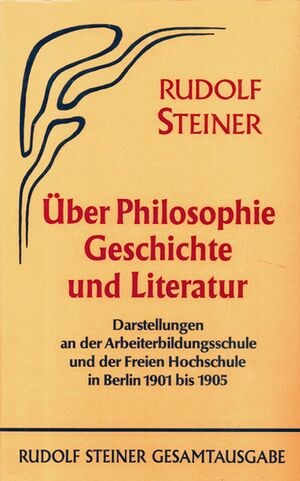Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 51
RUDOLF STEINER
VORTRÄGE
ÖFFENTLICHE VORTRÄGE
Über Philosophie, Geschichte und Literatur
Darstellungen an der Arbeiterbildungsschule
und der Freien Hochschule in Berlin
Autoreferate und Referate
von vierunddreißig Vorträgen,
gehalten in den Jahren 1901 bis 1905.
Mit Berichten über Rudolf Steiners Wirken
im «Giordano Bruno-Bund» 1902
GA 51
1983
Inhaltsverzeichnis
- I. VORTRÄGE AN DER ARBEITERBILDUNGSSCHULE IN BERLIN
- WELT- UND LEBENSANSCHAUUNGEN VON DEN ÄLTESTEN ZEITEN BIS ZUR GEGENWART
- WILLIAM SHAKESPEARE Berlin, 6. Mai 1902
- ÜBER RÖMISCHE GESCHICHTE Berlin, 19. Juli1904
- GESCHICHTE DES MITTELALTERS BIS ZU DEN GROSSEN ERFINDUNGEN UND ENTDECKUNGEN
- VORWORT VON MARIE STEINER ZUR 1. AUFLAGE 1936
- ERSTER VORTRAG, 18. Oktober 1904
- ZWEITER VORTRAG, 25. Oktober 1904
- DRITTER VORTRAG, 1. November 1904
- VIERTER VORTRAG, 8. November 1904
- FÜNFTER VORTRAG, 15. November 1904
- SECHSTER VORTRAG, 6. Dezember 1904
- SIEBENTER VORTRAG, 13. Dezember 1904
- ACHTER VORTRAG, 20. Dezember 1904
- NEUNTER VORTRAG, 28. Dezember 1904
- ZEHNTER VORTRAG, 29. Dezember 1904
- II. VORTRÄGE AN DER BERLINER «FREIEN HOCHSCHULE»
- PLATONISCHE MYSTIK UND DOCTA IGNORANTIA
- SCHILLER UND UNSER ZEITALTER
- VORWORT VON RUDOLF STEINER ZUR 1. AUFLAGE 1905
- ERSTER VORTRAG, 21. Januar 1905
- ZWEITER VORTRAG, 28. Januar 1905
- DRITTER VORTRAG, 4. Februar 1905
- VIERTER VORTRAG, 11. Februar 1905
- FÜNETER VORTRAG, 18. Februar 1905
- SECHSTER VORTRAG, 25. Februar 1905
- SIEBENTER VORTRAG, 4. März 1905
- ACHTER VORTRAG, 5. März 1905
- NEUNTER VORTRAG, 25. März 1905
- 9 III ANHANG
- 10 HINWEISE
- 11 Literatur
I. VORTRÄGE AN DER ARBEITERBILDUNGSSCHULE IN BERLIN
WELT- UND LEBENSANSCHAUUNGEN VON DEN ÄLTESTEN ZEITEN BIS ZUR GEGENWART
Autoreferat
Zusammenfassung von zehn Vorträgen,
gehalten in Berlin vom Januar bis März 1901
1. Die griechischen Weltanschauungen
Daß der Mensch nicht dabei stehenbleiben kann, was ihm seine Sinne über die Natur und über sich selbst sagen, darüber hat Aristoteles, den der große mittelalterliche Dichter Dante den Meister derer nennt, die da wissen, folgende schönen Worte gesprochen: «Alle Menschen verlangen von Natur nach dem Wissen; ein Zeichen dessen ist ihre Liebe zu den Sinneswahrnehmungen, die sie, auch abgesehen von dem Nutzen, um ihrer selbst willen lieben; insbesondere die des Gesichts. Nicht bloß des Handelns willen, sondern auch ohne solche Absicht, zieht man das Sehen sozusagen allem andern vor, weil dieser Sinn am meisten von allen uns Kenntnisse bringt und viele Eigenschaften der Dinge offenbart. Alle Tiere leben in ihren bildlichen Vorstellungen und haben nur wenig Erfahrung; das menschliche Geschlecht lebt dagegen auch in der Kunst und in dem vernünftigen Denken.» Und Hegel hat den scheinbar selbstverständlichen, aber doch höchst wichtigen Satz besonders betont: «Das Denken macht die Seele, womit auch das Tier begabt ist, erst zum Geiste.» Der Mensch kann nicht anders, als sich über die Welt und über sich selbst zahlreiche
Fragen vorlegen. Die Antworten, die er sich selbst, durch sein Denken, auf diese Fragen gibt, machen die «Welt- und Lebensanschauungen» aus. Trefflich hat Angelus Silesius, ein deutscher Denker des 17. Jahrhunderts, gesagt, daß die Rose einfach blüht, weil sie blüht; sie fragt nicht darnach, warum sie blüht. Der Mensch kann nicht so dahinleben. Er muß sich fragen, welchen Grund die Welt und er selbst haben. In erster Linie stellt naturgemäß der Mensch sein Denken in den Dienst des praktischen Lebens. Er macht sich Werkzeuge, Maschinen und Einrichtungen mit Hilfe des Denkens, durch die er seine Bedürfnisse in vollkommenerer Weise befriedigen kann, als dem Tiere dies mit den seinigen möglich ist. Aber in zweiter Linie will er durch sein Denken etwas erreichen, was mit dem praktischen Nutzen nichts zu tun hat; er will sich über die Dinge aufklären, er will erkennen, wie die Tatsachen zusammenhängen, die ihm im Leben begegnen. Die ersten Vorstellungen, die sich der Mensch über den Zusammenhang der Dinge macht, sind die religiösen. Er denkt sich, daß die Ereignisse in der Natur von ähnlichen Wesen gemacht werden, wie er selbst eines ist. Nur stellt er sich diese Wesen mächtiger vor, als er selbst ist. Der Mensch schafft sich Götter nach seinem Bilde. Wie er selbst seine Arbeit verrichtet, so stellt er sich auch die Welt als eine Arbeit der Götter vor. Aus den religiösen Anschauungen heraus erwachsen aber allmählich die wissenschaftlichen. Der Mensch lernt die Natur und ihre Kräfte beobachten. Er kann sich dann nicht mehr damit begnügen, sich diese Kräfte so vorzustellen, als wenn sie ähnlich den menschlichen Kräften wären. Er schafft sich nicht mehr einen Gott nach seinem Bilde, sondern er bildet sich Gedanken über den Zusammenhang der Welterscheinungen nach dem Bilde, das ihm die Beobachtung, die Wissenschaft liefert.
Daher entsteht eine denkende Weltbetrachtung innerhalb der abendländischen Kultur in der Zeit, in der die Naturwissenschaft zu einer gewissen Höhe gekommen ist. Die ersten Männer der griechischen Kulturwelt, von denen uns eine Weltanschauung überliefert ist, die nicht mehr in religiösen Vorstellungen besteht, waren Naturforscher. Thales, der erste große Denker, von dem uns Aristoteles erzählt, war ein für seine Zeit bedeutender Naturforscher. Er hat die Sonnenfinsternis, die am 28. Mai 585 v. Chr. eintrat, während sich das medische und lydische Heer am Halysflusse gegenüberstanden, bereits vorausberechnen können. Und auch sein Zeitgenosse Anaximander war ein großer Astronom.
Wenn in unserer Zeit die Pflege der «Welt- und Lebensanschauung», die als Philosophie an unseren Hochschulen gelehrt wird, sich keines besonderen Ansehens erfreut, vielmehr als eine einseitige und für das Leben entbehrliche Schulgelehrsamkeit gehalten wird, so rührt das davon her, daß die Philosophen der Gegenwart meistens den rechten Zusammenhang mit den einzelnen Wissenschaften verl ren haben. Wer eine «Welt- und Lebensanschauung» aufbauen will, kann nicht bei einer einzelnen Wissenschaft stehen bleiben. Er muß alle Erkenntnisse seiner Zeit, alles, was wir über die Natur- und Kulturentwickelung wissen, in sich verarbeiten. Alle anderen Wissenschaften sind für den Philosophen Handwerkszeug. Bei der großen Menge, zu der allmählich die Erkenntnisse geworden sind, ist es heute allerdings schwierig, eine umfassende «Welt- und Lebensanschauung» auszubilden. So kommt es, daß die Lehrer der Welt- und Lebensanschauung oft sich mit Fragen befassen, die nicht einem wahren Bedürfnisse des Menschen entspringen, sondern die ihnen ihr einseitiges, an gewissen Überlieferungen haftendes Denken vorlegt.
Eine wahrhafte «Welt- und Lebensanschauung» muß sich mit den Fragen beschäftigen, die sich in keiner einzelnen Wissenschaft beantworten lassen. Denn jede einzelne Wissenschaft hat es mit einem bestimmten Gebiete der Natur oder des Menschenlebens zu tun. Die «Welt- und Lebensauffassung» muß einen Gedankenzusammenhang suchen in dem, was alle einzelnen Wissenschaften uns an Erkenntnissen darbieten. Die einzelne Wissenschaft kann auch nicht jedermanns Sache sein. Dagegen hat die «Welt- und Lebensanschauung» für alle Menschen Interesse. Nicht jeder kann sie ausbauen, weil nicht jeder sich in allen Wissenschaften umschauen kann. Aber wie es unzähliger Kenntnisse bedarf, um einen Tisch zustande zu bringen, die sich nicht jeder aneigenen kann, der einen Tisch braucht, so bedarf es auch zum Ausbau einer «Weltanschauung» eines umfassenden Rüstzeuges, das nicht jedermann zur Verfügung stehen kann. Einen Tisch gebrauchen kann jeder, einen machen kann nur, wer es gelernt hat. Welt- und Lebensanschauung interessiert jeden; aufbauen und lehren kann und soll sie nur der, welcher sich das Rüstzeug dazu aus allen einzelnen Wissenschaften holen kann. Die Wissenschaften sind nur die Werkzeuge der Welt- und Lebensanschauungen.
Kant hat die Grundfragen, die in dem Menschen das Bedürfnis nach einer Weltanschauung erzeugen, folgendermaßen gestellt: «Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?» Goethe hat die Sache kürzer und bedeutender zum Ausdrucke gebracht, indem er sagte: «Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß ich's Wahrheit.» In der Tat will der Mensch durch eine Welt- und Lebensanschauung nichts anderes erreichen, als einen Aufschluß darüber, welchen Sinn sein eigenes Dasein hat, und wie er mit der Natur, die außer ihm ist, zusammenhängt.
Die ältesten griechischen Denker, so erzählt uns Aristoteles, hielten die stofflichen Anfänge für die alleinigen von allen. Das, woraus alle Dinge bestehen, aus dem alles entsteht und in das alles schließlich wieder vergeht: darüber dachten sie nach. In der feuchten Erde entwickeln sich die Samen der Lebewesen. Thales war Inselbewohner. Er sah, wie sich im Meere unendliches Leben entwickelt. Der Gedanke lag nahe, daß das Wasser der Urstoff sei, aus dem sich alle Dinge entwickeln. So kam es, daß der erste griechische Denker das Wasser für den Grund aller Dinge erklärte. Aus Wasser, sagt er, entstehe alles, und in Wasser verwandle sich alles. Anaximander kam einen Schritt weiter. Er vertraute den Sinnen nicht mehr so viel wie Thales. Das Wasser kann man sehen. Aber alles, was man sehen kann, verwandelt sich in anderes. So dachte Anaximander. Das Wasser kann durch Gefrieren fest werden; es kann durch Verdunsten dampfförmig werden. Unter Dampf und Luft dachten sich die Alten dasselbe. Ebenso nannten sie alles Feste Erde. Das feste Wasser, die Erde, kann sich in Flüssiges, dieses in Luft verwandeln, sagte sich demnach Anaximander. Kein bestimmter Stoff ist daher etwas Bleibendes. Er suchte deshalb den Urgrund auch nicht in einem bestimmten Stoff, sondern in dem unbestimmten. Anaximenes nahm dann wieder einen bestimmten Urstoff, nämlich die Luft, an. Er sagt: «Wie unsere Seele, die Luft ist, uns zusammenhält, so umfaßt Hauch und Luft die ganze Welt.»
Eine viel höhere Stufe der Weltanschauung beschritt Heraklit. Ihm drängte sich vor allem der ewige Wechsel aller Dinge auf. Nichts bleibt, alles verwandelt sich. Nur unsere Sinne täuschen uns, wenn sie uns sagen, daß etwas bleibt. Ich kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen. Denn nur scheinbar ist es derselbe Fluß, in den ich das zweite Mal steige. Das Wasser, aus dem doch der Fluß besteht,
ist ein ganz anderes geworden. Und so ist es mit allen Dingen. Der Baum von heute ist nicht der von gestern. Andere Säfte sind in ihn eingezogen; vieles, was noch gestern in ihm war, hat er mittlerweile ausgeschieden. In den Ausspruch: «Alles fließt», faßt daher Heraklit seine Überzeugung zusammen. Deshalb wird ihm das unruhigste Element, das Feuer, zum Bild alles Entstehens und Vergehens.
Von ganz anderen Gesichtspunkten ging Empedokles von Agrigent aus. Seine Vorgänger hatten nach einem einzelnen Urstoffe gesucht. Er ließ vier Urstoffe als gleichbedeutend nebeneinander gelten. Erde, Wasser, Luft, Feuer bestehen von Anfang an nebeneinander. Keiner dieser Stoffe kann sich in den andern verwandeln. Sie können sich nur in der verschiedenartigsten Weise mischen. Und durch ihre Mischung entstehen alle die verschiedenen Dinge in der Natur. Empedokles glaubt also nicht mehr daran, daß ein Ding wirklich entstehe und vergehe. Er glaubt, daß etwas scheinbar entstehe, wenn zum Beispiel Wasser und Feuer sich vermischen; und er glaubt, daß dasselbe Ding schein-bar wieder vergehe, wenn Wasser und Feuer wieder auseinandertreten. Aristoteles erzählt uns von Empedokles: «Seine vier Anfänge sollen nach ihm immer beharren, ohne Entstehen sein und sich in verschiedenen Verhältnissen zu einem Gegenstande verbinden oder daraus sondern.» Empedokles nimmt Kräfte an, die zwischen seinen vier Stoffen herrschen. Zwei oder mehrere Stoffe verbinden sich, wenn zwischen ihnen eine anziehende Kraft herrscht; sie trennen sich, wenn eine abstoßende Kraft zwischen ihnen wirkt. Diese anziehenden und abstoßenden Kräfte können, nach der Überzeugung des Empedokles, nicht bloß die leblose Natur aus den vier Stoffen aufbauen, sondern auch das ganze Reich des Lebendigen. Er stellt sich vor, daß naturgemäß, durch die Kräfte, tierische und pflanzliche Körper
entstehen. Und weil keine verständige lntelligenz dieses Entstehen leitet, so entstehen, bunt durcheinander, zweckmäßige und unzweckmäßige lebendige Gestalten. Nur die zweckmäßigen können aber bestehen; die unzweckmäßigen müssen von selbst zugrunde gehen. Dieser Gedanke des Empedokles ist bereits demjenigen Darwins von dem «Kampf ums Dasein» ähnlich. Darwin stellt sich auch vor, daß in der Natur Zweckmäßiges und Unzweckmäßiges entstehen und die Welt nur deshalb als eine zweckmäßige erscheine, weil im «Kampf ums Dasein» das Unzweckmäßige fortwährend unterliege, also zugrunde gehen muß.
Anaxagoras, der Zeitgenosse des Empedokles, glaubte nicht, wie dieser, die zweckmäßige Ordnung der Welt aus dem bloßen Wirken mechanischer Naturkräfte erklären zu können. Er nahm an, daß eine geistige Wesenheit, ein allgemeiner Weltverstand den Dingen ihr Dasein und ihre Ordnung gibt. Er stellte sich vor, daß alles aus kleinsten Teilen, den sogenannten Homöomerien, bestehe, die alle untereinander verschiedene Eigenschaften haben. Der allgemeine Weltverstand fügt diese Ur-Teile zusammen, daß sie zweck-volle Dinge und, im Ganzen, ein harmonisch angeordnetes Weltgebäude ergeben. Weil er an die Stelle der alten Volks-götter einen allgemeinen Weltverstand setzte, wurde Anaxagoras in Athen der Gottesleugnung angeklagt und mußte nach Lampsakus fliehen. In Athen, wohin er sich von Klazomenä aus begeben hatte, stand er in Beziehungen zu Perikles, Euripides und Themistokles.
Die kleinsten Teile, die Homöomerien, oder Samen aller Dinge, welche Anaxagoras annahm, stellte er sich ganz verschieden voneinander vor. An die Stelle dieser kleinsten Teile setzte Demokrit solche, die sich durch nichts anderes mehr unterschieden als durch Größe, Gestalt, Lage und Anordnung im Raume. In allen übrigen Eigenschaften sollen
die kleinsten Bestandteile der Dinge, die Atome, einander gleich sein. Was in der Natur wirklich vorgeht, kann nach dieser atomistischen Überzeugung nichts anderes sein, als daß die Lage und Anordnung der kleinsten Körperteile sich ändern. Wenn ein Körper seine Farbe ändert, so hat sich in Wirklichkeit die Anordnung seiner Atome geändert. Außer dem leeren Raum und den ihn erfüllenden Atomen gibt es nichts in der Welt. Es gibt keine Macht, welche den Atomen ihre Ordnung verleiht. Diese sind in fortwährender Bewegung. Die einen bewegen sich langsamer, die anderen schneller. Die schnelleren müssen mit den langsameren in Berührung kommen. Dadurch ballen sich Körper zusammen. Es entsteht also nichts durch einen Verstand in der Welt oder durch eine allgemeine Vernunft, sondern durch blinde Naturnotwendigkeit, die man auch Zufall nennen kann. Es ist aus diesen Überzeugungen heraus erklärlich, daß die Anhänger Demokrits einen heftigen Kampf gegen die alten Volksgötter führten. Sie waren entschiedene Gottesleugner oder Atheisten. Man muß in ihnen die Vorläufer der materialistischen Weltanschauungen späterer Jahrhunderte sehen.
Von einer ganz anderen Seite als die bisher genannten Denker suchten Parmenides und seine Anhänger den Welt-erscheinungen beizukommen. Sie gingen davon aus, daß uns unsere Sinne kein treues, wahrhaftes Bild der Welt liefern können. Heraklit hat aus dem Umstande, daß sich alles ewig verwandelt, gerade den Schluß gezogen, daß es nichts Bleibendes gibt, sondern daß der ewige Fluß aller Dinge dem wahren Sein entspricht. Parmenides sagte genau umgekehrt: weil sich in der Außenwelt alles verwandelt, weil hier ewig alles entsteht und vergeht, deswegen können wir das Wahre, das Bleibende nicht durch Beobachtung der Außenwelt gewinnen. Wir müssen das, was diese Außenwelt
uns darbietet, als Schein auffassen und können das Ewige, das Bleibende nur durch das Denken selbst gewinnen. Die Außenwelt ist ein Sinnentrug, ein Traum, der ganz etwas anderes ist, als was uns die Sinne vorgaukeln. Was dieser Traum wirklich ist, was sich ewig gleich bleibt, das können wir nicht durch Beobachtung der Außenwelt gewinnen, das offenbart sich uns durch das Denken. In der Außenwelt ist Vielfältigkeit und Verschiedenheit; im Denken enthüllt sich uns das Ewig-Eine, das sich nicht ändert, das sich immer gleich bleibt. So spricht sich Parmenides in seinem Lehrgedicht «Über die Natur» aus. Wir haben es da also mit einer Weltanschauung zu tun, welche die Wahrheit nicht aus den Dingen selbst holen will, sondern welche den Urgrund der Welt aus dem Denken heraus zu spinnen sucht. Wenn man sich klarmachen will, aus welcher Grundempfindung eine solche Weltanschauung stammt, so muß man sich vor Augen halten, daß oftmals das Denken in der Tat die Wahrnehmungen der Sinne in der richtigen Weise auslegen, erklären muß, um zu einem befriedigenden Gedanken zu kommen. Wenn wir einen Stock ins Wasser halten, so erscheint er dem Auge gebrochen. Das Denken muß nach den Gründen suchen, warum der Stab gebrochen erscheint. Wir bekommen also eine befriedigende Vorstellung dieser Erscheinung nur dadurch, daß unser Denken die Wahrnehmung erklärt. Wenn wir den Sternenhimmel bloß mit den Sinnen betrachten, so können wir uns keine andere Vorstellung machen, als diejenige, daß die Erde im Mittelpunkt der Welt stehe, und daß sich Sonne, Mond und alle Sterne um dieselbe bewegen. Erst durch das Denken gewinnen wir eine andere Vorstellung. In diesem Falle gibt uns sogar das Denken ein ganz anderes Bild als die sinnliche Wahrnehmung. Man kann also wohl sagen, daß die Sinne uns in gewisser Beziehung täuschen. Aber die
Weltanschauung des Parmenides und seiner Anhänger ist eine einseitige Übertreibung dieser Tatsache. Denn wie uns die Wahrnehmung gewisse Erscheinungen liefert, die uns täuschen, so liefert sie uns auch wieder andere Tatsachen, durch die wir die Täuschung richtigstellen können. Kopernikus ist nicht dadurch zu seiner Anschauung von der Bewegung der Himmelskörper gekommen, daß er dieselbe aus dem bloßen Denken heraus gesponnen hat, sondern dadurch, daß er die eine Wahrnehmung mit anderen in Einklang gebracht hat.
Im Gegensatz zu der Anschauung des Parmenides steht eine andere ältere Weltansicht. Sie geht nicht darauf aus, die Zusammenhänge in der Außenwelt für eine Täuschung anzusehen, sondern sie will gerade durch eine tiefere Beobachtung dieser Außenwelt zu der Erkenntnis führen, daß in der Welt alles auf einer großen Harmonie beruht, daß in allen Dingen Maß und Zahl vorhanden ist. Diese Anschauung ist die der Pythagoräer. Pythagoras lebte im 6. Jahrhundert v.Chr. Aristoteles erzählt von den Pythagoräern, daß sie sich gleichzeitig mit den oben genannten Denkern und auch noch vor ihnen der Mathematik zuwandten. «Sie führten zuerst diese fort und, indem sie ganz darin aufgingen, hielten sie die Anfänge in ihr auch für die Anfänge aller Dinge. Da nun in dem Mathematischen die Zahlen von Natur das erste sind, und sie in den Zahlen viel Ähnliches mit den Dingen und dem Werdenden zu sehen glaubten, und zwar in den Zahlen mehr als in dem Feuer, der Erde und dem Wasser, so galt ihnen eine Eigenschaft der Zahlen als die Gerechtigkeit, eine andere als die Seele und der Geist, wieder eine andere als die Zeit, und so fort für alles übrige. Sie fanden ferner in den Zahlen die Eigenschaften und die Verhältnisse der Harmonie, und so schien alles andere seiner ganzen Natur nach Abbild der Zahlen und die
Zahlen das erste in der Natur zu sein.» Wer die Bedeutung richtig zu würdigen weiß, welche Maß und Zahl in der Natur haben, wird es nicht verwunderlich finden, daß eine solche Weltanschauung, wie die pythagoräische, entstehen konnte. Wenn eine Saite von bestimmter Länge angeschlagen wird, so entsteht ein gewisser Ton. Wird die Saite in bestimmten Zahlenverhältnissen verkürzt, so entstehen immer andere Töne. Man kann die Tonhöhe durch Zahlenverhältnisse ausdrücken. Die Physik drückt auch die Farben in Zahlenverhältnissen aus. Wenn sich zwei Körper zu einem Stoffe verbinden, so geschieht das immer so, daß sich durch Zahlen ausdrückbare Gewichtsmengen des einen Körpers mit solchen des anderen Körpers verbinden. Solche Beispiele davon, welche Rolle Zahl und Maß in der Natur spielen, lassen sich unzählige anführen. Die pythagoräische Weltanschauung bringt diese Tatsache in einer einseitigen Weise zum Ausdruck, indem sie sagt: Maß und Zahl sind der Urgrund aller Dinge.
In allen bisher besprochenen Weltanschauungen schlummert eine Frage. Sie kommt in ihnen nirgends zu einem deutlichen Ausdrucke, weil die Denker offenbar der Ansicht waren, daß sie sich mit den anderen Fragen, die sie gestellt haben, von selbst beantwortet. Es ist die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zur Welt. Wenn Thales alle Dinge aus dem Wasser entstanden glaubt, so denkt er sich auch den Menschen aus demselben Quell entsprungen. Heraklit war der Meinung, daß der Mensch in dem ewigen Fluß der Dinge mit allen anderen mitschwimme; und Anaxagoras dachte sich den Menschen durch seinen allgemeinen Weltverstand aus seinen Ur-Teilchen aufgebaut, wie die Atomisten sich vorstellten, daß der Zufall auch den Menschen aus den Atomen zusammengefügt habe. Bei Empedokles taucht zuerst etwas von der Frage auf: In welchem
Verhältnis steht der Mensch zu der übrigen Natur? Wie kann er die Dinge erkennen? Wie ist es ihm möglich, Vorstellungen von dem zu machen, was doch außer ihm ist? Empedokles gab die Antwort: Gleiches kann nur durch Gleiches erkannt werden. - Weil der Mensch aus denselben Stoffen und Kräften besteht wie die übrige Natur, deshalb kann er diese auch erkennen.
In ganz anderer Weise nahm eine Anzahl von Denkern diese Frage in Angriff, die gewöhnlich verkannt werden. Es sind die Sophisten, deren bedeutendste Persönlichkeit Protagoras von Ahdera ist. Sie werden gewöhnlich wie Menschen hingestellt, die mit dem Denken ein oberflächliches Spiel, eine eitle Disputiersucht getrieben haben, und denen aller Ernst zur Erforschung der Wahrheit gefehlt haben soll. Viel hat zu der Meinung, die sich über die Sophisten herausgebildet hat, die Art beigetragen, wie sie der reaktionäre Lustspieldichter Aristophanes in seinen Dramen verspottet hat. Es mag sein, daß einzelne Sophisten die Kunst des Disputierens übertrieben haben, es mag auch sein, daß unter ihnen manche waren, denen es nur um Haarspaltereien und um ein geckenhaftes Auftreten zu tun war: bei den bedeutendsten von ihnen trifft das aber nicht zu, denn es waren Männer unter ihnen, die sich durch ein umfassendes Wissen auf den verschiedensten Gebieten auszeichneten. Von Protagoras muß das besonders betont werden, aber auch von Gorgias wissen wir, daß er ein hervorragender Politiker war, und von Prodicus rühmt dessen Schüler Sokrates selbst, daß er ein ausgezeichneter Gelehrter war, der sich die Veredlung der Sprache bei seinen Zöglingen besonders angelegen sein ließ.
Seine Grundanschauung spricht Protagoras in dem Satze aus: «Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, daß sie sind, der nicht seienden, daß sie nicht sind.» Was kann
dieser Satz bedeuten? Man kann sagen wie Parmenides: unsere Sinne täuschen uns. Und man könnte noch weiter gehen als dieser und sagen: vielleicht täuscht uns auch unser Denken. Protagoras würde antworten: was geht es den Menschen an, ob die Welt außer ihm anders ist, als er sie wahrnimmt und denkt. Stellt er denn die Welt für jemand anderen und nicht für sich vor? Mag sie für ein anderes Wesen sein wie immer: er hat sich darum nicht zu sorgen. Seine Vorstellungen sollen ja nur ihm dienen; er soll sich mit ihrer Hilfe in der Welt zurechtfinden. Der Mensch kann gar keine anderen Vorstellungen über die Welt wollen, als diejenigen, die ihm dienen. Was auch noch immer in der Welt ist: wenn der Mensch es nicht wahrnimmt, kann es ihn nicht kümmern. Für ihn ist da, was er wahrnimmt; und es ist für ihn nicht da, was er nicht wahrnimmt. Das heißt aber eben: der Mensch mißt die Dinge mit dem Maße, das ihm seine Sinne und seine Vernunft an die Hand geben. Protagoras gibt durch seine Anschauung dem Menschen eine feste Stellung und Sicherheit in der Welt. Er befreit ihn von unzähligen bangen Fragen, die er nur aufwirft, weil er sich nicht getraut, die Dinge nach sich zu beurteilen.
Man darf sagen, daß durch die Sophistik der Mensch in den Mittelpunkt der Weltbetrachtung gerückt wird. Daß dies zur Zeit des Protagoras geschah, das hängt mit der Entwickelung der öffentlichen Zustände in Griechenland zusammen. Das soziale Gefüge der griechischen Staatsverbände hatte sich gelockert. Das hat ja seinen bedeutsamsten Ausdruck in den Peloponnesischen Kriegen, 431-404 v.Chr., gefunden. Vorher war der einzelne fest in die sozialen Zusammenhänge eingeschlossen; die Gemeinwesen und die Tradition gaben ihm den Maßstab für all sein Handeln und Denken ab. Die einzelne Persönlichkeit hatte nur als Glied eines Ganzen Wert und Bedeutung. Unter solchen
Verhältnissen hätte unmöglich die Frage gestellt werden können: Was ist der einzelne Mensch wert? Die Sophistik ist ein ungeheurer Fortschritt nach der griechischen Aufklärung zu. Der Mensch konnte nunmehr daran denken, sein Leben nach seiner Vernunft einzurichten. Die Sophisten zogen als Tugendlehrer im Lande herum. Wenn man die Tugend lehren will, so muß man der Überzeugung sein, daß nicht die hergebrachten sittlichen Anschauungen maßgebend seien, sondern daß der Mensch durch eigenes Nachdenken die Tugend erkennen könne.
In solchen Vorstellungen von der Tugend lebte auch Sokrates. Man muß ihn durchaus als einen Schüler der Sophistik ansehen. Man weiß wenig über ihn. Die Berichte über das, was er gelehrt hat, sind zweifelhaft. Klar aber ist, daß er in erster Linie Tugendlehrer war, wie die Sophisten. Und sicher ist auch, daß er durch die Art, wie er gelehrt hat, hinreißend gewirkt hat. Sein Lehren bestand darin, daß er im Gespräch das aus dem Zuhörer selbst herauszulocken suchte, was er als das Richtige anerkannte. Der Ausdruck «geistige Hebammenkunst» ist in bezug auf seine Lehren bekannt. Er wollte in den Geist des Schülers nichts von außen hineinbringen. Er war der Ansicht, daß die Wahrheit in jedem Menschen gelegen sei, und daß man nur Hilfe zu leisten brauche, damit diese Wahrheit zutage trete. Faßt man das ins Auge, so zeigt sich, daß Sokrates der Vernunft in jedem einzelnen Menschen zu ihrem höchsten Rechte verhalf. Er brachte den Schüler immer dahin, daß dieser sich von einer Sache den rechten Begriff machen könne. Er ging von den Erfahrungen des alltäglichen Lebens aus. Man kann betrachten, was zum Beispiel Tugend bei dem Handwerker, was Tugend bei dem Kaufmann, was Tugend bei dem Gelehrten ist. Man wird finden, daß alle diese verschiedenen Arten des tugendhaften Lebens etwas Gemeinsames
haben. Dieses Gemeinsame ist eben der Begriff der Tugend. Wenn man mit seinem Denken so vorgeht, so befolgt man das sogenannte induktive Verfahren. Man sammelt die einzelnen Erfahrungen, um einen Begriff von einer Sache zu erhalten. Wenn man diesen Begriff hat, so kann man die Sache definieren. Man hat die Definition der Sache. Ein Säugetier ist ein lebendiges Wesen mit einer Wirbelsäule, das lebendige Junge zur Welt bringt. Dies ist die Definition des Säugetieres. Sie gibt das Merkmal - Gebären von lebendigen Jungen - an, welches allen Säugetieren gemeinsam ist. So wirkte Sokrates als Lehrer eines scharfen, klaren Denkens. Das ist sein großes Verdienst. -Der römische Redner Cicero hat von Sokrates gesagt, daß er die Philosophie vom Himmel auf die Erde herabgeholt habe. Damit ist gemeint, daß dieser seine Betrachtungen vorzüglich über den Menschen selbst angestellt habe. Wie der Mensch leben solle, das lag ihm vor allen Dingen am Herzen. Deshalb sehen wir nun in Griechenland, daß diejenigen, die sich um eine Weltanschauung bemühen, immer auch darnach fragen, welche sittlichen Ziele sich der Mensch stellen solle.
Das tritt uns gleich bei den nächsten Nachfolgern des Sokrates entgegen. Die Kyniker, deren hauptsächlichste Persönlichkeit Diogenes von Sinope ist, beschäftigen sich mit der Frage nach einem naturgemäßen Leben. Wie soll der Mensch leben, damit sein Leben dem nicht widerspricht, was die Natur an Anlagen und Fähigkeiten in ihn gelegt hat? Die Kyniker wollten alles Verkünstelte, Unnatürliche aus dem Leben entfernen. Daß ihnen vor allem die größte Einfachheit als das Beste erschien, ist erklärlich. Natürlich ist, was allen Menschen ein gemeinsames Bedürfnis ist. Der Proletarier kam in dieser Lebensauffassung zu seinem Recht. Man kann sich daher denken, daß den sogenannten
höheren Ständen diese Philosophie wenig gefiel. Was die Kyniker forderten, stimmte ja mit den künstlich geschaffenen Bedürfnissen nicht überein. Während ursprünglich der Name Kyniker nur von der Lehranstalt - Kynosarges - herrührte, wo die Kyniker Unterricht gaben, bekam er später einen verächtlichen Beigeschmack. Neben den Kynikern wirkten die Kyrenaiker und die Megariker. Auch sie waren vor allem auf das praktische Leben bedacht. Die Kyrenaiker suchten der Lust zu ihrem Rechte zu verhelfen. Die Lust entspricht der Natur des Menschen. Die Tugend kann nicht darin bestehen, daß man die Lust in sich ausrottet, sondern darin, daß man sich nicht zum Sklaven der Lust macht. Wer nach Lust strebt, aber immer so, daß er Herr seiner Lüste bleibt, der ist tugendhaft. Nur wer zum Sklaven seiner Leidenschaften wird, ist tugendlos.
Die Megariker hielten fest an dem Satze des Sokrates, daß die Tugend lehrbar sei, daß also die Vervollkommnung des Denkens auch tugendhafter machen muß. Der wichtigste Vertreter der megarischen Lehre ist Euklides. Ihm war das Gute ein Ausfluß der höchsten Weisheit. Deshalb war es ihm in erster Linie um Erlangung der Weisheit zu tun. Und aus dieser seiner Schätzung der Weisheit wird ihm wohl der Gedanke erwachsen sein, daß die Weisheit selbst der Urquell der Welt sei. Wenn - so dachte er - der Mensch sich durch sein Denken zu Begriffen erhebt, so erhebt er sich zugleich zu den Ursprüngen der Dinge. Mit Euklid nimmt die Weltanschauung eine entschieden idealistische Färbung an. Man muß sich den Gedankengang des Euklid etwa so vorstellen: Es gibt viele Löwen. Die Stoffe, aus denen diese bestehen, bleiben nicht zusammen. Der einzelne Löwe entsteht und vergeht. Er nimmt Stoffe aus der Außenwelt auf und gibt sie wieder an diese ab. Das, was ich mit den Sinnen wahrnehme, das ist das Stoffliche. Was
an den Dingen sinnlich wahrnehmbar ist, entsteht also und vergeht. Dennoch hat ein Löwe, der vor hundert Jahren gelebt hat, mit einem Löwen, der heute lebt, etwas Gemeinsames. Die Stoffe können es nicht sein. Es kann nur der Begriff, die Idee des Löwen sein, die ich durch mein Denken erfasse. Der Löwe von heute und der Löwe vor hundert Jahren sind nach derselben Idee aufgebaut. Das Sinnliche vergeht; die Idee bleibt. Die Ideen verkörpern sich in der Sinnenwelt immer aufs neue.
Ein Schüler des Euklides war Plato. Er hat die Vorstellung seines Lehrers von der Ewigkeit der Ideen zu seiner Grundüberzeugung gemacht. Die Sinnenwelt hat nur einen untergeordneten Wert für ihn. Das Wahre sind die Ideen. Wer bloß auf die Dinge der Sinnenwelt sieht, hat nur ein Scheinbild, ein Trugbild der wahren Welt. Platos Überzeugung ist scharf in folgenden Worten zum Ausdruck gebracht: Die Dinge dieser Welt, die wir mit den Sinnen wahrnehmen, haben kein wahres Sein; sie bleiben nicht. Man kann ihr ganzes Sein ebensogut ein Nichtsein nennen. Wer nach dem Wahren strebt, kann sich folglich mit den Dingen der Sinnenwelt nicht begnügen. Denn das Wahre kann nur daher kommen, wo das Bleibende ist. Wenn man sich bloß auf die sinnliche Wahrnehmung beschränkt, gleicht man einem Menschen, der in einer finsteren Höhle festgebunden sitzt, so daß er nicht einmal den Kopf drehen kann, und der nichts sieht, als beim Lichte einer hinter ihm brennenden Lampe die Schattenbilder der Dinge hinter ihm und auch seinen eigenen Schatten. Die Ideen sind zu vergleichen mit den wirklichen, wahren Dingen, und die Schatten mit den Dingen der Sinnenwelt. Auch von sich selbst erkennt derjenige, der sich auf die Sinnenwelt beschränkt, nur einen Schatten. Der Baum, den ich sehe, der Blütenduft, den ich atme: sie sind nur Schattenbilder. Erst,
wenn ich mich durch mein Denken zu der Idee des Baumes erhebe, habe ich das, was wahrhaft bleibend und nicht ein vergängliches Trugbild von dem Baume ist.
Man muß nun die Frage aufwerfen: wie denkt sich Plato das Verhältnis seiner Ideenwelt zu den Gottesvorstellungen der Griechen? Dieses Verhältnis ist aus Platos Schriften keineswegs mit vollkommener Klarheit festzustellen. Er spricht wiederholt von außerweltlichen Göttern. Doch kann man der Meinung sein, daß er sich mit solchen Aussprüchen bloß an die griechische Volksreligion anlehnen wollte; und man wird nicht fehlgehen, wenn man seine Götterbezeichnungen nur als bildliche Verdeutlichungen auffaßt. Was Plato selbst als Gottheit auffaßt, das ist eine erste bewegende Ursache der Welt. Man muß sich, im Sinne Platos, vorstellen, daß die Welt aus den Ideen und der Urmaterie besteht. Die Ideen verkörpern sich in der Urmaterie fortwährend. Und den Anstoß zu dieser Verkörperung gibt Gott, als der Urgrund aller Bewegung. Gott ist für Plato zugleich das Gute. Dadurch erhält die Welt einen großen einheitlichen Zweck. Das Gute bewegt alles Sein und Geschehen. Die höchsten Weltgesetze stellen also eine moralische Weltordnung dar.
Plato hat seine Weltanschauung in Gesprächsform niedergeschrieben. Seine Darstellungsform bildete in der ganzen Folgezeit einen Gegenstand der Bewunderung innerhalb der abendländischen Kulturentwickelung. - Plato stammt aus einem altadeligen Geschlecht in Athen. Aus Berichten wissen wir, daß er ein zur Schwärmerei geneigter Kopf war. Er wurde der treueste und verständnisvollste Schüler des Sokrates, der an dem Meister mit unbedingter Verehrung hing. Nach der Hinrichtung seines Lehrers begab er sich nach Megara zu Euklides. Später unternimmt er große Reisen nach Cyrene, Ägypten, Großgriechenland -
d.i. Süditalien - und Sizilien. Im Jahre 389 v.Chr. kehrte er nach Athen zurück. Doch unternahm er noch eine zweite und dritte Reise nach Sizilien. Nach der Rückkehr von seiner ersten sizilischen Reise gründete er in Athen seine Schule, aus der viele der bedeutenden Männer jener Zeit hervorgingen. In Platos Schriften kann man eine allmähliche Wandlung der Anschauungen beobachten. Er nimmt Vorstellungen an, die er bei anderen findet. In seinen ersten Schriften steht er ganz auf dem Standpunkte, den er sich als Schüler des Sokrates ausgebildet hat. Später erlangt Euklides starken Einfluß auf ihn, und bei seinem Aufenthalte in Sizilien lernt er die Pythagoräer kennen. In Ägypten eignet er sich verschiedene morgenländische Gedanken an. So kommt es, daß seine Weltanschauung in seinen Schriften nicht so erscheint, daß sie wie aus einem Gusse ist. Er verleibt später Vorstellungen, die er findet, seinen ursprünglichen Anschauungen ein. Wir dürfen zu diesen seine Seelenwanderungslehre rechnen. Die Seele ist schon vor dem Körper vorhanden. Ja, ihre Verkörperung, das heißt ihre Verbindung mit der Materie, wird als eine Art Strafe angesehen, die sie für eine im vorweltlichen Sein zugezogene Schuld zu erleiden hat. Aber die Seele verkörpert sich nicht nur einmal, sondern wiederholt. Plato bringt diese Ansicht mit der allgemeinen Gerechtigkeit der Welt zusammen. Wäre mit einem Leben alles zu Ende, so wäre der Gute im Nachteil gegenüber dem Schlechten. Es muß vielmehr das Böse, das die Seele in dem einen Leben verübt hat, in einem anderen gebüßt werden. Erst wenn alle Schuld in den verschiedenen Leben ihre Sühne gefunden hat, kehrt die Seele in das Ideenreich zurück, aus dem sie stammt.
In ihrer Verbindung mit dem Körper bildet die Seele des Menschen keine Einheit. Sie zerfällt in drei Teilseelen. Die
unterste Seele ist die des sinnlichen Lebens; sie hat den Ernährungs- und Fortpflanzungstrieb zu besorgen. Die mittlere Seele bezeichnet Plato als die Willenskraft im Menschen. Auf ihr beruht der persönliche Mut, die Tapferkeit. Und die höchste Seele ist die rein geistige. Sie hat die höchste Erkenntnis zu besorgen. Sie ist im Ideenreich heimisch. Sie ist der eigentliche unsterbliche Teil der Menschenseele. Seine Unsterblichkeitsgedanken bringt Plato in Zusammenhang mit der Vorstellung des Sokrates, daß das Lehren nur in einer Art Hebammenkunst bestehe. Wenn dasso ist, dann müssen alle Gedanken, die in dem Menschen erweckt werden, schon in ihm liegen. Sie liegen in ihm, weil er sie auch schon vor seiner Geburt, da ja auch schon die Seele vorhanden war, gehabt hat. Er erinnert sich also im Leben nur an die Gedanken, die ihm vor seiner Geburt schon eigen waren.
Mit Platos Seelenlehre hängt wieder seine Ansicht von dem Staate zusammen. Auch der Staat ist die Verkörperung einer Idee. Und er ist eine solche Verkörperung nach dem Bilde der menschlichen Natur, wenn er vollkommen ist. Die einzelnen Seelenkräfte sind im Staate durch die verschiedenen Stände dargestellt. Die oberste Seele stellen die Regierenden dar, die mittlere Seele findet in den Wächtern, welche für die Verteidigung da sind, und die unterste Seele in den Handwerkern ihr Ebenbild. Der platonische Staat ist ein kommunistischer Staat, aber mit einer streng aristokratischen Ständegliederung. Für die beiden oberen Stände empfiehlt Plato die Ehe- und Besitzlosigkeit. Es soll klösterliche Gemeinschaft und Güterkommunismus herrschen. Die gesamte Jugenderziehung, mit Ausnahme der von der Familie zu besorgenden ersten leiblichen Kinderpflege, soll Aufgabe des Staates sein.
Platos bedeutendster Schüler ist Aristoteles von Stagira in
Thrakien. Er wurde mit achtzehn Jahren Platos Zögling. Aber er war ein Schüler, der bald seine eigenen Wege ging. Im Jahre 343 wurde Aristoteles Erzieher Alexanders, des Sohnes König Philipps von Mazedonien. Als Alexander seine asiatischen Eroberungszüge unternahm, ging Aristoteles wieder nach Athen und eröffnete dort eine Schule.
Das Verhältnis der Weltanschauung des Aristoteles zu derjenigen Platos kann man durch folgenden Vergleich veranschaulichen. Platos Ideen sind der Materie, in der sie sich verkörpern, ganz fremd. Sie sind wie die Idee zu dem Kunstwerk, die im Kopfe des Künstlers lebt, und die er in seinen Stoff hineinbildet. Dieser Stoff, der Marmor einer Statue, ist etwas ganz Fremdes zur Idee des Künstlers. So denkt sich nun Aristoteles das Verhältnis der Ideen zur Materie nicht. Für ihn liegt die Idee in der Materie selbst. Es ist, wie wenn ein Kunstwerk nicht vom Künstler seine Idee eingeprägt erhielte, sondern wie wenn es von selbst sich seine Gestalt durch eine dem Stoff innewohnende Kraft gäbe. Aristoteles nennt die dem Stoff eingeborenen Ideen die Formen der Dinge. Es gibt also, im Sinne des Aristoteles, keine vom Stoffe getrennte Idee des Löwen zum Beispiel. Diese Idee liegt im Stoffe selbst. Es gibt, nach Aristoteles, keine Materie ohne Form und keine Form ohne Materie. Ein Lebewesen entwickelt sich vom Keim im Mutterleibe bis zu seiner ausgebildeten Gestalt, weil die Form in dem Lebensstoffe tätig ist und wie eine ihm eingeborene Kraft wirkt. In der ersten Anlage eines Lebewesens ist diese Kraft oder Form schon vorhanden; nur ist sie da noch äußerlich nicht sichtbar; sie schlummert gleichsam noch. Aber sie arbeitet sich heraus, so daß der Stoff die Gestalt annimmt, die al5 schlummernde Kraft schon anfangs in ihm liegt. Im Anfange der Dinge gab es nur äußerliche formlose Materie. Die Kraft oder der Stoff schlummerte noch ganz in derselben.
Es war ein Chaos vorhanden mit einer unermeßlichen in ihm schlafenden Kraft. Um diese Kraft zu erwecken, damit sich das Chaos zu der mannigfaltigen Welt der Dinge bilde, war ein erster Anstoß notwendig. Deshalb nimmt Aristoteles einen ersten Beweger der Welt, eine göttliche Weltursache an.
Wenn die Idee oder, wie Aristoteles sich ausdrückt, die Form in jedem Dinge selbst liegt, so kann man nicht, wie Plato meint, die Dinge als bloße Trugbilder und Schatten ansehen und sich mit seinem Denken in eine ganz andere Welt erheben, falls man das Wahre erlangen will, sondern man muß sich vielmehr gerade an die sinnlichen Dinge selbst wenden und das in ihnen liegende Wesen an den Tag bringen. Die denkende Beobachtung selbst gibt also Aufklärung über die Welt. Weil Aristoteles davon überzeugt war, deshalb wandte er seine Aufmerksamkeit vor allem der Beobachtung zu. Er ist dadurch ein Bahnbrecher der Wissenschaften geworden. Er hat die einzelnen Naturwissenschaften gepflegt in einer so umfassenden Weise, wie es für seine Zeit nur irgend möglich war. Er ist der anerkannte «Vater der Naturgeschichte». Von ihm liegen zum Beispiel feine und geistvolle Untersuchungen über die Entwickelung der Lebewesen von dem Keimzustande an vor. Solche Untersuchungen hingen mit seinen Weltanschauungsgedanken auf das natürlichste zusammen. Er mußte ja der Ansicht sein, daß zum Beispiel im Ei schon das ganze Lebewesen vorhanden sei, nur noch nicht auf äußerlich sichtbare Art. Er sagt sich: wenn aus dem Ei ein Lebewesen entsteht, dann muß es dieses Lebewesen selbst sein, das sich in dem Ei zum Dasein herausarbeitet. Sehen wir ein Ei an, so hat es im Grunde eine doppelte Wesenheit. Es ist erstens so, wie es unseren Augen erscheint. Aber es hat noch eine unsichtbare Wesenheit, die erst später zum Vorschein
kommen wird, wenn es ein ausgebildeter Vogel sein wird.
Diese Anschauung führt Aristoteles für die ganze Natur durch. Nur vor dem Menschen macht er halt. Im menschlichen Ei ist auch schon der ganze Mensch, sogar auch die Seele, insofern diese niedrige Verrichtungen vollzieht, die auch das Tier ausführen kann. Anders soll es aber mit dem Geiste des Menschen sein, der die höheren Tätigkeiten des Denkens ausführt. Dieser Geist ist noch nicht in dem menschlichen Keime. Wenn der Keim sich selbst überlassen bliebe, so könnte er es bloß bis zu einem tierischen Wesen bringen. Ein denkender Geist entstände nicht. Damit ein solcher werden kann, muß in dem Augenblicke, wo die rein tierische Entwickelung des Menschen weit genug vor-geschritten ist, eine höhere Schöpferkraft eintreten und den Geist in den Leib hineinschaffen. In der menschlichen Entwickelung geschieht alles auf natürliche Weise bis zu einem bestimmten Augenblicke, nämlich bis dahin, wo der Leib so weit ist, daß er den Geist beherbergen kann. Dann, wenn das eingetreten ist, wenn durch natürliche Entwickelung der Leib so weit gediehen ist, daß er alle notwendigen Organe hat, die der Geist zu seinen Zwecken braucht, dann wird der Geist in seine leibliche Wohnstätte hineingeschaffen. So denkt sich Aristoteles, daß die Geistseele des Menschen in der Zeit entstanden ist; aber er läßt sie nicht durch dieselben Kräfte entstehen, durch die der Leib entsteht, sondern durch einen höheren Einfluß. Zu betonen ist jedoch, daß die Organe, deren sich der Geist bedient, durch die Entwickelung des Leibes entstanden sind. Wenn also sich der Geist des Auges bedient, um sich über das Gesehene Gedanken zu machen, so kann er das nur innerhalb des Leibes, der ihm ein Auge zuerst entwickelt hat. Deshalb kann Aristoteles auch nicht in dem Sinne von einer Unsterblichkeit
sprechen, daß nach dem Tode der Geist in demselben Sinne fortbestehe, wie er vor dem Tode ist. Denn durch den Tod gehen seine Organe zugrunde. Er kann nicht mehr wahrnehmen. Er steht mit der Welt in keinem Zusammenhange mehr. Man darf also nicht behaupten, daß sich Aristoteles die Unsterblichkeit so vorstelle, als wenn der Geist seinen Leib wie ein irdisches Gefängnis verlasse und mit den Eigenschaften weiter existiere, die man an ihm kennt. Es werden ihm vielmehr alle die Eigenschaften entzogen, die er in seinem irdischen Dasein hat. Er führt also dann in der Tat eine Art Schattendasein wie etwa die griechischen Helden in der Unterwelt. Und von diesem Leben in der Unterwelt tut ja Achilleus den berühmten Ausspruch: «Lieber ein Tagelöhner im Lichte der Sonne, als ein König über die Schatten.»
Bei einer solchen Ansicht von dem Geiste mußte Aristoteles auch das sittliche Handeln als ein solches ansehen, das dieser Geist mit Hilfe der tierischen Seele ausübt. Der tierische Teil der Seele ist ja auf natürlichem Wege entstanden. Wenn dieser Teil allein handelt, wenn also der Mensch seinen tierischen Trieben und Leidenschaften allein folgt, dann kann er kein tugendhafter Mensch sein. Er wird es erst, wenn der Geist sich der tierischen Triebe und Leidenschaften bemächtigt und ihnen das rechte Maß gibt. Die tierische Wesenheit des Menschen würde in allen Dingen entweder zuviel oder zuwenig tun. Der bloß seinen Leidenschaften folgende Mensch ist entweder tollkühn oder feige. Der Geist allein findet die rechte Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit, nämlich die besonnene Tapferkeit.
In bezug auf den Staat bekennt sich Aristoteles zu der Ansicht, daß das Gemeinwesen den Bedürfnissen aller seiner Angehörigen Rechnung tragen müsse. Es gehört zum Wesen des Menschen, in einem Gemeinwesen zu leben.
Einer der Aussprüche des Aristoteles ist: «Wer für sich allein leben will, muß entweder ein Gott oder ein Tier sein... Der Mensch aber ist ein politisches Tier.» Eine für alle Menschen richtige Staatsform nimmt Aristoteles nicht an, sondern er findet in jedem einzelnen Falle diejenige Staatsform für die beste, die den Bedürfnissen des in Frage kommenden Volkes am besten entspricht. Jedenfalls aber legt er dem Staate die Pflicht auf, für das heranwachsende Geschlecht zu sorgen. Die Erziehung ist ihm somit Staatssache; und al5 Zweck der Erziehung erscheint ihm die Heranbildung zur Tugend.
Wer die griechische Kultur in ihrer Eigenart ganz verstehen will, der darf nicht vergessen, daß sich diese Kultur auf der Grundlage der Sklaverei aufbaute. Die Gebildeten innerhalb des Griechentums konnten zu ihrer Bildungsform nur dadurch gelangen, daß ihnen die Möglichkeit dazu durch das große Heer der Sklaven geboten wurde. Ohne Sklaverei konnte sich auch der fortgeschrittenste Grieche keine Kultur denken. Deshalb sieht selbst Aristoteles die Sklaverei als eine Naturnotwendigkeit an. Er hält sie einfach für selbstverständlich, denn er glaubt, daß viele Menschen durch ihr ganzes Wesen so beschaffen seien, daß sie zur vollen Freiheit gar nicht taugen. Nicht übersehen darf aber werden, daß sich der Grieche das Wohl seiner Sklaven angelegen sein ließ; und auch Aristoteles spricht von der Verpflichtung des Herrn, für seine Sklaven gewissenhaft zu sorgen und in ihnen die Menschenwürde zu achten.
Aristoteles hat durch mehr als ein Jahrtausend die abendländische Bildung beherrscht. Viele Jahrhunderte hindurch beschäftigte man sich nicht mit den Dingen der Natur selbst, sondern mit den Meinungen des Aristoteles über diese Dinge. Seinen Schriften wurde vollkommene Autorität zugemessen. Alle Gelehrsamkeit bestand darin, die
Schriften des alten Weisen zu erklären. Dazu kommt, daß man lange Zeit hindurch diese Schriften nur in einer sehr unvollkommenen und unzuverlässigen Gestalt hatte. Deshalb galten die verschiedensten Meinungen als solche, welche von Aristoteles herrühren sollten. Erst durch den christlichen Philosophen Thomas von Aquino wurden die Schriften des «Meisters derer, die da wissen» in einer Weise hergestellt, daß man sagen konnte, man habe es mit einem einigermaßen zuverläßlichen Text zu tun. Bis zum 12. Jahrhundert beschäftigte man sich außerdem fast einzig und allein mit einem Teil des aristotelischen Denkens, mit seinen logischen Untersuchungen. Man muß allerdings sagen, daß Aristoteles auf diesem Gebiete ganz besonders bahnbrechend geworden ist. Er hat die Kunst, richtig zu denken, das heißt die Logik, in einer Weise begründet, daß noch Kant am Ende des 18. Jahrhunderts der Ansicht sein konnte, die Logik sei seit Aristoteles um keinen wesentlichen Schritt vorwärtsgekommen. Die Kunst, in der richtigen Weise durch entsprechende Schlüsse des Denkens aus einer Wahrheit die andere abzuleiten, zu beweisen, hat Aristoteles meisterhaft in ein System gebracht. Und da die Gelehrsamkeit im Mittelalter weniger Interesse daran hatte, den menschlichen Geist durch Naturbeobachtung zu erweitern, sondern die Offenbarungswahrheiten durch logische Beweise zu stützen, so mußte ihr an der Handhabung der Denklehre besonders gelegen sein.
Was Aristoteles wirklich gelehrt hatte, das wurde bald nach seinem Tode getrübt durch die Auslegungen, die seine Nachfolger seinen Anschauungen gaben, und auch durch andere Meinungen, die sich an die seinigen anschlossen. Wir sehen in den nächsten Jahrhunderten nach Aristoteles zunächst drei Weltanschauungen auftauchen, den Stoizismus, den Epikureismus und den Skeptizismus.
Die stoische Schule stiftete Zeno von Kition auf Zypern, der von 342-270 v.Chr. lebte. Die Schule hat ihren Namen von der bunten Säulenhalle (Stoa) in Athen, wo ihre Lehrer den Unterricht erteilten. Das öffentliche Leben in Griechenland war seit den Tagen der Sophisten einer noch stärkeren Lockerung verfallen. Der einzelne stand immer mehr für sich da. Die Privattugend trat immer mehr an die Stelle der öffentlichen in den Mittelpunkt des Denkens. Die Stoiker sehen al5 das Höchste, was der Mensch erreichen könne, den vollkommenen Gleichmut im Leben an. Wer durch seine Begierden, durch seine Leidenschaften in seelischen Aufruhr versetzt werden kann, dem kann ein solcher Gleichmut nicht zuteil werden. Er wird durch Lust und Begierde dahin und dorthin getrieben, ohne daß er sich befriedigt fühlen kann. Man soll es daher so weit bringen, daß man von Lust und Begierde unabhängig ist und allein ein solches Leben führt, das durch weise Einsicht geregelt ist. Die Welt dachten sich die Stoiker aus einer Art Urfeuer entstanden. Sie waren der Ansicht, daß aus dem Feuer alles hervorgegangen sei, und daß auch in das Feuer alles zurückkehre. Dann erneuert sich wieder aus dem Feuer genau dieselbe Welt, die schon da war. Die Welt besteht also nicht einmal, sondern unzählige Male in der ganz gleichen Weise. Jeder einzelne Vorgang ist schon unendlich oft dagewesen und wird unendlich oft wiederkehren. Es ist das die Lehre von der ewigen Wiederkunft aller Dinge und Vorgänge, die in unseren Tagen Friedrich Nietzsche in genau derselben Weise erneuert hat. Mit der Sittenlehre der Stoiker stimmt eine solche Welterklärung in der besten Weise überein. Denn wenn alles schon dagewesen ist, dann kann der Mensch nichts Neues schaffen. Es ist daher natürlich, daß er in dem Gleichmut gegenüber allem, das auf jeden Fall kommen muß, die höchste sittliche Weisheit sieht.
Die Epikureer sahen das Lebensziel in der Befriedigung, die das Dasein dem Menschen gewährt, wenn er die Lust und das Glück in einer vernunftgemäßen Weise anstrebt. Es ist unvernünftig, kleinlichen Genüssen nachzujagen, denn diese müssen in den meisten Fällen zu Enttäuschungen, ja zum Unglücke führen; aber es ist ebenso unvernünftig, die edlen, hohen Genüsse zu verschmähen, denn sie führen zu der dauernden Befriedigung, die das Lebensglück des Menschen bildet. Die ganze Naturanschauung Epikurs trägt ein Gepräge, dem man es ansieht, daß es sich ihr um dauernde Befriedigung im Leben handelt. Es wird vor allem auf eine richtige Ansicht von der Urteilskraft gesehen, damit der Mensch sich durch sein Denken im Leben zurechtfindet. Denn die Sinne täuschen uns nicht, nur unser Denken kann uns täuschen. Wenn das Auge einen ins Wasser getauchten Stab gebrochen sieht, so täuscht uns das Auge nicht. Die wirklichen Tatsachen sind so, daß der Stab uns gebrochen erscheinen muß. Die Täuschung entsteht erst, wenn sich unser Denken ein falsches Urteil darüber bildet, wie es kommt, daß der Stab gebrochen erscheint. Epikurs Ansicht fand am Ende des Altertums zahlreiche Anhänger, namentlich die nach Bildung strebenden Römer suchten in ihr Befriedigung. Der römische Dichter T Lucretius Carus hat ihr in seinem genialen Lehrgedicht «Über die Natur» einen formvollendeten Ausdruck gegeben.
Der Skeptizismus ist die Weltanschauung des Zweifels und des Mißtrauens. Ihr erster bedeutsamster Bekenner ist Pyrrho, der schon ein Zeitgenosse des Aristoteles war, damals aber noch wenig Eindruck gemacht hat. Erst seine Nachfolger fanden Anhänger für ihre Meinung, daß die Erkenntniskräfte des Menschen nicht ausreichen, um eine Vorstellung von der wahren Wirklichkeit zu gewinnen. Sie glaubten, man könne nur menschliche Meinungen über die
Dinge äußern; ob sich die Dinge wirklich so verhielten, wie uns unser Denken das mitteilt, darüber ließe sich nichts entscheiden.
Die mannigfaltigen Versuche, durch das Denken zu einer Weltanschauung zu kommen, hatten zu so verschiedenartigen, zum Teil einander widersprechenden Vorstellungen geführt, daß man am Ende des Altertums zu einem Mißtrauen gegenüber aller Sinneswahrnehmung und allem Denken kam. Dazu kamen Vorstellungen, wie diejenigen Platons, daß die sinnliche Welt nur ein Traum- und Trugbild sei. Solche Vorstellungen verknüpften sich nun mit gewissen morgenländischen Gedanken, welche die Nichtigkeit und Wertlosigkeit des Lebens predigten. Aus diesen Einzelheiten baute sich in Alexandrien in den Jahrhunderten des zu Ende gehenden Altertums der Neuplatonismus au£ Als die wichtigsten Bekenner dieser Lehre sind Philo, der zur Zeit Christi lebte und Plotin zu nennen. Philo zieht aus der Lehre Platos die Konsequenzen für das sittliche Leben. Ist die Wirklichkeit ein Trugbild, dann kann die Tugend nur in der Abkehr von dieser Wirklichkeit bestehen und in der Hinlenkung aller Gedanken und Empfindungen zu der einzigen wahren Wirklichkeit liegen, die er bei Gott suchte. Was Plato in der Ideenwelt gesucht hatte, das glaubte Philo in dem Gott des Judentums zu finden. Plotin sucht dann diesen Gott nicht durch das vernünftige Erkennen zu erreichen, denn dieses kann sich nur auf das Endliche, Vergängliche beziehen: er sucht zu dem ewigen Urwesen durch innere Erleuchtung, durch ekstatisches Versenken in die Tiefen der Seele zu kommen. Durch ein solches Versenken kommt der Mensch zu dem Urwesen, das sich in die Welt ausgegossen hat. Diese Welt ist nur ein unvollkommener Ausfluß, ein Abfall von dem Urwesen.
2. Die Weltanschauungen des Mittelalters und der Neuzeit
Etwas ganz Neues tritt mit dem Christentum in der Weltanschauungs-Entwickelung des Abendlandes auf. Das vernünftige Denken wird von einer ganz anderen Autorität, von der Offenbarung, in den Schatten gedrängt. Die Wahrheit kommt nicht aus dem Denken, sondern stammt von einer höheren Macht, die sie dem Menschen enthüllt hat: das wird nunmehr die Überzeugung. Es ist der Glaube an Tatsachen von überirdischer Bedeutung und der Unglaube gegenüber der Vernunft, der das Wesen des Christentums ausmacht. Die Bekenner der christlichen Lehre wollen nicht an ihr Denken glauben, sondern an sinnenfällige Ereignisse, durch welche sich die Wahrheit kundgegeben habe. «Was von Anfang her geschehen ist, was wir gehört, was wir mit Augen gesehen haben, was wir selbst geschauet, was unsere Hände berührt haben von dem Worte des Lebens... was wir sahen und hörten, melden wir Euch, damit Ihr Gemeinschaft mit uns habt.» So heißt es in der 1. Epistel Johannis. Und Augustinus sagt: «Ich würde dem Evangelium nicht glauben, wenn mich die Autorität der katholischen Kirche nicht dazu bewegte.» Was die Zeitgenossen Christi gesehen und gehört und was die Kirche als solch Gehörtes und Gesehenes durch Überlieferung aufbewahrt, das wird nun Wahrheit; nicht mehr das gilt als solche, was der Mensch durch sein Denken erreicht.
Im Christentum treten uns einerseits die religiöse Gedankenwelt des Judentums, andererseits die Vorstellungen der griechischen Weltanschauung entgegen. Die Religion des Judentums war ursprünglich eine national-egoistische. Gott hat sein Volk auserwählt zur irdischen Macht und Herrlichkeit. Aber dieses Volk hatte die bittersten Enttäuschungen
erleben müssen. Es war in die Gefangenschaft und Untertänigkeit anderer Völker gekommen. Seine Messiashoffnungen gingen daraus hervor, daß es Erlösung aus seiner Schmach und Erniedrigung von seinem Gotte erwartete. Diese Erniedrigung schrieb man der eigenen Sündhaftigkeit zu. Hier dringen Vorstellungen ein von einer Abkehr vom Leben, das zur Sündhaftigkeit geführt hat. Man solle sich nicht an dieses Leben hängen, das ja zur Sünde führt; man solle vielmehr zu Gott sich wenden, der bald sein Reich auf diese Erde bringen und die Menschen aus der Schmach befreien wird. Von solchen Vorstellungen war Jesus ganz erfüllt. Zu den Armen und Bedrückten wollte er sprechen, nicht zu denen, welche an den Schätzen dieses Lebens hängen. Das Himmelreich, das bald kommt, wird denen gehören, die vorher im Elend gelebt haben. Und Jesus stellte sich das Himmelreich in zeitlicher Nähe vor. Nicht auf ein geistiges Jenseits verwies er die Menschen, sondern darauf, daß in der Zeit, und zwar bald, der Herr kommen und den Menschen die Herrlichkeit bringen werde. Schon durch Paulus, noch mehr durch die Glaubenslehrer der ersten christlichen Jahrhunderte trat an die Stelle des naiven Glaubens eine Verbindung der Lehren Christi mit den Vorstellungen der späteren griechischen Philosophen. Das zeitlich nahe Himmelreich wurde so zum Jenseits. Der Christenglaube wurde mit Hilfe griechischer Weltanschauungsgedanken umgedeutet. Aus dieser Umdeutung, aus dieser Zusammenarbeitung von ursprünglich naiven Vorstellungen mit den überlieferten Anschauungen entwickelte sich im Laufe der Zeiten der dogmatische Inhalt der christlichen Lehre. Das Denken trat ganz in den Dienst des Glaubens, es wurde der Diener der Offenbarung. Das ganze Mittelalter arbeitet daran, mit Hilfe des Denkens die Offenbarung zu stützen. Wie in den ersten
Jahrhunderten Denken und Offenbarung ineinanderarbeiten, davon gibt der Kirchenvater Augustinus ein Zeugnis; wie das in der späteren Zeit in der Kirche geschah, Thomas von Aquino. Augustinus sagt sich: Wenn wir auch zweifeln: die eine Tatsache bleibt doch bestehen, daß das Denken, der denkende Mensch selbst da sein muß; sonst könnte er ja nicht zweifeln. Wenn ich zweifle, so denke ich; also bin ich, ist meine Vernunft da. Und in der Vernunft offenbaren sich mir gewisse Wahrheiten. Aber meine Vernunft erkennt niemals alle Wahrheit, sondern immer nur einzelne Wahrheiten. Diese einzelnen Wahrheiten können nur von dem Wesen herstammen, bei dem alle Wahrheit ist, von Gott. Es muß also eine göttliche Wesenheit geben. Meine Vernunft beweist mir das. Meine Vernunft gibt mir aber nur Teile der Wahrheit; in der Offenbarung liegt die höchste Wahrheit. Thomas von Aquino ist ein umfassender Denker, welcher das ganze Wissen seiner Zeit in erstaunlich scharfsinniger Weise verarbeitet. Man darf sich durchaus nicht vorstellen, daß sich dieser christliche Philosoph der Naturerkenntnis und der Vernunft feindlich gegenüberstellte. Die Natur war für ihn die eine Quelle der Wahrheit; die Offenbarung aber die andere. Von Gott rührt, nach seiner Meinung, alles in der Welt her. Auch die Naturerscheinungen sind ein Ausfluß der göttlichen Wesenheit. Wenn wir über die Natur forschen, so forschen wir mit unserem Denken über die Taten Gottes. Bis zu den höchsten Taten Gottes können wir aber mit unserem menschlich schwachen Denken nicht dringen. Wir können, nach Thomas von Aquino, wohl noch aus unserer Vernunft beweisen, daß es einen Gott gibt; aber von dem Wesen Gottes, von seiner Dreieinigkeit, von der Erlösung der Menschen durch Christus, von der Macht der Sakramente und so weiter, können wir aus der Vernunft nichts
erfahren; darüber unterrichtet uns die Offenbarung durch die Autorität der Kirche. Nicht weil diese Dinge überhaupt nichts mit der Vernunft zu tun haben, meint Thomas, kann der Mensch sie durch sein Denken nicht erreichen, sondern nur, weil die menschliche Vernunft zu schwach ist. Eine stärkere Vernunft könnte also auch die geoffenbarten Wahrheiten begreifen. Diese Anschauung stellt sich in der Scholastik des Mittelalters dar.
Einen anderen Weg als die Scholastik schlug die deutsche Mystik zur Erreichung der Wahrheit ein. Die wichtigsten Mystiker sind: Meister Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Suso, Paracelsus, Jakoh Böhme und A ngelus Silesius. Sie bilden insofern die Vorläufer der neueren Weltanschauungen, als sie nicht von einer äußeren Autorität ausgingen, sondern die Wahrheit in der Seele des Menschen und in den Erscheinungen der Natur suchen wollten. Nicht ein äußerer Christus kann, nach ihrer Meinung, dem Menschen den Weg zu seinem Ziele zeigen, sondern allein die Geisteskräfte im menschlichen Innern weisen diesen Weg. «Der Arzt muß durch der Natur Examen gehen», sagt Paracelsus, um darauf hinzuweisen, daß in der Natur selbst die Quelle der Wahrheit ist. Und Angelus Silesius betont, daß nicht außer den Dingen der Natur eine göttliche Wesenheit sei, sondern daß Gott in der Natur sei. Wie die Natur selbst das Göttliche ist und als Göttliches schafft, das drückt er in schönen Sätzen aus, wie zum Beispiel: «Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben; werd' ich zu nicht, er muß vor Not den Geist aufgeben.» Gott hat kein Leben außer den Dingen, sondern nur in den Dingen. Von einer solchen Vorstellung ist auch die Weltanschauung Jakob Böhmes ganz beherrscht.
An der Scholastik ist ersichtlich, daß sie immerfort bestrebt war, einen Einklang zwischen Vernunft und Offenbarung
herzustellen. Das ging nicht ohne verkünstelte Logik, ohne die spitzfindigsten Schlußfolgerungen ab. Von solchen Schlußfolgerungen wollten sich die Mystiker frei machen. Das Höchste, was der Mensch erkennen kann, scheint ihnen unmöglich auf logische Spitzfindigkeiten aufzubauen zu sein, es muß sich klar und unmittelbar in der Natur und im menschlichen Gemüte offenbaren.
Von ähnlichen Empfindungen ging auch Luther aus. Ihm war es weniger darum zu tun, auf was es dem Mystiker ankam: er wollte die göttliche Offenbarung vor allem vor dem Widerspruche der Vernunft retten. Er suchte das, im Gegensatze zu den Scholastikern, dadurch zu erreichen, daß er sagte: Der Vernunft steht in Glaubenssachen überhaupt keine Entscheidung zu. Die Vernunft solle sich mit der Erklärung der Welterscheinungen zu tun machen; mit den Glaubenswahrheiten habe sie nichts zu tun. Das geoffenbarte Wort ist die Quelle des Glaubens. Mit diesem Glauben hat die Vernunft gar nichts gemein; er geht sie nichts an. Sie kann ihn nicht widerlegen und auch nicht beweisen. Er steht fest für sich da. Wenn sich die Vernunft an die religiösen Wahrheiten heranmacht, dann gibt es nur eitel Gezänk und Geschwätz. Deshalb schmähte Luther den Aristoteles, auf dessen Lehre sich die Scholastiker gestützt hatten, wenn sie dem Glauben durch die Vernunft eine Grundlage geben wolllten. Er sagt: «Dieser gottverfluchte Aristoteles ist ein wahrhafter Teufel, ein gräulicher Verleumder, ein verruchter Sycophant (Verleumder), ein Fürst der Finsternis, eine Bestie, ein häßlicher Betrüger der Menschheit, fast aller Philosophie bar, ein offener und anerkannter Lügner, ein geiler Bock.» Man sieht, um was es sich handelt. Aristoteles hatte durch menschliches Denken die höchsten Wahrheiten erreichen wollen; Luther wollte diese höchsten Wahrheiten vor der Bearbeitung durch die
Vernunft ein für allemal sicherstellen. Deshalb nennt er auch die Vernunft «des Teufels Hure, die nichts kann, denn lästern und schänden, was Gott redet und tut». Wir sehen die Vorstellungen Luthers auch heute noch in der gleichen Gestalt fortwirken, wenn auch die moderne Theologie ein fortschrittliches Mäntelchen um sie breitet. In dem viel-gepriesenen «Wesen des Christentums» von Adolf Harnack lesen wir: «Die Wissenschaft vermag nicht, dem Leben einen Sinn zu geben... Die Religion, nämlich die Gottes- und Nächstenliebe, ist es, die dem Leben Sinn gibt... Jesu eigentliche Größe ist, daß er die Menschen zu Gott geführt hat... Die christliche Religion ist ewiges Leben mitten in der Zeit.»
Kurze Zeit nach Luthers Auftreten gelang der von ihm geschmähten Vernunft ein Sieg nach dem andern. Kopernikus stellte seine neue Anschauung von der Bewegung der Himmelskörper auf. Kepler stellte die Gesetze fest, nach denen sich die Planeten um die Sonne bewegen; Galilei richtete das Fernrohr hinaus in ungemessene Himmelsräume und gab der Natur dadurch Gelegenheit, aus sich heraus eine Fülle von Tatsachen zu enthüllen. Durch solche Fortschritte mußte die Naturforschung zu sich selbst und zur Vernunft Vertrauen gewinnen. Galilei gibt die Empfindungen wieder, die sich in einem Denker der damaligen Zeit festsetzten. Man glaubte jetzt nicht mehr im Sinne des Aristoteles zu wirken, wenn man an dem festhielt, was er mit seinen beschränkten Kenntnissen behauptet hat. Dies hat das Mittelalter getan. Jetzt war man der Meinung, man schaffe im Geiste des Aristoteles, wenn man, wie er, den Blick in die Natur richte. Es sind goldene Worte, die in dieser Hinsicht Galilei gesprochen hat. «Ihr habt es immer» - sagt er - «mit eurem Aristoteles, der nicht sprechen kann. Ich aber sage euch, daß, wenn Aristoteles hier wäre, er entweder
von uns überzeugt würde, oder unsere Gründe widerlegte und uns eines Besseren belehrte... Die Philosophie ist in diesem größten Buche geschrieben, das fortwährend offen vor unseren Augen liegt, ich meine das Universum, das man aber nicht verstehen kann, wenn man nicht vorher die Sprache verstehen und die Zeichen kennengelernt hat, in denen es geschrieben ist.» Giordano Bruno ist einer derjenigen Geister dieses aufblühenden Denkens, der zwar imstande war, eine Welterklärung im Sinne der Naturanschauung aufzubauen, der aber daneben völlig an den hergebrachten Dogmen festhielt, ohne sich Rechenschaft zu geben, wie eines mit dem anderen sich vereinigen läßt.
Wollte das menschliche Denken nicht sich selbst verleugnen, wollte es sich nicht in eine völlig untergeordnete Stellung drängen lassen, so konnte es nur in neuer Weise den Weg wieder betreten, den schon die griechischen Weltanschauungen gesucht haben. Es mußte aus sich selbst heraus zu den höchsten Wahrheiten vorzudringen suchen.
René Descartes (Cartesius) war einer der ersten, der einen Versuch machte. Sein Weg hat viel Ähnlichkeit mit dem des Augustinus. Auch Descartes ging von dem Zweifel an aller Wahrheit aus. Und auch er sagte sich: Wenn ich auch an allem zweifeln kann, daran kann ich nicht zweifeln, daß ich bin. Ich denke, wenn ich zweifle; dächte ich nicht, so könnte ich nicht zweifeln. Wenn ich aber denke, so bin ich. «Ich denke, also bin ich» (cogito, ergo sum), das ist der berühmte Grundsatz des Descartes. Und von dieser Grundwahrheit sucht Descartes zu den höheren Erkenntnissen aufzusteigen. Er sagt sich: Was ich so klar und deutlich einsehe, wie, daß ich selbst bin, das muß auch ebenso wahr sein. - Und nun tritt bei ihm eine eigentümliche Erscheinung ein. Die christlichen Vorstellungen von Gott, Seele und Unsterblichkeit. die eine jahrhundertelange Erziehung
der abenländischen Menschheit eingeimpft hat, glaubt er in seiner Vernunft als ebenso sichere Wahrheiten zu finden, wie die Erkenntnis, daß er selbst ist. Diese wesentlichen Bestandteile der alten Theologie kommen da wieder als angebliche Vernunftswahrheiten zum Vorschein. Wir finden bei Descartes sogar die alte Seelenvorstellung wieder. Er denkt sich diese Seele als ein selbständiges geistiges Wesen, das sich des Körpers nur bedient. Wir sind einer solchen Idee bei Aristoteles begegnet. Die Tiere haben, nach Descartes, nichts von einer Seele. Sie sind Automaten. Der Mensch hat eine Seele, die im Gehirn ihren Sitz hat und durch die Zirbeldrüse mit dem seelenlosen Körper in Wechselwirkung tritt. Wir sehen bei Descartes ein Bestreben, das auch bei den Scholastikern vorhanden ist, nämlich die von der alten Überlieferung hergebrachten «höchsten Wahrheiten» durch die Vernunft beweisen zu wollen. Nur gestehen die Scholastiker offen zu, daß sie dies wollen, während Descartes glaubt, alle Beweise rein aus der Vernunft selbst zu schöpfen. Descartes bewies also scheinbar aus der Vernunft, was nur aus der Religion stammte. Diese verkappte Scholastik herrschte nunmehr lange noch; und in Deutschland haben wir in Leibniz und in Wolff ihre hauptsächlichsten Vertreter. Leibniz rettet die alte Seelenvorstellung dadurch, daß er alles zu einer Art selbständiger belebter Wesen macht. Diese entstehen nicht und vergehen nicht. Und er rettet die Gottesvorstellung dadurch, daß er ihr zuschreibt, sie bringe alle Wesen in eine harmonische Wechselwirkung. Es kommen immer wieder die alten religiösen Vorstellungen als angebliche Wahrheiten der Vernunft zum Vorschein. Das ist auch bei Wolff der Fall. Er unterscheidet sinnliche Wahrheiten, die durch Beobachtung gewonnen werden, und höhere Erkenntnisse, welche die Vernunft aus sich selbst schöpft. Diese höheren Wahrheiten
sind aber, bei Lichte besehen, nichts anderes als die alten, durch Verstümmelung und Durchsiebung gewonnenen Offenbarungswahrheiten. Kein Wunder, daß die Vernunft bei den Beweisen solcher Wahrheiten sich auf höchst fragwürdige Begriffe stützte, die bei näherer kritischer Prü-fung nicht standhalten konnten.
Eine solche kritische Prüfung des Beweisverfahrens der menschlichen Vernunft nahmen die englischen Denker Locke, David Hume, und der deutsche Philosoph Immanuel Kant vor. Locke prüfte das menschliche Erkenntnisvermögen und glaubte zu finden, daß wir nur durch die Beobachtung der Naturvorgänge selbst zu Erkenntnissen kommen können. Hume fragte nun, welcher Art diese Erkenntnisse seien. Er sagte sich: Wenn ich heute beobachte, daß die Sonnenwärme die Ursache der Erwärmung des Steines ist:
habe ich ein Recht zu sagen, daß das immer so sein wird? Wenn ich eine Ursache wahrnehme und dann eine Wirkung: darf ich sagen, jene Ursache werde immer und notwendig diese Wirkung haben? Nein, das darf ich nicht. Ich sehe den Stein zur Erde fallen und nehme wahr, daß er in der Erde eine Höhlung macht. Daß das so sein muß, daß es nicht auch anders sein könnte, davon kann ich nichts behaupten. Ich sehe gewisse Vorgänge und gewöhne mich auch daran, sie in einem bestimmten Zusammenhange zu sehen. Ob aber ein solcher Zusammenhang wirklich besteht, ob es Naturgesetze gibt, welche mir etwas Wirkliches über den Zusammenhang der Dinge sagen können, davon weiß ich nichts. Kant, der in den Vorstellungen der Wolffschen Weltanschauung gelebt hatte bis in sein Mannesalter, wurde in allen seinen Uberzeugungen erschüttert, als er die Schriften Humes kennenlernte. Die ewigen Wahrheiten könne die Vernunft beweisen, daran hatte er vorher nicht gezweifelt; Hume hatte gezeigt, daß selbst bei den einfachen
Wahrheiten von einem Beweis nicht die Rede sein könne, sondern daß wir alles, was wir glauben, nur aus Gewohnheit annehmen. Soll es wirklich keine ewigen Wahrheiten geben, fragte sich Kant. Es muß solche geben. Daß die Wahrheiten zum Beispiel der Mathematik immer und notwendig wahr sein müssen, daran mochte er nicht zweifeln. Ebensowenig daran, daß so etwas ewig gültig sein muß wie: jede Wirkung hat eine Ursache. Davon hat ihn aber Hume überzeugt, daß diese Erkenntnisse nicht ewig wahr sein könnten, wenn wir sie aus der Beobachtung von außen gewonnen hätten. Denn die Beobachtung kann uns nur sagen, was immer gewesen ist; nicht aber, ob dieses auch immer so sein muß. Kant fand einen Ausweg. Er sagte: es hängt gar nicht von den Dingen in der Natur ab, wie sie uns erscheinen. Das hängt einzig und allein von uns selbst ab. Ich bin so eingerichtet, daß für mich «zweimal zwei vier» sein muß; ich bin so eingerichtet, daß für mich jede Wirkung eine Ursache haben müsse. Mag es also draußen, im «Ding an sich», zugehen, wie es immer mag, mögen da einmal die Dinge so sein, daß «zweimal zwei drei» ist, ein andermal, daß «zweimal zwei fünf» ist; das kann alles nicht an mich herankommen. Ich kann nur wahrnehmen, daß «zweimal zwei vier» ist, folglich erscheint mir alles so, daß «zweimal zwei vier» ist. Ich kann nur eine Wirkung an eine Ursache knüpfen; folglich erscheint mir alles so, als wenn immer Wirkungen mit Ursachen verknüpft seien. Ob auch im «Ding an sich» Ursachen mit Wirkungen zusammenhängen, das weiß ich nicht. Ich bin wie mit einer blauen Brille behaftet. Mögen die Dinge draußen was immer für Farben haben, ich weiß im voraus, daß mir alles in einem blauen Farbentone erscheinen wird. Wie die «Dinge an sich» sind, weiß ich also nicht; ich weiß nur, wie sie mir erscheinen. Da nun Gott, Unsterblichkeit und Freiheit des
menschlichen Willens überhaupt nicht beobachtet werden können, nicht erscheinen, so kann das menschliche Denken, die Vernunft über diese Dinge nichts ausmachen. Sie gehen die Vernunft nichts an. Gehen sie aber deswegen den Menschen überhaupt nichts an? So fragt sich Kant. Sie gehen den Menschen sehr viel an, gibt er zur Antwort. Nur kann man ihr Dasein nicht begreifen; man muß es glauben. Ich weiß, daß ich meine Pflicht tun soll. Ein kategorischer Imperativ spricht in mir: Du sollst. Also muß ich auch können. Wenigstens muß ich daran glauben, daß ich kann. Und zu diesem Glauben brauche ich einen andern. Ich selbst kann den Verrichtungen meiner Pflicht nicht den notwendigen Nachdruck geben. Ich kann die Welt nicht so einrichten, daß sie dem entspricht, was ich als sittliche Weltordnung ansehen muß. Also muß es einen Gott geben, der diese sittliche Weltordnung bestimmt. Er gibt meiner Seele auch die Unsterblichkeit, damit sie im ewigen Leben die Früchte ihrer Pflichten genießen könne, die ihr in diesem vergänglichen, unvollkommenen Leben nimmer beschieden sein können. Man sieht, bei Kant taucht als Glaube alles wieder auf, was das Wissen niemals erreichen kann. Kant hat auf anderem Wege ein ähnliches erreicht, was Luther auf seinem Wege angestrebt hat. Luther wollte die Erkenntnis von den Gegenständen des Glaubens ausschließen. Kant wollte das gleiche. Sein Glaube ist nicht mehr der Bibelglaube; er spricht von einer «Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft». Aber die Erkenntnis, das Wissen, sollten nur auf die Erscheinungen beschränkt sein; über die Glaubensgegenstände sollten sie nicht mitzureden haben. Kant ist mit Recht der Philosoph des Protestantismus genannt worden. Er hat, was er erreicht zu haben glaubt, selbst am besten mit den Worten bezeichnet: «Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu
bekommen.» Die Erkenntnis soll es also, im Sinne Kants, nur mit der untergeordneten Welt zu tun haben, die dem Leben keinen Sinn gibt; was dem Leben Sinn gibt, das sind Gegenstände des Glaubens, an die kein Wissen heran kann.
Wer immer den Glauben retten will, der kann es mit den Waffen der Kantschen Weltanschauung tun; denn das Wissen hat keine Macht - im Sinne dieser Ansicht -, über die höchsten Wahrheiten etwas auszumachen. Die Philosophie des 19. Jahrhunderts steht in vielen ihrer Strömungen unter dem Einfluß der Kantschen Gedanken. Man kann mit ihnen so bequem dem Wissen die Flügel beschneiden; man kann dem Denken das Recht bestreiten, über die höchsten Dinge mitzureden. Man kann zum Beispiel sagen: Was will denn die Naturwissenschaft? Sie kann ja nur untergeordnete Weisheit zum besten geben. Durch Kant, den man so gern den großen Reformator der Philosophie nennt, ist ein für allemal bewiesen, daß das Wissen beschränkt, untergeordnet ist, daß es dem Leben keinen Sinn geben kann. Die Weltanschauungen der Gegenwart, die sich auf solche Selbstverstümmelung der Erkenntnis berufen, sind noch nicht einmal bis zum Standpunkt der Scholastik vorgedrungen, die sich wenigstens verpflichtet fühlte, einen Einklang zwischen Wissen und Glauben herbeizuführen. Du Bois-Reymond hat sogar diesem Standpunkte in seinem berühmten Vortrag: «Über die Grenzen des Naturerkennens» ein naturwissenschaftliches Mäntelchen umgehängt.
3. Die neuen Weltanschauungen
Eine andere Weltanschauungsströmung, die bis in die Gegenwart heraufreicht, nimmt ihren Ausgangspunkt von Spinoza. Er ist ein Denker, der ein unbedingtes Vertrauen in die menschliche Vernunft hat. Was so erkannt werden
kann, wie die mathematischen Wahrheiten, das nimmt die Vernunft als ihre Erkenntnisse an. Und die Dinge der Welt stehen in einem ebensolchen notwendigen Zusammenhange, wie die Glieder einer Rechnung oder wie die mathematischen Figuren. Alles Geistige ist ebenso wie alles Körperliche von solchen notwendigen Naturgesetzen beherrscht. Es ist eine kindliche Vorstellung, zu glauben, daß eine menschenähnliche allweise Vorsehung die Dinge einrichtet. Die Verrichtungen der Lebewesen, die Handlungen des menschlichen Geistes unterliegen ebenso den Naturgesetzen, wie der Stein, der gemäß den Gesetzen der Schwere zur Erde fällt. Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß eine schöpferische Macht nach bestimmten Zwecken irgendwelche Wesen geschaffen habe. Man täuscht sich, wenn man zum Beispiel glaubt, ein Schöpfer habe dem Stier Hörner gegeben, damit er stoßen könne. Nein, der Stier hat seine Hörner nach ebenso notwendigen Gesetzen bekommen, wie eine Billardkugel nach Gesetzen weiterrollt, wenn sie gestoßen wird. Er hat naturnotwendig die Hörner und deshalb stößt er. Man kann auch sagen: der Stier hat nicht Hörner, damit er stoßen könne, sondern er stößt, weil er Hörner hat. Gott ist im Sinne Spinozas nichts als die allen körperlichen und geistigen Erscheinungen innewohnende natürliche Notwendigkeit. Wenn der Mensch hinaussieht in die Welt, dann erblickt er Gott; wenn er über die Dinge und Vorgänge nachdenkt, dann stellt sich ihm die göttliche Weltordnung dar, die aber nichts ist als die natürliche Ordnung der Dinge. Im Sinne Spinozas kann man von einem Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen nicht sprechen. Denn es gibt nichts außer der Natur. Der Mensch gehört selbst zu dieser Natur. Wenn er also sich und die Natur betrachtet, so gibt sich ihm alles kund, wovon überhaupt gesprochen werden kann.
Von dieser Weltanschauung war auch Goethe durchdrungen. Auch er suchte, was frühere Anschauungen in einer jenseitigen Welt gesucht haben, in der Natur selbst. Die Natur wurde sein Gott. Von keiner anderen göttlichen Wesenheit wollte er etwas wissen.
Was wär' ein Gott, der nur von außen stieße,
Im Kreis das All am Finger laufen ließe!
Ihm ziehmt's, die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
So daß, was in ihm lebt und webt und ist,
Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.
So sagt Goethe. Die Natur ist ihm Gott, und die Natur offenbart auch Gott. Es gibt keine andere Offenbarung. Und es kann neben den Wesenheiten der Natur keine anderen mehr geben, die nur durch den Glauben erreicht werden sollen. Deshalb hat Goethe mit der Kantschen Unterscheidung von Glauben und Wissen niemals etwas zu tun haben wollen.
Und daß alles, was der Mensch an Wahrheit wünschen kann, auch durch die Betrachtung der Natur und des Menschen selbst erreicht werden kann, das ist auch die Überzeugung der Denker, die im Beginne des 19. Jahrhunderts sich um Weltanschauungen bemühen. Das ist auch die Überzeugung der Denker, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus den Erkenntnissen der Naturwissenschaft heraus sich eine Weltanschauung erbauen wollen. Diese letzteren Denker, wie zum Beispiel Haeckel, sind der Meinung, daß die Naturgesetze, die sie erforschen, nicht bloß untergeordnete Dinge sind, sondern daß sie dasjenige wahrhaft darstellen, was dem Leben einen Sinn gibt.
Johann Gottlieb Fichte stellt das eigene «Ich» des Menschen in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Was haben
frühere Weltanschauungen mit diesem «Ich» alles gemacht? Sie haben es aus dem Menschen herausgehoben und zum Gott gemacht. Dadurch entstand der menschenähnliche Schöpfer der Welt. Fichte läßt alle solchen Gottesvorstellungen auf sich beruhen. Er sucht das Bewußtsein da auf, wo es allein wirklich zu finden ist, im Menschen. Etwas, was man früher als Gott verehrt hat, ein solches geistiges Wesen, findet Fichte nur im Menschen. Der Mensch hat es also, wenn er das Verhältnis sucht zwischen dem Geiste und der Welt, nicht mit einem Zusammenhang von «Gott und Welt» zu tun, sondern nur mit einer Wechselwirkung des Geistes, der in ihm ist, mit der Natur. Dies ist der Sinn der Fichteschen Weltanschauung; und alles, was man Fichte angedichtet hat: als ob er zum Beispiel hätte behaupten wollen, der einzelne Mensch schaffe sich aus sich heraus die Natur, beruht nur auf einer ganz kurzsichtigen Auslegung seiner Gedanken. Schelling hat dann auf Fichtes Vorstellungen weitergebaut. Fichte hat nichts anderes gewollt, als den menschlichen Geist belauschen, wenn dieser sich seine Vorstellungen über die Natur bildet. Denn kein Gott gibt ihm ja diese Vorstellungen; er bildet sich dieselben allein. Nicht wie Gott es macht, das war für Fichte die Frage, sondern wie der Mensch es macht, wenn er sich in der Welt zurechtfindet. Schelling baute darauf die Anschauung, daß wir die Welt von zwei Seiten betrachten können, von der äußeren Seite, wenn wir die körperlichen Vorgänge betrachten, und von der inneren Seite, wenn wir den Geist betrachten, der ja auch nichts anderes ist als die Natur. Hegel ging dann noch einen Schritt weiter. Er fragte sich: Was ist denn das eigentlich, was uns unser Denken über die Natur offenbart? Wenn ich durch mein Denken die Gesetze der Himmelskörper erforsche, enthüllt sich in diesen Gesetzen nicht die ewige Notwendigkeit, die in der Natur
herrscht? Was geben mir also alle meine Begriffe und Ideen? Doch nichts anderes, als was draußen in der Natur selbst ist. In mir sind dieselben Wesenheiten als Begriffe, als Ideen vorhanden, die in der Welt als ewige, eherne Gesetze alles Dasein beherrschen. Sehe ich in mich, so nehme ich Begriffe und Ideen wahr; sehe ich außer mich, so sind diese Begriffe und Ideen Naturgesetze. Im einzelnen Menschen spiegelt sich als Gedanke, was die ganze Welt als Gesetz beherrscht. Man mißversteht Hegel, wenn man behauptet, er hätte die ganze Welt aus der Idee, aus dem menschlichen Kopfe, herausspinnen wollen. Es wird einst als eine ewige Schande der deutschen Philosophie angerechnet werden müssen, daß sie Hegel so mißverstanden hat. Wer Hegel versteht, dem fällt es gar nicht ein, irgend etwas aus der Idee herausspinnen zu wollen. Wirklich verstanden, im fruchtbaren Sinne des Wortes, hat Marx Hegel. Deshalb hat Marx die Gesetze der ökonomischen Entwickelung gesucht da, wo sie allein zu finden sind. Wo sind die Gesetze zu finden? Auf diese Frage antwortete Hegel: Dort, wo die Tatsachen sind, sind auch die Gesetze. Es gibt sonst nirgends eine Idee, als wo die Tatsachen sind, die man durch diese Idee begreifen will. Wer die Tatsachen des wirklichen Lebens erforscht, der denkt hegelisch. Denn Hegel war der Ansicht, daß nicht abstrakte Gedanken, sondern die Dinge selbst zu ihren Wesenheiten führen.
Ebenso verfährt die neuere Naturwissenschaft im Geiste Hegels. Diese neue Naturwissenschaft, deren großer Begründer Charles Darwin durch sein Werk «Die Entstehung der Arten» (1859) geworden ist, sucht die Naturgesetze im Reiche der Lebewesen ebenso auf, wie man dies auch in der leblosen Natur tut. Ernst Haeckel faßt das Glaubensbekenntnis dieser Naturwissenschaft in die Worte zusammen:
«Der Magnet, der Eisenspäne anzieht, das Pulver, das explodiert,
der Wasserdampf, der die Lokomotive treibt ... sie wirken ebenso durch lebendige Kraft, wie der Mensch, der denkt.» Diese Naturwissenschaft ist davon überzeugt, daß sie mit den Gesetzen, welche die Vernunft aus den Dingen herausholt, zugleich das Wesen dieser Dinge enthüllt. Für einen Glauben, der erst dem Leben seinen Sinn geben soll, bleibt da nichts mehr übrig. In den fünfziger Jahren haben mutige Köpfe, wie Carl Vogt, Jacob Moleschott und Ludwig Büchner, die Anschauung wieder zur Geltung zu bringen versucht, daß in den Dingen dieser Welt sich auch deren Wesen durch die Erkenntnis ganz und restlos enthüllt. Es ist heute Mode geworden, über diese Männer wie über die borniertesten Köpfe herzufallen und von ihnen zu sagen, daß sie die eigentlichen Rätsel der Welt gar nicht gesehen hätten. Das tun nur Menschen, die selbst keine Ahnung davon haben, welche Fragen man überhaupt aufwerfen kann. Was wollten diese Männer anderes, als die Natur erforschen, um aus der Natur selbst durch Erkenntnis den Sinn des Lebens zu gewinnen? Tiefere Geister werden der Natur gewiß noch tiefere Wahrheiten ablauschen können als Vogt und Büchner. Aber auch diese tieferen Geister werden es auf denselben Erkenntniswegen tun müssen wie sie. Denn man sagt immer: Ihr müßt den Geist suchen, nicht den rohen Stoff! Wohlan, die Antwort kann nur mit Goethe gegeben werden: Der Geist ist in der Natur.
Was jeder Gott außer der Natur ist, darauf hat Ludwig Feuerbach die Antwort gegeben, indem er zeigte, wie eine solche Gottesvorstellung von dem Menschen, nach dessen Bilde, geschaffen ist. «Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen, die Religion ist die feierliche Enthüllung der verborgenen Schätze des Menschen, das Eingeständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner Liebesgeheimnisse.» Was der Mensch
in sich selbst hat, das setzt er in die Welt hinaus und verehrt es als Gott. So macht der Mensch es auch mit der sittlichen Weltordnung. Diese kann nur er selbst, aus sich im Zusammenhang mit seinesgleichen, schaffen. Er stellt sich aber dann vor, sie sei von einem anderen, höheren Wesen über ihn gesetzt. In radikaler Weise ist Max Stirner solchen Wesenheiten zu Leibe gegangen, die der Mensch sich selbst schafft und dann wie höhere Gewalten, als Spuk oder Gespenst, über sich setzt. Stirner fordert die Befreiung des Menschen von solchen Gespenstern.
Der Weg, der von ihnen befreit, wurde einzig und allein von den auf naturwissenschaftlicher Grundlage aufgebauten Weltanschauungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betreten. Andere Weltanschauungen, wie zum Beispiel die Arthur Schopenhauers und Eduard v. Hartmanns sind wieder nur Rückfälle in veraltete Vorstellungen. Schopenhauer hat statt des ganzen menschlichen «Ich» nur einen Teil, den Willen, zum göttlichen Wesen gemacht; und Hartmann hat mit dem «Ich» dasselbe gemacht, nachdem er zuerst das Bewußtsein aus diesem «Ich» hinausbefördert hat. Dadurch ist er zum «Unbewußten» als Urgrund der Welt gekommen. Es ist begreiflich, daß diese beiden Denker, von solchen Voraussetzungen aus, zur Überzeugung kommen mußten, daß die Welt die denkbar schlechteste sei. Denn sie haben das «Ich» zum Urgrunde der Welt gemacht, nachdem sie aus demselben die Vernunft entweder ganz oder teilweise hinausbefördert haben. Die früheren Denker dieses Charakters haben das «Ich» zuerst idealisiert, das heißt mit noch mehr Vernunft ausgestaltet, als es im Menschen hat. Dadurch wurde die Welt zu einer Einrichtung von unendlicher Weisheit.
Die wahrhaft moderne Weltanschauung kann nichts mehr von alten religiösen Vorstellungen in sich aufnehmen.
Ihre Grundlage hat schon Schiller ausgesprochen, als er Goethes Naturanschauung in seinem Briefe an diesen kennzeichnete: «Von der einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu der mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, naturgemäß aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen.» Wenn der Mensch sein Dasein aus etwas hervorgehen lassen will, so kann er es nur aus der Natur selbst hervorgehen lassen. Der Mensch ist aus der Natur nach ewigen, ehernen Gesetzen gebildet; aber er ist noch in keiner Weise, weder als Gott noch als anderes Geistwesen, in der Natur schon gelegen. Alle Vorstellungen, welche sich die Natur beseelt oder vergeistigt vorstellen (z.B. Paulsens u. a.), sind Rückfälle in alte theologische Ideen. Der Geist ist entstanden, nicht aus der Natur herausentwickelt. Dies muß erst begriffen sein, dann kann das Denken sich über diesen innerhalb der Naturordnung entstandenen Geist eine Anschauung bilden. Eine solche Weltanschauung kann erst von einer wirklichen Freiheit sprechen. Das habe ich in meiner «Philosophie der Freiheit», und in meinem Buche «Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahrhundert» eingehend gezeigt. Ein Geist, der aus einem anderen Geiste herausentwickelt wäre, müßte von dem letzteren, von dem Gottes- oder Weltgeiste, auch seine sittlichen Ziele und Zwecke erhalten; ein Geist, der aus der Natur entstanden ist, setzt sich Zweck und Ziel seines Daseins selbst, gibt sich selbst seine Bestimmung. Eine wahre Freiheitsphilosophie kann nicht mehr mit Adolf Harnack davon sprechen, daß das Wissen dem Leben keinen Sinn zu geben vermag; sie zeigt vielmehr, daß der Mensch durch Natur-notwendigkeit entstanden ist, daß er allerdings keinen vorherbestimmten Sinn mitbekommen hat, daß es aber an ihm selbst liegt, sich einen Sinn zu geben. Die alten Weltanschauungen
stehen mit den alten ökonomischen Ordnungen, aber sie werden auch mit diesen fallen. Der ökonomisch befreite Mensch wird auch als wissender und sittlicher ein freier sein; und wenn die ökonomische Ordnung allen Menschen ein menschenwürdiges Dasein bringen wird, dann werden sie auch eine Weltanschauung zu der ihrigen machen, die den Geist ganz befreit.
WILLIAM SHAKESPEARE Berlin, 6. Mai 1902
Einem Ausspruch des berühmten Schriftstellers Georg Brandes gemäß muß man Shakespeare den deutschen Klassi-kern hinzurechnen. Und wenn man den außerordentlichen Einfluß bedenkt, den Shakespeare, nachdem er in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Deutschland, besonders durch Lessing wieder bekanntgeworden war, auf Goethe, Schiller, auf die ganze Entwickelung der deutschen Literatur genommen hat - besonders nach der ausgezeichneten Über-tragung seiner Werke durch Schlegel und Tieck -, muß man diesem Ausspruche zustimmen.
Es hat sich über Shakespeare eine ganze Legende gebildet; über jedes einzelne seiner Werke sind ganze Bibliotheken geschrieben worden. Die Gelehrten haben alles mögliche in seine Werke hineingelegt und herausgelesen. Schließlich ist eine Anzahl von Schriftstellern, die den nicht gelehrt gebildeten Schauspieler für unfähig hielten, alle die Gedanken zu erzeugen, die sie in den Werken Shakespeares fanden, auf die Hypothese verfallen, daß nicht der Schauspieler vom Globe-Theater, William Shakespeare, die Werke geschrieben habe, die seinen Namen tragen, sondern irgendein bedeutender hochgelehrter Mann, etwa Lord Francis Bacon von Verulam, sei der Dichter, der - bei der niedrigen Schätzung der literarischen Tätigkeit in damaliger Zeit
- den Namen des Schauspielers geborgt habe. Diese Annahmen stützen sich darauf, daß man keine Manuskripte von Shakespeares Hand gefunden habe; dann auf ein in einer Londoner Bibliothek entdecktes Notizheft, in dem
man einzelne Stellen finden wollte, die gewissen Stellen in Shakespeares Werken entsprechen und so weiter.
Ein Zeugnis aber für die Autorschaft Shakespeares sind seine Werke selbst. Seine Dramen sprechen davon, daß sie von einem Manne geschrieben sind, der das Theater auf das genaueste kannte, für die schauspielerische Wirkung das feinste Verständnis hatte.
Es entsprach nur einer allgemeinen Sitte der damaligen Zeit, wenn Shakespeare selbst keine Ausgabe seiner Werke veranstaltete. Kein einziges seiner Dramen ist bei seinen Lebzeiten gedruckt. Die Stücke wurden ängstlich gehütet vor dem Bekanntwerden durch den Druck; die Leute sollten ins Theater kommen, um dort die Stücke zu sehen, nicht sie zu Hause lesen. Alles, was etwa damals entstehen konnte, waren Raubdiucke, die mit Hilfe der damals aufkommenden Stenographie während der Vorstellung nachgeschrieben wurden, und so nicht den authentischen Text, sondern mannigfache Verstümmelungen und Fehler enthielten.
Diese teilweisen Lücken und Fehler haben einzelne Forscher dazu geführt, zu behaupten, daß die Werke Shakespeares, so wie sie vorlägen, gar keine besonderen Kunstwerke seien, sondern daß sie ursprünglich ganz anders zusammengestellt gewesen seien. Ein Vertreter dieser Ansicht ist Eugen Reichel, der in dem Dichter der Shakespeare-Dramen den Vertreter einer bestimmten Weltanschauung glaubt sehen zu dürfen. Demgegenüber bleibt aber doch bestehen, daß diese Dramen, so wie sie sind, solch außerordentlichen Eindruck machen. Bei Werken, von denen wir bestimmt wissen, daß sie verstümmelt sind, wie zum Beispiel bei «Macbeth», sehen wir diese hinreißende Wirkung. Einen Beweis dafür bot die Auffährung von «Heinrich V.» bei der Eröffnung des Lessing-Theaters unter der Direktion
Neumann-Hofer, die trotz spottschlechter Übersetzung und nicht guter Aufführung einen gewaltigen Eindruck hervorrief.
Die Dramen Shakespeares sind in erster Linie Charakterdramen. Nicht hauptsächlich in der Handlung, sondern in der großartigen Entwickelung der einzelnen Charaktere liegt das gewaltig Interessierende dieser Dichtungen. Gerade darin, daß der Dichter einen menschlichen Charakter vor uns hinstellt, ihn sich vor uns ausleben läßt, ihn schildert in all seinem Denken, seinem Empfinden, in dem Darstellen einer einzelnen Persönlichkeit.
Diese Kunstentwickelung, die in Shakespeare ihre Vollendung erreichte, war erst möglich durch die vorhergegangene Kulturentwickelung der Renaissanceperiode. Erst durch die aus dieser Renaissancekultur sich ergebende höhere Bewertung der Einzelpersönlichkeit, war das Charakterdrama Shakespeares möglich. Im früheren Mittelalter sehen wir selbst bei Dante, trotz all seiner starken Persönlichkeit, doch im Grunde den Ausdruck der christlichen Ideen, wie sie sich damals darstellten. Der christliche Typus seiner Zeit trat in den Vordergrund gegenüber dem Einzelpersönlichen. Es lag dies eben in der allgemeinen Auffassung. Das christliche Prinzip hatte kein Interesse an der einzelnen Persönlichkeit. Erst allmählich bildete sich unter der neuen Anschauungsweise das Interesse am einzelnen Menschen heraus.
Der Umstand, daß Shakespeares Ruhm sich so bald verbreitete, beweist, daß er eine Zuhörerschaft fand, die ein großes Theaterinteresse besaß, also Sinn und Verständnis in reichem Maße mitbrachte für die Darstellung der Persönlichkeit, wie sie Shakespeare ihnen bot. Es ist Shakespeare eben auf diese Charakterdarstellung angekommen; ihm lag es fern, seinen Zuhörern eine ethische oder moralische
Idee zu entwickeln. Die Idee einer tragischen Schuld beispielsweise, mit der Schiller glaubte seinen Helden belasten zu müssen, um seinen Untergang zu rechtfertigen, lag Shakespeare vollständig fern. Er läßt die Ereignisse sich entwickeln, so wie sich Naturvorgänge abspielen, folgerichtig eines aus dem anderen hervorgehend, doch nicht von dem Gedanken an Schuld und Sühne beeinflußt. Es würde schwer sein, einen Schuldbegriff in diesem Sinne bei einem der Shakespeare-Dramen nachzuweisen.
Auch nicht um die Darstellung einer Idee war es Shakespeare zu tun, nicht die Eifersucht im «Othello», nicht den Ehrgeiz im «Macbeth», nein, den bestimmten Charakter des Othello, des Hamlet, des Macbeth wollte er darstellen. Dadurch gerade konnte er so große Charaktere schaffen, weil er seine Gestalten nicht mit einer Theorie beschwerte. Er kannte die Bühne von Grund aus, er wußte, wie ein Vorgang sich wirksam darstellte, und gerade er als Praktiker konnte den Vorgang so entwickeln, daß er die Hörer mit sich fortriß. - Es gibt keine Dramen in der ganzen Weltliteratur, die so sehr vom schauspielerischen Standpunkt aus gedacht sind. Das sichert dem Schauspieler Shakespeare den Ruhm, diese Dramen gedichtet zu haben.
Shakespeare wurde im Jahre 1564 in Stratford geboren, sein Vater war ein wohlhabender Bürger, und er besuchte die Lateinschule seiner Heimatstadt. Um sein Jugendleben haben sich vielfach Legenden gebildet; man behauptet, er sei ein Wilddieb gewesen und habe ein Abenteurerleben geführt. All das ist auch gegen die Autorschaft Shakespeares geltend gemacht worden, und doch ist all das gerade seiner Dichtung zugute gekommen. Schon der Umstand, daß er, zwar mit einer guten Bildung ausgerüstet, doch von dem eigentlichen Studium verschont geblieben war, sicherte ihm die Möglichkeit, den Dingen viel freier und unbefangener
gegenüberzustehen, sie unbeschwert von dem Wust der Büchergelehrsamkeit zu sehen. Und gerade aus der Abenteurernatur des Dichters erklären sich einige der größten Vorzüge seiner Werke. Der kühne Flug der Phantasie, der jähe Wechsel der Begebenheiten, die Leidenschaft und Kühnheit, all das spricht für einen Menschen, der auch im Leben viel herumgeworfen worden war, der selbst ein bewegtes Leben geführt haben mußte.
Nachdem die Vermögensverhältnisse von Shakespeares Vater sich verschlechtert hatten, kam Shakespeare im Jahre 1585 nach London. In der denkbar untergeordnetsten Tatigkeit begann er seine Laufbahn beim Theater; er hielt die Pferde der Theaterbesucher, während diese der Vorstellung beiwohnten. Später rückte er zum Aufseher einer Anzahl solcher Pferdejungen auf, bis er endlich auf der Bühne selbst Verwendung fand und im Jahre 1592 seine erste größere Rolle spielen durfte.
Nun breitete sich sein Ruhm bald aus: als Schauspieler, als Theaterdichter; mit ihm wuchs sein Wohlstand, so daß er im Jahre 1597 schon ein Haus in Stratford kaufen konnte. Besonders, nachdem er Mitbesitzer des Globe-Theaters geworden war, wurde er zu einem sehr wohlhabenden Mann.
Die Dramen der ersten Periode Shakespeares «Verlorene Liebesmüh», «Wie es euch gefällt», einige der Königsdramen sind noch nicht so wesentlich verschieden von anderen Dramen der gleichen Zeit, wie sie von Marlowe und anderen geschaffen wurden; auch wurde noch die Kraft des Ausdrucks, die Reinheit und Natürlichkeit durch eine der damaligen Mode entsprechende gewisse Künstlichkeit der Sprache beeinträchtigt. Erst allmählich folgten dann die großen Charakterdramen: «Othello», «Hamlet», «Macbeth», «König Lear», «Julius Cäsar», «Coriolan», die für alle
Zeiten den Ruhm Shakespeares begründen sollten. Aus einer Anzahl seiner letzten Werke wollen dann einige seiner Biographen und Schilderer auf trübe Erfahrungen und Erlebnisse schließen, die der Dichter in jener Zeit gehabt, und die ihn zu einer bitteren Lebensauffassung geführt hätten. Doch ist eine solche Folgerung bei Shakespeare gerade sehr schwer zu begründen, da er wie kein anderer Dichter hinter seinen Figuren zurücktritt. Nicht was er über eine Sache denkt, bringt er durch den Mund seiner Gestalten zum Ausdruck, sondern er läßt jede einzelne ihrem Charakter gemäß denken und handeln.
Müßig erscheint daher auch die Frage, welchen Standpunkt Shakespeare selbst den verschiedenen Fragen gegenüber einnahm. Nicht Shakespeare... Hamlet grübelt über Sein oder Nichtsein; er erschrickt vor dem Geiste des Vaters, wie Macbeth vor den Hexen auf der Heide. Ob Shakespeare an Hexen, an Geister geglaubt, ob er ein Gläubiger, ein Freigeist gewesen, es kommt hierbei gar nicht in Betracht. Er stellte sich die Frage: Wie muß ein Geist, eine Hexe auf der Bühne sich darstellen, um die Wirkung auf den Zuhörer auszuüben, die er beabsichtigte. Und daß die Wirkung der Shakespeareschen Gestalten bis heute die gleich große geblieben ist, beweist eben, wie er sich diese Frage beantwortete.
Dabei darf nicht vergessen werden, daß eigentlich die Verhältnisse unserer heutigen Bühne der Wirkung der Shakespeareschen Dramen nicht besonders günstig sind. Der Wert, der heute auf die Ausstattung, auf allerlei Beiwerk gelegt wird, der häufige Szenenwechsel, all das beeinträchtigt die Wirkung der Charakterschilderung, die eben die Hauptsache bleibt. Zu Shakespeares Zeiten, als man eine Änderung der Szene einfach durch eine ausgehängte Tafel andeutete, als ein Stuhl und Tisch für die Ausstattung
eines königlichen Palastes genügten, mußte in dieser Hinsicht die Wirkung eine noch bedeutend größere sein.
Während aber bei einem heutigen Dichter so unendlich vieles in der Aufführung von all dem Beiwerk abhängt - wie ja auch heute die Dichter meist ganz genau die Ausstattung der Räume und so weiter bis in alle Details vorschreiben, so daß bei einer schlechten Aufführung die Wirkung vollständig versagt -, wirken Shakespeares Dramen gewaltig auch in der mangelhaftesten Aufführung.
Und wenn eine Zeit kommt, in der wir wieder mehr auf das Wesentliche sehen, als es heute der Fall ist, dann wird die Wirkung von Shakespeares Kunst eine immer gewaltigere werden: durch die Kraft der Charakterschilderung, in der sie durch die Jahrhunderte lebendig und unerreicht geblieben ist.
ÜBER RÖMISCHE GESCHICHTE Berlin, 19. Juli1904
Wir haben gesehen, daß etwa achthundert Jahre vor dem Beginn unserer Zeitrechnung von Rom aus ein Reich sich ausbreitete, das ursprünglich seinen Ausgang genommen hat von einer Art von Priesterkönigtum; wie dieses Priesterkönigtum dann übergegangen ist durch etwa zweieinhalb Jahrhunderte in eine Republik. Dann sehen wir den römischen Staat durch fünf Jahrhunderte hindurch sich ausbreiten über die ganze damals in Betracht kommende Welt. Wir sehen also etwa siebenhundert Jahre vor Christi Geburt in Rom einen König herrschen, welcher bekleidet ist zu gleicher Zeit mit der höchsten damaligen priesterlichen Würde. Dieses Amt hat sich erhalten. Der Träger desselben, dem damals die Königswurde mit zukam in den älteren Zeiten, bevor es weltliche Könige in Rom gab, hieß Pontifex Maximus. Einen Pontifex Maximus sehen wir also an der Spitze des römischen Staates stehen, im Aufgange dieses Staates. Wir sehen dann, wie die Würde des Pontifex Maximus allmählich herabgedrückt wird, so daß ihm nur noch die priesterlichen Formen verbleiben. Wir sehen, daß der Rex, der König noch besteht, der aber eigentlich nur noch ein Schatten der ursprünglichen Persönlichkeit ist. Nun sehen wir die Republik immer mehr und mehr sich ausdehnen und in der Zeit, in der im Osten das Christentum gestiftet wird, sehen wir in Rom wieder eine Persönlichkeit alle Gewalt, alle Macht in Händen haben in dem Kaiser Augustus. Er findet es angemessen, notwendig damals, sich übertragen zu lassen, neben anderen Ämtern der
Republik, die Würde des Pontifex Maximus. So haben wir im Anfange unserer Zeitrechnung in Rom wieder den Pontifex Maximus mit der höchsten Gewalt. Aber das ist ein Pontifex Maximus, ein Oberpriester, dessen Gewalt nicht auf dem Priesteramt, sondern dessen Gewalt einzig und allein auf seiner weltlichen Macht beruht.
Und wir sehen wenige Jahrhunderte, etwa fünfhundert Jahre darnach, diese weltliche Macht des römischen Gewalthabers vollständig vernichtet. Dafür aber sehen wir wieder einen Pontifex Maximus, einen Oberpriester, einen römischen Bischof, den späteren Papst, der wieder die Würde des Pontifex Maximus trägt. Und etwa im Jahre 800 n. Chr. empfing derjenige Fürst, der am meisten genannt wird, der herrschte über diejenigen, die den weltlichen Pontifex Maximus in Rom gestürzt haben, die weltliche Königskrone von diesem Pontifex Maximus. Er unterwarf die weltliche Herrschaft vollständig der priesterlichen Herrschaft, der priesterlichen Gewalt. Und nun beginnt das römische Reich, das Heilige Römische Reich.
So sehen wir eine Wandlung in der Geschichte sich vollziehen. Wir sehen, das einzige was geblieben ist, was sich fortgepflanzt hat, das ist die Würde des Oberpriesters in Rom. Ringsherum haben sich Wandlungen von einer weltgeschichtlich einschneidenden Bedeutung vollzogen, die man auch einmal von einem höheren Gesichtspunkt aus überblicken muß, um sie vollständig zu verstehen.
Wir werden uns vor allen Dingen fragen müssen: wie hat sich diese Wandlung vollzogen in dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt stehen, in dem das Christentum seinen Anfang genommen hat, also im Anfange unserer Zeitrechnung? Wie ist es gekommen, auf der einen Seite, daß ein weltlicher Machthaber die ganze Herrschaft über die damalige Welt hatte, und daß diese ungeheure Macht vollständig zerstört
war wenige Zeit hernach; daß das Volk, auf dem diese Macht beruht hat, aufgehört hat eine Rolle zu spielen, eine Macht zu sein? Wie kommt es, daß fünfhundert Jahre nach dem Beginn unserer Zeitrechnung das römische Kaisertum zerstört war, und daß in Rom der römische Priester als ein Fürst saß, mit ebensolcher Macht über die Seelen, wie sie einstmals der römische Kaiser, der Cäsar, in weltlicher Beziehung hatte?
Zwei große Strömungen sind es, die das bewirken, zwei Strömungen von einer Wichtigkeit und einer Bedeutung, wie sie wenige in der Geschichte haben. Es ist auf der einen Seite die Ausbreitung des Christentums von Osten her, und auf der anderen Seite sind es die wandernden Kriegs-züge der Germanen. Das römische Reich wird von zwei Seiten bedroht: in geistiger Beziehung von Osten und in weltlicher Beziehung von Norden. Alles das, was früher die Größe des Römerreiches ausgemacht hat, war nicht mehr da in einer gewissen Beziehung. Aber etwas anderes war da. Es waren die äußeren Formen dieses römischen Reiches geblieben. Es war dasjenige geblieben, was die eigentliche Bedeutung dieses römischen Reiches ausmachte, das was ursprünglich die Größe des römischen Weltreiches bedingte. Es war das römische Denken, die römische Weltanschauung in bezug auf die äußeren Einrichtungen geblieben. Wir werden sehen, bis zu welchem Grade diese erhalten geblieben sind. Zwar war aller frühere Inhalt aus diesem Reiche ausgetrieben. Aber die bloße Form, das äußere Kleid war geblieben. Und hineingegossen in diese Form war etwas anderes, nämlich das Christentum, das jetzt in denselben Formen auftritt wie das römische Kaisertum. Das, worauf die Herrschaft der Römer beruhte, das hatten die nordischen Völkerschaften zerstört. Es ist das eine eigentümliche Geschichte, denn es ist vom römischen Reiche mindestens soviel
geblieben als zugrunde gegangen ist. Und was davon geblieben ist, davon erzählt die Geschichte der katholischen Kirche, was davon ferner geblieben ist, das erzählt das, was wir täglich erleben können. Gehen Sie in einen Gerichtssaal und sehen Sie, wie da angeklagt, verteidigt und Recht gesprochen wird. Das ist das römische Recht. Dieses Recht ist in Rom geschaffen worden und heute noch vorhanden. Wir leben in Einrichtungen, welche ganz durchsetzt sind von Anschauungen dieses römischen Reiches. Alles, was wir noch denken von Rechts-, Eigentums- und Besitzverhältnissen, was wir denken über Familienverhältnisse und so weiter, das führt seinem Ursprung nach, wenn wir es entwickelungsgeschichtlich verfolgen, auf das alte römische Reich zurück, trotzdem das Volk, aus dem das alles hervorgegangen ist, fünfhundert Jahre nach Christi Geburt seine äußere Macht und Bedeutung in der Weltgeschichte verloren hat.
Wir haben die Ausbreitung Roms über den Erdkreis beschrieben, wir haben gesehen, wie von diesem damaligen Weltmittelpunkt aus Rom in alle bekannten, damals in Betracht kommenden Länder seine Herrschaft ausdehnte. Wir haben aber auch gesehen, worauf eigentlich die Möglichkeit beruhte, daß Rom so mächtig wurde. Wir haben das römische Volk nach und nach in seiner ganzen Entwikkelung betrachtet, und wir haben gesehen, daß mit einer gewissen Notwendigkeit aus der ganzen Anlage und dem ganzen Charakter dieses Volkes, sich die Art entwickelte, wie dieses Volk seine Weltherrschaft begründete. Wir haben zu gleicher Zeit gesehen, wie gerade aus dieser Art zuletzt der Verfall der römischen Weltherrschaft hervorgehen mußte, und dieser hängt so innig zusammen mit der Entstehung, daß wir dieselben Gedanken gebrauchen müssen, die wir gebrauchten, als wir von der Entstehung sprachen. Wir haben
gesehen, daß der römische Grundbesitz, in unermeßlicher Gier erworben, den Reichtum ins Unermeßliche stei-gern und dagegen auf der anderen Seite eine Armut, ebenso ins Unermeßliche gesteigert, hervorbringen mußte, so daß wir auf der einen Seite Luxus und Reichtum und auf der anderen Seite Unzufriedenheit sehen.
Wir haben auch gesehen, worauf alles das beruhte, wodurch Rom groß geworden ist. Wir haben gesehen, was es hieß, ein römischer Bürger zu sein. In diese Denkweise müssen wir uns hineinversetzen. Wir haben gesehen, wie die Cives, die römischen Bürger, ihr Interesse am Staate hatten, wie jeder römische Bürger sich berufen fühlt mitzureden, mitzuraten, wie also die Stimme des einzelnen in Betracht kam. Das drückt sich darin aus, wie in Rom regiert wurde, wie die sämtlichen Ämter so aufgefaßt wurden, daß die Regierungsgewalt in den Händen der gesamten Bürgerschaft lag. Diejenigen, welche während der republikanischen Zeit der Römer das Reich verwalteten, waren nichts anderes als Verweser der bürgerlichen Gewalt. Übertragen war ihnen für Jahresfrist, aber auch für andere Fristen, das, was die Bedeutung ihres Amtes ausmachte. Niemals dachte ein römischer Bürger anders als daß das, was der Prätor tat, eigentlich ihm zugut kommt und daß jener es nur in seiner Vertretung tat. Als Stellvertreter sah der Römer den Konsul, den Quästor, den Prätor an. Und worauf beruhte dieses? Es beruhte darauf, daß die denkbar kürzesten Wahlperioden eingeführt waren, so daß im Grunde genommen niemals einer ein Amt längere Zeit inne hatte. Etwas anderes als Vertrauen zwischen denjenigen, die gewählt waren, und denjenigen, die wählten, war nicht vorhanden. Es konnte ein Mißtrauen zwischen einer regierenden Persönlichkeit und dem Volke nicht geben. Es konnten Zwischenfälle vorkommen während der kurzen Regierungszeit eines
Tribuns, aber im großen und ganzen war diese Regierung ganz auf das Vertrauen aufgebaut. Es war eine übertragene Gewalt, und der Römer verstand das. Er verstand, was das heißt, daß er der Herr ist und der andere, dem die Regierungsgewalt übertragen war, diese nur in Vertretung führte. Das geht daraus hervor, wie der Römer das Glied eines Rechtsvolkes war. Erst in späterer Zeit wurde es etwas anders. Versuchen Sie heute einmal einen Gebildeten - er kann sogar sehr gebildet sein - zu fragen, welches der juristische Unterschied ist zwischen dem Begriff «Eigentum» und dem Begriff «Besitz». Das sind zwei Begriffe, die aus dem römischen Recht stammen. Ich bin überzeugt, Sie können weit herumgehen, selbst bei Leuten, die viel gelernt haben, und man wird Ihnen den Unterschied kaum sagen können. Hätten Sie einen römischen Bauern gefragt, der hätte ganz gewiß gewußt den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. So wie man im Mittelalter die Zehn Gebote gelernt hat, so hat jeder römische Knabe die zwölf Gesetzestafeln schon in der Schule gelernt. Die Römer waren ein Rechtsvolk, und in Fleisch und Blut ging ihnen das Recht über.
Nun dehnte sich aber die römische Herrschaft über unermeßliche Gebiete und viele Provinzen aus. Sie können sich denken, daß ein solches Staatsgefüge nur so lange zusammenhalten kann in der Weise, wie wir es kennengelernt haben, als es eine bestimmte Größe nicht übersteigt. In dem Augenblicke aber, wo die vielen Provinzen erobert worden waren, konnte das nicht mehr so sein. Es tauchte der Unterschied zwischen dem römischen Urstaat und den Provinzen auf. Das römische Bürgerrecht wird den Provinzen versagt. Die Provinzen haben keine Rechte, sie sind Unterjochte. Das geht Hand in Hand mit den übrigen Entwickelungsstadien, mit der Ausdehnung des Großgrundbesitzes
und den damit verknüpften Problemen der Vererbung. Es geht Hand in Hand mit dem Heraufkommen eines ungeheuren Proletariats. Das Überhandnehmen des Proletariats hängt damit zusammen, daß das alte Bürgerheer sich allmählich verwandelte in ein Heer von Söldnertruppen, welche einzelne führende Persönlichkeiten wie Marius und so weiter anwarben. So sehen wir, daß neben dem alten römischen Bürger sich entwickelte eine Art von Militärmacht, die demjenigen gefügig ist, der gerade die Gunst dieser Militärmacht erringen kann. Wir sehen ferner, daß Menschen wie Gracchus bemüht sind, den Untergang des römischen Reiches dadurch aufzuhalten, daß sie eine Art von Mittelpartei schaffen wollen. Ich habe Ihnen die Gracchen-Bewegung ja geschildert. Jetzt hat noch das Bedeutung, daß der jüngere Gracchus eine Mittelpartei hat schaffen wollen. - Diese sollte aus solchen Leuten bestehen, die Senatoren waren und ausgetreten sind. Es war also eine Art von Ritterschaft. Diese Ritterschaft war es, die von den Proletariern befeindet worden war.
Nun hatte sich etwas ganz Besonderes in Rom zugetragen in der Zeit, in der die Cäsarenmacht heraufkam. Diese Ritterschaft sollte eine Macht bilden gegen die großen Grundbesitzer, gegen die sogenannten Optimaten. Es sollten die alten Ackergesetze erneuert werden. Niemand sollte mehr als fünfhundert Morgen Land haben, höchstens noch für erwachsene Söhne zweihundertfünfzig Morgen dazu, jedenfalls höchstens tausend Morgen. Der andere Boden sollte als kleinere Besitzungen diesem Mittelstande übergeben werden. Dadurch glaubte man eine Mittelschicht zu schaffen zwischen den Großgrundbesitzern und dem Proletariat. Das ist aber mißglückt, weil das Proletariat mißtrauisch geworden war und weil es eine Partei zwischen sich selbst und den eigentlichen Besitzern nicht dulden wollte.
Die Mittelpartei schlug sich zuletzt auch zu den Optimaten. Dadurch haben wir also jetzt das Proletariat auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Art von Ordnungspartei. Das hat sich herausgebildet in der letzten Zeit. Die republikanische Gewalt ist ganz allmählich, fast unbemerkt in die cäsarische Gewalt übergegangen. Octavius, der römische Kaiser, war selbst eine Art von republikanischem Machthaber, und er hat sich nach und nach zu der - man kann nicht sagen - Würde aufgeschwungen, denn ganz mit Notwendigkeit ging aus den römischen Verhältnissen diese eigentümliche Machtfülle des Octavius-Augustus hervor. Er hat einfach die alten römischen Verhältnisse fortgesetzt, hat sich alle die Ämter nach und nach übertragen lassen. Und daß er imstande war als eine Art von Alleinherrscher diese Ämter auszufüllen, kam davon her, daß der Unterschied zwischen den römischen Verhältnissen und denen in der Provinz draußen ein so großer geworden war. In der Provinz hatte man längst in einer Art edelmännischer Weise regiert. Das hatte den römischen Bürgern gar nicht widerstrebt. Sie fühlten sich als römische Bürger, und es war ihnen gar nicht darum zu tun, daß die draußen in der Provinz dasselbe Recht hätten wie sie. So war man damit zufrieden, daß sich von Rom aus eine Art absoluter Regierungsgewalt gegenüber der Provinz entwickelte. Namentlich ließen die römischen Alleinherrscher sich alle die sogenannten prokonsularischen Gewalten in den Provinzen übertragen. So ist es gekommen, daß die ersten Konsuln Herrscher ganz eigener Art und Kraft waren. In Rom wußten sie aufrechtzuerhalten die Gewalt, die ihnen übertragen war wie in früherer Zeit, und draußen im Sinne eines zum Staate Halten der Provinzen. So entwickelte sich, man kann sagen mit Übereinstimmung der römischen Bürgerschaft, die römische Gewalt.
Und dann kam während der Cäsarenzeit das Folgende. Es war tatsächlich so, daß durch die absolute Gewalt in den Provinzen die Cäsaren sich die gesamte Steuereinrichtung angeeignet hatten und die gesamte Militärgewalt. Daher kam es, daß sie ungeheure Einkünfte aus den Provinzen zu ziehen vermochten. So entwickelte sich neben dem römischen Staatsfiskus eine Art von kaiserlichem Fiskus. Und mit der oktavianischen Gewalt entwickelte sich dann die römisch-cäsarische Alleinherrschaft in der folgenden Art:
Es waren die römischen Bürger, welche übereinkamen, alles das, was in der Provinz zu tun war, nicht mehr zu leisten mit der römischen Staatskasse. Es waren oft Dinge, die notwendig geworden waren. Aber auch diese waren nicht mehr aus der Staatskasse zu bezahlen. Die Einkünfte flossen nämlich nicht in die Staatskasse, sondern in die Kasse der Cäsaren. Und so kam es, daß sich die Cäsaren zu einer Art von Wohltätern aufwerfen konnten. Dadurch entwickelte sich die cäsarische Gewalt und Macht, und alle übrigen Ämter mußten zu einer Art von Schattenämtern zusammensinken. Von innen heraus eroberte die römische Cäsarenmacht die Macht im Staat. Und so begreifen wir es auch, daß im Grunde genommen nur die ersten Kaiser echte Römer waren. Wir begreifen, daß später im Grunde genommen nicht mehr wirkliche Römer auf dem Stuhle der Cäsaren saßen, sondern Leute, die in den Provinzen gewählt worden waren, und die so wie Hadrian und Caracalla die Herrschaft an sich reißen konnten. Vom Umkreis aus wurde Rom dem Absolutismus zugeführt. So ging durch eine Art innerer Notwendigkeit der Entwickelung das, was auf die römischen Bürger verteilt war, in die Hände eines Alleinherrschers über. Es wird nun ganz selbstverständlich, daß das ganze römische Rechts- und Begriffssystem sich überträgt auf den einen inneren Mittelpunkt.
Was früher die römischen Bürger besorgt haben, besorgen jetzt einzelne Beamte, und nicht bloß in den Provinzen, sondern auch in Rom selbst.
Da geht etwas vor, was man verstehen muß, wenn man die Zeit richtig verstehen will. Blicken wir einen Augenblick zurück nach Griechenland und nach Rom in der Zeit des alten Königtums, da werden wir sehen, daß überall mitspricht ein unmittelbares Verhältnis der Regierenden zu den Regierten. Sei nun dieses Vertrauensverhältnis in dieser oder jener Art gebildet, es war von den älteren Zeiten an, von denen wir bei der letzten Geschichtsbetrachtung ausgegangen sind, ein natürliches Verhältnis, weil sie in dieser oder jener Weise von den Regierten anerkannt waren, so daß man an sie glaubte. Im Prinzip war es so. Derjenige, welcher regierte, mußte gewisse Eigenschaften sich erwerben, namentlich in den älteren Priesterstaaten. Da glaubte niemand an jenseits der Welt schwebende göttliche Mächte. Aber man glaubte an eine Art Vergöttlichung des Menschen, weil man in dem Menschen das Entwickelungsprinzip suchte. Man erkannte den Priesterkönig in Rom nur dann an, wenn er sich geistige und moralische Eigenschaften der Götter erworben hatte, wenn er sich innerlich dahin entwickelt hatte. Man konnte sich das erwerben, man konnte es dahin bringen, eine Art vergöttlichter Person zu sein, die Verehrung verdiente. Es war kein Unterwürfigkeitsverhältnis, es war Vertrauen. Das muß jeder sagen, der die Dinge kennt. Das beruhte auf etwas, das immer da war im Herzen und es pflanzte sich auch noch fort in der Republik.
Aber bei der Art und Weise, wie sich das römische Recht entwickelt hat, war es geeignet dieses persönliche, lebendige Verhältnis von Regierenden und Regierten vollständig auszulöschen. Es war geeignet anstelle des persönlichen ein
abstraktes, gedachtes Verhältnis zu setzen. Wenn Sie in diese Zeiten Roms zurückgehen könnten, so würden Sie sehen, daß der, welcher als Prätor zu Rom zu Gericht saß, wenn er auch die zwölf Tafelgesetze vor sich hatte, er doch durch die persönliche Einsicht etwas tun konnte, was auf Vertrauen beruhte. Es hing da von der Persönlichkeit noch etwas ab. Das wurde später ganz anders. Später wurde das ganze Rechtssystem allmählich zu dem rein abstrakten Gedankensystem. Es kam lediglich darauf an, das Gesetz seinen Paragraphen nach durch logische Schärfe auszulegen. Der Jurist sollte ein bloßer Denker sein, ein bloß logisch geschulter Mann. Allein auf das Denken kam es an. Nichts vom unmittelbaren Leben sollte da einfließen, nichts vom Gemüt und nichts von persönlichem Einfluß. Nur an den Buchstaben sollte man sich halten. Und nach dem Buchstaben wurde immer mehr und mehr das Gesetz ausgelegt. Nur Beamte waren es, die den Buchstaben draußen in den Provinzen und später auch in Rom zu handhaben hatten. Da handelte es sich darum, die Paragraphen zu studieren und abgesehen von jedem unmittelbaren Leben lediglich durch Gedanken - und das ging herüber bis in die sophistischen Gedanken - zu entscheiden. Die ganze Denkweise, die sich in der Verwaltung und Regierung ausdrückte, hatte etwas angenommen, das die ganzen Einrichtungen wie ein Rechenexempel behandelte. Das müssen Sie festhalten, dann werden Sie verstehen, was es heißt, wenn man sagt, daß das ganze römische Leben sich verwandelt hatte in ein Dogmensystem. Der römische Staat, der ein Recht geschaffen hatte aus dem freien Entschluß, aus der Seele der Bürger heraus, der hatte es allmählich verwandelt in Dogmen.
Zur Zeit der Entstehung des Christentums kam keine persönliche Regierung mehr in Betracht, sondern nur geschriebenes Gesetz. Es war ein richtiges Dogmenrecht. Die
Cäsaren konnten da und dort her genommen werden, alles das, worauf es für sie ankam, war, den ganzen Staat in ein Rechtssystem einzuzwängen, das von einem Mittelpunkt aus straff gespannt werden konnte. Der ganze römische Staat wurde allmählich dogmatisiert. Wir sehen ihn eingeteilt in kleinere Gebiete, an deren Spitze Verwaltungsbeamte juristischer Art standen. Diese Gebiete wurden wieder zusammengefaßt zu Diözesen. So sehen wir den römischen Staat allmählich eine Form annehmen, die wir später wieder erblicken in der Einteilung, die die katholische Kirche angenommen hat. Nicht das Christentum hat diese Formen geschaffen; das ist ganz nach der Schablone des romisch-dogmatisierten Staates geschehen.
In diesen Staat hinein, mit dem ganzen Aussehen, das Sie jetzt kennen, verpflanzte sich das Christentum von Osten herüber. Da müssen wir freilich auf Persönlichkeiten eingehen. Wir können aber nicht auf einzelne römische Kaiser eingehen. Im Grunde genommen ist diese Geschichte auch ziemlich langweilig. Es genügt vielleicht, wenn wir Caligula - Kommißstiefelchen - erwähnen. Aber eines ist wichtig. Wir müssen uns klarmachen, was mit oder aus der römischen Kultur geworden ist. Diese römische Kultur hatte etwas, was Sie an die Kultur einer anderen Zeit erinnern wird. Ich möchte Ihnen eine Persönlichkeit schildern, die typisch, repräsentativ ist und die sich hier zum Vergleich anführen läßt, das ist Lucian. Er stammte aus Asien und wird eingeführt als ein ganz besonderes Licht. Er erzählt uns selbst von sich in einem bemerkenswerten Werk «Der Traum». Ich erwähne das, nicht weil es ein bedeutendes literarisches Produkt ist, sondern weil es als ein charakteristisches Zeichen für die Denkweise des damaligen römischen Reiches gelten kann. Zwei Frauengestalten erschienen ihm im Traume, die eine war die Kunst, die andere war
die Bildung. Die Kunst verlangte von ihm, daß er nach harter Arbeit strebe. Die Bildung forderte von alledem nichts. Er brauchte sich nur anzueignen ein paar Kunstgriffe, wie man möglichst gut die Leute überreden kann. Und im alten Rom bedeutete reden soviel wie heute Zeitungschreiben. Er sagte sich daher, warum soll ich Phidias nachfolgen, warum dem Homer? Da bleibe ich ja ein armer Kerl. Er folgte der zweiten Frauengestalt und wurde Wanderredner, ein Redner ganz eigentümlicher Art, ein Redner ohne Bildungsgrundlage. Bildung hieß dazumal: ohne etwas zu wissen, ohne ernstlich studiert zu haben, zu den Leuten zu reden so wie man heute in der Zeitung schreibt.
So ging er in die Welt hinaus. Und nun sehen wir, wie er über Religion und Politik redet, wie er auftritt als eine Persönlichkeit, von der die Geschichte nichts meldet, die aber die Rede in einem Gespräch, wie in einem Leitartikel, bis zum Himmel hinauf zu heben vermochte. Überall war er in dieser Weise tätig. Er kam bis nach Frankreich, war eine Persönlichkeit ohne Halt, ohne inneren Gehalt und Inhalt. So war überhaupt die Bildung in diesem damaligen großen römischen Reich beschaffen. Das waren die Gebildeten. Derjenige, welcher einen Kern hatte, wie Apollonius, ein Zeitgenosse des Lucian, der konnte nicht zu einer irgendwie erheblichen Bedeutung kommen. Das war damals ganz unmöglich. Aber das ganze weite Reich seufzte. Es war die Unzufriedenheit und die Sittenlosigkeit, unter denen man litt. Ich kann Ihnen nicht schildern die Art von Vergnügungen grausiger und unmoralischer Art. Ein Drittel des Jahres wurde verbracht mit Gladiatorenspielen, mit Stierkämpfen oder mit Schaustellungen der ausgelassensten Art. Und das breitete sich immer mehr und mehr aus. Wir haben da auf der einen Seite äußersten Luxus und daneben eine Armut und ein Elend, wie es ganz unbeschreiblich ist.
Nun sehen Sie, wie es dazu kam, wie in diesem ganzen römischen Reich ein Element mehr und mehr Ausbreitung gewann, welches sich von allen anderen dadurch unterschied, daß es mehr Ernst hatte, daß es einen tieferen Gehalt hatte. Das war das Judentum. Die Juden konnten Sie im römischen Reiche damals überall finden. Es wäre ganz ungeschichtlich, wenn man glauben wollte, daß damals die Juden nur auf Palästina beschränkt waren. In ganz Nordafrika, in Rom und in Frankreich, überall finden Sie schon damals die Juden ausgebreitet. Jhre Religion war noch viel gehaltvoller als das, was die Bildung der römischen Zeit bot. Sie bestand neben den Strömungen niederer Geistes-art. Dadurch, daß die Römer in alle Welt kamen, breiteten sie auch die Kultus-, die Opferhandlungen, die heiligen Handlungen der verschiedenen Provinzen aus. In Rom konnte man persische, arabische, ägyptische Gottesdienste halten sehen. Das hatte eine ungeheure Veräußerlichung zur Folge.
In der römischen Cäsarenzeit ist die Religion zu einem solchen Grad von Äußerlichkeit gekommen, daß sie sich mit nichts früherem vergleichen läßt. Der Priester der älteren Zeit war eine Art von Eingeweihtem, nachdem er vorher überwunden hatte alles Niedere. Dann nannte man ihn auch eine vergöttlichte Persönlichkeit. Das erreichte man in den verschiedenen Schulen der verschiedensten Länder. Soweit diese Würde erhaben war - sie war eine der heiligsten des Altertums -, so weit war diese nun herabgezogen. Es war so, daß die römischen Cäsaren als sogenannte Eingeweihte verehrt wurden, ja sogar göttlich verehrt wurden. Lucretia erlangte sogar göttliche Verehrung, weil bei ihr, durch äußere Handlungen und Schulung vorbereitet, eine Einweihung vollzogen worden war.
Aber das war ganz äußerlich. Als Augustus den Titel
Pontifex Maximus angenommen hatte, da hatte er äußerlich angenommen alles das, was früher das innerliche Zeichen der Priester war. Dadurch, daß das allen Zusammenhang mit seinem Ursprung verloren hatte, hatte es auch alle Bedeutung und das richtige Verhältnis verloren.
So sah es in Rom aus in der Zeit, als es von Osten herüber eine völlige Erneuerung der religiösen Anschauung bekam. Eine Erneuerung der religiösen Anschauung kam, welche wir ja dem Inneren nach, weil wir ja keine Religionsgeschichte, sondern Allgemeingeschichte vortragen, dem Inhalte nach nicht zu schildern brauchen, aber den äußeren Formen nach schildern müssen. Vor allen Dingen verpflanzte sich eine Weisheitsreligion. Die ersten Verbreiter dieser christlichen Religion waren tatsächlich die gelehrtesten, die tiefsten und bedeutsamsten Männer der damaligen Zeit. Sie hatten zu dem Stifter des Christentums, von dem ganzen Grunde dieser Gelehrsamkeit aus, aufgesehen. Man lese sie nach: Klemens von Alexandrien, Origenes und so weiter, und man wird sehen, was sie an Weisheit in der damaligen Wissenschaftlichkeit geleistet haben. Das alles haben sie in den Dienst dieser neuen Idee gestellt. Alles, was sie versuchen wollten, war nichts anderes als eine völlige Erneuerung des religiösen Gefühls, das gleichzeitig verknüpft war mit einer Durchdringung des ganzen Menschseins.
Nun stellen Sie sich vor, daß, während in Rom drüben alles Äußerlichkeit geworden war, alle Religiosität dem Cäsar wie ein Mantel umgehängt war, und alles unter Beimischung von Spott beredet wurde, wie Lucian es tat, da sollte mit Verzicht auf jegliches Weltliche, bloß aus dem Innersten des Menschen, des menschlichen Gemüts heraus das Religiöse erneuert werden. Und das Religiöse wird so erneuert, daß tief veranlagte, gelehrteste Männer in den
Dienst dieser Idee gestellt sind. Es war so - das darf man nicht verkennen -, daß die Leute des ersten Christentums nicht Leute waren, etwa wie die gewöhnlichen Glieder der Völkermassen, sondern es waren die Gescheitesten jener Zeit. Das verbreitete sich mit Blitzesschnelle, deshalb, weil die ganze Religion nichts von Asketismus, nichts von Jenseitigkeit an sich hatte. Die Menschen im unmittelbaren Alltagsleben griffen sie auf. Alles das, was man als römisch empfunden hatte, alles das, was in Rom zum Luxus, zum Wohlleben geführt hatte, das war dem Kern dieser Religion im Innersten fremd. Was von dem ganzen Menschen, von dem Menschen des Alltags aufgefaßt und eingefaßt worden ist durch dieses Bekenntnis, das sich mit großer Schnelligkeit ausbreitete, das können Sie sehen, wenn Sie die Schilderung des christlichen Prinzips bei Tertullian lesen, der da sagt: Wir Christen kennen nichts, was dem menschlichen Leben fremd ist. Wir ziehen uns nicht zurück von dem Alltagsleben, wir wollen dem Menschen, wie er alltäglich ist, etwas bringen, wir wollen die Welt vertreten, wir wollen das, was in der Welt ist, genießen. Nur wollen wir nichts wissen von den Ausschweifungen Roms.
Und um zu zeigen, wie diese Christen miteinander lebten, wo das römische Imperium noch nicht zerstört hatte die Marktherrschaften, da brauche ich nur die Worte anzuführen aus der Apostelgeschichte, nicht etwa als Predigt und nicht als ermahnendes Wort: «Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch keiner sagte von seinen Gütern, daß sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein . . . Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn, wieviel ihrer waren, die da Acker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Gutes und legten es zu der Apostel Füßen, und man gab einem jeglichen, was ihm not war. Joses aber,
mit dem Zunamen von den Aposteln genannt Barnabas, von Geschlecht ein Levit aus Cypern, der hatte einen Akker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu der Apostel Füßen.» Das ist nicht eine Predigt, das ist eine Schilderung dessen, was man beabsichtigte, und was man auch vielfach verwirklichte. Das war es, was man entgegen-setzte dem römischen Staatsleben. Das war ein Grund, warum das Christentum sich mit solcher Schnelligkeit eingeführt hat. Daher schaltete sich das Christentum so schnell ein in die Herzen derjenigen, welche nichts zu hoffen hatten. Nicht allein das haben sie gehört damals, daß es kein Dogma gibt, das lebendige Wort war es, das lebendige Wirken, was sie empfanden.
Derjenige, welcher sprach, sprach das, was er wußte und als Wahrheit erkannt hatte. Das konnte er heute in der Form und morgen in einer anderen Form sagen. Es gab kein festgestelltes christliches Dogma. Die Gesinnung, das innere Leben, war es, das diese christliche Gemeinde zusammenhielt. Und das war es auch, was die ersten Christen predigten. Das war es auch, warum man in den ersten Jahren des Christentums frei über die Wahrheit hin und her diskutierte. Es gibt keine freiere Besprechung, keine freiere Diskussion, als sie in der ersten Zeit dieses Christentums vorhanden war. Von einer Gewalt wird nur nach und nach geredet. Das Wichtige, was dabei zu berücksichtigen ist, was dann später zur Vergewaltigung führt, was überhaupt zum Entstehen des Dogmatismus des Christentums führt, ist die Tatsache, daß das römische Reich dogmatisiert war. Das ganze römische Reich war in ein Dogmensystem verwandelt. Man konnte nichts anderes begreifen als Verstandessachen, nichts anderes als steifes, abstraktes Dogma. So kam es, daß die ersten Christen verfolgt wurden, daß sie aber immer mehr an Bedeutung zunahmen, und daß sich
die Cäsaren endlich nach des Konstantin Vorgehen, und die Konstantiner selbst gezwungen sahen, die Christen anzuerkennen. Aber wie erkannten sie sie an? Sie ließen sie hineinwachsen in den römischen Staat, in dasjenige, was erfüllt war von dem Dogma und von weltlicher Macht, die im romischen Staate begründet waren. Dafür mußte es seinen ganzen Einfluß den römischen Machthabern zur Verfügung stellen; und die ursprüngliche Einteilung ging in die Bistümer und Diözesen über.
Nicht zu verwundern ist es, daß im Jahre 325 das nicaische Konzil so ausfiel, wie es eben ausgefallen ist. Damals standen die zwei Strömungen des Christentums sich noch gegenüber in dem Presbyter Arius und dem ganz im romischen Geiste erzogenen A thanasius. Arjus glaubte an die allmähliche Entwickelung des Menschen. Er sah sie unbegrenzt; Vergöttlichung nannte er sie. Der Mensch kann sich Gott anähneln; das ist der wahre Arianismus. Dem stand gegenüber der römische Dogmatiker Athanasius, der da sagt: Die Gottheit Christi muß über alles, was mit Menschentum zusammenhängt, hinausgehoben werden zu der Abstraktheit, der Jenseitigkeit des im römischen Reiche sich allmählich herausentwickelnden Dogmatismus. So verwandelte sich das arianische Christentum zum athanasischen Christentum, und das letztere siegte. Worauf kam es dem römischen Cäsar an? Er tritt spräter selbst zum Christentum über, aber nicht zum athanasischen, sondern zum arianischen. Er wußte aber, daß das athanasische wenigstens scheinbar das alte römische Reich stützen konnte. Das Christentum sollte eine Stütze des römischen Reiches werden; das war die wichtige Frage, die sich im Beginne des 4. Jahrhunderts entschieden hat. Das war aber zu gleicher Zeit die Epoche der Weltgeschichte, wo die Germanen immer mächtiger und mächtiger geworden waren, und es
nichts mehr half, durch Umwandlung und Ummodelung das alte römische Reich zu stützen; es wurde hinweggefegt von den Germanen. Davon wollen wir das nächste Mal sprechen, wie die Germanen das alte römische Reich stürzten.
Dann wollen wir noch zeigen, wie das römische Reich im letzten Todeszucken noch eine Macht gewesen ist. Das war die Aufgabe, die Lehre des Christentums so umzuformen, daß diese Lehre eine politische Gestalt annahm und geeignet war, Träger eines politischen Systems zu sein. Mächtig war diese Idee allerdings, die dazumal das führende Christentum aus dem ursprünglichen Christentum herauszuholen wußte. Macht war es, was sie zu dem römischen Cäsarengedanken und dem verwandelten Christentum hinzubrachte. Macht war es. Das politische System war so mächtig, daß, als Germanien dieses römische Reich zerstörte, als das germanische Ländergebiet sich immer mehr ausbreitete, der sogenannte bedeutende Herrscher des beginnenden Mittelalters, Karl der Große, aus den Händen des Papstes, des Pontifex Maximus, die Kaiserkrone erhielt. So waren die Wirkungen, als von dem alten römischen Reich nur wenig übriggeblieben war. Sie sehen, wie eigentümlich die Geschicke der Welt sich verketten, Sie sehen, daß wir vor allen Dingen wissen müssen, daß wir es das ganze Mittelalter hindurch mit einer politischen Macht zu tun haben, deshalb, weil in das ursprüngliche Christentum die römische Staatsidee hineingeflossen ist. In die römische Staatsidee wurde nicht das eigentliche Christentum eingefügt; und immer war es so, daß sich das Christentum in dem Mönchstum aufgebäumt hat gegen die politische Gestalt des Christentums.
Eine Idee hängt damit zusammen. Es ist eine Idee, die schwer zu begreifen ist, weil sie gar nicht im ursprünglichen
Christentum begründet war. Sie finden nichts von dem Mönchswesen im Christentum, weil diese Art von Vereinsamung, von Zurückziehen von der Welt, ihm ganz fremd war. Demjenigen, der das Christentum ernst nahm, war die Form, die politische Form, fremd. So zog er sich, um die Religion des Christentums zu führen, in das Kloster zurück. Alles was sich als solche Vereinigungen, als Mönchstum, durch die Jahrhunderte hindurch geltend gemacht hat - wenn es auch ausartete, weil die katholische Kirche jeden solchen Versuch unterdrücken wollte -, das war ein lebendiger Aufschrei des Christentums gegen die politische Macht. So haben wir also die Entwickelung der Macht.
Jetzt steht uns noch bevor zu erkennen, was das germanische Element für eine Bedeutung hat in dieser Zeit, zu erkennen, was das Christentum in dem germanischen Elemente für eine Rolle spielt. Wir haben auch noch zu erkennen, was sich aus dem alten römischen Reich herausentwikkelt und zu sehen, wie diese alte römische Ruine zusammenstürzt, wie aber etwas daraus hervorging, unter dem die Völker noch lange zu seufzen hatten. Es beginnt mit dem Ruf nach Freiheit und endigt mit der Unterdrückung der Freiheit. Das ist der Ruf, daß jeder dem anderen sich gleich achtet, und der endet, daß jeder unterdrückt wird. Es ist merkwürdig, daß sich in unserer Zeit Geschichtsschreiber gefunden haben, die Caracalla in Schutz nahmen, weil er dem ganzen römischen Reich die sogenannte Gleichberechtigung gegeben hat. Er hat als einer der unbedeutendsten und schädlichsten Cäsaren diejenigen, die draußen in den Provinzen waren, gleichberechtigt mit den Römern gemacht. Aber, er hat sie dann alle zusammen unterdrückt! Diese Gestalt hat die ursprüngliche römische Freiheit angenommen.
Wenn wir sehen, daß das Schicksal der Freiheit ein solches sein kann, dann gewinnen wir wohl wirklich aus der Geschichte das, was wir eine Art Erziehung durch die Geschichte nennen können. Dann lernen wir, daß es einen wirklichen Felsen gibt, wie Petrus ihn hatte, einen Felsen auf der Grundlage des ursprünglichen Stifters, auf den die menschliche Entwickelung wirklich gebaut werden kann. Dieser Fels ist und muß sein: die menschliche Freiheit und die menschliche Würde. Diese können zu Zeiten unterdrückt werden, so stark unterdrückt werden, wie es durch die Verhältnisse, die sich mit wenigen vergleichen lassen, im alten römischen Reiche geschehen ist. Jedoch ist die Erziehung des Menschen zur Freiheit in der Geschichte gegeben. Das ist eine wichtige Tatsache, daß, als die Gewalt herrschte im alten Rom, im Gipfel, zugleich das Fundament unterwühlt war, und der ganze Bau zusammenstürzte, so daß von der Freiheit gesagt werden muß, daß, wenn sie noch so tief unterdrückt ist, für sie und von ihr gilt das wahre Wort:
Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit,
Und neues Leben blüht aus den Ruinen.
GESCHICHTE DES MITTELALTERS BIS ZU DEN GROSSEN ERFINDUNGEN UND ENTDECKUNGEN
VORWORT VON MARIE STEINER ZUR 1. AUFLAGE 1936
Die Niederschrift dieser von Rudolf Steiner in der Arbeiterbildungsschule Berlins gehaltenen Vorträge über die Geschichte des Mittelalters gibt deren Inhalt, wenn auch etwas zusammengedrängt, so doch dem Geiste nach treu und genau wieder. Die Vorträge zeigen, in welchem Sinne Dr. Steiner die Geschichte behandelt sehen wollte, und bilden so den Auftakt zu dem, was aus seinem Gesamtwerke als eine neue Wissenschaft der Geschichte wegweisend wirken kann. Ihre geistige Spannweite, welche die Untergründe des irdischen Geschehens aus tieferen Schachten herausholt, als wir es sonst gewohnt sind, kündigt sich schon in dieser gedrängten Übersicht weit auseinander liegender historischer Geschehnisse an. Hineingestellt waren diese frei gesprochenen Vorträge in dasjenige, was als Seelenkonfiguration sich in den Kreisen der Arbeiterschaft ergab; sie wandten sich an dasjenige, was die Zuhörer aus ihrer gut geschulten und wachen Intelligenz heraus verständnisvoll verfolgen konnten. Aber sie dienten keinem Parteiprogramm, sondern traten im eminentesten Sinne dem Dogma einer materialistischen Geschichtsauffassung entgegen. So wurden sie von den dort leitenden Persönlichkeiten verketzert, die ja keine Freiheit, sondern, wie sie sich ausdrückten «einen vernünftigen Zwang» forderten! Dies führte denn
auch dazu, daß Rudolf Steiner seiner Lehrtätigkeit in der Arbeiterbildungsschule enthoben wurde, trotz des allgemeinen Eintretens der Zuhörerschaft für deren Fortsetzung. Interessant waren viele Briefe von Arbeitern, die erkannt hatten, in welcher Weise Rudolf Steiner ihnen hatte dienen wollen: sie dankten, daß endlich Einer gekommen sei, der ihnen zutraute, noch andere Interessen zu haben, als den Kampf ums Brot, der vom Geiste zu ihnen gesprochen habe, ein solches Streben auch bei ihnen voraussetzend und so an ihre besten Kräfte appellierend.
Für die Niederschrift dieser Vorträge sind wir Fräulein Johanna Mücke zu Dank verpflichtet.
ERSTER VORTRAG, 18. Oktober 1904
Goethe hat gesagt, das Beste in der Geschichte wäre der Enthusiasmus, den sie errege, der dazu führe, zu gleichen Taten zu ermuntern. In gewissem tieferem Sinne kann alles Wissen und alle Erkenntnis erst den rechten Wert erhalten, wenn es ins Leben hinaustritt. Es ist nötig, bei der Geschichte weit zurückzugreifen, um die Ursachen der späteren Entwickelung zu finden. Wie wir, um einzelne Zweige der äußeren Entwickelung der menschlichen Kultur zu verstehen, zum Beispiel beim Brücken- und Wegebau, daran festhalten müssen, daß dies die Früchte der Errungenschaften in den einzelnen Wissenschaften, der Physik und der Mathematik sind, so sehen wir auch in der eigentlichen Geschichte überall die Früchte der früheren Geschehnisse. In ferne Zeiten greift das zurück, was in unserem Leben zum Ausdruck kommt.
Wir haben die Anfänge der Kultur, ihre Entwickelung im Griechen- und Römertum verfolgt. In dieser Geschichtsbetrachtung nähern wir uns der Gegenwart. Wir gehen jetzt daran, einen Zeitabschnitt zu betrachten, auf den viele nicht gerne zurückblicken, den sie als finsteres Mittelalter am liebsten auslöschen möchten aus der Geschichte. Und doch stehen wir da vor einem wichtigen Abschnitt der Geschichte: es treten auf den Schauplatz der Geschichte barbarische Völker, die nichts wissen von Gesittung und Kunst. Diese Völkerstämme werden durch mongolische Völker aus ihrem Wohnsitz im heutigen Rußland verdrängt und rücken weit nach Westen vor. Wir werden die Kämpfe und Schicksale dieser Völker verfolgen; dann wird uns unser Weg weiterführen bis zur Entdeckung Amerikas, bis zu jenem
Zeitpunkt, wo sich Mittelalter und Neuzeit zusammenschließen, bis zur Zeit der großen Erfindungen und Entdeckungen, wo jene Erfindung geschah, die wohl die tiefgehendste Bedeutung hatte, die Erfindung der Buchdruckerkunst; jene Zeit, in der Kopernikus uns ein neues Weltbild gab. Diese Entwickelung des Menschen hat von der Völkerwanderung bis zu den Entdeckungen der Neuzeit geführt.
Es ist in der Geschichte weit schwerer, den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung nachzuweisen, als in der Chemie und Physik; denn oft liegen Ursache und Wirkung weit auseinander.
Heute erst erachtet man die Duldung verschiedenartiger Bekenntnisse untereinander für eine Forderung, die notwendig sei als eine Kulturbedingung. Und doch bestand bereits im 3. Jahrhundert vor Christo in Indien eine derartige gegenseitige Achtung und Duldung der verschiedensten Glaubensbekenntnisse, wie dies ein Denkstein des Königs Asoka beweist. Die im späteren römischen Reich auftauchende christliche Gesinnung hat ihre Wirkung über das ganze Mittelalter geäußert; ihre Ursachen liegen aber weder im Römerreich noch in Germanien, sondern in einer verschollenen Sekte des kleinen jüdischen Volkes in Palästina:
bei den Essäern. Bei dem verhältnismäßig großen Programm kann jetzt nicht jeder Zeitpunkt ausführlich behandelt werden. Es muß gewissermaßen erst eine Kohlezeichnung entworfen werden, deren Linien dann weiter auszuführen sind. Wir müssen zunächst begreifen, was uns aus diesem Mittelalter zuströmt, wenn wir verstehen wollen, welche Wirkung diese Zeit für uns haben muß. Ein hervor-ragender römischer Schriftsteller, Tadtus, hat uns in seiner «Germania» ein Bild jener Stamme aufbewahrt, die sich in dem heutigen Deutschland niedergelassen hatten. Er schildert
sie als einzelne Stämme, gleich durch ihre Sprache; und während sie sich selbst als verschiedene Völker betrachteten, erschienen sie ihm, dem Außenstehenden, sehr ähnlich. Er fand das Gemeinsame heraus und gab ihnen den gemeinsamen Namen Germanen.
Wenn wir nun die Volksseele dieser germanischen Völkerschaften prüfen, tritt uns der Unterschied zwischen ihnen und den Griechen und Römern entgegen. Bei der Bildung dieser seelischen Eigenschaften handelt es sich um einen wichtigen Zeitunterschied. Die griechische Kultur mit ihrer unvergleichlichen Kunst bestimmt einen besonderen Punkt in der Menschheitsentwickelung. Wir sahen dort vor der Eroberung durch die später eindringenden Hellenen ein uraltes Volk, ungefähr gleich den späteren Germanen, die Pelasger, die in einer Gemeinschaft von freien Menschen lebten. Dann nach der Einwanderung der Hellenen fanden wir die zwei Bevölkerungsschichten, Eroberer und Eroberte, diesen Gegensatz von Freien und Unfreien. Aus der Völkerwanderung und der Eroberung ging die griechische Herrschaft hervor. Hieraus ergibt sich, daß nur ein kleiner Teil der Bevölkerung teil hatte an den Gütern der Kultur. Es ergibt sich ferner daraus die niedrige Wertung der Arbeit; selbst die künstlerische war des freien griechischen Bürgers unwürdig. Griechenland ging unter an dieser Geringschätzung der Arbeit. Diese in vielen Punkten unerreichte Kultur der Griechen war eine Kultur, die nur möglich war unter Eroberern. Der römische Charakter bildete sich während der Eroberung; die Geschichte des Römerreiches ist eine Geschichte von fortwährenden Eroberungen; als es nichts mehr erobern konnte, ging es zugrunde.
Der germanische Charakter prägte sich in allen seinen wesentlichen Bestandteilen vor der Eroberung aus, und er
hat sich von den Berührungen mit anderen Völkern nicht unterjochen lassen. Seine Entwickelung stand fest vor dem Kampf. So sehen wir die Bildung des Volksgeistes sich vollziehen bei den Griechen nach, bei den Römern während und bei den Germanen vor den großen geschichtlichen Kämpfen. Wollen wir diese Charakterzüge betrachten, so werden wir diese Völkergruppen in Mitteleuropa genauer unterscheiden müssen. Drei Völker kommen in Betracht. In Spanien, Frankreich, Irland und Süddeutschland finden wir zunächst das alte Volk der Kelten. Es wird aus dem größten Teil seiner Wohnsitze durch die Germanen vertrieben. Von Osten her rücken die Slawen nach und drängen die Germanen weiter. So finden wir bei den Germanen, die von den beiden anderen Völkern umgeben sind, eine starke Vermischung mit keltischem und slawischem Blut. Auch auf die ganze Kultur des Mittelalters wirkt diese Mischung des germanischen mit dem keltischen und slawischen Element.
Wenn man in ferne Zeiten zurückgeht, so zeigt sich uns eine große merkwürdige Kultur der alten Kelten. Rührig, energisch, geistig angeregt, zu revolutionären Impulsen geneigt - so zeigt sich auch noch in späteren Zeiten das keltische Blut. Großartige Dichtungen, Gesänge, Wissenschaftsvorstellungen verdankt man dem keltischen Volke. Zu den Sagen, die im späteren Mittelalter von den deutschen Dichtern bearbeitet wurden - Roland, Tristan, Parzival und so weiter -, haben die Kelten die Anregung gegeben. Dieses merkwürdige Volk ist fast verschwunden, nachdem es immer weiter nach Westen verdrängt wurde oder sich mit den Germanen vermischte.
Der germanische Charakter zeigt als Hauptmerkmale Tapferkeit, Wanderlust, ein starkes Naturgefühl. In ihm entwickeln sich die häuslichen und kriegerischen Tugenden,
die praktische Tüchtigkeit, die auf das Nützliche gerichtete Tätigkeit. Die Hauptbeschäftigungen der Germanen bilden Jagd und Viehzucht. Wenige einfache Dichtungen, die von einem älteren Volke übernommen sind, haben die Germanen. Der germanische Charakter bleibt in seinen Grundeigenschaften erhalten aus barbarischer Urzeit. Innerhalb des germanischen Elementes entstehen die treibenden Kräfte entgegengesetzter Entwickelung. Eine merk-würdige Wandlung vollzieht sich innerhalb des Mittelalters. Griechenland hatte seine hohe Kunst, Rom hatte sein Rechtsleben und den Staatsbegriff ausgebildet. Die einfachen Rechtsanschauungen der Germanen gingen von ganz anderen Voraussetzungen aus. In Rom waren die Besitzverhältnisse, besonders in bezug auf Grund und Boden, das Ausschlaggebende. Die komplizierten Rechtsbegriffe des römischen Staates gehen hervor aus dem Bestreben, Einklang zu bringen zwischen den freien Bürgern und den Besitzern des Bodens. Alle die Kämpfe zwischen den Plebejern und Patriziern, die Kämpfe der Gracchen, selbst die Parteikämpfe der späteren Republik, waren Kämpfe für das Recht des freien Bürgers gegenüber den durch den Grundbesitz auch im Besitze der Macht Befindlichen. Formell stand jedem römischen Bürger das gleiche Recht auf den Staat zu. Ja, selbst in den späteren Zeiten des Kaisertums besaßen nominell die Kaiser das Recht an den Staat, indem sie das Recht aller freien Bürger in ihrer Person vereinigten und es an ihrer Stelle ausübten.
Den einfachen Rechtsanschauungen der Germanen waren solche kunstvolle Begriffe fremd. Der besondere Wert des freien Bürgers kam zu keiner rechtlichen Anerkennung. Was sich aus diesen Anschauungen heraus entwickelte, war das Faustrecht, das Recht des Stärkeren; der war der Mächtige, der sein Recht durch seine Kraft geltend machen
konnte. Zunächst war es die physische Kraft, die sich behauptete; da mußte sich jeder fügen und fügte sich auch dem Stärkeren. Die Frucht dessen aber, was sich im germanischen Zeitalter vorbereitet hatte, tritt später hervor als das Recht der freien, durch nichts als durch die selbsterworbene Tüchtigkeit bedingten Persönlichkeit. Es prägt sich dies aus in der Städtegründung. Diese Kultur der Städte, die sich im 11. Jahrhundert im ganzen westlichen Europa vollzieht, stellt eine bedeutsame Erscheinung dar. Woraus waren sie entstanden? Daraus, daß die, welche sich bedrückt fühlten von ihren Grundherren, eine Stätte suchten, wo sie das, was sie ihrer Tätigkeit, ihrer persönlichen Geschicklichkeit verdankten, ungestört genießen konnten. Der freie Bürger des alten Rom fußte auf einem Titel. Wer ihn hatte, hatte dadurch das Recht. Im Mittelalter galt nicht ein Titel des Bürgers, sondern nur das, was man sich erwarb. In den Kämpfen, die die Städte mit den Fürsten und Rittern um ihre Freiheit und Unabhängigkeit führten, drückt sich nichts anderes aus als der Kampf der freien Persönlichkeit. So war es nicht im alten Griechenland, nicht im alten Rom. Das war ein bedeutsames Übergangsstadium.
Was war denn der Grund, daß sich die Leute in den Städten zusammenfanden? Das materielle Interesse war es zunächst, das Freiseinwollen von den Bedrückungen; so zeigte sich auch zunächst die Tätigkeit auf den Nutzen, auf den materiellen Erwerb gerichtet.
Auch aus der Städtekultur - aber nicht aus diesen neuen Begründungen - in Italien, auf dem Schauplatz einer alten absterbenden Kultur, geht die gewaltige Dichterpersönlichkeit des Mittelalters, Dante hervor. In den germanischen Städten entstehen zunächst praktische Erfindungen: der Kompaß, das Schießpulver, bis zu dem bedeutsamen Ereignis der Erfindung der Buchdruckerkunst. Alles dies, was
hinüberführt in eine völlige Umgestaltung der Verhältnisse. war herausgeboren aus dem, was man praktisch errungen hatte. Das mag auf den ersten Blick sehr weit hergeholt erscheinen, aber, wie schon betont, liegen in der Geschichte Ursache und Wirkung weit auseinander. Möge dies ein Beispiel erläutern:
Franz Palacky', der tschechische Historiker, hat im Jahre 1846 in seinem Werke über das tschechische Volk im 15. Jahrhundert auf die Reformbewegung des Mittelalters hingewiesen, auf diese Bewegungen, die lange vor der sogenannten Reformation die Gedanken einer Neugestaltung der Kirche versuchten. Besonders an der hussitischen Bewegung, die Palacký, der selber an der Revolution 1848 tätigen Anteil nahm, mit großer Sympathie behandelte, macht er auf die Strömungen aufmerksam. Er charakterisiert in ihnen in ganz eigentümlicher Weise, was sich in den Herzen ausgebildet hat in der Städtekultur. Es ist eine den keltischen, germanischen und slawischen Stämmen gemeinsame Eigenschaft. Wir verstehen sie, wenn wir die Sagen und Lieder dieser Völker betrachten. Von alten griechischen und römischen Sagen unterscheiden sie sich dadurch, daß sie schildern, was das Menschenherz leiden kann und was es erlöst.
Es ist dies der Sinn für das Tragische. Bei dem griechischen und römischen Volk war derjenige der Held der Sage, der äußerlich siegte, nicht der, welcher seine Seele aufrecht erhielt. Immer war das Herz des Volkes bei denjenigen, die äußerlich vom Glück begünstigt waren. Anders bei den germanischen Völkern. Für die Helden, die äußerlich untergehen, aber die Seele aufrecht erhalten, schlägt das Herz der germanischen und slawischen Völker. Sie leben in der Seele, im Geiste. Helden wie Siegfried und Roland oder der Königssohn Marko werden in der Dichtung dieser Völker
gefeiert. Nicht der äußere Sieg dieser Helden, sondern ihr Mut im Leiden und Untergang, ihr ungebeugter Geist wird gefeiert. Alles tritt zurück vor dem Rechte des Geistes und der Seele. Im Imperium Romanum sehen wir die Tapferkeit, das Rechtsbewußtsein, in Griechenland die Kunst blühen; das Leben der Seele tritt uns bei den Germanen entgegen. Sie hatten keine Bilder ihrer Götter; nicht wie bei den Griechen treten uns herrliche Bilder ihrer Göttergestalten plastisch entgegen. Ihre Seele hat gearbeitet an den Bildern ihrer Götter, tief im Innern des Gemütes bildete der Deutsche sich seinen Gott.
Aus dieser Volksanlage entsprang auch der reformatorische Gedanke. Selbst mittätig sein an dem, was sein Glaube sein sollte, das verlangten diese Völker. Hundert Jahre vor Luther hatte Wiclzf in England eine reformatorische Bewegung eingeleitet. Der Volksgeist fordert, selbst die Bibel in die Hand zu nehmen. Aus diesem Geiste stammte auch die hussitische Bewegung. Schon im frühen Mittelalter waren Ansätze in dieser Richtung vorhanden. Kaiser Heinrich II. aus sächsischem Geschlecht, dem die katholische Kirche später den Namen «der Heilige» gegeben hat, forderte eine «ecclesia non romana». Militsch, der nicht genug gewürdigte Gelehrte, der im Kerker von Prag schmachtete, schrieb sein Buch über den Antichrist. Die römische Kirche mit ihrer äußeren Organisation war ihm der Antichrist. Das, was in solchen Forderungen und Bewegungen zutage trat, die Loslösung vom äußeren Zwang, die innerliche Vertiefung, das nimmt Palacký für das slawische Volk in Anspruch; den Gedanken der Humanität wie ihn Herder ausgesprochen hat, er sieht ihn dargestellt in den Brüdergemeinden wie sie auf böhmischem Boden sich entwickelten. Tief in unserem Volk liegt es, eine zwanglose Organisation als Ideal zu betrachten.
Nicht nach, nicht während der Eroberung bildete es seinen Volkscharakter, sondern der Zug, der vor dieser Zeit in ihm lag, hat sich durch dieses Stadium hindurch erhalten und zu diesem Ideale endlich sich entwickelt. Der Freiheitsgedanke bildet sich während des Mittelalters aus, trotz all der Unterdrückung, trotz all der Gegenströmungen, die das ausmachen, was man das dunkle Mittelalter nennt. Mag auch vielen das Mittelalter heute als eine finstere Zeit erscheinen, so hat sich doch im Mittelalter das entwickelt, was später die Dichter suchten: das Freiheitsbewußtsein, für welches das 18. Jahrhundert kaum mehr als die Definition fand, um das man im 19. Jahrhundert erbittert kämpfte, und welchem das Ringen der Gegenwart gilt.
Freimachen müssen wir uns von den Zwangsverhältnissen, in denen auch heute noch die Menschen gebunden sind. Das Bewußtsein, daß der Mensch dem Menschen in bezug auf das Freiheitsgefühl gleich sei, hat sich immer mehr verbreitet. Das haben die Menschen begriffen, daß rechtlich ein Mensch nicht Sklave, nicht Höriger sein könne. Rechtlich fühlt sich der Mensch heute frei. Aber eine andere Form der Unfreiheit hat sich noch erhalten, die materielle. Unfrei war im alten Griechenland der Unterdrückte, der Überwundene, der Sklave. Unfrei war im alten Rom der nicht zum Bürgertum Gehörende, der keinen Teil an dem Staate hatte. Im Mittelalter waren die Menschen unfrei durch die physische Gewalt. Alle diese Formen haben sich nicht erhalten können, erhalten hat sich nur die ökonomjsche Unfreiheit.
Immer deutlicher gibt sich das Bestreben nach voller Befreiung der Persönlichkeit kund. Der alte Grieche legte Wert auf die Vornehmheit der Rasse, der Römer auf die Vornehmheit der Person. Bei dem Germanen lag der Wert in der Kraft und Stärke der Person. Der moderne Mensch
legt Wert auf den Kapitalismus, auf den Schein des Besitzes. So weist uns die Entwickelung darauf hin, daß immer mehr die Schranken fallen, die von außen die Persönlichkeit hemmen. Dann wird der Boden frei sein für das neue Ideal. Daß der freie Mensch aus dem Geist heraus einen neuen Wert erhält, lehrt uns die Geschichte. Der idealerfüllte Mensch wird derjenige sein, der befreit ist von all diesen Formen der Unterdrückung, der gelöst von der Erdenschwere, seinen Blick aufwärts richten kann. Dann erst wird das Wort Hegeis zur vollen Wahrheit werden: Die Geschichte ist der Fortschritt der Menschheit zum Bewußtsein der Freiheit!
ZWEITER VORTRAG, 25. Oktober 1904
Gründlich verändert hat sich das Bild Mitteleuropas von der Zeit etwa vom Jahre 1 bis zum 6. Jahrhundert n.Chr. Diese Änderung bedeutet einen vollständigen Ersatz der Völker, die an der Weichsel, Oder und Elbe gelebt haben, durch andere, und daher ist es sehr schwer, sich ein Bild dieser Völker zu machen, über ihre Sitten, über ihre Lebensart etwas zu erfahren. Man muß zu einer eigenartigen Methode greifen, um ein Bild jener Völker zu finden. In den Beschreibungen des Tacitus in der Germania ergibt sich uns ein Bild der damaligen Gegend. Urkunden sind uns sonst aus jener Zeit nicht aufbewahrt, und wir müssen die Sagen der nördlichen Germanen heranziehen, um unsere Vorstellungen zu ergänzen. Etwas sehr Bezeichnendes für die Anschauungen des Römers damaligen Verhältnissen gegenüber ist es, was Tacitus über diese Völker sagt. Er ist der Meinung, sie seien die Urbewohner jenes Landes, denn er kann sich nicht vorstellen, daß in diese unwirtlichen Gegenden
andere Völker sich hätten wenden können. Er nennt jene Völkerstämme, die am Rhein, an der Lippe, an der Weser, an der Donau und in Brandenburg wohnen; nur diese sind ihm bekannt. Von ihnen erzählt er eigentümliche Züge, sie faßt er zusammen ihrer Gleichartigkeit halber mit dem Namen Germanen. Sie selbst fühlten sich als viele verschiedene Stämme und werden bei den Kämpfen mit den Römern mit den mannigfachsten Namen genannt, von denen sich nur wenige in den späteren Zeiten erhalten haben, wie die Sueven, Langobarden. Chatten. Friesen und so weiter.
Sie leiten sich ursprünglich her von einem Tuisto, dem sie göttliche Verehrung zollen, die sie durch Kriegsgesänge zum Ausdruck bringen. Der Sohn des Tuisto war Mannus, nach dessen drei Söhnen sie ihre Hauptstämme benennen:
Ingwäonen, Istwäonen und Herminonen. Wenn wir diese Mitteilung des Tacitus mit den Mythen eines anderen arischen Volkes vergleichen, so finden wir auch hier in der heiligen Sprache der Inder im Sanskrit die gleiche Bezeichnung Manu für übermenschliche Führer. Das weist uns auf eine Stammesverwandtschaft, ja, wir können die gleichen Gottheiten verfolgen bei all den indogermanischen Völkerschaften. So erzählt Tacitus, daß der Held der griechischen Sage, Herkules, auch von den Germanen verehrt wurde und bei ihnen den Namen Irmin führte. Wir wissen, daß bei den südlichen indogermanischen Stämmen eine Sage lebte, welche in Griechenland eine künstlerische Ausgestaltung fand: Die Sage von Odysseus. Tacitus fand in der Nähe des Rheins eine Kultusstätte, die dem Odysseus und seinem Vater Laertes geweiht war. Wir sehen also, daß die Kultur der Germanen um diese Zeit verwandt war mit der Kultur, die wir im 8. und 9. Jahrhundert v.Chr. in Griechenland antreffen. So sehen wir in Griechenland später die
Ausbildung einer Kultur, die in Deutschland auf niedrigerer Stufe stehengeblieben ist.
All das weist auf eine ursprüngliche Verwandtschaft. Jene Völker, die später in Deutschland, Griechenland, Rußland wohnten, hatten wahrscheinlich ihre frühere Heimat nördlich vom Schwarzen Meer. Von dort wanderte ein Stamm nach Griechenland, ein Stamm nach Rom, ein dritter nach Westen. Die ursprüngliche Kultur aller dieser Völker hat sich in dieser Form bei den Germanen erhalten, weiter ausgebildet wurde sie bei den Kelten. Nichts erzählt uns Tacitus von den Sitten und Gebräuchen dieses merkwürdigen Volkes. An die Sagen und Lieder, die in der älteren und jüngeren Edda später in Island zusammengefaßt wurden, müssen wir uns halten, dort lebt, was jenes Volk hervorgebracht hat. Tacitus erzählt uns weiter von den Gebräuchen der Deutschen bei ihren Volksversammlungen, die wir uns aber nur als Beratungen sehr kleiner Gemeinden vorzustellen haben. Zu diesen versammelten sich alle Männer des Gaues, die Beratungen wurden bei Bier und Met gepflogen, und nun wird erzählt, daß die alten Deutschen trunken des Abends ihre Beschlüsse faßten, diese aber wurden am nächsten Morgen, wenn jene wieder nüchtern waren, revidiert und hatten erst dann Gültigkeit. Wie wir aus den Scholien zur Ilias erfahren, bestand bei den Persern dieselbe Sitte. Auf einen Urstamm der Arier müssen wir also schließen, auf eine Verwandtschaft aller dieser Völker.
Besonders große Ähnlichkeit zeigt sich bei den nördlicher wohnenden germanischen Völkern in eigentümlichen Religionsformen, die zwar in dem Grundcharakter denjenigen der südlichen ähnlich sind, aber doch eine weit größere Ubereinstimmung mit denjenigen der Perser zeigen. Nach der Anschauung der nördlichen Germanen bestanden ursprünglich zwei Reiche, die durch einen Abgrund voneinander
getrennt waren, ein Reich des Feuers, Muspelheim, und ein Reich des Eises, Niflheim. Durch die Funken, die von Muspelheim herüberflogen, entstand in dem Abgrund das erste Geschlecht der Riesen, von denen Ymir der hervorragendste war. Dann entstand eine Kuh, Audhumbla, die beleckt das Eis, und aus ihm hervor entsteht eine starke menschliche Gestalt. Von dieser stammen die Götter Wotan, Wili und We, deren Namen Vernunft, Willen und Gemüt bedeuten. Dieses zweite Göttergeschlecht hieß Asen. Ihr Ursprung wurde von dem älteren der Riesen abgeleitet.
Auch hier ergibt sich ein wichtiger sprachlicher Zusammenhang, denn die Götter der Perser wurden beinahe gleichlautend Asuras genannt, was gleichfalls auf eine über alle diese Völker hingehende Verwandtschaft deutet. Ein weiterer wichtiger Hinweis findet sich in einer alten persischen Beschwörungsformel oder Beschwörungsdichtung, die uns überliefert ist. Sie weist auf Wandlungen des Volks-gemütes hin, auf alte Götter, die abgesetzt und von anderen verdrängt worden sind. Abgeschworen wird der Dienst der Devas, beschworen der Dienst der Asuras. Es tritt hier die Ähnlichkeit der Devas mit den Riesen hervor, die von den Asen bezwungen wurden.
Ferner erzählt die nordgermanische Sage, wie die drei Götter am Meeresstrande eine Esche und eine Erle fanden und aus ihnen das Menschengeschlecht erschaffen haben. Auch die persische Mythe läßt das Menschengeschlecht aus einem Baume hervorgehen. Bei den Juden finden wir Anklänge an diesen Mythus in der Erzählung vom Baume des Lebens im Garten des Paradieses. So sehen wir von Persien über Palästina hinüber nach Skandinavien Spuren der gleichen mythischen Vorstellungen.
So haben wir damit bei gewissen Völkern einen gemeinsamen
Grundcharakter nachgewiesen. Dabei ergeben sich wiederum Unterschiede zwischen einem südlicheren und einem nördlicheren Zweige des gemeinsamen Hauptstammes. Zu dem südlichen gehören die Griechen, Lateiner und Inder, zu dem nördlicheren die Perser und Germanen. Sehen wir also, mit was für Völkern wir es in Deutschland jetzt zu tun haben. Sie treten uns so entgegen, daß wir wohl glauben müssen, sie haben sich Charakterzüge bewahrt, die die Griechen und Italer schon längst abgestreift hatten, und zwar die Griechen nach, die Römer während der Eroberung ihres Reiches; während diese nördlichen Völker ihre wesentlichen Charakterzüge und Eigenschaften vor jener Eroberung ausgebildet hatten. Urwüchsige Eigenschaften waren es, die diese Völker sich bewahrt hatten. Sie waren nicht durch jene Zwischenstufe hindurchgegangen, die jene südlicheren Völker inzwischen durchgemacht hatten. Wir haben es also hier mit einem Zusammenstoß eines konservativ gebliebenen, mit einem verwandten, aber zur Kultur-höhe gelangten Volke zu tun.
Zur Zeit der Entstehung des Christentums, das so große Bedeutung für sie erlangen sollte, standen die Germanen auf jener Kulturstufe, wie wir sie von den Griechen bei Homer geschildert finden. Den Fortschritt in der Kultur und Gesittung, der dazwischen liegt, hatten sie nicht mitgemacht. In dem ersten Jahrhundert n.Chr. schildert Tacitus die Germanen der Grenzländer an der Donau, am Rhein und an der Lippe. Diese Völker zeichnen sich durch Wanderlust, Freiheitsliebe, sowie Jagd- und Kriegslust aus. Die häuslichen Angelegenheiten lagen in den Händen der Frauen. Nun tritt uns hier eine Gesittung entgegen und eine Gestaltung der Gesellschaft, die bei den Griechen längst entschwunden war, die sich nur dort erhalten konnte, wo die einzelnen Glieder eines Stammes noch durch Blutsverwandtschaften
aneinander gebunden waren. Daher die vielen Stämme. Bei ihnen, die ihrer Abstammung von der gleichen Familie sich bewußt waren - denn geregelte Familien, keine Horden waren es -, entwickelte sich aus den einzelnen Familien die Stammesverwandtschaft. Daher waren auch die Kriege, die sie führten, fast stets Kriege gegen Blutsfremde.
Gegen Ende des 4. und im 5. Jahrhundert sehen wir nun alle diese Völker gezwungen, ihre Wohnsitze zu wechseln und sich neue zu suchen.
Die Epoche der Völkerwanderung hatte begonnen. Die Hunnen brechen herein. Damit dämmert auf die Kenntnis der Völker, die weiter nach Osten wohnen, der Alanen, der Gepiden und so weiter und vor allem der Goten. Dieses Volk, das sich in West- und Ostgoten teilte, hatte bereits das Christentum angenommen. Es ist dieses Volk für uns von besonderer Wichtigkeit durch die Art seiner Auffassung des Christentums. Während das Volk, das später das Christentum von Westen nach Osten ausbreitete, die Franken, es mit Gewalt den übrigen Völkern aufzwang, waren die Goten voller Toleranz. Für die hohe Kulturstufe, die sie schon erreicht hatten, spricht der Umstand, daß wir einem Bischof der Goten, Ulfilas oder Wulfila, die erste Bibelübersetzung verdanken, den sogenannten silbernen Kodex, der in Uppsala aufbewahrt wird.
Diese Goten, deren Christianisierung von Osten her geschehen war, waren nicht solche Christen wie diejenigen, deren Bekehrung später vom Westen aus erfolgte; nicht wie die Franken, die zur Zeit Karls des Großen mit Waffengewalt den Sachsen das Christentum aufdrängten. Sie waren nicht athanasische, sondern arianische Christen. All diese östlichen germanischen Völkerstämme bekannten sich zu dem arianischen Glauben, einer Anschauung, die auf dem
Konzil von Nicäa von den Anhängern des Athanasius für ketzerisch erklärt und verfolgt wurde.
Die arianischen Christen nahmen an, daß der Gott in jeder Menschenbrust wohne. Daher glaubten die Goten an eine Vergöttlichung des Menschen, wie Christus, der ihnen vorangegangen sei, sie den Menschen gezeigt hatte. Diese Anschauung war verknüpft mit einer tiefen Bildung des Gemütes. Die Goten waren von größter Duldsamkeit gegen jede andere religiöse Anschauung. Zwischen zwei christlichen Religionen, die voneinander so verschieden waren, war keine Verständigung möglich. War die absolute Toleranz eine Eigenschaft dieser Goten, fiel es ihnen nicht ein, einem anderen einen Glauben aufzuzwingen, so tritt uns hierin schon der Unterschied entgegen von der Art und Weise, wie zum Beispiel bei Karl dem Großen und Chlodwig, den Anhängern des athanasischen Glaubensbekenntnisses, das Christentum zu politischen Zwecken ausgebeutet wurde.
Die Arianer sahen in Christus einen Menschen, hochentwickelt über alle anderen Menschen zwar, aber Mensch unter Menschen. Ihr Christus gehörte zu den Menschen und wohnte in des Menschen Brust. Der Christus der athanasischen Christen ist Gott selbst, der hoch über den Menschen thronte.
Athanasius hat gesiegt, dadurch ist die Kulturentwickelung wesentlich beeinflußt worden.
Die Germanen waren rings eingezwängt von fremden Völkern: im Süden und Westen von den Römern und Galliern - kelto-germanischen Völkerschaften -, während von Osten her fortwährend neue Völkerzuschübe stattfanden. Die ersten christlichen Germanenstämme hatten nichts anderes gekannt als absolute Toleranz, die Franken-Christen brachten ein aufgezwungenes Christentum. Das
führte zu einer Änderung der ganzen Gemütsart. An der Entwickelung dieses Teiles der Germanen hängt nun im wesentlichen die Fortentwickelung der Kultur.
Eine tiefgreifende Änderung der Rechtsverhältnisse hatte sich allmählich vollzogen. Einigermaßen tritt Ruhe und Seßhaftigkeit mit dem Ende des 5. Jahrhunderts ein. Durch die fortgesetzten Nachschübe von Osten haben sich aus den früher genannten, fortwährend untereinandergerüttelten Völkerschaften, von denen sich nur wenige selbst den Namen bewahrt haben - Chatten und Friesen und so weiter - größere Völkergemeinschaften gebildet. Durch die Auflösung der alten Blutsverbände war ein anderes Motiv der Zusammengehörigkeit geschaffen. An die Stelle des Blutes trat das Band, welches den Menschen verknüpft mit dem Grund und Boden, den er bebaut.
Stammeszusammengehörigkeit wurde gleichbedeutend mit Lokalzusammengehörigkeit. Es entstand die Dorfgemeinde. Nicht mehr das Bewußtsein der Blutsgemeinschaft, sondern die Zusammengehörigkeit mit dem Boden band die einzelnen Glieder der Gemeinde untereinander. Es führte dies zu einer Umgestaltung der Eigentumsver-hältnisse.
Ursprünglich war alles Gemeineigentum gewesen. Jetzt tritt die Scheidung zwischen Gemeineigentum und Privateigentum hervor. Doch ist vorerst noch alles Gemeineigentum, was Gemeineigentum sein kann, Wald, Weide, Wasser und so weiter. Es bildete sich dann eine Zwischenstufe zwischen dem Gemein- und Privatbesitz, die sogenannte Hufe. Die Benutzung dieses halb privaten, halb gemeinsamen Eigentums unterlag dem Beschlusse der gesamten freien Bewohner einer sogenannten Hufe, einer Gemeinde, und in jenen früheren Zeiten waren fast alle Bewohner der Gemarkung frei.
Das steht in schroffem Gegensatz zum eigentlichen Privateigentum: Waffen, Geräten, Gewändern, Gärten, Vieh und so weiter, allem, was sich der einzelne persönlich erworben hatte. Dieser begrenzte Charakter drückte sich darin aus, daß das Privateigentum mit der Person des Besitzers eng verbunden war. Man gab daher dem Toten seine Waffen, Pferde, Hunde und so weiter mit ins Grab. Ein Anklang an diesen alten Gebrauch ist es, wenn noch heute beim Begräbnis eines Fürsten ihm Orden, Krone und so weiter nachgetragen, sowie sein Pferd nachgeführt wird.
Auch bei einem Volke, das in mancher Weise Ähnlichkeit mit den alten Germanen aufweist, bei den Chinesen, gibt man den Toten die Gegenstände, die ihm persönlich gehörten, mit ins Grab, wobei man sich heute allerdings mit Papiermodellen begnügt.
So sehen wir also, was sich aus bestimmten Verhältnissen herausgebildet hatte: Übergang von der Stammes- zur Dorfgemeinschaft. Wir begreifen damit weitere Umwandlungen. Wir verstehen, warum Tacitus nicht von den Asen spricht, sondern von Tuisto und seinem Sohne Mannus. Er spricht von Völkern, die noch nicht zu der Dorfgemeinschaft gekommen sind. Die Asengötter gehören einer höheren Kulturstufe an. Andere Völker kamen von Norden und brachten Vorstellungen mit, die sich dort entwickelt hatten. Die paßten nun für die inzwischen erreichte höhere Kulturstufe. Wie weit geht der Mensch mit Vorstellungen, wie sie uns in Tuisto, in Mannus entgegentreten? Er bleibt beim Menschen, geht nicht über sich selbst hinaus. Es wäre etwas Fruchtloses gewesen, bei diesen Stämmen den Wotansdienst einzuführen. Der Wotansdienst geht bis in das Universum; der Mensch sucht seinen Ursprung im Schoße der Natur. Erst auf dieser späteren Kulturstufe konnte sich der Mensch zu diesen Religionsvorstellungen erheben. Er
ist seßhaft geworden, daher versteht er den Zusammenhang mit der Natur. So haben wir gesehen, wie die primitive Kultur der südlicheren Germanen von Norden beeinflußt wird, und wie unterdessen im Süden bei verwandten Völkern sich hohe Kulturen entwickelt hatten.
Wir werden weiterhin sehen, unter welchen Bedingungen die südlichen Kulturen sich über die Germanen ergießen werden. Eine interessante Übersicht bietet sich uns dar, eine tiefgehende ursprüngliche Verwandtschaft der verschiedenen Völker, ein innerer Zusammenhang, der ihr Wesen bestimmt. Wir sehen dann äußere Einflüsse, die den Charakter ändern. So stellen sich uns Ursache und Wirkung dar.
Aus der Vergangenheit können wir so die Gegenwart verstehen lernen. Ewige Wandelbarkeit beherrscht nicht nur die Natur, sondern auch die Geschichte. Wie könnten wir getrosten Mutes in die Zukunft blicken, wenn wir nicht wüßten, daß auch die Gegenwart sich ändert, daß wir sie in unserem Sinne gestalten können, daß auch hier das Dichterwort sich erfüllt:
Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit,
und neues Leben blüht aus den Ruinen.
DRITTER VORTRAG, 1. November 1904
Man braucht nur eine einzige Tatsache zu erwähnen von allen, die in derselben Weise sprechen, um zu sehen, was für durchgreifende Veränderungen im 5. Jahrhundert vor sich gegangen sind. Die Westgoten finden wir am Ende des 4. Jahrhunderts im Osten der Donau: ein Jahrhundert später
zeigt sie uns die Karte in Spanien. Ebenso wie dieses Volk von einem Ende Europas zum anderen gezogen ist, so ist es mit vielen anderen. Sie zogen in Länder, wo sie andere Kulturen antrafen und andere Sitten annahmen.
Wir müssen einen Rückblick auf die vorhergegangene Geschichtsepoche werfen, um den Umschwung zu verstehen, den hundert Jahre in Mitteleuropa hervorriefen. Wir finden, wenn wir den Berichten der Römer folgen, längs des Rheins kriegerische Stämme, deren Hauptbeschäftigung außer den Kämpfen die Jagd bildet. Weiter nach Osten zu finden wir Ackerbau und Viehzucht bei den Germanen, und noch weiter im Nordosten Volksstämme, die am Meere wohnen und von denen die Römer berichten, als wären sie etwas ganz Dunkles und Nebelhaftes.
Es wird erzählt, daß dieses Volk die Sonne anbete und seinen Glauben daher habe, daß es die Sonnengöttin aus dem Meere hervorgehen sehe. Von dem Volke, das in diesen Gegenden in der Mark Brandenburg wohnte, den Semnonen, wird gesagt, daß sich ihr Gottesdienst durch seine blutigen Opfer auszeichnete. Bei ihnen wären zwar meist nicht Menschen, sondern Tiere den Göttern dargebracht worden, der Opferdienst hätte aber einen grausamen Charakter getragen, der ihn von dem der übrigen Stämme unterschied. Und noch manches sonst wäre zu schildern von dieser Zeit.
Es folgt dann zunächst eine verhältnismäßig ruhige Zeit.
Allmählich werden von den einzelnen Stämmen die Grenzen des römischen Reiches überschritten. Im 3. Jahrhundert dringen zuerst vor gegen das römische Reich im Südwesten die Burgunder und weiter nördlich die Franken, die in Gallien einfallen. Auch weiter nach Osten zu, an der Donau, rücken andere germanische Völkerschaften gegen das Reich. So mußten die Römer mit ihrer hochentwickelten
Kultur jener Völker sich erwehren. Wir finden hier einen großen Unterschied der Kulturstufen. Bei den Germanen herrschte überall noch Naturalwirtschaft, bei den Römern ausgebildete Geldwirtschaft. Der Handel bei den Germanen war ein bloßer Tauschverkehr. Handel mit Geld kannte man noch nicht. Es ist bezeichnend, wie in Frankreich - unter dessen Bevölkerung sich so viel keltisches Blut findet - nach der römischen Eroberung vollständige Geldwirtschaft eingeführt war, diese bei der Eroberung durch germanische Stämme durch die Naturalwirtschaft wieder verdrängt wurde. So zeigt sich uns der Zusammenstoß hochentwickelter Kultur mit barbarischen Volksstämmen.
Dann brechen die Hunnen herein. Im Jahre 375 erfolgt der erste Zusammenstoß zunächst mit den Ostgoten, die am Schwarzen Meer ihren Wohnsitz hatten, und den Herulern. Sie werden nach Westen gedrängt, und dadurch werden auch die Westgoten genötigt, aus ihren Wohnsitzen aufzubrechen. Wohin sollen sie gehen als in das römische Reich, das sie bis an die Donau überfluten. Schon ist das Römerreich in ein Ost- und weströmisches Reich zerspalten, jenes mit Byzanz, dieses mit Rom als Hauptstadt. Der oströmische Herrscher weist den Westgoten Wohnsitze an, deren Besitz sie sich jedoch erst in der Schlacht bei AdrianOpel erstreiten mußten. Dort in jenen Gegenden schrieb Ulfila seine Bibelübersetzung. Doch bald mußten sie ihre Wanderung wieder fortsetzen. Nachrückende slawische Völkerschaften drängten sie weiter nach Westen. Unter ihrem König Alarich eroberten sie Rom und gründeten im 5. Jahrhundert in Spanien das west gotische Reich.
Die Ostgoten folgten ihnen nach und versuchten gleichfalls im Gebiete des römischen Reiches Wohnsitze zu begründen. Der germanische Stamm der Vandalen eroberte
Spanien, schiffte dann nach Afrika hinüber, wo er in der Gegend, wo einst Karthago gestanden hatte, ein Vandalenreich begründete und von da aus durch Überfälle Rom beunruhigte. So ist der ganze Charakter dieser Völkerumwälzung der, daß in all die Teile, die die neue Gestalt des christlichen Roms bildete, sich diese Germanenvölker hineindrängten. Aus dieser Art der Eroberung gingen Neugestaltungen von ganz eigentümlichem Wesen hervor.
Auf dem Gebiete des vormaligen Gallien entsteht ein mächtiges Reich, das Frankenreich, welches Jahrhunderte lang ganz Mitteleuropa seinen Stempel aufdrückte. In ihm bildete sich vornehmlich das, was man gewöhnlich als «römisches Christentum» bezeichnet. Jene anderen Völker, die in raschem Siegeszuge sich Teile des römischen Reichs unterworfen haben, die Goten, die Vandalen, verschwinden bald wieder völlig aus der Geschichte. Bei den Franken sehen wir ein mächtiges Reich sich über Europa ausdehnen. Welches sind die Gründe hierfür?
Um diese zu finden, müssen wir einen Blick auf die Art werfen, wie diese Stämme ihr Reich ausdehnen. Es geschah das in der Weise, daß ein Drittel bis zwei Drittel des Gebietes, in das sie eindrangen, unter die Eroberer verteilt wurde. So erhielten die Anführer große Ländergebiete, welche sie nun für sich bearbeiten ließen. Zur Arbeit wurde die unterworfene Bevölkerung benutzt, die zum Teil zu Sklaven oder Unfreien geworden waren. So machten es die Westgoten in Spanien, die Ostgoten in Italien. Sie können sich denken, daß dieses Verfahren unter den schon bestehenden Verhältnissen, wo die Bevölkerung auf einer höheren Kulturstufe lebte, große Schwierigkeiten fand und sich auf die Dauer nicht zu halten vermochte.
Anders in Gallien. Dort gab es große Wälder und unbewohnte Landstriche. Auch hier verteilte man die eroberten
Gebiete, und den Anführern fielen große Teile zu. Man war hier nicht in schon bestehende Verhältnisse hineingedrängt; es war die Möglichkeit zur Ausdehnung gegeben. Die Führer wurden hier zu Großgrundbesitzern und Herrschern über die unterworfenen Volksstämme. Aber die Verhältnisse ermöglichten es, daß dies ohne zu großen Zwang geschah. In den Zeiten vor der Völkerwanderung waren die Angehörigen eines Stammes einander im wesentlichen gleich gewesen. Die Freiheit war ein gemeinsames, germanisches Gut, und in gewissem Sinne war jeder sein eigener, niemand verantwortlicher Herr auf seinem eigenen Grund und Boden. Diese Unabhängigkeit und Macht der Führer dehnte sich nun dadurch aus, daß so viele Menschen von ihnen in Abhängigkeit gekommen waren.
Dadurch waren sie in der Lage, sich selber besser zu beschützen, und kleine Besitzer begaben sich in den Schutz der größeren. So entstand ein Schutzverhältnis des Mächtigen gegen den weniger Mächtigen. Die vielen kleinen Fehden führten viele kleine Besitzer, die sich selbst nicht ausgiebig genug verteidigen konnten, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu den Mächtigeren. Sie gelobten Treue im Fall eines Krieges; andere traten Teile ihres Besitztums ab, oder bezahlten dem Schutzherrn einen Zins. Solche Abhängige hießen Vasallen. Anderen wurde von den großen Besitzern für ihren Dienst in Kriegsfällen ein Besitz auf Widerruf verliehen: das Lehen. Der Mächtige wurde der Lehnsherr, der andere Vasall. So bildeten sich auf die natürlichste Weise der Welt gewisse Besitzverhältnisse aus.
Die Eroberungszüge der Goten hatten keine dauernde Wirkung. Diejenigen Völker, die sich hineingeschoben hatten auf Kulturboden, kamen zu nichts, ihre Macht war bald gebrochen. - Anders in Gallien. Hier, wo weite Gebiete noch auszuroden waren, konnte das Eindringen neuer
Volksmassen im Kulturinteresse nur begrüßt werden. Unbeengt waren die Großen im Reich der Franken in der Ausbildung ihres Volkscharakters.
Ausgelöscht sind die Goten und Vandalen, sie und all die germanischen Stämme, die in schon ausgebildete Wirtschaftsgebiete gekommen waren. Bei den Franken haben wir die Unabhängigkeit von dem wirtschaftlichen Unter-bau, und die Franken drückten der Folgezeit den Charakter auf, namentlich auch dadurch, daß das sich ausbildende Christentum den Boden fand, sich in solcher Freiheit auch auszubreiten. Während die Westgoten ursprünglich arianische Christen waren, wurden ihrer Eigenart andere Vorstellungen eingeimpft; unter den ihrer Wesensart fremden wirtschaftlichen Vorbedingungen entwickelte sich das, was als Druck der materiellen Verhältnisse angesehen werden kann. Nicht so war es bei den Franken. Innerhalb der Frankenstämme war es, wo die Kirche Großgrundbesitzerin wurde. Unbeirrt durch die materiellen Verhältnisse konnten sich diese Äbte, Bischöfe, Priester, Gelehrte dem Dienste der Religion widmen. Rein, wie es aus dem Wesen des Empfindens dieser Leute hervorging, bildete sich die eigenartige Kultur dieses Christentums aus. Die geistigen Bestrebungen innerhalb des freien Frankentums wurden gefördert durch das Hereinströmen des keltischen Elementes. Das Keltentum, dessen feuriges Blut wieder zum Durchbruch kam, wurde zu Lehrern und Führern der geistig weniger regsamen Franken. Von Schottland und Irland herüber kamen keltische Mönche und Priester in großer Zahl, um im Frankenreich ihren Glauben zu verkündigen.
Das alles macht es möglich, daß das Christentum damals nicht ein Spiegelbild äußerer Verhältnisse war, sondern unbeengt vom materiellen Druck auf freiem Boden sich entwickeln konnte. Die Verhältnisse von Mitteleuropa wurden
bestimmt durch das Christentum. Alles Wissen des Altertums wurde auf diese Weise durch das Christentum für die germanischen Völker aufbewahrt. Aristoteles gab den geistigen Kern, den das Christentum zu begreifen suchte. Damals gab es noch keine Abhängigkeit von Rom. Frei konnte sich das christliche Leben im Frankenreiche ausbilden. Auch Platos Ideenwelt fand Eingang in dieses geistige Leben. Besonders geschah dies durch schottische und irische Mönche, vor allem durch Scotus Erigena in seinem Werke «Über die Einteilung der Natur», einem Werke, das eine Höhe des Geisteslebens bedeutet. So sehen wir, wie unbeirrt von äußeren Verhältnissen, geistiges Leben sich gestaltet. Die geistigen Strömungen nehmen gerade da ihr charakteristisches Gepräge an, wo sie unabhängig sind von wirtschaftlichen Verhältnissen. Später, als der materielle Druck sich ausdehnt, nehmen sie rückwirkend den Charakter dieser Verhältnisse an, dann aber fließen sie selbst da hinein und beeinflussen diese wieder.
Mehrere kleine Königreiche bildeten das Reich, das wir als das der Merowinger kennen und das erst später unter die Gewalt eines einzigen gelangte.
Nach dem, was Ihnen geschildert wurde, werden Sie einsehen, daß das südlichere Christentum anders sein mußte als dieses fränkische Christentum, mit dem es sich später vermischte. Das fränkische Christentum war verhältnismäßig unabhängig und konnte die politischen Verhältnisse zu seinen Gunsten benutzen. Je mehr die römische Herrschaft zurückgedrängt wurde, ein um so größerer Teil des Klerus ging aus den Franken hervor, dessen Bildung weit hinter der der anderen Geistlichen zurückstand; die gelehrten Priester und Mönche aber waren alle Kelten.
So waren in diesen Jahrhunderten allmählich die verschiedensten Völkerschaften durcheinander gerüttelt worden;
der Einfall der Hunnen hatte den Anlaß zu diesen Veränderungen gegeben. Während sich nun innerhalb der eigentlichen Kulturströmungen das gestaltete, was hier geschildert wurde, hatten sich äußerlich große Kämpfe abgespielt. Aber das, was wir die Kulturentwickelung nennen, wurde von diesen äußeren Kämpfen nicht wesentlich berührt.
Die Hunnen waren weit nach Westen vorgedrungen. Wenn wir nicht blind sind gegenüber dem, was alte Sagen verkünden, so wissen wir: sie waren bis nach Südfrankreich gelangt. In der alten Heldendichtung, die in lateinischer Sprache überliefert wurde, dem Waltharilied, wird erzählt, wie die Fürsten der germanischen Stämme, die Burgunder und Franken und so weiter, den Hunnen Geiseln geben mußten, darunter auch jenen Walthari, den Sohn des Fürsten des germanischen Volksstammes, der in Aquitanien herrschte. Von den Taten dieses Walther, des Hagen und des Gunther erzählt dieses Heldenlied. Fortwährend erfolgten nun Einfälle der Hunnen und beunruhigten die germanischen Völker weit nach Westen hin, bis endlich die Franken, Goten, sowie das, was vom römischen Volke noch übriggeblieben war, eine Macht bildeten, die sich den Hunnen im Jahre 451 entgegenstellte in der Schlacht auf den katalaunischen Feldern. Dies ist der erste Schlag, den die Herrschaft der Hunnen erlitt, eine Herrschaft, die schwer auf den Völkern lastete, die aber keinen dauernden Eindruck hinterließ.
Die Hunnen waren an Sitten und Gebräuchen ein den europäischen Völkern so fremdes Volk, daß die ganze Art und Gestalt der Hunnen als etwas ganz Seltsames geschildert wird. Wichtig war, daß dieses Volk eine kompakte Einheit bildete; eine bis zur Vergötterung sich steigernde Unterwürfigkeit unter ihren König Attila ließ sie den anderen
Völkern gegenüber von unwiderstehlichem Schrecken erscheinen. Nach der Schlacht auf den katalaunischen Feldern empfing diese Macht ihren letzten, entscheidenden Schlag durch Leo den Großen, den Bischof von Rom, der Attila entgegentrat und ihn bewog, zurückzugehen. Volkspsychologisch ist dieses Geschehnis verständlich. Leo kannte die Macht, die Attila auf sein Volk ausübte. Attila aber bei all seiner Macht kannte das nicht, was ihm da entgegentrat: das Christentum; darum beugte er sich ihm.
Die Herrschaft der Hunnen blieb somit eine Episode; dauernde Wirkung hatte viel mehr das, was aus dem Westen kam. Nach Attilas Tode 453 zerfiel die Macht der Hunnen bald wieder; auch die Herrschaft der Goten, Gepiden, Vandalen und so weiter war nichts Dauerndes, sie fanden sich eingeschlossen in schon gegebene Verhältnisse und konnten sich in ihrer Eigenart nicht erhalten. Dies geschieht dagegen im Frankenreiche; diese Kultur erweist sich treu dem Charakter des Frankenstammes, und so ist zu sehen, wie dieses Volk sich mächtig entwickelt. Wir sehen später aber auch, wie dieser Stamm die anderen mit Gewalt zwingt, das Christentum anzunehmen. Wir sehen ferner, daß nichts Geeigneteres vorhanden ist, die materielle Kultur auszugestalten, als das Christentum; allerlei Kulturgebilde erhalten ihr Gepräge von dem äußeren Christentum. Und weil sie den Charakter frei erhalten können, geben sie den Rahmen für lose Gebilde, in denen sich das geistige Leben entwickeln kann: so entstehen die geistlichen Wirtschaftsgemeinschaften im Kloster und so weiter. Mit der Zeit aber entsteht eine Unzusammengehörigkeit der geistigen und wirtschaftlichen Kultur. Trotzdem das Reich Karls des Großen sich zu einem christlichen Reiche macht, aber mit Gewalt das Christentum ausbreitet, stellt es sich in Widerspruch zum Geist des Christentums. Daher paßt bald
das Christentum nicht mehr zum Wirtschaftsleben. Die Verhältnisse des Wirtschaftslebens werden als drückende empfunden, und so entstehen die freien Städte.
Dies ist die Entwickelung der geistigen und der materiellen Kultur in großen Zügen. Die Verhältnisse in ihrer eigentlichen Bedeutung werden Ihnen vorgeführt. Sie sehen, wie erst als die geistigen Strömungen nicht mehr mit den materiellen Verhältnissen zusammenfielen, dieses Mißverhältnis seinen Ausdruck findet in der Entstehung einer rein materiellen Kultur, der Städtekultur. Denn aus materiellem Interesse waren diese Wirtschaftsgebilde entstanden. Die Bevölkerung, die es nicht aushalten konnte auf dem Lande, sie drängte hinein in die Städte, um dort Schutz und Sicherheit zu finden. So sehen wir neue Wirtschaftsgebilde entstehen, die von weittragendster Bedeutung werden sollten. Sie sehen Reiche entstehen und vergehen und neue Gebilde an die Stelle von alten treten. Sie sehen aber auch, daß wir ihren Organismus nur verstehen, wenn wir erkennen, wie sich das erste maßgebende Reich, das Frankenreich, gestaltete. Nicht hineingedrängt in schon bestehende Verhältnisse, sondern dort, wo Raum zu freier Ausdehnung geboten war, hatte sich das Wesen dieses Volksstammes entwikkelt und seine Herrschaft ausgestalten können.
Nicht nur gründlich durcheinandergerüttelt, sondern neu gebildet waren die Volksstämme, die durch die große Völkerwanderung aus ihren Wohnsitzen getrieben waren. Einige waren ganz aus der Geschichte verschwunden, andere traten an ihre Stelle. Nicht nur von außen, viel mehr im tiefsten Grunde ihres Charakters hatte sich die große Umwandlung vollzogen. Wir sehen bei Beginn der Epoche der Völkerwanderung die verschiedenen germanischen Völker die Frage an das Schicksal stellen. Für die Goten, die ein tolerantes Christentum sich erwählt hatten, bedeutete diese
Frage die Vernichtung, für die Franken, die unter anderen, freieren, für sie günstigeren Verhältnissen vor diese Frage gestellt wurden, bedeutete sie die Machtentfaltung auf Jahrhunderte hinaus. Ob zum Heile der Gesamtheit? Das werden wir in der Folge sehen.
VIERTER VORTRAG, 8. November 1904
Es ist ein gebräuchliches Vorurteil das Wort: die menschliche Entwickelung gehe in einem regelmäßigen, sukzessiven Gange vorwärts, die Entfaltung der geschichtlichen Ereignisse mache nirgends Sprünge. Alimähliches und sukzessives Fortschreiten sei Entwickelung. Das hängt zusammen mit einem anderen Vorurteil: denn auch von der Natur heißt es, sie mache keinen Sprung. Das wird immer wieder gesagt, es ist aber unrichtig für die Natur wie für die Geschichte. Wir sehen in der Natur nirgends, wenn es sich um gewaltige Fortschritte handelt, Sprungloses. Nicht allmählich ist ihr Gang, sondern aus kleinen Vorgängen ergeben sich wichtige Folgen; das Allerwichtigste geschieht doch durch Sprünge. Man könnte viele Fälle aufzählen, wo die Natur durchaus in solcher Weise fortschreitet, daß wir ein Übergehen der Formen geradezu in ihr Gegenteil beobachten können.
In der Geschichte ist dies besonders wichtig, weil wir da zwei solche bedeutende Ereignisse haben, die sich zwar allmählich vorbereiten, dann abfluten, aber doch ein sprunghaftes Vorwärtsschreiten bedeuten. Erstens die Begründung der freien Städte am Anfang des Mittelalters und zweitens die großen Erfindungen und Entdeckungen am Ende des Mittelalters. Die Geschichte rückt rascher vor um
die Wende des ii. zum 12. Jahrhundert. Es entwickeln sich neue Gesellschaftsformen aus alten; daraus, daß viele Menschen ihre Wohnsitze verlassen und sich in den Städten niederlassen, entstehen durch Deutschland, Frankreich, England, Schottland, bis nach Rußland und Italien, solche Städte mit neuen Lebensbedingungen, Ordnungen, Rechten und Verfassungen. Dann am Ende des Mittelalters finden wir die großen Entdeckungen, die Seereisen nach Indien, Amerika und so weiter, die weltumfassende Erfindung der Buchdruckerkunst. Alles das zeigt uns, welche radikale Veränderung hervorgerufen ist durch das Aufkeimen des neuen Wissenschaftsgeistes, durch Kopernikus.
Damit sind zwei Einschnitte gegeben, und will man sinnvoll das Mittelalter betrachten, so müssen diese zwei Ereignisse in richtige Beleuchtung gestellt werden. Man könnte sagen, alles deutet hin auf diese großen Ereignisse. Sie nehmen sich aus wie Sprünge; aber es bereitet sich solch ein Ereignis langsam vor, um dann mit lawinenartiger Kraft hervorzubrechen und vorwärts zu fluten. Wenn wir sie weiter verfolgen, wird sich schrittweise zeigen, wie diese beiden Ereignisse sich vorbereitet haben im Leben der Germanen. Wir werden sehen, durch welche Umstände gerade dem Frankenvolke jene Macht zuteil wurde, jener Einfluß auf die Gestaltung der europäischen Verhältnisse. Man muß dazu den Charakter dieses Volkes verstehen, die notwendige Umgestaltung der Gesellschaftsverhältnisse und den machtvollen Einschlag durch das Christentum im 4. Jahr-hundert. Diese zwei Dinge bedeuten die Änderung im Leben der Germanen. Sie bedingen die Entwickelung des Mittelalters. Es wäre nutzlos, alle diese Wanderungen der Germanen weiter zu verfolgen, zu sehen, wie Odoaker den letzten weströmischen Kaiser entthronte, wie die Goten durch Kaiser Justinian aus Italien vertrieben werden, wie die
Langobarden von Norditalien Besitz ergreifen - wir sehen immer dieselben Verhältnisse sich abspielen.
In südlichen Gegenden, wo die Germanen festgefügte politische, wirtschaftliche Verhältnisse vorfinden, verschwanden die Eigentümlichkeiten dieser Völkerschaften; sie haben jede Bedeutung verloren. Wir hören nichts mehr von Goten, Gepiden und so weiter; sie sind bis auf den Namen verschwunden. Im Gegensatz dazu waren die Franken in noch nicht gefestigte, freie Verhältnisse, wo noch kein ernster Besitz bestand, gelangt. Durch diese politische Konfiguration wurden die Franken das maßgebende Volk.
Nun müssen wir sehen, wie in diesem Frankenreich sich dieses Gebilde entwickelt hat, das wir als merowingisches Königreich bezeichnen. Es war eigentlich nichts anderes als die vielen kleinen Königreiche, die sich auf natürlichste Weise bildeten. Die Merowinger blieben als Sieger, nachdem sie die anderen ihnen ursprünglich Gleichen überwunden hatten. Alle diese Königreiche hatten sich auf folgende Weise gebildet; irgendein kleiner Stamm wanderte ein, unterjochte die Einwohner, verteilte das Land, so daß alle Mitglieder kleinere und größere freie Besitztümer erhielten. So wurden alle solche Gebiete auf Grundbesitz begründet. Der Mächtigste erhielt das größte Gebiet. Zur Bebauung desselben wurde eine große Anzahl von Leuten gebraucht, die aus der Bevölkerung entnommen wurde, zum Teil wurden auch Gefangene aus den Kriegen zu Arbeitern gemacht. Nur durch diesen Unterschied des kleineren und größeren Grundbesitzes bildeten sich die Machtverhältnisse heraus. Der größte Grundbesitzer war eben der König. Seine Macht beruht auf dem Grundbesitz, das ist das Charakteristische. Aus diesen Machtverhältnissen bildeten sich die Rechtsverhältnisse heraus, und es ist interessant zu beobachten, wie auf dieser Grundlage die Rechtsverhältnisse
sich entwickeln. Allerdings finden wir bei den alten germanischen Stämmen ihre Gewohnheitsrechte, die sich in alten Zeiten, in die wir keinen Einblick mehr haben, entwickelt hatten. Bei den kleineren Stämmen versammelten sich alle Leute, um Recht zu sprechen; später kamen die Stammesgenossen nur am 1. März zusammen, um über ihre Angelegenheiten zu beraten. Jetzt war aber der Großgrundbesitzer den anderen gegenüber unverantwortlich für das, was er tat auf seinem Gebiet. Zwar finden wir ein konservatives Festhalten an den alten Rechtsgewohnheiten bei den verschiedenen Stämmen. Lange bewahrt finden wir sie besonders bei den Sachsen; Thüringern, Friesen, auch bei den Cheruskern, deren Stamm sich länger erhalten hat als man gewöhnlich glaubt. Anders war es, wo Großgrundbesitz sich entwickelte, weil der Besitzer, da er. auf seinem Gebiete unumschränkt war, auch unverantwortlich wurde. Er hatte die Macht, Gerichtsbarkeit, Polizeigewalt auszuüben. Aus der Unverantwortlichkeit bildete sich ein neuer Rechtsstand heraus. Wenn ein anderer einen Verstoß beging, wurde er zur Verantwortung gezogen; wenn es der Unverantwortliche tat, wurde derselbe Verstoß als Recht angesehen. Was bei den nicht Mächtigen Unrecht war, das war bei den Mächtigen Recht. Er hatte die Möglichkeit, Macht in Recht umzuwandeln.
Nun bedenke man, daß auf diese Weise namentlich im Nordwesten die Franken ihre Macht weiter ausdehnen konnten, große Gebiete erobern konnten. In einer Zeit, wo Krieg und immer Krieg war, waren die weniger Mächtigen auf den Schutz der Mächtigen angewiesen. Da entstand das Lehn- und Vasallenwesen, das eine Auslese der Mächtigsten hervorrief. Es entstand die Art und Weise, durch Verträge gewisse Rechte zu übertragen. Der große Grundbesitz, das Königsgut erlangte besondere Rechtsverhältnisse, die vom
König oder vom Besitzer auch auf andere übertragen werden konnten. Mit dem Land zugleich wurde die Gerichtsbarkeit und die Polizeigewalt übertragen. Es entstand Königsrecht und Recht der kleinen Vasallen. Dadurch, daß eine solche Umlagerung eintrat, sehen wir ein mächtiges Beamtentum sich entwickeln, nicht auf Grund von Besoldung, sondern von Grundbesitz. Solche Gerichtsherren waren oberste Richter. Anfangs, wo sie auf die Rechte mächtiger Stämme noch Rücksicht zu nehmen hatten, waren sie verpflichtet, alte Rechte zu respektieren. Aber allmählich wurde dieses Verhältnis ein absolutes Richtertum, so daß in der Folge im Frankenreich neben dem Königtum eine Art Beamtenadel sich bildete, der zum Rival des Königtums heranwuchs. Erst war er abhängig, dann wurde er mächtig und Rival. So mußte sich schon im 6. Jahrhundert im Frankenreich immer stärker die Rivalität zwischen dem Königtum und dem Beamtenadel entwickeln, und dieser zur größten Bedeutung gelangen.
Das ursprüngliche Herrschergeschlecht, das aus den Großgrundbesitzern hervorgegangen ist, die Merowinger, wird abgelöst von den Karolingern, die ursprünglich zu dem Beamtenadel gehörten. Sie bildeten die Hausmeier, Majordomus, des ersten Herrschergeschlechtes, das durch die Rivalität des Beamtenadels gestürzt wurde. Im wesentlichen war es also der Großgrundbesitz, der hier die Machtverhältnisse begründete, und die mächtigste moralische Strömung, die Kirche, mußte auf diesem Umwege des Großgrundbesitzes ihre Herrschaft einleiten.
Das Charakteristische bei der fränkischen Kirche ist, daß sie zunächst nichts als eine Anzahl von Großgrundbesitzungen darstellt: wir sehen Bistümer und Abteien entstehen, und Vasallen, die, wie sonst unter dem Schutz der Großgrundbesitzer, in den Schutz der Kirche sich begeben,
um von ihr Lehen zu empfangen. So bildeten sich neben weltlichen geistliche Großgrundbesitzer. Dies ist der Grund, warum wir so wenig Tiefe und Wissenschaft wahrnehmen, und daß das, was wir an Geistigem dort im Christentum finden, wesentlich fremden Einflüssen zu verdanken ist. Nicht innerhalb des Frankenvolkes, sondern durch Angehörige des angelsächsischen, besonders des keltischen Stammes auf den britischen Inseln, ist es gelungen, jenen mächtigen Strom zu schaffen, der sich dann nach Osten er-goß. Auf den britischen Inseln wirkten bedeutende Gelehrte, fromme Mönche in ernster Vertiefung. Hier ist wirklich gearbeitet worden, wie wir im einzelnen an der Wiederaufnahme des Platonismus und seiner Vereinigung mit dem Christentum sehen. Wir sehen Mystik, Dogmatismus, aber auch Enthusiasmus und begeistertes Pathos von hier ausgehen. Von hier aus kommen die ersten Bekehrer:
Columban, Gallus und Winfrid-Bonifatius, der Bekehrer der Deutschen. Und diese ersten Missionare, weil sie nichts als das Geistige des Christentums im Auge hatten, sind nicht geneigt, den Verhältnissen des Frankenstammes sich anzupassen. Sie sind die treibende Kraft und haben auch, besonders Bonifatius, ihren Haupteinfluß bei den östlichen Germanen. - Deswegen greift im Frankenreiche in dieser Zeit ein steigender Einfluß von Rom aus Platz. - Wir müssen nun sehen, was vorher gestaltend gewirkt hat. Da haben wir zwei heterogene Elemente, die sich einander anpassen: die rauhe Kraft des Germanen und die geistige Lehre des Christentums. Wunderbar erscheint es, wie diese Stämme sich dem Christentum anpassen und wie das Christentum sich selbst wandelt, um sich dem Germanentum anzupassen. Anders arbeiten diese Sendboten als die fränkischen Könige, die mit der Gewalt der Waffen das Christentum ausbreiteten. Nicht als etwas Fremdes wird
es in ihre Seele gedrängt: geschont werden die Kultusstätten, heilige Sitten, Gebräuche und Personen, so geschont, daß alte Einrichtungen benutzt wurden, um den neuen Gehalt auszugießen. Interessant ist es, wie das Alte das Kleid, das Neue die Seele wird. Wir besitzen aus jener Zeit, aus dem sächsischen Stamm, eine Schilderung des Jesus-Lebens: Sie nahmen die Gestalt des Jesus, aber alle Einzelheiten wurden germanisch überkleidet, Jesus erscheint als deutscher Herzog, der Verkehr mit den Jüngern gleicht einer Volksversammlung. So wird im «Heliand» das Leben Jesu dargestellt.
Alte Helden werden in Heilige verwandelt, Feste, Kultusgebräuche in christliche. Vieles von dem, was heute die Leute für christliches Alleingut halten, ist damals eingewandert von heidnischen Gebräuchen. Im Frankenreich dagegen müssen wir sehen, daß die Franken im Christentum nichts anderes sehen als ein Mittel zur Befestigung ihrer Machtverhältnisse: ein fränkisches Rechtsbuch beginnt mit einer Berufung auf Christus, der die Franken liebt vor allen anderen Völkern.
Das sind so Arten, wie diese beiden welthistorischen Strömungen ineinanderwachsen. In der Zeit, wo die britischen Missionare den moralischen Einfluß des Christentums vertreten, steigt auch der Einfluß der römischen Kirche bedeutend. Ausgehend von dem, was hier vorgearbeitet war, suchen die Frankenkönige Anlehnung an das Papsttum. Die Langobarden hatten Italien besetzt und beunruhigten namentlich den Bischof von Rom. Sie waren arianische Christen. Das bewirkte, daß der römische Bischof sich zunächst hilfesuchend an die Franken wandte, aber zugleich seinen Einfluß den Franken anbot. So wurde der fränkische König Schützer des Papstes, und der Papst salbte den König: daher leiteten die fränkischen Könige ihre besondere
Stellung, den besonderen Glanz ihrer Würde von dieser Heiligung durch den Papst ab. Das war eine Verstärkung dessen, was die Franken im Christentum gesehen hatten. Dies alles vollzieht sich im wesentlichen im 7. Jahrhundert. Durch dieses Bündnis zwischen Papsttum und Frankenherrschaft bereitete sich die spätere Krönung Karls des Großen langsam vor. So sehen wir also mächtige soziale und geistige Veränderungen sich vollziehen. Aber das allein hätte nicht zu jenem Ereignis geführt, das ich als eines der wichtigsten bezeichnete, als eine materielle Revolution: die Begründung von Städten. Denn es fehlte der fränkischchristlichen Kultur etwas, trotzdem Tüchtigkeit, Geist und Tiefe da waren.
Nicht vorhanden war, was man als Wissenschaft, als rein äußerliche Wissenschaft bezeichnet. Lediglich eine materielle und eine moralische Bewegung haben wir verfolgt. Das, was an Wissenschaft vorhanden war, war stehengeblieben auf derselben Höhe wie zur Zeit der Berührung mit dem Christentum. Und wie die Frankenvölker kein Interesse hatten an der Verbesserung ihrer einfachen Agrikultur, nicht daran dachten, sie wissenschaftlich auszubilden, ebenso suchte die Kirche nur ihren moralischen Einfluß auszubauen. Der primitive Ackerbau bot keine besonderen Schwierigkeiten, die wie in Ägypten zur Entwickelung der Physik, der Geometrie, der Technik geführt hätten. Alles war hier einfacher, ursprünglicher; so wie auch die schon bestehende Geldwirtschaft wieder durch Naturalwirtschaft ersetzt worden war.
So brauchte die europäische Kultur einen neuen Einschlag, und man versteht sie nicht, wenn man nicht diesen Einschlag würdigt. Vom Fernen Osten her, woher einst das Christentum gekommen, aus Asien kommt diese neue Kultur durch die Araber. Die Religion, die durch Mohammed
dort gegründet worden war, ist in ihrem religiösen Gehalt einfacher als das Christentum. Der innere Gehalt des Mohammedanismus gründet sich im wesentlichen auf einfache monotheistische Ideen, die sich beschränken auf ein göttliches Grundwesen, dessen Natur und Gestalt man nicht besonders erforscht, das man nicht ergründet, in dessen Willen man sich aber ergibt, das man glaubt. Deshalb ist diese Religion dazu geschaffen, ein ungeheures Vertrauen in diesen Willen hervorzurufen, das zum Fatalismus führt, zur willenlosen Ergebung. Daher war es möglich, daß in wenigen Menschenaltern diese Stämme die arabische Herrschaft ausdehnten über Syrien, Mesopotamien, Nordafrika bis zu dem Reich der Westgoten in Spanien, so daß bereits um die Wende des 7. zum 8. Jahrhundert die Mauren ihre Herrschaft dort ausbreiteten und an die Stelle der westgotischen ihre eigene Kultur setzten.
So strömt etwas ganz Neues, Andersgeartetes in die europäische Kultur. Auf eigentlich geistigem, religiösem Gebiet hat diese arabische Kultur nur einen einfachen Inhalt, der in der Seele gewisse Kräfte begründete, aber nicht viele Vorstellungen erwirkte, nicht den Geist besonders in Anspruch nahm. Dieser Geist war nicht erfüllt vom Nachdenken über Dogmen, über Engel und Dämonen und so weiter. Aber war der Geist nicht damit erfüllt, so mit dem, was den christlich-germanischen Stämmen damals fehlte: mit äußerer Wissenschaftlichkeit. Fortgebildet finden wir hier alle jene Wissenschaften, wie Medizin, Chemie, mathematisches Denken. Der praktische Geist, der aus Asien mit nach Spanien gebracht war, fand nun in Seefahrten und so weiter Betätigung. Er wurde hinübergebracht in einer Zeit, wo dort ein wissenschaftsloser Geist sein Reich begründet hatte. Die maurischen Städte wurden Stätten ernster, wissenschaftlicher Arbeit: wir sehen da eine Kultur, die jeder,
der sie kennt, nur bewundern kann, von der ein Humboldt sagte: «Diese Weite, diese Intensität, diese Schärfe des Wissens ist ohne Beispiel in der Kulturgeschichte.» Diese maurischen Gelehrten sind voll Weitblick und Tiefsinn und haben nicht nur wie die Germanen die griechische Wissenschaft übernommen, sondern vorgebildet. Aristoteles lebte auch bei diesen fort, aber bei den Arabern der wahre Aristoteles als Vater der Wissenschaft, verehrt mit großem Weitblick. Es ist interessant zu sehen, wie das, was in Griechenland vorgebildet war, die alexandrinische Kultur, dort fortlebte, und damit haben wir eine der merkwürdigsten Strömungen im menschlichen Geistesleben berührt. Die Araber lieferten die Grundlagen zur objektiven Wissen-schaft. Diese strömte zunächst von da aus ein in die angelsächsischen Klöster in England und Irland, wo das alte energische keltische Blut lebte. Eigentümlich war es zu sehen, was für ein reger Verkehr zwischen ihnen und Spanien eingeleitet wurde, und wie dort, wo Tiefsinn und Fähigkeit zum Denken vorhanden war, die Wissenschaft durch Vermittlung der Araber auflebte.
Und es ist eine merkwürdige Erscheinung, wenn wir weiter sehen, daß die Araber, die anfangs ganz Spanien in Besitz nahmen, bald äußerlich besiegt wurden in der Schlacht bei Poitiers 732 durch die Franken unter Karl Martell. Damit siegte äußerlich die physische Kraft der Franken über die physische Kraft der Mauren. Aber unbesiegbar bleibt die geistige Kraft der Araber, und so wie einst die griechische Bildung erobernd in Rom auftritt, so erobert sich die arabische Bildung den Westen, den siegreichen Germanen gegenüber. Wenn nun die Wissenschaft, die man braucht, um den Gesichtskreis für Handel und Weltverkehr auszubreiten, wenn die Städtekultur entsteht, so sehen wir, daß es arabische Einflüsse sind, die hier sich geltend
machen, ganz neue Elemente, die hier einströmen, und die versuchen, sich den alten anzupassen.
Daß jemand wohl verwirrt werden konnte, der mit freiem Blick diese sich widerstrebenden Strömungen im Mittelalter verfolgte, sehen wir an Walther von der Vogeiweide zum Ausdruck kommen. Der Dichter sah, wie die Germanenvölker nach äußerer Macht strebten, sah vom Christentum eine entgegengesetzte Strömung ausgehen. - Denn ich bitte Sie zu beachten, daß das Christentum erst später jene Form annahm, die ihm dann anhaftete. - Bei Walther von der Vogelweide sehen wir in Empfindung umgewandelt, was das Mittelalter durchströmte, in der wehmütigen Schilderung:
Gar bänglich bedachte ich mir,
Weshalb man auf der Welt wohl sei.
Es fiel mir keine Antwort bei,
Wie man drei Ding' erwürbe,
Daß keins davon verdürbe.
Die zwei sind Ehr' und weltlich Gut,
Das oft einander Schaden tut;
Das dritt' ist Gott gefallen,
Das wichtigste von allen.
Die wünscht' ich mir in einen Schrein.
Doch leider kann das nimmer sein,
Daß weltlich Gut und Ehre
Und Gottes Huld je kehre
Ein in dasselbe Menschenherz.
Sie finden Hemmnis allerwärts:
Untreu legt allenthalben Schlingen,
Gewalt darf alles niederzwingen,
So Fried' als Recht sind todeswund,
Und nimmer finden Schutz die drei,
Eh' diese zwei nicht sind gesund.
Wir wollen dann weiter sehen, wie schwer es dem Mittelalter selbst wurde, diese drei Dinge im Herzen zu vereinigen, und wie sie die großen Kämpfe hervorgerufen haben, die das Mittelalter zerrissen.
FÜNFTER VORTRAG, 15. November 1904
Wenn Sie irgendeines der gebräuchlichen Schulbücher oder eine der anderen üblichen Darstellungen des Mittelalters über die Zeit, von der wir jetzt sprechen werden - vom 8. oder 9. Jahrhundert -, in die Hand nehmen, so nimmt darin einen außerordentlichen Raum ein die Persönlichkeit Karls des Großen. Aber Sie werden wenig von dem verstehen, was eigentlich das Bedeutungsvolle dieses Zeitalters ausmacht, wenn Sie diese Eroberungszüge und Taten Karls des Großen in dieser Weise verfolgen. All das war nur ein äußerer Ausdruck für viel tiefere Ereignisse im Mittelalter, die sich darstellen werden als das Zusammenspiel vieler bedeutender Faktoren. Wollen wir diese betrachten, so müssen wir dazu Dinge streifen, die wir schon berührt haben, um Licht da hineinzubringen.
Wenn Sie sich erinnern an die Schilderung europäischer Verhältnisse unmittelbar nach der Völkerwanderung, als hier und da nach diesem Ereignisse germanische Völker zur Ruhe gekommen waren, so werden Sie daran denken müssen, daß sich diese Völker ihre altgewohnten Einrichtungen, ihre Sitten und Gebräuche in die neuen Wohnsitze mitgebracht hatten und sie dort ausbildeten. Dabei sehen wir, daß sie sich eine Eigentümlichkeit bewahrt haben: eine Art soziale Ordnung, bestehend in der Verteilung von Privat- und Gemeineigentum. Es waren kleine soziale Verbände,
in denen sie ursprünglich lebten, Dorfgemeinden, dann später Hundertschaften, Gaue, und in allen gab es Gemeineigentum an alledem, was Gemeineigentum sein konnte:
Wald, Wiese, Wasser und so weiter. Und nur, was der Einzelne bebauen konnte, der einzelne Feldanteil, die Hufe, wurde der Privatfamilie zugeteilt, wurde erblich. Alles andere blieb Gemeineigentum.
Nun haben wir gesehen, wie die Führer solcher Stämme größere Gebiete bei der Eroberung zuerteilt bekamen, und wie dadurch gewisse Herrschaftsverhältnisse entstanden, namentlich in Gallien, wo vieles Land noch urbar zu machen war. Für die Bearbeitung dieser Ländereien nahm man teils die Angehörigen der früheren Bevölkerung, teils die römischen Kolonen oder Kriegsgefangene. Dadurch bildeten sich gewisse Rechtsverhältnisse heraus. Der Großgrundbesitzer war unverantwortlich für das, was er tat innerhalb seines Besitzes; er konnte für das, was er verfügte, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Daher konnte er für sein Besitztum Rechtsvorschriften, Polizeimaßregeln erlassen. Wir treffen also in dem Frankenreiche kein einheitliches Königtum; das, was man das Reich der Merowinger nennt, war nichts anderes als ein solcher großer Grundbesitz. Die Merowinger waren eine der großgrundbesitzenden Familien; aus privatrechtlichen Verhältnissen hervorgegangen, dehnte sich ihre Herrschaft aus dem Kampfe ums Dasein immer weiter aus. Immer neue Gebiete wurden hineingezogen. Der Großgrundbesitzer war nicht in der Weise König, wie wir es seit dem 13. und 14., ja noch im 16. Jahrhundert gewohnt sind, sondern privatherrschaftliche Verhältnisse gingen in Rechtsverhältnisse über.
Er übertrug gewisse Teile seines Gebietes an andere, minder Begüterte - weil er nicht alles selbst bebauen konnte - und mit ihnen seine Rechte; das nannte man «unter
Immunität»: jene Richtergewalt, die aus der Unverantwortlichkeit in solchen Verhältnissen erwachsen war. Dafür mußte der Betreffende Abgaben entrichten und dem König in dem Kriege Heeresfolge leisten. In solcher Ausbreitung der Besitzverhältnisse ging das Geschlecht der Merowinger als Sieger hervor über andere, so daß wir an der Formel festhalten müssen: das alte Frankenreich ging hervor aus rein privatrechtlichen Verhältnissen.
Und wiederum geschah der Übergang von den Merowingern zum Karolingergeschlecht, aus dem Karl Martell entstammte, auf dieselbe Art, aus denselben Verhältnissen heraus. Die Karolinger waren ursprünglich Verwalter der Domänen der Merowinger, aber allmählich so einflußreich geworden, daß es Pippin dem Kleinen gelang, den blödsinnigen Childerich in ein Kloster zu stecken und mit Hilfe des Papstes abzusetzen. Von ihm stammte sein Nachfolger, Karl der Große. In raschem Fluge können wir die äußeren Ereignisse nur streifen, denn sie haben keine besondere Bedeutung. Karl der Große bekriegt die umliegenden deutschen Volksstämme und dehnt gewisse Herrschaftsverhältnisse aus. Man kann dieses Reich noch nicht einen Staat nennen. Er führte lange Kämpfe gegen die Sachsen, die an der alten Dorfverfassung, an den alten Sitten und Gebräuchen, dem alten germanischen Glauben mit großer Zähigkeit festhielten. Die Eroberung geschah nach langwierigen Kriegen, die mit außerordentlicher Grausamkeit von beiden Seiten geführt wurden.
Bei solchen Stämmen, wie die Sachsen waren, tat sich irgendeine Persönlichkeit besonders hervor, die dann zum Führer wurde. Diesmal war es ein Herzog mit großen Besitztümern, starkem Heeresgefolge, Widukind, dessen Tapferkeit heftigsten Widerstand leistete. Er wurde mit der größten Grausamkeit niedergezwungen und mußte sich der
Herrschaft Karis des Großen unterwerfen. Was bedeutet solche Herrschaft? Sie bedeutet folgendes: Wenn Karl der Große wieder abgezogen wäre, so wäre nichts Besonderes geschehen gewesen. Solche Stämme, die sich zu Tausenden hatten taufen lassen müssen, hätten doch in derselben Weise fortgelebt wie früher.
Das Mittel, um hier ein Herrschaftsverhältnis zu begründen, war die Form, die Karl der Große hier der Kirche gegeben. Mittels der Macht der Kirche wurden diese Gebiete unterworfen. Bistümer und Klöster wurden gegründet, die große Besitztümer zuerteilt erhielten, welche früher die Sachsen besaßen. Die Bebauung wurde durch die Bischöfe und Äbte besorgt; damit trat die Kirche das an, was sonst der durch Immunität geschützte, weltliche Grundbesitz getan, die richterliche Gewalt. Wenn die Sachsen sich nicht fügten, wurden sie durch neue Einfälle Karls des Großen gezwungen. So geschah dasselbe, wie im westlichen Frankenreich: die kleineren Besitzer konnten sich als Einzelne nicht halten, sie schenkten daher was sie hatten den Klöstern und Bistümern, um es wieder als Lehen zu erhalten.
Das eine Verhältnis ist also, daß große Besitzungen direkt zur Kirche gehörten, wie bei den neugegründeten Bistümern Paderborn, Merseburg, Erfurt, die für den Bischof von den Unterworfenen bebaut wurden. Aber auch diejenigen, welche noch selbst Besitztümer hatten, nahmen sie zu Lehen und mußten immer größere Abgaben an die betreffenden Bistümer und Abteien geben. Damit war hier die Herrschaft Karls des Großen begründet, ein Machtverhältnis zustande gekommen, mit Hilfe des großen Einflusses, den die Kirche gewann, deren Oberherrscher er war.
So wie hier dehnte Karl seine Macht auch in andere Gegenden aus. In Bayern gelang es ihm, die Macht des Herzogs
Tassilo zu brechen, ihn ins Kloster zu stecken und damit Bayern in sein Herrschaftsverhältnis einzubeziehen. Die Bayern hatten sich mit den Awaren, einem Volke, das man als Nachkommen der Hunnen bezeichnen kann, verbündet. Karl blieb in diesem Kampfe siegreich und hat einen Streifen Landes als Grenzmark gegen die Awaren befestigt, die awarische Mark, das Ursprungsland des heutigen Österreich. In eben dieser Weise hat er sich auch einen gegen die Dänen geschaffen.
Gegen die Langobarden, die den Papst beunruhigten, kämpfte er in Italien wie Pippin, er blieb siegreich und begründete abermals dort ein Herrschaftsverhältnis. Er versuchte es auch gegen die Mauren in Spanien. Fast überall blieb er Sieger. Wir sehen über die damalige europäische Welt die Frankenherrschaft sich begründen, die wir nicht Staat nennen können, die bloß die Keime der künftigen Staatsgewalt enthielt.
In solchen neugewonnenen Gegenden waren auch Grafen eingesetzt, die richterliche Gewalt ausübten. In Gegenden, wo Karl der Große abwechselnd seinen Hof abhielt, an gesicherten Plätzen, die man Pfalzen nannte, waren es die Pfalzgrafen, meist Großgrundbesitzer, die gewisse Abgaben bekamen von den umliegenden Gebieten. Doch nicht nur von Grund und Boden, auch Erträgnisse, die aus der Rechtssprechung erwuchsen, fielen ihnen zu. War jemand gemordet worden, so wurde vom Gau- oder Pfalzgrafen das öffentliche Gericht zusammengerufen. Ein Verwandter, oder jemand, der in näherem Verhältnis zu dem Ermordeten stand, führte Klage. Für Mord konnte damals ein gewisses Wehrgeld gezahlt werden, das für Freie und Unfreie verschieden war, eine bestimmte Summe, die teils an die Familie des Gemordeten, teils an den Gau- oder Pfalzgrafen gezahlt wurde; ein Teil mußte an die königliche
Zentralkasse abgeliefert werden. Für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, es waren eigentlich nur solche, die sich auf Abgaben und Verteidigung bezogen, und zur Beaufsichtigung, waren Landgrafen, die von einem Land zum anderen reisten, angestellt, Botschafter ohne besondere Funktionen.
Unter diesen Verhältnissen bildete sich immer mehr heraus das, was man den Gegensatz nennen könnte zwischen dem neuen Grundbesitzeradel und den Hörigen, sowie denjenigen Freien, die zwar persönlich noch frei waren, aber in ein scharfes Abhängigkeitsverhältnis gerieten dadurch, daß sie große Abgaben zu zahlen und Heeresfolge zu leisten hatten. Diese Verhältnisse spitzten sich immer mehr zu, weltlicher und kirchlicher Besitz dehnten sich immer weiter aus, und bald schon, im 10., 11. und 12. Jahrhundert, sehen wir das Volk in schwerer Abhängigkeit, treffen wir schon auf kleinere Empörungen, Revolten, als Vorherverkündigung dessen, was wir als Bauernkriege kennen. Daß sich dabei die materielle Kultur immer produktiver entwickelte, werden Sie begreifen. Viele germanische Stämme hatten vor der Völkerwanderung noch nicht Akkerbau betrieben, sondern ihren Unterhalt durch Viehzucht gewonnen; jetzt entwickelten sie sich immer mehr zum Ackerbau; hauptsächlich wurde Hafer und Gerste angebaut, aber auch Weizen und Lein (Flachs) und so weiter. Das ist das Wesentliche, was der älteren Kultur Bedeutung gab. Das eigentliche Handwerk gab es damals noch nicht, es entwickelte sich erst unter der Oberfläche; Weberei, Färberei und so weiter wurden im Hause meist von den Frauen betrieben; Schmiede- und Goldschmiedekunst waren die ersten Handwerke, die sich herausbildeten. Noch unbedeutender war der Handel.
Eigentliche Städte entwickelten sich vom 10. Jahrhundert
ab. Ein geschichtliches Ereignis bereitet sich damit vor. Aber das, was von diesen Städten ausgegangen ist, der Handel, hatte damals keine Bedeutung, höchstens wurde von israelitischen Kaufleuten ein Handel mit Kostbarkeiten aus dem Orient betrieben. Gebräuche des Handels gab es fast gar nicht, trotzdem Karl der Große schon Münzen prägen ließ. Fast alles war Tauschhandel, bei dem Vieh, Waffen und dergleichen Dinge ausgetauscht wurden.
So müssen wir uns die materielle Kultur jener Gebiete vorstellen, und nun werden Wir begreifen, warum auch die geistige Kultur ein ganz bestimmtes Gepräge annehmen mußte. All das, was wir uns als geistige Kultur vorstellen, gab es in diesen Gegenden weder bei Freien noch bei Hörigen. Jagd, Krieg, Ackerbau war die Beschäftigung der Grundbesitzer. Als Symptom hierfür diene, daß nicht nur die Bauern, sondern Gutsbesitzer, Fürsten, Herzöge, Könige, selbst Dichter, wenn sie nicht geistlich waren, selten lesen und schreiben konnten. Wolfram von Eschenbach mußte seine Dichtungen einem Kleriker diktieren und sich von ihm vorlesen lassen, und Hartmann von der Aue rühmt als eine besondere Eigenschaft, daß er in Büchern lesen konnte. Und bei allen denjenigen, die die weltliche Kultur besorgten, war nicht die Rede davon, daß sie lesen und schreiben konnten.
Nur im Innersten der Klöster wurde die Pflege der Wissenschaft und Kunst betrieben. Alle anderen waren auf das angewiesen was ihnen durch die Geistlichen an Belehrung und Predigt geboten wurde. Und das bedingt ihre Abhängigkeit von Geistlichen und Mönchen, es bedeutet die Herrschaft der Kirche.
Wenn wir heute geschildert finden das, was man als «finsteres Mittelalter», Ketzerverfolgungen, Hexenprozesse versteht, müssen wir uns klar sein, daß wir damit von Verhältnissen
sprechen, die erst mit dem 13. Jahrhundert beginnen. In diesen älteren Zeiten hat so etwas nicht bestanden. Die Kirche führte keine andere Herrschaft als der weltliche Großgrundbesitz. Entweder ging die Kirche Hand in Hand mit der weltlichen Herrschaft, war nur ein Glied derselben, oder sie war bestrebt, christliche Wissenschaft und Theologie auszubilden.
Bis der Strom des geistigen Einflusses der Araber kam, wurde alles Geistige nur in den Klöstern gepflegt; was die Mönche da drinnen taten, war etwas, das in der Welt draußen völlig unbekannt war. Draußen wußte man nur von der Predigt und einer Art geistiger Unterweisung, die in primitiven Schulen stattfand.
Die Herrschaft der Kirche wurde auch dadurch gefördert, daß die Geistlichen alle Verrichtungen, welche Wissen erforderten, selbst ausführten. Die Mönche waren die Baumeister; sie schmückten die Kirchen mit Bildwerken, sie schrieben die Werke der Klassiker ab in kunstvoller Schrift. Auch die höheren Beamten, die Kanzler der Kaiser, waren zum großen Teil Mönche.
Nun zu dem, was in den Klöstern geschah. Eine Form der Bildung, die dort in den Klöstern gepflegt wurde, war die Scholastik, eine spätere die Mystik. Diese Scholastik, die bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts ihre Blüte hatte, hat ein Ungeheures vollbracht, sie hat ein streng geschultes Denken wenigstens bei einem Stande hervorzurufen vermocht. Das ist der große Unterschied zu dem, was später gekommen ist. Es waren harte Prüfungen zu bestehen, niemand konnte ohne harte Proben absolut logischer Schulung des Denkens weiterkommen; an dem geistigen Leben konnte nur der teilnehmen, der wirklich logisch denken konnte. Das wird heute nicht geachtet. Aber tatsächlich war es dies logische folgerichtige Denken, das, als die maurisch-arabische
Kultur nach Europa kam, es bewirkte, daß diese Wissenschaft geschultes Denken vorfand. Die Denkformen, mit denen die Wissenschaft heute arbeitet, sie sind dort gefunden, es sind die wenigsten Ideenformen, die nicht von dort stammen.
Die Begriffe, mit denen noch heute die Wissenschaften, wie Chemie, Medizin, Philosophie operieren, wie Subjekt und Objekt, wurden damals gefunden. Eine Trainierung des Denkens, wie sie sonst in der Weltgeschichte nicht vorkommt, wurde da ausgebildet. Der heutige scharfe Denker verdankt, was heute in den Adern seines Geistes fließt, jener Trainierung, die zwischen dem 5. und 14. Jahrhundert gepflogen wurde. Nun mag es jemand als ungerecht empfinden, daß die große Menge damals nichts von alledem hatte, allein der Gang der Weltgeschichte geht nicht nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, sondern folgt dem großen Gesetz von Ursache und Wirkung. So sehen wir zwei streng nebeneinanderlaufende Strömungen auch hier: erstens die materielle Kultur draußen mit absoluter Unwissenschaftlichkeit, und zweitens eine fein ziselierte Kultur bei einigen wenigen innerhalb der Kirche. Und doch beruhte die Städtekultur auf dieser streng scholastischen Denkweise. Die Männer, die den großen Umschwung herbeiführten, entstammten ihr: Kopernikus war Domherr, Giordano Bruno Dominikaner und so weiter. Ihre und vieler anderer Bildung, ihre formale Schulung wurzelte in diesem Geist der Kirche. Nicht Mächtige, nicht Bischöfe und reiche Äbte, sondern einfache Mönche waren es, die die Wissenschaft fortpflanzten, arme Mönche, die in der Vergangenheit lebten und die den Druck der Mächtigen oft zu spüren hatten.
Die Kirche, die sich mit den äußeren Mächten verbündete, mußte sich vermaterialisieren, sie mußte dazu greifen,
ihre Lehre und ganzes Wesen zu verweltlichen. Es gab in den ältesten Zeiten bis zu dem 12. Jahrhundert nichts, was erhabener, feierlicher war für den Christen als das Abendmahl. Es sollte ein dankbares Erinnerungsopfer sein, ein Symbol für die Verinnerlichung des Christentums. Da kam jene Verweltlichung, jenes Unverständnis solchen hohen, geistigen Tatsachen gegenüber, vor allem den Festen gegenüber. Im 9. Jahrhundert lebte im Lande der Franken, am Hofe Karls des Kahlen, ein sehr bedeutender, christlicher Mönch aus Irland, Scotus Erigena, in dessen Buche «Von der Einteilung der Natur» wir eine Fülle von Geist und Tiefsinn finden, freilich nicht von dem, was das 20. Jahrhundert unter Wissenschaft versteht. Er hatte zu kämpfen gegen eine feindliche Richtung in der Kirche. Er verteidigte die alte Lehre, daß das Abendmahl die Versinnbildlichung des höchsten Opfers bedeutete. Eine andere, materielle Auffassung bestand und wurde von Rom protegiert, daß Brot und Wein sich wirklich in Fleisch und Blut verwandeln. Unter dem Einfluß der vor sich gehenden Vermaterialisierung entstand das Abendmahlsdogma, doch erst im 13. Jahrhundert wurde es offiziell.
Scotus mußte nach England flüchten und wurde auf Betreiben des Papstes im eigenen Kloster von den verbrüderten Mönchen hingemordet. Das sind Kämpfe, die sich nicht innerhalb der Kirche, sondern durch das Eindringen des weltlichen Einflusses abspielen. Sie sehen, das, was geistiges Leben war, war beschränkt auf einige wenige und unoffenbar der großen Masse, auf der ein immer steigender Druck lag von weltlichen und geistlichen Grundbesitzern. Auf diese Weise mehrte sich die Unzufriedenheit immer mehr. Es konnte nicht ausbleiben, daß sich in den von zwei Seiten abhängigen Leuten die Unzufriedenheit häufte. Draußen auf dem Lande. auf den Bauernhöfen entstanden immer
neue Ursachen zur Unzufriedenheit. Kein Wunder, daß sich die kleinen Städte, wie sie am Rhein und an der Donau schon vorhanden waren, immer mehr vergrößerten und neue sich bildeten durch das Abströmen derer, die es auf dem Lande nicht mehr aushalten konnten. Was den Grund zur Umgestaltung solcher Verhältnisse bildete, war der Abfluß der nach Freiheit dürstenden Bevölkerung.
Eine rein materielle Veranlassung war es, aus der die städtische Kultur entstand. Die geistige Kultur blieb vorläufig unberührt; viele Städte entwickelten sich auch um die Bistümer und Klöster. Aus der städtischen Kultur entstand alles, was Handel und Gewerbe im Mittelalter begründete und nachher ganz andere Verhältnisse herbeiführte.
Das Bedürfnis nach unmittelbarem Ausleben der menschlichen Persönlichkeit gab Anlaß zur Gründung der Städte. Das war ein mächtiger Schritt auf der Bahn zur Freiheit, wie ja nach dem Worte Hegels die Geschichte die Erziehung des Menschengeschlechts zur Freiheit bedeutet.
Und wenn wir die Geschichte des Mittelalters weiter verfolgen, werden wir sehen, daß diese Begründung der Städtekultur nicht einen kleinen, sondern einen großen Schritt auf dieser Bahn vorwärts bedeutet.
SECHSTER VORTRAG, 6. Dezember 1904
Die Geschichte des Mittelalters ist deshalb für die menschliche Betrachtung so außerordentlich wichtig, weil wir es mit einem Zeitraum zu tun haben, den wir schon besser erforschen können, in dem wir die menschliche Entwickelung verfolgen können vom einfachen Ursprung aus bis zur
Entstehung dessen, was wir Staaten nennen. Und außerdem haben wir hier ein Ineinandergreifen der mannigfaltigsten Faktoren. Innerhalb einfacher Verhältnisse lebt sich ein fertiges Kulturgebilde ein, wie es das Christentum ist. Aus dem Zustande der Barbarei sehen wir immer mehr das sich entwickeln, was als Blüte der Kultur des Mittelalters erscheint, was wir als Erfindungen kennen.
Zu diesen auf dem Wege der Völkerwanderung durcheinandergewürfelten Völkerschaften sehen wir auf einem komplizierten Umwege dasjenige kommen, was man heute mit «Wissenschaft» bezeichnet. Das Mittelalter hatte eine große Erbschaft angetreten. Zwar war von dem, was wir als griechische Kultur kennengelernt haben, nichts vorhanden geblieben als einige Traditionen auf Plato zurückgehend und durch die Brille der christlichen Anschauungen gesehen. Dagegen war ein mächtiges Erbe aus der Zeit des römischen Reiches geblieben: das mächtige Staatengebilde mit seiner Verwaltung und Rechtspflege von einer Einheitlichkeit und Geschlossenheit, wie sie nie zuvor in der Weltgeschichte aufgetreten waren, wie wir sie im ganzen Mittelalter auch nicht finden; erst in der Neuzeit, die sich sonst so viel auf ihre Freiheit einbildet, begegnen wir einer solchen Ausdehnung der Staatsgewalt. Das, verbunden mit jener anderen idealistischen Kulturbewegung, die allmählich das römische Reich durchdrungen und aufgesogen hatte, kam zu Völkern, die nichts hatten von irgendeiner ähnlichen Bildung, und dazu von der Völkerwanderung entwurzelt waren. Alle diese Völkerstämme, Goten, Heruler, Langobarden, Franken, Sachsen und so weiter, waren etwas ganz anderes, völlig im Kindheitsstadium geblieben, im Vergleich zu jenen Römern.
Eine Art Naturleben, beschränkt auf Jagd und Kriegführung, führten sie ohne festes Recht und Gesetz. Ein großer
Übergang fand nun statt in den Verhältnissen und Anschauungen dieser Völkerschaften, die in kleinen Verbänden zusammenlebten.
Was hielt diese einzelnen Stämme zusammen? Das Andenken an irgendeinen Ahnen, der dem Stamme den Namen gegeben hatte, an mächtige Geschlechter, die sich in alten Kämpfen oder bei Eroberung des neuen Landes hervorgetan hatten, und dem Stamm das geliefert, was man Grafen, Fürsten, Herzöge nennt.
Dieser Übergang drückt sich nun darin aus, daß man den gemeinsamen Boden liebt. Sie fangen an, mehr Wert auf die Gemeinsamkeit des Landbesitzes zu legen als auf die Blutsverwandtschaft.
An die Stelle der Stammeszugehörigkeit tritt das, was wir Dorfgemeinschaft nennen. Auf dem Grund und Boden beruht das gesamte materielle Leben. Handel und Gewerbe gibt es noch nicht.Was diese Menschen davon nötig haben, wird nebenbei besorgt von den Frauen, den jungen Leuten und Sklaven. Der größte Teil der Bevölkerung kannte gar nichts anderes als den Ackerbau und häufige Kriegszüge. Sie hatten keine Ahnung von dem, was wir heute Kultur nennen, keine Ahnung von dem, was wir als die erste Forderung derselben ansehen, von Lesen und Schreiben. Es wird Karl dem Großen als besonderes Verdienst angerechnet, daß er sich bemühte, im Alter noch Lesen und Schreiben zu lernen. Alles, was an Bildung vorhanden war, lag in den Händen der römischen Bevölkerung in den Gegenden, die erobert worden waren. Aus ihnen ging das Beamtentum hervor, daher der Einfluß der römischen Rechtsanschauungen. So war es in den westlichen Gegenden; anders im Osten. Dort, in den heutigen deutschen Gebieten, hatte sich das ursprüngliche germanische Wesen von diesen Einflüssen frei gehalten. Die ungebrochene Kraft der thüringischen
und sächsischen Stämme war etwas, mit dem alles im Mittelalter zu rechnen hatte.
Das einzige, was hierher eine Bildung brachte, war das Christentum. Doch eigentliche Wissenschaft, wie Mathematik, Naturwissenschaft und so weiter war nicht darin einbegriffen. Moralische, religiöse Bildung brachte es. Die moralischen, ethischen Begriffe hinzugefügt zu haben, war das Verdienst des Christentums. Namentlich innerhalb des am meisten begünstigten Frankenstammes war der Einfluß des Klerus, besonders der hereinziehenden, gelehrten keltischen Mönche, ein sehr großer. Bei diesem Stamme, der durch die Gunst der Umstände in ein freies Land geführt wurde, wo er seine Eigenart in noch großenteils unbebauten Gegenden ausleben konnte, sehen wir am besten, wie diese Umwandlung sich vollzieht. Die Umwandlung von kleineren zu größeren Gemeinschaften kam hier zustande. Grafen und Fürsten eroberten immer neue Gebiete, und belehnten kleine Besitzer mit Teilen ihres Besitzes. Dadurch breitete sich die Macht der großen Grundbesitzer immer mehr aus. Eine Art Gerichtsbarkeit und Verfassung entstand aus der Übertragung ursprünglich rein privat-rechtlicher Verhältnisse. Was ursprünglich die irischen und schottischen Mönche antrieb, war der heilige Glaubenseifer, der Gedanke, für das Heil der Menschheit zu wirken. Das alles änderte sich. Das Frankentum konnte auch das Christentum nur als Machtmittel begreifen.
Besonders Karl der Große benutzt die Kirche dazu, sein Gebiet zu vergrößern. Irgendein Bischof, den er einsetzte, war zumeist bestimmt, ein Werkzeug seiner Herrschaft zu sein. Anfangs wurde die Kirche nur von Glaubenseifer, von wirklicher Uberzeugung geleitet, später unter dem Einfluß der äußeren Gewalt, suchte sie selbst ein Machtverhältnis zu erringen. So war der Bischof erst ein dienendes Glied der
Kirche, später selbst ein Herrscher und Grundbesitzer. So zeigt sich uns das Mittelalter etwa zur Zeit Karls des Großen. Aber wir dürfen nicht von einem Reiche Karls des Großen sprechen, wie wir heute von Reichen sprechen. Der Großgrundbesitz gibt die Möglichkeit, Grundbesitz an andere zu übertragen. Neue Gebiete werden erobert und ergeben neue Möglichkeiten, die Macht zu vergrößern durch neue Übertragungen. So entstehen höfische Gerichtsbeamte. An die Stelle der alten Gaugerichte treten Hofgerichte mit kaiserlichen Grafen, oder wenn sie von Bischöfen ernannt werden, Vögten.
Dazwischen haben wir immer noch unabhängige Stämme, die an ihren alten Herzögen, ihren selbstgewählten Gerichten festhielten.
So war es noch beim Tode Karls des Großen, so blieb es unter seinem Sohne Ludwig dem Frommen. Das sehen wir aus seinem Verhältnis zu seinen drei Söhnen Lothar, Pippin und Ludwig; er teilt sein Reich wie einen privaten Besitz unter die drei. Und als er aus einer zweiten Ehe noch einen Sohn erhält und eine abermalige Teilung vornimmt, erheben sich seine älteren Söhne gegen ihn, besiegen ihn in der Schlacht auf dem Lügenfelde und zwingen ihn, dem Thron zu entsagen, um sich ihren Besitz nicht schmälern zu lassen. Wir ersehen deutlich, was es mit einem damaligen Staate auf sich hatte. Wir sehen auch, welch falsches Bild das gibt, was in der Geschichte von dieser Zeit gewöhnlich erzählt wird. Es waren rein privatrechtliche Streitigkeiten, die Kämpfe, die sich damals abspielten, und die eigentlichen Völker wurden zwar bei solchen Feld-zügen durch die Heeresmassen gestört und beunruhigt, aber für den Fortschritt der Menschheit haben alle diese Kämpfe in der nachkarolingischen Zeit keine wirkliche Bedeutung.
Dasjenige, was aber eine wirkliche Bedeutung hatte, war der Gegensatz, der sich herausgebildet hatte zwischen dem Frankenreiche und dem Reiche, das Deutschland und Osterreich umfaßte. Im Westreiche war allmählich ein Kampf entstanden zwischen dem weltlichen Adel und der herrschenden kirchlichen Macht. Der gebildete Klerus lieferte dasjenige, was man früher aus den Resten der romischen Bevölkerung entnommen hatte: die höheren Hofbeamten, die Schreiber bei den Gerichten und so weiter. Sie alle besaßen eine ganz gleichförmige, aus den Klöstern hervorgehende Bildung. - Neben diesem gebildeten Klerus gab es eine große ungebildete Masse, die ganz abhängig war von den so ausgebildeten Geistlichen. - Es war die ganze Bildung jener Zeit, die hervorgegangen war aus dem, was in den Klosterschulen gelehrt wurde. Die christliche Theologie umfaßte eine Siebenzahl der Wissenschaften, drei niedere und vier höhere.
So sehen wir draußen im Lande ein nur Krieg und Ackerbau treibendes Volk; in Kirchen, Schulen und Ämtern lebt das, was den Klosterschulen entstammt. Hier in den Klerikerschulen werden diese Wissenschaften gelehrt; die drei niederen waren: Grammatik, Logik und Dialektik. Die Grammatik war die Lehre von der Sprache, die Logik, die Denklehre, die sich in der gleichen Gestalt von Griechenland aus in den Klöstern des Mittelalters bis in das 19. Jahrhundert erhielt, während man sie heute für überflüssig erachtet. An die Logik reihte sich dann die Dialektik, die ganz aus dem Bestande der heutigen Wissenschaft verschwunden ist. Die mittelalterliche Bildung ruhte in der Dialektik, die mußte jeder lernen und beherrschen, der etwas in dem geistigen Leben leisten wollte. Die Dialektik ist die Kunst, gegenüber Angriffen eine Wahrheit in regeirechter Weise zu verteidigen. Die Gesetze der Vernunft müssen
gekannt werden, um dies tun zu können. Nicht mit Scheingründen konnte gearbeitet werden, wo es galt, eine Wahrheit dauernd zu verteidigen; es war nicht die Zeit der Zeitungen, wo Gründe von heute nur bis morgen gelten.
Aus der Dialektik stammt, was man wissenschaftliches und gelehrtes Gewissen nennen kann, und das sollte jeder haben, der in der Wissenschaft mittun will. Nicht alles und jedes läßt sich in vernunftgemäßer Weise verteidigen; darin lag die große Bedeutung dieser Schulung, hier gewissenhaft zu unterscheiden. Später ist das allmählich ausgeartet, so daß es im späteren Mittelalter dahin kommen konnte zum Beispiel, daß sich jemand erbot, irgendeine Wahrheit vierundzwanzig Stunden lang gegen die Angriffe sämtlicher Professoren, Studenten und Laien von Paris zu verteidigen.
Geschult durch die Dialektik waren diejenigen, die zum Richterberuf kamen, weniger die Vorsitzenden der Gerichte, als diejenigen, die die Urteile ausfertigten.
Wenn Goethe im Anfang des «Faust» ihn sagen läßt:
«Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen», so kennzeichnet er damit die Würden und Ämter, zu denen man damals durch eine wissenschaftliche Ausbildung gelangte. «Doktor» war derjenige, der sein Wissen selbständig verwenden konnte. Magister war derjenige, der an den Hochschulen unterrichten durfte. Schreiber waren alle, die im weltlichen Dienste beschäftigt waren, gleichviel ob in höherer oder niederer Stellung. Pfaffen waren alle Geistlichen. Das Wort Pfaffe war in jenen Zeiten noch kein Schimpfwort, sondern ein Ehrentitel. So nennt noch im 14. Jahrhundert der Meister Eckhart Plato den großen griechischen Pfaffen.
Die vier höheren Wissenschaften waren Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik.
Geometrie ist Raumlehre. Arithmetik ist höheres Rechnen, auch Astronomie entsprach ungefähr dem, was wir heute darunter verstehen. Musik aber war nicht das gleiche, was wir heute so nennen. Musik war die Wissenschaft von der Harmonie des Weltenalls. Man glaubte, daß das gesamte Weltenganze in harmonischen Verhältnissen zu seinen einzelnen Bestandteilen stehe. Alle diese Verhältnisse, die sich durch Zahlen ausdrückten, suchte man aufzufinden. Wie auch in der Tat die Farben, Töne und so weiter auf bestimmten Zahlen beruhen. Man suchte nun in der Musik überall die Gesetze der Harmonie, die rhythmischen Verhältnisse; der Zusammenklang der Weltgesetze wurde gelehrt.
So habe ich versucht, Ihnen eine Vorstellung zu geben von dem, was der durch Bildung herrschende Stand trieb. Diese Bildung gewann immer mehr die Oberhand in dem Westreich, das wir jetzt Frankreich nennen. Anders in Deutschland. Diese Stämme waren ungebrochen geblieben, sie hatten sich ihre einfachen Sitten gewahrt, ihre Freiheit größtenteils erhalten. Die Schattenseite dieser primitiven Verhältnisse aber war, daß hier der Klerus ungebildet war, und daher sich dazu verwenden ließ, ein Machtmittel in den Händen der Herzöge und Kaiser abzugeben.
Die Herrschaft des Westreiches blieb bei den Karolingern. Doch die Herrscher aus diesem Hause wurden immer minderwertiger. Zuletzt zeigte sich besonders die Unfähigkeit dieser karolingischen Herrscher, als von Norden her kriegerische Seeräuber, die Normannen, das Land beunruhigten. Diese Normannen drangen von der Mündung der Flüsse aus, der Elbe und Weser, in das Land, plünderten überall die Küsten, besonders in Frankreich, wo sie die nördlichen Gegenden besetzten und bis nach Paris vordrangen. Dazumal regierte Karl III., der sich vollständig unfähig
zeigte, etwas gegen dieses Volk zu unternehmen. Deshalb war es ein Leichtes, daß ein unbekannter Herzog in Österreich, Arnuif von Kärnten, der Karolingerherrschaft ein Ende machen und sich die Herrschaft aneignen konnte. Zuerst genoß er großes Ansehen, da es ihm gelang, die Normannen zu besiegen. Aber die Eifersucht unter den Fürsten war so groß, daß sich Arnulf bequemen mußte, sich an die Kirche zu wenden und einen Bund mit ihr zu schließen. Er mußte einen Zug nach Italien machen und sich überhaupt ihrer Herrschaft in vielen Stücken unterwerfen. Die Folge ist dann, daß wir nach seinem Tode sehen, wie die Kirche sich ihrer Macht bedient. Nicht ein weltlicher Fürst oder Graf, sondern der Erzbischof Hatto von Mainz wird der Vormund seines Sohnes, Ludwig des Kindes. Er tritt damit in all die Herrscherrechte ein, und von da an sehen wir den Grund gelegt für die Herrschaft der Kirche, die nicht mehr nur ausgebeutet wird von den weltlichen Herrschern, sondern sich immer mehr einfügt in weltliche Herrschaft und weltliche Gerichtsbarkeit ausübt. Die Folge davon war, daß jener Kampf zwischen weltlicher und kirchlicher Macht heraufdämmerte, und damit sich jene wichtige Geschichtsperiode einleitet. der Kampf zwischen Kaiser und Papst.
Es ist falsch, wenn herkömmliche Geschichtsbeschreibung diese beiden Mächte als etwas voneinander ganz Verschiedenes darstellt. Sie sind nur Rivalen im Streite um äußere Macht. Es sind gleiche Mächte, die in derselben Richtung wirken. Wir haben es nicht zu tun mit einem Streit zwischen geistlicher und weltlicher Macht, sondern mit einem Streit der weltlich gewordenen Kirche mit weltlicher Macht. Zwei sich ausbreitende Machtrichtungen sehen wir, und als dritte sehen wir die «freien Städte» entstehen, die über ganz Europa sich ausbreiten.
SIEBENTER VORTRAG, 13. Dezember 1904
Vor acht Tagen habe ich Ihnen den Gegensatz entwickelt zwischen dem West- und dem Ostreich, zwischen dem, was heute Frankreich, und dem, was heute Deutschland und Osterreich ist, wie es sich im 8., 9. und 10. Jahrhundert herausgebildet hatte.
Wir haben gesehen, daß sich die beiden Reiche dadurch unterschieden, daß im Westreiche die alte römische Kultur ihre Spuren hinterlassen hatte und die Kirche bald zu einer Herrschaft gelangte, indem sie selbst Großgrundbesitz erwarb. So kam es zum Kampf des Laienadels mit der aufstrebenden Kirche. Vor allem haben wir es zu tun mit einer anderen Art von Kirche. Sie war mit mächtigem Großgrundbesitz ausgestattet worden, vorzüglich durch Karl den Großen, so daß die Kirche zum Bundesgenossen der weltlichen Herrschaft wurde, weil sie in die feudalen Verhältnisse nach oben wie nach unten gebracht worden war.
Die Unterworfenen waren in ein Lehensverhältnis zu den Überwindern gekommen; die Adeligen entwickelten sich zu Lehensleuten der Könige, und so hatte sich das Königreich immer mehr ausgebildet. Fortwährend hatte das Westreich mit dem Gegensatz zwischen den Lehensleuten und der Kirche zu schaffen. Anders im Ostreich. Hier war das alte Unabhängigkeitsempfinden, das Freiheitsgefühl noch wach geblieben, so daß die Stammesherzöge sich durchaus nicht bequemen wollten, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu treten. So ist das 9., 10. und 11. Jahrhundert damit ausgefüllt, daß die sogenannten Könige, die zwar gewählt, aber eigentlich nur ihrem Namen nach Könige waren, fortwährend damit zu tun hatten, die Stammesherzöge in ihre Abhängigkeit zu bringen.
Die Geschichte erzählt viel von solchen Kämpfen. Auf
die Karolinger folgte nach dem Franken Konrad das sächsische Königshaus, und es wird viel von den Taten Heinrichs I., Ottos I., II. und III. und Heinrichs II. erzählt, sowie der darauffolgenden fränkischen Könige, Konrads II., Heinrichs III., IV. und V. Diese Könige, die im Ostreich gewählt werden, hatten ja nicht irgendwie in die Verfassung, die Gesetzgebung der Stämme hineinzureden; auch keine Justizgewalt stand ihnen zur Verfügung. So ist es viel wichtiger, wenn man weiß, was eigentlich das Reich damals zu bedeuten hatte, als daß man sich von den einzelnen Kämpfen eine genaue Vorstellung bildet.
Vorhanden waren größere Herzogtümer. Sie sind entstanden auf die geschilderte Art. Bei der ursprünglichen Wanderung in diese Gegenden waren einzelne, die großen Grundbesitz erworben hatten, immer mächtiger geworden, kleinere Besitzer wurden von ihnen abhängig, mußten ihren Besitz als Lehen übergeben und dann Abgaben zahlen.
So hatten die Stammesherzöge allmählich den kleinen Besitz eingezogen und dadurch, daß sie von dem großen Grundbesitz anderen etwas zum Lehen gegeben, sich das Recht zugesichert, daß sie ihnen eine bestimmte Anzahl von Kriegsleuten zur Verfügung stellten, eine bestimmte Summe zu zahlen hatten.
So waren durch die Aufsaugung des kleineren Grundbesitzes durch den großen die Herzogtümer Sachsen, Franken, Schwaben, Bayern und so weiter entstanden. Allmählich ging auch die Gerichtsbarkeit von den Gaugerichten an die sogenannten Hofgerichte über, die die Herzöge ihren Lehensleuten und Bauern aufgedrängt hatten. Die Kirche mußte, ihren Vorschriften nach, ihre Gerichtsbarkeit durch Vögte ausüben lassen. Auch der König war nichts anderes als ein großer Grundbesitzer. Er hatte Vasallen, Heeresgefolge,
das er in seine Botmäßigkeit gezwungen, ferner Domänengüter erworben und damit da und dort sich Herrschaftsverhältnisse begründet. Das Verhältnis des Herzogs zum König war auch nur das eines Vasallen, indem er bestimmte Abgaben an den Hof lieferte, bestimmte Erträgnisse der herumziehenden Hofhaltung zur Verfügung stellte. Gerichtsbarkeit war Herzogssache. Nur in den Grenzgebieten gegen die Magyaren, Wenden und Dänen zu wurde die Gerichtsbarkeit durch königliche Mark- und Pfalzgrafen ausgeübt. Große Staaten mit einheitlicher Verwaltung, einheitlichem Heere gab es nicht. Daher ewige Kriege der Könige gegen die unbotmäßigen Herzöge, welche nicht Abgaben leisten wollten. Da war es nötig geworden, daß allmählich die Kirche herangezogen wurde.
Es war vereinbar mit der Frömmigkeit, daß ihr Lasten für den König auferlegt wurden. Otto I. war es besonders, der bei aller Frömmigkeit, bei aller kirchlichen Gläubigkeit die Kirche notigte, Abgaben zu leisten. Die Bistümer wurden gezwungen, sich in derselben Weise wie die anderen Lehensleute zu verhalten. Der kirchliche Besitz wurde in zwei Glieder geteilt, von denen ein Teil von Hörigen bebaut wurde für den Bischof, zu dem sie in völlige Abhängigkeit geraten waren. Ein anderes Gebiet blieb in loserem Verhältnis; dort mußten die Bauern im Namen des Bischofs für den Kaiser das Feld bestellen.
Immer mehr sahen sich die Kaiser durch neue Feinde genötigt, die Kirche zu einem engeren Verhältnis heranzuziehen. Mächtige Feinde bedrohten Mitteleuropa. Die Normannen hatten, nachdem sie immer wieder die Völker beunruhigten, nachdem sie von Arnulf von Kärnten in der Schlacht bei Löwen besiegt worden waren und sich die Bretagne erworben hatten, aufgehört mit ihren Einfällen. Dagegen brachen jetzt von Osten finnisch-ugrische Völkerschaften
herein, die Magyaren, deren Einfälle einen unbeschreiblichen Schrecken verursachten. Alle Berichte erzählen von der entsetzlichen Brutalität ihrer Eroberungszüge. Das Verdienst, sie zurückgeschlagen zu haben, wird gewöhnlich Heinrich I. und Otto I. zugeschrieben. Es ist dies bis zu einem gewissen Grad richtig. Die Einfälle der Magyaren waren nicht etwas, was einer späteren Kriegs-führung und Kriegserklärung ähnlich sehen konnte.
Als die Magyaren hereinbrachen, waren die Herzöge gerade besonders unbotmäßig, und Heinrich I. mußte sich deshalb erst einen Waffenstillstand erbitten, um sich ein wenigstens einigermaßen einheitliches Heer zu schaffen. Dieser Zusammenschluß wurde nur auf dem Gebiete des Heereswesens durch die dringende Not bewirkt.
Heinrich I. wird gewöhnlich als der Städtegründer gefeiert; es ist dies eine schiefe Darstellung. Damals begann die allgemeine Städtegründung über ganz Europa, und Heinrich I. folgte nur dem Zuge der Zeit, wenn er diese Bewegung unterstützte.
Wir haben gesehen, wie die Gerichtsbarkeit allmählich auf die Grundherren, die Herzöge und Könige überging. Immer unwurdigere Verhältnisse traten ein. Eine Menge Leute, welche früher freie Bauern waren, mußten alles, was sie hatten hingeben, um in die Botmäßigkeit der Großgrundbesitzer zu treten. Sie wurden dort, außer zum Ackerbau, als Boten, Handwerker und im Kriegsdienst verwendet.
Namentlich durch die gesteigerte Ertragsfähigkeit des Bodens, die durch die Verwendung dieser vielen Arbeitskräfte immer größer wurde, entstand eine Art von Handel. Zugleich bildete sich ein besonderer Handwerkerstand heran. Das gab es vorher gar nicht; wie schon erwähnt, wurden die notwendigen Arbeiten im Hause von Sklaven und
Frauen besorgt. Höchstens das Schmiede- und das Goldschmiedehandwerk war vorhanden. Aber jetzt durch diese Art des Übertragens bildete sich ein neuer Stand von Handwerkern und Handelsleuten heran. An den Orten, wo geeignete Märkte waren, entstanden Ansiedelungen, feste Plätze wurden gegründet überall in ganz Europa. Hierzu kam die Unzufriedenheit der unwürdig behandelten Menschen, so daß der Andrang nur größer wurde. Dieser Zug der Zeit zwang den König, sich auf die Städte zu stützen.
Man brauchte ein Reiterheer gegen das Reitervolk der Magyaren. Dieses Reiterheer bildete den Grund für den Ritterstand, der damals entstand. Man muß alles dies zusammenfassen, um ein wirkliches Bild zu gewinnen, wie damals alles verlief. Dies ist wichtiger als die ausführliche Würdigung jener Kämpfe.
In den Schlachten auf dem Ried 933 und auf dem Lechfelde 955 wurden die Magyaren besiegt und erlitten eine so furchtbare Niederlage, daß ihnen tatsächlich die Lust zu weiteren Einfällen vergangen war. Sie gründeten sich in der Donaugegend im heutigen Ungarn ein Reich. Seitdem waren die Kaiser gezwungen, sich auf die Kirche zu stützen, das Christentum wurde politisch ausgenutzt. Die Magyaren wurden zum Christentum bekehrt, besonders von dem Bistum Passau aus. Will man verstehen, was damals in den Seelen entstand, muß man nicht mit späteren Begriffen rechnen. Es lebte ein intensiver Glaube, ein bis zur Schwärmerei gesteigertes religiöses Empfinden in dem Herzen des Volkes. Es hörte in allen Dingen auf die Geistlichen, von denen es sich in allen Ange-[egenheiten leiten ließ. Die Herzöge und Könige unterstützten diese Art von Unterwürfigkeit. Von Karl dem Großen an hat man mit dieser Herrschaft über die Seele gerechnet. - So wurde der Klerus bester und stärkster
Ratgeber und nistete sich in die Seelen und Herzen des Volkes ein.
Dazu kam, daß in der damaligen Zeit durch die Araber ein starker Einfluß stattfand, nicht nur, wie früher geschildert wurde, durch wissenschaftliche, sondern auch durch gewisse literarische Einflüsse, durch die ein neuer Seelenzug in das Mittelalter hineinkam. Ein großer Kreis von Sagen, Märchen Legenden, Gefühlen und Bildern wurde in die Volksseele verpflanzt, und dieser seelische Einfluß vom Orient nach Europa war ein so intensiver, daß wir sehen, wie die ursprüngliche rauhe Seele des Germanen mildere Gesittung annahm, und daß ihre Frömmigkeit durchtränkt wurde von einem Element von großer Bedeutung: das war der Marienkultus und der sich daraus entwickelnde Frauendienst. Wer das nicht würdigt, weiß gar nichts von der Geschichte des Mittelalters. Er verschließt die Augen vor Tatsachen wie der, daß große Volksmassen manchmal ergriffen wurden von epidemischer Furcht. Von einer solchen Furcht wurde das Volk ergriffen um das Jahr 1000 - während der Regierung Kaiser Ottos III.-, welches den Weltuntergang bringen sollte. Dieses große Ereignis, für das man sich durch Bußübungen und Wallfahrten vorbereiten wollte, erregte ganz Deutschland. Kaiser Otto III. selbst unternahm eine Wallfahrt zu dem Grabe des heiligen Adalbert von Preußen. All das ergab sich aus der damaligen Volksseele. Wer das nicht versteht, versteht auch nicht die Entstehung der späteren Kreuzzüge. Man hat auch hier materielle Beweggründe gesucht; aber der redet an der Sache vorbei, der sie nicht von dieser Seite betrachtet.
Die Verweltlichung der Bischöfe und Äbte konnte nicht ohne Reaktion, ohne Rückwirkung bleiben, und so verstehen wir, daß von Cluny eine mächtige Bewegung nach Reform ausgeht. Der Einfluß der Cluniazenser war ein ungeheuer
großer; daß es möglich war, den Gottesfrieden durchzusetzen, ist ein Beweis dafür. In einer Zeit, wo nirgends ein einheitliches Reich vorhanden war, kann man ermessen, was es bedeutet, daß es den Bestrebungen der Mönche von Cluny gelang, das Faustrecht für einige Tage der Woche - von Freitag zum Montag - einzuschränken, so daß während dieser Zeit Fehden nicht ausgefochten wurden. Man muß nur bedenken, daß es damals eigentlich ein Recht nicht gab, sondern vollständiges Faustrecht herrschte. Der schroffe Kampf zwischen den deutschen Kaisern und den Päpsten wurde nicht bloß geführt aus selbstsüchtigen Interessen, sondern auch von Seite der Kirche aus Fanatismus. Der Papst fühlte sich als Stellvertreter Christi, als Herr auch der weltlichen Gebiete; als ob das Reich Christi auch die weltliche Herrschaft sein nenne.
Papst Gregor VII., der den deutschen Kaiser Heinrich IV. zum Canossagang nötigte, war erst Mönch von Cluny, und ist von dort aus zu seinem Fanatismus gelangt. Es wurde Tendenz des Papsttums zu erklären: so wie es zwei Regierende gibt im Sonnensystem, die Sonne und den Mond, so auch im menschlichen Leben; der Papst sei die Sonne, der König der Mond, der erst von der Kirche sein Licht empfängt. Diese Gesinnung fand Eingang und ist auch von dem großen Dichter Dante als gerecht anerkannt, der bei der Verteilung der Gewalt die Ubergewalt der geistlichen über die weltliche Macht als recht und billig bezeichnet. Nun war dieser Kampf zwischen Kaiser und Papst deshalb ein so mächtiger geworden, weil inzwischen ein gewisser Einigungsprozeß sich vollzogen hatte. Die verschiedenen Herzogtümer wurden durch äußere Gewalt zusammengeschmiedet. Die Herzöge betrachteten sich jetzt verpflichtet, Heeresfolge und gewisse Abgaben dem Kaiser zu leisten. Alle diese Länder: Italien, Burgund, Lothringen, Franken,
Sachsen, Österreich und auch Ungarn und Polen standen zeitweilig zur deutschen Krone im Lehensverhältnis.
So ist man in der Tat im ii. Jahrhundert zu einer gewissen Einheitlichkeit gekommen. Dabei wird die Kirche immer mächtiger. Bei dem Tode Heinrichs III. werden nicht weltliche Fürsten zur Vormundschaft des jungen Königs, Heinrich IV. berufen, sondern die Erzbischöfe Hanno von Köln und später Adalbert von Bremen.
Die Durchsetzung der Volksseele mit religiösen Empfindungen hatte zu einem blinden Autoritätsglauben geführt. Jetzt war die Zeit für Rom gekommen. Eine kluge Politik wurde von Rom aus eingeleitet. Der Klerus mußte herausgerissen werden aus allen weltlichen Interessen, um nur das eine vor Augen zu haben: die Predigt und Beherrschung des Volkes. Dazu mußte er vollständig unabhängig gemacht werden. So wurde im 11. Jahrhundert das Zölibat über den Klerus verhängt, die Priesterheirat untersagt, da jeder, der durch selbstgewählte Blutsbande mit der Welt zusammenhänge, in Abhängigkeit gerate und nicht so rückhaltlos dienen könne.
Das gab dem Klerus und Papsttum die Tendenz zu unbeugsamer Willensentfaltung: nur das eine vor Augen, die Herrschaft der Kirche. So kam es, daß die Kirche die Forderung stellen konnte, bei Besetzung der Bistümer nur die Kirche mitsprechen zu lassen. Früher hatten die weltlichen Fürsten jedes Bistum besetzt, das frei wurde. Jetzt sollten nur geistliche Interessen ausschlaggebend sein, und die Herrschaft wurde dadurch erhöht, daß die Besetzung der Amter nur von der Kirche ausging. Dadurch kam der Investiturstreit, der Heinrich IV., der sich das nicht gefallen lassen wollte, zum Gange nach Canossa führte.
Das alles faßt sich zusammen in dem Streit zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Haben wir noch bei
Chlodwig gesehen, daß der Gott der Christen der seine wird, weil er die Heere zum Siege führte, so sehen wir, wie die Kirche jetzt selbst zur Herrschaft gelangt. Das muß man verstehen, wenn man die neuen Verhältnisse begreifen will, welche die Kreuzzüge verursachten.
Wir haben an den Franken gesehen, was aus den Stämmen hervorgegangen ist, die durch die Völkerwanderung aus ihren Wohnsitzen verdrängt wurden. Wir sahen, wie das Christentum in allen Lebensverhältnissen ausschlaggebend geworden ist, wie bei den Ansiedlungen Klöster und Bistümer zum Mittelpunkt wurden, wie die Mönche nicht nur auf geistigem Gebiet die Leiter des Volkes waren, sondern es im Anbau der verschiedenen Früchte unterrichteten, die Bauleute der Kirchen waren und so weiter.
Die Städte bildeten sich gern um die bestehenden Bistümer herum. So sehen wir überall den mächtigen Einfluß der Kirche.
Hereinbrechen sehen wir den Einfluß der Mauren durch Wissenschaft und Literatur. Einen anderen Einfluß werden wir kennenlernen, wichtiger als vieles andere, durch die Kreuzzüge; er kam gleichfalls vom Orient. Durch diese Einflüsse wurden die großen Erfindungen und Entdeckungen angeregt. Denn dort im Orient und in China waren viele Dinge bekannt, von denen der Westen nichts wußte: Papierbereitung, Seidenweberei, der Gebrauch des Schießpulvers und so weiter. So wurde zu den großen Erfindungen durch diese Züge der erste Anstoß gegeben.
Wir sahen so von zwei Seiten aus mächtige Impulse auf die mittelalterliche Menschheit ihren Einfluß ausüben. Halten Sie das zusammen mit der Städtegründung und Sie werden empfinden, daß ein Jahrhundert heranbricht, das die Entwickelung machtvoll vorbereitet. Wenn Sie das in der rechten Weise verfolgen wollen, dann ist es nicht genug,
es nur verstandesgemäß in sich aufzunehmen. Niemand versteht die Ereignisse wirklich, der nur mit dem Verstande sie ergreifen will und nicht mit dem Gefühl, der sich nicht in die Feinheiten der Volksseele hineinleben kann, und begreift, was sich dort im Innern abspielt und vorbereitet. Und wer das nicht hat, für den gilt das Wort des Faust:
Was ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
ACHTER VORTRAG, 20. Dezember 1904
Wir stehen in der Mitte des Mittelalters und haben die Zeit des 11., 12., 13. und 14. Jahrhunderts zu betrachten. Diese Zeit ist bedeutungsvoll und wichtig, weil man in dieser Epoche das Entstehen von großen Reichen studieren kann. Auch im Altertum haben wir große Staatengebilde kennengelernt - Persien, Römisches Reich und so weiter -, aber sie liegen uns so fern, daß uns eine wirkliche, geschichtliche Beurteilung schwer ist. Im Mittelalter sehen wir aber aus kleinen Ursachen sich das entwickeln, was ein gemeinschaftliches Heer, Gericht, Verfassung hat, so gab es in Deutschland so etwas nicht. Diese Gegenden zerfielen noch im 13. und 14. Jahrhundert in einzelne getrennte Gebiete.
Erst unter Heinrich III. geschieht etwas, was beiträgt zu einer Einigung der Reichsgebiete, indem es dem Kaiser gelang, die einzelnen Stammesherzöge zu einer Art von kaiserlichen Beamten zu machen. Vorher waren sie souverän hervorgegangen aus der Stammeseigentümlichkeit; jetzt waren sie geworden was man Ministeriale nennt, Dienstmannen
des Kaisers. Allmählich geschah eine Gleichstellung der niederen Lehensleute, die aus Freien auch zu Dienstleuten geworden waren, mit den Ministerialen. Sie bildeten mit der Zeit das heraus, was man den niederen Adel nennt, aus dem sich der Ritterstand rekrutierte, der Stand, der in den Kreuzzügen eine so große Rolle spielte. Auch schon unter der Regierung Heinrichs IV spielte der Ritterstand eine große Rolle.
Als Gregor VII. den Kaiser in den Bann tat, hielten die deutschen Fürsten nur teilweise zum Kaiser, während andere unter dem Einfluß des Papstes verschiedene Gegenkönige wählten. Wichtig sind alle diese Kämpfe nicht; wichtig aber ist es, daß der Ritterstand durch diese verschiedenen Streitigkeiten eine besondere Bedeutung erhielt. Ritter und Städte wurden bald vom Papst, bald vom König geködert. Fortwährende Fehden und Kriege herrschten; die Roheit nahm immer mehr zu. Bei den Plünderungszügen hatte der Bauernstand schwer zu leiden. Die letzten freien Bauern konnten sich nicht mehr halten und wurden aufgesogen von den Herren und Herzögen und diese wieder von den Königen. Aus diesem unerquicklichen Prozeß sehen wir hervorgehen, was wir als das «Reich» kennen.
Hierbei war kein Unterschied zwischen weltlichen und geistlichen Fürsten; groß aber war der Unterschied zwischen dem verweltlichten Klerus, und dem in den Klöstern. Der von den Bischöfen regierte Klerus war meist ungebildet, konnte nicht lesen und schreiben, verbauerte und beutete seine Lehensleute aus. Der Bischof beschäftigte sich mit der Verwaltung seiner Güter und war ebenso ungebildet wie Ritter- und Bauernstand; nichts von dem, was wir heute Bildung nennen können, war vorhanden. So war es möglich, von Rom aus die politische Lage der Kirche immer mehr zu befestigen.
Anders war es in den Klöstern. Hier wurde viel gearbeitet von Männern und Frauen. Tiefe Gelehrsamkeit war hier zu finden; alle Bildung der damaligen Zeit ist lediglich von den Klöstern ausgegangen. Sie ließen sich auch in bezug darauf nicht abhängig machen von der politischen Macht Roms, die auf der weltlichen Macht des Klerus ruhte. Was von Rom aus geschah, ist in der verschiedensten Weise zu beurteilen. Es sollte ein gewisser Kampf geführt werden gegen die Roheit, gegen das Faustrecht der deutschen Völker. Eifer für die geistigen Güter, der Wunsch, die Gewalt mittelalterlichen Denkens über die Welt auszubreiten war es, was von Rom aus gewollt wurde. Jedenfalls ging ein besserer Wille von Rom aus als von den deutschen Fürsten. In diesem Sinne muß man auffassen, was Gregor VII. wollte, als er die Ehelosigkeit forderte, und als er nicht dulden wollte, daß weltliche Fürstenmacht einen Einfluß auf die Besetzung der Bistümer sich anmaße: es war eine Opposition gegen die überhandnehmende Roheit in den deutschen Ländern. So waren die Kämpfe Heinrichs IV. mit den Sachsen nicht nur fast ebenso blutig, wie einst die Kriege Karls des Großen gegen die Sachsen, sondern sie wurden mit ganz besonderer Hintansetzung von Treu und Glauben geführt.
Durch alle diese Kämpfe wurde der Wohlstand immer mehr zerrüttet. Aus den Stürmen der Zeit entstand ein tief-religiöser Zug, der sich bis zur Schwärmerei steigerte, wie ich es Ihnen bei dem Jahre 1000 schilderte. Diese religiöse Schwärmerei trieb immer wieder die Menge zu Zügen nach dem Morgenland.
Ursprünglich hatte die christliche Religion kein Festhalten an irgendein Dogma gekannt. Auf den Ideengehalt war es angekommen, nicht auf die äußere Einkleidung. Sie haben gesehen, wie im Heliand die Christus-Idee in freier
Weise ausgestaltet wurde, wie der Dichter dabei für seine Landsleute das Christus-Leben in altsächsische Verhältnisse verlegte. Er faßte die Äußerlichkeiten dabei ganz frei auf, die ganz ebensogut bei uns in Deutschland, wie in Palästina sich ereignen konnten.
Unter den sich immer mehr veräußerlichenden Verhältnissen wurde für die Kirche die äußere Gestaltung des
Glaubens eine Lebensfrage. Sie konnte nicht mehr den Stämmen überlassen, wie sie Christus auffassen wollten. Als Seitenstück der politischen Macht trat ein, daß auch die Dogmen fest und starr wurden.
Die Fürsten versuchten die weltliche Macht der Kirche in ihrem Interesse zu verwenden; die Bischofsstühle wurden mit jüngeren Brüdern besetzt, die körperlich oder geistig zu anderem unbrauchbar erschienen. Ganz allmählich änderten sich so die Verhältnisse und die alte Zeit wuchs in eine neue hinein.
So entstehen nun die Kreuzzüge, die wir nur psychologisch aus der Stimmung, die das Mittelalter beherrschte, verstehen können. Die vorhandene religiöse Schwärmerei bewirkte, daß es dem Papst ein Leichtes war, durch eigene Agenten wie Peter von Amiens und andere die Menschen zu den Kreuzzügen aufzustacheln. Dazu kam, daß eine große Anzahl von Leuten völlig mittellos geworden war. So waren es nicht nur religiöse Beweggründe, die mitwirkten. Immer mehr Freie waren zu Hörigen geworden; andere hatten ihr Besitztum verlassen müssen und waren fahrende Leute geworden, die nichts hatten, als was sie auf dem Leibe trugen. Unter diesen fahrenden Leuten, die allen Ständen entstammten, auch dem Adel, war eine große Menge, die nichts zu tun hatte und zu jeder Unternehmung bereit war, auch zum Kreuzzug.
So kommen wir dazu zu verstehen, daß eine große Anzahl
von Faktoren tätig war: religiöse Schwärmerei, starres Dogma und materielle Bedrückung. Wie stark diese Ursachen wirkten, sehen wir daraus, daß, als der erste Kreuzzug zustande kam, es eine halbe Million Leute waren, die nach dem Morgenlande zogen. Den ersten äußeren Anstoß dazu hatte die schlechte Behandlung der zahlreichen Pilger durch die Sarazenen gegeben. Doch lagen tiefere Ursachen dem zugrunde. Ein starres Dogma, dem die Menschen sich unterwarfen, war vorhanden. Doch die wissen nichts vom Mittelalter, die nicht verstehen, wie damals die Menschen mit Herz und Seele an der Religion hingen. Eine Predigt wirkte zündend auf die Leute, wenn sie das rechte Wort traf. Viele glaubten durch solche Tat Hilfe zu finden; andere suchten Vergebung ihrer Sünden zu erlangen. Aus unserer heutigen Anschauung erhält man kein rechtes Bild dieser Erscheinung des Mittelalters, man hat es hier mit vielen ungreifbaren Ursachen zu tun.
Nicht die Ursachen, sondern die Wirkungen der Kreuzzüge sind es, die von besonderer Bedeutung für die Weiter-entwickelung geworden sind. Bald nach Beginn wurde eine dieser Wirkungen sichtbar: nämlich ein viel intimerer Austausch zwischen den einzelnen Ländern. Bisher war Deutschland im allgemeinen ziemlich unbekannt mit den romanischen Ländern geblieben; jetzt wurden sie durch die Waffenbrüderschaft einander nähergebracht. Auch die maurische Wissenschaft fand erst auf diesem Wege wirklichen Eingang. Vorher hatten Lehrstühle der Hochschulen nur in Spanien, Italien und Frankreich bestanden; in Deutschland wurden sie erst nach den Kreuzzügen errichtet. Erst jetzt kam der Einfluß wahrer Wissenschaft vom Osten. Dieser war bisher völlig verschlossen gewesen und bewahrte große Bildungsschätze in den Schriften der griechischen Klassiker. Gründlich genommen entstand
erst durch die Berührung mit dem Osten eine Wissenschaft.
Der unbestimmte Drang religiöser Schwärmerei hatte eine bestimmte Form angenommen, war das geworden, was man mittelalterliche Wissenschaft nennt. Diese Wissenschaft möchte ich Ihnen ein wenig charakterisieren.
Vor allen Dingen hatten sich zwei Denkweisen ausgebildet, die sich bemerkbar machten im wissenschaftlichen Leben des Mittelalters. Die Denkweise der Scholastik trennte sich in zwei Strömungen: Realismus und Nominalismus. Es ist ein scheinbar abstraktes Thema, wenn ich von Nominalismus und Realismus rede, aber für das Mittelalter und auch für die späteren Zeiten gewann dieser Streit eine tiefgreifende Bedeutung. Theologische und weltliche Wissenschafter teilten sich nach diesen zwei Lagern. Nominalisten heißt Namengläubige, Realisten sind diejenigen, die an das Wirkliche glauben. Realisten im Sinne des Mittelalters waren diejenigen, die an die Wirklichkeit des Gedankens glaubten, an einen realen Sinn der Welt. Sie nahmen an, daß die Welt einen Sinn hat, und nicht von ungefähr gebildet sei. Vom Standpunkt des Materialismus aus mag das als ein törichter Standpunkt angesehen werden; wer aber den Gedanken nicht für ein leeres Hirngespinst hält, muß zugeben, daß der Gedanke über ein Weltgesetz, den man sucht und in sich findet, auch eine Bedeutung für die Welt hat.
Die Nominalisten waren diejenigen, die nicht glaubten, daß Gedanken etwas Wirkliches sind, die darin nur Namen, Zufälligkeiten sahen, Dinge von keiner Bedeutung. Alle, die glauben, in dem, was das menschliche Denken erreicht, nur blinde Zufälligkeiten zu sehen, wie Kant, auch Schopenhauer, der die Welt als Vorstellung auffaßt, bilden einen Ausfluß des mittelalterlichen Nominalismus.
Diese Strömungen teilten das Heer der Mönche in zwei Lager. In so wichtigen Fragen ist es bemerkenswert, wie die Kirche keinen Zwang ausübte und, insofern es die Gelehrsamkeit betrifft, ruhig es gestatten konnte, daß man die Frage anschnitt, ob nicht die göttliche Dreieinigkeit auch bloß ein Name und somit nichts Wirkliches sei. Immerhin sehen Sie daraus eine große Freiheit der mittelalterlichen Kirche. Erst am Ende dieser Zeit beginnt man mit Ketzerverfolgungen, und es ist bezeichnend, daß der erste Ketzerrichter in Deutschland, Konrad von Marburg vom Volke erschlagen wurde. Damals begann man erst damit, Meinungen zu verfolgen. Es ist dies ein wichtiger Umschwung. Wie frei vorher kirchliches Denken war, können Sie an dem großen Lehrer und Denker Albertus Magnus sehen. Er war ein ausgezeichneter Gelehrter, vertiefte sich in die gesamte Wissenschaft: kirchliche Gelehrsamkeit, arabisches Wissen, naturwissenschaftliches und physikalisches Denken sowie philosophisches beherrschte er; er wurde vom Volke als ein Zauberer aufgefaßt. Schroff stoßen aufeinander Gelehrsamkeit und Volksaberglaube, der ausgebeutet wird vom verweltlichten Klerus.
Jetzt kommen die Städte empor. In den Städten sehen wir ein mächtiges Bürgertum entstehen. Das Handwerk blüht und schließt sich in Zünften zusammen. Nicht mehr braucht sich der Handwerker unter der Bedrückung eines Grundherrn zu beugen, wie einst als Höriger. Bald schließen Könige und Fürsten Bündnisse mit den mittelalterlichen Städten. Kaiser Friedrich Barbarossa kämpfte jahrelang mit den norditalienischen Städten. Im Bürgertum entwikkelte sich ein starkes Freiheitsgefühl und der Sinn für den unmittelbaren persönlichen Wert. Wir sehen so auf der einen Seite auf dem Lande eine religiöse Gesinnung bei zunehmendem äußerem Druck; in den Städten ein freies Bürgertum,
zwar an eine streng geregelte Zunftverfassung gebunden, doch gerade dadurch gedieh damals die Freiheit der Städte; auf dem Lande aber ein absterbendes Leben, Faustrecht und Roheit. Das Rittertum geriet nach den Kreuzzügen in ein in das Nichts führendes, leeres höfisches Leben. Die Ritter beschäftigten sich mit Fehde, Turnieren und Waffenkämpfen; ihre Sitten nahmen immer rohere Formen an. Besonders gewann der Minnedienst mit der Zeit die lächerlichsten Formen. Diejenigen Ritter, die dichten konnten, dichteten Strophen auf ihre Damen; die übrigen machten ihnen auf andere Weise den Hof. Eine große Unwissenheit war mit diesem Hofleben vereint. Die Männer waren fast alle ganz ungebildet; die Frauen mußten lesen und schreiben können. Die Frauen nahmen eine ganz eigentümliche Stellung ein; auf der einen Seite wurden sie vergöttert, auf der anderen geknechtet. Eine Art von Barbarei herrschte, ein zügelloses Leben, das dazu führte, daß das Gastrecht zur Entehrung der Frauen führte.
Währenddessen bereitet in den Städten sich das vor, was man später Kultur nennt. Es geschah dort, was geschehen mußte, denn Neues bildet sich dort heran, wo es die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten. Der wirkliche geistige Fortschritt findet dort statt, wo das wirtschaftliche Leben nicht beengt ist. Nicht dem materiellen Fortschritt entspringt das geistige Leben, sondern der wahre geistige Fortschritt findet sich dort, wo das wirtschaftliche Leben nicht bedrückt und eingeengt ist.
So entstand in den Städten damals eine reiche Kultur; fast alles, was uns in den Werken der Malerei, der Baukunst, der Erfindungen geschenkt wurde, ist in dieser Zeit der Städtekultur zu danken. Einer solchen reichen italienischen Städtekultur entstammte auch Dante. Auch in Deutschland finden wir bedeutende geistige Leistungen unter dem Einfluß
dieser Städtekultur. Zwar waren die ersten bedeutenden Dichter Ritter, wie Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg und so weiter, aber ohne den Rückhalt, den die Städte boten, wären diese Leistungen nicht möglich gewesen. In dieser Zeit, wo eine freie Luft in den Städten weht, entsteht auch das Universitätsleben. Zunächst mußte der Deutsche, wenn er höheres Wissen finden wollte, nach Italien, Frankreich und so weiter. Jetzt entstehen in Deutschland die ersten Universitäten, wie Prag 1348, Wien 1365, Heidelberg 1386. Das Freiheitswesen räumte auf mit dem mittelalterlichen Dünkel.
Der weltliche Klerus war wie die Fürsten in egoistische Interessenkämpfe verwickelt, und die Kirche hatte diesen Zug angenommen. Wer die Entwickelung verfolgt, wird verstehen, daß die neue geistige Strömung, die deutsche Mystik nur so entstehen konnte - in schroffer Opposition gegen den weltlichen Klerus. Besonders am Rhein entlang, in Köln, Straßburg, in Süddeutschland, breitete sich diese Bewegung aus, der Männer wie Eckhart, Tauler, Suso und so weiter angehörten. Sie hatten sich unabhängig gemacht von dem römischen Klerus; dafür wurden sie auch zu Ketzern erklärt und ihnen das Leben auf jede Weise erschwert. Ein Zug von Innerlichkeit geht durch ihre Schriften; sie hatten sich in das menschliche Herz zurückgezogen, um mit sich selbst ins klare zu kommen. Diese Mönche, die sich unabhängig gemacht hatten, sprachen zu dem Herzen des Volkes in seiner Sprache. Die deutsche Sprache wurde in einer Art veredelt, die man heute nicht begreift, wenn man nicht die Schriften liest eines Meisters Eckhart, Taulers oder des Verfassers der «Theologia deutsch». Die Schönheit der Sprache wurde durch die Mystik eingepflanzt, und die damaligen Übersetzungen übertrafen an Schönheit der Sprache weit die späteren. Diese Entwickelung der deutschen
Sprache wurde schroff unterbrochen dadurch, daß Luther die deutsche Bibel in der pedantischsten, philiströsesten damaligen Mundart schuf, aus der das jetzige Hochdeutsch geworden ist. Alles das geschah in Opposition gegen den Klerus. Was damals gewollt wurde, ist auf vielen Gebieten heute noch nicht erreicht. Ich habe Ihnen vieles anders geschildert, als Sie gewohnt sind zu hören. Es wird immer versichert, daß etwas Unerhörtes geschehen ist durch die Bibelübersetzung Luthers; Sie sehen aber, wie vorher viel Höheres erreicht war. Ich habe Ihnen ein Tableau für das, was in der Folgezeit uns beschäftigen wird, entworfen.
Wir nähern uns der Renaissancezeit. Die Konsolidierung der Verhältnisse, die sich vollzog, bestand im wesentlichen darin, daß immer größere Gebiete unter die Herrschaft der Landesfürsten gerieten. Auch ein großer Teil der mittelalterlichen Städtefreiheit wurde aufgesogen durch die Verfassung der großen Staaten, jedes Ding hat eben seine zwei Seiten. Den heutigen Menschen wird gewiß vieles abstoßen und es wird heute viel geredet über die Willkür, die damals herrschte. Die Freiheit hat selbstverständlich ihre Kehrseite, und es ist noch keine Freiheit, wenn man in der Willkür durch die Willkür anderer eingeschränkt ist.
Eine Sprache konnte zum Beispiel in der Mitte des Mittelalters an den Universitäten gegen die Willkür der weltlichen Machthaber geführt werden, wie später vielleicht nur Fichte es getan hat. Die Dokumente der damaligen Universitäten bewahren uns die Worte der damaligen freien Geister. Heute ist nicht nur die weltliche Herrschaft, sondern auch die Wissenschaft verstaatlicht.
Ohne Licht und Schatten nach den Schlagworten der Gegenwart zu verteilen, habe ich Ihnen diese Zeiten geschildert. Ich suchte an den Punkten zu verweilen, wo wirklicher Fortschritt vorhanden ist. Wollen wir freie Menschen
sein, müssen wir ein Herz haben für die, die vor uns nach Freiheit gestrebt haben. Wir müssen verstehen, daß auch andere Zeiten Menschen hatten, die etwas auf Freiheit gegeben haben.
Geschichte ist die Entwickelungsgeschichte der Menschheit zur Freiheit, und wir müssen, um sie zu verstehen, die Freiheit in all ihren Gipfelpunkten studieren.
NEUNTER VORTRAG, 28. Dezember 1904
Wie sich das Leben des Mittelalters in den Städten herangebildet hat, haben wir gesehen.
Wir sind bis dahin gekommen, wo das öffentliche Leben sich hauptsächlich in dem Leben der Städte abspielt. Ursprünglich war die Veranlassung zur Ansiedelung in den Städten die Bedrückung der Landleute und die Ausbreitung des Handelswesens.
Wir haben gesehen, wie diejenigen, welche ihren Bedrükkern entfiohen oder sich dem Handel gewidmet hatten, sich entweder in einem Bischofssitz oder an einer anderen Stätte mittelalterlicher Macht ansiedelten. Zunächst befand sich der Teil der Bevölkerung, welcher die Städte bewohnte, nicht in einer angenehmen Lage; sie mußten ihrem früheren Gutsherrn Abgaben zahlen, Waffen, Kleider und so weiter liefern. Diejenigen, die in die Städte gezogen waren und sich dem Handel gewidmet hatten, sowie die, welche königliche, bischöfliche oder sonstige Beamte waren, bildeten zunächst die eigentlich freien bevorzugten Stände. Aber mehr und mehr wurden die Vorrechte der Beamten und der Kaufleute, die das Patriziat bildeten, den Bevorrechteten abgenommen von denen, die bedrückt lebten. Am
Rhein in Süddeutschland wurde diese Gleichberechtigung im 13. und 14. Jahrhundert errungen. Könige und Kaiser rechneten damit.
Früher hatten die herumziehenden Könige bald hier bald dort Hof gehalten, nun ließen sie sich in den Städten nieder. Die Herrscher mußten rechnen mit den Städten, sie fanden in ihnen Grund zu eigener Machtentfaltung. Daher wurden den Städten gewisse Rechte übertragen, Gerichtsbarkeit, Münzrecht und so weiter. Auf diese Weise wuchs ihre Macht immer mehr. Ein demokratisches Element bildete sich dadurch jetzt in Deutschland. Früher hatte der Grundadel, der Feudaladel der Zeit ihr bestimmtes Gepräge gegeben. Statt dessen ist jetzt etwas Neues aufgekommen. Immer mehr wurden in den Städten die Vorrechte beseitigt. Statt allgemeine Betrachtungen anzustellen, wollen wir uns zu bestimmten Beispielen wenden. Köln war schon lange eine wichtige Handelsstadt, Sitz eines mächtigen Klerus; auch auf geistigem Gebiete wurden ja die Städte zu einer Macht. Dort hatte der untergeordnete Stand sich bald Gleichberechtigung mit dem Patriziat, eine Art von Verfassung erworben, das Eidbuch, in dem verzeichnet war, was jeder einzelne für Rechte hatte. Zusammengeschlossen hatten sich die Zünfte, von denen es in Köln zweiundzwanzig gab, die vor dem 14. Jahrhundert auch hier von den Patriziern abhängig waren. Jetzt, im Jahre 1321, eroberten diese die Gleichberechtigung.
Der Stadtrat wurde nicht nur aus Patriziern zusammengesetzt, sondern die Mitglieder der Zünfte hatten gleiches Wahlrecht. Um diesen Rat möglichst demokratisch zu gestalten, sollten die Mitglieder immer nur auf eine halbes Jahr gewählt werden und nachher auf drei Jahre nicht wählbar sein. Mit der Durchführung des demokratischen Prinzips wuchs auch das Interesse des einzelnen Bürgers am
Aufblühen der Städte. Noch bis ins 12. Jahrhundert waren solche Städte nicht viel anderes als schmutzige Dörfer mit strohgedeckten Häusern. Aber wir sehen sie in wenigen Jahren in ganz auffallender Weise wachsen. Jeder Mann ist jetzt Bürger und mit der Teilnahme des Einzelnen wächst das Ansehen und die Schönheit der Stadt.
Was die Städte angaben, wirkte bestimmend auch auf die ganze hohe Politik. Was konnte Städte wie Hamburg, Lübeck, Köln politisch interessieren, wie es früher die Könige und Herzöge draußen trieben? Als die Städte anfingen Politik zu treiben, geschah es nach städtischer Weise. Weite Gebiete verbündeten sich zur Wahrung ihrer städtischen Interessen. Solche mächtigen Städtebündnisse bildeten sich zuerst in Norddeutschland, später schlossen die norditalienischen Städte ebensolche Bündnisse. Die deutschen Städte erlangten auch weithin im Ausland bedeutenden Einfluß; in Bergen, in London hatten sie ihr mächtiges Gildehaus.
Wie sich die Fürsten entschließen mußten, den Städten das Recht zu solcher Politik zuzusprechen, so wurden die Städte auch allmählich der Mittelpunkt einer neuen Kultur. Allerdings einer materiellen Kultur, die aber zur Besiedlung weiter Gebiete führte. Neue Kulturzentren bildeten sich, in denen ein lebhafter Handel mit den nördlichen Ländern, besonders mit Rußland blühte; das sagenhafte Vineta war ein solcher Handelsplatz. Wir sehen, wie die Handelspolitik sich entwickelt, mächtige Handelsstraßen entstehen, den Rhein entlang, durch Nord- und Mitteldeutschland, mit wichtigen Handelsstädten wie Magdeburg, Hildesheim, Erfurt, Breslau und so weiter. Aus diesen Städtebündnissen ging das hervor, was man die Hansa nennt. Im Lauf der Zeit war es nötig geworden, nicht nur Handels-, sondern auch Kriegspolitik zu treiben. Im Hintergrunde lauerten Feinde, die Ritter und Herzöge, die neidisch die
Entwickelung der Städte verfolgten. Die Städte mußten sich mit Mauern umgeben und sich gegen ihre Feinde verteidigen. So wurden sie immer mehr mächtige Kulturstätten, auch Mittelpunkte des geistigen Lebens. Was in jener Zeit geistiges Leben in sich spürte, zieht sich in den Städten zusammen. Auch die Kunst erblüht in den mittelalterlichen Städten unter dem Einfluß des freien Bürgertums. In Venedig wird die Halle der Tuchmacher durch Tizian gemalt.
Auch eine neue Form der Kriegsführung entstand. Durch die Anwendung des Pulvers, dessen Gebrauch schon früher im Orient bekannt war, aber erst jetzt für Europa neu gefunden wurde, entsteht eine neue, die demokratische Form des Kampfes gegenüber dem Einzelkampf der geharnischten Ritter. Die Anwendung des Schießpulvers bildet sich immer weiter aus. Erst waren es ungeschlachte Donnerbüchsen und Mörser, aber bald wurden vollkommenere Waffen besonders durch Kaspar Zöllner in Wien erfunden.
Was sich namentlich in den Städten im Zusammenhang mit dem Geiste kirchlichen Lebens entwickelte, ist für den Kulturfortschritt von besonderer Wichtigkeit. Wir haben gesehen, wie die höchste Ekstase der religiösen Schwärmerei in den Kreuzzügen sich darstellt. Wir haben gesehen, wie namentlich am Rhein die deutsche Mystik aufblüht, wie die Brüder des gemeinsamen Lebens eine tiefe Frömmigkeit ganz unabhängig von Rom pflegen. Zwei verschiedene Zeitströmungen treten uns jetzt entgegen: auf der einen Seite ist der Bürger bedacht auf Erhöhung des materiellen Lebens, auf der anderen Seite sehen wir hier ein ins Innere gerichtetes geistiges Leben. Im frühen Mittelalter ist materielles und geistiges Leben eng ineinander verschlungen, das Gedeihen seiner Früchte wie sein religiöses Empfinden glaubt der Landmann durch die Kirche gefördert
und gesegnet. Jetzt, wo persönliche Tüchtigkeit in den Vordergrund trat, spalteten sich diese Richtungen.
Der eigentümliche Baustil des Mittelalters, den man fälschlich den gotischen nennt, kam aus Südfrankreich, entstammte Gegenden, wo solche frommen Ketzer lebten wie die Katharer, die Waldenser, die bestrebt waren, das innere Leben zu vertiefen und mit dem üppigen Leben der Bischöfe und des Klerus zu brechen. Ein eigentümliches geistiges Leben breitet sich von dorther aus; die deutsche Mystik wird stark davon beeinflußt.
Welch tiefen Einfluß diese Gesinnung auch auf die äußere Gestalt dieser Kirchen hatte, geht daraus hervor, daß alle diese gotischen Münster einen mystischen Schmuck besaßen in den wunderbaren Glasmalereien. Diese Kunst, die im 17. Jahrhundert vollständig verlorengegangen ist, war nicht artistische Allegorie, sondern die Sinnbilder, die dort eingemalt waren, übten wirklich einen mystischen Einfluß aus auf die Menge, wenn der Sonnenschein durch sie hereinschien in die dämmerigen hohen Kirchen. Eng bedingt war diese Bauart aus den Verhältnissen der mittelalterlichen Städte, gotisch war auch das Rathaus, das Gildehaus. Die Stadt, die von Mauern umgeben war, war darauf angewiesen, sich innerhalb dieser Mauern zu vergrößern, der romanische Baustil reichte dazu nicht aus. So entstanden die hochaufstrebenden gotischen Kirchen, ein Ausdruck zugleich der Innerlichkeit des damaligen Lebens; die Totentänze, die sie häufig schmücken, führten die Vergänglichkeit alles Irdischen vor Augen.
In der Sorge für die Reinlichkeit und Schönheit ihrer Stadt finden die Bürger eine vornehme Form, ihren Namen im Gedächtnis ihrer Mitbürger zu erhalten. Besonders werden überall schöne Brunnen errichtet. Wir sehen, daß damals etwas entsteht, was im Mittelalter besondere Bedeutung
erlangte, die öffentlichen Bäder, die in keiner Stadt fehlten. Im späteren Mittelalter gaben diese Bäder Anlaß zu moralischen Ausschreitungen und wurden aus diesem Grunde vom Protestantismus ausgerottet. Doch dieser Bürgersinn ging noch weiter, er griff in das öffentliche Leben ein, indem er Wohltätigkeitsanstalten schuf, die heute noch als Muster gelten können. Und diese Wohltätigkeitsanstalten wurden auch dringend nötig, denn im 14. Jahrhundert wurde Europa von schweren Plagen heimgesucht, von Hungersnöten, dem Aussatz, der Pest oder, wie man es damals nannte, «dem schwarzen Tod». Aber der mittelalterliche Mensch wußte dem zu begegnen. Siechenhäuser, Spitäler, Pfrundhäuser entstanden allerwärts und auch für die Fremden wurde gesorgt durch die sogenannten Elendsherbergen. Elend war damals gleichbedeutend mit fremd und hat erst später eine andere Bedeutung erlangt.
Neben diesen lichten Seiten des mittelalterlichen Lebens gab es natürlich auch manche dunkle. Vor allem die harte Behandlung aller derjenigen, die nicht zu einer festen Gemeinschaft gehörten. Sie waren ausgestoßen, etwas für das die Städte nicht aufkamen. Alle die nicht zur Zunft gehörten, mußten eine schlechte Behandlung erleiden. Vor allem die «fahrenden Leute». Der Name «unehrliche Leute» entstand damals, eine furchtbare Bezeichnung für die fahrenden Leute. Zu den unehrlichen Leuten wurden die verschiedensten Berufe gerechnet, Schauspieler, Gaukler, Schäfer und so weiter. Ihnen war der Zutritt zu den Zünften verschlossen, sie durften sich nirgends zeigen, ohne Gefahr zu laufen, gequält zu werden. Ebenso erging es den Juden. Das Vorurteil gegen diese ist nicht sehr alt. Im frühen Mittelalter finden wir viele Juden als Gelehrte anerkannt. In späterer Zeit kamen sie dem Geldbedürfnis der Fürsten und Ritter entgegen. Durch die eigentümlichen Verhältnisse
des Mittelalters gelangten sie zu der Stellung des Geldverleihers, der zwischen Handel und Wucher stand und ihnen Haß eintrug. Doch verschaffte ihnen die Geldnot der Könige immer wieder gewisse Rechte; diese Tätigkeit trug ihnen den seltsamen Namen Königliche Kammerknechte ein. Eine andere Schattenseite bildete das Gerichtswesen, das notwendig mit dem Mittelalter heraufgezogene Strafrecht. In früheren Zeiten war Recht wirklich mit Rache verwandt, entweder sollte ein Schaden wieder gutgemacht werden, oder es sollte eben Rache genommen werden. Der Begriff der Strafe war nicht vorhanden, er kam erst jetzt herauf. Römische Rechtsbegriffe bürgerten sich ein. Die Gerichtsgewalt war ein wertvolles Vorrecht einer Stadt und die Bürger waren nicht nur stolz auf ihre Kirchen und Mauern, sondern auch auf ihr Hochgericht. Oft wurden wegen der geringfügigsten Ursachen die härtesten Strafen verhängt.
So steht das 15. und 16. Jahrhundert des mittelalterlichen Lebens unter dem Einfluß des städtischen Lebens. Eine andere Strömung ging daneben her. Was wir heute als große Politik verstehen, hing mit dieser anderen Strömung zusammen. Es ist dies die Bewegung, die man als die der Ketzer oder Katharer bezeichnet. Welchen Umfang diese angenommen hat, können Sie ermessen, wenn Sie sich die Tatsache vorhalten, daß es in Italien im 13. Jahrhundert mehr Ketzer als Rechtgläubige gab.
Hier lag auch der eigentliche Konflikt, der zu den Kreuzzügen führte. Als auf der Kirchenversammlung zu Clermont 1095 der Beschluß zu ihnen gefaßt worden war, war es nicht nur Gesindel, nein, es waren auch anständige Leute, die sich in ungeordneten Scharen unter Peter von Amiens und dem Ritter Walter von Habenichts auf den Weg nach dem gelobten Lande machten. Ein päpstliches
Unternehmen war es, es war nicht lediglich hervorgegan. gen aus Begeisterung. Es handelte sich um die Bedrängung des päpstlichen Einflusses durch die Ketzer. Das Bestreben des Papstes war, was auch wirklich erfolgte, so einen Abfluß für die Ketzer zu schaffen.
Im ersten richtigen Kreuzzuge waren es großenteils Ketzer, die sich aufmachten. Das geht auch aus der Person des Führers hervor. Gottfried von Bouillon war von entschieden antipäpstlicher Gesinnung, wie aus seinem Vorleben hervorgeht. Denn als auf Betreiben des Papstes Gregor gegen Heinrich IV. ein Gegenkönig in der Person des Herzogs Rudolf von Schwaben aufgestellt wurde, kämpfte Gottfried von Bouillon auf der Seite des Kaisers Heinrich und tötete Rudolf von Schwaben. Man muß sehen, um was es sich für ihn handelte, was aber nicht zur Ausführung kam: in Jerusalem ein Anti-Rom zu gründen. Deshalb nannte er sich auch nur «Beschützer des heiligen Grabes» und suchte in anspruchsloser Bescheidenheit in Jerusalem die Fahne des antirömischen Christentums aufzurichten. Nach den Kreuzzügen ist dann aus den Vertretern solcher Anschauungen die ghibellinische Partei entstanden; ihnen gegenüber, auf der Seite des Papstes, standen die Guelfen.
Auch bei Betrachtung des zweiten Kreuzzuges, den auf Betreiben Bernhards von Clairvaux 1147 Kaiser Konrad III. unternahm, sehen wir dieselben Erscheinungen. Diese Kreuzzüge hatten an sich keine weitere Bedeutung, sie zeigten nur, welch ein Geist durch die Welt wehte. Barbarossa, welcher gegen den Papst und die norditalischen Städte, die auf Seite des Papstes standen, fünf Römerzüge unternahm, um sie niederzuzwingen, mußte im Frieden von Konstanz ihnen die Unabhängigkeit zugestehen, nachdem es ihm nicht gelungen war, ihre Festung Alessandria einzunehmen.
Die deutsche päpstliche Partei bestand besonders aus den Fürstengeschlechtern, die zurückgeblieben waren aus dem alten Adel. Heinrich der Stolze und sein Sohn Heinrich der Löwe kämpften für die alte Herzogsmacht gegen die kaiserliche Gewalt. Gewöhnlich wurden dann durch Vermählung mit einer Kaisertochter diese widerstrebenden Fürsten an die Kaisermacht gefesselt. Durch die Belehnung von Verwandten des Kaisers mit erledigten Herzogtümern wurden in der Folge immer wieder solche Umlagerungen der Machtverhältnisse bewirkt.
Kaiser Friedrich Barbarossa unternahm den dritten Kreuzzug, der auch zu keinen wirklichen Erfolgen führte, der aber wichtig wurde durch die Kyffhäusersage, die sich daran knüpfte. Wer Sagen lesen kann, weiß, daß er es hier mit einer der wichtigsten zu tun hat. Nicht aus der Volksseele entsprungen, wie es gewöhnlich heißt, denn es dichtete nur der Einzelne und dann verbreitete sich das, was er hervorgebracht hat, in dem Volke, wie es auch bei dem Volkslied geschieht, von dem Professoren behaupten, daß es unmittelbar aus dem Volke hervorgehe und nicht den Köpfen von Einzelnen entstamme. Hervorgegangen ist die Sage aus dem Geiste eines Menschen, der verstand die Symbole zu verwenden, die eine tiefe Bedeutung hatten, wie die Höhle im Kyffhäuser, die Raben und so weiter. Es ist eine der Sagen, die sich in der ganzen Welt finden, ein Beweis, daß hier überall etwas ähnliches vorliegt.
Die Barbarossasage ist eine kulturhistorisch sehr wichtige Sage. - Rom war in der Kirche der Anwalt dessen, was sich aus dem, dem germanischen Geiste in Verbindung mit dem Christentum aufgedrängten äußeren Beiwerk, ergab. - In einer Grotte sollte der Kaiser verborgen sein. Von alters her waren Grotten geheime Kultstätten. So wurde der Mithrasdienst allgemein in Grotten abgehalten. Bei dieser
Verehrung wurde Mithras auf dem Stiere dargestellt, dem Sinnbild der niederen tierischen Natur, die von Mithras, dem Vorgänger des Christus überwunden wurde. In der Kyffhäusersage wurde der in der Felsengrotte verborgene Kaiser zum Anwalt dessen, was sich im deutschen Seelenleben gegen Rom und seinen Einfluß wendete. Wieviel steckt in dieser Sage! Ein reines Christentum, das damals von vielen ersehnt wurde, sollte, wenn die Zeit gekommen war, aus der Verborgenheit hervorgehen.
Unter dem Staufenkaiser Friedrich II. geschah der Mongoleneinfall, der Europa verwüstete. Nicht eine Geschichte der Hohenstaufen will ich Ihnen hier geben, nur auf das hindeuten, was sich aus den Kreuzzügen entwickelte: erweiterte Handelsbeziehungen, eine Neubelebung der Wissenschaften und Künste durch die Berührung mit dem Orient. Was die Kreuzfahrer errangen an neuen Erfahrungen und Gütern, brachten sie mit in die Heimat.
Damals war es auch, als die beiden großen Mönchsorden entstanden, die für das geistige Leben von besonderer Bedeutung wurden, die Dominikaner und die Franziskaner. Die Dominikaner vertraten die als Realismus bezeichnete geistige Richtung, während die Franziskaner dem Nominalismus sich zuneigten. Im heiligen Lande geschah auch die Gründung der geistlichen Ritterorden; der Johanniterorden wurde zunächst zur Krankenpflege gegründet.
Aus einer ähnlichen Stimmung wie die, welche ich Ihnen als die von Gottfried von Bouillon geschildert habe, ging der zweite Ritterorden, der der Tempelherren hervor. Seine wirklichen Ziele wurden geheimgehalten, doch durch intime Agitatoren war der Orden bald sehr mächtig geworden. Es herrschte in ihm ein antirömisches Prinzip, wie es auch bei den Dominikanern sich zeigte, die sich häufig in völliger Opposition gegen Rom befanden; so standen sie
bei dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis in heftigem Widerstand gegen den Papst. Die Tempelherren erstrebten eine Reinigung des Christentums. Unter Berufung auf Johannes den Täufer vertraten sie eine asketische Tendenz. Ihre gottesdienstlichen Handlungen waren aus dem Widerstande gegen die römische Verweltlichung so kirchenfeindlich, daß es heute noch nicht angeht, darüber öffentlich zu reden. Der Orden war durch seine Macht dem Klerus und den Fürsten sehr unbequem geworden, er mußte schwere Verfolgungen erleiden und ging zugrunde, nachdem sein letzter Großmeister, Jacob von Molay, mit einer Anzahl von Ordensbrüdern 1314 den Märtyrertod erlitten hatte.
Auch der «deutsche Ritterorden» war ähnlichen Ursprunges. Mit dem Orden der Schwertbrüder, der sich ihm anschloß, machte er es sich besonders zur Aufgabe, die noch heidnisch gebliebenen Gegenden Europas zu bekehren, besonders im Osten, von seinem Hauptsitze Marienburg aus. Aus den Berichten der Zeitgenossen erhält man von den Bewohnern der Gegenden, die heute die Provinzen Ost- und Westpreußen bilden, ein merkwürdiges Bild. Albert von Bremen schildert die alten Preußen als vollständige Heiden. Bei diesem Volke, von dem es nicht genau feststeht, ob es germanischen oder slawischen Stammes war, finden sich die alten heidnischen Gebräuche des Pferdefleisch-Essens und Pferdeblut-Trinkens. Der Chronist beschreibt sie als heidnisch grausame Leute.
Bevor sie mit den deutschen Rittern in Berührung gekommen war, hatten die Schwertbrüder besonders nach weltlicher Gewalt gestrebt.
Man kann sich die Entwickelung nur konstruieren. Obgleich sich die Städte gebildet hatten, war doch ein Teil der Herzogsgewalt und des Raubrittertums zurückgeblieben.
Nicht Begeisterung für das Christentum, sondern bloßer Egoismus war es, der es bewirkte, daß die Reste des Feudal. adels sich zusammenzogen in diesen beiden deutschen Ritterorden. In diesen Gegenden war kein nennenswerter Einfluß der Städte zu verspüren. Die anderen beiden christlichen Orden waren Verbindungen derer, die nicht mit Rom in Verbindung standen. Wenn man die historischen Quellen untersucht, wird man oft Bündnisse zwischen ihnen und den Städten finden.
Neben diesen zwei Strömungen der städtischen Entwikkelung und des tieferen religiösen Lebens sehen wir, daß die kaiserliche Gewalt alle Bedeutung verlor. In den Jahren 1254 bis 1273 war in Deutschland kein Träger der kaiserlichen Gewalt vorhanden, die Kaiserwürde war zeitweise an ausländische Fürsten verkauft, von denen der eine, Richard von Cornwall nur zweimal nach Deutschland kam, während der zweite, Alfons von Castilien, es überhaupt nicht betreten hat.
Als man endlich wieder zu einer richtigen Kaiserwahl schritt, war das Bestreben, nicht irgendwelche kaiserliche Zentralgewalt aufzurichten oder nochmals zu versuchen, eine Kaisermacht zu schaffen, sondern der Wunsch war ausschlaggebend, Ordnung in bezug auf das Raubrittertum zu bringen.
So wählte man den Grafen Rudolf von Habsburg. Wenn man fragen soll, was er und seine Nachfolger für das Reich taten, würde es schwer sein, dies zu sagen, denn sie waren nicht für die öffentlichen Verhältnisse tätig. Sie waren beschäftigt, ihre Hausmacht zu begründen. So verlieh Rudolf von Habsburg nach dem Tode des Herzogs Heinrich Jasomirgott Niederösterreich an seinen Sohn und gründete damit die habsburgische Hausmacht. Seine Nachfolger suchten diese Macht durch Eroberungen und besonders durch
Heiratsverträge zu erhöhen und kümmerten sich nicht mehr um irgend etwas, was mit allgemeinen Interessen zusammenhing.
Sie sehen, was wirklich bedeutend für die Fortentwickelung war: Die Ereignisse, die zu den mittelalterlichen Verhältnissen das ergaben, was endlich zu den großen Entdekkungen und Erfindungen am Ende des Mittelalters führten, Wir sehen die Städte mit mächtig aufstrebender, aber verweltlichter Kultur; in der Kirche sehen wir die Scheidung, das Schisma, die Trennung; aus dieser Strömung heraus bricht der letzte Akt des mittelalterlichen Dramas an, wir sehen die Abendröte des Mittelalters, den Aufgang einer neuen Zeit.
ZEHNTER VORTRAG, 29. Dezember 1904
Wir schreiten immer mehr in der Betrachtung der Geschichte fort zu den Zeiten, in denen die großen Erfindungen und Entdeckungen geschahen im 15. Jahrhundert.
Die neue Zeit beginnt. Für eine geschichtliche Betrachtung hat diese neue Zeit besonderes Interesse; in charakteristischen Merkmalen vollzieht sich der Übergang zu den großen Staatenbildungen Europas. Wir haben gesehen, wie aus der Feudalmacht der Übergang zu der neuzeitlichen Fürstenmacht sich entwickelt. Sie bedeutet auf der einen Seite eine Reaktion von alten Überbleibseln aus früherer Zeit und nur in gewisser Weise eine Erneuerung. Dasjenige, was geblieben ist von den alten Ansprüchen von Fürsten und Herzögen, was übriggeblieben war, sammelt wieder seine Kräfte und bestimmt durch seine familiären privaten Verhältnisse die Landkarte Europas.
Der Grundbesitz war in seiner Vorherrschaft durch die
Städte abgelöst worden, das Bürgertum blühte und alle eigentlichen Kulturfaktoren gingen von den Städten aus. Das Kaisertum war zu einer Schattenmacht herabgesunken; nach langem Interregnum wurde Rudolf von Habsburg zwar gewählt, aber der Kaiser war im Reich sehr unnötig geworden, er brauchte sich dort kaum mehr sehen lassen. Die habsburgische Dynastie ist nur bestrebt, durch diese kaiserliche Gewalt ihre Hausmacht zu mehren, überall, wo außerhalb der Städtemacht ihr Rechte geblieben sind. Es ist ein einfacher Prozeß, der sich hier vollzieht, auch die übrigen - Fürsten und Herzöge - sammeln, was ihnen geblieben ist, um ihre Hausmacht zu stärken, und schaffen so die Grundlage für große politische Gebiete.
Der Mongoleneinbruch, später die Einfälle der Türken, geben dazu Anlaß. Nur größere Fürsten sind imstande, ihre Gebiete zu verteidigen; es schließen sich die kleineren dem mächtigeren an und bilden so die Grundlage für künftige Staaten. Der neue Kaiser bedeutete nur noch sehr wenig. Wie erwähnt, war Rudolf von Habsburg nur bestrebt, sich eine Hausmacht zu gründen. Nach der Überwindung Ottokars von Böhmen wurde sein Sohn mit dessen Ländern belehnt, später wurde die habsburgische Hausmacht dadurch verstärkt, daß immer neue Gebiete dazu erheiratet wurden.
Nur der Vorgang kann bei all diesen rein privaten Unternehmungen uns interessieren, daß es dabei zu dem Aufstande der Schweizer Eidgenossen kam, die frei sein wollten von den Ansprüchen, die der Nachfolger Rudolf von Habsburgs, Kaiser Albrecht I., an sie machte. Durch harte Kämpfe erlangten sie es, nur abhängig von kaiserlicher Gewalt - reichsunmittelbar - zu sein; sie wollten nichts wissen von fürstlicher Gewalt.
Das Bestreben, die eigene Hausmacht zu vergrößern,
setzt sich fort unter den folgenden Kaisern; so bemächtigt sich Adolf von Nassau eines großen Teiles von Thüringen, das er den schwächlichen Fürsten entreißt. Auch Albrecht von Osterreich und dessen Nachfolger Heinrich von Luxemburg suchen sich in dieser Weise zu bereichern, letzterer, indem er seinen Sohn mit einer böhmischen Prinzessin vermählte. Dies ist ein typischer Fall für die Entwickelung der damaligen Verhältnisse.
Diese Strömung setzte sich fort unter neuem Anwachsen der kirchlichen Gewalt, aber zugleich war auch ein Anwachsen der Strömung vorhanden, die nichts mit der Kirche zu tun haben wollte. Die Lehren der Waldenser oder Katharer wirkten aufreizend, es gab gewaltige Kämpfe gegen die wieder aufkommende Fürstenmacht. Die Lage der Bauern, die sich gehoben hatte durch die Städte-Entstehung, wurde jetzt immer drückender durch das feudale und Raubrittertum, die Bistümer und Abteien, denen sie fronen mußten. Die Städte hatten eine Zeit der Blüte gehabt, damals hatte der Grundsatz gegolten: Stadtluft macht frei. - Doch mit der Zeit waren viele Städte in Abhängigkeit geraten, besonders war es den Hohenstaufen gelungen, viele Städte in Abhängigkeit zu bringen. Jetzt bestrebten sich die Städte, weiteren Zufluß abzuhalten, sie machten Schluß damit und suchten auch hier sich fürstlichen Schutz. Die Bauernbevölkerung geriet dadurch in erhöhte Abhängigkeit von ihren Grundherren. Die Stimmung der Unterdrückten wurde aufgestachelt von den Waldensern und Ketzern, denen die Kirche nicht mehr genügte.
Der Schrei nach Freiheit und die christlich-ketzerische Stimmung gingen Hand in Hand; es verquickte sich religiöse Stimmung mit politischer Bewegung und diese Volksstimmung fand ihren Ausdruck in den Bauernkriegen. Wer sie erfassen will, diese geistige Ketzerstimmung unabhängig
von äußerer Kirchlichkeit und Fürstengewalt, der muß sich vergegenwärtigen, daß besonders in den Rheingegenden -«des Heiligen römischen Reiches Pfaffengasse» - durch Jahrzehnte hindurch harte Kämpfe von der fürstlichen Macht gegen diese Strömung geführt wurden. Volkstümliche Prediger, die namentlich dem Dominikanerorden entstammten, widersetzten sich, ja, es kommt zum Streite der Prediger, weil sich diese Prediger nicht fügen wollen der Bedrückung des Volkes durch die päpstliche Gewalt. Sie sind nicht einverstanden mit der politischen Machtentfaltung des Papsttums und der Ausbreitung der Macht der Fürsten.
Die französischen Könige sahen in dem Papsttum eine Unterstützung im Kampfe mit der deutschen Fürstenmacht. So wurde der Papst nach Avignon geführt und während etwa siebzig Jahren hatten die Päpste dort ihren Sitz. Heinrich von Luxemburg kämpft mit dem Papst, dem der König von Frankreich seine Unterstützung leiht. So beherrscht nun der Papst von Avignon, von Frankreich aus, die Christenheit, und wie die Fürsten ihren Lehensleuten gegenüber immer mehr ihre Macht zur Geltung bringen, so streben die Päpste nach immer größerer Ausbreitung ihrer Gewalt. Der weltliche Klerus, die machtbesitzenden Abteien und Bistümer waren abhängig vom Papst. Währenddessen gestalteten die Fürsten willkürlich die Landkarte Europas. Kaiser Karl IV. vereinigt unter seiner Hausmacht Brandenburg, Ungarn und Böhmen. Die Kaiserwürde ist zur Titulatur geworden, die Kaiser begnügen sich damit, ihre Privatländer zu verwalten, der Kaisertitel wird von den Fürsten verschachert.
Wollen wir die eigentliche Geschichte verstehen, müssen wir uns vorhalten, wie der große Umschwung vom Mittelalter zur neuen Zeit darin bestand, daß die Fürsten für ihre
Privatinteressen jene unzufriedene Stimmung benutzt haben; die Staaten, die sich bilden, sehen wir ihre Fangarme ausbreiten über eine jahrhundertlange populäre Strömung, und es wird diese Strömung für religiöse Freiheit benutzt, um zuerst das Papsttum zu bekämpfen und seine Macht zu unterbinden und sich selber dann in diese Machtstellung hineinzuschleichen.
Auf dem Grunde der Volksseele entwickelte sich jene Strömung; sie erstrebte etwas ganz anderes, als was dann die Reformation brachte. Der verweltlichte Klerus war ein ebensolcher Bedrücker geworden wie die weltlichen Fürsten. Die städtische Bevölkerung sah sich in ihrem Egoismus nicht genötigt, sich auf die Seite der Bedrückten zu stellen, nur wenn ihre eigene Freiheit bedroht wurde, sahen wir sie bemüht, sich diese Freiheit zu erhalten. So gelang es ihnen im schwäbischen Städtebund und in der Pfalz doch nicht, sich zu behaupten, so daß sich auch hier neue Fürstenmacht herausbildete.
Schon während der Regierung des Kaisers Sigismund kam es zum Ausbruch in Böhmen in einer eigentümlichen religiösen Bewegung. Eine Bewegung, die sich ausbreitet unter einem Manne, der - man mag anerkennen oder leugnen, was er vertrat - doch nur sich auf seine eigene Überzeugung verließ; eine Überzeugung, die sich stützte auf den reinsten Willen, auf das Feuer in der eigenen Brust. Dieser Mann war Johannes Hus von Hussonetz, der Prediger und Professor an der Universität Prag. Gestützt auf etwas, was in ganz Europa sich ausbreitete - denn schon vorher war in England durch Wielif auf Herstellung des ursprünglichen Christentums gedrungen worden -, was aber besonderen Glanz erhielt durch die feurige Beredsamkeit des hervorragenden Mannes, fand Hus überall Zustimmung. Überall fanden seine Worte dadurch Eingang, daß man nur
hinzuweisen brauchte auf das schmähliche Verhalten des weltlichen Klerus, auf den Verkauf der Bistümer und so weiter. Es waren zu Herzen gehende Worte, denn sie verkündeten etwas, was als Stimmung durch ganz Europa ging und nur dort hervortrat, wo eine Persönlichkeit sich fand, die ihr Ausdruck verlieh. Durch die Päpste und die Gegen-päpste war die Kirche in Unordnung geraten, die Päpste selbst mußten etwas tun. So wurde das Konzil von Konstanz einberufen. Es bildete einen Wendepunkt des mittelalterlichen Lebens. Eine Umwandlung in eine reine Kirche wurde angestrebt. Dieses Vorhaben setzte eine lebhafte Opposition in Bewegung. Politische Beweggründe spielten mit, Kaiser Sigismund selbst war lebhaft interessiert. Die ärgsten Mißstände der Kirche sollten abgestellt werden, denn der Klerus war vollständig verwahrlost, auch in den Klöstern waren unglaubliche Mißbräuche eingerissen. In Italien hatte Savonarola seine machtvolle Agitation gegen die Verweltlichung der Kirche begonnen. Auch damit wollte das Konzil abrechnen. Der Vorsitzende des Konzils war Gerson, der oberste Leiter der Pariser Universität, ein zweiter Tauler für die romanischen Länder. Diese Tatsache war für den Ausgang des Konzils bedeutsam, denn mit Hilfe des Gerson war es dem Kaiser möglich geworden, die Führung den Päpstlichen zu entreißen und dem Hussitismus den Garaus zu machen. Weil diese Strömung nichts zu tun hatte mit politischer Machtentfaltung, sondern aus tiefster Volksseele hervorging, deshalb war sie den geistlichen und auch besonders den weltlichen Machthabern so gefährlich. Es ist nicht Rom allein, es ist die heraufkommende Fürstengewalt, der Hus zum Opfer gefallen ist. Die Hussiten führten ihren Krieg für ein republikanisches Christentum nicht nur gegen die Kirche, er wurde geführt gegen die herannahende Fürstenmacht.
Im Protestantismus verbündet sich aber diese Macht mit der religiösen Unzufriedenheit, um sie für seine Zwecke auszunützen. Die Taten der Nachfolger des Hus waren damit zum Tode verurteilt, daß die Fürstengewalt gesiegt hatte. Sonst hatten die Kaiser in jener Zeit nicht besondere Macht: den Kaiser Friedrich III. zum Beispiel nannte man allgemein den «unnützen Kaiser».
So gibt sich uns ein Bild der eigentümlichen Entwickelung in jener Zeit. In den immer mehr heraufkommenden Städten ein blühendes Leben, dahingegen dort, wo die feudale Macht sich behauptete, fortwährend zunehmende Bedrückung; auf dem Gebiete tieferen religiösen Lebens zugleich, von diesen beiden Faktoren beeinflußt, eine starke Bewegung, wie sie im Auftreten eines Wielif, eines Hus hervortrat. Italien bietet uns ein glänzendes Bild jenes städtischen Lebens in seinen Städterepubliken; so waren es in Florenz die Mediceer-Kaufleute, die grundlegend wirkten für die Kultur Italiens. Alle diese Städte waren maßgebende Kulturfaktoren.
So werden Sie begreifen, daß die Mittel, durch die man sonst zur Macht gelangte, nicht mehr ausreichten. Im Mittelalter hatte außer der Anzahl von Geistlichen, die in den Klöstern und in den Beamtenstellen wirkten, niemand lesen und schreiben können. Nun ist dies Verhältnis ein anderes geworden. Lesen und Schreiben findet Verbreitung durch die neuen Strömungen, die nun über die Volksmengen dahinfluten. Die großen Schreibinstitute verbreiteten in Abschriften, was früher dem Volke verboten war, und diese Abschriften wurden gekauft wie später Bücher: Schriften des Neuen Testamentes, populärwissenschaftliche Bücher, Sagen-, Legenden-, Helden- und Arzneibücher wurden im 14. Jahrhundert ins Volk geworfen.
Namentlich von den Brüdern vom gemeinsamen Leben
waren, wie schon erwähnt, überall Schulen errichtet worden. Den Rhein entlang namentlich wurde, was früher in Klöstern verborgen war, jetzt ans Licht geholt. Eine förmliche Abschriftenindustrie entstand in Hagenau im Elsaß, deren Ankündigungen wie zum Beispiel die von Lamberts, einem heutigen Kataloge ähnlich sind. Auch von Köln ging ein nachhaltiger Handschriftenhandel aus und die Brüder vom gemeinsamen Leben wurden auch genannt «Brödder von de penne».
Hier haben wir das Vorbereitungsstadium der Buchdrukkerkunst. Sie entsprang einem tiefen Bedürfnis, sie ist nicht wie aus der Pistole geschossen entstanden, sondern war dadurch vorbereitet, daß sie zum Bedürfnis geworden war, indem die Bücher, die durch Abschrift hergestellt wurden, zu teuer waren, aber auch die ärmeren Volksklassen nach Büchern verlangten. Sie war ein Mittel damals, das Volk aufzurütteln.
Die Männer, die dazumal die Sache der Bauern führten, konnten nur dadurch diese Flugschriften im Volk verbreiten, daß ihnen die Verhältnisse entgegenkamen. So entstanden damals die Bauernbündnisse, der «Arme Konrad», der «Bundschuh» mit dem Wahlspruch: «Wir mögen von Pfaffen und Adel nicht genesen». Von allen Seiten ging damals das Bedürfnis nach etwas Neuem aus und als um 1445 Gutenberg die beweglichen Lettern erfand, war das Mittel gegeben, das dazumalige Kulturleben ausgestalten zu können. Die Empfänglichkeit war vorbereitet für die Erweiterung des Gesichtskreises. Unter dem Einfluß solcher Stimmungen entwickelt sich die Verweltlichung von Künsten und Wissenschaften, und dadurch die Periode der Erfindungen und Entdeckungen. Während früher die Kirche allein die Trägerin der Künste und Wissenschaften gewesen ist, sind jetzt die Städte und das Bürgertum die Träger der Kultur;
aus der früheren bloß kirchlichen Kultur ist sie herübergebracht und verweltlicht worden.
Wir kommen zu den Entdeckungen, die wir nur kurz aufzählen können, die den Schauplatz der Menschengeschichte über weite unbekannte Gebiete hin erstreckte. Dazu kam der Einfall der Türken in Griechenland, wodurch die dort noch vorhandene Kultur Einfluß auf Europa gewann. Es wanderte eine große Anzahl von griechischen Künstlern und Gelehrten nach den anderen Ländern, namentlich nach Italien aus und fand in den Städten Unterkunft. Sie befruchteten den Geist des Abendlandes. Diese Reformation nennt man die Renaissance. Das alte Griechenland stand wieder auf, jetzt erst konnte man die Schriften kennenlernen, auf denen das Christentum fußte. Das alte hebräische Testament wurde gelesen, namentlich Reuchlin verdanken wir das und durch ihn und Desiderius Erasmus von Rotterdam wurde die Bewegung in die Welt gesetzt, die wir als Humanismus kennen. Aus den Bestrebungen, die durch diese Einwirkungen eingeleitet waren, ging die Morgenröte der neuen Zeit hervor. Noch etwas hatte die Ausbreitung der türkischen Gewalt zur Folge. Lange schon hatte das Abendland mit dem Orient in Verbindung gestanden. Durch die Herrschaft der italischen Städte über die Meere, deren Mittelpunkt Venedig war, hatte man die Produkte des Orients, namentlich indische Spezereien, nach Europa verfrachten können. Als nun durch den Einfall der Türken den Handelsleuten die Möglichkeit dieser Verbindung erschwert worden war, entsprang daraus das Bedürfnis, um Afrika herum einen anderen Weg nach Indien zu finden. Von Portugal und anderen südlichen Ländern gingen Sendungen aus, um die Gegenden um Afrika zu erforschen, und es gelang Bartolomeo Diaz, das Kap der Stürme später Kap der Guten Hoffnung,
und Vasco da Gama 1498 den Seeweg nach Indien zu finden. Damit war eine neue Epoche für das europäische Wirtschaftsleben angebrochen, die ihren Gipfelpunkt 1492 in der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus fand. Doch das gehört zu der Geschichte der neueren Zeit.
So haben wir den Ausgang des Mittelalters kennengelernt und die Faktoren, die hinüberführen zu einer neuen Zeit. Erschüttert sehen wir das ganze Leben in seinen Grundlagen. Und wenn man oft meint, daß die Einschnitte bei der Geschichtsbetrachtung willkürlich gewählt seien, dieser Einschnitt ist wirklich bedeutsam. Es geschah einer von jenen «Rucken», wie wir das in der Mitte des Mittelalters bei der Städtegründung, im Anfang bei der Völkerwanderung haben verfolgen können.
Jetzt unter der Ägide der Städtekultur in Verbindung aller dieser Erfindungen mit der großen wissenschaftlichen Eroberung, die die Tat des Kopernikus ist, wird eine ganz neue Kultur hervorgerufen. Die Verweltlichung der Kultur, eine Erstarkung der Fürstenmacht wird herbeigeführt durch diese Strömung. Kleinere Gebiete hatten nicht Widerstand leisten können gegen die verheerenden Züge der Türken, sie hatten sich Mächtigeren angeschlossen. All diesen Faktoren ist die Ausbreitung der großen Staaten zuzuschreiben. In mannigfaltigen Bildern haben wir die Verhältnisse sich wandeln gesehen, wir haben gesehen, wie das Bürgertum ersteht, wie es emporblüht und wie ihm in der Fürstenmacht ein gefährlicher Gegner entgegentritt.
Sie wissen, daß die Gegenwart das Ergebnis der Vergangenheit ist, wir werden daher Geschichte treiben in richtiger Weise, wenn wir von der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft lernen in der Art, wie es uns in dem Ausspruch eines alten keltischen Barden entgegentritt, der sagt, daß es ihm die schönste Musik sei, wenn er die großen Taten
der Vorzeit höre, die ihn aufrütteln und begeistern. So wahr es ist, daß das menschliche Dasein das wichtigste Phänomen und damit der Mensch selbst das würdigste Studium ist, so wahr ist es auch, daß der Mensch sich ein großes Rätsel bleibt. Wenn der Mensch sich klar wird, daß er sich selbst ein Geheimnis bleibt, wird er zu dem rechten Studium gelangen. Denn nur dann wird der Mensch sich in rechter Würdigung gegenüberstehen, wenn er weiß, daß dies sein Geheimnis ist: sein eigenes Dasein im Zusammen-hange stehend mit dem Allsein. Das gibt ihm die rechte Grundlage für all sein Tun und Handeln.
Will er aber etwas erfahren über dieses Geheimnis seines eigenen Daseins, so muß er sich wenden an die Wissenschaft, die von seinem eigenen Streben erzählt. In der Weltgeschichte sehen wir, wie Gefühle und Gedanken in Handlungen übergehen. Darum sollen wir Weltgeschichte lernen, daß wir an ihr beflügeln unsere Hoffnungen, unsere Gedanken und Gefühle. Bringen wir herüber aus der Vorzeit, was wir brauchen für die Zukunft, was wir brauchen für das Leben, für die Tat!
II. VORTRÄGE AN DER BERLINER «FREIEN HOCHSCHULE»
PLATONISCHE MYSTIK UND DOCTA IGNORANTIA
ERSTER VORTRAG, 29. Oktober 1904
Im Aufgange dessen, was wir die christliche Mystik nennen, zur Zeit der Gnosis, wurde die Mystik «Mathesis» genannt. Es war eine Welterkenntnis im großen, die nach dem Muster der Mathematik aufgebaut ist. Der Mystiker sucht nicht bloß den äußeren Raum nach innerlich gewonnenen Gesetzen zu erkennen, sondern er sucht alles Leben zu erkennen; er beschäftigt sich mit dem Studium der Gesetze alles Lebens. Vom Allereinfachsten ausgehend steigt er zum Vollkommenen auf. Die Grundlage des mystischen Denkens, die Grundbegriffe der Mystik, der Inhalt dessen, was man Mystik nennt, wird wenig verstanden, nicht deshalb allein, weil sie bloß nach dem äußeren Worte beurteilt wird. Wenn man Darstellungen der Mystik liest, so ist es so, als ob man eine Darstellung läse, in der von Winkeln und Ecken in einem Hause gesprochen wird, da wo der Mathematiker eigentlich mathematische Winkel und Ecken meint. Die Worte der Mystik beziehen sich aber auf Lebenszusammenhänge.
Wir betrachten nun ein Bild der mystischen Vorstellungsweise bis zum Meister Eckhart im 13. und 14. Jahrhundert, dessen Predigten alle späteren Mystiker angeregt haben. Wir müssen da an einen Namen anknüpfen, der oft verkannt wird, den des Dionysius Areopagita. In der Apostelgeschichte wird erzählt von einem Dionysius, der ein Schüler des Apostel Paulus gewesen sein soll. Im 6.
Jahrhundert tauchten einige Schriften auf, die außerordentlich anregend sind für die, welche eine Religion des Gemütes brauchen. Aus dem Griechischen wurden sie ins Lateinische übersetzt, und dadurch wurden sie dem abendländischen Geistesleben bekannt gemacht. Das geschah am Hofe Karls des Kahlen durch den Theologen Scotus Erigena.
Man nennt heute in gelehrten Schriften die Werke des Dionysius gewöhnlich die des Pseudo-Dionysius. Man kann die Schriften nicht weiter zurück als bis zum 6. Jahrhundert nachweisen. Aber da sie durch Tradition überliefert wurden, ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß die Schriften in den ältesten Zeiten der abendländischen Welt bestanden. Im 6. Jahrhundert sind sie aber wohl erst niedergeschrieben worden.
Der Mystiker denkt anders, als der Rationalist und Materialist es tut. Der Mystiker sagt: Ich sehe hinaus in den Raum, sehe die Gesetzeswelt, nach der die Sterne sich bewegen; ich erfasse diese Gesetze und schaffe sie nach. So gibt es also eine nacherschaffende Kraft des Geistes. Der Gedanke ist für den Mystiker nichts bloß Imaginäres. Der Gedanke, der im Menschen lebt, ist nur ein nachschaffender Gedanke, worin der Mensch das nachlebt, was draußen in der Welt erschafft. Der Geist, der draußen im Weltenall schafft, ist derselbe Geist, der seine Gesetze in mir nachdenkt. Er sieht draußen in der Welt sprechende Gedanken. Die schaffenden Gewalten des Weltenalls haben die Gesetze den Sternenbahnen eingeprägt. Dieser Geist feiert seine Selbsterkenntnis, seine Wiedergeburt im Menschengeist. Der Mystiker sagte sich: Im Weltenall draußen schafft der Gedanke. Indem der Mensch erkennt, erkennt er den objektiven Gedanken draußen. Im Menschen wird er subjektiver Gedanke. Es gibt ein Bindeglied, welches zu gleicher Zeit den Menschen in seinem innern Erleben trennt von
dem äußeren Gedanken und verursacht, daß der Gedanke von außen hereinfließt in ihn.
Wenn wir einen Kristall ansehen, so ist in dem Kristall der Gedanke eines Würfels oder ein anderer Gedanke verwirklicht. Wenn ich diesen Gedanken verstehen will, muß ich den Gedanken nachkonstruieren, nachleben. Daß das, was in der Außenwelt lebt, zu mir in Beziehung tritt, geschieht durch die Empfindung von innen, durch den Weg des Auges, die Empfindung, die den Gedanken nachlebt.
Wir haben also zu unterscheiden: Erstens den schaffenden Gedanken im Weltenall; zweitens die Körperlichkeit oder Leiblichkeit des Menschen als das Bindeglied; drittens den nachlebenden Gedanken im Menschen. - Der Leib des Menschen eröffnet die Pforte, daß der schaffende Gedanke von außen einfließt, und dadurch im Innern wieder aufleuchtet. Der Leib des Menschen bildet die Vermittlung zwischen beiden Gedanken, dem schaffenden und dem nachschaffenden. Der Mensch nennt das, was in der Natur erst erschaffender Gedanke ist, den Geist. Das, was den Gedanken empfindet, nennt er Leib. Das, was den Gedanken nachlebt, nennt er Seele. - Der Geist ist der Schöpfer des Gedankens. Der Leib ist der Empfänger des Gedankens. Die Seele ist die Erleberin des Gedankens.
Den schaffenden Geist draußen erfaßt der Mystiker unter drei Begriffen. Dies ist bei Aristoteles klar ausgeführt. Er hat einen ganz merkwürdigen Begriff vom Weltenschöpfer. Er sagt nämlich, dieser Weltenschöpfer kann nicht unmittelbar gefunden werden; er ist aber in jedem Dinge enthalten. Würde der göttliche Geist heute irgendwo in irgendeiner Gestalt vorhanden sein, und würden wir uns ein Bild vom Schöpfer danach machen, so würden wir doch nur ein unvollkommenes Bild von ihm haben. Wir dürfen uns nicht ein bestimmtes, begrenztes Bild von dem Weltengeist
machen. Erst in Zukunft wird man erkennen, was die Welt eigentlich treibt und in Bewegung setzt. Die Welt ist in fortwährender Vervollkommnung begriffen. Derjenige, der da schafft in der Welt, ist der eigentliche Beweger, der Urbeweger, der unbewegte Beweger. Zu ihm müssen wir aufblicken und in ihm die Urkraft erkennen, die in allem lebt. Der Urgeist des Aristoteles bewegt alles in der Welt, er lebt sich aber in keinem Wesen ganz aus; er ist der schöpferische, die äußere Welt bewegende, gestaltende Geist.
Immer ist in der Welt schon etwas verwirklicht. Wir erheben unseren Blick zu den Sternen eines Sonnensystems. Dort finden wir eine große Vollkommenheit. Im Sinne der Entwickelungslehre gedacht, müssen wir verstehen, daß dieses Weltensystem nicht immer da war, sondern daß es sich gebildet hat. Wo wir auch hinausblicken in das Weltall, müssen wir sagen, es hat sich bis zu einem gewissen Vollkommenheitsgrade gebildet. In verschiedenen Vollkommenheitsgraden ist das, was erreicht ist, durch den unbewegten Beweger vorhanden. Man kann überall immer unterscheiden zwischen dem schon Vorhandenen, Verwirklichten und dem fernen, göttlichen Ziel. Aber warum bewegt sich ein Weltensystem, eine Erde, zu diesem fernen Ziele hin? Es muß in sich ein Streben nach dem unbewegten Beweger haben. In der Mystik braucht man für dieses Streben in dem einzelnen Weltensystem eine Bezeichnung. Man fragte sich, wodurch hat der Mensch nach diesem unbewegten Beweger gestrebt? Er hat sein Gemüt darauf gerichtet. Der Ausdruck dieser Richtung war stets gegeben in dem Inhalt seiner Religionsbekenntnisse, in denen noch heute vorhanden ist die Anleitung, zum unbewegten Beweger zu gelangen. In der indischen Welt hieß der Ausdruck des Hinstrebens Veda oder Wort. Bei den Griechen hieß es
Logos, Wort. Es ist das Streben des Menschen nach dem unbewegten Beweger, der uns hinzieht zu sich. Das, was verwirklicht ist, heißt in den ersten Zeiten der christlichen Mystik der Geist, der Heilige Geist. Das Hinstrebende ist das Wort. In der Gnostik und bei Augustin ist der Heilige Geist der das Weltenall gestaltende Gedanke. Das, was in allen Dingen strebt, um zu der Gestalt des Geistes zu gelangen, heißt Logos oder Wort. Das dritte ist der unbewegte Beweger selbst, was die christliche Mystik der ersten Jahrhunderte den Vater nennt. Dies ist der dreifache Aspekt, unter welchem sich der Gedanke in der Außenwelt darstellt. Die erste christliche Mystik sagte: Gott stellt sich dar in drei Masken - Maske = persona, von personare, hindurchtönen -, also in drei Masken oder drei Personen des göttlichen Geistes. Unter diesen drei Masken zeigt sich der Geist im Universum.
Was als Geist im Innern des Menschen lebt, ist die Seele. Diese Seele kann nicht einen Gedanken für sich schaffen. Sie muß zuerst die Empfindung haben von dem Gegenstande. Dann kann sie in sich geistig den Gegenstand nachschaffen. Dann haben wir die Vorstellung in der Seele; dann kommt uns das Bewußtsein der Vorstellung. Was in der Seele lebt, können wir darstellen unter zwei Aspekten: dem Aspekt der Empfindung, der große Anreger, der große Befruchter; dann kommt das, was in der Seele aufleuchtet als Vorstellung; das ist das Ruhende in der Seele, was von außen seinen Inhalt empfängt. Die ruhende Seele, die sich befruchten läßt durch die Eindrücke aus der Welt, ist die Mutter. Die Summe der Empfindungen durch das Universum ist das Seelisch- Männliche, der Vater. Das, was sichbe fruchten läßt, ist das Seelisch-Weibliche, die Mutter-Seele, das Ewig-Weibliche. Das, wodurch der Mensch sich selbst bewußt wird, nennt der Mystiker den Sohn.
Die Aspekte der Seele sind: Vater, Mutter und Sohn. Sie entsprechen den drei Aspekten im Kosmos: Vater, Sohn, Heiliger Geist, den Aspekten des Weltengeistes.
Indem der Mensch durch die Empfindung seine Seele befruchten läßt, gebiert er noch einmal das ganze Weltenall aus seiner Seele heraus als Sohn. Dies aus der Seele als Mutter herausgeborene Universum nennt der Mystiker den Christus. Der Mensch, der sich dem Ideale nähert, immer mehr bewußt zu werden von dem Universum, der nähert sich dem, was der Mystiker den Christus im Menschen nennt. Meister Eckhart sagt, daß in der Seele Christus geboren wird. Ebenso sagt Tauler: Christus ist das in jedem Menschen wiedergeborene Weltenall. Diese Dreiheit war im alten Ägypten: Osiris, Isis und Horus.
Als drittes betrachtet der Mystiker das leibliche Selbst. Der Mystiker unterscheidet als sein Erlebnis die drei Personen des universellen Geisteslebens als Vater, Mutter und Sohn. In diesem Sinne muß der Meister Eckhart gelesen werden. Das Erkennen ist für den Meister Eckhart eine Auferstehung. Er sagt, Gott habe sich in ihm ein Auge geschaffen, mit dem er sich selbst anschauen könne. Wenn der Mensch sich fühlt als Organ der Gottheit, die sich dadurch selbst beschaut, dann ist er zum Mystiker geworden; eine höhere Erkenntnis ist ihm dann aufgegangen.
ZWEITER VORTRAG, 5. November 1904
Wir haben gesehen, daß der Mystik des Mittelalters zugrunde liegt die Anschauung von der Dreiteilung der menschlichen Natur und des ganzen Universums. Wir haben gesehen, wie der Mystiker sich den Geist vorstellte und
das Leibliche und Seelische. Es liegt in der Natur der mystischen Vorstellungsweise, daß der Mystiker im Geiste erlebt, was draußen in der Natur ist, daß er aus sich nachschafft, was draußen in der Natur schafft. In aller Erkenntnis, in allem innern Erleben sucht er ein Wiederaufleben des Universums aus der Seele des Menschen. In den Gesetzen, die das Universum beherrschen, sieht er die großen Weltgedanken, Weltideen. Damit steht er ganz auf dem Standpunkt der platonischen Weltanschauung. Plato war der große Mystiker des Altertums, und alle, die sich im Mittelalter in mystischer Anschauungsweise betätigt haben, fußen auf dem Platonismus. Wenn der Mystiker darum in der Natur den schaffenden Gedanken sieht, den kosmischen Gedanken, dann wird jedes einzelne, was den Mystiker umgibt, ein Ausdruck des Geistigen. Er unterscheidet: erstens die großen Weltgesetze, die schöpferischen Gedanken; zweitens die formlose Materie; drittens die Kraft, zu der die Materie wird dadurch, daß der Geist sich in ihr betätigt. Also: erstens Gesetz oder Weltgedanke; zweitens Materie; drittens Kraft. Die Kraft entsteht dadurch, daß der Weltgedanke sich in der Materie zum Ausdruck bringt. Nichts könnte mit den Sinnen wahrgenommen werden, wenn nicht die Kraft an die Sinne sich herandrängte und auf die Sinne eine Wirkung ausübte. Im äußeren Physischen gibt es also drei Glieder. In der Seele ersteht das Äußerliche innerlich wieder auf.
Wir unterscheiden im Sinne der Mystik: erstens das Vaterprinzip, die Summe aller Empfindungen und Wahrnehmungen; zweitens das, was die Empfindung empfängt in der Seele, nannte man die seelische Mutter; drittens das Bewußtsein selbst, worin die Empfindung auflebt, nannte man den Sohn. Dies ist der Zusammenhang von Empfindung, Vorstellung und Gedanke.
In der Seele selbst erlebt der Mystiker den Geist in seiner Innerlichkeit als Geist unmittelbar, in drei Gliedern: erstens den Vatergeist, den unbewegten Beweger des Aristoteles; zweitens die Sehnsucht nach dem unbewegten Beweger, die in der Seele lebte: das Wort oder Logos; drittens das Aufleben in der geistigen Welt: das ist der Geist.
Die Seele kann sich in sich selbst versenken, geistig schauen, durch die Inspiration oder Intuition. Der Mystiker sagt:
Wenn ich herausschaue in die Natur, wirkt die Kraft auf mich, und ich empfinde die Kraft, die auf mich wirkt - die Energetik genannt, das Kraftleben. - Indem die Seele sich in die Außenwelt versenkt, muß sie nach dem Satze des Aristoteles durch die Empfindung beseelt werden. Er sagt:
Wenn ich den unbewegten Beweger sehen will, muß ich frei sein von aller äußeren Empfindung. Dies Versenken in die Seele nennt er die Katharsis, Reinigung. Nach der Katharsis vereinigt sich die Seele mit dem Geiste, wenn sie intuitiv wird, wenn sie mit der Empfindung aus der Außenwelt sich nicht vereinigt.
Die Henosis - Vereinigung - ist die Versenkung in den Geist, die Vereinigung mit dem göttlichen Urgeist. Diese kann nur vor sich gehen, wenn die Seele von der äußeren Empfindung gereinigt ist. Diese gereinigte, von äußerer Empfindung freie Seele nennt der Mystiker die jungfräuliche Seele, die nicht befruchtet ist durch die äußere Empfindung. So wie die Seele sonst von der Außenwelt befruchtet wird durch die Empfindung, so wird sie im Innern befruchtet durch die Idee. Wenn die Seele in sich die Idee erlebt, jungfräulich sich befruchten läßt von dem Geist, dann ist diese Empfängnis für den Mystiker die unbefleckte, jungfräuliche Empfängnis: die Conceptio immaculata. Die Idee wird in der Seele nicht nur den Sohn erzeugen, der wiedergibt die Außenwelt, sondern den Sohn, der der Geist selbst
ist. Das Aufleben des zweiten Prinzips des Geistes, des Wortes oder Logos in der jungfräulichen Seele, nennt der Mystiker das Aufleben des Christus-Prinzips. So kann die Seele durch die Empfindung befruchtet werden und den Christus in sich auferstehen lassen, der in der Außenwelt begraben ist, oder sie kann von der Idee befruchtet werden, und dann gebiert die Seele in sich den geistigen Christus, das Wort oder Logos. Nur der ist im höheren Sinne für den Meister Eckhart ein wirklicher Teilnehmer am Christus-Prinzip, der in sich den Christus, den Logos erlebt. Nichts hilft es, wenn der Mensch sich mit seinem Gott vereinigt weiß, wenn er den Gott als äußere Wirklichkeit ansieht, sondern nur, wenn er in seiner Seele das Christus-Prinzip aufleben läßt. Der Meister Eckhart hat mit seiner Lehre die Herzen immer wieder erglühen lassen dadurch, daß er den Menschen gezeigt hat, daß der Mensch trunken werden kann, wenn er dies in sich erlebt. Die tiefste Geburt des Geistes muß aus der eigenen Seele geboren werden. Die Mystiker haben alle dies verstanden. Eckhart sagt, es kommt nicht auf das gegenwärtig gewordene Bild an, sondern auf das, was dem Menschen immer gegenwärtig ist. Gott und ich sind eins im Erkennen. Gott ist Mensch geworden, damit ich Gott werde. Er spricht ferner davon, wie in jedem einzelnen Menschen der höhere, innere Mensch, der zum Geiste hinaufführt, auflebt. In jedem wohnen zwei Menschen, der weltliche und der geistige Mensch. Der innere, geistige Mensch geht seine Wege für sich.
Der äußere Mensch kann ein Leben für sich führen; aber das innere Leben nimmt seinen eigenen Gang dadurch, daß es sich im Innern durch den Logos befruchten läßt. Immer wieder hielt Eckhart dies durch seine gewaltigen Predigten dem Menschen vor. Das Fünklein in der Seele ist das Wesentliche. Das Fünklein ist ein ewig Eins.
Wenn der Mensch das Aufleben des Fünkleins erlebt, so fühlt er Gott selbst in der Seele. Es gibt bei den Mystikern einen Kunstausdruck: Die Seele hat sich in den Grund gelassen. - Es ist dies eine Anknüpfung an das Bild der Tür mit dem Angel. Wie der Angel, auf dem sich die Tür dreht, unbewegt bleibt, so bleibt auch der innere Mensch unbewegt; im Innern führt er ein eigenes Leben. Das innere Erleben Gottes ist das, was zustande kommt, wenn die Seele sich in ihren Grund läßt. Das Gewahrwerden des göttlichen Lebens in sich selbst nennt der Mystiker die Gelassenheit (Angelus Silesius). Der Mystiker erlebt den Gott in seinem Innern. Dadurch ist Gott wie in einer Wohnung in dem Menschen gegenwärtig. Der Mystiker fühlt sich als Vermittler Gottes und der Welt; er führt die in die Seele gesenkten Befehle der Gottheit aus. Er hat die Vorstellung, daß Gott den Menschen braucht; diese Vorstellung zieht sich wie ein Leitmotiv durch die ganze Mystik des Mittelalters hindurch. Das macht das Weihevolle der Mystik aus.
Eckhart vergleicht die Welt mit einem Bau, und die Menschen mit den Bausteinen. Der Mensch soll als Baustein sich nicht dem Weltenall entziehen. Der Mystiker fühlt sich vereint mit dem urgöttlichen Leben: das ist das Durchleuchtetsein, das man in der Mystik als Selbsterkenntnis des Menschen bezeichnet. Es zeigt, daß, so wie der Mathematiker die Zahlen, der Mensch das Höchste aus sich erzeugen kann. Selbsterkenntnis wird zum unmittelbaren Enthusiasmus, weil die Selbsterkenntnis Hingabe an die Gottheit bedeutet.
Bei Johannes Tauler kommt dieses Stimmungsvolle des Mystikers in seinem ganzen Leben heraus: sein Leben war eine Darlegung des göttlichen Lebens. Er sagt, so lange ich die höchste göttliche Weisheit nur bespreche und darstelle, habe ich nicht das Richtige erreicht. Ich muß selbst ganz
verschwinden und muß Gott aus mir sprechen lassen. Er sagt, Gott sieht seine eigenen Gesetze, durch die er die Welt geschaffen hat, durch mich an, mein Selbst ist das Selbstleben: Ich muß Gott in mir sich erleben lassen.
Die Mystik Eckharts ist eine mystische Erkenntnis; bei Tauler finden wir mystisches Leben. Von der Zeit an findet sich ein besonderer Kunstausdruck des Mystikers: der, der in sich Gott erlebt, wird «Gottesfreund» genannt.
Eine unbekannte Persönlichkeit erschien während der Predigt Taulers; sie wird der «Gottesfreund aus dem Ober-land» genannt. Er begegnet uns nie anders, als daß er gleichsam als Spiegel der anderen Persönlichkeiten erscheint, die von ihm beeinflußt werden. Johannes Tauler stellt in seinem Meisterbuch dar, daß er Gotteserkenntnis den Menschen mitteilte, aber er konnte das Leben noch nicht über-fließen lassen; da kam der Gottesfreund und ließ Johannes Tauler seine Erleuchtung zuteil werden. Der Urquell selbst ging in ihm lebendig auf. Lange Zeit gab er alles Predigen auf und zog sich zurück mit dem Unbekannten aus dem Oberland, um sich in die Geistesverfassung zu bringen, in der dieses Geistesleben aufging, so daß er sich selbst zum Kanale der göttlichen Weisheit machte und diese durch ihn in andere überfloß. Seine Rede gewann an Feuer, er machte den größten Eindruck; die Leute wurden durch seine Worte verwandelt, wodurch die Menschen das Fünklein in sich angefacht fanden. Das Ersterben für alles, was lebt in der Außenwelt, das ist das Aufleben des neuen Menschen: das konnte Johannes Tauler jetzt bewirken durch die Kraft seines Wortes. Goethe sagt: «Denn solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.» Das Erleben der Conceptio immaculata ist das Stirb und Werde, im niederen Sinn und im höheren Sinn. Es erlebten die, welche Tauler zuhörten,
die Unio mystica. Wie der Mensch alle äußeren Schönheiten empfindet, die von außen herankommen, durch die Empfindung, so empfindet der Mystiker die Schönheit der geistigen Welt durch Christus, den er erlebt; es ist ein Erlebnis, das ihn trunken macht: dies ist die wahre Sphären-musik. So wie der Mensch in der Empfindungswelt die sinnliche Harmonie empfindet, so empfindet der Mystiker in der Seele den Zusammenhang der großen Weltgesetze, das Walten, das Schaffen des Logos, des Gottes selbst, die Sphärenmusik. Durch die Menschenseele spricht der ewige Gott in seinem Logos sich aus. Johannes Ruyshroek, der belgische Mystiker, hebt diesen Gedanken in besonders intensiver Weise hervor. Der Mystiker versteht in der Mystik das Aufleuchten des göttlichen Urquells in seiner eigenen Seele. Der Mystiker fühlte in sich, in der Selbsterkenntnis, die Gottheit. Dadurch fand er solch flammende Worte dafür.
DRITTER VORTRAG, 12. November 1904
Wir kommen heute zu einem Höhepunkt der mittelalterlichen Mystik, zu dem Mystiker, welcher zu gleicher Zeit einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit war: Nikolaus Chrypff oder Krebs, von Kues an der Mosel, der Kusaner genannt. Er war eine der interessantesten Persönlichkeiten seiner Zeit. Er lebte von 1401 bis 1464. Er stand auf der Höhe seiner Zeit in den verschiedenen Wissenschaften. Er war Mathematiker, Physiker, Jurist, zuerst Rechtsanwalt. Auch war er einer der führenden, der tonangebenden Männer seiner Zeit. Er war seiner Zeit außerordentlich vorausgeeilt. Etwa hundert Jahre später stellte Nikolaus
Kopernikus die Weltanschauung der Astronomie auf eine neue Basis. Doch hat Nikolaus von Kues schon klar ausgesprochen, daß sich die Erde um die Sonne bewegt. Noch bedeutsamer scheint zu sein, daß der Kusaner nicht nur ein tiefer, führender Denker, sondern ein klarer Denker war. Er ist ein Denker, der die Scholastik ganz in sich aufgenommen hatte. Dasjenige, was durch die Scholastik zum Ausdruck gebracht wird, wird nur sehr wenig studiert. Die ungeheure Klarheit und Schärfe der Begriffsführung ist das Wesentliche daran. Niemals hat es eine so scharfe Führung der Begriffskonturen gegeben, niemals eine so strenge Begrenzung der auf das Geistesleben bezüglichen Begriffe. Wer sich schulen will in klarem Denken, derjenige, welcher arbeitet mit festen, begrifflichen Umrißzeichnungen, müßte sich in irgendeines der scholastischen Werke vertiefen. Cusanus machte diese Schulung durch.
Er besaß auch alles auf die soziale Kenntnis seiner Zeit Bezügliche. Er hatte einen umfassenden Gesichtskreis. 1432, auf dem Basler Konzil, nahm er eine wichtige Stellung ein. Dann machte er weite Reisen durch Deutschland und die Niederlande, die namentlich der Reform des Erziehungswesens gewidmet waren. Er ging hervor aus der Schule der «Brüder des gemeinsamen Lebens». Es wurde dort auf eine gründliche Gemütsbildung und eine klare Verstandesbildung gesehen. Der Kusaner unternahm seine Reise im Dienst dieser Schule. Wissenschaftlich geschult, klar und scharf denkend - frei steht er da, als Persönlichkeit von imponierendem Charakter. Hätte er gewollt, so hätte er noch manches auf wissenschaftlichem Gebiete leisten können. Als Prediger wußte er die Zuhörer in der Tiefe des Gemütes durch seine Predigt zu fassen. Das, was seine Predigt so bedeutend machte, war der Strom, der aus der mittelalterlichen Mystik hervorging, der Strom, den
wir bei Eckhart finden, bei Tauler und Suso, und in einer anderen Gestalt bei Giordano Bruno und Paracelsus.
Tiefe des Gemüts, Feuer der Seele, paarte sich bei ihm mit einem ganz durchsichtigen, scharfen Begriffsvermögen. Alles, was der Verstand begreifen kann, was die Vernunft überschauen kann, das gab dem Kusaner nur den Unterbau für dasjenige, was er der Welt zu sagen hatte. Er wurde von dem Papst nach Konstantinopel geschickt, um dort eine Vereinigung zwischen der griechischen und römischen Kirche zu bewirken. Auf der Heimreise bekam er eine Erleuchtung, bei welcher er fühlte, daß es noch etwas ganz anderes gibt als das Verstandeswissen. Von da an sprach er nur dem den höchsten Wert zu, was höher als das Wissen ist. Das Werk: «De docta ignorantia» schrieb er aus dieser Stimmung heraus. Der Titel: «Von der gelehrten Unwissenheit» sollte bedeuten: etwas, was über das bloße Sinnes- und Verstandeswissen hinausgeht, ein Schauen, ein Erleuchtetsein. Will man dies ganz verstehen, so muß man manche Begriffe zu Hilfe nehmen, die erst das 19. Jahrhundert gebracht hat.
Das 19. Jahrhundert hat eine eigentümliche Sinnesphysiologie herausgebildet, zum Beispiel bei dem berühmten Gesetze der Sinnesenergien des Physiologen Johannes Müller. Er sagt, daß wir eine Farbe sehen, Licht aufnehmen können, das rührt davon her, daß unser Auge in einer bestimmten Weise gebaut ist. Hätten wir nicht das Auge, so würde die in Licht und Farben erglänzende Welt lichtlos sein, ohne die Wahrnehmung von Farben. Dasselbe läßt sich sagen über die Einrichtung unseres Ohres. Es hängt von der Einrichtung unserer Sinne ab, wie die äußere Welt in uns eindringt. Von den spezifischen Energien unserer Sinne hängt es ab, wie wir die Welt wahrnehmen. Helmholtz hat sich darüber ausgesprochen, wie er das Verhältnis
sich denkt. Er sagt: Wie kann ich wissen, wie das Licht an sich, der Ton an sich gestaltet ist? Nur Zeichen der äußeren Welt sind unsere Sinnesempfindungen.
Das «Wissen» nennt der Kusaner auch in diesem Sinne Wissen, nämlich als die durch den Verstand verarbeiteten Eindrücke.
Wir fragen nun: Haben denn unsere Sinne kein intimes Verhältnis zu dem, was wir sehen, hören und so weiter? Wir haben uns vorzustellen, daß das Auge selbst vom Licht gebaut ist, daß die Sinne nicht nur für die Außenwelt da sind, sondern aus der Außenwelt. Das Auge ist durch das Licht gebildet worden. Wer sind denn diejenigen, die bauen an unseren Sinnen? Wäre nicht der Mensch begrenzt in den Grenzen seines gewöhnlichen Bewußtseins, so würde er dies wissen.
Im einzelnen Individuum muß die Kraft sein, welche die Sinne bildet. Im Embryonalleben muß das Licht wirksam sein, muß der Ton wirksam sein. Sie müssen im Embryonalleben im Individuum selbst arbeiten und die Organe bilden. Das Licht schließt das Auge von innen auf, der Ton das Ohr. Die äußeren Qualitäten nehmen wir erst wahr durch die Sinne. Diese äußeren Qualitäten haben die Sinne auch gebildet. Sie sind die Baumeister der eigenen Organe. Wir sind selbst Licht vom Weltenlichte; wir sind Ton vom Weltenton.
Der Mystiker lebt sich ein in das, was um ihn und in ihm lebt und webt. Das schaffende Licht, das draußen wirkt und innen schafft, empfindet er. Er ist selbst leuchtend und tönend in einer leuchtenden und tönenden Welt. Wenn er im schöpferischen Lichte lebt, im schöpferischen Ton lebt, dann hat er mystisches Leben. Dann überkommt den Menschen etwas, was anders ist als das Licht von außen und der Ton von außen. Wer das einmal erfahren hat, der empfindet
es als Wahrheit. Von dem schaffenden Lichte sprechen die Gnostiker, die ägyptischen Mystiker, die Mystiker des Mittelalters. Sie nennen es das Äonenlicht. Es ist ein Licht, welches vom Mystiker aus die Gegenstände um ihn her zu lebendigem Leben erweckt. Das ist das Pleroma der Gnostiker. So fühlt sich der Mystiker in dem Weltenlicht beseligt. Er fühlt sich beseligt verwebt mit diesem Äonenlicht. Da ist er nicht getrennt von der Wesenheit der Dinge; da ist er teilhaftig der unmittelbaren Schöpferkraft. Das ist, was der Mystiker als seine Beseligung in dem schöpferischen Lichte bezeichnet. Die Vedantaweisheit bezeichnet die Welten-weisheit als Chit, aber die Beseligung, wo der Mystiker untertaucht in die Dinge, wo die Seele ganz mit den Dingen verschmilzt, bezeichnet die Vedantalehre als Anânda. Chit ist Weltenweisheit, Anânda die Weisheit, die unmittelbar mit dem Äonenlicht verschmilzt, die eins sich fühlt mit dem die Welt durchleuchtenden All-Licht. Diese Stimmung bezeichnet der Kusaner als «Docta ignorantia».
So wie der Mensch die Erfahrung machen kann, daß er verschmilzt mit dem Äonenlichte zu dem Pleroma, so kann er auch verschmelzen mit dem kosmischen Weltgedanken. Dann fühlt er die Weltgedanken in seinem eigenen Innern auftönen. Wenn der Mensch gewahr wird den Gedanken, der das Gesetz zum Dasein bringt in den Dingen, und dies als eigenes Gesetz in sich aufquillen fühlt, dann tönen die Dinge in ihrem eigenen Wesen in seiner Seele wider, daß er intim mit den Dingen wird, wie der Freund mit dem Freunde intim wird. Dieses Wahrnehmen der ganzen Welt bezeichneten die Pythagoräer als Sphärenharmonie. Das ist das Widerklingen des Wesens der Dinge in der eigenen Seele des Menschen. Da fühlt er sich vereinigt mit der Gotteskraft. Das ist das Hören der Sphärenharmonie, des schaffenden Weitgesetzes; das ist das Verwobensein mit
dem Sein der Dinge, das ist das, wo die Dinge selbst reden, und die Dinge sprechen durch die Sprache seiner Seele aus ihm selbst heraus. Dann hat er erreicht, wovon der Kusaner sagt, daß keine Worte fähig sind, dies auszudrücken.
Das Seiende ist das Gesehene. Das drückt nicht die erhabene Existenz aus, welche als Prädikat den Dingen zukommt, wenn der Mystiker sich in der tiefsten Weise mit den Dingen vereinigt. Diese erhabene Existenz ist das Sat der Inder.
Die pythagoräische Schule unterscheidet drei Stufen:
Erstens die äußere Wahrnehmung = Chit; zweitens das Pleroma = Anânda; drittens die Sphärenharmonie = Sat.
Dies sind die drei Stufen der Erkenntnis bei dem Cusanus: Erstens das Wissen; zweitens das Überwissen oder die Beseligung; drittens die Vergottung. So nennt er sie in der «Docta ignorantia».
Daß er diese Zustände kennt, gibt seinen Schriften einen Schmelz, eine Weichheit, daß man sagen kann, sie sind völlig süß vor Reife. Außerdem sind seine Schriften wunderbar klar, durchsichtig, voll gewaltiger Ideen.
Er war ein führender Geist. Alle, die ihm folgen, stehen dann auf der Grundlage, die er geschaffen hat. So auch Giordano Bruno. Cusanus hat seine Weisheit aus der pythagoräischen Schule geschöpft. Er hat verstanden, was mit dem Pleroma, dem Äonenlicht und der Sphärenharmonie gemeint war. - Auch Ruysbroek und Suso sind in ihrer feinen und geistestrunkenen Art die Vorläufer des Cusanus.
Wie eine Ouvertüre nimmt sich zu dem, was der Kusaner geschrieben hat, die «Theologia deutsch» aus. Ein Neudruck derselben ist nach einer Handschrift von 1497 durch Franz Pfeiffer besorgt worden. Tiefe, gemütvolle Töne von einer historisch unbekannt gebliebenen Persönlichkeit sind in dieser Schrift enthalten. Will jemand das Sat der Vedantaphilosophie
verstehen, so muß er, wie er bei Anânda sich ausgießen muß in die Welt, bei Sat seinen Willen ganz aus-gießen. Bei der Vergottung (Sat) muß das selbstlose Wollen da sein; sein Wille muß unpersönlich geworden sein. - Der die «Theologia deutsch» geschrieben hat, hat dafür gesorgt, daß sein Name nicht auf die Nachwelt kam. Er nennt sich nur «der Frankfurter». Der Mensch muß sein Wollen hingeben an das Göttliche, als Bote der Gottheit, und dasjenige, was der Mensch von sich aus will, nennt er die Schrift, ein Entgegenbringen.
Vor Cusanus strebte die Mystik aus dem bloßen Wissen in das Einführen in das Pleroma, das schaffende Welten-licht. In dem gelehrten Nichtwissen kam das dann auf eine gelehrte und scharfsinnige Weise heraus. Wissen und Verstand wurden zu unmittelbarem, neuem Leben erweckt.
Das Nichtwissen des Kusaners ist zugleich ein Überwissen. Er unterscheidet drei Stufen: Wissen, Beseligung, Vergottung - Chit, Anânda, Sat. Er ist zugleich der größte Gelehrte und einer der tiefsten Menschen.
SCHILLER UND UNSER ZEITALTER
VORWORT VON RUDOLF STEINER ZUR 1. AUFLAGE 1905
Einige Worte an den Leser
Das folgende ist eine Wiedergabe der Vorträge, die ich in den Monaten Januar bis März an der Berliner «Freien Hochschule» über Schiller gehalten habe. Der Abdruck ist erfolgt lediglich nach Notizen, die sich zwei Zuhörer während der Vorträge gemacht haben. Ich selbst war gar nicht in der Lage, die Aufzeichnungen durchzusehen. Nur einem dringenden Wunsche entspreche ich, wenn ich meine Einwilligung zur Drucklegung gebe. Eigentlich bin ich nicht der Ansicht, daß Vorträge gedruckt werden sollen. Was gesprochen wird, ist auf das Gehört-werden und nicht auf das Gelesen-werden zu stilisieren. Gesprochene Abhandlungen oder Bücher sind ein Unding. Und ebenso Bücher, die aus nachgeschriebenen Vorträgen entspringen. Wer Stilgefühl hat, wird mir recht geben. Ausnahmen von diesem Gesetze mögen in einzelnen Fällen gemacht werden. Eine solche Ausnahme liegt hier vor. Sie scheint mir die Regel zu bestätigen.
Berlin, April 1905 Dr. Rudolf Steiner
ERSTER VORTRAG, 21. Januar 1905
Schillers Leben und Eigenart
Hundert Jahre sind am 9. Mai 1905 seit Schillers Tode dahingegangen. Die deutsche gebildete Welt wird ohne Zweifel die Erinnerung an dieses Ereignis in festlicher Weise begehen.
Drei Generationen trennen uns von Schillers Tode. Da erscheint es notwendig, Umschau zu halten, was uns heute Schiller ist. Im Jahre 1859 fand die letzte große Schillerfeier statt in ganz anderer Weise, als es heute sein kann. Die Zeiten haben sich seitdem unermeßlich geändert: andere Bilder, Fragen, Gedanken sind es, die heute die Gemüter der Zeitgenossen beschäftigen. Als im Jahre 1859 die Schillerfeier stattfand, war sie etwas, was tief eingriff in die Herzen des deutschen Volkes. Damals gab es noch Persönlichkeiten, die selbst ganz in den Vorstellungen lebten, die durch Schillers dichterische Kraft hervorgebracht waren. Es ist möglich, daß diesmal rauschendere Festlichkeiten veranstaltet werden; eine solche Anteilnahme aus der Tiefe der Seele kann es nicht mehr geben. Die Frage drängt sich uns auf: Was ist seitdem vorgegangen und wie kann Schiller uns noch etwas sein? Der Schiller-Goethe-Zeit große Bilder sind dahingeschwunden. Damals waren jene Anschauungen noch verkörpert in Persönlichkeiten, die die älteren von uns in ihrer Jugendzeit kennengelernt haben. Diese führenden Geister, die ganz in den Traditionen jener Zeit wurzelten, sie gehören heute zu den Toten. Die Jüngsten kennen sie nicht mehr. In der Person meines Lehrers Schröer, der in begeisterter Weise uns die Goethezeit darstellte,
war es mir vergönnt gewesen, einen Menschen kennenzulernen, der ganz wurzelte in den Traditionen jener Zeit. In Herman Grimm ist der letzte gestorben von denen, deren Seelen ganz verbunden waren mit jener Zeit.
Heute ist das alles Geschichte geworden. Andere Fragen beschäftigen uns heute. Politische Fragen, soziale Fragen sind so brennend geworden, daß wir jene intime Kunstbetrachtung nicht mehr verstehen. Sonderbar müßten uns die Schiller-Goethe-Zeitmenschen erscheinen. Verlorengegangen ist uns die intime seelenvolle Betrachtung der Kunst. Das soll kein Tadel sein; hart ist unsere Zeit geworden.
Sehen wir uns drei führende Geister der Gegenwart an:
wie anders sprechen sie über das, was die Zeit bewegt. Zunächst Ibsen: Wir sehen ihn, wie er in umfassender Art die Kulturprobleme der Gegenwart schildert, er, der die eindringlichsten Töne gefunden hat, gerade für das Herz der Gegenwart, für eine ins Chaotische gehende Zivilisation. Dann Zola: Wie soll sich die heutige Kunst zum Leben verhalten, das in sozialen Kämpfen emporlodert -, das ist die Frage, die er aufwirft. Dieses Leben erscheint uns so fest, so undurchdringlich, von ganz anderen Mächten bestimmt, als es unsere Phantasie und Seele sind. Endlich Tolstoi: Er, der ausgegangen ist von der Kunst und hieraus erst geworden ist zum Prediger und Sozialreformator. Unmöglich erscheint heute eine rein ästhetische Kultur, wie Schröer für die Schiller-Goethe-Zeit sie uns charakterisierte. Dazumal war das, was wir das ästhetische Gewissen nennen können, zur maßgebenden Lebensfrage geworden. Man nahm Schönheit, Geschmack, künstlerisches Empfinden für so ernste und wichtige Fragen, wie heute die Politik und die Freiheit. Man betrachtete die Kunst als etwas, das eingreifen sollte in das Räderwerk der Kultur. Heute ist das anders: Tolstoi, der auf dem Gebiete der Kunst selbst ein
höchstes geleistet hat, verläßt die Kunst und sucht nach anderen Mitteln, um zu dem Empfinden seiner Zeitgenossen zu sprechen.
Schiller ist daher für unsere Zeit nicht zu würdigen in der Weise, wie es im 18. Jahrhundert geschah. Was aber geblieben ist, das ist die eindringlichste Tiefe seiner Weltanschauung. Wir sehen zahlreiche Fragen in ganz neue Beleuchtung gerückt durch Schillers Weltbetrachtung. Versuchen wir sie von diesem Standpunkt aus zu betrachten. Es soll dies die Aufgabe dieser Vorträge sein.
Bei der Behandlung der Tages- und Kulturfragen, in der Wissenschaft wie im künstlerischen Streben, herrscht heute vielfach Verwirrung und Unklarheit. Jeder junge Schriftsteller glaubt sich berufen, eine neue Weltanschauung zu begründen. Die Literatur wird erfüllt mit Büchern über Fragen, die längst gelöst sind. Probleme werden aufgerollt, die sich, so wie sie uns entgegentreten, unreif ausnehmen, weil diejenigen, die sie zu lösen versuchen, sich nicht wirklich mit den Fragen beschäftigt haben. Oft werden die Fragen überhaupt nicht richtig gestellt. Das Problem liegt in der Fragestellung.
Aus zwei Strömungen sehen wir die Persönlichkeit Schillers hervorwachsen. Es ist dies einerseits das Emporkommen des Materialismus, und andererseits die Sehnsucht nach der Behauptung der Persönlichkeit. Was wir Aufklärung nennen, wurzelt in diesen beiden Strömungen. Uralte Traditionen waren im 18. Jahrhundert ins Wanken gekommen. Im 16. und 17. Jahrhundert noch wurden die tiefsten Fragen des Menschengeistes aus der Tradition heraus gelöst. An dem Verhältnis des Menschen zur Welt, zum Urgrunde der Welt wurde nicht gerüttelt.
Jetzt wurde es anders. Über das menschliche Geistesleben die Grundwahrheiten in dem Sinne zu lösen, wie sie Jahrhunderte
gelöst, war unmöglich geworden. In Frankreich, angeregt durch den englischen Sensualismus, kam eine rationalistisch, materialistische Anschauung auf. Man begann die Seele abzuleiten aus materiellen Bedingungen, aus dem Stofflichen; man versuchte alles Geistige aus dem Physischen zu erklären. Die Enzyklopädisten ließen den Geist aus der Materie hervorgehen. Wirbel von Atombewegungen waren das Um und Auf, das man in der Welt sah. «Der Mensch ist eine Maschine», so ungefähr formuliert Lamettrie sein materialistisches Glaubensbekenntnis. Schon Goethe klagt, als ihm die Schriften dieser französischen Materialisten - Holbachs «Systéme de la nature» - bekannt werden, sein Unbehagen über die Anmaßung, mit ein paar hingepfahlten Begriffen die ganze Welt erklären zu wollen.
Daneben gab es eine andere Strömung, diejenige, die von Rousseau ausging. Rousseaus Schriften machten den größten Eindruck auf die bedeutendsten Männer jener Zeit. Es wird von Kant erzählt, daß er, der ein großer Pedant war, mit einer solchen Pünktlichkeit seinen täglichen Spaziergang unternahm, daß die Bewohner Königsbergs ihre Uhren darnach stellen konnten. Einmal aber blieb, zum größten Erstaunen der Bürger, der Philosoph für einige Tage aus; er hatte Rousseaus Schriften gelesen. Sie hatten ihn so gefesselt, daß er den gewohnten Spaziergang darüber vergaß.
Die Grundlage der gesamten Kultur war in Zweifel gestellt durch Rousseau. Er hatte die Frage aufgeworfen, ob die Menschheit durch die Kultur höher gekommen sei, und er verneinte diese Frage. Seiner Ansicht nach waren die Menschen in dem Naturzustande glücklicher gewesen als jetzt, wo sie die Persönlichkeit in sich verkommen ließen. In den Zeiten, als der Mensch, in alten Traditionen fußend, noch etwas zu wissen glaubte von den Zusammenhängen
der Welt, war er nicht so sehr auf die Persönlichkeit gestellt. Jetzt, wo die Persönlichkeit zerschnitten hatte die Verbindungsketten zwischen sich und der Welt, kam die Frage heran: Wie soll diese Persönlichkeit wieder feststehen in der Welt? Über den Urgrund der Welt und der Seele glaubte man nichts wissen zu können. Wenn aber so nichts fest stand in der Welt, mußte der Drang nach besseren Zuständen mächtig in allen Herzen werden. Das revolutionäre Streben des 18. Jahrhunderts ging von hier aus. Es hing zusammen mit der materialistischen Strömung. Ein guter Christ des 17. Jahrhunderts hätte nicht so von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sprechen können. Dieses Freiheitsstreben muß als ureigenste Strömung jener Zeit gelten.
Schiller war jung in der Zeit, als die Gedanken der Freiheit reiften. Rousseaus Ideale übten, wie gesagt, einen gewaltigen Eindruck auf die hervorragendsten deutschen Männer aus, wie Kant, Herder, Wieland und so weiter. Auch der junge Schiller wurde ergriffen von dieser Strömung. Wir finden ihn schon auf der Karlsschule damit beschäftigt, Rousseau, Voltaire und andere zu lesen. Es war die Zeit damals auf einen toten Punkt gekommen; die höheren Schichten hatten allen moralischen Halt verloren; die äußere Tyrannis herrschte auch auf der Schule. Bei Schiller finden wir eine eigentumliche Tiefe der Gemütsanlage, die schon im Knaben als Neigung zur Religion hervortrat. Ursprünglich beabsichtigte er daher auch, das theologische Studium zu wählen, sein ganzes Gemüt drängte ihn zu den tiefsten Fragen des Daseins. Es war eine Form jenes Freiheitsstrebens, das gerade in Deutschland diese besondere Gestaltung annahm: Frömmigkeit vereinigte sich mit unendlicher Sehnsucht nach Emanzipation. Der Persönlichkeits.Freiheitsdrang, nicht nur Religion, ist es auch,
was aus Klopstocks «Messias» spricht. Gerade in seinem religiösen Empfinden wollte der Deutsche frei sein. Der «Messias» machte auf Schiller einen ungeheuren Eindruck.
Schiller wählte das Studium der Medizin. Die Art, wie er die Medizin ergriff, hängt zusammen mit den Fragen, die ihn vor allem beschäftigten. Durch ernstes Naturstudium suchte er sich Aufschluß zu verschaffen über diese ihm vorliegenden Fragen. Der Unterricht in der Karlsschule sollte in ganz umfassender Weise auf ihn einwirken. Die Schäden, die dem heutigen Gymnasialunterricht vielfach anhaften, bestanden in der Karlsschule nicht. Physik, Naturwissenschaften wurden eingehend behandelt; im Mittelpunkte des Studiums stand die Philosophie. Ernste Fragen der Metaphysik, der Logik wurden erörtert. Schiller trat mit philosophischem Geist in das medizinische Studium ein. Die Art und Weise, wie er es erfaßte, ist wichtig und bedeutungsvoll für sein Leben. Man versteht Schiller nicht ganz, wenn man nicht seine beiden Dissertationen liest, die er nach Absolvierung seines Studiums schrieb. Sie behandeln die Fragen: «Welches ist der Zusammenhang zwischen Materie und Geist?» - «Über den Zusammenhang der tierischen und geistigen Natur des Menschen.»
Von der ersteren Dissertation ist uns wenig nur erhalten geblieben. In der zweiten stellt sich Schiller die Frage: Wie haben wir uns das Wirken des Stofflichen im menschlichen Körper zu deuten?
Für Schiller ist schon im materiellen Körper etwas Geistiges. Es gibt Menschen, die im Körper nur etwas Niedriges, Tierisches sehen. Es ist keine tiefe, gehaltvolle Weltanschauung, wenn man das Körperliche so erniedrigt und verabscheut. Es war nicht die Weltanschauung des jungen Schiller. Für Schiller ist der Körper der Tempel des Geistes, von Weisheit auferbaut, und hat nicht umsonst Einfluß auf
das Geistige. Welche Bedeutung hat der Körper für das Seelische? - Diese Frage hat Schiller, dem das Physische auch heilig war, sich zu lösen gesucht. Er schildert zum Beispiel, wie im Affekt, in der Geste, sich das Seelische ausdrückt; er sucht sich das Bleibende der seelischen Bewegung im Ausdruck in feiner geistvoller Weise zu erklären. Er sagt am Schlusse seiner Abhandlung:
«Die Materie zerfällt (beim Tode) in ihre letzten Elemente wieder, die nun in anderen Formen und Verhältnissen, durch die Reiche der Natur wandern, anderen Absichten zu dienen. Die Seele fährt fort, in anderen Kreisen ihre Denkkraft zu üben und das Universum von anderen Seiten zu beschauen. Man kann freilich sagen, daß sie diese Sphäre im geringsten noch nicht erschöpft hat, daß sie solche vollkommener hätte verlassen können, aber weiß man denn, daß diese Sphäre für sie verloren ist? Wir legen jetzt manches Buch weg, das wir nicht verstehen, aber vielleicht verstehen wir es in einigen Jahren besser.»
So versucht sich Schiller das Ewige des Geistes im Verhältnis zur physischen Natur klarzulegen, ohne aber das Physische zu unterschätzen. Diese Frage blieb nun die Grund- und Kernfrage Schillers für das ganze Leben: «Wie ist der Mensch herausgeboren aus dem Physischen, und wie stellt sich seine Seele, die Freiheit seiner Persönlichkeit, zur Welt?» «Wie soll die Seele ihren Mittelpunkt finden, da die alten Traditionen dahin sind?»
Nachdem er in seinen Jugenddramen herausgebraust hat seinen ganzen Emanzipationsdrang, und damit das Herz des Volkes gewonnen hatte, vertiefte er sich in Geschichte und Philosophie, und wir berühren die tiefsten kulturgeschichtlichen Fragen, wenn wir die Schillerschen Dramen betrachten. Jeder Mensch hatte damals ein Stück Marquis Posa in sich. Dadurch gewann Schillers Problem ein neues
Gesicht. Tiefe Fragen werden aufgerollt über die Menschenseele, über die Bedeutung des Lebens. Schiller sah, wie wenig auf dem äußeren Plane sich hatte erreichen lassen. Man versuchte nun in Deutschland das Problem der Freiheit auf künstlerische Art zu lösen, und das ergab die Bedeutung des «ästhetischen Gewissens». Auch Schiller hatte sich die Frage jetzt in diesem Sinne gestellt. Es war ihm klar, daß der Künstler den Menschen das Höchste zu bringen habe. Er hat dieses Problem in späteren Jahren behandelt. In seinen «Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen» sagt er: Der Mensch handelt unfrei in der Sinnenwelt aus Notwendigkeit; in der Vernunftwelt ist er unterworfen der Notwendigkeit der Logik. So ist der Mensch eingeschränkt von der Wirklichkeit und dem Vernunftideale. Es gibt aber einen anderen, mittleren Zustand zwischen Vernunft und Sinnenwelt, den ästhetischen. Derjenige, der künstlerisch empfindet, genießt den Geist im Sinnlichen; er sieht den Geist in die Natur hineinverwoben. Die Natur ist ihm ein schönheitsvolles Bild des Geistigen. Das Sinnliche ist dann nur der Abdruck des Geistes; im Kunstwerk ist das Sinnliche durch den Geist geadelt. Der Geist ist herabgeholt aus dem Reiche der Notwendigkeit. In der Schönheit lebt der Mensch als in der Freiheit. Die Kunst ist also die Vermittlerin zwischen dem Sinnlichen und dem Vernünftigen im Reiche der Freiheit.
Auch Goethe empfand so vor den Kunstwerken in Italien. Im Schönen fand der Freiheitsdrang dieser Menschen seine Befriedigung; hier ist er der ehernen Notwendigkeit enthoben. Nicht durch Zwang, durch staatliche Gesetze:
im ästhetischen Genusse sah Schiller eine Erziehung zur Harmonie. Als Mensch fühlt er sich frei durch die Kunst: so möchte Schiller die ganze Welt in ein Kunstwerk umwandeln.
Wir sehen hier den Unterschied jener Zeit von der unseren. Heute steht die Kunst im Winkel; damals wollte Schiller dem Leben durch die Kunst einen unmittelbaren Eindruck geben. Tolstoi muß heute die Kunst verdammen, Ibsen wird in seiner Kunst zum Kritiker des gesellschaftlichen Lebens: Damals wollte Schiller durch seine Kunst eingreifen in das Leben selbst. Als er, während seiner Tätigkeit als Mannheimer Theaterreferent, seine Abhandlung über die «Schaubühne als moralische Anstalt» schrieb, geschah es, um durch die Kunst unmittelbar einen Kulturimpuls zu geben.
ZWEITER VORTRAG, 28. Januar 1905
Schillers Schaffen und seine Wandlungen
Wir haben gesehen, wie Schiller herausgewachsen ist aus den Ideen des 18. Jahrhunderts, wie die Ideale des Aufklärungszeitalters in seiner Seele wurzelten. Ihre besondere Gestalt hatten sie schon angenommen, als er von der Karls-schule abging und jene vorher erwähnten Abhandlungen geschrieben hatte. Wenn wir diese Anschauungen mit einem Worte charakterisieren wollen, können wir sagen, es handelte sich um die Emanzipation der Persönlichkeit. Dieses Freimachen von uralten Traditionen geht noch weiter.
Wenn der mittelalterliche Mensch vor der Aufklärungs. zeit nachgedacht hatte über sein Verhältnis zu sich, zur Natur, zum Universum, zu Gott, hat er sich hineingestellt gefunden in dieses Universum. Er verehrte denselben Gott draußen, der in der eigenen Seele lebte; dieselben Weltenmächte,
die er in der Natur fand, waren in der eigenen Seele des Menschen tätig; es war eine gewisse Einheit, die man sah in den Gesetzen des Weltalls und in der Natur des Menschen. Man braucht sich nur an Geister wie Giordano Bruno zu erinnern. Diese monistische Überzeugung von dem Zusammenhang der Natur mit dem Menschen spricht aus seinen Schriften. So war keine Trennung zwischen dem, was man moralische Forderung nennt, und den objektiven Gesetzen in der Natur.
Dieser Gegensatz ist erst später gekommen, als man die Natur von dem göttlichen Einfluß ausschloß. Das, was im Materialismus heraufgekommen ist, kannte keinen Zusammenhang zwischen der Natur und dem moralischen Empfinden, dem, was der Mensch als moralische Forderung in sich ausbildet. Aus diesem ging hervor, was man den Rousseauismus nannte. Er ist im tiefsten Grunde eine revolutionäre Empfindung, ein Protest gegen die ganze bisherige Entwickelung. Er lehrt, daß, wenn wir den Ruf des Menschen nach Freiheit, seine Forderung nach Moral betrachten, wir einen tiefen Mißklang finden. Er fragt: kann es denn einen Unterschied geben zwischen der objektiven Welt und der menschlichen Natur, daß die Menschen sich heraussehnen müssen, aus der ganzen Kultur heraus?
Diese geistigen Stürme lebten sich aus als Gesinnung des jungen Schiller. In seinen drei Jugenddramen erhält dieses Sehnen eine neue Gestaltung. In den «Räubern», in «Fiesco» und in «Kabale und Liebe» sehen wir ganz lebendig dargestellt, mit ungeheurem Pathos die Forderung, daß der Mensch etwas tun müsse, um diesen Einklang hervorzurufen. In der Figur des Karl Moor wird herausgearbeitet ein Mensch, der in sich selbst den Zwiespalt zwischen der objektiven Ordnung und den menschlichen Forderungen trägt, und der sich berufen fühlt, zwischen der Natur und
sich diesen Einklang hervorzurufen. Seine Tragik entsteht, weil er glaubt, durch Gesetzlosigkeit und Willkür dem Gesetz wieder aufzuhelfen. - In «Fiesco» scheitert das Sehnen nach Freiheit an dem Ehrgeiz. Das Ideal der Freiheit geht unter durch diese Disharmonie in der Seele des ehrgeizigen Fiesco, der sich nicht hineinfinden kann in die Ordnung des moralischen Ideals. - In «Kabale und Liebe» steht die Forderung der menschlichen Natur im aufstrebenden Bürgerstande den Forderungen der Welt gegenüber, wie sie in den herrschenden Ständen zum Ausdruck kamen. - Es war verlorengegangen der Zusammenhang zwischen den moralischen Idealen und den universellen Weltenideen. Dieser Mißklang tönt grandios bei aller jugendlichen Unreife aus Schillers ersten Dramen.
Solche Naturen wie Schiller finden sich schwerer selbst als gradlinige, einfache, naive Naturen, wie auch die natürliche Entwickelung zeigt, daß niedere Geschöpfe weniger lange Vorbereitungsstadien brauchen als hochentwickelte Tiere. Große Naturen haben das an sich, daß sie die verschiedensten Wandlungen durchmachen müssen, weil ihr Innerstes aus tiefen Schachten herausgeholt werden muß. In wem viel liegt, wer mit Anwartschaft auf Genie zur Welt kommt, wird schwer sich durchfinden, sich durch mannigfaltige Anfangsstadien durcharbeiten müssen, wie es uns als Analogie die embryonale Entwickelung höherstehender Tierarten zeigt.
Was Schiller fehlte, war Welt- und Menschenkenntnis. Die ersten Dramen zeigen Schiller mit all seinen daraus entstehenden Mängeln, aber auch mit all seinen Vorzügen, wie sie sich später kaum so wiederfinden. - Dieses Urteil ist projiziert aus einer gewissen Höhe: man muß wissen, was man Schillers Größe schuldig ist. - Doch es konnte nicht lange so bleiben. Schiller mußte über diesen kleinen
Horizont hinauskommen, und nun sehen wir, wie er im vierten seiner Dramen, im «Don Carlos» sich hinarbeitet zu einem anderen Standpunkt. Wir können aus einer doppelten Perspektive «Don Carlos» betrachten: erstens von Carlos, zweitens von Marquis Posa aus. Schiller selbst erzählt uns, wie erst sein Interesse bei dem jugendlich-feurigen Carlos gestanden hat und dann übergegangen ist zum kosmopolitischen Posa. Es bedeutet dies eine tiefe Wandlung in Schillers eigener Persönlichkeit.
Schiller war von seinem Freunde Körner nach Dresden gerufen worden, um dort ruhig zu arbeiten. Er wurde da bekannt mit einer Weltanschauung, die auf seine eigene Persönlichkeit einen tiefen Einfluß ausüben sollte, mit dem Kantianismus. Schillers Wesenheit war so, daß ihm diese Beschäftigung mit Kant notwendig wurde und wir werden dadurch seinen Standpunkt noch tiefer verstehen lernen, wenn wir uns mit dem beschäftigen, was damals auf ihn einwirkte.
Wir haben zu jener Zeit zwei ganz bestimmte Strömungen im deutschen Geistesleben. Die eine Strömung ist diejenige, die sich am gründlichsten ausdrückt in Herders «Ideen zur Geschichte der Philosophie der Menschheit». Die zweite ist die Kantsche Philosophie. Bei Herder haben wir die Sehnsucht, den Menschen hereinzustellen in die ganze Natur, und ihn von da heraus zu begreifen. Es ist dieses Einheitsstreben, was uns Herder als modernen Geist erscheinen läßt. Was sich heute aufbäumt gegen den zwar als Kathederphilosophie noch viel geltenden Kantianismus mit seinem Dualismus, lebt schon bei Herder in seiner Metakritik. Alles schließt eine Fülle von großen Ideen ein; da ist ein Streben nach Einheitlichkeit zwischen Natur und Mensch. Vom untersten Naturprodukt, bis herauf zu dem Gedanken des Menschen, lebt ein Gesetz. Was im Menschen als
Sittengesetz sich darstellt, ist im Kristall sich selbst Gesetz der Gestaltung. Eine Grundentwickelung zieht sich durch alles Bestehende hindurch, so daß, was an der Pflanze sich zur Blüte gestaltet, in dem Menschen sich zur Humanität entwickelt. Es ist das Weltbild, das auch bei Goethe herausgetreten ist, das er in seinem Faust ausgedrückt hat in den Worten:
Wie alles sich zum ganzen webt!
Eins in dem andern wirkt und lebt...
und das er in seinem «Hymnus an die Natur» darstellt.
Goethe ist ganz durchglüht von diesem Einheitsstreben, wie es sich in Giordano Bruno, dem Pythagoräer, ausdrückt. Er stellt sich vollkommen in diese Strömung hinein:
Was wär' ein Gott, der nur von außen stieße,
Im Kreis das All am Finger laufen ließe,
Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen.
So daß, was in Ihm lebt und webt und ist,
Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.
Das ist die monistische Strömung, der Schiller in jener Zeit noch fremd gegenübersteht. Für ihn ist noch die Zweiheit da, der Dualismus.
Kant hat in seiner «Kritik der reinen Vernunft» und in seiner «Kritik der praktischen Vernunft» dem menschlichen Erkenntnisvermögen eine entschiedene Grenze gesetzt. So weit der Verstand reicht, geht menschliches Erkenntnisvermögen. Es kann nur äußeres geben, reicht aber nicht zu dem Wesen der Dinge. Was das Ding an sich ist, verbirgt sich hinter den Erscheinungen; der Mensch darf gar nicht darüber sprechen. Aber es lebt etwas im Menschen,
was unmöglich nur Erscheinung sein kann. Das ist das Sittengesetz. Auf der einen Seite: die Welt der Erscheinungen; auf der anderen Seite: das Sittengesetz, der kategorische Imperativ, das «Du sollst», an dem nicht zu mäkeln ist, das erhaben ist über Erkenntnis und nicht als Erscheinung aufzufassen. So tritt uns in Kants Philosophie nicht nur die Zweiheit, die wir früher sahen, entgegen, sondern die ganze Welt menschlichen Geisteslebens trennt sich in zwei Hälften: das, was erhaben sein soll über alle Kritik, das Sittengesetz, soll überhaupt nicht Wissen sein, sondern praktischer Glaube, der keine Erkenntnisgesetze hat, sondern lediglich sittliche Postulate. So erscheint der Kantianismus als die schroffste Darlegung des Dualismus.
Vor Kant gab es eine Wissenschaft über die äußeren Erscheinungen, dann eine Vernunftwissenschaft, die durch eingepflanzte Tätigkeit bis zu Gott, Seele und Unsterblichkeit dringen konnte: so stellt sich die Wolffsche Philosophie dar. Kant, der die englischen Sensualisten Hume und Locke studierte, kam dadurch zum Zweifel in diesem Punkt. Er sagte sich: Wohin will man kommen, wenn man die höchsten Begriffe, Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, immer wieder prüfen muß auf ihre Vernünftigkeit hin? - Er erklärt in der Einleitung zu seiner «Kritik der reinen Vernunft»: Ich mußte also das Wissen aufheben um zum Glauben Platz zu bekommen. Weil man glauben soll und damit man glauben kann, hat er das Wissen vom Throne gestürzt. Er wollte von zweifellosen Grundlagen ausgehen und sagt daher: das Wissen kann überhaupt nicht bis zu diesen Dingen vordringen, aber das «Du sollst» spricht so streng, daß der Einklang, den der Mensch zu finden ohnmächtig ist, durch Gott muß bewirkt werden. Das führt dazu, einen Gott zu postulieren. Wir sind als physische Wesen zwischen Schranken eingeschlossen, müssen aber als moralische
Wesen frei sein. Dies gibt einen unüberbrückbaren Dualismus, aber keinen Ausgleich zwischen Mensch und Natur.
Schiller, der seiner Anlage nach damals an dem Gegensatz zwischen Natur und Menschen festhielt, schildert im «Don Carlos» das Herauswachsen des Menschen über alle Natur zu den Idealen hinauf. Er stellt nicht die Frage nach dem, was möglich ist, sondern nur die Frage nach dem: «Du sollst». Im Carlos ist es nicht eine Kritik des Hoflebens, die uns Schiller gibt. Diese tritt zurück hinter praktisch sittlichen Postulaten. «Mensch werde so, daß die Gesetze deines Handelns allgemeine Gesetze der Menschheit werden könnten», hatte Kant gefordert, - und in dem Marquis Posa, dem kosmopolitischen Idealisten, stellt Schiller die Forderung nach der Unabhängigkeit des Ideals von allem, was aus der Natur herauswächst.
Als «Don Carlos» fertig war, stand Schiller in größtmöglichstem Gegensatz zu der Weltanschauung Goethes und Herders, und im Anfang seines Lebens in Weimar konnte sich deshalb keine Annäherung an diese vollziehen. Nun ist aber Schiller zum Reformator des Kantianismus geworden: er strebt jetzt zum Monismus, findet aber die Einheitlichkeit nur auf ästhetischem Gebiete: im Problem der Schönheit. Er zeigt uns, wie der Mensch sich erst da auslebt, wo er die Natur heraufadelt zu sich und das Sittliche von oben in seine Natur aufnimmt. Der kategorische Imperativ zwingt ihn nicht unter ein Joch, sondern freiwillig dient er dem, was im «Du sollst» enthalten ist. So stellt sich Schiller auf seine Höhe, indem er über Kant hinauswächst. Er wendet sich gegen Kant, der den Menschen nicht zum freien Wesen, sondern zum Sklaven machen will, gebeugt unter das Joch der Pflicht. Es wurde ihm klar, daß im Menschen etwas ganz anderes lebt, als dieses Beugen unter ein «Du
sollst». In monumentalen Sätzen kommt zum Ausdruck, wie er sich dem nähert, was Goethes und Herders Anschauung ausmacht: «Gerne dien' ich den Freunden, doch tu' ich es leider mit Neigung, und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.»
Kant hat das herabgewürdigt, was der Mensch aus Neigung, was er freiwillig tut, und dagegen was er aus Pflicht tut, als das Höhere gepriesen. Kant wendet sich in pathetischer Apostrophe an die strenge Pflicht, die nichts Verlokkendes haben soll. Schiller holt den Menschen aus seiner Schwäche heraus, indem er das Sittengesetz zum Gesetze seiner eigenen Natur werden läßt. Durch das Studium der Geschichte, durch aufrichtige Neigung und Hingabe an das menschliche Leben, kam er zu dem verlorenen Einklang und damit zu dem Verständnis Goethes.
Herrlich beschreibt Schiller Goethes Weise in dem denkwürdigen Brief vom 23. August 1794: «Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen, und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das einzelne Licht zu bekommen; in der Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf.»
Damit war Schiller auf der Höhe angekommen, zu der er sich entwickeln mußte. War er selbst ausgegangen von der Zweiheit, so war er jetzt gekommen zu der Einheit zwischen Mensch und Natur. So kam er zu der Art des Schaffens, die ihm in der letzten Zeit, seit der Mitte der neunziger Jahre eigen war, und zur Freundschaft mit Goethe. Es war eine geschichtliche Freundschaft, weil sie
nicht nur nach Glück für die beiden allein suchte, sondern fruchtbringend war für die Welt, für die Menschheit. In dem, was wir an Goethe und Schiller haben, haben wir nicht nur Goethe und Schiller, sondern wir haben noch ein Drittes: Goethe plus Schiller. - Wer den Gang des Geisteslebens verfolgt, sieht darin ein Wesen, das nur dadurch entstehen konnte, daß in der selbstlosen Freundschaft, aus der gegenseitigen Hingabe, sich etwas entfaltete, was als neues Wesen über der Einzelpersönlichkeit stand. Diese Stimmung wird uns den rechten Übergang zu Goethe und dem, was er für Schiller bedeuten sollte, ergeben.
DRITTER VORTRAG, 4. Februar 1905
Schiller und Goethe
Wir kommen heute zu einem der wichtigsten Kapitel der deutschen Geistesgeschichte, zu dem Verhältnis zwischen Goethe und Schiller. Das Verhalten der beiden ist einzigartig in der Welt. Von verschiedenen Seiten her waren sie gekommen. Von Herder und allem, was anknüpfte an die Einheitlichkeit des Geistes und der Natur, kam Goethe, von der Kantischen Philosophie, vom Dualismus, kam Schiller. Außerdem waren Goethes und Schillers Naturen grundverschieden. Nehmen wir Goethes «Faust», wie er sucht in die Natur einzudringen, wie er sich unbefriedigt fühlt, etwas Geistiges in Abstraktionen zu begreifen und sich bemüht, es unmittelbar aus der Natur zu schöpfen. Für Schiller war zunächst die Natur etwas Niedriges, das Ideal war ihm etwas besonderes, was dem Geiste entsprungen war, im Widerspruch mit dem Realen. Beide waren
außerordentlich tiefe Naturen, die sich deshalb nur schwer finden konnten. So sehen wir, daß sich diese beiden großen Genien in der ersten Zeit ihres persönlichen Begegnens durchaus nicht verstehen können.
Als Schiller nach Weimar kam, fühlte er sich von dem, was er von Goethe zu hören bekam, eher abgestoßen als angezogen, auch ein persönliches Zusammentreffen konnte daran nichts ändern. So konnte Schiller im Jahre 1788 über «Egmont», diese Frucht reifen Kunststudiums, eine abfällige Kritik schreiben. Er kann nicht begreifen, wie Goethe Egmont hingestellt habe nicht als heroischen Schwärmer, wie es damals in Schillers Sinne gelegen hätte, sondern, nach seiner Meinung, als eine Art Schwächling, der sich von den gegebenen Verhältnissen bestimmen läßt. Auch «Iphigenie» konnte Schiller damals nicht verstehen.
In einem Punkte begegneten sich Schiller und Goethe. Schiller hatte in einem Aufsatz über Bürgers Gedichte sich dahin ausgesprochen, daß der Mangel an Idealismus bei Bürger ihn nicht befriedige. Goethe war mit diesem Aufsatz so einverstanden, daß er sagte, er möchte gern den Aufsatz selbst geschrieben haben. Aber es zeigt sich noch, wie verschieden der Lauf der beiden Geister ist in dem Aufsatz Schillers über «Anmut und Würde». Es tritt uns in diesem Aufsatz Schillers ganzes Streben nach Freiheit entgegen. In dem Notwendigen kann er nicht Anmut finden, ein Naturwerk kann als anmutig nicht erscheinen; erst beim Kunstwerk, das ein Symbol, ein Sinnbild der Freiheit ist, können wir von «Anmut» sprechen. Als «Würde» kann man nur vom höheren Geistigen sprechen. In allem zeigte sich Schillers alte Anlage, den Begriff des Idealen als etwas Entgegengesetztes dem Natürlichen zu fassen.
Auch die Professur in Jena, die Goethe für Schiller erwirkte, ist nicht als ein Freundschaftsdienst aufzufassen.
Dieses Ereignis war für Schiller von weitgehender Bedeutung. An dem Studium geschichtlicher Charaktere konnte er einen tiefen Blick in den Entwickelungsgang des Geistes tun. Auch war ihm die Möglichkeit gegeben, sich einen Hausstand zu gründen und sich mit Charlotte von Lenge. feld zu verheiraten. Gerade an der Geschichte konnte Schiller so heranreifen, wie es sein Antrittsthema: «Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?» bedeutungsvoll ausspricht. So war Schiller immer mehr in die Wirklichkeit hineingekommen.
Vom Jahre 1790 ab, nach einem Besuche bei Körner, der sich zum Vermittler zwischen den beiden machte, hat wohl Goethe eine ganz andere Ansicht über Schiller bekommen. Doch ihre Freundschaft sollte nicht bestimmt werden durch die Punkte, in denen sich Sympathien von Alltagsnaturen finden. Nicht aus persönlichen Interessen sollte dies Bündnis hervorgehen. Nie wäre auf diese Art bei der Verschiedenheit ihrer Persönlichkeiten ihre Freundschaft so weltbedeutend geworden.
Es war nach einer Versammlung der Gesellschaft für naturwissenschaftliche Forschung im Jahre 1794 - vermutlich im Juli -, als Goethe und Schiller beim Nachhauseweg in ein Gespräch über den eben gehörten Vortrag kamen. Schiller sagte, es sei ihm alles so zerstückelt vorgekommen, wie lauter Einzelheiten, worauf Goethe meinte, er könne sich wohl eine andere Art der Naturbetrachtung vorstellen. Er entwickelte ihm seine Anschauungen über den Zusammenhang aller Lebewesen, wie man das ganze Pflanzenreich, als in fortwährender Entwickelung zu betrachten habe. Mit einigen charakteristischen Strichen zeichnete Goethe die Urpflanze, die er gefunden, auf ein Blatt Papier. Aber das ist keine Wirklichkeit, das ist eine Idee -, wendete Schiller ein. «Nun, wenn das eine Idee ist», sagte Goethe,
«so sehe ich meine Ideen mit Augen.» So zeigte sich in diesem Zusammenstoß beider Denken. Goethe sah den Geist in der Natur. Das, was der Geist intuitiv erfaßt, war für ihn ebenso wirklich, wie das Sinnliche; die Natur umschließt für ihn den Geist. Die wahre Größe im Menschen zeigte sich nun bei Schiller in der Art, wie er sich bemühte zu ergründen, worauf Goethes Geist fußte. Er wollte den rechten Standpunkt finden. In neidloser Anerkennung dessen, was ihm so entgegentritt, begründet Schiller die tiefe Freundschaft, die nun die beiden verbinden sollte. Es ist eines der schönsten menschlichen Dokumente der Brief vom 23. August 1794, den Schiller an Goethe schreibt, nachdem er sich in Goethes Schaffen vertieft hat. «Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen, und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das einzelne Licht zu bekommen: in der Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf.»
Auf diese Weise hat Schiller, nachdem er ihn erkannt hatte, Goethe gewürdigt. Es gibt keine tiefere psychologische Schilderung Goethes. So ist es bis zu dem Tode Schillers geblieben: unanfechtbar war diese Freundschaft, obwohl Neid und Mißgunst die beiden mit den niedrigsten Mitteln zu trennen versuchten. Jetzt arbeiteten sie so zusammen, daß der Rat des einen auf den anderen stets befruchtend wirkte. Schiller findet in einer Größe, die heute noch nicht übertroffen ist von andern Ästhetikern, indem er sich fragt: «Wie verträgt sich dieser oder jener Begriff mit dem Geiste Goethes?», eine Darstellung der verschiedenen Arten des
künstlerischen Schaffens, die er in seiner Abhandlung über «Naive und sentimentale Kunst» niederlegt. Naiv schafft der Künstler, der noch im Zusammenhange steht mit der Natur, der selbst noch Natur in der Natur ist. So schufen die Griechen. Sentimental schafft derjenige, der sich wieder zurücksehnt zur Natur, nachdem er aus ihr herausgerissen war. Es ist dies das Wesen der modernen Kunst.
Es liegt etwas Großes in der Art, wie die Kunst von den Freunden aufgefaßt wurde. Eine uralte Lehre, die in der orientalischen Weisheit fortlebt, von dem Vergänglichen aller Erscheinung, von dem Schleier der Maja, spricht sich hier aus. Nur derjenige Mensch lebt in der Wirklichkeit, der sich über die Illusion erhebt in die Region des Geistes. Die höchste Wirklichkeit ist nichts Äußerliches. Alles drängte die beiden auf eine innerliche Wirkung. Zwar hatte Goethe seinen Faust sagen lassen: «Im Anfang war die Tat.» Doch in Deutschland waren damals die Verhältnisse noch nicht so weit, um, wie in Frankreich, äußere Wirkungen zu schaffen; nur die Sehnsucht nach Freiheit gab es. So suchten diese Geister ihre Taten im Gebiete des Schönen, im Kunstwerk. Hineingestellt sollte werden ein Abglanz der höheren Wirklichkeit, der Natur in der Natur, in das Leben, durch den schönen Schein.
Goethes «Wilhelm Meister» steht in diesem Zeichen. Im «Wilhelm Meister» soll hinausgeführt werden über das Illusionare in der Alltäglichkeit zu der Vollendung der Persönlichkeit. So wird «Wilhelm Meister» zum schönsten Erziehungsroman, dem Schillers Worte als Motto gelten könnten: «Nur durch das Morgenrot des Schönen dringst du in der Erkenntnis Land.» Der Geist, aus dem wir handeln, ist das Höchste. Es war nicht möglich, in jener Zeit zu zeigen, daß aus dem Innern heraus die spirituelle Welt des Geistes geboren wird. So wurde im «Wilhelm Meister» zunächst
die Befreiung der Welt durch künstlerische Schönheit geschildert.
Die fortdauernde Mitarbeit, die Ratschläge Schillers, halfen das persönliche Moment im «Wilhelm Meister» herausschälen. Wir sehen hier auf der einen Seite dasjenige, was man als die tiefere Ursache des Menschen zu betrachten hat, was eine neuere Geisteswissenschaft den Ursachenleib nennt; auf der anderen Seite die äußeren Einwirkungen. Nichts entwickelt sich, was nicht im Keime vorhanden wäre, aber es wird durch die äußeren Einwirkungen beeinflußt. Dieses Zusammenwirken zeigt sich in Schillers schöpferischer Tätigkeit. Seine Balladen, sein Wallenstein, wären nicht möglich gewesen, hätte Goethes Einfluß nicht befruchtend gewirkt. Es war eine Art von Bescheidenheit, mit der sich die beiden gegenüberstanden, in der eine ungeheure Größe liegt. Sie wurden eigentlich erst ein Ganzes durch die Ergänzung ihrer beiden Naturen, durch die aber auch ungeheuer Großes zustande kommen konnte.
Die tiefe und starke Freundschaft machte es, daß alles Philiströse sich gegen sie aufbäumte. Die beiden wurden von Neid und Mißgunst verfolgt, denn noch niemals hat das Kleine die Größe verstehen können. Heute glaubt man kaum mehr, welche Angriffe von der Kleinheit auf diese Großen losgelassen wurden. Die «Annalen für Philosophie» zum Beispiel sprachen wegwerfend von ihnen; ein gewisser Manso bezeichnete sie als «Sudelköche von Weimar und Jena...» Wehren mußten sie sich gegen all diese Angriffe, und es ist ein schönes Denkmal ihrer Freundschaft, was sie in den «Xenien» im Jahre 1796 gaben. Bei diesen Distichen, in denen sie an all denen, die sich an ihnen und dem guten Geschmack vergingen, ein weltgeschichtliches Strafgericht vollzogen, ist nicht immer zu unterscheiden, welche von Goethe und welche von Schiller herrühren. Ihre
Freundschaft sollte sie als eine Person erscheinen lassen. An dem Beispiel Schillers und Goethes können wir wahrnehmen, wie Größe sich des Alltags zu erwehren weiß, und wie Freundschaft, die im Geistigen ruht, sich wahrhaft trägt und erhebt.
Und Wahrheit suchten sie beide: Schiller zunächst im Herzen des Menschen, Goethe in der ganzen Natur.
VIERTER VORTRAG, 11. Februar 1905
Schillers Weltanschauung und sein Wallenstein
Von Schillers Weltanschauung kann man nicht in dem Sinne sprechen wie von der philosophischen Weltanschauung anderer Menschen, denn sie ist in einem fortwährenden Flusse, in stetigem Aufsteigen. Kleine menschliche Persönlichkeiten haben es leicht, zu einer Weltanschauung zu kommen. Größere können sehr schwer sich durchringen. Dies kommt daher, weil eine kleine Persönlichkeit nicht imstande ist, die großen Rätsel zu durchschauen. Für den Größeren stellt sich mit jeder Lebenserfahrung ein neues Rätsel ein; es modifiziert auf einer neuen Grundlage die Anschauung, die neu gestaltet werden muß. Diese Sache hat Goethe bis zu seinem Lebensende durchgemacht und auch Schiller ging es so. Gerade Schiller hat es ausgesprochen, daß er im Grunde nur einen kleinen Umkreis des eigenen Werdens kannte, aber sein Geist arbeitete fortwährend an einer Vertiefung, einer Harmonisierung dieses seines Begriffs- und Lebenserfahrungsvorrats. Geradezu charakteristisch ist, wie Schiller Gespräche führte. Darin
war er ein Gegenpol von Herder, und ein gewisses Licht fällt auf Schiller durch diese Gegenüberstellung.
Wenn Herder in Gesellschaft von Leuten war, die sich dafür interessierten, entwickelte er seine Anschauungen; selten wurde ein Einwand gemacht; er stand so fest, so klar, daß er im dialektischen Gespräch nicht hätte eine Frage weiter bringen wollen. Ganz anders war es bei Schiller; bei ihm wurde jedes Gespräch lebendig: er nahm jeden Einwand auf, jedes Thema wurde angeschlagen, und dadurch brachte er das Gespräch auf alle möglichen Seitenpfade, alles wurde von allen Seiten beleuchtet. Im Gespräch drückt sich am schönsten aus - in dem Leben, welches Schiller im persönlichen Verkehr umfloß -, wie seine Anschauungen im ewigen Flusse waren. Wir haben hier dasselbe Streben nach Wahrheit, das Lessing in den Worten zum Ausdruck brachte: «Wenn Gott vor mir stünde, in der einen Hand die volle Wahrheit, in der andern das Streben nach der Wahrheit, so würde ich ihn bitten: Herr, gib mir das Streben nach der Wahrheit, denn die volle Wahrheit ist wohl nur für Gott allein da.»
So sehen wir, wie Schiller durch alle Perioden seines Lebens hindurch in einem fortwährenden Streben nach höherer Weltanschauung begriffen ist; wie er, als er zur Professur nach Jena ging, genötigt war, seine Ideen lebendig zu machen; wie er rang, die großen Kräfte, die in der Welt wirkend sind, zu erfassen und in lebendigem Vortrage fruchtbar zu machen.
Die geschichtsphilosophischen kleineren Aufsätze zeigen uns, wie er mit diesen Ideen rang. Außer dem schon erwähnten Vortrag: «Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?» - versuchte er die Bedeutung eines solchen Gesetzgebers wie Moses zu charakterisieren. Dann behandelt er die Zeit der Kreuzzüge; und es
gibt vielleicht nichts Schöneres und Interessanteres als die Art, in der Schiller die Besitz- und Lehnsverhältnisse des Mittelalters schildert. Die großen Freiheitskämpfe der Niederlande werden so erfaßt, daß man daran lernen kann, wie die Geschichtsentwickelung innerlich vor sich geht. Dann die Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs, in der ihn schon vor allem die Figur des Wallenstein fesselt, die ihm den Menschen mit dem Gesetz des Willens in sich selbst zeigt, fest in seiner Person, aber mit kleinlicher Ehrsucht behaftet, schwankend in seinen Zielen, und, voll von unklaren Begriffen, über Sterndeutung grübelnd. Später versucht er dichterisch diese Figur zu enträtseln. Doch vorher sucht Schiller sich noch zu klären durch philosophische Studien in Kants Werken. Nicht unvorbereitet trat Schiller auch als Philosoph an den Kantianismus heran. Es war damals etwas in ihm, das nur durch die Anlehnung an Kant herauskommen konnte.
Man muß diesen Punkt in Schillers Wesen tief fassen, um seine große Persönlichkeit recht verstehen zu können. Es gibt eine Reihe von Briefen, «Philosophische Briefe» zwlschen Julius und Rafael: die Philosophie, die er da entwikkelt, ist etwas, was ihm eingeboren ist. Das Weltbild, das er sich gebildet hat aus seiner tiefen Persönlichkeit heraus, stellt der dar, welcher Julius heißt, während wir uns in Rafael einen Mann charakterisiert denken müssen, wie seinen Freund Körner, der zu einer gewissen Abgeschlossenheit gekommen ist, wenn auch nicht in so tiefer Weise. Denn im Leben erscheint der Geringere oft als der Klügere, Übergeordnete, gegenüber dem Höherstrebenden, Ringenden. Der Ringende, der aber hier noch in Disharmonien unbefriedigt lebt, entwirft in der «Theosophie des Julius» sein Weltbild etwa in folgender Weise: «Alles in der Welt entstammt einem geistigen Urgrunde. Auch der Mensch ist zunächst
hervorgegangen aus diesem Urgrund; er ist ein Zusammenfluß aller Kräfte der Welt. Er wirkt wie ein Auszug, wie eine Vereinigung alles dessen, was in der Natur ausgebreitet ist. Alles Dasein außer ihm ist nur Hieroglyphe einer Kraft, die ihm ähnlich ist. Im Bilde des Schmetterlings, der sich aus der Raupe neu verjüngt in die Luft er-hebt, haben wir ein Bild der menschlichen Unsterblichkeit. Nur, wenn wir uns erheben könnten zu dem Ideal, das uns eingepflanzt ist, könnten wir zur Befriedigung gelangen.» Er nennt dieses Weltbild «Theosophie des Julius». Die Welt ist ein Gedanke Gottes; alles lebt nur in der unendlichen Liebe Gottes; alles in mir und außer mir ist nur eine Hieroglyphe des höchsten Wesens. Wie Goethe in seinem Prosahymnus an die Natur es ausgedrückt hatte, daß der Mensch ungefragt und ungewarnt in den Kreislauf des Lebens durch die Natur gestellt sei, daß sie selbst in ihm rede und handle, so kommt Schiller in gewisser Weise in dieser Theosophie des Julius zu einem ähnlichen Standpunkt. Aber er fühlt sich zunächst unbefriedigt: nur ein Gott könnte von einem solchen Standpunkt aus die Welt betrachten, meint er. Kann denn wirklich die Menschenseele, die so klein und beschränkt ist, mit einem solchen Bilde der Welt leben?
Aus dem Kantianismus hat Schiller nun zunächst ein neues Weltbild gewonnen, das bis zur Mitte der neunziger Jahre vorhält. Das Welträtsel ist ihm zum Menschenrätsel geworden; das Problem der Freiheit ist es zunächst, das ihn beschäftigt. Die Frage tritt vor seinen Geist: Wie kann der Mensch seine Vollkommenheit erlangen?
Am reinsten und schönsten tritt uns hier Schillers Weltanschauung in den «Ästhetischen Briefen» entgegen: Auf der einen Seite ist der Mensch seiner niederen Natur, seinen Trieben unterworfen; die Natur ist hier Notwendigkeit in
den Sinnendingen, die auf ihn einstürmen. Auf der anderen Seite liegt im Denken des Menschen die geistige Notwendigkeit; da ist die Logik, der er sich unterwerfen muß. Er ist Sklave der Naturnotwendigkeit und zugleich Sklave der Vernunftnotwendigkeit. Kant antwortet auf diesen Widerspruch mit einer Herabdrückung der Naturnotwendigkeit gegenüber der geistigen Notwendigkeit. Schiller erfaßte in ganzer Tiefe die Kluft zwischen Natur- und Vernunftnotwendigkeit. Er sah hier ein Problem, das über alle menschlichen Verhältnisse sich ausbreitet. Die Gesetze, die die Menschen regieren, sind teils hergenommen aus der Naturnotwendigkeit, aus den dynamischen Kräften, die in den Menschen wirken; teils aus der moralischen Ordnung, die sie in sich tragen. Disharmonie, Unterdrückung muß daraus folgen. So haben wir den dynamischen Staat und den moralischen Staat; beide wirken als eine eiserne Notwendigkeit.
Derjenige Mensch nur kann sich frei nennen, der sich die ehernen Gesetze der Vernunft und Logik so zu eigen gemacht hat, daß er ihnen ohne Zwang folgt, der so weit sein sittliches Gefühl geläutert hat, daß er gar nicht anders kann, als das Reine wollen, weil seine Neigungen sich hinauforganisiert haben zum geistigen Leben. Der Mensch, der die Vernunftgesetze heruntergeholt hat in die Triebe und Neigungen der Seele, und die menschlichen Leidenschaften heraufgeholt zur Erkenntnis der moralischen Ordnung, der wird die dynamischen Gesetze so beherrschen, daß Harmonie entsteht zwischen seinen Trieben und der Vernunft. Schiller nennt die Stimmung, in der der Mensch sich befindet, der seine Triebe so gereinigt hat, die ästhetische Stimmung, und den Staat, in dem solche Menschen wirken, die ästhetische Gesellschaft. Der Mensch muß verwirklichen, was ihm als seine höchste Würde erscheint.
In der Theosophie des Julius hatte Schiller ein ideales Weltbild aufgestellt. Eine Erziehung zu dem Ideal ist es, was Schiller vom Menschen und von der menschlichen Gesellschaft verlangt. Entwickelung ist es. was Schiller den Menschen vorhält.
Das drückt sich aus in dem Gedichte: «Der Spaziergang». Nicht als etwas Erreichtes erscheint ihm die Harmonie der Welt, sondern als ein Entwickelungsziel. Schön erscheint ihm die ewige Harmonie der Natur, aber als etwas, was auch der Mensch in sich erstreben sollte. Es muß das Ideal des Menschen werden, daß ein Zustand herbeigeführt werde, wo die Menschen in solcher Harmonie dahinleben, wie sie in der Natur vorbildlich sich uns zeigt. Was Schiller früher angestrebt hatte als Inhalt der Erkenntnis, wurde ihm jetzt sittlich-ästhetisches Ideal. Jetzt, unter dem Einfluß Goethes, wurde er wieder zum Dichter: so glaubte er arn besten zeigen zu können, wie der Geist des Menschen in Entwickelung begriffen ist, wie die verschiedenen Kräfte in ihm zusammenwirken, wie er von den Tiefen zu den Höhen strebt
In einer ganz bedeutsamen Weise hat er im «Wallenstein» sein ureigenes Problem dichterisch hingestellt. Schwer ist es ihm geworden die Menschennatur darzustellen, schwerer wie kleinere n Naturen. Nicht aus abstrakten Ideen heraus hat Schiller seine Gestalten geschaffen und dann erst gleichsam zu seinem Gedankenskelett das Fleisch gesucht, wie man vielfach behauptet hat. So war es nicht bei seinen Gestalten, so war es vor allem nicht beim «Wallenstein». Schiller ging aus von einer innerlich musikalischen Stimmung, wie er es nannte, nicht von Ideen. Gleichsam in Melodien ergoß sich in sein Inneres der Strom der im Menschen verwickelten Kräfte, die sich lösten in Harmonie oder untergingen in Disharmonie. Dann suchte er die Gedanken,
die Charaktere, die einzelnen Stimmungen. So standen ihm vor Augen die kontrastierenden Seelenkräfte Wallensteins, die diesen mit Notwendigkeit zu einer großen Katastrophe führen. - Man kann leider diese Stimmung nicht anders als mit gedanklichen Mitteln wiedergeben. - Es gibt eine auf sich selbst gebaute Persönlichkeit, die tragisch zugrunde geht. Tragisch in wahrem Sinne aber wirkt sie nur, wenn sie an sich selbst scheitert. Was Hebbel als notwendige Voraussetzung des Tragischen fordert, «daß es so hat kommen müssen», daß nichts tragisch sein könne, was auch in anderer Weise hätte getan werden können; wie intuitiv ist diese Ansicht von Schiller erfaßt worden, obgleich er sie nocht nicht ausspricht!
Aber Schiller steht unter dem Einflusse noch einer andern tragischen Idee, die sich nicht auflösen läßt, die vor allem in der Person des Wallenstein selbst zum Ausdruck kommt. Es ist das Bewußtsein, daß in das Menschenleben etwas Höheres hineinspielt, das in diesem Rahmen nicht zu lösen ist. Erst am Ende der Welt, wenn die Menschen zur Vollkommenheit gelangt sein werden, wird der Blick des Menschen so sein Schicksal überschauen können. Bis dahin werden immer Irrtümer sein müssen, etwas Unlösbares, für das Wallenstein in den Sternen eine Lösung sucht, das etwas Imponderables im eigenen Herzen ist. Fest vorherbestimmt glaubt Wallenstein in den Sternen sein Geschick zu lesen und muß nun sehen, wie Octavio ihn, entgegen dem Sternenorakel, betrügt. Doch die Freiheit des Menschen bleibt das Höchste; eine innere Notwendigkeit läßt ihn in den Sternen die Lösung suchen: er steht vor einem neuen Rätsel, die Sterne haben ihm gelogen. Doch nein, die Sterne können nicht lügen: Der Mensch, der gegen die heiligsten Gesetze des Gefühls und Herzens verstößt, er bringt die Harmonie der Sterne in Unordnung. Es kann keine Ordnung
in der Natur geben, die den Gesetzen des menschlichen Geistes widerspricht. Wer in dieser Weise den Charakter Wallensteins betrachtet, wird Schillers eigene Person in tiefer Bedeutung durch die Person Wallensteins hin-durchblicken sehen.
Ins Auge schauen wollte Schiller dem Widerspruch der Welt und zeigen, wie man mit diesem Widerspruch lebt. Es muß eine Wahrheit in der Welt sein, sagt er sich, und diese hat er gesucht, wie er es schon in dem Briefe des Julius tut. Der Widerspruch liegt in den einzelnen Erscheinungen. Schiller kommt hier zu der Erkenntnis dessen, was die alten Inder und andere Weise als Illusion erkannten. In der Wahrheit wollte er leben, und er betrachtete die Kunst als ein Tor, durch welches der Mensch wandeln muß, um ins Morgenrot der Schönheit und Freiheit zu gelangen. In dem Gedichte «Die Künstler» fordert er es geradezu von den Künstlern, sich hinzustellen auf den Weltenplan und mitzuschaffen an der Verwirklichung des Ideals. So ruft er ihnen zu: «Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie!»
FÜNETER VORTRAG, 18. Februar 1905
Schiller, das griechische Drama und Nietzsche
Es ist die Zeit, in der Schiller den «Wallenstein» geschrieben hat, für ihn eine Zeit des Übergangs, eine Zeit der Läuterung gewesen, in der er versuchte aufzusteigen aus seiner früheren Weltanschauung zu der Erfassung dessen, was er das rein Künstlerische nannte. Wir haben gesehen, wie Schiller versuchte, im Schönen, Künstlerischen etwas zu sehen,
was die menschlichen Seelenkräfte zu erheben, in Harmonie zu bringen vermag, so daß es das künstlerische Schaffen ist, was dem Menschen die Freiheit gibt. So war ihm, wie er an Goethe gelegentlich des «Wilhelm Meister» schrieb, der Künstler einzig der ganz wahre Mensch, und der Philosoph nur eine Karikatur neben ihm. Es war dies eine radikale Wendung, die wiedergab, was Schiller damals empfunden hatte.
In «Fiesco», in «Kabale und Liebe», in «Don Carlos» sind die Figuren so aufzufassen, daß ihm einige sympathisch, andere antipathisch sind. Diese moralische Beurteilung, diese moralische Wertung wollte er ablegen auf der Höhe seiner Künstlerschaft. Jetzt wollte er den Verbrecher mit derselben Liebe und Sorgfalt wie den Helden behandeln; nicht mehr sollte das Kunstwerk anknüpfen an etwas, was er selber als Sympathie oder Antipathie empfand.
Als man gegen den «Wilhelm Meister» den Vorwurf erhob, daß mehrere Figuren gegen das moralische Gefühl verstießen, schrieb er an Goethe etwa: «Könnte (man) Ihnen zeigen, daß das nicht Moralische aus Ihnen und nicht aus den Figuren stammt, so könnte man Ihnen einen Vorwurf machen.» Ihm ist der Wilhelm Meister eine Schule der Ästhetik.
Schiller, der die menschliche Persönlichkeit in ihrer Autonomie geschaut hatte, versucht sich aufzuschwingen zur Sonnenhöhe echten Künstlertums. Daher ergibt sich eine neue Art des Anteils des Künstlers an seinen Schöpfungen. Wir sehen sie schon im «Wallenstein». Nicht mehr sollte er persönlichen Anteil haben, nicht mehr wollte er moralisch urteilen und werten, sondern nur als Künstler.
Es erinnert diese Auffassung an ein Gespräch Schillers mit Goethe, in dem sie Betrachtungen über Architektur angestellt haben. In diesem hat Goethe ein tief bedeutendes
Wort gesprochen, das zunächst etwas paradox klingen könnte. Goethe hat verlangt von einem schönen Gebäude, daß es nicht nur auf das Auge, sondern auch auf den, der mit verbundenen Augen hindurchgeführt würde, einen harmonischen Eindruck mache. Wenn alles Sinnliche ausgelöscht ist, kann ein Hineinversetzen mit dem Geiste möglich sein.
Nicht Zweckmäßigkeit: Idealität des Geistes war, was hier gefordert wurde. Paradox erscheint diese Forderung auf den ersten Augenblick: sie war herausgeschaffen aus der hohen Kunstanschauung Goethes und Schillers Es bildete sich um sie ein Kreis von Künstlern, die ähnlich urteilten. So Wilhelm von Humboldt, ein feiner Kenner der Kunst, dessen ästhetische Abhandlungen bedeutsam sind für das geistige Milieu. Schiller wurde dadurch geführt zu einer Kollision mit seinen früheren künstlerischen Anschauungen und mit dem Kantianismus, der im Grunde das Übersinnliche nur dort gelten lassen wollte, wo Moralisches in Frage kommt. So aber kann kein Künstler sehen; beim Zurückkehren zum Künstlerischen genügt Schillern Kant nicht mehr. Schillers Auffassung des tragischen Konflikts war diejenige, die später Hebbel formulierte, indem er sagte, nur das sei tragisch, was unabänderlich sei. So empfand Schiller; so hatte er es im «Wallenstein» auszuführen versucht, so wollte er das Tragische darstellen. In Shakespeares «Richard III.» sah er das Schicksal mit solcher Unabänderlichkeit hereinbrechen. Doch schon hatte er eine Vorliebe für das griechische Drama gefaßt. Im Shakespeare-Drama steht die Person des Helden im Mittelpunkt; aus dem Charakter des Helden ergibt sich die Notwendigkeit der Entwickelung.
Ganz anders ist es im griechischen Drama. Dort ist alles schon vorherbestimmt, alles fertig. Der Mensch wird hineingestellt
in eine höhere geistige Ordnung, aber zugleich, weil er ein Sinnenwesen ist, wird er von ihr zermalmt. Nicht der Charakter, die Persönlichkeit, sondern das übermenschliche Schicksal ist das Bestimmende. So sind die Erinnyen der griechischen Tragödie ursprünglich nicht Rachegöttinnen, sondern bedeuten eigentlich das Dämmernde, das, was sich nicht ganz auflösen läßt, was hineindämmert in des Menschen Schicksal. Bei der Rückkehr zur Künstlerschaft kam Schiller zu dieser Auffassung des Tragischen. Wer das Tragische in solcher Weise empfinden will, muß das Persönliche eliminieren, herauslösen aus dem nur Menschlichen. Erst so wird man den «Wallenstein» recht verstehen. Hinausgewachsen über die Persönlichkeit, schwebt etwas Überpersönliches über Wallenstein. Daß der Mensch einer höheren Ordnung, einer höheren geistigen Welt angehört, das ist für Schiller die Bedeutung der Sterne, die des Menschen Schicksal lenken. Dort in den Sternen soll Wallenstein sein Schicksal lesen.
Auf diese Überpersönlichkeit deutet Carlyle hin, wenn er in Wallensteins Lager in dem Charakter der einzelnen Persönlichkeiten einen Parallelismus findet, der über sie hinaus zu den Persönlichkeiten der Führer hinspielt: so weist der irische Dragoner, der dem Spiel des Kriegsglücks vertraut, auf seinen Chef Buttler; der erste Kürassier, der die edlere Seite des Kriegslebens darstellt, auf Max Piccolomini; der Trompeter in seiner unbedingten Ergebenheit auf Terczky; während der Wachtmeister, der die Aussprüche seines Feldherrn pedantisch zitiert, als eine Karikatur des Wallenstein erscheint.
So sehen wir hier eine große Gesetzmäßigkeit, die über das bloß Persönliche hinausgeht. Die ganze Komposition des Gedichtes beweist den Standpunkt, den Schiller erklommen zu haben glaubte. Wir haben erstens das Lager,
wo Wallenstein gar nicht auftritt, zweitens die Piccolomini, wo Wallenstein eigentlich gar nicht eingreift, er erfährt, was geschehen ist, durch Max Piccolomini, und von seiner Frau hört er, was am Wiener Hofe vor sich geht. Er läßt es geschehen, daß seine Generäle sich verbinden, das berühmte Dokument unterzeichnen. Um ihm herum spielt die Handlung sich ab. So wird auch der Gedanke des Verrats nur spielend von ihm gefaßt, der sich dann seiner Seele bemächtigt. Drittens Wallensteins Tod. Jetzt ist Wallenstein in die Ereignisse gedrängt durch die eigenen Gedanken, die ein objektives Leben angenommen haben, hineingedrängt in ein überpersönliches Schicksal. Eine monumentale Sprache kennzeichnet diese Situation. Hineingestellt ist er in eine eherne Notwendigkeit; das Persönliche, das mit den großen Linien nichts Besonderes zu tun hat, ist in den Winkel gedrängt. Wohl findet es auch erschütternde Töne, wie in dem Gespräch mit Max Piccolomini.
Wallenstein (hat den Blick schweigend auf ihn geheftet und nähert sich ihm jetzt):
Max, bleibe bei mir. - Geh nicht von mir, Max!
Sieh, als man dich im Prag'schen Winterlager
Ins Zelt mir brachte, einen zarten Knaben,
Des deutschen Winters ungewohnt, die Hand
War dir erstarrt an der gewichtigen Fahne,
Du wolltest männlich sie nicht lassen, damals nahm ich
Dich auf, bedeckte dich mit meinem Mantel,
Ich selbst war deine Wärterin, nicht schämt' ich
Der kleinen Dienste mich, ich pflegte deiner
Mit weiblich sorgender Geschäftigkeit,
Bis du, von mir erwärmt, an meinem Herzen
Das junge Leben wieder freudig fühltest.
Wann hab' ich seitdem meinen Sinn verändert?
Ich habe viele Tausend reich gemacht,
Mit Ländereien sie beschenkt, belohnt
Mit Ehrenstellen - dich hab' ich geliebt,
Mein Herz, mich selber hab' ich dir gegeben.
Sie alle waren Fremdlinge, du warst
Das Kind des Hauses - Max, du kannst mich nicht verlassen!
Es kann nicht sein, ich mag's und will's nicht glauben,
Daß mich der Max verlassen kann.
Aber es greift nicht eigentlich in die Handlung ein. Das große Tragische und das Persönliche auseinanderzuhalten, wie hier geschieht, darzustellen, wie Wallenstein gar nicht anders kann als zur Tat zu schreiten, nachdem er die Gedanken hat frei um sich her spielen lassen, das ist das Große in diesem Drama Schillers Wie aus der Freiheit eine Art Sonne der Notwendigkeit wird, zeigt er uns hier. In dieser ganzen Gedankenrichtung liegen Gegenwartsbegriffe, die nur angefacht zu werden brauchen, um fruchtbar zu werden.
In derselben Art ist auch das nächste Drama «Maria Stuart» gedacht. Es ist im Grunde anfangs schon alles geschehen, und nichts vollzieht sich als nur das, was längst vorbereitet ist. Nur der Charakter, das innere Leben entrollt sich vor uns, und dies innere Leben wirkt wieder als Notwendigkeit.
In den späteren Dramen hat Schiller versucht, das Schicksalsmäßige immer mehr auszugestalten. So wird in der «Jungfrau von Orleans» etwas Überpersönliches zum Ausdruck gebracht, in den Visionen, wo ihr Dämonisches entgegentritt, das sie zu ihrer Sendung beruft und sich ihr entgegenstellt, als sie dem Gebot untreu geworden ist, bis sie es durch Buße versöhnt.
In der «Braut von Messina» versucht er geradezu der griechischen Tragödie wieder Eingang ins moderne Leben zu verschaffen. Er drückt hier das Überpersönliche durch Einführung des Chores aus. Was wollte Schiller mit dem Chor? Er blickte zurück auf den Ursprung der Tragödie, die entstanden ist aus der Religion. In dem Urdrama wurde gezeigt, wie Dionysos, der leidende Gott, in der Menschheit wieder erlöst wird. - Spätere Forschungen haben zu dieser Wahrheit geführt. - Als das griechische Mysteriendrama verweltlicht wurde, entstanden die ersten Anfänge der dramatischen Kunst. So tritt uns bei Äschylos noch ein Anklang an das entgegen, aus dem die Kunst hervorgegangen war, an die Mysterienkulte, in denen das Weltendrama der Weltenerlösung dargestellt wurde. Edouard Schure' hat diese Eleusinischen Mysterien in seinen «Sanctuaires d'Orient» dargestellt, eine erste Art religiös-künstlerischer Lösung des Weltenrätsels. Die weltumspannenden Handlungen dieses Urdramas finden in der Sprache nicht das geeignete Instrument; diese ist der Ausdruck der persönlichen Beziehungen. Als das Drama zum Wort überging, behandelte es die mehr persönlichen Beziehungen, so bei Sophokles, bei Euripides. Vom Typischen war man zur Darstellung des Persönlichen gekommen. Das alte Drama verwendete daher eine überpersönliche Sprache, etwas was der Musik angeähnelt war. Sie ging von dem Chor aus, der die mimisch dargestellte Handlung begleitete. So hat sich aus dem musikalischen Drama das spätere Wortdrama entwikkelt. Friedrich Nietzsche hat diesen Gedanken weiter ausgeführt in seiner Schrift «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik». Ihm ist das Wortdrama eine Art von Dekadenzwerk. Daher seine Verehrung für Wagner, der eine neue religiöse Kunst schaffen wollte, herausgeboren aus der mythischen Welt. Richard Wagner begeisterte sich
nicht für das Persönliche, sondern für das Überpersönliche. Er nimmt daher zur Grundlage seiner Dramen nicht historische, sondern mythische Handlungen, und da, wo es gilt Überpersönliches darzustellen, verwendet er nicht die gewöhnliche Sprache, sondern die musikalisch gehobene.
Schiller hat das, was man später erforschte, vorausgefühlt, und in diesem Sinne die griechische Tragödie entwickelt. Er wollte ein lyrisches Element einführen, um, wie er es in der Vorrede erwähnt, durch die Stimmung die Kunst auf eine besondere Höhe zu heben. So ist, was in dem Wagner- und Nietzschekreis sich in radikaler Form abgespielt hat, schon bei Schiller vorhanden; nur wird es dort nicht in so abgeklärter Weise behandelt, wie es von ihm geschieht.
Es lebt schon in Schiller der große Gedanke, die Menschheit wieder zu dem Quell zu führen, dem das Geistige entsprungen ist, die Kunst zurückzuführen auf den heimischen Urgrund, aus dem die Religion, Kunst und Wissenschaft hervorgegangen sind. Es konnte ihm die Schönheit das Morgenrot der Wahrheit sein. Auch heute noch werden wir in Schiller finden, was uns hinweist auf das Beste, was wir für die Gegenwart und Zukunft erhoffen. So kann Schiller heute als ein Prophet einer besseren Zukunft uns vorangehen.
SECHSTER VORTRAG, 25. Februar 1905
Schillers spätere Dramen
Wir haben gesehen, wie Schiller bei jedem seiner späteren Dramen immer von neuem versucht hat, das Problem des Dramatischen zu lösen. Es hat etwas Erhebendes, zu sehen, wie Schiller nach jedem neuen großen Erfolge - und es
waren außerordentliche Erfolge, Anerkennungen der Besten seiner Zeit, wenn es auch an Anfeindungen nicht fehlte -, es hat etwas besonders Erhebendes, zu sehen, sagte ich, wie er versucht, mit jedem neuen Drama eine höhere Etappe zu erklimmen.
Alle seine späteren Dramen, «Teil», die «Braut von Messina», die «Jungfrau von Orleans», «Demetrius», sie sind lauter Versuche, dem Problem des Dramatischen und Tragischen in einer neuen Form beizukommen. Niemals hätte er sich zufrieden gegeben in dem Glauben, die Psychologie ausgeschöpft zu haben. In der «Maria Stuart» haben wir ihn das Problem des Schicksals behandeln sehen, eine vollendete Situation schaffend, in der nur die Charaktere sich abrollen. Noch tiefer stieg er in der «Jungfrau von Orleans» hinunter in die Menschenseele. Er wußte einen tiefen Griff zu tun in die Menschheitspsychologie, das Problem in der Art begründend, wie Hebbel es dargestellt hat, als er sagte, daß das Tragische auf etwas sich beziehen muß, das in einer gewissen Weise irrationell ist. So haben wir in der «Jungfrau» das Hineinspielen von dunklen Seelenkräften: sie ist eine Art von Somnambule, steht unter dem Einflusse dessen, was man dämonisch nennen kann, wird dadurch weitergetragen. Hoch über dem Menschlichen soll sie stehen, nur dadurch, daß sie Jungfrau ist, hat sie das Recht, wie ein Würgeengel durch die Reihen der Feinde zu gehen, im Dienste des Vaterlandes. In der «Braut von Messina» versucht Schiller das Drama höher zu fassen dadurch, daß er einen Griff in das Urdrama tut. Auf jenes Urdrama griff er zurück, das noch dem Äschylos voranging, das nicht nur Kunst war, sondern ein integrierender Bestandteil der die Religion, die Wissenschaft und die Kunst umfassenden Wahrheit: auf jenes Dionysosdrama, das den leidenden, sterbenden, auferstehenden Gott auf die Bühne brachte, als
Repräsentanten der ganzen Menschheit. Die Handlung trug da nicht den Charakter dessen, was man heute Dichtung nennt. Das Weltendrama sollte vorgeführt werden, die Wahrheit in schöner, künstlerischer Form. Erhebung, religiöse Erbauung sollte es dem Menschen bringen. So enthielt für den Zuschauer das Mysteriendrama zugleich, was später sich getrennt als Religion, Kunst und Philosophie entwickelte.
Dieser Gedankengang, den Friedrich Nietzsche in seiner Schrift «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» entwickelt, in der er das Urdrama als das höhere hinstellt, diese Grundidee lebte schon in Schiller. Schillers Idee, das Schöne dadurch in höhere Sphären zu heben, daß er das musikalische Element wieder einführte, wurde von Wagner in großem Stil wieder aufgenommen und fand in dem Musikdrama monumentalen Ausdruck. Wagner griff zum Mythos und wählte die Musik, um nicht in der täglichen, sondern in gehobener Sprache das Bedeutende auszudrücken. Die Richtung, welche die Kunst im Wagnerkreis genommen hat, wurde von Schiller intendiert. In seiner kurzen Einleitung zur «Braut von Messina» findet er dafür einen so plastischen wie prägnanten Ausdruck. Freiheit des Gemüts in dem lebendigen Spiel aller seiner Kräfte soll die rechte Kunst verschaffen. Daraus erkennen wir, was in Schiller lebte. Wir haben gesehen, wie Schillers Geist sich an Goethe hinaufrankte. Er selbst nannte Goethes Geist den intuitiven, seinen eigenen den symbolisierenden. Es ist dies ein bedeutsamer Ausspruch.
Schiller dachte im Grunde genommen die Menschen immer als Repräsentanten der Gattung, er dachte sie in einer Art Symphonie. Wir sehen bei ihm das Drama aus einer musikalischen Stimmung herauswachsen: daraus ergibt sich diese Symphonie von Menschencharakteren, von handelnden
und leidenden Charakteren. Das bewirkte, daß er nötig hatte, die einzelnen Züge zu Symbolen großer Menschenerfahrung zu machen. Dadurch ist Schiller der Dichter des Idealismus geworden: er hat durch die Erfahrung die Ideale heruntergeholt, um sie im Charakter zu gestalten. Im Mittelpunkt stand ihm das Problem des menschlichen Ich, die Frage: wie wirkt der Mensch innerhalb seiner Umgebung?
In der «Braut von Messina» hat er in einer neuen Form die griechische Schicksalstragödie geben wollen. Es muß etwas in der Menschenseele sein, welches bewirkt, daß der Mensch nicht in verstandesmäßiger Art seine Entschlüsse ausführt - er würde sonst klüger handeln -, etwas Dunkles muß in ihm leben, was dem Dämon des Sokrates ähnlich ist. Das muß aus der geistigen Welt in ihn hineinwirken. Dieses mit dem Verstande nicht zu Erfassende läßt Schiller in die Tragödie hineinspielen. In der Art, wie er das tut, zeigt sich Schiller als ganz moderner Charakter. Von zwei Träumen geht bei ihm die Handlung aus: Der Fürst von Messina träumt von einer Flamme, die zwei Lorbeerbäume verzehrt. Dieser Traum wird ihm von einem arabischen Sterndeuter dahin ausgelegt, daß die Tochter, die ihm geboren ist, seinen Söhnen Unheil bringen würde, und er gibt Befehl, sie zu töten. Zugleich aber hat die Fürstin geträumt von einem Kinde, dem Adler und Löwe sich friedlich anschmiegen. Auch ihr wird der Traum gedeutet: ein christlicher Mönch verheißt ihr, daß die Tochter die beiden streitenden Brüder in Liebe zu sich vereinen werde. Da rettet sie das Kind.
So ist das Dunkle, Unbestimmte, in den Ausgangspunkt der Handlung hineingelegt. Sehr fein erscheint, daß der erste Traum von einem Araber, der zweite von einem Christen gedeutet wird; Schiller aber entscheidet sich für keinen. Hebt man alles, was mystisch traumhaft ist, hinweg,
so bleibt nur der Kampf der Brüder, und diese rationelle Handlung bleibt noch immer dramatisch. Das Geistvolle und ganz besonders Künstlerische ist, daß jedes Element etwas Ganzes ist; auch ohne das Mystische ist die Handlung eine ganze. Es ist von Schiller in dieser Richtung mit Feinheit und Kunst etwas in dieses Drama gelegt, das über das menschliche Bewußtsein hinausgeht. So war er zu noch höherer Beantwortung seiner Frage gekommen.
An derselben Menschheitspsychologie arbeitet er im «Tell». Ich will das Drama nicht analysieren, nur zeigen, was Schiller dem 19. Jahrhundert war und was er uns noch sein wird. Nicht umsonst stellt Schiller den «Tell» heraus aus dem übrigen Gefüge des Dramas:
Doch was ihr tut, laßt mich aus euerm Rat.
Ich mag nicht lange prüfen oder wählen!
Bedürft ihr meiner zu bestimmter Tat,
Dann ruft den Tell, es soll an mir nicht fehlen.
Nicht wie die anderen unter dem Eindruck der Freiheitsidee handelt er, sondern aus rein persönlichem Gefühl, dem gekränkten Vaterempfinden. Zwei Linien läßt Schiller zusammenlaufen, etwas, was Tell allein angeht, und das, was das schweizerische Volk empfindet
Schiller wollte zeigen, wie beim Menschen nicht alles so gradlinig sich abspielt. Wir können gleiches bei Hebbels «Judith» wiederfinden, wo die Not des Vaterlandes zusammenfällt mit dem gekränkten Weibempfinden; der Dichter braucht etwas, was unmittelbar herauswächst aus der menschlichen Brust. Nicht das bloß Moralische, nicht das bloß Sinnliche will Schiller, sondern das Moralische soll herabsteigen und zur persönlichen Leidenschaft werden. Der Mensch wird nur dadurch frei, daß er sein Persönliches in der Art zu verrichten vermag, daß es mit dem allgemeinen
zusammentrifft. So arbeitete Schiller Stück für Stück an dem Ausbau seiner Psychologie, so sehen wir seinen Idealismus in einer fortwährenden Klärung. Das ist der Zauber, der in Schillers Dramen lebt. Er hat seine tiefgründigen, ästhetischen Schriften nicht umsonst verfaßt, in diese Probleme sich nicht umsonst versenkt.
Alles, was im 19. Jahrhundert über Asthetik geschrieben worden ist von Vischer, Hartmann, Fechner und so weiter, so bedeutend und treffend vieles ist, wir sehen bei allen das Schöne aus dem Menschen herausverlegt. Schiller aber hat immer studiert, was in der Seele des Menschen vorgeht, wie das Schöne auf die Menschenseele wirkt. Darum berührt uns, was er sagt, so traulich, so heimisch, darum können immer wieder Schillers Prosaschriften mit Entzücken gelesen werden. Es wäre eine würdige Schillerfeier, wenn diese Schriften weit verbreitet und gelesen würden, sie könnten weitgehend beitragen zur Vertiefung des menschlichen Geistes in künstlerischer und moralischer Beziehung. Eine pädagogische Ausbeute müßte aus Schillers ästhetischen Briefen gezogen werden; es würde in unser ganzes Unterrichtswesen dadurch ein neuer Zug kommen.
Wer Schillers Dramen verstehen will, muß die feine Bildungsluft aus seinen ästhetischen Schriften hervorholen. Wie Schiller in immer tiefere Schächte des Menschenherzens hineingraben wollte, wird der sehen, der sich mit dem leider nicht vollendeten «Demetrius» beschäftigt. Ein Drama hätte der «Demetrius» werden können, wie es erschütternder und gewaltiger kaum hätte ein Shakespearesches sein können. Viele Versuche sind unternommen worden, den «Demetrius» zu vollenden, doch der Größe der Aufgabe war niemand gewachsen. Der durchaus tragische Konflikt, bei reichster Handlung, beispielsweise der polnische Reichstag, ist - und das ist das Bedeutende - ganz in das
Ich verlegt. Wir können nicht sagen, daß unser Sinnen, Empfinden und Fühlen unser Ich ist. Wir sind, was wir sind, weil das Denken und Fühlen der Umwelt zu uns hereindringt. Dieser Demetrius ist so aufgewachsen, daß er selbst nicht weiß, was sein Ich ist. Es findet sich bei ihm, bei einer bedeutungsvollen Tat, für die er hingerichtet werden soll, ein Kleinod. Es scheint sich herauszustellen, daß ihm die Anwartschaft auf den Zarenthron gebührt. Alles trifft zusammen, er kann nicht anders glauben, als daß er der echte russische Thronerbe sei. So wird er hineingetrieben in eine bestimmte Konfiguration seines Jch. Fäden, die von außen gesponnen werden, treiben ihn weiter. Die Bewegung ist siegreich; Demetrius aber entwickelt sich zum Zarencharakter. Jetzt, wo das Ich zusammenstimmt mit der Welt um ihn her, erfährt er, daß er im Irrtum war: er ist nicht der echte Thronerbe. Er ist nicht mehr derjenige, als der er sich selbst gefunden hat. Er steht der Mutter gegenüber: sie verehrt ihn, aber die Stimme der Natur ist so stark in ihr, daß sie ihn als Sohn nicht anerkennen kann. Er jedoch ist selbst zu dem geworden, was er vorstellte. Er kann es nicht mehr von sich werfen, aber die Voraussetzungen dieses Ich fallen von ihm ab. Dies ist ein unendlich tragischer Konflikt, ihn können wir glauben. Alles ist auf die Spitze der Persönlichkeit gestellt, einer Persönlichkeit, die mit unendlicher Kunst gezeichnet ist, der wir glauben, daß sie «nicht über Sklaven herrschen wolle».
Auch das Äußere war mit all der Kunst gefügt, zu der nur Schiller imstande war. So wird in Sapieha, dem Opponenten des Demetrius, vorahnend der Charakter des Demetrius angezeigt. Auch hier wird die Symmetrie angestrebt, die im Wallenstein erreicht ist. Das Drama wurde nicht vollendet; der Tod trat dazwischen. So erhält der Tod Schillers etwas Tragisches; alle die Hoffnungen, die auf
Schiller gesetzt wurden, sie kamen in den Briefen und Äußerungen seiner Zeitgenossen zum Ausdruck. Tief erschüttert von dem Verlust dessen, von dem man noch so vieles erwartete, klingt es uns aus den Briefen der Besten entgegen, wie bei Wilhelm von Humboldt:
«Er wurde der Welt in der vollendetsten Reife seiner geistigen Kraft entrissen, und hätte noch Unendliches leisten können. Sein Ziel war so gesteckt, daß er nie an einen Endpunkt gelangen konnte, und die immer fortschreitende Tätigkeit seines Geistes hätte keinen Stillstand besorgen lassen; noch sehr lange hätte er die Freude, das Entzücken, ja, wie er es in einem Briefe bei Gelegenheit des Plans zu einer Idylle so unnachahmlich beschreibt, die Seligkeit des dichterischen Schaffens genießen können.»
Das ist der Ton, der den Tod Schillers erst zum Tragischen erhebt, denn im gewöhnlichen Verlauf der Dinge hat der Tod nicht jenes Irrationelle. Aus dieser Stimmung heraus fand Goethe für den toten Freund in dem «Epilog zu Schillers Glocke» die Worte:
Und hinter ihm in wesenlosem Scheine
Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.
Diesen großen idealistischen Zug, den können wir fortströmen sehen im 19. Jahrhundert. Man wurde sich bewußt, daß Schillers Geist erhebend sei, um fortan in allen Kämpfen seinem Volke Trost und Vorbild zu sein.
Das Fortwirkende von Schillers Idealismus in der deutschen Geistessubstanz sprach K. Gutzkow in seiner Rede zur Schillerfeier in der Harmonie in Dresden am 10. November 1859 aus, in den treffenden Worten:
«Das ist das Geheimnis unserer Liebe zu Schiller: Die Erhebung unserer Herzen! Der Mut zur Tat! Der treue Beistand, den die Nation in all ihren Lagen bei ihrem Liebling
findet! Mut und Freudigkeit weckt, was uns an Schiller erinnert. So lieblich, so reich, so tief anheimelnd wie Goethe uns anmutet, was in seinen Schöpfungen an deutsche Art und Sitte erinnert, es ist wie Efeu, der sich trauernd träumerisch an das Vergangene schmiegt. Aber bei Schiller ist alles Zukunft, Fahnenwinken oder Lorbeer. Deshalb, deshalb feiern wir das hundertjährige Gedächtnis seines Namens so klingend und weithinschallend, wie das Schlagen an einen ehernen Schild. Hoch der Dichter der Tat, ein Hort des deutschen Vaterlandes.»
SIEBENTER VORTRAG, 4. März 1905
Schillers Wirkungen im 19. Jahrhundert
Ich möchte heute noch sprechen über die Art der Wirkung, die Schiller auf das 19. Jahrhundert gehabt hat, um dann überzugehen auf die Bedeutung Schillers für die Gegenwart, und auf das, was Schiller für die noch folgende Zukunft sein kann. Im Schlußvortrage will ich dann ein Gesamtbild Schillers geben. Wer Schillers Verhältnis zum 19. Jahrhundert schildern will, kann sich unmöglich auf Einzelheiten einlassen, deshalb wollen wir uns nicht mit einzelnen Begebenheiten besonders aufhalten, wenn sie nicht besondere symptomatische Bedeutung haben. Es handelt sich darum, zu zeigen, wie es sich mit dem ganzen Kulturleben des 19. Jahrhunderts verhält, und welche Stellung Schiller darin einnimmt.
Es ist im allgemeinen schwer zu sagen, wie groß der Einfluß Schillers auf die einzelnen Perioden ist; die Kanäle lassen sich nicht im einzelnen verfolgen. Schillers Einfluß läßt
sich zum Teil vergleichen mit dem, welchen Herder im Anfange des Jahrhunderts ausübte, von dem Goethe zu Eckermann sagte: «Wer liest noch Herders philosophische Werke? aber überall begegnet man Ideen, die er gesät.» Es ist dies eine intensivere Wirkung als die mit dem Namen verknüpfte. Auch mit Schiller ist dies der Fall. Sein Wirken läßt sich nicht abtrennen von der Wirkung der großen klassischen Zeit. Eines aber läßt sich herausheben: diese Wirkung Schillers, die Anerkennung, von der das Nationalfest am 10. November 1859 Kunde gibt, kam keineswegs so leicht und widerspruchslos heraus. Schiller hat sich nicht so leicht durchgerungen. Es hat viel geschehen müssen, um namentlich in die Jugend hinein den Geist Schillers auf ganz imponderable Art fließen zu lassen. So hat das «Lied von der Glocke» zunächst in den Kreisen der Romantiker den heftigsten Widerspruch hervorgerufen. Caroline von Schlegel, die Gattin August Wilhelms von Schlegel hat es ein spießbürgerliches philiströses Gedicht genannt.
Nicht nur in dem, was uns in den Xenien entgegentritt, sondern im allgemeinen in den Kreisen derer, die man die Romantiker nannte, finden wir lebhaften Widerspruch gegen Schiller. Die Romantiker sahen in Goethes «Wilhelm Meister» ihr Ideal und hatten Goethe, den treuen Freund, der Schiller die Worte nachgerufen:
Weit hinter ihm im wesenlosen Scheine
Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine . . .
auf den Schild gehoben auf Kosten Schillers Was Schiller verstand, das Moralische, Ethische so hoch zu erheben, war ihnen etwas durchaus Unsympathisches. Harte Worte flossen von seiten der Romantiker gegen Schiller, den spieß-bürgerlichen Ethiker. Diejenigen, die heute in Schillerehrung
aufgewachsen sind, werden schwer Worte verstehen können, wie sie zum Beispiel Friedrich von Schlegel über ihn fand in Besprechungen über Schiller und Goethe. Er nennt seine Einbildungskraft «zerrüttet». Da ist nichts zu merken von dem, was alle Herzen zu Schiller zog. Ungefähr gegen Ende der zwanziger Jahre erschien der Briefwechsel Goethes und Schillers, jenes Denkmal, das Goethe seinem Freunde und der Freundschaft setzte. Man kann unendlich viel daraus lernen, und seine Bedeutung für die deutsche Kunstbetrachtung ist gar nicht zu bemessen. Auch da verhielten sich die Romantiker durchaus ablehnend. Sie hatten bissigen Spott dafür. Wie schwer es war, für Schillers Ruhm festen Boden zu fassen, zeigt die Großmannssucht der Persönlichkeiten, die Schiller am heftigsten Opposition machten. A. W. Schlegel, der verdienstvolle Übersetzer Shakespeares, hat ein Sonett auf sich selbst gedichtet, in dem sich ausspricht, wie er sein eigenes Verhältnis zum deutschen Volke auffaßte; er spricht da mit einem Selbstgefühl von seiner dichterischen Bedeutung, das uns heute sonderbar anmutet. Es schließt:
Wie ihn der Mund der Zukunft nennen werde
Ist unbekannt, doch dies Geschlecht erkannte
Ihn bei dem Namen August Wilhelm Schlegel.
Der Mann stellt nicht bloß eine Einzelerscheinung dar, er stellt die romantische Theorie dar; ihn kann man nur verstehen, wenn man begreift, was die romantische Schule wollte. Die Romantiker wollten eine neue Kunst, eine Zusammenfassung alles Künstlerischen. Es war ihre Theorie eigentlich herausgewachsen aus dem, was Schiller in seinen ästhetischen Aufsätzen dargestellt hatte, aber sie war eine karikierte Auffassung. Das Wort Schillers «Der Mensch ist
nur da ganz Mensch, wo er spielt», wurde ihnen zu einer Art Motto. So entstand die romantische Ironie, die alles zu einem Spiele des Genies machte. Man hatte eine Auffassung, als ob es der Willkür des Menschen unterliege, ein Genie zu sein. Wenn Schiller die Kunst ein Spiel nannte, war es, weil er dem Spiel den ganzen vollen Ernst geben wollte. In der Besiegung des Stoffes durch die Form liegt das Kunstgeheimnis des Meisters, sagt Schiller, während die Romantiker die Form vernachlässigten und vom Stoffe selbst verlangten, daß er künstlerisch wirke. Eine solche Richtung war es, die ich nicht kritisieren, sondern charakterisieren will, welche Schiller grundsätzlich entgegenstand. Der Briefwechsel Goethes und Schillers wurde daher, wie gesagt, von ihnen aufgenommen als etwas, das sie störte. Die darin besprochenen Kunstregeln fanden sie hausbacken. A. W. von Schlegel schrieb unter dem Eindruck dieses Briefwechsels boshafte Epigramme. Untereinander betrachteten sich die Romantiker mit der größten Bewunderung. Dies alles zeigt, wie in den ersten Jahrzehnten Schillers Lebenswerk den heftigsten Widerspruch hervorrief. Andererseits war die Persönlichkeit Schillers so gewaltig, daß auch aus diesen Kreisen ihm Anerkennung und Bewunderung gezollt wurde. So schrieb Ludwig Tieck über Schillers «Wallenstein» in verständnisvoller und verehrungsvoller Art.
Wir sehen, daß Schiller immer mehr seinen Einfluß sich nach und nach erringt, daß er sich einnistet in die Herzen der Nation. So ist Theodor Körner zwar die bedeutendste, aber nicht einzige Erscheinung, die ganz im Geiste Schillers lebt, er, der auch den Heldentod stirbt, ganz erfüllt von den Idealen, die Schiller ihm eingepflanzt. Er schien dazu geweiht durch die persönliche Freundschaft, die seine Familie mit Schiller verband. Eine herzliche Freundschaft war es,
die Körners Vater und Schiller verknüpfte; er war der Pate Theodor Körners, von ihm war die «Leier» gekauft, die Theodor Körner überall begleitete. Schiller hat sich langsam, aber ganz sicher in die Herzen der Jugend eingeschlichen.
Wer die Entwickelung des Schriftwesens bei den sich sträubenden Romantikern verfolgt, begegnet dem Einfluß Schillers selbst in den Wortformen, die er geprägt. Durch Schiller hat sich herausgebildet, was man in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutsche Bildung nennen kann: sie ist ganz wie durch Imponderabilien geformt durch das, was sich in das Gemüt einpflanzte von Schiller aus. Das, was von Herder und den anderen Klassikern ausging, ist durch die Bilder und didaktischen Wendungen Schillers in die Nation geflossen. Mochten auf der Höhe der ästhetischen Bildung sich einige auch sträuben, immer mehr hat Schiller sich eingebürgert. So wächst sein Einfluß fort und fort. Und wie der hundertjährige Geburtstag Schillers kommt, da sind es die Besten, die ihn feiern, die Besten der Nation. In einem Buch über Schiller sind die Reden gesammelt, die damals gehalten wurden. Und es waren bedeutende Männer, die jene Reden hielten: Jakob Grimm, Th. Vischer der große Ästhetiker, Karl Gutzkow, Ernst Curtius, Moriz Carriere und viele andere. Der Same war aufgegangen, den Schiller gesäet.
Und doch muß man sagen, daß die Sprache, die damals, 1859, gesprochen wurde, dem doch recht fremd gegenüberstand, was als etwas Neues in jener Zeit heraufkam. Die Betonung des Ideals im Jahre 1859 stimmt seltsam zu dem, was sonst in diesem Jahre ans Licht kam. Vier bedeutende Erscheinungen sind es vor allem, auf die ich hier hinweisen will: 1859 erschien Charles Darwins «Abstammung der Arten». Dann Fechners «Vorschule der Ästhetik». Fechner
hat einen großen Einfluß auf eine Strömung der Gegenwart gewonnen: er ist ausgegangen von Hegel, der selbst Schiller gegen die Romantiker in Schutz genommen hatte. Vischer, der aus der Goethe-Schillerzeit stammte, der eine idealistische Ästhetik vertrat, sieht sich in Widerspruch versetzt zu dem, was er selbst bisher bekannt hatte; er sieht diese Richtung abgelöst durch Fechner. Es ist dies eine Ästhetik von unten, während es früher eine Ästhetik von oben war, die man vertrat. Von unten, aus kleinen Symptomen, wollte man jetzt das Wesen des Schönen erkennen. Das dritte Werk, welches Raumverhältnisse behandelte, steht in einem gewissen Gegensatz zu Schillers Art. Hatte sich doch dieser in einem seiner Epigramme an die Astronomen so gewendet:
«Schwatzet mir nicht so viel von Nebelflecken und Sonnen.
Ist die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt?
Euer Gegenstand ist der erhabendste freilich im Raume,
Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht.»
Dieses dritte Werk war die von Kirchhoff und Bunsen gefundene «Spektralanalyse». Durch sie konnte die Sonne in ihren Bestandteilen erkannt werden, konnte eine Analyse der fernsten Nebeiflecken unternommen werden.
Das vierte Werk war: Karl Marx «Kritik der politischen Ökonomie». Es war ein sonderbarer Kontrast zwischen dem, was man damals bei der Schillerfeier entwickelte und dem, was jene Zeit wirklich heraufbrachte.
Es war ein eigentümlicher Standpunkt, den Schiller, und unsere Klassiker überhaupt, zur Weltkultur einnahmen. Man kann sich Raffael, Michelangelo nicht denken ohne den Zusammenhang mit ihrer Zeit, aus der sie geboren waren,
aus der heraus sie schufen. So ist die homerische Kunst im innigen Zusammenhang mit dem, was in allen lebte. Homer brauchte nur dem Form zu geben, was als Fühlen und Denken seine Zeitgenossen durchdrang. Ganz anders war es bei unseren Klassikern. Homer, von wem dichtete er? Von Griechen redete er zu Griechen. So waren noch Dante, noch Michelangelo, ja auch noch Shakespeare ganz hineingestellt in ihre Zeit. Anders war es bei unseren Klassikern. Lessing begeisterte sich für Winckelmann, aus seinen Darlegungen bildete er sich seine Kunstanschauungen. Auch ging Lessing zuruck auf Aristoteles. Schiller und Goethe studierten mit Lessing in Gläubigkeit Aristoteles. Daher kam ein so abgesondertes Schönheitsideal, eine so vom Leben der Zeit abgesonderte Kunst, besonders im späteren Lebensalter der Dichter. Denn die Jugenddramen Schillers, «Die Räuber», «Kabale und Liebe» sind ja noch verbunden mit dem eigenen Leben. Goethe hatte sich besonders in Italien entwickelt. Die Kunst war Selbstzweck geworden, abstrakt abgezogen vom wirklichen Leben. Gleichgültig gegenüber den Stoffen waren Goethe und Schiller geworden. So sehen wir, daß Schiller jetzt seine Stoffe überall sucht in der Welt. Er hat sich herausgehoben aus der ihn umgebenden Welt, hat sich auf eigene Füße gestellt. Nichts charakterisiert Schillers Einfluß so, als daß auf ihn die Romantik folgt, die alles Fremdländische assimiliert. Ubersetzungen aus allen Gebieten der Weltliteratur bilden ein Hauptverdienst der romantischen Schule.
Schillers Stellung zur Kunst bildet etwas, was auf sein Verhältnis zum 19. Jahrhundert entscheidend wirkt.
ACHTER VORTRAG, 5. März 1905
Was kann die Gegenwart von Schiller lernen?
Man darf nicht verkennen, daß das Verhältnis des Publikums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Schiller ein ganz anderes werden mußte als in der ersten; schon durch die Erscheinungen war das bedingt, die ich Ihnen angedeutet habe. Schiller stand zur Wahrheit so, daß er sagen konnte: «Durch das Morgenrot des Schönen trittst du in der Erkenntnis Land.» Ihm war die Wahrheit das Schöne. Das Kunstwerk sollte sein eine Gestaltung der Idee; der Idee, von der man sich das Weltall durchflutet dachte. Es war eine ideale Weltanschauung, eine feine, subtile, die nur erfassen kann, wer sich zu subtilen, geistigen Höhen aufzuschwingen vermag. Die Grundlage für Schillers Verständnis bedingt etwas, was bedeutende Anforderungen stellt.
Deshalb liegt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in der Schiller-Verehrung etwas weniger Intensives; durch die heraufkommende Naturwissenschaft war ein kühleres Verhältnis bedingt. Man sah nun das Wahre nur in dem, was sinnlich ist. Das hat Schiller nie getan. Die Ideale Schillers waren immer Wahrheit, aber Wahrheiten auf geistiger Grundlage. Was dazumal den Leuten im Gefühl saß, ist heute nicht mehr greifbare Wirklichkeit. Die Größe und Weite des geistigen Horizonts war es, aus der Schiller herausgewachsen ist: es ist die Welt Goethes, Lessings, Herders und Winckelmanns. Als die äußere Wirklichkeit drängte mit ihren derberen Anforderungen, gab es zwischen dem Schönen und Wahren keinen rechten Zusammenhang mehr. Auf Grundlage der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse konnte ein Ludwig Büchner eine rein materialistische
Weltanschauung konstruieren. Schiller aber ist nicht für ein materialistisches Zeitalter; es wird zur Phrase, wenn man sich in einem solchen auf seine Anschauungen beruft. So kam es, daß Schiller etwas in den Hintergrund trat. Goethe konnte für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts noch etwas sein, weil sich in ihm das Künstlerische abtrennen läßt von der Weltanschauung. Selbst bei Herman Grimm tönt alles aus in einen Panegyrikus auf Goethe, den Künstler. Zwar für den, der sich ganz genau mit Goethe beschäftigt, ist es fraglos, daß es auch bei ihm nicht angängig ist, ihn von seiner Weltanschauung zu trennen. Immerhin ist bei Goethe eine rein ästhetische Betrachtung möglich; bei Schiller ist ein solcher Standpunkt nicht möglich. Heute wird die Kunst betrachtet als etwas, was sich mit dem Gebiete der Phantasie beschäftigt. Darin liegt schon eine Ablehnung der Weltanschauung.
So hat sich eine Kluft gebildet zwischen dem Geiste der Zeit, in der Schiller lebte, und dem der unsrigen, aus der heraus es möglich war, daß ein neuer Schiller-Biograph, Otto Brahm, der aus der Scherer-Schule hervorgegangen ist, sein Buch mit den Worten beginnen konnte: «Ich war in meiner Jugend ein Schillerhasser.» Er hat sich erst nach und nach durch Gelehrsamkeit, durch Erkenntnis, zu einer Verehrung Schillers hindurchgerungen. Schiller hat gelehrte Biographen gefunden, aber das Fühlen der Zeit ist schon fremd geworden den eigentlich Schillerschen Aufgaben. Es kann nicht verstehen, wie man das, was man heute Erkenntnis nennt, in Einklang bringen kann mit dem, was Schiller vertritt. Wie schon gesagt, die Künstler einer früheren Zeit, ein Raffael, ein Michelangelo, sie sind herausgewachsen aus dem Leben ihrer Epoche. So war es nicht mehr nach Goethes Tode. Wir sehen, wie ein Künstler, wie Peter Cornelius, ganz aus dem Gedanken heraus schafft; er
stand nicht mehr in irgendeinem Zusammenhange mit der geistigen Substanz seiner Zeit. Er fühlte sich besonders in Berlin immer fremd; hingezogen zu dem Katholizismus, in dem er sein Kunstideal gegründet glaubte, stand er dem Leben seiner Zeit teilnahmslos gegenüber.
So wird die Kluft zwischen Leben und Kunst immer größer. Wie fremd steht daher Schiller in dem Leben des 19. Jahrhunderts. Wohl hat Jakob Minor dicke Bände über Schillers Jugend geschrieben, aber alles weist darauf hin, wie fremd geworden Schillers Anschauungen unserer Zeit sind. Was man heute als wahr erkennt, ist aus der naturwissenschaftlichen Weltanschauung herausgewachsen. So ist auch die Ästhetik aus einer idealistischen in eine realistische Richtung hineingekommen. Dieser Umschwung war ein so starker, daß sich Vischer nicht zu einer zweiten Auflage seiner «Ästhetik» entschließen konnte, die in idealistischem Sinne geschrieben war; jetzt war er irre geworden an dem, was er bisher vertreten. So fremd waren für führende Geister die Empfindungen der ersten Hälfte des Jahrhunderts geworden, daß ein solcher Mann sich in dieser Weise selbst kritisiert.
Nach dieser Entwickelung werden wir verstehen, wie Schiller in unserer Gegenwart steht. So war es möglich, daß ein Mann wie E. Du Bois-Reymond, der doch selbst ganz in Schillers Diktion wurzelte, in einer Rede über Goethes «Faust» sagen konnte, «Faust» sei eigentlich ein verfehltes Werk, von Rechts wegen müsse Faust Gretchen heiraten, bedeutende Erfindungen machen, und so ein nützliches Dasein führen - und so weiter. Alles, was den Faust ausmacht, verstand ein bedeutender Mann des 19. Jahrhunderts nicht mehr.
Diese Richtung war ausschlaggebend geworden. Keiner wagt ihr zu widersprechen, niemand wagt das Recht des
Idealen zu betonen. Selbst die Kunst nennt sich realistisch. Eine idealistische Deutung findet wenig Anklang bei dem Publikum. Ehrlich sind diejenigen, die gestehen, daß Schil1er ihnen nicht sympathisch ist. Daß das Schöne eine Ausprägung des Wahren sei, gilt nicht mehr. Das Wahre wird genannt, was mit Augen gesehen, mit Händen getastet werden kann. Das Alltägliche wird das Wahre genannt. So war es nicht für Schiller; ihm lag das Wahre in den großen, ideellen Gesetzen. Die Kunst war für ihn die Wiedergabe des im Wirklichen verborgenen Geistigen, nicht des Alltäglichen. Das Wahre, das Schiller suchte, wird heute weder von der Wissenschaft noch von der Kunst anerkannt; niemand versteht heute, was Schiller unter dem Wahren verstand. Deshalb dieser Gegensatz. Man versteht heute unter dem Wahren das, was Schiller das Sinnlich-Notdürftige nannte. In der Harmonie zwischen dem Geistigen und dem Sinnlich-Notwendigen sucht Schiller das Freiheitsideal. Was man heute das Künstlerische nennt, kann man nimmermehr im Sinne Schillers das Künstlerische nennen. Noch eine Kluft liegt zwischen den heutigen und Schillers Anschauungen. Unsere Zeit hat nicht mehr den tiefen intensiven Drang nach einem Eindringen in den inneren Kern der Welt. Dieser tiefe Ernst, der wie ein Duft über Schillers Anschauungen liegt, dieser tiefe Ernst ist nirgends mehr vorhanden.
So versucht unsere Zeit, große Geister von so grundsätzlicher Verschiedenheit wie Tolstoi und Nietzsche in ganz oberflächlicher Weise nebeneinander zu stellen. Der Materialismus ist zur Weltanschauung geworden, er ist ein Evangelium geworden, ein integrierender Bestandteil unserer Zeit. Besonders die großen Massen stehen auf rein materialistischer Grundlage, sie wollen keine andere Weltanschauung gelten lassen. Wahr gilt ihnen nur, was die Naturwissenschaft
erlaubt, wirklich zu nennen. Zu welchen Vorkommnissen das führt, dafür eine kleine Episode. Es war zum letztenmal, da eine idealistisch gefärbte, wenn auch pessimistische Weltanschauung auf die Welt wirkte: Eduard von Hartmanns «Philosophie des Unbewußten».
Die Schrift erfuhr zahlreiche Angriffe. So erschien auch eine scharfe Kritik unter dem Titel: «Das Unbewußte vom Standpunkte der Deszendenztheorie und des Darwinismus.» Das Buch trug keinen Verfassernamen. Von seiten der Naturwissenschafter wurde es als beste Widerlegung der Schrift E. von Hartmanns bezeichnet. Bei der zweiten Auflage nannte sich der Verfasser: er war E. von Hartmann selbst. Er hatte zeigen wollen, daß es leicht ist, sich zu dem materialistischen Standpunkt herunter zu schrauben, wenn man einen höheren erklommen hat. Die auf einem höheren Standpunkt stehen, können einen niedrigeren, die auf niederem nicht den höheren verstehen. Es ist durchaus so, daß derjenige, der auf idealistischem Standpunkte steht, ganz bereit ist, in gewisser Weise den materialistischen anzuerkennen. Derjenige, der auf dem Standpunkt Schillers steht, kann Büchner, kann die moderne Kunst in ihrer materialistischen Anschauung beurteilen, nicht aber kann umgekehrt der Materialist den Idealisten durchschauen.
Schiller war ein Gläubiger des Ideals. Ein tiefer Spruch von ihm lautet: «Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, die du mir nennst. - Und warum keine? - Aus Religion.»
Das ist das Große an ihm, daß sein ästhetisches Bekenntnis zugleich sein religiöses, daß sein künstlerisches Schaffen sein Kultus war. Daß so sein Ideal in ihm lebte, das ist ein Bestandteil seiner Größe. Und so fragen wir nicht: «Kann uns Schiller heute etwas sein?» Im Gegenteil, er muß uns wieder etwas werden, darum, weil wir verlernt haben, das
über das rein materielle Hinausgehende zu verstehen. Man wird dann eine Kunst wieder verstehen, welche die Geheimnisse des Daseins enthüllen will.
Aber auch ein neues Freiheitsideal werden wir durch ihn verstehen lernen. Heute hört man viel von Freiheit reden, frei von staatlichen, von ökonomischen Fesseln wünscht man zu sein. Schiller hat die Freiheit anders aufgefaßt. Wie wird der Mensch in sich selber frei? Wie wird er frei von seinen niedrigen Begierden, frei von dem Zwange der Logik und Vernunft? Schiller, der über den Staat und das Leben in der Gesellschaft geschrieben hat, kommt da zu einem neuen Ziele, zu einem Hinweis auf Zukunftsideale. Wenn man in unserer Zeit mit Recht fordern will, daß das Individuum sich frei entfalten könne, muß man die Harmonie im Sinne Schillers auffassen. Messen wir, was man heute verlangt, an dem was Schiller gefordert hat. Zwei Erscheinungen wollen wir ins Auge fassen: Max Stirner und Schiller. Was kann unähnlicher, entgegengesetzter erscheinen, als Stirners «Der Einzige und sein Eigentum» und Schillers «Asthetische Briefe». In der Zeit, als Schillers Einfluß in den Hintergrund trat, kam Stirners Einfluß herauf. Stirner, der unberücksichtigt geblieben war die ganze Zeit hindurch, wurde in den neunziger Jahren neu entdeckt, sein Werk bildete die Grundlage dessen, was als Individualismus herumschwirrt. Diese Empfindung unserer Zeit hat etwas Berechtigtes, muß aber, wie sie jetzt erscheint, als etwas Ungezügeltes erscheinen. In Schillers «Ästhetischen Briefen» wird die Forderung der Befreiung der menschlichen Persönlichkeit fast noch radikaler erhoben. Weniger spießbürgerlich als Stirner hat Schiller dieses Ideal aufgestellt. Das Ideal des Zusammenwirkens der Menschen, die innerlich frei geworden sind, tritt für andere Menschen als eine Mahnung auf. Gebote, Zwangsvorschriften, gibt es
nicht, wo Menschen so leben. Heute scheint man zu glauben, es müsse alles in Unordnung geraten, wenn die Menschen nicht von Polizeimaßregeln eingeengt sind. Und doch muß man sich klar sein: Unzähliges in der Weltgeschichte geht ohne Gesetze. Täglich kann man beobachten, wie ganz von selbst in den belebtesten Straßen die Menschen einander ausweichen, ohne daß eine Vorschrift darüber besteht. Achtundneunzig Prozent unseres Lebens gehen ohne Gesetze vor sich. Und es wird einst möglich sein, ganz ohne Gesetze, ohne Zwang auszukommen. Dazu aber muß der Mensch innerlich frei geworden sein.
Ein Ideal von unermeßlicher Größe ist es, das Schiller vor uns hinstellt. Die Kunst soll den Menschen zur Freiheit führen. Die Kunst, herausgewachsen aus der Kultursubstanz, soll zur großen Welterzieherin werden. Nicht Photographien der äußeren Welt sollten die Künstler liefern: sie sollten Boten sein einer höheren geistigen Wirklichkeit. Dann werden die Künstler wieder schaffen wie früher, aus dem Ideal heraus. Durch die Kunst hindurch zu einer neuen Erfassung der Wirklichkeit wollte Schiller leiten; er meinte es ernst damit.
Wenn unsere Zeit Schiller recht verstehen will, muß sie zusammenfassen, was sie errungen hat an Erkenntnissen, zu einem höheren Idealismus, der sie emporhebt zu der geistigen Wirklichkeit. Dann werden auch diejenigen kommen, die wieder aus der Tiefe ihres Herzens aus Schillers Geiste heraus sprechen können.
Wenig nützt es, zu Schillers Ehren die Theater zu öffnen, wenn die Leute, die darinnen sitzen, kein Verständnis für Schiller haben. Erst wenn wir uns so zum Verständnis Schillers erheben, werden auch Leute da sein, die, wie Herman Grimm über Goethe, so aus tiefstem Herzen über Schiller sprechen können.
NEUNTER VORTRAG, 25. März 1905
Schiller und der Idealismus (Ästhetik und Moral)
Ich möchte heute in der Schlußstunde eine spezielle Frage erledigen, die sich an den Vortrag über Schillers Wirkung auf die Gegenwart anreihen soll. Die Frage der deutschen Ästhetik kann uns hier interessieren, weil Schiller in enger Verbindung steht mit der Begründung der ästhetischen Wissenschaft. Ästhetik ist Wissenschaft des Schönen.
Wir haben gesehen, wie Schiller in verschiedenen Perioden seines Lebens sich zum Schönen stellt. Schiller sah in dem Schönen etwas, was einen ganz besonderen Kultur-wert hat. Inwiefern damit etwas ganz Besonderes getan war, zeigt uns die ästhetische Wissenschaft, wie wir sie heute haben, und die erst etwa hundertfünfzig Jahre alt ist. Freilich hat schon Aristoteles über Poetik geschrieben, aber durch Jahrhunderte blieben die Anschauungen darüber auf demselben Standpunkt stehen. Wir wissen, daß selbst Lessing häufig noch auf Aristoteles zurückgriff. Erst im 18. Jahrhundert, aus der Wolffschen Philosophie, ging Baumgarten hervor, der ein Buch über das Schöne, «Asthetica», 1750 schrieb. Er unterscheidet das Schöne vom Wahren dadurch, daß, wie er sagt, das Wahre eine klare Vorstellung enthält, während das Schöne unklare, verworrene Vorstellungen verkörpert. Es war noch nicht lange vor Schiller, daß solche Gedanken auftauchen konnten. Nun haben wir bei Kant selbst in der «Kritik der Urteilskraft» eine Art Ästhetik, aber bei ihm war alles nur Theorie; er hat nie einen lebendigen Begriff erhalten von dem, was Schönheit ist, er ist nicht über drei Meilen weit von seinem Geburtsort Königsberg hinweggekommen, hat kein bedeutendes
Kunstwerk gesehen; hat also nur vom Standpunkte abstrakter Philosophie geschrieben. Schiller war es, der dies Problem zuerst lebensvoll erfaßte in seinem Werk «Ästhetische Briefe».
Wie hat das Problem damals gestanden? Goethe blickte mit Wehmut auf Griechenland; so schaute auch Winckelmann sehnsüchtig in die Zeit zurück, in der der Mensch das Göttliche in seinen Kunstwerken nachbildete. Auch Schil1er litt in seiner zweiten Periode an dieser Sehnsucht. In den «Göttern Griechenlands» kommt dies zum Ausdruck. Was ist es im Grunde anderes als ein religiöser Zug, der der griechischen Dramatik zugrunde lag? Ihr liegt das Mysterium zugrunde, das Geheimnis des Gottes, der Mensch wird, der als Mensch leidet, stirbt und aufersteht. Man faßte als eine Läuterung des Menschen auf, was dabei durch die Seele zog. Selbst durch Aristoteles' Poetik zieht noch ein Hauch davon. Das Tragische sollte darin bestehen, wie Lessing sich ausdrückte, durch Vorführung von Handlungen, die Furcht und Mitleid erregen, die Reinigung von diesen Leidenschaften zu erstreben. Es war schwer zu verstehen, was damit gemeint sein sollte. Lessing selbst hat viel darüber nachgedacht. Im 19. Jahrhundert ist eine reiche Literatur darüber entstanden. Über das Wort Katharsis sind ganze Bibliotheken geschrieben worden. Es wurde deshalb nicht verstanden, weil man nicht wußte, woraus es hervorgegangen ist.
In dem Drama des Äschylos erkennt man noch etwas von dem Drama des Gottes. In der Mitte der Handlung steht Dionysos als die große dramatische Figur; der ihn umgebende Chor begleitet die Handlung. So hat Edouard Schuré das Mysteriendrama neu erstehen lassen. Die dramatische Kulthandlung hatte die ganz bestimmte Aufgabe, den Menschen auf eine höhere Stufe des Daseins zu führen.
Man sagte, der Mensch ist mit Leidenschaften behaftet; durch das niedere Leben gehört er ihnen an; er kann aber darüber hinauskommen, wenn das höhere, das in ihm lebt, geläutert wird; er kann sich herausheben durch die Anschauung des göttlichen Vorbildes. Diese Art der Darstellung sollte die Menschen leichter dazu bringen, sich zu veredeln, als dies durch Lehren erreicht wird. Denn wie Schopenhauer sagt: Moral läßt sich leicht predigen, aber es ist schwer, Moral zu begründen. - Es war eine spätere Epoche der Menschheit, als die Anschauung des Sokrates auftrat, daß die Tugend lehrbar sei. Sie ist aber etwas, was im Menschen lebt, was ihm natürlich ist wie das Essen und Trinken; er kann dazu geführt werden, wenn das Göttliche in ihm erweckt wird durch das Vorbild des leidenden Gottes. Diese Reinigung durch das göttliche Vorbild nennt man die «Katharsis». So sollte Furcht und Mitleid hervorgerufen werden. Das gewöhnliche Mitleid, das am Persönlichen hängt, soll zum großen unpersönlichen Mitleid erhoben werden, wenn man den Gott leiden sieht für die Menschheit.
Dann wurde die dramatische Handlung vermenschlicht, und im Mittelalter sehen wir, wie die Moral sich emanzipiert und selbständig auftritt. So wird später im Christentum einseitig ausgebildet, was im Mysterium leibhaftig lebte. Der Grieche sah mit eigenen Augen den Gott, der aufstieg aus der Erniedrigung. Es wurde in den Mysterien die Tugend nicht bloß gepredigt, sondern dem Menschen zur Anschauung gebracht.
Dies den Menschen wieder zum Verständnis zu bringen, diese beiden Dinge miteinander wieder zu vereinen, war etwas, was in Schiller ganz intensiv lebte. Der Nerv seiner Dichtungen war die Sehnsucht, diese beiden zu versöhnen: Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Die strenge Sittlichkeit ist
durch Kant so aufgefaßt worden, daß die Pflicht hinweggeführt hatte von allem, was als Neigung erschien. Schiller forderte dagegen, daß die Pflicht zur Neigung werde. So gereinigt wissen wollte Schiller die Leidenschaft, daß sie selbst als Pflicht erscheine. Deshalb verehrte er auch Goethe so, indem er bei ihm eine vollkommene Vereinigung von Sinnlichkeit und Sittlichkeit sah. Im Schönen suchte er diese Vereinigung von Sinnlichem und Sittlichem. Denn weil Schiller in besonderem Maße eine deutsche Eigenschaft hatte, das ästhetische Gewissen, wollte er, daß die Kunst dazu da sein sollte, um den Menschen zu höherem Dasein zu erheben. In unserer klassischen Zeit lebte ein starkes Gefühl dafür, daß das Schöne nicht zur Ausfüllung müßiger Stunden da sei, sondern daß es die Brücke sei zwischen dem Göttlichen und Sinnlichen. Und Schiller rang sich durch dazu, daß er die Freiheit hier fand. Die Neigung wird nicht mehr unterdrückt; er sagt, daß der Mensch noch niedrig stehe, der gegen seine Neigungen tugendhaft sein müsse. Nein, seine Neigungen müssen so ausgebildet sein, daß er von selbst tugendhaft handle. Früher, in der Schrift «Die Schaubühne als moralische Anstalt» hat er noch etwas Ähnliches wie die herbe kantische Moral gepredigt.
In der Besiegung des Stoffes durch die Form liegt das Geheimnis des Meisters. Was ist der Stoff der Dichtung überhaupt? In welcher Auffassung liegt der rechte Standpunkt zur Betrachtung des Schönen? - Solange ich mich interessiere für ein einzelnes besonderes Gesicht, habe ich nicht die wahre künstlerische Anschauung erworben; es ist noch ein Am-Stoffe-Hängen da. - «Das ‹Was› bedenke, mehr bedenke ‹wie›!» - Solange der Dichter noch zeigt, daß er den Bösewicht haßt, in der Art des persönlichen Interesses, hängt er noch am Stoffe, nicht an der Form, er ist noch nicht zu der ästhetischen Anschauung gekommen. Erst
dann ist er zu dieser Anschauung fortgeschritten, wenn der Bösewicht so hingestellt ist, daß die Naturordnung das Strafgericht vollzieht, nicht der Dichter selbst. Dann vollzieht sich das Weltenkarma, dann wird die Weltgeschichte zum Weltgericht. Der Dichter schaltet sich aus und betrachtet objektiv die Weltgeschichte. Damit vollzieht sich, was schon Aristoteles ausspricht, daß die Dichter wahrer sind als die Geschichte. In der Geschichte kann man nicht immer das ganze Geschehen überblicken; es ist ein Ausschnitt, der vor uns liegt, so daß wir oft den Eindruck des Ungerechten empfangen. Insofern ist daher das Kunstwerk wahrer als die Geschichte.
Damit war geschaffen eine reine edle Auffassung der Kunst; die Reinigung, Katharsis selbst, ist über Sympathie und Antipathie stehend. Mit reinem, beinah göttlichem Gefühl soll der Beschauer vor dem Kunstwerk stehen und so vor sich sehen ein objektives Abbild der Welt, sich einen Mikrokosmos schaffen. Der Dramatiker zeigt uns im engen Rahmen, wie sich Schuld und Sühne verketten, stellt im einzelnen dar, was Wahrheit ist, aber gibt dieser Wahrheit ein allgemein gültiges Gepräge. Goethe gibt dem Ausdruck, indem er das Schöne eine Manifestation der Naturgesetze nennt, die ohne das Schöne nie zum Ausdruck gelangten.
Goethe und Schiller wollten einen Realismus finden, aber einen idealistischen Realismus. Heute glaubt man, durch genaue Abbildung der Natur den Realismus zu finden. Schiller und Goethe würden gesagt haben: Das ist nicht die ganze Wahrheit; die sinnliche Natur stellt nur einen Teil dessen dar, was wahrnehmbar ist; es fehle das Geistige darinnen; nur dann könne man sie als Wahrheit gelten lassen, wenn man das ganze Naturtableau auf einmal in ein Werk hineinbrächte; die sinnliche Natur sei aber
doch immer nur ein Ausschnitt des Wirklichen. - Weil sie nach Wahrheit strebten, haben sie die unmittelbare Naturwahrheit nicht gelten lassen.
So bemühen sich Schiller und Goethe, in ihrer Zeit den Idealismus zu erwecken. Früher war dieser Idealismus vorhanden; in Dante finden wir dargestellt nicht die äußere Wirklichkeit, wie sie uns umgibt, sondern das, was sich in der menschlichen Seele vollzieht. Später wollte man das Geistige veräußerlicht vor sich sehen. Goethe hat im «Großkophta» dargestellt, wie der, welcher den Geist vermaterialisiert, Verirrungen ausgesetzt ist. Auch Schiller hat sich mit der Materialisation des Spirituellen beschäftigt. In der damaligen Zeit wurde nach dieser Richtung auch vieles gesucht. Vieles von dem, was heute als Spiritismus auftritt, beschäftigte damals weite Kreise. So entstand der tiefe «Geisterseher», eine Auseinandersetzung mit diesen Strömungen. Vor der Zeit als er durch den Kantianismus und das Künstlerische sich ,zu höheren Anschauungen durchgerungen hatte, schilderte Schiller die Gefahren, denen derjenige, der das Geistige in der äußeren Welt sucht, statt in sich selbst, ausgesetzt ist. So entsteht der «Geisterseher».
Ein Fürst, der seinem Glauben entfremdet ist und nicht die Kraft besitzt, in seiner eigenen Seele das Geistige zu erwecken, wird durch eine seltsame Prophezeiung, die ihm ein geheimnisvoller Fremder verkündet, und die bald darauf in Erfüllung geht, in eine heftige Aufregung versetzt. Er fällt in dieser Stimmung Gauklern in die Hände, die durch geschickte Ausnutzung gewisser Umstände ihn in die Seelenverfassung versetzen, die für eine Geistererscheinung empfänglich macht. Die Beschwörung geht vor sich, aber plötzlich tritt ein Fremder dazwischen, entlarvt den Beschwörer, läßt aber selbst nun eine Erscheinung an die Stelle jener des Betrügers treten, die eine wichtige Mitteilung
an den Prinzen macht. Der Prinz wird von Zweifeln hin und her geworfen, der Fremde ist derselbe, der ihm die Prophezeiung machte; aber bald vermutet der Zweifler, daß die beiden unter einer Decke steckten, da der erste Beschwörer zwar verhaftet wird, aber bald verschwindet. Neue, unerklärliche Vorfälle bringen ihn zu einem Streben nach der Lösung all des Geheimnisvollen; er gerät dabei vollständig in Abhängigkeit von einer geheimen Gesellschaft; er verliert aber allen sittlichen Halt. Der Roman ist nicht vollendet worden, aber in erschütternder Weise erscheint hier das Ringen eines Geistersuchers dargestellt; wir sehen, wie die Sehnsucht nach dem Geistigen den Menschen herunterführt, wenn er es im Äußeren sucht. Nicht derjenige, der an dem Sinnlichen hängt, auch nicht in der Weise, daß er verlangt, das Geistige als Sinnliches erscheinen zu sehen, kann zum Geistigen vordringen. Das Geistige soll sich in der Seele des Menschen enthüllen.
Das ist das wahre Geheimnis des Geistigen. Darum sieht es der Künstler zuerst als Schönheit. Das Schöne dann, besiegt und durchdrungen vom Geiste, wird wirklich im Kunstwerk. So ist das Schöne das würdige Material des Geistigen. Zunächst war für Schiller das Schöne das einzige, wodurch sich das Geistige offenbaren kann. Mit Wehmut blickte er zurück auf die Griechenzeit, wo die Möglichkeit zu einer anderen Erweckung des Geistigen vorhanden war. Der Mensch hatte sich zu dem Gott erhoben, indem er ihn herabholte, ihn Mensch werden und sich durch ihn erheben ließ. Jetzt sollte der Mensch sich wieder zum Göttlichen erheben durch Besiegung des Stofflichen. So hat Schiller in seinen Dramen zu immer Höherem gestrebt, bis das Physische immer mehr von ihm abfiel, bis das: «Weit hinter ihm in wesenlosem Scheine / lag, was uns alle bändigt, das Gemeine», das ihm Goethe nachrief, volle Wahrheit
bei ihm geworden war. Nicht in verächtlichem, niederem Sinn hat hier Goethe dieses Wort «gemein» gebraucht; das allgemein Menschliche, die gewöhnliche Art des Menschen ist hier gemeint, über die sich Schiller erhoben hatte. So hat Schiller als ein echter Geisterseher sich emporgehoben zur Anschauung des Geistigen.
Er soll als ein Vorbild vor uns stehen. Nur das sollte der Zweck dieser Vorträge sein, soweit dies in so wenigen Stunden möglich war, diese ringende Seele Schillers zu verfolgen, wie sie sich emporhebt zu immer erhöhter geistiger Anschauung, das Geistige zu erfassen suchend, um es einzuprägen in das Sinnliche. In diesem Ringen erkennt man Schiller, indem sich bei ihm persönlich wahrhaft Goethes Wort erfüllt:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß.
So hat sich Schiller emporgerungen zum Meister der ästhetischen, geisterfüllten Form.
III ANHANG
Diskussionen und Vorträge Rudolf Steiners im «Giordano Bruno-Bund für einheitliche Weltanschauung» im Jahre 1902
Referate von Mitgliedern des Giordano Bruno-Bundes in der Zeitschrift «Der Freidenker»
«.... Eine zweite Begründung war der Giordano Bruno-Bund. Es sollten sich in demselben solche Persönlichkeiten zusammenfinden, die einer geistig-monistischen Weltanschauung sympathisch gegenüberstanden. Es kam dabei auf die Betonung dessen an, daß es nicht zwei Weltprinzipien, Stoff und Geist, gebe, sondern daß der Geist als Einheitsprinzip alles Sein bilde.»
Rudolf Steiner, «Mein Lebensgang»
DIE EINHEIT DER WELT
Berlin, im März 1902
Diskussion im «Giordano Bruno-Bund für einheitliche Weltanschauung» mit Votum Rudolf Steiners
Der Bruno-Bund hat den Zweck, einheitliche Weltanschauung zu fördern. Diese gilt ihm nicht als eine endgültig vollbrachte Leistung, sondern als eine Aufgabe, an deren Lösung er forschend und belehrend, organisierend und anregend mitzuwirken sucht. Dabei kommt es ihm besonders darauf an, die verschiedenen Standpunkte zur Verständigung und womöglich zu einigem Ausgleich zu bringen. Auch insofern bemüht er sich um Einigung, als er Naturwissenschaft, Philosophie, Kunst und Andacht harmonisch zusammenschließen möchte. Ms eines der Mittel zu diesem Zwecke betrachtet der Bund neben größeren öffentlichen Vorträgen auch die Diskussion über Fragen der Weltanschauung im engeren Kreis sowie die Veröffentlichung solcher Bundesverhandlungen durch den Druck.
Der erste Versuch, planmäßig über einheitliche Weltanschauung zu verhandeln, fand im März 1902 statt. Zur Diskussion stand das Thema: «Was bedeutet einheitliche Weltanschauung ihrem Begriffe und Werte nach?» Das einleitende Referat hatte der neue Schriftführer des Bundes, Herr Dr. Hermann Friedmann, übernommen, wegen Erkrankung jedoch einstweilen nicht halten können. Für ihn war freundlichst Herr Wolfgang Kirchbach eingesprungen, um seine eigenen Anschauungen improvisiert darzulegen. Nachdem der Bundesvorsitzende Dr. Bruno Wille auf den Zweck der Diskussionsabende hingewiesen hatte, sprach Fräulein Maria Holgers das ergreifende Gedicht von Hölderlin «An die Natur». Alsdann nahm Wolfgang Kirchbach das Wort:
«Der Herr Vorsitzende hat soeben betont, es sei eine ebenso schwierige als reizvolle und bedeutende Aufgabe, monistische Weltanschauung zu begründen und ihr nachzustreben. Deshalb werde ich gleich heute bei unserer ersten Diskussion versuchen, Ihnen die ganze Schwierigkeit des Problems darzustellen, vor
dem wir stehen. Dieser Hinweis auf die Schwierigkeit unserer Aufgabe soll aber nur ein rein akademischer sein.
Formuliert ist der Satz, über den ich zu sprechen habe: Was bedeutet uns, oder vielmehr mir, ihrem Begriffe und Werte nach? Ich will Ihnen in Kürze das Problem, wie es mich berührt, vorführen. Für diejenigen, denen es noch unbekannt sein sollte, betone ich, daß das Wort hier nur eine Übersetzung des Wortes ist, welches die Verarbeitung aller Begriffs- und sonstigen Erkenntnis zu einer Weltanschauung vom Einheits-Wesen, vom Dasein der Welt in einer Einheit ausdrückt. Das Wort EinheitsWeltanschauung würde den Sinn wohl treffender bezeichnen.
Wir können aber, wenn wir eine Einheits-Weltanschauung begründen, uns auch die Frage nicht versagen nach dem Wert einer solchen, nach den Gebieten, in denen sie von Wert sei und in die sie zerfalle.
Auf dem Gebiete des , wie man populärerweise die Natur in ihrer Gesetzmäßigkeit nennt, die Einheit aller Erscheinungen zu suchen, würde die eine Seite eines einheitlichen Forschens und Denkens sein. Die Naturwissenschaft, wie sie augenblicklich liegt, gibt aber demjenigen, der tiefer in sie eingedrungen ist, zur Zeit noch kein Recht, objektiv von einer Einheit im Kosmos zu reden. Wir sind populärerweise gewöhnt, dieses Weltganze, quantitativ dargestellt, als Materie und in Verbindung damit den Begriff Kraft zu denken. Der Dualismus, der dieser Begriffsverbindung anhängt, hat zu Versuchen geführt, ihn in eine Einheit aufzulösen. Man sagte, Kraft ist eine Funktion, eine Äußerung der Materie und hatte so eine gewisse Einheit gewonnen, indem man sich die Materie als etwas Wesenhaft-Eines vorstellte. Auf eine ganz andere Weise hat die tatsächliche Naturwissenschaft den Begriff Materie ausgebildet. Mit Hilfe ihrer analytischen Methoden hat sie immer mehr Elemente aus dem umgebenden Kosmos herausgelöst und hat so durch empirische Arbeit an Stelle einer monistischen Materie etwa siebzig verschiedene Elemente, das heißt Materien gefunden. So hat der Begriff nur noch den Wert einer sprachlichen Abstraktion wie der Begriff. Es entspricht ihm kein reales Einzelwesen, sondern die Einheit dieser siebzig Elemente ist vorderhand nur eine Hypothese.
Dasselbe finden wir in betreff des Begriffs Kraft seit Robert
Mayers Entdeckung von der Einheit der Kraft und der Umwandlungsfähigkeit der Energie. Sie stehen vor dem ungeheuren Rätsel, daß die mechanische Kraft und vielleicht dieselbe Kraft, die den Erdball und die Sonne in dauernde Beziehung setzt und die Umdrehung der Gestirne bewirkt, daß vielleicht dieselbe Kraft, umgesetzt und verwandelt, jene Erscheinungen darstellt, welche uns zum Beispiel ein Gewitter vorführt. Aber die Tatsache bleibt bestehen, daß diese Erscheinung der Elektrizität doch anders sich äußert als etwa die Kraft, die einen Stein nach dem Mittelpunkt der Erde treibt. So hat denn die Wissenschaft noch nicht dargelegt, daß man eine Einheit der Natur in dem Sinne annehmen müsse, als seien die verschiedenen Energieformen eins. Die unterschiedlichen Phänomene sind eben noch nicht überbrückt; wir stehen auch hier erst vor Hypothesen.
Dasselbe gilt von einer ganzen Reihe anderer Erscheinungen. So weiß man zum Beispiel nicht, wo man den höheren Lebensbegriff des Organischen von dem Begriff des Unorganischen abgrenzen soll. Die gesamte Naturerklärung ist darüber in einem lebhaften Streit begriffen.
Da wir bei dieser 5eite der Wekanschauung anknüpfen müssen an das Material, das uns die Naturwissenschaft liefert, müssen wir somit wohl zugeben: Objektiv ist die Einheit des Universums noch nicht als Tatsache nachgewiesen.
Wie aber steht es mit der anderen Frage, die bei unserer Gesamtfrage nach einer einheitlichen Weltanschauung zu behandeln ist? Es ist die Frage: Wie verhält sich unser eigenes, auf Einheit ausgehendes Denken zu seinem Objekt, der Welt? Hier stehen wir vor einem scheinbaren Dualismus. Wir sehen: da ist etwas außen, und hier ist etwas, was dieses Außen in sich aufnimmt. Da haben wir zunächst eine Zweiheit. Wir fragen nun aber: Wie weit können und dürfen wir annehmen, daß die Funktionen unseres Gehirns, die Aussageformen, Kategorien unseres Geistes eine Einheit bilden mit der Welt? Die Tatsache, daß Sie alle Funktionen Ihres Geistes auf eine Einheit beziehen, könnte allenfalls daraus abgeleitet werden, daß Sie sie gemeinsam in Ihrem Körper lokalisieren. Zunächst ist die Tätigkeit, die Sie vollbringen, wenn Sie nach der Ursache forschen, die einen Stein dazu bringt, nach der Erde zu fallen, eine ganz andere, als wenn Sie fragen: Ist es unter den jetzt gegebenen Bedingungen möglich, daß dieser Fall eintritt? Es könnte ja sein, daß die von den verschiedenen Geistestätigkeiten
gelieferten Vorstellungen miteinander in Widerstreit treten und somit schon in Ihrem Inneren keine Einheit bestände. Eine weitere Frage wäre, wie das einheitliche Bild der Welt, das Sie in sich tragen, übereinstimmt mit der objektiven Wirklichkeit. Wie weit wirken die Gesetze, die in meinem Geiste walten, auch in der äußeren Welt? Wir werden dabei zunächst dualistisch denken müssen. Diesen Dualismus in einen Monismus aufzulösen, ist allerdings ein höchster Trieb im Denken selbst; aber die Erkenntnistheorie steht hier vor einem großen Problem. Die Beschäftigung mit ihm ist seit Kant Pflicht für jeden, der sich mit Fragen der Weltanschauung beschäftigt.
Wir haben also beim Aufbau einer einheitlichen Weltanschauung zwei Operationen zu vollziehen, einmal auf empirischem Wege die unendliche Vielheit der Welt bis in ihre kleinsten Differenziertingen zu verfolgen, und anderseits dabei immer unser Denken in erkenntnistheoretischem Sinne zu einem Monismus, zur Zusammenfassung jener Vielheit zur Einheit zu bilden.
Bei der Bearbeitung des Materials in dieser Richtung würden uns bald nicht mindergewichtige Schwierigkeiten aufstoßen auf ethischem Gebiet. Es würde bald die Frage vor uns entstehen, wieweit können wir das sittliche Leben im Menschen selbst und die Vorgänge im Kosmos unter dem Gesichtspunkte einheitlicher sittlicher Gesetze beurteilen Denn wir können keinen Vorgang dieser Welt auf uns wirken lassen, ohne ihn zugleich ethisch zu verarbeiten. Die Freude am Kosmos, die Betrachtung der Harmonie in der unendlichen Vielheit ist zugleich eine sittliche Auseinandersetzung. Es würde sich also fragen: Können wir zu einem Monismus im ethischen Denken selbst kommen und ihn mit der übrigen monistischen Betrachtung verbinden? - Damit tritt zu gleich die Frage an uns: Könnte unser sittliches Gefühl nicht auch durch eine anderweitige Betrachtung Befriedigung finden? Weshalb hält zum Beispiel der kirchlich denkende Christ seine Lehre, die nur einen Gott kennt, für so etwas unendlich Höheres gegenüber dem Heidentum, das mehrere Gottheiten hat? Und wie ist der Christ gleichwohl zu einem Dualismus, ja zur Annahme einer noch größeren Vielheit in der übernatürlichen Welt gekommen?
Ergäben die wissenschaftlichen Betrachtungen den Beweis für einen Dualismus, so müßten wir uns damit befriedigt erklären. Einen Monismus zu etablieren, nur um monistisch zu sein, wäre wertlos. Aber wir haben im Geiste ein Monon, ein Wesen der
Dinge selbst, nach dem wir den Wert aller unserer Anschauungen messen können: das Wahre, die Wahrheit. Es gibt für jede einzelne Wissenschaft, für jedes Erkennen nur die eine dauernde Bewertung, daß ihre Aussagen wahr sind, das heißt, mit den objektiven Vorgängen übereinstimmen. Auch für eine Weltanschauung kann nur diese Wertung zutreffend sein. Nur wenn eine monistische Erklärungsweise in allen objektiven Verhältnissen wie in unserem subjektiven Wirken, in allen Manifestationen der Verschiedenartigkeit des Lebens sich als wahr bewährte, wäre sie wertvoll; nichts anderes könnte ich als Kriterium des Wertes dieser Weltanschauung ansehen. Dieses Monon der Wahrheit, die nie unwahr werden kann, ist bis jetzt die einzig erkennbare ewige Einheit, zu der die objektiven Erscheinungen in ihrer Vielheit und Vergänglichkeit mit dem Geiste zusammenwirken.»
Nach diesen Worten Kirchbachs erhob sich Herr Dr. Rudolf Steiner zu folgenden Ausführungen:
«Ich möchte mich streng an die Frage halten: Was bedeutet einheitliche Weltanschauung ihrem Begriffe und Werte nach? Ich stehe dabei in geradem Gegensatz zu meinem Herrn Vorredner. Wenn ich mir die Frage vorlege: Sind wir vom Standpunkt unserer modernen Natur- und Geisteswissenschaft berechtigt, die Welt für eine Einheit zu halten, so muß ich sagen, wir sind es, wir sind jedenfalls in die Notwendigkeit versetzt, danach zu suchen. Gegenüber der Mannigfaltigkeit, in die uns ohne Zweifel die Spezialisierung der Wissenschaften geführt hat, frage ich: Worin haben wir die Einheit zu suchen? Von vornherein zu sagen, dieses oder jenes müsse als Einheit vorerst nachgewiesen werden, erscheint mir als übertriebene Forderung einer extremen Erkenntnistheorie. Für mich ist das Streben nach einheitlicher Weltanschauung schon darin berechtigt, daß es einfach ein unauslöschliches Bedürfnis des menschlichen Geistes ist, das zu allen Zeiten vorhanden war, deutlicher vielleicht in den vorchristlichen Zeiten, als es noch nicht zurückgedrängt war von den Dogmen und Anschauungen
der Kirche, gegen die anzukämpfen vor allem die Pflicht eines Bundes ist, der an Giordano Bruno anknüpfen will.
Jndessen finde ich, daß auch die Ergebnisse der Naturwissenschaften diesem Bedürfnisse entgegenkommen. Zwar hat die Chemie siebzig Elemente gefunden und wird diese Mannigfaltigkeit vielleicht noch vermehren; zugleich aber etwas ganz Besonderes dazu: Zwischen diesen Elementen hat sie zum Beispiel hinsichtlich des Atomgewichtes bestimmte Verhältnisse gefunden, nach denen sich eine Skala der Elemente aufbauen läßt, die zugleich eine Gliederung dieser Elemente nach ihren akustischen, optischen und anderen physischen Eigenschaften ist. Man hat aus einem Zwischenraum in dieser Skala auf fehlende Elemente geschlossen, ihre Eigenschaften zum Teil vorhergesagt und sie hinterher tatsächlich entdeckt. So stellen die phänomenal allerdings verschiedenen Elemente dennoch eine große Einheit dar, die wir mit der Rechnung verfolgen können.
Allerdings ist der Chemiker gezwungen, die Einheit anderswo zu suchen als in dem brutalen Begriff einer wesenseinheitlichen Materie, nämlich in einem System gesetzmäßiger Beziehungen. Professor Ostwald hat sich auf einem Naturforscherkongreß in dieser Richtung ausgesprochen. Auch ist neuerdings eine Zeitschrift gegründet worden zur Weiterbildung des veralteten Materialismus in diesem neuen naturphilosophischen Sinne. So stehen wir denn vor einem neuen Weltbild, das wir zwar noch nicht abschließen können, zu dem uns aber eine Perspektive eröffnet ist, und zwar eine Perspektive zur Einheit.
So steht es auch mit der Einheitlichkeit der Kraft. Dem Phänomene nach werden wir Elektrizität wohl niemals zurückführen können auf reine Gravitation, aber in der mathematischen Formel, nach der wir sie berechnen und umrechnen, haben wir etwas Reales, Grundlegendes; und somit
ist uns auch zur Einheit der Kraft eine Perspektive eröffnet.
Ohne mich genau auf den Standpunkt von Goethes Metamorphosenlehre stellen zu wollen, der auf organischem Gebiete zum ersten Male ein Einheitsprinzip suchte, meine ich doch, daß auch sie einen bedeutenden Schritt zur einheitlichen Weltanschauung darstellt. Hinzu kommt das biogenetische Grundgesetz, wonach jedes Wesen bei seinem embryonalen Bildungsgange die Formen der Wesensarten noch einmal durchläuft, von denen es abstammt. Seitdem es vollends gelungen ist, organische Stoffe im Laboratorium herzustellen, ist uns auch hier eine freie Aussicht auf Einheit geboten.
Wenn man nicht die Einheit geradezu im Phänomenalen verlangen will, so zeigt uns diese Perspektive, wo wir das Monon zu suchen haben. Und immer deutlicher enthüllt sich, was für alle großen Philosophen keinen Zweifel hatte:
Daß das, was wir in der Außenwelt erleben, sich als gleichbedeutend darstellt mit dem, was wir im Geiste erfahren. Wenn wir von der äußeren zur inneren Erfahrung fortschreiten, werden wir ein einheitliches Weltbild zustande bringen. Für einen nach Einheit Suchenden sind die letzten Jahrzehnte der Wissenschaft recht trostreich, denn aus allen Gebieten strömen ihm Elemente zu, die ihm einheitliche Weltanschauung eröffnen.
Ihr Wert besteht darin, daß sie einem geistigen Bedürfnisse genügt, das ebenso notwendig wie Luft und Licht zum Glück eines Geistes gehört, der dieses Bedürfnis in sich ausbildet.»
Herr Kirchbach replizierte in folgendem Sinne: «Zu der Frage: Wie kommen wir zu einheitlicher Weltanschauung und wie stellen wir sie uns vor? - hat Herr Dr. Steiner viele Anregungen gegeben, mit denen ich durchaus einverstanden bin. Doch kann
man in einzelnen Punkten streiten. So ist die vom Herrn Vorredner erwähnte Lehre Goethes von der Metamorphose der Pflanzen ein Beispiel dafür, wie selbst ein so großer Geist glauben konnte, eine Einheitssache gefunden zu haben in einem Punkt, der sich später als fraglich darstellte. Goethe glaubte, im Chlorophyllblatt walte dasselbe morphologische Prinzip wie im Stengel, und er sah das Prinzip der Blätter in der Gestalt der Blumenblätter und in dem Pistille wiederkehren, so daß ihm alle Teile der Pflanze nur Modifikationen eines und desselben morphologischen Gestaltungsprinzips waren. Dagegen ist es Tatsache, daß bei der Rose das Stengelblatt nur einen mittleren Kanal hat, während das Blütenblatt deren drei besitzt, also besteht doch ein fundamentaler Unterschied im morphologischen Aufbau der Rose, ebenso wie ein chemischer zugrunde liegt.
Die neuere Zellentheorie sucht ja auch die Einheit auf einem ganz anderen Gebiete als in dieser Scheinmorphologie. Hier ist die Zelle das Bildungsprinzip und bringt den Gesamtaufbau durch die Summe aller Faktoren hervor, denen sie unterworfen ist. Vielleicht wird es ähnlich gehen mit manchen Begriffen des Darwinismus.
Ich habe das Beispiel herangezogen, um zu zeigen, wie schwierig das Suchen einer Einheit selbst auf natürlichem Gebiet ist, weil wir erst die Phänomene richtig der bloßen Anschauung nach gruppieren lernen müssen, ehe wir auf ihre Wesens-Einheit durch mathematische oder sonstige logische Vermittlung schließen dürfen.»
Dr. Bruno Wille: «Sie haben soeben zwei Vertreter von Weltanschauungen gehört, die, wie ich meine, abgesehen von einzelnen Differenzpunkten, in den Grundzügen doch übereinstimmen. Es ist zunächst auf gewisse Schwierigkeiten hingewiesen worden, die der Ausbildung einer einheitlichen Weltanschauung scheinbar im Wege stehen. Allerdings erleben wir die Natur zunächst als eine Vielheit, als eine ungeheure Menge von verschiedenen Empfindungen. Erst wenn wir diese Mannigfaltigkeit im Einheit suchenden Geiste vergleichen und die Unterschiede teils überbrücken, teils auflösen, können wir einer einheitlichen Weltanschauung näherkommen.
Solche Einheit zu suchen ist in der Tat, wie Dr. Steiner sagt, ein allgemein menschliches Bedürfnis; zunächst ein logisches Bedürfnis. Unser Erkenntnisapparat, der die Welt begreifen möchte, hat
die Tendenz, alles Vielfache zur Einheit zusammenzudenken. So sehen wir an den Bäumen unserer märkischen Wälder trotz aller Verschiedenheit eine gewisse Gemeinsamkeit und schließen sie zum Beispiel in dem Begriffe zu einer Einheit zusammen. Die Kiefern wiederum ordnen wir mit den Birken, Eichen und Espen, mit den Heidelbeeren, Farnen und Moosen zu einer noch höheren Einheit, zum Begriffe zusammen. Vergleichen wir eine Pflanze mit uns selbst, so ist hier wieder eine Einheit vorhanden; wir haben es mit organischen Lebewesen zu tun. So ist unser Denken beständig auf der Suche nach übergeordneten Zusammenschlüssen und Zusammenhängen. Hier entsteht nun freilich die bedeutsame Frage der Erkenntnistheorie: Entspricht unserem Denken die von uns unabhängige Welt? Ist die Einheit der Natur mehr als ein bloß subjektives, intellektuales Erlebnis? Die Antwort ist höchst verwickelt. Heute begnüge ich mich mit einem einfachen , indem ich noch bemerke: Ich suche den Monismus auch darin, daß ich, anders wie Kant, Subjekt und Objekt, Geist und Natur als eine untrennbare Einheit auffasse und wie die mittelalterlichen im Begriffe eine wirkliche, nicht bloß namentliche Identität sehe.
Auch für unser sittliches Streben kann der Zweifel über das sittlich Wahre, das Rechte und Heilsame nur beseitigt werden, wenn wir aus einer höchsten Einheit heraus die einzelnen sittlichen Ideen ableiten können. Gäbe es zwei oder mehrere Weltprinzipien, die in absolutem Gegensatz ständen, so würden sich auch widerspruchsvolle Grundsätze für unser sittliches Leben daraus ableiten lassen; und überhaupt auf allen Gebieten unseres Lebens gerieten wir in heillose Widersprüche. Also unser ganzer Idealismus weist uns auf den Monismus hin, auf das Suchen nach dem ewig Einen.
Worin wir das Eine in der mannigfaltig erscheinenden Welt zu suchen haben, darüber gibt die Naturwissenschaft freilich noch nicht klipp und klar Antwort; aber die großartig entfaltete Naturwissenschaft des vorigen Jahrhunderts war, wie Dr. Steiner sehr richtig betonte, so fruchtbar auch für die Sache der einheitlichen Weltanschauung, daß der monistische Philosoph nicht unterlassen darf, den vollen Nutzen aus diesen Früchten zu ziehen. Allerdings sollte ebensowenig der Naturforscher verächtlich auf die jahrtausendalte Arbeit der Philosophie blicken, vielmehr die von philosophischer Seite erhobenen Zweifel ernst nehmen und zu
beantworten suchen. Es freut mich, daß Herr Dr. Steiner anerkannt hat, der alte Materialismus sei unhaltbar geworden. Diese Einsicht ist eine Frucht der philosophischen Kritik. Und so gehören Philosophie und Naturwissenschaft zusammen als Betrachtungsweisen, die einander ergänzen.
Zur Ergänzung der naturwissenschaftlichen Tatsachen, in denen Herr Dr. Steiner mit Recht wichtige Momente des Monismus erblickt, möchte ich noch auf folgende Seiten meiner einheitlichen Weltanschauung hinweisen. Ich möchte vor allem betonen, daß wir ein umfassendes Naturgesetz in sämtlichen Weltvorgän-gen und Erscheinungen vorfinden, für das wir noch niemals eine Ausnahme haben feststellen können: das Gesetz der Kausalität. Es ist eine Tatsache, daß jeder Vorgang denknotwendig aus einem anderen folgt, den wir die Ursache des folgenden nennen können. Ich meine nun, Ursache und Wirkung bedeutet in dieser Verbindung nichts als das, was wir Entwicklung nennen. Das Hervorgehen der Wirkung aus dem System ihrer Bedingungen können wir nämlich als die Fortentwicklung der Ursache auffassen. Das Gesetz der Kausalität also durchzieht sämtliche Weltvorgänge, für die wir wiederum besondere Regeln, die speziellen Naturgesetze feststellen können. Nach solchen schließt sich für uns die Welt zur Einheit zusammen, im Gegensatz zu der dualistischen Weltanschauung, die Wunder, also Ausnahmen von den Naturgesetzen zugesteht, die sie ohne , das heißt ohne Geständnis der menschlichen Unwissenheit, nicht plausibel machen kann.
Eine weitere Einheit der Welt finde ich in der Tatsache, daß alles, was ich vom Universum kenne, ein Erlebnis ist, entweder ein Erlebnis für mich oder ein Erlebnis für andere Wesen, sowie ein Selbsterlebnis. Wenn man darunter nicht nur das Ideenerlebnis versteht, womit man sich der idealistischen Anschauung nähern würde, die eben nur die Idee als das Reale der Welt betrachtet, so meine ich, können wir uns alle auf diesen Satz einigen; denn niemand würde wohl nachweisen können, es gebe ein Dasein, das nicht Erlebnis wäre. In diesem Grundsatze meiner Weltanschauung habe ich den Ausgleich bedeutender Gegensätze gewonnen, die jedem einseitig materialistischen oder mechanistischen Monismus bedenklich werden. So habe ich den Gegensatz von Materie und Geist überwunden, die ich einige, indem ich alles Physische als Erlebnis auffasse, freilich nicht etwa als bloßes Phänomen für
unsere Sinne, sondern als eine Art, in der sich das ewig Eine erlebt. - Überhaupt leugnet mein Monismus alle absoluten Gegensätze. Der Tod bedeutet für mich eine andere Seite des Lebens. Das Entstehen des Organischen aus dem Unorganischen kann ich mir nur vorstellen, wenn kein absoluter Gegensatz zwischen beiden Naturreichen besteht. Im sittlichen Leben betrachte ich das Böse nur als eine unreife Form, eine niedere Stufe des Guten; also kein absolut, nur ein relativ Böses lasse ich gelten. So ist auch der Irrtum nur eine unreife Wahrheit, eine bestimmte Entwicklungsstufe auf dem Wege zur Erkenntnis.
Ich suche einheitliche Weltanschauung, wie Sie sehen, auch in der Weise, daß ich eine subjektive Einheit, eine Einheit zwischen meinen verschiedenen geistigen Bestrebungen, meinen mannigfaltigen Erlebnissen und Persönlichkeitskräften erstrebe. Uberwunden ist für mich der Gegensatz zwischen Kopf und Herz, Gemüt und Verstand, zwischen wahrer Religiosität und wissenschaftlicher Erkenntnis, wie auch die Meinung, daß die Kunst nur eine Illusion, eine holde Täuschung sei, die der kühlen Einsicht im Wege stehe. So habe ich denn schon bei der Gründung unseres Bundes betont, man solle bei der Pflege einheitlicher Weltanschauung den Menschen anleiten, in seinem Innenleben die zerreißenden Feindseligkeiten zur Harmonie zu gestalten - zu einer Versöhnung; nicht freilich zu einer Versöhnungsduselei, sondern zur klaren Einheit seiner höchsten Geistesbetätigungen.»
Wolfgang Kirchbach: «Zum Beschluß dieser Diskussion möchte ich Sie bitten, die Unterhaltung, die zwischen den drei Herren geführt worden ist, zu betrachten als die Vorrede zu den Diskussionen, die weiter folgen. Bei den bevorstehenden Unterredungen werden wir vielleicht davon absehen, sie in dieser allgemeinen Weise weiterzuführen. Es sind Linien beschrieben worden, an denen ein innerer Konsensus verfolgt werden kann. Wir wollen in den nächsten Diskussionen konkrete Fragen herausnehmen. Alle Redner sind ja darin einig, eine einheitliche Weltanschauung sei ein unabweisbares Bedürfnis. So hätten wir denn hauptsächlich nur die Aufgabe, festzustellen, wie weit diese Bestrebungen gekommen sind, und hätten die Frage auf bestimmte Punkte zu beschränken. Ich möchte darüber noch keine näheren Angaben machen und so den Roman mit einem für heute beschließen, damit Sie begierig sind: heute beschließen, damit Sie begierig sind: ‹Wie wird das weitergehen›?»
WAHRHEIT UND WISSENSCHAFT
Berlin, 7. Mai 1902
Einleitendes Referat Rudolf Steiners: «Vor welchem Forum kann über (‹einheitliche Weltanschauung› entschieden werden? - Versuch einer Antwort auf die Frage nach ‹Wahrheit und Wissenschaft›»; anschließend Diskussion.
Dr. Rudolf Steiner, als Referent: Angeregt worden bin ich zu unserer Fragestellung «Vor welchem Forum muß einheitliche Weltanschauung entschieden werden» einmal durch die früheren Diskussionen unseres Bundes, der ja monistische Weltanschauung pflegen will, und auch durch meine persönliche Beteiligung an dem Streit um Haeckels «Welträtsel». Hier im Bunde wurden oft die Fragen erwogen: Was ist das Wesen einer einheitlichen Weltanschauung, worin besteht ihr Wert, haben wir eigentlich das Recht, von einer speziell monistischen zu sprechen? Es wurde einmal betont, daß wir nach dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft kein Recht haben, von einer Einheit in stofflicher Beziehung zu sprechen, und ein andermal von Dr. Penzig ausgeführt, daß beim Streben nach einem einheitlichen, die ganze Natur und Geisteswelt umfassenden Weltbilde man gar nicht anders könne, als das objektiv von der Einzelwissenschaft gegebene Bild fälschend abzurunden, also den Tatsachen Gewalt anzutun. Ich habe schon damals bemerkt, daß von solchen vermeintlichen Fälschungen oft die größten Fortschritte ausgegangen sind. So war das Kopernikanische Weltsystem für seine Zeit eine «Fälschung» der vorliegenden Tatsachen, wie die LamarckDarwinsche Entwickelungstherorie nichts weiter ist. Wie
Tycho de Brahe das für seine Zeit einzig mögliche Weltbild gab, so ist es dem Tatsachenfanatiker, der mit seinem Denken nicht über die objektiv gebotenen Tatsachen hinausgehen will, leicht, die «Fälschungen» nachzuweisen, die die Lamarck-Haeckelsche Entwickelungstheorie nach dem heutigen Stande der Wissenschaft enthält. Trotzdem glaube ich, wird wie Kopernikus Haeckel Recht behalten. Ich bin seinerzeit mit aller Entschiedenheit für die viel umstrittenen «Welträtsel» eingetreten, weil ich die Konsequenz und äußerste Kühnheit bewunderte, mit der ein Geist von einem einseitigen Standpunkte aus ein Weltbild entwirft und «fälscht». Obwohl meine philosophischen Grundanschauungen ihm nur entgegengesetzt sind in dem, was er darin bekämpft und ihm beistimmen in dem, was er Positives gibt. Zugleich wurde ich aber unter Heranziehung früherer Schriften als ein Hauptgegner Haeckels bezeichnet, eine Erfahrung, die mir symptomatisch scheint für unsere Zeit, insofern im Kopf eines anderen die Vorstellungswelt des Autors ein ganz anderes Bild annimmt. Wir führen eben mit unseren Begriffen, nach ihrer sonstigen Stellung im Geistesleben, Vorstellungen ins Feld, die etwas anderes besagen, als wir ausdrücken wollen.
Bei diesen Auseinandersetzungen über Haeckel und in den Diskussionen des Bundes ist mir eine Frage wieder lebendig geworden, die ich mir schon oft vorlegte: Wie verhält sich Wahrheit zur Wissenschaft? Enthält die Wissenschaft Wahrheit, enthält sie irgendwelche Momente, die zum Aufbau einer einheitlichen Weltanschauung führen könnten? Haben wir das Recht, aus der Wissenschaft heraus eine einheitliche Weltanschauung oder überhaupt eine Weltanschauung aufbauen zu wollen?
Bei dieser Frage, die schon Jahrhunderte beschäftigt hat, die ihrer Lösung näher waren als die Neuzeit. die sich den
Weg der Lösung durch die sogenannte Erkenntnistheorie verbaut hat, muß man sich klar werden, vor welchem Forum überhaupt etwas ausgemacht werden kann in bezug auf Wahrheit und Wissenschaft. in bezug auf Wahrheitsgehalt der Wissenschaft.
Heutzutage haben wir nach der ganzen Entwickelung des 19. Jahrhunderts von der Wahrheit etwa die Vorstellung, daß sie mit der objektiv vorliegenden Wirklichkeit übereinstimmen müsse. Wir befinden uns in einem intensiven Tatsachenfanatismus, der uns nicht gestattet, irgendeinen Schritt über die Registrierung hinauszugehen. Wenn Wahrheit nur eine begriffliche Wiederholung dessen ist, was außer uns vorhanden ist, so ist nach Empfindung derjenigen, die heute nach Weltanschauung streben, diese auch nichts anderes, als ein Gegenbild außer uns vorhandener Tatsachen, der außer uns in der Welt fertigen Wirklichkeit. Wenn es gelänge, von irgendeiner Ecke in möglichst günstiger Perspektive eine Photographie der Welt zu machen, so wäre das Ideal eines Weltbildes erreicht. Eine solche Weltanschauung aufzubauen wäre aber tatsächlich überflüssig, ein bloßer Luxus des Menschengeistes, wenn sie, wie die Wissenschaft, nichts anderes sein soll als eine bloße Wiederholung, eine Art photographisches Gegenbild dessen, was in der Welt vorgeht, was abgeschlossen vorliegt. Daß der Einzelne sich noch ein individuelles Gegenbild neben der Wissenschaft bildet, wäre vollkommen entbehrlich, für den ganzen Weltzusammenhang unendlich gleichgültig. Wenn die Natur alles bis auf den Schlußpunkt für uns besorgt und ausgebildet hat, so gehört das nicht zur Wirklichkeit, was der Menschengeist träumt und schafft. Für diesen Standpunkt, der in grotesker Weise in der heutigen Wissenschaft auch in Haeckels «Welträtsel» hervortritt, ist der Mensch nichts anderes als ein bloßes Staubkorn im Kosmos, das
sich bloß quantitativ unterscheidet von dem Wurm. Macht er sich ein Weltbild, so lebt er ein Luxusleben, tut etwas, was nicht das Geringste hinzubringt zur Weltentwickelung. Vielmehr wird gefordert, daß er niemals etwas aus dem eigenen Geiste Genommenes, was in der übrigen Natur nicht gefunden wird, zubringen dürfe, sondern nur registrieren, vergleichen, logisch verknüpfen.
Wir fragen: Stimmt dies Verfahren, bloß logisch der objektiven Natur gegenüberzutreten, niemals etwas über den derzeitigen Stand der Verhältnisse Hinausgehendes hinzuzufügen, überein mit dem Gange der Wesenheiten der Natur; liegt nicht vielleicht in der Entwickelungsrichtung der Natur etwas, das uns zwingt, irgend etwas der Wirklichkeit hinzuzufügen? Die Antwort gibt die Natur uns selbst. Besonders solle sie sie dem Entwickelungstheoretiker geben.
Gestatten Sie mir, um Ihnen dies in prägnanter Weise darzulegen, die Annahme, die Natur befände sich in dem Stadium ihrer Entwickelung, daß es nur Affen und keine Menschen gegeben hätte, die Affen hätten nachgeforscht über die Erscheinungen der Welt, sie hätten gefunden, was unter ihnen liegt, und noch Affen dazu. Hätten sie sich auf den empirischen Standpunkt gestellt, so hätten sie sich bei der Erkenntnis beruhigt: die Welt schließt mit den Affen ab. Sie hätten vielleicht eine Affenethik gegründet auf Grund der allgemeinen Affenempfindung, so daß hier zu der Welt nichts Neues hinzugetan worden und sie auf ihrem Standpunkt stehen geblieben wäre. Doch von unserem Standpunkte der Erkenntnis wissen wir, daß im Entwickelungsprinzip allerdings etwas vorhanden war, was über die Affengattung hinausgeleitet hat, das, weil es ein produktives Prinzip war, weil es über dasjenige, was als abgeschlossene Wirklichkeit vorlag, hinauswies, zur Menschenbildung geführt hat, etwas, das sich nicht auf das Tatsächliche
beschränkte, was, gleichsam als reale Phantasie, reale Intuition in der Natur vorhanden, diese über ihre einzelnen Stadien hinwegführt und über die unmittelbare Gegenwart hinaushebt.
Auch der Mensch als Produkt der Entwickelung, als Wesen in der Natur, ist da, um der Entwickelung zu leben, nicht bloß, um zurückschauend sich ein Bild der Entwickelung zu machen und sich als den Schlußpunkt der Reihe zu betrachten. Eine Weltanschauung, die den Inhalt seines ganzen Denkens und Tuns zusammenfassen will, wird deshalb nicht bloß theoretisch-betrachtend, sondern auch praktisch-postulierend sein müssen. Der Mensch soll also nicht nur in irgendeiner Weise die Natur wiederholen, sondern sehen, ob nicht in ihm Kräfte liegen, die über das unmittelbar Gegebene hinausführen. Er soll die Entwickelung geistig, ideell lebendig in sich machen, soll die Kräfte suchen, die die Gattung weitertreiben, den Fortschritt hervorbringen, nicht bloß seine Geisteskräfte danach untersuchen, ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Die Frage «Können wir zum Ding an sich dringen, in das Wesen der Welt hineinsehen» ist ein Unheil, ein Hemmnis für den Menschen. Aber wenn er sich in die Entwickelung stellt, eingreifend in die Natur, um sie ein Stück weiterzuführen, kommt er zu einem Gefühl seiner erhabenen Aufgabe, seiner Stellung innerhalb der Welt.
Es sind tatsächlich Ansätze zur Bildung dieses überwissenschaftlichen Standpunktes vorhanden, der die Wissenschaft durchaus gelten läßt, aber sich über das erhebt, was die Wissenschaft ihm als Gesetzmäßigkeit des logischen Gedankens bietet. Maeterlinck ist zum Beispiel mit ähnlichen Anschauungen hervorgetreten in einem seiner neueren Bücher, in dem er die Hochzeit der Bienen schildert. Man fragt: Können wir von Wahrheit im Sinne wissenschaftlicher
Wahrheit, von Übereinstimmung mit der vorliegenden Wirklichkeit, die sich immer im materiellen Kleinkram befindet, reden, wenn sie Inhalt einer Weltanschauung sein soll, oder führt sie als Weltanschauungswahrheit in ähnlicher Weise über die rein objektive Wahrheit hinaus, wie die dichterische Wahrheit nach Anschauung derjenigen, die sie im Goetheschen Sinne auffassen, über die unmittelbare naturalistische Wahrheit hinausführt?
Solche Ansätze sind in heutiger Zeit mehrfach zu finden zum Entzücken derer, die die Wahrheit im lebendigen Leben sehen, zum Greuel der Tatsachenfanatiker wie Tycho de Brahe oder der Gegner Haeckels. Doch gehört sie nicht vor deren Forum. Die Wahrheit, die befruchten will, wird immer ein Suchen sein, wird immer das Bild der Tatsachen-fanatiker «fälschen» müssen; aber sie steht unendlich über dieser, indem sie etwas Intuitives, Geistiges im Menschen ausbildet, etwas Neues der Natur hinzufügt, was nicht wäre ohne den Menschengeist. Dadurch erhält das, was der Mensch in seinen Träumen hegt, in seinem Geiste schafft, mehr als die Bedeutung eines bloßen Luxus, erhält kosmische Wahrheit im Leben, als etwas, das der Mensch neu erzeugt hat. So steigt er auf dem Unterbau der Wissenschaft empor zu produktiver Arbeit, die frei aus seiner Seele hervorquillt als Originalintuition. Anschließend an die höchste Stufe der Entwickelung hat er eine Aufgabe, die kein anderes Wesen der Welt hat, fügt er etwas hinzu, was ohne ihn ewig nicht vorhanden wäre.
Mögen diese Anschauungen dem reinen Naturforscher ein Greuel sein, ich halte es für eine richtige Erkenntnis, daß der Mensch ein Recht hat, produktiv in seiner Weltanschauung zu sein, ein Gefühl, das zu verschiedenen Zeiten lebendig war, als uns noch nicht Tatsachenfanatismus und
Erkenntnistheorie Scheuklappen angelegt hatten, Zeiten, die von vornherein von dem kosmischen Charakter dieser Hinzufügung überzeugt waren.
Lassen Sie mich schließen mit den Worten des Angelus Silesius, die die Erkenntnis der einzigartigen Bedeutung des Menschengeistes in der Welt ausdrücken:
Ohn' mich könnt' Gott kein einzig Würmlein schaffen;
Würd' ich zu nichts, müßt' es im Nichts zerkrachen.
Schäfer, früher Sprecher der freireligiösen und der humanistischen Gemeinde zu Berlin, beanstandet den Ausdruck «Fälschung» für den Irrtum des Kopernikus. Wenn er anstatt einer Ellipsen- eine Kreisbewegung annahm, so sei das eine mangelhafte Anschauung, die wie viele ähnliche durch den fortschreitenden Menschengeist geklärt worden, wie es denn immer das Los des Menschen sein werde, vor Unvollkommenheiten seiner Anschauungen stehenbleiben zu müssen, die erst später gelöst werden.
Redner hätte das Thema lieber gefaßt gesehen: »Von welchem Forum, welchem Gerichtshof kann geurteilt werden über eine Weltanschauung, über Wahrheit und Unwahrheit, und damit über ihr Recht und Unrecht?»
Dieses Forum kann nur die Persönlichkeit, ihre Souveränität sein. Aus dieser Stellung fließt dann das Gefühl der Verantwortlichkeit.
Dr. Stern: «Eine Grundlage, die von Wichtigkeit ist für unsere Diskussion, lautet: Ist eine Weltanschauung, das heißt, eine allgemeine philosophische Anschauung vom wahren Wesen der Welt und alles Seienden überhaupt möglich? Diese Frage ist sehr verschieden beantwortet worden. Während es einerseits für unbedenklich gehalten wird, nach den gemachten Erfahrungen sich ein dogmatisches Weltbild zu verschaffen, so ist eine andere Meinung, zu der ich mich bekenne, der kritische Positivismus, der von wissenschaftlicher Erkenntnis ausgehend zwar nicht bei der einzelnen Tatsache stehenbleibt, es aber doch nicht für möglich hält, ein Bild des letzten Sachverhaltes, ein wahres Bild des Kosmos zu gewinnen.
Um die dogmatische Methode zu rechtfertigen, wird auf den metaphysischen Trieb hingewiesen, der unzweifelhaft im Menschen existiert, schon im Kinde, das das Spielzeug zerbricht, um hinter den Kern der Sache zu kommen.
Bei der Bildung metaphysischer Systeme zur Befriedigung dieses Triebes haben sich aber zwei psychologische Fehler eingeschlichen: die griechische Philosophie griff einseitig einen der verschiedenen Teile des Weltalls heraus und machte ihn zum Subjekt, dem wahren Wesen der Natur. So Thales das Wasser. In neuerer Zeit ist man darauf verfallen, verschiedene psychologische Fähigkeiten der Menschennatur einzeln ins Auge zu fassen und, phantastisch vergrößert, der Natur als Wesenheit unterzuschieben. So macht Hegel die Vernunft zum Weltprinzip, Schopenhauer den blinden Willen. Lotze nimmt ein umfassendes Bewußtsein an, das alle Wechselwirkung vermittelt. So ist die Philosophie glücklich wieder da angelangt, wo sie ausging, im Hylozoismus.
Ich halte es überhaupt für unmöglich, eine allgemeine, wahre und richtige Weltanschauung zu finden, einmal wegen der subjektiven Beschaffenheit des menschlichen Geistes, der alles und jedes durch eine subjektive Brille sieht und nach Kant das Ding an sich nie erkennen kann, anderseits aus dem objektiven Grunde, daß alle unsere Forschung nur einen so kleinen Teil des Weltalls umfaßt und es überhaupt unmöglich ist, daß jemals ein so großer Teil des Geschehens in den Kreis unserer Erfahrung tritt, daß wir allgemein gültige Schlüsse auf die Gesamtwelt daraus ziehen können.»
Benedikt Lachmann: «Dr. Steiner scheint mir einen Gegensatz zwischen Mensch und Natur aufzustellen. Das Wesen des Menschen wie jeder anderen Existenzform läßt sich auflösen in ein Spiel von Kräften, von Bewegung und Widerstand, die zwecklos miteinander kämpfen. Es kann sich für den Menschen nicht darum handeln, sich über diese Kräfte zu erheben, sondern er muß suchen, so gut wie möglich mit ihnen sich auseinanderzusetzen.»
Wolfgang Kirchbach: «Dr. Steiner hat gesagt, es sei eine Gefahr, ja eine Notwendigkeit des menschlichen Geistes, zu einer Fälschung zu gelangen, wenn er sich nicht begnügen will, ein einfaches Abbild, einen Abklatsch der Wirklichkeit zu geben. Im Gegensatz dazu glaubte Baco von Verulam, ein richtiges Weltbild
aufbauen zu können allein auf den perceptionibus sensuum, und das Kopernikanische System verwarf er, weil es seiner Vorstellung von den perceptiones widersprach.
Es kommt doch bei der Feststellung der Wahrheit auf die Kenntnis an, die der Mensch überhaupt von seinen Kräften und Vermögen hat, die ihm zur Beurteilung der Wirklichkeit gegeben sind. Darunter gehört zum Beispiel auch die mathematische Beurteilung, die die Wahrnehmungen korrigiert. Von einer Fälschung kann man wohl nur in dem Sinne reden, daß der Mensch einseitig auf die eine oder andere Fähigkeit verzichtet. Es hat doch auch Köpfe gegeben, die im Vollbesitz aller ihrer geistigen Fähigkeiten in einer gewissen Reife, die wir Vernunft nennen, dachten. Wenn Herr Schäfer sagt, das Forum einer Weltanschauung sei die Souveränität meiner Persönlichkeit, so meinte er sicherlich, daß dieses Forum der Gesamtbesitz der geistigen Kräfte meiner Persönlichkeit sei, und wir können uns auf den Namen Vernunft einigen. Der Vernunftbegriff der Wahrheit fordert Ubereinstimmung des Urteils mit der Wirklichkeit für jedes Denken, in Wissenschaft wie Weltanschauung, verlangt nach Beobachtung, Wahrnehmung, Korrektur der Wahrnehmung, den Begriff, den Ausdruck zu finden, der die größte Summe der bekannten Tatsachen nach dem jeweiligen Stande der Erkenntnis ausdrückt, die größte Zusammenstimmung unserer Urteile mit der Wirklichkeit ausdrückt.
Dieser Weg allein macht Forschung und Phantasie produktiv, schützt sich vor Irrtum, der von der Wirklichkeit widerlegt, inhaltslos und unproduktiv ist. So allein ist es möglich, der Natur etwas produktiv hinzuzufügen. Auch wenn der Dichter uns ein Weltbild gibt, halten wir es für besser, daß er realistische Gestalten schafft, in seinem Werke ein gesellschaftliches oder sonstiges allgemeines Gesetz zu beobachten gibt. Sein Werk ist auch nur das Abbild der Wirklichkeit, aber allein das Auffinden des wirklichen innern Symbols ist eine eminent produktive Tätigkeit, wie in der Wissenschaft das Auffinden des zusammenfassenden, in seiner Anwendung fruchtbaren Oberbegriffs aus der Summe der entgegenstehenden und einschränkenden Data.
Es bedarf allerdings einer produktiven Einbildungskraft, aber diese ebenso eines Regulators der Vernunft, eine Einschränkung der Phantasie durch die Wirklichkeit.
Diese Methode hat durch Schaffung neuer Organe etwas zur
Welt hinzugefügt. Durch methodisch-vernünftige Betrachtung hat Kant auf sittlichem Gebiet dem, was wir hier gemeinhin Natur nennen, der Welt der Empfindung und Lustgefühle, ein ganz neues Moment hinzugesellt, das weit über die empirische Natur hinausragt, den kategorischen Imperativ.»
Dr. Steiner: «Ich muß gestehen, daß die Angriffe das, was ich heute gesprochen habe, gar nicht getroffen haben. Ich habe nicht von einem Gegensatz zwischen Mensch und Natur gesprochen. Ich habe mich vielmehr auf den konsequentesten Standpunkt der Entwickelungstheorie gestellt, daß ich alle Stufen der Natürlichkeit, von den tiefsten bis hinauf zu den höchsten Regungen des Geistes, als einheitliche betrachte, die nur in verschiedenen Formen zum Vorschein kommen. Aber eine Amöbe ist schließlich kein Mensch, und es handelt sich nicht darum, alle Unterschiede zu verwischen. Wenn ich aber sage, in der Natur ist alles nur Kraft, Widerstand, Bewegung, so erinnert das zu sehr an den Satz: In der Nacht sind alle Katzen grau. Es ist nicht so im Handumdrehen mit der Welt fertig zu werden. Erst wenn ich die Dinge unterschieden habe, kann ich nach einem einheitlichen, verbindenden Prinzip suchen. Im Sinne des verbindenden Entwickelungsprinzips habe ich von der Aufgabe des Menschen gesprochen als einer innerhalb der Natur liegenden, durch die Entwickelungstatsachen gegebenen.
Daß wir uns an die Wirklichkeit halten müssen, wenn wir produktiv sein wollen, und an ihr unsere Phantasie korrigieren, darin stimme ich vollkommen bei. Ich führte nur aus, daß die Bemühungen, ein Weltbild zu geben, das nur ein Abklatsch der Wirklichkeit ist, wie Büchner will, diesen Anforderungen bisher nicht genügten, und zum Beispiel auch dieser gezwungen ist, den Tatsachen Gewalt anzutun. Man muß hier nicht auf den Willen sehen, sondern
auf das Resultat. Man benimmt sich so, als wenn man ein Bild des real Vorliegenden geben wolle, kann es aber nicht. Mein Prinzip ist daher nicht ein theoretisches, sondern ein praktisches Hinausgehen über die Wirklichkeit im Sinne, wie ich sie im Entwickelungsprinzip sehe, wo Geschöpfe über ihre eigene Gattung hinausgehen. Diese Stellung des Problems ist in der Diskussion gar nicht berührt worden.
Das Wort Fälschung habe ich nicht im Sinne der Unvollkommenheit einer Vorstellung gebraucht, die erst später geklärt wird, sondern meinte, daß die Forscher immer um des Systems willen zu bewußt falscher Darstellung gezwungen werden, wenn sie eine umfassende Einheit suchen, und habe deshalb gefragt, ob überhaupt das, was wir im höchsten Sinne Wirklichkeit zu nennen berechtigt sind, sich mit dem deckt, was der Naturforscher sich unter Wirklichkeit denkt. Wenn Haeckel drei Stufen des embryonalen Entwikkelungsstandes mit demselben Klischee abdruckt, so ist er, um den Beweis nach naturwissenschaftlicher Methode liefern zu können, zu einer Fälschung gezwungen. Ich meine mit Ironie, daß solche Fälscher trotzdem Recht behalten, wie Haeckel gegenüber seinen Gegnern, die am rein Tatsächlichen der naturwissenschaftlichen Methode hängen, denn sie sehen in intuitiver Weise hinaus über die Einzeltatsachen, nicht in phantastischer.
Wenn aber Herr Dr. Stern die Möglichkeit eines Weltbildes, einer Gesamtanschauung im Prinzip verwirft und dabei die Verschiedenheit der philosophischen Systeme zur Unterstützung seiner Ansicht heranzieht, so ist das eine Fable convenue, die auf unvollständigen Vorstellungen von den einzelnen Systemen beruht. Die bedeutendsten Wahrheitsversuche, die gemacht worden sind, von der Vedantaphilosophie durch die griechische bis zur deutschen, sind Annäherungen an die Wahrheit in verschiedenen Graden.
Das Forum, vor dem die Berechtigung der einen oder der anderen Anschauungsweise entschieden wird, kann allein das Forum des Menschen, seine souveräne Persönlichkeit sein, wie ich mit Dr. Schäfer übereinstimmend meine. Dieser Satz scheint mir ein wahrhaft realer, der geflossen ist - nicht aus theoretischen Spintisierereien, sondern aus der Erfahrung von Männern, die praktisch gewirkt haben. Aber so wahr es ist, daß die Persönlichkeit das letzte Forum ist, so sicher ist es wahr, daß dann die Persönlichkeit immerdar die Verantwortlichkeit dieser Stellung fühlen muß und die Pflicht, sich stetig zu entwickeln, die Tiefen der Persönlichkeit auszubilden. Das Kind kann nicht ebenso Forum sein wie der, der auf der Höhe der ,Erkenntnis steht. Es entsteht daher die Frage: Wo liegt in uns Menschen das zu Entwickelnde, das Produktive? Was entspricht in uns dem, das die Natur vorwärtstreibt, die Affen aus ihrer Gattung hinausgehen ließ und zum Menschen machte?
Betrachte ich den Menschen als Entwickelungsprodukt, so kann ich ihn allerdings als das höchste vorhandene Forum ansehen. Aber ich habe auch die Verpflichtung, das höchste Menschliche in mir immer zum Dasein zu rufen und habe in keinem Momente meines Lebens das Recht, mich als Forum in voller und letzter Instanz anzuerkennen, wohl aber kann ich mich, als in der Entwickelung stehend, der Erwartung hingeben, daß mir in jedem Augenblick meines Daseins ein höherer Punkt der Erkenntnis, als ich jetzt habe, aufgehen kann. Die Fortentwickelung der Persönlichkeit hat sich auf der Wissenschaft aufzubauen, aber auch darüber hinauszugehen, wie Kunst und Poesie es tut, und so wenig Kunst und Poesie in blinde Phantasmen hineinkommen, wird, wenn die Menschen am Entwickelungsprinzip ihre Persönlichkeit kontrollieren, wenn sie
auch noch so weit hinausgehen über die objektive Natur, in den verschiedensten Menschen Übereinstimmung entstehen, wie die Übereinstimmung philosophischer Systeme aller Zeiten das zeigt.
In dieser souveränen Bedeutung der menschlichen Persönlichkeit liegt die Lösung der Frage: Inwiefern enthält die Wissenschaft Wahrheit? Kann sie allein zur Wahrheit führen?
Die Welt, besonders für die Wissenschaft, ist in mancher Beziehung dualistisch gebaut. Die Entwickelung ist nur möglich, indem die Natur zwiespältig das Künftige in ihr vorbereitet hat. Als ein scheinbarer, für die Wissenschaft zunächst nicht auflösbarer Gegensatz tritt die Natur dem Menschen entgegen, als Kraft, Materie und so weiter.
Hier tritt nun die Bedeutung der menschlichen Persönlichkeit ein. Vereinigend, monistisch, kann allein die Lebenstätigkeit des Menschen sein. Sie besteht im Auflösen dieser scheinbaren Gegensätze in eine höhere, produktiv aus dem Menschen erzeugte Anschauung, im Leben der Entwickelung, im Vereinen der Gegensätze, im lebendigen Tun.
Deshalb ist die Frage nach Gültigkeit der Weltanschauung vor dem Forum des Lebens, nicht vor dem Forum der Erkenntnis zu entscheiden.»
MONISMUS UND THEOSOPHIE
Berlin, 8. Oktober 1902
Vortrag Rudolf Steiners im Giordano Bruno-Bund
Herr Dr. Steiner betont zunächst, daß ein im gewöhnlichen Sinne lebenskluger Mann bei dem gegenwärtigen deutschen Geistesleben öffentlich nicht über ein solches Thema sprechen werde, weil kaum ein anderes geeigneter sei, sich stark zu kompromittieren, und fährt dann fort:
«Theosophie ist ein Name, der oft von Leuten in Anspruch genommen wird, die in spiritistischen Zirkeln ihr Schicksal erkunden wollen. Und trotzdem sogar der Geruch des Schwindelhaften daran haftet, spreche ich über das Thema in seiner Verbindung mit dem deutschen Geistesleben mit vollem Bewußtsein. Viel lieber war ich in meinem chemischen Laboratorium als in irgendeinem spiritistischen Zirkel, und ich weiß, daß man sich in solchen geradezu die Hände beschmutzen kann, aber ich habe mir auch die Hände gewaschen und hoffe, daß es mir gelingen wird, das Wort Theosophie für eine ernste Weltanschauung Ihnen nahezubringen. Klar muß es ausgesprochen werden, daß nur auf Grund der modernen Naturwissenschaft eine ernste Weltanschauung gesucht werden kann, ich werde niemals von dem Gedanken abweichen, daß nur in ihr ein Heil gegeben ist. Die Naturwissenschaft erfüllt die Köpfe und Herzen aber noch immer auch mit ihrer materialistischen Weltanschauung, und wenn auch einzelne Schwärmer behaupten, wir seien längst über das Zeitalter der Büchner und so weiter hinaus, wenn wir keine ideale Weltanschauung auf Grund der Naturwissenschaft konstruieren
können, so wird sich der Materialismus der fünfziger Jahre noch weiter die Welt erobern. So gut wie alle Naturforscher der Gegenwart sind Materialisten, auch da, wo sie es ablehnen.
Die Naturwissenschaft hat uns gezeigt, wie allmählich die Wesen entstanden und sich vervollkommneten, bis der Mensch auftrat. Aber hier, nach Haeckel im 22. Gliede seiner organischen Ahnenreihe, machte sie halt. David Friedrich Strauß hat es gepriesen, daß die Naturwissenschaft uns vom Wunder erlöst hat, vom Wunder in dem Sinne, in dem noch Linné im 18. Jahrhundert sagte: Die Naturwissenschaft hat durch das Zauberwort diese Wunder aufgelöst, dieses Zauberwort hat das räumliche Nebeneinander in ein übersichtlich gewordenes zeitliches Nacheinander verwandelt, aber das Wunder, das der Mensch sich selbst ist, hat sie bisher nicht auflösen können. Wir müssen versuchen, die Methode der Naturwissenschaft auch auf das Nebeneinander anwenden zu können, das wir im Hottentotten und im Genie vor uns sehen; wir müssen gewissermaßen die geistige Urzelle entdecken, welche beide verbindet. Aber die hierzu erforderliche Methode der Naturwissenschaft wird wieder eine andere sein, wie die Naturwissenschaft stets ihre Methoden nach ihren Zwecken modeln mußte. Der Geologe durfte nicht nur Mineralien sammeln, um die Geschichte der Erde verstehen zu lernen, Haeckel hätte sein biogenetisches Grundgesetz nicht gefunden, wenn er seine Tierleiber im Laboratorium mit chemischen Reagenzien behandelt hätte, ebensowenig wird die chemische Untersuchung des Gehirns dem Seelenforscher Aufschlüsse über das Seelenleben geben. Aber trotz der ungeheuren Fortschritte der Naturwissenschaft war sie bisher
nicht imstande, diese Methode zu entdecken, und dadurch ist eine so tiefe Kluft zwischen Naturwissenschaft und religiösem Gefühl entstanden, wie sie niemals größer war. Anders in den alten Kulturen und deren Theologien. Da gibt es diesen Zwiespalt nicht, Theologie ist nichts anderes als der Ausdruck des jeweiligen wissenschaftlichen Denkens. Was man als Weltanschauung darbot, das war so hehr und groß und göttlich, daß es in Empfindung umgesetzte Religion war. Heute stehen wir aber vor der Tatsache, daß Theologie und Wissenschaft zwei völlig getrennte Dinge sind, und in diesem Sinne sagt Adolf Harnack, man fühle sich wie erlöst in dem Gedanken, daß die Wissenschaft niemals imstande sein werde, die religiösen Bedürfnisse zu erfüllen. Und auf der anderen Seite sagt für die Naturwissenschaft zum Beispiel der Engländer Ingersoll:
Wie können wir da wieder den Einklang herstellen, der für die alten Religionen, ja selbst noch für das frühe Mittelalter bestand? Mit dem heiligen Augustinus trat dieser Zwiespalt allmählich ein, der in dem Gegensatz von Scholastik und Galilei und so weiter zu den beiden großen dualistischen Strömungen führte. Die Wissenschaft war wie ein Sohn, der aus der Fremde heimkehrt und vom Vater nicht mehr verstanden werden kann, und der Protestantismus ist nichts anderes als die Erklärung des Vaters, daß er den Sohn enterben will, und der Kantianismus ist der Abschluß, die letzte Phase dieses Prozesses!
Den ersten großen Versuch, diesen Zwiespalt zu überwinden,
machten die deutschen idealistischen Philosophen Fichte, Schelling und Hegel. Drei Jahre nach dem Tode Hegeis erschien von dem Sohne Fichtes ein Buch von der menschlichen Selbsterkenntnis. Es handelt von dieser als einer Aufgabe, die die Naturwissenschaft selbst gestellt hat. I. H. Fichte sagt etwa: Betrachten wir die Naturwesen, so sehen wir ihre ewigen Gesetze. Wenn wir aber die menschliche Seele selbst als einen Naturprozeß ansehen, so stehen wir vor einem Erkenntnisumschwung. Die Gesetze der Natur liegen außerhalb unserer Persönlichkeit in der Naturgrundlage, aus der wir hervorgegangen sind, aber in unserer Seele sehen wir nicht fertige Naturgesetze, sondern wir sind selbst Naturgesetz. Da wird die Natur unsere eigene Tat, da sind wir Entwicklung. Da erkennen wir nicht bloß, da leben wir. Wir haben jetzt die Aufgabe, ewige eherne Gesetze zu schaffen, nicht mehr, sie bloß zu erkennen. I. H. Fichte deutet dann an: in diesem Punkte lebt der Mensch nicht nur in seiner Naturerkenntnis, in diesem Punkte verwirklicht er und lebt er das Göttliche, das Schöpferische, an diesem Punkte geht die Philosophie in die Theosophie über!
Hier tritt uns der Begriff Theosophie im deutschen Geistesleben entgegen. Wir sehen jetzt vielleicht schon eher, daß Theosophie nichts anderes ist als letzte Anforderung eines wahren Monismus zwischen Naturerkenntnis und Selbsterkenntnis. Das gibt uns eine Perspektive, die Gegensätze zwischen Religion und Wissenschaft auszugleichen. Wir wissen jetzt: es gibt keine andere göttliche Kraft, welche den Wurm zum Menschen hinaufbefördert, wir wissen, daß wir selbst diese sind.
Man wird fragen: Was hat aber denn eine solche Erkenntnis überhaupt für einen Zweck? Nun, so entgegne ich, was hat das, was man gewöhnlich Erkenntnis nennt, das einfache
Registrieren der Tatsachen für eine Bedeutung? Mit ihr begnügen sich die, die ich kosmische Eckensteher nennen möchte.
Wer in dieser Weise den Begriff Theosophie faßt, der wird auch Feuerbach verstehen, der da sagt, der Mensch hat Gott nach seinem Bilde geschaffen. Wir wollen es durchaus zugeben, daß der Gottesbegriff aus dem Menschenherzen geboren ist, und Gott als Symbol eines inneren Ideals den Menschen über den Menschen hinaus entwickeln kann.
So werden wir wiederum eine Gottesweisheit gewinnen, welche die Göttlichkeit der Natur aussprechen wird. Wir leben heute wiederum in einer Zeit, die ein wichtiger Knotenpunkt in der geistigen Entwickelung Europas werden kann, wie es der war, in dem Kopernikus, Giordano Bruno und Galilei lebten und die moderne Naturwissenschaft begründeten. Aber diese hat es nicht verstanden, ihre Versöhnung zu feiern mit der Religion. Vor dieser Aufgabe stehen wir, wir müssen sie erfüllen. Mögen diese Versuche noch so mangelhaft sein, aber wir haben Strömungen im modernen Geistesleben, welche darauf hinausgehen. Religionen werden als solche zwar nicht gegründet, religiöse Genies in dem Sinne, wie es wissenschaftliche und künstlerische Genies gibt, gibt es daher nicht, wohl aber solche Persönlichkeiten, welche den Erkenntnisinhalt ihrer Zeit als religiöses Empfinden aussprechen. Ich kenne die großen Mängel und Fehler der theosophischen Bewegung durchaus. Duboc hat die Theosophie eine weibliche Philosophie genannt. Das können wir ändern, indem wir sie im kritischen Deutschland zu einer männlichen machen.
Ich weiß, daß es kein Heil außerhalb der Naturwissenschaft geben kann, aber wir müssen neue Methoden der Seelenforschung auf naturwissenschaftlicher Grundlage finden, um das zu können, was alle alten religiösen Anschauungen
vermochten: eine große Einheit zwischen religiösem Bedürfnis und Wissenschaft herzustellen. Theosophie in dem von mir gekennzeichneten Sinne hat an sich nichts zu tun mit den oft damit zusammengeworfenen Berichten über Tatsachen des Hypnotismus und Somnambulismus; ja, man könnte diese ablehnen und doch ein Theosoph sein, aber diese Erscheinungen des abnormen Seelenlebens sind durchaus nicht abzulehnen, und in der besonders von französischen und englischen Gelehrten unternommenen naturwissenschaftlichen Auslegung dieser Tatsachen sehe ich die ersten tastenden Versuche einer wirklichen Seelenforschung.»
Herr Dr. Steiner schloß seinen programmatischen Vortrag mit dem Hinweis auf ein Bild des Belgiers Wiertz «Der Mensch der Zukunft». Es stellt einen Riesen dar, der Kanonen und die sonstigen Attribute der Kultur unserer Zeit in der Hand hält und sie lächelnd seinem Weibe und seinen Kindern zeigt; sie sind vor seiner Größe pygmäenhaft zusammengeschrumpft. Es wird unsere Aufgabe sein, daß wir vor dem Zukunftsmenschen nicht so pygmäenhaft erscheinen.
Berlin, 15. Oktober 1902
Diskussion mit Voten Rudolf Steiners
Zuerst erstattete O. Lehmann-Rußbüldt zur Orientierung ein Referat über den Vortrag Dr. R. Steiners und fügte hinzu, es wäre sein persönlicher Wunsch gewesen, daß nicht bloß die 250 bis 300 Hörer des Vortrags zugegen gewesen wären, sondern die 2000 bis 3000 Personen, die das geistig-öffentliche Leben in Deutschland ausmachen. Dr. Steiners Aufforderung, die Theosophie, wenn sie nach Duboc eine weibliche Philosophie sei, im kritischen Deutschland zu einer männlichen zu machen, müßte dick unterstrichen
werden, so daß es im Druck allein eine Seite einnehmen würde, denn es läge in der theosophischen Bewegung sicher auch keine geringe Gefahr. Der Referent erkannte es an, daß unsere geistige Kultur trotz Elektrizität und Feinmechanik roh zu nennen sei gegenüber der Harmonie, die in den großen Kulturen des Altertums zwischen Wissenschaft und religiöser Welt bestand, aber, so fügte er nachdrücklich hinzu, wir wollen deshalb an uns nicht verzweifeln. Die offenbare Überlegenheit unserer Intelligenz, wie sie sich eben im Maschinenzeitalter äußere, könnte uns eine Bürgschaft dessen sein, daß wir vertiefen und ausbauen werden, was die Kultur des Altertums erst in der Ahnung, wenn auch in großartigster Weise besaß. Hierzu zitierte der Referent aus dem Rassenwerk des Grafen Golineau einen Passus über die geistige Veranlagung des Ariers, der sich durchaus auch auf die Völker der atlantischen Welt, also auf Westeuropa und Nordamerika, anwenden lasse:
«Der Arier ist also den übrigen Menschen hauptsächlich in dem Maße seiner Intelligenz und seiner Energie überlegen, und dank diesen beiden Anlagen ist es ihm, wenn es ihm gelingt, seine Leidenschaften und seine materiellen Bedürfnisse zu besiegen, ebenfalls vergönnt, zu einer unendlich viel höheren Moralität zu gelangen, wiewohl man im gewöhnlichen Lauf der Dinge bei ihm ebenso viele tadelnswerte Handlungen rügen kann, als bei den Individuen minderer Rassen.» Der Referent schloß mit der Bemerkung, daß nach seiner Voraussicht sich aus dem verlästerten Hypnotismus und Somnambulismus die Wissenschaft einer erweiterten und verfeinerten Psychologie entwickeln werde, die uns für die Seelenerkenntnis soviel bedeuten würde, wie es die Astronomie und Chemie für die Naturerkenntnis bedeuten, trotzdem sich diese Wissenschaften aus Astrologie und Alchimie entwickelt hätten.
In der Diskussion bemängelt zunächst Nicolai, daß nicht ausgeführt sei, was denn die Theosophie eigentlich wolle und könne.
Dr. Steiner entgegnete, sein Vortrag habe nur den Zusammenhang zwischen dem Monismus und der Weltanschauung hervorheben wollen, die schon in den Tagen der Vedantaphilosophie Indiens sich in modernen Gleisen bewegte. Darin bestände der seit dem 4. Jahrhundert im Christentum
einsetzende Dualismus, daß er wohl für die Erkenntnis der Erscheinungswelt das Auge und die Sinne gelten lasse, aber für die Erkenntnis über unser Woher und Wohin nicht ebenfalls die Mittel unserer Erkenntnis zulasse, sondern uns auf den Glauben, auf die Offenbarungen alter Bücher und Propheten verweise. Der Monismus verheißt aber eine Erkenntnisentwickelung, ebenso wie er für die Lebewesen eine Artentwickelung habe feststellen können. In den Schriften der Vedantaphilosophie existiere ein Gespräch, worin ein Jünger den Lehrer fragt: Was geschieht, wenn ich sterbe?... Der Lehrer erwidert: Das Feste und Flüssige deines Leibes wird wieder zum Festen und Flüssigen, denn der Mensch ist wie ein Stein und Tier, auch die Äußerungen deines Denkens und Handelns lösen sich auf in deiner Umgebung, aber es bleibt übrig die «Entwicklung», der Grund dessen, was deine Persönlichkeit gebildet hat. - So monistisch im Keime denke schon die Vedantaphilosophie. Was im Tier nur im Unbewußten lebe, nämlich der Drang zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, müsse im Menschen ins vollste Bewußtsein treten und im Bewußtsein als Ideal aufgehen.
Fritz Sänger polemisierte gegen Dr. Steiner. Die Theosophen gäben stets vor, die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft schon voraus besessen zu haben und noch zu besitzen, aber Proben solcher Uberlegenheit hätten sie noch nie gegeben. Er befürchte, daß eine solche Bewegung nur zu sehr geeignet sei, die Resultate der modernen Naturwissenschaft wieder zu untergraben; trotz ruhigster Beobachtung habe er im Spiritismus nur den Ausdruck des Blödsinnes finden können, die Tatsache des Hypnotismus müsse er jedoch anerkennen.
Nachdem noch Köhn in warmen eindringlichen Worten für Herrn Dr. Steiner eingetreten war, bemerkte O. Lehmann-Rußbüldt, daß die Ausführungen Herrn Sängers typisch wären für die Vertreter der sogenannten Naturwissenschaft aller Zeiten. Vor fünfzehn Jahren hätte mit ihr Sänger noch die von Krafft-Ebing
unter anderem demonstrierte Tatsache für Unsinn erklärt, daß ein einem Hypnotisierten aufgelegtes Lindenblatt wie ein glühendes Stück Eisen eine Brandwunde zieht, wenn der Hypnotisierte es für ein solches ansehen soll; ebenso wie vor hundert Jahren die französischen Materialisten es für Humbug erklärten, daß Meteorsteine aus dem Weltenraum auf die Erde fallen können.
Dr. Steiner wandte sich sodann noch einmal energisch gegen die Verwechslung von Theosophie und Spiritismus. Wenn Herr Sänger solchen Theosophen begegnet sei, die dazu Veranlassung geben, so möge er sich an diese halten, er, Dr. Steiner, lehne das entschieden ab. Er halte es für unmoralisch im philosophischen Geiste, wenn man durch die Manifestationen sogenannter Geister Belehrungen über Schicksal und Menschennatur erlangen wolle, das wäre grober Materialismus. Er lege auch keinen besonderen Wert auf den Namen Theosophie Vor allem sei ihm bedeutsam die hohe Ethik der Theosophie in seinem Sinne, die zum Beispiel in der Pädagogik zu den ernstesten Konsequenzen führe. Welche Perspektive für das Gemüt des Erziehers, wenn er sich bewußt sei, daß er im Kinde einen Keim der Göttlichkeit zu entfalten habe! *
* Unser Berichterstatter, Herr Otto Lehmann.Rußbüldt, der zweite Vorsitzende des Bruno-Bundes, hat das Bedürfnis, dem Berichte hier beizufügen, daß er auch diesen Vortrag neben so vielen anderen bedeutsamen Erscheinungen im Geistesleben als eine Keimzelle neuer Edelkultur ansehe. «Zeiten großer Umwälzung kommen ja nicht wie ein mystisches Etwas über uns; wenn wir sie schaffen, so sind sie da. Die
Bewegung wäre mir mit einem Programm, wie es Dr. Steiner formuliert, willkommen. Hoffen wir, daß frisch einsetzende Lebenskräfte der Verjüngung vor allem lebendigere, dichterisch zündende Worte schaffen können; was sollen uns alle ! Jedenfalls ist der goldene Weizen einer echten Theosophie leider verschüttet worden unter soviel Spreu der Nachplapperei indischer Vokabeln, daß der philosophische Held hochwillkommen sein soll, der ihn in eine neue Scheuer, das heißt unter neuem Namen, sammeln kann.»
HINWEISE
#G051-1983-SE321 - Über Philosophie, Geschichte und Literatur
#TI
HINWEISE
#TX
Im Jahr 1897 übersiedelte Rudolf Steiner von Weimar nach Berlin und übernahm dort die Herausgabe und Redaktion des «Magazins für Literatur» und der «Dramaturgischen Blätter», Organ des deutschen Bühnenvereins. (Die Aufsätze aus dieser Zeit sind enthalten in den Bänden «Gesammelte Aufsätze« der GA Bibl.-Nr. 29, 30, 31, 32.) Neben dieser Tätigkeit hielt er in den folgenden Jahren zahllose Vorträge in verschiedensten Zusammenhängen, wovon jedoch so gut wie keine Nachschriften vorhanden sind. Nur von Rudolf Steiners Vortragstätigkeit innerhalb der «Arbeiterbildungsschule» und der «Freien Hochschule« in Berlin liegen einige wenige Nachschriften vor, die in diesem Band 51 der GA zusammengefaßt sind.
Zum ersten Teil
In den Jahren 1899 bis 1904 unterrichtete Rudolf Steiner an der Arbeiterbildungsschule in Berlin, einer Gründung des Sozialdemokraten Wilhelm Liebknecht. Im 28. Kapitel von «Mein Lebensgang», GA Bibl.-Nr. 28, hat Rudolf Steiner über diese Epoche seines Lebens berichtet. Siehe auch das Büchlein «Erinnerungen an Rudolf Steiner und seine Wirksamkeit an der Arbeiterbildungsschule» von Johanna Mücke und A. A. Rudolph, Neuauflage Basel 1979, das ein lebendiges Bild von Rudolf Steiners Tätigkeit in diesen Zusammenhängen gibt.
Textunterlagen zu den Vorträgen an der Arbeiterbildungsschule
Welt- und Leblensanschauungen von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart: Die kurze Zusammenfassung des Inhaltes von zehn Vorträgen ist von Rudolf Steiner selbst verfaßt.
William Shakespeare: Notizen von Johanna Mücke. Johanna Mücke, 1864-1949, gehörte der sozialistischen gewerkschaftlichen Bewegung und dem Vorstand der Arbeiterbildungsschule in Berlin an. Sie wurde 1903 Mitgiied der Theosophischen Gesellschaft und war von 1908 bis 1935 Geschäftsführerin des von Marie Steiner-von Sivers begründeten Philosophisch-Anthroposophischen Verlages in Berlin, später Dornach. Die Nachschrift von Johanna Mücke ist nach handschriftlichen Notizen von ihr ausgearbeitet, da sie nicht stenographieren konnte.
Über römische Geschichte: Dieser Vortrag ist der einzige des vorliegenden Bandes, der mitstenographiert wurde, und zwar von Franz Seiler,
#SE051-322
1868 - 1959, Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, dem ersten Stenographen von Rudolf Steiners frühen Mitgliedervorträgen. In Franz Seilers Stenogrammheft ist das Vortragsdatum des 19. Juli 1904 angegeben. Vermutlich handelt es sich um einen der letzten Vorträge des Kurses «Geschichte der Urvölker und des Altertums bis zum Untergang der Römerherrschaft«, die nach dem «Vortragswerk Rudolf Steiners« von Hans Schmidt vom 5. April bis 14. Juni 1904 datiert sind. Eine Überein-stimmung mit einem dieser Daten ließ sich nicht feststellen. Aus Notizen von Marie Steiner-von Sivers ist zu entnehmen, daß am 26. Juli 1904 ein weiterer Vortrag in der Arbeiterbildungsschule stattfand mit dem Thema «Das Verhältnis der germanischen Völker zum Christentum». Von den übrigen Vorträgen dieses Kurses gibt es keinerlei Nachschrift.
Geschichte des Mittelalters bes zu den großen Erfindungen und Entdeckungen (10 Vorträge): Die im Jahre 1936 erschienene 1. Auflage enthielt nur acht Vorträge vom 18. Oktober bis 20. Dezember 1904. Die in dieser früheren Veröffentlichung fehlenden zwei Vorträge werden von Hans Schmidt im «Vortragswerk Rudolf Steiners» auf den 4. und Ii. Oktober 1904 angesetzt. Abweichend hiervon sind diese beiden Vorträge im vorliegenden Bande als neunter und zehnter Vortrag abgedruckt mit den Daten 28. und 29. Dezember 1904. Die Richtigkeit dieser Anordnung ergibt sich aus dem thematischen Zusammenhang.
Zum zweiten Teil
Im Herbst 1902 hatte Rudolf Steiner an der von Wilhelm Bölsche und Bruno Wille gegründeten Freien Hochschule in Berlin den Unterricht in Geschichte übernommen und hielt bis zum Dezember 1905 dort jeweils während des Wintersemesters Vortragskurse, unter anderem über folgende Themen: «Deutsche Geschichte von der Völkerwanderung bis ins 12. Jahrhundert«, «Deutsche Geschichte von der Gründung der freien Städte bis zu den großen Erfindungen und Entdeckungen im Beginne der Neuzeit», «Geschichte der Mathematik und Physik«, «Vom Germanentum zum Staatsbürgertum» und «Deutsche Mystik und ihre Voraussetzungen». Nur von einem Teil des zuletzt genannten Kurses liegen Nachschriften vor.
Textunterlagen zu den Vorträgen an der Freien Hochschule
Platonische Mystik und Docta ignorantia: Notizen von Mathilde Scholl. Mathilde Scholl, 1868 - 1941, war seit 1903 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft und von 1905 bis
#SE051-323
1914 Rerausgeberin des Gesellschaftsorgans «Mitteilungen für die Mitglieder der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft«. Sie leitete bis 1914 die anthroposophische Arbeit in Köln und lebte später in Dornach.
Schiller und unser Zeitalter (Neun Vorträge): Aufzeichnungen von Marie Steiner-von Sivers und Johanna Mücke.
Zum dritten Teil
Der «Giordano Bruno-Bund für einheitliche Weltanschauung» wurde im Jahre 1900 von Dr. Bruno Wille, 1860-1928, und anderen Literaten des Friedrichshagener Kreises begründet. Wille war auch Leiter der Zeitschrift «Der Freidenker», in der die hier abgedruckten Referate erschienen. Zur Tätigkeit Rudolf Steiners innerhalb des Giordano Bruno-Bundes siehe die ausführliche Darstellung in der Schriftenreihe «Beiträge zur Rudolf Steiner-Gesamtausgabe», Heft 79, Ostern 1983.
Als Einzelausgaben sind erschienen:
Welt- und Lebensanschauungen. Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Berlin 1901
Geschichte des Mittelalters bis zu den großen Erfindungen und Entdeckungen. Acht Vorträge, vom 18. Oktober bis 20. Dezember 1904, Dornach 1936
Schiller und unser Zeitalter. Zehn Vorträge, Januar bis März 1905, 1. Auflage Berlin 1905
Schiller und unser Zeitalter. Neun Vorträge, 21. Januar bis 25. März 1905, Dornach 1932
Folgende Vorträge wurden in Zeitschriften veröffentlicht:
Welt- und Lebensanschauungen von den ältesten Zeiten bis zur Gegen-wart. Zehn Vorträge 7. Januar bis 11. März 1901; «Gegenwart» 1958, Hefte 10-12
William Shakespeare, 6. Mai 1902; Nachrichtenblatt 1945, Nr.4 Geschichte des Mittelalters bis zu den großen Erfindungen und Entdekkungen. Acht Vorträge 18. Oktober bis 20. Dezember 1904; Nachrichtenblatt 1934 Nrn. 47-50,52, 1935 Nrn. 1,29,30,31,32
Platonische Mystik und Docta ignorantia. 29. Oktober, 5. und 12. November 1904; Nachrichtenblatt 1947, Nrn. 32-35
Werke Rudolf Steiners innerhalb der Gesamtausgabe (GA) werden in den Hinweisen mit der Bibliographie-Nummer angegeben. Siehe auch die Übersicht am Schluß des Bandes.
#SE051-324
Zu Seite
17 Aristoteles, 384-322 v.Chr., «Alle Menschen verlangen von Natur
nach dem Wissen« in «Metaphysik«, einleitende Sätze zu Buch I.
Dante Alighieri, 1265-1321, in «La Divina Commedia».
Hegel (1770 - 1831) «Das Denken macht die Seele...»: In »Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften» Vorrede S. XIX. 2. Aufl. Heidelberg 1827.
18 Angelus Silesius (1624-1677)... daß die Rose einfach blüht, weil sie blüht in «Cherubinischer Wandersmann», wörtlich: »Die Ros ist ohn Warumb; sie blühet, weil sie blühet, Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.«
19 Thales, 624 - 545 v. Chr.
Anaximander, 611-550v. Chr.
20 Kant (1724-1804): «Was kann ich wissen?...» Siehe «Kritik der
reinen Vernunft».
Goethe: «Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst...»: Maximen und
Reflexionen 198.
21 Anaximenes, 588-524 v.Chr.
Heraklit, 535 - 475v. Chr.
22 Empedokles, 483-424 v. Chr.
Aristoteles erzählt uns von Empedokles. In «Metaphysik», Buch I.
23 Darwin stellt sich auch vor...: Charles Darwin (1809-1882) in seinem Werk «Über die Entstehung der Arten», 1859.
Anaxagoras, 500-430 v.Chr.
Perikles, um 500-429v. Chr., Staatsmann in Athen
Euripides um 480 - 406v. Chr., griechischer Tragödiendichter.
Themistokles, um 527-459v. Chr., Athen. Staatsmann.
Demokrit, 460-370 v.Chr.
24 Parmenides, etwa 540 v.Chr. geboren.
26 Aristoteles erzählt von den Pythagoräern: In «Metaphysik» Buch I (frei wiedergegebenes Zitat).
#SE051-325
28 Protagoras, 480-410 v.Chr.
Aristophanes, um 445-um 385 v.Chr.
Gorgias, um 480 - 370v. Chr., Sophist.
Prodic'ts von Keos, Sophist zur Zeit von Sokrates.
Sokrates, 469-399 v.Chr.
31 Cicero hat von Sokrates gesagt Tusculanen i. Buch, 4. Kapitel.
Kyniker: Griechische Philosophen; Pflege der Tugend, Bedürfnis-
losigkeit, Selbstbeherrschung.
Diogenes von Sinope, um 412-um 323 v.Chr.
32 Kyrenaiker: Griechische Philosophen, lehrten die Lebensfreude.
Megariker: Griechische Philosophen, lehrten die Tugend, übten
das Denken.
Euklides von Megara, um 450 - 380v. Chr.
33 Plato, 427-347 v.Chr.
34 Nach der Hinrichtung seines Lehe'ret (Sokrates): Im Jahre 399
v. Chr.
40 «Lieber ein Tagelöhner im Lichte der Sonne...»: Homer, Achilleus
in «Odyssee» ii. Gesang, Vers 489-491.
41 Aristoteles... «Wer für sich allein leben will..»: Zitiert nach Vincenz Knauer, Hauptprobleme der Philosophie, 32. Vorlesung,
Wien/Leipzig 1892.
42 Thomas von Aquino, 1227 - 1274.
44 Epikur, 341-270 v.Chr.
T Lucretius Carus, 96 - 55v. Chr.
Pyrrho, 360 - 270v. Chr.
45 Philo, 25 v. Chr. - 50 n.Chr.
Plotis, 205-270 n.Chr.
46 Augustinus (354 430) «Ich würde dem Evangelium nicht glauben...»: Contr. Epist. Manich 5 zitiert nach Willmann Geschich te des Idealismus» Band 2 Abschnitt IX Braunschweig 1896
Im Christentum Vgl. zu diesem Abschnitt Rudolf Steiner «Mein Lebensgang« Bibl. Nr.28, Kapitel 26. «In Widerspruch mit den Darstellungen die ich später vom Christentum gegeben habe, scheinen einzelne Behauptungen zu stehen die ich damals
#SE051-326
niedergeschrieben und in Vorträgen ausgesprochen habe. Dabei kommt das Folgende in Betracht. Ich hatte, wenn ich in dieser Zeit das Wort «Christentum» schrieb, die Jenseitsiehre im Sinne, die in den christlichen Bekenntnissen wirkte. Aller Inhalt des religiösen Erlebens verwies auf eine Geistwelt, die für den Menschen in der Entfaltung seiner Geisteskräfte nicht zu erreichen sein soll. Was Religion zu sagen habe, was sie als sittliche Gebote zu geben habe, stammt aus Offenbarungen, die von außen zum Menschen kommen. Dagegen wendete sich meine Geistanschauung, die die Geistwelt genau wie die sinnenfällige im Wahrnehmbaren am Menschen und in der Natur erleben wollte. Dagegen wendete sich auch mein ethischer Individualismus, der das sittliche Leben nicht von außen durch Gebote gehalten, sondern aus der Entfaltung des seelisch-geistigen Menschenwesens, in dem das Göttliche lebt, hervorgehen lassen wollte.
Was damals im Anschauen des Christentums in meiner Seele vorging, war eine starke Prüfung für mich. Die Zeit von meinem Abschiede von der Weimarer Arbeit bis zu der Ausarbeitung meines Buches: 48 Thomas von Aquino (1227-1274): «Wenn wir auch zweifeln...» «De trinitate«, Buch X, Kapitel 14, zitiert nach Willmann a.a.O.
49 Meister Eckhart, um 1260 - 1327.
Johannes Tauler, 1300-1361.
Heinrich Suso, 1295 - 1365.
Jakob Böhme, 1575-1624.
Paracelsus (1493 - 1541): «Der Arzt muß durch der Natur Examen gehen«: Opus Paramirum: «Nun ist der Artzt auß der Artzney und nit auß sich selbst, darumb so muß er durch der Natur Examen gehn, welche Natur die Welt ist und all ihr Einfang.«
50/51 Martin Luther (1483 - 1546): »Dieser gottverfluchte Aristoteles»: An Eck 1519; «Die Vernunft ist des Teufels Erahure und Braut«: Polem. dtsche. Schriften 1524/25, nach Ferd. Bahlow «Luthers Stellung zur Philosophie», Berlin 1891.
51 Adolf von Harnack (1851 - 1930): «Die Wissenschaft vermag nicht...»: In »Das Wesen des Christentums» 16. Vorlesung, 4.
#SE051-327
Aufl. Leipzig 1901, S. 188, wörtlich. «Die Religion, nämlich die Gottes- und Nächstenliebe, ist es, die dem Leben einen Sinn gibt, die Wissenschaft vermag das nicht.»
A.a.O. S. 5: «Die christliche Religion ist etwas Hohes, Einfaches und auf einen Punkt Bezogenes: Ewiges Leben mitten in der Zeit, in der Kraft und und vor den Augen Gottes.»
51 Nikolaus Kopernikus, 1473-1543.
Johannes Kepler, 1571 - 1630.
Galilei (1564-1642): «Ihr habt es immer mit eurem Aristoteles...»: Zitiert nach Laurenz Müllner «Die Bedeutung Galileis für die Philosophie», Inaugurationsrede gehalten am 8. November 1894, Wien 1894.
52 Giordano Bruno, 1548-1600.
René Descartes (Cartesius), 1596-1650.
53 Gottfried Wilhelm von Leihniz, 1646-1716.
Christian von Wolff, 1679-1754.
54 John Locke, 1632-1704.
David Hume, 1711 - 1776.
57 Emil Du Bois-Reymond, 1818 - 1896, deutscher Naturforscher. I seiner Rede «Über die Grenzen des Naturerkennens» 1872.
58 Baruch de Spinoza, 1632 - 1677, niederländischer Philosoph.
59 Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814.
60 Friedrich WilbeIm Scbelling 1775-1854.
61 Deshalb hat Marz die Gesetze der ökonomiscben Entwickelung gesucht da, wo sie allein zu finden sind: Diese Bemerkung bedeutet nicht etwa ein Bekenntnis R. Steiners zum Marxismus. Vgl. «Geisteswissenschaft und soziale Frage», drei Aufsätze aus den Jahren 1905/1906, «Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft», GA Bibl.-Nr. 23; sowie besonders in bezug auf Hegel und Marx «Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage» (Acht Vorträge, Dornach 1919), GA Bibl.-Nr. 189.
Geo'g WilbeIm Friedrich Hegel (1770-1831), über Gesetze: In «Grundlinien der Philosophie des Rechts».
Charles Darwin, 1809-1882.
#SE051-328
61 Ernst Haeckel, 1834-1919.
62 Carl Vogt, 1817-1895, Naturforscher.
Jacob Moleschott, 1822 - 1893, materialistischer Philosoph.
LudwigBüchner, 1824-1899, Physiologe.
Ludwig Feuerbach (1804-1872): «Gott ist das offenbare Innere...»:
Zitat aus «Das Wesen des Christentums», Leipzig 1841.
63 Max Stirner 1806-1856.
Arthur Schopenhauer, 1788-1860.
Eduard von Hartmann, 1842-1906.
64 hat schon Schiller ausgesprochen...: Brief Schillers an Goethe vom
23. August 1794, Jena, in «Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794-1805»; Stuttgart 1828.
m me'nem Buche «Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahrhundert»: In der Gesamtausgabe «Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt», GA Bibl.-Nr. 18.
66 Georg Brandes, 1842 - 1927, dänischer Schriftsteller.
August Wilhelm Schlegel, 1767-1845, und Ludwig Tieck. 1773 - 1853, Shakespeare-Übersetzer.
Lord Francis Bacon von Verulam, 1561 - 1626, englischer Staatsmann und Philosoph.
67 Eugen Reichel, 1853 - 1916, Schriftsteller, «Shakespeare-Littera
tur», Stuttgart 1887. Eine Anzahl von Aufsätzen Reichels sind
erschienen in dem von Rudolf Steiner herausgegebenen «Magazin
Für Litteratur«.
70 ChristopherMarlowe, 1564-1593.
73 Kaiser Augustus, 65 v. Chr. bis 14 n.Chr.
74 derjenige Fürst, der am meisten genannt wird: Kaiser Karl der Große, 742 - 814, regierte seit 768 als Frankenkönig. Gekrönt 800 von Papst Len III.
76 Wir haben die Ausbreitung Roms über den Erdkreis beschrieben: In den vorangehenden Vorträgen in der Arbeiterbildungsschule, von denen keine Nachschriften erhalten sind
77 Prätor: Höchster Richter im alten Rom.
#SE051-329
77 Konsul: Höchster Beamter.
Quästor: Finanzbeamter.
78 Tribun: Ursprünglich Vorsteher eines Wahlbezirks. Volkstribun:
Vertreter des Volkes mit Vetorecht gegen den Senat.
..Unterschied... zwischen dem Begrsff «Eigentum» und dem Begriff
«Besitz»: «Besitz« als die tatsächliche Verfügungsgewalt im Gegen
satz zum «Eigentum« als bürgerlich-rechtliche Macht über eine
Sache.
79 Mariüs, 156 - 86 v. Chr., römischer Feldherr und Staatsmann.
Gracchus: Name einer berühmten Familie im alten Rom. Tiberius
Sempronius (Vater) sowie die Söhne Tiberius Sempronius und
Gajus Sempronius, lebten im 2. vorchristlichen Jahrhundert.
80 Octaviüs-Augustüs, später Kaiser Augustus.
81 Hadrian, Pubbus Aelsus, 76 138 n. Chr., römischer Kaiser.
Caracalla, Marcus Aurelius Antöninus, 176-217 n. Chr., römischer Kaiser ab 211.
84 Caligüla Gajus Julius Caesar Germanicus, 12-41 n. Chr., römischer Kaiser ab 37.
Lücian, um 120-180 n.Chr., griechischer Satiriker.
85 Apollonius, römischer Philosoph, zum Christentum bekehrt,
184/85 als Märtyrer enthauptet.
86 Lücretia: Tugendhafte Gattin des Lucius Tarquinius Cöllatinus.
Von Seztus Tarquinius entehrt, tötete sie sich selbst, dies soll den
Sturz des Königtums veranlaßt haben.
87 Klesnens von Alexandrien, um 150-215, christlicher Religionsphilosoph, Leiter der theologischen Schule in Alexandria.
Origenes, 185-254, griechischer Kirchenschriftsteller, bedeutendster Lehrer der Gnosis.
88 Tertüllian, um 160 bis nach 220, lateinischer Kirchenschriftsteller, Hauptwerk «Apölogetikum öder Verteidigung der christlichen Religion und ihrer Anhänger«.
«Die Menge aber der Gläubigen...»: Apostelgeschichte, Kap. 4,
32-37
#SE051-330
90 -.. nach des Konstantin Vorgehen: Konstantin 1., genannt «der Große», um 285 - 337, römischer Kaiser, anerkannte das Christen. tum als Staatsreligion durch das Edikt von Mailand im Jahre 313.
Konstantiner: Nachfolger des Konstantin I. ist sein Sohn Konstantin II., Kaiser im westlichen römischen Reich von 337-340.
das nicäischa Konxil: Durch das Konzil von Nicäa in Nordwest-Anatolien (Türkei), von Konstantin I. einberufen im Jahre 325, wurde die Glaubensformel der Wesenseinheit des Sohnes mit dem Vater angenommen.
Ariüs in Alexandrien, lebte im 4. Jahrhundert, gest. 336. Lehrte, daß Christus nicht selbst Gott ist, Sohn nicht gleich Vater.
Athanasius, um 295 - 373, Bischof von Alexandrien. Lehrte Wesensgleichheit von Christus mit Gottvater. Schrift: «Orationes contra Arianos».
Er tritt zum Chrsstentüm über, aber nwht zum athanasicben, son-dem zum aranischen: Siehe zu dieser Frage: Jakob Burckhardt «Die Zeit Konstantins des Großen« im Kapitel «Konstantin und die Kirche«.
93 «Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit...» Friedrich Schiller in seinem Drama «Wilhelm TeIl» 4. Aufzug, 2. Szene.
96 Goethe hat gesagt...: Sprüche in Prosa, Nr.779. Wörtlich: «Das
Beste, was wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus,
den sie erregt.«
97 König Asoke: Auch Aschoka, 259 - 226 v. Chr., indischer Mauria
König.
Tadtus, um 55 - 120, römischer Geschichtsschreiber, u.a. «Germania».
99 Roland, Tristan, Parzival: Von Chrestien de Troyes, Gottfried von Straßburg, Wolfram von Eschenbach.
101 Kompaß- Soll von Marco Polo aus China nach Europa gebracht worden sein, um 1300.
Schießpulver: Bereits vor Chr. in China bekannt. In Europa erfunden von Berthold Schwarz, Franziskaner, um 1300: Schwarzpulver.
Erfindung der Büchdruckerkunst: Durch Joh. Gutenberg, um
1400-1468.
#SE051-331
102 Franz Palacký; 1798 - 1876, tschechischer Historiker und Politiker, Panslawist.
hussitische Bewegung: Geht zurück auf Joh. Hus (um 1369-1415), tschechischer Reformator, verbrannt 1415.
Marko Kraljevié - Marko der Königssohn, Hauptheld der serbi schen und bulgarischen Volkspoesie.
103 John Wiclifi, um 1326-1386, englischer Reformator.
Kaiser Heinrich IL, 973 - 1024.1146 heiliggesprochen.
Johann Militsch, tschech. Mileæ, Domherr und Archidiakon in Prag. Vorläufer des Joh. Hus. Ging 1374 zum Papst nach Avignon, um sich vom Verdacht der Ketzerei zu reinigen. Starb dort im gleichen Jahr. Seine Schriften wurden verbrannt.
den Gedanken der Humanität, wie ihn Herder aü'ges'rocben hat:
Johann Gottfried Herder, 1744-1803, Theologe, Dichter und Philosoph. Siehe seine Schrift «Briefe zur Beförderung der Humanität«, 1793.
los das Wort Hegels: Wörtlich: «Die Weltgeschichte ist der Fortschritt der Menschheit im Bewußtsein der Freiheit:» Siehe «Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte», 3. Aufl. Berlin 1848, Einleitung S. 24.
107 Wie wir aus den Scholien zur ilias e'fahren: Die Angabe konnte nicht nachgewiesen werden.
110 Ulfilas (Wulfila), um 310-383, Bischof der Westgoten, Arianer, übersetzte die Bibel ins Gotische.
111 Chlodwig Name fränk. Könige. Chlodwig 1., 466-511, wurde
496 Christ.
120 Johannes Scotus Erigenn, 810 - 877, bedeutender Denker des Früh-mittelalters, lebte am Hofe KarIs des Kahlen. Hauptwerk «Über die Einteilung der Natur».
121 Aquitanien: Alter Name für Südwest-Gallien, etwa heutige Provinz Guyenne im Südwesten Frankreichs.
Attila, König der Hunnen von 434-453.
122 Schlacht auf den katalaüniscben Feldern: Bei Troyes in der
pagne im Jahre 451.
Leo der Große, Papst von 440-461.
#SE051-332
125 Nikolaus Kopernikus, 1473-1543.
Odoaker (433 - 493) germanischer Heerführer, stürzte 476 das weströmische Reich und den letzten weströmischen Kaiser, Romulus Augustinus.
Justinian L, 482/3 - 565, seit 527 oströmischer Kaiser.
wie die Goten durch Kaiser Justinian aus Italien vertrieben werden:
Im Jahre 553.
126 wie die Lan goharden von Norditalien Besitz ergreifen: Im Jahre 570.
129 Columban,, um 600, Missionar des iro-schottischen Christentums.
Gallus, um 555 bis um 645, irischer Missionar, Begründer der Mönchsschule in St. Gallen.
Winfrid Bonifatius, um 672 - 754, christlicher Missionar in den germanischen Landen.
130 ein fränkisches Rechtsbüch: Das sogenannte «Salische Gesetz» (Lex Salica), um 500 n. Chr. niedergeschrieben.
131 Mohammed: Üm 570-632, Begründer des Islam.
133 Wilhelm von Hümboldt, 1767-1835, deutscher Staatsmann und Philosoph, Sprachforscher.
aber bei den Arabern der wahre Aristoteles: Von den Schriften des Aristoteles kamen die philosophischen Schriften direkt nch Europa, während die naturwissenschaftlichen zu den Arabern gelangten und über diese erst nach dem christlichen Europa kamen.
Karl Martell, um 688-741.
134 Walther von der Vogelweide, um 1170 bis um 1230, mittelhoch-deutscher Dichter.
«Gar bänglich bedachte ich mir...»: Aus «Der Wahlstreit»: Die drei Dinge.
136 Kolonen: Persönlich freie, aber (erblich) an ihren Landbesitz gebundene Pächter in der römischen Kaiserzeit.
137 Pippin dem Kleinen: Pippin III., 714-768, Vater Karls des Großen.
Childerich... abzusetzen: im Jahre 751/52.
Wdükind, unterwarf sich im Jahre 785
139 Herzog Tassilo, Herzog von 748 - 782.
#SE051-333
141 Wolfram von Eschenbach, um 1170 bis nach 1220, bedeutendstet mittelhochdeutscher Dichter, «Parzival», «Willehalm», «Titurel».
Hartmann von der Aus, um 1170 bis nach 1210, mittelhochdeutscher Dichter, «Erec«, «Iwein«, «Der arme Heinrich».
145 nach dem Worte Hegels: Siehe Hinweis zu Seite 61.
149 Ludwig der Fromme, 778 - 840, seit 814 Kaiser, abgesetzt nach der Schlacht auf dem Lügenfelde 833. Im Jahre 843 Teilung des Reiches.
150 ... werden diese Wissenschaften gelehrt: Die sogenannten «sieben freien Künste«: Grammatik, Logik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik.
151 «Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen...»: Goethe, «Faust I», Nacht, 366-367.
152 Karl III, derDicke, 839-888, Kaiser seit 881,887 abgesetzt.
153 Arnulfvon Kärnten, um 850-899, Kaiser von 896-899.
155 Aufdie Karolinger folgte...:
Karolinger bis 911
Konrad I.(Franke) 911- 918
Sächsisches Haus: Heinrich I. 918 - 936
Otto I. 936- 973
Otto II. 973-983
Otto III. (983) 996 - 1002
Heinrich II. 1002 - 1024
Fränkisches (Salisches) Haus: Konrad II. 1024-1039
Heinrich III. 1039 - 1056
Heinrich IV. 1056-1106
Heinrich V. 1106-1125.
156 Schlacht bei Löwen: flämisch Leuven, im Jahre 891.
156/157 finnisch-ügrischa Völkerschaften..., die Magyaren: In das DonauTheiß-Gebiet, um das Jahr 900.
159 Adalbert von Preußen,, eigentlich Adalbert von Prag Apostel der Preußen, seit 982 Bischof von Prag, starb 997 den Märtyrertod, war befreundet mit Kaiser Otto III.
Clüny: War Ausgangspunkt der auf Befreiung der Kirche von der Herrschaft des Kaisertums gerichteten Reformation.
160 Gregor VII., Mönch Hildebrand, Papst von 1073 - 1085.
#SE051-334
160 Diese Gesinnung... ist von... Dante als gerecht anerkannt: In seinem Buche «De Monarchia».
163 «Was ihr den Geist der Zeiten heißt...»: Goethe «Faust 1«, Nacht,
577-579.
169 Konrad von Marburg, Beichtvater der heiligen Elisabeth von Thü
ringen, päpstlicher Inquisitor; wurde 1233 von Rittern erschlagen.
Albertus Magnus, 1193 - 1280, Dominikaner, scholastischer Philo
soph, Doctor universalis.
Kaiser Friedrich Berbaross', 1125 - 1190, Kaiser seit 1155.
171 Johannes Tauler, um 1300-1361.
Heinrich Suso, 1295 - 1366, deutsche Mystiker.
«Theologie deutsch» Siehe Hinweis zu Seite 215
175 Vineta (Wendenstadt): Wendischer Handelsplatz des Nordens auf
der Insel Wollin (Ostsee), im 10. und ii. Jahrhundert. 176 Tizian,, um 1476-1576, italienischer Maler.
Kaspar Zöllner, erfand 1498 die gezogenen Läufe für Gewehre
(nach Reinhold Günther, «Deutsche Kulturgeschichte», Leipzig
1902).
180 Im ersten richttgen Kreuzzug: 1096-1099 unter Gottfried von Bouillon, gestorben 1100.
Rudolf von Schteaben, Gegenkönig zu Heinrich IV., wurde 1077 gekrönt.
Ghibellinen: Staufen-Anhänger.
Guefen: Vertraten die päpstlichen Interessen.
Bernhard von Clairvaux 1090 - 1153, Abt, Kreuzzugsprediger.
Frieden von Konstanz: 1183.
182 Unter dem Staufenkaiser Friedrich II. (1215 - 1250) geschah derMongoleneinfall: Schlacht bei Liegnitz im Jahre 1241. Die Mongolen siegten, zogen sich aber aus nicht leicht verständlichen Gründen zurück.
183 Jacob von Molay, um 1250-1314, letzter Großmeister des Templerordens.
#SE051-335
183 Albert von Bre'nen: Albert von Buxhövden, um 1165-1229,
Bischof und Gründer von Riga. Missionar der baltischen Länder.
184 Richardvon Cornwall, 1209-1272.
Alfons von Gastilien,, 1226-1284, regierte 1252-82.
Rudolfvon Habiburg, 1218-1291, Kaiser ab 1273.
Heinrich Jasomirgott, Markgraf und Herzog von Österreich,
1114-1177.
186 Einfälle der Türken: ab 1353.
Ottokar von Böhmen, 1230 - 1278.
Aufttand der Schweizer Eidgenossen und Bildung der Eidgenossen-
schaft. Bundesbrief 1291.
Albrecht I. von Österreich, Kaiser von 1298 - 1308.
187 Adoifvon Nassau, Kaiser von 1292-1298.
Heinrich VII. von Luxemburg, Kaiser von 1308-1313.
188 So würde der Papst nach Avignon geführt: Er residierte dort von
1309-1377.
Karl IV, Karl von Luxemburg: Regierte 1346-1378, Kaiser seit 1355.
189 Kaiser Sigismund, regierte von 1410-1437.
190 Konzilvon Konstanz: 1414-1418.
Girolamo Savonarola, 1452 - 1498, Dominikaner in Florenz, Gegner der Medici, sittlicher Prediger und Reformer, als Ketzer verbrannt.
Jean le Charlier de Gerson,, 1363 - 1429. einer der gelehrtesten Theologen des 15. Jahrhunderts.
191 Kaiser Friedrich III., 1415 - 1493, Kaiser seit 1452.
192 Armer Konrad: Bauernbund im Bauernaufstand 1514 in Württemberg, Anführer Götz von Berlichingen.
Bunaschuh: Namen und Feldzeichen aufständischer Bauernver
bände, seit 1493.
193 Johannes Reuchlin,, 1455-1522, deutscher Humanist.
Erasmus von Rotterdans,, 1466-1536, Gelehrter und führender Humanist.
#SE051-336
193 Bartolomeo Diaz, 1450-1500, Portugiese.
194 Vasco da Gama, 1469 - 1525, portugiesischer Seefahrer.
Christoph Kolumbus, 1451 - 1506.
199 Gnosis: Wesentlichste Erkenntnislehre der ersten christlichen Jahrhunderte. Hauptvertreter Origenes und Klemens von Alexandrien. Siehe Hinweis zu Seite 87. Vgl. auch Rudolf Steiner
«Christus und die geistige Welt» (6 Vorträge, Leipzig 1913/14), GA Bibl.-Nr. 149.
Dion ysiüs Areopagita: Erster Bischof von Athen, von Paulus bei kehrt, Märtyrer. «Schriften« in zwei Bänden, 1823.
201 Dies ist bei Aristoteles klar ausgeführt: In der «Metaphysik», Pader-born 1951, Kapitel XI.
209 Goethe sagt: «Denn solang du das nicht hast...»: In seinem Gedicht «Selige Sehnsucht«, S. Strophe.
210 Johannes von Ruysbroek. 1293 - 1381, flämischer Mystiker, Priot im Augustinerkloster Groenendaal. Werk «Die Zierde der geist. lichen Hochzeit« 1350, deutsch 1923.
Nikolaus von Kues, 1401 - 1464, Philosoph und Kardinal.
211 Konzil von Basel: 1431-1443.
«Brüder des genteinsamen Lebens»: (Fratres communis vitae). Aus der «Devotio moderna» im 14. Jahrhundert allmählich sich entwickelnde Form einer klösterlichen Gemeinschaft ohne bindende Gelübde. Siehe auch Seite 192.
212 «De docta ignorantia»: Erschien im Jahre 1440.
Johannes Müller, 1801 - 1858, Physiologe, Anatom, Naturforscher. Hermann von Helmholtz, 1821 - 1894, Mediziner und Naturforscher.
215 «Theologie deutsch». Ein Neudruck derselben ist nach einer Handschrsft von 1497 durch Franz Pfeiffer besorgt worden: Siehe Georg Baring «Bibliographie der Ausgaben der Theologia deutsch«
(1516-1961).
218 Karl Julius Scbröer, 1825 - 1900, österreichischer Literarhistoriker, Professor für Literatur an der Technischen Hochschule in Wien. Siehe Rudolf Steiner «Mein Lebensgang», Seiten 54 - 58, Bibl.-Nr. 28.
#SE051-337
219 Herman Grimm, 1828 - 1901, deutscher Kunst- und Literarhistort
ker.
Henrik Ibien,, 1828 - 1906.
Emile Zola, 1840-1902.
Lete Nikolajewitsch Graf Tolstoi, 1828 - 1910.
221 Jülien Offray de Lamettrie, 1709 - 1751, französischer materialisti
scher Philosoph. Hauptwerk: «L'homme-machine.» Schon Goethe klagt...: In «Dichtung und Wahrheit», ii. Buch.
Paul H. D. Baron dHolbach, 1723 - 1789, französischer atheistischer Philosoph, gehörte zu den Pariser Enzyklopädisten. Haupti werk: «Systéme de la nature.»
Jean Jaeques Rousseau, 1712 - 1778, französischer Kulturphilosoph
schweizerischer Herkunft.
223 Friedrich Gottlieb Klopstock. 1724 - 1803, Hauptwerk: «Messias».
224 Marquis Posa: Eine der Hauptgestalten in Schillers Drama «Don Carlos».
225 In seinen «Briefen über die ästhatische Erziehung...»: Im 12.113. und
14./15. Brief.
230 «Wie alles sich zum Ganzen webt...»: «Faust I», Nacht, 447.
231 Wolffscha Philosophie: Christian von Wolff, 1679 - 1754, Philosoph
und Mathematiker, Professor in Halle.
John Locke, 1632-1704, engl. Philosoph.
233 «Gerne dien' ich den Freunden...»: Schiller «Die Philosophen, Gewissensskrupel».
236 Christian Gotifried Körner, 1756-1831, Freund Schillers. Später preußischer Staatsminister.
238 «Nur durch das Morgenrot des Schönen. .»: Schiller in seinem Gedicht «Die Künstler».
239 Johann Kaspar Friedrich Manso, 1760-1826, in seiner Schrift «Gegengeschenk an die Sudelköche von Weimar und Jena. Poetische Epistel», Leipzig 1797.
241 Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781.
#SE051-338
241 «Wenn Gott vor mir stünde. - .»: In «Theologische Schriften.» Lessings sämtliche Schriften, herausgegeben von Karl Lachmann, Leipzig 1897, Band 13, Seite 23 ff.
243 Prosahymnüs an die Natur: In «Goethes Naturwissenschaftliche Schriften», herausgegeben und kommentiert von Rudolf Steiner in Kürschners «Deutsche National-Litteratur» (1883-97), Nachdruck Dornach 1975, GA Bibl.-Nr. la-e; Band 2, Seite 5-7.
246 Was Hebbel als notwendige Voraussetzung des Tragischen fordert:
Friedrich Hebbel (1813 - 1863) in «Vorwort zu 248 «Könnte (man) Ihnen zeigen, - - .»: Brief Schillers an Goethe vom i. März 1793.
Es erinnert diese Auffassung an ein Gespräch Schillers mit Goethe...:
Siehe Brief Schillers an Wilh. v. Humboldt am 9. November 1795
in «Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt»,
Stuttgart 1900.
249 Schillers Auffassung... die Hebbel später formulierte: Siehe Hinweis
zu Seite 246.
250 Thomas Garlyle, 1795-1881, englischer Historiker.
251 «Maz, bleibe bei mir. - .»: «Wallensteins Tod«, 3. Aufzug, 18. Auftritt.
253 Edouard Schuré, 1841 - 1929. «Sanctuaires d'Orient» wurde von Marie Steiner-von Sivers ins Deutsche übersetzt unter dem Titel «Die Heiligtümer des Orients», Leipzig 1923.
Richard Wagner, 1813-1883.
258 «Doch was ihr tut. - .»: «Wilhelm Tell«, i. Aufzug, 3. Szene.
259 Friedrich Theodor Vischer, 1807-1887.
Eduard von Hartmann, 1842 - 1906.
Gustav Theodor Fechner, 1801 - 1887.
259/260 «Demetrius».. - «nicht über Sklaven herrschen wollen»: Erster Aufzug: Demetrius in Unterredung mit dem König. Wörtlich:
»Ich will nicht herrschen über Sklavenseelen.»
261 Wilhelm von Humboldt »Er wurde der Welt.. .»: Aus dem Kapitel «Vorerinnerung« zu «Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt«, Stuttgart 1900.
#SE051-339
261 Karl Gützkow, 1811-1878.
263 Caroline von Schlegel, 1763 - 1809, Gattin von August Wilhelm von Schlegel, 1767-1845, später verheiratet mit Schelling.
264 Friedrich von Schlegel, 1772-1829, Bruder von August Wilhelm von Schlegel.
264/265 Das Wort Schillert: «Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt»: in «Über die ästhetische Erziehung des Menschen», Fünf-zehnter Brief.
265 Ludwig Tieck. 1773 - 1853, Dichter der Romantik.
265 Theodor Körner, 1791 - 1813, Dichter, starb den Heldentod in den Befreiungskriegen.
266 Körne's Vater: Christian Gottfried Körner, 1756-1831, Schriftsteller.
In einen' Buch über Schiller: «Schiller-Reden» gehalten von Jacob
Grimm, Ludwig Doederlein, Friedrich Theodor Vischer, August
Stoeber, Carl Grunert, Karl Gutzkow u.a. Ulm 1905.
Jakob Grimm, 1785-1863, Sprachwissenschafter.
Ernst Curtius, 1814-1896, Archäologe und Historiker.
Moriz Carriére, 1817-1895, philosophischer Schriftsteller.
270 Otto Brahtn,, 1856-1912, Literarhistoriker und Kritiker, Mitbegründer der Freien Bühne in Berlin.
Scherer-Schule: Wilhelm Scherer, 1841 - 1886, Germanist, Professor für Literaturgeschichte in Berlin.
Peter von Cornelius, 1783 - 1867, deutscher Maler; Nibelungen-kartons.
271 Jakob Minor, 1855 - 1912, Literarhistoriker.
273 »Welche Religion ich bekenne?»: Schiller, Votirtafeln, Nr.30 «Mein
Glaube».
276 Christian von Wolff 1679-1754, Philosoph und Mathematiker,
Professor in Halle.
Alerander Gottlieb Baumgarten, 1714-1762, Philosoph.
Sokrates, um 470 - 399 v. Chr.
277 Äschylos, um 525 bis um 455 v. Chr.
#SE051-340
279 «Das 280 Goethe gibt dem Ausdruck. indem er das Schöne eine Manifestation der Naturgesetze nennt Maximen und Reflexionen 183.
282 «Weit hinter ihm in wesenlosem Scheine. »: Goethe, Epilog zu Schillers «Glocke».
283 «Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben...» «Faust» II, Palast
11575.
287 Wolfgang Kirchbach, 1857-1906, Schriftsteller, eine der leitenden Persönlichkeiten des Giordano Bruno-Bundes.
292 Wilhelm Ostwald, 1853 - 1932, deutscher Physiker, Chemtker und Philosoph. Auf der Naturforscherversammlung in Lübeck 1895 hielt er eine Rede über »Die Überwindung des Materialismus».
Siehe auch sein Werk «Vorlesungen über Naturphilosophie», 1902.
- etne Zeitschrtft gegründet worden: «Annalen der Naturphilosophie», herausgegeben von Professor Wilhelm Ostwald, 14 Bände,
1901 - 1921.
299 Tycho deBrahe, 1546-1601, dänischer Astronom.
302 Maürice Maeterlinck. 1862-1949, belgischer Schriftsteller; sein Werk »Die Hochzeit der Bienen« erschien auf deutsch 1901 in Jena.
304 Angelüs Silesius (Johannes Scheffler), 1624 - 1677. «Ohn' mich könnt' Gott...»: Wörtlich: «Gott mag nicht ohne mich ein einzigs Würmlein machen, Erhalt ich's nicht mit ihm, so muß es stracks zerkrachen», in «Der Cherubinische Wandersmann».
307 Ludwig Büchner, 1824-1899, materialistischer Philosoph, bekanntestes Werk «Kraft und Stoff« 1855.
311 Monismus und Theosophie: Über diesen Vortrag schreibt Rudolf Steiner an Wilhelm Hübbe-Schleiden am 13. Oktober 1902 (vgl. «Briefe Band II», Bibl.-Nr. 39):
«Es war mir überraschend, wieviel Interesse ich mit meinem Vortrag #SE051-341
stattfinden. Im Verlauf des Vortrags habe ich auch Mrs. Besant und ihre ganze Geistesart charakterisiert. Es wird jetzt eben alles davon abhängen, ob wir imstande sind, so zu wirken, daß man uns durch den Anschluß an die theosophische Bewegung nicht kompromittiert findet. Ich wußte, was ich an dem Abend riskierte. Aber wir haben ein starkes Entweder-Oder nötig. Der Graf Hoensbroech verließ nach meinen ersten Sätzen den Saal. Vor den übrigen mehr als dreihundert Menschen habe ich 1 3/4 Stunden unter - das darf ich wohl sagen - gespanntester Aufmerksamkeit gesprochen.
Ich gebe mich gewiß keinen Illusionen hin, aber ich denke, die anwesend waren, haben zum größten Teil das Bewußtsein davongetragen, daß sie da vor etwas stehen, an dem sie nicht vorübergehen dürfen. Ünd dies Publikum des Giordano-Bruno-Bundes kennt mich als einen Menschen, der in den Naturwissenschaften wohl Bescheid weiß. - Auch an diesem Tage hatte übrigens, wie mir gesagt wird, [Franz] Hartmann seine Berliner Anhänger bei Raatz am Plan-Üfer vereinigt. Von dem, was sich in Berlin Gros der Theosophen nennt, war also nichts da.
Ünd ich kam den Leuten mit echt deutscher Theosophie. Der mittlere Teil meines Vortrags war eine Interpretation des Satzes, den I. H. Fichte 1833 in seinem Buche über i Nun wollen wir sehen, was wird...».
312 nach Haeckel im 22. Gliede seiner organiscben Ahnenreihe: «Natürliche Schöpfungsgeschichte» 2. Band, 2. Teil: Allgemeine Stammesgeschichte, Tierische Ahnenreihe oder Vorfahrenkette des Menschen; Berlin 1898 und «Über den Stammbaum des Menschengeschlechts», Vortrag in Jena 1865.
312 David Friedrich Strauß, 1808 - 1874, deutscher freigeistiger protestantischer Theologe, ...hat es gepriesen, daß die Naturwissenschaft uns vom Wunder erlöst hat: in seinem Werk «Der alte und der neue Glaube», Bonn 1881.
Carl von Linné, 1707 - 1778, Botaniker, ... im 18. Jahrhundert sagi te...: in «Genera plantarium» 8. Aufl. Vindo bonae 1791, Band 1, Seite IV.
#SE051-342
313 Adof von Harnack. 1851 - 1930, evang.4iberaler Kirchenhistori
ker, «Das Wesen des Christentums», 4. Aufl. Leipzig 1901, S. 111ff.
Robert G. Ingersoll, «Moderne Götterdämmerung», deutsch von
Wolfgang Schaumburg, Leipzig o. J.
Galileo Galilei 1564-1642.
314 erschien von dem Sohne Fichtes ein Buch: Immanuel Hermann
Fichte, 1797-1879, Philosoph und Psychologe, «Grundzüge zum
Systeme der Philosophie« Erste Abteilung: Das Erkennen als
Selbsterkennen. Heidelberg 1833.
«Betrachten wir die Naturwesen. »: a.a.O. Seite 316 ff.
315 (Ludwig) Feuerbech... der da sagt, der Mensch hat Gott nach seinem Bilde geschaffen: In «Das Wesen der Religion», Leipzig 1851, S. 224, heißt es wörtlich: «Denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel heißt, sondern der Mensch schuf... Gott nach seinem Bilde.«
Dübec hat die Theosophie eine weibliche Philosophie genannt
Charles Eduard Duboc, 1822 - 1910, Dichter und Schriftsteller, in
der Zeitschrift «Zukunft«, Hg. Maximilian Harden, Jahrg. 1901.
I. Märzheft, Berlin.
316 Antoine Wiertz, 1806-1865, belgischer Maler, lebte in Brüssel (Wiertz-Museum).
Otto LebmanniRußbüidt, Schriftsteller, Geschäftsführer und zeitweise 2. Vorsitzender des Giodano Bruno-Bundes.
318 In den Schrtften der Vedantaphilosophie: Brihadaranyaka Üpanishad 3,2,11 ff.: « #SE051-343
SACHWORT- ÜND NAMENREGISTER
Abdera 28
Abendmahl 144
Adalbett von Bremen 161, 183
Adalbert von Preußen 159
Achilleus 40
Adel 128, 140, 150, 154, 164, 166, 174,181, 184
Adolf von Nassau 187
Adrianopel 116
Ägypten 34,35, 131,204,214
Äonenlicht 214, 215
Äschylos 253,255, 277
Ästhetik 259, 267,271,276
Afrika 117, 193
Nordafrika 132
Agrigent 22
Alanen 110
Alarich I. 116
Albertus Magnus 169
Albrecht I. (Kaiser) 186
Albrecht von Österreich 187
Alessandria 180
Alexander der Große 37, 133
Alexandria (Alexandrien) 45, 87
Alfons von Castilien 184
Amerika 96
Amiens, Peter von 166, 179
Anända 214216
Anaxagoras 23,27
Anaximander 19,21
Anaximenes 21
Angelus Silesius 18, 49, 208, 304
Angelsachsen (Volk) 129
Angelsachsen (Land) 133
«Annalen für Philosophie» 239
Apollonius (von Tyana) 85
Aquino 42,48
Aquitanien 121
Araber 131-133, 142, 143, 159
Arianismus, Arius 90, 96, 110, 111,119, 130
Arier 107
Aristophanes 28
Aristoteles 17, 19, 21, 22, 26, 36
42,44, 50, 51, 53, 120, 133,201, 202,206,268,276,277,280
Arithmetik 151, 152
Arjus, Arianismus 90, 96, 110, 111, 119, 130
Arnulf von Kärnten 153, 156
Asen 108, 113
Asien 131, 132
Asoka 97
Astronomie 151, 152,211
Asura 108
Athanasius 90, 110, 111
Athen 23, 34, 35, 37, 43
Attila 121, 122
Audhumbla 108
Augustinus 46, 48, 52, 203, 313
Augustus 73, 86
Avignon 188
Awaren 139
Bacon, Francis von Verulam 66, 305
Barbarossa, Friedrich 169, 180, 181
Barnabas (Joses) 89
Basel, Konzil von 211
Bauernbündnisse 192
#SE051-344
Baumgarten, Alexander Gottlieb276
«Ästhetica» 276
Bayern (Volk) 139
Bayern (Land) 138, 139, 155
Beamte 82-84, 128, 142, 147, 150, 163, 173, 191
Bergen (Stadt) 175
Berlin 94, 271, 304
Bernhard von Clairvaux 180
Bibelübersetzung 110, 116, 172
Bildung 85, 152, 164, 165
Bischof 156, 159, 164, 166, 173, 177
Bistum 156,161, 187, 190
Blutsgemeinschaft 112
Böhme, Jakob 49
Böhmen (Land) 188, 189
Böhmen, Ottokar von 186
Bonifatius, Winfried 129
Bouillon, Gottfried von 180, 182
Brahe, Tycho de 299, 303
Brahm, Otto 270
Brandenburg (Land) 106, 115, 188
Brandes, Georg 66
Bremen, Adalbert von 161, 183
Breslau 175
Britische Inseln 129
Brüdergemeinden 103
Bruno, Giordano (s.a. GiordanoBruno-Bund) 52, 143,212, 215, 227,230,292,315
Buchdruckerkunst 97, 101, 125, 192
Büchner, Ludwig 62, 269, 273, 307,311
Bürger, Gottfried August 235
Bunsen, Robert Wilhelm 267 «Spektralanalyse« 267
Burgund (Land) 160
Burgunder (Volk) 115, 121
Buttler (aus Schillers »Wallenstein») 250
Byzanz 116
Cäsaren 81, 84, 86,90,92
Caligula 84
Canossa 160, 161
Caracalla, Marcus Aurelius 81, 92
Carlyle, Thomas 250
Carriére, Moriz 266
Cartesius (René Descartes) 52, 53
Carus, T. Lucretius 44
«Über die Natur» 44
Castilien, Alfons von 184
Chatten 106, 112
Chemie 97, 132, 143
Cherusker (Volk) 127
Childerich III. 137
China 162
Chinesen 113
Chit 214-216
Chlodwig 111, 162
Christentum 46, 51, 73-75, 83,
84, 87-92, 109-111, 117, 119,
120, 122, 123, 125, 129-132,
134, 144, 146, 148, 158, 162,
180-184, 189, 190, 193, 278,
317
Christus (s.a. Jesus) 46, 47, 49, 111, 130, 160, 165, 166, 182,
204, 207, 210
Chtypff, Nikolaus, von Kues s.u. Nikolaus von Kues
#SE051-345
Cicero, Marcus Tullius 31
Clairvaux, Bernhard von 180
Clermont (Stadt) 179
Cluniazenser 159
Cluny 159, 160
Columban 129
Cornelius, Peter 270
Curtius, Ernst 266
Cusanus s. Nikolaus von Kues
Cypern 43, 89
Cyrene 34
Dänen 139, 156
Dante, Alighieri 17, 68, 101, 160, 170,268
Darwin, Charles 23, 61, 266, 298
«Die Entstehung der
Arten« 61,266
«Der Kampf ums Dasein» 23
Demokrit 23, 24
Descartes, René 52, 53
Deutsche 103, 107,129
Deutschland 66, 97, 107, 109, 125, 147, 150, 152, 154, 159, 166, 167, 169, 170, 171, 184, 211,222,225,238,315
Mitteldeutschland 175
Norddeutschland 175
Süddeutschland 99, 171, 174
Devas 108
Dialektik 150, 151
Diaz, Bartolomeo 193
Diogenes (von Sinope) 31
Dionysios Areopagita 199, 200
Dionysos 253, 255,277
docta ignorantia, De 199-216
Dogma, Dogmatismus 83,84, 89, 90, 94, 129,132, 144, 165, 166, 183
Dogmenrecht 83
Doktor 151
Dominikaner 182, 188
Donau 106,109, 114, 116, 145
Dorfgemeinschaft 112, 113, 147
Drama, griechisches 247, 249, 277
Dreißigjähriger Krieg 242
Dresden 229,261
Dualismus 230-232, 234,288-290, 318
Duboc, Julius 315,316
Du Bois-Reymond, Emil 57.271
Eckermann, Joh. Peter 263
Eckhart, Meister 49, 151, 171, 199, 204,207-209, 212
Edda 107
Eigentum 112, 113
Elbe 105, 152
Eleusinische Mysterien 253
Elsaß 192
Empedokles 22, 23,27, 28
England 125, 133, 144
Entdeckungen, große 97, 124, 125, 162, 185, 193
Epikur, Epikureer 42, 44
Erasmus von Rotterdam 193
Erfindungen, große 97, 101, 124, 125, 162, 185
Erfurt 138, 175
Erinnyen 250
Essäer 97
Euklid 32-35
Euripides 23, 253
Fechner, Gustav Theodor 259, 266,267
«Vorschule der Ästhetik» 266
#SE051-346
Feuerbach, Ludwig 62, 315
Fichte, Immanuel Hermann 314
Fichte, Johann Gottlieb 59, 60, 172,314
Finnen (Volk) 156
Florenz 191
Franken (Volk) 110, 115, 117,
119-131, 133, 136139, 146, 148, 150, 162
Franken (Land) 144, 155, 160
Frankfurter, «Der Frankfurter»
216
«Theologia deutsch» 215, 216
Frankreich 85, 86, 99,116, 125, 152, 154, 167, 171, 188,221,238
Südfrankreich 121, 177
Franziskaner 182
Freidenker, «Der Freidenker»
285-319
Freiheit, Freiheitsbewußtsein
104, 118, 145, 154, 169, 172, 173, 222, 274,275
Friedmann, Dr. Hermann 287
Friedrich II. (Kaiser) 182
Friedrich 111. (Kaiser) 191
Friedrich Barbarossa 169. 180.
181
Friesen 106, 112, 127
Fürsten 147, 166, 185, 186, 188, 194
Galilei, Galileo 51,313,315
Gallien 115, 117, 118
Gallier 111
Gallus 129
Gama, Vasco de 194
Geist, s.a. Heiliger Geist 203
Geistige Hebammenkunst 30, 36
Gelassenheit 208
Geldwirtschaft 116, 131
Gemeineigentum 112, 135
Geometrie 151, 152
Gepiden 110,122,126
Germanen 75, 90-92, 98-100, 103-
107, 109,111-117,119,121, 123,
125-127, 129, 133-135, 140, 147,
159, 183
Germanien 91, 97
Gerson, Jean Charlier de 190
Geschichte 96
Geschichte des Mittelalters
94-105
Römische Geschichte 73-93 Ghibellinen 180 Giordano-Bruno-Bund für einheitliche Weltanschauung
285-319
Globe Theater 70
Gnosis 199, 203, 214
Gobinean, Jos. Arthur Graf von 317
Goethe 20, 59, 62, 64, 66, 96,
151, 209, 218, 219, 221, 225,
230, 232-240, 243, 245, 248,
249,256,261-265, 267-271,275,
277,279-283, 303
«Epilog zu Schillers Glocke» 261
«Egmont» 235
«Faust» 151, 230, 234, 238, 271
«Großkophta« 281
«Hymnus an die Natur» 230
«Iphigenie« 235
Metamorphosenlehre 293, 294
Ürpflanze 236
«Wilhelm Meister« 238, 239, 248.263
#SE051-347
«Xenien» 239, 263 Georgias 28 Goten (s.a. Ostgoten, Westgoten) 110, 111,117-119,121-123, 125, 126, 146
Gotik 177 Gottesfreund aus dem Oberland
209
Gottfried von Bouillon 180, 182
Gottfried von Straßburg 171
Gracchen 100
Gracchus 79
Graf, s.a. Landgraf 139, 147, 149, 156
Grammatik 150
Gregor VII. 60, 164, 165, 180
Griechen 98, 99, 103, 104, 109, 202,238,268
Griechenland 29, 34, 82, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 133,
150, 193, 277 Griechisches Drama 247,249 Griechische Kultur 19, 41, 98,
146
Griechische Dramatik 277 Griechisches Mysteriendrama
253
Griechische Tragödie 253, 254, 257
Griechische Weltanschauung
17-45, 47, 52
Grimm, Herman 219, 270, 275
Grimm, Jakob 266
Großgrundbesitz 118, 119, 127-129, 136, 139, 142, 149, 154, 157
Grundbesitz 100, 126,128, 136, 138, 140, 141, 144, 149, 155,
185
Guelfen 180
Gunther (Waltharllied) 121 Gutenberg, Johann Gensfleisch
zum 192 Gutzkow, Karl 261,266
Habsburg, Rudolf von 184, 186
Habsburger 184
Hadrian 81
Haeckcl, Ernst 59, 61, 298, 299, 300,303,308,312
«Welträtsel» 298-300 Hagen von Tronje (Waltharilied)
121
Hagenau (Elsaß) 192 Halys (Fluß, jetziger Name: Kisil-lrmak) 19
Hamburg 175
Handel 140, 141, 157,158, 173, 182
Handwerk, Handwerker 36,140, 157, 158, 169
Hanno von Köln 161
Hanse 175
Harnack, Adolf 51,64, 313 «Wesen des Christentums» 51
Hartmann von der Aue 141 Hartmann, Eduard von 63, 259, 273
«Philosophie des Unbewuß ten» 273
«Das Ünbewußte vom Stand-Punkte der Deszendenzthec< rie und des Darwinismus»
273
Hatto von Mainz 153
Hausmeier 128
Hebammenkunst, geistige 30, 36
#SE051-348
Hebbel, Friedrich 246, 249, 255, 258
«Judith« 258
Hegel, Georg Wilh. Friedr. 17, 60, 61, 105, 145, 267, 305, 314
Heidelberg 171
Heiliger Geist 203,204
Heiliges Römisches Reich 74
Heinrich I. 155, 157
Heinrich II. 103, 155
Heinrich III. 155, 161, 163
Heinrich IV. 155,160, 161, 164, 165, 180
Heinrich V. 155
Heinrich der Löwe 181
Heinrich von Luxemburg 187, 188
Heinrich der Stolze 181
Heliand 130, 165
Hellenen 98
Helmholtz, Herm. Ludw. Ferd. v.
212
Henosis 206
Heraklit 21,22, 24, 27
Herder, Joh. Gottfried von 103, 222,229,232-234,241, 263,266, 269
«Ideen zur Geschichte der Philosophie der Menschheit» 229
Herkules 106
Herminonen 106
Heruler 116, 146
Herzöge 147, 155, 156, 158, 185, 186
Hildesheim 175
Hölderlin, Friedrich 287
«An die Natur« 287
Hörige 140,141, 156, 166, 169
Hohenstaufen (Stamm) 182, 187
Holbach, Paul Heinrich Dietrich, Baron von 221
«SysteHolgers, Maria 287
Hottentotten 312
Homer 85, 109, 268
Horus 204
Hufe 112, 136
Humanismus 193
Humboldt, Wilhelm von 133, 249,261
Hume, David 54, 55,231
Hunnen 110,116, 121, 122, 139
Hus, Johannes 189, 191
Hypnotismus 316,318,319
Ibsen, Henrik 219, 226
Idealismus 257, 261, 273, 275, 276,281
ilias 107
Immunität 137,138
Inder 106, 109, 247
Indien 97, 193, 194
Ingersoll, Robert G. 313
Ingwäonen 106
Irland 99,119, 133, 144
Irmin 106
Isis 204
Island 107
Israel 141
Istwäonen 106
Italien 117, 125, 139, 153, 160, 167, 170, 171,191,193, 225, 268
Norditalien 126, 169, 175, 180
Süditalien 35
Jacob von Molay 183
#SE051-349
Jasomirgott, Heinrich 184
Jena 235,239,241
Jerusalem 180
Jesus (s.a. Christus) 51,130
Johannes der Täufer 183
Johannes (1. Brief des J.) 46
Johanniterorden 182
Joses (Barnabas) 89
Juden 86, 108, 178
Judentum 45,46, 86
Julius (aus Schillers «Philosophische Briefe» bzw. «Theosophie
des Julius») 242, 243, 245, 247
Justinian I. 125
Kant, Immanuel 20, 42, 54-57, 59, 221, 222, 229-234, 242-244, 249,276,279,281, 290,295,313
«Kritik der praktischen Vernunft» 230
«Kritik der reinen Vernunft»
230
«Kritik der Urteilsltraft» 276
Karl der Große 91, 110, 111, 122, 131, 135, 137-139, 141,
147-149, 154, 158, 165
Karl der Kahle 144,200
Karl III. 152
Karl IV. 188
Karolinger 128, 137, 152, 153, 155
Karthago 117
Katalaunische Felder 121, 122
Kategorischer Imperativ 231,232
Katharer 177, 179, 187
Katharsis 206,277,278,280
Katholische Kirche 76, 84, 92, 103, 130
Kelten 99, 107, 116, 119, 120, 129, 133, 148
Kepler,Johannes 51
Ketzer 169, 177, 179, 180, 187
Kirchbach, Wolfgang 287, 291, 293, 297, 305
Kirchhoff, Gustav Robert 267
«Spektralanalyse» 267
Kisil-Armak (Fluß Halys) 19
Kition 43
Klazomenä 23
Klemens von Alexandrien 87
Klopstock, Friedrich Gottl. 223
«Messias« 223
Kloster 36, 133, 138, 141, 142, 145, 150, 162, 164, 165, 191, 192
Köhn (Berlin) 318
Köln 161, 171, 174, 175, 192
Königsberg 221,276
Königtum 128, 136
Körner, Christian Gottfried 266
Körner, Karl Theodor 229, 236, 242,265, 266
Kolonen 136
Kolumbus, Christoph 194
Kompaß 101
Konrad I. 155
Konrad II. 155
Konrad III. 180
Konrad von Marburg 169
Konstantin I. 90
Konstantinopel 212
Konstanz, Konzil von 190
Konzil von Basel 211
Konzil von Konstanz 190
Konzil von Nicäa 90, 111
Kopernikus, Nikolaus 26, 51, 97, 125, 143, 194, 210, 298, 299, 304,306,315
#SE051-350
Krafft-Ebing, Richard Freiherr von 318
Krebs, Nikolaus von Kues s. Nikolaus von Kues
Kreuzzüge 159, 162, 164, 166, 167, 176, 180, 181, 182,241
Kunst 254-256, 270, 272, 275, 280,287
Kusaner, Der
S. Nikolaus von Kues
Kyffhäuser 181, 182
Kyniker 31, 32
Kynosarges 32
Kyrenaiker (Volk) 32
Lachmann, Benedikt 305
Laertes 106
Lamarck, Jean Baptiste Pierre Monete de 298, 299
Lambert von Hersfeld 192
Lamettrie, Julien Offray de 221
Landgraf (s.a. Graf) 140
Lampsakus 23
Langobarden 106, 126, 130, 139, 146
Lateiner 109
Lechfeld 158
Lehmann-Rußbüldt, Otto 316, 318,319
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von 53
Lengefeld, Charlotte von 236
LeoderGroße 122
Lessing, Gotthold Ephraim 66, 241, 268,269, 276, 277
Linné, Karl von 312
Lippe (Fluß) 106, 109
Locke, John 54, 231
Logik 42, 150, 223, 244
Logos 203,207,210
London 66, 70, 175
Lothar I. 149
Lothringen 160
Lotze, Rudolf Hermann 305
Löwen (fläm. Leuven) 156
Lucian 84, 85, 87
«Der Traum« 84
Lucretia 86
Ludwig der Fromme 149
Ludwig das Kind 153
Lübeck 175
Lügenfeld 149
Luther Martin 50, 51, 56, 103, 172
Luxemburg, Heinrich von 187, 188
Lydier 19
Maeterlinck, Maurice 302
Magdeburg 175
Magister 151
Magyaren 156158
Majordomus 128
Mannheim 226
Mannus 106, 113
Manso, Johann Kaspar Friedrich
239
Manu 106
Marburg 169
Marienburg (Schloß) 183
Marius, Gajus 79
Marko 102
Marlowe, Christoph 70
Martell, Karl 133, 137
Marx,Karl 61,267
«Kritik der politischen
Ökonomie» 267
#SE051-351
Materialismus 24, 94, 144, 168, 200, 220, 221, 227, 272, 273, 292,312
Mathematik 26, 55, 58, 96, 132, 148, 199
Mathesis 199
Mauren 132,133, 139, 142, 162, 167
Mayer, Robert 288
Mazedonien 37
Meder (Volk) 19
Medici (Mediceer) 191
Medizin 132, 143
Megara 34
Megariker 32
Meister Eckhart 49, 151, 171, 199, 204, 207-209,212
Merowinger 120, 126, 128, 136, 137
Merseburg 138
Mesopotamien 132
Metaphysik 223
Michelangelo, Buonarroti 267, 268,270
Militsch (Milicius/Mllitz/tschechisch Milec), Johann 103
Minor, Jakob 271
Mithras 181, 182
Mittelalter, Geschichte 94-195
Mittelalter, Weltanschauungen
4657
Mitteldeutschland 175
Mönche, Mönchswesen 92, 119, 120, 129, 141-144, 148, 162, 169, 171, 182
Mohammed 131, 132
Molay, Jacob von 183
Moleschott, Jacob 62
Mongolen 96, 182, 186
Monismus 230, 232, 290, 295,
296,297,311-319
Moor, Karl (aus Schillers «Die
Räuber» 227
Moral 276,278
Morgenland 165, 167
Moses 241
Mücke, Johanna 95
Müller, Johannes 212
Münzen 141
Musik 151,152,256
Muspelheim 108
Mysterien, eleusinische 253
Mysteriendrama 256, 277
griechisches 253
Mysterienkult 253
Mystik (Mystiker) 49, 50, 129, 142, 171, 176, 177, 199-216
Nassau, Adolf von 187
Nat'tralwirtschaft 116, 131
Naturwissenschaft 19, 57, 59, 61, 63, 148, 169, 269, 272, 287-289, 291, 292, 295, 296, 311-315, 318
Neue Weltanschauungen 57-65
Neumann-Hofer, Otto 68
Neuplatonismus 45
Neuzeit,Weltanschauungen 4657
Nicäisches Konzil 90, 111
Nicolai 317
Niederlande 211,242
Niederösterreich 184
Nietzache, Friedrich 43, 247, 253, 254, 256,272
«Die Geburt der Tragödie aus
dem Geiste der Musik» 253, 256,272
Nifiheim 108
#SE051-352
Nikolaus von Kues 210-216
«De docta ignorantia (Von der
gelehrten Unwissenheit)»
212,214,215
Nominalismus 168, 182
Nordafrika 86, 132
Norddeutschland 175
Norditalien 126, 169, 175, 180
Normannen 152,153, 156
Oberland, Gottesfreund aus dem
209
Octavio (aus Schillers «WallenStein») 246
Octavius 80
Oder 105
Odoaker 125
Odysseus 106
Österreich, Albrecht von 187
Österreich (Land) 139, 150.153.
154, 161
Niederösterreich 184
Optimaten 79, 80
Orient 141, 159, 162, 176, 182, 193
Origines 87
Osiris 204
Ostgoten 110,116,117
Ostpreußen 183
Ostwald, Wilhelm 292
Otto I. 155-157
Otto II. 155
Otto III. 155,159
Ottokar von Böhmen 186
Paderborn 138
Palacký, Franz 102, 103
Palästina 86, 97,108,166,182
Papierbereitung 162
Papst 74, 91,130, 131,137, 139, 153, 160, 161, 164, 180, 183, 188, 190
Paracelsus 49,212
Paris (Stadt) 151,152, 190
Parmenides 24-26, 29
«Über die Natur» 25
Parzival 99
Passau 158
Paulsen, Friedrich 64
Paulus, Apostel 47, 199
Pelasger 98
Peloponnesischer Krieg 29
Penzig, Dr. Rudolf 298
Perikles 23
Perser 107-109
Persien 108, 163
Peter von Amiens 166, 179
Petrus 93
Pfaffe 151
Pfaffengasse (Rheingegend) 188
Pfalz 189
Pfeiffer, Franz 215
Phidias 85
Philipp von Mazedonien 37
Philo, Judäus 45
Philosophie 52, 57, 143, 223, 256,287,314,315
Physik 27, 96, 97, 223
Piccolomini, Max (aus Schillers
»Wallenstein») 250, 251
Pippin (Sohn Karls des Gr.) 149
Pippin der Kleine 137, 139
Plato (s.a. Neuplatonismus) 33-
38, 45, 120,129, 146, 151, 199-
216
Pleroma 214-216
Plotin 45
Poitiers 133
#SE051-353
Polen 161
Pontifex Maximus 73, 74, 87, 91
Portugal 193
Prag 103, 171, 189
Preußen (Land) 159, 183
Ostpreußen 183
Westpreußen 183
Privateigentum 112, 113, 135
Prodicus 28
Proletariat 79, 80
Protagoras von Abdera 28, 29
Protestantismus 313
Pseudo-Dionysius 200
Phyrrho 44
Pythagoras, Pythagoräer 26, 27, 35,214,215,230
Rafael (aus Schillers «Philosophische Briefe») 242
Raffael, Santi 267, 270
Rationalist 200
Realismus 168, 182,280,295
Recht, Rechtsprechung 127,136, 139, 160, 179
Recht, Dogmenrecht 83
Recht, römisches 76, 78, 81, 83, 100
Reich (deutsches) 164
Reich (röm.) 74-77, 79, 86, 89-92, 97, 98, 103, 115, 116, 146, 163
Reichel, Eugen 67
Religion, religiös 18, 46, 50, 51, 53, 56,62, 8688, 107, 111, 113, 119, 131, 132, 165, 253-256,
273,313-315
Renaissance 68, 193
Reuchlin, Desiderius 193
Richard von Cornwall 184
Rhein 106, 109, 115, 145, 171, 174, 175, 188, 192
Richter, (Rechtsprechung) 128, 137
Ried(Ort) 158
Rittertum 79, 170
Römer 86, 98, 99, 104, 105, 109, 111, 115, 116, 146
Römisches Christentum 117
Römische Geschichte 73-93
Römische Kultur 84
Römisches Recht 76, 78, 81, 83
Römisches Reich 74-77, 79, 86,
89-92, 97, 98, 103, 115, 116, 146, 163
Römische Weltanschauung 75
Roland (Rolandrage) 99, 102
Rom 73-77, 79, 80-83, 85-88, 100, 101, 107, 116, 117, 120, 122, 129, 130, 133, 144, 161, 165, 176, 180-182, 184, 190
Romanischer Baustil 177
Rotterdam, Erasmus von 193
Rousseau, Jean Baptiste 221,222, 227
Rudolf von Habsburg 184, 186
Rudoll von Schwaben 180
Rußland 96, 107, 125, 175
Ruysbroek, Johannes 210, 215
Sachsen (Volk) 110, 127, 130, 137, 138, 146, 148, 165
Sachsen (Land) 155, 161
Sänger, Fritz 318, 319
Sapieha (aus Schillers «Demetrius« 260
Sarazenen 167
Sat 215,216
Savonarola, Girolamo 190
#SE051-354
Schäfer, Dr. (Berlin) 304, 306, 309
Schelling, Friedrich Wilhelm Johann von 60, 314
Scherer, Wilhelm 270
Schießpulver 101, 162, 176
Schiller 64, 66, 69, 217-283 «Uber Anmut und Würde«
235
«Braut von Messina» 253,
255-257
«Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen»
225, 243,274,277
Brief an Goethe 64, 233
«Demetrius» 255,259,260
«Don Carlos» 229, 232,248
«Fiesco» 227,228,248
«Geisterseher» 281
«Götter Griechenlands» 277
«Jungfrau von Orleans» 252, 255
«Kabale und Liebe» 227, 228, 248,268
«Die Künstler» 247 «Lied von der Glocke» 261, 263
«Maria Stuart» 252,255 Marquis von Posa (aus «Don Carlos») 229, 232
«Naive und sentimentale Dichtung» 238
Octavio (»Wallenstein«) 246 «Philosophische Briefe« 242, 247
»Die Räuber» 227,268 «Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet»
226, 279
«Der Spaziergang» 245
«Theosophie des Julius» 242, 243, 245
«Uber den Zusammenhang der tierischen und geistigen Natur des Menschen» 223
«Wallenstein« 239, 240, 242, 245-252, 260, 265
«Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?» 236, 241
»Welches ist der Zusammenhang zwischen Materie und Geist?» 223
«Wilhelm Tell» 255,258
«Xenien» 239, 263
Schlegel, August Wilhelm 66,
263-265
Schlegel, Caroline von 263
Schlegel, Friedrich von 264
Scholastik 49, 50, 53, 57, 142, 143,168,211,313
Schopenhauer, Arthur 63, 278, 305
Schottland 119, 125
Schreiber (Vervielfältiger) 151
Schreibinstitut 191
Schröer, Karl Julius 218, 219
Schuré, Edouard 253, 277
«Sanctuaires d'Orient» 253
Schwaben, Rudolf von 180
Schwaben (Land) 155, 189
Schwarzes Meer 107, 116
Schweizer Eidgenossen 186, 258
Schwertbrüder 183
Scotus Erigena 120, 144, 200
«Über die Einteilung der Natur» 120, 144
Seidenweberei 162
#SE051-355
Semnonen 115
Sensualismus 231
Shakespeare 6672, 249, 259, 264, 268,313
«Coriolan» 70
«Hamlet» 69-71
«Heinrich V.» 67
«Julius Cäsar» 70
«König I>ear» 70
«Macbeth» 67, 69-71
«Othello» 69, 70
«Richard III.» 249
«Verlorene Liebesmüh» 70
»Wie es Euch gefällt» 70
Sigismund (Siegmund), Kaiser
189, 190
Siegfried (Nibelungenlied) 102
Sinope 31
Sizilien 35
Skandinavien 108
Skeptizismus 42, 44
Slawen 99, 166, 183
Sokrates 28, 30-32, 34-36, 257, 278
Somnambulismus 316
Sophistik 28-30, 43, 83
Sophokles 253
Spanien 99, 115-117, 132, 133, 139, 167
Spektralanalyse 267
Spinoza, Baruch 57,58
Spiritismus 281,311,318,319
Städte 101, 102, 123-125, 131, 133, 140, 143, 145, 153, 157, 158, 162, 164, 169, 170, 172-
179, 185-187, 189, 19 1. 192, 194
Stagira 36
Stamm, Stammesverwandtschaft
106, 109, 110, 112, 113, 119,
121, 123, 126, 127, 132, 136, 137, 147, 149, 152, 154, 155, 163
Steiner, Rudolf 94, 95, 291, 293,
294-296, 298, 305, 307, 311, 316319
«Philosophie der Freiheit» 64
«Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahrhundert» 64
Stern, Dr. Wilhelm 304, 308
Stirner, Max 63, 274
«Der Einzige und sein Eigentum» 274
Stoizismus 42, 43
Straßburg 171
Straßburg, Gottfried von 171
Stratford 69, 70
Strauß, Friedrich 312
Süddeutschland 99, 171, 174
Südfr'nkreich 121, 177
Süditalien 35
Sueven 106
Suso, Heinrich 49, 171, 212, 215
Syrien 132
Tacitus 97, 105-107, 109, 113
«Germania» 97, 105
Tassilo 139
Tauler, Johannes 49,171, 190, 204, 208, 209, 212
Tauschhandel 141
Tempelherren 182, 183
Terczlty (aus Schillers «Wallen
stein») 250
Tertullian 88
Thales 19, 21, 27, 305
Themistokles 23
Theologia deutsch 171, 215, 216
Theosophie 311-319
#SE051-356
Thomas von Aquino 42, 48, 49
Thrakien 37
Thüringen 187
Thüringer 127, 147
Tieck, Ludwig 66, 265
Tizian, Vecellio 176
Tolstoi, Alexei, Graf 219, 226, 272
Totentanz 177
Tragödie 253, 254, 257
Tristan (Heldensage) 99
Türken 186, 193, 194
Tuisto 106, 113
Ugrier 156
Ulfila (Wulfila) 110, 116
Ungarn (Land) 158, 161,188
Universitäten 171
Unwissenheit, Von der gelehrten 212
Uppsala 110
Vandalen 116, 117, 119,122
Vasallentum, Vasalienwesen 118, 127, 128, 155,156
Veda 202
Vedantaweisheit 214, 215, 308, 317, 318
Venedig 176, 193
Vineta 175
Vischer, Friedrich Theodor 259, 266, 267, 271
«Asthetik» 271
Völkerwanderung 98, 110, 117, 118,123, 135, 140,146,162, 194
Vogt (Richter) 149
Vogt, Carl 62
Voltaire, Francois Marie Arouet
de 222
Wagner, Richard 253, 254, 256 Wahrheit 20, 25, 28, 30, 46, 48-
50, 52-55, 58, 59, 62, 89, 151,
255, 269, 280, 291, 298-310 Waldenser 177, 187 Wallenstein, Herzog von Friedland 242, 246, 247
Walter von Habenicht 179
Walter von der Vogelweide 134
Walthari (Walther von Aquitanien, Waltharilied) 121
We 108
Weichsel 105
Weimar 232, 235, 239
Wenden 156
Weltanschauungen 17-65, 75, 220, 240, 269, 270, 272, 285-319
Weser 106, 152
Westgoten 110, 114, 116, 117, 119, 132
Westpreußen 183
Wielif 103, 189, 191
Widukind 137
Wieland, Christoph Martin 222
Wien 171,176
Wiertz, Anton Joseph 316 «Der Mensch der Zukunft» 316
Wili 108
Wille, Dr. Bruno 287, 294
Winckelmann, Johann Joachim
268, 269, 277 Winfried Bonifacius 129 Wissenschaft 18-20, 129,131-133,
143, 146, 148, 150, 151, 162,
167-169, 172, 182, 220, 231,
254, 255, 291, 293, 298-310,
313,314,316
Wolff, Kaspar Friedrich 53, 54, 231, 276
#SE051-357
Wolfram von Esehenbach 141, 171
Wotan 108, 113
Wulfila (Ulfila) 110, 116
Xenien 239, 263 Ymir 108
Zeno von Kition 43
Zölibat 161, 165
Zöllner, Kaspar 176
Zola, Emile 219
Zypern 43, 89
Literatur
- Rudolf Steiner: Über Philosophie, Geschichte und Literatur, GA 51 (1983), ISBN 3-7274-0510-4 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |