Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 28
| vorige GA ◁ ■ ▷ nächste GA |

RUDOLF STEINER
SCHRIFTEN
MEIN LEBENSGANG
Eine nicht vollendete Autobiographie,
mit einem Nachwort
herausgegeben von Marie Steiner 1925
GA 28
2000
Inhalt
- 1861-1879 / Kraljevec, Mödling, Pottschach, Neudörfl
- 1879-1890 / Wien
- III. Studentenjahre 51
- IV. Jugendfreundschaften 73
- Wissenschaftliche Studien (Farbenlehre, Optik) 89
- Hauslehrer in der Familie Specht; Goethestudien 104
- VII. In Wiener Gelehrten-und Künstlerkreisen 118
- VIII. Reflexionen über Kunst und Ästhetik; Redakteur bei der «Deutschen Wochenschrift» 138
- IX. Reisen nach Weimar, Berlin und München 150
- X. Die Philosophie der Freiheit 162
- XI. Über Mystik und Mystiker 169
- XII. Schicksalsfragen 174
- XIII. Reisen nach Budapest und Siebenbürgen; Erinnerungen an die Familie Specht 184
- 1890-1897/Weimar
- XIV. Mitarbeit im Goethe-Schiller-Archiv 198
- XV. Begegnungen mit Haeckel, Treitschke und Laistner 216
- XVI. Unter Gelehrten und Künstlern; Goethe-Versammlungen 230
- XVII. Kritische Bemerkungen zur Ethik 239
- XVIII. Als Gast im Nietzsche-Archiv; Nietzscheana 250
- XIX. Erkenntnisfragen - Erkenntnisgrenzen; unter Künstlern 266
- XX. Weimarer Freundeskreis 281
- XXI. Freundschaften (Neuffer, Ansorge); das Buch «Goethes Weltanschauung» als Abschluß der Arbeit an der Sophien-Ausgabe entsteht 302
- XXII. In und mit Gegensätzen leben können 316
- XXIII. Der «ethische Individualismus» 331
- 1897-1907 / Berlin - München
- XXIV. Redakteur des «Magazin für Litteratur»; Begegnungen mit Hartleben, Scheerbart, Wedekind 339
- XXV. In der «Freien literarischen Gesellschaft»; Berliner Theaterleben 353
- XXVI. Stellung zum Christentum; «Das Christentum als mystische Tatsache» 363
- XXVII. Perspektiven zur Jahrhundertwende; Reflexionen über Hegel, Mackay und Anarchismus 367
- XXVIII. Als Lehrer an der Arbeiterbildungsschule 375
- XXIX. Unter Literaten («Die Kommenden») und Monisten («Giordano-Bruno-Bund») 381
- XXX. Esoterik und Öffentlichkeit 391
- XXXI. Beginn der Zusammenarbeit mit Marie von Sivers 407
- XXXII. Theosophie und Anthroposophie 416
- XXXIII. Innere Aspekte des Buches «Theosophie» 432
- XXXIV. Geist-Erkenntnis und Kunst 437
- XXXV. Über Bücher, Vorträge und ihre öffentliche Wirksamkeit 440
- XXXVI. Esoterische Unterweisungen 446
- XXXVII. Reifung der Seele; Vorträge in Paris 1906 453
- XXXVIII. Der Münchner Theosophen-Kongreß 1907 460
- Nachwort von Marie Steiner 1925 466
- Literatur
I.
In die öffentlichen Besprechungen der von mir gepflegten Anthroposophie sind seit einiger Zeit Angaben und Beurteilungen über meinen Lebensgang verflochten worden. Und aus dem, was in dieser Richtung gesagt worden ist, sind Schlüsse gezogen worden über den Ursprung dessen, was man als Wandlungen in meiner geistigen Entwickelung ansieht. Demgegenüber haben Freunde die Ansicht ausgesprochen, daß es gut wäre, wenn ich selbst etwas über meinen Lebensgang schriebe.
Ich muß gestehen, daß dies nicht in meinen Neigungen liegt. Denn es war stets mein Bestreben, das, was ich zu sagen hatte, und was ich tun zu sollen glaubte, so zu gestalten, wie es die Dinge, nicht das Persönliche forderten. Es war zwar immer meine Meinung, daß das Persönliche auf vielen Gebieten den menschlichen Betätigungen die wertvollste Färbung gibt. Allein mir scheint, daß dies Persönliche durch die Art, wie man spricht und handelt, zur Offenbarung kommen muß, nicht durch das Hinblicken auf die eigene Persönlichkeit. Was aus diesem Hinblicken sich ergeben kann, ist eine Sache, die der Mensch mit sich selbst abzumachen hat.
Und so kann ich mich zu der folgenden Darstellung nur entschließen, weil ich verpflichtet bin, manches schiefe Urteil über den Zusammenhang meines Lebens mit der von mir gepflegten Sache durch eine objektive Beschreibung in das rechte Licht zu stellen, und weil mir das Drängen freundlich gesinnter Menschen im Hinblick auf diese Urteile als begründet erscheint.
Meine Eltern hatten in Niederösterreich ihre Heimat. Mein Vater ist in Geras, einem ganz kleinen Ort im niederösterreichischen Waldviertel, geboren, meine Mutter in Horn, einer Stadt in der gleichen Gegend.
Seine Kindheit und Jugend hat mein Vater im engsten Zusammenhange mit dem Prämonstratenserstifte in Geras verlebt. Er hat stets mit einer großen Liebe auf diese Zeit seines Lebens zurückgeblickt. Er erzählte gerne, wie er im Stifte Dienste geleistet hat und wie er von den Mönchen unterrichtet worden ist. Er war dann später Jäger in gräflich-Hoyos'schen Diensten. Diese Familie hatte ein Besitztum in Horn. Da lernte mein Vater die Mutter kennen. Er verließ dann den Jagddienst und trat als Telegraphist bei der österreichischen Südbahn ein. Er war zuerst an einer kleinen Bahnstelle in der südlichen Steiermark angestellt. Dann wurde er nach Kraljevec an der ungarisch-kroatischen Grenze versetzt. In dieser Zeit fand die Verheiratung mit meiner Mutter statt. Deren Mädchenname ist Blie. Sie stammt aus einer alten Horner Familie. In Kraljevec bin ich am 27. Februar 1861 geboren. - So ist es gekommen, daß mein Geburtsort weit abliegt von der Erdgegend, aus der ich stamme.
Sowohl mein Vater wie meine Mutter waren echte Kinder des herrlichen niederösterreichischen Waldlandes nördlich von der Donau. Es ist eine Gegend, in die erst spät die Eisenbahn eingezogen ist. Geras wird heute noch nicht von ihr berührt. - Meine Eltern liebten, was sie in der Heimat erlebt hatten. Und wenn sie davon sprachen, empfand man instinktiv, wie sie mit ihrer Seele diese Heimat nicht verlassen hatten, trotzdem sie





das Schicksal dazu bestimmt hatte, den größten Teil ihres Lebens fern von ihr durchzurmachen. Als dann mein Vater nach einem arbeitsreichen Leben sich in den Ruhestand versetzen ließ, zogen sie sogleich wieder dahin - nach Horn.
Mein Vater war ein durch und durch wohlwollender Mann, aber mit einem Temperament, das namentlich, als er noch jung war, leidenschaftlich aufbrausen konnte. Der Eisenbahndienst war ihm Pflicht; mit Liebe hing er nicht an ihm. Als ich noch Knabe war, mußte er zu Zeiten drei Tage und drei Nächte hindurch Dienst leisten. Dann wurde er flir vierundzwanzig Stunden abgelöst. So bot ihm das Leben nichts Farbiges, nur Grauheit. Gerne beschäftigte er sich damit, die politischen Verhältnisse zu verfolgen. Er nahm an ihnen den lebhaftesten Anteil. Meine Mutter mußte, da Glücksgüter nicht vorhanden waren, in der Besorgung der häuslichen Angelegenheiten aufgehen. Liebevolle Pflege ihrer Kinder und der kleinen Wirtschaft füllten ihre Tage aus.
Als ich einundeinhalbes Jahr alt war, wurde mein Vater nach Mödling bei Wien versetzt. Dort blieben meine Eltern ein halbes Jahr. Dann wurde meinem Vater die Leitung der kleinen Südbahnstation Pottschach in Niederösterreich, nahe der steirischen Grenze, übertragen. Ich verlebte da die Zeit von meinem zweiten bis zu meinem achten Jahre. Eine wundervolle Landschaft umschloß meine Kindheit. Der Ausblick ging auf die Berge, die Niederösterreich mit Steiermark verbinden:
Der «Schneeberg», Wechsel, die Raxalpe, der Semmering. Der Schneeberg fing mit seinem nach oben hin
kahlen Gestein die Sonnenstrahlen auf, und was diese verkündeten, wenn sie vom Berge nach dem kleinen Bahnhof strahlten, das war an schönen Sommertagen der erste Morgengruß. Der graue Rücken des «Wechsel » bildete dazu einen ernst stimmenden Kontrast. Das Grün, das von überall her in dieser Landschaft freundlich lächelte, ließ die Berge gleichsam aus sich hervorsteigen. Man hatte in der Ferne des Umkreises die Majestät der Gipfel, und in der unmittelbaren Umgebung die Anmut der Natur.
Auf dem kleinen Bahnhofe aber vereinigte sich alles Interesse auf den Eisenbahnbetrieb. Es verkehrten zwar damals in dieser Gegend die Züge nur in größeren Zeitabständen; aber wenn sie kamen, waren zumeist eine Anzahl von Menschen des Dorfes, die Zeit hatten, am Bahnhof versammelt, um Abwechslung in das Leben zu bringen, das ihnen sonst anscheinend eintönig vorkam. Der Schullehrer, der Pfarrer, der Rechnungsführer des Gutshofes, oft der Bürgermeister erschienen da.
Ich glaube, daß es für mein Leben bedeutsam war, in einer solchen Umgebung die Kindheit verlebt zu haben. Denn meine Interessen wurden stark in das Mechanische dieses Daseins hineingezogen. Und ich weiß, wie diese Interessen den Herzensanteil in der kindlichen Seele immer wieder verdunkeln wollten, der nach der anmutigen und zugleich großzügigen Natur hin ging, in die hinein in der Ferne diese dem Mechanismus unterworfenen Eisenbahnzüge doch jedesmal verschwanden.
In all das hinein spielte der Eindruck von einer Persönlichkeit, die von einer großen Originalität war: die
des Pfarrers von St. Valentin, einem Orte, der in etwa dreiviertel Stunden von Pottschach aus zu Fuß erreicht werden konnte. Dieser Pfarrer kam gerne in mein Elternhaus. Er machte fast täglich seinen Spaziergang zu uns und hielt sich stets längere Zeit auf. Er war der Typus des liberalen katholischen Geistlichen, tolerant, leutselig. Ein robuster, breitschultriger Mann. Er war witzig, sprach gerne in Schnurren und liebte es, wenn die Menschen um ihn lachten. Und man lachte noch weiter über das, was er gesagt hatte, wenn er schon lange fort war. Er war ein Mann des praktischen Lebens; und er gab auch gern gute praktische Ratschläge. Ein solcher hat in meiner Familie dauernd fortgewirkt. Die Bahngleise in Pottschach waren an den Seiten begleitet mit Akazienbäumen (Robinien). Wir gingen einmal den schmalen Gehweg, der längs dieser Baumreihe führte. Da sagte er: «Ach, welch schöne Akazienblüten sind da.» Und flugs schwang er sich auf einen der Bäume und pflückte eine große Menge dieser Blüten. Dann breitete er sein sehr großes rotes Taschentuch aus
- er schnupfte leidenschaftlich -, wickelte sorgfältig die Beute ein und nahm das «Binkerl» unter den Arm. Dann sagte er: «Sie haben es gut, daß Sie soviel Akazien haben. » Mein Vater war erstaunt und erwiderte:
«Ja, was können uns die nützen? » «Waaas», sagte der Pfarrer, «wissen Sie denn nicht, daß man die Akazienblüten backen kann wie den Hollunder, und daß sie viel besser schmecken, weil sie ein viel feineres Aroma haben.» Und von der Zeit an gab es oft, wenn dazu Gelegenheit war, von Zeit zu Zeit auf unserem Familientisch «gebackene Akazienblüten».
In Pottschach wurden meinen Eltern noch eine Tochter und ein Sohn geboren. Eine weitere Vergrößerung der Familie fand nicht statt.
Eine sonderbare Eigenheit hatte ich als ganz kleiner Junge. Es mußte von dem Zeitpunkte an, da ich selbständig essen konnte, sehr auf mich acht gegeben werden. Denn ich hatte die Meinung ausgebildet, daß ein Suppenteller oder eine Kaffeetasse nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt sei. Und so warf ich denn jedesmal, wenn ich unbeachtet war, nach eingenommenem Essen, Teller oder Tasse unter den Tisch, daß sie in Scherben zerbrachen. Kam dann die Mutter heran, dann empfing ich sie mit dem Ausruf: «Mutter, ich bin schon fertig.»
Es kann dies bei mir nicht Zerstörungswut gewesen sein. Denn meine Spielsachen behandelte ich mit peinlicher Sorgfalt und hielt sie lange in gutem Zustande. Unter diesen Spielsachen fesselten mich besonders diejenigen, deren Art ich auch heute für besonders gut halte. Es waren Bilderbücher mit beweglichen Figuren, die unten an Fäden gezogen werden können. Man verfolgte kleine Erzählungen an diesen Bildern, denen man einen Teil ihres Lebens dadurch selbst gab, daß man an den Fäden zog. Vor diesen Bilderbüchern saß ich oft stundenlang mit meiner Schwester. Ich lernte an ihnen auch. wie von selbst, die Anfangsgründe des Lesens.
Mein Vater war darauf bedacht, daß ich früh lesen und schreiben lernte. Als ich das schulpflichtige Alter erreicht hatte, wurde ich in die Dorfschule geschickt. Der Schullehrer war ein alter Herr, dem das Schule-Halten eine lästige Beschäftigung war. Mir aber war das Unterrichtet-Werden von ihm auch eine lästige Beschäf-
tigung. Ich glaubte überhaupt nicht, daß ich durch ihn etwas lernen könne. Denn er kam mit seiner Frau und seinem Söhnlein oft in unser Haus. Und dieses Söhnlein war nach meinen damaligen Begriffen ein Schlingel. Da hatte ich es mir denn in den Kopf gesetzt: wer einen solchen Schlingel zum Sohn hat, von dem kann man nichts lernen. Nun aber kam auch noch etwas «ganz Schreckliches» vor. Einmal machte sich dieser Schlingel, der auch in der Schule war, den Spaß, mit einem Holzspan in alle Tintenfässer der Schule zu tauchen und rings um sie Kreise aus Tintenklecksen zu bilden. Der Vater bemerkte dies. Die Mehrzahl der Schüler waren schon fort. Ich, der Lehrersohn und noch ein paar Buben waren zurückgeblieben. Der Schullehrer war außer sich, schimpfte fürchterlich. Ich war überzeugt, er wurde sogar «brüllen», wenn er nicht ständig heiser gewesen wäre. Trotz seines Tobens ging ihm durch unser Benehmen ein Licht darüber auf, wer der Übeltäter war. Aber da kam es doch anders. Die Lehrerwohnung stieß an das Schulzimmer. Die «Frau Oberlehrerin» hatte die Aufregung gehört, kam herein, hatte wilde Augen und fuchtelte mit den Armen. Für sie war es klar, daß ihr Söhnlein das Ding nicht gedreht haben konnte. Sie beschuldigte mich. Ich lief davon. Mein Vater wurde wütend, als ich die Sache nach Hause brachte. Und als die Lehrersleute wieder zu uns kamen, da kündigte er ihnen mit der größten Deutlichkeit die Freundschaft und erklärte: «Mein Bub darf keinen Schritt mehr in Ihre Schule machen.» Und nun übernahm mein Vater selbst den Unterricht. Und so saß ich denn stundenlang neben ihm in seiner Kanzlei, und sollte schreiben und lesen,
während er zwischendurch die Amtsgeschäfte verrichtete.
Ich konnte auch bei ihm kein rechtes Interesse zu dem fassen, was durch den Unterricht an mich herankommen sollte. Für das, was mein Vater schrieb, interessierte ich mich. Ich wollte nachmachen, was er tat. Dabei lernte ich so manches. Zu dem, was von ihm zugerichtet wurde, daß ich es zu meiner Ausbildung tun sollte, konnte ich kein Verhältnis finden. Dagegen wuchs ich auf kindliche Art in alles hinein, was praktische Lebensbetätigung war. Wie der Eisenbahndienst verläuft, was alles mit ihm verbunden ist, erregte meine Aufmerksamkeit. Besonders aber war es das Naturgesetzliche, das mich gerade in seinen kleinen Ausläufern anzog. Wenn ich schrieb, so tat ich das, weil ich eben mußte; ich tat es sogar möglichst schnell, damit ich eine Seite bald vollgeschrieben hatte. Denn nun konnte ich das Geschriebene mit Streusand, dessen sich mein Vater bediente, bestreuen. Und da fesselte mich dann, wie schnell der Streusand mit der Tinte auftrocknete und welches stoffliche Gemenge er mit ihr gab. Ich probierte immer wieder mit den Fingern die Buchstaben ab; welche schon aufgetrocknet seien, welche nicht. Meine Neugierde dabei war sehr groß, und dadurch kam ich zumeist zu früh an die Buchstaben heran. Meine Schriftproben nahmen dadurch eine Gestalt an, die meinem Vater gar nicht gefiel. Er war aber gutmütig und strafte mich nur damit, daß er mich oft einen unverbesserlichen «Patzer» nannte. - Es war dies aber nicht die einzige Sache, die sich bei mir aus dem Schreiben entwickelte. Mehr als meine Buchstabenformen interessierte mich die Gestalt der Schreibfeder. Wenn ich
das Papiermesser meines Vaters nahm, so konnte ich es in den Schlitz der Feder hineintreiben und so physikalische Studien über die Elastizität des Federnmateriales machen. Ich bog dann allerdings die Feder wieder zusammen; aber die Schönheit meiner Schriftwerke litt gar sehr darunter.
Das war auch die Zeit, wo ich mit meinem Sinn für Erkenntnis der Naturvorgänge mitten hineingestellt wurde zwischen das Durchschauen eines Zusammenhanges und die «Grenzen der Erkenntnis». Etwa drei Minuten von meinem Elternhause entfernt befand sich eine Mühle. Die Müllersleute waren die Paten meiner Geschwister. Wir wurden in der Mühle gern gesehen. Ich verschwand gar oft dahin. Denn ich «studierte» mit Begeisterung den Mühlenbetrieb. Da drang ich in das «Innere der Natur». Noch näher aber lag eine Spinnfabrik. Die Rohmaterialien für diese kamen auf der Bahnstation an; die fertigen Erzeugnisse gingen ab. Ich war bei alledem dabei, was in die Fabrik verschwand, und was sich wieder aus ihr offenbarte. Einen Blick «ins Innere» zu tun, war streng verboten. Es kam nie dazu. Da waren die «Grenzen der Erkenntnis». Und ich hätte diese Grenzen so gerne überschritten. Denn fast jeden Tag kam der Direktor der Fabrik in Geschäftssachen zu meinem Vater. Und dieser Direktor war für mich Knaben ein Problem, das mir das Geheimnis des «Innern» des Werkes wie mit einem Wunder verhüllte. Er war an vielen Stellen seines Körpers mit weissen Flocken bedeckt; er machte Augen, die von dem Maschinenwerk eine gewisse Unbeweglichkeit bekommen hatten. Er sprach rauh wie in einer mechanisierten Sprache. «Wie
hängt dieser Mann mit dem zusammen, was jene Mauern umschließen?» Dies unlösbare Problem stand vor meiner Seele. Ich fragte aber auch niemanden nach dem Geheimnis. Denn es war meine Knabenmeinung, daß es nichts hilft, wenn man über eine Sache frägt, die man nicht sehen kann. So lebte ich dahin zwischen der freundlichen Mühle und der unfreundlichen Spinnfabrik.
Einmal gab es auf der Bahnstation etwas ganz «Erschütterndes». Ein Eisenbahnzug mit Frachtgütern sauste heran. Mein Vater sah ihm entgegen. Ein hinterer Wagen stand in Flammen. Das Zugspersonal hatte nichts davon bemerkt. Der Zug kam bis zu unserer Station brennend heran. Alles, was sich da abspielte, machte einen tiefen Eindruck auf mich. In einem Wagen war Feuer durch einen leicht entzündlichen Stoff entstanden. Lange Zeit beschäftigte mich die Frage, wie dergleichen geschehen kann. Was mir meine Umgebung darüber sagte, war, wie in ähnlichen Dingen, für mich nicht befriedigend. Ich war voller Fragen; und mußte diese unbeantwortet mit mir herumtragen. So wurde ich acht Jahre alt. -
Als ich im achten Lebensjahre stand, übersiedelte meine Familie nach Neudörfl, einem kleinen ungarischen Dorfe. Das liegt unmittelbar an der Grenze gegen Niederösterreich hin. Diese Grenze wird durch den Laytha-Fluß gebildet. Die Bahnstation, die nun mein Vater zu besorgen hatte, liegt an dem einen Ende des Dorfes. Man hatte eine halbe Stunde bis zum Grenzfluß zu gehen. Nach einer weiteren halben Stunde kam man nach Wiener-Neustadt.
Die Alpengebirge, die ich in Pottschach ganz in der Nähe sah, waren nun nur noch in der Ferne sichtbar. Aber sie standen eben doch erinnerungweckend im Hintergrunde, wenn man auf die kleineren Berge blickte, die in kurzer Zeit von dem neuen Wohnorte meiner Familie zu erreichen waren. Mäßige Erhebungen mit schönen Waldungen begrenzten den einen Ausblick; der andere konnte über ebenes, mit Feld und Wald bedecktes Land nach Ungarn hineinschweifen. Von den Bergen war mir besonders der unbegrenzt lieb geworden, der in drei Viertelstunden zu besteigen war. Er trug auf seinem Gipfel eine Kapelle, in der ein Bildnis der hl. Rosalia war. Diese Kapelle bildete den Endpunkt eines Spazierganges, den ich erst oft mit meinen Eltern und Geschwistern und später gerne allein machte. Solche Spaziergänge machten auch dadurch eine besondere Freude, daß man in der entsprechenden Jahreszeit mit reichlichen Gaben der Natur beschenkt zurückkehren konnte. Denn in den Wäldern waren Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren zu finden. Man konnte oft eine innige Befriedigung daran haben, durch ein anderthalbstündiges Sammeln eine schöne Zugabe zu dem Familienabendbrot hinzuzufügen, das sonst für jeden nur aus einem Butterbrot oder einem Stück Brot mit Käse bestand.
Noch anderes Erfreuliches brachte das Herumstreifen in diesen Wäldern, die Gemeindegut waren. Die Leute des Dorfes holten von dort ihren Holzvorrat. Die Ärmeren sammelten ihn persönlich, die Wohlhabenderen ließen ihn durch Knechte besorgen. Man lernte sie alle kennen, diese meist gemütvollen Menschen.
Denn sie hatten stets Zeit zu plaudern, wenn der «Steiner-Rudolf» zu ihnen hinzutrat. «Na du willst di a wieder a bissl dagehn, Steiner-Rudolf», so fing es an, und dann wurde von allem möglichen geredet. Die Leute achteten nicht darauf, daß sie doch ein Kind vor sich hatten. Denn sie waren im Grunde in ihrer Seele auch noch Kinder, auch wenn sie schon sechzig Jahre zählten. Und so wußte ich aus diesen Erzählungen eigentlich fast alles, was auch im Innern der Häuser dieses Dorfes vor sich ging.
Eine halbe Stunde Fußweg von Neudörfl entfernt ist Sauerbrunn mit einer Quelle von eisen- und kohlensäurehaltigem Wasser. Der Weg dahin geht der Eisenbahnlinie entlang und teilweise durch schöne Wälder. Wenn Schulferien waren, ging ich jeden Tag ganz früh morgens dahin, beladen mit einem «Blutzer». Das ist ein Wasserbehälter aus Ton. Der meinige faßte etwa drei bis vier Liter. Den konnte man ohne Entgelt an der Quelle füllen. Beim Mittag konnte dann die Familie das wohlschmeckende perlende Wasser genießen.
Gegen Wiener-Neustadt und weiter gegen die Steiermark zu fallen die Berge in die Ebene ab. Durch diese schlängelt sich der Laytha-Fluß hindurch. Am Bergabhange lag ein Redemptoristen-Kloster. Den Mönchen begegnete ich oft auf meinen Spaziergängen. Ich weiß noch, wie gerne ich von ihnen wäre angesprochen worden. Sie taten es nie. Und so trug ich von der Begegnung nur immer einen unbestimmten, aber feierlichen Eindruck davon, der mir immer lange nachging. Es war in meinem neunten Lebensjahre, da setzte sich in mir die Idee fest: im Zusammenhange mit den Aufgaben
dieser Mönche müssen wichtige Dinge sein, die ich kennen lernen müsse. Auch da war es wieder so, daß ich voller Fragen war, die ich unbeantwortet mit mir herurmtragen mußte. Ja, diese Fragen über alles mögliche machten mich als Knaben recht einsam.
An den Alpen-Vorbergen waren die beiden Schlösser Pitten und Frohsdorf sichtbar. In dem letztern wohnte zu jener Zeit der Graf Chambord, der im Beginne der siebziger Jahre als Heinrich der Fünfte hat König von Frankreich werden wollen. Es waren starke Eindrücke, die ich von dem Stück Leben empfing, das mit dem Schloß Frohsdorf verbunden war. Der Graf mit seinem Gefolge fuhr des öfteren von der Bahnstation Neudörfl ab. Alles an diesen Menschen zog meine Aufmerksamkeit an. Besonders tiefen Eindruck machte ein Mann des gräflichen Gefolges. Er hatte nur ein Ohr. Das andere war glatt hinweggehauen. Die darüberliegenden Haare hatte er geflochten. Ich erfuhr an diesem Anblick zum erstenmale, was ein Duell ist. Denn der Mann hatte das eine Ohr bei einem solchen eingebüßt.
Auch ein Stück sozialen Lebens enthüllte sich mir im Zusammenhange mit Frohsdorf. Der Hilfslehrer von Neudörfl, in dessen Privatzimmerchen ich oft seinen Arbeiten zusehen durfte, verfertigte unzählige Bettelgesuche für die ärmeren Bewohner des Dorfes und der Umgegend an den Grafen Chambord. Auf jedes solches Gesuch hin kam ein Gulden als Unterstützung an, von dem der Lehrer für seine Mühe immer sechs Kreuzer behalten durfte. Diese Einnahme brauchte er. Denn sein Amt brachte ihm jährlich - achtundfünfzig Gulden ein. Dazu hatte er Morgenkaffee und Mittagstisch beim
«Schulmeister». Er gab dann noch etwa zehn Kindern, unter denen auch ich war, «Extrastunden». Dafür zahlte man monatlich einen Gulden.
Diesem Hilfslehrer verdanke ich viel. Nicht, daß ich von seinem Schulehalten viel gehabt hätte. Damit ging es mir nicht viel anders als in Pottschach. Ich wurde sogleich nach der Übersiedlung nach Neudörfl in die dortige Schule geschickt. Sie bestand aus einem Schulzimmer, in dem fünf Klassen, Knaben und Mädchen, zugleich unterrichtet wurden. Während die Buben, die in meiner Bankreihe saßen, die Geschichte vom König Arpad abschreiben mußten, standen die ganz kleinen an einer Tafel, auf der ihnen das i und u mit Kreide aufgezeichnet wurden. Es war schlechterdings unmöglich, etwas anderes zu tun, als die Seele stumpf brüten zu lassen und das Abschreiben mit den Händen fast mechanisch zu besorgen. Den ganzen Unterricht hatte der Hilfslehrer fast allein zu besorgen. Der «Schulmeister» erschien äußerst selten in der Schule. Er war zugleich Dorfnotar; und man sagte, er habe in diesem Amte so viel zu tun, daß er nie Schule halten könne.
Und trotz alledem habe ich verhältnismäßig früh gut lesen gelernt. Dadurch konnte der Hilfslehrer mit etwas in mein Leben eingreifen, das für mich richtunggebend geworden ist. Bald nach meinem Eintreten in die Neudörfler Schule entdeckte ich in seinem Zimmer ein Geometriebuch. Ich stand so gut mit diesem Lehrer, daß ich das Buch ohne weiteres eine Weile zu meiner Benutzung haben konnte. Mit Enthusiasmus machte ich mich darüber her. Wochenlang war meine Seele ganz erfüllt von der Kongruenz, der Ähnlichkeit von Dreiecken,
Vierecken, Vielecken; ich zergrübelte mein Denken mit der Frage, wo sich eigentlich die Parallelen schneiden; der pythagoreische Lehrsatz bezauberte mich.
Daß man seelisch in der Ausbildung rein innerlich angeschauter Formen leben könne, ohne Eindrücke der äußeren Sinne, das gereichte mir zur höchsten Befriedigung. Ich fand darin Trost für die Stimmung, die sich mir durch die unbeantworteten Fragen ergeben hatte. Rein im Geiste etwas erfassen zu können, das brachte mir ein inneres Glück. Ich weiß, daß ich an der Geometrie das Glück zuerst kennen gelernt habe.
In meinem Verhältnisse zur Geometrie muß ich das erste Aufkeimen einer Anschauung sehen, die sich allmählich bei mir entwickelt hat Sie lebte schon mehr oder weniger unbewußt in mir während der Kindheit und nahm um das zwanzigste Lebensjahr herum eine bestimmte, vollbewußte Gestalt an.
Ich sagte mir: die Gegenstände und Vorgänge, welche die Sinne wahrnehmen, sind im Raume. Aber ebenso wie dieser Raum außer dem Menschen ist, so befindet sich im Innern eine Art Seelenraum, der der Schauplatz geistiger Wesenheiten und Vorgänge ist. In den Gedanken konnte ich nicht etwas sehen wie Bilder, die sich der Mensch von den Dingen macht, sondern Offenbarungen einer geistigen Welt auf diesem Seelen-Schauplatz. Als ein Wissen, das scheinbar von dem Menschen selbst erzeugt wird, das aber trotzdem eine von ihm ganz unabhängige Bedeutung hat, erschien mir die Geometrie. Ich sagte mir als Kind natürlich nicht deutlich, aber ich fühlte, so wie Geometrie muß man das Wissen von der geistigen Welt in sich tragen.
Denn die Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so gewiß wie die der sinnlichen. Ich hatte aber eine Art Rechtfertigung dieser Annahme nötig. Ich wollte mir sagen können, das Erlebnis von der geistigen Welt ist ebenso wenig eine Täuschung wie das von der Sinnenwelt. Bei der Geometrie sagte ich mir, hier darf man etwas wissen, was nur die Seele selbst durch ihre eigene Kraft erlebt; in diesem Gefühle fand ich die Rechtfertigung, von der geistigen Welt, die ich erlebte, ebenso zu sprechen wie von der sinnlichen. Und ich sprach so davon. Ich hatte zwei Vorstellungen, die zwar unbestimmt waren, die aber schon vor meinem achten Lebensjahr in meinem Seelenleben eine große Rolle spielten. Ich unterschied Dinge und Wesenheiten, «die man sieht» und solche, «die man nicht sieht».
Ich erzähle diese Dinge wahrheitsgemäß, trotzdem die Leute, welche nach Gründen suchen, um die Anthroposophie für phantastisch zu halten, vielleicht daraus den Schluß ziehen werden, ich wäre eben als Kind schon phantastisch veranlagt gewesen; kein Wunder, daß dann auch eine phantastische Weltanschauung sich in mir ausbilden konnte.
Aber gerade deshalb, weil ich weiß, wie wenig ich später meinen persönlichen Neigungen in der Schilderung einer geistigen Welt nachgegangen bin, sondern nur der inneren Notwendigkeit der Sache, kann ich selbst ganz objektiv auf die kindlich unbeholfene Art zurückblicken, wie ich mir durch die Geometrie rechtfertigte, daß ich doch von einer Welt sprechen mußte, «die man nicht sieht».
Nur das muß ich auch sagen: ich lebte gerne in dieser
Welt. Denn ich hätte die Sinnenwelt wie eine geistige Finsternis um mich empfinden müssen, wenn sie nicht Licht von dieser Seite bekommen hätte.
Der Hilfslehrer in Neudörfl lieferte mir mit seinem Geometriebuch die Rechtfertigung der geistigen Welt, die ich damals brauchte.
Ich verdanke ihm auch sonst sehr viel. Er brachte mir das künstlerische Element. Er spielte Violine und Klavier. Und er zeichnete viel. Beides zog mich stark zu ihm hin. Ich war, so viel es nur sein konnte, bei ihm. Besonders das Zeichnen liebte er; und er veranlaßte mich, schon im neunten Jahre mit Kohlenstiften zu zeichnen. Ich mußte unter seiner Anleitung auf diese Art Bilder kopieren. Lange saß ich zum Beispiel über dem Kopieren eines Porträts des Grafen Széchényi.
Seltener in Neudörfl, aber oft in dem benachbarten Orte Sauerbrunn konnte ich den tiefgehenden Eindruck der ungarischen Zigeunermusik hören.
Das alles spielte in eine Kindheit hinein, die in unmittelbarer Nähe der Kirche und des Friedhofes verlebt wurde. Der Neudörfler Bahnhof liegt wenige Schritte von der Kirche ab, und zwischen beiden ist der Friedhof.
Ging man an dem Friedhof entlang und dann eine kurze Strecke weiter, so kam man in das eigentliche Dorf. Das bestand aus zwei Häuserreihen. Die eine begann mit der Schule, die andere mit dem Pfarrhof. Zwischen den beiden Häuserreihen floß ein Bächlein, und an dessen Seiten waren stattliche Nußbäume. An dem Verhältnis zu diesen Nußbäumen bildete sich eine Rangordnung unter den Kindern der Schule aus. Wenn die Nüsse anfingen, reif zu werden, so bewarfen die Buben
und Mädchen die Bäume mit Steinen und setzten sich auf diese Art in den Besitz eines Wintervorrates von Nüssen. Im Herbste sprach keiner von viel anderem als von der Größe seiner Ausbeute an Nüssen. Wer am meisten erbeutet hatte, der war der angesehenste. Und dann ging es stufenweise nach abwärts - bis zu mir, dem letzten, der als «Fremder im Dorfe» kein Recht hatte, an dieser Rangordnung teilzunehmen.
Beim Pfarrhof stieß im rechten Winkel an die Haupt-Häuserreihen des Dorfes, in denen die «großen Bauern» wohnten, eine Reihe von etwa zwanzig Häusern, in deren Besitz die «mittleren» Dorfeinwohner waren. Anstoßend an die Gärten, die zum Bahnhof gehörten, war dann noch eine Gruppe von Strohhäusern, der Besitz der «Kleinhäusler». Diese bildeten die unmittelbare Nachbarschaft meiner Familie. Die Wege vom Dorf aus führten nach den Feldern und Weinbergen, deren Eigentümer die Dorfleute waren. Bei Kleinhäusler-Leuten machte ich jedes Jahr die Weinlese und einmal eine Dorfhochzeit mit.
Neben dem Hilfslehrer liebte ich von den Persönlichkeiten, die an der Schulleitung beteiligt waren, den Pfarrer. Er kam zweimal in der Woche regelmäßig zur Erteilung des Religionsunterrichtes und auch sonst öfter zur Inspektion in die Schule. Das Bild dieses Mannes hat sich tief in meine Seele eingeprägt; und er trat durch mein ganzes Leben hindurch immer wieder in meiner Erinnerung auf. Unter den Menschen, die ich bis zu meinem zehnten, oder elften Jahre kennen lernte, war er der weitaus bedeutendste. Er war energischer ungarischer Patriot. An der damals im Gange befindlichen
Magyarisierung des ungarischen Gebietes nahm er lebhaften Anteil. Er schrieb aus dieser Gesinnung heraus Aufsätze in ungarischer Sprache, die ich dadurch kennen lernte, daß sie der Hilfslehrer ins Reine abschreiben mußte, und dieser mit mir, trotz meiner Jugend, über den Inhalt immer sprach. Der Pfarrer war aber auch ein tatkräftiger Arbeiter für die Kirche. Das trat mir einmal recht eindringlich durch eine Predigt vor die Seele.
In Neudörfl war nämlich auch eine Freimaurerloge. Sie war vor den Dorfbewohnern in Geheimnis gehüllt, und von ihnen mit den allersonderbarsten Legenden umwoben worden. Die leitende Rolle in dieser Freimaurerloge hatte der Direktor einer am Ende des Dorfes gelegenen Zündwarenfabrik inne. Neben ihm kamen unter den Persönlichkeiten, die in unmittelbarer Nähe daran beteiligt waren, nur noch ein anderer Fabrikdirektor und ein Kleiderhändler in Betracht. Sonst merkte man die Bedeutung der Loge nur an der Tatsache, daß von Zeit zu Zeit «weither» fremde Gäste kamen, die den Dorfbewohnern im hohen Grade unheimlich vorkamen. Der Kleiderhändler war eine merkwürdige Persönlichkeit. Er ging stets mit gesenktem Kopfe, wie in Gedanken versunken. Man nannte ihn den «Simulierer», und man hatte durch seine Sonderbarkeit weder die Möglichkeit, noch das Bedürfnis, an ihn heranzukommen. Zu seinem Hause gehörte die Freimaurerloge.
Ich konnte kein Verhältnis zu dieser Loge gewinnen. Denn nach der ganzen Art, wie sich die Menschen meiner Umgebung in dieser Hinsicht benahmen, mußte
ich es auch da aufgeben, Fragen zu stellen; und dann wirkten die ganz abgeschmackten Reden, die der Zündwarenfabrikbesitzer über die Kirche führte, auf mich abstoßend.
Der Pfarrer hielt nun eines Sonntags in seiner energischen Art eine Predigt, in der er die Bedeutung der wahren Sittlichkeit für das menschliche Leben auseinandersetzte und dann von den Feinden der Wahrheit in Bildern sprach, die von der Loge hergenommen waren. Dann ließ er seine Rede gipfeln in dem Satze: «Geliebte Christen, merket wer ein Feind dieser Wahrheit ist, zum Beispiel ein Freimaurer und ein Jude.» Für die Dorfleute waren damit der Fabrikbesitzer und der Kleiderhändler autoritativ gekennzeichnet. Die Tarkraft, mit der dies gesprochen wurde, gefiel mir ganz besonders.
Auch diesem Pfarrer verdanke ich besonders durch einen starken Eindruck außerordentlich viel für meine spätere Geistesorientierung. Er kam einmal in die Schule, versammelte die «reiferen» Schüler, zu denen er mich rechnete, in dem kleinen Lehrerstübehen um sich, entfaltete eine Zeichnung, die er gemacht hatte, und erklärte uns an ihr das kopernikanische Weltsystem. Er sprach dabei sehr anschaulich über die Erdbewegung um die Sonne, über die Achsendrehung, die schiefe Lage der Erdachse und über Sommer und Winter, sowie über die Zonen der Erde. Ich war ganz von der Sache hingenommen, zeichnete tagelang sie nach, bekam dann von dem Pfarrer noch eine Spezialunterweisung über Sonnen- und Mondfinsternisse und richtete damals und weiter alle meine Wißbegierde auf diesen Gegenstand.
Ich war damals etwa zehn Jahre alt und konnte noch nicht orthographisch und grammatikalisch richtig schreiben.
Von tiefgehender Bedeutung für mein Knabenleben war die Nähe der Kirche und des um sie liegenden Friedhofes. Alles, was in der Dorfschule geschah, entwickelte sich im Zusammenhange damit. Das war nicht nur durch die in jener Gegend damals herrschenden sozialen und staatlichen Verhältnisse bewirkt, sondern vor allem dadurch, daß der Pfarrer eine bedeutende Persönlichkeit war. Der Hilfslehrer war zugleich Orgelspieler der Kirche, Kustos der Meßgewänder und der anderen Kirchengeräte; er leistete dem Pfarrer alle Hilfsdienste in der Versorgung des Kultus. Wir Schulknaben hatten den Ministranten- und Chordienst zu verrichten bei Messen, Totenfeiern und Leichenbegängnissen. Das Feierliche der lateinischen Sprache und des Kultus war ein Element, in dem meine Knabenseele gerne lebte. Ich war dadurch, daß ich an diesem Kirchendienste bis zu meinem zehnten Jahre intensiv teil-nahm, oft in der Umgebung des von mir so geschätzten Pfarrers.
In meinem Elternhause fand ich in dieser meiner Beziehung zur Kirche keine Anregung. Mein Vater nahm daran keinen Anteil. Er war damals «Freigeist». Er ging nie in die Kirche, mit der ich so verwachsen war; und trotzdem ja auch er während seiner Knaben- und JüngIingsjahre einer solchen ergeben und dienstbar war. Das änderte sich bei ihm erst wieder, als er als alter Mann, in Pension, nach Horn, seiner Heimatgegend, zurückzog. Da wurde er wieder ein «frommer Mann». Nur
war ich damals längst außer allem Zusammenhang mit dem Elternhause
Mir steht von meiner Neudörfler Knabenzeit stark dieses vor der Seele, wie die Anschauung des Kultus in Verbindung mit der musikalischen Opferfeierlichkeit vor dem Geiste in stark suggestiver Art die Rätselfragen des Daseins aufsteigen läßt. Der Bibel- und Katechismus-Unterricht, den der Pfarrer erteilte, war weit weniger wirksam innerhalb meiner Seelenwelt als das, was er als Ausübender des Kultus tat in Vermittelung zwischen der sinnlichen und der übersinnlichen Welt. Von Anfang an war mir das alles nicht eine bloße Form, sondern tiefgehendes Erlebnis. Das war um so mehr der Fall, als ich damit im Elternhause ein Fremdling war. Mein Gemüt verließ das Leben, das ich mit dem Kultus aufgenommen hatte, auch nicht bei dem, was ich in meiner häuslichen Umgehung erlebte. Ich lebte ohne Anteil an dieser Umgebung. Ich sah sie; aber ich dachte, sann und empfand eigentlich fortwährend mit jener anderen Welt. Dabei darf ich aber durchaus sagen, daß ich kein Träumer war, sondern mich in alle lebenspraktischen Verrichtungen wie selbstverständlich hineinfand.
Einen völligen Gegensatz zu dieser meiner Welt bildete auch das Politisieren meines Vaters. Er wurde von einem andern Beamten im Dienstturnus abgelöst. Dieser wohnte auf einer anderen Eisenbahnstation, die er mitversorgte. Er traf in Neudörfl nur alle zwei oder drei Tage ein. In den unbeschäftigten Abendstunden politisierten mein Vater und er. Es geschah das an dem Tisch, der neben dem Bahnhof unter zwei mächtigen, wundervollen Lindenbäumen stand. Da waren die ganze Familie
und der fremde Beamte versammelt. Die Mutter strickte oder häkelte; meine Geschwister tummelten sich; ich saß oft an dem Tisch und hörte dem unaufhörlichen Politisieren der beiden Männer zu. Mein Anteil bezog sich aber nie auf den Inhalt dessen, was sie sprachen, sondern auf die Form, welche das Gespräch annahm. Sie waren immer uneinig; wenn der eine «Ja» sagte, erwiderte der andere «Nein». Alles das aber spielte sich immer zwar im Zeichen der Heftigkeit, ja Leidenschaftlichkeit ab, aber auch in dem der Gutmütigkeit, die ein Grundzug im Wesen meines Vaters war.
In dem kleinen Kreise, der da öfter versammelt war, und in dem sich oft «Honoratioren» des Ortes einfanden, erschien zuweilen ein Arzt aus Wiener-Neustadt. Er behandelte viele Kranke des Ortes, in dem damals kein Arzt war. Er machte den Weg von Wiener-Neustadt nach Neudörfl zu Fuß, und kam dann, nachdem er bei seinen Kranken war, nach dem Bahnhof, um den Zug abzuwarten, mit dem er zurückkehrte. Dieser Mann galt in meinem Elternhause und bei den meisten Leuten, die ihn kannten, als ein Sonderling. Er sprach nicht gerne von seinem medizinischen Berufe, aber um so lieber von deutscher Literatur. Von ihm habe ich zuerst über Lessing, Goethe, Schiller sprechen gehört. In meinem Elternhause war davon nie die Rede. Man wußte davon nichts. Auch in der Dorfschule kam davon nichts vor. Es war da alles auf ungarische Geschichte eingestellt. Pfarrer und Hilfslehrer hatten kein Interesse für die Größen der deutschen Literatur. Und so kam es, daß mit dem Wiener-Neustädtler Arzt eine ganz neue Welt in meinen Gesichtskreis einzog. Der beschäftigte sich
gerne mit mir, nahm mich oft, nachdem er kurze Zeit unter den Linden ausgeruht hatte, beiseite, ging mit mir auf dem Bahnhofplatze auf und ab und sprach, nicht in dozierender, aber enthusiastischer Art von deutscher Literatur. Er entwickelte dabei allerlei Ideen über dasjenige, was schön, was häßlich ist.
Es ist mir auch dies ein Bild geblieben, das in meinem ganzen Leben in meiner Erinnerung Festesstunden feierte: der hochgewachsene, schlanke Arzt, mit seinem kühn ausschreitenden Gange, stets mit dem Regenschirm in der rechten Hand, den er so hielt, daß er neben dem Oberkörper schlenkerte, an der einen Seite, und ich zehnjähriger Knabe, an der andern Seite, ganz hingegeben dem, was der Mann sagte.
Neben alledem beschäftigten mich die Einrichtungen der Eisenbahn stark. Am Stationstelegraphen lernte ich die Gesetze der Elektrizitätslehre zunächst in der Anschauung kennen. Auch das Telegraphieren lernte ich schon als Knabe.
In der Sprache bin ich ganz aus dem deutschen Dialekt herausgewachsen, der in dem östlichen Niederösterreich gesprochen wird. Der war im wesentlichen auch derjenige, der damals noch in den an Niederösterreich angrenzenden Gegenden Ungarns üblich war. Mein Verhältnis war ein ganz anderes zum Lesen als zum Schreiben. Ich las in meiner Knabenzeit über die Worte hinweg; ging mit der Seele unmittelbar auf Anschauungen, Begriffe und Ideen, so daß ich vom Lesen gar nichts für die Entwickelung des Sinnes für orthographisches und grammatikalisches Schreiben hatte. Dagegen hatte ich beim Schreiben den Drang, genau die
Wortbilder so in Lauten festzuhalten, wie ich sie als Dialektworte zumeist hörte. Dadurch bekam ich nur unter den größten Schwierigkeiten einen Zugang zum Schreiben der Schriftsprache; während mir deren Lesen vom Anfange an ganz leicht war.
Unter solchen Einflüssen wuchs ich heran zu dem Lebensalter, in dem für meinen Vater die Frage zu lösen war, ob er mich in das Gymnasium oder die Realschule in Wiener-Neustadt geben solle. Von da ab hörte ich zwischen der Politik viel mit andern über mein künftiges Lebensschicksal sprechen. Da wurde meinem Vater dieser oder jener Rat gegeben; ich wußte schon damals: er hört gerne, was die andern sagen; aber er handelt nach seinem eigenen, fest empfundenen Willen.
II.
Den Ausschlag bei der Entscheidung, ob ich auf das Gymnasium oder die Realschule geschickt werden solle, gab bei meinem Vater seine Absicht, mir die rechte Vorbildung für eine «Anstellung» bei der Eisenbahn zu verschaffen. Seine Vorstellungen drängten sich zuletzt in die zusammen, ich sollte Eisenbahn-Ingenieur werden. Das führte zu der Wahl der Realschule.
Zunächst aber war die Frage zu entscheiden, ob ich beim Übergange von der Neudörfler Dorfschule zu einer der Schulen des benachbarten Wiener-Neustadt überhaupt für eine dieser Schularten schon reif sei. Ich wurde zunächst zur Aufnahmeprüfung in die Bürgerschule geführt.
An mir selbst gingen die Vorgänge, die nun für meine Lebenszukunft eingeleitet wurden, ohne tiefergehendes Interesse vor sich. Mir war in jenem Lebensalter die Art meiner «Anstellung», mir war auch die Frage gleichgültig, ob Bürger- oder Realschule, oder Gymnasium. Ich hatte durch das, was ich um mich beobachtet, was ich in mir ersonnen hatte, unbestimmte, aber brennende Fragen über Leben und Welt in der Seele und wollte etwas lernen, um sie mir beantworten zu können. Mich kümmerte dabei wenig, durch welche Schulart das geschehen sollte.
Die Aufnahmeprüfung in die Bürgerschule bestand ich sehr gut. Man hatte alle die Zeichnungen mitgebracht, die ich bei meinem Hilfslehrer angefertigt hatte; und diese machten auf die Lehrerschaft, die mich prüfte, einen so starken Eindruck, daß wohl dadurch hinweg-
gesehen wurde über meine mangelnden Kenntnisse. Ich kam mit einem «glänzenden» Zeugnisse davon. Es war helle Freude bei meinen Eltern, beim Hilfslehrer, beim Pfarrer, bei vielen Honoratioren von Neudörfl. Man war über meinen Erfolg froh, denn er war für Viele ein Beweis, daß die «Neudörfler Schule etwas leisten könne».
Für meinen Vater entsprang aus alledem der Gedanke, daß ich nun, da ich so weit sei, gar nicht erst ein Jahr in der Bürgerschule verbringen, sondern sogleich in die Realschule kommen solle. So wurde ich denn schon wenige Tage nachher zur Aufnahmeprüfung in diese geführt. Da ging es zwar nicht so gut als vorher; aber ich wurde doch zur Aufnahme zugelassen. Es war im Oktober 1872.
Nun mußte ich täglich den Weg von Neudörfl nach Wiener-Neustadt machen. Morgens konnte ich mit dem Eisenbahnzuge fahren, abends mußte ich zu Fuß zurückkehren, da ein Zug zur rechten Zeit nicht fuhr. Neudörfl lag in Ungarn, Wiener-Neustadt in Niederösterreich. Ich kam also täglich von «Transleithanien» nach «Cisleithanien». (So nannte man offiziell das ungarische und das österreichische Gebiet.)
Während des Mittags blieb ich in Wiener-Neustadt. Es hatte sich eine Dame gefunden, die mich bei einem ihrer Aufenthalte auf dem Neudörfler Bahnhof kennen gelernt und dabei erfahren hatte, daß ich zur Schule nach Wiener-Neustadt kommen werde. Meine Eltern hatten ihr ihre Sorge darüber mitgeteilt, wie ich über den Mittag bei meinen Schulbesuchen hinwegkommen werde. Sie erklärte sich bereit, mich in ihrem Hause
unentgeltlich essen zu lassen und mich jederzeit aufzunehmen, wenn ich es nötig hätte.
Der Fußweg von Wiener-Neustadt nach Neudörfl ist im Sommer sehr schön; im Winter war er oft beschwerlich. Ehe man von dem Stadtende zum Dorfe kam, mußte man über einen Feldweg von einer halben Stunde gehen, der vom Schnee nicht gesäubert wurde. Da hatte ich oft durch Schnee zu «waten», der bis an die Knie ging, und kam als «Schneemann» zu Hause an.
Das Stadtleben konnte ich in der Seele nicht in der gleichen Art mitmachen, wie das auf dem Lande. Ich stand verträumt dem gegenüber, was zwischen und in den aneinandergepferchten Häusern vorging. Nur vor den Buchhandlungen Wiener-Neustadts blieb ich oft lange stehen.
Auch was in der Schule vorgebracht wurde und was ich selbst da zu tun hatte, ging ohne ein lebhafteres Interesse an meiner Seele zunächst vorüber. Ich hatte in den beiden ersten Klassen viele Mühe, mitzukommen. Erst im zweiten Halbjahr der zweiten ging es besser. Da war ich erst ein «guter Schüler» geworden.
Ich hatte ein mich stark beherrschendes Bedürfnis. Ich sehnte mich nach Menschen, denen ich wie Vorbildern menschlich nachleben konnte. Solche fanden sich unter den Lehrern der beiden ersten Klassen nicht.
In dieses Erleben in der Schule trat nun wieder ein Ereignis, das tief in meine Seele hineinwirkte. Der Schuldirektor hatte in einem der Jahresberichte, die am Ende eines jeden Schuljahres ausgegeben wurden, einen Aufsatz erscheinen lassen: «Die Anziehungskraft betrachtet als eine Wirkung der Bewegung.» Ich konnte als elf-
jähriger Junge von dem Inhalte zunächst fast nichts verstehen. Denn es fing gleich mit höherer Mathematik an. Aber von einzelnen Sätzen erhaschte ich doch einen Sinn. Es bildete sich in mir eine Gedankenbrücke von den Lehren über das Weltgebäude, die ich von dem Pfarrer erhalten hatte, bis zu dem Inhalte dieses Aufsatzes. In diesem war auch auf ein Buch verwiesen, das der Direktor geschrieben hatte: «Die allgemeine Bewegung der Materie als Grundursache aller Naturerscheinungen.» Ich sparte so lange, bis ich mir das Buch kaufen konnte. Es wurde nun eine Art Ideal von mir, alles so schnell als möglich zu lernen, was mich zum Verständnis des Inhaltes von Aufsatz und Buch führen konnte.
Es handelte sich um folgendes. Der Schuldirektor hielt die von dem Stoffe aus in die Ferne wirkenden «Kräfte» für eine unberechtigte «mystische» Hypothese. Er wollte die «Anziehung» sowohl der Himmelskörper, wie auch der Moleküle und Atome ohne solche «Kräfte» erklären. Er sagte, zwischen zwei Körpern befinden sich viele in Bewegung begriffene kleinere Körper. Diese stoßen, sich hin und her bewegend, auf die größeren Körper. Ebenso werden diese an den Seiten überall gestoßen, an denen sie von einander abgewandt sind. Die Stöße, die auf die abgewandten Seiten ausgeübt werden, sind zahlreicher als die in dem Raum zwischen den beiden Körpern. Dadurch nähern sich diese. Die «Anziehung» ist keine besondere Kraft, sondern nur eine «Wirkung der Bewegung». Zwei Sätze fand ich ausgesprochen auf den ersten Seiten des Buches: «1. Es existiert ein Raum und in diesem eine Be-
wegung durch längere Zeit. 2. Raum und Zeit sind kontinuierliche homogene Größen; die Materie aber besteht aus gesonderten Teilchen (Atomen).» Aus den Bewegungen, die auf die beschriebene Art zwischen den kleinen und großen Teilen der Materie entstehen, wollte der Verfasser alle physikalischen und chemischen Naturvorgänge erklären.
Ich hatte nichts in mir, was in irgendeiner Art dazu drängte, mich zu dieser Anschauung zu bekennen; aber ich hatte das Gefühl, es werde eine große Bedeutung für mich haben, wenn ich das auf diese Art Ausgesprochene verstehen werde. Und ich tat alles dazu, um dahin zu gelangen. Wo ich nur mathematische und physikalische Bücher auftreiben konnte, benützte ich die Gelegenheit. Es ging recht langsam. Ich setzte mit dem Lesen von Aufsatz und Buch immer wieder an; es ging jedesmal etwas besser.
Nun kam etwas anderes hinzu. In der dritten Klasse erhielt ich einen Lehrer, der wirklich das «Ideal» erfüllte, das vor meiner Seele stand. Ihm konnte ich nachstreben. Er unterrichtete Rechnen, Geometrie und Physik. Sein Unterricht war von einer außerordentlichen Geordnetheit und Durchsichtigkeit. Er baute alles so klar aus den Elementen auf, daß es dem Denken im höchsten Grade wohltätig war, ihm zu folgen.
Ein zweiter Jahresberichtsaufsatz der Schule war von ihm. Er war aus dem Gebiete der Wahrscheinlichkeitsrechnung und des Lebensversicherungsrechnens. Ich vertiefte mich auch in diesen Aufsatz, obwohl ich auch von ihm noch nicht viel verstehen konnte. Aber ich kam doch bald dazu, den Sinn der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung zu begreifen. Eine noch wichtigere Folge aber für mich war, daß ich an der Exaktheit, mit welcher der geliebte Lehrer die Materie durchgeführt hatte, ein Vorbild für mein mathematisches Denken hatte. Das aber ließ nun ein wunderschönes Verhältnis zwischen diesem Lehrer und mir entstehen. Ich empfand es beglückend, diesen Mann nun durch alle Realschulklassen hindurch als Lehrer der Mathematik und Physik zu haben.
Mit dem, was ich durch ihn lernte, kam ich dem Rätsel, das mir durch die Schriften des Schuldirektors aufgegeben war, immer näher.
Mit einem andern Lehrer kam ich erst nach längerer Zeit in ein näheres seelisches Verhältnis. Es war derjenige, der in den unteren Klassen geometrisches Zeichnen und in den oberen darstellende Geometrie lehrte. Er unterrichtete schon in der zweiten Klasse. Aber erst im Verlaufe des Unterrichtes in der dritten ging mir der Sinn für seine Art auf. Er war ein großartiger Konstrukteur. Auch sein Unterricht war von musterhafter Klarheit und Geordnetheit. Das Zeichnen mit Zirkel, Lineal und Dreieck wurde mir durch ihn zu einer Lieblingsbeschäftigung. Hinter dem, was ich durch den Schuldirektor, den Mathematik- und Physiklehrer und den des geometrischen Zeichnens in mich aufnahm, stiegen nun in knabenhafter Auffassung die Rätselfragen des Naturgeschehens in mir auf. Ich empfand: ich müsse an die Natur heran, um eine Stellung zu der Geisteswelt zu gewinnen, die in selbstverständlicher Anschauung vor mir stand.
Ich sagte mir, man kann doch nur zurechtkommen mit dem Erleben der geistigen Welt durch die Seele,
wenn das Denken in sich zu einer Gestaltung kommt, die an das Wesen der Naturerscheinungen herangelangen kann. Mit diesen Gefühlen lebte ich mich durch die dritte und vierte Realschulklasse durch. Ich ordnete alles, was ich lernte, selbst daraufhin an, mich dem gekennzeichneten Ziele zu nähern.
Da ging ich einmal an einer Buchhandlung vorbei. Im Schaufenster sah ich Kants «Kritik der reinen Vernunft» in Reclams Ausgabe. Ich tat alles, um mir dies Buch so schnell als möglich zu kaufen.
Als damals Kant in den Bereich meines Denkens eintrat, wußte ich noch nicht das geringste von dessen Stellung in der Geistesgeschichte der Menschheit. Was irgend ein Mensch über ihn gedacht hat, zustimmend oder ablehnend, war mir gänzlich unbekannt. Mein unbegrenztes Interesse an der Kritik der reinen Vernunft wurde aus meinem ganz persönlichen Seelenleben heraus erregt. Ich strebte auf meine knabenhafte Art danach, zu verstehen, was menschliche Vernunft für einen wirklichen Einblick in das Wesen der Dinge zu leisten vermag.
Die Kantlektüre fand mancherlei Hindernisse an den äußeren Lebenstatsachen. Ich verlor durch den weiten Weg, den ich zwischen Heim und Schule zurückzulegen hatte, täglich wenigstens drei Stunden. Abends kam ich vor sechs Uhr nicht zu Hause an. Dann war eine endlose Masse von Schulaufgaben zu bewältigen. Und an Sonntagen gab ich mich fast ausschließlich dem konstruktiven Zeichnen hin. Es in der Ausführung der geometrischen Konstruktionen zur größten Exaktheit, in der Behandlung des Schraffierens und Anlegens der
Farbe zur tadellosen Sauberkeit zu bringen, war mir ein Ideal.
So blieb mir für das Lesen der «Kritik der reinen Vernunft» gerade damals kaum eine Zeit. Ich fand den folgenden Ausweg. Die Geschichte wurde uns so beigebracht, daß der Lehrer scheinbar vortrug, aber in Wirklichkeit aus einem Buche vorlas. Wir hatten dann von Stunde zu Stunde das in dieser Art an uns Herangebrachte aus unserem Buche zu lernen. Ich dachte mir, das Lesen des im Buche Stehenden muß ich ja doch zu Hause besorgen. Von dem «Vortrag» des Lehrers hatte ich gar nichts. Ich konnte durch das Anhören dessen, was er las, nicht das geringste aufnehmen. Ich trennte nun die einzelnen Bogen des Kantbüchleins auseinander, heftete sie in das Geschichtsbuch ein, das ich in der Unterrichtsstunde vor mir liegen hatte, und las nun Kant, während vom Katheder herunter die Geschichte «gelehrt» wurde. Das war natürlich gegenüber der Schuldisziplin ein großes Unrecht; aber es störte niemand und es beeinträchtigte so wenig, was von mir verlangt wurde, daß ich damals in der Geschichte die Note «vorzüglich» bekam.
In den Ferienzeiten wurde die Kantlektüre eifrig fortgesetzt. Ich las wohl manche Seite mehr als zwanzigmal hintereinander. Ich wollte zu einem Urteile darüber kommen, wie das menschliche Denken zu dem Schaffen der Natur steht.
Die Empfindungen, die ich gegenüber diesen Denkbestrebungen harte, wurden von zwei Seiten her beeinflußt. Zum ersten wollte ich das Denken in mir selbst so ausbilden, daß jeder Gedanke voll überschaubar
wäre, daß kein unbestimmtes Gefühl ihn in irgendeine Richtung brächte. Zum zweiten wollte ich einen Einklang zwischen einem solchen Denken und der Religionslehre in mir herstellen. Denn auch diese nahm mich damals im höchsten Grade in Anspruch. Wir hatten gerade auf diesem Gebiete ganz ausgezeichnete Lehrbücher. Dogmatik und Symbolik, die Beschreibung des Kultus, die Kirchengeschichte nahm ich aus diesen Lehrbüchern mit wirklicher Hingebung auf. Ich lebte ganz stark in diesen Lehren. Aber mein Verhältnis zu ihnen war dadurch bestimmt, daß mir die geistige Welt als ein Inhalt der menschlichen Anschauung galt. Gerade deshalb drangen diese Lehren so tief in meine Seele, weil ich an ihnen empfand, wie der menschliche Geist erkennend den Weg ins Übersinnliche finden kann. Die Ehrfurcht vor dem Geistigen - das weiß ich ganz bestimmt - wurde mir durch dieses Verhältnis zur Erkenntnis nicht im geringsten genommen.
Auf der andern Seite beschäftigte mich unaufhörlich die Tragweite der menschlichen Gedankenfähigkeit. Ich empfand, daß das Denken zu einer Kraft ausgebildet werden könne, die die Dinge und Vorgänge der Welt wirklich in sich faßt. Ein «Stoff», der außerhalb des Denkens liegen bleibt, über den bloß «nachgedacht» wird, war mir ein unerträglicher Gedanke. Was in den Dingen ist, das muß in die Gedanken des Menschen herein, das sagte ich mir immer wieder.
An dieser Empfindung stieß aber auch immer wieder das an, was ich bei Kant las. Aber ich merkte damals diesen Anstoß kaum. Denn ich wollte vor allem durch die «Kritik der reinen Vernunft» feste Anhaltspunkte
gewinnen, um mit dem eigenen Denken zurecht zu kommen. Wo und wann ich meine Ferienspaziergänge machte: ich mußte mich irgendwo still hinsetzen, und mir immer von neuem zurechtlegen, wie man von einfachen, überschaubaren Begriffen zur Vorstellung über die Naturerscheinungen kommt. Ich verhielt mich zu Kant damals ganz unkritisch; aber ich kam durch ihn nicht weiter.
Ich wurde durch alles dieses nicht abgezogen von den Dingen, welche die praktische Handhabung von Verrichtungen und die Ausbildung der menschlichen Geschicklichkeit betrafen. Es fand sich, daß einer der Beamten, die meinen Vater im Dienste ablösten, die Buchbinderei verstand. Ich lernte von ihm das Buchbinden und konnte mir in den Ferien, die zwischen der vierten und fünften Realschulklasse lagen, meine Schulbücher selbst einbinden. Auch lernte ich in dieser Zeit während der Ferien die Stenographie ohne Lehrer. Trotzdem machte ich dann die Stenographiekurse mit, die von der fünften Klasse an gehalten wurden.
Gelegenheit zum praktischen Arbeiten gab es genug. Meinen Eltern war in der Umgebung des Bahrihofes ein kleiner Garten mit Obstbäumen und ein kleines Kartoffelfeld zugeteilt. Kirschenpflücken, die Gartenarbeiten besorgen, die Kartoffeln für die Aussaat vorbereiten, den Acker bestellen, die reifen Kartoffeln ausgraben, das alles wurde von meinen Geschwistern und mir mitbesorgt. Den Lebensmitteleinkauf im Dorfe zu besorgen, ließ ich mir in den Zeiten, die mir die Schule frei ließ, nicht nehmen.
Als ich etwa fünfzehn Jahre alt war, durfte ich zu
dem schon erwähnten Arzte in Wiener-Neustadt in ein näheres Verhältnis treten. Ich hatte ihn durch die Art, wie er bei seinen Neudörfler Besuchen mit mir sprach, sehr lieb gewonnen. So schlich ich denn öfter an seiner Wohnung, die in einem Erdgeschoße an der Ecke zweier ganz schmaler Gäßchen in Wiener-Neustadt lag, vorbei. Einmal war er am Fenster. Er rief mich in sein Zimmer. Da stand ich vor einer für meine damaligen Begriffe «großen» Bibliothek. Er sprach wieder von Literatur, nahm dann Lessings «Minna von Barnhelm» aus der Büchersammlung und sagte, das solle ich lesen und dann wieder zu ihm kommen. So gab er mir immer wieder Bücher zum Lesen und erlaubte mir, von Zeit zu Zeit zu ihm zu gehen. Ich mußte ihm dann jedesmal, wenn ich ihn besuchen durfte, von meinen Eindrücken aus dem Gelesenen erzählen. Er wurde dadurch eigentlich mein Lehrer in dichterischer Literatur. Denn diese war mir bis dahin sowohl im Elternhause wie in der Schule, außer einigen «Proben», ziemlich ferne geblieben. Ich lernte in der Atmosphäre des liebevollen, für alles Schöne begeisterten Arztes besonders Lessing kennen.
Ein anderes Ereignis beeinflußte tief mein Leben. Die mathematischen Bücher, die Lübsen zum Selbstunterricht geschrieben hat, wurden mir bekannt. Da konnte ich analytische Geometrie, Trigonometrie und auch Differential- und Integralrechnung mir aneignen, lange bevor ich sie schulmäßig lernte. Das setzte mich in den Stand, zu der Lektüre der Bücher über «Die allgemeine Bewegung der Materie als Grundursache aller Naturerscheinungen» wieder zurückzukehren. Denn nunmehr
konnte ich sie durch meine mathematischen Kenntnisse besser verstehen. Es war ja auch mittlerweile zum Physikunterricht der aus der Chemie getreten und damit für mich eine neue Anzahl von Erkenntnisrätseln zu den alten. Der Chemielehrer war ein ausgezeichneter Mann. Er gab den Unterricht fast ausschließlich experimentierend. Er sprach wenig. Er ließ die Naturvorgänge für sich sprechen. Er war einer unserer beliebtesten Lehrer. Es war etwas Merkwürdiges an ihm, wodurch er sich für seine Schüler von den andern Lehrern unterschied. Man setzte von ihm voraus, daß er zu seiner Wissenschaft in einem nähern Verhältnisse stehe als die andern. Diese sprachen wir Schüler mit dem Titel «Professor» an; ihn, trotzdem er ebensogut «Professor» war, mit «Herr Doktor». Er war der Bruder des sinnigen tirolischen Dichters Hermann v. Gilm. Er harte einen Blick, der die Aufmerksamkeit stark anzog. Man bekam das Gefühl, dieser Mann ist gewohnt, scharf auf die Naturerscheinungen hinzusehen und sie dann im Blicke zu behalten.
Sein Unterricht verwirrte mich ein wenig. Die Fülle der Tatsachen, die er brachte, konnte meine damals nach Vereinheitlichung drängende Seelenart nicht immer zusammenhalten. Dennoch muß er die Ansicht gehabt haben, daß ich in der Chemie gute Fortschritte mache. Denn er gab mir von Anfang an die Note «lobenswert», die ich dann durch alle Klassen beibehielt.
In einem Antiquariat in Wiener-Neustadt entdeckte ich eines Tages in jener Zeit die Weltgeschichte von Rotteck. Geschichte war meiner Seele vorher, trotzdem ich in der Schule die besten Noten bekam, etwas Äußer-
liches geblieben. Jetzt wurde sie mir etwas Innerliches. Die Wärme, mit der Rotteck die geschichtlichen Ereignisse ergriff und schilderte, riß mich hin. Seinen einseitigen Sinn in der Auffassung bemerkte ich noch nicht. Durch ihn wurde ich dann weiter zu zwei andern Geschichtsschreibern gebracht, die durch ihren Stil und durch ihre geschichtliche Lebensauffassung den tiefsten Eindruck auf mich machten: Johannes von Müller und Tacitus. Es wurde unter solchen Eindrücken für mich recht schwer, mich in den Schulunterricht aus Geschichte und Literatur hineinzufinden. Aber ich versuchte, mir diesen Unterricht durch alles das zu beleben, was ich außerhalb desselben mir angeeignet hatte. In einer solchen Art verbrachte ich die Zeit in den drei obern der sieben Realschulklassen.
Von meinem fünfzehnten Lebensjahre an gab ich Nachhilfestunden, entweder an Mitschüler desselben Jahrganges oder an Schüler, die in einem niedrigeren Jahrgange waren als ich selbst. Man vermittelte mir von Seite des Lehrerkollegiums gerne diesen Nachhilfeunterricht, denn ich galt ja als «guter Schüler». Und mir war dadurch die Möglichkeit geboten, wenigstens ein Geringes zu dem beizusteuern, was meine Eltern von ihrem kärglichen Einkommen für meine Ausbildung aufwenden mußten.
Ich verdanke diesem Nachhilfeunterricht sehr viel. Indem ich den aufgenommenen Unterrichtsstoff an Andere weiterzugeben hatte, erwachte ich gewissermaßen für ihn. Denn ich kann nicht anders sagen, als daß ich die Kenntnisse, die mir selbst von der Schule übermittelt wurden, wie in einem Lebenstraume auf-
nahm. Wach war ich in dem, was ich mir selbst errang oder was ich von einem geistigen Wohltäter, wie dem erwähnten Wiener-Neustädter Arzt, erhielt. Von dem, was ich so in einen vollbewußten Seelenzustand hereinnahm, unterschied sich beträchtlich, was wie traumbildhaft als Schulunterricht an mir vorüberging. Für die Umbildung dieses halbwach Aufgenommenen sorgte nun die Tatsache, daß ich meine Kenntnisse in den Nachhilfestunden beleben mußte.
Andererseits war ich dadurch genötigt, mich in einem frühen Lebensalter mit praktischer Seelenkunde zu beschäftigen. Ich lernte die Schwierigkeiten der menschlichen Seelenentwickelung an meinen Schülern kennen.
Den Mitschülern des gleichen Jahrganges, die ich unterrichtete, mußte ich vor allem die deutschen Aufsätze machen. Da ich jeden solchen Aufsatz auch noch für mich selbst zu schreiben hatte, mußte ich für jedes Thema, das uns gegeben wurde, verschiedene Formen der Ausarbeitung finden. Ich fühlte mich da oft in einer recht schwierigen Lage. Meinen eigenen Aufsatz machte ich erst, nachdem ich die besten Gedanken für das Thema weggegeben hatte.
Mit dem Lehrer der deutschen Sprache und Literatur in den drei oberen Klassen stand ich in einem ziemlich gespannten Verhältnis. Er galt unter meinen Mitschülern als der «gescheiteste Professor» und als besonders strenge. Meine Aufsätze waren immer besonders lange geworden. Die kürzere Fassung hatte ich ja an meinen Mitschüler diktiert. Der Lehrer brauchte lange, um meine Aufsätze zu lesen. Als er nach der Abgangsprüfung beim Abschiedsfeste zum erstenmal mit uns
Schülern «gemütlich» zusammen war, sagte er mir, wie ärgerlich ich ihm durch die langen Aufsätze geworden war.
Dazu kam noch ein anderes. Ich fühlte, daß durch diesen Lehrer etwas in die Schule hereinragte, mit dem ich fertig werden mußte. Wenn er zum Beispiel über das Wesen der poetischen Bilder sprach, da empfand ich, daß etwas im Hintergrunde stand. Nach einiger Zeit kam ich darauf, was es war. Er bekannte sich zur Herbartschen Philosophie. Er selbst sagte davon nichts. Aber ich kam dahinter. Und so kaufte ich mir denn eine «Einleitung in die Philosophie» und eine «Psychologie», die beide vom Herbart'schen philosophischen Gesichtspunkte aus geschrieben waren.
Und jetzt begann eine Art Versteckspiel zwischen diesem Lehrer und mir durch die Aufsätze. Ich fing an, manches bei ihm zu verstehen, was er in der Färbung der Herbart'schen Philosophie vorbrachte; und er fand in meinen Aufsätzen allerlei Ideen, die auch aus dieser Ecke kamen. Es wurde nur weder von ihm, noch von mir der Herbart'sche Ursprung genannt. Das war wie durch ein stilles Übereinkommen. Aber einmal schloß ich einen Aufsatz in einer gegenüber dieser Lage unvorsichtigen Art. Ich hatte über irgendeine Charaktereigenschaft bei den Menschen zu schreiben. Zum Schluß brachte ich den Satz: «ein solcher Mensch hat psychologische Freiheit.» Der Lehrer besprach mit uns Schülern die Aufsätze, nachdem er sie korrigiert hatte. Als er an die Besprechung des genannten Aufsatzes kam, verzog er mit gründlicher Ironie die Mundwinkel und sagte: «Sie schreiben da etwas von psychologischer Frei-
heit; die gibt es ja gar nicht.» Ich erwiderte: «Ich meine, das ist ein Irrtum, Herr Professor, die «psychologische Freiheit» gibt es schon; es gibt nur keine «transzendentale Freiheit» im gewöhnlichen Bewußtsein.» Die Mundfalten des Lehrers wurden wieder glatt; er sah mich mit einem durchdringenden Blicke an und sagte dann: «Ich bemerke schon lange an Ihren Aufsätzen, daß Sie eine philosophische Bibliothek haben. Ich möchte Ihnen raten, darin nicht zu lesen; Sie verwirren sich dadurch nur Ihre Gedanken.» Ich konnte nun durchaus nicht begreifen, warum ich meine Gedanken durch Lesen derselben Bücher verwirren sollte, aus denen er die seinigen hatte. Und so blieb denn das Verhältnis zwischen ihm und mir weiter ein gespanntes.
Sein Unterricht gab mir viel zu tun. Denn er umfaßte in der fünften Klasse die griechische und lateinische Dichtung, von der Proben in deutscher Übersetzung vorgebracht wurden. Erst jetzt begann ich zuweilen schmerzlich zu empfinden, daß mich mein Vater nicht in das Gymnasium, sondern in die Realschule geschickt hatte. Denn ich fühlte, wie wenig ich von der Eigenart der griechischen und lateinischen Kunst durch die Übersetzungen berührt wurde. Und so kaufte ich mir griechische und lateinische Lehrbücher und trieb ganz im stillen neben dem Realschulunterricht einen privaten Gymnasialunterricht. Das beanspruchte viel Zeit; aber es legte auch den Grund dazu, daß ich doch noch später, zwar abnorm, aber ganz regelrecht das Gymnasium absolvierte. Ich mußte nämlich, als ich an der Hochschule in Wien war, erst recht viele Nachhilfestunden geben. Ich bekam bald einen Gymnasiasten
zum Schüler. Die Umstände, von denen ich noch sprechen werde, bewirkten, daß ich diesen Schüler fast durch das ganze Gymnasium hindurch mit Hilfe von Privatstunden zu führen hatte. Ich unterrichtete ihn auch im Lateinischen und Griechischen, so daß ich an seinem Unterricht alle Einzelheiten des Gymnasialunterrichtes mitzuerleben hatte.
Die Lehrer aus der Geschichte und Geographie, die mir in den unteren Klassen so wenig geben konnten, wurden nun in den oberen Klassen doch noch von Bedeutung für mich. Gerade derjenige, der mich zu einer so sonderbaren Kantlektüre getrieben hatte, schrieb einmal einen Schulprogrammaufsatz über die «Eiszeit und ihre Ursachen». Ich nahm den Inhalt mit großer seelischer Begierde auf und behielt davon ein reges Interesse für das Eiszeitproblem. Aber dieser Lehrer war auch ein guter Schüler des ausgezeichneten Geographen Friedrich Simony. Das brachte ihn dazu, in den oberen Klassen, zeichnend an der Schultafel, die geologisch-geographischen Verhältnisse der Alpen zu entwickeln. Da las ich nun allerdings nicht Kant, sondern war ganz Auge und Ohr. Ich bekam von dieser Seite her viel von dem Lehrer, dessen Geschichtsunterricht mich gar nicht interessierte.
In der letzten Realschulklasse bekam ich erst einen Lehrer, der mich auch durch seinen Geschichtsunterricht fesselte. Er unterrichtete Geschichte und Geographie. In dieser wurde die Alpengeographie in der reizvollen Art fortgesetzt, die schon bei dem andern Lehrer vorhanden war. In der Geschichte wirkte der neue Lehrer stark auf uns Schüler. Er war für uns eine
Persönlichkeit aus dem Vollen heraus. Er war Parteimann, ganz begeistert für die fortschrittlichen Ideen der damaligen österreichischen liberalen Richtung. Aber in der Schule bemerkte man davon gar nichts. Er trug von seinen Parteiansichten nichts in die Schule hinein. Aber sein Geschichtsunterricht hatte durch seinen Anteil am Leben selbst starkes Leben. Ich hörte mit den Ergebnissen meiner Rotteck-Lektüre in der Seele die temperamentvollen geschichtlichen Auseinandersetzungen dieses Lehrers. Es gab einen schönen Einklang. Ich muß es als wichtig für mich ansehen, daß ich gerade die neuzeitliche Geschichte auf diese Art in mich aufnehmen konnte.
Im Elternhause hörte ich damals viel diskutieren über den russisch-türkischen Krieg (1877/78). Der Beamte, der damals die Ablösung meines Vaters im Dienste an jedem dritten Tag hatte, war ein origineller Mensch. Er kam immer zur Ablösung mit einer mächtigen Reisetasche. Darinnen hatte er große Manuskriptpakete. Es waren Auszüge aus den verschiedensten wissenschaftlichen Büchern. Er gab sie mir nach und nach zum Lesen. Ich verschlang sie. Mit mir diskutierte er dann über diese Dinge. Denn er hatte wirklich auch im Kopfe eine zwar chaotische, aber umfassende Anschauung von alledem, was er zusammengeschrieben hatte. - Mit meinem Vater aber politisierte er. Er nahm begeistert Partei für die Türken; mein Vater verteidigte mit starker Leidenschaft die Russen. Er gehörte zu denjenigen Persönlichkeiten, die Russland damals noch dankbar waren für die Dienste, die es den Österreichern beim ungarischen Aufstande (1849) geleistet hatte. Denn mit den Ungarn
war mein Vater gar nicht einverstanden. Er lebte ja an dem ungarischen Grenzorte Neudörfl in der Zeit der Magyarisierung. Und immer war über seinem Haupte das Damoklesschwert, daß er nicht Leiter der Station Neudörfl sein könne, weil er nicht magyarisch sprechen könne. Es war dies in der dortigen urdeutschen Gegend zwar ganz unnötig. Aber die ungarische Regierung arbeitete darauf hin, daß die ungarischen Linien der Eisenbahnen mit magyarisch sprechenden Beamten auch bei Privatbahnen besetzt würden. Mein Vater wollte aber seinen Posten in Neudörfl so lange behalten, bis ich mit der Schule in Wiener-Neustadt fertig war. Durch alles dieses war er den Ungarn recht wenig geneigt. Und weil er die Ungarn nicht mochte, liebte er in seiner einfachen Art zu denken: die Russen, die 1849 den Ungarn «den Herrn gezeigt hatten». Diese Denkweise wurde außerordentlich leidenschaftlich, aber in der zugleich außerordentlich liebenswürdigen Art meines Vaters gegenüber dem «Türkenfreund» in der Person seines «Ablösers» vertreten. Die Wogen der Diskussion gingen manchmal recht hoch. Mich interessierte das Aufeinanderplatzen der Persönlichkeiten stark, ihre politischen Ansichten fast gar nicht. Denn mir war damals weit wichtiger, die Frage zu beantworten: inwiefern läßt sich beweisen, daß im menschlichen Denken realer Geist das Wirksame ist?


III.
Meinem Vater war von der Direktion der Südbahngesellschaft versprochen worden, daß man ihn nach einer kleinen Station in der Nähe Wiens berufen werde, wenn ich nach Absolvierung der Realschule an die technische Hochschule kommen sollte. Mir sollte dadurch die Möglichkeit gegeben werden, jeden Tag nach Wien und zurück zu fahren. So kam denn meine Familie nach Inzersdorf am Wiener Berge. Der Bahnhof stand da, weit vom Orte entfernt, in völliger Einsamkeit in einer unschönen Naturumgebung.
Mein erster Besuch in Wien nach Ankunft in Inzersdorf wurde dazu benützt, mir eine größere Zahl von philosophischen Büchern zu kaufen. Dasjenige, dem nun meine besondere Liebe sich zuwandte, war der erste Entwurf von Fichtes «Wissenschaftslehre». Ich hatte es mit meiner Kantlektüre so weit gebracht, daß ich mir eine, wenn auch unreife Vorstellung von dem Schritte machen konnte, den Fichte über Kant hinaus tun wollte. Aber das interessierte mich nicht allzu stark. Mir kam es damals darauf an, das lebendige Weben der menschlichen Seele in der Form eines strengen Gedankenbildes auszudrücken. Meine Bemühungen um naturwissenschaftliche Begriffe hatten mich schließlich dazu gebracht, in der Tätigkeit des menschlichen «Ich» den einzig möglichen Ausgangspunkt für eine wahre Erkenntnis zu sehen. Wenn das Ich tätig ist und diese Tätigkeit selbst anschaut, so hat man ein Geistiges in aller Unmittelbarkeit im Bewußtsein, so sagte ich mir. Ich meinte, man müsse nun nur, was man so anschaut, in
klaren, überschaubaren Begriffen ausdrücken. Um dazu den Weg zu finden, hielt ich mich an Fichtes «Wissenschaftslehre». Aber ich hatte doch meine eigenen Ansichten. Und so nahm ich denn die «Wissenschaftslehre» Seite für Seite vor und schrieb sie um. Es entstand ein langes Manuskript. Vorher hatte ich mich damit geplagt, für die Naturerscheinungen Begriffe zu finden, von denen aus man einen solchen für das «Ich» finden könne. Jetzt wollte ich umgekehrt von dem Ich aus in das Werden der Natur einbrechen. Geist und Natur standen damals in ihrem vollen Gegensatz vor meiner Seele. Eine Welt der geistigen Wesen gab es für mich. Daß das «Ich», das selbst Geist ist, in einer Welt von Geistern lebt, war für mich unmittelbare Anschauung. Die Natur wollte aber in die erlebte Geisteswelt nicht herein.
Von der «Wissenschaftslehre» ausgehend bekam ich ein besonderes Interesse für die Fichte'schen Abhandlungen «Über die Bestimmung des Gelehrten» und «Über das Wesen des Gelehrten». In diesen Schriften fand ich eine Art Ideal, dem ich selbst nachstreben wollte. Daneben las ich auch die «Reden an die deutsche Nation». Sie fesselten mich damals viel weniger als die andern Fichte'schen Werke.
Ich wollte aber nun doch auch zu einem besseren Verständnis Kants kommen, als ich es bisher hatte gewinnen können. In der «Kritik der reinen Vernunft» wollte sich mir aber dieses Verständnis nicht erschließen. So nahm ich es denn mit den «Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik» auf. An diesem Buche glaubte ich zu erkennen, daß ein gründliches Eingehen
auf alle die Fragen, die Kant in den Denkern angeregt hatte, für mich notwendig sei. Ich arbeitete nunmehr immer bewußter daran, die unmittelbare Anschauung, die ich von der geistigen Welt hatte, in die Form von Gedanken zu gießen. Und während diese innere Arbeit mich erfüllte, suchte ich mich an den Wegen zu orientieren, welche die Denker der Kantzeit und diejenigen in der folgenden Epoche genommen hatten. Ich studierte den trockenen, nüchternen «transzendentalen Synthetismus» Traugott Krugs ebenso eifrig wie ich mich in die Erkenntnistragik einlebte, bei der Fichte angekommen war, als er seine «Bestimmung des Menschen» schrieb. Die «Geschichte der Philosophie» des Herbartianers Thilo erweiterte meinen Blick von der Kantzeit aus über die Entwickelung des philosophischen Denkens. Ich rang mich zu Schelling, zu Hegel durch. Der Gegensatz des Denkens bei Fichte und Herbart trat mit aller Intensität vor meine Seele.
Die Sommermonate im Jahre 1879, vom Ende meiner Realschulzeit bis zum Eintritte in die technische Hochschule, brachte ich ganz mit solchen philosophischen Studien zu. Im Herbst sollte ich mich für die Richtung eines Brotstudiums entscheiden. Ich beschloß, auf das Realschullehramt hinzuarbeiten. Mathematik und darstellende Geometrie zu studieren, entsprach meiner Neigung. Ich mußte auf die letztere verzichten. Denn deren Studium war verbunden mit einer Anzahl von Übungsstunden im geometrischen Zeichnen während des Tages. Aber ich mußte, um mir einiges Geld zu verdienen, Zeit dazu haben, Nachhilfestunden zu geben. Das vertrug sich damit, Vorlesungen zu hören,
deren Stoff man nachlesen konnte, wenn man sie versäumen mußte, nicht aber damit, regelmäßig die Zeichenstunden in der Schule selbst durchzusitzen.
So ließ ich mich denn zunächst für Mathematik, Naturgeschichte und Chemie einschreiben.
Von besonderer Bedeutung aber wurden für mich die Vorlesungen, die Karl Julius Schröer damals über die deutsche Literatur an der technischen Hochschule hielt. Er las im ersten Jahre meines Hochschulstudiums über «Deutsche Literatur seit Goethe» und über «Schillers Leben und Werke». Schon von seiner ersten Vorlesung an war ich gefesselt. Er entwickelte einen Überblick über das deutsche Geistesleben in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts und setzte da in dramatischer Art auseinander, wie Goethes erstes Auftreten in dieses Geistesleben einschlug. Die Wärme seiner Behandlungsart, die begeisternde Art, wie er innerhalb der Vorlesungen aus den Dichtern vorlas, führten auf eine verinnerlichte Weise in die Dichtung ein.
Daneben hatte er «Übungen im mündlichen Vortrag und schriftlicher Darstellung» eingerichtet. Die Schüler sollten da vortragen, oder vorlesen, was sie selbst ausgearbeitet hatten. Schröer gab dann anknüpfend an die Schülerleistungen Unterweisungen über Stil, Vortragsform usw. Ich hielt da zuerst einen Vortrag über Lessings Laokoon. Dann machte ich mich an eine größere Aufgabe. Ich arbeitete das Thema aus: Inwiefern ist der Mensch in seinen Handlungen ein freies Wesen? Ich geriet bei dieser Arbeit stark in die Herbart'sche Philosophie hinein. Das gefiel Schröer gar nicht. Er hat die Strömung für Herbart, die damals in Österreich sowohl
auf den philosophischen Lehrkanzeln wie in der Pädagogik die herrschende war, nicht mitgemacht. Er war ganz an Goethes Geistesart hingegeben. Da erschien ihm denn alles, was an Herbart anknüpfte, trotzdem er an ihm die Denkdisziplin anerkannte, als pedantisch und nüchtern.
Ich konnte nun auch einzelne Vorlesungen an der Universität hören. Auf den Herbertianer Robert Zimmermann hatte ich mich sehr gefreut. Er las «Praktische Philosophie». Ich hörte den Teil seiner Vorlesungen, in denen er die Grundprinzipien der Ethik auseinandersetzte. Ich wechselte ab: ich saß gewöhnlich einen Tag bei ihm, den andern bei Franz Brentano, der zu gleicher Zeit über denselben Gegenstand las. Allzu lange konnte ich das nicht fortsetzen, denn ich versäumte dadurch an der technischen Hochschule zu viel.
Es machte tiefen Eindruck auf mich, die Philosophie nun nicht bloß aus Büchern kennen zu lernen, sondern aus dem Munde von Philosophen selbst zu hören.
Robert Zimmermann war eine merkwürdige Persönlichkeit. Er hatte eine ganz ungewöhnlich hohe Stirn und einen langen Philosophenbart. Alles an ihm war gemessen, stilisiert. Wenn er zur Türe hereinkam, aufs Katheder stieg, waren seine Schritte wie einstudiert und doch wieder so, daß man sich sagte: dem Mann ist es selbstverständlich-natürlich, so zu sein. Er war in Haltung und Bewegung, wie wenn er sich selbst dazu nach Herbart'schen ästhetischen Prinzipien in langer Disziplin geformt hätte. Und man konnte doch rechte Sympathie mit alledem haben. Er setzte sich dann langsam auf seinen Stuhl, schaute dann durch die Brille in einem
langen Blicke auf das Auditorium hin, nahm dann langsam gemessen die Brille ab, schaute noch einmal lange unbebrillt über den Zuhörerkreis hin, dann begann er in freier Rede, aber in sorgsam geformten, kunstvoll gesprochenen Sätzen seine Vorlesung. Seine Sprache hatte etwas Klassisches. Aber man verlor wegen der langen Perioden im Zuhören leicht den Faden seiner Darstellung. Er trug die Herbart'sche Philosophie etwas modifiziert vor. Die Strenge seiner Gedankenfolge machte Eindruck auf mich. Aber nicht auf die andern Zuhörer. In den ersten drei bis vier Vorlesungen war der große Saal, in dem er vortrug, überfüllt. «Praktische Philosophie» war für die Juristen im ersten Jahre Pfiichtvorlesung. Sie brauchten die Unterschrift des Professors im Index. Von der fünften oder sechsten Stunde an blieben die meisten weg; man war, indem man den philosophischen Klassiker hörte, nur noch mit ganz wenigen Zuhörern zusammen auf den vordersten Bänken.
Für mich boten diese Vorträge doch eine starke Anregung. Und die Verschiedenheit in der Auffassung Schröers und Zimmermanns interessierte mich tief. Ich verbrachte die wenige Zeit, die mir vom Anhören der Vorlesungen und dem Privatunterricht, den ich zu geben hatte, blieb, entweder in der Hofbibliothek oder in der Bibliothek der technischen Hochschule. Da las ich denn, zum ersten Male, Goethes «Faust». Ich war tatsächlich bis zu meinem neunzehnten Jahre, in dem ich durch Schröer angeregt worden bin, nicht bis zu diesem Werke vorgedrungen. Damals aber wurde mein Interesse für dasselbe sogleich stark in Anspruch genommen. Schröer hatte seine Ausgabe des ersten Teiles bereits
veröffentlicht. Aus ihr lernte ich den ersten Teil zuerst kennen. Dazu kam, daß ich schon nach wenigen seiner Vorlesungsstunden mit Schröer näher bekannt wurde. Er nahm mich dann oft mit nach seinem Hause, sprach dies oder jenes zu mir in Ergänzung seiner Vorlesungen, antwortete gern auf meine Fragen und entließ mich mit einem Buche aus seiner Bibliothek, das er mir zum Lesen lieh. Dabei fiel auch manches Wort über den zweiten Teil des «Faust», an dessen Herausgabe und Erläuterung er gerade arbeitete. Ich las auch diesen in jener Zeit.
In den Bibliotheken beschäftigte ich mich mit Herbarts «Metaphysik», mit Zimmermanns «Ästhetik als Formwissenschaft», die vom Herbart'schen Standpunkte aus geschrieben war. Dazu kam ein eingehendes Studium von Ernst Haeckels «Genereller Morphologie». Ich darf wohl sagen: alles, was ich durch Schröers und Zimmermanns Vorlesungen, sowie durch die gekennzeichnete Lektüre an mich herantretend fand, wurde mir damals zum tiefsten Seelenerlebnis. Wissens- und Weltauffassungsrätsel formten sich mir daran.
Schröer war ein Geist, der nichts auf Systematik gab. Aus einer gewissen Intuition heraus dachte und sprach er. Er hatte dabei die denkbar größte Achtung vor der Art, wie er seine Anschauungen in Worte prägte. Er sprach wohl aus diesem Grunde in seinen Vorlesungen nie frei. Er brauchte die Ruhe des Niederschreibens, um sich selbst Genüge zu tun in der Umformung seines Gedankens in das zu sprechende Wort. Dann las er das Geschriebene mit starker Verinnerlichung der Rede ab. Doch - einmal sprach er frei über Anastasius Grün und
Lenau. Er hatte sein Manuskript vergessen. Aber in der nächsten Stunde behandelte er den ganzen Gegenstand noch einmal lesend. Er war nicht zufrieden mit der Gestalt, die er ihm in freier Rede hatte geben können.
Von Schröer lernte ich viele Werke der Schönheit kennen. Durch Zimmermann trat eine ausgebildete Theorie des Schönen an mich heran. Beides stimmte nicht gut zusammen. Schröer, die intuitive Persönlichkeit mit einer gewissen Geringschätzung des Systematischen, stand für mich neben Zimmermann, dem strengen systematischen Theoretiker des Schönen.
In Franz Brentano, bei dem ich auch Vorlesungen über «praktische Philosophie» hörte, interessierte mich damals ganz besonders die Persönlichkeit. Er war scharf-denkend und versonnen zugleich. In der Art, wie er sich als Vortragender gab, war etwas Feierliches. Ich hörte, was er sprach, mußte aber auf jeden Blick, jede Kopfbewegung, jede Geste seiner ausdrucksvollen Hände achten. Er war der vollendete Logiker. Jeder Gedanke sollte absolut durchsichtig und getragen von zahlreichen andern sein. Im Formen dieser Gedankenreihen waltete die größte logische Gewissenhaftigkeit Aber ich hatte das Gefühl, dieses Denken kommt aus seinem eigenen Weben nicht heraus; es bricht nirgends in die Wirklichkeit ein. Und so war auch die ganze Haltung Brentanos. Er hielt mit der Hand lose das Manuskript, als ob es jeden Augenblick den Fingern entgleiten könnte; er streifte mit dem Blicke nur die Zeilen. Auch diese Geste war nur für eine leise Berührung der Wirklichkeit, nicht für ein entschlossenes Anfassen. Ich konnte aus seinen «Philosophenhänden» die Art seines
Philosophierens noch mehr verstehen als aus seinen Worten.
Die Anregung, die von Brentano ausging, wirkte in mir stark nach. Ich fing bald an, mich mit seinen Schriften auseinanderzusetzen und habe dann im Laufe der späteren Jahre das meiste von dem gelesen, was er veröffentlicht hat.
Ich hielt mich damals für verpflichtet, durch die Philosophie die Wahrheit zu suchen. Ich sollte Mathematik und Naturwissenschaft studieren. Ich war überzeugt davon, daß ich dazu kein Verhältnis finden werde, wenn ich deren Ergebnisse nicht auf einen sicheren philosophischen Boden stellen könnte. Aber ich schaute doch eine geistige Welt als Wirklichkeit. Mit aller Anschaulichkeit offenbarte sich mir an jedem Menschen seine geistige Individualität. Diese hatte in der physischen Leiblichkeit und in dem Tun in der physischen Welt nur ihre Offenbarung. Sie vereinte sich mit dem, was als physischer Keim von den Eltern herrührte. Den gestorbenen Menschen verfolgte ich weiter auf seinem Wege in die geistige Welt hinein. Einem meiner früheren Lehrer, der mir auch nach meiner Realschulzeit freundschaftlich nahe blieb, schrieb ich einmal nach dem Tode eines Mitschülers über diese Seite meines Seelenlebens. Er schrieb mir ungewöhnlich lieb zurück, würdigte aber, was ich über den verstorbenen Mitschüler schrieb, keines Wortes.
Und so ging es mir damals überall mit meiner Anschauung von der geistigen Welt. Man wollte von ihr nichts hören. Von dieser oder jener Seite kam man da höchstens mit allerlei Spiritistischem. Da wollte ich wieder
nichts hören. Mir erschien es abgeschmackt, dem Geistigen sich auf solche Art zu nähern.
Da geschah es, daß ich mit einem einfachen Manne aus dem Volke bekannt wurde. Er fuhr jede Woche mit demselben Eisenbahnzuge nach Wien, den ich auch benützte. Er sammelte auf dem Lande Heilkräuter und verkaufte sie in Wien an Apotheken. Wir wurden Freunde. Mit ihm konnte man über die geistige Welt sprechen wie mit jemand, der Erfahrung darin hatte. Er war eine innerlich fromme Persönlichkeit. In allem Schulmäßigen war er ungebildet. Er hatte zwar viele mystische Bücher gelesen; aber, was er sprach, war ganz unbeeinflußt von dieser Lektüre. Es war der Ausfluß eines Seelenlebens, das eine ganz elementarische, schöpferische Weisheit in sich trug. Man konnte bald empfinden: er las die Bücher nur, weil er, was er durch sich selbst wußte, auch bei andern finden wollte. Aber es befriedigte ihn nicht. Er offenbarte sich so, als ob er als Persönlichkeit nur das Sprachorgan wäre für einen Geistesinhalt, der aus verborgenen Welten heraus sprechen wollte. Wenn man mit ihm zusammen war, konnte man tiefe Blicke in die Geheimnisse der Natur tun. Er trug auf dem Rücken sein Bündel Heilkräuter; aber in seinem Herzen trug er die Ergebnisse, die er aus der Geistigkeit der Natur bei seinem Sammeln gewonnen hatte. Ich habe manchen Menschen lächeln gesehen, der zuweilen als Dritter sich angeschlossen hatte, wenn ich mit diesem «Eingeweihten» durch die Wiener Alleegasse ging. Das war kein Wunder. Denn dessen Ausdrucksweise war nicht von vorneherein verständlich. Man mußte gewissermaßen erst seinen «geistigen Dia-
lekt» lernen. Auch mir war er anfangs nicht verständlich. Aber vom ersten Kennenlernen an hatte ich die tiefste Sympathie für ihn. Und so wurde es mir nach und nach, wie wenn ich mit einer Seele aus ganz alten Zeiten zusammen wäre, die unberührt von der Zivilisation, Wissenschaft und Anschauung der Gegenwart, ein instinktives Wissen der Vorzeit an mich heranbrächte.
Nimmt man den gewöhnlichen Begriff des «Lernens», so kann man sagen: «Lernen» konnte man von diesem Manne nichts. Aber man konnte, wenn man selbst die Anschauung einer geistigen Welt hatte, in diese durch einen Andern, in ihr ganz Feststehenden, tiefe Einblicke tun.
Und dabei lag dieser Persönlichkeit alles weltenferne, was Schwärmerei war. Kam man in sein Heim, so war man im Kreise der nüchternsten, einfachen Landfamilie. Über der Türe seines Hauses standen die Worte: «In Gottes Segen ist alles gelegen.» Man wurde bewirtet, wie bei andern Dorfbewohnern. Ich habe immer Kaffee trinken müssen, nicht aus einer Tasse, sondern aus einem «Häferl», das nahezu einen Liter faßte; dazu hatte ich ein Stück Brot zu essen, das Riesendimensionen hatte. Aber auch die Dorfbewohner sahen den Mann nicht für einen Schwärmer an. An der Art, wie er sich in seinem Heimatorte gab, prallte jeder Spott ab. Er hatte auch einen gesunden Humor und wußte im Dorfe mit jung und alt bei jeder Begegnung so zu reden, daß die Leute an seinen Worten Freude hatten. Da lächelte niemand so wie die Leute, die mit ihm und mir durch die Wiener Alleegasse gingen und die in ihm zumeist etwas sahen, das ihnen ganz fremd erschien.
Mir blieb dieser Mann, auch als das Leben mich wieder von ihm weggeführt hatte, seelennahe. Man findet ihn in meinen Mysteriendramen in der Gestalt des Felix Balde.
Nicht leicht wurde es damals meinem Seelenleben, daß die Philosophie, die ich von Andern vernahm, in ihrem Denken nicht bis an die Anschauung der geistigen Welt heranzubringen war. Aus den Schwierigkeiten, die ich nach dieser Richtung erlebte, fing sich in mir eine Art «Erkenntnistheorie» an zu bilden. Das Leben im Denken erschien mir allmählich als der in den physischen Menschen hereinstrahlende Abglanz dessen, was die Seele in der geistigen Welt erlebt. Gedanken-Erleben war mir das Dasein in einer Wirklichkeit, an die als an einer durch und durch erlebten sich kein Zweifel heranwagen konnte. Die Welt der Sinne erschien mir nicht so erlebbar. Sie ist da; aber man ergreift sie nicht wie den Gedanken. Es kann in ihr oder hinter ihr ein wesenhaftes Unbekanntes stecken. Aber der Mensch ist in sie hineingestellt. Da entstand die Frage: ist denn diese Welt eine volle Wirklichkeit? Wenn der Mensch an ihr aus seinem Innern die Gedanken webt, die dann Licht in diese Sinnenwelt bringen, bringt er dann auch tatsächlich etwas ihr Fremdes zu ihr hinzu? Das stimmt doch gar nicht zu dem Erlebnis, das man hat, wenn die Sinnenwelt vor dem Menschen steht, und er mit seinen Gedanken in sie einbricht. Dann erweisen sich doch die Gedanken als dasjenige, durch das die Sinnenwelt sich ausspricht. Die weitere Verfolgung dieses Nachsinnens war dazumal ein wichtiger Teil meines inneren Lebens.
Aber ich wollte vorsichtig sein. Voreilig einen Gedankengang bis zum Ausbilden einer eigenen philosophischen Anschauung zu führen, schien mir gefährlich. Das trieb mich zu einem eingehenden Studium Hegels. Die Art, wie dieser Philosoph die Wirklichkeit des Gedankens darstellt, war mir nahegehend. Daß er nur zu einer Gedankenwelt, wenn auch zu einer lebendigen, vordringt, nicht zu einer Anschauung einer konkreten Geisteswelt, stieß mich zurück. Die Sicherheit, mit der man philosophiert, wenn man von Gedanke zu Gedanken fortschreitet, zog mich an. Ich sah, daß Viele einen Gegensatz empfanden zwischen der Erfahrung und dem Denken. Mir war das Denken selbst Erfahrung, aber eine solche, in der man lebt, nicht eine solche, die von außen an den Menschen herantritt. Und so wurde mir Hegel für eine längere Zeit sehr wertvoll.
Bei meinen Pflichtstudien, die unter diesen philosophischen Interessen naturgemäß hätten zu kurz kommen müssen, kam mir zugute, daß ich schon vorher mich viel mit Differential- und Integralrechnung, auch mit analytischer Geometrie befaßt hatte. So konnte ich von mancher mathematischen Vorlesung wegbleiben, ohne den Zusammenhang zu verlieren. Die Mathematik behielt für mich ihre Bedeutung auch als Grundlage meines ganzen Erkenntnisstrebens. In ihr ist doch ein System von Anschauungen und Begriffen gegeben, die von aller äußeren Sinneserfahrung unabhängig gewonnen sind. Und doch geht man, so sagte ich mir damals unablässig, mit diesen Anschauungen und Begriffen an die Sinneswirklichkeit heran und findet durch sie ihre Gesetzmäßigkeiten. Durch die Mathematik lernt man die Welt
kennen, und doch muß man, um dies erreichen zu können,erst die Mathematik aus der menschlichen Seele hervorgehen lassen.
Ein ausschlaggebendes Erlebnis kam mir damals geradezu von der mathematischen Seite. Die Vorstellung des Raumes bot mir die größten inneren Schwierigkeiten. Er ließ sich als das allseitig ins Unendliche laufende Leere, als das er den damals herrschenden naturwissenschaftlichen Theorien zugrunde lag, nicht in überschaubarer Art denken. Durch die neuere (synthetische) Geometrie, die ich durch Vorlesungen und im Privatstudium kennen lernte, trat vor meine Seele die Anschauung, daß eine Linie, die nach rechts in das Unendliche verlängert wird, von links wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkommt. Der nach rechts liegende unendlich ferne Punkt ist derselbe wie der nach links liegende unendlich ferne.
Mir kam vor, daß man mit solchen Vorstellungen der neueren Geometrie den sonst in Leere starrenden Raum begrifflich erfassen könne. Die wie eine Kreislinie in sich selbst zurückkehrende gerade Linie empfand ich wie eine Offenbarung. Ich ging aus der Vorlesung, in der mir das zuerst vor die Seele getreten ist, hinweg, wie wenn eine Zentnerlast von mir gefallen wäre. Ein befreiendes Gefühl kam über mich. Wieder kam mir, wie in meinen ganz jungen Knabenjahren, von der Geometrie etwas Beglückendes.
Hinter dem Raumrätsel stand in diesem meinem Lebensabschnitt für mich das von der Zeit. Sollte auch da eine Vorstellung möglich sein, die durch ein Fortschreiten in die «unendlich ferne» Zukunft ein Zurückkom
men aus der Vergangenheit ideell in sich enthält? Das Glück über die Raumvorstellung brachte etwas tief Beunruhigendes über diejenige von der Zeit. Aber da war zunächst kein Ausweg sichtbar. Alle Denkversuche führten dazu, zu erkennen, daß ich mich insbesondere hüten müsse, die anschaulichen Raumbegriffe in die Auffassung der Zeit hineinzubringen. Alle Enttäuschungen, welche das Erkenntnisstreben bringen kann, traten an dem Zeitenrätsel auf.
Die Anregungen, die ich von Zimmermann für die Ästhetik erhalten hatte, führten mich zum Lesen der Schriften des berühmten Ästhetikers der damaligen Zeit, Friedrich Theodor Vischers. Ich fand bei ihm an einer Stelle seiner Werke eine Hinweisung darauf, daß das neuere naturwissenschaftliche Denken eine Reform des Zeitbegriffes nötig mache. Ich war immer besonders freudig erregt, wenn ich Erkenntnisbedürfnisse, die sich bei mir einstellten, auch bei einem Andern fand. Es war mir in diesem Falle wie eine Rechtfertigung meines Strebens nach einem befriedigenden Zeitbegriffe.
Die Vorlesungen, für die ich an der technischen Hochschule eingeschrieben war, mußte ich immer mit den entsprechenden Prüfungen abschließen. Denn mir war ein Stipendium bewilligt worden; und das konnte ich nur fortbeziehen, wenn ich jedes Jahr bestimmte Studienerfolge nachwies.
Aber meine Erkenntnisbedürfnisse wurden insbesondere auf den naturwissenschaftlichen Gebieten durch dieses Pflichtstudium wenig befriedigt. Es bestand aber damals an den Wiener Hochschulen die Möglichkeit, als Hospitant Vorlesungen, ja auch Übungen mitzu-
machen. Ich fand überall Entgegenkommen, wenn ich in dieser Art das wissenschaftliche Leben pflegen wollte, bis in das Medizinische hinein.
Ich darf sagen, daß ich meine Einsichten in das Geistige nicht störend eingreifen ließ, wenn es sich darum handelte, die Naturwissenschaften so kennen zu lernen, wie sie damals ausgebildet waren. Ich widmete mich dem, was gelehrt wurde, und hatte nur im Hintergrunde die Hoffnung, daß sich mir einmal der Zusammenschluß der Naturwissenschaft mit der Geist-Erkenntnis ergeben werde. Nur von zwei Seiten her war ich für diese Hoffnung beunruhigt.
Die Wissenschaften der organischen Natur waren da, wo ich mich mit ihnen befassen konnte, durchtränkt von Darwin'schen Ideen. Mir erschien damals der Darwinismus in seinen höchsten Ideen als eine wissenschaftliche Unmöglichkeit. Ich war nach und nach dazu gekommen, mir ein Bild des Menschen-Innern zu machen. Das war geistiger Art. Und es war als ein Glied einer geistigen Welt gedacht. Es war so vorgestellt, daß es aus der Geisteswelt in das Naturdasein untertaucht, sich dem natürlichen Organismus eingliedert, um durch denselben in der Sinneswelt wahrzunehmen und zu wirken.
Von diesem Bilde konnte ich mir auch dadurch nichts abdingen lassen, daß ich vor den Gedankengängen der organischen Entwickelungslehre eine gewisse Achtung hatte. Das Hervorgehen höherer Organismen aus niederen schien mir eine fruchtbare Idee. Ihre Vereinigung mit dem, was ich als Geisteswelt kannte, unermeßlich schwierig.
Die physikalischen Studien waren ganz durchsetzt von der mechanischen Wärmetheorie und der Wellenlehre für die Licht- und Farbenerscheinungen.
Das Studium der mechanischen Wärmetheorie hatte für mich einen persönlich gefärbten Reiz bekommen, weil ich Vorlesungen über dieses physikalische Gebiet bei einer Persönlichkeit hörte, die ich ganz außerordentlich verehrte. Es war Edmund Reitlinger, der Verfasser des schönen Buches «Freie Blicke».
Dieser Mann war von der gewinnendsten Liebenswürdigkeit. Er litt, als ich sein Zuhörer wurde, bereits an einer hochgradigen Lungenkrankheit. Ich hörte zwei Jahre hindurch bei ihm Vorlesungen über mechanische Wärmetheorie, Physik für Chemiker und Geschichte der Physik. Ich arbeitete bei ihm im physikalischen Laboratorium auf vielen Gebieten, besonders auf dem der Spektralanalyse.
Von besonderer Bedeutung wurden für mich Reitlingers Vorlesungen aus der Geschichte der Physik. Er sprach so, daß man das Gefühl hatte, ihm werde wegen seiner Krankheit jedes Wort schwer. Aber dennoch war sein Vortrag im allerbesten Sinne begeisternd. Er war ein Mann der streng induktiven Forschungsart; er zitierte für alles physikalisch Methodische gern das Buch Whewells über induktive Wissenschaften. Newton bildete für ihn den Höhepunkt des physikalischen Forschens. Die Geschichte der Physik trug er in zwei Abteilungen vor: die erste von den ältesten Zeiten bis zu Newton, die zweite von Newton bis zur Neuzeit. Er war ein universeller Denker. Von der historischen Betrachtung der physikalischen Probleme ging er stets auf all-
gemeine kulturgeschichtliche Perspektiven über. Ja auch ganz allgemeine philosophische Ideen traten bei ihm im naturwissenschaftlichen Vortrag auf So setzte er sich mit dem Optimismus und Pessimismus auseinander und sprach über die Berechtigung der naturwissenschaftlichen Hypothesenbildung außerordentlich anregend. Seine Darstellung Keplers, seine Charakteristik Julius Robert Mayers waren Meisterstücke wissenschaftlicher Vorträge.
Ich wurde damals angeregt, fast alle Schriften Julius Robert Mayers zu lesen; und ich konnte als eine wirklich große Freude erleben, mit Reitlinger oft mündlich über deren Inhalt sprechen zu dürfen.
Es erfüllte mich mit großer Trauer, als wenige Wochen, nachdem ich meine letzte Prüfung aus der mechanischen Wärmetheorie bei Reitlinger abgelegt hatte, der geliebte Lehrer seiner schweren Krankheit erlag. Er hatte mir noch kurz vor seinem Ende wie ein Vermächtnis Empfehlungen für Persönlichkeiten gegeben, die mir Schüler zum Privatunterricht verschaffen konnten. Das war von sehr gutem Erfolg. Für einen nicht geringen Teil dessen, was mir in den nächsten Jahren an Mitteln zum Lebensunterhalt zufloß, hatte ich dem toten Reitlinger zu danken.
Durch die mechanische Wärmetheorie und die Wellenlehre für die Lichterscheinungen und Elektrizitätswirkungen wurde ich in erkenntnistheoretische Studien hineingedrängt. Die physische Außenwelt stellte sich damals als Bewegungsvorgänge der Materie dar. Die Empfindungen der Sinne erschienen nur wie subjektive Erlebnisse, wie Wirkungen reiner Bewegungsvorgänge
auf die Sinne des Menschen. Da draußen im Raume spielen sich die Bewegungsvorgänge der Materie ab; treffen diese Vorgänge auf den menschlichen Wärmesinn, so erlebt der Mensch die Empfindungen der Wärme. Es sind außer dem Menschen Wellenvorgänge des Äthers; treffen diese auf den Sehnerv, so entsteht im Menschen die Licht- und Farbenempfindung.
Diese Anschauung trat mir überall entgegen. Sie machte meinem Denken unsägliche Schwierigkeiten. Sie trieb allen Geist aus der objektiven Außenwelt heraus. Mir stand die Idee vor der Seele, daß, wenn die Betrachtung der Naturerscheinungen auf dergleichen Annahmen führe, man mit einer Anschauung vom Geiste an diese Annahmen nicht herankommen könne. Ich sah, wie verführerisch für die damals an der Naturwissenschaft heranerzogene Denkrichtung diese Annahmen sind. Ich konnte mich auch jetzt noch nicht entschließen, eine eigene Denkungsart auch nur für mich selber der herrschenden entgegenzusetzen. Aber eben dies ergab schwere Seelenkämpfe. Immer wieder mußte die leicht zu erdenkende Kritik dieser Denkungsart innerlich niedergerungen werden, um die Zeit abzuwarten, in der weitere Erkenntnisquellen und Erkenntniswege eine größere Sicherheit geben würden.
Eine starke Anregung erhielt ich durch das Lesen von Schillers «Briefen über ästhetische Erziehung des Menschen». Der Hinweis darauf, daß das menschliche Bewußtsein zwischen verschiedenen Zuständen gleichsam hin und her schwinge, bot eine Anknüpfung an das Bild, das ich mir von dem inneren Wirken und Weben der menschlichen Seele gemacht hatte. Schiller unterscheidet
zwei Bewußtseinszustände, in denen der Mensch sein Verhältnis zur Welt entwickelt. Überläßt er sich dem, was in ihm sinnlich wirkt, so lebt er unter der Nötigung der Natur. Die Sinne und die Triebe bestimmen sein Leben. Stellt er sich unter die logische Gesetzmäßigkeit der Vernunft, so lebt er in einer geistigen Notwendigkeit. Aber er kann einen mittleren Bewußtseinszustand in sich entwickeln. Er kann die «ästhetische Stimmung» ausbilden, die weder einseitig an die Naturnötigung, noch an die Vernunftnotwendigkeit hingegeben ist. In dieser ästhetischen Stimmung lebt die Seele durch die Sinne; aber sie trägt in die sinnliche Anschauung und in das von der Sinnlichkeit angeregte Handeln ein Geistiges hinein. Man nimmt mit den Sinnen wahr, aber so, als ob das Geistige in die Sinne eingeströmt wäre. Man überläßt sich im Handeln dem Wohlgefallen des unmittelbaren Begehrens, aber man hat dieses Begehren so veredelt, daß ihm das Gute gefällt, das Schlechte mißfällt Die Vernunft ist da eine innige Verbindung mit der Sinnlichkeit eingegangen. Das Gute wird zum Instinkt; der Instinkt darf sich selbst die Richtung geben, weil er in sich den Charakter der Geistigkeit angenommen hat. Schiller sieht in diesem Bewußtseinszustand diejenige Seelenverfassung, durch die der Mensch die Werke der Schönheit erleben und hervorbringen kann. In der Entwickelung dieses Zustandes findet er das Aufleben des wahren Menschenwesens im Menschen.
Mich zogen diese Schiller'schen Gedankengänge an. Sie sprachen davon, daß man das Bewußtsein erst in einer bestimmten Verfassung haben müsse, um ein Verhältnis zu den Erscheinungen der Welt zu gewinnen,
das der Wesenheit des Menschen entspricht. Mir war damit etwas gegeben, das die Fragen, die sich für mich aus Naturbetrachtung und Geist-Erleben stellten, zu einer größeren Deutlichkeit brachte. Schiller hat von dem Bewußtseinszustand gesprochen, der da sein muß, um die Schönheit der Welt zu erleben. Konnte man nicht auch an einen solchen Bewußtseinszustand denken, der die Wahrheit im Wesen der Dinge vermittelt? Wenn das berechtigt ist, dann kann man nicht in Kantscher Art das zunächst gegebene menschliche Bewußtsein betrachten und untersuchen, ob dieses an das wahre Wesen der Dinge herankommen könne. Sondern man mußte erst den Bewußtseinszustand erforschen, durch den der Mensch sich in ein solches Verhältnis zur Welt setzt, daß ihm die Dinge und Tatsachen ihr Wesen enthüllen.
Und ich glaubte, zu erkennen, daß ein solcher Bewußtseinszustand bis zu einem gewissen Grade erreicht sei, wenn der Mensch nicht nur Gedanken habe, die äußere Dinge und Vorgänge abbilden, sondern solche, die er als Gedanken selbst erlebt. Dieses Leben in Gedanken offenbarte sich mir als ein ganz anderes als das ist, in dem man das gewöhnliche Dasein und auch die gewöhnliche wissenschaftliche Forschung verbringt. Geht man immer weiter in dem Gedanken-Erleben, so findet man, daß diesem Erleben die geistige Wirklichkeit entgegenkommt. Man nimmt den Seelenweg zu dem Geiste hin. Aber man gelangt auf diesem inneren Seelenwege zu einer geistigen Wirklichkeit, die man dann auch im Innern der Natur wiederfindet. Man erringt eine tiefere Naturerkenntnis, indem man sich
der Natur dann gegenüberstellt, wenn man im lebendigen Gedanken die Wirklichkeit des Geistes geschaut hat.
Mir wurde immer klarer, wie durch das Hinwegschreiten über die gewöhnlichen abstrakten Gedanken zu denjenigen geistigen Schauungen, die aber doch die Besonnenheit und Helligkeit des Gedankens sich bewahren, der Mensch sich in eine Wirklichkeit einlebt, von der ihn das gewöhnliche Bewußtsein entfernt. Dieses hat die Lebendigkeit der Sinneswahrnehmung auf der einen Seite, die Abstraktheit des Gedanken-Bildens auf der andern. Die geistige Schauung nimmt den Geist wahr wie die Sinne die Natur; aber sie steht mit dem Denken der geistigen Wahrnehmung nicht ferne wie das gewöhnliche Bewußtsein mit seinem Denken der Sinneswahrnehmung, sondern sie denkt, indem sie das Geistige erlebt, und sie erlebt, indem sie die erwachte Geistigkeit im Menschen zum Denken bringt.
Eine geistige Schauung stellte sich mir vor die Seele hin, die nicht auf einem dunklen mystischen Gefühle beruhte. Sie verlief vielmehr in einer geistigen Betätigung, die an Durchsichtigkeit dem mathematischen Denken sich voll vergleichen ließ. Ich näherte mich der Seelenverfassung, in der ich glauben konnte, ich dürfe die Anschauung von der Geisteswelt, die ich in mir trug, auch vor dem Forum des naturwissenschaftlichen Denkens für gerechtfertigt halten.
Ich stand, als diese Erlebnisse durch meine Seele zogen, in meinem zweiundzwanzigsten Lebensjahre.
IV.
Für die Form des Geist-Erlebens, die ich damals in mir auf eine sichere Grundlage bringen wollte, wurde das Musikalische von einer krisenhaften Bedeutung. Es lebte sich zu dieser Zeit in der geistigen Umgebung, in der ich mich befand, der «Streit um Wagner» in der heftigsten Art aus. Ich hatte während meines Knaben- und Jugendlebens jede Gelegenheit benützt, um mein Musikverständnis zu fördern. Die Stellung, die ich zum Denken hatte, brachte das mit sich. Für mich hatte das Denken Inhalt durch sich selbst. Es bekam ihn nicht bloß durch die Wahrnehmung, die es ausdrückt. Das aber führte wie mit Selbstverständlichkeit in das Erleben des reinen musikalischen Tongebildes als solchen hinüber. Die Welt der Töne an sich war mir die Offenbarung einer wesentlichen Seite der Wirklichkeit. Daß das Musikalische über die Töne-Formung hinaus noch etwas «ausdrücken» sollte, wie es von den Anhängern Wagners damals in allen möglichen Arten behauptet wurde, schien mir ganz «unmusikalisch».
Ich war stets ein geselliger Mensch. Dadurch hatte ich schon während meiner Schulzeit in Wiener-Neustadt und dann wieder in Wien viele Freundschaften geschlossen. In den Meinungen stimmte ich selten mit diesen Freunden zusammen. Das hinderte aber niemals, daß Innigkeit und starke gegenseitige Anregung in den Freundschaftsbündnissen lebte. Eines derselben ward mit einem herrlich idealistisch gesinnten jungen Manne geschlossen. Er war mit seinen blonden Locken, mit den treuherzigen blauen Augen so recht der Typus des
deutschen Jünglings. Der war nun ganz mitgerissen von dem Wagnertum. Musik, die in sich selbst lebte, die nur in Tönen weben wollte, war ihm eine abgetane Welt greulicher Philister. Was in den Tönen sich offenbarte wie in einer Art von Sprache, das machte für ihn das Tongebilde wertvoll. Wir besuchten zusammen manches Konzert und manche Oper. Wir waren stets verschiedener Meinung. In meinen Gliedern lagerte etwas wie Blei, wenn die «ausdrucksvolle Musik» ihn bis zur Ekstase entflammte; er langweilte sich entsetzlich, wenn Musik erklang, die nichts als Musik sein wollte.
Die Debatten mit diesem Freunde dehnten sich ins Endlose aus. Auf langen Spaziergängen, in Dauersitzungen bei einer Tasse Kaffee führte er seine in begeisterten Worten sich aussprechenden «Beweise» durch, daß mit Wagner eigentlich erst die wahre Musik geboren worden sei, und daß alles Frühere nur eine Vorbereitung zu diesem «Entdecker des Musikalischen» sei. Mich brachte das dazu, meine Empfindung in recht drastischer Art zur Geltung zu bringen. Ich sprach von der Wagner'schen Barbarei, die das Grab alles wirklichen Musikverständnisses sei.
Besonders heftig wurden die Debatten bei besonderen Gelegenheiten. Es trat bei meinem Freunde eines Tages der merkwürdige Hang ein, unseren fast täglichen Spaziergängen die Richtung nach einem engen Gäßchen zu geben, und mit mir da, Wagner diskutierend, oft viele Male auf- und abzugehen. Ich war in unsere Debatten so vertieft, daß mir erst allmählich ein Licht darüber aufging, wie er zu diesem Hang ge-
kommen war. Am Fenster eines Hauses dieses Gäßchens saß um die Zeit unserer Spaziergänge ein anmutiges junges Mädchen. Es gab für ihn zunächst keine andere Beziehung zu dem Mädchen als die, daß er es am Fenster fast täglich sitzen sah und zuweilen das Bewußtsein hatte, ein Blick, den es auf die Straße fallen ließ, gelte ihm.
Ich empfand zunächst nur, wie sein Eintreten für Wagner, das auch sonst schon feurig genug war, in diesem Gäßchen zur hellen Flamme aufloderte. Und als ich darauf kam, welche Nebenströmung da immer in sein begeistertes Herz floß, da wurde er auch nach dieser Richtung mitteilsam, und ich wurde der Mitfühlende bei einer der zartesten, schönsten, schwärmerischsten Jugendliebe. Das Verhältnis kam nicht viel über den geschilderten Stand hinaus. Mein Freund, der aus einer nicht mit Glücksgütern gesegneten Familie stammte, mußte bald eine kleine Journalistenstelle in einer Provinzstadt antreten. Er konnte an keine nähere Verbindung mit dem Mädchen denken. Er war auch nicht stark genug, die Verhältnisse zu meistern. Ich blieb noch lange mit ihm in brieflicher Verbindung. Ein trauriger Nachklang von Resignation tönte aus seinen Briefen heraus. In seinem Herzen lebte das fort, von dem er sich hatte trennen müssen.
Ich traf, nachdem das Leben lange schon dem Briefverkehr mit dem Jugendfreunde ein Ende bereitet hatte, mit einer Persönlichkeit aus der Stadt zusammen, in der er seine Journalistenstellung gefunden hatte. Ich hatte ihn immer lieb behalten und frug nach ihm. Da sagte mir die Persönlichkeit: «Ja, dem ist es recht
schlecht ergangen; er konnte kaum sein Brot verdienen, zuletzt war er Schreiber bei mir, dann starb er an einer Lungenkrankheit.» Mir schnitt diese Mitteilung ins Herz, denn ich wußte, daß der idealistische blonde Mann sich von seiner Jugendliebe dereinst unter dem Zwange der Verhältnisse mit dem Gefühle getrennt hatte, es sei für ihn gleichgültig, was ihm das Leben ferner noch bringen werde. Er legte keinen Wert darauf, sich ein Leben zu begründen, das doch nicht so sein konnte, wie es als ein Ideal ihm bei unseren Spaziergängen in dem engen Gäßchen vorschwebte.
Im Verkehr mit diesem Freunde ist mein damaliges Anti-Wagnertum nur eben in starker Form zum Ausleben gekommen. Aber es spielte in dieser Zeit auch sonst eine große Rolle in meinem Seelenleben. Ich suchte mich nach allen Seiten in das Musikalische, das mit Wagnerturn nichts zu tun hatte, hineinzufinden. Meine Liebe zur «reinen Musik» wuchs durch mehrere Jahre; mein Abscheu gegen die «Barbarei» einer «Musik als Ausdruck» wurde immer größer. Und dabei hatte ich das Schicksal, daß ich in menschliche Umgebungen kam, in denen fast ausschließlich Wagner-Verehrer waren. Das alles trug viel dazu bei, daß es mir
- viel - später recht sauer wurde, mich bis zu dem Wagner-Verständnis durchzuringen, das ja das menschlich Selbstverständliche gegenüber einer so bedeutenden Kulturerscheinung ist. Doch dieses Ringen gehört einer spätern Zeit meines Lebens an. In der hier geschilderten war mir z. B. eine Tristanaufführung, in die ich einen Schüler von mir begleiten mußte, «ertötend langweilig».

In diese Zeit fällt noch eine andere für mich bedeutsame Jugendfreundschaft. Die galt einem jungen Manne, der in allem das Gegenteil des blondgelockten Jünglings darstellte. Er fühlte sich als Dichter. Auch mit ihm verbrachte ich viel Zeit in anregenden Gesprächen. Er hatte große Begeisterung für alles Dichterische. Er machte sich frühzeitig an große Aufgaben. Als wir bekannt wurden, hatte er bereits eine Tragödie «Hannibal » und viel Lyrisches geschrieben.
Mit beiden Freunden zusammen war ich auch bei den «Übungen im mündlichen Vortrag und schriftlicher Darstellung», die Schröer an der Hochschule abhielt. Davon gingen für uns drei und noch für manchen Andern die schönsten Anregungen aus. Wir jungen Leute konnten, was wir geistig zustande brachten, vortragen und Schröer besprach alles mit uns und erhob unsere Seelen durch seinen herrlichen Idealismus und seine edle Begeisterungsfähigkeit.
Mein Freund begleitete mich oft, wenn ich Schröer in seinem Heim besuchen durfte. Da lebte er immer auf, während sonst oft ein schwer wirkender Ton durch seine Lebensäußerungen ging. Er wurde durch einen innern Zwiespalt mit dem Leben nicht fertig. Kein Beruf reizte ihn so, daß er ihn hätte mit Freude antreten wollen. Er ging in dem dichterischen Interesse ganz auf und fand außer diesem keinen rechten Zusammenhang mit dem Dasein. Zuletzt wurde nötig, daß er eine ihm gleichgültige Stellung annahm. Ich blieb auch mit ihm in brieflicher Verbindung. Daß er an seiner Dichtkunst selbst nicht eine wirkliche Befriedigung erleben konnte, wirkte zehrend an seiner Seele. Das Leben erfüllte sich
für ihn nicht mit Wertvollem. Ich mußte zu meinem Leid erfahren, wie nach und nach in seinen Briefen und auch bei Gesprächen immer mehr sich bei ihm die Ansicht verdichtete, daß er an einer unheilbaren Krankheit litte. Nichts reichte hin, um diesen unbegründeten Verdacht zu zerstreuen. So mußte ich denn eines Tages die Nachricht empfangen, daß der junge Mann, der mir recht nahe stand, seinem Leben selbst ein Ende gemacht habe.
Recht innige Freundschaft schloß ich damals mit einem jungen Manne, der aus dem deutschen Siebenbürgen nach der Wiener technischen Hochschule gekommen war. Auch ihn hatte ich in Schröers Übungsstunden zuerst getroffen. Da hat er einen Vortrag über den Pessimismus gehalten. Alles, was Schopenhauer für diese Lebensauffassung vorgebracht hat, lebte in diesem Vortrage auf. Dazu kam die eigene pessimistische Lebensstimmung des jungen Mannes. Ich erbot mich, einen Gegenvortrag zu halten. Ich «widerlegte» den Pessimismus mit wahren Donnerworten, nannte schon damals Schopenhauer ein «borniertes Genie» und ließ meine Ausführungen in dem Satze gipfeln, «wenn der Herr Vortragende mit seiner Darstellung über den Pessimismus recht hätte, dann wäre ich lieber der Holzpfosten, auf dem meine Füße stehen, als ein Mensch». Dieses Wort wurde lange spottend in meinem Bekanntenkreise über mich wiederholt. Aber es machte den jungen Pessimisten und mich zu innig verbundenen Freunden. Wir verlebten nun viele Zeit miteinander. Auch er fühlte sich als Dichter. Und ich saß oft viele Stunden lang bei ihm auf seinem Zimmer und hörte
gerne dem Vorlesen seiner Gedichte zu. Er brachte auch meinen damaligen geistigen Bestrebungen ein warmes Interesse entgegen, obwohl er dazu weniger durch die Dinge, mit denen ich mich befaßte, als durch seine persönliche Liebe zu mir angeregt wurde. Er knüpfte so manche schöne Jugendbekanntschaft und auch Jugendliebe an. Er brauchte das zu seinem Leben, das ein recht schweres war. Er hatte in Hermannstadt die Schule als armer Junge durchgemacht, und mußte da schon sein Leben von Privatstunden unterhalten. Er kam dann auf die geniale Idee, von Wien aus durch Korrespondenz die in Hermannstadt gewonnenen Privatschüler weiter zu unterrichten. Die Hochschul-Wissenschaften interessierten ihn wenig. Einmal wollte er doch ein Examen aus der Chemie ablegen. Er war in keiner Vorlesung und hatte auch kein einschlägiges Buch berührt. In der letzten Nacht vor der Prüfung ließ er sich von einem Freunde einen Auszug aus dem ganzen Stoff vorlesen. Er schlief zuletzt dabei ein. Dennoch ging er mit diesem Freunde zugleich zum Examen. Beide fielen wirklich «glänzend» durch.
Ein grenzenloses Vertrauen zu mir hatte dieser junge Mann. Er behandelte mich eine Zeitlang fast wie einen Beichtvater. Er breitete ein interessantes, oft traurig stimmendes, für alles Schöne begeistertes Leben vor meiner Seele aus. Er brachte mir soviel Freundschaft und Liebe entgegen, daß es wirklich schwer war, ihn nicht das eine oder andre Mal bitter zu enttäuschen. Das geschah namentlich dadurch, daß er oft glaubte, ich brächte ihm nicht genug Aufmerksamkeit entgegen. Aber das konnte eben doch nicht anders sein, da ich so
manchen Interessenkreis hatte, für den ich bei ihm auf ein sachliches Verständnis nicht stieß. Das alles trug aber zuletzt doch nur dazu bei, daß die Freundschaft immer Inniger wurde. Er verbrachte die Ferien jeden Sommer in Hermannstadt. Da sammelte er wieder Schüler, um sie dann das Jahr hindurch von Wien aus per Korrespondenz zu unterrichten. Ich erhielt dann immer lange Briefe von ihm. Er litt darunter, daß ich sie selten oder gar nicht beantwortete. Aber wenn er im Herbste wieder nach Wien kam, dann sprang er mir wie ein Knabe entgegen; und das gemeinsame Leben fing wieder an. Ihm verdankte ich damals, daß ich mit vielen Menschen verkehren konnte. Er liebte es, mich zu allen Leuten zu bringen, mit denen er Zusammenhang hatte. Und ich lechzte nach Geselligkeit. Der Freund brachte vieles in mein Leben, was mir Freude und Wärme gab.
Diese Freundschaft ist eine solche für das Leben geblieben, bis zu dem vor einigen Jahren erfolgten Tode des Freundes. Sie bewahrte sich durch manchen Lebenssturm hindurch, und ich werde noch vieles von ihr zu sagen haben.
Im rückschauenden Bewußtsein taucht vieles an Menschen- und Lebensbeziehungen auf, das in Liebe- und Dankesempfindungen heute noch ein volles Dasein in der Seele hat. Hier darf ich nicht alles im einzelnen schildern und muß manches unberührt lassen, das mir gerade im persönlichen Erleben nahe war und nahe geblieben ist.
Meine Jugendfreundschaften in der Zeit, von der ich hier spreche, hatten zum Fortgang meines Lebens ein eigentümliches Verhältnis. Sie zwangen mich zu einer
Art Doppelleben in der Seele. Das Ringen mit den Erkenntnisrätseln, das vor allem damals meine Seele erfüllte, fand bei meinen Freunden zwar stets ein starkes Interesse, aber wenig mittätigen Anteil. Ich blieb im Erleben dieser Rätsel ziemlich einsam. Dagegen lebte ich selbst alles voll mit, was im Dasein meiner Freunde auftauchte. So gingen zwei Lebensströmungen in mir nebeneinander: eine, die ich wie ein einsamer Wanderer verfolgte; und die andere, die ich in lebendiger Geselligkeit mit liebgewonnenen Menschen durchmachte. Aber von tiefgehender, dauernder Bedeutung für meine Entwickelung waren in vielen Fällen auch die Erlebnisse der zweiten Art.
Da muß ich besonders eines Freundes gedenken, der schon in Wiener-Neustadt mein Mitschüler war. Während dieser Zeit stand er mir aber ferne. Erst in Wien, wo er mich zuerst öfters besuchte und wo er später als Beamter lebte, trat er mir nahe. Er hatte aber doch, ohne eine äußere Beziehung, schon in Wiener-Neustadt eine Bedeutung für mein Leben gehabt. Ich war mit ihm einmal gemeinsam in einer Turnstunde. Er ließ, während er turnte und ich nichts zu tun hatte, ein Buch neben mir liegen. Es war Heines Buch über «Die romantische Schule» und «Die Geschichte der Philosophie in Deutschland». Ich tat einen Blick hinein. Das wurde zum Anlaß, daß ich das Buch selber las. Ich empfand viele Anregungen daraus, stand aber in einem intensiven Widerspruch zu der Art, wie Heine den mir nahestehenden Lebensinhalt behandelte. In der Anschauung einer Denkungsart und einer Gefühlsrichtung, die der in mir sich ausbildenden völlig entgegengesetzt war, lag eine starke
Anregung zur Selbstbesinnung auf die innere Lebensorientierung, die mir, nach meinen Seelenanlagen, notwendig war.
In Anlehnung an das Buch sprach ich dann mit dem Mitschüler. Dabei kam das innere Leben seiner Seele zum Vorschein, das dann später zur Begründung einer dauernden Freundschaft führte. Er war ein verschlossener Mensch, der sich nur Wenigen mitteilte. Die meisten hielten ihn für einen Sonderling. Den Wenigen gegenüber, denen er sich mitteilen wollte, wurde er namentlich in Briefen sehr gesprächig. Er nahm sich als einen durch innere Veranlagung zum Dichter berufenen Menschen. Er war der Ansicht, daß er einen großen Reichtum in seiner Seele trug. Er hatte dabei auch die Neigung, sich in Beziehungen zu andern, namentlich weiblichen Persönlichkeiten mehr hineinzuträumen, als diese Beziehungen äußerlich wirklich anzuknüpfen. Zuweilen war er einer solchen Anknüpfung nahe, konnte sie aber doch nicht zum wirklichen Erleben bringen. In Gesprächen mit mir lebte er dann seine Träume mit einer Innigkeit und Begeisterung durch, als wenn sie Wirklichkeiten wären. Dabei konnte nicht ausbleiben, daß er bittere Gefühle hatte, wenn die Träume immer wieder zerrannen.
Das ergab ein seelisches Leben bei ihm, das mit seinem Außendasein nicht das geringste zu tun hatte. Und dieses Leben war ihm wieder der Gegenstand quälender Selbstbetrachtungen, deren Spiegelbild in vielen Briefen an mich und in Gesprächen enthalten war. So schrieb er mir einmal eine lange Auseinandersetzung darüber, wie ihm das kleinste wie das größte Erlebnis innerlich
zum Symbol würde und wie er mit solchen Symbolen lebte.
Ich liebte diesen Freund, und in Liebe ging ich auf seine Träume ein, obgleich ich stets im Zusammensein mit ihm das Gefühl hatte: wir bewegen uns in den Wolken und haben keinen Boden. Das war für mich, der ich mich unablässig bemühte, gerade die festen Stützen des Lebens in der Erkenntnis zu suchen, ein eigenartiges Erleben. Ich mußte immer wieder aus der eigenen Wesenheit herausschlüpfen und wie in eine andere Haut hinüberspringen, wenn ich diesem Freunde gegenüberstand. Er lebte gerne mit mir; er stellte auch zuweilen weitausgreifende theoretische Betrachtungen über die «Verschiedenheit unserer Naturen» an. Er ahnte kaum, wie wenig unsere Gedanken zusammenklangen, weil die Freundesgesinnung über alle Gedanken hinwegführte.
Mit einem andern Wiener-Neustädter Mitschüler erging es mir ähnlich. Er gehörte dem nächst niedrigeren Jahrgang der Realschule an, und wir traten einander erst nahe, als er ein Jahr später als ich an die technische Hochschule nach Wien kam. Da aber waren wir viel zusammen. Auch er ging wenig auf das ein, was mich auf dem Erkenntnisgebiete innerlich bewegte. Er studierte Chemie. Die naturwissenschaftlichen Ansichten, denen er gegenüberstand, verhinderten ihn damals im Verkehre mit mir, sich anders denn als Zweifler an der Geistesanschauung zu geben, von der ich erfüllt war. Später im Leben habe ich an diesem Freunde erfahren, wie nahe er in seinem innersten Wesen meiner Seelenverfassung schon damals stand; aber er ließ dieses
innerste Wesen in jener Zeit gar nicht hervortreten. Und so wurden unsere lebhaften, langdauernden Debatten für mich zu einem «Kampfe gegen den Materialismus». Er setzte meinem Bekenntnis zum Geistgehalt der Welt stets alle aus der Naturwissenschaft vermeintlich sich ergebenden Widerlegungen gegenüber. Ich mußte damals schon alles, was ich an Einsichten hatte, auftreten lassen, um die aus der materialistischen Denkorientierung kommenden Einwürfe gegen eine geistgemäße Welterkenntnis aus dem Felde zu schlagen.
Einmal spielte sich die Debatte mit großer Lebhaftigkeit ab. Mein Freund fuhr jeden Tag nach dem Besuch der Vorlesungen von Wien nach seinem Wohnort, der in Wiener-Neustadt geblieben war. Ich begleitete ihn oft durch die Wiener Alleegasse zum Südbahnhofe. Wir waren nun an einem Tage in der Materialismusdebatte an einer Art Kulmination angekommen, als wir schon den Bahnhof betreten hatten, und der Zug bald abfahren mußte. Da faßte ich, was ich noch zu sagen hatte, in die folgenden Worte zusammen: «Also du behauptest, wenn du sagst: ich denke, so sei das nur der notwendige Effekt der Vorgänge in deinem Gehirnnervensystem. Diese Vorgänge seien allein Wirklichkeit. Und so sei es, wenn du sagst: ich sehe dies oder das, ich gehe usw. Aber sieh einmal: du sagst doch nicht: mein Gehirn denkt, mein Gehirn sieht das oder das, mein Gehirn geht. Du müßtest doch, wenn du wirklich zu der Einsicht gelangt wärest, was du theoretisch behauptest, sei wahr, deine Redewendung korrigieren. Wenn du dennoch vom «ich» sprichst, so lügst du eigentlich. Aber du kannst nicht anders, als deinem
gesunden Instinkte gegen die Einflüsterungen deiner Theorie folgen. Du erlebst einen andern Tatbestand als denjenigen, den deine Theorie verficht. Dein Bewußtsein straft deine Theorie Lügen.» Der Freund schüttelte den Kopf. Zu einer Einwendung hatte er nicht mehr Zeit. Ich ging allein zurück, und konnte nur nachdenken, daß der Einwand gegen den Materialismus in dieser groben Form nicht einer besonders exakten Philosophie entsprach. Aber mir kam es damals wirklich weniger darauf an, einen philosophisch einwandfreien Beweis fünf Minuten vor Zugsabgang zu liefern, als Ausdruck zu geben meiner inneren sicheren Erfahrung von der Wesenheit des menschlichen «Ich». Mir war dieses «Ich» innerlich überschaubares Erlebnis von einer in ihm selbst vorhandenen Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit erschien mir nicht weniger gewiß wie irgendeine vom Materialismus anerkannte. Aber in ihr ist gar nichts Materielles. Mir hat dieses Durchschauen der Wirklichkeit und Geistigkeit des «Ich» in den folgenden Jahren über alle Versuchungen des Materialismus hinweggeholfen. Ich wußte:
an dem «Ich» kann nicht gerüttelt werden. Und mir war klar, daß derjenige das «Ich» eben nicht kennt, der es als eine Erscheinungsform, ein Ergebnis anderer Vorgänge auffaßt. Daß ich dieses als innere, geistige Anschauung hatte, wollte ich dem Freunde gegenüber zum Ausdruck bringen. Wir bekämpften uns noch viel auf diesem Felde. Aber wir hatten in der allgemeinen Lebensansicht so viele ganz gleichgeartete Empfindungen, daß die Heftigkeit unserer theoretischen Kämpfe nie auch nur in die geringsten Mißverständnisse in dem persönlichen Verhältnis umschlug.
Ich kam in dieser Zeit tiefer in das studentische Leben in Wien hinein. Ich wurde Mitglied der «deutschen Lesehalle an der technischen Hochschule». In Versammlungen und kleineren Zusammenkünften wurden eingehend die politischen und Kulturerscheinungen der Zeit besprochen. Die Diskussionen ließen alle möglichen - und unmöglichen - Gesichtspunkte, die junge Leute haben konnten, zutage treten. Namentlich wenn Funktionäre gewählt werden sollten, platzten die Meinungen gar heftig aufeinander. Anregend und aufregend war vieles, was sich da unter der Jugend im Zusammenhang mit den Vorgängen im öffentlichen Leben Österreichs abspielte. Es war die Zeit, in der sich die nationalen Parteien in immer schärferer Ausprägung bildeten. Alles, was später in Österreich immer mehr und mehr zur Zerbröckelung des Reiches führte, was nach dem Weltkrieg in seinen Folgen auftrat, konnte damals in seinen Keimen erlebt werden.
Ich war zunächst zum Bibliothekar der «Lesehalle» gewählt worden. Als solcher machte ich alle möglichen Autoren ausfindig, die Bücher geschrieben hatten, von denen ich glaubte, daß sie für die Studentenbibliothek von Wert sein könnten. An diese Autoren schrieb ich «Pumpbriefe». Ich verfertigte oft in einer Woche wohl hundert solcher Briefe. Durch diese meine «Arbeit» wurde die Bibliothek rasch vergrößert. Aber die Sache hatte für mich einen Nebeneffekt. Ich hatte dadurch die Möglichkeit, in einem weiten Umfange die wissenschaftliche, künstlerische, kulturgeschichtliche, politische Literatur der Zeit kennen zu lernen. Ich war ein eifriger Leser der geschenkten Bücher.
Später wurde ich zum Vorsitzenden der «Lesehalle» gewählt. Das aber war für mich ein schwieriges Amt. Denn ich stand einer großen Anzahl der verschiedensten Parteistandpunkte gegenüber und sah in ihnen allen das relativ Berechtigte. Dennoch kamen die Angehörigen der verschiedenen Parteien zu mir. Jeder wollte mich überzeugen, daß nur seine Partei recht habe. Als ich gewählt worden war, stimmten alle Parteien für mich. Denn bis dahin hatten sie nur gehört, wie ich in den Versammlungen für das Berechtigte eingetreten war. Als ich ein halbes Jahr Vorsitzender war, stimmten alle gegen mich. Denn bis dahin hatten sie gefunden, daß ich keiner Partei so stark recht geben konnte, als sie es wollte.
Mein Geselligkeitstrieb fand in der «Lesehalle» reichliche Befriedigung. Und es wurde auch für weitere Kreise des öffentlichen Lebens das Interesse geweckt durch die Spiegelungen seiner Vorgänge im studentischen Vereins-leben. Ich war damals bei mancher interessanten Parlamentsdebatte auf der Galerie des österreichischen Abgeordneten- und Herrenhauses.
Mich interessierten außer den oft in das Leben tief einschneidenden Maßnahmen der Parlamente ganz besonders die Persönlichkeiten der Abgeordneten. Da stand an seiner Bankecke jedes Jahr als ein Hauptbudgetredner der feinsinnige Philosoph Bartholomäus Carneri. Seine Worte hagelten schneidende Anklagen gegen das Ministerium Taaffe, sie bildeten eine Verteidigung des Deutschtums in Österreich. Da stand Ernst von Plener, der trockene Redner, die unbestrittene Autorität in Finanzfragen. Man fröstelte, wenn er mit rechnerischer Kälte dem Finanzminister Dunajewski die Ausgaben
kritisierte. Da donnerte gegen die Nationalitätenpolitik der Ruthene Tomasczuck. Man hatte das Gefühl, daß es ihm auf die Erfindung eines für den Augenblick besonders gut geprägten Wortes ankam, um für die Minister Antipathien zu nähren. Da redete bäuerlich-schlau, immer gescheit der Klerikale Lienbacher. Sein etwas vorgebeugter Kopf ließ, was er sagte, als den Ausfluß abgeklärter Anschauungen erscheinen. Da redete in seiner Art schneidend der Jungtscheche Gregr. Man hatte bei ihm das Gefühl, einen halben Demagogen vor sich zu haben. Da stand Rieger von den Alttschechen, ganz im tief charakteristischen Sinn das verkörperte Tschechentum, wie es seit langer Zeit sich herangebildet und in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zum Bewußtsein seiner selbst gekommen war. Ein in sich selten abgeschlossener, seelisch vollkräftiger, von sicherem Willen getragener Mann. Da redete auf der rechten Seite, inmitten der Polenbänke, Otto Hausner. Oft nur Lesefrüchte geistreich vortragend, oft spitz-treffend nach allen Seiten des Hauses auch sachlich berechtigte Pfeile mit einem gewissen Wohlbehagen sendend. Ein zwar selbstbefriedigtes, aber gescheites Auge blinzelte hinter einem Monokel, das andere schien zu dem Blinzeln stets ein befriedigtes «Ja» zu sagen. Ein Redner, der aber auch zuweilen prophetische Worte für Österreichs Zukunft schon damals fand. Man sollte heute nachlesen, was er damals gesagt hat; man würde über seinen Scharfblick staunen. Man lachte damals sogar über vieles, was nach Jahrzehnten bitterer Ernst geworden ist.
V.
Zu Gedanken über das öffentliche Leben Österreichs, die in irgend einer Art tiefer in meine Seele eingegriffen hätten, konnte ich damals nicht kommen. Es blieb beim Beobachten der außerordentlich komplizierten Verhältnisse. Aussprachen, die mir tieferes Interesse abgewannen, konnte ich nur mit Karl Julius Schröer haben. Ich durfte ihn gerade in dieser Zeit oft besuchen. Sein eigenes Schicksal hing eng zusammen mit dem der Deutschen Österreich-Ungarns. Er war der Sohn Tobias Gottfried Schröers, der in Preßburg ein deutsches Lyzeum leitete und Dramen, sowie geschichtliche und ästhetische Bücher schrieb. Die letzteren sind mit dem Namen Chr. Geser erschienen und waren beliebte Unterrichtsbücher. Die Dichtungen Tobias Gottfried Schröers sind, trotzdem sie zweifellos bedeutend sind und in engeren Kreisen große Anerkennung fanden, nicht bekannt geworden. Die Gesinnung, die sie atmeten, stand der herrschenden politischen Strömung in Ungarn entgegen. Sie mußten ohne Verfassernamen zum Teil im deutschen Auslande erscheinen. Wäre die geistige Richtung des Verfassers in Ungarn bekannt geworden, so hätte dieser nicht nur der Entlassung aus dem Amte, sondern sogar einer harten Bestrafung gewärtig sein müssen.
Karl Julius Schröer erlebte so den Druck auf das Deutschtum schon in seiner Jugend im eigenen Hause. Unter diesem Druck entwickelte er seine intime Hingabe an deutsches Wesen und deutsche Literatur, sowie eine große Liebe zu allem, was an und um Goethe war. Die
«Geschichte der deutschen Dichtung» von Gervinus war von tiefgehendem Einfluß auf ihn.
Er ging in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts nach Deutschland, um an den Universitäten von Leipzig, Halle und Berlin deutsche Sprach- und Literaturstudien zu treiben. Nach seiner Rückkehr war er zunächst am Lyzeum seines Vaters als Lehrer der deutschen Literatur und Leiter eines Seminars tätig. Er lernte nun die volkstümlichen Weihnachtsspiele, die alljährlich von den deutschen Kolonisten in der Umgebung von Preßburg gespielt wurden, kennen. Da war deutsches Volkstum in für ihn tief sympathischer Art vor seiner Seele. Die vor Jahrhunderten aus westlicheren Gegenden in Ungarn eingewanderten Deutschen hatten sich diese Spiele aus der alten Heimat mitgebracht und spielten sie so weiter, wie sie sie um das Weihnachtsfest in alten Zeiten in Gegenden, die wohl in der Nähe des Rheines gelegen waren, aufgeführt hatten. Die Paradieseserzählung, die Geburt Christi, die Erscheinung der drei Könige lebten auf volkstümliche Art in diesen Spielen. Schröer veröffentlichte sie dann nach dem Anhören oder nach der Einsichtnahme in die alten Manuskripte, die er bei den Bauern zu sehen bekam, unter dem Titel «Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungarn».
Das liebevolle Einleben in deutsches Volkstum nahm Schröers Seele immer mehr in Anspruch. Er machte Reisen, um die deutschen Mundarten in den verschiedensten Gebieten Österreichs zu studieren. Überall, wo deutsches Volkstum in den slawischen, magyarischen, italienischen Landesteilen der Donaumonarchie eingestreut war, wollte er dessen Eigenart kennen lernen. So entstanden seine
Wörterbücher und Grammatiken der Zipser Mundart, die im Süden der Karpaten heimisch war, der Gortscheer Mundart, die bei einem kleinen deutschen Volksteil in Krain lebte, der Sprache der Heanzen, die im westlichen Ungarn gesprochen wurde.
Für Schröer waren diese Studien niemals eine bloß wissenschaftliche Aufgabe. Er lebte mit ganzer Seele in den Offenbarungen des Volkstums und wollte dessen Wesen durch Wort und Schrift zum Bewußtsein derjenigen Menschen bringen, die aus ihm durch das Leben herausgerissen sind. Er wurde dann Professor in Budapest. Da konnte er sich der damals herrschenden Strömung gegenüber nicht wohl fühlen. So übersiedelte er denn nach Wien, wo ihm zunächst die Leitung der evangelischen Schulen übertragen und wo er später Professor für deutsche Sprache und Literatur wurde. Als er schon diese Stellung innehatte, durfte ich ihn kennen lernen und ihm näher treten. In der Zeit, da dies geschah, war sein ganzes Sinnen und Leben Goethe zugewendet. Er arbeitete an der Ausgabe und Einleitung des zweiten Teiles des «Faust» und hatte den ersten Teil bereits erscheinen lassen.
Wenn ich zu Besuchen in die kleine Bibliothek Schröers kam, die zugleich sein Arbeitszimmer war, fühlte ich mich in einer geistigen Atmosphäre, die meinem Seelenleben in starkem Maße wohltat. Ich wußte schon damals, wie Schröer von den Bekennern der herrschend gewordenen literarhistorischen Methoden wegen seiner Schriften, namentlich wegen seiner «Geschichte der deutschen Dichtung im neunzehnten Jahrhundert» angefeindet wurde. Er schrieb nicht so wie etwa die Mit-
glieder der Scherer-Schule, die wie ein Naturforscher die literarischen Erscheinungen behandelten. Er trug gewisse Empfindungen und Ideen über die literarischen Erscheinungen in sich und sprach diese rein menschlich aus, ohne viel das Auge im Zeitpunkt des Schreibens auf die «Quellen» zu lenken. Man hat sogar gesagt, er habe seine Darstellung «aus dem Handgelenk hingeschrieben».
Mich interessierte das wenig. Ich erwarmte geistig, wenn ich bei ihm war. Ich durfte stundenlang an seiner Seite sitzen. Aus seinem begeisterten Herzen lebten in seiner mündlichen Darstellung die Weihnachtsspiele, der Geist der deutschen Mundarten, der Verlauf des literarischen Lebens auf. Das Verhältnis der Mundart zu der Bildungssprache wurde mir praktisch anschaulich. Eine wahre Freude hatte ich, als er mir, was er auch schon in Vorlesungen getan hatte, von dem Dichter in niederösterreichischer Mundart, Joseph Misson, sprach, der die herrliche Dichtung « Da Naaz, a niederösterreichischer Baurnbua, geht ind Fremd» geschrieben hat. Schröer gab mir dann immer Bücher aus seiner Bibliothek mit, in denen ich weiterverfolgen konnte, was Inhalt des Gespräches war. Ich hatte wirklich immer, wenn ich so allein mit Schröer saß, das Gefühl, daß noch ein Dritter anwesend war: Goethes Geist. Denn Schröer lebte so stark in Goethes Wesen und Werken, daß er bei jeder Empfindung oder Idee, die in seiner Seele auftraten, sich gefühlsmäßig die Frage vorlegte: Würde Goethe so empfunden oder gedacht haben?
Ich hörte geistig mit der allergrößten Sympathie alles, was von Schröer kam. Dennoch konnte ich nicht anders,
als auch ihm gegenüber, das, wonach ich geistig intim strebte, in der eigenen Seele ganz unabhängig aufbauen. Schröer war Idealist; und die Ideenwelt als solche war für ihn das, was in Natur- und Menschenschöpfung als treibende Kraft wirkte. Mir war die Idee der Schatten einer volllebendigen Geisteswelt. Ich fand es damals sogar schwierig, für mich selbst den Unterschied zwischen Schröers und meiner Denkungsart in Worte zu bringen. Er redete von Ideen als von den treibenden Mächten in der Geschichte. Er fühlte Leben in dem Dasein der Ideen. Für mich war das Leben des Geistes hinter den Ideen, und diese nur dessen Erscheinung in der Menschenseele. Ich konnte damals kein anderes Wort für meine Denkungsart finden als «objektiver Idealismus». Ich wollte damit sagen, daß für mich das Wesentliche an der Idee nicht ist, daß sie im menschlichen Subjekt erscheint, sondern daß sie wie etwa die Farbe am Sinneswesen an dem geistigen Objekte erscheint, und daß die menschliche Seele - das Subjekt - sie da wahrnimmt, wie das Auge die Farbe an einem Lebewesen.
Meiner Anschauung kam aber Schröer in hohem Grade mit seiner Ausdrucksform entgegen, wenn wir das besprachen, was sich als «Volksseele» offenbart. Er sprach von dieser als von einem wirklichen geistigen Wesen, das sich in der Gesamtheit der einzelnen Menschen, die zu einem Volke gehören, darlebt Da nahmen seine Worte einen Charakter an, der nicht bloß auf die Bezeichnung einer abstrakt gehaltenen Idee ging. Und so betrachteten wir beide das Gefüge des alten Österreich und die in demselben wirksamen Individualitäten der Volksseelen. - Von dieser Seite war es mir möglich, Gedanken über die
öffentlichen Zustände zu fassen, die tiefer in mein Seelenleben eingriffen.
So hing ganz stark in der damaligen Zeit mein Erleben mit meinem Verhältnis zu Karl Julius Schröer zusammen. Was ihm aber ferner lag, und womit ich vor allem nach einer innerlichen Auseinandersetzung strebte, das waren die Naturwissenschaften. Ich wollte auch meinen «objektiven Idealismus» im Einklange mit der Naturerkenntnis wissen.
Es war in der Zeit meines lebhaftesten Verkehrs mit Schröer, als mir die Frage nach dem Verhältnis von geistiger und natürlicher Welt in erneuerter Art vor die Seele trat. Es geschah dies zunächst noch ganz unabhängig von Goethes naturwissenschaftlicher Denkungsart. Denn auch Schröer konnte mir nichts Entscheidendes über dieses Gebiet Goethe'schen Schaffens sagen. Er hatte seine Freude darüber, wenn er bei diesem oder jenem Naturforscher eine wohlwollende Anerkennung von Goethes Betrachtung des Pflanzen- und Tierwesens fand. Für die Farbenlehre Goethes traf er aber überall bei naturwissenschaftlich Gebildeten entschiedene Ablehnung. So entwickelte er nach dieser Richtung keine besondere Meinung.
Mein Verhältnis zur Naturwissenschaft wurde in die ser Zeit meines Lebens, trotzdem ich im Umgange mit Schröer an Goethes Geistesleben nahe herankam, von dieser Seite her nicht beeinflußt. Es bildete sich vielmehr an den Schwierigkeiten aus, die ich hatte, wenn ich die Tatsachen der Optik im Sinne der Physiker nachdenken sollte.
Ich fand, daß man das Licht und den Schall in der naturwissenschaftlichen Betrachtung in einer Analogie
dachte, die unstatthaft ist. Man sprach von «Schall im Allgemeinen» und «Licht im Allgemeinen». Die Analogie lag im Folgenden: man sieht die einzelnen Töne und Klänge als besonders modifizierte Luftschwingungen an, und das Objektive des Schalles, außer dem menschlichen Erlebnis der Schallempfindung, als einen Schwingungszustand der Luft. Ähnlich dachte man für das Licht. Man definierte, was außer dem Menschen sich abspielt, wenn er eine durch das Licht bewirkte Erscheinung wahrnimmt, als Schwingung im Äther. Die Farben sind dann besonders gestaltete Ätherschwingungen. Mir wurde damals diese Analogie zu einem wahren Peiniger meines Seelenlebens. Denn ich vermeinte, völlig im klaren darüber zu sein, daß der Begriff «Schall» nur eine abstrakte Zusammenfassung der einzelnen Vorkommnisse in der tönenden Welt ist, während «Licht» für sich ein Konkretes gegenüber den Erscheinungen in der beleuchteten Welt darstellt. - «Schall» war für mich ein zusammen-gefaßter abstrakter Begriff, «Licht» eine konkrete Wirklichkeit. Ich sagte mir, das Licht wird gar nicht sinnlich wahrgenommen; es werden «Farben» wahrgenommen durch Licht, das sich in der Farbenwahrnehmung überall offenbart, aber nicht selbst sinnlich wahrgenommen wird. «Weisses» Licht ist nicht Licht, sondern schon eine Farbe.
So wurde mir das Licht eine wirkliche Wesenheit in der Sinneswelt, die aber selbst außersinnlich ist. Es trat nun der Gegensatz des Nominalismus und Realismus vor meiner Seele auf, wie er sich innerhalb der Scholastik ausgebildet hat. Man behauptete bei den Realisten, die Begriffe seien Wesenhaftes, das in den Dingen lebt und nur von der menschlichen Erkenntnis aus ihnen heraus-
geholt wird. Die Nominalisten faßten dagegen die Begriffe nur als vom Menschen geformte Namen auf, die Mannigfaltiges in den Dingen zusammenfassen, in diesen selbst aber kein Dasein haben. Ich empfand nun, man müsse die Schall-Erlebnisse auf nominalistische und die Erlebnisse, die durch das Licht da sind, auf realistische Art ansehen.
Ich trat mit dieser Orientierung an die Optik der Physiker heran. Ich mußte in dieser vieles ablehnen. Da gelangte ich zu Anschauungen, die mir den Weg zu Goethes Farbenlehre bahnten. Von dieser Seite her öffnete ich mir das Tor zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. Ich brachte zunächst kleine Abhandlungen, die ich aus meinen naturwissenschaftlichen Anschauungen heraus schrieb, zu Schröer. Er konnte damit nicht viel machen. Denn sie waren noch nicht aus Goethes Anschauungsart heraus gearbeitet, sondern ich hatte am Schlusse nur die kurze Bemerkung angebracht: wenn man dazu kommen werde, über die Natur so zu denken, wie ich es dargestellt habe, dann erst werde Goethes Naturforschung in der Wissenschaft Gerechtigkeit widerfahren. Schröer hatte innige Freude, wenn ich dergleichen aussprach; aber darüber hinaus kam es zunächst nicht. Die Situation, in der ich mich befand, wird wohl durch folgenden Vorfall charakterisiert. Schröer erzählte mir eines Tages, er habe mit einem Kollegen gesprochen, der Physiker sei. Ja, sagte dieser, Goethe habe sich gegen Newton aufgelehnt, und Newton war doch «solch' ein Genie»; darauf habe er, Schröer, erwidert: aber Goethe sei doch «auch ein Genie» gewesen. So fühlte ich mich doch wieder mit einer Rätselfrage, mit der ich rang, ganz allein.
In den Anschauungen, die ich über die physikalische Optik gewann, schien sich mir die Brücke zu bauen von den Einsichten in die geistige Welt zu denen, die aus der naturwissenschaftlichen Forschung kommen. Ich empfand damals die Notwendigkeit, durch eigenes Gestalten gewisser optischer Experimente die Gedanken, die ich über das Wesen des Lichtes und der Farben ausgebildet hatte, an der sinnlichen Erfahrung zu prüfen. Es war für mich nicht leicht, die Dinge zu kaufen, die für solche Experimente notwendig waren. Denn die durch Privatunterricht erworbenen Mittel waren schmal genug. Was mir nur irgend möglich war, tat ich, um für die Lichtlehre zu Experimentanordnungen zu kommen, die wirklich zu einer vorurteilslosen Einsicht in die Tatsachen der Natur auf diesem Gebiete führen konnten.
Mit den gebräuchlichen Versuchsanordnungen der Physiker war ich durch die Arbeiten in dem Reitlingerschen physikalischen Laboratorium bekannt. Die mathematische Behandlung der Optik war mir geläufig, denn ich hatte gerade über dieses Gebiet eingehende Studien gemacht. - Trotz aller Einwände, die von seiten der Physiker gegen die Goethe'sche Farbenlehre gemacht werden, wurde ich durch meine eigenen Experimente immer mehr von der gebräuchlichen physikalischen Ansicht zu Goethe hin getrieben. Ich wurde gewahr, wie alles derartige Experimentieren nur ein Herstellen von Tatsachen «am Lichte» - um einen Goethe'schen Ausdruck zu gebrauchen - sei, nicht ein Experimentieren «mit dem Lichte» selbst. Ich sagte mir: die Farbe wird nicht nach Newton'scher Denkungsweise aus dem Lichte hervorgeholt; sie kommt zur Erscheinung, wenn dem Lichte
Hindernisse seiner freien Entfaltung entgegengebracht werden. Mir schien, daß dies aus den Experimenten unmittelbar abzulesen sei.
Damit aber war für mich das Licht aus der Reihe der eigentlichen physikalischen Wesenhaftigkeiten ausgeschieden. Es stellte sich als eine Zwischenstufe dar zwischen den für die Sinne faßbaren Wesenhaftigkeiten und den im Geiste anschaubaren.
Ich war abgeneigt, über diese Dinge mich bloß in philosophischen Denkvorgängen zu bewegen. Aber ich hielt sehr viel darauf, die Tatsachen der Natur richtig zu lesen. Und da wurde mir immer klarer, wie das Licht selbst in den Bereich des Sinnlich-Anschaubaren nicht eintritt, sondern jenseits desselben bleibt, während die Farben erscheinen, wenn das Sinnlich-Anschaubare in den Bereich des Lichtes gebracht wird.
Ich fühlte mich nun genötigt, neuerdings von den verschiedensten Seiten her an die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse heranzudringen. Ich wurde wieder zum Studium der Anatomie und Physiologie geführt. Ich betrachtete die Glieder des menschlichen, des tierischen und pflanzlichen Organismus in ihren Gestaltungen. Ich kam dadurch in meiner Art auf die Goethe'sche Metamorphosenlehre. Ich wurde immer mehr gewahr, wie das für die Sinne erfaßbare Naturbild zu dem hindrängt, was mir auf geistige Art anschaubar war.
Blickte ich in dieser geistigen Art auf die seelische Regsamkeit des Menschen, auf Denken, Fühlen und Wollen, so gestaltete sich mir der «geistige Mensch» bis zur bildhaften Anschaulichkeit. Ich konnte nicht stehen bleiben bei den Abstraktionen, an die man gewöhnlich denkt,
wenn man von Denken, Fühlen und Wollen spricht. Ich sah in diesen inneren Lebensoffenbarungen schaffende Kräfte, die den «Menschen als Geist» im Geiste vor mich hinstellten. Blickte ich dann auf die sinnliche Erscheinung des Menschen, so ergänzte sich mir diese im betrachtenden Blicke durch die Geistgestalt, die im Sinnlich-Anschaubaren waltet.
Ich kam auf die sinnlich-übersinnliche Form, von der Goethe spricht, und die sich sowohl für eine wahrhaft naturgemäße wie auch für eine geistgemäße Anschauung zwischen das Sinnlich-Erfaßbare und das GeistigAnschaubare einschiebt.
Anatomie und Physiologie drängten Schritt für Schritt zu dieser sinnlich-übersinnlichen Form. Und in diesem Drängen fiel mein Blick zuerst in einer noch ganz unvollkommenen Art auf die Dreigliederung der menschlichen Wesenheit, von der ich erst, nachdem ich im stillen dreißig Jahre lang die Studien über sie getrieben hatte, öffentlich in meinem Buche «Von Seelenrätseln» zu sprechen begann. Zunächst wurde mir klar, daß in dem Teile der menschlichen Organisation, in der die Bildung am meisten nach dem Nerven- und Sinneshaften hin orientiert ist, die sinnlich-übersinnliche Form auch am stärksten in dem Sinnlich-Anschaubaren sich ausprägt. Die Kopforganisation erschien mir als diejenige, an der das Sinnlich-Übersinnliche auch am stärksten in der sinnlichen Form zur Anschauung kommt. Die Gliedmaßen-Organisation dagegen mußte ich als diejenige ansehen, in der sich das Sinnlich-Übersinnliche am meisten verbirgt, so daß in ihr die in der außermenschlichen Natur wirksamen Kräfte sich in die menschliche Bildung
hinein fortsetzen. Zwischen diesen Polen der menschlichen Organisation schien mir alles das zu stehen, was auf rhythmische Art sich darlebt, die Atmungs- und Zirkulationsorganisation usw.
Ich fand damals niemanden, zu dem ich von diesen Anschauungen hätte sprechen können. Deutete ich da oder dort etwas von ihnen an, so sah man sie als das Ergebnis einer philosophischen Idee an, während ich doch gewiß war, daß sie sich mir aus einer vorurteilsfreien anatomischen und physiologischen Erfahrungserkenntnis heraus geoffenbart hatten.
In der Stimmung, die auf meiner Seele aus solcher Vereinsamung mit Anschauungen lastete, fand ich nur innere Erlösung, indem ich immer wieder das Gespräch las, das Goethe mit Schiller geführt hatte, als die beiden aus einer Versammlung der naturforschenden Gesellschaft in Jena zusammen weggingen. Sie waren beide darin einig, daß man die Natur nicht in einer so zerstükkelten Art betrachten dürfe, wie das von dem Botaniker Batsch in dem Vortrage, den sie gehört hatten, geschehen war. Und Goethe zeichnete vor Schillers Augen mit ein paar Strichen seine «Urpflanze» hin. Sie stellte durch eine sinnlich-übersinnliche Form die Pflanze als ein Ganzes dar, aus dem Blatt, Blüte usw. sich, das Ganze im einzelnen nachbildend, herausgestalten. Schiller konnte wegen seines damals noch nicht überwundenen Kant'schen Standpunktes in diesem «Ganzen» nur eine «Idee» sehen, die sich die menschliche Vernunft durch die Betrachtung der Einzelheiten bildet. Goethe wollte das nicht gelten lassen. Er «sah» geistig das Ganze, wie er sinnlich die Einzelheit sah. Und er gab keinen prin-
zipiellen Unterschied zu zwischen der geistigen und sinnlichen Anschauung, sondern nur einen Übergang von der einen zur andern. Ihm war klar, daß beide den Anspruch erheben, in der erfahrungsgemäßen Wirklichkeit zu stehen. Aber Schiller kam nicht los davon, zu behaupten: die Urpflanze sei keine Erfahrung, sondern eine Idee. Da erwiderte denn Goethe aus seiner Denkungsart heraus, dann sehe er eben seine Ideen mit Augen vor sich.
Es war für mich die Beruhigung eines langen Ringens in der Seele, was mir aus dem Verständnis dieser Goethe-Worte entgegenkam, zu denen ich durchgedrungen zu sein glaubte. Goethes Naturanschauung stellte sich mir als eine geistgemäße vor die Seele.
Ich mußte nun, durch eine innere Notwendigkeit getrieben, Goethes naturwissenschaftliche Schriften in allen Einzelheiten durcharbeiten. Ich dachte zunächst nicht daran, eine Erklärung dieser Schriften zu versuchen, wie ich sie dann bald in den Einleitungen zu denselben in «Kürschners Deutscher Nationalliteratur» veröffentlicht habe. Ich dachte vielmehr daran, irgendein Gebiet der Naturwissenschaft selbständig so darzustellen, wie mir diese Wissenschaft nun als «geistgemäß» vorschwebte.
Um an dergleichen wirklich zu kommen, war mein äußeres Leben in der damaligen Zeit nicht gestaltet. Ich mußte Privatunterricht auf den verschiedensten Gebieten geben. Die «pädagogischen» Situationen, in die ich mich hineinzufinden hatte, waren mannigfaltig genug. So tauchte einmal ein preußischer Offizier in Wien auf, der aus irgend einem Grunde den deutschen Heeresdienst hatte verlassen müssen. Er wollte sich zum Eintritt in das österreichische Heer als Genieoffizier vorbereiten. Durch
eine besondere Schicksalsfügung wurde ich sein Lehrer in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern. Ich hatte an diesem «Unterrichten» die tiefste Befriedigung. Denn mein «Schüler» war ein ganz außerordentlich liebenswürdiger Mann, der nach menschlicher Unterhaltung mit mir drängte, wenn wir die mathematischen und mechanischen Entwickelungen hinter uns hatten, die er für seine Vorbereitung brauchte. - Auch in andern Fällen, so bei absolvierten Studenten, die sich zum Doktorexamen vorbereiteten, mußte ich namentlich die mathematischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse vermitteln.
Ich hatte durch diese Nötigung, das Naturwissenschaftliche der damaligen Zeit immer wieder durchzuarbeiten, genug Gelegenheit, mich in die Zeitanschauungen auf diesem Gebiete einzuleben. Ich konnte ja im Unterrichten nur diese Zeitanschauungen vermitteln; woran mir am meisten in bezug auf Natur-Erkenntnis gelegen war, mußte ich still in mir verschlossen tragen.
Meine Betätigung als Privatlehrer, die mir in jener Zeit die einzige Lebensmöglichkeit eröffnete, bewahrte mich vor Einseitigkeit Ich mußte vieles aus dem Grunde selbst lernen, um es unterrichten zu können. So lebte ich mich in die «Geheimnisse» der Buchhaltung ein, weil ich Gelegenheit fand, gerade auf diesem Gebiete Unterricht zu erteilen.
Auch auf dem Gebiete des pädagogischen Denkens kam mir von Schröer die fruchtbarste Anregung. Er hatte als Direktor der evangelischen Schulen in Wien jahrelang gewirkt und seine Erfahrungen in dem liebenswür-
digen Büchlein «Unterrichtsfragen» ausgesprochen. Was ich darinnen las, konnte dann mit ihm besprochen werden. Er sprach in bezug auf Erziehen und Unterrichten oft gegen das bloße Beibringen von Kenntnissen, und für die Entwickelung der ganzen, vollen Menschenwesenheit.
VI.
Auf pädagogischem Gebiete brachte mir das Schicksal eine besondere Aufgabe. Ich wurde als Erzieher in eine Familie empfohlen, in der vier Knaben waren. Dreien hatte ich nur erst den vorbereitenden Volksschul- und dann den Nachhilfeunterricht für die Mittelschule zu geben. Der vierte, der ungefähr zehn Jahre alt war, wurde mir zunächst zur vollständigen Erziehung übergeben. Er war das Sorgenkind der Eltern, besonders der Mutter. Er hatte, als ich ins Haus kam, sich kaum die allerersten Elemente des Lesens, Schreibens und Rechnens erworben. Er galt als abnormal in seiner körperlichen und seelischen Entwickelung in einem so hohen Grade, daß man in der Familie an seiner Bildungsfähigkeit zweifelte. Sein Denken war langsam und träge. Selbst geringe geistige Anstrengung bewirkte Kopfschmerz, Herabstimmung der Lebenstätigkeit, Blaßwerden, besorgniserregendes seelisches Verhalten.
Ich bildete mir, nachdem ich das Kind kennen gelernt hatte, das Urteil, daß eine diesem körperlichen und seelischen Organismus entsprechende Erziehung die schlummernden Fähigkeiten zum Erwachen bringen müsse; und ich machte den Eltern den Vorschlag, mir die Erziehung zu überlassen. Die Mutter des Knaben brachte diesem Vorschlage Vertrauen entgegen, und dadurch konnte ich mir diese besondere pädagogische Aufgabe stellen.
Ich mußte den Zugang zu einer Seele finden, die sich zunächst wie in einem schlafähnlichen Zustande befand und die allmählich dazu zu bringen war, die Herrschaft über die Körperäußerungen zu gewinnen. Man hatte
gewissermaßen die Seele erst in den Körper einzuschalten. Ich war von dem Glauben durchdrungen, daß der Knabe zwar verborgene, aber sogar große geistige Fähigkeiten habe. Das gestaltete mir meine Aufgabe zu einer tief befriedigenden. Ich konnte das Kind bald zu einer liebevollen Anhänglichkeit an mich bringen. Das bewirkte, daß der bloße Verkehr mit demselben die schlummernden Seelenfähigkeiten zum Erwachen brachte. Für das Unterrichten mußte ich besondere Methoden ersinnen. Jede Viertelstunde, die über ein gewisses dem Unterricht zugeteiltes Zeitmaß hinausging, bewirkte eine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes. Zu manchen Unterrichtsfächern konnte der Knabe nur sehr schwer ein Verhältnis finden.
Diese Erziehungsaufgabe wurde für mich eine reiche Quelle des Lernens. Es eröffnete sich mir durch die Lehrpraxis, die ich anzuwenden hatte, ein Einblick in den Zusammenhang zwischen Geistig-Seelischem und Körperlichem im Menschen. Da machte ich mein eigentliches Studium in Physiologie und Psychologie durch. Ich wurde gewahr, wie Erziehung und Unterricht zu einer Kunst werden müssen, die in wirklicher Menschen-Erkenntnis ihre Grundlage hat. Ein ökonomisches Prinzip hatte ich sorgfältig durchzuführen. Ich mußte mich oft für eine halbe Unterrichtsstunde zwei Stunden lang vorbereiten, um den Unterrichtsstoff so zu gestalten, daß ich dann in der geringsten Zeit und mit möglichst wenig Anspannung der geistigen und körperlichen Kräfte ein Höchstmaß der Leistungsfähigkeit des Knaben erreichen konnte. Die Reihenfolge der Unterrichtsfächer mußte sorgfältig erwogen, die ganze Tageseinteilung sach-
gemäß bestimmt werden. Ich hatte die Befriedigung, daß der Knabe im Verlaufe von zwei Jahren den Volksschulunterricht nachgeholt hatte und die Reifeprüfung in das Gymnasium bestehen konnte. Auch seine Gesundheitsverhältnisse hatten sich wesentlich gebessert. Die vorhandene Hydrocephalie war in starker Rückbildung begriffen. Ich konnte den Eltern den Vorschlag machen, den Knaben in die öffentliche Schule zu schicken. Es erschien mir nötig, daß er seine Lebensentwickelung im Verein mit andern Knaben finde. Ich blieb als Erzieher in der Familie für mehrere Jahre und widrnete mich besonders diesem Knaben, der ganz darauf angewiesen war, seinen Weg durch die Schule so zu nehmen, daß seine häusliche Betätigung in dem Geiste fottgeführt wurde, in dem sie begonnen war. Ich hatte da Veranlassung, in der schon früher erwähnten Art meine griechischen und lateinischen Kenntnisse fortzubilden, denn ich hatte für den Gymnasialunterricht dieses und noch eines andern Knaben in der Familie die Nachhilfestunden zu besorgen.
Ich muß dem Schicksal dafür dankbar sein, daß es mich in ein solches Lebensverhältnis gebracht hat. Denn ich erwarb mir dadurch auf lebendige Art eine Erkenntnis der Menschenwesenheit, von der ich glaube, daß sie so lebendig auf einem andern Wege von mir nicht hätte erworben werden können. Auch war ich in die Familie in einer ungewöhnlich liebevollen Art aufgenommen; es bildete sich eine schöne Lebensgemeinschaft mit derselben aus. Der Vater des Knaben war als Agent für indische und amerikanische Baumwolle tätig. Ich konnte einen Einblick gewinnen in den Gang des Geschäftes und in vieles, das damit zusammenhängt. Auch dadurch

lernte ich vieles. Ich sah in die Führung eines außerordentlich interessanten Importgeschäftszweiges hinein, konnte den Verkehr unter Geschäftsfreunden, die Verkettung verschiedener kommerzieller und industrieller Betätigungen beobachten.
Mein Pflegling konnte durch das Gymnasium durchgeführt werden; ich blieb an seiner Seite bis zur Unter-Prima. Da war er so weit, daß er meiner nicht mehr bedurfte. Er ging nach absolviertem Gymnasium an die medizinische Fakultät, wurde Arzt und ist als solcher ein Opfer des Weltkrieges geworden. Die Mutter, die mir durch meine Tätigkeit für den Sohn zur treuen Freundin geworden war, und die mit innigster Liebe an diesem Sorgenkinde hing, ist ihm bald nachgestorben. Der Vater hat schon früher die Erde verlassen.
Ein gut Teil meines Jugendlebens ist mit der Aufgabe verknüpft, die mir so erwachsen war. Ich ging durch mehrere Jahre mit der Familie der von mir zu erziehenden Kinder jeden Sommer an den Attersee im Salzkammergute und lernte da die herrliche Alpennatur Oberösterreichs kennen. Allmählich konnte ich die anfangs auch noch während dieser Erziehertätigkeit fortgesetzten Privatstunden bei andern abstreifen; und so blieb mir Zeit für das Fortführen meiner Studien.
Ich hatte in meinem Leben, bevor ich in diese Familie eintrat, wenig Gelegenheit, an kindlichen Spielen teilzunehmen. Und so kam es, daß meine erst in meine zwanziger Jahre fiel. Ich mußte da auch lernen, wie man spielt. Denn ich mußte das Spielen leiten. Und ich tat es mit großer Befriedigung. Ich glaube sogar, ich habe im Leben nicht weniger gespielt als andere
Menschen. Nur habe ich eben dasjenige, was man sonst vor dem zehnten Lebensjahre nach dieser Richtung vollbringt, vom drei- bis achtundzwanzigsten Jahre nachgeholt.
In diese Zeit fällt meine Beschäftigung mit der Philosophie Eduard von Hartmanns. Ich studierte seine «Erkenntnistheorie», indem sich fortwährender Widerspruch in mir regte. Die Meinung, daß das wahrhaft Wirkliche als Unbewußtes jenseits der Bewußtseinserlebnisse liege, und diese nichts weiter sein sollen als ein unwirklicher, bildhafter Abglanz des Wirklichen, war mir tief zuwider. Ich stellte dem entgegen, daß die Bewußtseinserlebnisse durch die innerliche Verstärkung des Seelenlebens in das wahrhaft Wirkliche untertauchen können. Ich war mir klar darüber, daß sich im Menschen das Göttlich-Geistige offenbart, wenn der Mensch durch sein Innenleben diese Offenbarung möglich macht.
Der Pessimismus Eduard von Hartmanns erschien mir als das Ergebnis einer ganz falschen Fragestellung an das menschliche Leben. Den Menschen mußte ich so auffassen, daß er dem Ziele zustrebt, aus dem Quell seines Innern zu holen, was ihm das Leben zu seiner Befriedigung erfüllt. Wäre, so sagte ich mir, ein «bestes Leben» dem Menschen von vorneherein durch die Welteinrichtung zugeteilt, wie könnte er diesen Quell in sich zum Strömen bringen? Die äußere Weltordnung gelangt zu einem Entwickelungsstadium, in dem sie Gutes und Böses an die Dinge und Tatsachen vergeben hat. Da erwacht erst das Menschenwesen zum Eigenbewußtsein und führt die Entwickelung weiter, ohne daß sie von den Dingen und Tatsachen, sondern nur von dem Quell des Seins die
in Freiheit einzuschlagende Richtung erhält. Schon das Aufwerfen der Pessimismus- oder Optimismusfrage schien mir gegen die freie Wesenheit des Menschen zu verstoßen. Ich sagte mir oft: wie könnte der Mensch der freie Schöpfer seines höchsten Glückes sein, wenn ihm ein Maß von Glück durch die äußere Weltordnung zugeteilt wäre?
Dagegen zog mich Hartmanns Werk «Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins» an. Da, fand ich, wird die sittliche Entwickelung der Menschheit am Leitfaden des empirisch zu Beobachtenden verfolgt. Es wird nicht, wie in der Hartmann'schen Erkenntnistheorie und Metaphysik dies geschieht, die Gedankenspekulation auf ein jenseits des Bewußten liegendes unbekanntes Sein gelenkt, sondern es wird, was als Sittlichkeit erlebt werden kann, in seiner Erscheinung erfaßt. Und ich war mir klar darüber, daß keine philosophische Spekulation über die Erscheinung hinausdenken darf, wenn sie an das wahrhaft Wirkliche herankommen will. Die Erscheinungen der Welt offenbaren selbst dieses wahrhaft Wirkliche, wenn sich erst die bewußte Seele bereit macht, es zu erfassen. Wer nur das Sinnlich-Ergreifbare in das Bewußtsein aufnimmt, der kann das wahrhaft Seiende in einem dem Bewußtsein Jenseitigen suchen; wer das Geistige in der Anschauung erfaßt, der spricht von ihm als von einem Diesseitigen, nicht von einem Jenseitigen im erkenntnis-theoretischen Sinne. Mir erschien die Betrachtung der sittlichen Welt bei Hartmann sympathisch, weil er dabei seinen Jenseitsstandpunkt völlig zurücktreten läßt und sich an das Beobachtbare hält. Durch die Yertiefung in die Phänomene bis zu dem Grade, daß sie ihre geistige
Wesenheit enthüllen, wollte ich Erkenntnis des Seienden zustande gebracht wissen, nicht durch Nachdenken darüber, was «hinter» den Phänomenen ist.
Da ich stets darnach strebte, eine menschliche Leistung nach ihrer positiven Seite zu empfinden, wurde mir Eduard von Hartmanns Philosophie wertvoll, trotzdem mir gerade ihre Grundrichtung und ihre Lebensanschauung zuwider war, weil sie vieles in den Erscheinungen auf eine eindringliche Art beleuchtet. Und ich fand auch in denjenigen Schriften des «Philosophen des Unbewußten», die ich im Prinzipe ablehnte, vieles, das mir außerordentlich anregend war. Und so ging es mir auch mit den populären Schriften Eduard von Hartmanns, die kulturhistorische, pädagogische, politische Probleme behandeln. Ich fand «gesunde» Lebenserfassung bei diesem Pessimisten, wie ich sie bei manchem Optimisten nicht finden konnte. Gerade ihm gegenüber empfand ich, was ich brauchte: anerkennen zu können, auch wenn ich widersprechen mußte.
Ich verbrachte so manchen Spätabend am Artersee, wenn ich meine Buben sich selbst überlassen konnte und die Sternenwelt vom Balkon des Hauses aus bewundert war, mit dem Studium der «Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins» und dem «Religiösen Bewußtsein der Menschheit im Stufengange seiner Entwicklung». Und während ich diese Schriften las, bekam ich eine immer größere Sicherheit über meine eigenen erkenntnistheoretischen Gesichtspunkte.
Auf Schröers Empfehlung hin lud mich 1882 Joseph Kürschner ein, innerhalb der von ihm veranstalteten «Deutschen Nationalliteratur» Goethes naturwissen-
schaftliche Schriften mit Einleitungen und fortlaufenden Erklärungen herauszugeben. Schröer, der selbst für dieses große Sammelwerk die Dramen Goethes übernommen hatte, sollte den ersten der von mir zu besorgenden Bände mit einem einführenden Vorworte versehen. Er setzte in diesem auseinander, wie Goethe als Dichter und Denker innerhalb des neuzeitlichen Geisteslebens steht. Er sah in der Weltanschauung, die das auf Goethe folgende naturwissenschaftliche Zeitalter gebracht hatte, einen Abfall von der geistigen Höhe, auf der Goethe gestanden hatte. Die Aufgabe, die mir durch die Herausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften zugefallen war, wurde in umfassender Art in dieser Vorrede charakterisiert.
Für mich schloß diese Aufgabe eine Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft auf der einen, mit Goethes ganzer Weltanschauung auf der andern Seite ein. Ich mußte, da ich nun mit einer solchen Auseinandersetzung vor die Öffentlichkeit zu treten hatte, alles, was ich bis dahin als Weltanschauung mir errungen hatte, zu einem gewissen Abschluß bringen.
Ich hatte mich bis dahin nur in wenigen Zeitungsaufsätzen schriftstellerisch betätigt. Mir wurde nicht leicht, was in meiner Seele lebte, in einer solchen Art niederzuschreiben, daß ich diese der Veröffentlichung wert halten konnte. Ich hatte immer das Gefühl, daß das im Innern Erarbeitete in einer armseligen Gestalt erschien, wenn ich es in eine fertige Darstellung prägen sollte. So wurden mir alle schriftstellerischen Versuche zu einem fortwährenden Quell innerer Unbefriedigung.
Die Denkungsart, von der die Naturwissenschaft seit dem Beginn ihres großen Einflusses auf die Zivilisation des neunzehnten Jahrhunderts beherrscht war, schien mir ungeeignet, zu einem Verständnisse dessen zu gelangen, was Goethe für die Naturerkenntnis erstrebt und bis zu einem hohen Grade auch erreicht hatte.
Ich sah in Goethe eine Persönlichkeit, welche durch das besondere geistgemäße Verhältnis, in das sie den Menschen zur Welt gesetzt hatte, auch in der Lage war, die Naturerkenntnis in der rechten Art in das Gesamtgebiet des menschlichen Schaffens hineinzustellen. Die Denkungsart des Zeitalters, in das ich hineingewachsen war, schien mir nur geeignet, Ideen über die leblose Natur auszubilden. Ich hielt sie für ohnmächtig, mit den Erkenntniskräften an die belebte Natur heranzutreten. Ich sagte mir, um Ideen zu erlangen, welche die Erkenntnis des Organischen vermitteln können, ist es notwendig, die für die unorganische Natur tauglichen Verstandesbegriffe erst selbst zu beleben. Denn sie erschienen mir tot, und deshalb auch nur geeignet, das Tote zu erfassen.
Wie sich in Goethes Geist die Ideen belebt haben, wie sie Ideengestaltungen geworden sind, das versuchte ich für eine Erklärung der Goethe'schen Naturanschauung darzustellen.
Was Goethe im einzelnen über dieses oder jenes Gebiet der Naturerkenntnis gedacht und erarbeitet hatte, schien mir von geringerer Bedeutung neben der zentralen Entdeckung, die ich ihm zuschreiben mußte. Diese sah ich darin, daß er gefunden hat, wie man über das Organische denken müsse, um ihm erkennend beizukommen.
Ich fand, daß die Mechanik das Erkenntnisbedürfnis aus dem Grunde befriedigt, weil sie auf eine rationelle Art im Menschengeiste Begriffe ausbildet, die sie dann in der Sinnes-Erfahrung des Leblosen verwirklicht findet. Goethe stand als der Begründer einer Organik vor mir, die in der gleichen Art sich zu dem Belebten verhält. Wenn ich in der Geschichte des neueren Geisteslebens auf Galilei sah, so mußte ich bemerken, wie er durch die Ausbildung von Begriffen über das Anorganische der neueren Naturwissenschaft ihre Gestalt gegeben hat. Was er für das Anorganische geleistet hat, das hat Goethe für das Organische angestrebt. Mir wurde Goethe zum Galilei der Organik.
Ich hatte für den ersten Band der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes zunächst dessen Metamorphosen-Ideen zu bearbeiten. Es wurde mir schwer, auszusprechen, wie sich die lebendige Ideengestalt, durch die das Organische erkannt werden kann, zu der umgestalteten Idee, die für das Erfassen des Anorganischen geeignet ist, verhält. Aber es schien mir für meine Aufgabe alles darauf anzukommen, diesen Punkt in rechter Art anschaulich zu machen.
Im Erkennen des Anorganischen wird Begriff an Begriff gereiht, um den Zusammenhang von Kräften zu überschauen, die eine Wirkung in der Natur hervorbringen. Dem Organischen gegenüber ist es notwendig, einen Begriff aus dem andern so hervorwachsen zu lassen, daß in der fortschreitenden lebendigen Begriffsverwandlung Bilder dessen entstehen, was in der Natur als gestaltete Wesen erscheint. Das hat Goethe dadurch erstrebt, daß er von dem Pflanzenblatte ein Ideenbild im
Geiste festzuhalten versuchte, das nicht ein starrer, lebloser Begriff ist, sondern ein solcher, der sich in den verschiedensten Formen darstellen kann. Läßt man im Geiste diese Formen auseinander hervorgehen, so konstruiert man die ganze Pflanze. Man schafft auf ideelle Art den Vorgang in der Seele nach, durch den die Natur in realer Art die Pflanze gestaltet.
Sucht man in dieser Art das Pflanzenwesen zu begreifen, so steht man dem Natürlichen mit dem Geiste viel näher, als bei dem Erfassen des Anorganischen mit den gestaltlosen Begriffen. Man erfaßt für das Anorganische nur ein geistiges Scheinbild dessen, was auf geistlose Art in der Natur vorhanden ist. In dem Werden der Pflanze lebt aber etwas, das schon eine entfernte Ähnlichkeit hat mit dem, was im Menschengeiste als Bild der Pflanze ersteht. Man wird gewahr, wie die Natur, indem sie das Organische hervorbringt, selbst geistähnliche Wesenheit in sich zur Wirkung bringt.
Daß Goethe mit seiner Metamorphosenlehre die Richtung nahm, die organischen Naturwirkungen auf geistähnliche Art zu denken, wollte ich in der Einleitung zu Goethes botanischen Schriften zeigen.
Noch geistähnlicher erscheinen für Goethes Denkungsart die Wirkungen in der tierischen Natur und in der natürlichen Unterlage des Menschenwesens.
In bezug auf das Tierisch-Menschliche ging Goethe von dem Durchschauen eines Irrtums aus, den er bei seinen Zeitgenossen bemerkte. Diese wollten der organischen Grundlage des Menschenwesens dadurch eine besondere Stellung in der Natur anweisen, daß sie nach einzelnen Unterscheidungsmerkmalen zwischen Men-
schen und Tier suchten. Sie fanden ein solches in dem Zwischenkieferknochen, den die Tiere haben, und in dem die oberen Schneidezähne sitzen. Dem Menschen soll ein solcher besonderer Zwischenknochen im Oberkiefer fehlen. Sein Oberkiefer soll aus einem Stücke bestehen.
Das erschien Goethe als ein Irrtum. Für ihn ist die menschliche Gestalt eine Umwandlung des Tierischen zu einer höheren Stufe. Alles, was in der tierischen Bildung erscheint, muß auch in der menschlichen da sein, nur in einer höheren Form, so daß der menschliche Organismus zum Träger des selbstbewußten Geistes werden kann.
In der Erhöhung der Gesamtform des Menschen sieht Goethe dessen Unterschied vom Tier, nicht im Einzelnen.
Stufenweise sieht man die organischen Schaffenskräfte geistähnlicher werden, indem man in der Betrachtung von dem Pflanzenwesen zu den verschiedenen Formen des Tierischen aufsteigt. In der organischen Gestalt des Menschen sind geistige Schaffenskräfte tätig, die eine höchste Metamorphose der tierischen Bildung hervorbringen. Diese Kräfte sind im Werden des menschlichen Organismus vorhanden; und sie leben sich zuletzt als Menschengeist dar, nachdem sie sich in der natürlichen Grundlage ein Gefäß gestaltet haben, das sie in ihrer naturfreien Daseinsform aufnehmen kann.
In dieser Goethe'schen Anschauung von dem Menschenorganismus erschien mir alles Berechtigte, was später auf Darwin'scher Grundlage über die Verwandtschaft des Menschen mit den Tieren gesagt worden ist, schon vorausgenommen. Es erschien mir aber auch alles Unberechtigte abgewiesen. Die materialistische Auffassung
von dem, was Darwin gefunden hat, führt dazu, aus der Verwandtschaft des Menschen mit den Tieren Vorstellungen zu bilden, die den Geist da verleugnen, wo er im Erdendasein in seiner höchsten Form, im Menschen erscheint. Die Goethe'sche Auffassung führt dazu, in der tierischen Gestaltung eine Geistschöpfung zu sehen, die nur noch nicht die Stufe erreicht hat, auf welcher der Geist als solcher leben kann. Was im Menschen als Geist lebt, das schafft in der tierischen Form auf einer Vorstufe; und es verwandelt diese Form am Menschen so, daß es nicht nur als Schaffendes, sondern auch als sich selbst Erlebendes erscheinen kann.
So angesehen, wird die Goethe'sche Naturbetrachtung eine solche, die, indem sie das natürliche Werden vom Anorganischen zu dem Organischen stufenweise verfolgt, die Naturwissenschaft allmählich in eine Geisteswissenschaft überführt Dies darzustellen, darauf kam es mir bei Ausarbeitung des ersten Bandes der Goethe'schen naturwissenschaftlichen Schriften vor allem an. Ich ließ daher meine Einleitung in eine Erklärung darüber ausklingen, wie der Darwinismus in materialistischer Färbung eine einseitige Anschauung bildet, die an der Goethe'schen Denkungsart gesunden müsse.
Wie man erkennen müsse, um in die Erscheinungen des Lebens einzudringen, das wollte ich in der Betrachtung der Goethe'schen Organik zeigen. Ich fühlte bald, daß diese Betrachtung einer sie stützenden Grundlage bedürfe. Das Wesen des Erkennens wurde damals von meinen Zeitgenossen in einer Art dargestellt, die nicht an Goethes Anschauung herankommen konnte. Die Erkenntnistheoretiker hatten die Naturwissenschaft, wie
sie in jener Zeit war, vor Augen. Was sie über das Wesen der Erkenntnis sagten, galt nur für das Erfassen der anorganischen Natur. Es konnte keinen Zusammenklang geben zwischen dem, was ich über Goethes Erkenntnisart sagen mußte, und den gebräuchlichen Erkenntnistheorien der damaligen Zeit.
Deshalb trieb mich das, was ich in Anlehnung an Goethes Organik dargestellt hatte, neuerdings an die Erkenntnistheorie heran. Vor mir standen Ansichten wie die Otto Liebmanns, die in den verschiedensten Formen den Satz aussprachen, das menschliche Bewußtsein könne aus sich niemals heraus; es müsse sich dabei bescheiden, in dem zu leben, was ihm die Wirklichkeit in die menschliche Seele hereinschickt und was in ihm in geistiger Form sich darstellt. Sieht man die Sache so an, dann kann man nicht davon sprechen, daß man Geistverwandtes in der organischen Natur in Goethe'scher Art findet. Man muß den Geist innerhalb des menschlichen Bewußtseins suchen und eine geistgemäße Naturbetrachtung als unzulässig ansehen.
Ich fand, es gibt für die Goethe'sche Erkenntnisart keine Erkenntnistheorie. Das führte mich dazu, den Versuch zu machen, eine solche wenigstens andeutungsweise auszuführen. Ich schrieb meine «Erkenntnistheorie der Goethe'schen Weltanschauung» aus einem inneren Bedürfnisse heraus, bevor ich daran ging, die weiteren Bände der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes zu bearbeiten. Das Büchelchen wurde 1886 fertig.
VII.
Die Ideen einer «Erkenntnistheorie der Goethe'schen Weltanschauung» schrieb ich in einer Zeit nieder, in der mich das Schicksal in eine Familie einführte, die mich viele schöne Stunden und einen glücklichen Lebensabschnitt in ihrem Kreise verleben ließ. Unter meinen Freunden war seit längerer Zeit einer, den ich wegen seines frischen sonnigen Wesens, wegen seiner treffsicheren Bemerkungen über Leben und Menschen, und wegen seiner ganzen offenen, treuen Art sehr lieb gewonnen hatte. Er führte mich mit anderen gemeinsamen Freunden in sein Haus ein. Dort trafen wir außer dem Freunde noch zwei Töchter des Hauses, seine Schwestern, und einen Mann, in dem wir bald den Bräutigam der älteren Tochter anzuerkennen hatten.
Im Hintergrunde dieser Familie schwebte etwas Unbekanntes, das wir nie zu sehen bekamen. Es war der Vater der Geschwister. Er war da und auch nicht da. Wir bekamen von den verschiedensten Seiten etwas über den uns Unbekannten zu hören. Er mußte, nach den Reden, die wir vernahmen, etwas Sonderbares sein. Die Geschwister sprachen anfangs gar nicht über den Vater, der doch im nächsten Zimmer sein mußte. Erst allmählich kam es dazu, daß sie die eine oder die andere Bemerkung über ihn machten. Jedes Wort war eingegeben von echter Ehrfurcht. Man fühlte, daß sie in ihm einen bedeutenden Menschen verehrten. Aber man empfand auch, daß sie eine große Scheu davor hatten, wir könnten ihn doch durch einen Zufall zu Gesicht bekommen.
Unsere Gespräche im Kreise der Familie hatten zu-
meist literarischen Inhalt. Da wurde denn, um an dies oder jenes anzuknüpfen, von den Geschwistern manches Buch aus der Bibliothek des Vaters herbeigeholt. Und die Umstände brachten es mit sich, daß ich nach und nach mit Vielem bekannt wurde, was der Mann im nächsten Zimmer las, wogegen ich ihn selbst nie zu sehen bekam.
Ich konnte zuletzt nicht mehr anders, als nach vielem zu fragen, was sich auf den Unbekannten bezog. Und so entstand vor meiner Seele allmählich aus den zwar zurückhaltenden, aber doch so vieles verratenden Reden der Geschwister ein Bild der merkwürdigen Persönlichkeit. Ich liebte den Mann, der auch mir als ein bedeutender erschien. Ich verehtte zuletzt in ihm einen Menschen, den das Leben durch schwere Erfahrungen dazu gebracht hatte, sich nur mehr mit der Welt in seinem Innern zu beschäftigen und allen Verkehr mit Menschen zu meiden.
Eines Tages wurde uns Besuchern gesagt, daß der Mann krank sei, und bald darauf mußte man uns seinen Tod berichten. Die Geschwister übertrugen mir die Grabrede. Ich sprach, was mir das Herz eingab über die Persönlichkeit, die ich nur auf die geschilderte Art kennen gelernt hatte. Es war ein Begräbnis, bei dem nur die Familie, der Bräutigam der einen Tochter und meine Freunde anwesend waren. Die Geschwister sagten mir, daß ich ein treues Bild ihres Vaters in meiner Grabrede gegeben habe. Und an ihrer Art zu sprechen, an ihren Tränen konnte ich empfinden, daß dies wirklich ihre Überzeugung war. Und ich wußte ja auch, daß mir der Mann geistig so nahe stand, als ob ich viel mit ihm verkehrt hätte.
Zwischen der jüngeren Tochter und mir entstand allmählich ein schönes Freundschaftsverhältnis. Sie hatte wirklich etwas von dem Urbild eines deutschen Mädchens an sich. Sie trug nichts von angelernter Bildung in ihrer Seele, sondern lebte eine ursprüngliche, anmutige Natürlichkeit mit edler Zurückhaltung dar. Und diese ihre Zurückhaltung löste eine gleiche in mir aus. Wir liebten einander und wußten beide das wohl ganz deutlich; aber konnten auch beide nicht die Scheu davor überwinden, uns zu sagen, daß wir uns liebten. Und so lebte die Liebe zwischen den Worten, die wir miteinander sprachen, nicht in denselben. Das Verhältnis war seelisch nach meinem Gefühle das innigste; aber es fand nicht die Möglichkeit, auch nur einen Schritt über das Seelische hinaus zu tun.
Ich war froh in dieser Freundschaft; ich fühlte die Freundin als Sonnenhaftes im Leben. Doch dieses Leben hat uns später auseinandergeführt. Von Stunden freudigen Zusammenseins blieb dann noch ein kurzer Briefwechsel, dann noch wehmütiges Gedenken an einen schön verlebten Lebensabschnitt. Ein Gedenken, das aber durch das ganze folgende Leben immer wieder aus den Tiefen meiner Seele herauftauchte.
In derselben Zeit war es, daß ich einmal zu Schröer kam. Er war ganz erfüllt von einem Eindruck, den er eben erhalten hatte. Er war mit den Dichtungen Marie Eugenie delle Grazies bekannt geworden. Es lagen von ihr damals vor: ein Bändchen Gedichte, ein Epos «Herman», ein Drama «Saul» und eine Erzählung «Die Zigeunerin». Schröer sprach mit Enthusiasmus von diesen Dichtungen. «Und das alles hat eine junge Persön-
lichkeit vor Vollendung ihres sechzehnten Jahres geschrieben», sagte er. Er fügte hinzu: Robert Zimmermann habe gesagt, das sei das einzige wirkliche Genie, das er in seinem Leben kennen gelernt habe.
Schröers Enthusiasmus führte mich dazu, die Dichtungen in einem Zuge nun auch zu lesen. Ich schrieb ein Feuilleton über die Dichterin. Das brachte mir die große Freude, sie besuchen zu können. Bei diesem Besuche konnte ich ein Gespräch mit der Dichterin haben, das mir oft im Leben vor der Seele gestanden hat. Sie hatte sich damals bereits an eine Aufgabe größten Stiles gemacht, an ihr Epos «Robespierre». Sie sprach über die Grundideen dieser Dichtung. Schon damals tönte durch ihre Reden eine pessimistische Grundstimmung durch. Mir erschien ihre Empfindung so, als ob sie in einer Persönlichkeit wie Robespierre die Tragik alles Idealismus darstellen wollte. Ideale entstehen in der Menschenbrust; aber sie haben keine Macht gegenüber dem ideenlosen, grausamen, zerstörenden Wirken der Natur, die allem Idealen ihr unerbittliches «du bist nur Illusion, ein Scheingeschöpf von mir, das ich immer wieder ins Nichts zurückwerfe» entgegenschreit.
Das war ihre Überzeugung. Die Dichterin sprach dann zu mir von einem weiteren dichterischen Plan, einer «Satanide». Sie wollte das Gegenbild Gottes als das Urwesen darstellen, das in der grausamen, ideenlosen, zermalmenden Natur die für den Menschen sich offenbarende Macht ist. Sie sprach mit wahrer Genialität von dieser aus dem Abgrund des Seins herauf dieses Sein beherrschenden Gewalt. Ich ging tief erschüttert von der Dichterin weg. Die Größe, mit der sie gesprochen hatte,
stand vor mir; der Inhalt ihrer Ideen war das Gegenbild alles dessen, was mir als Anschauung von der Welt vor dem Geiste stand. Aber ich war niemals geneigt, dem, was mir als groß erschien, meine Bewunderung und mein Interesse zu versagen, auch wenn es mir inhaltlich ganz widerstrebte. Ja, ich sagte mir: solche Gegensätze in der Welt müssen irgendwo doch ihre Harmonie finden. Und das machte mir möglich, verständnisvoll dem Widerstrebenden so zu folgen, als ob es in der Richtung meiner eigenen Seelenverfassung läge.
Kurz darauf wurde ich eingeladen zu delle Grazie. Sie sollte vor einer Anzahl von Persönlichkeiten, zu denen auch Schröer und seine Frau, sowie eine Freundin des Schröer'schen Hauses gehörten, aus ihrem «Robespierre» vorlesen. Wir hörten Szenen von hohem dichterischem Schwung, aber in pessimistischem Grundton, von farbenreichem Naturalismus; das Leben von seinen erschütterndsten Seiten gemalt. Vom Schicksal innerlich betrogene Menschengrößen tauchten auf und sanken hinunter in ergreifender Tragik. Das war mein Eindruck. Schröer wurde unwillig. Für ihn durfte die Kunst nicht in solche Untiefen des «Schrecklichen» hinuntersteigen. Die Damen entfernten sich. Sie hatten eine Art von Krämpfen bekommen. Ich konnte mit Schröer nicht übereinstimmen. Denn er schien mir von dem Gefühle ganz durchdrungen, daß zur Dichtung niemals werden dürfe, was schreckliches Erlebnis in der Seele eines Menschen ist, auch wenn dieses Schreckliche ehrlich erlebt ist. Bald darnach erschien von delle Grazie ein Gedicht, in dem die Natur als höchste Macht besungen wird, aber so, daß sie Hohn spricht allem Idealen, das sie nur ins Dasein ruft,
um den Menschen zu betören, und das sie ins Nichts zurückwirft, wenn die Betörung erreicht ist.
Ich schrieb in Anknüpfung an dieses Gedicht einen Aufsatz «Die Natur und unsere Ideale», den ich nicht veröffentlichte, sondern in einer geringen Anzahl von Exemplaren drucken ließ. Darin sprach ich von dem Scheine der Berechtigung, welche die Anschauung delle Grazies hat. Ich sagte, daß mir eine Anschauung, die sich nicht verschließt vor dem Feindlichen, das in der Natur gegenüber den menschlichen Idealen liegt, höher stehe als ein «flacher Optimismus», der für die Abgründe des Seins keinen Blick hat. Aber ich sprach auch davon, daß die innere freie Wesenheit des Menschen aus sich erschafft, was dem Leben Sinn und Inhalt gibt, und daß diese Wesenheit sich nicht voll entfalten könnte, wenn ihr von außen, durch eine glückspendende Natur zukäme, was im Innern entstehen soll.
Durch diesen Aufsatz erlebte ich einen großen Schmerz. Als ihn Schröer empfangen hatte, schrieb er mir, daß, wenn ich so über den Pessimismus denke, wir uns nie verstanden hätten. Und wer von der Natur so spreche wie ich in diesem Aufsatze, der zeige damit, daß er Goethes Worte «Erkenne dich und leb' mit der Welt in Frieden» nicht tief genug nehmen könne.
Ich war im tiefsten meiner Seele betroffen, als ich diese Zeilen von der Persönlichkeit empfing, an die ich mit stärkster Anhänglichkeit hingegeben war. Schröer konnte in leidenschaftliche Erregung kommen, wenn er eine Versündigung gegen die als Schönheit wirkende Harmonie in der Kunst wahrnahm. Er wandte sich von delle Grazie ab, als er diese Versündigung nach seiner Auffas-
sung bemerken mußte. Und er betrachtete bei mir die Bewunderung, die ich für die Dichterin behielt, als einen Abfall von ihm und von Goethe zugleich. Er sah in meinem Aufsatze nicht, was ich von dem aus dem eigenen Innern die Hemmnisse der Natur überwindenden Menschengeiste sagte; er war davon verletzt, daß ich von der natürlichen Außenwelt behauptete, sie könne nicht die Schöpferin der wahren inneren Befriedigung des Menschen sein. Ich wollte die Bedeutungslosigkeit des Pessimismus trotz seiner Berechtigung innerhalb gewisser Grenzen darstellen; Schröer sah in jeder Hinneigung zum Pessimismus etwas, was er «die Schlacke ausgebrannter Geister» nannte.
Im Hause Marie Eugenie delle Grazies verlebte ich schöne Stunden meines Lebens. Sie hatte jeden Sonnabend Besuchsabend. Es waren Persönlichkeiten vieler Geistesrichtungen, die sich da einfanden. Die Dichterin bildete den Mittelpunkt. Sie las aus ihren Dichtungen vor; sie sprach im Geiste ihrer Weltauffassung mit entschiedener Wortgeberde; sie beleuchtete mit den Ideen dieser Auffassung das Menschenleben. Es war keine Sonnenbeleuchtung. Eigentlich immer Mondendüsterkeit. Drohender Wolkenhimmel. Aber aus den Wohnungen der Menschen stiegen in die Düsternis Feuerflammen hinauf, wie die Leidenschaften und Illusionen tragend, in denen sich die Menschen verzehren. Alles aber auch menschlich ergreifend, stets fesselnd, das Bittere von dem edlen Zauber einer ganz durchgeistigten Persönlichkeit umflossen.
An delle Grazies Seite erschien Laurenz Müllner, katholischer Priester, der Lehrer der Dichterin und spätere
vorsorgliche edle Freund. Er war damals Professor für christliche Philosophie an der theologischen Fakultät der Universität. Er hatte nicht nur das Gesicht, sondern die ganze Gestalt im Ausdrucke des Ergebnisses einer seelisch-asketisch verbrachten geistigen Entwickelung. Ein Skeptiker in philosophischen Dingen, gründlich durchgebildet nach allen Seiten der Philosophie, der Kunstanschauung, der Literatur. Er schrieb für das katholisch-klerikale Tagblatt «Vaterland» anregende Artikel über Künstlerisches und Literarisches. Die pessimistische Welt- und Lebensauffassung der Dichterin sprach stets auch aus seinem Munde.
Die Beiden vereinigte eine heftige Abneigung gegen Goethe; dagegen war ihr Interesse Shakespeare und den neueren aus der leidensvollen Schwere des Lebens, oder den naturalistischen Verirrungen der Menschennatur geborenen Dichtern zugewendet. Dostojewskij hatte ihre ganze Liebe; Leopold v. Sacher-Masoch sahen sie als einen glänzenden, vor keiner Wahrheit zurückschreckenden Darsteller dessen an, was im modernen Sumpfleben als zerstörenswurdiges Allzumenschliches hervorsproßt. Bei Laurenz Müllner hatte die Goetheabneigung etwas von der Farbe des katholischen Theologen. Er pries Baumgartners Goethe-Monographie, die Goethe als den Widerpart des Menschlich-Erstrebenswerten charakterisiert. Bei delle Grazie war etwas wie eine tiefe persönliche Antipathie gegen Goethe vorhanden.
Um die beiden sammelten sich Professoren der theologischen Fakultät, katholische Priester von der aller-feinsten Gelehrsamkeit. Da war vor allem immer intensiv anregend der Heiligenkreuzer Zisterzienser Ordens-
priester Wilhelm Neumann. Müllner verehrte ihn mit Recht wegen seiner umfassenden Gelehrsamkeit. Er sagte mir, als ich einmal in Abwesenheit Neumanns von dessen weitausschauendem Wissen mit enthusiastischer Bewunderung sprach: ja, der Professor Neumann kennt die ganze Welt und noch drei Dörfer. Ich schloß mich gerne dem gelehrten Manne an, wenn wir von dem Besuche bei delle Grazie weggingen. Ich hatte so viele Gespräche mit diesem «Ideal» eines wissenschaftlichen Mannes, aber zugleich «treuen Sohnes seiner Kirche». Ich möchte nur zweier hier Erwähnung tun. Das eine war über die Wesenheit Christi. Ich sprach meine Anschauung darüber aus, wie Jesus von Nazareth durch außerirdischen Einfluß den Christus in sich aufgenommen habe und wie Christus als eine geistige Wesenheit seit dem Mysterium von Golgatha mit der Menschheitsentwickelung lebt. Dies Gespräch blieb tief in meiner Seele eingepragt; es tauchte immer wieder aus ihr auf. Denn es war für mich tief bedeutsam. Es unterredeten sich damals eigentlich drei. Professor Neumann und ich und ein dritter Unsichtbarer, die Personifikation der katholischen Dogmatik, die sich wie drohend, dem geistigen Auge sichtbar, hinter Professor Neumann, diesen begleitend, zeigte, und die stets ihm verweisend auf die Schulter klopfte, wenn die feinsinnige Logik des Gelehrten mir zu weit zustimmte. Es war bei diesem merkwürdig, wie der Vordersatz gar oft im Nachsatze in sein Gegenteil umschlug. Ich stand damals der katholischen Lebensart in einem ihrer besten Vertreter gegenüber; ich habe sie achtend, aber auch wirklich gründlich gerade durch ihn kennen gelernt.
Ein andres Mal sprachen wir über die wiederholten Erdenleben. Da hörte mich der Professor an, sprach von allerlei Literatur, in der man darüber etwas finden könne; er schüttelte oft leise den Kopf, hatte aber wohl gar nicht die Absicht, auf das Inhaltliche des ihm absonderlich scheinenden Themas einzugehen. Und dennoch ist mir auch dieses Gespräch wichtig geworden. Die Unbehaglichkeit Neumanns, mit der er seine nicht ausgesprochenen Urteile gegenüber meinen Aussagen empfanden hat, ist mir tief in das Gedächtnis eingeschrieben geblieben.
Noch waren die Kirchenhistoriker und andere Theologen die Sonnabend-Besucher. Außerdem fanden sich ab und zu der Philosoph Adolf Stöhr, Goswine von Berlepsch, die tiefempfindende Erzählerin, Emilie Mataja (die den Schriftstellernamen Emil Marriot trug), der Dichter und Schriftsteller Fritz Lemmermayer und der Komponist Stroß. Fritz Lemmermayer, mit dem ich später eng befreundet wurde, lernte ich an den delle Grazie-Nachmittagen kennen. Ein ganz merkwürdiger Mensch. Er sprach alles, wofür er sich interessierte, mit innerlich gemessener Würde. In seinem Äußeren war er ebenso dem Musiker Rubinstein wie dem Schauspieler Lewinsky ähnlich. Mit Hebbel trieb er fast einen Kultus. Er hatte über Kunst und Leben bestimmte, aus dem klugen Herzenskennen geborene Anschauungen, die außerordentlich fest in ihm saßen. Er hat den interessanten, tiefgründigen Roman «Der Alchymist» geschrieben und manches Schöne und auch Gedankentiefe. Er wußte die kleinsten Dinge des Lebens in den Gesichtspunkt des Wichtigen zu rücken. Ich denke, wie ich ihn einmal in seinem lieben
Stübchen in einer Seitengasse in Wien mit anderen Freunden besuchte. Er hatte sich eben selbst seine Mahlzeit bereitet: zwei kernweiche Eier auf einem Schnellsieder; dazu Brot. Mit Emphase sprach er, während das Wasser wallte, uns die Eier zu sieden: «Das wird köstlich sein.» Ich werde noch in einer späteren Lebensphase von ihm zu sprechen haben.
Alfred Stroß, der Komponist, war ein genialisch, aber tief pessimistisch angelegter Mensch. Wenn er sich bei delle Grazie ans Klavier setzte und seine Etuden spielte, so hatte man das Gefühl: Anton Bruckners Musik verdunstet in Tönen, die dem Erdensein entfliehen wollen. Stroß wurde wenig verstanden; Fritz Lemmermayer liebte ihn ganz unsäglich.
Beide, Lemmermayer und Stroß, waren mit Robert Hamerling sehr befreundet. Und ich wurde durch sie später zu einem kurzen Briefwechsel mit Hamerling veranlaßt, von dem ich noch sprechen werde. Stroß endete in schwerer Krankheit, geistig umnachtet.
Auch der Bildhauer Hans Brandstetter fand sich bei delle Grazie ein.
Doch unsichtbar über dieser ganzen Gesellschaft schwebte oftmals in wunderbarer Schilderung und wie hymnisch angeredet der Theologie-Historiker Werner. Delle Grazie liebte ihn über alles. Er erschien, während ich die Sonnabende besuchen durfte, nie selbst. Aber seine Bewunderin zeigte das Bild des Thomas v. Aquin-Biographen von immer neuen Seiten, das Bild des gütigen, liebevollen, im höchsten Alter naiv gebliebenen Gelehrten. Man hatte einen Menschen vor sich: so selbstlos, so hingegeben dem Stoffe, von dem er als Historiker
sprach, so exakt, daß man sich sagte: ach, gäbe es doch recht viele solcher Historiker.
Es waltete ein wahrer Zauber über diesen Sonnabend-Zusammenkünften. Wenn es dunkel geworden war, dann brannte die mit rotem Stoff umhüllte Deckenlampe, und wir saßen in einem die ganze Gesellschaft feierlich machenden Lichtraume. Dann wurde delle Grazie oft, namentlich wenn die etwas ferner Stehenden weggegangen waren, außerordentlich gesprächig, und man bekam manches Wort zu hören, das wie Lebensseufzer im Nachgefühle schwerer Schicksalstage klang. Man konnte aber auch echten Humor über Verkehrtheiten des Lebens und Töne der Entrüstung über Presse- und andere Korruption hören. Dazwischen kamen die sarkastischen, oft ätzenden Bemerkungen Müllners über allerlei Philosophisches, Künstlerisches und anderes.
Delle Grazies Haus war eine Stätte, in der der Pessimismus mit unmittelbarer Lebenskraft sich offenbarte, eine Stätte des Anti-Goetheanismus. Man hörte immer an, wenn ich über Goethe sprach; doch war Laurerz Müllner der Ansicht, daß ich Goethe Dinge andichtete, die eigentlich mit dem wirklichen Minister des Großherzogs Karl August nicht viel zu tun haben. Trotzdem war für mich jeder Besuch in diesem Hause - und ich wußte, daß man mich dort gerne sah - etwas, dem ich Unsägliches verdanke; ich fühlte mich da in einer geistigen Atmosphäre, die mir wahrhaft wohltat. Dazu bedurfte es für mich nicht der Übereinstimmung in den Ideen; dazu bedurfte es der strebsamen, für Geistiges empfänglichen Menschlichkeit.
Ich war nun hineingestellt zwischen dieses Haus, in
dem ich so gerne verkehrte, und meinen Lehrer und väterlichen Freund Karl Julius Schröer, der nach den ersten Besuchen niemals wieder bei delle Grazie erschien. Mein Gefühlsleben hatte dadurch, weil es an beiden Seiten mit ehrlicher Liebe und Verehrung beteiligt war, einen wirklichen Riß.
Aber gerade in dieser Zeit reiften die ersten Gedanken zu meiner später erschienenen «Philosophie der Freiheit» heran. In dem oben gekennzeichneten Sendschreiben an delle Grazie über «Die Natur und unsere Ideale» liegt in den folgenden Sätzen die Urzelle dieses Buches:
«Unsere Ideale sind nicht mehr flach genug, um von der oft so schalen, so leeren Wirklichkeit befriedigt zu werden. - Dennoch kann ich nicht glauben, daß es keine Erhebung aus dem tiefen Pessimismus gibt, der aus dieser Erkenntnis hervorgeht. Diese Erhebung wird mir, wenn ich auf die Welt unseres Innern schaue, wenn ich an die Wesenheit unserer idealen Welt näher herantrete. Sie ist eine in sich abgeschlossene, in sich vollkommene Welt, die nichts gewinnen, nichts verlieren kann durch die Vergänglichkeit der Außendinge. Sind unsere Ideale, wenn sie wirklich lebendige Individualitäten sind, nicht Wesenheiten für sich, unabhängig von der Gunst oder Ungunst der Natur? Mag immerhin die liebliche Rose vom unbarmherzigen Windstoße zerblättert werden, sie hat ihre Sendung erfüllt, denn sie hat hundert menschliche Augen erfreut; mag es der mörderischen Natur morgen gefallen, den ganzen Sternenhimmel zu vernichten: durch Jahrtausende haben Menschen verehrungsvoll zu ihm emporgeschaut, und damit ist es genug. Nicht das Zeitendasein, nein, das innere Wesen der Dinge macht sie voll-
kommen. Die Ideale unseres Geistes sind eine Welt für sich, die sich auch für sich ausleben muß, und die nichts gewinnen kann durch die Mitwirkung einer gütigen Natur. - Welch erbarmungswürdiges Geschöpf wäre der Mensch, wenn er nicht innerhalb seiner eigenen Idealwelt Befriedigung gewinnen könnte, sondern dazu erst der Mitwirkung der Natur bedürfte? Wo bliebe die göttliche Freiheit, wenn die Natur uns, gleich unmündigen Kindern, am Gängelbande führend, hegte und pflegte? Nein, sie muß uns alles versagen, damit, wenn uns Glück wird, dies ganz das Erzeugnis unseres freien Selbstes ist. Zerstöre die Natur täglich, was wir bilden, auf daß wir uns täglich aufs neue des Schaffens freuen können! Wir wollen nichts der Natur, uns selbst alles verdanken!
Diese Freiheit, könnte man sagen, sie ist doch nur ein Traum! Indem wir uns frei dünken, gehorchen wir der ehernen Notwendigkeit der Natur. Die erhabensten Gedanken, die wir fassen, sind ja nur das Ergebnis der in uns blind waltenden Natur. - O, wir sollten doch endlich zugeben, daß ein Wesen, das sich selbst erkennt, nicht unfrei sein kann!... Wir sehen das Gewebe der Gesetze über den Dingen walten, und das bewirkt die Notwendigkeit. Wir besitzen in unserem Erkennen die Macht, die Gesetzlichkeit der Naturdinge aus ihnen loszulösen und sollten dennoch die willenlosen Sklaven dieser Gesetze sein?» - Diese Gedanken entwickelte ich nicht aus Widerspruchsgeist, sondern es drängte mich, was mir die Anschauung der geistigen Welt sagte, dem entgegenzusetzen, was ich als den andern Pol einer Lebensauffassung gegenüber der meinigen ansehen mußte, den ich aber
auch, weil er mir in wahrhaft seelischer Vertiefung sich offenbarte, ganz unsäglich verehrte.
In derselben Zeit, in der ich so viele Anregungen im Hause delle Grazies erleben durfte, konnte ich auch in einen Kreis junger österreichischer Dichter eintreten. Man traf sich in jeder Woche zu einer freien Aussprache und zur gegenseitigen Mitteilung dessen, was der eine oder der andere hervorgebracht hatte. Die verschiedensten Charaktere versammelten sich da. Vom optimistischen, naiven Lebensdarsteller bis zu dem bleischweren Pessimisten war jede Lebensauffassung und Seelenstimmung vorhanden. Fritz Lemmermayer war die Seele des Kreises. Es war etwas da von dem Ansturm gegen «das Alte» im Geistesleben der Zeit, den im deutschen Reiche «draußen» die Brüder Hart, Karl Henckel und andere entfesselt hatten. Aber es war alles in die österreichische «Liebenswürdigkeit» getaucht. Man sprach viel davon, wie die Zeit gekommen sei, in der neue Töne auf allen Lebensgebieten erklingen müssen; aber man tat es mit der Abneigung gegenüber dem Radikalismus, die dem Österreicher eigen ist.
Einer der Jüngsten dieses Kreises war Joseph Kitir. Er strebte eine Art Lyrik an, zu der er sich bei Martin Greif die Anregung geholt hatte. Er wollte nicht subjektive Gefühle zum Ausdruck bringen; er wollte einen Vorgang, eine Situation «objektiv» hinstellen, doch so, als ob diese nicht von den Sinnen, sondern vom Gefühle beobachtet werden. Er wollte nicht sagen: er sei entzückt, sondern es sollte der entzückende Vorgang hingemalt werden, und das Entzücken sollte sich bei dem Zuhörer oder Leser einstellen, ohne daß der Dichter es ausspricht.
Kitir hat wahrhaft Schönes in dieser Richtung geschaffen. Er war eine naive Natur. Eine kurze Zeit hindurch hat er sich enger an mich angeschlossen.
In diesem Kreise hörte ich nun mit großer Begeisterung von einem deutsch-österreichischen Dichter sprechen und lernte auch zunächst einige seiner Dichtungen kennen. Diese machten auf mich einen starken Eindruck. Ich strebte danach, ihn kennen zu lernen. Ich fragte Fritz Lemmermayer, der ihn gut kannte, und einige andere, ob der Dichter nicht zu unseren Versammlungen eingeladen werden könnte. Aber man sagte mir, der ist nicht herzukriegen, wenn man vier Pferde anspannte. Der sei ein Sonderling und wolle nicht unter Leute gehen. Ich wollte aber durchaus ihn kennen lernen. Da machte sich denn die ganze Gesellschaft eines Abends auf und wanderte nach dem Orte, wo ihn die «Wissenden» finden konnten. Es war eine kleine Weinstube in einer Parallelgasse zur Kärtnerstraße. Da saß er in einer Ecke, sein nicht kleines Glas Rotwein vor sich. Er saß, wie wenn er seit unbegrenzt langer Zeit gesessen hätte und noch unbegrenzte Zeit sitzen bleiben wollte. Ein schon recht alter Herr, aber mit jugendlich leuchtenden Augen und einem Antlitz, das in den feinsten, sprechendsten Zügen den Dichter und Idealisten offenbarte. Er sah uns Eintretende zunächst nicht. Denn durch den edelgeformten Kopf zog sichtlich eine entstehende Dichtung. Fritz Lemmermayer mußte ihn erst am Arm fassen; da wendete er das Gesicht zu uns und blickte uns an. Wir hatten ihn gestört. Das konnte sein betroffener Blick nicht verbergen; aber er offenbarte es auf die allerliebenswürdigste Weise. Wir stellten uns um ihn. Zum Sitzen war für so viele kein
Platz in der engen Stube. Es war nun merkwürdig, wie der Mann, der als ein «Sonderling» geschildert worden war, sich nach ganz kurzer Zeit als geistvoll-gesprächig erwies. Wir empfanden alle, mit dem, was sich da zwischen Seelen im Gespräche abspielte, können wir in der dumpfen Enge dieser Stube nicht bleiben. Und es gehörte nun gar nicht viel dazu, um den «Sonderling» mit uns in ein anderes «Lokal» zu bringen. Wir andern außer ihm und einem Bekannten von ihm, der schon lange in unserem Kreise verkehrte, waren alle jung; doch bald zeigte es sich, daß wir noch nie so jung waren, als an diesem Abend, da der alte Herr unter uns war, denn der war eigentlich der allerjüngste.
Ich war in tiefster Seele ergriffen von dem Zauber dieser Persönlichkeit. Es war mir ohne weiteres klar, daß dieser Mann noch viel Bedeutenderes geschaffen haben müsse, als er veröffentlicht hatte, und ich fragte ihn kühnlich danach. Da antwortete er fast scheu: ja, ich habe zu Hause noch einige kosmische Sachen. Und ich konnte ihn dahin bringen, daß er versprach, diese das nächste Mal, wenn wir ihn sehen dürfen, mitzubringen.
So lernte ich Fercher von Steinwand kennen. Ein kerniger, ideenvoller, idealistisch fühlender Dichter aus dem Kärntnerland. Er war das Kind armer Leute und hat seine Jugend unter großen Entbehrungen verlebt. Der bedeutende Anatom Hyrtl hat ihn schätzen gelernt und ihm ein Dasein ermöglicht, in dem er ganz seinem Dichten, Denken und Sinnen leben konnte. Die Welt wußte recht lange wenig von ihm. Robert Hamerling brachte ihm von dem Erscheinen seiner ersten Dichtung, der «Gräfin Seelenbrand», an die vollste Anerkennung entgegen.
Wir brauchten nunmehr den «Sonderling» nicht mehr zu holen. Er erschien fast regelmäßig an unseren Abenden. Mir wurde die große Freude, daß er an einem derselben seine «kosmischen Sachen» mitbrachte. Es waren der «Chor der Urtriebe» und der «Chor der Urträume», Dichtungen, in denen in schwungvollen Rhythmen Empfindungen leben, die an die Schöpferkräfte der Welt heranzudringen scheinen. Da weben wie wesenhaft Ideen in herrlichem Wohlklang, die als Bilder der Weltkeimes-mächte wirken. Ich betrachte die Tatsache, daß ich Fercher von Steinwand habe kennen lernen dürfen, als eine der wichtigen, die in jungen Jahren an mich herangetreten sind. Denn seine Persönlichkeit wirkte wie die eines Weisen, der seine Weisheit in echter Dichtung offenbart.
Ich hatte gerungen mit dem Rätsel der wiederholten Erdenleben des Menschen. Manche Anschauung in dieser Richtung war mir aufgegangen, wenn ich Menschen nahegetreten war, die in dem Habitus ihres Lebens, in dem Gepräge ihrer Persönlichkeit unschwer die Spuren eines Wesensinhaltes offenbaren, den man nicht in dem suchen darf, was sie durch die Geburt ererbt und seit dieser erfahren haben. Aber in dem Mienenspiel, in jeder Geberde Ferchers zeigte sich mir die Seelenwesenheit, die nur gebildet sein konnte in der Zeit vom Anfange der christlichen Entwickelung, da noch griechisches Heidentum nachwirkte in dieser Entwickelung. Eine solche Anschauung gewinnt man nicht, wenn man über die zunächst sich aufdrängenden Äußerungen einer Persönlichkeit sinnt; man fühlt sie erregt durch die solche Äußerungen scheinbar begleitenden, in Wirklichkeit aber sie unbegrenzt vertiefenden, in die Intuition eintre-
tenden Züge der Individualität. Man gewinnt sie auch nicht, wenn man sie sucht, während man mit der Persönlichkeit zusammen ist, sondern erst dann, wenn der starke Eindruck nachwirkt und wie eine belebte Erinnerung wird, in der das im äußeren Leben Wesentliche sich auslöscht und das sonst «Unwesentliche» beginnt eine ganz deutliche Sprache zu reden. Wer Menschen «beobachtet», um ihre vorangegangenen Erdenleben zu enträtseln, der kommt ganz gewiß nicht zum Ziele. Solche Beobachtung muß man wie eine Beleidigung empfinden, die man den Beobachteten zufügt; dann erst kann man hoffen, daß wie durch eine von der geistigen Außenwelt kommende Schicksalsfügung sich das Langvergangene des Menschen in dem Gegenwärtigen enthüllt.
Gerade in der hier dargestellten Zeit meines Lebens errang ich mir die bestimmten Anschauungen über die wiederholten Erdenleben des Menschen. Vorher lagen sie mir zwar nicht ferne; aber sie rundeten sich nicht aus den unbestimmten Zügen heraus zu scharfen Eindrücken. Theorien aber über solche Dinge wie wiederholte Erdenleben bildete ich nicht in eigenen Gedanken aus; ich nahm sie zwar in das Verständnis aus der Literatur oder andern Mitteilungen auf als etwas Einleuchtendes; aber ich theoretisierte selbst nicht darüber. Und nur, weil ich mir wirklicher Anschauung auf diesem Gebiete bewußt war, konnte ich das erwähnte Gespräch mit Professor Neumann führen. Es ist ganz gewiß nicht zu tadeln, wenn sich Menschen von den wiederholten Erdenleben und andern nur auf übersinnlichem Wege zu erlangenden Einsichten überzeugen; denn eine vollgeltende Überzeugung auf diesem Gebiete ist auch dem unbefangenen
gesunden Menschenverstande möglich, auch dann, wenn der Mensch es nicht zur Anschauung gebracht hat. Nur war der Weg des Theoretisierens auf diesem Gebiete nicht mein Weg.
In der Zeit, in der sich mir über die wiederholten Erdenleben konkrete Anschauungen immer mehr herausbildeten, lernte ich die theosophische Bewegung kennen, die von H. P. Blavatsky ausgegangen ist. Sinnetts «Esoterischer Buddhismus» kam mir durch einen Freund in die Hände, zu dem ich über diese Dinge sprach. Dieses Buch, das erste, das ich aus der theosophischen Bewegung kennen lernte, machte auf mich gar keinen Eindruck. Und ich war froh darüber, dieses Buch nicht gelesen zu haben, bevor ich Anschauungen aus dem eigenen Seelenleben heraus hatte. Denn sein Inhalt war für mich abstoßend; und die Antipathie gegen diese Art, das Übersinnliche darzustellen, hätte mich wohl verhindert, auf dem Wege, der mir vorgezeichnet war, zunächst weiter fortzuschreiten.
VIII.
In dieser Zeit - um 1888 herum - ward ich auf der einen Seite zur scharfen geistigen Konzentration durch mein inneres Seelenleben gedrängt; auf der andern stellte mich das Leben in einen ausgebreiteten geselligen Verkehr hinein. In meinem Innern ergab sich durch die ausführliche Einleitung, die ich zurn zweiten Bande der von mir herauszugebenden naturwissenschaftlichen Werke Goethes zu schreiben hatte, die Nötigung, meine Anschauung von der geistigen Welt in die Form einer gedanklich durchsichtigen Darstellung zu bringen. Das erforderte eine innere Abgezogenheit von allem, womit ich durch das äußere Leben verbunden war. Ich verdanke dem Umstande viel, daß mir diese Abgezogenheit möglich war. Ich konnte damals in einem Kaffeehause sitzen, um mich herum das lebhafteste Treiben haben, und doch im Innern ganz still sein, die Gedanken darauf gewandt, im Konzept niederzuschreiben, was dann in die erwähnte Einleitung übergegangen ist. So führte ich ein inneres Leben, das in gar keinem Zusammenhange stand mit der Außenwelt, in die meine Interessen doch wieder intensiv verflochten waren.
Es war das die Zeit, in der sich in dem damaligen Österreich diese Interessen den krisenhaften Erscheinungen zuwenden mußten, die in den öffentlichen Angelegenheiten sich offenbarten. Persönlichkeiten, mit denen ich viel verkehrte, widmeten ihre Arbeit und Kraft den Auseinandersetzungen, die sich zwischen den Nationalitäten Österreichs vollzogen. Andere beschäftigten sich mit der sozialen Frage. Wieder andere standen in Bestre-
bungen nach einer Verjüngung des künstlerischen Lebens darinnen.
Wenn ich mit meiner Seele in der geistigen Welt lebte, dann hatte ich oft die Empfindung, daß alle diese Zielsetzungen in ein Unfruchtbares auslaufen mußten, weil sie es doch vermieden, an die geistigen Kräfte des Daseins heranzutreten. Die Besinnung auf diese geistigen Kräfte schien mir das zuerst Notwendige. Ein deutliches Bewußtsein davon aber konnte ich in dem geistigen Leben nicht finden, das mich umgab.
Es erschien damals Robert Hamerlings satyrisches Epos «Homunculus». In diesem ward der Zeit ein Spiegel vorgehalten, aus dem ihr Materialismus, ihre dem Äußerlichen des Lebens zugewandten Interessen in beabsichtigt karikaturenhaften Bildern erschienen. Der Mann, der nur noch in mechanistisch-materialistischen Vorstellungen und Betätigungen leben kann, geht eine Verbindung ein mit dem Weibe, das sein Wesen nicht in einer wirklichen, sondern in einer phantastischen Welt hat. Die zwei Seiten, in denen sich die Zivilisation verbildet hatte, wollte Hamerling treffen. Auf der einen Seite stand ihm das geistlose Streben, das die Welt als einen Mechanismus dachte und das Leben maschinenmäßig gestalten wollte; auf der andern die seelenlose Phantastik, die gar kein Interesse daran hat, daß ihr geistiges Scheinleben in irgend eine wahrhaftige Beziehung zur Wirklichkeit kommt
Das Groteske der Bilder, in denen Hamerling malte, stieß viele ab, die seine Verehrer durch seine früheren Werke geworden waren. Auch in dem Hause delle Grazies, in dem man vorher in restloser Bewunderung Ha-
merlings lebte, wurde man bedenklich, als dieses Epos erschien.
Auf mich aber machte der «Homunculus» doch einen sehr tiefen Eindruck. Er zeigte, so schien es mir, die Kräfte, die als geistverfinsternd in der modernen Zivilisation walten. Ich fand in ihm eine ernste Mahnung an die Zeit. Aber ich hatte auch Schwierigkeiten, eine Stellung zu Hamerling zu gewinnen. Und das Erscheinen des «Homunculus» vermehrte in meiner Seele zunächst die Schwierigkeiten. Ich sah in Hamerling eine Persönlichkeit, die mir in einer besondern Art selbst eine Offenbarung der Zeit war. Ich blickte zurück auf die Zeit, in der Goethe und die mit ihm Wirkenden den Idealismus auf eine menschenwürdige Höhe gebracht hatten. Ich erkannte die Notwendigkeit, durch das Tor dieses Idealismus in die wirkliche Geistwelt einzudringen. Mir erschien dieser Idealismus als der herrliche Schatten, den nicht die Sinnenwelt hinein in die Seele des Menschen wirft, sondern als derjenige, der aus einer geistigen Welt in das Innere des Menschen fällt, und der eine Aufforderung darstellt, von dem Schatten aus die Welt zu erreichen, die den Schatten wirft.
Ich liebte Hamerling, der in so gewaltigen Bildern den idealistischen Schatten gemalt hatte. Aber es war mir eine tiefe Entbehrung, daß er dabei stehen blieb. Daß sein Blick weniger nach vorwärts auf das Durchbrechen zu einer neuen Form der wirklichen Geistwelt gerichtet war, als nach rückwärts, auf den Schatten einer durch den Materialismus zerschlagenen Geistigkeit. Dennoch zog mich der «Homunculus» an. Zeigte er nicht, wie man in die geistige Welt eindringt, so stellte er doch dar, wohin
man kommt, wenn man sich allein in einer geistlosen bewegen will.
Die Beschäftigung mit dem «Homunculus» fiel für mich in eine Zeit, in der ich dem Wesen des künstlerischen Schaffens und der Schönheit nachsann. Was mir damals durch die Seele zog, hat seinen Niederschlag in der kleinen Schrift «Goethe als Vater einer neuen Ästhetik» gefunden, die einen Vortrag wiedergibt, den ich im Wiener Goethe-Verein gehalten habe. Ich wollte die Ursachen finden, warum der Idealismus einer mutigen Philosophie, die in Fichte und Hegel so eindringlich gesprochen hatte, doch nicht bis zum lebendigen Geiste hat vordringen können. Von den Wegen, die ich ging, um diese Ursachen zu finden, war einer das Nachsinnen über die Irrtümer der bloß idealistischen Philosophie auf ästhetischem Gebiete. Hegel und die, die ähnlich wie er dachten, fanden den Inhalt der Kunst in dem sinnlichen Erscheinen der «Idee». Wenn die «Idee» im sinnlichen Stoffe erscheint, so offenbart sie sich als das Schöne. Dies war ihre Ansicht. Aber die auf diesen Idealismus folgende Zeit wollte ein Wesenhaftes der «Idee» nicht mehr anerkennen. Weil die Idee der idealistischen Weltanschauung, so wie sie im Bewußtsein der Idealisten lebte, nicht auf eine Geistwelt hinwies, konnte sie sich bei den Nachfolgern nicht als etwas behaupten, das Wirklichkeitswert hatte. Und so entstand die «realistische» Ästhetik, die nicht auf das Scheinen der Idee im sinnlichen Bilde beim Kunstwerk hinsah, sondern nur auf das sinnliche Bild, das aus den Bedürfnissen der Menschennatur heraus im Kunstwerk eine unwirkliche Form annimmt.
Ich wollte im Kunstwerk als das Wesentliche dasjenige ansehen, was den Sinnen erscheint. Aber mir zeigte sich der Weg, den der wahre Künstler in seinem Schaffen geht, als ein Weg zum wirklichen Geiste. Er geht aus von dem, was sinnlich wahrnehmbar ist; aber er gestaltet dieses um. Bei dieser Umgestaltung läßt er sich nicht von einem bloß subjektiven Drang leiten, sondern er sucht dem sinnlich Erscheinenden eine Form zu geben, die es so zeigt, als ob das Geistige selbst da stehe. Nicht die Erscheinung der Idee in der Sinnenform ist das Schöne, so sagte ich mir, sondern die Darstellung des Sinnlichen in der Form des Geistes. So erblickte ich in dem Dasein der Kunst ein Hereinstellen der Geist-Welt in die sinnliche. Der wahre Künstler bekennt sich mehr oder weniger unbewußt zum Geiste. Und es bedarf nur - so sagte ich mir damals immer wieder - der Umwandlung derjenigen Seelenkräfte, die im Künstler an dem sinnlichen Stoffe wirken, zu einem sinnenfreien, rein geistigen Anschauen, um in die Erkenntnis der geistigen Welt einzudringen.
Es gliederten sich mir dazumal die wahre Erkenntnis, die Erscheinung des Geistigen in der Kunst und das sittliche Wollen im Menschen zu einem Ganzen zusammen. In der menschlichen Persönlichkeit mußte ich einen Mittelpunkt sehen, in dem diese ganz unmittelbar mit dem ursprünglichsten Wesen der Welt zusammenhängt. Aus diesem Mittelpunkt heraus quillt das Wollen. Und wirkt in dem Mittelpunkt das klare Licht des Geistes, so wird das Wollen frei. Der Mensch handelt dann in Übereinstimmung mit der Geistigkeit der Welt, die nicht aus einer Notwendigkeit, sondern nur in der Verwirklichung
des eigenen Wesens schöpferisch wird. In diesem Mittelpunkte des Menschen werden nicht aus dunklen Antrieben heraus, sondern aus «moralischen Intuitionen» Tatenziele geboren, aus Intuitionen, die in sich so durchsichtig sind wie die durchsichtigsten Gedanken. So wollte ich durch das Anschauen des freien Wollens den Geist finden, durch den der Mensch als Individualität in der Welt ist. Durch die Empfindung des wahren Schönen wollte ich den Geist schauen, der durch den Menschen wirkt, wenn er im Sinnlichen sich so betätigt, daß er sein eigenes Wesen nicht bloß geistig als freie Tat darstellt, sondern so, daß dieses sein Geisteswesen hinausfließt in die Welt, die zwar aus dem Geiste ist, aber diesen nicht unmittelbar offenbart. Durch die Anschauung des Wahren wollte ich den Geist erleben, der sich in seinem eigenen Wesen offenbart, dessen geistiger Abglanz die sittliche Tat ist, und zu dem das künstlerische Schaffen durch das Gestalten einer sinnlichen Form hinstrebt.
Eine «Philosophie der Freiheit», eine Lebensansicht von der geistdurstenden, in Schönheit strebenden Sinneswelt, eine geistige Anschauung der lebendigen Wahrheitswelt schwebte vor meiner Seele.
Es war auch im Jahre 1888, als ich in das Haus des Wiener evangelischen Pfarrers Alfred Formey eingeführt wurde. Einmal in der Woche versammelte sich dott ein Kreis von Künstlern und Schriftstellern. Alfred Formey war selbst als Dichter aufgetreten. Fritz Lemmermayer charakterisierte ihn aus Freundesherzen heraus so: «Warmherzig, innig in der Naturempfindung, schwärmerisch, trunken fast im Glauben an Gott und Seligkeit, so dichtet Alfred Formey in weichen, brausenden Akkor-
den. Es ist, als ob sein Schritt nicht die harte Erde berührte, sondern als ob er hoch in den Wolken hindämmerte und träumte.» Und so war Alfred Formey auch als Mensch. Man fühlte sich recht erdentrückt, wenn man in dieses Pfarrhaus kam und zunächst nur der Hausherr und die Hausfrau da waren. Der Pfarrer war von kindlicher Frömmigkeit; aber die Frömmigkeit ging in seinem warmen Gemüte auf die selbstverständlichste Art in lyrische Stimmung über. Man war sogleich von einer Atmosphäre von Herzlichkeit umgeben, wenn Formey nur einige Worte gesprochen hatte. Die Hausfrau hatte den Bühnenberuf mit dem Pfarrhaus vertauscht. Kein Mensch konnte in der liebenswürdigen, die Gäste mit hinreißender Anmut bewirtenden Pfarrerin die frühere Schauspielerin entdecken. Den Pfarrer pflegte sie fast mütterlich; und mütterliche Pflege war fast jedes Wort, das man sie zu ihm sprechen hörte. In den beiden kontrastierte in einer entzückenden Art Anmut der Seele mit einer äußerst stattlichen Erscheinung. In die weltfremde Stimmung dieses Pfarrhauses brachten nun die Gäste «Welt» aus allen geistigen Windrichtungen hinein. Da erschien von Zeit zu Zeit die Witwe Friedrich Hebbels. Ihr Erscheinen bedeutete jedesmal ein Fest. Sie entfaltete im hohen Alter eine Kunst der Deklamation, die das Herz in seliges Entzücken versetzte und den Kunstsinn völlig gefangen nahm. Und wenn Christine Hebbel erzählte, dann war der ganze Raum von Seelenwärme durchdrungen. An diesen Formey-Abenden lernte ich auch die Schauspielerin Wilborn kennen. Eine interessante Persönlichkeit, mit glänzender Stimme als Deklamatorin. Lenaus «Drei Zigeuner» konnte man von ihr
immer wieder mit erneuter Freude hören. Es kam bald dazu, daß der Kreis, der sich bei Formey zusammengefunden hatte, sich auch ab und zu bei Frau Wilborn versammelte. Aber wie anders war es da. Weltfreudig, lebenslustig, humorbedürftig wurden da dieselben Menschen, die im Pfarrhause selbst noch ernst blieben, wenn der «Wiener Volksdichter» Friedrich Schlögl seine lustigen Sehnurren vorlas. Der hatte, zum Beispiel, als in Wien die Leichenverbrennung in einem engen Kreise eingeführt wurde, ein «Feuilleton» geschrieben. Da erzählte er, wie ein Mann, der seine Frau in einer etwas «derben» Art liebte, ihr bei jeder Gelegenheit, die ihm nicht paßte, zurief: «Alte, los di verbrenna!» Bei Formey machte man über eine solche Sache Bemerkungen, die eine Art kulturgeschichtlichen Kapitels über Wien waren; bei Wilborn lachte man, daß die Stühle klapperten. Formey sah bei der Wilborn wie ein Weltmann aus; die Wilborn bei Formey wie eine Äbtissin. Man konnte die eingehendsten Studien über die Verwandlung der Menschen bis in den Gesichtsausdruck hinein machen.
Bei Formey verkehrte auch Emilie Mataja, die unter dem Namen Emil Marriot ihre von eindringlicher Lebensbeobachtung getragenen Romane schrieb. Eine faszinierende Persönlichkeit, die in ihrer Lebensart die Härten des Menschendaseins anschaulich, genial, oft aufreizend offenbarte. Eine Künstlerin, die das Leben darzustellen versteht, wo es seine Rätsel in den Alltag hineinwirft, wo es seine Schicksalstragik zermalmend über Menschen hinwirft.
Da waren auch öfters die vier Damen des österreichischen Damenquartetts Tschempas zu hören; da rezitierte
Fritz Lemmermayer melodramatisch zu Alfred Stroß' feurigem Klavierspiel wiederholt Hebbels «Heideknaben».
Ich liebte dieses Pfarrhaus, in dem man soviel Wärme finden konnte. Es war da edelstes Menschentum wirksam.
In derselben Zeit fand es sich, daß ich mich in eingehender Art mit den öffentlichen Angelegenheiten Österreichs beschäftigen mußte. Denn mir wurde 1888 für kurze Zeit die Redaktion der «Deutschen Wochenschrift» übertragen. Diese Zeitschrift war von dem Historiker Heinrich Friedjung begründet worden. Meine kurze Redaktion fiel in die Zeit, in der die Auseinandersetzung der Völker Österreichs einen besonders heftigen Charakter angenommen hatte. Es wurde mir nicht leicht, jede Woche einen Artikel über die öffentlichen Vorgänge zu schreiben. Denn im Grunde stand ich aller parteimäßigen Lebensauffassung so fern als nur möglich. Mich interessierte der Entwickelungsgang der Kultur im Menschheitsfortschritt. Und ich mußte den sich daraus ergebenden Gesichtspunkt so einnehmen, daß unter seiner vollen Wahrung meine Artikel doch nicht als die eines «weltfremden Idealisten» erschienen. Dazu kam, daß ich in der damals in Österreich besonders durch den Minister Gautsch eingeleiteten «Unterrichtsreform» eine Schädigung der Kulturinteressen sah. Auf diesem Gebiete wurden meine Bemerkungen einmal sogar Schröer, der immerhin für parteiliche Betrachtung viel Sympathie hatte, bedenklich. Ich lobte die sachgemäßen Einrichtungen, die der katholisch-klerikale Minister Leo Thun schon in den fünfziger Jahren für die österreichischen Gymnasien getroffen hatte, gegenüber den unpädagogi-
schen Maßnahmen von Gautsch. Als Schröer meinen Artikel gelesen hatte, sagte er: Wollen Sie denn wieder eine klerikale Unterrichtspolitik in Österreich?
Für mich war diese kurze Redaktionstätigkeit doch von großer Bedeutung. Sie lenkte meine Aufmerksamkeit auf den Stil, mit dem man damals in Österreich die öffentlichen Angelegenheiten behandelte. Mir war dieser Stil tief unsympathisch. Ich wollte auch in die Besprechungen über diese Angelegenheiten etwas hineinbringen, das einen die großen geistigen und menschheitlichen Ziele in sich schließenden Zug hatte. Diesen vermißte ich in der damaligen Tagesschriftstellerei. Wie dieser Zug zur Wirksamkeit zu bringen sei, das war damals meine tägliche Sorge. Und Sorge mußte es sein, denn ich hatte nicht die Kraft, die eine reiche Lebenserfahrung auf diesem Gebiete hätte geben können. Ich war im Grunde ganz unvorbereitet in diese Redaktionstätigkeit hineingekommen. Ich glaubte zu sehen, wohin auf den verschiedensten Gebieten zu steuern war; aber ich hatte die Formulierungen nicht in den Gliedern, die den Lesern der Zeitungen einleuchtend sein konnten. So war denn das Zustandekommen jeder Wochennusnmer für mich ein schweres Ringen.
Und so fühlte ich mich denn wie von einer großen Last befreit, als diese Tätigkeit dadurch ein Ende fand, daß der damalige Besitzer der Wochenschrift mit dem Begründer derselben in einen Streit über den Kaufschilling verwickelt wurde.
Doch brachte mich diese Tätigkeit in eine ziemlich enge Beziehung zu Persönlichkeiten, deren Tätigkeit auf die mannigfaltigsten Zweige des öffentlichen Lebens ge-
richtet war. Ich lernte Viktor Adler kennen, der damals der unbestrittene Führer der Sozialisten in Österreich war. In dem schmächtigen, anspruchslosen Mann steckte ein energischer Wille. Wenn er am Kaffeetisch sprach, hatte ich stets das Gefühl: der Inhalt dessen, was er sagte, sei unbedeutend, alltäglich, aber so spricht ein Wille, der durch nichts zu beugen ist. Ich lernte Pernerstorfer kennen, der sich in der Umwandlung vom deutschnationalen zum sozialistischen Parteigänger befand. Eine starke Persönlichkeit von umfassendem Wissen. Ein scharfer Kritiker der Schäden des öffentlichen Lebens. Er gab damals eine Monatsschrift «Deutsche Worte» heraus. Die war mir eine anregende Lektüre. In der Gesellschaft dieser Persönlichkeiten traf ich andere, die wissenschaftlich oder parteigemäß den Sozialismus zur Geltung bringen wollten. Durch sie wurde ich veranlaßt, mich mit Karl Marx, Friedrich Engels, Rodbertus und anderen sozial-ökonomischen Schriftstellern zu befassen. Ich konnte zu alledem ein inneres Verhältnis nicht gewinnen. Es war mir persönlich schmerzlich, davon sprechen zu hören, daß die materiell-ökonomischen Kräfte in der Geschichte der Menschheit die eigentliche Entwickelung tragen und das Geistige nur ein ideeller Überbau dieses «wahrhaft realen» Unterbaues sein sollte. Ich kannte die Wirklichkeit des Geistigen. Es waren die Behauptungen der theoretisierenden Sozialisten für mich das Augen-Verschließen vor der wahren Wirklichkeit.
Und dabei ward mir doch klar, daß die «soziale Frage» selbst eine unbegrenzte Bedeutung habe. Es erschien mir aber als die Tragik der Zeit, daß sie behandelt wurde von Persönlichkeiten, die ganz von dem Materialismus der
zeitgenössischen Zivilisation ergriffen waren. Ich hielt dafür, daß gerade diese Frage nur von einer geistgemäßen Weltauffassung richtig gestellt werden könne.
So war ich denn als Siebenundzwanzigjähriger voller «Fragen» und «Rätsel» in bezug auf das äußere Leben der Menschheit, während sich mir das Wesen der Seele und deren Beziehung zur geistigen Welt in einer in sich geschlossenen Anschauung in immer bestimmteren Formen vor das Innere gestellt hatte. Ich konnte zunächst nur aus dieser Anschauung heraus geistig arbeiten. Und diese Arbeit nahm immer mehr die Richtung, die dann einige Jahre später mich zur Abfassung meiner «Philosophie der Freiheit» geführt hat.
IX.
In diese Zeit (1889) fällt meine erste Reise nach Deutschland. Sie ist veranlaßt worden durch die Ein-ladung zur Mitarbeiterschaft an der Weimarer Goethe-Ausgabe, die im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen durch das Goethe-Archiv besorgt wurde. Einige Jahre vorher war Goethes Enkel, Walter von Goethe, gestorben; er hatte Goethes handschriftlichen Nachlaß der Großherzogin als Erbe übermacht. Diese hatte damit das Goethe-Archiv begründet und im Verein mit einer Anzahl von Goethe-Kennern, an deren Spitze Herman Grimm, Gustav von Loeper und Wilhelm Scherer standen, beschlossen, eine Goethe-Ausgabe zu veranstalten, in der das von Goethe Bekannte mit dem noch unveröffentlichten Nachlaß vereinigt werden sollte.
Meine Veröffentlichungen zur Goethe-Literatur waren die Veranlassung, daß ich aufgefordert wurde, einen Teil der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes für diese Ausgabe zu bearbeiten. Um mich in dem naturwissenschaftlichen Nachlaß zu orientieren und die ersten Schritte zu meiner Arbeit zu machen, wurde ich nach Weimar gerufen.
Mein durch einige Wochen dauernder Aufenthalt in der Goethe-Stadt war für mich eine Festeszeit meines Lebens. Ich hatte jahrelang in Goethes Gedanken gelebt; jetzt durfte ich selber an den Stätten sein, an denen diese Gedanken entstanden sind. Unter dem erhebenden Eindrucke dieses Gefühles verbrachte ich diese Wochen.
Ich durfte nun Tag für Tag die Papiere vor Augen haben, auf denen Ergänzungen zu dem standen, was ich
vorher für die Goethe-Ausgabe der Kürschner'schen «National-Literatur» bearbeitet hatte.
Die Arbeit an dieser Ausgabe hat in meiner Seele ein Bild von Goethes Weltanschauung ergeben. Jetzt handelte es sich darum, zu erkennen, wie dieses Bild bestehen kann im Hinblick darauf, daß sich vorher nicht Veröffentlichtes über Naturwissenschaft im Nachlasse vorfand. Mit großer Spannung arbeitete ich mich in diesen Teil des Goethe-Nachlasses hinein.
Ich glaubte bald zu erkennen, daß das noch Unveröffentlichte einen wichtigen Beitrag lieferte, um namentlich Goethes Erkenntnisart genauer zu durchschauen.
Ich hatte in meinen bis dahin veröffentlichten Schriften diese Erkenntnisart so aufgefaßt, daß Goethe in der Anschauung lebte, der Mensch stehe zunächst mit seinem gewöhnlichen Bewußtsein dem wahren Wesen der ihn umgebenden Welt ferne. Und aus diesem Ferne-Stehen sproßt der Trieb auf, vor dem Erkennen der Welt erst Erkenntniskräfte in der Seele zu entwickeln, die im gewöhnlichen Bewußtsein nicht vorhanden sind.
Von diesem Gesichtspunkte aus war es bedeutungsvoll für mich, wenn aus Goethes Papieren mir Ausführungen wie die folgenden entgegentraten:
«Um uns in diesen verschiedenen Arten einigermaßen zu orientieren (Goethe meint die verschiedenen Arten des Wissens im Menschen und seines Verhältnisses zur Außenwelt), wollen wir sie einteilen in: Nutzende, Wissende, Anschauende und Umfassende.
1. Die Nutzenden, Nutzensuchenden, Fordernden sind die ersten, die das Feld der Wissenschaft gleichsam umreißen, das Praktische ergreifen. Das Bewußtsein durch
Erfahrung gibt ihnen Sicherheit, das Bedürfnis eine gewisse Breite.
2. Die Wißbegierigen bedürfen eines ruhigen, uneigennützigen Blickes, einer neugierigen Unruhe, eines klaren Verstandes und stehen immer im Verhältnis mit jenen; sie verarbeiten auch nur im wissenschaftlichen Sinne dasjenige, was sie vorfinden.
3. Die Anschauenden verhalten sich schon produktiv, und das Wissen, indem es sich selbst steigert, fordert, ohne es zu bemerken, das Anschauen und geht dahin über, und so sehr sich auch die Wissenden vor der Imagination kreuzigen und segnen, so müssen sie doch, ehe sie sich versehen, die produktive Einbildungskraft zu Hilfe rufen.
4. Die Umfassenden, die man in einem stolzen Sinne die Erschaffenden nennen könnte, verhalten sich im höchsten Sinne produktiv, indem sie nämlich von Ideen ausgehen, sprechen sie die Einheit des Ganzen schon aus, und es ist gewissermaßen nachher die Sache der Natur, sich in diese Idee zu fügen.»
Klar wird aus solchen Bemerkungen: Goethe ist der Ansicht, der Mensch steht mit der gewöhniichen Bewußtseinsform außerhalb des Wesens der Außenwelt. Er muß zu einer andern Bewußtseinsform übergehen, wenn er mit diesem Wesen sich erkennend vereinigen will. Mir war während meines Weimarer Aufenthaltes die Frage immer entschiedener aufgetaucht: wie soll man auf den Erkenntnisgrundlagen, die Goethe gelegt hat, weiter-bauen, um von seiner Anschauungsart aus denkend zu derjenigen hinüberzuleiten, die geistige Erfahrung, wie sie sich mir ergeben hatte, in sich aufnehmen kann?
Goethe ging von dem aus, was die niederen Stufen des Erkennens, die der «Nutzenden» und der «Wißbegierigen» erreichen. Dem ließ er in seiner Seele entgegenleuchten das, was in den «Anschauenden» und «Umfassenden» dem Inhalt der niedern Erkenntnisstufe durch produktive Seelenkräfte entgegenleuchten kann. Wenn er so mit dem niederen Wissen in der Seele in dem Lichte des höheren Anschauens und Umfassens stand, so fühlte er sich mit dem Wesen der Dinge vereinigt.
Das erkennende Erleben im Geiste ist damit allerdings noch nicht gegeben; aber der Weg dazu ist von der einen Seite her vorgezeichnet, von derjenigen, die sich aus dem Verhältnis des Menschen zur Außenwelt ergibt. Vor meiner Seele stand, daß erst im Erfassen der anderen Seite, die sich aus dem Verhältnis des Menschen zu sich selbst ergibt, Befriedigung kommen könne.
Wenn das Bewußtsein produktiv wird, also von sich aus zu den nächsten Bildern der Wirklichkeit etwas hinzubringt: kann es da noch in einer Wirklichkeit bleiben, oder entschwebt es dieser, um in dem Unwirklichen sich zu verlieren? Was in dem vom Bewußtsein «Produzierten » diesem gegenübersteht, das mußte durchschaut werden. Eine Verständigung des menschlichen Bewußtseins mit sich selbst müsse zuerst bewirkt werden; dann könne man die Rechtfertigung des rein geistig Erlebten finden. Solche Wege nahmen meine Gedanken, ihre früheren Formen deutlicher wiederholend, als ich über Goethes Papieren in Weimar saß.
Es war Sommer. Von dem damals gegenwärtigen Kunstleben Weimars war wenig zu bemerken. Man konnte sich in voller Ruhe dem Künstlerischen hingeben,
das wie ein Denkmal für Goethes Wirken dastand. Man lebte nicht in der Gegenwart; man war entrückt in die Goethe-Zeit. Gegenwärtig war ja dazumal in Weimar die Liszt-Zeit. Aber die Vertreter dieser waren nicht da.
Die Zeiten nach den Arbeiten wurden mit den Persönlichkeiten, die im Archiv arbeiteten, verlebt. Dazu kamen die Mitarbeiter, die von auswärts für kürzere oder längere Zeit das Archiv besuchten. Ich ward mit außerordentlicher Liebenswürdigkeit von Bernhard Suphan aufgenommen, dem Direktor des Goethe-Archivs, und ich fand in Julius Wahle, einem ständigen Mitarbeiter des Archivs, einen lieben Freund. Doch alles das nahm erst bestimmtere Formen an, als ich nach einem Jahr für längere Zeit wieder in das Archiv eintrat; und es wird dann erzählt werden müssen, wenn diese Zeit meines Lebens darzustellen ist.
Meine Sehnsucht ging nun vor allem darauf, Eduard von Hartmann, mit dem ich seit Jahren in brieflichem Verkehre über Philosophische Dinge stand, persönlich kennen zu lernen. Das sollte während eines kurzen Aufenthaltes in Berlin, der sich an den Weimarischen anschloß, geschehen.
Ich durfte ein langes Gespräch mit dem Philosophen führen. Er lag mit aufgerichtetem Oberkörper, die Beine ausgestreckt, auf einem Sopha. In dieser Lage verbrachte er, seit sich sein Knieleiden eingestellt hatte, den weitaus größten Teil seines Lebens. Eine Stirne, die ein deutlicher Ausdruck eines klaren, scharfen Verstandes war, und Augen, die in ihrer Haltung die innerlichst gefühlte Sicherheit im Erkannten offenbarten, standen vor meinem Blicke. Ein mächtiger Bart umrahmte das Antlitz.
Er sprach mit einer vollen Bestimmtheit, die andeutete, wie er einige grundlegende Gedanken über das ganze Weltbild geworfen hatte, und dieses dadurch in seiner Art beleuchtete. In diesen Gedanken wurde alles sogleich mit Kritik überzogen, was an ihn von andern Anschauungen herankam. So saß ich ihm denn gegenüber, indem er mich scharf beurteilte, aber eigentlich mich innerlich doch nicht anhörte. Für ihn lag das Wesen der Dinge im Unbewußten und muß für das menschliche Bewußtsein immer dort verbergen bleiben; für mich war das Unbewußte etwas, das durch die Anstrengungen des Seelenlebens immer mehr in das Bewußtsein heraufgehoben werden kann. Ich kam im Verlauf des Gespräches darauf, zu sagen: man dürfe doch in der Vorstellung nicht von vorneherein etwas sehen, das vom Wirklichen abgesondert nur ein Unwirkliches im Bewußtsein darstelle. Es könne eine solche Ansicht doch nicht der Ausgangspunkt einer Erkenntnistheorie sein. Denn durch dieselbe versperre man sich den Zugang zu aller Wirklichkeit, indem man dann doch nur glauben könne, man lebe in Vorstellungen, und könne sich einem Wirklichen nur in Vorstellungshypothesen, das heißt auf unwirkliche Art nähern. Man müsse vielmehr erst prüfen, ob die Ansicht von der Vorstellung als eines Unwirklichen Geltung habe, oder ob sie nur einem Vorurteil entspringe. Eduard von Hartmann erwiderte: darüber ließe sich doch nicht streiten; es läge doch schon in der Wort-Erklärung der «Vorstellung», daß in ihr nichts Reales gegeben sei. Als ich diese Erwiderung vernahm, bekam ich ein seelisches Frösteln. «Wort-Erklärungen» der ernsthafte Ausgangspunkt von Lebensanschauungen! Ich fühlte, wie weit ich
weg war von der zeitgenössischen Philosophie. Wenn ich auf der Weiterreise im Eisenbahnwagen saß, meinen Gedanken und den Erinnerungen an den mir doch so wertvollen Besuch hingegeben, so wiederholte sich das seelische Frösteln. Es war etwas, das in mir lange nachwirkte.
Mit Ausnahme des Besuches bei Eduard von Hartmann waren die kurzen Aufenthalte, die ich im Anschlusse an denjenigen in Weimar auf meiner Reise durch Deutschland in Berlin und München nehmen konnte, ganz dem Leben in dem Künstlerischen gewidmet, das diese Orte bieten. Die Ausdehnung meines Anschauungskreises nach dieser Richtung empfand ich damals als eine besondere Bereicherung meines Seelenlebens. Und so ist diese erste größere Reise, die ich machen konnte, auch für meine Kunstanschauungen von einer weitgehenden Bedeutung gewesen. Eine Fülle von Eindrücken lebte in mir, als ich zunächst nach dieser Reise wieder für einige Wochen im Salzkammergute bei der Familie lebte, deren Söhne ich schon seit vielen Jahren unterrichtete. Ich war auch weiter darauf angewiesen, eine äußere Beschäftigung im Privatunterrichte zu finden. Und ich wurde in demselben auch innerlich gehalten, weil ich den Knaben, dessen Erziehung mir vor Jahren anvertraut war, und bei dem es mir gelungen war, die Seele aus einem völlig schlummernden Zustande zum Wachen zu bringen, bis zu einem gewissen Punkte seiner Lebensentwickelung bringen wollte.
In der nächsten Zeit, nach der Rückkehr nach Wien, durfte ich viel in einem Kreise von Menschen verkehren, der von einer Frau zusammengehalten wurde, deren mystisch-theosophische Seelenverfassung auf alle Teil-
nehmer des Kreises einen tiefen Eindruck machte. Mir waren die Stunden die ich in dem Hause dieser Frau, Marie Lang damals verleben durfte, in hohem Maße wertvoll. Ein ernster Zug der Lebensauffassung, und Lebensempfindung lebte bei Marie Lang sich in einer edel-schönen Art dar. In einer klangvoll-eindringlichen Sprache kamen ihre tiefen Seelenerlebnisse zum Ausdrucke. Ein innerlich mit sich und der Welt schwer ringendes Leben konnte in ihr nur im mystischen Suchen eine wenn auch nicht völlige Befriedigung finden. So war sie zur Seele eines Kreises von suchenden Menschen wie geschaffen In diesen Kreis war die Theosophie gedrungen, die von H. P. Blavatsky am Ende des vorigen Jahrhunderts ausgegangen war. Franz Hartmann, der durch seine zahlreichen theosophischen Werke und durch seine Beziehungen zu H. P. Blavatsky in weiten Kreisen berühmt geworden ist, hat auch in diesen Kreis seine Theosophie hineingebracht. Marie Lang hatte manches von dieser Theosophie aufgenommen. Die Gedankeninhalte, die sie da finden konnte, schienen in mancher Beziehung dem Zuge ihrer Seele entgegenzukommen. Doch war, was sie von dieser Seite annahm, ihr nur äußerlich angeflogen. Sie trug aber ein mystisches Gut in sich, das auf ganz elementarische Art sich aus einem durch das Leben geprüften Herzen in das Bewußtsein gehoben hatte.
Die Architekten, Literaten und sonstigen Persönlichkeiten, die ich in dem Hause von Marie Lang traf, hätten sich wohl kaum für die Theosophie, die von Franz Hartmann vermittelt wurde, interessiert, wenn nicht Marie Lang einigen Anteil an ihr genommen hätte. Und am wenigsten hätte ich mich selbst dafür interessiert. Denn
die Art, sich zur geistigen Welt zu verhalten, die sich in den Schriften Franz Hartmanns darlebte, war meiner Geistesrichtung völlig entgegengesetzt. Ich konnte ihr nicht zugestehen, daß sie von wirklicher innerer Wahrheit getragen ist. Mich beschäftigte weniger ihr Inhalt, als die Art, wie sie auf Menschen wirkte, die doch wahrhaft Suchende waren.
Durch Marie Lang wurde ich bekannt mit Frau Rosa Mayreder, die mit ihr befreundet war. Rosa Mayreder gehört zu denjenigen Persönlichkeiten, zu denen ich in meinem Leben die größte Verehrung gefaßt und an deren Entwickelungsgang ich den größten Anteil genommen habe. Ich kann mir ganz gut denken, daß, was ich hier zu sagen habe, sie selbst wenig befriedigen werde; allein ich empfinde, was durch sie in mein Leben getreten ist, in solcher Art. Von den Schriften Rosa Mayreders, die nachher auf viele Menschen einen so berechtigt großen Eindruck gemacht haben, und die sie ganz zweifellos an einen ganz hervorragenden Platz in der Literatur stellen, war damals noch nichts erschienen. Aber, was sich in diesen Schriften offenbart, lebte in Rosa Mayreder in einer geistigen Ausdrucksform, zu der ich mich mit der allerstärksten inneren Sympathie wenden mußte. Diese Frau machte auf mich den Eindruck, als habe sie jede der einzelnen menschlichen Seelengaben in einem solchen Maße, daß diese in ihrem harmonischen Zusammenwirken den rechten Ausdruck des Menschlichen formten. Sie vereinigt verschiedene Künstlergaben mit einem freien, eindringlichen Beobachtungssinn. Ihre Malerei ist ebenso getragen von individueller Lebensentfaltung wie von hingebender Vertiefung in die objektive Welt
Die Erzählungen, mit denen sie ihre schriftstellerische Laufbahn begann, sind vollendete Harmonien, die aus persönlichem Ringen und ganz objektiv Betrachtetem zusammenklingen. Ihre folgenden Werke tragen immer mehr diesen Charakter. Am deutlichsten tritt das in ihrem später erschienenen zweibändigen Werke «Kritik der Weiblichkeit» zu Tage. Ich betrachte es als einen schönen Gewinn meines Lebens, manche Stunde in der Zeit, die ich hier schildere, mit Rosa Mayreder in den Jahren ihres Suchens und seelischen Ringens verbracht zu haben.
Ich muß auch da wieder auf eines meiner Verhältnisse zu Menschen blicken, die über die Gedanken-Inhalte hinüber und in einem gewissen Sinne ganz unabhängig von diesen entstanden sind und intensives Leben gewannen. Denn meine Weltanschauung und noch mehr meine Empfindungstichtung waren nicht diejenigen Rosa Mayreders. Die Art, wie ich aus der gegenwärtig anerkannten Wissenschaftlichkeit zum Erleben des Geistigen aufsteige, kann ihr unmöglich sympathisch sein. Sie sucht diese Wissenschaftlichkeit zur Begründung von Ideen zu verwenden, die auf die volle Ausgestaltung der menschlichen Persönlichkeit zielen, ohne daß sie in diese Persönlichkeit die Erkenntnis einer rein geistigen Welt hereinspielen läßt. Was mir nach dieser Richtung eine Notwendigkeit ist, kann ihr kaum etwas sagen. Sie ist ganz hingegeben an die Forderungen der unmittelbaren menschlichen Individualität und wendet den in dieser Individualität wirkenden geistigen Kräften nicht ihre Aufmerksamkeit zu. Sie hat es durch diese ihre Art zu der bisher bedeutsamsten Darstellung des Wesens der Weiblichkeit und deren Lebensforderungen gebracht.
Ich konnte Rosa Mayreder auch nie befriedigen durch die Anschauung, die sie sich von meinem Verhältnis zur Kunst bildete. Sie meinte: ich verkenne das eigentlich Künstlerische, während ich doch gerade danach rang, dieses spezifisch Künstlerische mit der Anschauung zu erfassen, die sich mir durch das Erleben des Geistigen in der Seele ergab. Sie hielt dafür, daß ich in die Offenbarungen der Sinneswelt nicht genug eindringen und dadurch an das wirklich Künstlerische nicht herankommen könne, während ich darnach suchte, gerade in die volle Wahrheit der sinnengemäßen Formen einzudringen. - Das alles hat nichts weggenommen von dem innigen freundschaftlichen Anteil, den ich an dieser Persönlichkeit in mir entwickelte in der Zeit, als ich ihr wertvollste Stunden meines Lebens verdankte, und der sich bis zum heutigen Tage wahrhaftig nicht vermindert hat.
Im Hause Rosa Mayreders durfte ich des öfteren teilnehmen an den Unterhaltungen, zu denen sich da geistvolle Menschen versammelten. Still, scheinbar mehr in sich schauend als auf die Umgebung hörend, saß da Hugo Wolf, mit dem Rosa Mayreder eng befreundet war. Man hörte in der Seele auf ihn, auch wenn er noch so wenig sprach. Denn, was er lebte, teilte sich auf geheimnisvolle Art denen mit, die mit ihm zusammen sein konnten. - In inniger Liebe war ich zugetan dem Gatten von Frau Rosa, dem menschlich und künstlerisch so feinen Karl Mayreder und auch dessen künstlerisch enthusiastischem Bruder Julius Mayreder. Marie Lang und ihr Kreis, Friedrich Eckstein, der damals ganz in theosophischer Geistesströmung und Weltauffassung stand, waren oft da.
Es war dies die Zeit, in der in meiner Seele sich meine «Philosophie der Freiheit» in immer bestimmteren Formen ausgestaltete. Rosa Mayreder ist die Persönlichkeit, mit der ich über diese Formen am meisten in der Zeit des Entstehens meines Buches gesprochen habe. Sie hat einen Teil der innerlichen Einsamkeit, in der ich gelebt habe, von mir hinweggenommen. Sie strebte nach der Anschauung der unmittelbaren menschlichen Persönlichkeit, ich nach der Weltoffenbarung, welche diese Persönlichkeit auf dem Grunde der Seele durch das sich öffnende Geistesauge suchen kann. Zwischen beiden gab es manche Brücke. Und oft hat im weiteren Leben in dankbarster Erinnerung vor meinem Geiste das eine oder das andere Bild der Erlebnisse gestanden von der Art wie ein Gang durch die herrlichen Alpenwälder, auf dem Rosa Mayreder und ich über den wahren Sinn der menschlichen Freiheit sprachen.
X.
Wenn ich auf meinen Lebensgang zurückblicke, so stellen sich mir die drei ersten Lebensjahrzehnte als ein in sich abgeschlossener Abschnitt dar. Am Ende desselben übersiedelte ich nach Weimar, um da fast sieben Jahre am Goethe- und Schiller-Archiv zu arbeiten. Ich blicke auf die Zeit, die ich zwischen der geschilderten Weimarischen Reise und meiner Übersiedelung in die Goethe-Stadt noch in Wien verbrachte, als auf diejenige zurück, die in mir zu einem gewissen Abschlusse brachte, was meine Seele bis dahin erstrebt hatte. In dem Hinarbeiten auf meine «Philosophie der Freiheit» lebte dieser Abschluß.
Ein wesentlicher Teil im Umkreise der Ideen, durch die ich damals meine Anschauungen ausdrückte, war, daß mir die Sinneswelt nicht als wahre Wirklichkeit galt. Ich sprach mich in den Schriften und Aufsätzen, die ich damals veröffentlichte, stets so aus, daß die menschliche Seele in der Betätigung eines Denkens, das sie nicht aus der Sinneswelt schöpft, sondern in freier, über die Sinneswahrnehmung hinausgehender Tätigkeit entfaltet, als eine wahre Wirklichkeit erscheint. Dieses «sinnlichkeitsfreie» Denken stellte ich als dasjenige hin, mit dem die Seele in dem geistigen Wesen der Welt darinnen steht
Aber ich machte auch scharf geltend, daß der Mensch, indem er in diesem sinnlichkeitsfreien Denken lebt, auch wirklich sich bewußt in den geistigen Urgründen des Daseins befinde. Das Reden von Erkenntnisgrenzen hatte für mich keinen Sinn. Erkennen war mir das Wiederfinden der durch die Seele erlebten Geistes-Inhalte in der

wahrgenommenen Welt. Wenn jemand von Erkenntnisgrenzen sprach, so sah ich darinnen das Zugeständnis, daß er die wahre Wirklichkeit nicht geistig in sich erleben und sie deshalb auch in der wahrgenommenen Welt nicht wiederfinden könne.
Auf die Widerlegung der Anschauung von Erkenntnisgrenzen kam es mir beim Vorbringen meiner eigenen Einsichten in erster Linie an. Ich wollte den Erkenntnisweg ablehnen, der auf die Sinneswelt sieht und der dann nach außen durch die Sinneswelt zu einer wahren Wirklichkeit durchbrechen will. Ich wollte darauf hindeuten, daß nicht in einem solchen Durchbrechen nach außen, sondern in dem Untertauchen in das Innere des Menschen das wahre Wirkliche zu suchen sei. Wer nach außen durchbrechen will, und dann sieht, daß dies eine Unmöglichkeit ist, der spricht von Erkenntnisgrenzen. Es ist aber nicht deshalb eine Unmöglichkeit, weil das menschliche Erkenntnisvermögen begrenzt ist, sondern deshalb, weil man etwas sucht, von dem man bei gehöriger Selbstbesinnung gar nicht sprechen kann. Man sucht da gewissermaßen, indem man weiter in die Sinneswelt hineinstoßen will, eine Fortsetzung des Sinnlichen hinter dem Wahrgenommenen. Es ist, wie wenn der in Illusionen Lebende in weiteren Illusionen die Ursachen seiner Illusionen suchte.
Der Sinn meiner Darstellungen war damals dieser: Der Mensch tritt, indem er sich im Erdendasein von der Geburt an weiter entwickelt, der Welt erkennend gegenüber. Er gelangt zuerst zur sinnlichen Anschauung. Aber diese ist erst ein Vorposten des Erkennens. Es offenbart sich in dieser Anschauung noch nicht alles, was in der
Welt ist. Die Welt ist wesenhaft; aber der Mensch gelangt zuerst noch nicht zu diesem Wesenhaften. Er verschließt sich noch vor demselben. Er bildet sich, weil er sein eigenes Wesen noch nicht der Welt gegenüberstellt, ein Weltbild, das des Wesens entbehrt. Dieses Weltbild ist in Wahrheit eine Illusion. Sinnlich wahrnehmend steht der Mensch vor der Welt als einer Illusion. Wenn aber aus seinem Innern zu der sinnlichen Wahrnehmung das sinnlichkeitsfreie Denken nachrückt, dann durchtränkt sich die Illusion mit Wirklichkeit; dann hört sie auf, Illusion zu sein. Dann trifft der in seinem Innern sich erlebende Menschengeist auf den Geist der Welt, der für den Menschen nun nicht hinter der Sinneswelt verborgen ist, sondern in der Sinneswelt webt und West.
Den Geist in der Welt zu finden, sah ich damals nicht als eine Sache des logischen Schließens, oder der Fortsetzung des sinnlichen Wahrnehmens an; sondern als etwas, das sich ergibt, wenn der Mensch vom Wahrnehmen zum Erleben des sinnlichkeitsfreien Denkens sich fortentwickelt.
Von solchen Anschauungen durchdrungen ist, was ich im zweiten Bande meiner Ausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes 1888 schrieb: «Wer dem Denken seine über die Sinnesauffassung hinausgehende Wahrnehmungsfähigkeit zuerkennt, der muß ihm notgedrungen auch Objekte zuerkennen, die über die bloße sinnenfällige Wirklichkeit hinaus liegen. Diese Objekte des Denkens sind aber die Ideen. Indem sich das Denken der Idee bemächtigt, verschmilzt es mit dem Urgrunde des Weltdaseins; das, was außen wirkt, tritt in den Geist des Menschen ein: er wird mit der objektiven Wirklich-
keit auf ihrer höchsten Potenz eins. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. - Das Denken hat den Ideen gegenüber dieselbe Bedeutung wie das Auge dem Lichte, das Ohr dem Ton gegenüber. Es ist Organ der Auffassung.» (Vgl. Einleitung zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften in Kürschners Deutscher National-Literatur, 2. Bd., S.IV.)
Mir kam es damals weniger darauf an, die Welt des Geistigen so darzustellen, wie sie sich ergibt, wenn das sinnlichkeitsfreie Denken über das Sich-selbst-Erleben zur geistigen Anschauung fortschreitet, als vielmehr darauf, zu zeigen, daß das Wesen der in der sinnenfälligen Anschauung gegebenen Natur das Geistige ist. Ich wollte zum Ausdrucke bringen, daß die Natur in Wahrheit geistig ist.
Das lag darin begründet, daß mich mein Schicksal zu einer Auseinandersetzung mit den Erkenntnistheoretikern der damaligen Zeit geführt hat. Diese stellten sich als ihre Voraussetzung eine geistlose Natur vor und hatten demgemäß die Aufgabe, zu zeigen, inwiefern der Mensch berechtigt ist, sich in seinem Geiste ein geistiges Bild der Natur zu gestalten. Ich wollte dem eine ganz andere Erkenntnistheorie gegenüberstellen. Ich wollte zeigen, daß der Mensch denkend nicht Bilder über die Natur wie ein ihr Außenstehender formt, sondern daß Erkennen Erleben ist, so daß der Mensch erkennend in dem Wesen der Dinge steht.
Und weiter war es mein Schicksal, meine eigenen Anschauungen an Goethe anzuknüpfen. In dieser Anknüpfung hat man zwar viel Gelegenheit, zu zeigen, wie die
Natur geistig ist, weil Goethe selbst nach einer geistgemäßen Naturanschauung gestrebt hat; man hat aber nicht in ähnlicher Art Gelegenheit, über die rein geistige Welt als solche zu sprechen, weil Goethe die geistgemäße Naturanschauung nicht bis zur unmittelbaren Geistanschauung fortgeführt hat.
In zweiter Linie kam es mir damals darauf an, die Idee der Freiheit zum Ausdrucke zu bringen. Handelt der Mensch aus seinen Instinkten, Trieben, Leidenschaften usw., so ist er unfrei. Impulse, die ihm so bewußt werden wie die Eindrücke der Sinneswelt, bestimmen dann sein Handeln. Aber es handelt da auch nicht sein wahres Wesen. Er handelt auf einer Stufe, auf der sein wahres Wesen sich noch gar nicht offenbart. Er enthüllt sich als Mensch da ebensowenig, wie die Sinneswelt ihr Wesen für die bloß sinnenfällige Beobachtung enthüllt. Nun ist die Sinneswelt nicht in Wirklichkeit eine Illusion, sondern wird dazu nur von dem Menschen gemacht. Der Mensch in seinem Handeln kann aber die sinnlichkeitsähnlichen Triebe, Begierden usw. als Illusionen wirklich machen; er läßt dann an sich ein Illusionäres handeln; es ist nicht er selbst, der handelt. Er läßt das Ungeistige handeln. Sein Geistiges handelt erst, wenn er die Impulse seines Handelns in dem Gebiete seines sinnlichkeitfreien Denkens als moralische Intuitionen findet. Da handelt er selbst, nichts anderes. Da ist er ein freies, ein aus sich selbst handelndes Wesen.
Ich wollte darstellen, wie derjenige, der das sinnlichkeitfreie Denken als ein rein Geistiges im Menschen ablehnt, niemals zum Begreifen der Freiheit kommen könne; wie aber ein solches Begreifen sofort eintritt,
wenn man die Wirklichkeit des sinnlichkeitsfreien Denkens durchschaut.
Auch auf diesem Gebiete ging ich in jener Zeit weniger darauf aus, die rein geistige Welt darzustellen, in welcher der Mensch seine moralischen Intuitionen erlebt, als vielmehr darauf, den geistigen Charakter dieser Intuitionen selbst zu betonen. Wäre es mir auf das erstere angekommen, so hätte ich wohl das Kapitel «Die moralische Phantasie» in meiner «Philosophie der Freiheit» so beginnen müssen: «Der freie Geist handelt nach seinen Impulsen; das sind Intuitionen, die von ihm außerhalb des Naturdaseins in der rein geistigen Welt erlebt werden, ohne daß er sich im gewöhnlichen Bewußtsein dieser geistigen Welt bewußt wird.» Aber mir kam es damals darauf an, nur den rein geistigen Charakter der moralischen Intuitionen zu charakterisieren. Deshalb wies ich auf das Dasein dieser Intuitionen in der Gesamtheit der menschlichen Ideenwelt hin und sagte demgemäß: «Der freie Geist handelt nach seinen Impulsen, das sind Intuitionen, die aus dem Ganzen seiner Ideenwelt durch das Denken ausgewählt sind.» - Wer nicht auf eine rein geistige Welt hinblickt, wer also nicht auch den ersten Satz schreiben könnte, der kann auch zu dem zweiten sich nicht voll bekennen. Hindeutungen auf den ersten Satz sind aber in meiner «Philosophie der Freiheit» genügend zu finden; zum Beispiel: «Die höchste Stufe des individuellen Lebens ist das begriffliche Denken ohne Rücksicht auf einen bestimmten Wahrnehmungsgehalt. Wir bestimmen den Inhalt eines Begriffes durch reine Intuitionen aus der ideellen Sphäre heraus. Ein solcher Begriff enthält dann zunächst keinen Bezug auf bestimmte
Wahrnehmungen.» Es sind hier «sinnenfällige Wahrnehmungen» gemeint. Hätte ich damals über die geistige Welt, nicht bloß über den geistigen Charakter der moralischen Intuitionen schreiben wollen, so hätte ich den Gegensatz zwischen sinnlicher und geistiger Wahrnehmung berücksichtigen müssen. Mir kam es aber nur darauf an, den nicht-sinnlichen Charakter der moralischen Intuitionen zu betonen.
In dieser Richtung bewegte sich meine Ideenwelt, als mein erster Lebensabschnitt mit dem dritten Lebensjahrzehnt, mit dem Eintritt in meine Weimarer Zeit, zu Ende ging.
XI.
Am Ende dieses meines ersten Lebensabschnittes stellte sich in meinem Innern die Notwendigkeit ein, zu gewissen Orientierungen der Menschenseele ein deutlich sprechendes Verhältnis zu gewinnen. Eine dieser Orientierungen war die Mystik. So wie diese in den verschiedenen Epochen der geistigen Entwickelung der Menschheit, in der orientalischen Weisheit, im Neuplatonismus, im christlichen Mittelalter, in den kabbalistischen Bestrebungen, mir vor das Seelenauge trat, konnte ich, durch meine besondere Veranlagung, nur schwer ein Verhältnis zu ihr gewinnen.
Der Mystiker schien mir ein Mensch zu sein, der mit der Welt der Ideen, in der sich für mich das Geistige darlebte, nicht zurecht kommt. Ich empfand es als einen Mangel an wirklicher Geistigkeit, wenn man mit den Ideen, um zur seelischen Befriedigung zu gelangen, in das ideenlose Innere untertauchen will. Ich konnte darinnen keinen Weg zum Lichte, sondern eher einen solchen zur geistigen Finsternis sehen. Wie eine Ohnmacht im Erkennen erschien es mir, wenn die Seele die geistige Wirklichkeit, die in den Ideen zwar nicht selbst webt, die sich aber durch die Ideen vom Menschen erleben läßt, durch die Flucht vor den Ideen erreichen will.
Und dennoch zog mich auch etwas zu den mystischen Bestrebungen der Menschheit hin. Es ist die Art des inneren Erlebens der Mystiker. Sie wollen mit den Quellen des menschlichen Daseins im Innern zusammenleben, nicht bloß auf diese durch die ideengemäße Beobachtung als etwas Äußerliches schauen. Aber mir war auch klar,
daß man zu der gleichen Art des inneren Erlebens kommt, wenn man mit dem vollen, klaren Inhalt der Ideenwelt in die Untergründe der Seele sich versenkt, statt diesen Inhalt bei der Versenkung abzustreifen. Ich wollte das Licht der Ideenwelt in die Wärme des inneren Erlebens einführen. Der Mystiker kam mir vor wie ein Mensch, der den Geist in den Ideen nicht schauen kann, und der deshalb an den Ideen innerlich erfriert. Die Kälte, die er an den Ideen erlebt, zwingt ihn, die Wärme, deren die Seele bedarf, in der Befreiung von den Ideen zu suchen.
Mir ging die innere Wärme des seelischen Erlebens gerade dann auf, wenn ich das zunächst unbestimmte Erleben der geistigen Welt in bestimmte Ideen prägte. Ich sagte mir oft: wie verkennen doch diese Mystiker die Wärme, die Seelen-Intimität, die man empfindet, wenn man mit geistdurchtränkten Ideen zusammenlebt. Mir war dieses Zusammenleben stets wie ein persönlicher Umgang mit der geistigen Welt gewesen.
Der Mystiker schien mir die Stellung des materialistisch gesinnten Naturbetrachters zu verstärken, nicht abzuschwächen. Dieser lehnt eine Betrachtung der geistigen Welt ab, weil er eine solche entweder überhaupt nicht gelten läßt, oder weil er vermeint, daß die menschliche Erkenntnis nur für das Sinnlich-Anschaubare tauglich ist Er setzt der Erkenntnis dort Grenzen, wo solche die sinnliche Anschauung hat. Der gewöhnliche Mystiker ist in bezug auf die menschliche Ideen-Erkenntnis gleichen Sinnes mit dem Materialisten. Er behauptet, daß Ideen nicht an das Geistige heranreichen, daß man deshalb mit der Ideen-Erkenntnis stets außerhalb des Gei-
stigen bleiben müsse. Da er aber nun doch zum Geiste gelangen will, so wendet er sich an ein ideen-freies inneres Erleben. So gibt er dem materialistischen Naturbetrachter Recht, indem er das Ideen-Erkennen auf die Erkenntnis des bloß Natürlichen einschränkt.
Geht man aber in das seelische Innere, ohne die Ideen mitzunehmen, so gelangt man in die innere Region des bloßen Fühlens. Man spricht dann davon, daß das Geistige nicht auf einem Wege erreicht werden könne, den man im gewöhnlichen Leben einen Erkenntnisweg nennt. Man sagt, man müsse aus der Erkenntnissphäre in die der Gefühle untertauchen, um das Geistige zu erleben.
Mit einer solchen Anschauung kann sich der materialistische Naturbetrachter dann einverstanden erklären, wenn er nicht alles Reden vom Geiste als ein phantastisches Spiel mit Worten ansieht, die nichts Wirkliches bedeuten. Er sieht dann in seiner auf das Sinnenfällige gerichteten Ideenwelt die einzige berechtigte Erkenntnisgrundlage und in der mystischen Erziehung des Menschen zum Geiste etwas rein Persönliches, zu dem man neigt oder nicht neigt, je nachdem man veranlagt ist, von dem man aber jedenfalls nicht so sprechen dürfe wie von dem Inhalt einer «sicheren Erkenntnis». Man müsse eben das Verhältnis des Menschen zum Geistigen ganz dem «subjektiven Fühlen» überlassen.
Indem ich mir dieses vor das Seelenauge stellte, wurden die Kräfte in meiner Seele, die zur Mystik in innerer Opposition standen, immer stärker. Die Anschauung des Geistigen im inneren Seelen-Erlebnis war mir viel sicherer als diejenige des Sinnenfälligen; Erkenntnisgrenzen gegenüber diesem Seelen-Erlebnis zu setzen, war mir eine
Unmöglichkeit. Den bloßen Gefühlsweg zum Geistigen lehnte ich mit aller Entschiedenheit ab.
Und dennoch - wenn ich darauf blickte, wie der Mystiker erlebt, so empfand ich wieder ein entfernt Verwandtes mit meiner eigenen Stellung zur geistigen Welt. Ich suchte das Zusammensein mit dem Geiste durch die vom Geiste durchleuchteten Ideen auf dieselbe Art wie der Mystiker durch Zusammensein mit einem Ideenlosen. Ich konnte auch sagen: Meine Anschauung beruhe auf «mystischem» Ideen-Erleben.
Diesem Seelenkonflikt im eigenen Innern diejenige Klarheit zu schaffen, die schließlich über ihn erhebt, bestand keine große Schwierigkeit. Denn die wirkliche Anschauung des Geistigen wirft Licht auf den Geltungsbereich der Ideen, und sie weist dem Persönlichen seine Grenzen. Man weiß als Beobachter des Geistigen, wie im Menschen das Persönliche zu wirken aufhört, wenn das Wesen der Seele sich zum Anschauungsorgan der geistigen Welt umwandelt.
Die Schwierigkeit ergab sich aber dadurch, daß ich die Ausdrucksformen für meine Anschauungen in meinen Schriften zu finden hatte. Man kann ja nicht sogleich eine neue Ausdrucksform für eine Beobachtung finden, die den Lesern ungewohnt ist. Ich hatte die Wahl: was ich zu sagen für notwendig fand, entweder mehr in Formen zu bringen, die auf dem Felde der Naturbetrachtung gewohnheitsmäßig angewendet, oder in solche, die von mehr nach dem mystischen Empfinden neigenden Schriftstellern gebraucht werden. Durch das letztere schienen sich mir die sich ergebenden Schwierigkeiten nicht hinwegräumen zu lassen.
Ich kam zu der Meinung, daß die Ausdrucksformen auf dem Gebiete der Naturwissenschaft in inhaltsvollen Ideen bestanden, wenn auch zunächst der Inhalt ein materialistisch gedachter war. Ich wollte Ideen bilden, die in ähnlicher Art auf das Geistige deuten, wie die naturwissenschaftlichen auf das sinnlich Wahrnehmbare. Dadurch konnte ich den Ideen-Charakter für das beibehalten, was ich zu sagen hatte. Ein gleiches schien mir bei dem Gebrauch von mystischen Formen unmöglich. Denn diese weisen im Grunde nicht auf das Wesenhafte außer dem Menschen, sondern sie beschreiben nur die subjektiven Erlebnisse im Menschen. Ich wollte nicht menschliche Erlebnisse beschreiben, sondern zeigen, wie eine geistige Welt durch Geistorgane im Menschen sich offenbart.
Aus solchen Untergründen heraus bildeten sich die Ideengestalten, aus denen dann später meine «Philosophie der Freiheit» erwuchs. Ich wollte keine mystischen Anwandlungen in mir beim Bilden dieser Ideen walten lassen, trotzdem mir klar war, daß das letzte Erleben dessen, was in Ideen sich offenbaren sollte, von der gleichen Art im Innern der Seele sein mußte wie die innere Wahrnehmung des Mystikers. Aber es bestand doch der Unterschied, daß in meiner Darstellung der Mensch sich hingibt und die äußere Geistwelt in sich zur objektiven Erscheinung bringt, während der Mystiker das eigene Innenleben verstärkt und auf diese Art die wahre Gestalt des objektiven Geistigen auslöscht.
XII.
Die Zeit, die ich mit der Darstellung von Goethes naturwissenschaftlichen Ideen für die Einleitungen in «Kürschners Deutscher National-Literatur» brauchte, war eine lange. Ich begann damit im Beginne der achtziger Jahre und war noch nicht fertig, als ich in meinen zweiten Lebensabschnitt mit der Übersiedelung von Wien nach Weimar eintrat. In der geschilderten Schwierigkeit gegenüber der naturwissenschaftlichen und der mystischen Ausdrucksart liegt der Grund davon.
Während ich daran arbeitete, Goethes Stellung zur Naturwissenschaft in die rechte Ideengestaltung zu bringen, mußte ich auch im Formen dessen weiterkommen, was sich mir als geistige Erlebnisse in der Anschauung der Weltvorgänge vor die Seele gestellt hatte. So drängte es mich immer wieder von Goethe ab nach der Darstellung der eigenen Weltanschauung und zu ihm hin, um mit den gewonnenen Gedanken seine Gedanken besser zu interpretieren. Ich empfand vor allem als wesentlich bei Goethe seine Abneigung, sich mit irgendeinem theoretisch leicht überschaubaren Gedankengebilde gegenüber der Erkenntnis des unermeßlichen Reichtums der Wirklichkeit zu befriedigen. Goethe wird rationalistisch, wenn er die mannigfaltigen Formen der Pflanzen- und Tiergestalten darstellen will. Er strebt nach Ideen, die im Naturwerden wirksam sich erweisen, wenn er den geologischen Bau der Erde begreifen oder die Erscheinungen der Meteorologie erfassen will. Aber seine Ideen sind nicht abstrakte Gedanken, sondern auf gedankliche Art in der Seele lebende Bilder.
Wenn ich erfaßte, was er an solchen Bildern in seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten hingestellt hat, so hatte ich etwas vor mir, das mich im tiefsten meiner Seele befriedigte. Ich schaute auf einen Idee-Bilder-Inhalt, von dem ich glauben mußte, daß er - in weiterer Ausführung - eine wirkliche Spiegelung des Naturgeschehens im Menschengeiste darstellt. Ich war mir klar darüber, daß die herrschende naturwissenschaftliche Denkungsart zu dieser Goethe'schen erhoben werden müsse.
Zugleich lag aber in dieser Auffassung der Goetheschen Naturerkenntnis die Anforderung, das Wesen des Ideen-Bilder-Inhaltes im Verhältnis zur geistigen Wirklichkeit selbst darzustellen. Die Ideen-Bilder haben doch nur eine Berechtigung, wenn sie auf eine solche geistige Wirklichkeit, die der sinnenfälligen zugrunde liegt, hindeuten. - Aber Goethe in seiner heiligen Scheu vor dem unermeßlichen Reichtum der Wirklichkeit vermeidet es, an die Darstellung der geistigen Welt heranzutreten, nachdem er die sinnliche bis zu einer geistgemäßen Bild-Gestalt in seiner Seele gebracht hat.
Ich mußte nun zeigen, daß Goethe zwar seelisch leben konnte, indem er von der Sinnes-Natur zur Geist-Natur erkennend vordrang, daß ein anderer aber Goethes Seelenleben nur ganz begreifen kann, wenn er, über ihn hinaus-gehend, die Erkenntnis bis zur ideengemäßen Auffassung der geistigen Welt selbst führt.
Goethe stand, indem er über die Natur sprach, im Geiste drinnen. Er fürchtete, abstrakt zu werden, wenn er von diesem lebendigen Drinnenstehen weitergegangen wäre zu einem Leben in Gedanken über dieses Drin-
nenstehen. Er wollte sich selbst im Geiste empfinden; aber er wollte sich selbst nicht im Geiste denken.
Oft empfand ich, ich würde der Goethe'schen Denkungsart untreu, wenn ich nun doch Gedanken über seine Weltanschauung zur Darstellung brachte. Und ich mußte mir fast bei jeder Einzelheit, die ich in bezug auf Goethe zu interpretieren hatte, immer wieder die Methode erobern, über Goethe in Goethes Art zu sprechen.
Meine Darstellung von Goethes Ideen war ein Jahre lang dauerndes Ringen, Goethe durch die Hilfe der eigenen Gedanken immer besser zu verstehen. Indem ich auf dieses Ringen zurückblicke, muß ich mir sagen: ich verdanke ihm viel für die Entwickelung meiner geistigen Erkenntnis-Erlebnisse. Diese Entwickelung ging dadurch viel langsamer vor sich, als es der Fall gewesen wäre, wenn sich die Goethe-Aufgabe nicht schicksalsgemäß auf meinen Lebensgang hingestellt hätte. Ich hätte dann meine geistigen Erlebnisse verfolgt und sie ebenso dargestellt, wie sie vor mich hingetreten wären. Ich wäre schneller in die geistige Welt hineingerissen worden; ich hätte aber keine Veranlassung gefunden, ringend unterzutauchen in das eigene Innere.
So erlebte ich durch meine Goethe-Arbeit den Unterschied einer Seelenverfassung, der sich die geistige Welt gewissermaßen wie gnadevoll offenbart, und einer solchen, die Schritt vor Schritt das eigene Innere immer mehr dem Geiste erst ähnlich macht, um dann, wenn die Seele sich selbst als wahrer Geist erlebt, in dem Geistigen der Welt darinnen zu stehen. In diesem Darinnenstehen empfindet man aber erst, wie innig in der Menschenseele
Menschengeist und Weltengeistigkeit mit einander verwachsen können.
Ich hatte in der Zeit, da ich an meiner Goethe-Interpretation arbeitete, Goethe stets im Geiste wie einen Mahner neben mir, der mir unaufhörlich zurief: Wer auf geistigen Wegen zu rasch vorschreitet, der kann zwar zu einem engumgrenzten Erleben des Geistes gelangen; allein er tritt an Wirklichkeitsgehalt verarmt aus dem Reichtum des Lebens heraus.
Ich konnte an meinem Verhältnis zur Goethe-Arbeit recht anschaulich beobachten «wie Karma im Menschenleben wirkt». Das Schicksal setzt sich zusammen aus zwei Tatsachengestaltungen, die im Menschenleben zu einer Einheit zusammenwachsen. Die eine entströmt dem Drange der Seele von innen heraus; die andere tritt von der Außenwelt her an den Menschen heran. Meine eigenen seelischen Triebe gingen nach Anschauung des Geistigen; das äußere Geistesleben der Welt führte die Goethe-Arbeit an mich heran. Ich mußte die beiden Strömungen, die in meinem Bewußtsein sich begegneten, in diesem zur Harmonie bringen. - Ich verbrachte die letzten Jahre meines ersten Lebensabschnittes damit, mich abwechselnd vor mir selbst und vor Goethe zu rechtfertigen.
Innerlich erlebt war die Aufgabe, die ich mir in meiner Doktorarbeit stellte: «eine Verständigung des menschlichen Bewußtseins mit sich selbst» herbeizuführen. Denn ich sah, wie der Mensch erst dann verstehen konnte, was die wahre Wirklichkeit in der äußeren Welt ist, wenn er diese wahre Wirklichkeit in sich selbst geschaut hat.
Dieses Zusammentreffen der wahren Wirklichkeit der äußeren Welt mit der wahren Wirklichkeit im Innern der Seele muß für das erkennende Bewußtsein in emsiger geistiger Innentätigkeit errungen werden; für das wollende und handelnde Bewußtsein ist sie immer dann vorhanden, wenn der Mensch im Tun seine Freiheit empfindet.
Daß die Freiheit im unbefangenen Bewußtsein als etwas Tatsächliches lebt und doch für das Erkennen zur Rätselfrage wird, ist eben darin begründet, daß der Mensch das eigene wahre Sein, das echte Selbstbewußtsein nicht von vornherein gegeben hat, sondern erst nach einer Verständigung seines Bewußtseins mit sich selbst erringen muß. Was des Menschen höchsten Wert ausmacht: die Freiheit, das kann erst nach entsprechender Vorbereitung begriffen werden.
Meine «Philosophie der Freiheit» ist in einem Erleben begründet, das in der Verständigung des menschlichen Bewußtseins mit sich selbst besteht. Im Wollen wird die Freiheit geübt; im Fühlen wird sie erlebt; im Denken wird sie erkannt. Nur darf, um das zu erreichen, im Denken nicht das Leben verloren werden.
Während ich an meiner «Philosophie der Freiheit» arbeitete, war meine stete Sorge, in der Darstellung meiner Gedanken das innere Erleben bis in diese Gedanken hinein voll wach zu halten. Das gibt den Gedanken den mystischen Charakter des inneren Schauens, macht aber dieses Schauen auch gleich dem äußeren sinnenfälligen Anschauen der Welt. Dringt man zu einem solchen inneren Erleben vor, so empfindet man keinen Gegensatz mehr zwischen Natur-Erkennen und Geist-Erkennen.
Man wird sich klar darüber, daß das zweite nur die metamorphosierte Fortsetzung des ersten ist.
Weil mir das so erschien, konnte ich später auf das Titelblatt meiner «Philosophie der Freiheit» das Motto setzen: «Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode». Denn, wenn die naturwissenschaftliche Methode treulich für das Geistgebiet festgehalten wird, dann führt sie auch erkennend in dieses Gebiet hinein.
Eine große Bedeutung hatte in dieser Zeit für mich die eingehende Beschäftigung mit Goethes Märchen von der «grünen Schlange und der schönen Lilie», das den Schluß bildet seiner «Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter». Dieses «Rätselmärchen» hat viele Ausleger gefunden. Mir kam es auf eine «Auslegung» des Inhaltes gar nicht an. Den wollte ich in seiner poetisch-künstlerischen Form einfach hinnehmen. Die waltende Phantasie erklärend mit dem Verstande zu zerstäuben, war mir immer unsympathisch.
Ich sah, wie diese Goethe'sche Dichtung aus dessen geistigem Verkehr mit Schiller hervorgegangen ist Schillers Geist machte, als er seine «Briefe zur Förderung der ästhetischen Erziehung des Menschen» schrieb, die philosophische Epoche seiner Geistesentwickelung durch. Die «Verständigung des menschlichen Bewußtseins mit sich selbst» war eine ihn aufs stärkste beschäftigende Seelenaufgabe. Er sah die menschliche Seele auf der einen Seite ganz hingegeben der Vernunfttätigkeit. Er fühlte, daß die im rein Vernünftigen waltende Seele nicht vom Körperlich-Sinnlichen abhängig ist. Aber er empfand in dieser Art von übersinnlicher Betätigung doch ein Unbefriedi-
gendes. Die Seele ist «im Geiste», wenn sie an die «logische Notwendigkeit» der Vernunft hingegeben ist; aber sie ist in dieser Hingabe weder frei, noch innerlich geistig lebendig. Sie ist an ein abstraktes Schattenbild des Geistes hingegeben; webt und waltet aber nicht in dem Leben und Dasein des Geistes. - Auf der andern Seite bemerkte Schiller, wie die menschliche Seele in einer entgegengesetzten Betätigung ganz an das Körperliche - die sinnlichen Wahrnehmungen und die triebhaften Impulse - hingegeben ist. Da verliert sich in ihr das Wirken aus dem geistigen Schattenbilde; aber sie ist an eine Naturgesetzlichkeit hingegeben, die nicht ihr Wesen ausmacht.
Schiller kam zu der Anschauung, daß in beiden Betätigungen der Mensch nicht «wahrhafter Mensch» ist. Aber er kann durch sich bewirken, was ihm durch die Natur und den ohne sein Zutun zutage tretenden, vernünftigen Geistesschatten nicht gegeben ist. Er kann in sinnliche Betätigung die Vernunft einführen; und er kann das Sinnliche heraufheben in eine höhere Sphäre des Bewußtseins, so daß es wirkt wie das Geistige. So erlangt er eine mittlere Stimmung zwischen dem logischen und dem natürlichen Zwange. Schiller sieht den Menschen in einer solchen Stimmung, wenn er in dem Künstlerischen lebt. Die ästhetische Erfassung der Welt schaut das Sinnliche an; aber so, daß sie den Geist darin findet. Sie lebt im Schatten des Geistes, aber sie gibt im Schaffen oder Genießen dem Geiste sinnliche Gestalt, so daß er sein Schattendasein verliert.
Mir war schon Jahre vorher dieses Ringen Schillers nach der Anschauung vom «wahrhaften Menschen» vor
die Seele getreten; als nun Goethes «Rätselmärchen» selber für mich zum Rätsel wurde, da stellte es sich neuerdings vor mich hin. Ich sah, wie Goethe die Schiller'sche Darstellung des «wahrhaftigen Menschen» aufgenommen hat. Für ihn war nicht minder als für den Freund die Frage lebendig: wie findet das schattenhafte Geistige in der Seele das Sinnlich-Körperhafte, und wie arbeitet sich das Naturhafte im physischen Körper zum Geistigen hinauf?
Der Briefwechsel zwischen den beiden Freunden, und was man sonst über ihren geistigen Verkehr wissen kann, bezeugen, daß die Schiller'sche Lösung Goethe zu abstrakt, zu einseitig philosophisch war. Er stellte die anmurvollen Bilder von dem Flusse, der zwei Welten trennt, von Irrlichtern, die den Weg von der einen in die andere Welt suchen, von der Schlange, die sich hingeben muß, um eine Brücke zwischen den beiden Welten zu bilden, von der «schönen Lilie», die «jenseits» des Flusses nur als waltend im Geiste von denen erahnt werden kann, die «diesseits» leben, und vieles andere hin. Er stellte der Schiller'schen philosophischen Lösung eine märchenhaft-poetische Anschauung gegenüber. Er hatte die Empfindung: geht man gegen das von Schiller wahrgenommene Rätsel der Seele mit philosophischen Begriffen vor, so verarmt der Mensch, indem er nach seinem wahren Wesen sucht; er wollte im Reichtum des seelischen Erlebens sich dem Rätsel nahen.
Die Goethe'schen Märchenbilder weisen zurück auf Imaginationen, die von Suchern nach dem Geist-Erleben der Seele öfters vor Goethe hingestellt worden sind. Die drei Könige des Märchens findet man in einiger Ähnlich-
keit in der «Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz». Andere Gestalten sind Wieder-Erscheinungen von früher in Bildern des Erkenntnisweges Aufgetretenem. - Bei Goethe erscheinen diese Bilder nur in schöner, edler, künstlerischer Phantasie-Form, während sie vorher doch einen mehr unkünstlerischen Charakter tragen.
Goethe hat in diesem Märchen die Phantasieschöpfung nahe an die Grenze herangeführt, an der sie in den inneren Seelenvorgang übergeht, der ein erkennendes Erleben der wirklichen geistigen Welten ist. Ich vermeinte, am tiefsten könne man in sein Gemüt sehen, wenn man sich in diese Dichtung versenkt.
Nicht die Erklärung, wohl aber die Anregungen zu seelischem Erleben, die mir von der Beschäftigung mit dem Märchen kamen, waren mir wichtig. Diese Anregungen wirkten dann in meinem folgenden Seelenleben fort bis in die Gestaltung meiner später geschaffenen Mysteriendramen hinein. Für meine Arbeiten, die sich an Goethe anlehnten, konnte ich aber gerade durch das Märchen nicht viel gewinnen. Denn es erschien mir so, als ob Goethe in der Abfassung dieser Dichtung, wie durch die innere Macht eines halb unbewußten Seelenlebens getrieben, über sich selbst in seiner Weltanschauung hinausgewachsen wäre. Und so erstand mir eine ernsthafte Schwierigkeit. Ich konnte meine Goethe-Interpretation für Kürschners «Deutsche Nationalliteratur» nur in dem Stile fortsetzen, in dem ich sie begonnen hatte, genügte mir aber damit selber nicht. Denn ich sagte mir, Goethe habe, während er an dem «Märchen» schrieb, wie von der Grenze zur geistigen Welt in diese hinübergesehen.
Was er aber dann noch über die Naturvorgänge schrieb, das läßt doch wieder den Einblick unbeachtet. Man kann ihn deshalb auch nicht von diesem Einblick aus interpretieren.
Aber, wenn ich zunächst auch für meine Goethe-Schriften durch das Versenken in das Märchen nichts gewann, so ging doch eine Fülle von Seelenanregungen davon aus. Mir wurde, was sich an Seeleninhalt in Anlehnung an das Märchen ergab, ein wichtiger Meditationsstoff. Ich kam immer wieder darauf zurück. Ich bereitete mir mit dieser Betätigung die Stimmung vor, in der ich in meine Weimarer Arbeit später eintrat.
XIII.
Gerade in dieser Zeit war mein äußeres Leben ein durchaus geselliges. Mit den alten Freunden kam ich viel zusammen. So wenig ich die Möglichkeit hatte, von den Dingen zu sprechen, die ich hier andeutete, so intensiv waren aber doch die geistigen und seelischen Bande, die mich an die Freunde knüpften. Ich muß oft zurückdenken an die zum Teil endlosen Gespräche, die damals in einem bekannten Kaffeehause am Michaelerplatz in Wien geführt wurden. Ich mußte es besonders in der Zeit, in der nach dem Weltkriege das alte Österreich zersplitterte. Denn die Bedingungen dieser Zersplitterung waren damals durchaus schon vorhanden. Aber keiner wollte es sich gestehen. Ein jeder hatte Heilmittel-Gedanken, je nach seinen besonderen nationalen oder kulturellen Neigungen. Und wenn Ideale, die in aufgehenden Strömungen leben, erhebend sind, so sind es solche, die aus dem Niedergange erwachsen und die ihn abhalten möchten, in ihrer Tragik nicht minder. Solche tragischen Ideale wirkten damals in den Gemütern der besten Wiener und Österreicher.
Ich erregte oft Mißstimmung bei diesen Idealisten, wenn ich eine Überzeugung äußerte, die sich mir durch meine Hingabe an die Goethe-Zeit aufgedrängt hatte. Ich sagte, in dieser Zeit war ein Höhepunkt der abendländischen Kulturentwickelung erreicht. Nachher wurde er nicht festgehalten. Das naturwissenschaftliche Zeitalter mit seinen Folgen für das Menschen- und Volksleben bedeutet einen Niedergang. Zu einem weiteren Fortschritte bedürfe es eines ganz neuen Einschlages von der geistigen
Seite her. Es läßt sich in den Bahnen, die bisher im Geistigen eingeschlagen worden sind, nicht fortgehen, ohne zurückzukommen. Goethe ist eine Höhe, aber auf derselben nicht ein Anfang, sondern ein Ende. Er zieht die Folgen aus einer Entwickelung, die bis zu ihm geht, in ihm ihre vollste Ausgestaltung findet, die aber nicht weiter fortgesetzt werden kann, ohne zu viel ursprünglicheren Quellen des geistigen Erlebens zu gehen, als sie in dieser Entwickelung enthalten sind. - In dieser Stimmung schrieb ich an dem letzten Teile meiner Goethe-Darstellungen.
In dieser Stimmung lernte ich Nietzsches Schriften zuerst kennen. «Jenseits von Gut und Böse» war das erste Buch, das ich von ihm las. Ich war auch von dieser Betrachtungsart zugleich gefesselt und wieder zurückgestoßen. Ich konnte schwer mit Nietzsche zurecht kommen. Ich liebte seinen Stil, ich liebte seine Kühnheit; ich liebte aber durchaus die Art nicht, wie Nietzsche über die tiefsten Probleme sprach, ohne im geistigen Erleben mit der Seele bewußt in sie unterzutauchen. Nur kam mir wieder vor, wie wenn er viele Dinge sagte, die mir selbst im geistigen Erleben unermeßlich nahe standen. Und so fühlte ich mich seinem Kämpfen nahe und empfand, ich müsse einen Ausdruck für dieses Nahestehen finden. Wie einer der tragischsten Menschen der damaligen Gegenwart erschien mir Nietzsche. Und diese Tragik, glaubte ich, müsse sich der tiefer angelegten Menschenseele aus dem Charakter der geistigen Verfassung des naturwissenschaftlichen Zeitalters ergeben. Mit solchen Empfindungen verlebte ich meine letzten Wiener Jahre.
Vor dem Ende meines ersten Lebensabschnittes konnte ich auch noch Budapest und Siebenbürgen besuchen. Der
früher erwähnte, aus Siebenbürgen stammende Freund, der all die Jahre her mit seltener Treue mir verbunden geblieben war, hatte mich mit mehreren seiner in Wien weilenden Landesgenossen bekannt gemacht. Und so hatte ich denn außer dem andern sehr ausgebreiteten geselligen Verkehr auch einen solchen mit Siebenbürgern. Unter diesen waren Herr und Frau Breitenstein, die mir damals befreundet wurden und die es in herzlichster Weise geblieben sind. Sie haben seit langem eine führende Stellung in der Wiener Anthroposophischen Gesellschaft. Der menschliche Zusammenhang mit Sieben-bürgern führte mich zu einer Reise nach Budapest. Die Hauptstadt Ungarns, mit ihrem von dem Wiens so ganz verschiedenen Charakter, machte mir einen tiefen Eindruck. Man gelangt ja von Wien aus auf einer Reise dahin, die ganz in anmutvollster Natur, temperamentvollstem Menschentum und musikalischer Regsamkeit er-glänzt. Man hat da, wenn man zum Fenster des Eisenbahnzuges hinaussieht, den Eindruck, daß die Natur selbst in einer besonderen Art poetisch wird, und daß die Menschen, gar nicht viel achtend der ihnen gewohnten poetischen Natur, sich in derselben nach einer oft tiefinnerlichen Herzensmusik herumtummeln. Und betritt man Budapest, so spricht eine Welt, die von den Angehörigen der anderen europäischen Volkstümer zwar mit dem höchsten Anteil angeschaut, die aber nie völlig verstanden werden kann. Ein dunkler Untergrund, über dem ein in Farben spielendes Licht glänzt. Mir erschien dieses Wesen wie in Eins für den Blick zusammengedrängt, als ich vor dem Franz Deak-Monument stand. In diesem Kopfe des Schöpfers jenes Ungarns, das vom Jahre 1867
bis 1918 bestand, lebte ein derb-stolzer Wille, der herzhaft zugreift, der sich ohne Schlauheit, aber mit elementarischer Rücksichtslosigkeit durchsetzt. Ich fühlte, wie subjektiv wahr für jeden echten Ungarn der von mir oft gehörte Wahlspruch ist: «Außer Ungarn gibt es kein Leben; und wenn es eines gibt, so ist es kein solches.»
Als Kind hatte ich an Ungarns westlicher Grenze gesehen, wie Deutsche diesen derb-stolzen Willen zu fühlen hatten; jetzt lernte ich in Ungarns Mitte kennen, wie dieser Wille den magvarischen Menschen in eine menschliche Abgeschlossenheit bringt, die mit einer gewissen Naivität sich in einen ihr selbstverständlichen Glanz kleidet, der viel daran liegt, sich den verborgenen Augen der Natur, nicht aber den offenen des Menschen zu zeigen.
Ein halbes Jahr nach diesem Besuche veranlaßten die Siebenbürger Freunde, daß ich in Hermannstadt einen Vortrag halten konnte. Es war Weihnachtszeit. Ich fuhr über die weiten Flächen, in deren Mitte Arad liegt. Lenaus sehnsuchtgetragene Poesien klangen in mein Herz herein, als meine Augen über diese Flächen sahen, an denen alles Weite ist, die dem hinschweifenden Blick keine Grenze setzt. Ich mußte in einem Grenznest zwischen Ungarn und Siebenbürgen übernachten. Ich saß in einer Gaststube die halbe Nacht. Außer mir war nur noch ein Tisch mit Kartenspielern. Da waren alle Nationalitäten beisammen, die in Ungarn und Siebenbürgen damals gefunden werden konnten. Menschen spielten da mit einer Leidenschaftlichkeit, die in Zeiten von einer halben Stunde sich immer überschlug, so daß sie wie in Seelenwolken sich auslebte, die sich über den Tisch er-
hoben, sich wie Dämonen bekämpften und die Menschen vollständig verschlangen. Welche Verschiedenheit im Leidenschaftlich-Sein offenbarte sich da bei diesen verschiedenen Nationen!
Am Weihnachtstage kam ich nach Hermannstadt. Ich wurde in das Siebenbürger Sachsentum eingeführt. Das lebte da innerhalb des Rumänischen und Magyarischen. Ein edles Volkstum, das im Untergange, den es nicht sehen möchte, sich wacker bewahren möchte. Ein Deutschtum, das wie eine Erinnerung an sein Leben vor Jahrhunderten in den Osten verschlagen, seiner Quelle die Treue bewahren möchte, das aber in dieser Seelenverfassung einen Zug von Weltfremdheit hat, die eine anerzogene Freudigkeit überall im Leben offenbart. Ich verlebte schöne Tage unter den deutschen Geistlichen der evangelischen Kirche, unter den Lehrern der deutschen Schulen, unter andern deutschen Siebenbürgern. Mir wurde das Herz warm unter diesen Menschen, die in der Sorge um ihr Volkstum und in dessen Pflege eine Kultur des Herzens entwickelten, die auch vor allem zum Herzen sprach.
Es lebte in meiner Seele diese Wärme, als ich mit den alten und neugewonnenen Freunden in dicke Pelze gehüllt durch eisige Kälte und knisternden Schnee eine Schlittenfahrt südwärts nach den Karpaten (den transsylvanischen Alpen) machte. Eine schwarze, waldige Bergwand, wenn man sich von der Ferne hinbewegt; eine wild zerklüftete, oft schauerlich stimmende Berglandschaft, wenn man da ist.
Den Mittelpunkt in all dem, was ich da erlebte, bildete mein langjähriger Freund. Er dachte immer neue
Dinge aus, durch die ich das Siebenbürger Sachsentum genau kennen lernen sollte. Er verbrachte auch jetzt noch immer einige Zeit in Wien, einige in Hermannstadt. Er hatte damals ein Wochenblatt in Hermannstadt für die Pflege des Siebenbürger Sachsentums begründet. Ein Unternehmen, das ganz aus Idealismus und aus keinem Milligramm Praxis bestand, an dem aber doch fast alle Träger des Sachsentums mitarbeiteten. Es ging nach wenigen Wochen wieder ein.
Solche Erlebnisse wie diese Reisen wurden mir vom Schicksal zugetragen; und ich konnte mir durch sie den Blick für die Außenwelt anerziehen, der mir nicht leicht geworden ist, während ich in dem geistigen Element mit einer gewissen Selbstverständlichkeit lebte.
In wehmütigen Erinnerungen machte ich die Reise zurück nach Wien. Da kam mir bald ein Buch in die Hand, von dessen «Geistesreichtum» damals die weitesten Kreise sprachen: «Rembrandt als Erzieher». In Gesprächen über dieses Buch, die damals überall sich entwickelten, wo man hinkam, konnte man von einem Aufkommen eines ganz neuen Geistes hören. Ich mußte gerade an dieser Erscheinung wahrnehmen, wie einsam ich mit meiner Seelenverfassung in dem damaligen Geistesleben stand.
Ich empfand von einem Buche, das von aller Welt auf das höchste gepriesen wurde, so: es kam mir vor, als wenn jemand sich durch einige Monate jeden Abend in einem besseren Gasthause an einen Tisch gesetzt und zugehört hätte, was die «hervorragenderen» Persönlichkeiten an den Stammtischen an «geistvollen» Aussprüchen machten, und dann dies in aphoristischer Form aufge-
zeichnet hätte. Nach dieser fortlaufenden «Vorarbeit» könnte er die Zettel mit den Aussprüchen in ein Gefäß geworfen, kräftig durcheinander geschüttelt und dann wieder herausgenommen haben. Nach der Herausnahme hätte er dann das eine an das andere gefügt und so ein Buch entstehen lassen. Natürlich ist diese Kritik übertrieben. Aber mich drängte eben meine Lebensauffassung zu solcher Ablehnung dessen, was der damalige «Geist der Zeit» als eine Höchstleistung pries. Ich empfand «Rembrandt als Erzieher» als ein Buch, das sich ganz auf der Oberfläche sich geistreich gebendender Gedanken hielt und das in keinem Satze mit den wahren Tiefen einer menschlichen Seele zusammenhing. Ich fühlte es schmerzlich, daß meine Zeitgenossen gerade ein solches Buch für den Ausfluß einer tiefen Persönlichkeit hielten, während ich meinen mußte, daß mit solchem Gedankenplätschern in seichten Geist-Gewässern alles Tief-Menschliche aus den Seelen herausgetrieben wird.
Als ich vierzehn Jahre alt war, mußte ich damit beginnen, Privatunterricht zu geben; fünfzehn Jahre lang, bis zum Beginne meines zweiten in Weimar verbrachten Lebensabschnittes, hielt mich das Schicksal in dieser Betätigung fest Die Entfaltung der Seelen vieler Menschen im kindlichen und Jugendalter verband sich da mit meiner eigenen Entwickelung. Ich habe dabei beobachten können, wie verschieden das Hineinwachsen in das Leben beim männlichen und weiblichen Geschlechte ist. Denn neben der Erteilung von Unterricht an Knaben und junge Männer fiel mir auch der an eine Anzahl junger Mädchen zu. Ja, eine Zeitlang wurde auch die Mutter des
Knaben, dessen Erziehung wegen seines pathologischen Zustandes ich übernommen hatte, meine Schülerin in der Geometrie; zu einer andern Zeit trug ich dieser Frau und deren Schwester Ästhetik vor.
In der Familie dieses Knaben habe ich durch mehrere Jahre eine Art von Heim gefunden, von dem aus ich bei anderen Familien der Erzieher- und Unterrichtstätigkeit oblag. Durch das freundschaftlich nahe Verhältnis zu der Mutter dieses Knaben kam es so, daß ich Freuden und Leiden dieser Familie völlig mitmachte. Mir stand in dieser Frau eine eigenartig schöne Menschenseele gegenüber. Ganz hingegeben war sie der Sorge um die Schicksalsentwickelung ihrer vier Knaben. Man konnte an ihr geradezu den großen Stil der Mutterliebe studieren. In Erziehungsfragen mit ihr zusammen arbeiten, bildete einen schönen Lebensinhalt. Für den musikalischen Teil des Künstlerischen hatte sie Anlage und Begeisterung. Die Musikübungen mit ihren Knaben besorgte sie, solange diese klein waren, zum Teile selbst. Mit mir unterhielt sie sich über die mannigfaltigsten Lebensprobleme verständnisvoll und mit dem tiefsten Interesse auf alles eingehend. Meinen wissenschaftlichen und sonstigen Arbeiten brachte sie die größte Aufmerksamkeit entgegen. Es war eine Zeit, wo ich das tiefste Bedürfnis hatte, alles, was mir nahe ging, mit ihr zu besprechen. Wenn ich von meinen geistigen Erlebnissen sprach, da hörte sie in einer eigentümlichen Art zu. Ihrem Verstande waren die Dinge zwar sympathisch, aber er behielt einen leisen Zug von Zurückhaltung; ihre Seele aber nahm alles auf. Sie behielt dabei dem Menschenwesen gegenüber eine gewisse naturalistische Anschauung. Die
moralische Seelenverfassung dachte sie ganz in Zusammenhang mit der gesunden oder kranken Körperkonstitution. Ich möchte sagen, sie dachte instinktiv über den Menschen medizinisch, wobei dieses eben einen naturalistischen Einschlag hatte. Sich in dieser Richtung mit ihr zu unterhalten, war im höchsten Maße anregend. Dabei stand sie allem äußeren Leben wie eine Frau gegenüber, die das ihr Zufallende mit dem stärksten Pflichtgefühle besorgte, aber das meiste doch innerlich nicht als zu ihrer Sphäre gehörig betrachtete. Sie sah ihr Schicksal in vieler Beziehung als etwas Belastendes an. Aber sie forderte auch nichts vom Leben; sie nahm dieses hin, wie es sich gestaltete, sofern es nicht ihre Söhne betraf. Diesen gegenüber erlebte sie alles mit den stärksten Emotionen ihrer Seele.
All dieses, das Seelenleben einer Frau, deren schönste Hingabe an ihre Söhne, das Leben der Familie innerhalb eines weiten Verwandten- und Bekanntenkreises lebte ich mit. Aber dabei ging es nicht ohne Schwierigkeit ab. Die Familie war eine jüdische. Sie war in den Anschauungen völlig frei von jeder konfessionellen und Rassenbeschränktheit. Aber es war bei dem Hausherrn, dem ich sehr zugetan war, eine gewisse Empfindlichkeit vorhanden gegen alle Äußerungen, die von einem Nicht-Juden über Juden getan wurden. Der damals aufflammende Antisemitismus harte das bewirkt.
Nun nahm ich damals an den Kämpfen lebhaften Anteil, welche die Deutschen in Österreich um ihre nationale Existenz führten. Ich wurde dazu geführt, mich auch mit der geschichtlichen und sozialen Stellung des Judentums zu beschäftigen. Besonders intensiv wurde diese
Beschäftigung, als Hamerlings «Homunculus» erschienen war. Dieser eminent deutsche Dichter wurde wegen dieses Werkes von einem großen Teil der Journalistik als Antisemit hingestellt, ja auch von den deutschnationalen Antisemiten als einer der ihrigen in Anspruch genommen. Mich berührte das alles wenig; aber ich schrieb einen Aufsatz über den «Homunculus», in dem ich mich, wie ich glaubte, ganz objektiv über die Stellung des Judentums aussprach. Der Mann, in dessen Hause ich lebte, mit dem ich befreundet war, nahm dies als eine besondere Art des Antisemitismus auf. Nicht im geringsten haben seine freundschaftlichen Gefühle für mich darunter gelitten, wohl aber wurde er von einem tiefen Schmerze befallen. Als er den Aufsatz gelesen hatte, stand er mir gegenüber, ganz von innerstem Leid durch-wühlt, und sagte mir: Was Sie da über die Juden schreiben, kann gar nicht in einem freundlichen Sinne gedeutet werden; aber das ist es nicht, was mich erfüllt, sondern daß Sie bei dem nahen Verhältnis zu uns und unseren Freunden die Erfahrungen, die Sie veranlassen, so zu schreiben, nur an uns gemacht haben können.» Der Mann irrte; denn ich harte ganz aus der geistig-historischen Überschau heraus geurteilt; nichts Persönliches war in mein Urteil eingeflossen. Er konnte das nicht so sehen. Er machte, auf meine Erklärungen hin, die Bemerkung: «Nein, der Mann, der meine Kinder erzieht, ist, nach diesem Aufsatze, kein Judenfreund.» Davon war er nicht abzubringen. Er dachte keinen Augenblick daran, daß sich an meinem Verhältnis zu der Familie etwas ändern solle. Das sah er als eine Notwendigkeit an. Ich konnte noch weniger die Sache zum Anlaß einer Ände-
rung nehmen. Denn ich betrachtete die Erziehung seines Sohnes als eine Aufgabe, die mir vom Schicksal zugefallen war. Aber wir konnten beide nicht anders als denken, daß sich in dieses Verhältnis ein tragischer Einschlag gemischt hatte.
Es kam zu alledem dazu, daß viele meiner Freunde aus den damaligen nationalen Kämpfen heraus in ihrer Auffassung des Judentums eine antisemitische Nuance angenommen hatten. Die sahen meine Stellung in einem jüdischen Hause nicht mit Sympathie an; und der Herr dieses Hauses fand in meinem freundschaftlichen Umgange mit solchen Persönlichkeiten nur eine Bestätigung der Eindrücke, die er von meinem Aufsatze empfangen hatte.
Dem Familienzusammenhang, in dem ich so darinnen stand, gehörte der Komponist des «Goldenen Kreuzes», Ignaz Brüll, an. Eine feinsinnige Persönlichkeit, die ich außerordentlich lieb hatte. Ignaz Brüll hatte etwas Weltfremdes, in sich Versunkenes. Seine Interessen waren nicht ausschließlich musikalisch; sie waren vielen Seiten des geistigen Lebens zugewandt. Er konnte diese Interessen nur als ein «Glückskind» des Schicksals ausleben, auf dem Hintergrunde eines Familienzusammenhanges, der ihn von den Sorgen der Alltäglichkeit gar nicht berühren ließ, der sein Schaffen aus einem gewissen Wohl-stande herauswachsen ließ. Und so wuchs er nicht in das Leben, sondern nur in die Musik hinein. Wie wertvoll oder nicht wertvoll sein musikalisches Schaffen war, davon braucht hier nicht die Rede zu sein. Aber es war im schönsten Sinne reizvoll, dem Manne auf der Straße zu begegnen, und ihn aus seiner Welt von Tönen erwachen
zu sehen, wenn man ihn anredete. Er hatte auch gewöhnlich die Westenknöpfe nicht in die rechten Knopflöcher eingeknöpft. Sein Auge sprach in milder Sinnigkeit, sein Gang war nicht fest, aber ausdrucksvoll. Man konnte mit ihm über vieles sprechen; er harte dafür ein zartes Verstehen; aber man sah, wie der Inhalt des Gespräches sogleich bei ihm in das Reich des Musikalischen hineinschlüpfte.
In der Familie, in der ich so lebte, lernte ich auch den ausgezeichneten Arzt kennen, Dr. Breuer, der mit Dr. Freud zusammen bei der Geburt der Psychoanalyse stand. Er hatte aber nur im Anfange diese Anschauungs-art mitgemacht, und war wohl mit deren späterer Ausbildung durch Freud nicht einverstanden. Dr. Breuer war für mich eine anziehende Persönlichkeit. Die Art, wie er im ärztlichen Berufe drinnen stand, bewunderte ich. Dabei war er auch in andern Gebieten ein vielseitig interessierter Geist. Er sprach über Shakespeare so, daß man die stärkste Anregung davon empfing. Es war auch interessant, ihn mit seiner durch und durch medizinischen Denkungsart über Ibsen oder gar über Tolstois «Kreuzersonate» sprechen zu hören. Wenn er mit meiner hier geschilderten Freundin, der Mutter der von mir zu erziehenden Kinder, über solche Dinge sprach, war ich oft mit dem stärksten Interesse dabei. Die Psychoanalyse war damals noch nicht geboren; aber die Probleme, die nach dieser Richtung hinzielten, waren schon da. Die hypnotischen Erscheinungen hatten dem medizinischen Denken eine besondere Färbung gegeben. Meine Freundin war mit Dr. Breuer von Jugend an befreundet. Vor mir steht da eine Tatsache, die mir viel zu denken gegeben
hat. Diese Frau dachte in einer gewissen Richtung noch medizinischer als der so bedeutende Arzt. Es handelte sich einmal um einen Morphinisten. Dr. Breuer behandelte ihn. Die Frau sagte mir einmal das Folgende: «Denken Sie sich, was Breuer getan hat. Er hat sich von dem Morphinisten auf Ehrenwort versprechen lassen, daß er kein Morphium mehr nehmen werde. Er glaubte damit etwas zu erreichen; und er war entrüstet, als der Patient sein Wort nicht hielt. Er sagte sogar: wie kann ich jemand behandeln, der sein Wort nicht hält. Sollte man glauben - so sagte sie -, daß ein so ausgezeichneter Arzt so naiv sein könne. Wie kann man etwas in der Natur so tief Begründetes durch ein Versprechen heilen wollen?» - Die Frau braucht doch nicht ganz recht gehabt zu haben; des Arztes Ansichten über Suggestionstherapie können da zu seinem Heilungsversuche mitgewirkt haben; aber man wird nicht in Abrede stellen können, daß der Ausspruch meiner Freundin von der außerordentlichen Energie spricht, mit der sie in merkwürdiger Art aus dem Geiste heraus sprach, der in der Wiener medizinischen Schule lebte gerade zu der Zeit, in der diese Schule blühte.
Diese Frau war in ihrer Art bedeutend; und sie steht als bedeutende Erscheinung in meinem Leben darinnen. Sie ist nun schon lange tot; unter die Dinge, die mir den Fortgang von Wien schwer machten, gehört auch dies, daß ich mich von ihr trennen mußte.
Wenn ich auf den Inhalt meines ersten Lebensabschnittes rückschauend hinblicke, so drängt sich mir, indem ich ihn wie von außen zu charakterisieren versuche, die Empfindung auf: das Schicksal hatte mich so geführt, daß ich mich in meinem dreißigsten Lebensjahre von keinem
äußeren «Berufe» umklammert sah. Ich trat auch in das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar nicht für eine Lebensstellung ein, sondern als ein freier Mitarbeiter an der Goethe-Ausgabe, die im Auftrage der Großherzogin Sophie von dem Archiv herausgegeben wurde. In dem Bericht, den der Direktor des Archivs im zwölften Bande des Goethe-Jahrbuchs abdrucken ließ, steht: «Den ständigen Arbeitern hat sich seit dem Herbst 1890 Rudolf Steiner aus Wien zugesellt. Ihm ist (mit Ausnahme der osteologischen Partie) das gesamte Gebiet der Morphologie zugeteilt, fünf oder voraussichtlich sechs Bände der zweiten Abteilung, denen aus dem handschriftlichen Nachlaß ein hochwichtiges Material zufließt.»
XIV.
Auf unbestimmte Zeit war ich wieder vor eine Aufgabe gestellt, die sich nicht aus einem äußeren Anlasse, sondern aus dem innern Werdegang meiner Welt- und Lebensanschauungen ergeben hatte. Und aus diesem hatte sich auch ergeben, daß ich in Rostock mit meiner Abhandlung über den Versuch einer «Verständigung des menschlichen Bewußtseins mit sich selbst» das Doktorexamen machte. Äußere Tatsachen bewirkten nur, daß ich es in Wien nicht machen konnte. Ich hatte die Realschule, nicht das Gymnasium offiziell hinter mir, hatte mir die Gymnasialbildung, Privatunterricht darin erteilend, auch privat angeeignet. Das schloß in Österreich das Doktorieren aus. Ich war in die «Philosophie» hineingewachsen, hatte aber einen offiziellen Bildungsgang hinter mir, der mich von allem ausschloß, in das den Menschen das Philosophiestudium hineinstellt.
Nun war am Ende meines ersten Lebensabschnittes mir ein philosophisches Werk in die Hände gefallen, das mich außerordentlich fesselte, die «Sieben Bücher Platonismus» von Heinrich v. Stein, der damals in Rostock Philosophie lehrte. Diese Tatsache führte dazu, daß ich bei dem lieben alten Philosophen, den mir sein Buch sehr wert machte und den ich nur bei dem Examen gesehen habe, meine Abhandlung einreichte.
Die Persönlichkeit Heinrichs v. Stein steht noch ganz lebendig vor mir. Fast so, als ob ich viel mit ihm durchlebt hätte. Denn die «Sieben Bücher Platonismus» sind der Ausdruck einer scharf geprägten philosophischen Individualität. Die Philosophie als Denkinhalt wird in
diesem Werke nicht als etwas genommen, das auf eigenen Füßen steht. Plato wird allseitig als der Philosoph betrachtet, der eine solche auf sich selbst gestellte Philosophie suchte. Was er auf diesem Wege gefunden hat, wird von Heinrich v. Stein sorgfältig dargestellt. Man lebt sich in diesen ersten Kapiteln des Werkes ganz in die platonische Weltanschauung ein. Dann aber geht Stein über zu dem Hereinbrechen der Christus-Offenbarung in die Entwickelung der Menschheit. Dieses reale Hereinbrechen geistigen Lebens stellt er als das Höhere hin gegenüber dem Erarbeiten eines Denkinhaltes durch die bloße Philosophie.
Von Plato zu Christus wie zu der Erfüllung eines Erstrebten, so könnte man kennzeichnen, was in der Darstellung Steins liegt. Dann verfolgt er weiter, wie in der christlichen Entwickelung der Weltanschauungen der Platonismus weiter wirkte.
Stein ist der Meinung, daß die Offenbarung von außen dem menschlichen Weltanschauungsstreben seinen Inhalt gegeben habe. Da konnte ich mit ihm nicht mitgehen. Mir war Erlebnis, daß die menschliche Wesenheit, wenn sie sich zur Verständigung mit sich selbst im geistlebendigen Bewußtsein bringt, die Offenbarung haben könne, und daß diese dann im Ideen-Erleben Dasein im Menschen gewinnen könne. Aber ich empfand aus dem Buche etwas, das mich anzog. Das reale Leben des Geistes hinter dem Ideenleben, wenn auch in einer Form, die nicht die meinige war, bildete da den Impuls einer umfassenden geschichts-philosophischen Darstellung. Plato, der große Träger einer Ideenwelt, die der Erfüllung durch den Christus-Impuls harrte; das darzustellen
ist der Sinn des Stein'schen Buches. Mir stand dieses Buch, trotz des Gegensatzes, in dem ich mich zu ihm befand, viel näher als alle Philosophien, die nur aus Begriffen und Sinneserfahrungen heraus sich einen Inhalt erarbeiten.
Ich vermißte bei Stein auch das Bewußtsein, daß Platos Ideenwelt doch auch zu einer uralten Offenbarung der geistigen Welt zurückführt. Diese (vorchristliche) Offenbarung, die zum Beispiel in Otto Willmanns «Geschichte des Idealismus» eine sympathische Darstellung gefunden hat, tritt in Steins Anschauung nicht zutage. Er stellt den Platonismus nicht als den Ideenrest der Uroffenbarung hin, der dann im Christenturn den verlorenen Geistgehalt in einer höheren Gestalt wiedererlangt hat; er stellt die platonischen Ideen wie einen aus sich selbst gesponnenen Begriffsinhalt hin, der dann durch Christus Leben gewonnen hat.
Doch ist das Buch eines von denjenigen, die mit philosophischer Wärme geschrieben sind; und sein Verfasser war eine Persönlichkeit, die von tiefer Religiosität durchdrungen, in der Philosophie den Ausdruck des religiösen Lebens suchte. Auf jeder Seite des dreibändigen Werkes wird man der dahinterstehenden Persönlichkeit gewahr. Es war, nachdem ich das Buch, besonders die Partien über das Verhältnis des Platonismus zum Christentum immer wieder gelesen hatte, für mich ein bedeutsames Erlebnis, dem Verfasser gegenüberzutreten.
Eine in ihrer ganzen Haltung ruhige Persönlichkeit, im höhern Alter, mit mildem Auge, das wie geeignet erschien, sanft aber doch eindringlich auf den Entwickelungsgang von Schülern hinzuschauen; eine Sprache, die
in jedem Satze die Überlegung des Philosophen im Ton der Worte an sich trug. So stand Stein gleich vor mir, als ich ihn vor dem Examen besuchte. Er sagte mir: Ihre Dissertation ist nicht so, wie man sie fordert; man sieht ihr an, daß Sie sie nicht unter der Anleitung eines Professors gemacht haben; aber was sie enthält, macht möglich, daß ich sie sehr gerne annehme. Ich hatte nun so stark gewollt, im mündlichen Examen über etwas gefragt zu werden, was mit den «Sieben Büchern Platonismus» zusammengehangen hätte; aber keine Frage bezog sich darauf; alle waren der Kant'schen Philosophie entnommen.
Ich habe das Bild Heinrichs v. Stein immer tief eingeprägt in meinem Herzen getragen; und es wäre mir unbegrenzt lieb gewesen, dem Manne wieder zu begegnen. Das Schicksal hat mich nie wieder mit ihm zusammengebracht. Mein Doktorexamen gehört zu meinen liebsten Erinnerungen, weil der Eindruck von Steins Persönlichkeit weitaus alles andere, das damit zusammenhängt, überstrahlt.
Die Stimmung, mit der ich in Weimar eintrat, war gefärbt von meiner vorangehenden eingehenden Beschäftigung mit dem Platonismus. Ich meine, daß mir diese Stimmung viel geholfen hat, mich in meiner Aufgabe im Goethe- und Schiller-Archiv zurechtzufinden. Wie lebte Plato in der Ideenwelt, und wie Goethe? Das beschäftigte mich, wenn ich die Gänge von und zum Archiv machte; es beschäftigte mich auch, wenn ich über den Papieren des Goethenachlasses saß.
Diese Frage war im Hintergrunde, als ich anfangs 1891 meine Eindrücke von Goethes Naturerkenntnis (in dem Aufsatze «Über den Gewinn unserer Anschauungen
von Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten durch die Publikationen des Goethe-Archivs» im 12. Band des Goethe-Jahrbuches in Worten aussprach wie diesen: «Es ist für die Mehrzahl der Menschen unmöglich, sich vorzustellen, daß etwas, zu dessen Erscheinung durchaus subjektive Bedingungen notwendig sind, doch eine objektive Bedeutung und Wesenheit haben kann. Und gerade von dieser letzteren Art ist die Urpflanze. Sie ist das objektiv in allen Pflanzen enthaltene Wesentliche derselben; wenn sie aber erscheinendes Dasein gewinnen soll, so muß sie der Geist des Menschen frei konstruieren.» Oder diesen: Eine rechte Erkenntnis der Goetheschen Denkungsart «liefert nun auch die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob es der Auffassung Goethes gemäß ist, die Urpflanze oder das Urtier mit irgendeiner zu einer bestimmten Zeit vorgekommenen oder noch vorkommenden sinnlich-realen organischen Form zu identifizieren. Darauf kann nur mit einem entschiedenen Nein geantwortet werden. Die Urpflanze ist in jeder Pflanze enthalten, kann durch die konstruktive Kraft des Geistes aus der Pflanzenwelt gewonnen werden, aber keine einzelne, individuelle Form darf als typisch angesprochen werden.»
In das Goethe- und Schiller-Archiv trat ich nun als Mitarbeiter ein. Das war die Stätte, in der die Philologie vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts Goethes Nachlaß übernommen hatte. An der Spitze des Archivs stand, als Direktor, Bernhard Suphan. Mit ihm ergab sich auch, ich möchte sagen vom ersten Tage meines Weimarer Lebensabschnittes an, ein persönliches Verhältnis. Ich konnte oft in sein Haus kommen.

Daß Bernhard Suphan der Nachfolger Erich Schmidts, des ersten Direktors des Archivs, geworden war, hatte er seiner Freundschaft mit Herman Grimm zu verdanken.
Der letzte Goethenachkomme, Walter von Goethe, hatte Goethes Nachlaß der Großherzogin Sophie erblich hinterlassen. Diese hat das Archiv begründet, damit der Nachlaß in angemessener Art in das Geistesleben hineingestellt werde. Naturgemäß wandte sie sich an diejenigen Persönlichkeiten, von denen sie annehmen mußte, daß sie wissen konnten, was mit Goethes Papieren zu geschehen habe.
Da war zunächst Herr v. Loeper. Er war wie vorbestimmt, der Vermittler zu werden zwischen den Goethekennern und dem Weimarischen Hofe, dem die Verwaltung des Goethenachlasses anvertraut war. Denn er hatte es zu einer hohen Beamtenstellung im preußischen Hausministerium gebracht, stand so der Königin von Preußen, der Schwester des Großherzogs von Weimar nahe, und er war zugleich der wichtigste Mitarbeiter an der damals berühmtesten Goetheausgabe, der Hempel'schen.
Loeper war eine eigenartige Persönlichkeit; eine höchst sympathische Mischung von Weltmann und Sonderling. Als Liebhaber, nicht als Fachmann war er in die «Goetheforschung» hineingewachsen. Aber er hatte es in ihr zu hohem Ansehen gebracht. In seinen Urteilen über Goethe, die in so schöner Art in seiner Faustausgabe zutage traten, war er durchaus selbständig. Was er vorbrachte, hatte er von Goethe selbst gelernt. Da er nun raten sollte, wer Goethes Nachlaß am besten verwalten könne, mußte er auf diejenigen verfallen, denen er als
Goethekennern durch seine eigene Tätigkeit an Goethe nahegetreten war.
Da kam zunächst Herman Grimm in Betracht. Als Kunsthistoriker ist Herman Grimm an Goethe herangetreten; als solcher hat er an der Berliner Universität Vorlesungen über Goethe gehalten, die er dann als Buch veröffentlicht hat. Aber er konnte sich zugleich als eine Art geistiger Nachkomme Goethes betrachten. Er wuchs aus denjenigen Kreisen des deutschen Geisteslebens heraus, die stets eine lebendige Tradition von Goethe bewahrt hatten und die sich gewissermaßen in einer persönlichen Verbindung mit ihm denken konnten. Die Frau Herman Grimms war Gisela v. Arnim, die Tochter Bettinas, der Verfasserin des Buches: «Goethes Briefwechsel mit einem Kinde».
Herman Grimm urteilte als kunstbegeisterter Mensch über Goethe. Er ist ja auch als Kunsthistoriker nur insoweit in die Gelehrsamkeit hineingewachsen, als ihm dies unter Wahrung einer persönlich gefärbten Stellung zur Kunst, als Kunstgenießer, möglich war.
Ich denke, mit Loeper, mit dem er durch das gemeinschaftliche Goetheinteresse naturgemäß befreundet war konnte sich Herman Grimm gut verständigen. Ich stelle mir vor, daß bei den beiden, wenn sie über Goethe sprachen, die menschliche Anteilnahme an dem Genius durchaus im Vordergrunde, die gelehrte Betrachtung aber im Hintergrunde stand.
Diese gelehrte Art, Goethe anzusehen, lebte nun in Wilhelm Scherer, dem Professor für deutsche Literaturgeschichte an der Berliner Universität. In ihm mußten die beiden den offiziellen Kenner Goethes gelten lassen.
Loeper tat das in kindlich harmloser Art. Herman Grimm mit einem gewissen inneren Widerstreben. Denn ihm war die philologische Betrachtungsweise, die in Scherer lebte, eigentlich nicht sympathisch.
An diese drei Persönlichkeiten kam die eigentliche Führung in der Verwaltung des Goethe-Nachlasses. Aber sie glitt doch stark ganz in die Hände Scherers hinüber. Loeper dachte wohl nicht daran, mehr als ratend und von außen mitarbeitend sich an der Aufgabe zu beteiligen; er hatte seine festen gesellschaftlichen Zusammenhänge durch seine Stellung am preußischen Königshause. Herman Grimm dachte ebensowenig daran. Er konnte durch seine Stellung im Geistesleben nur Neigung haben, Gesichtspunkte und Richtlinien für die Arbeit anzugeben; für die Einrichtung der Einzelheiten konnte er nicht aufkommen.
Ganz anders stand die Sache für Wilhelm Scherer. Für ihn war Goethe ein gewichtiges Kapitel der deutschen Literaturgeschichte. In dem Goethe-Archiv waren neue Quellen von unermeßlicher Bedeutung für dieses Kapitel zutage getreten. Da mußte denn die Arbeit des Goethe-Archivs in die allgemeine literarhistorische Arbeit systematisch eingegliedert werden. Der Plan zu einer Goethe-Ausgabe entstand, die im philologisch richtigen Sinne gestaltet sein sollte. Scherer übernahm die geistige Oberaufsicht; die Leitung des Archivs wurde seinem Schüler, der damals die Professur für neuere deutsche Literaturgeschichte in Wien innehatte, Erich Schmidt, übertragen.
Dadurch bekam die Arbeit am Goethe-Archiv ihr Gepräge. Aber auch alles andere, was im Goethe-Archiv
und durch dieses geschah. Es trug alles den Charakter der damaligen philologischen Denk- und Arbeitsart.
In Wilhelm Scherer hat die literargeschichtliche Philologie nach einer Nachahmung der damaligen naturwissenschaftlichen Methoden gestrebt. Man nahm die gebräuchlichen naturwissenschaftlichen Ideen und wollte die philologisch-literarhistorischen ihnen nachbilden. Woher ein Dichter etwas entlehnt hat, wie das Entlehnte sich in ihm umgebildet hat, wurden die Fragen, die man einer Entwickelungsgeschichte des Geisteslebens zum Grunde legte. Die dichterischen Persönlichkeiten verschwanden aus der Betrachtung; eine Anschauung davon, wie sich «Stoffe», «Motive» durch die Persönlichkeiten hindurch entwickelten, trat auf. Ihren Höhepunkt erreichte diese Anschauungsart in Erich Schmidts großer Lessing-Monographie. In dieser ist nicht Lessings Persönlichkeit die Hauptsache, sondern eine höchst sorgfältige Betrachtung des Minna von Barnhelm-, des Nathan-Motivs usw.
Scherer starb früh, bald nachdem das Goethe-Archiv errichtet war. Seine Schüler waren zahlreich. Erich Schmidt wurde vom Goethe-Archiv hinweg an seine Stelle in Berlin berufen. Herman Grimm setzte es dann durch, daß nicht einer der zahlreichen Schüler Scherers die Direktion des Archivs erhielt, sondern Bernhard Suphan.
Dieser war vorher seiner Stellung nach Gymnasiallehrer in Berlin. Er hatte sich zugleich der Herausgabe von Herders Werken unterzogen. Dadurch schien er gut vorbestimmt, auch die Leitung der Goethe-Ausgabe zu übernehmen.
Erich Schmidt behielt noch einen gewissen Einfluß;
dadurch waltete Scherers Geist an der Goethe-Arbeit fort. Aber die Ideen Herman Grimms traten daneben, wenn auch nicht in der Arbeitsweise, so doch innerhalb des persönlichen Verkehrs im Goethe-Archiv stärker hervor.
Bernhard Suphan war, als ich nach Weimar kam und in ein näheres Verhältnis zu ihm trat, ein persönlich hartgeprüfter Mann. Er hatte zwei Frauen, die Schwestern waren, frühzeitig ins Grab sinken sehen. Mit seinen beiden Knaben lebte er nun in Weimar, trauernd um die Dahingeschiedenen, ohne jegliche Lebensfreude. Sein einziger Lichtpunkt war das Wohlwollen, das ihm die Großherzogin Sophie, seine von ihm ehrlich verehrte Herrin, entgegenbrachte. In dieser Verehrung war nichts von Servilismus; Suphan liebte und bewunderte die Großherzogin ganz persönlich.
In treuer Anhänglichkeit war Suphan Herman Grimm zugetan. Er war vorher, in Berlin, wie ein Mitglied im Hause Grimm angesehen worden, hatte mit Befriedigung in der geistigen Atmosphäre geatmet, die in diesem Hause war. Aber es lag in ihm etwas, das ihn mit dem Leben nicht zurechtkommen ließ. Man konnte wohl mit ihm über die höchsten geistigen Angelegenheiten sprechen; aber es kam leicht etwas Säuerliches, das von seiner Empfindung ausging, in das Gespräch. Vor allem waltete dieses Säuerliche in seiner eigenen Seele; dann half er sich durch einen trockenen Humor über diese Empfindung hinweg. Und so konnte man mit ihm nicht warm werden. Er konnte in einem Atemzug ganz sympathisch das Große erfassen, und, ohne Übergang, in Kleinlich-Triviales verfallen. Er stand mir dauernd mit Wohlwollen gegenüber. Für die geistigen Interessen, die in meiner
Seele lebten, hatte er keine Anteilnahme, behandelte sie wohl auch zuweilen vom Gesichtspunkte seines trockenen Humors; für meine Arbeitsrichtung im Goethe-Archiv und für mein persönliches Leben hatte er aber das größte Interesse.
Ich kann nicht in Abrede stellen, daß mich manchmal recht unangenehm berührte, was Suphan tat, wie er sich in der Führung des Archivs und in der Leitung der Goethe-Ausgabe verhielt; ich habe daraus nie ein Hehl gemacht. Aber, wenn ich auf die Jahre zurückblicke, die ich mit ihm durchlebt habe, so überwiegt doch eine starke innere Anteilnahme an dem Schicksal und an der Persönlichkeit des schwer geprüften Mannes. Er litt am Leben und er litt an sich. Ich sah, wie er gewissermaßen immer mehr mit guten Seiten seines Charakters und seiner Fähigkeiten in ein bodenloses, wesenloses Grübeln versank, das in seiner Seele aufstieg. Als das Goethe- und Schiller-Archiv in das neue, an der ihm gebaute Haus einzog, sagte Suphan, er komme sich vor gegenüber der Eröffnung dieses Hauses wie eines der Menschenopfer, die in uralten Zeiten vor den Toren geheiligter Gebäude zum Segen der Sache eingemauert wurden. Er hatte sich auch allmählich ganz in die Rolle eines für die Sache, mit der er sich doch nicht ganz verbunden fühlte, Geopferten hineinphantasiert. Wie ein Lasttier der Goethe-Arbeit, das keine Freude empfinden konnte an einer Aufgabe, bei der andere mit höchster Begeisterung hätten sein können, empfand er sich. In dieser Stimmung fand ich ihn später immer, wenn ich ihn nach meinem Weggang von Weimar traf. Er endete durch Selbstmord in getrübtem Bewußtsein.
Außer Bernhard Suphan wirkte am Goethe- und Schiller-Archiv zur Zeit meines Eintrittes Julius Wahle. Er war noch von Erich Schmidt berufen worden. Wahle und ich waren einander schon zur Zeit meines ersten Aufenthaltes in Weimar nahegekommen; es bildete sich zwischen uns eine herzliche Freundschaft aus. Wahle arbeitete an der Herausgabe von Goethes Tagebüchern. Als Archivar wirkte Eduard von der Hellen, der auch die Ausgabe von Goethes Briefen besorgte.
An «Goethes Werken» wirkte ein großer Teil der deutschen Germanistenwelt mit. Es war ein fortwährendes Kommen und Gehen von Professoren und Privatdozenten der Philologie. Man war mit diesen dann auch außerhalb der Archivstunden während ihrer längeren und kürzeren Besuche viel zusammen. Man konnte sich ganz in die Interessenkreise dieser Persönlichkeiten einleben.
Außer diesen eigentlichen Mitarbeitern an der Goethe-Ausgabe wurde das Archiv von zahlreichen Persönlichkeiten besucht, die sich für das eine oder das andere der reichen Handschriftensammlungen deutscher Dichter interessierten. Denn das Archiv wurde nach und nach die Sammelstätte vieler Dichter-Nachlässe. Und auch andere Interessenten kamen, die zunächst weniger mit Handschriften zu tun hatten, die nur innerhalb der Archivräume in der vorhandenen Bibliothek studieren wollten. Auch viele Besucher, die nur die Schätze des Archivs sehen wollten, gab es.
Eine Freude war es allen, die im Archiv arbeiteten, wenn Loeper erschien. Er trat mit sympathisch-liebenswürdigen Bemerkungen ein. Er ließ sich sein Arbeits-
material geben, setzte sich hin und arbeitete nun stundenlang mit einer Konzentration, die man selten an einem Menschen bemerken kann. Was auch um ihn herum vorging, er blickte nicht auf. - Sollte ich nach einer Personifikation der Liebenswürdigkeit suchen: ich würde Herrn v. Loeper wählen. Liebenswürdig war seine Goethe-Forschung, liebenswürdig jedes Wort, das er zu jemand sprach. Besonders liebenswürdig war die Prägung, die sein ganzes Seelenleben dadurch angenommen hatte, daß er fast immer nur daran zu denken schien: wie bringt man Goethe der Welt zum rechten Verständnis. Ich saß einmal neben ihm bei einer Faust-Aufführung im Theater. Ich fing an, über die Art der Darstellung, über das Schauspielerische zu sprechen. Er hörte gar nicht, was ich sagte. Aber er erwiderte: «Ja, diese Schauspieler sprechen ja oft Worte und Wendungen, die mit den Goethe'schen nicht ganz stimmen.» Noch liebenswürdiger erschien mir Loeper in seiner «Zerstreutheit». Als ich in der Pause auf etwas zu sprechen kam, wobei man eine Zeitdauer ausrechnen sollte, sagte Loeper: «Also die Stunde zu 100 Minuten, die Minute zu 100 Sekunden...» Ich schaute ihn an und sagte: «Exzellenz, 60.» Er nahm seine Uhr heraus, prüfte, lächelte herzlich, zählte und sprach: «Ja, ja, 60 Minuten, 60 Sekunden.» Ähnliche Proben von «Zerstreutheit» erlebte ich viele bei ihm. Aber selbst über solche Proben der Eigenart von Loepers Seelenverfassung konnte ich nicht lachen, denn sie erschienen als eine notwendige Beigabe des ganz posenlosen, unsentimentalischen, ich möchte sagen, graziösen Ernstes dieser Persönlichkeit, der zugleich anmutig wirkte. Er sprach in etwas sich übersprudelnden Sätzen, fast ohne
allen Tonfall; aber man hörte durch die farblose Sprache eine starke Artikulation der Gedanken.
Geistige Vornehmheit zog in das Archiv ein, wenn Herman Grimm erschien. Von dem Zeitpunkte an, da ich- noch in Wien - sein Goethe-Buch gelesen hatte, lebte zu seiner Geistesart die tiefste Neigung in mir. Und da ich ihm im Archiv zum erstenmal begegnen durfte, hatte ich fast alles gelesen, was bis dahin von ihm erschienen war. Durch Suphan wurde ich denn bald näher mit ihm bekannt. Er lud mich dann einmal, als Suphan nicht in Weimar anwesend war und er zum Besuch ins Archiv kam, zu einem Mittagessen in sein Hotel ein. Ich war allein mit ihm. Ihm war offenbar sympathisch, wie ich auf seine Art, Welt und Leben anzusehen, eingehen konnte. Er wurde mitteilsam. Er sprach zu mir von seiner Idee einer «Geschichte der deutschen Phantasie», die er in seiner Seele trug. Ich bekam damals den Eindruck, daß er eine solche schreiben wolle. Es ist nicht dazu gekommen. Aber er setzte mir schön auseinander, wie der fortlaufende Strom des geschichtlichen Werdens seine Impulse in der schaffenden Volksphantasie habe, die in seiner Auffassung den Charakter eines lebenden, wirkenden übersinnlichen Genius annahm. Ich war während dieses Mittagsmahles ganz erfüllt von den Ausführungen Herman Grimms. Ich glaubte zu wissen, wie die übersinnliche Geistigkeit durch Menschen wirkt. Ich hatte einen Mann vor mir, dessen Seelenblick bis zu der schaffenden Geistigkeit reicht, der aber nicht das Eigenleben dieser Geistigkeit erkennend ergreifen will, sondern der in der Region verbleibt, wo sich im Menschen das Geistige als Phantasie auslebt.
Herman Grimm hatte eine besondere Gabe, größere oder kleinere Epochen der Geistesgeschichte zu überschauen und das Überschaute in präzisen, geistvollen epigrammatischen Charakteristiken darzustellen. Wenn er eine einzelne Persönlichkeit, wenn er Michel Angelo, Raphael, Goethe, Homer schilderte, so erschien seine Darstellung immer auf dem Hintergrunde solcher Überschauen. Wie oft habe ich doch seinen Aufsatz gelesen, in dem er Griechentum, Römertum, Mittelalter in seinen schlagenden Überblicken charakterisiert. Der ganze Mann war die Offenbarung eines einheitlichen Stiles. Wenn er seine schönen Sätze im mündlichen Gespräche prägte, so hatte ich die Vorstellung: das könnte genau so in einem Aufsatze von ihm stehen; und wenn ich, nachdem ich ihn kennen gelernt hatte, einen Aufsatz von ihm las, so vermeinte ich, ihn sprechen zu hören. Er ließ sich keine Lässigkeit im mündlichen Gespräche durch; aber er hatte das Gefühl, man müsse im künstlerisch-schriftstellerischen Darstellen der Mensch bleiben, als der man alltäglich herumwandelt. Aber Herman Grimm wandelte eben in der Alltäglichkeit nicht so herum wie andere Menschen. Es war ihm selbstverständlich, ein stilisiertes Leben zu führen.
Wenn Herman Grimm in Weimar und im Archiv erschien, dann fühlte man die Nachlaßstätte wie durch geheime geistige Fäden mit Goethe verbunden. Nicht so, wenn Erich Schmidt kam. Er war nicht durch Ideen, sondern durch die historisch-philologische Methode mit den Papieren verbunden, die im Archiv aufbewahrt waren. Ich konnte nie ein menschliches Verhältnis zu Erich Schmidt gewinnen. Und so ging denn an mir ziemlich
interesselos vorbei, was sich an großer Verehrung für diesen in den Kreisen aller derer auslebte, die als Scherer-Philologen im Archiv arbeiteten.
Sympathische Augenblicke waren es immer, wenn der Großherzog Karl Alexander im Archiv erschien. Eine in vornehmer Haltung auftretende, aber innerlich wahre Begeisterung für alles, was an Goethe anknüpfte, lebte in dieser Persönlichkeit. Durch sein Alter, seine lange Verbindung mit vielem Bedeutenden im deutschen Geistesleben, durch seine gewinnende Liebenswürdigkeit machte er einen wohltuenden Eindruck. Es war ein befriedigender Gedanke, ihn als Beschützer der Goethe-Arbeit im Archiv zu wissen.
Die Großherzogin Sophie, die Besitzerin des Archivs, sah man in diesem nur bei besonders feierlichen Anlässen. Wenn sie etwas zu sagen hatte, ließ sie Suphan zu sich rufen. Die mitarbeitenden Besucher wurden zu ihr geführt, uni ihr vorgestellt zu werden. Ihre Fürsorge für das Archiv war aber eine außerordentliche. Sie bereitete damals persönlich alles vor, was zum Bau eines staatlichen Hauses führen sollte, in dem die Dichternachlässe würdig untergebracht werden sollten.
Auch der Erbgroßherzog Karl August, der, bevor er zur Regierung kam, gestorben ist, kam öfter ins Archiv. Sein Interesse an all dem, was da vorhanden war, ging nicht tief, aber er unterhielt sich gerne mit uns Mitarbeitenden. Er betrachtete es mehr als Pflicht, sich für die Angelegenheiten des geistigen Lebens zu interessieren. Warm aber war das Interesse der Erbgroßherzogin Pauline. Mit ihr konnte ich manches Gespräch über Dinge führen, die Goethe, Dichtung usw. betrafen. Das Archiv
stand in bezug auf seinen Verkehr zwischen der wissenschaftlichen, künstlerischen und der Weimarischen Hofgesellschaft darinnen. Von beiden Seiten her erhielt es seine eigene gesellschaftliche Färbung. Kaum hatte sich die Türe hinter einem Kathedermann geschlossen, so ging sie wieder für irgendeine fürstliche Persönlichkeit auf, die am Hofe zum Besuche erschienen war. Viele Menschen aller gesellschaftlichen Stellungen nahmen teil an dem, was im Archiv geschah. Es war im Grunde ein reges, in vieler Beziehung anregendes Leben.
In der unmittelbaren Nachbarschaft des Archivs war die Weimarische Bibliothek. In ihr hauste ein Mann mit kindlichem Gemüte und einer schier unbegrenzten Gelehrsamkeit, Reinhold Köhler, als Oberbibliothekar. Die Mitarbeiter des Archivs hatten oft dort zu tun. Denn, was sie im Archiv als literarische Hilfsmittel ihrer Arbeit hatten, fand dort seine wichtige Ergänzung. Reinhold Köhler war in einzigartiger Umfänglichkeit bewandert in der Mythen-, Märchen- und Sagenschöpfung; sein Wissen auf sprachgelehrtem Gebiet war von der bewunderungswürdigsten Universalität. Er wußte Rat im Aufsuchen der verborgensten Literaturbelege. Dabei war er von rührender Bescheidenheit, von herzlichstem Entgegenkommen. Er ließ es sich nie nehmen, die Bücher, die man brauchte, selbst von ihren Ruheplätzen her in das Bibliotheksarbeitszimmer, wo man arbeitete, zu holen. Ich kam einmal hin, bat um ein Buch, das Goethe bei seinen botanischen Studien benützt hatte, um es einzusehen. Reinhold Köhler holte den Schmöker, der wohl seit Jahrzehnten unbenützt ganz oben irgendwo gelagert hatte. Er kam längere Zeit nicht zurück. Man schaute
nach, wo er blieb. Er war von der Leiter gefallen, auf der er zur Besorgung des Buches zu klettern harte. Ein Bruch eines Oberschenkelknochens. Die liebe, edle Persönlichkeit konnte sich von den Folgen des Unfalles nicht mehr erholen. Nach langem Kranksein starb der weithin verehrte Mann. Ich litt unter dem schmerzlichen Gedanken, daß sein Unfall bei dem Besorgen eines Buches für mich geschehen war.
XV.
An zwei Vorträge, die ich bald nach dem Beginne meines weimarischen Lebensabschnittes zu halten hatte, knüpfen sich für mich wichtige Erinnerungen. Der eine fand in Weimar statt und hatte den Titel «Die Phantasie als Kulturschöpferin»; er ging dem charakterisierten Gespräch mit Herman Grimm über dessen Anschauungen von der Geschichte der Phantasie-Entwickelung voran. Bevor ich den Vortrag hielt, faßte ich in meiner Seele zusammen, was ich aus meinen geistigen Erfahrungen heraus über die unbewußten Einströmungen der wirklichen Geisteswelt in die menschliche Phantasie sagen konnte. Mir erschien, was in der Phantasie lebt, nur dem Stoffe nach angeregt von den Erlebnissen der menschlichen Sinne. Das eigentlich Schöpferische in den echten Phantasiegestaltungen zeigte sich mir als ein Abglanz der außer dem Menschen bestehenden geistigen Welt. Ich wollte zeigen, wie die Phantasie das Tor ist, durch das die Wesenheiten der geistigen Welt schaffend auf dem Umwege durch den Menschen in die Entfaltung der Kulturen hereinwirken.
Weil ich für einen solchen Vortrag meine Ideen nach einem solchen Ziele hin orientiert hatte, machte mir die Auseinandersetzung Herman Grimms einen tiefen Eindruck. Dieser hatte gar nicht das Bedürfnis, nach den übersinnlich geistigen Quellen der Phantasie zu forschen; er nahm, was in Menschenseelen als Phantasie auftrat, seiner Tatsächlichkeit nach hin und wollte es seiner Entwickelung nach betrachten.
Ich stellte zunächst den Einen Pol der Phantasie-Ent-
faltung, das Traumleben, dar. Ich zeigte, wie äußere Sinnesempfindungen durch das herabgedämpfte Bewußtseinsleben im Traume nicht wie im Wachleben, sondern in symbolisch-bildlicher Umgestaltung erfahren werden; wie innere Leibesvorgänge in ebensolcher Symbolisierung erlebt werden; wie Erlebnisse nicht in nüchterner Erinnerung, sondern in einer Art im Bewußtsein aufsteigen, die auf ein kraftvolles Arbeiten des Erlebten in den Tiefen des Seelenseins hinweist.
Im Traume ist das Bewußtsein herabgedämpft; es versenkt sich da in die sinnlich-physische Wirklichkeit und schaut das Walten eines Geistigen im Sinnensein, das in der sinnlichen Wahrnehmung verborgen bleibt, das aber auch dem halbschlafenden Bewußtsein nur wie ein Heraufschillern aus den Untiefen des Sinnlichen erscheint.
In der Phantasie erhebt sich die Seele um ebensoviel über den gewöhnlichen Bewußtseinsstand, wie sie sich im Traumleben unter denselben heruntersenkt. Es erscheint nicht das im Sinnensein verborgene Geistige, sondern das Geistige wirkt auf den Menschen; er kann es aber nicht in seiner ureigenen Gestalt erfassen, sondern er verbildlicht es sich unbewußt durch einen Seeleninhalt, den er aus der Sinneswelt entlehnt. Das Bewußtsein dringt nicht bis zur Anschauung der Geisteswelt vor; aber es erlebt diese in Bildern, die ihren Stoff aus der Sinneswelt entnehmen. Dadurch werden die echten Phantasie-Schöpfungen zu Erzeugnissen der geistigen Welt, ohne daß diese selbst in das Bewußtsein des Menschen eindringt.
Ich wollte durch den Vortrag einen der Wege zeigen, auf denen die Wesenheiten der geistigen Welt an der Entwickelung des Lebens arbeiten.
So bemühte ich mich, Mittel zu finden, durch die ich die erlebte Geisteswelt zur Darstellung bringen und doch in irgend einer Art anknüpfen konnte an das, was dem gewöhnlichen Bewußtsein geläufig ist. Ich war eben der Ansicht: vom Geiste müsse gesprochen werden; aber die Formen, in denen man sich in diesem wissenschaftlichen Zeitalter auszusprechen gewohnt ist, müßten respektiert werden.
Den andern Vortrag hielt ich in Wien. Der «Wissenschaftliche Club» hatte mich dazu eingeladen. Er handelte von der Möglichkeit einer monistischen Weltauffassung unter Wahrung einer wirklichen Erkenntnis vom Geistigen. Ich stellte dar, wie der Mensch durch die Sinne von außen die physische Seite der Wirklichkeit, durch die geistige Wahrnehmung «von innen» deren geistige Seite erfaßt, so daß alles, was erlebt wird, als einheitliche Welt erscheint, in der das Sinnliche den Geist abbildet, der Geist sich im Sinnlichen schaffend offenbart.
Es war das in der Zeit, in der Haeckel seiner monistischen Weltauffassung eine Formulierung gegeben hatte durch seine Rede über den «Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft». Haeckel, der von meinerAnwesenheit in Weimar wußte, schickte mir einen Abdruck seiner Rede. Ich erwiderte die mir erwiesene Aufmerksamkeit, indem ich Haeckel das Heft der Zeitschrift übersandte, in dem meine Wiener Rede abgedruckt war. Wer diese Rede liest, der muß sehen, wie ablehnend ich mich damals gegen den von Haeckel vorgebrachten Monismus verhielt, wenn es mir darauf ankam, bemerklich zu machen, was ein Mensch über diesen Monismus zu sagen hat, für den die Geisteswelt etwas ist, in das er hineinschaut.
Aber es gab damals für mich noch eine andere Notwendigkeit, auf den Monismus in Haeckel'scher Färbung hinzuschauen. Er stand vor mir als eine Erscheinung des naturwissenschaftlichen Zeitalters. Philosophen sahen in Haeckel den philosophischen Dilettanten, der in Wirklichkeit nichts anderes kannte als die Gestaltungen der Lebewesen, auf die er die darwinistischen Ideen an-wandte, in der Form, die er sich zurecht gelegt hatte, und der kühn erklärte: nichts anderes dürfe zum Ausgestalten einer Weltanschauung verwendet werden, als was sich ein darwinistisch gebildeter Naturbeobachter vorstellen kann. Naturforscher sahen in Haeckel einen Phantasten, der aus den naturwissenschaftlichen Beobachtungen Schlüsse zieht, die willkürlich gezogen sind.
Indem ich durch meine Arbeit genötigt war, die innere Verfassung des Denkens über Welt und Mensch, über Natur und Geist, wie sie ein Jahrhundert zuvor in Jena geherrscht hat, da Goethe seine naturwissenschaftlichen Ideen in dieses Denken hineinwarf, darzustellen, veranschaulichte sich mir im Hinblicke auf Haeckel, was in der damaligen Gegenwart in dieser Richtung gedacht wurde. Goethes Verhältnis zur Naturanschauung seiner Zeit mußte ich während meiner Arbeit in allen Einzelheiten mir vor das Seelenauge stellen. An der Stätte in Jena, von der für Goethe die bedeutsamen Anregungen ausgegangen waren, seine Ideen über Naturerscheinungen und Naturwesen auszubilden, wirkte ein Jahrhundert später Haeckel mit dem Anspruch, aus der Naturerkenntnis heraus Maßgebliches für eine Weltanschauung sagen zu können.
Dazu kam, daß an einer der ersten Versammlungen
der Goethe-Gesellschaft, an der ich während meiner Weimarer Arbeit teilnahm, Helmholtz über «Goethes Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Ideen» einen Vortrag hielt. Da wurde ich auf manches hingewiesen, das Goethe durch eine glückliche Eingebung von späteren naturwissenschaftlichen Ideen «vorausgeahnt» habe, da wurde aber auch angedeutet, wie sich Goethes Verirrungen auf diesem Gebiete an seiner Farbenlehre zeigten.
Wenn ich auf Haeckel blickte, wollte ich mir immer Goethes eigenes Urteil vor die Seele stellen über die Entwickelung der naturwissenschaftlichen Anschauungen in dem Jahrhundert, das auf die Ausgestaltung der seinigen gefolgt war; als ich Helmholtz zuhörte, stand das Urteil dieser Entwickelung über Goethe vor meiner Seele.
Ich konnte damals nicht anders, als mir sagen, wenn aus der herrschenden Geistesverfassung der damaligen Zeit über das Wesen der Natur gedacht wird, so muß das herauskommen, was Haeckel in vollkommener philosophischer Naivität denkt; die ihn bekämpfen, zeigen überall, daß sie bei der bloßen Sinnesanschauung stehen bleiben und das Fortentwickeln dieser Anschauung durch das Denken vermeiden wollen.
Ich hatte zunächst kein Bedürfnis, Haeckel, an den ich viel zu denken gezwungen war, persönlich kennen zu lernen. Da kam sein sechzigster Geburtstag heran. Ich wurde veranlaßt, an der glänzenden Festlichkeit teilzunehmen, die damals in Jena veranstaltet wurde. Das Menschliche an dieser Festlichkeit zog mich an. Während des Festessens trat Haeckels Sohn, den ich in Weimar, wo er an der Malerschule war, kennen gelernt hatte,
an mich heran und sagte, sein Vater möchte, daß ich ihm vorgestellt werde. Das tat denn nun der Sohn.
So lernte ich Haeckel persönlich kennen. Er war eine bezaubernde Persönlichkeit. Ein Augenpaar, das naiv in die Welt blickte, so milde, daß man das Gefühl hatte, dieser Blick müßte sich brechen, wenn Schärfe des Denkens sich durch ihn durchdränge. Der konnte nur Sinnes-Eindrücke vertragen, nicht Gedanken, die sich in den Dingen und Vorgängen offenbaren. Jede Bewegung an Haeckel war darauf gerichtet, gelten zu lassen, was die Sinne aussprechen, nicht den beherrschenden Gedanken in ihr sich offenbaren zu lassen. Ich verstand, warum Haeckel so gerne malte. Er ging in der Sinnesanschauung auf. Wo er beginnen sollte, zu denken, da hörte er auf, die Seelentätigkeit zu entfalten und hielt lieber das Gesehene durch den Pinsel fest. So war die eigene Wesenheit Haeckels. Härte er nur sie entfaltet, etwas ungemein reizvoll Menschliches hätte sich geoffenbart.
Aber in einem Winkel dieser Seele wühlte etwas, das eigensinnig als ein bestimmter Gedankeninhalt sich geltend machen wollte. Etwas, das aus ganz anderen Weltrichtungen herkam, als sein Natursinn. Die Richtung eines früheren Erdenlebens, mit fanatischem Einschlag, auf ganz anderes gerichtet als auf die Natur, wollte sich austoben. Religiöse Politik lebte sich aus den Untergründen der Seele herauf aus und benützte die Natur-Ideen, um sich auszusprechen.
In solch widerspruchvoller Art lebten zwei Wesen in Haeckel. Ein Mensch mit mildem, liebeerfülltem Natursinn, und dahinter etwas wie ein Schattenwesen mit unvollendet gedachten, engumgrenzten Ideen, die Fanatis-
mus atmeten. Wenn Haeckel sprach, dann ließ seine Milde den Fanatismus nur schwer sich in das Wort ergießen; es war, wie wenn naturgewollte Sanftheit ein verborgenes Dämonisches im Sprechen abstumpfte. Ein Menschenrätsel, das man nur lieben konnte, wenn man es sah; über das man oft in Zorn geraten konnte, wenn es urteilte. So sah ich Haeckel vor mir, als er in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das vorbereitete, was dann zu dem wilden Geisteskampfe führte, der um die Jahrhundertwende wegen seiner Gedankenrichtung tobte.
Unter den Weimar-Besuchern war auch Heinrich v. Treitschke. Ich konnte ihn kennen lernen, da Suphan mich miteinlud, als er Treitschke einmal zum Mittagsmahle bei sich hatte. Ich hatte einen tiefen Eindruck von dieser viel umstrittenen Persönlichkeit. Treitschke war völlig taub. Man verständigte sich mit ihm, indem er kleine Zettel reichte, auf die man schrieb, was man an ihn heranbringen wollte. Das ergab, daß in einer Gesellschaft, in der er sich befand, seine Persönlichkeit in dem Mittelpunkte stand. Hatte man etwas aufgeschrieben, so sprach er dann darüber, ohne daß ein wirkliches Gespräch entstand. Er war für die Andern in viel intensiverer Art da, als sie für ihn. Das war in seine ganze Seelenhaltung übergegangen. Er sprach, ohne daß er mit Einwänden zu rechnen hatte, die einem andern begegnen, der unter Menschen seine Gedanken mitteilt. Man konnte deutlich sehen, wie das in seinem Selbstbewußtsein Wurzel gefaßt hatte. Weil er keine Einwände gegen seine Gedanken hören konnte, empfand er stark den Wert dessen, was er selber dachte.
Die erste Frage, die Treitschke an mich richtete, war, woher ich stamme. Ich schrieb auf das Zettelchen, ich sei Österreicher. Treitschke erwiderte: Die Österreicher sind entweder ganz gute und geniale Menschen oder Schurken. Er sprach solches, indem man wahrnahm, die Einsamkeit, in der seine Seele durch die Taubheit lebte, drängte zum Paradoxen und hatte an diesem eine innere Befriedigung. Die Mittagsgäste blieben bei Suphan gewöhnlich den ganzen Nachmittag zusammen. So war es auch damals, als Treitschke unter ihnen war. Man konnte diese Persönlichkeit sich entfalten sehen. Der breitschultrige Mann hatte auch in seiner geistigen Persönlichkeit etwas, durch das er sich breit unter seinen Mitmenschen zur Geltung brachte. Man kann nicht sagen, Treitschke dozierte. Denn es trug alles, was er sprach, den Charakter des Persönlichen. Leidenschaftliche Lust, sich auszusprechen, lebte in jedem Wort. Wie befehlend war sein Ton, auch wenn er nur erzählte. Er wollte, daß auch der andere im Gefühle von seinem Worte ergriffen werde. Seltenes Feuer, das aus seinen Augen sprühte, begleitete seine Behauptungen. Das Gespräch kam damals auf Moltkes Weltanschauung, wie sich diese in dessen Lebenserinnerungen ausgesprochen fand. Treitschke verwarf die unpersönliche, an das mathematische Denken erinnernde Art, in der Moltke die Welterscheinungen auffaßte. Er konnte gar nicht anders, als mit dem Unterton starker persönlicher Sympathien und Antipathien die Dinge beurteilen. Menschen, die wie Treitschke so ganz in ihrer Persönlichkeit stecken, können auf andre Menschen nur einen Eindruck machen, wenn das Persönliche zugleich bedeutend und tief mit den Dingen verwoben
ist, die sie vorbringen. Das war bei Treitschke so. Wenn er von Historischem sprach, so redete er so, als ob alles gegenwärtig wäre und er persönlich dabei mit all seiner Freude und all seinem Ärger. Man hörte dem Manne zu, man behielt den Eindruck des Persönlichen in einer unbegrenzten Stärke; aber man bekam zu dem Inhalt des Gesagten kein Verhältnis.
Einem andern Weimar-Besucher trat ich freundschaftlich sehr nahe. Es war Ludwig Laistner. Eine feine, auf die schönste Art im Geistigen lebende, in sich harmonische Persönlichkeit. Er war damals literarischer Beirat der Cotta'schen Verlagsbuchhandlung und hatte als solcher im Goethe-Archiv zu arbeiten. Ich konnte fast alle Zeit, die uns frei blieb, mit ihm zubringen. Sein Hauptwerk, «Das Rätsel der Sphinx», lag damals schon der Welt vor. Es ist eine Art Mythengeschichte. Er geht in der Erklärung des Mythischen seine eigenen Wege. Unsere Gespräche bewegten sich viel auf dem Gebiete, das in dem so bedeutenden Buche behandelt ist. Laistner verwirft alle Erklärung des Märchenhaften, des Mythischen, die sich an die mehr oder weniger bewußt symbolisierende Phantasie hält. Er sieht den Ursprung der mythisierenden Naturauffassung des Volkes in dem Traume, namentlich dem Alptraume. Der drückende Alp, der sich als peinigender Fragegeist für den Träumenden zeigt, wird zum Alb, zur Elfe, zum dämonischen Quäler; die ganze Schar der Geister entsteigt für Ludwig Laistner aus dem träumenden Menschen. Die fragende Sphinx ist eine andere Metamorphose der einfachen Mittagsfrau, die dem auf dem Felde am Mittag Schlafenden erscheint und ihm Fragen aufgibt, die er zu beantworten hat. - Alles, was
der Traum an paradoxen, sinnigen und sinn-vollen, an peinigenden und lust-erfüllten Gestaltungen schafft, das verfolgte Ludwig Laistner, um es in den Märchen- und Mythen-Bildungen wieder aufzuweisen. Ich hatte bei jedem Gespräche das Gefühl: der Mann könnte so leicht den Weg finden von dem im Menschen schaffenden Unterbewußten, das in der Traumwelt wirkt, zu dem Überbewußten, das auf die reale Geistwelt trifft. Er hörte meine diesbezüglichen Auseinandersetzungen mit dem größten Wohlwollen an; wendete nichts dagegen ein, aber ein innerliches Verhältnis dazu gewann er doch nicht. Daran hinderte auch ihn die in der Zeitgesinnung liegende Furcht, sogleich den «wissenschaftlichen» Boden zu verlieren, wenn man an das Geistige als solches herantritt. Aber Ludwig Laistner stand zu Kunst und Poesie dadurch in einem besonderen Verhältnis, daß er das Mythische an die realen Traumerlebnisse und nicht an die abstrakt schaffende Phantasie herantrug. Alles Schöpferische im Menschen bekam dadurch in seiner Auffassung eine Weltbedeutung. Er war bei einer seltenen inneren Ruhe und seelischen Geschlossenheit eine feinsinnige, poetische Persönlichkeit. Seine Aussagen über alle Dinge hatten etwas Poesievolles. Begriffe, die unpoetisch sind, kannte er eigentlich gar nicht. Ich habe mit ihm in Weimar, dann bei einem Besuche in Stuttgart, wo ich bei ihm wohnen durfte, schönste Stunden verlebt. An seiner Seite stand seine ganz in seiner geistigen Wesenheit aufgehende Gattin. Für sie war Ludwig Laistner eigentlich alles, was sie mit der Welt verband. Er lebte nach seinem Besuche in Weimar nur noch kurze Zeit. Die Frau folgte dem Dahingeschiedenen in der aller-
kürzesten Zeit nach; die Welt war für sie leer, als Ludwig Laistner nicht mehr in ihr war. Eine ganz selten liebenswürdige, in der Liebenswürdigkeit wahrhaft bedeutende Frau. Sie wußte immer abwesend zu sein, wenn sie zu stören vermeinte; sie fehlte nie, wenn sie für etwas zu sorgen hatte. Mütterlich stand sie an Ludwig Laistners Seite, der mit seiner feinen Geistigkeit in einem sehr zarten Körper steckte.
Mit Ludwig Laistner konnte ich wie mit wenigen andern Menschen über den Idealismus der deutschen Philosophen Fichte, Hegel, Schelling sprechen. Er hatte den lebendigen Sinn für die Realität des Ideellen, die in diesen Philosophen lebte. Als ich ihm einmal von meinen Sorgen über die Einseitigkeit der naturwissenschaftlichen Weltauffassung sprach, sagte er: die Leute haben eben keine Ahnung von der Bedeutung des Schöpferischen in der Menschenseele. Sie wissen nicht, daß in diesem Schöpferischen gerade so Weltinhalt lebt wie in den Naturerscheinungen.
Über dem Literarischen und Künstlerischen verlor Ludwig Laistner nicht das Verhältnis zu dem unmittelbar Menschlichen. Bescheiden war bei ihm Haltung und
Auftreten: wer Verständnis dafür hat, der fühlte bald nach der Bekanntschaft mit ihm das Bedeutende seiner Persönlichkeit. Die offiziellen Mythenforscher standen zu seiner Auffassung gegnerisch; sie berücksichtigten sie kaum. So blieb im Geistesleben ein Mann fast unbeachtet, dem nach seinem inneren Werte eine erste Stelle gebührt. Von seinem Buche «Rätsel der Sphinx» hätte die Mythen-Wissenschaft ganz neue Impulse empfangen können; es blieb fast ganz ohne Wirkung.
Ludwig Laistner hatte damals in die «Cotta'sche Bibliothek der Weltliteratur» eine vollständige Schopenhauer-Ausgabe und eine Ausgabe von ausgewählten Werken Jean Pauls aufzunehmen. Er übertrug mir diese beiden. Und so hatte ich in meine damaligen weimarischen Aufgaben die vollständige Durcharbeitung des pessimistischen Philosophen und des genial-paradoxen Jean Paul einzugliedern. Beiden Arbeiten unterzog ich mich mit dem tiefsten Interesse, weil ich es liebte, mich in Geistes-verfassungen zu versetzen, die der meinigen stark entgegengesetzt sind. Es waren bei Ludwig Laistner nicht äußerliche Motive, durch die er mich zum Schopenhauer- und Jean Paul-Herausgeber machte; der Auftrag entsprang durchaus den Gesprächen, die wir über die beiden Persönlichkeiten geführt hatten. Er kam auch zu dem Gedanken, mir diese Aufgaben zu übertragen, mitten in einem Gespräche.
In Weimar wohnten damals Hans Olden und Frau Grete Olden. Sie versarnmelten einen geselligen Kreis um sich, der «Gegenwart» leben wollte, im Gegensatz zu allem, was wie die Fortsetzung eines vergangenen Lebens in Goethe-Archiv und Goethe-Gesellschaft den Mittelpunkt des geistigen Daseins sah. In diesen Kreis wurde ich aufgenommen; und ich denke mit großer Sympathie an alles zurück, was ich in ihm erlebt habe.
Man konnte seine Ideen im Archiv noch so stark versteift haben an dem Mit-Erleben der «philologischen Methode»; sie mußten frei und flüssig werden, wenn man in Oldens Haus kam, wo alles Interesse fand, was sich in den Kopf gesetzt hatte, daß eine neue Denkweise in der Menschheit Boden gewinnen müsse; aber auch
alles, was mit Seelen-Innigkeit manches alte Kultur-Vorurteil schmerzlich empfand und an Zukunfts-Ideale dachte.
Hans Olden kennt die Welt als den Verfasser leichtgeschürzter Theaterstücke wie die «Offizielle Frau»; in seinem damaligen weimarischen Kreise lebte er sich anders aus. Er hatte ein offenes Herz für die höchsten Interessen, die zu dieser Zeit im geistigen Leben vorhanden waren. Was in Ibsens Dramen lebte, was in Nietzsches Geiste rumorte, darüber wurden in seinem Hause endlose, aber immer anregende Diskussionen geführt.
Gabriele Reuter, die damals an dem Roman «Aus guter Familie» schrieb, der ihr bald darauf wie im Sturm ihre literarische Stellung eroberte, fand sich in Oldens Kreis ein und erfüllte ihn mit allen ernsten Fragen, die damals die Menschheit in bezug auf das Leben der Frau bewegten.
Hans Olden konnte reizvoll werden, wenn er sofort mit seiner leicht-skeptischen Denkweise ein Gespräch stoppte, das sich in Sentimentalität verlieren wollte; aber er konnte selbst sentimental werden, wenn andere ins Leichtlebige verfielen. Man wollte in diesem Kreise für alles «Menschliche» tiefstes «Verständnis» entwickeln; aber man kritisierte schonungslos, was einem an diesem oder jenem Menschlichen nicht gefiel. Hans Olden war tief durchdrungen davon, daß es für einen Menschen nur Sinn habe, sich literarisch und künstlerisch den großen Idealen zuzuwenden, von denen in seinem Kreise recht viel gesprochen wurde; aber er war zu stark Menschenverächter, um in seinen Produktionen seine Ideale zu verwirklichen. Er meinte, Ideale können wohl in einem klei-
nen Kreise auserlesener Menschen leben; der aber sei ein «Kindskopf», der glaubte, solche Ideale vor ein größeres Publikum tragen zu können. Er machte gerade in der damaligen Zeit einen Ansatz zur künstlerischen Verwirklichung weiterer Interessen mit seiner «Klugen Käte». Dies Schauspiel konnte es in Weimar nur zu einem «Achtungserfolg» bringen. Das bestärkte ihn in der Ansicht, man gebe dem Publikum, was es nun einmal verlangt, und behalte seine höheren Interessen in den kleinen Kreisen, die dafür Verständnis haben.
In einem noch viel höheren Maße als Hans Olden war Frau Grete Olden von dieser Anschauung durchdrungen. Sie war die vollendetste Skeptikerin in der Schätzung dessen, was die Welt an Geistigem aufnehmen kann. Was sie schrieb, war ganz offensichtlich von einem gewissen Genius der Menschenverachtung eingegeben.
Was Hans Olden und Grete Olden aus solcher Seelenverfassung ihrem Kreise boten, atmete in der Atmosphäre einer ästhetisierenden Weltempfindung, die an das Ernsteste herankommen konnte, aber die auch nicht verschmähte, über manches Ernste mit leichtem Humor hinwegzukommen.
XVI.
Zu den schönsten Stunden meines Lebens muß ich zählen, was ich durch Gabriele Reuter erlebte, der ich durch diesen Kreis nahe treten durfte. Eine Persönlichkeit, die in sich tiefe Menschheitsprobleme trug und diese mit einem gewissen Radikalismus des Herzens und der Empfindung anfaßte. Sie stand mit voller Seele in all dem, was ihr im sozialen Leben als Widerspruch erschien zwischen traditionellem Vorurteil und den ursprünglichen Forderungen der Menschennatur. Sie sah hin auf die Frau, die von außen in diese traditionellen Vorurteile durch Leben und Erziehung eingespannt wird, und die leidvoll erfahren muß, was aus den Tiefen der Seele als «Wahrheit» in das Leben hinein will. Radikalismus des Herzens in ruhig-kluger Art ausgesprochen, von künstlerischem Sinn und eindringlicher Gestaltungskraft durchzogen, das offenbarte sich als Größe aus Gabriele Reuter. Unermeßlich reizvoll konnten die Gespräche sein, die man mit ihr, während sie an ihrem Buche «Aus guter Familie> arbeitete, führen durfte. Ich denke zurück und sehe mich mit ihr an einer Straßenecke stehen, bei glühendster Sonnenhitze diskutierend mehr als eine Stunde über Fragen, die sie bewegten. Gabriele Reuter konnte in würdigster Art, keinen Augenblick die ruhige Haltung verlierend, über Dinge sprechen, bei denen andere sogleich in sichtbare Aufregung geraten. «Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt», das lebte in ihren Gefühlen; doch blieb es in der Seele und zog sich nicht in die Worte hinein. Gabriele Reuter betonte scharf, was sie zu sagen hatte; aber sie tat es nie lautlich, sondern
allein seelisch. Ich glaube, daß ihr diese Kunst, bei lautlich gleichmäßigem Hinfließen der Rede die Artikulation ganz im Seelischen zu halten, als Stil besonders eigen ist. Und mir scheint, daß sie im Schreiben diese Eigenart zu ihrem so reizvollen Stil umfassend ausgebildet hat.
Die Bewunderung, die Gabriele Reuter im Olden'schen Kreise fand, hatte etwas unsäglich Schönes. Hans Olden sagte mir öfters ganz elegisch: diese Frau ist groß, konnte ich mich - fügte er hinzu - doch auch so mutvoll dazu aufschwingen, der äußeren Welt das darzustellen, was mich in der Tiefe der Seele bewegt.
Dieser Kreis machte auf seine besondere Art die weimarischen Goethe-Veranstaltungen mit. Es war ein Ton von Ironie, der aber nie frivol spottete, sondern oft sogar ästhetisch entrüstet war, was hier als «Gegenwart» die «Vergangenheit» beurteilte. Tagelang stand Olden nach Goethe-Versammlungen an der Schreibmaschine, um über das Erlebte Berichte zu schreiben, die nach seiner Meinung das Urteil des «Weltkindes» über die Goethe-Propheten geben sollten.
In diesen Ton fiel bald auch der eines anderen «Weltkindes», Otto Erich Hartlebens. Der fehlte fast bei keiner Goethe-Versammlung. Doch konnte ich zunächst nicht recht entdecken, warum er kam.
In dem Kreise der Journalisten, Theaterleute und Schriftsteller, die sich an den Abenden der Goethe-Feste, abgesondert von den «gelehrten Zelebritäten», im Hotel «Chemnitius» zusammenfanden, lernte ich Otto Erich Hattleben kennen. Warum er da saß, das konnte ich sogleich begreifen. Denn sich in Gesprächen, wie sie da gepflogen wurden, auszuleben, das war sein Element.
Da blieb er lange. Er konnte gar nicht fortgehen. So war ich einmal mit ihm und andern zusammen. Wir andern waren «pflichtgemäß» am nächsten Morgen in der Goethe-Versammlung. Hartleben war nicht da. Ich hatte ihn aber schon recht lieb gewonnen und war um ihn besorgt. Deshalb suchte ich ihn nach dem Ende der Versammlung in seinem Hotelzimmer auf. Er schlief noch. Ich weckte ihn und sagte, daß die Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft schon zu Ende sei. Ich begriff nicht, warum er auf diese Art das Goethe-Fest habe mitmachen wollen. Er aber erwiderte so, daß ich sah, ihm war es ganz selbstverständlich, nach Weimar zur Goethe-Versammlung zu fahren, um während deren Veranstaltungen zu schlafen. Denn er verschlief das meiste, weshalb die andern gekommen waren.
Nahe trat ich Otto Erich Hartleben auf eine besondere Art. An einem der angedeuteten Abendtische entspann sich einmal ein Gespräch über Schopenhauer. Es waren schon viele bewundernde und ablehnende Worte über den Philosophen gefallen. Hartleben hatte lange geschwiegen. Dann sagte er in wildwogende Gesprächsoffenbarungen hinein: «Man wird bei ihm aufgeregt; aber er ist doch nichts für das Leben. » Mich schaute er dabei fragend an, mit kindlich-hilflosem Blicke; er wollte, daß ich etwas sagen sollte, weil er gehört hatte, daß ich mich doch mit Schopenhauer beschäftige. Und ich sagte: «Schopenhauer muß ich für ein borniertes Genie halten.» Hartlebens Augen funkelten, er wurde unruhig, er trank aus und bestellte sich ein frisches Glas, er hatte mich in diesem Augenblicke in sein Herz geschlossen; seine Freundschaft zu mir war begründet. «Borniertes
Genie!» Das gefiel ihm. Ich hätte es ebenso gut von einer ganz anderen Persönlichkeit gebrauchen können, es wäre ihm gleichgültig gewesen. Ihn interessierte tief, daß man die Ansicht haben könne, auch ein Genie könne borniert sein.
Für mich waren die Goethe-Versammlungen anstrengend. Denn die meisten Menschen in Weimar waren während derselben in ihren Interessen entweder in dem einen oder dem andern Kreise, in dem der redenden oder tafelnden Philologen, oder in dem der Olden-Hartlebenschen Färbung. Ich mußte an beiden teilnehmen. Meine Interessen trieben mich eben nach beiden Seiten hin. Das ging, weil die einen ihre Sitzungen bei Tag, die andern bei Nacht hielten. Aber mir war es nicht erlaubt, die Lebensart Otto Erichs einzuhalten. Ich konnte während der Tag-Versammlungen nicht schlafen. Ich liebte die Vielseitigkeit des Lebens, und war wirklich gerade so gerne mittags im Archivkreise bei Suphan, der Hartleben nie kennen gelernt hat - weil sich das für ihn nicht schickte -, wie abends mit Hartleben und seinen Gesinnungsgenossen zusammen.
Die Weltanschauungsrichtungen einer Reihe von Menschen stellten sich mir während meiner Weimarischen Zeit vor die Seele. Denn mit jedem, mit dem Gespräche über Welt- und Lebensfragen möglich waren, entwickelten sich solche im damaligen unmittelbaren Verkehre. Und durch Weimar kamen eben viele an derartigen Gesprächen interessierte Persönlichkeiten durch.
Ich verlebte diese Zeit in dem Lebensalter, in dem die Seele sich, ihrer Neigung nach, intensiv dem äußeren Leben zuwendet, in dem sie ihren festen Zusammen-
schluß mit diesem Leben finden möchte. Mir wurden die sich darlebenden Weltanschauungen ein Stück Außenwelt. Und ich mußte empfinden, wie wenig ich im Grunde bis dahin mit einer Außenwelt gelebt hatte. Wenn ich mich von dem lebhaften Verkehre zurückzog, dann wurde ich gerade damals immer wieder gewahr, daß mir eine vertraute Welt bis dahin nur die geistige, die ich im Innern anschaute, gewesen ist. Mit dieser Welt konnte ich mich leicht verbinden. Und meine Gedanken gingen damals oft nach der Richtung, mir selbst zu sagen, wie schwer mir der Weg durch die Sinne zur Außenwelt während meiner ganzen Kindheit und Jugendzeit geworden ist. Ich habe immer Mühe gehabt, dem Gedächtnisse die äußeren Daten einzuverleiben, die sich anzueignen z. B. auf dem Gebiete der Wissenschaft notwendig ist. Ich mußte oft und oft ein Naturobjekt sehen, wenn ich wissen sollte, wie man es nennt, in welche Klasse es wissenschaftlich eingereiht ist usw. Ich darf schon sagen: die Sinneswelt hatte für mich etwas Schattenhaftes, Bildhaftes. Sie zog in Bildern vor meiner Seele vorbei, während der Zusammenhalt mit dem Geistigen durchaus den echten Charakter des Wirklichen trug.
Das alles empfand ich am meisten in dem Anfang der neunziger Jahre in Weimar. Ich legte damals die letzte Hand an meine «Philosophie der Freiheit». Ich schrieb, so fühlte ich, die Gedanken nieder, die mir die geistige Welt bis zu der Zeit meines dreißigsten Lebensjahres gegeben hatte. Alles, was mir durch die äußere Welt gekommen war, hatte nur den Charakter einer Anregung.
Ich empfand das besonders, wenn ich in dem lebendigen Verkehre in Weimar mit andern Menschen über
Weltanschauungsfragen sprach. Ich mußte auf sie, ihre Denkart und Gefühlsrichtung eingehen; sie gingen auf das gar nicht ein, was ich im Innern erlebt hatte und weiter erlebte. Ich lebte ganz intensiv mit dem, was andere sahen und dachten; aber ich konnte in diese erlebte Welt meine innere geistige Wirklichkeit nicht hineinfließen lassen. Ich mußte mit meinem eigenen Wesen immer in mir zurückbleiben. Es war wirklich meine Welt wie durch eine dünne Wand von aller Außenwelt abgetrennt.
Mit meiner eigenen Seele lebte ich in einer Welt, die an die Außenwelt angrenzt; aber ich hatte immer nötig, eine Grenze zu überschreiten, wenn ich mit der Außenwelt etwas zu tun haben wollte. Ich stand im lebhaftesten Verkehre; aber ich mußte in jedem einzelnen Falle aus meiner Welt wie durch eine Türe in diesen Verkehr eintreten. Das ließ mir die Sache so erscheinen, als ob ich jedesmal, wenn ich an die Außenwelt herantrat, einen Besuch machte. Das aber hinderte mich nicht, mich mit lebhaftestem Anteile dem hinzugeben, bei dem ich zu Besuch war; ich fühlte mich sogar ganz heimisch, während ich zu Besuch war.
So war es mit Menschen, so war es mit Weltanschauungen. Ich ging gerne zu Suphan, ich ging gerne zu Hartleben. Suphan ging nie zu Hartleben; Hartleben nie zu Suphan. Keiner konnte in des andern Denk- und Gefühlsrichtung eintreten. Ich war sogleich bei Suphan, sogleich bei Hartleben wie zu Hause. Aber weder Suphan noch Hartleben kamen eigentlich zu mir. Sie blieben auch, wenn sie zu mir kamen, bei sich. In meiner geistigen Welt konnte ich keine Besuche erleben.
Ich sah die verschiedensten Weltanschauungen vor meiner Seele. Die naturwissenschaftliche, die idealistische und viele Nuancen der beiden. Ich fühlte den Drang, auf sie einzugehen, mich in ihnen zu bewegen; in meine geistige Welt warfen sie eigentlich kein Licht. Sie waren mir Erscheinungen, die vor mir standen, nicht Wirklichkeiten, in die ich mich hätte einleben können.
So stand es in meiner Seele, als das Leben mir unmittelbar nahe rückte Weltanschauungen wie diejenige Haeckels und Nietzsches. Ich empfand ihre relative Berechtigung. Ich konnte durch meine Seelenverfassung sie nicht so behandeln, daß ich sagte: das ist richtig, das unrichtig. Da hätte ich, was in ihnen lebt, als mir fremd empfinden müssen. Aber ich empfand die eine nicht fremder als die andere; denn heimisch fühlte ich mich nur in der angeschauten geistigen Welt, und «wie zu Hause» konnte ich mich in jeder andern fühlen.
Wenn ich das so schildere, kann es scheinen, als ob mir im Grunde alles gleichgültig gewesen wäre. Das war es aber durchaus nicht. Ich hatte darüber eine ganz andere Empfindung. Ich empfand mich mit vollem Anteil in dem anderen darinnen, weil ich es mir nicht dadurch entfremdete, daß ich sogleich das Eigene in Urteil und Empfindung hineintrug.
Ich führte z. B. unzählige Gespräche mit Otto Harnack, dem geistvollen Verfasser des Buches «Goethe in der Epoche seiner Vollendung», der damals viel nach Weimar kam, weil er über Goethes Kunststudien arbeitete. Der Mann, der dann später in eine erschütternde Lebenstragik verfallen ist, war mir lieb. Ich konnte ganz Otto Harnack sein, wenn ich mit ihm sprach. Ich nahm seine
Gedanken hin, lebte mich - im gekennzeichneten Sinne - zu Besuch, aber «wie zu Hause» in sie ein. Ich dachte gar nicht daran, ihn zu mir zu Besuch zu bitten. Er konnte nur bei sich leben. Er war so in seine Gedanken eingesponnen, daß er alles als fremd empfand, was nicht das Seinige war. Er hätte von meiner Welt nur so hören können, daß er sie wie das Kant'sche «Ding an sich» behandelt hätte, das «jenseits des Bewußtseins» liegt. Ich fühlte mich geistig verpflichtet, seine Welt als eine solche zu behandeln, zu der ich mich nicht kantisch zu verhalten hatte, sondern in die ich das Bewußtsein hinüberleiten mußte.
Ich lebte so nicht ohne geistige Gefahren und Schwierigkeiten. Wer alles ablehnt, was nicht in seiner Denkrichtung liegt, der wird nicht bedrängt von der relativen Berechtigung, die die verschiedenen Weltanschauungen haben. Er kann rückhaltlos das Faszinierende dessen empfinden, was nach einer bestimmten Richtung ausgedacht ist. Dieses Faszinierende des Intellektualismus lebt ja in so vielen Menschen. Sie werden leicht mit dem fertig, was anders gedacht ist als das ihrige. Wer aber eine Welt der Anschauung hat, wie sie die geistige sein muß, der sieht die Berechtigung der verschiedensten «Standpunkte»; und er muß sich fortwährend im Innern seiner Seele wehren, um nicht zu stark zu dem einen oder dem andern hingelenkt zu werden.
Man wird aber schon das «Wesen der Außenwelt» gewahr, wenn man in Liebe an sie hingegeben sein kann, und doch immer wieder zur Innenwelt des Geistes zurückkehren muß. Man lernt aber dabei auch, wirklich im Geistigen zu leben.
Die verschiedenen intellektuellen «Standpunkte» lehnen einander ab; die geistige Anschauung sieht in ihnen eben «Standpunkte». Von jedem derselben aus gesehen, nimmt sich die Welt anders aus. Es ist, wie wenn man ein Haus von verschiedenen Seiten photographiert. Die Bilder sind verschieden; das Haus ist dasselbe. Geht man um das wirkliche Haus herum, so erhält man einen Gesamteindruck. Steht man wirklich in der geistigen Welt darinnen, so läßt man das «Richtige» eines Standpunktes gelten. Man sieht eine photographische Aufnahme von einem «Standpunkte» aus als etwas Berechtigtes an. Man frägt dann nach der Berechtigung und Bedeutung des Standpunktes.
So mußte ich z. B. an Nietzsche, so mußte ich auch an Haeckel herantreten. Nietzsche, so fühlte ich, photographiert die Welt von einem Standpunkte aus, zu dem eine tiefangelegte Menschenwesenheit in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hingedrängt wurde, wenn sie von dem geistigen Inhalte dieses Zeitalters allein leben konnte, wenn in ihr Bewußtsein die Anschauung des Geistes nicht hereinbrechen wollte, der Wille im Unterbewußtsein mit ungemein starken Kräften aber zum Geist hindrängte. So lebte in meiner Seele das Bild Nietzsches auf; es zeigte mir die Persönlichkeit, die den Geist nicht schaute, in der aber der Geist unbewußt kämpft gegen die ungeistigen Anschauungen der Zeit.
XVII.
In dieser Zeit wurde in Deutschland ein Zweig der von Amerika ausgehenden «Gesellschaft für ethische Kultur» begründet. Es scheint selbstverständlich zu sein, daß man in der Zeit des Materialismus einem Streben nach ethischer Vertiefung nur zustimmen sollte. Aber dieses Streben ging damals von einer Grundanschauung aus, die in mir die stärksten Bedenken wachrief.
Die Führer dieser Bewegung sagten sich: man steht gegenwärtig inmitten der vielen einander widerstreitenden Welt- und Lebensanschauungen in bezug auf das Erkenntnisleben, auf die religiösen, die sozialen Empfindungen. Die Menschen sind auf dem Gebiete dieser Anschauungen nicht dazu zu bringen, sich zu verstehen. Es ist vom Übel wenn die sittlichen Gefühle, die die Menschen für einander haben sollen, in das Gebiet dieser widerstreitenden Meinungen hineingezogen werden. Wohin soll es führen, wenn religiös oder sozial anders Empfindende, oder im Erkenntnisleben voneinander Abweichende ihre Verschiedenheit auch dadurch zum Ausdruck bringen, daß sie ihr moralisches Verhalten gegen Andersdenkende und Andersempfindende darnach gestalten. Man müsse deshalb die Grundsätze einer rein menschlichen Ethik aufsuchen, die unabhängig von jeder Weltanschauung sein solle, die jeder anerkennen könne, wie er auch über die verschiedenen Gebiete des Daseins denkt.
Auf mich machte diese ethische Bewegung einen tiefgehenden Eindruck. Sie rührte an meine mir wichtigsten Anschauungen. Denn vor mir stand der tiefe Abgrund, den die Denkungsarten der neueren Zeit zwischen dem
Naturgeschehen und dem moralisch-geistigen Weltinhalt geschaffen haben.
Man ist zu einer Anschauung über die Natur gekommen, die das Weltwerden ohne moralisch-geistigen Inhalt darstellen will. Man denkt hypothetisch an einen rein materiellen Urzustand der Welt. Man sucht die Gesetze, nach denen aus diesem Urzustand sich allmählich das Lebendige, das Beseelte, das Durchgeistigte in der gegenwärtigen Form gebildet haben könnte. Ist man mit einer solchen Denkungsart konsequent - so sagte ich mir damals -, dann kann das Geistig-Moralische gar nicht anders denn als ein Ergebnis des Naturwirkens vorgestellt werden. Dann hat man die für das Geistig-Moralische gleichgültigen Naturtatsachen, die in ihrem Werden wie ein Nebenergebnis das Moralische hervorbringen und es schließlich auch wieder in ihrer moralischen Gleichgültigkeit begraben.
Ich konnte mir allerdings vor Augen halten, daß die vorsichtigen Denker diese Konsequenz nicht zogen, daß sie einfach hinnahmen, was die Naturtatsachen ihnen zu sagen schienen, und dabei dachten, man müsse die Weltbedeutung des Geistig-Moralischen auf sich beruhen lassen. Aber das schien mir gar nicht wichtig. Es kam mir nicht darauf an, daß man sagte: im Sinne des Naturgeschehens müsse man eben in einer für das Moralische gleichgültigen Art denken, und was man so denke, seien eben Hypothesen; über das Moralische möge jeder sich seine Gedanken bilden. Ich sagte mir: wer über die Natur auch im Kleinsten so denkt, wie es damals üblich war, der kann dem Geistig-Moralischen keine in sich selbständige, sich tragende Wirklichkeit zuschreiben. Bleibt die
Physik, die Chemie, die Biologie so wie sie ist, wie sie allen als unantastbar erscheint, so saugen die Wesenheiten, die man da als Wirklichkeit denkt, alle Wirklichkeit auf; und das Geistig-Moralische könnte nur der aus dieser Wirklichkeit aufsteigende Schaum sein.
Ich sah in eine andere Wirklichkeit. In eine solche, die moralisch-geistig ebenso wie naturhaft zugleich ist. Mir erschien es als eine Schwäche des Erkenntnisstrebens, nicht bis zu dieser Wirklichkeit vordringen zu wollen. Ich mußte mir, nach meiner geistgemäßen Anschauung, sagen: über dem Naturgeschehen und dem Geistig-Moralischen gibt es eine wahre Wirklichkeit, die sich moralisch offenbart, die aber im moralischen Tun zugleich die Kraft hat, sich in ein Geschehen umzusetzen, das so zur Geltung gelangt wie das Naturgeschehen. Dieses schien mir gegenüber dem Geistig-Moralischen nur deshalb gleichgültig zu sein, weil es aus seinem ursprünglichen Verbundensein mit ihm herausgefallen ist wie der Leichnam eines Menschen von seinem Verbundensein mit dem Beseelt-Lebendigen des Menschen.
Mir war das gewiß: denn ich dachte es nicht bloß, ich sah es als Wahrheit in den geistigen Tatsachen und Wesenheiten der Welt. In den gekennzeichneten «Ethikern» schienen mir die Menschen geboren zu sein, die eine solche Einsicht als ihnen gleichgültig betrachteten; sie vertraten mehr oder weniger unbewußt die Meinung: mit Weltanschauungsstreben ist nichts auszurichten; retten wir ethische Grundsätze, bei denen man gar nicht weiter nachzuforschen braucht, wie sie in der Weltwirklichkeit wurzeln. Die nackte Verzweiflung an allem Weltanschauungsstreben schien mir aus dieser Zeit-
erscheinung zu sprechen. Unbewußt frivol erschien mir ein Mensch, der behauptete: lassen wir alle Weltanschauung auf sich beruhen, damit wir wieder Sittlichkeit unter den Menschen verbreiten können. Ich machte mit Hans und Grete Olden manchen Spaziergang durch die Weimarer Parkanlagen, auf dem ich mich radikal über diese Frivolität aussprach. Wer mit seiner Anschauung so weit dringt, als es dem Menschen möglich ist, so sagte ich, der findet ein Weltgeschehen, aus dem ihm die Realität des Moralischen ebenso wie die des Naturhaften entgegentritt. Ich schrieb in der damals vor kurzem begründeten «Zukunft» einen scharfen Artikel gegen das, was ich eine aus aller Weltwirklichkeit entwurzelte Ethik nannte, die keine Kraft haben könne. Der Artikel fand eine recht unfreundliche Aufnahme. Wie sollte das auch anders sein, da doch die «Ethiker» sich als Retter der Kultur vorkommen mußten.
Mir war die Sache unbegrenzt wichtig. Ich wollte an einem wichtigen Punkte für das Geltendmachen einer Weltanschauung kämpfen, die das Ethische festbegründet mit aller andern Realität aus sich heraus offenbart. So mußte ich gegen die weltanschauungslose Ethik kämpfen.
Ich fuhr von Weimar nach Berlin, um mir Möglichkeiten aufzusuchen, in Zeitschriften meine Ansichten zu vertreten.
Ich besuchte den von mir hochverehrten Herman Grimm. Ich wurde mit der allergrößten Freundlichkeit aufgenommen. Aber es kam Herman Grimm so sonderbar vor, daß ich, der ich voll von Eifer für meine Sache war, ihm diesen Eifer in sein Haus brachte. Er hörte mir
etwas teilnahmslos zu, als ich ihm von meinen Ansichten in bezug auf die «Ethiker» sprach. Ich dachte, ich konnte ihn für die mir so wichtig erscheinende Sache interessieren. Doch konnte ich das nicht im geringsten. Da er hörte, «ich wolle etwas tun», so sagte er doch: «Gehen Sie doch zu diesen Leuten hin, ich kenne mehr oder weniger die meisten; sie sind alle ganz liebenswürdige Menschen.» Ich war wie von kaltem Wasser übergossen. Der Mann, den ich so sehr verehrte, er empfand gar nichts von dem, was ich wollte; er meinte, ich werde in der Sache «ganz vernünftig denken», wenn ich mich durch einen Besuch bei den «Ethikern» überzeugte, daß sie alle ganz sympathische Menschen seien.
Ich fand bei andern nicht mehr Interesse als bei Herman Grimm. Und so war es damals für mich. Ich mußte, was mit meinen Anschauungen vom Geistigen zusammenhing, ganz allein mit mir abmachen. Ich lebte in der geistigen Welt; niemand aus meinem Bekanntenkreise folgte mir dahin. Mein Verkehr bestand in Exkursionen in die Welten der andern. Aber ich liebte diese Exkursionen. Meine Verehrung für Herman Grimm wurde auch nicht im geringsten beeinträchtigt. Aber ich konnte eine gute Schule in der Kunst durchmachen, das in Liebe zu verstehen, was gar keinen Anlauf nahm, zu verstehen, was ich selbst in der Seele trug.
Das war meine «Einsamkeit» damals in Weimar, wo ich in einem so ausgebreiteten geselligen Verkehre stand. Aber ich schrieb es nicht den Menschen zu, daß sie mich so zur Einsamkeit verurteilten. Ich sah doch in vielen den Drang nach einer bis in die Wurzeln des Daseins dringenden Weltanschauung unbewußt walten. Ich emp-
fand, wie eine Denkungsart, die sicher auftreten konnte, weil sie sich nur an das Allernächstliegende hielt, auf den Seelen lastete. «Die Natur ist die ganze Welt», das war diese Denkungsart. Von ihr glaubte man, man müsse sie richtig finden; und man unterdrückte in der Seele alles, was empfand, man könne sie doch nicht richtig finden. In diesem Lichte zeigte sich mir Vieles, das mich damals geistig umgab. Es war die Zeit, in der meine «Philosophie der Freiheit», deren wesentlichen Inhalt ich ja schon lange in mir trug, die letzte Form erhielt.
Meine «Philosophie der Freiheit» schickte ich sogleich, nachdem sie gedruckt war, an Eduard von Hartmann. Er hat sie mit großer Aufmerksamkeit durchgelesen, denn ich bekam bald sein Exemplar des Buches mit seinen ausführlichen Randbemerkungen vom Anfang bis zum Ende. Dazu schrieb er mir, unter anderem, das Buch sollte den Titel haben: Erkenntnistheoretischer Phänomenalismus und ethischer Individualismus. Er hatte die Quellen der Ideen und meine Ziele ganz mißverstanden. Er dachte über die Sinneswelt in Kant'scher Art, wenn er diese auch modifizierte. Er hielt diese Welt für die Wirkung von Wesenhaftem auf die Seele durch die Sinne. Dieses Wesenhafte soll, nach seiner Meinung, niemals in das Anschauungsfeld eintreten können, das die Seele mit dem Bewußtsein umfaßt. Es sollte jenseits des Bewußtseins bleiben. Nur durch logische Schlußfolgerungen könne man sich hypothetische Vorstellungen darüber bilden. Die Sinneswelt stelle daher nicht ein objektiv in sich Bestehendes dar, sondern die subjektive Erscheinung, die nur in der Seele Bestand habe, solange diese sie mit dem Bewußtsein umfasse.
Ich suchte in meinem Buche darzulegen, daß nicht hinter der Sinneswelt ein Unbekanntes liegt, sondern in ihr die geistige Welt. Und von der menschlichen Ideenwelt suchte ich zu zeigen, daß sie in dieser geistigen Welt ihren Bestand hat. Es ist also dem menschlichen Bewußtsein das Wesenhafte der Sinneswelt nur so lange verborgen, als die Seele nur durch die Sinne wahrnimmt. Wenn zu den Sinneswahrnehmungen die Ideen hinzuerlebt werden, dann wird die Sinneswelt in ihrer objektiven Wesenhaftigkeit von dem Bewußtsein erlebt. Erkennen ist nicht ein Abbilden eines Wesenhaften, sondern ein Sich-hinein-Leben der Seele in dieses Wesenhafte. Innerhalb des Bewußtseins vollzieht sich das Fortschreiten von der noch unwesenhaften Sinnenwelt zu dem Wesenhaften derselben. So ist die Sinnenwelt nur so lange Erscheinung (Phänomen), als das Bewußtsein mit ihr noch nicht fertig geworden ist.
In Wahrheit ist die Sinneswelt also geistige Welt; und mit dieser erkannten geistigen Welt lebt die Seele zusammen, indem sie das Bewußtsein über sie ausdehnt. Das Ziel des Erkenntnisvorganges ist das bewußte Erleben der geistigen Welt, vor deren Anblick sich alles in Geist auflöst.
Ich stellte dem Phänomenalismus die Welt der geistigen Wirklichkeit gegenüber. Eduard von Hartmann meinte, ich wolle innerhalb der Phänomene stehen bleiben und nur darauf verzichten, von diesen auf irgendeine objektive Wirklichkeit zu schließen. Für ihn stellte sich die Sache also so dar, daß ich mit meiner Denkweise das menschliche Erkennen dazu verurteile, überhaupt zu keiner Wirklichkeit zu kommen, sondern sich innerhalb
einer Scheineswelt bewegen zu müssen, die nur im Vorstellen der Seele (als Phänomen) Bestand hat.
So war meinem Suchen nach dem Geist durch Erweiterung des Bewußtseins die Ansicht gegenübergestellt, daß «Geist» doch zunächst nur in der menschlichen Vorstellung lebt, außer ihr nur gedacht werden könne. Das war, im Grunde genommen, die Auffassung des Zeitalters, in das ich meine «Philosophie der Freiheit» hineinzustellen hatte. Das Erleben des Geistigen war für diese Auffassung zusammengeschrumpft auf das Erleben der menschlichen Vorstellungen. Und von diesen aus konnte man keinen Weg zu einer wirklichen (objektiven) Geist-Welt finden.
Ich wollte zeigen, wie im subjektiv Erlebten das objektiv Geistige aufleuchtet und wahrer Bewußtseinsinhalt wird; Eduard von Hartmann hielt mir entgegen, wer solches darstellt, der bleibt innerhalb des Sinnenscheins stecken und redet gar nicht von einer objektiven Wirklichkeit.
Es war nun selbstverständlich, daß Eduard von Hartmann auch meinen «ethischen Individualismus» bedenklich finden mußte.
Denn worin war dieser in meiner «Philosophie der Freiheit» begründet? Ich sah im Mittelpunkt des menschlichen Seelenlebens ein vollkommenes Zusammensein der Seele mit der Geistwelt. Ich versuchte die Sache so darzustellen, daß sich eine vermeintliche Schwierigkeit, die Viele stört, in Nichts auflöst. Man meint nämlich, um zu erkennen, müsse die Seele - oder das «Ich» - sich von dem Erkannten unterscheiden, dürfe also nicht mit ihm in eins zusammenfließen. Doch ist diese Unterscheidung
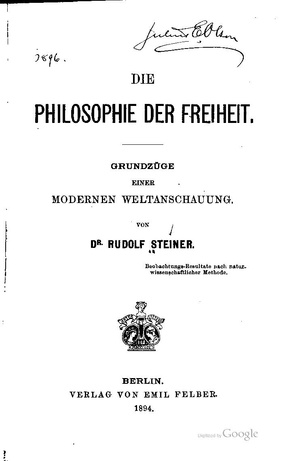
ja auch dann möglich, wenn die Seele gewissermaßen pendelartig sich zwischen dem Eins-Sein mit dem geistig Wesenhaften und der Besinnung auf sich selbst hin- und herbewegt. Sie wird dann «unbewußt» im Untertauchen in den objektiven Geist, bringt aber das vollkommen Wesenhafte bei der Selbstbesinnung in das Bewußtsein herein.
Ist es nun möglich, daß die persönliche Individualität des Menschen in die geistige Wirklichkeit der Welt untertaucht, so kann in dieser Wirklichkeit auch die Welt der sittlichen Impulse erlebt werden. Sittlichkeit bekommt einen Inhalt, der sich aus der geistigen Welt innerhalb der menschlichen Individualität offenbart; und das ins Geistige erweiterte Bewußtsein dringt bis zum Anschauen dieses Offenbarens vor. Was den Menschen anregt zum sittlichen Handeln, ist Offenbarung der Geistwelt an das Erleben dieser Geistwelt durch die Seele. Und dieses Erleben geschieht innerhalb der persönlichen Individualität des Menschen. Sieht der Mensch im sittlichen Handeln sich im Wechselverkehr mit der Geistwelt, so erlebt er seine Freiheit. Denn die Geistwelt wirkt in der Seele nicht in Notwendigkeit, sondern so, daß der Mensch in Freiheit die Aktivität entfalten muß, die ihn zum Annehmen des Geistigen veranlaßt.
In dem Hindeuten darauf, daß die Sinnenwelt in Wirklichkeit geistiger Wesenheit ist, und daß der Mensch als seelisches Wesen durch die wahre Erkenntnis der Sinneswelt in einem Geistigen webt und lebt, liegt das eine Ziel meiner «Philosophie der Freiheit». In der Kennzeichnung der moralischen Welt als einer solchen, die ihr Dasein in dieser von der Seele erlebten Geistwelt
aufleuchten und damit den Menschen in Freiheit an sich herankommen läßt, ist das zweite Ziel enthalten. Die sittliche Wesenheit des Menschen wird damit in dessen ganz individuellem Verwachsensein mit den ethischen Impulsen der Geistwelt gesucht. Ich hatte die Empfindung, der erste Teil dieser «Philosophie der Freiheit» und der zweite stehen wie ein Geistorganismus, als eine echte Einheit da. Eduard von Hartmann mußte finden, sie seien als erkenntnistheoretischer Phänomenalismus und ethischer Individualismus willkürlich aneinander gekoppelt.
Die Gestalt, welche die Ideen des Buches angenommen haben, ist durch meine damalige Seelenverfassung bedingt. Durch mein Erleben der geistigen Welt in unmittelbarer Anschauung zeigte sich mir die Natur als Geist; ich wollte eine geistgemäße Naturwissenschaft schaffen. Im anschauenden Selbsterkennen der Menschenseele trat in dieser die moralische Welt als deren ganz individuelles Erlebnis auf.
Im Geist-Erleben lag die Quelle für die Gestaltung, die ich den Ideen meines Buches gab. Es ist zunächst die Darstellung einer Anthroposophie, die auf die Natur hin und auf das Stehen des Menschen in der Natur mit seiner ihm individuell eigenen sittlichen Wesenheit orientiert ist.
Für mich war mit der «Philosophie der Freiheit» gewissermaßen das von mir abgesondert und in die Außenwelt hineingestellt, was der erste Lebensabschnitt durch das schicksalsgemäße Erleben der naturwissenschaftlichen Daseinsrätsel an Ideengestaltung von mir verlangt hat Der weitere Weg konnte nunmehr nur in einem
Ringen nach einer Ideengestaltung für die geistige Welt selbst sein.
Die Erkenntnisse, die der Mensch in der Sinnesbeobachtung von außen empfängt, waren von mir als inneres anthroposophisches Geist-Erlebnis der Menschenseele dargestellt Daß ich den Ausdruck «Anthroposophie» damals noch nicht gebraucht habe, rührt davon her, daß meine Seele zunächst immer nach Anschauungen und fast gar nicht nach Terminologien drängt. Es stand mir bevor, Ideen zu bilden, die das Erleben der Geist-Welt selbst durch die menschliche Seele darstellen konnten.
Ein innerliches Ringen nach einer solchen Ideenbildung ist der Inhalt der Episode meines Lebens, die ich von meinem dreißigsten bis zum vierzigsten Jahre durchgemacht habe. Ich war damals schicksalsgemäß am meisten in eine äußere Lebensbetätigung hineingestellt, die meinem inneren Leben nicht so entsprach, daß sie dieses hätte zum Ausdruck bringen können.
XVIII.
In diese Zeit fällt mein Hineintreten in die Kreise des geistigen Erlebens, in denen Nietzsche geweilt hat.
Meine erste Bekanntschaft mit Nietzsches Schriften fällt in das Jahr 1889. Vorher hatte ich keine Zeile von ihm gelesen. Auf den Inhalt meiner Ideen, wie sie in der «Philosophie der Freiheit» zum Ausdruck kamen, haben die seinigen keinen Einfluß gehabt. Ich las, was er geschrieben hatte, mit der Empfindung des Angezogenwerdens von dem Stil, den ihm sein Verhältnis zum Leben gegeben hatte. Ich empfand seine Seele als ein Wesen, das mit vererbter und anerzogener Aufmerksamkeit auf alles hinhorchen mußte, was das Geistesleben seiner Zeit hervorgebracht hatte, das aber stets fühlte, was geht mich doch dieses Geistesleben an; es muß eine andere Welt geben, in der ich leben kann; in dieser stört mich so vieles am Leben. Dieses Gefühl machte ihn zum geistbefeuerten Kritiker seiner Zeit; aber zu einem Kritiker, den die eigene Kritik krank machte. Der die Krankheit erleben mußte, und der von der Gesundheit, von seiner Gesundheit nur träumen konnte. Er suchte zuerst nach Möglichkeiten, seinen Traum von der Gesundheit zum Inhalt seines Lebens zu machen; und so suchte er mit Richard Wagner, mit Schopenhauer, mit dem modernen «Positivismus» so zu träumen, als ob er den Traum in seiner Seele zur Wirklichkeit machen wollte. Eines Tages entdeckte er, daß er nur geträumt hatte. Da fing er an, mit jeglicher Kraft, die seinem Geiste eigen war, nach Wirklichkeiten zu suchen. Wirklichkeiten, die «irgendwo» liegen mußten; er fand nicht «Wege» zu diesen Wirk-
lichkeiten, aber Sehnsuchten. Da wurden die Sehnsuchten in ihm Wirklichkeiten. Er träumte weiter; aber die gewaltige Kraft seiner Seele schuf aus den Träumen innermenschliche Wirklichkeiten, die ohne die Schwere, die den Menschenideen seit lange eigen war, frei in einer geistfrohen, aber von dem «Zeitgeist» widerlich berührten Seelenstimmung schwebten.
So empfand ich Nietzsche. Das Freischwebende, Schwerelose seiner Ideen riß mich hin. Ich fand, daß dieses Freischwebende in ihm manche Gedanken gezeitigt hatte, die Ähnlichkeit mit denen hatten, die in mir selbst auf Wegen, die den seinigen ganz unähnlich waren, sich gebildet hatten.
So konnte ich 1895 in der Vorrede zu meinem Buche «Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit» schreiben:
«Schon in meinem 1886 erschienenen kleinen Buche Erkenntnistheorie der Goethe'schen Weltanschauung kommt dieselbe Gesinnung zum Ausdruck, wie in einigen Werken Nietzsches. » Was mich aber besonders anzog, war, daß man Nietzsche lesen durfte, ohne irgendwie bei ihm selbst auf etwas zu stoßen, das den Leser zu seinem «Anhänger» machen wollte. Man konnte mit hingebender Freude seine Geisteslichter empfinden; man fühlte sich in diesem Empfinden ganz frei; denn man fühlte, seine Worte fingen an zu lachen, wenn man ihnen zugemutet hätte, man solle ihnen zustimmen, wie Haekkel oder Spencer dies voraussetzten.
So durfte ich auch, um mein Verhältnis zu Nietzsche auszusprechen, in dem genannten Buche dies mit Worten tun, die er über das seinige zu Schopenhauer geformt hat: «Ich gehöre zu den Lesern Nietzsches, welche, nach-
dem sie die erste Seite von ihm gelesen, mit Bestimmtheit wissen, daß sie alle Seiten lesen und auf jedes Wort hören werden, das er überhaupt gesagt hat Mein Vertrauen zu ihm war sofort da... Ich verstand ihn, als ob er für mich geschrieben hätte, um mich verständlich, aber unbescheiden und töricht auszudrücken. »
Kurz bevor ich an die Niederschrift dieses Buches ging, erschien eines Tages Nietzsches Schwester, Elisabeth Förster-Nietzsche im Goethe- und Schiller-Archiv. Sie machte eben die ersten Schritte zur Gründung eines Nietzsche-Archives und wollte erfahren, wie das Goethe- und Schiller-Archiv eingerichtet war. Bald darauf erschien auch der Herausgeber von Nietzsches Werken, Fritz Koegel, in Weimar, und ich lernte ihn kennen.
Ich bin später mit Frau Elisabeth Förster-Nietzsche in schwere Konflikte gekommen. Damals forderte ihr beweglicher, liebenswürdiger Geist meine tiefste Sympathie heraus. Ich habe unter den Konflikten unsäglich gelitten; eine verwickelte Situation hat es dazu kommen lassen; ich wurde genötigt, mich gegen Anschuldigungen zu verteidigen; ich weiß, daß das alles notwendig war, daß mir dadurch schöne Stunden, die ich im Nietzsche-Archiv in Naumburg und Weimar verleben durfte, mit einem Schleier der Bitternis in der Erinnerung überzogen sind; aber ich bin Frau Förster-Nietzsche doch dankbar, daß sie mich bei dem ersten der vielen Besuche, die ich bei ihr machen durfte, in das Zimmer Friedrich Nietzsches führte. Da lag der Umnachtete mit der wunderbar schönen Stirne, Künstler- und Denkerstirne zugleich, auf einem Ruhesofa. Es waren die ersten Nachmittagsstun-
den. Diese Augen, die im Erloschensein noch durchseelt wirkten, nahmen nur noch ein Bild der Umgebung auf, das keinen Zugang zur Seele mehr hatte. Man stand da, und Nietzsche wußte nichts davon. Und doch hätte man von dem durchgeistigten Antlitz noch glauben können, daß es der Ausdruck einer Seele wäre, die den ganzen Vormittag Gedanken in sich gebildet hatte, und die nun eine Weile ruhen wollte. Eine innere Erschütterung, die meine Seele ergriff, durfte meinen, daß sie sich in Verständnis für den Genius verwandle, dessen Blick auf mich gerichtet war, mich aber nicht traf. Die Passivität dieses lange Zeit verharrenden Blickes löste das Verständnis des eigenen Blickes aus, der die Seelenkraft des Auges wirken lassen durfte, ohne daß ihm begegnet wurde.
Und so stand vor meiner Seele: Nietzsches Seele wie schwebend über seinem Haupte, unbegrenzt schön in ihrem Geisteslichte; frei hingegeben geistigen Welten, die sie vor der Umnachtung ersehnt, aber nicht gefunden; aber gefesselt noch an den Leib, der nur so lange von ihr wußte, als diese Welt noch Sehnsucht war. Nietzsches Seele war noch da; aber sie konnte nur noch von außen den Körper halten, der ihr Widerstand bot, sich in ihrem vollen Lichte zu entfalten, so lange sie in seinem Innern war.
Ich hatte vorher den Nietzsche gelesen, der geschrieben hatte; jetzt hatte ich den Nietzsche geschaut, der aus weit entlegenen Geistgebieten Ideen in seinem Leib trug, die noch in Schönheit schimmerten, trotzdem sie auf dem Wege ihre ursprüngliche Leuchtkraft verloren hatten. Eine Seele, die aus früheren Erdenleben reiches Lichtgold brachte, es aber nicht ganz in diesem Leben zum Leuch-
ten bringen konnte. Ich bewunderte, was Nietzsche geschrieben; aber ich schaute jetzt hinter meiner Bewunderung ein hellstrahlendes Bild.
Ich konnte in meinen Gedanken nur stammeln von dem, was ich damals geschaut; und das Stammeln ist der Inhalt meines Buches «Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit». Daß das Buch nur ein solches Stammeln geblieben ist, verbirgt die aber doch wahre Tatsache, daß das Bild Nietzsches es mir inspiriert hat.
Frau Förster-Nietzsche hat mich dann aufgefordett, Nietzsches Bibliothek zu ordnen. Ich habe dadurch mehrere Wochen im Nietzsche-Archiv in Naumburg zubringen dürfen. Ich wurde dabei auch mit Fritz Koegel sehr befreundet. Es war eine schöne Aufgabe, die die Bücher vor meine Augen stellte, in denen Nietzsche gelesen hatte. Sein Geist lebte in den Eindrücken auf, welche diese Bücher machten. Ein ganz mit Randbemerkungen versehenes, alle Spuren hingebendster Durcharbeitung tragendes Exemplar eines Emerson'schen Buches. Guyaus Schriften mit ebensolchen Spuren. Bücher mit leidenschaftlich kritisierenden Bemerkungen von seiner Hand. Eine große Anzahl von Randbemerkungen, aus denen man die Keime seiner Ideen aufschießen sieht.
Eine durchgreifende Idee der letzten Schaffensperiode Nietzsches konnte ich aufleuchten sehen, indem ich seine Randbemerkung in Eugen Dührings philosophischem Hauptwerk las. Dühring konstruiert da den Gedanken, daß man das Weltall in einem Augenblick als eine Kombination von Elementarteilen vorstellen könne. Dann wäre das Weltgeschehen der Ablauf aller möglichen sol-
cher Kombinationen. Wären diese erschöpft, dann müßte die allererste wiederkehren und der ganze Ablauf sich wiederholen. Stellte so etwas die Wirklichkeit vor, so müßte es unzählige Male schon geschehen sein und weiter in die Zukunft hinein unzählige Male geschehen. Man käme zu der Idee der ewigen Wiederholung gleicher Zustände des Weltalls. Dühring weist diesen Gedanken als einen unmöglichen zurück. Nietzsche liest das; er nimmt davon einen Eindruck auf; der arbeitet in den Untergründen seiner Seele weiter; und er formt sich dann in ihm als «die Wiederkunft des Gleichen», die mit der Idee vom «Übermenschen» zusammen seine letzte Schaffensperiode beherrscht.
Ich war tief ergriffen, ja erschüttett von dem Eindruck, den ich durch ein solches Nachgehen von Nietzsches Lekture bekam. Denn ich sah, welch ein Gegensatz zwischen Nietzsches Geistesart und der seiner Zeitgenossen war. Dühring, der extreme Positivist, der alles ablehnt, was sich nicht aus einer ganz nüchtern orientierten, mathematisch verfahrenden Schematik ergibt, findet den Gedanken der «ewigen Wiederkunft des Gleichen» absurd, konstruiert ihn nur, um seine Unmöglichkeit darzutun: Nietzsche muß ihn als seine Welträtsellösung wie eine aus den Tiefen der eigenen Seele kommende Intuition aufnehmen.
So steht Nietzsche in vollem Gegensatz zu vielem, was als Inhalt des Denkens und Fühlens seiner Zeit auf ihn einstürmt. Er nimmt diese Stürme so auf, daß er tief durch sie leidet, und im Leiden, in unsäglichen Seelenschmerzen den Inhalt der eigenen Seele schafft. Das war die Tragik seines Schaffens.
Sie erreichte ihren Höhepunkt, als er die Gedankenskizzen zu seinem letzten Werke notierte, zum «Willen zur Macht», oder der «Umwertung aller Werte». Nietzsche war dazu veranlagt, alles, was er dachte und empfand, aus den Tiefen seiner Seele in rein geistiger Art heraufzuholen. Das Weltbild zu schaffen aus dem Geistgeschehen, das die Seele miterlebt, das lag in seiner Richtung. Das positivistische Weltbild seines, des naturwissenschaftlichen Zeitalters, floß aber auf ihn ein. Darinnen war nur die rein materielle geistlose Welt. Was in diesem Bild noch auf geistige Art gedacht war, das war der Überrest alter Denkweisen, die nicht mehr zu ihm paßten. Nietzsches unbegrenzter Wahrheitssinn wollte alles das ausmerzen. So kam er dazu, den Positivismus ganz extrem zu denken. Eine Geistwelt hinter der materiellen ward ihin zur Lüge. Er konnte aber nur aus der eigenen Seele heraus schaffen. So schaffen, wie ein wahres Schaffen nur Sinn erhält, wenn es den Inhalt der Geistwelt in Ideen vor sich hinstellt. Diesen Inhalt lehnte er ab. Der naturwissenschaftliche Weltinhalt hatte seine Seele so stark ergriffen, daß er ihn wie auf Geistwegen schaffen wollte. Lyrisch, in dionysischem Seelenfluge, schwingt sich seine Seele im «Zarathustra» auf. Wunderbar webt da das Geistige, aber es träumt in Geistwundem von materiellem Wirklichkeitsgehalt. Es zerstäubt der Geist in seinem Entfaltung, weil er nicht sich finden, sondern nur den erträumten Abglanz des Materiellen als seine Schein-Wesenheit erleben kann.
Ich lebte in der eigenen Seele damals in Weimar viel in dem Anschauen von Nietzsches Geistesart. In meinem eigenen Geist-Erleben hatte diese Geistesamt ihren Platz.
Dieses Geist-Erleben konnte mit Nietzsches Ringen, mit Nietzsches Tragik leben; was gingen es die positivistisch gestalteten Gedankenergebnisse Nietzsches an!
Andere haben mich für einen «Nietzscheaner» gehalten, weil ich restlos bewundern konnte auch, was meiner eigenen Geistesrichtung entgegengesetzt war. Mich fesselte, wie der Geist in Nietzsche sich offenbarte; ich glaubte, ihm gerade dadurch nahe zu sein, denn er stand niemand nahe durch Gedanken4nhalte; er fand sich aflein mit Menschen und Zeiten im Mit-Erleben der Geist - Wege zusammen.
Eine Zeitlang habe ich mit dem Herausgeber von Nietzsches Werken, Fritz Koegel, viel verkehrt. Manches auf die Nietzsche-Ausgabe Bezügliche haben wir durchgesprochen. Eine offizielle Stellung im Nietzsche-Archiv oder zur Nietzsche-Ausgabe habe ich nie gehabt. Als Frau Förster-Nietzsche mir eine solche anbieten wollte, führte gerade das zu Konflikten mit Fritz Koegel, die fortan mir jede Gemeinsamkeit mit dem Nietzsche-Archiv unmöglich machten.
Mein Verhältnis zum Nietzsche-Archiv stellte sich in mein Weimarer Leben als eine Episode starker Anregungen hinein, die mir zuletzt im Zerbrechen des Verhältnisses tiefes Leid brachte.
Aus dem weitgehenden Beschäftigung mit Nietzsche verblieb mir die Anschauung von seinem Persönlichkeit, deren Schicksal war, das naturwissenschaftliche Zeitalter der letzten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in Tragik mitzuerleben, und an der Berührung mit ihm zu zerbrechen. Er suchte in diesem Zeitalter, konnte aber in ihm nichts finden. Mich konnte das Erleben an ihm nur
festigen in der Anschauung, daß alles Suchen in den Ergebnissen der Naturwissenschaft das Wesentliche nicht in ihnen, sondern durch sie im Geiste finden müsse.
So trat gerade durch Nietzsches Schaffen das Problem der Naturwissenschaft in erneuerter Gestalt vor meine Seele. Goethe und Nietzsche standen in meiner Perspektive. Goethes energischem Wirklichkeitssinn nach den Wesen und Vorgängen der Natur gerichtet. Er wollte in der Natur bleiben. Er hielt sich in meinen Anschauungen von Pflanzen-, Tier- und Menschenformen. Aber indem er sich mit der Seele in diesen bewegte, kam er überall zum Geiste. Den in der Materie waltenden Geist fand er. Bis zu der Anschauung des in sich selbst lebenden und waltenden Geistes wollte er nicht gehen. Eine «geistgemäße» Naturerkenntnis bildete er aus. Vor einer reinen Geist-Erkenntnis machte er Halt, um die Wirklichkeit nicht zu verlieren.
Nietzsche ging vom Geist-Anschauen in mythischer Form aus. Apollo und Dionysos waren Geistgestalten, die er erlebte. Dem Ablauf dem menschlichen Geistgeschichte erschien ihm wie ein Zusammenwirken, oder auch wie ein Kampf zwischen Apollo und Dionysos. Aber er brachte es nur zu dem mythischen Vorstellen solcher Geistgestalten. Er drang nicht vor zu der Anschauung wirklichem geistiger Wesenheit. Vom Geist-Mythos aus drang er zur Natur vor. Apollo sollte in Nietzsches Seele das Materielle nach dem Muster der Naturwissenschaft vorstellen; Dionysos sollte wirken wie Naturkräfte. Aber da verfinsterte sich Apollos Schönheit; da ward des Dionysos Weltemotion durch die Naturgesetzmäßigkeit gelähmt.
Goethe fand den Geist in der Naturwirklichkeit; Nietzsche verlor den Geist-Mythos in dem Naturtraum, in dem er lebte.
Ich stand zwischen diesen beiden Gegensätzen. Die seelischen Erlebnisse, die sich in meiner Schrift «Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit» ausgelebt hatten, fanden zunächst keine Fortsetzung; dagegen stellte sich in meiner letzten Weimarer Zeit Goethe wieder beherrschend vor meine Betrachtung. Ich wollte den Weg kennzeichnen, den das Weltanschauungsleben dem Menschheit bis zu Goethe genommen hat, um dann Goethes Anschauungsamt in ihrem Hervorgehen aus diesem Leben darzustellen. Ich habe das versucht in dem Buche «Goethes Weltanschauung», das 1897 erschienen ist.
Ich wollte da zur Anschauung bringen, wie Goethe an der reinen Naturerkenntnis überall, wo er hinblickt, den Geist aufblitzend erblickt; aber ich habe die Art, wie Goethe sich zum Geist als solchem stellte, ganz unberührt gelassen. Ich wollte den Teil von Goethes Weltanschauung charakterisieren, der in einem «geistgemäßen» Naturanschauung lebt.
Nietzsches Ideen von der «ewigen Wiederkunft» und dem «Übermenschen» standen lange vom mir. Denn in ihnen spiegelte sich, was eine Persönlichkeit über die Entwickelung der Menschheit und über das Wesen des Menschen erleben mußte, die von der Erfassung dem geistigen Welt durch die festgezimmerten Gedanken der Naturanschauung vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts zurückgehalten wurde. Nietzsche sah die Entwickelung der Menschheit so, daß sich, was in einem Augenblick geschieht, unzählige Male in ganz gleicher Gestalt schon
ereignet hat und unzählige Male sich in der Zukunft ereignen werde. Die atomistische Gestaltung des Weltalls läßt den gegenwärtigen Augenblick als eine bestimmte Kombination dem kleinsten Wesenheiten erscheinen; an diese muß sich eine andere anschließen, an diese wieder eine andere; und wenn alle möglichen Kombinationen erschöpft sind, so muß die anfängliche wieder erscheinen.
- Ein menschliches Leben mit allen seinen Einzelheiten war unzählige Male da; es wird unzählige Male mit all diesen selben Einzelheiten wiederkehren.
Die «wiederholten Erdenleben» des Menschen dämmerten im Unterbewußtsein Nietzsches. Sie führen das Menschenleben durch die Menschheitsentwickelung zu Lebensetappen, in denen das waltende Schicksal auf geistgestaltenden Bahnen den Menschen nicht zu einer Wiederholung des gleichen Erlebens, sondern zu einem vielgestalteten Hindurchgehen durch den Weltenlauf kommen läßt. Nietzsche war umklammert von den Fesseln dem Naturanschauung. Was diese aus den wiederholten Erdenleben machen konnte, das zauberte sich vor seine Seele. Und er lebte das. Denn er empfand sein Leben als ein tragisches, erfüllt mit schmerzvollsten Erfahrungen, niedergedrückt von Leid. - Dieses Leben noch unzählige Male zu erfahren - das stand vor seinem Seele statt der Perspektive auf die befreienden Erfahrungen, die eine solche Tragik in der Weiterentfaltung kommendem Leben zu erfahren hat.
Und Nietzsche empfand, daß in dem Menschen, der sich in Einem Erdendasein erlebt, ein anderer sich offenbart - ein «Übermensch», dem aus sich nur die Fragmente seines Gesamtlebens im leiblichen Erdendasein ausgestalten kann. Die naturalistische Entwickelungs-Idee ließ
ihn diesen «Übermenschen» nicht als das geistig Waltende innerhalb des Sinnlich-Physischen schauen, sondern als das durch bloß naturgemäße Entwickelung sich Ausgestaltende Wie aus dem Tier der Mensch sich entfaltet hat, wird sich aus dem Menschen der «Übermensch» entfalten. Die Naturanschauung entriß Nietzsche den Ausblick auf den «Geistmenschen» im «Naturmenschen» und blendete ihn mit einem höheren Naturmenschen.
Was nach dieser Richtung Nietzsche erlebt hat, das stand in vollster Lebhaftigkeit im Sommer 1896 vor meinem Seele. Damals gab mir Fritz Koegel seine Zusammenstellung von Nietzsches Aphomismen zum «ewigen Wiederkunft» zur Durchsicht. Ich habe, was ich damals über das Hervorgehen von Nietzsches Ideen gedacht habe, 1900 in einem Aufsatze im «Magazin für Literatur» niedergeschrieben. - In einzelnen Sätzen dieses Aufsatzes ist festgehalten, was ich 1896 an Nietzsche und dem Naturwissenschaft erlebt habe. Ich werde diese meine Gedanken von damals hier wiederholen, losgelöst von dem Polemik, in die sie damals gekleidet waren.
«Es ist kein Zweifel, daß Nietzsche diese einzelnen Aphorismen in zwangloser Reihenfolge aufgeschrieben hat... Ich habe meine damals ausgesprochene Überzeugung auch heute noch: daß Nietzsche bei Gelegenheit dem Lektüre von Eugen Dührings Kursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher Weltanschauung und Lebensgestaltung (Leipzig 1875) und unter dem Einflusse dieses Buches die Idee gefaßt hat. Auf S. 84 dieses Werkes findet sich nämlich dieser Gedanke ganz klar
ausgesprochen; nur wird er da ebenso energisch bekämpft, wie ihn Nietzsche verteidigt. Das Buch ist in Nietzsches Bibliothek vorhanden. Es ist, wie zahlreiche Bleistiftstmiche am Rande zeigen, von Nietzsche eifrig gelesen worden... Dühring sagt: Der tiefere logische Gmund alles bewußten Lebens fordert daher im strengsten Sinne des Worts eine Unerschöpflichkeit der Gebilde. Ist diese Unendlichkeit, vermöge deren immer neue Fommen hemvomgetmieben werden, an sich möglich? Die bloße Zahl dem materiellen Teile und Kraftelemente würde an sich die unendliche Häufung der Kombinationen ausschließen, wenn nicht das stetige Medium des Raumes und dem Zeit eine Unbeschränktheit dem Vamiationen verbürgte. Aus dem, was zählbar ist, kann auch nur eine erschöpfbare Anzahl von Kombinationen folgen. Aus dem aber, was seinem Wesen nach ohne Widerspruch gar nicht als etwas Zählbares konzipiert werden darf, muß auch die unbeschränkte Mannigfaltigkeit der Lagen und Beziehungen hervorgehen können. Diese Unbeschränktheit, die wir für das Schicksal dem Gestaltungen des Universums in Anspruch nehmen, ist nun mit jedem Wandlung und selbst mit dem Eintreten eines Intervalls der annähernden Beharmung Odem dem vollständigen Sichselbstgleichheit (von mir unterstrichen), aber nicht mit dem Aufhören alles Wandels verträglich. Wer die Vorstellung von einem Sein kultivieren möchte, welches dem Ürsprungszustande entspricht, sei daran erinnert, daß die zeitliche Entwickelung nur eine einzige reale Richtung hat, und daß die Kausalität ebenfalls dieser Richtung gemäß ist. Es ist leichter, die Unterschiede zu verwischen, als sie festzuhalten, und es kostet daher wenig Mühe, mit Hinwegsetzung über die Kluft das Ende nach
Analogie des Anfangs zu imaginieren. Hüten wir uns jedoch vom solchen oberflächlichen Voreiligkeiten; denn die einmal gegebene Existenz des Universums ist keine gleichgültige Episode zwischen zwei Zuständen der Nacht, sondern der einzige feste und lichte Grund, von dem aus wir unsere Rückschlüsse und Vorwegnahmen bewerkstelligen... Dühring findet auch, daß eine immerwährende Wiederholung dem Zustände keinen Reiz für das Leben hat. Er sagt: Nun versteht es sich von selbst, daß die Prinzipien des Lebensreizes mit ewigem Wiederholung derselben Formen nicht verträglich sind...»
Nietzsche wird mit der Naturanschauung in eine Konsequenz hineingetrieben, vor der Dühring durch die mathematische Betrachtung und durch das Schreckbild, das sie vor dem Leben darstellt, zurückschauert.
In meinem Aufsatze heißt es weiter: ... . machen wir die Voraussetzung, daß mit den materiellen Teilen und Kraftelementen eine zählbare Anzahl von Kombinationen möglich sei, so haben wir die Nietzschesche Idee der Wiederkunft des Gleichen. Nichts anderes als die Verteidigung einer aus der Dühring'schen Ansicht genommenen Gegen-Idee haben wir in dem Aphorismus 203 (Band XII in Koegels Ausgabe und Aphorismus 22 in Homneffers Schrift: Nietzsches Lehre von dem ewigen Wiederkunft): Das Maß der All-Kraft ist bestimmt, nichts ,Unendliches': hüten wir uns vor solchen Ausschweifungen des Begriffs! Folglich ist die Zahl dem Lagen, Veränderungen, Kombinationen und Entwickelungen diesem Kraft zwar ungeheuer groß und praktisch
,unermeßlich', aber jedenfalls auch bestimmt und nicht unendlich, das heißt: die Kraft ist ewig gleich und ewig tätig: - bis zu diesem Augenblick ist schon eine Unendlichkeit abgelaufen, das heißt, alle möglichen Entwickelungen müssen schon dagewesen sein. Folglich muß die augenblickliche Entwickelung eine Wiederholung sein und so die, welche sie gebar, und die, welche aus ihr entsteht, und so vorwärts und rückwärts weiter! Alles ist unzähligemal dagewesen, insofern die Gesamtlage aller Kräfte immer wiederkehrt... Und Nietzsches Gefühl gegenüber diesem Gedanken ist genau das Gegenteilige von dem, das Dühring bei ihm hat. Nietzsche ist dieser Gedanke die höchste Formel der Lebensbejahung. Aphorismus 43 (bei Horneffer, 234 in Koegels Ausgabe lautet: die zukünftige Geschichte: immer mehr wird dieser Gedanke siegen - und die nicht daran glauben, die müssen ihrer Natur nach endlich aussterben? - Nur wer sein Dasein für ewig wiederholungsfähig hält, bleibt übrig: unter solchen aber ist ein Zustand möglich, an den kein Utopist gereicht hat! Es ist der Nachweis möglich, daß viele der Nietzsche'schen Gedanken auf dieselbe Art entstanden sind wie der ewige Wiederkunftsgedanke. Nietzsche bildete zu irgend einer vorhandenen Idee die Gegen-Idee. Schließlich führte ihn dieselbe Tendenz auf sein Hauptwerk: Umwertung aller Werte.»
Mir war damals klar: Nietzsche ist mit gewissen seiner nach der Geist-Welt strebenden Gedanken ein Gefangener dem Naturanschauung. Deshalb lehnte ich die mystische Interpretation seines Wiederkunftsgedankens streng ab. Und ich stimmte Peter Gast zu, der in seiner Ausgabe von Nietzsches Werken geschrieben hat: «Die
rein mechanisch zu verstehende Lehre von der Erschöpfbarkeit, also Repetition, der kosmischen Molekularkombinationen.» - Nietzsche glaubte einen Höhe-Gedanken aus den Grundlagen der Naturanschauung holen. zu müssen. Das war die Art, wie er an seiner Zeit leiden mußte.
So stand was man - nach dem Geiste ausblickend - an der Naturanschauung vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts zu leiden hatte, in dem Anblicke von Nietzsches Seele 1896 vor mir.
XIX.
Wie einsam ich damals mit dem stand, was ich im stillen als meine «Weltanschauung» in mir trug, während meine Gedanken auf Goethe einerseits und Nietzsche andererseits gelenkt waren, das konnte ich auch empfinden an dem Verhältnis zu mancher Persönlichkeit, mit der ich mich freundschaftlich verbunden fühlte, und die doch mein Geistesleben energisch ablehnte.
Der Freund, den ich in jungen Jahren gewonnen hatte, nachdem unsere Ideen so aneinandergeprallt waren, daß ich ihm sagen mußte: «Wäre richtig, was du über das Wesen des Lebens denkst, so wäre ich lieber das Holzstück, auf dem meine Füße stehen, als ein Mensch», verblieb mir in Liebe und Treue zugetan. Seine warm gehaltenen Briefe aus Wien versetzten mich immer wieder an den Ort, der mir so lieb war; namentlich durch die menschlichen Beziehungen, in denen ich da leben durfte.
Aber wenn der Freund in seinen Briefen auf mein Geistesleben zu sprechen kam, da tat sich ein Abgrund auf.
Er schrieb mir oft, daß ich dem ursprünglich Menschlichen mich entfremde, daß ich «meine Seelen-Impulse rationalisiere». Er hatte das Gefühl, daß bei mir das Gefühlsleben sich umwandle in ein reines Gedankenleben; und er empfand dieses als eine von mir ausgehende Kälte. Es konnte mir alles nichts helfen, was ich auch dagegen geltend machte. Ich mußte sogar bemerken, daß zeitweilig die Wärme seiner Freundschaft abnahm, weil er den Glauben nicht los werden konnte: ich müsse in dem Menschlichen erkalten, da ich mein Seelenleben in der Region des Gedankens verbrauche.
Wie ich, statt im Gedankenleben zu erkalten, das ganze Menschliche in dieses Leben mitnehmen mußte, um mit ihm in der Sphäre des Gedanklichen die geistige Wirklichkeit zu ergreifen, das wollte er nicht begreifen.
Er sah nicht, daß das Rein-Menschliche verbleibt, auch wenn es in das Gebiet des Geistes sich erhebt; er sah nicht, wie man im Gedankengebiet leben könne; er vermeinte, man könne da bloß denken und müsse sich in der kalten Region des Abstrakten verlieren.
Und so machte er mich zu einem «Rationalisten». Ich empfand darin das größte Mißverständnis dessen, was auf meinen Geisteswegen lag. Alles Denken, das von der Wirklichkeit hinwegführte und in Abstraktheit auslief, war mir im Innersten zuwider. Ich war in einer Seelenverfassung, die den Gedanken aus der sinnenfälligen Welt nur bis zu der Stufe herausführen wollte, wo er droht, abstrakt zu werden; in diesem Augenblicke, sagte ich mir, müsse er den Geist ergreifen Mein Freund sah, wie ich mit dem Gedanken aus der Welt des Physischen heraustrete; aber er gewahrte nicht, wie ich in demselben Augenblicke in das Geistige hineintrete. Und so war ihm, wenn ich von dem wirklich Geistigen sprach, dies alles ein Wesenloses; und er vernahm in meinen Worten nur ein Gewebe von abstrakten Gedanken.
Ich litt schwer unter der Tatsache, daß ich eigentlich, indem ich das mir Bedeutungsvollste aussprach, für meinen Freund von einem «Nichts» sprach. - Und so stand ich vielen Menschen gegenüber.
Ich mußte, was mir so im Leben gegenübertrat, auch an meiner Auffassung des Naturerkennens sehen. Ich konnte die rechte Methode des Forschens in der Natur
nur darin anerkennen, daß man die Gedanken dazu verwendet, um die Erscheinungen der Sinne in ihren gegenseitigen Verhältnissen zu durchschauen; nicht aber konnte ich zugeben, daß man durch die Gedanken, über das Gebiet der Sinnesanschauung hinaus, Hypothesen bilde, die dann auf eine außersinnliche Wirklichkeit deuten wollen, die in Wahrheit aber nur ein Gespinnst von abstrakten Gedanken bilden. Ich wollte in dem Augenblicke, wo der Gedanke an der Feststellung dessen, was die Sinneserscheinungen, recht angeschaut, durch sich selbst aufklären, genug getan hat, nicht mit einer Hypothesenbildung, sondern mit der Anschauung, mit der Erfahrung des Geistigen beginnen, das in der Sinneswelt und im wahren Sinne nicht hinter der Sinnesanschauung wesenhaft lebt.
Was ich damals, Mitte der neunziger Jahre, intensiv als meine Anschauung in mir trug, das faßte ich später in einem Aufsatz, den ich 1900 in Nr.16 des «Magazin für Literatur» schrieb, so zusammen: «Eine wissenschaftliche Zergliederung unserer Erkenntnistätigkeit führt... zu der Überzeugung, daß die Fragen, die wir an die Natur zu stellen haben, eine Folge des eigentümlichen Verhältnisses sind, in dem wir zur Welt stehen. Wir sind beschränkte Individualitäten, und können deshalb die Welt nur stückweise wahrnehmen. Jedes Stück, an und für sich betrachtet, ist ein Rätsel, oder, anders ausgedrückt, eine Frage für unser Erkennen. Je mehr der Einzelheiten wir aber kennen lernen, desto klarer wird uns die Welt. Eine Wahrnehmung erklärt die andere. Fragen, welche die Welt an uns stellt und die mit den Mitteln, die sie uns bietet, nicht zu beantworten wären, gibt es nicht. Für den
Monismus existieren demnach keine prinzipiellen Erkenntnisgrenzen. Es kann zu irgendeiner Zeit dies oder jenes unaufgeklärt sein, weil wir zeitlich oder räumlich noch nicht in der Lage waren, die Dinge aufzufinden, welche dabei im Spiele sind. Aber was heute noch nicht gefunden ist, kann es morgen werden. Die hierdurch bedingten Grenzen sind nur zufällige, die mit dem Fortschreiten der Erfahrung und des Denkens verschwinden. In solchen Fällen tritt dann die Hypothesenbildung in ihr Recht ein. Hypothesen dürfen nicht über etwas aufgestellt werden, das unserer Erkenntnis prinzipiell unzugänglich sein soll. Die atomistische Hypothese ist eine völlig unbegründete, wenn sie nicht bloß als ein Hilfsmittel des abstrahierenden Verstandes, sondern als eine Aussage über wirkliche, außerhalb der Empfindungsqualitäten liegende wirkliche Wesen gedacht werden soll. Eine Hypothese kann nur eine Annahme über einen Tatbestand sein, der uns aus zufälligen Gründen nicht zugänglich ist, der aber seinem Wesen nach der uns gegebenen Welt angehört.»
Ich habe diese Anschauung über Hypothesenbildung damals ausgesprochen, indem ich die «Erkenntnisgrenzen» als unberechtigt, die Grenzen der Naturwissenschaft als notwendige hinstellen wollte. Ich habe es damals nur im Hinblick auf die Naturerkenntnis getan. Aber diese Ideengestaltung hat mir immer den Weg gebahnt, da wo man mit den Mitteln der Naturerkenntnis an der notwendigen «Grenze» steht, mit den Mitteln der Geisteserkenntnis weiterzuschreiten.
Seelisches Wohlbefinden und etwas innerlich tief Befriedigendes erlebte ich in Weimar durch das künst-
lerische Element, das in die Stadt durch die Kunstschule und durch das Theater mit dem sich daranschließenden Musikalischen gebracht wurde.
In den malenden Lehrern und Schülern der Kunstschule offenbarte sich, was damals aus älteren Traditionen heraus nach einer neuen, unmittelbaren Anschauung und Wiedergabe von Natur und Leben strebte. Recht viele waren unter diesen Malern, die im echten Sinne als «suchende Menschen» erschienen. Wie dasjenige, was der Maler als Farbe auf seiner Palette oder in seinem Farbentopfe hat, auf die Malfläche zu bringen ist, damit, was der Künstler schafft, ein berechtigtes Verhältnis habe zu der im Schaffen lebenden und vor dem menschlichen Auge erscheinenden Natur: das war die Frage, die mit anregender, oft wohltuend phantasievoller, oft auch doktrinärer Art in den mannigfaltigsten Formen erörtert wurde, und von deren künstlerischem Erleben die zahlreichen Bilder zeugten, die von Weimarer Malern in der ständigen Kunstausstellung in Weimar vorgeführt wurden.
Meine Kunstempfindung war damals noch nicht so weit wie mein Verhältnis zu den Erkenntnis-Erlebnissen. Aber ich suchte doch auch im anregenden Verkehr mit den Weimarer Künstlern nach einer geistgemäßen Auffassung des Künstlerischen.
Ziemlich chaotisch steht vor der rückschauenden Erinnerung, was ich in der eigenen Seele empfand, wenn die modernen Maler, die Licht- und Luftstimmung im unmittelbaren Anschauen ergreifen und wiedergeben wollten, zu Felde zogen gegen die «Alten», die aus der Tradition «wußten», wie man dies oder jenes zu behandeln
habe. Es war in Vielen ein begeistertes, aus den ursprünglichsten Seelenkräften stammendes Bestreben, «wahr» zu sein im Erlauschen der Natur.
Aber nicht so chaotisch, sondern in den deutlichsten Formen steht vor meiner Seele das Leben eines jungen Malers, dessen künstlerische Art, sich zu offenbaren, mit meiner eigenen Entwickelung nach der Seite der künstlerischen Phantasie hin innig zusammenhing. Der damals in der Vollblüte der Jugend stehende Künstler schloß sich für einige Zeit eng an mich an. Das Leben hat auch ihn wieder von mir entfernt; aber ich lebte oft in der Erinnerung an die gemeinsam verbrachten Stunden.
Das Seelenleben dieses jungen Menschen war ganz Licht und Farbe. Was andere in Ideen ausdrücken, sprach er durch «Farben im Lichte» aus. Selbst sein Verstand wirkte so, daß er durch ihn die Dinge und Vorgänge des Lebens verband wie sich Farben verbinden, nicht wie sich die bloßen Gedanken verbinden, die der gewöhnliche Mensch von der Welt sich bildet.
Dieser junge Künstler war einmal auf einer Hochzeitsfeier, bei der ich auch eingeladen war. Es wurden die üblichen Festreden gehalten. Der Pastor suchte für den Inhalt seiner Rede in der Bedeutung der Namen von Braut und Bräutigam; ich suchte mich der Rednerpflicht, die mir oblag, weil ich oft in dem befreundeten Hause verkehrte, dem die Braut entstammte, dadurch zu entledigen, daß ich von den entzückenden Erlebnissen sprach, die die Gäste dieses Hauses haben konnten. Ich redete, weil man erwartete, daß ich rede. Und man erwartete von mir eine Hochzeitstischrede, wie «sich's ge-
hört». Und so hatte ich an «meiner Rolle» wenig Freude.
- Nach mir erhob sich der junge Maler, der längst auch Freund des Hauses geworden war. Von ihm erwartete man eigentlich nichts. Denn man wußte, solche Vorstellungen, wie man sie in Tischreden bringt, die hat der nicht. Er fing an etwa so: «Uber den rot erglimmenden Gipfel des Hügels liebend der Sonnenglanz ergossen. Wolken über Hügel und im Sonnenglanz atmend; glühend rote Wangen dem Sonnenlichte entgegenhaltend, zum Geistes-Farben-Triumphbogen sich vereinend, das Geleite gebend dem zur Erde strebenden Lichte. Blumenflächen weit und breit, über sich gelb erglimmende Stimmung, die in die Blumen schlüpft, Leben aus ihnen erweckend...» Er sprach so noch lange fort. Er hatte ja plötzlich all das Hochzeitgewühle um sich vergessen und «im Geiste» zu malen begonnen. Ich weiß nicht mehr, warum er aufgehört hat, so malend zu sprechen; ich glaube, es hat ihn jemand an seinem Samtrock gezupft, der ihn sehr lieb hatte, der es aber nicht weniger lieb hatte, daß die Gäste zum ruhigen Genusse des Hochzeitsbratens kamen.
Der junge Maler hieß Otto Fröhlich. Er saß viel bei mir auf meiner Stube, wir machten zusammen Spaziergänge und Ausflüge. Otto Fröhlich malte «im Geiste» immer neben mir. Man konnte neben ihm vergessen, daß die Welt noch einen andern Inhalt hat als Licht und Farbe.
So empfand ich den jungen Freund. Ich weiß, wie, was ich ihm zu sagen hatte, ich vor seiner Seele in ein Farbenkleid hüllte, um mich ihm verständlich zu machen.
Und der junge Maler brachte es auch wirklich dahin,
den Pinsel so zu führen, die Farbe so zu4egen, daß seine Bilder bis zum hohen Grade ein Abglanz wurden seiner lebend-üppigen Farbenphantasie. Wenn er einen Baumstamm malte, dann war auf der Leinwand nicht die Linienform des Gebildes, wohl aber, was Licht und Farben aus sich heraus offenbaren, wenn der Baumstamm ihnen die Gelegenheit gibt, sich darzuleben.
Ich suchte in meiner Art nach dem Geistgehalt des leuchtend Farbigen. In ihm mußte ich das Geheimnis des Farbenwesens sehen. In Otto Fröhlich stand ein Mensch an meiner Seite, der persönlich instinktiv als sein Erleben in sich trug, was ich für das Ergreifen der Farbenwelt durch die menschliche Seele suchte.
Ich empfand es als beglückend, gerade durch mein eigenes Suchen dem jungen Freunde manche Anregung geben zu können. Eine solche bestand im folgenden. Ich erlebte selbst das intensiv Farbige, das Nietzsche in dem Zarathustra-Kapitel vom «häßlichsten Menschen» darbietet, in einem hohen Maße. Dieses «Tal des Todes», dichtend gemalt, enthielt für mich vieles von dem Lebensgeheimnis der Farben.
Ich gab Otto Fröhlich den Rat: er möge Nietzsches dichtend gemaltes Bild von Zarathustra und dem häßlichsten Menschen nun malend dichten. Er tat dieses. Es kam nun eigentlich etwas Wunderbares zustande. Die Farben konzentrierten sich leuchtend, vielsagend in der Zarathustra-Figur. Diese kam nur nicht als solche voll zustande, weil in Fröhlich noch nicht die Farbe selbst bis zur Schöpfung des Zarathustra sich entfalten konnte. Aber um so lebendiger umwellte das Farbenschillern die «grünen Schlangen» im Tal des häßlichsten Menschen.
In dieser Partie des Bildes lebte der ganze Fröhlich. Nun aber der « häßlichste Mensch». Da hätte es der Linie bedurft, der malenden Charakteristik. Da versagte Fröhlich. Er wußte noch nicht, wie in der Farbe gerade das Geheimnis lebt, aus sich, durch ihre Eigenbehandlung, das Geistige in der Form erstehen zu lassen. Und so wurde der «häßlichste Mensch» eine Wiedergabe desjenigen Modells, das unter weimarischen Malern der «Füllsack» hieß. Ich weiß nicht, ob dies wirklich der bürgerliche Name des Mannes war, den die Maler immer benützten, wenn sie «charakteristisch ins Häßliche» werden wollten; aber ich weiß, daß «Füllsacks» Häßlichkeit schon keine bürgerlich-philiströse mehr war, sondern etwas vom «Genialischen» hatte. Aber ihn so ohne weiteres als den »häßlichen Füllsack» in das Bild hineinzusetzen, als Modellkopie, da, wo Zarathustras Seele leuchtend in Antlitz und Kleid sich offenbarte, wo das Licht wahres Farbenwesen aus seinem Verkehr mit den grünen Schlangen hervorzauberte, das verdarb Fröhlich das malerische Werk. Und so konnte das Bild doch nicht das werden, was ich gehofft hatte, daß es durch Otto Fröhlich zustande käme.
Obwohl ich Geselligkeit im Charakter meines Wesens sehen muß, so fühlte ich in Weimar doch nie in ausgiebigerem Maße den Antrieb, mich dort einzufinden, wo die Künstlerschaft und alles, was gesellschaftlich sich mit ihr verbunden wußte, die Abende zubrachte.
Das war in einem romantisch aus einer alten Schmiede umgestalteten, gegenüber dem Theater gelegenen «Künstlervereinshaus». Da saßen im dämmerigen, farbigen Licht vereint die Lehrer und Schüler der Maler-
Akademie, da saßen Schauspieler und Musiker. Wer Geselligkeit «suchte», der mußte sich gedrängt fühlen, am Abend dahin zu gehen. Und ich fühlte es eben deshalb nicht, weil ich doch Geselligkeit nicht suchte, sondern sie dankbar hinnahm, wenn die Verhältnisse sie mir brachten.
Und so lernte ich in anderen geselligen Zusammenhängen einzelne Künstler kennen; nicht aber «die Künstierschaft».
Und einzelne Künstler in Weimar in jener Zeit kennen zu lernen, war schon Gewinn des Lebens. Denn die Traditionen des Hofes, die außerordentlich sympathische persönlichkeit des Großherzogs Karl Alexander gaben der Stadt eine künstlerische Haltung, die fast alles, was Künstlerisches sich in jenem Zeitabschnitt abspielte, in irgend ein Verhältnis zu Weimar brachte.
Da war vor allem das Theater mit den guten alten Traditionen. In seinen wichtigsten Darstellern durchaus abgeneigt, naturalistischen Geschmack aufkommen zu lassen. Und wo das Moderne sich offenbaren und manchen Zopf ausmerzen wollte, der immer auch mit guten Traditionen doch verknüpft ist, da war die Modernität doch weitab gelegen von dem, was Brahm auf der Bühne, Paul Schlenther journalistisch als die «moderne Auffassung» propagierten. Da war unter diesen «Weimarer Modernen» vor allem der durch und durch künstlerische, edle Feuergeist Paul Wiecke. Solche Menschen in Weimar die ersten Schritte ihres «Künstlertums machen zu sehen, gibt unauslöschliche Eindrücke und ist eine weite Schule des Lebens. Paul Wiecke brauchte den Untergrund eines Theaters, das, aus seinen Traditionen heraus, den elemen-
tarischen Künstler ärgert. Es waren anregende Stunden, die ich im Hause von Paul Wiecke verleben durfte. Er war mit meinem Freunde Julius Wahle tief befreundet; und so kam es, daß ich zu ihm in ein näheres Verhältnis trat. Es war oft entzückend, Wiecke poltern zu hören fast über alles, was er erleben mußte, wenn er die Proben für ein neu aufzuführendes Stück absolvierte. Und im Zusammenhang damit dann ihn die Rolle spielen zu sehen, die er sich so erpoltert hatte; die aber immer durch das edle Streben nach Stil und auch durch schönes Feuer der Begeisterung einen seltenen Genuß darbot.
In Weimar machte damals seine ersten Schritte Richard Strauß. Er wirkte als zweiter Kapellmeister neben Lassen. Die ersten Kompositionen Richard Strauß' wurden in Weimar zur Aufführung gebracht Das musikalische Suchen dieser Persönlichkeit offenbarte sich wie ein Stück weimarischen Geisteslebens selbst. Solche freudig-hingebungsvolle Aufnahme von etwas, das im Aufnehmen zum aufregenden künstlerischen Problem wurde, war doch nur im damaligen Weimar möglich. Ringsum Ruhe des Traditionellen, getragene, würdige Stimmung: nun fährt da hinein Richard Strauß' «Zarathustra-Symphonie», oder gar seine Musik zum Eulenspiegel. Alles wacht auf aus Tradition, Getragenheit, Würde; aber es wacht so auf, daß die Zustimmung liebenswürdig, die Ablehnung harmlos ist - und der Künstler so in der schönsten Art das Verhältnis zu der eigenen Schöpfung finden kann.
Wir saßen so viele Stunden lang bei der Erst-Aufführung von Richard Strauß' Musikdrama «Guntram», wo der so liebwerte, menschlich so ausgezeichnete
Heinrich Zeller die Hauptrolle hatte und sich fast stimmlos sang.
Ja, dieser tief sympathische Mensch, Heinrich Zeller, auch er mußte Weimar haben, um zu werden, was er geworden ist. Er hatte die schönste elementarste Sängerbegabung. Er brauchte, um sich zu entfalten, eine Umgebung, die in voller Geduld entgegennahm, wenn sich eine Begabung nach und nach hinaufexperimentierte. Und so war die Entfaltung Heinrich Zellers zu dem Menschlich-Schönsten zu zählen, das man erleben kann. Dabei war Zeller eine so liebenswürdige Persönlichkeit, daß man Stunden, die man mit ihm verlebte, zu den reizvollsten zählen mußte.
Und so kam es, daß, obwohl ich nicht oft daran dachte, abends in die Künstlervereinigung zu gehen: wenn Heinrich Zeller mich traf und sagte, ich solle mitgehen, ich dieser Aufforderung jedes Mal gerne folgte.
Nun hatten die weimarischen Zustände auch ihre Schattenseiten. Das Traditionelle, Ruhe-Liebende hält nur zu oft den Künstler wie in einer Art von Dumpfheit zurück. Heinrich Zeller ist der Welt außerhalb Weimars wenig bekannt geworden. Was zunächst geeignet war, seine Schwingen zu entfalten, hat sie dann doch wieder gelähmt Und so ist es ja wohl auch mit meinem lieben Freunde Otto Fröhlich geworden. Der brauchte, wie Zeller, Weimars künstlerischen Boden; den nahm aber auch die abgedämpfte geistige Atmosphäre zu stark in ihre künstlerische Behaglichkeit auf.
Und man fühlte diese «künstlerische Behaglichkeit» in dem Eindringen des Geistes Ibsens und von anderem Modernen. Da machte man alles mit. Den Kampf, den
die Schauspieler kämpften, um den Stil z. B. für eine «Nora» zu finden. Ein solches Suchen, wie man es hier bemerken konnte, findet nur da statt, wo man durch die Fortpflanzung der alten Bühnentraditionen eben Schwierigkeiten findet, um das darzustellen, was von Dichtern herrührt, die nicht wie Schiller von der Bühne, sondern wie Ibsen von dem Leben ausgegangen sind.
Man machte aber auch die Spiegelung dieses Modernen aus der «künstlerischen Behaglichkeit» des Theaterpublikums mit. Man sollte nun doch den Weg finden mitten durch das, was einem der Umstand auferlegte, daß man ein Bewohner des «klassischen Weimar» war, und auch durch das, was Weimar doch groß gemacht hat, nämlich daß es immerdar Verständnis für das Neue gehabt hat.
Mit Freude denke ich an die Aufführungen der Wagner'schen Musikdramen zurück, die ich in Weimar mitgemacht habe. Der Intendant v. Bronsart entwickelte besonders für diese Seite der Theaterleistungen verständnisvollste Hingabe. Heinrich Zellers Stimme kam da zur vorzüglichsten Geltung. Eine bedeutende «Kraft als Sängerin war Frau Agnes Stavenhagen, die Frau des Pianisten Bernhard Stavenhagen, der auch eine Zeitlang «Kapellmeister am Theater war. Wiederholte Musikfeste brachten die die Zeit repräsentierenden Künstler und deren Werke nach Weimar. Man sah z. B. da Mahler als «Kapellmeister bei einem Musikfest in seinen Anfängen. Unauslöschlich der Eindruck, wie er den Taktstock führte, Musik nicht im Flusse der Formen fordernd, sondern als Erleben eines Übersinnlich-Verborgenen, zwischen den Formen sinnvoll pointierend.
Was sich mir hier von Weimarer Vorgängen, scheinbar ganz losgelöst von mir, vor die Seele stellt, ist aber in Wirklichkeit doch tief mit meinem Leben verbunden. Denn es waren das Ereignisse und Zustände, die ich eben als das erlebte, das mich in intensivster Art anging. Ich habe oftmals später, wenn ich einer Persönlichkeit oder deren Werk begegnete, die ich in ihren Anfängen in Weimar miterlebt habe, dankbar zurückgedacht an diese Weimarer Zeit, durch die so vieles verständlich werden konnte, weil so vieles dorthin gegangen war, um dort den Keimzustand durchzumachen. So erlebte ich gerade damals in Weimar das «Kunststreben so, daß ich über das meiste mein eigenes Urteil in mir trug, oft recht wenig in Übereinstimmung mit dem der andern. Aber daneben interessierte mich alles, was die andern empfanden, ebenso stark wie das eigene. Auch da bildete sich in mir ein inneres Doppelleben der Seele aus.
Es war dies eine rechte, durch das Leben selbst schicksalsgemäß herangebrachte Seelen-Übung, um über das abstrakte Entweder-Oder des Verstandes-Urteiles hinauszukommen. Dieses Urteil errichtet für die Seele Grenzen vor der übersinnlichen Welt. In dieser sind nicht Wesen und Vorgänge, die zu einem solchen Entweder-Oder Anlaß geben. Man muß dem Übersinnlichen gegenüber vielseitig werden. Man muß nicht nur theoretisch lernen, sondern man muß es in die innersten Regungen des Seelenlebens gewohnheitsmäßig aufnehmen, alles von den mannigfaltigsten Gesichtspunkten aus zu betrachten. Solche «Standpunkte» wie Materialismus, Realismus, Idealismus, Spiritualismus, wie sie von abstrakt orientierten Persönlichkeiten in der physischen Welt zu umfang-
reichen Theorien ausgebildet werden, um etwas an den Dingen selbst zu bedeuten, verlieren für den Erkenner des Übersinnlichen alles Interesse. Er weiß, daß z. B. Materialismus nichts anderes sein kann, als der Anblick der Welt von dem Gesichtspunkte aus, von dem sie sich in materieller Erscheinung zeigt.
Eine praktische Schulung in dieser Richtung ist es nun, wenn man sich in ein Dasein versetzt sieht, das einem das Leben, das außerhalb seine Wellen schlägt, innerlich so nahe bringt wie das eigene Urteilen und Empfinden. Das aber war so für mich mit vielem in Weimar. Mir scheint, mit dem Ende des Jahrhunderts hat das dort aufgehört. Vorher ruhte doch noch der Geist Goethes und Schillers über allem. Und der alte, liebe Großherzog, der so vornehm durch Weimar und seine Anlagen schritt, hatte als «Knabe noch Goethe erlebt. Er fühlte wahrhaftig seinen «Adel» recht stark; aber er zeigte überall, daß er sich durch «Goethes Werk für Weimar» ein zweites Mal geadelt fühlte.
Es war wohl der Geist Goethes, der von allen Seiten in Weimar so stark wirkte, daß mir eine gewisse Seite des Mit-Erlebens dessen, was da geschah, zu einer praktischen Seelen-Übung im rechten Darstellen der übersinnlichen Welten wurde.
XX.
Ein in schönster Art gestaltetes gesellschaftliches Entgegenkommen fand ich in der Familie des Archivars am Goethe- und Schiller-Archiv, Eduard von der Hellens. Diese Persönlichkeit stand neben den anderen Mitarbeitern des Archivs in einer eigentümlichen Lage. Sie hatte in den Kreisen der Fachphilologen durch die außerordentlich gelungene Erstlingsarbeit über «Goethes Anteil an Lavaters physiognomischen Fragmenten» ein außerordentlich großes Ansehen. Von der Hellen hatte mit dieser Arbeit etwas geleistet, das jeder Fachgenosse sofort als «voll» nahm. Nur der Autor selbst dachte nicht so. Er sah die Arbeit als eine methodische Leistung an, deren Prinzipien man «lernen könne», während er nach einer inneren seelischen Erfüllung mit Geist-Gehalt allseitig streben wollte.
So saßen wir, wenn nicht Besucher da waren, eine Zeitlang im alten Mitarbeiterzimmer des Archives, da dieses noch im Schlosse war, zu drei: von der Hellen, der an der Ausgabe von Goethes Briefen, Julius Wahle, der an den Tagebüchern, und ich, der an den naturwissenschaftlichen Schriften arbeitete. Aber gerade aus den geistigen Bedürfnissen Eduard von der Hellens heraus ergaben sich zwischen der Arbeit Gespräche über die allermannigfaltigsten Gebiete des geistigen und sonstigen öffentlichen Lebens. Es kamen dabei aber diejenigen Interessen durchaus zu ihrem Recht, die sich an Goethe anschlossen. Aus den Eintragungen, die Goethe in seine Tagebücher gemacht hat, aus den manchmal so hohe Standpunkte und weite Gesichtskreise offenbarenden Brief-
stellen Goethes konnten sich Betrachtungen ergeben, die in die Tiefen des Daseins und in die Weiten des Lebens führten.
Eduard von der Hellen hatte die große Liebenswürdigkeit, die Beziehungen, die sich aus diesem oft so anregenden Archiv-Verkehre ergeben hatten, dadurch weiterzubilden, daß er mich in den Kreis seiner Familie einführte. Es ergab sich ja dadurch eine schöne Erweiterung der Geselligkeit, daß Eduard von der Hellens Familie gleichzeitig in den Kreisen verkehrte, die ich als die um Olden, um Gabriele Reuter u. a. beschrieben habe.
In besonders eindringlicher Erinnerung ist mir stets die so tief sympathische Frau von der Hellen gewesen. Eine durch und durch künstlerische Natur. Eine von denen, die, wenn nicht andere Lebenspflichten aufgetreten wären, es in der Kunst zu schönen Leistungen hätte bringen können. So wie das Schicksal gewirkt hat, so kam, so weit ich weiß, das Künstlertum dieser Frau nur in Anfängen zum Vorschein. Aber wohltuend wirkte jedes Wort, das man mit ihr über Kunst sprechen durfte. Sie hatte einen wie verhaltenen, stets im Urteil vorsichtigen, aber rein-menschlich tief sympathischen Grundton. Ich ging selten von einem solchen Gespräche weg, ohne daß ich, was Frau von der Hellen mehr angeschlagen als gesagt hatte, lange sinnend in meinem Gemüte herumtrug.
Von großer Liebenswürdigkeit waren auch der Vater der Frau von der Hellen, ein General-Leutnant, der den siebenziger Krieg als Major mitgemacht hatte, und dessen zweite Tochter. Wenn man im Kreise dieser Menschen war, lebten die schönsten Seiten der deutschen
Geistigkeit auf, jener Geistigkeit, die von den religiösen, den schöngeistigen, den populär-wissenschaftlichen Impulsen, die so lange das eigentliche geistige Wesen des Deutschen waren, hinein erflossen in alle Kreise des sozialen Lebens.
Eduard von der Hellens Interessen brachten für einige Zeit das politische Leben der damaligen Zeit an mich heran. Die Unbefriedigtheit mit dem Philologischen warf von der Hellen in das rege politische Leben Weimars hinein. Da schien sich für ihn eine weitere Lebensperspektive zu eröffnen. Und das freundschaftliche Interesse für diese Persönlichkeit ließ auch mich, ohne tätigen Anteil an der Politik zu nehmen, Interesse fassen für die Bewegungen des öffentlichen Lebens.
Man hatte damals vieles von dem, was heute im Leben entweder sich in seiner Unmöglichkeit gezeigt, oder in furchtbaren Metamorphosen absurde soziale Gestaltungen hervorgebracht hat, in seiner Entstehung vor sich, mit all den Hoffnungen einer Arbeiterschaft, die von beredten, energischen Führern den Eindruck empfangen hatte, es müsse für die Menschheit eine neue Zeit der sozialen Gestaltung kommen. Besonnenere und ganz radikale Elemente in der Arbeiterschaft machten sich geltend. Sie zu beobachten war um so eindrucksvoller, als ja das, was sich da zeigte, wie ein Brodeln des sozialen Lebens in den Untergründen war. Obenauf lebte doch, was an würdigem Konservatismus im Zusammenhange mit einem vornehm denkenden, für alles Humane energisch und eindringlich wirkenden Hofe sich nur hatte ausbilden können. In der Atmosphäre, die da vorhanden war, sproßten eine sich als selbstverständlich nehmende reak-
tionäre Partei und außerdem das, was man National-Liberalismus nannte.
In all dem sich so zurechtzufinden, daß sich für ihn eine durch die Wirrnisse hindurchorientierte fruchtbare Führerrolle ergeben möchte, so mußte man interpretieren, was nun Eduard von der Hellen darlebte. Und man mußte miterleben, was er in dieser Richtung erlebte. Er besprach alle Einzelheiten, die er für eine Broschüre ausarbeitete, im Kreise seiner Freunde. Man mußte sich so tief für die damals mit ganz anderem Empfinden als jetzt begleiteten Begriffe von materialistischer Geschichtsauffassung, Klassenkampf, Mehrwert interessieren wie Eduard von der Hellen selbst. Man konnte gar nicht anders als in die zahlreichen Versammlungen mitgehen, in denen er als Redner auftrat. Er dachte, dem theoretisch gebildeten marxistischen Programme ein anderes gegenüberzusetzen, das aus dem guten Willen zum sozialen Fortschritt bei allen Arbeiterfreunden aller Parteien ersprießen sollte. An eine Art Neu-Belebung der Mittelparteien mit Aufnahme solcher Impulse in deren Programme dachte er, durch die das soziale Problem bewältigt werden könne.
Die Sache verlief ohne Wirkung. Nur das darf ich sagen, daß ich ohne die Teilnahme an dieser Hellen'schen Bestrebung das öffentliche Leben in jenem Zeitraume nicht so intensiv miterlebt hätte, als es durch dieselbe geschehen ist.
Noch von einer andern Richtung allerdings, aber weit weniger intensiv, kam dieses Leben an mich heran. Ja, da zeigte sich, daß ich ziemliche Widerstände entwickelte -was bei von der Hellen nicht der Fall war -, wenn Poli-
tisches sich nahte. Es lebte damals in Weimar ein freisinniger Politiker, Anhänger Eugen Richters und auch in dessen Sinne politisch tätig, Dr. Heinrich Fränkel. Ich wurde mit dem Manne bekannt. Eine kurze Bekanntschaft, die dann durch ein «Mißverständnis» abgebrochen wurde, an die ich aber oft gerne zurückdenke. Denn der Mann war in seiner Art außerordentlich liebenswert, hatte energischen Politiker-Willen und dachte, mit gutem Willen und vernünftigen Einsichten müßten sich Menschen für einen rechten Fortschritts-Weg im öffentlichen Leben begeistern lassen. Sein Leben wurde eine Kette von Enttäuschungen. Schade, daß ich selbst ihm auch eine solche bereiten mußte. Er arbeitete gerade während der Zeit unserer Bekanntschaft an einer Broschüre, bei der er an eine Massenverbreitung größten Stiles dachte. Es handelte sich für ihn darum, schon damals entgegenzuarbeiten dem Ergebnis des Bundes zwischen Groß-Industrie und Agrariertum, das in Deutschland damals keimte und was später, nach seiner Ansicht, zu verheerender Frucht sich entwickeln müßte. Seine Broschüre trug den Titel: «Kaiser, werde hart.» Er dachte daran, die Kreise um den Kaiser von dem, nach seiner Ansicht, Schädlichen überzeugen zu können. - Der Mann hatte damit nicht den geringsten Erfolg. Er sah, daß aus der Partei, der er zugehörte, und für die er arbeitete, nicht die Kräfte zu holen seien, die für eine von ihm gedachte Aktion eine Grundlage liefern können.
Und so kam er dazu, sich eines Tages dafür zu begeistern, die «Deutsche Wochenschrift», die ich vor einigen Jahren kurze Zeit hindurch in Wien redigiert hatte, wieder aufleben zu lassen. Er wollte damit eine politische
Strömung schaffen, die ihn vom damaligen «Freisinn» hinweg in eine mehr national-freigeistige Tätigkeit geführt hätte. Er dachte sich, ich könne in dieser Richtung mit ihm zusammen etwas machen. Das war unmöglich; allein auch für die Wiederbelebung der «Deutschen Wochenschrift» konnte ich nichts tun. Die Art, wie ich ihm dieses mitteilte, führte zu Mißverständnissen, welche die Freundschaft in kurzer Zeit zerstörten.
Aber aus dieser Freundschaft ging ein anderes hervor. Der Mann hatte eine sehr liebe Frau und liebe Schwägerin. Und er führte mich auch in seine Familie ein. Diese wieder brachte mich zu einer anderen Familie. Und da spielte sich nun etwas ab, das wie das Abbild des merk-würdigen Schicksalszusammenhanges sich darstellt, der mich einst in Wien getroffen hat. Ich habe dort in einer Familie intim verkehrt, doch so, daß deren Haupt immer unsichtbar geblieben, mir aber doch geistig-seelisch so nahe gekommen war, daß ich nach seinem Tode die Begräbnisrede wie für den besten Freund gehalten habe. Die ganze Geistigkeit dieses Mannes stand durch die Familie in voller Wirklichkeit vor meiner Seele.
Und jetzt trat ich in fast die ganz gleiche Beziehung zu dem Haupte der Familie, in die ich auf dem Umwege durch den freisinnigen Politiker eingeführt wurde. Dieses Familienhaupt war vor kurzer Zeit gestorben; die Witwe lebte voller Pietät im Gedenken an den Verstorbenen. Es ergab sich, daß ich aus meiner bisherigen Weimarischen Wohnung auszog, und mich bei der Familie einmietete. Da war die Bibliothek des Verstorbenen. Ein nach vielen Richtungen geistig interessierter Mensch, ganz aber wie jener in Wien lebende, abgeneigt der Berührung mit
Menschen; in seiner eigenen «Geisteswelt» wie jener lebend; von der Welt so wie jener für einen «Sonderling» genommen.
Ich empfand den Mann gleich dem andern, ohne ihm im physischen Leben begegnen zu können, wie «hinter den Kulissen des Daseins» durch mein Schicksal schreiten. In Wien entstand ein so schönes Band zwischen der Familie des so bekannten «Unbekannten» und mir; und in Weimar entstand zwischen dem zweiten also «Bekannten» und seiner Familie und mir ein noch bedeutungsvolleres.
Wenn ich nun von den zwei «unbekannten Bekannten» reden muß, so weiß ich, daß, was ich zu sagen habe, von den meisten Menschen als wüste Phantasterei bezeichnet wird. Denn es bezieht sich darauf, wie ich den beiden Menschenseelen nahetreten durfte in dem Weltgebiet, in dem sie waren, nachdem sie durch die Pforte des Todes gegangen waren.
Es hat jedermann das innerliche Recht, Aussagen über dieses Gebiet aus dem Kreise dessen zu streichen, das ihn interessiert; sie aber als etwas behandeln, das nur als phantastisch charakterisiert werden kann, ist doch noch etwas anderes. Wenn dieses jemand tut, dann muß ich geltend machen, daß ich die Quellen zu derjenigen Seelenverfassung, aus der heraus man etwas Geistiges behaupten darf, immer bei solchen exakten Wissenszweigen wie der Mathematik oder der analytischen Mechanik gesucht habe. Leichtsinniges Hinreden, ohne Erkenntnis-Verantwortung, wird also nicht zum Vorwurf gemacht werden dürfen, wenn ich das Folgende sage.
Die geistigen Anschauungskräfte, die ich damals in der
Seele trug, machten mir möglich, mit den beiden Seelen eine engere Verbindung nach ihrem Erdentode zu haben. Sie waren anders geartet als andere Verstorbene. Diese machen nach dem Erdentode zunächst ein Leben durch, das, seinem Inhalte nach, eng mit dem Erdenleben zusammenhängt, das erst langsam und allmählich ähnlich demjenigen wird, das der Mensch in der rein geistigen Welt hat, in der er sein Dasein verbringt bis zu einem nächsten Erdenleben.
Die beiden «unbekannten Bekannten» waren nun mit den Gedanken des materialistischen Zeitalters ziemlich gründlich bekannt geworden. Sie haben begrifflich die naturwissenschaftliche Denkungsart in sich verarbeitet. Der zweite, den mir Weimar brachte, war sogar gut bekannt mit Billroth und ähnlichen naturwissenschaftlichen Denkern. Dagegen war wohl beiden während ihres Erdenlebens eine geistgemäße Weltauffassung ferne geblieben. Sie würden wohl jede, die ihnen damals hätte entgegentreten können, abgelehnt haben, weil ihnen das «naturwissenschaftliche Denken» nun einmal als das Ergebnis der Tatsachen, nach dem Charakter der Denkgewohnheiten der Zeit, hat erscheinen müssen.
Aber dieses Verbundensein mit dem Materialismus der Zeit blieb ganz in der Ideenwelt der beiden Persönlichkeiten. Sie machten die Lebensgewohnheiten nicht mit, die aus dem Materialismus ihres Denkens folgten und die bei allen andern Menschen die herrschenden waren. Sie wurden «Sonderlinge vor der Welt», lebten in primitiveren Formen, als man es damals gewohnt war und als es ihnen nach ihrem Vermögensstande zugekommen wäre. So trugen sie in die geistige Welt nicht das
hinüber, was ein Verbundensein mit den materialistischen Willenswerten ihren geistigen Individualitäten hätte geben können, sondern nur dasjenige, was die materialistischen Denkwerte in diese Individualitäten verpflanzt hatten. Selbstverständlich spielte sich dies für die Seelen zum größten Teil im Unterbewußten ab. Und nun konnte ich sehen, wie diese materialistischen Denkwette nicht etwas sind, das den Menschen nach dem Tode der göttlich-geistigen Welt entfremdet; sondern daß diese Entfremdung nur durch die materialistischen Willenswerte eintritt. Sowohl die Seele, die mir in Wien nahegetreten war, sowie auch diejenige, die ich in Weimar geistig kennen lernte, waren nach dem Tode herrlich-leuchtende Geistgestalten, in denen der Seelen4nhalt erfüllt war von den Bildern der geistigen Wesenheiten, die der Welt zum Grunde liegen. Und ihr Bekanntwerden mit den Ideen, durch die sie das Materielle genauer durchdachten während ihres letzten Erdenlebens, hat nur dazu beigetragen, daß sie auch nach dem Tode ein urteilgetragenes Verhältnis zur Welt entwickeln konnten, wie es ihnen nicht geworden wäre, wenn die entsprechenden Ideen ihnen fremd geblieben wären.
In diesen zwei Seelen hatten sich Wesen in meinen Schicksalsweg hereinversetzt, durch die sich mir unmittelbar aus der geistigen Welt heraus die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Denkart enthüllte. Ich konnte sehen, daß diese Denkart an sich nicht von einer geist-gemäßen Anschauung hinwegführen muß. Bei den beiden Persönlichkeiten war dieses während ihres Erden-lebens deshalb geschehen, weil sie da keine Gelegenheit fanden, das naturwissenschaftliche Denken hinaufzu-
heben in die Sphäre, wo geistiges Erleben beginnt. Nach ihrem Tode hatten sie das in der allervollkommensten Art vollbracht. Ich sah, man kann dieses Hinaufheben auch bewirken, wenn man im Erdenleben inneren Mut und Kraft dazu aufbringt. Ich sah auch, durch ein Mit-Erleben von Bedeutungsvollem in der geistigen Welt, daß die Menschheit sich zu der naturwissenschaftlichen Denkart hat entwickeln müssen. Frühere Denkweisen konnten die Menschenseele mit dem Geist der übersinnlichen Welt verbinden; sie konnten den Menschen, wenn er überhaupt auf Selbst-Erkenntnis (die Grundlage aller Erkenntnis) einging, dazu führen, sich als ein Abbild, oder auch ein Glied der göttlich-geistigen Welt zu wissen; sie konnten ihn aber nicht dazu bringen, sich als eine selbständige, in sich geschlossene geistige Wesenheit zu erfühlen. Es mußte deshalb der Fortschritt zum Fassen einer Ideenwelt gemacht werden, die nicht am Geiste selbst entzündet, sondern an der Materie angeregt ist, die wohl geistig, aber nicht aus dem Geiste ist
Eine solche Ideenwelt kann im Menschen nicht angeregt werden in der geistigen Welt, in der er nach dem Tode, beziehungsweise vor einer neuen Geburt lebt, sondern allein im irdischen Dasein, weil er nur da der materiellen Form des Seins gegenübersteht.
Was also der Mensch für sein Gesamt-Leben, auch das geistige, nach dem Tode, gewinnt durch das Verwobensein mit der naturwissenschaftlichen Denkungsart, das konnte ich an den beiden Menschenseelen erleben. Ich konnte aber auch sehen, an andern, die die Willenskonsequenzen der bloßen naturwissenschaftlichen Denkart im Erdenleben ergriffen hatten, daß sie sich der Geist-Welt ent-
fremdeten, daß sie, sozusagen, zu einem Gesamt-Leben kommen, das mit der naturwissenschaftlichen Denkart weniger den Menschen in seinem Menschentum darstellt als ohne dieselbe.
Die beiden Seelen sind «Sonderlinge vor der Welt» geworden, weil sie im Erdenleben nicht ihr Menschentum verlieren wollten; sie haben im vollen Umfange die naturwissenschaftliche Denkungsart aufgenommen, weil sie die geistige Menschheits-Etappe erreichen wollten, die ohne diese nicht möglich ist.
Ich hätte wohl nicht diese Anschauungen an den beiden Seelen gewinnen können, wenn sie mir innerhalb des Erdendaseins als physische Persönlichkeiten entgegengetreten wären. Ich brauchte für das Anschauen der beiden Individualitäten in der Geistwelt, in der sich mir ihr Wesen und durch sie vieles andere enthüllen sollte, jene Zartheit des Seelenblickes in bezug auf sie, die leicht verloren geht, wenn das in der physischen Welt Erlebte das rein geistig zu Erlebende verdeckt, oder wenigstens beeinträchtigt.
Ich mußte daher schon damals in der Eigenart des Auftretens der beiden Seelen innerhalb meines Erdendaseins etwas sehen, das schicksalgemäß für meinen Erkenntnispfad bestimmt war.
Aber irgend etwas nach dem Spiritismus hin Gerichtetes konnte bei diesem Verhältnis zu Seelen in der geistigen Welt nicht in Betracht kommen. Es konnte für mich niemals etwas anderes für die Beziehung zur geistigen Welt Geltung haben als die wirklich geistgemäße Anschauung, von der ich später in meinen anthroposophischen Schriften öffentlich gesprochen habe. Für eine me-
diale Vermittlung mit den Verstorbenen war übrigens sowohl die Wiener Familie in allen ihren Gliedern wie auch die Weimarische viel zu gesund.
Ich habe mich stets, wo dergleichen in Frage kam, auch für ein solches Suchen der Menschenseelen interessiert, wie es im Spiritismus zutage tritt. Der Spiritismus der Gegenwart ist der Abweg solcher Seelen nach dem Geistigen, die auch den Geist auf äußerliche - fast experimentelle - Art suchen möchten, weil sie das Wirkliche, Wahre, Echte einer geistgemäßen Art gar nicht mehr empfinden können. Gerade, wer sich ganz objektiv für den Spiritismus interessiert, ohne selbst durch ihn etwas erforschen zu wollen, der kann die rechten Vorstellungen über Wollen und Irrwege des Spiritismus durchschauen. - Mein eigenes Forschen ging stets andere Wege als der Spiritismus in irgendeiner Form. - Es war gerade auch in Weimar möglich, interessanten Verkehr mit Spiritisten zu haben, denn in der Künstlerschaft lebte eine Zeitlang diese Art, sich suchend zum Geistigen zu verhalten, intensiv auf.
Mir aber kam aus dem Verkehr mit den beiden Seelen - Eunike hieß die weimarische - eine Erkräftigung für meine «Philosophie der Freiheit». Was in dieser angestrebt ist: es ist zum ersten ein Ergebnis meiner philosophischen Denkwege in den achtziger Jahren; es ist zuxn zweiten auch ein Ergebnis meines konkreten allgemeinen Hineinschauens in die geistige Welt. Zum dritten fand es aber eine Erkräftigung durch das Mit-Erleben der Geist-Erlebnisse jener beiden Seelen. In ihnen hatte ich den Aufstieg vor mir, den der Mensch der naturwissenschaftlichen Weltanschauung verdankt. In ihnen hatte ich aber auch die Furcht edler Seelen vor einem Hineinleben in
das Willenselement dieser Weltanschauung vor mir. Diese Seelen bebten vor den ethischen Folgen einer solchen Weltanschauung zurück.
In meiner «Philosophie der Freiheit» habe ich nun die Kraft gesucht, die aus der ethisch neutralen naturwissenschaftlichen Ideenwelt in die Welt der sittlichen Impulse führt. Ich habe zu zeigen versucht, wie der Mensch, der sich als in sich geschlossenes, geistgeartetes Wesen weiß, weil er in Ideen lebt, die nicht mehr aus dem Geist erströ- mend, sondern an dem materiellen Sein angeregt sind, auch für das Sittliche aus seinem Eigenwesen Intuition entwickeln kann. Dadurch leuchtet das Sittliche in der frei gewordenen Individualität als individuelle ethische Impulsivität so auf wie die Ideen der Naturanschauung.
Die beiden Seelen waren nicht zu dieser moralischen Intuition vorgedrungen. Daher bebten sie (unbewußt) vor dem Leben zurück, das nur im Sinne der noch nicht erweiterten naturwissenschaftlichen Ideen hätte gehalten sein können.
Ich sprach damals von «moralischer Phantasie» als von dem Quell des Sittlichen in der menschlichen Einzel-Individualität. Ich wollte damit ganz gewiß nicht auf diesen Quell als auf etwas nicht Voll-Wirkliches hinweisen. Im Gegenteil, ich wollte in der «Phantasie» die Kraft kennzeichnen, die auf allen Gebieten der wahren geistigen Welt zum Durchbruch im individuellen Menschen verhilft. Soll es allerdings zum wirklichen Erleben des Geistigen kommen, so müssen dann die geistgemäßen Erkenntniskräfte: Imagination, Inspiration, Intuition eintreten. Der erste Strahl einer Geistoffenbarung an den individuell sich wissenden Menschen geschieht aber durch
die Phantasie, die ja in der Art, wie sie sich von allem Phantastischen entfernt und zum Bilde des geistig Wirklichen wird, gerade an Goethe beobachtet werden kann.
In der Familie, die der weimarische «unbekannte Bekannte» zurückgelassen hatte, wohnte ich den weitaus größten Teil der Zeit, die ich in Weimar verlebt habe. Ich hatte einen Teil der Wohnung für mich; Frau Anna Eunike, mit der ich bald innig befreundet wurde, besorgte für mich in aufopferndster Weise, was zu besorgen war. Sie legte einen großen Wert darauf, daß ich ihr in ihren schweren Aufgaben bei der Erziehung der Kinder zur Seite stand. Sie war als Witwe mit vier Töchtern und einem Sohne nach Eunikes Tod zurückgeblieben.
Die Kinder sah ich nur, wenn eine Gelegenheit dazu herbeigeführt wurde. Das geschah oft, denn ich wurde ja ganz als zur Familie gehörig betrachtet. Die Mahlzeiten, mit Ausnahme der am Morgen und der am Abend, nahm ich aber auswärts ein.
Da, wo ich solch schönen Familienanschluß gefunden hatte, fühlte ich mich wahrlich nicht allein nur wohl. Wenn die jüngeren Besucher der Goethegesellschafts-versammlungen aus Berlin, die sich enger an mich angeschlossen hatten, einmal ganz gemütlich «unter sich» sein wollten, da kamen sie zu mir in das Eunike'sche Haus. Und ich habe, nach der Art, wie sie sich verhalten haben, allen Grund, anzunehmen, daß sie sich da recht wohl fühlten.
Gerne fand sich auch Otto Erich Hartleben, wenn er in Weimar war, da ein. Das Goethe-Brevier, das er herausgegeben hat, ist da in wenigen Tagen von uns beiden zusammengestellt worden.
Von meinen eigenen größeren Schriften sind dort die «Philosophie der Freiheit» und «Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit» entstanden.
Und ich denke, auch mancher weimarische Freund verlebte ganz gerne ein - oder auch mehrere - Stündchen bei mir im Eunike'schen Hause.
Da denke ich vor allem an denjenigen, mit dem ich in einer echten freundschaftlichen Liebe verbunden war, Dr. August Fresenius. Er war, von einem gewissen Zeitpunkte an, ständiger Mitarbeiter am Archiv geworden. Vorher gab er die «Deutsche Literaturzeitung» heraus. Seine Redaktion war ganz allgemein als eine mustergültige angesehen worden. Ich hatte viel gegen Philologie, wie sie damals, namentlich unter der Führung der Scherer-Anhänger war, auf dem Herzen. August Fresenius entwaffnete mich immer wieder durch die Art, wie er Philologe war. Und er machte nicht einen Augenblick daraus ein Hehl, daß er Philologe und nur rechter Philologe sein wolle. Aber bei ihm war Philologie wirklich Liebe zum Worte, die den ganzen Menschen lebenskräftig erfüllte; und das Wort war ihm die menschliche Offenbarung, in der sich alle Gesetzmäßigkeiten des Weltalls spiegelten. Wer die Geheimnisse der Worte wahrhaft durchschauen will, der braucht dazu die Einsicht in alle Geheimnisse des Daseins. Der Philologe kann daher gar nicht anders, als ein universelles Wissen pflegen. Richtige philologische Methode entsprechend angewendet, kann von ganz Einfachem ausgehend, in weite und bedeutungsvolle Gebiete des Lebens starke Beleuchtungen werfen.
Fresenius zeigte dies damals an einem Beispiele, das mein Interesse intensiv in Anspruch nahm. Wir sprachen
über die Sache viel, bevor er sie in einer kurzen, aber schwerwiegenden Miszelle im «Goethe-Jahrbuch» veröffentlichte.
Bis zu dieser Entdeckung Fresenius' hatten alle Persönlichkeiten, die sich mit der Erklärung des Goethe' schen «Faust» befaßt hatten, eine Äußerung Goethes, die dieser fünf Tage vor seinem Tode zu Wilhelm von Humboldt gemacht hatte, mißverstanden. Goethe hatte die Äußerung getan: Es sind über sechzig Jahre, daß die Konzeption des «Faust» bei mir, jugendlich von vornherein klar, die weitere Reihenfolge hingegen weniger ausführlich vorlag. Die Erklärer hatten das «von vornherein» so genommen, als ob Goethe vom Anfang an eine Idee oder einen Plan des ganzen Faustdramas gehabt hätte, in die er dann die Einzelheiten mehr oder weniger hinein-gearbeitet hätte. Auch mein lieber Lehrer und Freund, Karl Julius Schröer, war dieser Meinung.
Man bedenke: wäre dieses richtig, dann hätte man in Goethes «Faust» ein Werk vor sich, das Goethe als junger Mann in dem Hauptverlauf konzipiert hätte. Man müßte zugeben, daß es der Goethe'schen Seelenverfassung möglich gewesen wäre, so aus einer allgemeinen Idee heraus zu arbeiten, daß die ausführenden Arbeiten unter dem Feststehen der Idee sechzig Jahre dauern können. Daß dies nicht so ist, zeigte Fresenius' Entdeckung in ganz unwiderleglicher Art. Er legte dar, daß Goethe niemals das Wort «von vornherein» so brauchte, wie es ihm die Erklärer zuschrieben. Er sagte z. B., er habe ein Buch «von vornherein» gelesen, das weitere nicht mehr. Er gebrauchte das Wort «von vornherein» nur im räumlichen Sinne. Damit war bewiesen, daß alle Erklärer
des «Faust» Unrecht hatten, und daß Goethe nichts über einen «von vornherein» bestandenen Plan des «Faust» gesagt habe, sondern nur, daß ihm als jungem Menschen die ersten Partien klar waren, und daß er hie und da etwas von dem Folgenden ausgeführt habe.
Damit war durch rechte Anwendung der philologischen Methode ein bedeutsames Licht auf die ganze Goethe-Psychologie geworfen.
Ich wundette mich damals nur, daß etwas, das die weitgehendsten Folgen für die Auffassung des Goethe'schen Geistes hätte haben sollen, eigentlich, nachdem es durch die Veröffentlichung im «Goethe-Jahrbuch» bekannt geworden war, wenig Eindruck gerade bei denen gemacht hat, die es am meisten hätte interessieren sollen.
Aber es wurden mit August Fresenius nicht etwa bloß philologische Dinge besprochen. Alles, was damals die Zeit bewegte, was uns Interessierendes in Weimar oder außerhalb vorging, war Inhalt unserer langen Gespräche. Denn wir waren viel zusammen. Wir führten über manches zuweilen aufgeregte Diskussionen; alles aber endete immer in völliger Harmonie. Denn wir waren ja gegenseitig von dem Ernste überzeugt, von dem unsere Anschauungen getragen waren. Um so bitterer ist es mir, auf die Tatsache zurückblicken zu müssen, daß auch meine Freundschaft zu August Fresenius einen Riß erhalten hat im Zusammenhang mit den Mißverständnissen, die sich an mein Verhältnis zum Nietzsche-Archiv und zu Frau Dr. Förster-Nietzsche angeschlossen haben. Die Freunde konnten kein Bild gewinnen von dem, was eigentlich vorgegangen war. Ich konnte ihnen kein sie befriedigendes geben. Denn es war eigentlich nichts vor-
gegangen. Und alles beruhte auf mißverständlichen Illusionen, die sich im Nietzsche-Archiv festgesetzt hatten. Was ich sagen konnte, enthalten meine später erschienenen Artikel im «Magazin für Literatur». Ich bedauerte das Mißverständnis tief, denn die Freundschaft zu August Fresenius war stark in meinem Herzen begründet.
In eine andere Freundschaft, an die ich seither oft gedacht habe, trat ich zu Franz Ferdinand Heitmüller, der ebenfalls, später als Wahle, v. d. Hellen und ich, in den Kreis der Archiv-Mitarbeiter eingetreten war.
Heitmüller lebte sich als eine feine, künstlerisch empfindende Seele dar. Er entschied eigentlich alles durch die künstlerische Empfindung. Intellektualität lag ihm ganz ferne. Durch ihn kam etwas Künstlerisches in den ganzen Ton, in dem man im Archiv sprach. Feinsinnige Novellen lagen damals von ihm vor. Er war durchaus kein schlechter Philologe; und er arbeitete, was er als solcher für das Archiv zu arbeiten hatte, gewiß nicht schlechter als ein anderer. Aber er stand stets in einer Art innerer Opposition zu dem, was da im Archiv gearbeitet wurde. Namentlich zu der Art, wie man diese Arbeit auffaßte. Durch ihn kam es, daß eine Zeitlang recht lebhaft vor unseren Seelen stand, wie Weimar dereinst die Stätte geistig regster und vornehmster Produktion war; und wie man sich jetzt damit befriedigte, dem einst Produzierten wortglauberisch, «Lesearten feststellend» und höchstens interpretierend nachzugehen. Heitmüller schrieb anonym, was er darüber zu sagen hatte, in der S. Fischer'schen «Neuen Deutschen Rundschau» in Novellenform: «Die versunkene Vineta.» Oh, wie gab man sich damals Mühe, zu erraten, wer so das einst geistig
blühende Weimar zur «versunkenen Stadt» gemacht hatte.
Heitmüller lebte mit seiner Mutter, einer außerordentlich lieben Dame, in Weimar. Diese befreundete sich mit Frau Anna Eunike und verkehrte gerne in deren Haus. Und so hatte ich denn die Freude, auch die beiden Heitmüllers oft in dem Hause zu sehen, in dem ich wohnte.
Eines Freundes muß ich gedenken, der ziemlich früh während meines Weimarer Aufenthaltes in meine Kreise trat, und der intim freundschaftlich mit mir verkehrte, bis ich wegging, ja auch noch dann, als ich später hie und da zu Besuch nach Weimar kam. Es war der Maler Joseph Rolletschek. Er war Deutschböhme, und nach Weimar, angezogen von der Kunstschule, gekommen. Eine Persönlichkeit, die durch und durch liebenswürdig wirkte, und mit der man im Gespräche gerne das Herz aufschloß. Rolletscheck war sentimental und leicht zynisch zu gleicher Zeit; er war pessimistisch auf der einen Seite und geneigt, das Leben so gering zu schätzen auf der andern Seite, daß es ihm gar nicht der Mühe wert erschien, die Dinge so zu werten, daß zum Pessimismus Anlaß sei. Viel mußte, wenn er dabei war, über die Ungerechtigkeiten des Lebens gesprochen werden; und endlos konnte er sich ereifern über das Unrecht, das die Welt an dem armen Schiller gegenüber dem schon vom Schicksal bevorzugten Goethe begangen habe.
Trotzdem täglicher Verkehr mit solchen Persönlichkeiten den Austausch des Denkens und Empfindens fortdauernd rege erhielt, war es mir in dieser weimarischen Zeit doch nicht eigen, auch zu denen ich sonst intim mich verhielt, in der unmittelbaren Art von meinem Erleben
der geistigen Welt zu sprechen. Ich hielt dafür, daß eingesehen werden müsse, wie der rechte Weg in die geistige Welt zunächst zum Erleben der reinen Ideen führt. Das war es, was ich in allen Formen geltend machte, daß der Mensch, wie er Farben, Töne, Wärmequalitäten usw. in seinem bewußten Erleben haben könne, er ebenso reine, von aller äußeren Wahrnehmung unbeeinflußte, mit einem völligen Eigenleben auftretende Ideen erleben kann. Und in diesen Ideen ist der wirkliche, lebendige Geist. Alles übrige geistige Erleben im Menschen, so sagte ich damals, müsse sich aufsprießend im Bewußtsein aus diesem Ideenerleben ergeben.
Daß ich so das geistige Erleben zunächst im Ideen-Erleben suchte, führte ja zu dem Mißverständnis, von dem ich schon gesprochen habe, daß selbst intime Freunde die lebendige Wirklichkeit in den Ideen nicht sahen und mich für einen Rationalisten, oder Intellektualisten nahmen.
Am energischesten im Verständnis der lebendigen Wirklichkeit der Ideenwelt verhielt sich damals eine jüngere Persönlichkeit, die öfters nach Weimar kam, Max Christlieb. Es war ziemlich im Anfange meines Weimarer Aufenthaltes, daß ich diesen nach Geist-Erkenntnis suchenden Mann öfters sah. Er hatte damals die Vorbereitung zum evangelischen Pfarrer hinter sich, machte eben sein Doktorexamen und bereitete sich darauf vor , nach Japan zu einer Art Missionsdienst zu gehen, was er auch dann bald tat.
Dieser Mann sah - ich darf sagen begeistert - ein, wie man im Geiste lebt, wenn man in reinen Ideen lebt, und wie, da in der reinen Ideenwelt die ganze Natur vor der
Erkenntnis aufleuchten muß, man in aller Materie nur Schein (Illusion) vor sich habe, wie durch die Ideen alles physische Sein als Geist sich enthülle. - Es war mir tief befriedigend, bei einer Persönlichkeit ein schier restloses Verständnis für die Geistwesenheit zu finden. Es war Verständnis für das Geist-Sein im Ideellen. Da lebt der Geist allerdings so, daß aus dem Meere des allgemeinen ideellen Geist-Seins noch nicht empfindende, schaffende Geist-Individualitäten sich für den wahrnehmenden Blick loslösen. Von diesen Geist-Individualitäten konnte ich ja zu Max Christlieb noch nicht sprechen. Das hätte seinem schönen Idealismus zu viel zugemutet. Aber echtes Geist-Sein, das konnte man mit ihm besprechen. Er hatte sich in alles gründlich hineingelesen, was ich bis dahin geschrieben hatte. Und ich hatte im Beginn der neunziger Jahre den Eindruck: Max Christlieb hat die Gabe, so in die Geist-Welt durch die lebendige Geistigkeit des Ideellen einzudringen, wie ich es für den angemessensten Weg halten mußte. Daß er dann später diese Orientierung nicht voll eingehalten hat, sondern eine etwas andere Richtung genommen hat, das hier zu besprechen, ist keine Veranlassung.
XXI.
Durch den freisinnigen Politiker, von dem ich gesprochen habe, wurde ich mit dem Inhaber einer Buchhandlung bekannt. Dieses Büchergeschäft hatte einst bessere Tage gesehen, als diejenigen waren, die es in meiner weimarischen Zeit erlebte. Das war noch unter dem Vater des jungen Mannes der Fall, den ich als Inhaber kennen lernte. Für mich war wichtig, daß diese Buchhandlung ein Blatt herausgab, das übersichtliche Artikel über das zeitgenössische Geistesleben und Besprechungen über die erscheinenden dichterischen, wissenschaftlichen, künstlerischen Erscheinungen brachte. Auch dieses Blatt war im Verfall. Es hatte seine Verbreitung verloren. Mir aber bot es die Gelegenheit, über vieles zu schreiben, was damals in meinem geistigen Horizont lag, oder in diesen eintrat. Obgleich die zahlreichen Aufsätze und Bücherbesprechungen, die ich so schrieb, nur von Wenigen gelesen wurden, war mir die Möglichkeit angenehm, ein Blatt zur Verfügung zu haben, das von mir druckte, was ich wollte. Es lag da eine Anregung, die dann später fruchtbar wurde, als ich das «Magazin für Literatur» herausgab, und ich dadurch verpflichtet war, intensiv mit dem zeitgenössischen Geistesleben mitzudenken und mitzufühlen.
So ward für mich Weimar der Ort, an den ich im späteren Leben oft zurücksinnen mußte. Denn die Enge, in der ich in Wien gezwungen war zu leben, erweiterte sich; und es wurde Geistiges und Menschliches erlebt, das in seinen Folgen später sich zeigte.
Von allem das Bedeutsamste waren aber doch die Verhältnisse zu Menschen, die geknüpft wurden.
Da wurde doch immer wieder, wenn ich in späteren Jahren mir Weimar und mein dortiges Leben vor die Seele rückte, der geistige Blick auf ein Haus geworfen, das mir ganz besonders lieb geworden war.
Ich lernte den Schauspieler Neuffer, noch während er am Weimarischen Theater tätig war, kennen. Ich schätzte zunächst an ihm die ernste, strenge Auffassung seines Berufes. Er ließ in seinem Urteile über Bühnenkunst nichts Dilettantisches durchgehen. Das war deshalb wohltuend, weil man sich nicht immer bewußt ist, daß die Schauspielkunst in ähnlicher Art sachlich-künstlerische Vorbedingungen erfüllen muß wie z. B. die Musik.
Neuffer verheiratete sich mit der Schwester des Pianisten und Komponisten Bernhard Stavenhagen. Ich wurde in sein Haus eingeführt. Damit war man zugleich in das Haus der Eltern Frau Neuffers und Bernhard Stavenhagens freundschaftlich aufgenommen. Frau Neuffer ist eine Frau, die eine Atmosphäre von Geistigkeit über alles ausstrahlt, das in ihrer Umgebung ist. Ihre in tiefen Seelengebieten wurzelnden Meinungen leuchteten wunderschön auf alles, was in zwangloser Art gesprochen wurde, wenn man im Hause war. Sie brachte, was sie zu sagen hatte, bedächtig, und doch graziös vor. Und ich harte jeden Augenblick, den ich bei Neuffers zubrachte, das Gefühl: Frau Neuffer strebt nach Wahrheit in allen Lebensbeziehungen in einer seltenen Art.
Daß man mich da gerne hatte, konnte ich aus den verschiedensten Vorkommnissen sehen. Ich möchte Eines herausgreifen.
An einem Weihnachtsabend erschien bei mir Herr Neuffer und ließ, da ich nicht zu Hause war, die Auffor-
derung zurück: ich müsse unbedingt zur Weihnachtsbescherung zu ihm kommen. - Das war nicht leicht, denn ich hatte in Weimar immer mehrere solche Festlichkeiten mitzumachen. Aber ich ermöglichte es. Und so fand ich denn, neben den Geschenken für die Kinder, schön aufgebaut ein besonderes Weihnachtsgeschenk für mich, dessen Wert nur aus seiner Geschichte hervorgehen kann.
Ich wurde eines Tages in ein Bildhaueratelier geführt. Ein Bildhauer wollte mir seine Arbeiten zeigen. Mich interessierte im Grunde recht wenig, was ich da sah. Nur eine einzige Büste, die verloren in einer Ecke lag, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Es war eine Hegelbüste. In dem Atelier, das zur Wohnung einer älteren, in Weimar sehr angesehenen Dame gehörte, fand sich alles mögliche Bildhauerische. Bildhauer mieteten den Raum immer für kurze Zeit; es blieb in ihm manches liegen, was ein Mieter nicht mitnehmen wollte. Es waren aber auch Dinge darinnen, die seit alter Zeit unbeachtet da lagerten, wie jene Hegelbüste.
Das Interesse, das ich dieser Büste zugewendet hatte, bewirkte immerhin, daß ich da oder dort davon sprach. Und so auch einmal im Hause Neuffer; und ich habe da wohl eine leise Andeutung hinzugefügt, daß ich die Büste gerne in meinem Besitze hätte.
Und am nächsten Weihnachtsabend ward sie mir als Geschenk bei Neuffer gegeben. - Am nächsten Mittag, zu dem ich eingeladen war, erzählte Neuffer, wie er sich die Büste verschafft hatte.
Er ging zunächst zu der Dame, der das Atelier gehörte. Er sprach ihr davon, daß jemand die Büste in ihrem
Atelier gesehen habe, und daß es für ihn besonders wertvoll wäre, wenn er sie erwerben könnte. Die Dame sagte:
Ja, solche Dinge seien seit alten Zeiten in ihrem Hause; ob aber gerade ein «Hegel» da sei, davon wisse sie nichts. Sie zeigte sich aber ganz bereitwillig, Neuffer herumzuführen, damit er nachsehen könne. — Es wurde alles «durchforscht», nicht die verborgenste Ecke wurde unberücksichtigt gelassen; die Hegelbüste fand sich nirgends. Neuffer war recht traurig, denn für ihn hatte der Gedanke etwas tief Befriedigendes, mir mit der Hegelbüste eine Freude zu machen. — Da stand er denn schon an der Türe mit der Dame. Das Dienstmädchen kam hinzu. Es hörte gerade noch die Worte Neuffers: «Ja, schade, daß wir die Hegelbüste nicht gefunden haben.» «Hegel», warf das Mädchen ein, «ist das vielleicht der Kopf mit der abgebrochenen Nasenspitze, der in der Dienstbotenstube unter meinem Bette liegt?» — Sofort wurde der letzte Akt der Expedition arrangiert. Neuffer konnte die Büste wirklich erwerben; bis Weihnachten war gerade noch Zeit, die fehlende Nasenspitze zu ergänzen.
Und so kam ich denn zu der Hegelbüste, die zu dem Wenigen gehört, was mich dann an viele Orte begleitete. Ich sah immer wieder gerne nach diesem Hegelkopfe (von Wichmann aus dem Jahre 1826) hin, wenn ich mich in Hegels Gedankenwelt vertiefte. Und das geschah wirklich recht oft. Die Züge des Antlitzes, die menschlichster Ausdruck des reinsten Denkens sind, bilden einen vielwirkenden Lebensbegleiter.
So war es bei Neuffers. Sie waren unermüdlich, wenn sie es dahin bringen wollten, jemand mit etwas zu erfreuen, das besonders mit seinem Wesen zusammen-
hing. Die Kinder, die sich allmählich im Neuffer'schen Hause einfanden, hatten eine musterhafte Mutter. Frau Neuffer erzog weniger durch das, was sie tat, sondern durch das, was sie ist, durch ihr ganzes Wesen. Ich hatte die Freude, Taufpate bei einem der Söhne sein zu dürfen. Jeder Besuch in diesem Hause war mir ein Quell innerer Befriedigung. Ich durfte solche Besuche auch noch in späteren Jahren machen, als ich von Weimar fort war, und ab und zu zu Vorträgen hinkam. Leider ist das nun lange nicht mehr der Fall gewesen. Und so habe ich denn Neuffers nicht sehen können in den Jahren, in denen ein schmerzliches Schicksal über sie hereingebrochen ist. Denn diese Familie gehört zu denjenigen, die durch den Weltkrieg am meisten geprüft worden sind.
Eine reizvolle Persönlichkeit war der Vater der Frau Neuffer, der alte Stavenhagen. Er hatte sich wohl vorher in einem praktischen Berufe betätigt, dann aber zur Ruhe gesetzt. Nun lebte er ganz in dem Inhalte einer Bibliothek, die er sich angeschafft hatte. Und es stellte sich vor Anderen in durchaus sympathischer Art dar, wie er darin lebte. Es war nichts Selbstgefälliges oder Erkenntnis-Hochmütiges in den lieben alten Herrn eingezogen, sondern etwas, das eher in jedem Worte den ehrlichen Wissensdurst erkennen ließ.
So waren damals wirklich die Verhältnisse in Weimar noch in der Art, daß die Seelen, die an andern Orten sich wenig befriedigt fühlten, sich da einfanden. So war es mit denen, die dauernd da ein Heim bauten, so aber auch mit solchen, die immer wieder gerne zum Besuch kamen. Man fühlte Vielen an: Weimarische Besuche sind ihnen etwas anderes als solche an andern Orten.
Ich habe das ganz besonders empfunden bei dem dänischen Dichter Rudolf Schmidt. Er kam zuerst zu der Aufführung seines Dramas «Der verwandelte König». Schon bei diesem Besuche wurde ich mit ihm bekannt. Dann aber stellte er sich bei vielen Gelegenheiten ein, bei denen Weimar auswärtige Besucher sah. Der schöngebaute Mann mit dem wallenden Lockenkopf war oft unter diesen Besuchern. Die Art, wie man in Weimar «ist», hatte etwas Anziehendes für seine Seele. Er war eine Persönlichkeit von schärfster Prägung. In der Philosophie war er ein Anhänger Rasmus Nielsens. Durch diesen, der von Hegel ausgegangen war, harte Rudolf Schmidt das schönste Verständnis für die deutsche idealistische Philosophie. Und waren so Schmidts Urteile nach dem Positiven hin deutlich geprägt, sie waren es nicht minder nach dem Negativen. So wurde er beißend, satirisch, ganz vernichtend, wenn er auf Georg Brandes zu sprechen kam. Es hatte etwas Künstlerisches, wie da jemand ein ganzes, breites, in Antipathie ergossenes Empfindungsgebiet offenbarte. Auf mich konnten diese Offenbarungen keinen anderen als einen künstlerischen Eindruck machen. Denn ich harte vieles von Georg Brandes gelesen. Mich hatte besonders interessiert, was er aus einem immerhin weiten Umkreis der Beobachtung und des Wissens über die Geistesströmungen der europäischen Völker in geistreicher Art geschildert hat. - Aber, was Rudolf Schmidt vorbrachte, war subjektiv ehrlich, und wegen des Charakters dieses Dichters wirklich fesselnd. - Ich gewann schließlich Rudolf Schmidt im tiefsten Herzen lieb; ich freute mich der Tage, an denen er nach Weimar kam. Es war interessant, ihn reden zu
hören von seiner nordischen Heimat, und zu sehen, welch bedeutende Fähigkeiten in ihm gerade aus dem Grundquell nordischen Empfindens erwachsen waren. Es war nicht minder interessant, mit ihm über Goethe, Schiller, Byron zu sprechen. Da sprach er wirklich anders als Georg Brandes. Dieser ist überall in seinem Urteil die internationale Persönlichkeit; in Rudolf Schmidt sprach über alles der Däne. Aber eben deshalb sprach er über vieles und in vieler Beziehung doch interessanter als Georg Brandes.
In meiner letzten Weimarer Zeit wurde ich nahe befreundet mit Conrad Ansorge und seinem Schwager von Crompton. Conrad Ansorge hat später in einer glänzenden Art seine große Künstlerschaft entfaltet Ich habe hier nur von dem zu sprechen, was er mir in einer schönen Freundschaft Ende der neunziger Jahre war, und wie er damals vor mir stand.
Die Frauen Ansorges und von Cromptons waren Schwestern. Die Verhältnisse brachten es mit sich, daß unser Zusammensein entweder im Hause von Cromptons oder im Hotel «Russischer Hof» sich abspielte.
Ansorge war ein energisch künstlerischer Mensch. Er wirkte als Pianist und Komponist. In der Zeit unserer weimarischen Bekanntschaft komponierte er Nietzsche'sche und Dehmel'sche Dichtungen. Es war immer ein Festereignis, wenn die Freunde, die allmählich in den AnsorgeCrompton-Kreis hereingezogen wurden, eine neue Komposition hören durften.
Zu diesem Kreise gehörte auch ein weimarischer Redakteur, Paul Böhler. Er redigierte die Zeitung «Deutschland», die neben der amtlichen «Weimarischen Zeitung»
ein mehr unabhängiges Dasein führte. Es erschienen manche andere weimarische Freunde auch in diesem Kreise: Fresenius, Heitmüller, auch Fritz Koegel u. a. Wenn Otto Erich Hartleben in Weimar auftauchte, so erschien er stets auch, als dieser Kreis gebildet war, in ihm.
Conrad Ansorge ist aus dem Liszt-Kreise herausgewachsen. Ja, ich sage wohl nichts, was neben der Wirklichkeit einhergeht, wenn ich behaupte: er bekannte sich als einen der Liszt-Schüler, die dem Meister künstlerisch am treuesten anhingen. Aber man bekam gerade durch Conrad Ansorge das, was von Liszt fortlebte, in der aller-schönsten Art vor die Seele gestellt. Denn bei Ansorge war alles Musikalische, das von ihm kam, aus dem Quell einer ganz ursprünglichen, individuellen Menschlichkeit herausstammend. Diese Menschlichkeit mochte von Liszt angeregt worden sein; das Reizvolle an ihr war aber ihre Ursprünglichkeit. Ich spreche diese Dinge so aus, wie ich sie damals erlebte; wie ich später zu ihnen stand oder heute zu ihnen stehe, kommt hier nicht in Betracht.
Durch Liszt hing Ansorge einmal in früherer Zeit mit Weimar zusammen; in der Zeit, von der ich hier spreche, war er seelisch aus dieser Zusammengehörigkeit herausgelöst. Und das war das Eigentümliche dieses Ansorge-Crompton-Kreises, daß er zu Weimar ganz anders stand als weitaus die meisten Persönlichkeiten, von denen ich bisher schildern konnte, daß sie mir nahetraten.
Diese Persönlichkeiten waren in Weimar auf die Art, wie ich dies im vorigen Abschnitt beschrieben habe. Dieser Kreis strebte mit seinen Interessen aus Weimar
hinaus. Und so ist es gekommen, daß ich in der Zeit, als meine Weimarer Arbeit beendet war und ich daran denken mußte, die Goethestadt zu verlassen, befreundet wurde mit Menschen, für die das Leben in Weimar nichts besonders Charakteristisches war. Man lebte sich in einem gewissen Sinne mit diesen Freunden aus Weimar heraus.
Ansorge, der Weimar als eine Fessel für seine künstlerische Entfaltung fühlte, übersiedelte ja ungefähr gleichzeitig mit mir nach Berlin. Paul Böhler, obwohl Redakteur der gelesensten weimarischen Zeitung, schrieb nicht aus dem damaligen «Weimarischen Geist» heraus, sondern übte von weiterem Gesichtskreise manche herbe Kritik an diesem Geiste. Er war derjenige, der auch immer seine Stimme erhob, wenn es sich darum handelte, das ins rechte Licht zu rücken, was von Opportunität und Kleingeisterei eingegeben war. Und so kam es denn, daß er gerade in der Zeit, als er in dem geschilderten Kreis war, seine Stelle verlor.
Von Crompton lebte sich als die denkbar liebenswürdigste Persönlichkeit aus. In seinem Hause konnte der Kreis die schönsten Stunden verleben. Da war dann im Mittelpunkte Frau von Crompton, eine geistvoll-graziöse Persönlichkeit, die sonnenhaft auf diejenigen wirkte, die in ihrer Umgebung sein durften.
Der ganze Kreis stand sozusagen im Zeichen Nietzsches. Man betrachtete die Lebensauffassung Nietzsches als dasjenige, was von allergrößtem Interesse ist; man gab sich der Seelenverfassung, die sich in Nietzsche geoffenbart hatte, als derjenigen hin, die gewissermaßen eine Blüte des echten und freien Menschentums darstellte. Nach
diesen beiden Richtungen hin war besonders von Crompton ein Repräsentant der Nietzsche-Bekenner der neunziger Jahre. Mein eigenes Verhältnis zu Nietzsche änderte sich innerhalb dieses Kreises nicht. Da ich aber derjenige war, den man fragte, wenn man über Nietzsche etwas wissen wollte, so projizierte man die Art, wie man sich selbst an Nietzsche hielt, auch in mein Verhältnis zu ihm hinein.
Aber es muß gesagt werden, daß gerade dieser Kreis in verständnisvoller Art zu dem aufsah, was Nietzsche zu erkennen vermeinte, daß er auch verständnisvoller darzuleben versuchte, was in Nietzsches Lebens-Idealen lag, als dies von manchen andern Seiten geschah, wo das «Übermenschenturn» und das «Jenseits von Gut und Böse» nicht immer die erfreulichsten Blüten trieben.
Für mich war der Kreis bedeutsam durch eine starke, mitreißende Energie, die in ihm lebte. Auf der andern Seite aber fand ich das entgegenkommendste Verständnis für alles dasjenige, was ich in dem Kreise glaubte vorbringen zu können.
Die Abende, an denen Ansorges Musikleistungen glänzten und alle Teilnehmer interessierende Gespräche über Nietzsche Stunden füllten, in denen weittragende, schwerwiegende Fragen über Welt und Leben eine sozusagen angenehme Unterhaltung bildeten, waren schon etwas, an das ich mit Befriedigung als auf etwas zurückblicken kann, das meine letzte weimarische Zeit verschönt hat.
Weil in diesem Kreise alles, was in ihm sich darlebte, aus einem unmittelbaren und ernsten künstlerischen Empfinden stammte und sich durchdringen wollte mit
einer Weltanschauung, die sich an den echten Menschen als ihren Mittelpunkt hielt, konnte man keine unangenehmen Gefühle hegen, wenn zum Vorschein kam, was gegen das damalige Weimar einzuwenden war. Der Ton war dabei ein wesentlich anderer als ich ihn früher im Olden'schen Kreise erlebt hatte. Da war viel Ironie im Spiele; man sah auch Weimar als «menschlich-allzumenschlich» an, wie man andere Orte angesehen hätte, wenn man an ihnen gewesen wäre. Im Ansorge-Crompton-Kreise war - ich möchte sagen - mehr die ernste Empfindung vorhanden: wie soll es mit der deutschen Kulturentwickelung weitergehen, wenn ein Ort wie Weimar so wenig seine ihm vorgezeichneten Aufgaben erfüllt?
Auf dem Hintergrunde dieses geselligen Verkehres entstand mein Buch «Goethes Weltanschauung», mit dem ich meine weimarische Tätigkeit abschloß. Ich fühlte, als ich vor einiger Zeit eine Neuauflage dieses Buches besorgte, an der Art, wie ich damals in Weimar meine Gedanken für das Buch formte, nachklingen die innere Gestaltung der freundschaftlichen Zusammenkünfte des geschilderten Kreises.
Dieses Buch hat etwas weniger Unpersönliches, als es bekommen hätte, wenn nicht bei seinem Niederschreiben in meiner Seele nachvibriert hätte, was in diesem Kreise mit Begeisterung bekenntnismäßig und energisch über das «Wesen der Persönlichkeit» immer wieder erklungen hatte. Es ist das einzige meiner Bücher, von dem ich gerade dieses zu sagen habe. Als persönlich im echtesten Sinne des Wortes erlebt, darf ich sie alle bezeichnen; nicht aber auf diese Art, wo die eigene Persönlichkeit so
stark das Wesen der Persönlichkeiten der Umgebung miterlebt.
Doch bezieht sich dieses nur auf die allgemeine Haltung des Buches. Die in bezug auf das Gebiet der Natur sich offenbarende «Weltanschauung Goethes» kommt ja doch so zur Darstellung, wie das schon in meinen Goetheschriften der achtziger Jahre der Fall war. Nur über Einzelnes sind durch die erst im Goethe-Archiv aufgefundenen Handschriften meine Anschauungen erweitert, vertieft, oder befestigt worden.
In allem, was ich im Zusammenhange mit Goethe gearbeitet habe, kam es mir darauf an, Inhalt und Richtung seiner «Weltanschauung» vor die Welt hinzustellen. Dadurch sollte sich ergeben, wie das Umfassende und geistig in die Dinge Eindringende des Goethe'schen Forschens und Denkens zu Einzelentdeckungen auf den besonderen Naturgebieten gekommen ist. Mir kam es nicht darauf an, auf diese Einzelentdeckungen als solche zu verweisen, sondern darauf, daß sie Blüten waren an der Pflanze einer geistgemäßen Naturanschauung.
Diese Naturanschauung zu charakterisieren als einen Teil dessen, was Goethe der Welt gegeben hat, schrieb ich Darstellungen dieses Teiles der Goethe'schen Gedanken- und Forschungsarbeit. Aber nach dem gleichen Ziele strebte ich auch durch die Anordnung der Goetheschen Aufsätze in den beiden Ausgaben, an denen ich mitgearbeitet habe, derjenigen in «Kürschners Deutscher National-Literatur» und auch der Weimarischen SophienAusgabe. Ich betrachtete es niemals als eine Aufgabe, die für mich aus Goethes ganzem Wirken folgen könnte, anschaulich zu machen, was Goethe als Botaniker, als
Zoologe, als Geologe, als Farbentheoretiker in der Art geleistet hat, wie man eine solche Leistung vor dem Forum der geltenden Wissenschaft beurteilt. - Dafür etwas zu tun, schien mir auch unangemessen bei der Anordnung der Aufsätze für die Ausgaben.
Und so ist denn auch der Teil der Goethe-Schriften, den ich für die Weimarische Ausgabe herausgegeben habe, nichts anderes geworden als ein Dokument für Goethes in seiner Naturforschung sich offenbarende Weltanschauung. Wie diese Weltanschauung im Botanischen, Geologischen usw. ihre besonderen Lichter wirft, das sollte zur Geltung kommen. (Man hat z. B. gefunden, daß ich die geologisch-mineralogischen Schriften hätte anders anordnen sollen, damit man «Goethes Verhältnis zur Geologie» aus dem Inhalte ersehen könne. Man brauchte nur zu lesen, was ich über die Anordnung der Goethe'schen Schriften auf diesem Gebiete in den Einleitungen zu meinen Ausgaben in «Kürschners Deutscher National-Literatur» gesagt habe, und man könnte gar nicht daran zweifeln, daß ich mich auf die von meinen Kritikern geforderten Gesichtspunkte nie eingelassen hätte. In Weimar konnte man das wissen, als man mir die Herausgabe übertrug. Denn in der Kürschnerschen Ausgabe war bereits alles erschienen, was meine Gesichtspunkte festgestellt harte, bevor man daran dachte, mir in Weimar eine Arbeit zu übertragen. Und man hat sie mir mit vollem Bewußtsein dieser Umstände übertragen. Ich werde nie in Abrede stellen, daß, was ich bei Bearbeitung der Weimarischen Ausgabe in manchem Einzelnen gemacht habe, als Fehler von «Fachleuten» bezeichnet werden kann. Diese mag man richtigstellen.
Aber man sollte nicht die Sache so darstellen, als ob die Gestalt der Ausgabe nicht von meinen Grundsätzen, sondern von meinem Können oder Nichtkönnen herrührte. Insbesondere sollte dieses nicht geschehen von einer Seite her, die zugibt, daß sie kein Organ hat zur Auffassung dessen, was ich in bezug auf Goethe dargestellt habe. Wenn es sich um einzelne sachliche Fehler da oder dort handelte, so könnte ich meine diesbezüglichen Kritiker auf noch viel Schlimmeres verweisen, auf meine Aufsätze, die ich als Oberrealschüler geschrieben habe. Ich habe es durch diese Darstellung meines Lebenslaufes doch wohl bemerklich gemacht, daß ich schon als Kind in der geistigen Welt als in der mir selbstverständlichen lebte, daß ich mir aber alles schwer erobern mußte, was sich auf das Erkennen der Außenwelt bezieht. Dadurch bin ich für dieses auf allen Gebieten ein spät sich entwickelnder Mensch gewesen. Und die Folgen davon tragen Einzelheiten meiner Goethe-Ausgaben.)
XXII.
Am Ende meiner weimarischen Zeit hatte ich sechsunddreißig Lebensjahre hinter mir. Schon ein Jahr vorher hatte in meiner Seele ein tiefgehender Umschwung seinen Anfang genommen. Mit meinem Weggang von Weimar wurde er einschneidendes Erlebnis. Er war ganz unabhängig von der Änderung meiner äußeren Lebensverhältnisse, die ja auch eine große war. Das Erfahren von dem, was in der geistigen Welt erlebt werden kann, war mir immer eine Selbstverständlichkeit; das wahrnehmende Erfassen der Sinneswelt bot mir die größten Schwierigkeiten. Es war, als ob ich das seelische Erleben nicht so weit in die Sinnesorgane hätte ergießen können, um, was diese erlebten, auch vollinhaltlich mit der Seele zu verbinden.
Das änderte sich völlig vom Beginne des sechsunddreißigsten Lebensjahres angefangen. Mein Beobachtungsvermögen fär Dinge, Wesen und Vorgänge der physischen Welt gestaltete sich nach der Richtung der Genauigkeit und Eindringlichkeit um. Das war sowohl im Wissenschaftlichen wie im äußeren Leben der Fall. Während es vorher fär mich so war, daß große wissenschaftliche Zusammenhänge, die auf geistgemäße Art zu erfassen sind, ohne alle Mühe mein seelisches Eigentum wurden und das sinnliche Wahrnehmen und namentlich dessen erinnerungsgemäßes Behalten mir die größten Anstrengungen machte, wurde jetzt alles anders. Eine vorher nicht vorhandene Aufmerksamkeit für das Sinnlich-Wahrnehmbare erwachte in mir. Einzelheiten wurden mir wichtig; ich hatte das Gefühl, die Sinneswelt habe
etwas zu enthüllen, was nur sie enthüllen kann. Ich betrachtete es als ein Ideal, sie kennen zu lernen allein durch das, was sie zu sagen hat, ohne daß der Mensch etwas durch sein Denken oder durch einen andern in seinem Innern auftretenden Seelen4nhalt in sie hineinträgt.
Ich wurde gewahr, daß ich einen menschlichen Lebensumschwung in einem viel spätern Lebensabschnitt erlebte als andere. Ich sah aber auch, daß das für das Seelenleben ganz bestimmte Folgen hat. Ich fand, wie die Menschen, weil sie früh vom seelischen Weben in der geistigen Welt zum Erleben des Physischen übergehen, zu keinem reinen Erfassen weder der geistigen, noch der physischen Welt gelangen. Sie vermischen fortdauernd ganz instinktiv dasjenige, was die Dinge ihren Sinnen sagen, mit dem, was die Seele durch den Geist erlebt und was dann von ihr mitgebraucht wird, um sich die Dinge «vorzustellen».
Für mich war in der Genauigkeit und Eindringlichkeit der sinnenfälligen Beobachtung das Beschreiten einer ganz neuen Welt gegeben. Das von allem Subjektiven in der Seele freie, objektive Sich-Gegenüberstellen der Sinneswelt offenbarte etwas, worüber eine geistige Anschauung nichts zu sagen hatte.
Das warf aber auch sein Licht auf die Welt des Geistes zurück. Denn indem die Sinneswelt im sinnlichen Wahrnehmen selbst ihr Wesen enthüllte, war fär das Erkennen der Gegenpol da, um das Geistige in seiner vollen Eigenart, unvermischt mit dem Sinnlichen, zu würdigen.
Besonders einschneidend in das Seelenleben wirkte dieses, weil es sich auch auf dem Gebiete des mensch-
lichen Lebens zeigte. Meine Beobachtungsgabe stellte sich darauf ein, dasjenige ganz objektiv, rein in der Anschauung hinzunehmen, was ein Mensch darlebte. Mit Ängstlichkeit vermied ich, Kritik zu üben an dem, was die Menschen taten, oder Sympathie und Antipathie in meinem Verhältnis zu ihnen geltend zu machen: ich wollte «den Menschen, wie er ist, einfach auf mich wirken lassen».
Ich fand bald, daß ein solches Beobachten der Welt wahrhaft in die geistige Welt hineinführt. Man geht im Beobachten der physischen Welt ganz aus sich heraus; und man kommt gerade dadurch mit einem gesteigerten geistigen Beobachtungsvermögen wieder in die geistige Welt hinein.
So waren damals die geistige und die sinnenfällige Welt in ihrer vollen Gegensätzlichkeit mir vor die Seele getreten. Aber ich empfand den Gegensatz nicht als etwas, das durch irgendwelche philosophische Gedanken
- etwa zu einem «Monismus» - ausgleichend geführt werden müßte. Ich empfand vielmehr, daß ganz voll mit der Seele in diesem Gegensatz drinnen stehen, gleichbedeutend ist mit «Verständnis für das Leben haben». Wo die Gegensätze als ausgeglichen erlebt werden, da herrscht das Lebenslose, das Tote. Wo Leben ist, da wirkt der unausgeglichene Gegensatz; und das Leben selbst ist die fortdauernde Überwindung, aber zugleich Neuschöpfung von Gegensätzen.
Aus alledem drang in mein Gefühlsleben eine ganz intensive Hingabe nicht an ein gedankenmäßiges theoretisches Erfassen, sondern an ein Erleben des Rätselhaften in der Welt.
Ich stellte, um meditativ das rechte Verhältnis zur Welt zu gewinnen, immer wieder vor meine Seele: Da ist die Welt voller Rätsel. Erkenntnis möchte an sie herankommen. Aber sie will zumeist einen Gedankeninhalt als Lösung eines Rätsels aufweisen. Doch die Rätsel - so mußte ich mir sagen - lösen sich nicht durch Gedanken. Diese bringen die Seele auf den Weg der Lösungen; aber sie enthalten die Lösungen nicht. In der wirklichen Welt entsteht ein Rätsel; es ist als Erscheinung da; seine Lösung ersteht ebenso in der Wirklichkeit. Es tritt etwas auf, das Wesen oder Vorgang ist; und das die Lösung des andern darstellt.
So sagte ich mir auch: die ganze Welt, außer dem Menschen, ist ein Rätsel, das eigentliche Welträtsel; und der Mensch ist selbst die Lösung.
Dadurch konnte ich denken: der Mensch vermag in jedem Augenblick etwas über das Welträtsel zu sagen. Was er sagt, kann aber stets nur so viel an Inhalt über die Lösung geben, als er selbst über sich als Mensch erkannt hat.
So wird auch das Erkennen zu einem Vorgang in der Wirklichkeit. Fragen offenbaren sich in der Welt; Antworten offenbaren sich als Wirklichkeiten; Erkenntnis im Menschen ist dessen Teilnahme an dem, was sich die Wesen und Vorgänge in der geistigen und physischen Welt zu sagen haben.
Es war dies alles zwar schon andeutungsweise, an einigen Stellen sogar ganz deutlich in den Schriften enthalten, die von mir bis in die hier geschilderte Zeit gedruckt sind. Allein in dieser Zeit wurde es intensivstes Seelen-Erlebnis, das die Stunden erfüllte, in denen Erkenntnis
meditierend auf die Weltgründe blicken wollte. Und was die Hauptsache ist: dieses Seelen-Erlebnis ging in seiner damaligen Stärke aus dem objektiven Hingeben an die reine, ungetrübte Sinnes-Beobachtung hervor. Mir war in dieser Beobachtung eine neue Welt gegeben; ich mußte aus dem, was bisher erkennend in meiner Seele war, dasjenige suchen, was das seelische Gegen-Erlebnis war, um das Gleichgewicht mit dem Neuen zu bewirken.
Sobald ich die ganze Wesenhaftigkeit der Sinneswelt nicht dachte, sondern sinnlich anschaute, ward ein Rätsel als Wirklichkeit hingestellt. Und im Menschen selbst liegt dessen Lösung.
Es lebte in meinem ganzen Seelenwesen die Begeisterung für dasjenige, was ich später «wirklichkeitsgemäße Erkenntnis» nannte. Und namentlich war mir klar, daß der Mensch mit einer solchen «wirklichkeitsgemäßen Erkenntnis» nicht in irgendeiner Weltecke stehen könne, während sich außer ihm das Sein und Werden abspielt. Erkenntnis wurde mir dasjenige, was nicht allein zum Menschen, sondern zu dem Sein und Werden der Welt gehört. Wie Wurzel und Stamm eines Baumes nichts Vollendetes sind, wenn sie nicht in die Blüte sich hineinleben, so sind Sein und Werden der Welt nichts wahrhaft Bestehendes, wenn sie nicht zum Inhalt der Erkenntnis weiterleben. Auf diese Einsicht blickend, wiederholte ich bei jeder Gelegenheit, bei der es angebracht war: der Mensch ist nicht das Wesen, das für sich den Inhalt der Erkenntnis schafft, sondern er gibt mit seiner Seele den Schauplatz her, auf dem die Welt ihr Dasein und Werden zum Teil erst erlebt. Gäbe es nicht Erkenntnis, die Welt bliebe unvollendet.
In solchem erkennenden Einleben in die Wirklichkeit der Welt fand ich immer mehr die Möglichkeit, dem Wesen der menschlichen Erkenntnis einen Schutz zu schaffen gegen die Ansicht, als ob der Mensch in dieser Erkenntnis ein Abbild oder dergleichen der Welt schaffe. Zum Mitschöpfer an der Welt selbst wurde er für meine Idee des Erkennens, nicht zum Nachschaffer von etwas, das auch aus der Welt wegbleiben könnte, ohne daß diese unvollendet wäre.
Aber auch zur « Mystik» hin wurde dadurch fur mein Erkennen immer größere Klarheit geschaffen. Das MitErleben des Weltgeschehens von Seiten des Menschen wurde aus dem unbestimmten mystischen Erfühlen herausgezogen und in das Licht gerückt, in dem die Ideen sich offenbaren. Die Sinnenwelt, rein in ihrer Eigenart angeschaut, ist zunächst Ideen-los wie die Wurzel und der Stamm des Baumes Blüte-los sind. Aber wie die Blüte nicht ein sich verdunkelndes Hinschwinden des Pflanzen-Daseins ist, sondern eine Umformung dieses Daseins selbst, so ist die auf die Sinneswelt bezügliche Ideenwelt im Menschen eine Umformung des Sinnesdaseins, nicht ein mystisch-dunkles Hineinwirken von etwas Unbestimmtem in die Seelenwelt des Menschen. So hell wie in ihrer Art die physischen Dinge und Vorgänge im Lichte der Sonne, so geistig hell muß erscheinen, was als Erkenntnis in der Menschen-Seele lebt.
Es war ein ganz klares Seelen-Erleben, was in dieser Orientierung damals in mir vorhanden war. Doch im Übergehen dazu, diesem Erleben Ausdruck zu verschaffen, lag etwas außerordentlich Schwieriges.
Es entstanden in meiner letzten weimarischen Zeit mein Buch «Goethes Weltanschauung», und die Einleitungen zum letzten Band, den ich für die Ausgabe in «Kürschners Deutscher National-Literatur» herausgegeben hatte. Ich sehe da insbesondere auf dasjenige hin, was ich als Einleitung zu den von mir herausgegebenen «Sprüchen in Prosa» von Goethe geschrieben habe und vergleiche dieses mit der Formulierung des Inhaltes des Buches «Goethes Weltanschauung». Man kann, wenn man die Dinge nur an der Oberfläche betrachtet, diesen oder jenen Widerspruch konstruieren zwischen dem Einen und dem Andern in diesen meinen fast in der ganz gleichen Zeit entstandenen Darstellungen. Sieht man aber nach dem, was unter der Oberfläche lebt, was in den an der Oberfläche sich nur gestaltenden Formulierungen sich als Anschauung der Lebens-, Seelen- und Geistes-Tiefen offenbaren will, so wird man nicht Widersprüche finden, sondern gerade in meinen damaligen Arbeiten ein Ringen nach Ausdruck. Ein Ringen, eben das in die Weltanschauungsbegriffe hineinzubringen, was ich hier als Erlebnis von der Erkenntnis, von dem Verhältnis des Menschen zur Welt, von dem Rätsel-Werden und Rätsel-Lösen innerhalb der wahren Wirklichkeit geschildert habe.
Als ich etwa dreieinhalb Jahre später mein Buch «Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten Jahrhundert» schrieb, war manches bei mir wieder weiter; und ich konnte mein hier dargestelltes Erkenntnis-Erlebnis für die Schilderung der einzelnen, in der Geschichte auftretenden Weltanschauungen fruchtbar machen.
Wer Schriften deshalb ablehnen will, weil in ihnen das seelische Leben erkennend ringt, das heißt im Lichte der hier gegebenen Darstellung, in ihnen das Weltenleben in seinem Ringen auf dem Schauplatze der Menschenseele weiter sich entfaltet, dem kann es - meiner Einsicht nach - nicht gelingen, mit seiner erkennenden Seele in die wahre Wirklichkeit unterzutauchen. Das ist etwas, das sich als Anschauung gerade damals in mir befestigt hat, während es meine Begriffswelt lange schon durchpulst hatte.
Im Zusammenhange mit dem Umschwung in meinem Seelenleben stehen für mich inhaltsschwere innere Erfahrungen. - Ich erkannte im seelischen Erleben das Wesen der Meditation und deren Bedeutung für die Einsichten in die geistige Welt. Ich hatte auch früher schon ein meditatives Leben geführt; doch kam der Antrieb dazu aus der ideellen Erkenntnis seines Wertes für eine geistgemäße Weltanschauung. Nunmehr trat in meinem Ijinern etwas auf, das die Meditation forderte wie etwas, das meinem Seelenleben eine Daseinsnotwendigkeit wurde. Das errungene Seelenleben brauchte die Meditation, wie der Organismus auf einer gewissen Stufe seiner Entwickelung die Lungenatmung braucht.
Wie die gewöhnliche begriffliche Erkenntnis, die an der Sinnesbeobachtung gewonnen wird, sich zu der Anschauung des Geistigen verhält, das wurde mir in diesem Lebensabschnitt aus einem mehr ideellen Erleben zu einem solchen, an dem der ganze Mensch beteiligt ist. Das ideelle Erleben, das aber das wirkliche Geistige doch in sich aufnimmt, ist das Element, aus dem meine «Philosophie der Freiheit» geboren ist. Das Erleben durch den
ganzen Menschen enthält die Geisteswelt in einer viel wesenhafteren Art als das ideelle Erleben. Und doch ist dieses schon eine obere Stufe gegenüber dem begrifflichen Erfassen der Sinneswelt. Im ideellen Erleben erfaßt man nicht die Sinneswelt, sondern eine gewissermaßen unmittelbar an sie angrenzende geistige Welt.
Indem all das damals nach Ausdruck und Erlebnis in meiner Seele suchte, standen drei Arten von Erkenntnis vor meinem Innern. Die erste Art ist die an der Sinnesbeobachtung gewonnene Begriffs-Erkenntnis. Sie wird von der Seele angeeignet und dann nach Maßgabe der vorhandenen Gedächtniskraft im Innern behalten. Wiederholungen des anzueignenden Inhaltes haben nur die Bedeutung, daß dieser gut behalten werden könne. Die zweite Art der Erkenntnis ist die, bei der nicht an der Sinnesbeobachtung Begriffe erworben, sondern diese unabhängig von den Sinnen im Innern erlebt werden. Es wird dann das Erleben durch seine eigene Wesenheit Bürge dafür, daß die Begriffe in geistiger Wirklichkeit gegründet sind. Zu dem Erfahren, daß Begriffe die Bürgschaft geistiger Wirklichkeit enthalten, kommt man mit derselben Sicherheit aus der Natur der Erfahrung bei dieser Art von Erkenntnis, wie man bei der Sinneserkenntnis die Gewißheit erlangt, daß man nicht Illusionen, sondern physische Wirklichkeit vor sich habe.
Bei dieser ideell-geistigen Erkenntnis genügt nun schon nicht mehr - wie bei der sinnlichen - ein Aneignen, das dann dazu führt, daß man sie für das Gedächtnis hat. Man muß den Aneignungsvorgang zu einem fortdauernden machen. Wie es für den Organismus nicht genügt, eine Zeitlang geatmet zu haben, um dann in der
Atmung das Angeeignete im weiteren Lebensprozeß zu verwenden, so genügt ein der Sinneserkenntnis ähnliches Aneignen für die ideell-geistige Erkenntnis nicht. Für sie ist notwendig, daß die Seele in einer fortdauernden lebendigen Wechselwirkung stehe mit der Welt, in die man sich durch diese Erkenntnis versetzt. Das geschieht durch die Meditation, die - wie oben angedeutet - aus der ideellen Einsicht in den Wert des Meditierens hervorgeht. Diese Wechselwirkung hatte ich schon lange vor meinem Seelenumschwunge (im fünfunddreißigsten Lebensjahre) gesucht.
Was jetzt eintrat, war Meditieren als seelische Lebensnotwendigkeit. Und damit stand die dritte Art der Erkenntnis vor meinem Innern. Sie führte nicht nur in weitere Tiefen der geistigen Welt, sondern gewährte auch ein intimes Zusammenleben mit dieser. Ich mußte, eben aus innerer Notwendigkeit, eine ganz bestimmte Art von Vorstellungen immer wieder in den Mittelpunkt meines Bewußtseins rücken.
Es war diese:
Lebe ich mich mit meiner Seele in Vorstellungen ein, die an der Sinneswelt gebildet sind, so bin ich im unmittelbaren Erfahren nur imstande, von der Wirklichkeit des Erlebten so lange zu sprechen, als ich sinnlich beobachtend einem Dinge oder Vorgange gegenüberstehe. Der Sinn verbürgt mir die Wahrheit des Beobachteten, solange ich beobachte.
Nicht so, wenn ich mich durch ideell-geistige Erkenntnis mit Wesen oder Vorgängen der geistigen Welt verbinde. Da tritt in der Einzel-Anschauung die unmittelbare Erfahrung von dem über die Anschauungsdauer
hinausgehenden Bestand des Wahrgenommenen ein. Erlebt man zum Beispiel das «Ich» des Menschen als dessen ureigenste innere Wesenheit, so weiß man im anschauenden Erleben, daß dieses «Ich» vor dem Leben im physischen Leibe war und nach demselben sein wird. Was man so im «Ich» erlebt, offenbart dieses unmittelbar, wie die Rose ihre Röte im unmittelbaren Wahrnehmen offenbart.
In einer solchen aus innerer geistiger Lebensnotwendigkeit geübten Meditation entwickelt sich immer mehr das Bewußtsein von einem «inneren geistigen Menschen», der in völliger Loslösung von dem physischen Organismus im Geistigen leben, wahrnehmen und sich bewegen kann. Dieser in sich selbständige geistige Mensch trat in meine Erfahrung unter dem Einfluß der Meditation. Das Erleben des Geistigen erfuhr dadurch eine wesentliche Vertiefung. Daß die sinnliche Erkenntnis durch den Organismus entsteht, davon kann die für diese Erkenntnis mögliche Selbstbeobachtung ein genügendes Zeugnis geben. Aber auch die ideell-geistige Erkenntnis ist von dem Organismus noch abhängig. Die Selbstbeobachtung zeigt dafür dieses: Für die Sinnesbeobachtung ist der einzelne Erkenntnisakt an den Organismus gebunden. Für die ideell-geistige Erkenntnis ist der einzelne Akt ganz unabhängig von dem physischen Organismus; daß aber solche Erkenntnis überhaupt durch den Menschen entfaltet werden kann, hängt davon ab, daß im allgemeinen das Leben im Organismus vorhanden ist. Bei der dritten Art von Erkenntnis ist es so, daß sie nur dann durch den geistigen Menschen zustande kommen kann, wenn er sich von dem physischen Organismus so frei macht, als ob dieser gar nicht vorhanden wäre.
Ein Bewußtsein von alledem entwickelte sich unter dem Einfluß des geschilderten meditativen Lebens. Ich konnte die Meinung, man unterliege durch eine solche Meditation einer Art von Autosuggestion, deren Ergebnis die folgende Geist-Erkenntnis sei, für mich wirksam widerlegen. Denn von der Wahrheit des geistigen Erlebens hatte mich schon die allererste ideell-geistige Erkenntnis überzeugen können. Und zwar wirklich die allererste, nicht bloß die im Meditieren an ihrem Leben erhaltene, sondern die, welche ihr Leben begann. Wie man in besonnenem Bewußtsein ganz exakt Wahrheit feststellt, das hatte ich schon getan für das, was in Frage kommt, bevor überhaupt von Autosuggestion hat die Rede sein können. Es konnte sich bei dem, was die Meditation errungen hatte, also nur um das Erleben von etwas handeln, dessen Wirklichkeit zu prüfen ich vor dem Erleben schon völlig imstande war.
All dieses, das mit meinem Seelen-Umschwung verbunden war, zeigte sich im Zusammenhang mit einem Ergebnis möglicher Selbstbeobachtung, das ebenso wie das geschilderte für mich inhaltschwere Bedeutung gewann.
Ich fühlte, wie das Ideelle des vorangehenden Lebens nach einer gewissen Richtung zurücktrat und das Willensmäßige an dessen Stelle kam. Damit das möglich ist, muß sich das Wollen bei der Erkenntnis-Entfaltung aller subjektiven Willkür enthalten können. Der Wille nahm in dem Maße zu, als das Ideelle abnahm. Und der Wille übernahm auch das geistige Erkennen, das vorher fast ganz von dem Ideellen geleistet worden ist. Ich hatte ja schon erkannt, daß die Gliederung des Seelenlebens in
Denken, Fühlen und Wollen nur eingeschränkte Bedeutung hat. In Wahrheit ist im Denken ein Fühlen und Wollen mitenthalten; nur ist über die letzteren das Denken vorherrschend. Im Fühlen lebt Denken und Wollen, im Wollen Denken und Fühlen ebenso. Nun wurde mir Erlebnis, wie das Wollen mehr vom Denken, das Denken mehr vom Wollen aufnahm.
Führt auf der einen Seite das Meditieren zu der Erkenntnis des Geistigen, so ist andererseits die Folge solcher Ergebnisse der Selbstbeobachtung die innere Verstärkung des geistigen, vom Organismus unabhängigen Menschen und die Befestigung seines Wesens in der Geisteswelt, so wie der physische Mensch seine Befestigung in der physischen Welt hat. - Nur wird man gewahr, wie die Befestigung des geistigen Menschen in der Geisteswelt sich ins Unermeßliche steigert, wenn der physische Organismus diese Befestigung nicht beschränkt, während die Befestigung des physischen Organismus in der physischen Welt - mit dem Tode - dem Zerfalle weicht, wenn der geistige Mensch diese Befestigung nicht mehr von sich aus unterhält.
Mit solch einem erlebenden Erkennen ist nun jede Form einer Erkenntnistheorie unverträglich, die das Wissen des Menschen auf ein gewisses Gebiet beschränkt, und die «jenseits» desselben die «Urgründe», die «Dinge an sich» als für das menschliche Wissen Unzugängliches hinstellt. Jedes «Unzugängliche» war mir ein solches nur «zunächst»; und es kann nur so lange unzugänglich verbleiben, als der Mensch in seinem Innern nicht das Wesenhafte entwickelt hat, das mit dem vorher Unbekannten verwandt ist und daher im erlebenden Erken-
nen mit ihm zusammenwachsen kann. Diese Fähigkeit des Menschen, in jede Art des Seins hineinwachsen zu können, wurde für mich etwas, das der anerkennen muß, der in die Stellung des Menschen zur Welt im rechten Lichte sehen will. Wer zu dieser Anerkennung sich nicht durchringen kann, dem vermag Erkenntnis nicht etwas wirklich zur Welt Gehöriges zu geben, sondern nur ein der Welt gleichgültiges Nachbilden irgend eines Teiles des Welt-Inhaltes. Bei solcher bloß nachbildenden Erkenntnis kann der Mensch aber nicht in sich ein Wesen ergreifen, das ihm als vollbewußte Individualität ein inneres Erleben davon gibt, er stehe im Weltenall fest
Mir kam es darauf an, von Erkenntnis so zu sprechen, daß das Geistige nicht bloß anerkannt, sondern so anerkannt werde, daß der Mensch es mit seinem Anschauen erreichen könne. Und wichtiger erschien es mir, festzuhalten, daß die «Urgründe» des Daseins innerhalb dessen liegen, was der Mensch in seinem Gesamterleben erreichen kann, als ein unbekanntes Geistiges in irgend einem «jenseitigen» Gebiet gedanklich anzuerkennen.
Deshalb lehnte mein Anschauen die Denkungsart ab, die den Inhalt der sinnenfälligen Empfindung (Farbe, Wärme, Ton usw.) nur für etwas hält, das eine unbekannte Außenwelt durch die Sinneswahrnehmung im Menschen hervorruft, während diese Außenwelt selbst nur hypothetisch vorgestellt werden könne. Die theoretischen Ideen, die dem physikalischen und physiologischen Denken nach dieser Richtung zugrunde liegen, empfand mein erlebendes Erkennen als ganz besonders schädlich. Dieses Gefühl steigerte sich in meiner hier geschilderten Lebensepoche zur größten Lebhaftigkeit. Alles, was in
der Physik und Physiologie als «hinter der subjektiven Empfindung liegend» bezeichnet wurde, machte mir, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, Erkenntnis-Unbehagen.
Dagegen sah ich in der Denkungsart Lyells, Darwins, Haeckels etwas, das, wenn es auch, so wie es auftrat, unvollkommen war, doch der Entwickelung nach einem Gesunden fähig ist.
Lyells Grundsatz, die Erscheinungen in dem Teile des Erdenwerdens, der sich, weil er in der Vorzeit liegt, der sinnlichen Beobachtung entzieht, durch Ideen zu erklären, die sich an der gegenwärtigen Beobachtung dieses Werdens ergeben, schien mir nach der angedeuteten Richtung hin fruchtbar. Verständnis suchen für den physischen Bau des Menschen durch Herleitung seiner Formen aus den tierischen, wie das Haeckels «Anthropogenie» in umfassender Art tut, hielt ich für eine gute Grundlage zur weiteren Entwickelung der Erkenntnis.
Ich sagte mir: setzt sich der Mensch eine Erkenntnisgrenze, jenseits deren die «Dinge an sich» liegen sollen, so versperrt er sich damit den Zugang zur geistigen Welt; stellt er sich zur Sinneswelt so, daß eines das andere innerhalb ihrer erklärt (das gegenwärtig im Erdenwerden Vorsichgehende die geologische Vorzeit, die Formen der tierischen Gestalt diejenigen der menschlichen), so kann er bereit sein, diese Erklärbarkeit der Wesen und Vorgänge auch auf das Geistige auszudehnen.
Auch für mein Empfinden auf diesem Gebiete kann ich sagen: «Das ist etwas, das sich als Anschauung gerade damals in mir befestigt hat, während es meine Begriffswelt lange schon durchpulst hatte.»
XXIII.
Mit dem geschilderten Seelenumschwung muß ich meinen zweiten größeren Lebensabschnitt abschließen. Die Wege des Schicksals nahmen einen andern Sinn an als bis dahin. Sowohl während meiner Wiener wie auch während der Weimarischen Zeit wiesen die äußern Zeichen des Schicksals in Richtungen, die mit dem Inhalt meines inneren Seelenstrebens ineinanderliefen. In allen meinen Schriften lebt der Grundcharakter meiner geistgemäßen Weltanschauung, wenn auch eine innere Notwendigkeit gebot, die Betrachtungen weniger auf das eigentliche Geistgebiet auszudehnen. In meiner Wiener Erziehertätigkeit waren nur Zielsetzungen vorhanden, die aus den Einsichten der eigenen Seele kamen. In Weimar, bei der auf Goethe bezüglichen Arbeit wirkte allein, was ich als die Aufgabe einer solchen Arbeit betrachtete. Ich hatte nirgends die Richtungen, die von der Außenwelt kommen, in einer schwierigen Art mit den meinigen in Einklang bringen müssen.
Gerade aus diesem Verlauf meines Lebens kam die Möglichkeit, die Idee der Freiheit in einer mir klar erscheinenden Art anzuschauen und darzustellen. Ich glaube nicht, daß ich deshalb diese Idee einseitig angeschaut habe, weil sie in meinem eigenen Leben die große Bedeutung hatte. Sie entspricht einer objektiven Wirklichkeit, und was man selbst mit einer solchen erlebt, kann bei einem gewissenhaften Erkenntnisstreben diese Wirklichkeit nicht verändern, sondern nur deren Durchschauen in stärkerem oder geringerem Grade möglich machen.
Mit diesem Anschauen der Freiheitsidee verband sich der von vielen Seiten so verkannte «ethische Individualismus» meiner Weltanschauung. Auch er wurde beim Beginne meines dritten Lebensabschnittes aus einem Elemente meiner im Geiste lebenden Begriffswelt zu einem solchen, das nun den ganzen Menschen ergriffen hatte.
Sowohl die physikalische und physiologische Weltanschauung der damaligen Zeit, zu der ich ihrer Denkungsart nach ablehnend stand, wie auch die biologische, die ich trotz ihrer Unvollkommenheit als eine Brücke zu einer geistgemäßen ansehen konnte, forderten von mir, daß ich nach den beiden Weltgebieten hin die eigenen Vorstellungen zu immer besserer Ausgestaltung brachte. Ich mußte mir die Frage beantworten: können dem Menschen von der äußeren Welt Impulse seines Handelns sich offenbaren? Ich fand: die göttlich-geistigen Kräfte, die den Menschenwillen innerlich durchseelen, haben keinen Weg aus der Außenwelt in das menschliche Innere. Eine richtige physikalisch-physiologische sowohl wie eine biologische Denkungsart schienen mir das zu ergeben. Ein Naturweg, der äußerlich zum Wollen Veranlassung gibt, kann nicht gefunden werden. Somit kann auch kein göttlich-geistiger sittlicher Impuls auf einem solchen äußeren Wege an denjenigen Ort der Seele dringen, wo der im Menschen wirkende Eigen-Impuls des Willens sich ins Dasein bringt. Es können äußere naturhafte Kräfte auch nur das Naturhafte im Menschen mitreißen. Dann ist aber in Wirklichkeit keine freie Willensäußerung da, sondern eine Fortsetzung des naturhaften Geschehens in den Menschen hinein und durch diesen
hindurch. Der Mensch hat dann seine Wesenheit nicht voll ergriffen, sondern ist im Naturhaften seiner Außenseite als unfrei Handelnder stecken geblieben.
Es kann sich, so sagte ich mir immer wieder, gar nicht darum handeln, die Frage zu beantworten: ist der Wille des Menschen frei oder nicht? Sondern die ganz andere: wie ist der Weg im Seelenleben beschaffen von dem unfreien, naturhaften Wollen zu dem freien, das heißt wahrhaft sittlichen? Und um auf diese Frage Antwort zu finden, mußte darauf hingeschaut werden, wie das Göttlich-Geistige in jeder einzelnen Menschenseele lebt. Von dieser geht das Sittliche aus; in ihrem ganz individuellen Wesen muß also der sittliche Impuls sich beleben.
Sittliche Gesetze - als Gebote -, die von einem äußeren Zusammenhang kommen, in dem der Mensch steht, auch wenn sie ursprünglich aus dem Gebiete der geistigen Welt stammen, werden nicht dadurch in ihm zu sittlichen Impulsen, daß er sein Wollen nach ihnen orientiert, sondern allein dadurch, daß er deren Gedankeninhalt als geistig-wesenhaft ganz individuell erlebt. Die Freiheit lebt in dem Denken des Menschen; und nicht der Wille ist unmittelbar frei, sondern der Gedanke. der den Willen erkraftet.
So mußte ich schon in meiner «Philosophie der Freiheit» mit allem Nachdruck von der Freiheit des Gedankens in bezug auf die sittliche Natur des Willens sprechen.
Auch diese Idee wurde im meditativen Leben ganz besonders verstärkt. Die sittliche Weltordnung stand immer klarer als die eine auf Erden realisierte Ausprägung von solcher Art Wirkens-Ordnungen vor mir, die in über-
geordneten geistigen Regionen zu finden sind. Sie ergab sich als das, das nur derjenige in seine Vorstellungswelt hereinerfaßt, der Geistiges anerkennen kann.
All diese Einsichten schlossen sich mir gerade in der hier geschilderten Lebensepoche mit der erklommenen umfassenden Wahrheit zusammen, daß die Wesen und Vorgänge der Welt nicht in Wahrheit erklärt werden, wenn man das Denken zum «Erklären» gebraucht; sondern wenn man durch das Denken die Vorgänge in dem Zusammenhange zu schauen vermag, in dem das eine das andere erklärt, in dem eines Rätsel, das andere Lösung wird, und der Mensch selbst das Wort wird für die von ihm wahrgenommene Außenwelt.
Damit aber war die Wahrheit der Vorstellung erlebt, daß in der Welt und ihrem Wirken der Logos, die Weisheit, das Wort waltet.
Ich vermeinte mit diesen Vorstellungen das Wesen des Materialismus klar durchschauen zu können. Nicht darin sah ich das Verderbliche dieser Denkungsart, daß der Materialist sein Augenmerk auf die stoffliche Erscheinung einer Wesenheit richtet, sondern darin, wie er das Stoffliche denkt. Er schaut auf den Stoff hin und wird nicht gewahr, daß er in Wahrheit Geist vor sich habe, der nur in der stofflichen Form erscheint. Er weiß nicht, daß Geist sich in Stoff metamorphosiert, um zu Wirkungsweisen zu kommen, die nur in dieser Metamorphose möglich sind. Geist muß sich zuerst die Form eines stofflichen Gehirnes geben, um in dieser Form das Leben der Vorstellungswelt zu führen, die dem Menschen in seinem Erdenleben das frei wirkende Selbstbewußtsein verleihen kann. Gewiß: im Gehirn steigt aus dem Stoffe
der Geist auf; aber erst, nachdem das Stoffgehirn aus dem Geist aufgestiegen ist.
Abweisend gegen die physikalische und physiologische Vorstellungsart mußte ich nur aus dem Grunde sein, weil diese ein erdachtes, nicht ein erlebtes Stoffliches zum äußerlichen Erreger des im Menschen erfahrenen Geistigen macht und dabei den Stoff so erdachte, daß es unmöglich ist, ihn dahin zu verfolgen, wo er Geist ist. Solcher Stoff, wie ihn diese Vorstellungsart als real behauptet, ist eben nirgends real. Der Grundirrtum der materialistisch gesinnten Naturdenker besteht in ihrer unmöglichen Idee von dem Stoffe. Dadurch versperren sie den Weg in das geistige Dasein. Eine stoffliche Natur, die in der Seele bloß das erregte, was der Mensch an der Natur erlebt, macht die Welt «zur Illusion». Weil diese Ideen so intensiv in mein Seelenleben traten, verarbeitete ich sie dann vier Jahre später in meinem Werke «Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten Jahrhundert» in dem Kapitel «Die Welt als Illusion». (Dieses Werk hat in den späteren erweiterten Auflagen den Titel bekommen: «Rätsel der Philosophie».)
In der biologischen Vorstellungsart ist es nicht in gleicher Art möglich, in Charakteristiken zu verfallen, die das Vorgestellte völlig aus dem Gebiet verdrängen, das der Mensch erleben kann, und ihm dafür in seinem Seelenleben eine Illusion zurücklassen. Man kann da nicht bis zur Erklärung kommen: außer dem Menschen ist eine Welt, von der er nichts erlebt, die nur durch seine Sinne auf ihn einen Eindruck macht, der aber ganz unähnlich sein kann dem Eindruckgebenden. Man kann noch glauben, wenn man das Wichtigere des Denkens
im Seelenleben unterdrückt, daß man etwas gesagt habe, wenn man behauptet: der subjektiven Lichtwahrnehmung entspreche objektiv eine Bewegungsform im Äther - so war damals die Vorstellung -; man muß aber schon ein arger Fanatiker sein, wenn man auch das im Lebensgebiet Wahrgenommene so «erklären» will.
In keinem Falle, so sagte ich mir, dringt ein solches Vorstellen von Ideen über die Natur herauf zu Ideen über die sittliche Weltordnung. Es kann diese nur als etwas betrachten, das aus einem der Erkenntnis fremden Gebiet hereinfällt in die physische Welt des Menschen.
Daß diese Fragen vor meiner Seele standen, das kann ich nicht als bedeutsam für den Eingang meines dritten Lebensabschnittes ansehen. Denn sie standen ja seit langer Zeit vor mir. - Aber bedeutsam wurde mir, daß meine ganze Erkenntniswelt, ohne an ihrem Inhalte etwas Wesentliches zu ändern, in meiner Seele in einem gegenüber dem bisherigen wesentlich erhöhten Grade durch sie Lebensregsamkeit bekam. In dem «Logos» lebt die Menschenseele; wie lebt die Außenwelt in diesem Logos: das ist schon die Grundfrage meiner «Erkenntnistheorie der Goethe'schen Weltanschauung» (aus der Mitte der achtziger Jahre); es bleibt so für meine Schriften «Wahrheit und Wissenschaft» und «Philosophie der Freiheit». Es beherrschte diese Seelenorientierung alles, was ich an Ideen gestaltete, um in die seelischen Untergründe einzudringen, aus denen heraus Goethe Licht in die Welterscheinungen zu bringen suchte.
Was mich in dem hier geschilderten Lebensabschnitt besonders beschäftigte, war, daß die Ideen, die ich so streng abzuweisen genötigt war, das Denken des Zeit-
alters auf das intensivste ergriffen hatten. Man lebte so ganz in dieser Seelenrichtung, daß man nicht in der Lage war, irgendwie die Tragweite dessen zu empfinden, das in die entgegengesetzte Orientierung wies. Den Gegensatz zwischen dem, was mir klare Wahrheit war, und den Ansichten meines Zeitalters erlebte ich so, daß dies Erlebnis die Grundfärbung meines Lebens überhaupt in den Jahren um die Jahrhundertwende ausmachte.
In allem, was als Geistesleben auftrat, wirkte für mich der Eindruck, der von diesem Gegensatze ausging. Nicht als ob ich etwa alles ablehnte, was dies Geistesleben hervorbrachte. Aber ich empfand gerade gegenüber dem vielen Guten, das ich schätzen konnte, tiefen Schmerz, denn ich glaubte zu sehen, daß ihm als Entwickelungskeime des geistigen Lebens sich überall die zerstörenden Mächte entgegenstellten.
So erlebte ich denn von allen Seiten die Frage: wie kann ein Weg gefunden werden, um das innerlich als wahr Geschaute in Ausdrucksformen zu bringen, die von dem Zeitalter verstanden werden können?
Wenn man so erlebt, ist es, als ob auf irgendeine Art die Notwendigkeit vorläge, einen schwer zugänglichen Berggipfel zu besteigen. Man versucht es von den verschiedensten Ausgangspunkten; man steht immer wieder da, indem man Anstrengungen hinter sich hat, die man als vergeblich ansehen muß.
Ich sprach einmal in den neunziger Jahren in Frankfurt am Main über Goethes Naturanschauung. Ich sagte in der Einleitung: ich wolle nur über die Anschauungen Goethes vom Leben sprechen; denn seine Ideen über das Licht und die Farben seien solche, daß in der Physik der
Gegenwart keine Möglichkeit vorläge, die Brücke zu diesen Ideen zu schlagen. - Für mich aber mußte ich in dieser Unmöglichkeit ein bedeutsamstes Symptom für die Geistesorientierung der Zeit sehen.
Etwas später hatte ich mit einem Physiker, der in seinem Fache bedeutend war, und der auch intensiv sich mit Goethes Naturanschauung beschäftigte, ein Gespräch, das darin gipfelte, daß er sagte: Goethes Vorstellung über die Farben ist so, daß die Physik damit gar nichts anfangen kann, und daß ich - verstummte.
Wie Vieles sagte damals: das, was mir Wahrheit war, ist so, daß die Gedanken der Zeit «damit gar nichts anfangen» können.
XXIV.
Und die Frage wurde Erlebnis: muß man verstummen? Mit dieser Gestaltung meines Seelenlebens stand ich damals vor der Notwendigkeit, in meine äußere Wirksamkeit eine ganz neue Note hineinzubringen. Die Kräfte, die mein äußeres Schicksal bestimmten, konnten weiterhin nicht eine solche Einheit sein mit den inneren Richtlinien, die sich aus meinem Erleben der Geistwelt ergaben, wie bisher.
Ich hatte schon seit längerer Zeit daran gedacht, in einer Zeitschrift die geistigen Impulse an die Zeitgenossenschaft heranzubringen, von denen ich meinte, daß sie in die damalige Öffentlichkeit getragen werden sollten. Ich wollte nicht «verstummen», sondern so viel sagen, als zu sagen möglich war.
Selbst eine Zeitschrift zu gründen, was damals etwas, woran ich nicht denken konnte. Die Geldmittel und die zu einer solchen Gründung notwendigen Verbindungen fehlten mir vollständig.
So ergriff ich denn die Gelegenheit, die sich mir ergab, die Herausgeberschaft des «Magazin für Literatur» zu erwerben.
Das war eine alte Wochenschrift. Im Todesjahr Goethes (1832) ist sie gegründet worden. Zunächst als «Magazin für Literatur des Auslandes». Sie brachte Übersetzungen dessen, was die Redaktion an ausländischen Geistesschöpfungen auf allen Gebieten für wertvoll hielt, um dem deutschen Geistesleben einverleibt zu werden. - Später verwandelte man die Wochenschrift in ein «Magazin für die Literatur des In- und Auslandes». Jetzt brachte
sie Dichterisches, Charakterisierendes, Kritisches aus dem Gesamtgebiet des Geisteslebens. Innerhalb gewisser Grenzen konnte sie sich mit dieser Aufgabe gut halten. Ihre so geartete Wirksamkeit fiel in eine Zeit, in der im deutschen Sprachgebiete eine genügend große Anzahl von Persönlichkeiten vorhanden war, die jede Woche in kurz überschaulicher Weise das vor die Seele gerückt haben wollten, was auf geistigem Gebiete «vorging». - Als dann in den achtziger und neunziger Jahren in diese ruhig-gediegene Art, das Geistige mitzumachen, die neuen literarischen Zielsetzungen der jungen Generation traten, wurde das «Magazin» wohl bald in diese Bewegung mithineingerissen. Es wechselte ziemlich rasch seine Redakteure und bekam von diesen, die in den neuen Bewegungen in der einen oder der andern Art drinnen standen, seine jeweilige Färbung. - Als ich es 1897 erwerben konnte, stand es den Bestrebungen der jungen Literatur nahe, ohne sich in einen stärkeren Gegensatz zu versetzen gegen das, was außerhalb dieser Bestrebungen lag. - Aber jedenfalls war es nicht mehr in der Lage, sich allein durch das finanziell zu halten, was es inhaltlich war. So war es unter anderm das Organ der «Freien literarischen Gesellschaft» geworden. Das ergab zu der sonst nicht mehr ausreichenden Abonnentenzahl Einiges hinzu. Aber trotz alledem lag bei meiner Übernahme des «Magazin» die Sache so, daß man alle, auch die unsichern Abonnenten zusammennehmen mußte, um gerade knapp noch einen Stand herauszubekommen, bei dem man sich halten konnte. Ich konnte die Zeitschrift nur übernehmen, wenn ich mir zugleich eine Tätigkeit auferlegte, die geeignet erschien, den
Abonnentenkreis zu erhöhen. - Das war die Tätigkeit in der «Freien literarischen Gesellschaft». Ich mußte den Inhalt der Zeitschrift so einrichten, daß diese Gesellschaft zu ihrem Rechte kam. Man suchte in der «Freien literarischen Gesellschaft» nach Menschen, die ein Interesse hatten für die Schöpfungen der jüngeren Generation. Der Hauptsitz dieser Gesellschaft war in Berlin, wo jüngere Literaten sie gegründet hatten. Sie hatte aber Zweige in vielen deutschen Städten. Allerdings stellte sich bald heraus daß manche dieser «Zweige» ein recht bescheidenes Dasein führten Mir oblag nun in dieser Gesellschaft Vortrage zu halten um die Vermittlung mit dem Geistesleben die durch das «Magazin» gegeben sein sollte auch persönlich zum Ausdruck zu bringen.
Ich hatte somit für das «Magazin» einen Leserkreis, in dessen geistige Bedürfnisse ich mich hineinfinden mußte. Ich hatte in der «Freien literarischen Gesellschaft» eine Mitgliederschaft, die ganz Bestimmtes erwartete, weil ihr bisher ganz Bestimmtes geboten worden war. Jedenfalls erwartete sie nicht das, was ich ihr aus dem Innersten meines Wesens heraus hätte geben mögen. Das Gepräge der «Freien literarischen Gesellschaft» war ja auch dadurch bestimmt, daß sie eine Art Gegenpol gegen die «Literarische Gesellschaft» bilden sollte, in der Persönlichkeiten wie z. B. Spielhagen tonangebend waren.
Es lag nun an meinem Drinnenstehen in der geistigen Welt, daß ich diese Verhältnisse, in die ich da eintrat, wirklich ganz innerlich mitmachte. Ich versuchte ganz, mich in meinen Leserkreis und in den Mitgliederkreis
der «Gesellschaft» zu versetzen, um aus der Geistesart dieser Menschen die Formen zu finden, in die ich zu gießen hatte, was ich geistig geben wollte.
Ich kann nicht sagen, daß ich mich beim Beginn dieser Wirksamkeit Illusionen hingegeben hätte, die mir nach und nach zerstört worden wären. Aber gerade das Wirken aus Leser- und Zuhörerkreis heraus, das mir angemessen war, stieß auf immer größere Widerstände. Es war mit keinem ernsten, durchgreifenden Geistes-Zug bei dem Menschenkreis zu rechnen, den das «Magazin» um sich gesammelt hatte, bevor ich es übernommen hatte. Die Interessen dieses Kreises waren nur bei Wenigen tiefgreifend. Und auch bei den Wenigen lagen nicht starke Kräfte des Geistes zugrunde, sondern mehr ein allgemeines Wollen, das in allerlei künstlerischen und sonstigen geistigen Formen sich ausleben wollte.
Und so trat denn an mich bald die Frage heran, ob ich es vor meinem Innern und vor der geistigen Welt verantworten konnte, in diesem Kreise zu wirken. Denn wenn mir auch viele Persönlichkeiten, die da in Betracht kamen, sehr lieb waren, wenn ich auch freundschaftlich mich ihnen verbunden fühlte, so gehörten auch sie dem, was in mir lebte, gegenüber doch zu denen, die zu der Frage führten: «Muß man verstummen?»
Dazu kam ein Anderes. Von einer großen Anzahl von Menschen, die mir bisher freundschaftlich nahe standen, durfte ich, nach ihrem Verhalten zu mir, die Empfindung haben, sie gehen zwar in ihrem eigenen Seelenleben nicht sehr weit mit dem meinigen mit; aber sie setzen etwas in mir voraus, das mein Tun auf dem Erkenntnisgebiet und in mancherlei Lebensverhältnissen
ihnen wertvoll erscheinen ließ. Sie stellten sich so oft ungeprüft, nach ihren Erlebnissen mit mir, zu meinem Dasein.
Die bisherige Herausgeberschaft des «Magazin» empfand nicht so. Sie sagte sich, trotz mancher Züge von Lebenspraxis in ihm ist der Steiner doch eben «Idealist». Und da der Verkauf des «Magazin» so bewirkt wurde, daß im Laufe der Jahre Raten an den bisherigen Besitzer zu zahlen waren, daß dieser auch die stärksten sachlichen Interessen an dem Fortbestand der Wochenschrift hatte, so konnte er, von seinem Gesichtspunkte aus, gar nicht anders, als sich und der Sache noch eine andere Garantie schaffen, als diejenige, die in meiner Person lag, von der er nicht sagen konnte, wie sie innerhalb des Menschen-kreises wirken werde, der um «Magazin» und «Freie literarische Gesellschaft» sich bisher zusammengefunden hatte. Daher wurde mit zur Bedingung des Kaufes gemacht, daß Otto Erich Hartleben als Mitherausgeber zeichnen und tätig sein solle.
Nun möchte ich in der Rückschau auf diese Tatsachen heute nicht, daß bei der Einrichtung meiner Herausgeberschaft irgend etwas anders gekommen wäre. Denn der in der Geisteswelt Stehende muß, wie ich in dem Vorangehenden beschrieben habe, die Tatsachen der physischen Welt voll durch Erleben kennen lernen. Und mir war das insbesondere durch meinen Seelenumschwung zu einer selbstverständlichen Notwendigkeit geworden. Nicht hinzunehmen, was ich als die Kräfte des Schicksals deutlich erkannte, wäre mir eine Versündigung gegen mein Geist Erleben gewesen. Ich sah nicht nur «Tatsachen», die mich damals für einige Zeit mit Otto Erich
Hartleben zusammenstellten, sondern «schicksal-(karma-) gewobene Tatsachen».
Aber es ergaben sich doch aus diesem Verhältnisse nicht zu bewältigende Schwierigkeiten.
Otto Erich Hartleben war ein durch und durch von Ästhetik beherrschter Mensch. Als graziös empfand ich alles, was sich aus seiner restlos ästhetischen Weltauffassung bei ihm, bis in seine Gesten hinein, offenbarte, trotz des oft recht fragwürdigen «Milieus», in dem er mir entgegentrat. Er hatte aus dieser Haltung seiner Seele heraus das Bedürfnis, immer wieder monatelang sich in Italien aufzuhalten. Und wenn er von da zurückkam, da lag in dem, was von seinem Wesen in die Erscheinung trat, selbst ein Stück Italien. - Dazu hatte ich eine persönliche starke Liebe zu ihm.
Allein ein Zusammenarbeiten auf dem uns nun gemeinsamen Felde war eigentlich unmöglich. Er war gar nicht daraufhin orientiert, sich in Ideen- und Interessengebiete des Magazinleserkreises oder des Kreises der «Freien literarischen Gesellschaft» «hineinzuversetzen», sondern er wollte eben an beiden Orten «durchsetzen», was ihm seine ästhetische Empfindung sagte. Das wirkte auf mich wie ein mir fremdes Element. Dabei machte er sein Recht, mitzuarbeiten, oftmals geltend, aber oftmals ganz lange Zeit hindurch auch nicht Er war ja auch oft lange in Italien abwesend. So kam etwas ganz Uneinheitliches in den Inhalt des «Magazin» - Und bei all seiner «reifen ästhetischen Weltanschauung» konnte Otto Erich Hartleben den «Studenten» in sich nicht überwinden. Ich meine die fragwürdigen Seiten der «Studentenschaft», natürlich nicht das, was als schöne Daseinskraft
aus der Studentenzeit in das spätere Leben hinübergetragen werden kann.
Als ich mit ihm mich zusammenzuschließen hatte, war ihm ein weiterer Verehrerkreis wegen seines Dramas: «Die Erziehung zur Ehe» zugefallen. Das Werk war durchaus nicht aus dem Graziös-Ästhetischen hervorgegangen, das im Umgange mit ihm so reizvoll wirkte; es war gerade aus der «Ausgelassenheit» und «Ungebundenheit» hervorgegangen, die alles, was als geistige Produktion und auch als Entscheidungen gegenüber dem «Magazin» von ihm kam, doch nicht aus der Tiefe seines Wesens, sondern aus einer gewissen Oberflächlichkeit kommen ließen. Den Hartleben des persönlichen Umganges kannten nur Wenige.
Es ergab sich als etwas Selbstverständliches, daß ich nach meiner Übersiedelung nach Berlin, von wo aus ich das «Magazin» redigieren mußte, in dem Kreise verkehrte, der mit Otto Erich Hartleben zusammenhing. Denn es war derjenige, der mir die Möglichkeit gab, was zur Wochenschrift und zur «Freien literarischen Gesellschaft» gehörte, so zu überschauen, wie es notwendig war.
Das brachte mir auf der einen Seite einen großen Schmerz. Denn dadurch wurde ich verhindert, die Menschen aufzusuchen und ihnen näher zu kommen, mit denen von Weimar her schöne Verhältnisse bestanden. Wie lieb wäre es mir auch gewesen, Eduard v. Hartmann öfters zu besuchen.
All das ging nicht. Die andere Seite nahm mich voll in Anspruch. Und so wurde von einem mir werten Menschlichen mit einem Schlage manches von mir genommen, was ich gerne behalten hätte. Aber ich erkannte das als
eine Schicksals- (karmische) Fügung. Mir wäre es aus Seelenuntergründen heraus, die ich hier charakterisiert habe, durchaus möglich gewesen, zwei so grundverschiedenen Menschenkreisen wie dem mit Weimar zusammenhängenden und dem um das «Magazin» bestehenden, meine Seele mit vollem Interesse zuzuwenden. Allein keiner der Kreise hätte auf die Dauer an einer Persönlichkeit irgendwelche Freude gehabt, die abwechselnd mit Menschen verkehrte, die in bezug auf Seele und Geist polarisch entgegengesetzten Weltgebieten angehörten. Auch wäre es ja unvermeidlich geworden, bei solchem Verkehr fortwährend zu rechtfertigen, warum ich mein Wirken ausschließlich in den Dienst stelle, in den ich es, wegen dessen, was das «Magazin» war, stellen mußte.
Immer mehr trat mir vor die Seele: solche Art, Menschen gegenüberzustehen, wie ich sie für Wien, für Weimar hier beschreiben durfte, war nun unmöglich geworden. Literaten kamen zusammen, und literarisch lernten sich Literaten kennen. Selbst bei den Besten, auch bei den ausgeprägtesten Charakteren grub sich dies Literarische (oder auch Malerische, Bildhauerische) so tief in das Wesen der Seele, daß das rein Menschliche ganz in den Hintergrund trat.
Solchen Eindruck bekam ich, wenn ich zwischen diesen
- von mir doch geschätzten - Persönlichkeiten saß. Auf mich selbst machten dafür die menschlichen Seelen-Hintergründe einen um so tieferen Eindruck. In der «Freien literarischen Gesellschaft» in Leipzig saß ich einmal nach einem Vortrage von mir und einer Vorlesung O. J. Bierbaums mit einem Kreise zusammen, in dem auch Frank Wedekind war. Mein Schauen war wie gefes-
selt von dieser wahrhaft seltenen Menschen-Gestalt. Ich meine hier «Gestalt» ganz im physischen Sinne. Diese Hände! Wie aus einem vorigen Erdenleben, in denen sie Dinge verrichtet haben, die nur von Menschen verrichtet werden können, welche ihren Geist bis in die feinsten Fingerverzweigungen strömen lassen. Mag das dann, weil Energie verarbeitet worden ist, den Eindruck von Brutalität gegeben haben; das höchste Interesse wurde angezogen von dem, was diese Hände ausstrahlten. Und dieser ausdrucksvolle Kopf - ganz wie eine Gabe dessen, was aus den besonderen Willensnoten der Hände kam. Er hatte in Blick und Mienenspiel etwas, das sich so willkürlich der Welt geben, aber namentlich auch von ihr sich zurückziehen konnte, wie die Gesten der Arme durch die Empfindung der Hände. Ein der Gegenwart fremder Geist sprach aus diesem Kopfe. Ein Geist, der sich eigentlich außer das Menschentreiben dieser Gegenwart stellt. Der nur nicht innerlich zum Bewußtsein darüber kommen konnte, welcher Welt der Vergangenheit er angehört. Als Literat war - ich meine jetzt nur das, was ich an ihm schaute, kein literarisches Urteil - Frank Wedekind wie ein Chemiker, der die gegenwärtigen Ansichten der Chemie ganz von sich geworfen, und der Alchemie, aber auch diese nicht mit innerem Anteil, sondern mit Zynismus treibt. Man konnte viel von der Wirkung des Geistes in der Form kennen lernen, wenn man die äußere Erscheinung Frank Wedekinds in die Seelenanschauung hereinbekam. Dabei darf man allerdings nicht mit dem Blicke desjenigen «Psychologen» vorgehen, der «Menschen beobachten will», sondern mit dem, der das rein Menschliche auf dem Hintergrunde der Geistwelt durch
innere geistige Schicksaisfügung zeigt, die man nicht sucht, sondern die herankommt.
Ein Mensch, der bemerkt, er werde von einem «Psychologen» beobachtet, der darf ärgerlich werden; der Übergang aber von dem rein menschlichen Verhältnis zu dem «auf geistigem Hintergrunde schauen» ist auch rein menschlich, etwa wie der von einer flüchtigen zu einer intimeren Freundschaft.
Eine der eigenartigsten Persönlichkeiten des Hartleben'schen Berliner Kreises war Paul Scheerbarth. Er hat «Gedichte» geschrieben, die dem Leser zunächst wie willkürliche Wort- und Satzzusammenstellungen vorkommen. Sie sind so grotesk, daß man deswegen sich angezogen fühlt, über den ersten Eindruck hinauszugehen. Dann findet man, daß ein phantastischer Sinn allerlei sonst unbeachtete Bedeutungen in den Worten sucht, um einen geistigen Inhalt zum Ausdruck zu bringen, der nicht minder aus einer bedenlosen, aber einen Boden überhaupt gar nicht suchenden Seelen-Phantastik heraus stammt. In Paul &heerbarth lebte ein innerer Kultus des Phantastischen; aber der bewegte sich in den Formen des gesucht Grotesken. Er hatte, nach meiner Auffassung, das Gefühl, der geistvolle Mensch dürfe, was er darstellt, nur in grotesken Formen darstellen, weil andere alles ins Philiströse zerren. Aber dies Gefühl will auch das Groteske nicht in gerundeter künstlerischer Form entwickeln, sondern in souveräner, gesucht unbesonnener Seelenverfassung. Und was sich in diesen grotesken Formen offenbart, das muß dem Gebiet der inneren Phantastik entspringen. Ein nicht nach Klarheit suchender Seelenzug nach dem Geistigen lag bei Paul Scheerbarth zugrunde. Was aus
der Besonnenheit kommt, das geht nicht auf geistige Regionen, so sagte sich dieser «Phantast». Deshalb darf man, um Geist auszudrücken, nicht besonnen sein. Aber Scheerbarth tat auch keinen Schritt von der Phantastik zur Phantasie. Und so schrieb er aus einem in der interessanten, aber wüsten Phantastik steckengebliebenen Geist heraus, in dem ganze kosmische Welten als Rahmenerzählungen flimmern, schillern, das Geistgebiet karikieren und ebenso gehaltene Menschenerlebnisse umschließen. So in «Tarub, Bagdads berühmte Köchin».
Man sah den Mann nicht so, wenn man ihn persönlich kennen lernte. Ein Bureaukrat, etwas ins Geistige gehoben. Die «äußere Erscheinung», die bei Wedekind so interessant war, bei ihm alltäglich, philiströs. Und dieser Eindruck erhöhte sich noch, wenn man in der ersten Zeit der Bekanntschaft mit ihm ins Gespräch kam. Er hatte in sich den glühendsten Haß auf die Philister, hatte aber die Gesten der Philister, deren Sprechweise, zeigte sich so, als ob der Haß davon käme, daß er aus Philisterkreisen zuviel in die eigene Erscheinung aufgenommen hatte und das spürte; aber zugleich das Gefühl hatte, er könne es nicht bekämpfen. Man las auf dem Grunde seiner Seele eine Art Bekenntnis: Ich möchte die Philister vernichten, weil sie mich zum Philister gemacht haben.
Ging man aber von dieser äußeren Erscheinung zu dem von ihr unabhängigen inneren Wesen Paul Scheerbarths, so enthüllte sich ein ganz feiner, nur eben im Grotesk-Phantastischen steckengebliebener, geistig unvollendeter Geistmensch. Dann erlebte man mit seinem «hellen» Kopf, mit seinem «goldenen» Herzen die Art mit, wie er in der Geist-Welt stand. Man mußte sich sa-
gen, welch eine starke, in die Geistwelt schauend dringende Persönlichkeit hätte da in die Welt treten können, wenn das Unvollendete wenigstens bis zu einem gewissen Grade vollendet worden wäre. Man sah zugleich, daß das «Bekenntnis zur Phantastik» schon so stark war, daß auch eine Vollendung in der Zukunft dieses Erdenlebens nicht mehr im Bereich der Möglichkeit lag.
In Frank Wedekind und Paul Scheerbarth standen Persönlichkeiten vor mir, die in ihrem ganzen Wesen dem, der die Tatsache der wiederholten Erdenleben des Menschen kannte, höchst bedeutsame Erlebnisse gaben. Sie waren ja Rätsel in dem gegenwärtigen Erdenleben. Man sah bei ihnen auf das, was sie sich in dieses Erden-leben mitgebracht hatten. Und eine unbegrenzte Bereicherung ihrer ganzen Persönlichkeit trat auf. Man verstand aber auch ihre Unvollkommenheiten als Ergebnisse früherer Erdenleben, die in der gegenwärtigen geistigen Umgebung nicht voll zur Entfaltung kommen konnten. Und man sah, wie das, was aus diesen Unvollkommenheiten werden konnte, künftige Erdenleben brauchte.
So stand noch manche Persönlichkeit dieses Kreises vor mir. Ich erkannte, daß, ihr zu begegnen, für mich Schicksalsfügung (Karma) war.
Ein rein menschliches, herzliches Verhältnis konnte ich auch zu dem so durch und durch liebenswürdigen Paul Scheerbarth nicht gewinnen. Es war doch so, daß im Verkehr der Literat in Paul Scheerbarth, wie in den andern auch, immer durchschlug. So waren meine allerdings liebevollen Empfindungen für ihn doch durch die Aufmerksamkeit und das Interesse zuletzt bestimmt, die
ich an seiner in so hohem Grade merkwürdigen Persönlichkeit nehmen mußte.
Eine Persönlichkeit war allerdings in dem Kreise da, die sich nicht als Literat, sondern im vollsten Sinne als Mensch darlebte, W. Harlan. Aber der sprach wenig, und saß eigentlich immer wie ein stiller Beobachter da. Wenn er aber sprach, so war es immer entweder im besten Sinne geistreich, oder echt witzig. Er schrieb eigentlich viel, aber eben nicht als Literat, sondern als ein Mensch, der aussprechen mußte, was er auf der Seele hatte. Damals war von ihm gerade die «Dichterbörse» erschienen, eine Lebensdarstellung voll köstlichen Humors. Ich harte es immer gern, wenn ich etwas früher in das Versammlungslokal des Kreises kam und erst Harlan ganz allein dasaß. Man kam sich dann nahe. Ihn nehme ich also aus, wenn ich davon spreche, daß ich in diesem Kreise nur Literaten und keine «Menschen» gefunden habe. Und ich glaube, er verstand, daß ich den Kreis so ansehen mußte. Die ganz verschiedenen Lebenswege haben uns bald weit auseinandergeführt.
Es waren die Menschen um «Magazin» und «Freie literarische Gesellschaft» deutlich in mein Schicksal verwoben. Ich aber war nicht auf irgend eine Art in das ihrige verwoben. Sie sahen mich in Berlin, in ihrem Kreise auftauchen, erfuhren, daß ich das «Magazin> redigieren und für die «Freie literarische Gesellschaft» arbeiten wolle; aber verstanden nicht, warum gerade ich dies tun solle. Denn so, wie ich für ihre Seelenaugen unter ihnen herumging, hatte es für sie nichts Verlockendes, auf mich tiefer einzugehen. Obwohl in mir keine Spur Theorie steckte, kam ihrem theoretischen Dogmatisieren
mein geistiges Wirken wie etwas Theoretisches vor. Das war etwas, wofür sie als «künstlerische Naturen» glaubten, kein Interesse haben zu dürfen.
Ich lernte aber durch unmittelbare Anschauung eine künstlerische Strömung in ihren Repräsentanten kennen. Sie war nicht mehr so radikal wie die Ende der achtziger und in den ersten neunziger Jahren in Berlin auftretenden. Sie war auch nicht mehr so, daß sie wie die Theater-Umwandlung Otto Brahms einen Voll-Naturalismus als die Rettung der Kunst hinstellte. Sie war ohne eine solche zusammenfassende Kunstüberzeugung. Sie beruhte mehr auf dem, was aus dem Willen und den Begabungen der einzelnen Persönlichkeiten zusammenströmte, das aber auch ein einheitliches Stilstreben ganz entbehrte.
Meine Lage innerhalb dieses Kreises wurde seelisch unbehaglich wegen des Gefühls, daß ich wußte, warum ich da war, die andern nicht.
XXV.
Mit dem Magazinkreis im Zusammenhang stand eine freie «Dramatische Gesellschaft». Sie gehörte nicht so eng dazu wie die «Freie literarische Gesellschaft»; aber es waren dieselben Persönlichkeiten wie in dieser Gesellschaft im Vorstande; und ich wurde sogleich auch in diesen gewählt, als ich nach Berlin kam.
Die Aufgabe dieser Gesellschaft war, Dramen zur Aufführung zu bringen, die durch ihre besondere Eigenart, durch das Herausfallen aus der gewöhnlichen Geschmacksrichtung und ähnliches, von den Theatern zunächst nicht aufgeführt wurden. Es gab für den Vorstand gar keine leichte Aufgabe, mit den vielen dramatischen Versuchen der «Verkannten» zurechtzukommen.
Die Aufführungen gingen in der Art vor sich, daß man für jeden einzelnen Fall ein Schauspielerensemble zusammenbrachte aus Künstlern, die an den verschiedensten Bühnen wirkten. Mit diesen spielte man dann in Vormittagsvorstellungen auf einer gemieteten oder von einer Direktion frei überlassenen Bühne. Die Bühnenkünstier erwiesen sich dieser Gesellschaft gegenüber sehr opferwillig, denn sie war wegen ihrer geringen Geldmittel nicht in der Lage, entsprechende Entschädigungen zu zahlen. Aber Schauspieler und auch Theaterdirektoren hatten damals innerlich nichts einzuwenden gegen die Aufführung von Werken, die aus dem Gewohnten herausfielen. Sie sagten nur: Vor einem gewöhnlichen Publikum in Abendvorstellungen könne man das nicht machen, weil sich jedes Theater dadurch finanziell schädige. Das
Publikum sei eben nicht reif genug dazu, daß die Theater bloß der Kunst dienten.
Die Betätigung, die mit dieser dramatischen Gesellschaft verbunden war, erwies sich als eine solche, die mir in einem hohen Grade entsprechend war. Vor allem der Teil, der mit der Inszenierung der Stücke zu tun hatte. Mit Otto Erich Hartleben zusammen nahm ich an den Proben teil. Wir fühlten uns als die eigentlichen Regisseure. Wir gestalteten die Stücke bühnenmäßig. Gerade an dieser Kunst zeigt sich, daß alles Theoretisieren und Dogmatisieren nichts hilft, wenn sie nicht aus dem lebendigen Kunstsinn hervorgehen, der im Einzelnen das allgemein Stilvolle intuitiv ergreift. Die Vermeidung der allgemeinen Regel ist voll anzustreben. Alles, was man auf einem solchen Gebiete zu «können» in der Lage ist, muß im Augenblicke aus dem sicheren Stilgefühl für die Geste, die Anordnung der Szene sich ergeben. Und was man dann, ohne alle Verstandesüberlegung, aus dem Stilgefühle, das sich betätigt, tut, das wirkt auf alle beteiligten Künstler wohltuend, während sie sich bei einer Regie, die aus dem Verstande kommt, in ihrer inneren Freiheit beeinträchtigt fühlen.
Auf die Erfahrungen, die ich auf diesem Gebiete damals gemacht habe, mußte ich mit vieler Befriedigung in der Folgezeit immer wieder zurückblicken.
Das erste Drama, das wir in dieser Art aufführten, war Maurice Maeterlincks «Der Ungebetene» (l'intruse). Otto Erich Hartleben hatte die Übersetzung gegeben. Maeterlinck galt damals bei den Ästhetizisten als der Dramatiker, der das Unsichtbare, das zwischen den gröberen Geschehnissen des Lebens liegt, auf der Bühne dem
ahnend erfassenden Zuschauer vor die Seele bringen könne. Von dem, was im Drama sonst «Vorgänge» genannt wird, von der Art, wie der Dialog verläuft, machte Maeterlinck einen solchen Gebrauch, daß dadurch zu Ahnendes wie im Symbol wirkt. Dieses Symbolisierende war es, was manchen Geschmack damals anzog, der von dem vorangegangenen Naturalismus abgestoßen war. Allen, die «Geist» suchten, aber keine Ausdrucksformen wünschten, in denen eine «Geistwelt» sich unmittelbar offenbart, fanden in einem Symbolismus ihre Befriedigung, der eine Sprache führte, die sich nicht in naturalistischer Art ausdrückte, die aber auf ein Geistiges doch nur insofern ging, als dieses in mystisch-ahnungsvoller, unbestimmt verschwimmender Art sich kundgab. Je weniger man «deutlich sagen» konnte, was hinter den andeutenden Symbolen liegt, desto verzückter wurden manche durch sie.
Ich fühlte mich nicht behaglich gegenüber diesem geistigen Flimmern. Aber dennoch war es reizvoll, an der Regie eines solchen Dramas wie «Der Ungebetene» sich zu betätigen. Denn gerade diese Art von Symbolen durch geeignete Bühnenmittel zur Darstellung zu bringen, erfordert in einem besonders hohen Grade ein Regiewirken, das in der eben geschilderten Art orientiert ist.
Und dazu fiel noch die Aufgabe auf mich, die Vorstellung durch eine kurze hinweisende Rede (Conférence) einzuleiten. Man hatte damals diese in Frankreich geübte Art auch in Deutschland bei einzelnen Dramen angenommen. Natürlich nicht auf dem gewöhnlichen Theater, aber eben bei solchen Unternehmungen, wie sie in der Richtung der «Dramatischen Gesellschaft» lagen. Es
geschah das nicht etwa vor jeder Vorstellung dieser Gesellschaft, sondern selten; wenn man für notwendig hielt, das Publikum in ein ihm ungewohntes künstlerisches Wollen einzuführen. Mir war die Aufgabe dieser kurzen Bühnenrede aus dem Grunde befriedigend, weil sie mir Gelegenheit gab, in der Rede eine Stimmung walten zu lassen, die mir selbst aus dem Geist heraus strahlte. Und das war mir lieb in einer menschlichen Umgebung, die sonst kein Ohr für den Geist hatte.
Das Drinnenstehen in dem Leben der dramatischen Kunst war für mich damals überhaupt ein recht bedeutsames. Ich schrieb daher die Theaterkritiken des « Magazin» selbst. Ich hatte auch von solchen «Kritiken» meine besondere Auffassung, die aber wenig Verständnis fand. Ich hielt es für unnötig, daß ein Einzelner «Urteile» abgibt über ein Drama und dessen Aufführung. Solche Urteile, wie sie da gewöhnlich abgegeben werden, sollte eigentlich das Publikum mit sich allein abmachen.
Wer über eine Theateraufführung schreibt, sollte in einem künstlerisch-ideellen Gemälde vor seinem Leser erstehen lassen, welche Phantasie-Bild-Zusammenhänge hinter dem Drama stehen. In künstlerisch geformten Gedanken sollte vor dem Leser eine ideelle Nachdichtung stehen als der in dem Dichter unbewußt lebende Keim seines Dramas. Denn mir waren Gedanken niemals bloß etwas, wodurch man Wirkliches abstrakt und intellektualistisch ausdrückt. Ich sah, wie im Gedanken-Bilden eine künstlerische Betätigung möglich ist wie mit Farben, wie in Formen, wie mit Bühnenmitteln. Und ein solches kleines Gedankenkunstwerk sollte derjenige geben, der über eine Theateraufführung schreibt. Daß aber ein Der-
artiges entstehe, wenn ein Drama dem Publikum vorgeführt wird, erschien mir als eine notwendige Forderung des Lebens der Kunst.
Ob nun ein Drama «gut», «schlecht» oder «mittelmäßig» ist, das wird aus Ton und Haltung eines solchen «Gedanken-Kunstwerkes» ersichtlich werden. Denn in ihm läßt sich das nicht verbergen, auch wenn man es nicht grob-urteilend sagt. Was ein unmöglicher künstlerischer Aufbau ist, das wird anschaulich durch gedankenkünstlerische Nachbildung. Denn da stellt man zwar die Gedanken hin; sie erweisen sich aber als wesenlos, wenn das Kunstwerk nicht aus wahrer, in Wirklichkeit lebender Phantasie ist.
Solch ein lebendiges Zusammenwirken mit der lebenden Kunst wollte ich im «Magazin» haben. Dadurch hätte etwas entstehen sollen, was die Wochenschrift nicht wie etwas die Kunst und das geistige Leben theoretisch Besprechendes, Beurteilendes erscheinen ließ. Sie sollte ein Glied in diesem geistigen Leben, in dieser Kunst selbst sein.
Denn alles das, was man durch die Gedankenkunst für die dramatische Dichtung tun kann, das ist auch für die Schauspielkunst möglich. Man kann in Gedankenphantasie erstehen lassen, was die Regiekunst in das Bühnenbild hineinversetzt; man kann in solcher Art dem Schauspieler folgen, und was in ihm lebt nicht kritisierend, sondern «positiv» darstellend erstehen lassen. Man wird dann als «Schreibender» ein Mitgestalter am künstlerischen Zeitleben, nicht aber ein in der Ecke stehender «gefürchteter», «bemitleideter» oder wohl auch verachteter und gehaßter «Beurteiler». Wenn das für alle Ge-
biete der Kunst durchgeführt wird, dann eben steht eine literarisch-künstlerische Zeitschrift im wirklichen Leben darinnen.
Aber mit solchen Dingen macht man immer dieselbe Erfahrung. Sucht man sie vor Menschen, die sich schriftstellerisch betätigen, zur Geltung zu bringen, so gehen sie entweder gar nicht darauf ein, weil sie ihren Denkgewohnheiten widersprechen, und sie aus diesen nicht herauswollen. Oder aber sie hören zu, und sagen dann: ja, das ist das Richtige; aber ich habe das immer schon so gemacht. Sie bemerken gar nicht das Unterscheidende zwischen dem, was man will, und dem, was sie «schon immer gemacht haben».
Wer seine einsamen geistigen Wege gehen kann, den braucht das alles nicht seelisch zu berühren. Wer aber in einem geistigen Menschenzusammenhang arbeiten soll, der wird seelisch recht gründlich ergriffen von diesen Verhältnissen. Insbesondere dann, wenn seine innere Richtung eine so feste, mit ihm verwachsene ist, daß er in einem Wesentlichen nicht von ihr abgehen kann.
Weder von meinen Darstellungen im «Magazin», noch von denen meiner Vorträge konnte ich damals innerlich befriedigt sein. Nur, wer sie heute liest und glaubt, daß ich Materialismus hatte vertreten wollen, der irrt sich vollständig. Das habe ich niemals gewollt.
Man kann das auch aus den Aufsätzen und Vortragsauszügen, die ich geschrieben habe, deutlich ersehen. Man muß nur den einzelnen materialistisch klingenden Stellen andere gegenüberhalten, in denen ich vom Geistigen, vom Ewigen spreche. So in dem Artikel: «Ein Wiener Dichter». Von Peter Altenberg sage ich da: «Was
den Menschen, der sich in die ewige Weltharmonie vertieft, am meisten interessiert, scheint ihm fremd zu sein... Von den ewigen Ideen dringt kein Licht in Altenbergs Augen...» («Magazin» vom 17. Juli 1897). Und daß mit dieser «ewigen Weltenharmonie» nicht eine mechanisch-materialistische gemeint sein kann, wird deutlich an Aussprüchen wie die im Aufsatz über Rudolf Heidenhain (vom 6. November 1897): «Unsere Naturauffassung strebt deutlich dem Ziele zu, das Leben der Organismen nach denselben Gesetzen zu erklären, nach denen auch die Erscheinungen der leblosen Natur erklärt werden müssen. Mechanische, physikalische, chemische Gesetzmäßigkeit wird im tierischen und pflanzlichen Körper gesucht. Dieselbe Art von Gesetzen, die eine Maschine beherrschen, sollen, nur in unendlich komplizierter und schwer zu erkennender Form, auch im Organismus tätig sein. Nichts soll zu diesen Gesetzen hinzutreten, um das Phänomen, das wir Leben nennen, möglich zu machen ... Die mechanistische Auffassung der Lebenserscheinungen gewinnt immer mehr an Boden. Sie wird aber denjenigen nie befriedigen, der fähig ist, einen tieferen Blick in die Naturvorgänge zu tun... Die Naturforscher von heute sind in ihrem Denken zu feige. Wo ihnen die Weisheit ihrer mechanischen Erklärungen ausgeht, da sagen sie, für uns ist die Sache nicht erklärbar... Ein kühnes Denken erhebt sich zu einer höhern Anschauungsweise. Es versucht, nach höhern Gesezen zu erklären, was nicht mechanischer Art ist. All unser naturwissenschaftliches Denken bleibt hinter unserer naturwissenschaftlichen Erfahrung zurück. Man rühmt heute die naturwissenschaftliche Denkart sehr. Man
spricht davon, daß wir im naturwissenschaftlichen Zeitalter leben. Aber im Grunde ist dieses naturwissenschaftliche Zeitalter das ärmlichste, das die Geschichte zu verzeichnen hat. Hängenbleiben an den bloßen Tatsachen und an den mechanischen Erklärungsarten ist sein Charakteristikum. Das Leben wird von dieser Denkart nie begriffen, weil zu einem solchen Begreifen eine höhere Vorstellungsweise gehört als zur Erklärung einer Maschine.»
Ist nicht völlig selbstverständlich, daß, wer so von der Erklärung des «Lebens» spricht, von der des «Geistes» nicht im materialistischen Sinne denken kann?
Aber ich spreche öfter davon, daß der «Geist» aus dem Schoße der Natur «hervorgehe». Was ist da mit «Geist» gemeint? Alles das, was aus menschlichem Denken, Fühlen und Wollen die «Kultur» erzeugt. Von einem andern «Geiste» zu sprechen, wäre damals ganz zwecklos gewesen. Denn niemand hätte mich verstanden, wenn ich gesagt hätte: dem, was am Menschen als Geist erscheint, und der Natur liegt etwas zugrunde, das weder Geist, noch Natur ist, sondern die vollkommene Einheit beider. Diese Einheit: schaffender Geist, der den Stoff in seinem Schaffen zum Dasein bringt und dadurch zugleich Stoff ist, der ganz als Geist sich darstellt: diese Einheit wird durch eine Idee begriffen, die den damaligen Denkgewohnheiten so fern wie möglich lag. Von einer solchen Idee aber hätte gesprochen werden müssen, wenn in geistgemäßer Anschauungsart die Urzustände der Erd- und Menschheitsentwickelung und die heute noch im Menschen selbst tätigen geist-stofflichen Mächte hätten dargestellt werden sollen, die auf der
einen Seite seinen Körper bilden, auf der andern das lebendig Geistige aus sich hervorgehen lassen, durch das er die Kultur schafft. Die äußere Natur aber hätte so besprochen werden müssen, daß in ihr das ursprünglich Geist-Stoffliche als erstorben in den abstrakten Naturgesetzen sich darstellt.
Das alles konnte nicht gegeben werden.
Es konnte nur angeknüpft werden an die naturwissenschaftliche Erfahrung, nicht an das naturwissenschaftliche Denken. In dieser Erfahrung lag etwas vor, das einem wahren, geisterfüllten Denken gegenüber die Welt und den Menschen lichtvoll vor dessen eigene Seele stellen konnte. Etwas, aus dem der Geist wiedergefunden werden konnte, der in den traditionell bewahrten und geglaubten Bekenntnissen verlorengegangen war. Die Geist-Natur-Anschauung wollte ich aus der Naturerfahrung herausholen. Sprechen wollte ich von dem, was im «Diesseits» als das Geistig-Natürliche, als das wesenhaft Göttliche zu finden ist. Denn in den traditionell bewahrten Bekenntnissen war dies Göttliche zu einem «Jenseits» geworden, weil man den Geist des «Diesseits» nicht anerkannte und ihn daher von der wahrnehmbaren Welt absonderte. Er war zu etwas geworden, das für das menschliche Bewußtsein in ein immer stärkeres Dunkel untergetaucht war. Nicht die Ablehnung des Göttlich-Geistigen, sondern die Hereinstellung in die Welt, die Anrufung desselben im «Diesseits» lag in solchen Sätzen, wie dem in einem der Vorträge für die «Freie literarische Gesellschaft»: «Ich glaube, die Naturwissenschaft kann uns in schönerer Form, als die Menschen es je gehabt haben, das Bewußtsein der Freiheit wiedergeben. In unse-
rem Seelenleben wirken Gesetze, die ebenso natürlich sind wie diejenigen, welche die Himmelskörper um die Sonne treiben. Aber diese Gesetze stellen ein Etwas dar, das höher ist als alle übrige Natur. Dieses Etwas ist sonst nirgends vorhanden als im Menschen. Was aus diesem fließt, darinnen ist der Mensch frei. Er erhebt sich über die starre Notwendigkeit der unorganischen und organischen Gesetzmäßigkeit, gehorcht und folgt nur sich selbst.» (Die letzten Sätze sind erst hier unterstrichen, waren es noch nicht im «Magazin». Vgl. für diese Sätze das «Magazin» vom 12. Februar 1898.)
XXVI.
In Widerspruch mit den Darstellungen, die ich später vom Christentum gegeben habe, scheinen einzelne Behauptungen zu stehen, die ich damals niedergeschrieben und in Vorträgen ausgesprochen habe. Dabei kommt das Folgende in Betracht. Ich hatte, wenn ich in dieser Zeit das Wort «Christentum» schrieb, die Jenseitslehre im Sinne, die in den christlichen Bekenntnissen wirkte. Aller Inhalt des religiösen Erlebens verwies auf eine Geistwelt, die für den Menschen in der Entfaltung seiner Geisteskräfte nicht zu erreichen sein soll. Was Religion zu sagen habe, was sie als sittliche Gebote zu geben habe, stammt aus Offenbarungen, die von außen zum Menschen kommen. Dagegen wendete sich meine Geistanschauung, die die Geistwelt genau wie die sinnenfällige im Wahrnehrnbeten am Menschen und in der Natur erleben wollte. Dagegen wendete sich auch mein ethischer Individualismus, der das sittliche Leben nicht von außen durch Gebote gehalten, sondern aus der Entfaltung des seelisch-geistigen Menschenwesens, in dem das Göttliche lebt, hervorgehen lassen wollte.
Was damals im Anschauen des Christentums in meiner Seele vorging, war eine starke Prüfung für mich. Die Zeit von meinem Abschiede von der Weimarer Arbeit bis zu der Ausarbeitung meines Buches: «Das Christenturn als mystische Tatsache» ist von dieser Prüfung ausgefüllt. Solche Prüfungen sind die vom Schicksal (Karma) gegebenen Widerstände, die die geistige Entwickelung zu überwinden hat.
Ich sah in dem Denken, das aus der Naturerkenntnis
folgen kann - aber damals nicht folgte - die Grundlage, auf der die Menschen die Einsicht in die Geistwelt erlangen konnten. Ich betonte deshalb scharf die Erkenntnis der Naturgrundlage, die zur Geist-Erkenntnis führen muß. Für denjenigen, der nicht wie ich erlebend in der Geistwelt steht, bedeutet ein solches Sich-Versenken in eine Denkrichtung eine bloße Gedankenbetätigung. Für den, der die Geist-Welt erlebt, bedeutet sie etwas wesentlich anderes. Er wird in die Nähe von Wesen in der Geist-Welt gebracht, die eine solche Denkrichtung zur allein herrschenden machen wollen. Da ist Einseitigkeit in der Erkenntnis nicht bloß der Anlaß zu abstrakter Verirrung; da ist geist-lebendiger Verkehr mit Wesen, was in der Menschenwelt Irrtum ist. Von ahrimanischen Wesenheiten habe ich später gesprochen, wenn ich in diese Richtung weisen wollte. Für sie ist absolute Wahrheit, daß die Welt Maschine sein müsse. Sie leben in einer Welt, die an die sinnenfällige unmittelbar angrenzt.
Mit meinen eigenen Ideen bin ich keinen Augenblick dieser Welt verfallen. Auch nicht im Unbewußten. Denn ich wachte sorgfältig darüber, daß sich all mein Erkennen im besonnenen Bewußtsein vollzog. Um so bewußter war auch mein innerer Kampf gegen die dämonischen Mächte, die nicht aus der Naturerkenntnis Geist-Anschauung, sondern mechanistisch - materialistische Denkart werden lassen wollten.
Der nach geistiger Erkenntnis Suchende muß diese Welten erleben; bei ihm genügt nicht ein bloßes theoretisches Denken darüber. Ich mußte mir damals meine Geistanschauung in inneren Stürmen retten. Diese Stürme standen hinter meinem äußeren Erleben.
Ich konnte in dieser Prüfungszeit nur weiter kommen, wenn ich mit meiner Geist-Anschauung die Entwickelung des Christentums mir vor die Seele rückte. Das hat zu der Erkenntnis geführt, die in dem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache» zum Ausdrucke kam. Vorher deutete ich immer auf einen christlichen Inhalt, der in den vorhandenen Bekenntnissen lebte. Das tat ja auch Nietzsche.
An einer früheren Stelle dieses Lebensganges (S. 126 ff) schildere ich ein Gespräch über Christus, das ich mit dem gelehrten Cisterzienser und Professor an der katholisch-theologischen Fakultät in Wien gehabt habe. Skeptischer Stimmung stand ich gegenüber. Ich fand das Christentum, das ich suchen mußte, nirgends in den Bekenntnissen vorhanden. Ich mußte mich, nachdem die Prüfungszeit mich harten Seelenkämpfen ausgesetzt hatte, selber in das Christentum versenken, und zwar in der Welt, in der das Geistige darüber spricht.
An meiner Stellung zum Christentum wird voll anschaulich, wie ich in der Geisteswissenschaft gar nichts auf dem Wege gesucht und gefunden habe, den manche Menschen mir zuschreiben. Die stellen die Sache so hin, als ob ich aus alten Überlieferungen die Geist-Erkenntnis zusammengestellt hätte. Gnostische und andere Lehren hätte ich verarbeitet. Was im «Christentum als mystische Tatsache» an Geist-Erkenntnis gewonnen ist, das ist aus der Geistwelt selbst unmittelbar herausgeholt. Erst um Zuhörern beim Vortrag, Lesern des Buches den Einklang des geistig Erschauten mit den historischen Überlieferungen zu zeigen, nahm ich diese vor und fügte sie dem Inhalte ein. Aber nichts, was in diesen Dokumenten
steht, habe ich diesem Inhalte eingefügt, wenn ich es nicht erst im Geiste vor mir gehabt habe.
In der Zeit, in der ich die dem Wort-Inhalt nach Späterem so widersprechenden Aussprüche über das Christentum tat, war es auch, daß dessen wahrer Inhalt in mir begann keimhaft vor meiner Seele als innere Erkenntnis-Erscheinung sich zu entfalten. Um die Wende des Jahrhunderts wurde der Keim immer mehr entfaltet. Vor dieser Jahrhundertwende stand die geschilderte Prüfung der Seele. Auf das geistige Gestanden-Haben vor dem Mysterium von Golgatha in innerster ernstester Erkenntnis-Feier kam es bei meiner Seelen-Entwickelung an.
XXVII.
Mir schwebte damals vor, wie die Jahrhundertwende ein neues geistiges Licht der Menschheit bringen müsse. Es schien mir, daß die Abgeschlossenheit des menschlichen Denkens und Wollens vom Geiste einen Höhepunkt erreicht hätte. Ein Umschlagen des Werdeganges der Menschheitsentwickelung schien mir eine Notwendigkeit.
In diesem Sinne sprachen viele. Aber sie hatten nicht im Auge, daß der Mensch suchen werde, auf eine wirkliche Geistwelt seine Aufmerksamkeit zu richten, wie er sie durch die Sinne auf die Natur richtet. Sie vermeinten nur, daß die subjektive Geistesverfassung der Seelen einen Umschwung erfahren werde. Daß eine wirkliche neue, objektive Welt sich offenbaren könne, das zu denken, lag außerhalb des damaligen Gesichtskreises.
Mit den Empfindungen, die aus meiner Zukunftsperspektive und aus den Eindrücken der Umwelt sich ergaben, mußte ich immer wieder den Geistesblick in das Werden des neunzehnten Jahrhunderts zurückwenden.
Ich sah, wie mit der Goethe- und Hegel-Zeit alles verschwindet, was in die menschliche Denkungsart erkennend Vorstellungen von einer geistigen Welt aufnimmt. Das Erkennen sollte fortan durch Vorstellungen von der geistigen Welt nicht «verwirrt» werden. Diese Vorstellungen verwies man in das Gebiet des Glaubens und des «mystischen» Erlebens.
In Hegel erblickte ich den größten Denker der neuen Zeit. Aber er war eben nur Denker. Für ihn war die Geistwelt im Denken. Gerade, indem ich restlos bewunderte, wie er allem Denken Gestaltung gab, empfand ich
doch, daß er kein Gefühl für die Geistwelt hatte, die ich schaute, und die erst hinter dem Denken offenbar wird, wenn das Denken sich erkraftet zu einem Erleben, dessen Leib gewissermaßen Denken ist, und der als Seele in sich den Geist der Welt aufnimmt.
Weil im Hegeltum alles Geistige zum Denken geworden ist, stellte sich mir Hegel als die Persönlichkeit dar, die ein allerletztes Aufdämmern alten Geisteslichtes in eine Zeit brachte, in der sich für das Erkennen der Menschheit der Geist in Finsternis hüllte.
All dies stand so vor mir, ob ich in die geistige Welt schaute, oder ob ich in der physischen Welt auf das ablaufende Jahrhundert zurücksah. Aber nun trat eine Gestalt in diesem Jahrhundert auf, die ich nicht bis in die geistige Welt hinein verfolgen konnte: Max Stirner.
Hegel ganz Denkmensch, der in der inneren Entfaltung ein Denken anstrebte, das zugleich sich immer mehr vertiefte und im Vertiefen über größere Horizonte erweiterte. Dieses Denken sollte zuletzt im Vertiefen und Erweitern Eins werden mit dem Denken des Weltgeistes, das allen Welt-Inhalt einschließt. Und Stirner, alles, was der Mensch aus sich entfaltet, ganz aus dem individuell-persönlichen Willen holend. Was in der Menschheit entsteht, nur im Nebeneinander der einzelnen Persönlichkeiten.
Ich durfte gerade in jener Zeit nicht in Einseitigkeit verfallen. Wie ich im Hegeltum ganz darinnen stand, es in meiner Seele erlebend wie mein eigenes inneres Erleben, so mußte ich auch in diesen Gegensatz innerlich ganz untertauchen.
Gegenüber der Einseitigkeit, den Weltgeist bloß mit
Wissen auszustatten, mußte ja die andere auftreten, den einzelnen Menschen bloß als Willenswesen geltend zu machen.
Hätte nun die Sache so gelegen, daß diese Gegensätze nur in mir, als Seelenerlebnisse meiner Entwickelung aufgetreten wären, so hätte ich davon nichts einfließen lassen in meine Schriften oder Reden. Ich habe es mit solchen Seelenerlebnissen immer so gehalten. Aber dieser Gegensatz: Hegel und Stirner gehörten dem Jahrhundert an. Das Jahrhundert sprach sich durch sie aus. Und es ist ja so, daß Philosophen im wesentlichen nicht durch ihre Wirkung auf ihre Zeit in Betracht kommen.
Man kann zwar gerade bei Hegel von starken Wirkungen sprechen. Aber das ist nicht die Hauptsache. Philosophen zeigen durch den Inhalt ihrer Gedanken den Geist ihres Zeitalters an, wie das Thermometer die Wärme eines Ortes anzeigt. In den Philosophen wird bewußt, was unterbewußt in dem Zeitalter lebt.
Und so lebt das neunzehnte Jahrhundert in seinen Extremen durch die Impulse, die durch Hegel und Stirner sich ausdrücken: unpersönliches Denken, das am liebsten in einer Weltbetrachtung sich ergeht, an der der Mensch mit den schaffenden Kräften seines Innern keinen Anteil hat; ganz persönliches Wollen, das für harmonisches Zusammenwirken der Menschen wenig Sinn hat. Zwar treten alle möglichen «Gesellschafts-Ideale» auf; aber sie haben keine Kraft, die Wirklichkeit zu beeinflussen. Diese gestaltet sich immer mehr zu dem, was entstehen kann, wenn die Willen Einzelner nebeneinander wirken.
Hegel will, daß im Zusammenleben der Menschen der Gedanke des Sittlichen objektive Gestalt annimmt;
Stirner fühlt den «Einzelnen» (Einzigen) beirrt durch alles, was so dem Leben der Menschen harmonisierte Gestalt geben kann.
Bei mir verband sich mit der Betrachtung Stirners damals eine Freundschaft, die bestimmend auf so manches in dieser Betrachtung wirkte. Es ist die Freundschaft zu dem bedeutenden Stirner-Kenner und -Herausgeber J. H. Mackay. Es war noch in Weimar, da brachte mich Gabriele Reuter mit dieser mir sogleich durch und durch sympathischen Persönlichkeit zusammen. Er hatte sich in meiner «Philosophie der Freiheit» mit den Abschnitten befaßt, die vom ethischen Individualismus sprechen. Er fand eine Harmonie zwischen meinen Ausführungen und seinen eigenen sozialen Anschauungen.
Mir war zunächst der persönliche Eindruck, den ich von J. H. Mackay hatte, das meine Seele ihm gegenüber Erfüllende. Er trug «Welt» in sich. In seiner ganzen äußern und innern Haltung sprach Welterfahrung. Er hatte Zeiten in England, in Amerika zugebracht. Das alles war in eine grenzenlose Liebenswürdigkeit getaucht. Ich faßte eine große Liebe zu dem Manne.
Als dann 1898 J. H. Mackay in Berlin zu dauerndem Aufenthalte erschien, entwickelte sich eine schöne Freundschaft zwischen uns. Leider ist auch diese durch das Leben und namentlich durch mein öffentliches Vertreten der Anthroposophie zerstört worden.
Ich darf in diesem Falle nur ganz subjektiv schildern, wie mir J. H. Mackays Werk damals erschien und heute noch immer erscheint, und wie es damals in mir gewirkt hat. Denn ich weiß, daß er sich selbst darüber ganz anders aussprechen würde.
Tief verhaßt war diesem Manne im sozialen Leben der Menschen alles, was Gewalt (Archie) ist. Die größte Verfehlung sah er in dem Eingreifen der Gewalt in die soziale Verwaltung. In dem «kommunistischen Anarchismus» sah er eine soziale Idee, die im höchsten Grade verwerflich ist, weil sie bessere Menschheitszustände mit Anwendung von Gewaltmitteln herbeiführen wollte.
Nun war das Bedenkliche, daß J. H. Mackay diese Idee und die auf sie gegründete Agitation bekämpfte, indem er für seine eigenen sozialen Gedanken denselben Namen wählte, den die Gegner hatten, nur mit einem andern Eigenschaftswort davor. «Individualistischer Anarchismus» nannte er, was er selber vertrat, und zwar als Gegenteil dessen, was man damals Anarchismus nannte. Das gab natürlich dazu Anlaß, daß in der Öffentlichkeit nur schiefe Urteile über Mackays Ideen sich bilden konnten. Er stand im Einklange mit dem Amerikaner B. Tucker, der die gleiche Ansicht vertrat. Tucker besuchte Mackay in Berlin, wobei ich ihn kennen lernte.
Mackay ist zugleich Dichter seiner Lebensauffassung. Er schrieb einen Roman: «Die Anarchisten». Ich las ihn, nachdem ich den Verfasser kennen gelernt hatte. Es ist dies ein edles Werk des Vertrauens in den einzelnen Menschen. Es schildert eindringlich und mit großer Anschaulichkeit die sozialen Zustände der Ärmsten der Armen. Es schildert aber auch, wie aus dem Weltelend heraus die Menschen den Weg zur Besserung finden werden, die ganz den guten Kräften der Menschennatur hingegeben, diese so zur Entfaltung bringen, daß sie im freien Zusammensein der Menschen sozial, ohne Gewalt notwendig zu machen, wirken. Mackay hatte das edle Vertrauen in die
Menschen, daß sie durch sich selbst eine harmonische Lebensordnung schaffen können. Allerdings hielt er dafür, daß dies erst nach langer Zeit möglich sein werde, wenn auf geistigem Wege im Innern der Menschen sich der entsprechende Umschwung vollzogen haben werde. Deshalb forderte er für die Gegenwart von dem Einzelnen, der weit genug dazu ist, die Verbreitung der Gedanken von diesem geistigen Wege. Eine soziale Idee also, die nur mit geistigen Mitteln arbeiten wollte.
J. H. Mackay gab seiner Lebensansicht auch in Gedichten Ausdruck. Freunde sahen darinnen etwas Lehrhaftes und Theoretisches, das unkünstlerisch sei. Ich hatte diese Gedichte sehr lieb.
Das Schicksal hatte nun mein Erlebnis mit J. H. Mackay und mit Stirner so gewendet, daß ich auch da untertauchen mußte in eine Gedankenwelt, die mir zur geistigen Prüfung wurde. Mein ethischer Individualismus war als reines Innen-Erlebnis des Menschen empfunden. Mir lag ganz fern, als ich ihn ausbildete, ihn zur Grundlage einer politischen Anschauung zu machen. Damals nun, um 1898 herum, sollte meine Seele mit dem rein ethischen Individualismus in eine Art Abgrund gerissen werden. Er sollte aus einem rein-menschlich Innerlichen zu etwas Äußerlichem gemacht werden. Das Esoterische sollte ins Exoterische abgelenkt werden.
Als ich dann, im Beginne des neuen Jahrhunderts, in Schriften wie «Die Mystik im Aufgange» und das «Christentum als mystische Tatsache» mein Erleben des Geistigen geben konnte, stand, nach der Prüfung, der «ethische Individualismus» wieder an seinem richtigen Orte. Doch verlief auch da die Prüfung so, daß im Voll-
bewußtsein die Veräußerlichung keine Rolle spielte. Sie lief unmittelbar unter diesem Vollbewußtsein ab, und konnte ja gerade wegen dieser Nähe in die Ausdrucksformen einfließen, in denen ich in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts von sozialen Dingen sprach. Doch muß man auch da gewissen, allzu radikal erscheinenden Ausführungen andere gegenüberstellen, um ein rechtes Bild zu erhalten.
Der in die Geistwelt Schauende findet sein eigenes Wesen immer veräußerlicht, wenn er Meinungen, Ansichten aussprechen soll. Er tritt in die Geistwelt nicht in Abstraktionen, sondern in lebendigen Anschauungen. Auch die Natur, die ja das sinnenfällige Abbild des Geistigen ist, stellt nicht Meinungen, Ansichten auf, sondern sie stellt ihre Gestalten und ihr Werden vor die Welt hin.
Ein inneres Bewegtsein, das alle meine Seelenkräfte in Wogen und Wellen brachte, war damals mein inneres Erlebnis.
Mein äußeres Privatleben wurde mir dadurch zu einem äußerst befriedigenden gemacht, daß die Familie Eunike nach Berlin gezogen ist, und ich bei ihr unter bester Pflege wohnen konnte, nachdem ich kurze Zeit das ganze Elend des Wohnens in einer eigenen Wohnung durchgemacht hatte. Die Freundschaft zu Frau Eunike wurde bald darauf in eine bürgerliche Ehe umgewandelt. Nur dieses sei über diese Privatverhältnisse gesagt. Ich will von dem Privatleben in diesem «Lebensgange» nirgends etwas anderes erwähnen, als was in meinen Werdegang hineinspielt Und das Leben im Eunike'schen Hause gab mir damals die Möglichkeit, eine ungestörte Grundlage für ein innerlich und äußerlich bewegtes Leben zu
haben. Im übrigen gehören Privatverhältnisse nicht in die Öffentlichkeit. Sie gehen sie nichts an.
Und mein geistiger Werdegang ist ja ganz und gar unabhängig von allen Privatverhältnissen. Ich habe das Bewußtsein, er wäre der ganz gleiche gewesen bei ganz anderer Gestaltung meines Privatlebens.
In alle Bewegtheit des damaligen Lebens fiel nun die fortwährende Sorge um die Existenzmöglichkeit des «Magazins» hinein. Trotz all der Schwierigkeiten, die ich hatte, wäre die Wochenschrift zur Verbreitung zu bringen gewesen, wenn mir materielle Mittel zur Verfügung gestanden hätten. Aber eine Zeitschrift, die nur äußerst mäßige Honorare zahlen kann, die mir selbst fast gar keine materielle Lebensgrundlage gab, für die gar nichts getan werden konnte, um sie bekannt zu machen: die konnte bei dem geringen Maße von Verbreitung, mit dem ich sie übernommen hatte, nicht gedeihen.
Ich gab das «Magazin» heraus, indem es für mich eine ständige Sorge war.

XXVIII.
In dieser für mich schweren Zeit trat nun der Vorstand der Berliner Arbeiterbildungsschule an mich heran mit dem Ersuchen, ich solle in dieser Schule den Unterricht in Geschichte und «Rede»übungen übernehmen. Mich interessierte zunächst der sozialistische Zusammenhang, in dem die Schule stand, wenig. Ich sah die schöne Aufgabe vor mir, gereifte Männer und Frauen aus dem Arbeiterstande zu belehren. Denn junge Leute waren wenige unter den «Schülern». Ich erklärte dem Vorstande, wenn ich den Unterricht übernähme, so würde ich ganz nach meiner Meinung von dem Entwickelungsgange der Menschheit Geschichte vortragen, nicht in dem Stil, wie das nach dem Marxismus jetzt in sozialdemokratischen Kreisen üblich sei. Man blieb dabei, meinen Unterricht zu wünschen.
Nachdem ich diesen Vorbehalt gemacht hatte, konnte es mich nicht mehr berühren, daß die Schule eine sozialdemokratische Gründung des alten Liebknecht (des Vaters) war. Für mich bestand die Schule aus Männern und Frauen aus dem Proletariat; mit der Tatsache, daß weitaus die meisten Sozialdemokraten waren, hatte ich nichts zu tun.
Aber ich hatte selbstverständlich mit der Geistesart der «Schüler» zu tun. Ich mußte in Ausdrucksformen sprechen, die mir bis dahin ganz ungewohnt waren. In die Begriffs- und Urteilsformen dieser Leute mußte ich mich hineinfinden, um einigermaßen verstanden zu werden.
Von zwei Seiten her kamen diese Begriffs- und Urteilsformen. Zunächst aus dem Leben. Die materielle Arbeit
und deren Ergebnisse kannten diese Leute. Die die Menschheit in der Geschichte vorwärts geleitenden geistigen Mächte traten nicht vor ihre Seele. Deshalb hatte der Marxismus mit der «materialistischen Geschichtsauffassung» so leichtes Spiel. Er behauptete, die treibenden Kräfte im geschichtlichen Werden seien nur die wirtschaftlich-materiellen, die in materieller Arbeit erzeugten. Die «geistigen Faktoren» seien bloß eine Art Nebenprodukt, das aus dem Materiell-Wirtschaftlichen auf-steigt: sie seien eine bloße Ideologie.
Dazu kam, daß sich damals in der Arbeiterschaft ein Eifer nach wissenschaftlicher Bildung seit lange entwikkelt hatte. Aber der konnte nur in der populären materialistisch-wissenschaftlichen Literatur befriedigt werden. Denn nur diese Literatur traf eben auf die Begriffs- und Urteilsformen der Arbeiter auf. Was nicht materialistisch war, war so geschrieben, daß ein Verständnis für den Arbeiter unmöglich war. So kam die unsäglich tragische Tatsache, daß, als das werdende Proletariat mit höchster Sehnsucht nach Erkenntnis begehrte, ihm diese nur mit dem gröbsten Materialismus befriedigt wurde.
Man muß bedenken, daß in dem wirtschaftlichen Materialismus, den die Arbeiter durch den Marxismus als «materialistische Geschichte» in sich aufnehmen, Teilwahrheiten stecken. Und daß diese Teilwahrheiten gerade das sind, was sie leicht verstehen. Hätte ich daher mit völligem Außerachtlassen dieser Teilwahrheiten idealistische Geschichte gelehrt, man hätte in den materialistischen Teilwahrheiten ganz unwillkürlich das empfunden, was von meinem Vortrage zurückstieß.
Ich ging deshalb von einer auch für meine Zuhörer
zu begreifenden Wahrheit aus. Ich zeigte, wie bis zum sechzehnten Jahrhundert von einer Herrschaft der wirtschaftlichen Kräfte, so wie dies Marx tut, zu sprechen, ein Unding sei. Wie vom sechzehnten Jahrhundert an die Wirtschaft erst in Verhältnisse einrückt, die man marxistisch fassen kann; wie dieser Vorgang dann im neunzehnten Jahrhundert seinen Höhepunkt erlangt.
So war es möglich, für die vorangehenden Zeitalter der Geschichte die ideell-geistigen Impulse ganz sachgemäß zu besprechen und zu zeigen, wie diese in der neuesten Zeit schwach geworden sind gegenüber den materiell-wirtschaftlichen.
Die Arbeiter bekamen auf diese Art Vorstellungen von den Erkenntnisfähigkeiten, den religiösen, den künstlerischen, den sittlichen Triebkräften in der Geschichte und kamen davon ab, diese nur als «Ideologie» anzusehen. Dabei polemisch gegen den Materialismus zu werden, hätte gar keinen Sinn gehabt; ich mußte aus dem Materialismus heraus den Idealismus erstehen lassen.
In den «Redeübungen» konnte allerdings nur wenig nach der gleichen Richtung getan werden. Nachdem ich immer im Beginne eines Kurses die formalen Regeln des Vortragens und Redens erörtert hatte, sprachen die «Schüler» in Übungsreden. Sie brachten da selbstverständlich das vor, was ihnen nach ihrer materialistischen Art geläufig war.
Die «Führer» der Arbeiterschaft bekümmerten sich zunächst gar nicht um die Schule. Und so hatte ich völlig freie Hand.
Schwieriger wurde für mich die Sache, als zu dem geschichtlichen Unterricht der naturwissenschaftliche hin-
zuwuchs. Da war es besonders schwer, von den in der Wissenschaft, namentlich bei deren Popularisatoren, herrschenden materialistischen Vorstellungen zu sachgemäßen aufzusteigen. Ich tat es, so gut es nur irgend ging.
Nun dehnte sich aber gerade durch die Naturwissenschaft meine Unterrichtstätigkeit innerhalb der Arbeiterschaft aus. Ich wurde von zahlreichen Gewerkschaften aufgefordert, naturwissenschaftliche Vorträge zu halten. Insbesondere wünschte man Belehrung über das damals Aufsehen machende Buch Haeckels: «Welträtsel». Ich sah in dem positiv biologischen Drittel dieses Buches eine präzis-kurze Zusammenfassung der Verwandtschaft der Lebewesen. Was im allgemeinen meine Überzeugung war, daß die Menschheit von dieser Seite zur Geistigkeit geführt werden könne, das hielt ich auch für die Arbeiterschaft richtig. Ich knüpfte meine Betrachtungen an dieses Drittel des Buches an und sagte oft genug, daß man die zwei andern Drittel für wertlos halten muß und eigentlich von dem Buche wegschneiden und vernichten solle.
Als das Gutenberg-Jubiläum gefeiert wurde, übertrug man mir die Festrede vor 7000 Setzern und Druckern in einem Berliner Zirkus. Meine Art, zu den Arbeitern zu sprechen, wurde also sympathisch empfunden.
Das Schicksal hatte mich mit dieser Tätigkeit wieder in ein Stück Leben versetzt, in das ich unterzutauchen hatte. Wie die Einzelseele innerhalb dieser Arbeiterschaft schlummerte und träumte, und wie eine Art Massenseele diese Menschheit ergriff, die Vorstellung, Urteil, Haltung umschlang, das stellte sich vor mich hin.
Man darf sich aber nicht vorstellen, daß die Einzel-
seelen erstorben gewesen wären. Ich habe nach dieser Richtung tiefe Blicke in die Seelen meiner Schüler und überhaupt der Arbeiterschaft tun können. Das trug mich in der Aufgabe, die ich mir bei dieser ganzen Tätigkeit stellte. Die Stellung zum Marxismus war damals bei den Arbeitern noch nicht so, wie zwei Jahrzehnte später. Damals war ihnen der Marxismus etwas, das sie wie ein ökonomisches Evangelium mit voller Überlegung verarbeiteten. Später ist er etwas geworden, wovon die proletarische Masse wie besessen ist.
Das Proletarierbewußtsein bestand damals in Empfindungen, die wie Wirkung von Massensuggestionen sich ausnahmen. Viele der Einzelseelen sagten immer wieder: es muß eine Zeit kommen, in der die Welt wieder geistige Interessen entwickelt; aber zunächst muß das Proletariat rein wirtschaftlich erlöst werden.
Ich fand, daß meine Vorträge in den Seelen manches Gute wirkten. Es wurde aufgenommen, auch was dem Materialismus und der marxistischen Geschichtsauffassung widersprach. Als später die «Führer» von meiner Art Wirken erfuhren, da wurde es von ihnen angefochten. In einer Versammlung meiner Schüler sprach einer dieser «kleinen Führer». Er sagte das Wort: «Wir wollen nicht Freiheit in der proletarischen Bewegung; wir wollen vernünftigen Zwang.» Es ging das darauf hinaus, mich gegen den Willen meiner Schüler aus der Schule hinauszutreiben. Mir wurde die Tätigkeit allmählich so erschwert, daß ich sie bald, nachdem ich anthroposophisch zu wirken begonnen hatte, fallen ließ.
Ich habe den Eindruck, wenn damals von Seite einer größeren Anzahl unbefangener Menschen die Arbeiter-
bewegung mit Interesse verfolgt und das Proletariat mit Verständnis behandelt worden wäre, so hätte sich diese Bewegung ganz anders entfaltet. Aber man überließ die Leute dem Leben innerhalb ihrer Klasse, und lebte selbst innerhalb der seinigen. Es waren bloß theoretische Ansichten, die die eine Klasse der Menschen von der andern hatte. Man verhandelte in Lohnfragen, wenn Streiks u. dgl. dazu nötigten; man gründete allerlei Wohlfahrtseinrichtungen. Das letztere war außerordentlich anerkennenswert.
Aber alles Tauchen dieser weltbewegenden Fragen in eine geistige Sphäre fehlte. Und doch hätte nur ein solches der Bewegung ihre zerstörenden Kräfte nehmen können. Es war die Zeit, in der die «höheren Klassen» das Gemeinschaftsgefühl verloren, in der der Egoismus mit dem wilden Konkurrenzkampf sich ausbreitete. Die Zeit, in der sich die Weltkatastrophe des zweiten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts schon vorbereitete. Daneben entwickelte das Proletariat auf seine Art das Gemeinschaftsgefühl als proletarisches Klassenbewußtsein. Es nahm an der «Kultur», die sich in den «oberen Klassen» gebildet hatte, nur insoferne teil, als diese Material lieferten zur Rechtfertigung des proletarischen Klassenbewußtseins. Es fehlte allmählich jede Brücke zwischen den verschiedenen Klassen.
So stand ich durch das «Magazin» in der Notwendigkeit, in das bürgerliche Wesen unterzutauchen, durch meine Tätigkeit in der Arbeiterschaft in das proletarische. Ein reiches Feld, um die treibenden Kräfte der Zeit erkennend mitzuerleben.
XXIX.
Auf geistigem Gebiete wollte in die Erkenntniserrungenschaften des letzten Drittels des Jahrhunderts ein neues Licht in das Werden der Menschheit hereinbrechen. Aber der geistige Schlaf, in den die materialistische Ausdeutung dieser Errungenschaften versetzte, verhinderte, dieses auch nur zu ahnen, geschweige denn zu bemerken.
So kam die Zeit herauf, die sich in geistiger Richtung durch ihr eigenes Wesen hätte entwickeln müssen, die aber ihr eigenes Wesen verleugnete. Die Zeit, die die Unmöglichkeit des Lebens zu verwirklichen begann.
Einige Sätze aus Ausführungen möchte ich hierhersetzen, die ich im März 1898 in den «Dramaturgischen Blättern» (die seit Beginn 1898 dem «Magazin» als Beiblatt angeschlossen waren) schrieb. Von der «Vortragskunst» sage ich: «Mehr als auf irgend einem andern Gebiete ist auf diesem der Lernende ganz sich selber und dem Zufall überlassen ... Bei der Gestalt, welche unser öffentliches Leben angenommen hat, kommt gegenwärtig fast jeder in die Lage, öfter öffentlich sprechen zu müssen... Die Erhebung der gewöhnlichen Rede zum Kunstwerk ist eine Seltenheit... Es fehlt uns fast ganz das Gefühl für die Schönheit des Sprechens und noch mehr für charakteristisches Sprechen... Niemandem wird man das Recht zugestehen, über einen Sänger zu schreiben, der keine Kenntnis des richtigen Singens hat... In bezug auf die Schauspielkunst stellt man weit geringere Anforderungen... Die Leute, die verstehen, ob ein Vers richtig gesprochen wird oder nicht, werden immer seltener... Man hält künstlerisches Sprechen heute
vielfach für verfehlten Idealismus... Dazu hätte man nie kommen können, wenn man sich der künstlerischen Ausbildungsfähigkeit der Sprache besser bewußt wäre...»
Was mir da vorschwebte, konnte erst viel später in der Anthroposophischen Gesellschaft eine Art Verwirklichung finden. Marie v. Sivers (Marie Steiner), die für Sprachkunst Begeisterte, widmete sich zunächst selbst einem echt künstlerischen Sprechen; und mit ihrer Hilfe wurde es dann möglich, in Kursen für Sprachgestaltung und dramatische Darstellung für Erhebung dieses Gebietes zur wahren Kunst zu wirken.
Ich durfte dieses hier anführen, um zu zeigen, wie gewisse Ideale sich durch mein ganzes Leben hindurch ihre Entfaltung suchen, weil doch viele Menschen in meiner Entwickelung Widersprechendes finden wollen.
In diese Zeit fällt meine Freundschaft mit dem jung verstorbenen Dichter Ludwig Jacobowski. Er war eine Persönlichkeit, deren seelische Grundstimmung in innerer Tragik atmete. Er trug schwer an dem Schicksal, daß er Jude war. Er stand einem Bureau vor, das, unter der Direktion eines freisinnigen Abgeordneten, den Verein zur «Abwehr des Antisemitismus» leitete und dessen Zeitschrift herausgab. Eine Überlast von Arbeit lag auf Ludwig Jacobowski nach dieser Richtung. Und eine Arbeit, die täglich einen brennenden Schmerz erneuerte. Denn sie stellte täglich vor seine Seele die Vorstellung von der Stimmung gegen sein Volk, an der er doch so sehr litt.
Daneben entfaltete er eine reiche Tätigkeit auf dem Gebiete der Volkskunde. Er sammelte alles, dessen er habhaft werden konnte, als Grundlage für ein Werk über das
Werden der Volkstümer seit Urzeiten. Einzelne Aufsätze, die er aus seinem reichen Wissen auf diesem Gebiete schrieb, sind sehr interessant. Sie sind zunächst im materialistischen Sinne der Zeit geschrieben; aber Jacobowski wäre, hätte er länger gelebt, sicher einer Vergeistigung seines Forschens zugänglich gewesen.
Aus diesen Betätigungen strahlt heraus Ludwig Jacobowskis Dichtung. Nicht ganz ursprünglich; aber doch von tief menschlicher Empfindung und voll eines seelenkräftigen Erlebens. «Leuchtende Tage» nannte er seine lyrischen Dichtungen. Sie waren, wenn die Stimmung sie ihm schenkte, in seiner Lebenstragik wirklich das, was wie geistige Sonnentage für ihn wirkte. Daneben schrieb er Romane. In «Werther der Jude» lebt alle innere Tragik Ludwig Jacobowskis. In «Loki, Roman eines Gottes» schuf er ein Werk, das aus deutscher Mythologie heraus geboren ist. Das Seelenvolle, das aus diesem Roman spricht, ist ein schöner Abglanz von des Dichters Liebe zum Mythologischen im Volkstum.
Überschaut man, was Ludwig Jacobowski leistete, so ist man erstaunt über die Fülle auf den verschiedensten Gebieten. Trotzdem pflegte er Verkehr mit vielen Menschen und fühlte sich wohl im geselligen Leben. Dazu gab er damals noch die Monatsschrift «Die Gesellschaft» heraus, die eine ungeheure Überbürdung für ihn bedeutete.
Er verzehrte sich am Leben, nach dessen Inhalt er sehnsüchtig begehrte, um künstlerisch dessen Gestaltung zu bewirken.
Er gründete eine Gesellschaft «Die Kommenden», die aus Literaten, Künstlern, Wissenschaftern und künst-
lerisch interessierten Persönlichkeiten bestand. Da versammelte man sich jede Woche einmal. Dichter brachten ihre Dichtungen vor. Vorträge über die mannigfaltigsten Gebiete des Erkennens und Lebens wurden gehalten. Ein zwangloses Zusammensein schloß den Abend. Ludwig Jacobowski war der Mittelpunkt des sich immer mehr vergrößernden Kreises. Jeder liebte die liebenswürdige, ideenerfüllte Persönlichkeit, die in dieser Gemeinschaft sogar feinen, edlen Humor entfaltete.
Aus all dem riß ein jäher Tod den erst Dreißigjährigen. An einer Hirnhautentzündung, der Folge seiner unausgesetzten Anstrengungen, ging er zugrunde.
Mir blieb nur die Aufgabe, für den Freund die Begräbnisrede zu halten und seinen Nachlaß zu redigieren.
Ein schönes Denkmal in einem Buche mit Beiträgen seiner Freunde setzte ihm die Dichterin Marie Stona, mit der er befreundet war.
Alles an Ludwig Jacobowski war liebewert; seine innere Tragik, sein Herausstreben aus dieser zu seinen «leuchtenden Tagen», seine Hingabe an das bewegte Leben. Ich habe das Andenken an unsere Freundschaft stets lebendig im Herzen bewahrt und sehe auf die kurze Zeit unseres Zusammenlebens mit inniger Hingabe an den Freund zurück.
Eine andere freundschaftliche Beziehung entstand dazumal zu Martha Asmus; eine philosophisch denkende aber stark zum Materialismus neigende Dame. Diese Neigung wurde allerdings dadurch gemildert, daß Martha Asmus intensiv in den Erinnerungen an ihren früh verstorbenen Bruder Paul Asmus lebte, der ein entschiedener Idealist war.
Paul Asmus erlebt wie ein philosophischer Eremit den philosophischen Idealismus der Hegelzeit noch einmal im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts. Er schreibt eine Schrift über das «Ich» und eine solche über die indogermanischen Religionen. Beide in der Form des Hegelstiles, aber im Inhalte durchaus selbständig.
Diese interessante Persönlichkeit, die damals schon lange nicht mehr lebte, wurde mir durch die Schwester Martha Asmus recht nahe gebracht. Wie ein neues meteorartiges Aufblitzen der geistgeneigten Philosophie des Jahrhundertbeginnes gegen das Jahrhundertende erschien sie mir.
Weniger enge, aber immerhin eine Zeitlang bedeutsame Beziehungen bildeten sich zu den «Friedrichhagenern» heraus, zu Bruno Wille und Wilhelm Bölsche. Bruno Wille ist ja der Verfasser einer Schrift über «Philosophie der Befreiung durch das reine Mittel.» Nur der Titel hat den Anklang an meine «Philosophie der Freiheit». Der Inhalt bewegt sich auf einem ganz anderen Gebiete. In weitesten Kreisen bekannt wurde Bruno Wille durch seine sehr bedeutenden «Offenbarungen des Wachholderbaumes». Ein Weltanschauungsbuch aus dem schönsten Natursinn heraus geschrieben, durchdrungen von der Überzeugung, daß Geist aus allem materiellen Dasein spricht. Wilhelm Bölsche ist ja bekannt durch zahlreiche populär-naturwissenschaftliche Schriften, die in weitesten Kreisen ganz außerordentlich beliebt sind.
Von dieser Seite ging die Begründung einer «Freien Hochschule» aus, zu der ich zugezogen wurde. Es wurde mir der Unterricht in der Geschichte zugeteilt. Bruno Wille besorgte das Philosophische, Bölsche das Natur-
wissenschaftliche, Theodor Kappstein, ein freigeistig gesinnter Theologe, die Erkenntnis des Religiösen.
Eine zweite Begründung war der «Giordano-Bruno-Bund». Es sollten sich in demselben solche Persönlichkeiten zusammenfinden, die einer geistig-monistischen Weltanschauung sympathisch gegenüberstanden. Es kam dabei auf die Betonung dessen an, daß es nicht zwei Weltprinzipien, Stoff und Geist gebe, sondern daß der Geist als Einheitsprinzip alles Sein bilde. Bruno Wille leitete diesen Bund mit einem sehr geistvollen Vortrage ein, dem er das Goethe'sche Wort zugrunde legte: «Materie nie ohne Geist». Leider ergab sich zwischen Wille und mir nach diesem Vortrage ein kleines Mißverständnis. Meine an den Vortrag angeschlossenen Worte, daß Goethe, lange nachdem er dies schöne Wort geprägt hatte, es in gewichtiger Weise dadurch ergänzt habe, daß er in der wirksamen Geisttätigkeit des Daseins Polarität und Steigerung als die konkreten Geistgestaltungen gesehen habe, und daß dadurch das allgemeine Wort erst vollen Inhalt bekomme, wurde wie ein Einwand gegen Willes Vortrag genommen, den ich doch voll in seiner Bedeutung anerkannte.
Aber vollends in einen Gegensatz zu der Leitung des Giordano-Bruno-Bundes kam ich, als ich einen Vortrag über den Monismus selbst hielt. Ich betonte in demselben, daß die schroffe dualistische Fassung «Stoff und Geist» eigentlich eine Schöpfung der neuesten Zeit ist. Daß auch Geist und Natur in den Gegensatz, den der Giordano-Bruno-Bund bekämpfen will, erst in den allerletzten Jahrhunderten zu einander gebracht worden sind. Dann machte ich darauf aufmerksam, wie diesem Dualismus
gegenüber die Scholastik Monismus sei. Wenn sie auch einen Teil des Seins der menschlichen Erkenntnis entzogen und dem «Glauben» zuerteilt habe, so stelle die Scholastik doch ein Weltsystem dar, das von der Gottheit, der Geistwelt bis in die Einzelheiten der Natur hinein eine einheitliche (monistische) Konstitution zeige. Damit stellte ich auch die Scholastik höher als den Kantianismus.
Mit diesem Vortrage entfesselte ich die größte Aufregung. Man dachte, ich wolle dem Katholizismus in den Bund hinein die Wege öffnen. Nur Wolfgang Kirchbach und Martha Asmus standen von den leitenden Persönlichkeiten auf meiner Seite. Die andern konnten sich keine Vorstellung davon machen, was ich mit der «verkannten Scholastik» eigentlich wolle. Jedenfalls waren sie davon überzeugt, daß ich geeignet sei, in den Giordano-Bruno-Bund die größte Verwirrung hineinzubringen.
Ich muß dieses Vortrages gedenken, weil er in die Zeit fällt, in der später Viele mich als Materialisten sehen. Dieser «Materialist» galt damals zahlreichen Personen als der, der die mittelalterliche Scholastik neuerdings heraufbeschwören möchte.
Trotz alledem konnte ich später im Giordano-Bruno-Bund meinen grundlegenden anthroposophischen Vortrag halten, der der Ausgangspunkt meiner anthroposophischen Tätigkeit geworden ist.
Mit dem öffentlichen Mitteilen dessen, was Anthroposophie als Wissen von der geistigen Welt enthält, sind Entschlüsse notwendig, die nicht ganz leicht werden.
Es werden sich diese Entschlüsse am besten charakterisieren lassen, wenn man auf einiges Historische blickt.
Entsprechend den ganz anders gearteten Seelenverfassungen einer älteren Menschheit hat es ein Wissen von der geistigen Welt immer, bis zum Beginne der neueren Zeit, etwa bis zum vierzehnten Jahrhundert, gegeben. Es war nur eben ganz anders als das den Erkenntnisbedingungen der Gegenwart angemessene Anthroposophische.
Von dem genannten Zeitpunkte an konnte die Menschheit zunächst keine Geist-Erkenntnis hervorbringen. Sie bewahrte das «alte Wissen», das die Seelen in bildhafter Form geschaut haben, und das auch nur in symbolischbildlicher Form vorhanden war.
Dieses «alte Wissen» wurde in alten Zeiten nur innerhalb der «Mysterien» gepflegt. Es wurde denen mitgeteilt, die man erst reif dazu gemacht hatte, den «Eingeweihten». Es sollte nicht an die Öffentlichkeit gelangen, weil da die Tendenz zu leicht vorhanden ist, es unwürdig zu behandeln. Diese Gepflogenheit haben nun diejenigen spätern Persönlichkeiten beibehalten, die Kunde von dem «alten Wissen» erlangten und es weiterpflegten. Sie taten es in engsten Kreisen mit Menschen, die sie dazu vorbereiteten.
Und so blieb es bis in die Gegenwart.
Von den Persönlichkeiten, die mir mit einer solchen Forderung bezüglich der Geist-Erkenntnis entgegentraten, will ich eine nennen, die innerhalb des Wiener Kreises der Frau Lang, den ich gekennzeichnet habe, sich bewegte, die ich aber auch in andern Kreisen, in denen ich in Wien verkehrte, traf. Es ist Friedrich Eckstein, der ausgezeichnete Kenner jenes «alten Wissens». Friedrich Eckstein hat, solange ich mit ihm verkehrte, nicht viel geschrieben. Was er aber schrieb, war voll Geist. Aber
niemand ahnt aus seinen Ausführungen zunächst den intimen Kenner alter Geist-Erkenntnis. Die wirkt im Hintergrunde seines geistigen Arbeitens. Eine sehr bedeutende Abhandlung habe ich, lange nachdem das Leben auch von diesem Freunde mich entfernt hatte, in einer Schriftensammlung gelesen über die böhmischen Brüder.
Friedrich Eckstein vertrat nun energisch die Meinung, man dürfe die esoterische Geist-Erkenntnis nicht wie das gewöhnliche Wissen öffentlich verbreiten. Er stand mit dieser Meinung nicht allein; sie war und ist die fast aller Kenner der «alten Weisheit». Inwiefern in der von H. P. Blavatsky begründeten «Theosophischen Gesellschaft» die als Regel von den Bewahrern «alter Weisheit» streng geltend gemachte Meinung durchbrochen wurde, davon werde ich später zu sprechen haben.
Friedrich Eckstein wollte, daß man als «Eingeweihter in altes Wissen» das, was man öffentlich vertritt, einkleidet mit der Kraft, die aus dieser «Einweihung» kommt, daß man aber dieses Exoterische streng scheide von dem Esoterischen, das im engsten Kreise bleiben solle, der es voll zu würdigen versteht.
Ich mußte mich, sollte ich eine öffentliche Tätigkeit für Geist-Erkenntnis entfalten, entschließen, mit dieser Tradition zu brechen. Ich sah mich vor die Bedingungen des geistigen Lebens der Gegenwart gestellt. Denen gegenüber sind Geheimhaltungen, wie sie in älteren Zeiten selbstverständlich waren, eine Unmöglichkeit. Wir leben in der Zeit, die Öffentlichkeit will, wo irgend ein Wissen auftritt. Und die Anschauung von der Geheimhaltung ist ein Anachronismus. Einzig und allein möglich ist, daß
man Persönlichkeiten stufenweise mit der Geist-Erkenntnis bekannt macht und niemand zuläßt zu einer Stufe, auf der die höhern Teile des Wissens mitgeteilt werden, wenn er die niedrigeren noch nicht kennt. Das entspricht ja auch den Einrichtungen der niedern und höhern Schulen.
Ich hatte auch niemand gegenüber eine Verpflichtung zur Geheimhaltung. Denn ich nahm von «alter Weisheit» nichts an; was ich an Geist-Erkenntnis habe, ist durchaus Ergebnis meiner eigenen Forschung. Nur, wenn sich mir eine Erkenntnis ergeben hat, so ziehe ich dasjenige heran, was von irgend einer Seite an «altem Wissen» schon veröffentlicht ist, um die Übereinstimmung und zugleich den Fortschritt zu zeigen, der der gegenwärtigen Forschung möglich ist.
So war ich mir denn von einem gewissen Zeitpunkte an ganz klar darüber, daß ich mit einem öffentlichen Auftreten mit der Geist-Erkenntnis das Rechte tue.
XXX.
Der Wille, das Esoterische, das in mir lebte, zur öffentlichen Darstellung zu bringen, drängte mich dazu, zum 28. August 1899, als zu Goethes hundertfünfzigstem Geburtstag, im «Magazin» einen Aufsatz über Goethes Märchen von der «grünen Schlange und der schönen Lilie» unter dem Titel «Goethes geheime Offenbarung» zu schreiben. - Dieser Aufsatz ist ja allerdings noch wenig esoterisch. Aber mehr, als ich gab, konnte ich meinem Publikum nicht zumuten. - In meiner Seele lebte der Inhalt des Märchens als ein durchaus esoterischer. Und aus einer esoterischen Stimmung sind die Ausführungen geschrieben.
Seit den achtziger Jahren beschäftigten mich Imaginationen, die sich bei mir an dieses Märchen geknüpft haben. Goethes Weg von der Betrachtung der äußeren Natur zum Innern der menschlichen Seele, wie er ihn sich nicht in Begriffen, sondern in Bildern vor den Geist stellte, sah ich in dem Märchen dargestellt. Begriffe schienen Goethe viel zu arm, zu tot, um das Leben und Wirken der Seelenkräfte darstellen zu können.
Nun war ihm in Schillers «Briefen über ästhetische Erziehung» ein Versuch entgegengetreten, dieses Leben und Wirken in Begriffe zu fassen. Schiller versuchte zu zeigen, wie das Leben des Menschen durch seine Leiblichkeit der Naturnotwendigkeit und durch seine Vernunft der Geistnotwendigkeit unterliege. Und er meint, zwischen beiden müsse das Seelische ein inneres Gleichgewicht herstellen. In diesem Gleichgewicht lebe dann der Mensch in Freiheit ein wirklich menschenwürdiges Dasein.
Das ist geistvoll; aber für das wirkliche Seelenleben viel zu einfach. Dieses läßt seine Kräfte, die in den Tiefen wurzeln, im Bewußtsein aufleuchten; aber im Aufleuchten, nachdem sie andere ebenso flüchtige beeinflußt haben, wieder verschwinden. Das sind Vorgänge, die im Entstehen schon vergehen; abstrakte Begriffe aber sind nur an mehr oder weniger lang Bleibendes zu knüpfen.
Das alles wußte Goethe empfindend; er setzte sein Bildwissen im Märchen dem Schiller'schen Begriffswissen gegenüber.
Man ist mit einem Erleben dieser Goethe'schen Schöpfung im Vorhof der Esoterik.
Es war dies die Zeit, in der ich durch Gräfin und Graf Brockdorff aufgefordert wurde, an einer ihrer allwöchentlichen Veranstaltungen einen Vortrag zu halten. Bei diesen Veranstaltungen kamen Besucher aus allen Kreisen zusammen. Die Vorträge, die gehalten wurden, gehörten allen Gebieten des Lebens und der Erkenntnis an. Ich wußte von alledem nichts, bis ich zu einem Vortrage eingeladen wurde, kannte auch die Brockdorffs nicht, sondern hörte von ihnen zum ersten Male. Als Thema schlug man mir eine Ausführung über Nietzsche vor. Diesen Vortrag hielt ich. Nun bemerkte ich, daß innerhalb der Zuhörerschaft Persönlichkeiten mit großem Interesse für die Geistwelt waren. Ich schlug daher, als man mich aufforderte, einen zweiten Vortrag zu halten, das Thema vor:
«Goethes geheime Offenbarung». Und in diesem Vortrag wurde ich in Anknüpfung an das Märchen ganz esoterisch. Es war ein wichtiges Erlebnis für mich, in Worten, die aus der Geistwelt heraus geprägt waren, sprechen zu können, nachdem ich bisher in meiner Berliner Zeit
durch die Verhältnisse gezwungen war, das Geistige nur durch meine Darstellungen durchleuchten zu lassen.
Nun waren Brockdorffs die Leiter eines Zweiges der «Theosophischen Gesellschaft», die von Blavatsky begründet worden war. Was ich in Anknüpfung an das Märchen Goethes gesagt hatte, führte dazu, daß Brockdorffs mich einluden, vor den mit ihnen verbundenen Mitgliedern der «Theosophischen Gesellschaft» regelmäßig Vorträge zu halten. Ich erklärte, daß ich aber nur über dasjenige sprechen könne, was in mir als Geisteswissenschaft lebt.
Ich konnte auch wirklich von nichts anderem sprechen. Denn von der von der «Theosophischen Gesellschaft» ausgehenden Literatur war mir sehr wenig bekannt. Ich kannte Theosophen schon von Wien her, und lernte später noch andere kennen. Diese Bekanntschaften veranlaßten mich, im «Magazin» die abfällige Notiz über die Theosophen beim Erscheinen einer Publikation von Franz Hartmann zu schreiben. Und was ich sonst von der Literatur kannte, war mir zumeist in Methode und Haltung ganz unsympathisch; ich hatte nirgends die Möglichkeit, mit meinen Ausführungen daran anzuknüpfen.
So hielt ich denn meine Vorträge, indem ich an die Mystik des Mittelalters anknüpfte. Durch die Meinungen der Mystiker von Meister Eckhard bis zu Jacob Böhme fand ich die Ausdrucksmittel für die geistigen Anschauungen, die ich eigentlich darzustellen mir vorgenommen hatte. Ich faßte dann die Vorträge in dem Buche zusammen «Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens».

Bei diesen Vorträgen erschien eines Tages als Zuhörerin Marie von Sivers, die dann durch das Schicksal ausersehen ward, die Leitung der bald nach Beginn meiner Vorträge gegründeten «Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft» mit fester Hand zu übernehmen. Innerhalb dieser Sektion konnte ich nun vor einer sich immer vergrößernden Zuhörerschaft meine anthroposophische Tätigkeit entfalten.
Niemand blieb im Unklaren darüber, daß ich in der Theosophischen Gesellschaft nur die Ergebnisse meines eigenen forschenden Schauens vorbringen werde. Denn ich sprach es bei jeder in Betracht kommenden Gelegenheit aus. Und als in Berlin im Beisein von Annie Besant die «Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft» begründet und ich zu deren General-Sekretär gewählt wurde, da mußte ich von den Gründungssitzungen weggehen, weil ich einen der Vorträge vor einem nicht-theosophischen Publikum zu halten hatte, in denen ich den geistigen Werdegang der Menschheit behandelte, und bei denen ich im Titel: «Eine Anthroposophie» ausdrücklich hinzugefügt hatte. Auch Annie Besant wußte, daß ich, was ich über Geistwelt zu sagen hatte, damals unter diesem Titel in Vorträgen vorbrachte.
Als ich dann nach London zu einem theosophischen Kongreß kam, da sagte mir eine der leitenden Persönlichkeiten, in meinem Buche «Die Mystik . . . » stünde die wahre Theosophie. Ich konnte damit zufrieden sein Denn ich hatte nur die Ergebnisse meiner Geistesschau gegeben; und in der Theosophischen Gesellschaft wurden diese angenommen. Es gab nun für mich keinen Grund mehr, vor dem theosophischen Publikum, das da-
mals das einzige war, das restlos auf Geist-Erkenntnis einging, nicht in meiner Art, diese Geist-Erkenntnis vorzubringen. Ich verschrieb mich keiner Sektendogmatik; ich blieb ein Mensch, der aussprach, was er glaubte aussprechen zu können ganz nach dem, was er selbst als Geistwelt erlebte.
Vor die Zeit der Sektionsgründung fiel noch eine Vortragsreihe, die ich vor dem Kreise der «Kommenden» hielt, «Von Buddha zu Christus». Ich habe in diesen Ausführungen zu zeigen versucht, welch einen gewaltigen Fortschritt das Mysterium von Golgatha gegenüber dem Buddhaereignis bedeutet und wie die Entwickelung der Menschheit, indem sie dem Christusereignis entgegenstrebt, zu ihrer Kulmination kommt.
Auch sprach ich in demselben Kreise über das Wesen der Mysterien.
Das alles wurde von meinen Zuhörern hingenommen. Es wurde nicht in Widerspruch befunden mit früheren Vorträgen, die ich gehalten habe. Erst als die Sektion begründet wurde und ich damit als «Theosoph» abgestempelt erschien, fing die Ablehnung an. Es war wirklich nicht die Sache; es war der Name und der Zusammenhang mit einer Gesellschaft, die niemand haben wollte.
Aber andrerseits wären meine nicht-theosophischen Zuhörer nur geneigt gewesen, sich von meinen Ausführungen «anregen» zu lassen, sie «literarisch» aufzunehmen. Was mir auf dem Herzen lag, dem Leben die Impulse der Geistwelt einzufügen, dafür gab es kein Verständnis. Dieses Verständnis konnte ich aber allmählich in theosophisch interessierten Menschen finden.
Vor dem Brockdorff-Kreise, vor dem ich über Nietz-
sche und dann über Goethes geheime Offenbarung gesprochen hatte, hielt ich in dieser Zeit einen Vortrag über Goethes «Faust» vom esoterischen Gesichtspunkte. (Es ist derselbe, der dann später mit meinen Ausführungen über Goethes Märchen zusammen im philosophisch-anthroposophischen Verlag erschienen ist)
Die Vorträge über «Mystik . . . » haben dazu geführt, daß derselbe theosophische Kreis mich bat, im Winter darauf wieder zu ihm zu sprechen. Ich hielt dann die Vortragsreihe, die ich in dem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache» zusammengefaßt habe.
Ich habe vom Anfange an erkennen lassen, daß die Wahl des Titels «als mystische Tatsache» wichtig ist. Denn ich habe nicht einfach den mystischen Gehalt des Christentums darstellen wollen. Ich hatte zum Ziel, die Entwickelung von den alten Mysterien zum Mysterium von Golgatha hin so darzustellen, daß in dieser Entwickelung nicht bloß die irdischen geschichtlichen Kräfte wirken, sondern geistige außerirdische Impulse. Und ich wollte zeigen, daß in den alten Mysterien Kultbilder kosmischer Vorgänge gegeben waren, die dann in dem Mysterium von Golgatha als aus dem Kosmos auf die Erde versetzte Tatsache auf dem Plane der Geschichte sich vollzogen.
Das wurde in der Theosophischen Gesellschaft nirgends gelehrt. Ich stand mit dieser Anschauung in vollem Gegensatz zur damaligen theosophischen Dogmatik, bevor man mich aufforderte, in der Theosophischen Gesellschaft zu wirken.
Denn diese Aufforderung erfolgte gerade nach dem hier beschriebenen Vortragszyklus über Christus.
Marie von Sivers war zwischen den beiden Vortragszyklen, die ich für die Theosophische Gesellschaft hielt, in Italien (Bologna), um dort in dem theosophischen Zweige für die Theosophische Gesellschaft zu wirken.
So entwickelten sich die Tatsachen bis zu meinem ersten Besuch eines theosophischen Kongresses in London im Jahre 1902. Auf diesem Kongreß, an dem auch Marie von Sivers teilnahm, war es schon als fertige Tatsache angesehen, daß nun eine deutsche Sektion der Gesellschaft mit mir, der kurz vorher eingeladen war, Mitglied der Gesellschaft zu werden, als Generalsekretär begründet werden sollte.
Der Besuch in London war von großem Interesse für mich. Ich lernte da wichtige Führer der Theosophischen Gesellschaft kennen. Im Hause Mr. Bertram Keightleys, eines dieser Führer, durfte ich wohnen. Ich wurde sehr befreundet mit ihm. Ich lernte Mr. Mead, den so verdienstvollen Schriftsteller der theosophischen Bewegung, kennen. Da wurden im Hause Bertram Keightleys die denkbar interessantesten Gespräche über die Geist-Erkenntnisse geführt, die in der Theosophischen Gesellschaft lebten.
Besonders mit Bertram Keightley selbst wurden diese Gespräche intim. H.P. Blavatsky lebte auf in diesen Gesprächen. Ihre ganze Persönlichkeit mit dem reichen Geistinhalte schilderte mein lieber Gastgeber, der so vieles durch sie erlebt hatte, mit größter Anschaulichkeit vor mir und Marie von Sivers.
Flüchtiger lernte ich Annie Besant kennen, ebenso Sinnett, den Verfasser des «Esoterischen Buddhismus». Nicht kennen lernte ich Mr. Leadbeater, den ich nur vom
Podium herunter sprechen hörte. Er machte auf mich keinen besonderen Eindruck.
All das Interessante, das ich hörte, bewegte mich tief; auf den Inhalt meiner Anschauungen hatte es aber keinen Einfluß.
Ich versuchte die Zwischenzeiten, die mir von den Besuchen der Kongreßversammlungen blieben, zu benützen, fleißig die naturwissenschaftlichen und Kunstsammlungen Londons zu besuchen. Ich darf sagen, daß mir an den naturwissenschaftlichen und historischen Sammlungen manche Idee über Natur- und Menschheitsentwickelung aufgegangen ist
So hatte ich in diesem Londoner Besuch ein für mich bedeutsames Ereignis durchgemacht. Ich reiste mit den allermannigfaltigsten, meine Seele tief bewegenden Eindrücken ab.
In der ersten «Magazin»-Nummer des Jahres 1899 findet man einen Artikel von mir mit der Überschrift «Neujahrsbetrachtung eines Ketzers». Gemeint ist da nicht eine Ketzerei gegenüber einem Religionsbekenntnis, sondern gegenüber der Kulturorientierung, welche die Zeit angenommen hatte.
Man stand vor den Toren eines neuen Jahrhunderts. Das ablaufende hatte große Errungenschaften auf den Gebieten des äußeren Lebens und Wissens gebracht
Dem gegenüber entrang sich mir der Gedanke: «Trotz aller dieser und manch anderer Errungenschaften z. B. auf dem Gebiete der Kunst, kann aber der tiefer blickende Mensch gegenwärtig doch nicht recht froh über den Bildungsinhalt der Zeit werden. Unsere höchsten geistigen Bedürfnisse verlangen nach etwas, was die Zeit nur in
spärlichem Maße gibt» Und im Hinblick auf die Leerheit der damaligen Gegenwartskultur blickte ich zurück zur Zeit der Scholastik, in der die Geister wenigstens noch begrifflich mit dem Geiste lebten. «Man darf sich nicht wundern, wenn gegenüber solchen Erscheinungen Geister mit tieferen geistigen Bedürfnissen die stolzen Gedankengebäude der Scholastik befriedigender finden als den Ideengehalt unserer eigenen Zeit. Otto Willmann hat ein hervorragendes Buch geschrieben, seine «Geschichte des Idealismus», in dem er sich zum Lobredner der Weltanschauung vergangener Jahrhunderte aufwirft. Man muß zugeben: der Geist des Menschen sehnt sich nach jener stolzen, umfassenden Gedankendurchleuchtung, welche das menschliche Wissen in den philosophischen Systemen der Scholastiker erfahren hat.» Die «Mutlosigkeit ist ein charakteristisches Merkmal des geistigen Lebens an der Jahrhundertwende. Sie trübt uns die Freude an den Errungenschaften der jüngst vergangenen Zeiten.»
Und gegenüber den Persönlichkeiten, die geltend machten, daß gerade das «wahre Wissen» die Unmöglichkeit eines Gesamtbildes des Daseins in einer Weltanschauung beweise, mußte ich sagen: «Ginge es nach der Meinung der Leute, die solche Stimmen vernehmen lassen, so würde man sich begnügen, die Dinge und Erscheinungen zu messen, zu wägen, zu vergleichen, sie mit den vorhandenen Apparaten zu untersuchen; niemals aber würde die Frage erhoben nach dem höheren Sinn der Dinge und Erscheinungen.»
Das ist meine Seelenstimmung, aus der heraus die Tatsachen verstanden werden müssen, die meine anthropo-
sophische Tätigkeit innerhalb der Theosophischen Gesellschaft herbeiführten. Wenn ich damals aufgegangen war in der Zeitkultur, um für die Redaktion des «Magazins» den geistigen Hintergrund zu haben, so war es mir nachher ein tiefes Bedürfnis, die Seele an einer solchen Lektüre wie Willmanns «Geschichte des Idealismus» zu «erholen». Wenn auch ein Abgrund zwischen meiner Geistanschauung und der Ideengestaltung Otto Willmanns war: ich fühlte doch diese Ideengestaltung geistnahe.
Mit Ende September 1900 konnte ich das «Magazin» in andere Hände übergehen lassen.
Die mitgeteilten Tatsachen zeigen, daß mein Ziel nach einem Mitteilen des Inhaltes der Geistwelt schon vor dem Aufgeben des «Magazins» aus meiner Seelenverfassung heraus eine Notwendigkeit geworden war, daß es nicht etwa mit der Unmöglichkeit, das «Magazin» weiterzuführen, zusammenhängt.
Wie in das meiner Seele vorbestimmte Element, ging ich in eine Betätigung, die ihre Impulse in der Geist-Erkenntnis hatte, hinein.
Aber ich habe auch heute noch das Gefühl, daß, wenn nicht die hier geschilderten Hemmnisse vorhanden gewesen wären, auch mein Versuch, durch das naturwissenschaftliche Denken hindurch zur Geist-Welt zu führen, ein aussichtsvoller hätte werden können. Ich schaue zurück auf das, was ich von 1897 bis 1900 ausgesprochen habe, als auf etwas, das gegenüber der Denkweise der Zeit hat einmal ausgesprochen werden müssen; und ich schaue andrerseits zurück als auf etwas, in dem ich meine intensivste geistige Prüfung durchgemacht habe.
Ich habe gründlich kennen gelernt, wo die vom Geiste wegstrebenden Kultur-auflösenden, Kultur-zerstörenden Kräfte der Zeit liegen. Und aus dieser Erkenntnis hat sich mir vieles zu der Kraft hinzugesetzt, die ich weiterhin brauchte, um aus dem Geiste heraus zu wirken.
Noch vor der Zeit der Betätigung innerhalb der Theosophischen Gesellschaft, noch in der letzten Zeit der Redaktion des «Magazin» liegt die Ausarbeitung meines zweibändigen Buches «Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten Jahrhundert», das dann von der zweiten Auflage ab erweitert um einen Überblick über die Entwickelung der Weltanschauungen von der Griechenzeit bis zum neunzehnten Jahrhundert als «Rätsel der Philosophie» erschienen ist.
Der äußere Anlaß zur Entstehung dieses Buches ist als völlige Nebensache zu betrachten. Er war dadurch gegeben, daß Cronbach, der Verleger des «Magazin», eine Sammlung von Schriften veranstaltete, die die verschiedenen Gebiete des Wissens und Lebens in ihrer Entwickelung im neunzehnten Jahrhundert behandeln sollten. Er wollte in dieser Sammlung auch eine Darstellung der Welt- und Lebensanschauungen haben und übertrug mir diese.
Ich hatte den ganzen Stoff des Buches seit lange in meiner Seele. Meine Betrachtungen der Weltanschauungen hatten in derjenigen Goethes einen persönlichen Ausgangspunkt. Der Gegensatz, in den ich Goethes Denkungsart zum Kantianismus bringen mußte, die neuen philosophischen Ansätze an der Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts in Fichte, Schelling, Hegel: das alles war für mich der Anfang einer Epoche
der Weltanschauungsentwickelung. Die geistvollen Bücher Richard Wahles, die die Auflösung alles philosophischen Weltanschauungsstrebens am Ende des neunzehnten Jahrhunderts darstellten, schlossen diese Epoche. So rundete sich das Weltanschauungsstreben des neunzehnten Jahrhunderts zu einem Ganzen, das in meiner Anschauung lebte und das darzustellen ich die Gelegenheit gerne ergriff.
Wenn ich auf dieses Buch zurückblicke, so scheint mir mein Lebensgang gerade an ihm sich symptomatisch auszudrücken. Ich bewegte mich nicht, wie viele glauben, in Widersprüchen vorwärts. Wäre das der Fall, ich würde es gerne zugeben. Allein es wäre nicht die Wirklichkeit in meinem geistigen Fortgang. Ich bewegte mich so vorwärts, daß ich zu dem, was in meiner Seele lebte, neue Gebiete hinzufand. Und ein besonders regsames Hinzufinden auf geistigem Gebiete fand bald nach der Bearbeitung der «Welt- und Lebensanschauungen» statt
Dazu kam, daß ich nirgends in das Geistgebiet auf einem mystisch-gefühlsmäßigen Wege vordrang, sondern überall über kristallklare Begriffe gehen wollte. Das Erleben der Begriffe, der Ideen führte mich aus dem Ideellen in das Geistig-Reale.
Die wirkliche Entwickelung des Organischen von Urzeiten bis zur Gegenwart stand vor meiner Imagination erst nach der Ausarbeitung der «Welt- und Lebensanschauungen».
Während dieser hatte ich noch die naturwissenschaftliche Anschauung vor dem Seelenauge, die aus der Darwin'schen Denkart hervorgegangen war. Aber diese galt mir nur als eine in der Natur vorhandene sinnen-
fällige Tatsachenreihe. Innerhalb dieser Tatsachenreihe waren für mich geistige Impulse tätig, wie sie Goethe in seiner Metamorphosenidee vorschwebten.
So stand die naturwissenschaftliche Entwickelungsreihe, wie sie Haeckel vertrat, niemals vor mir als etwas, worin mechanische oder bloß organische Gesetze walteten, sondern als etwas, worin der Geist die Lebewesen von den einfachen durch die komplizierten bis herauf zum Menschen fährt. Ich sah in dem Darwinismus eine Denkart, die auf dem Wege zu der Goethe'schen ist, aber hinter dieser zurückbleibt
Das alles war von mir in ideellem Inhalte noch gedacht; zur imaginativen Anschauung arbeitete ich mich erst später durch. Erst diese Anschauung brachte mir die Erkenntnis, daß in Urzeiten in geistiger Realität ganz anderes Wesenhaftes vorhanden war als die einfachsten Organismen. Daß der Mensch als Geist-Wesen älter ist als alle andern Lebewesen, und daß er, um seine gegenwärtige physische Gestaltung anzunehmen, sich aus einem Weltenwesen herausgliedern mußte, das ihn und die andern Organismen enthielt Diese sind somit Abfälle der menschlichen Entwickelung; nicht etwas, aus dem er hervorgegangen ist, sondern etwas, das er zurückgelassen, von sich abgesondert hat, um seine physische Gestaltung als Bild seines Geistigen anzunehmen. Der Mensch als makrokosmisches Wesen, das alle übrige irdische Welt in sich trug, und das zum Mikrokosmos durch Absonderung des übrigen gekommen ist, das war für mich eine Erkenntnis, die ich erst in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts erlangte.
Und so konnte diese Erkenntnis in den Ausführungen
der «Welt- und Lebensanschauungen» nirgends impulsierend wirken. Ich verfaßte gerade den zweiten Band dieses Buches so, daß in einer vergeistigten Gestalt des im Lichte der Goethe'schen Weltanschauung gesehenen Darwinismus und Haeckelismus der Ausgangspunkt einer geistigen Vertiefung in die Weltgeheimnisse gegeben sein sollte.
Als ich dann später die zweite Auflage des Buches bearbeitete, da war in meiner Seele schon die Erkenntnis von der wahren Entwickelung. Ich fand nötig, obwohl ich den Gesichtspunkt, den ich in der ersten Auflage eingenommen hatte, als das festhielt, was Denken ohne geistige Anschauung geben kann, kleine Änderungen in der Ausdrucksform vorzunehmen. Sie waren nötig, erstens weil doch das Buch durch die Aufnahme des Überblicks über die Gesamtphilosophie eine ganz andere Komposition hatte, und zweitens, weil diese zweite Auflage erschien, als schon meine Ausführungen über die wahre Entwickelung des Lebendigen der Welt vorlagen.
Bei alledem hat die Gestalt, die meine «Rätsel der Philosophie» bekommen haben, nicht nur eine subjektive Berechtigung als festgehaltener Gesichtspunkt aus einem gewissen Abschnitte meines geistigen Werdeganges, sondern eine ganz objektive. Diese besteht darin, daß ein Denken, wenn es auch geistig erlebt wird, als Denken, die Entwickelung der Lebewesen nur so vorstellen kann, wie das in meinem Buche dargestellt wird. Und daß der weitere Schritt durch die geistige Anschauung geschehen muß.
So stellt mein Buch ganz objektiv den vor-anthroposophischen Gesichtspunkt dar, in den man untertauchen
muß, den man im Untertauchen erleben muß, um zu dem höheren aufzusteigen. Dieser Gesichtspunkt tritt bei demjenigen Erkennenden auf als eine Etappe des Erkenntnisweges, der nicht in mystisch-verschwommener, sondern in geistig-klarer Art die Geistwelt sucht. In der Darstellung dessen, was sich von diesem Gesichtspunkt aus ergibt, liegt also etwas, das der Erkennende als Vorstufe des Höheren braucht.
In Haeckel sah ich nun einmal damals die Persönlichkeit, die mutvoll auf den denkerischen Standpunkt in der Naturwissenschaft sich stellte, während die andere Forscherwelt das Denken ausschloß und nur die sinnenfälligen Beobachtungsergebnisse gelten lassen wollte. Daß Haeckel auf das schaffende Denken bei Ergründung der Wirklichkeit Wert legte: das zog mich immer wieder zu ihm hin. Und so widmete ich ihm mein Buch, trotzdem dessen Inhalt - auch in der damaligen Gestalt - durchaus nicht in seinem Sinne verfaßt war. Aber Haeckel war eben so gar nicht philosophischer Natur. Er stand der Philosophie ganz als Laie gegenüber. Und deshalb erschienen mir die Angriffe der Philosophen, die gerade damals auf Haeckel nur so niederhagelten, als ganz unangebracht. In Opposition zu ihnen widmete ich Haeckel das Buch, wie ich in Opposition zu ihnen auch schon meine Schrift «Haeckel und seine Gegner» verfaßt hatte. Haeckel hatte in voller Naivität gegenüber aller Philosophie das Denken zu einem Mittel gemacht, die biologische Wirklichkeit darzustellen; man richtete gegen ihn philosophische Angriffe, die auf einem geistigen Gebiet lagen, das ihm fremd war. Ich glaube, er hat nie gewußt, was die Philosophen von ihm wollten. Es ergab sich mir
dieses aus einem Gespräch, das ich nach dem Erscheinen der «Welträtsel» in Leipzig gelegentlich einer Aufführung des Borngräber'schen Stückes «Giordano Bruno» mit ihm hatte. Da sagte er: «Die Leute sagen, ich leugne den Geist. Ich möchte, daß sie sehen, wie die Stoffe durch ihre Kräfte sich gestalten, sie würden da Geist in jedem Retortenvorgang wahrnehmen. Überall ist Geist.» Haeckel wußte eben überhaupt nichts vom wirklichen Geist. Er sah in den Kräften der Natur schon «Geist».
Man mußte damals nicht gegen solche Blindheit für den Geist mit philosophisch toten Begriffen kritisch vorgehen, sondern sehen, wie weit das Zeitalter von Geist-Erleben entfernt ist, und versuchen, aus den Grundlagen, die sich boten, der biologischen Naturerklärung, den Geistesfunken zu schlagen.
Das war damals meine Meinung. Aus ihr heraus schrieb ich auch meine «Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten Jahrhundert».

XXXI.
Ein anderes Sammelwerk, das die Kulturerrungenschaften des neunzehnten Jahrhunderts darstellte, wurde damals von Hans Kraemer herausgegeben. Es bestand aus längeren Abhandlungen über die einzelnen Zweige des Erkenntnislebens, des technischen Schaffens, der sozialen Entwickelung.
Ich wurde eingeladen, eine Schilderung des literarischen Lebens zu geben. Und so zog denn damals auch die Entwickelung des Phantasielebens im neunzehnten Jahrhundert durch meine Seele hindurch. Ich schilderte nicht wie ein Philologe, der solche Dinge «aus den Quellen heraus» arbeitet; ich schilderte, was ich an der Entfaltung des Phantasielebens innerlich durchgemacht hatte.
Auch diese Darstellung war für mich dadurch von Bedeutung, daß ich über Erscheinungen des geistigen Lebens zu sprechen hatte, ohne daß ich auf das Erleben der Geistwelt eingehen konnte. Das, was an eigentlichen geistigen Impulsen aus dieser Welt sich in den dichterischen Erscheinungen auslebt, blieb unerwähnt.
Auch in diesem Falle stellte sich vor mich hin, was das Seelenleben über eine Daseinserscheinung zu sagen hat, wenn es sich auf den Gesichtspunkt des gewöhnlichen Bewußtseins stellt, ohne den Inhalt dieses Bewußtseins so in Aktivität zu bringen, daß er erlebend in die Geist-Welt aufsteigt.
Noch bedeutungsvoller erlebte ich dieses «Stehen vor dem Tore» der Geistwelt in einer Abhandlung, die ich für ein anderes Werk zu schreiben hatte. Es war dies kein Jahrhundertwerk, sondern eine Sammlung von Auf-
sätzen, die die verschiedenen Erkenntnis- und Lebensgebiete charakterisieren sollten, insofern in der Entfaltung dieser Gebiete der menschliche «Egoismus» eine treibende Kraft ist. Arthur Dix gab dieses Werk heraus. Es hieß «Der Egoismus» und war durchaus der Zeit - Wende des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts - entsprechend.
Die Impulse des Intellektualismus, die sich seit dem fünfzehnten Jahrhundert auf allen Gebieten des Lebens geltend gemacht hatten, wurzeln im «einzelnen Seelenleben», wenn sie wirklich echte Äußerungen ihres Wesens sind. Wenn der Mensch intellektuell sich aus dem sozialen Leben heraus offenbart, so ist das eben nicht eine echte intellektuelle Äußerung, sondern die Nachahmung einer solchen.
Es ist einer der Gründe, warum der Ruf nach sozialem Empfinden in diesem Zeitalter so intensiv hervorgetreten ist, der, daß in der Intellektualität dieses Empfinden nicht ursprünglich innerlich erlebt wird. Die Menschheit begehrt auch in diesen Dingen am meisten nach dem, was sie nicht hat.
Mir fiel für dieses Buch die Darstellung des «Egoismus in der Philosophie» zu. Nun trägt mein Aufsatz diese Überschrift nur deshalb, weil der Gesamttitel des Buches das forderte. Diese Überschrift müßte eigentlich sein: «Der Individualismus in der Philosophie». Ich versuchte, in ganz kurzer Form einen Überblick über die abendländische Philosophie seit Thales zu geben, und zu zeigen, wie deren Entwickelung darauf zielt, die menschliche Individualität zum Erleben der Welt in Ideenbildern zu bringen, so, wie dies versucht ist, in meiner
«Philosophie der Freiheit» für die Erkenntnis und das sittliche Leben darzustellen.
Wieder stehe ich mit diesem Aufsatz vor dem «Tore der Geistwelt». In der menschlichen Individualität werden die Ideenbilder gezeigt, die den Welt-Inhalt offenbaren. Sie treten auf, so daß sie auf das Erleben warten, durch das in ihnen die Seele in die Geistwelt schreiten kann. Ich hielt in der Schilderung an dieser Stelle ein. Es steht eine Innenwelt da, die zeigt, wie weit das bloße Denken im Weltbegreifen kommt.
Man sieht, ich habe das voranthroposophische Seelenleben vor meiner Hingabe an die öffentliche anthroposophische Darstellung der Geistwelt von den verschiedensten Gesichtspunkten aus geschildert. Darinnen kann kein Widerspruch mit dem Auftreten für die Anthroposophie gefunden werden. Denn das Weltbild, das entsteht, wird durch die Anthroposophie nicht widerlegt, sondern erweitert und fortgeführt.
Beginnt man die Geist-Welt als Mystiker darzustellen, so ist jedermann voll berechtigt, zu sagen: du sprichst von deinen persönlichen Erlebnissen. Es ist subjektiv, was du schilderst. Einen solchen Geistesweg zu gehen, ergab sich mir aus der geistigen Welt heraus nicht als meine Aufgabe.
Diese Aufgabe bestand darin, eine Grundlage für die Anthroposophie zu schaffen, die so objektiv war wie das wissenschaftliche Denken, wenn dieses nicht beim Verzeichnen sinnenfälliger Tatsachen stehen bleibt, sondern zum zusammenfassenden Begreifen vorrückt. Was ich wissenschaftlich-philosophisch, was ich in Anknüpfung an Goethes Ideen naturwissenschaftlich darstellte, da-
rüber ließ sich diskutieren. Man konnte es für mehr oder weniger richtig oder unrichtig halten; es strebte aber den Charakter des Objektiv-Wissenschaftlichen in vollstem Sinne an.
Und aus diesem von Gefühlsmäßig-Mystischem freien Erkennen heraus holte ich dann das Erleben der Geistwelt. Man sehe, wie in meiner «Mystik», im «Christentum als mystische Tatsache» der Begriff der Mystik nach der Richtung dieses objektiven Erkennens geführt ist. Und man sehe insbesondere, wie meine «Theosophie» aufgebaut ist. Bei jedem Schritte, der in diesem Buche gemacht wird, steht das geistige Schauen im Hintergrunde. Es wird nichts gesagt, das nicht aus diesem geistigen Schauen stammt. Aber indem die Schritte getan werden, sind es zunächst im Anfange des Buches naturwissenschaftliche Ideen, in die das Schauen sich hüllt, bis es sich in dem Aufsteigen in die höheren Welten immer mehr im freien Erbilden der geistigen Welt betätigen muß. Aber dieses Erbilden wächst aus dem Naturwissenschaftlichen wie die Blüte einer Pflanze aus dem Stengel und den Blättern. - Wie die Pflanze nicht in ihrer Vollständigkeit angeschaut wird, wenn man sie nur bis zur Blüte ins Auge faßt, so wird die Natur nicht in ihrer Vollständigkeit erlebt, wenn man von dem Sinnenfälligen nicht zum Geiste aufsteigt.
So strebte ich darnach, in der Anthroposophie die objektive Fortsetzung der Wissenschaft zur Darstellung zu bringen, nicht etwas Subjektives neben diese Wissenschaft hinzustellen. - Daß gerade dieses Streben zunächst nicht verstanden wurde, ist ganz selbstverständlich. Man hielt eben Wissenschaft mit dem abgeschlossen, was vor

der Anthroposophie liegt, und hatte gar keine Neigung dazu, die Ideen der Wissenschaft so zu beleben, daß das zur Erfassung des Geistigen führt. Man stand im Banne der in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ausgebildeten Denkgewohnheiten. Man fand nicht den Mut, die Fesseln der bloß sinnenfälligen Beobachtung zu durchbrechen; man fürchtete, in Gebiete zu kommen, wo jeder seine Phantasie geltend macht.
So war meine innere Orientierung, als 1902 Marie von Sivers und ich an die Führung der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft herantraten. Marie von Sivers war die Persönlichkeit, die durch ihr ganzes Wesen die Möglichkeit brachte, dem, was durch uns entstand, jeden sektiererischen Charakter fernzuhalten und der Sache einen Charakter zu geben, der sie in das allgemeine Geistes- und Bildungsleben hineinstellt. Sie war tief interessiert für dramatische und deklamatorisch-rezitatorische Kunst und hatte nach dieser Richtung eine Schulung, namentlich an den besten Lehrstätten in Paris, durchgemacht, die ihrem Können eine schöne Vollendung gegeben hatte. Sie setzte die Schulung noch zu der Zeit fort, als ich sie in Berlin kennen lernte, um die verschiedenen Methoden des künstlerischen Sprechens kennen zu lernen.
Marie von Sivers und ich wurden bald tief befreundet. Und auf der Grundlage dieser Freundschaft entfaltete sich ein Zusammenarbeiten auf den verschiedensten geistigen Gebieten im weitesten Umkreis. Anthroposophie, aber auch dichterische und rezitatorische Kunst gemeinsam zu pflegen, war uns bald Lebensinhalt geworden.
In diesem gemeinsam gepflegten geistigen Leben konnte allein der Mittelpunkt liegen, von dem aus Anthroposophie zunächst im Ralimen der Theosophischen Gesellschaft in die Welt getragen wurde.
Marie von Sivers hatte bei unserem ersten gemeinsamen Londoner Besuche durch Gräfin Wachtmeister, die intime Freundin H. P. Blavatskys, viel über diese und über die Einrichtungen und die Entwickelung der Theosophischen Gesellschaft gehört. Sie war in hohem Grade mit dem vertraut, was als geistiger Inhalt einstmals der Gesellschaft geoffenbart worden ist und wie dieser Inhalt weiter gepflegt worden war.
Wenn ich davon gesprochen habe, daß es möglich war, im Rahmen der Theosophischen Gesellschaft die Menschen zu finden, die auf Mitteilungen aus der Geist-Welt hören wollten, so ist damit nicht gemeint, daß als solche Persönlichkeiten vor allem in Betracht kamen die damals als Mitglieder in der Theosophischen Gesellschaft eingeschriebenen. Viele von diesen erwiesen sich allerdings bald als verständnisvoll gegenüber meiner Art der Geist-Erkenntnis.
Aber ein großer Teil der Mitglieder waren fanatische Anhänger einzelner Häupter der Theosophischen Gesellschaft. Sie schworen auf die Dogmen, die von diesen stark im sektiererischen Sinn wirkenden Häuptern ausgegeben waren.
Mich stieß dieses Wirken der Theosophischen Gesellschaft durch die Trivialität und den Dilettantismus, die darinnen steckten, ab. Nur innerhalb der englischen Theosophen fand ich inneren Gehalt, der noch von Blavatsky herrührte und der damals von Annie Besant
und anderen sachgemäß gepflegt wurde. Ich hätte nie in dem Stile, in dem diese Theosophen wirkten, selber wirken können. Aber ich betrachtete, was unter ihnen lebte, als ein geistiges Zentrum, an das man würdig anknüpfen durfte, wenn man die Verbreitung der Geist-Erkenntnis im tiefsten Sinne ernst nahm.
So war es nicht etwa die in der Theosophischen Gesellschaft vereinigte Mirgliederschaft, auf die Marie von Sivers und ich zählten, sondern diejenigen Menschen überhaupt, die sich mit Herz und Sinn einfanden, wenn ernst zu nehmende Geist-Erkenntnis gepflegt wurde.
Das Wirken innerhalb der damals bestehenden Zweige der Theosophischen Gesellschaft, das notwendig als Ausgangspunkt war, bildete daher nur einen Teil unserer Tätigkeit. Die Hauptsache war die Einrichtung von öffentlichen Vorträgen, in denen ich zu einem Publikum sprach, das außerhalb der Theosophischen Gesellschaft stand und das zu meinen Vorträgen nur wegen deren Inhalt kam.
Aus denjenigen Persönlichkeiten, die auf diese Art kennen lernten, was ich über die Geist-Welt zu sagen hatte, und aus denen, die aus der Betätigung mit irgend einer «theosophischen Richtung» den Weg zu dieser Art fanden, bildete sich im Rahmen der Theosophischen Gesellschaft dasjenige heraus, was später Anthroposophische Gesellschaft wurde.
Man hat unter den mancherlei Anklagen, die man wegen meines Wirkens in der Theosophischen Gesellschaft gegen mich gerichtet hat - auch von seiten dieser Gesellschaft selbst - auch die erhoben, daß ich gewissermaßen diese Gesellschaft, die Geltung hatte in der Welt, als
Sprungbrett benutzt hätte, um der eigenen Geist-Erkenntnis die Wege zu ebnen.
Davon kann nicht im entferntesten die Rede sein. Als ich der Einladung in die Gesellschaft folgte, war diese die einzige ernst zu nehmende Institution, in der reales Geistesleben vorhanden war. Und wären Gesinnung, Haltung und Wirken der Gesellschaft so geblieben, wie sie damals waren, mein und meiner Freunde Austritt hätte nie zu erfolgen gebraucht. Es hätte nur innerhalb der Theosophischen Gesellschaft die besondere Abteilung «Anthroposophische Gesellschaft» offiziell gebildet werden können.
Aber schon von 1906 ab machten sich in der Theosophischen Gesellschaft Erscheinungen geltend, die deren Verfall in erschreckendem Maße zeigten.
Wenn auch schon früher, zur Zeit von H.P. Blavatsky, solche Erscheinungen von der Außenwelt behauptet wurden, so lag dafür im Beginne des Jahrhunderts die Tatsache vor, daß im Ernst der geistigen Arbeit von seiten der Gesellschaft gut gemacht war, was an Unrichtigkeiten vorgekommen ist. Diese Vorkommnisse waren ja auch umstritten.
Aber seit 1906 kamen in der Gesellschaft, auf deren Führung ich nicht den geringsten Einfluß hatte, Betätigungen vor, die an die Auswüchse des Spiritismus erinnerten und die nötig machten, daß ich immer mehr betonte, daß der Teil dieser Gesellschaft, der unter meiner Führung stand, mit diesen Dingen absolut nichts zu tun habe. Den Gipfel erreichten diese Betätigungen, als dann von einem Hinduknaben behauptet wurde, er sei die Persönlichkeit, in der Christus in neuem Erdenleben auftre-
ten werde. Für die Verbreitung dieser Absurdität wurde eine besondere Gesellschaft in der Theosophischen gebildet, diejenige vom «Stern des Ostens». Es war für mich und meine Freunde ganz unmöglich, die Mitglieder dieses «Sternes des Ostens» so als Glied in die deutsche Sektion hereinzunehmen, wie diese es wollten und wie vor allem Annie Besant als Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft das beabsichtigte. Und weil wir das nicht tun konnten, schloß man uns 1913 von der Theosophischen Gesellschaft aus. Wir waren genötigt, die Anthroposophische Gesellschaft als selbständige zu begründen.
Ich bin damit der Schilderung der Ereignisse in meinem Lebensgang weit vorausgeeilt; allein das war notwendig, weil nur diese späteren Tatsachen das richtige Licht werfen können auf die Absichten, die ich mit dem Eintritte in die Gesellschaft im Beginne des Jahrhunderts verband.
Ich habe, als ich 1902 zum ersten Male in London auf dem Kongresse der Theosophischen Gesellschaft sprach, gesagt: Die Vereinigung, die die einzelnen Sektionen bilden, soll darin bestehen, daß eine jede nach dem Zentrum bringt, was sie in sich birgt; und ich betonte scharf, daß ich für die deutsche Sektion dies vor allem beabsichtige. Ich machte deutlich, daß diese Sektion niemals sich als Trägerin festgesetzter Dogmen, sondern als Stätte selbständiger geistiger Forschung betätigen werde, die sich bei den gemeinsamen Zusammenkünften der ganzen Gesellschaft über die Pflege echten Geisteslebens verständigen möchte.
XXXII.
Es hat für mich etwas Schmerzliches, wenn ich in Betrachtungen, die heute über Anthroposophie angestellt werden, immer wieder Gedanken von der Art lesen muß: der Weltkrieg hat in den Seelen der Menschen Stimmungen erzeugt, die dem Aufkommen von allerlei «mystischen» und ähnlichen Geistesströmungen günstig sind, und wenn dann unter diesen Strömungen auch die Anthroposophie angeführt wird.
Dem steht gegenüber, daß die anthroposophische Bewegung mit Beginn des Jahrhunderts begründet wurde, und daß seit dieser Begründung in ihr nie etwas Wesentliches getan worden ist, was nicht aus dem inneren Leben des Geistes veranlaßt gewesen wäre. Ich hatte vor zwei und einhalb Jahrzehnten einen Inhalt von geistigen Impressionen in mir. Ich gab ihnen Gestalt in Vorträgen, Abhandlungen und Büchern. Was ich tat, tat ich aus geistigen Impulsen. Im wesentlichen ist jedes Thema aus dem Geiste herausgeholt. Es sind während des Krieges von mir auch Themen besprochen worden, die von den Zeitereignissen veranlaßt waren. Aber dem lag nichts von einer Absicht zugrunde, die Zeitstimmung für Verbreitung der Anthroposophie auszunutzen. Es geschah, weil Menschen gewisse Zeitereignisse von den Erkenntnissen beleuchtet haben wollten, die aus der Geisteswelt kommen.
Für Anthroposophie ist nie etwas anderes angestrebt worden, als daß sie den Fortgang nehme, der aus ihrer inneren, ihr aus dem Geiste gegebenen Kraft möglich ist. - Für sie ist es so unzutreffend wie nur irgend möglich, wenn man sie so hinstellt, als ob sie aus den dunklen
Abgründen der Seelen während der Kriegszeit habe etwas gewinnen wollen. Daß die Zahl derer, die sich für Anthroposophie interessieren, sich nach dem Kriege mehrte, daß die anthroposophische Gesellschaft an Mitgliederzahl wuchs, ist richtig; allein man sollte bemerken, wie alle diese Tatsachen nie etwas an der Fortführung der anthroposophischen Sache im Sinne, wie diese seit dem Beginne des Jahrhunderts sich vollzog, geändert haben.
Die Gestalt, die aus dem innern Geisteswesen heraus der Anthroposophie zu geben war, hat zunächst sich gegen allerlei Widerstände der Theosophen in Deutschland durchringen müssen.
Da war vor allem die Frage nach der Rechtfertigung der Geist-Erkenntnis vor der «wissenschaftlichen» Denkart der Zeit. Daß diese Rechtfertigung notwendig sei, davon habe ich in diesem «Lebensgang» öfter gesprochen. Ich nahm die Denkart, die in der Natur-Erkenntnis mit Recht als «wissenschaftlich» galt, und bildete diese für die Geist-Erkenntnis aus. Dadurch wurde die Art der Natur-Erkenntnis allerdings etwas anderes für die Geist-Beobachtung, als sie für die Naturbeobachtung ist; aber den Charakter, wodurch sie als «wissenschaftlich> anzusehen ist, behielt sie bei.
Für diese Art von wissenschaftlicher Gestaltung der Geist-Erkenntnis hatten diejenigen Persönlichkeiten, die sich im Beginne des Jahrhunderts als die Träger der theosophischen Bewegung betrachteten, weder Sinn noch Interesse.
Es waren die Persönlichkeiten, die sich um Dr. Hübbe-Schleiden gruppierten. Dieser hatte als persönlicher
Freund von H. P. Blavatsky schon in den achtziger Jahren eine theosophische Gesellschaft von Elberfeld aus begründet An dieser Begründung war H. P. Blavatsky selbst beteiligt. Dr. Hübbe-Schleiden gab dann in der «Sphinx» eine Zeitschrift heraus, in der die theosophische Weltanschauung zur Geltung kommen sollte. - Die ganze Bewegung versiegte, und zur Zeit, als die deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft begründet wurde, war nichts davon da, als eine Anzahl von Persönlichkeiten, die aber mich doch als eine Art von Eindringling in ihre Sphäre betrachteten. - Diese Persönlichkeiten warteten auf die «wissenschaftliche Begründung» der Theosophie durch Dr. Hübbe-Schleiden. Sie waren der Ansicht, daß, bevor diese vorläge, innerhalb deutscher Gebiete auf diesem Felde überhaupt nichts zu geschehen habe. Was ich zu tun begann, erschien ihnen als Störung ihres «Wartens», als etwas durchaus Schädliches. Aber sie zogen sich nicht ohne weiteres zurück, denn Theo-sophie war doch «ihre» Sache; und wenn etwas in ihr geschah, so wollten sie nicht abseits stehen.
Was verstanden sie unter der «Wissenschaftlichkeit», die Dr. Hübbe-Schleiden begründen sollte, durch die die Theosophie «bewiesen» werden sollte? Auf Anthroposophie ließen sie sich gar nicht ein.
Sie verstanden darunter die atomistische Grundlage des naturwissenschaftlichen Theoretisierens und Hypothesenbildens. Die Erscheinungen der Natur wurden «erklärt», indem man «Ur-Teile» der Weltsubstanz sich zu Atomen, diese zu Molekülen gruppieren ließ. Ein Stoff war dadurch da, daß er eine bestimmte Struktur von Atomen in Molekülen darstellte.
Diese Denkart betrachtete man als vorbildlich. Man konstruierte komplizierte Moleküle, die die Grundlagen auch für Geist-Wirken sein sollten. Chemische Vorgänge seien die Ergebnisse von Vorgängen innerhalb der Molekularstruktur; für geistige Vorgange müsse Ähnliches gesucht werden.
Für mich war dieser Atomismus in der Deutung, die er in der «Naturwissenschaft» bekommt, schon innerhalb dieser etwas ganz Unmögliches; ihn ins Geistige übertragen wollen, schien mir eine Denkverirrung, über die man im Ernste nicht einmal sprechen kann.
Auf diesem Gebiete ist es für meine Art, Anthroposophie zu begründen, immer schwierig gewesen. Man versichert von gewissen Seiten her seit langer Zeit, der theoretische Materialismus sei überwunden. Und in dieser Richtung kämpfe Anthroposophie gegen Windmühlen, wenn sie von Materialismus in der Wissenschaft rede. Mir war dagegen immer klar, daß die Art von Überwindung des Materialismus, von der man da spricht, gerade der Weg ist, ihn unbewußt zu konservieren.
Mir kam immer wenig darauf an, daß Atome in rein mechanischer oder sonst einer Wirksamkeit innerhalb des materiellen Geschehens angenommen werden. Mir kam es darauf an, daß die denkende Betrachtung von dem Atomistischen - den kleinsten Weltgebilden - ausgeht und den Übergang sucht zum Organischen, zum Geistigen. Ich sah die Notwendigkeit, von dem Ganzen auszugehen. Atome oder atomistische Strukturen können nur Ergebnisse von Geistwirkungen, von organischen Wirkungen sein. - Von dem angeschauten Urphänomen, nicht von einer Gedankenkonstruktion, wollte ich im
Geiste der Goethe'schen Naturbetrachtung den Ausgang nehmen. Tief überzeugend war es mir immer, was in Goethes Worten liegt, daß das Faktische schon Theorie sei, daß man hinter diesem nichts suchen solle. Aber das bedingt, daß man für die Natur das hinnimmt, was die Sinne geben, und das Denken auf diesem Gebiete nur dazu benützt, von den komplizierten, abgeleiteten Phänomenen (Erscheinungen>, die sich nicht übersehen lassen, zu den einfachen, zu den Urphänomenen zu kommen. Da merkt man dann, daß man es in der Natur wohl mit Farben- und anderen Sinnesqualitäten zu tun hat, innerhalb deren Geist wirksam ist; man kommt aber nicht zu einer atomistischen Welt hinter der sinnenfälligen. Was von Atomismus Geltung haben kann, gehört eben der Sinneswelt an.
Daß nach dieser Richtung ein Fortschritt im Natur-Begreifen geschehen ist, kann anthroposophische Denk-art nicht zugeben. Was sich etwa in Ansichten wie der Mach'schen, oder was sich neuerdings auf diesem Gebiete zeigt, sind zwar Ansätze zum Verlassen des Atom- und Molekülkonstruierens; sie zeigen aber, daß sich dieses Konstruieren in die Denkweise so tief eingegraben hat, daß man mit seinem Verlassen alle Realität verliert. Mach hat nur noch von Begriffen als von ökonomischen Zusammenfassungen der Sinneswahrnehmungen, nicht mehr von etwas gesprochen, was in einer Geist-Realität lebt. Und den Neueren geht es nicht anders.
Deshalb ist, was da als Bekämpfung des theoretischen Materialismus auftritt, nicht weniger weit von dem geistigen Sein, in dem Anthroposophie lebt, entfernt, als es der Materialismus vom letzten Drittel des neunzehnten
Jahrhunderts war. Was damals von Anthroposophie gegen die naturwissenschaftlichen Denkgewohnheiten vorgebracht worden ist, gilt heute nicht in abgeschwächtem, sondern in verstärktem Maße.
Die Darstellungen dieser Dinge könnten wie theoretisierende Einschübe in diesen «Lebensgang» erscheinen. Für mich sind sie es nicht; denn was in diesen Auseinandersetzungen enthalten ist, das war für mich Erlebnis, stärkstes Erlebnis, viel bedeutsamer, als was von außen je an mich herangetreten ist.
Sogleich bei der Begründung der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft erschien es mir als eine Notwendigkeit, eine eigene Zeitschrift zu haben. So begründeten denn Marie von Sivers und ich die Monatsschrift «Luzifer». Der Name wurde damals selbstverständlich in keinen Zusammenhang gebracht mit der geistigen Macht, die ich später als Luzifer, den Gegenpol von Ahriman, bezeichnete. So weit war damals der Inhalt der Anthroposophie noch nicht ausgebildet, daß von diesen Mächten schon härte die Rede sein können. - Es sollte der Name einfach «Lichtträger» bedeuten.
Obwohl es zunächst meine Absicht war, im Einklang mit der Leitung der Theosophischen Gesellschaft zu arbeiten, hatte ich doch vom Anfange an die Empfindung:
in Anthroposophie muß etwas entstehen, das aus seinem eigenen Keim sich entwickele, ohne irgendwie sich, dem Inhalte nach, abhängig zu stellen von dem, was die Theosophische Gesellschaft lehren ließ. - Das konnte ich nur durch eine solche Zeitschrift. Und aus dem, was ich in dieser schrieb, ist ja in der Tat das herausgewachsen, was heute Anthroposophie ist.
So ist es gekommen, daß gewissermaßen unter dem Protektorate und der Anwesenheit von Mrs. Besant die deutsche Sektion begründet wurde. Damals hat Mrs. Besant auch einen Vortrag über Ziele und Prinzipien der Theosophie in Berlin gehalten. Wir haben Mrs. Besant dann etwas später aufgefordert, Vorträge in einer Reihe von deutschen Städten zu halten. Es kamen solche zustande in Hamburg, Berlin, Weimar, München, Stuttgart, Köln. - Trotz alldem ist nicht durch irgend welche besondere Maßnahmen meinerseits, sondern durch eine innere Notwendigkeit der Sache das Theosophische versiegt, und das Anthroposophische in einem von inneren Bedingungen bestimmten Werdegang zur Entfaltung gekommen.
Marie von Sivers hat das alles dadurch möglich gemacht, daß sie nicht nur nach ihren Kräften materielle Opfer gebracht, sondern auch ihre gesamte Arbeitskraft der Anthroposophie gewidmet hat. - Wir konnten wirklich anfangs nur aus den primitivsten Verhältnissen heraus arbeiten. Ich schrieb den größten Teil des «Luzifer». Marie von Sivers besorgte die Korrespondenz. Wenn eine Nummer fertig war, dann besorgten wir selbst das Fertigen der Kreuzbänder, das Adressieren, das Bekleben mit Marken und trugen beide persönlich die Nummern in einem Waschkorbe zur Post.
Der «Luzifer» erfuhr bald insofern eine Vergrößerung, als ein Herr Rappaport in Wien, der eine Zeitschrift «Gnosis» herausgab, mir den Vorschlag machte, diese mit der meinigen zu einer zu gestalten. So erschien denn der «Luzifer» dann als «Lucifer-Gnosis». Rappaport trug auch eine Zeitlang einen Teil der Ausgaben.
«Lucifer-Gnosis» nahm den allerbesten Fortgang. Die Zeitschrift verbreitete sich in durchaus befriedigender Weise. Es mußten Nummern, die schon vergriffen waren, sogar zum zweiten Male gedruckt werden. Sie ist auch nicht «eingegangen». Aber die Verbreitung der Anthroposophie nahm in verhältnismäßig kurzer Zeit die Gestalt an, daß ich persönlich zu Vorträgen in viele Städte gerufen wurde. Aus den Einzelvorträgen wurden in vielen Fällen Vortragszyklen. Anfangs suchte ich das Redigieren von «Lucifer-Gnosis» neben dieser Vortragstätigkeit noch aufrecht zu erhalten. Aber die Nummern konnten nicht mehr zur rechten Zeit erscheinen, manchmal um Monate zu spät. Und so stellte sich denn die merkwürdige Tatsache ein, daß eine Zeitschrift, die mit jeder Nummer an Abonnenten gewann, einfach durch Überlastung des Redakteurs nicht weiter erscheinen konnte.
In der Monatsschrift «Lucifer-Gnosis» konnte ich zur ersten Veröffentlichung bringen, was die Grundlage für anthroposophisches Wirken wurde. Da erschien denn zuerst, was ich über die Anstrengungen zu sagen harte, die die menschliche Seele zu machen hat, um zu einem eigenen schauenden Erfassen der Geist-Erkenntnis zu gelangen. «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» erschien in Fortsetzungen von Nummer zu Nummer. Ebenso ward der Grund gelegt zur anthroposophischen Kosmologie durch die fortlaufenden Aufsätze «Aus der Akasha-Chronik».
Aus dem hier Gegebenen, und nicht aus irgend etwas von der Theosophischen Gesellschaft Entlehntem erwächst die anthroposophische Bewegung. Dachte ich bei meinen Niederschriften der Geist-Erkenntnisse an die in
der Gesellschaft üblichen Lehren, so war es nur, um dem oder jenem, das mir in diesen Lehren irrtümlich erschien, korrigierend gegenüberzutreten.
In diesem Zusammenhang muß ich etwas besprechen, das von gegnerischer Seite, in einen Nebel von Mißverständnissen gehüllt, immer wieder vorgebracht wird. Aus inneren Gründen brauchte ich gar nicht darüber zu reden, denn es hat weder auf meinen Entwickelungsgang noch auf meine öffentliche Wirksamkeit einen Einfluß gehabt. Und gegenüber allem, was ich hier zu schildern habe, ist es eine rein «private» Angelegenheit geblieben. Es ist meine Aufnahme in die innerhalb der Theosophischen Gesellschaft bestehende «Esoterische Schule».
Diese «Esoterische Schule» ging auf H.P. Blavatsky zurück. Diese hatte für einen kleinen inneren Kreis der Gesellschaft eine Stätte geschaffen, in der sie mitteilte, was sie in der allgemeinen Gesellschaft nicht sagen wollte. Sie hielt es wie andere Kenner der geistigen Welt nicht für möglich, gewisse tiefere Lehren der Allgemeinheit mitzuteilen.
Nun hängt all das zusammen mit der Art, wie H. P. Blavatsky zu ihren Lehren gekommen ist. Es gab ja immer eine Tradition über solche Lehren, die auf alte Mysterien-Schulen zurückgehen. Diese Tradition wird in allerlei Gesellschaften gepflegt, die streng darüber wachen, daß von den Lehren aus den Gesellschaften nichts hinausdringe.
Aber von irgend einer Seite wurde es für angemessen gehalten, an H. P. Blavatsky solche Lehren mitzuteilen. Sie verband dann, was sie da erhielt, mit Offenbarungen, die ihr im eigenen Innern aufgingen. Denn sie war eine
menschliche Individualität, in der das Geistige durch einen merkwürdigen Atavismus wirkte, wie es einst bei den Mysterien-Leitern gewirkt hat, in einem Bewußtseinszustand, der gegenüber dem modernen von der Bewußtseinsseele durchleuchteten ein ins Traumhafte herabgestimmter war. So erneuerte sich in dem «Menschen Blavatsky» etwas, das in uralter Zeit in den Mysterien heimisch war.
Für den modernen Menschen gibt es eine irrtumsfreie Möglichkeit, zu entscheiden, was von dem Inhalte des geistigen Schauens weiteren Kreisen mitgeteilt werden kann. Mit Allem kann das geschehen, das der Forschende in solche Ideen kleiden kann, wie sie der Bewußtseinsseele eigen und wie sie ihrer Art nach auch in der anerkannten Wissenschaft zur Geltung kommen.
Nicht so steht die Sache, wenn die Geist-Erkenntnis nicht in der Bewußtseinsseele lebt, sondern in mehr unter-bewußten Seelenkräften. Diese sind nicht genügend unabhängig von den im Körperlichen wirkenden Kräften. Deshalb kann für Lehren, die so aus unterbewußten Regionen geholt werden, die Mitteilung gefährlich werden. Denn solche Lehren können ja nur wieder von dem Unterbewußten aufgenommen werden. Und Lehrer und Lernender bewegen sich da auf einem Gebiete, wo das, was dem Menschen heilsam, was schädlich ist, sehr sorgfältig behandelt werden muß.
Das alles kommt für Anthroposophie deshalb nicht in Betracht, weil diese ihre Lehren ganz aus der unbewußten Region heraushebt.
Der innere Kreis der Blavatsky lebte in der «Esoterischen Schule» fort. - Ich hatte mein anthroposophisches
Wirken in die Theosophische Gesellschaft hineingestellt. Ich mußte deshalb informiert sein über alles, was in derselben vorging. Um dieser Information willen und darum, weil ich für Vorgeschrittene in der anthroposophischen Geist-Erkenntnis selbst einen engeren Kreis für notwendig hielt, ließ ich mich in die «Esoterische Schule» aufnehmen. Mein engerer Kreis sollte allerdings einen andern Sinn als diese Schule haben. Er sollte eine höhere Abteilung, eine höhere Klasse darstellen für diejenigen, die genügend viel von den elementaren Erkenntnissen der Anthroposophie aufgenommen hatten. - Nun wollte ich überall an Bestehendes, an historisch Gegebenes anknüpfen. So wie ich dies mit Bezug auf die Theosophische Gesellschaft tat, wollte ich es auch gegenüber der «Esoterischen Schule» machen. Deshalb bestand mein «engerer Kreis» auch zunächst in Zusammenhang mit dieser Schule. Aber der Zusammenhang lag nur in den Einrichtungen, nicht in dem, was ich als Mitteilung aus der Geist-Welt gab. So nahm sich mein engerer Kreis in den ersten Jahren äußerlich wie eine Abteilung der «Esoterischen Schule» von Mrs. Besant aus. Innerlich war er das ganz und gar nicht. Und 1907, als Mrs. Besant bei uns am theosophischen Kongreß in München war, hörte nach einem zwischen Mrs. Besant und mir getroffenen Übereinkommen auch der äußere Zusammenhang vollständig auf.
Daß ich innerhalb der «Esoterischen Schule» der Mrs. Besant hätte etwas Besonderes lernen können, lag schon deshalb außer dem Bereich der Möglichkeit, weil ich von Anfang an nicht an Veranstaltungen dieser Schule teilnahm, außer einigen wenigen, die zu meiner Information, was vorgeht, dienen sollten.
Es war ja in der Schule damals kein anderer wirklicher Inhalt als derjenige, der von H.P. Blavatsky herrührt, und der war ja schon gedruckt. Außer diesem Gedruckten gab Mrs. Besant allerlei indische Übungen für den Erkenntnisfortschritt, die ich aber ablehnte.
So war bis 1907 mein engerer Kreis in einem auf die Einrichtung bezüglichen Sinne in einem Zusammenhang mit dem, was Mrs. Besant als einen solchen Kreis pflegte. Aber es ist ganz unberechtigt, aus diesen Tatsachen heraus das zu machen, was Gegner daraus gemacht haben. Es wurde geradezu die Absurdität behauptet, ich wäre zu der Geist-Erkenntnis überhaupt nur durch die esoterische Schule von Mrs. Besant geführt worden.
1903 nahmen dann Marie von Sivers und ich wieder an dem Theosophischen Kongreß in London teil. Da war denn auch aus Indien Colonel Olcott, der Präsident der Theosophischen Gesellschaft, erschienen. Eine liebenswürdige Persönlichkeit, der man noch ansah, wie sie durch Energie und eine außerordentliche organisatorische Begabung der Blavatsky Genosse sein konnte in der Begründung, Einrichtung und Führung der Theosophischen Gesellschaft. Denn nach außen hin war diese Gesellschaft in kurzer Zeit zu einer großen Körperschaft mit einer vorzüglichen Organisation geworden.
Marie von Sivers und ich traten für kurze Zeit Mrs. Besant dadurch näher, daß diese in London bei Mrs. Bright wohnte und wir für unsere späteren Londoner Besuche auch in dieses liebenswürdige Haus eingeladen wurden. Mrs. Bright und deren Tochter, Miß Esther Bright, waren die Hausleute. Persönlichkeiten wie die verkörperte Liebenswürdigkeit. Ich denke an die Zeit, die ich
in diesem Hause verbringen durfte, mit innerlicher Freude zurück. Brights waren gegenüber Mrs. Besant treuergebene Freunde. Ihr Bestreben war, das Band zwischen dieser und uns enge zu knüpfen. Als es dann unmöglich wurde, daß ich mich an die Seite von Mrs. Besant in gewissen Dingen - von denen einige hier schon besprochen sind - stellte, da war das auch zum Schmerze von Brights, die mit eisernen Banden kritiklos an der geistigen Leiterin der Theosophischen Gesellschaft festhielten.
Für mich war Mrs. Besant durch gewisse Eigenschaften eine interessante Persönlichkeit. Ich bemerkte an ihr, daß sie ein gewisses Recht habe, von der geistigen Welt aus ihren eigenen inneren Erlebnissen zu sprechen. Das innere Herankommen an die geistige Welt mit der Seele, das hatte sie. Es ist dies nur später überwuchert worden von äußerlichen Zielen, die sie sich stellte.
Für mich mußte ein Mensch interessant sein, der aus dem Geiste heraus vom Geiste redete. - Aber ich war andrerseits streng in meiner Anschauung, daß in unserer Zeit die Einsicht in die geistige Welt innerhalb der Bewußtseinsseele leben müsse.
Ich schaute in eine alte Geist-Erkenntnis der Menschheit. Sie hatte einen traumhaften Charakter. Der Mensch schaute in Bildern, in denen die geistige Welt sich offenbarte. Aber diese Bilder wurden nicht durch den Erkenntniswillen in voller Besonnenheit entwickelt. Sie traten in der Seele auf, ihr aus dem Kosmos gegeben wie Träume. Diese alte Geist-Erkenntnis verlor sich im Mittelalter. Der Mensch kam in den Besitz der Bewußtseinsseele. Er hat nicht mehr Erkenntnis-Träume. Er ruft die
Ideen in voller Besonnenheit durch den Erkenntniswillen in die Seele herein. - Diese Fähigkeit lebt sich zunächst aus in den Erkenntnissen über die Sinneswelt. Sie erreicht ihren Höhepunkt als Sinnes-Erkenntnis innerhalb der Naturwissenschaft.
Die Aufgabe einer Geist-Erkenntnis ist nun, in Besonnenheit durch den Erkenntniswillen Ideen-Erleben an die geistige Welt heranzubringen. Der Erkennende hat dann einen Seelen-Inhalt, der so erlebt wird wie der mathematische. Man denkt wie ein Mathematiker. Aber man denkt nicht in Zahlen oder geometrischen Figuren. Man denkt in Bildern der Geist-Welt. Es ist, im Gegensatz zu dem wachträumenden alten Geist-Erkennen, das vollbewußte Drinnenstehen in der geistigen Welt.
Zu diesem neueren Geist-Erkennen konnte man innerhalb der Theosophischen Gesellschaft kein rechtes Verhältnis gewinnen. Man war mißtrauisch, sobald das Vollbewußtsein an die geistige Welt heranwollte. Man kannte eben nur ein Vollbewußtsein für die Sinnenwelt. Man hatte keinen rechten Sinn dafür, dieses bis in das Geist-Erleben fortzuentwickeln. Man ging eigentlich doch darauf aus, mit Unterdrückung des Vollbewußtseins, zu dem alten Traumbewußtsein wieder zurückzukehren. Und dieses Rückkehren war auch bei Mrs. Besant vorhanden. Sie hatte kaum eine Möglichkeit, die moderne Art der Geist-Erkenntnis zu begreifen. Aber was sie von der Geist-Welt sagte, war doch aus dieser heraus. Und so war sie für mich eine interessante Persönlichkeit.
Weil auch innerhalb der andern Führerschaft der Theosophischen Gesellschaft diese Abneigung gegen vollbewußte Geist-Erkenntnis vorhanden war, konnte
ich mich in bezug auf das Geistige in der Gesellschaft nie mit der Seele heimisch fühlen. Gesellschaftlich war ich gerne in diesen Kreisen; aber deren Seelenverfassungen gegenüber dem Geistigen blieben mir fremd.
Ich war deswegen auch abgeneigt, auf den Kongressen der Gesellschaft in meinen Vorträgen aus meinem eigenen Geist-Erleben heraus zu reden. Ich hielt Vorträge, die auch jemand hätte halten können, der keine eigene Geist-Anschauung hatte. Diese lebte sofort auf in den Vorträgen, die ich nicht innerhalb des Rahmens der Veranstaltungen der Theosophischen Gesellschaft hielt, sondern die herauswuchsen aus dem, was Marie von Sivers und ich von Berlin aus einrichteten.
Da entstand das Berliner, das Münchener, das Stuttgarter usw. Wirken. Andere Orte schlossen sich an. Da verschwand allmählich das Inhaltliche der Theosophischen Gesellschaft; es erstand, was seine Zustimmung fand durch die innere Kraft, die im Anthroposophischen lebte.
Ich arbeitete, während in Gemeinschaft mit Marie von Sivers die Einrichtungen für die äußere Wirksamkeit getroffen wurden, meine Ergebnisse der geistigen Schauung aus. Jch hatte ja auf der einen Seite zwar ein vollkommenes Drinnenstehen in der Geist-Welt; aber ich hatte etwa 1902, und für vieles auch noch die folgenden Jahre zwar Imaginationen, Inspirationen und Intuitionen. Doch schlossen sich diese erst allmählich zu dem zusammen, was dann in meinen Schriften vor die Öffentlichkeit trat.
Durch die Tätigkeit, die Marie von Sivers entfaltete, entstand ganz aus dem Kleinen heraus der philosophischanthroposophische Verlag. Eine kleine Schrift aus Nach-
schriften von Vorträgen zusammengestellt, die ich in der hier erwähnten Berliner freien Hochschule hielt, war ein erstes Verlagswerk. Die Notwendigkeit, meine «Philosophie der Freiheit», die durch ihren bisherigen Verleger nicht mehr verbreitet werden konnte, zu erwerben und selbst für die Verbreitung zu sorgen, gab ein zweites. Wir kauften die noch vorhandenen Exemplare und die Verlagstechte des Buches auf. - Das alles war für uns nicht leicht. Denn wir waren ohne erhebliche Geldmittel.
Aber die Arbeit ging vorwärts, wohl gerade deshalb, weil sie sich auf nichts Äußerliches, sondern allein auf den inneren geistigen Zusammenhang stützen konnte.
XXXIII.
Meine erste Vortragstätigkeit innerhalb der Kreise, die aus der theosophischen Bewegung hervorgewachsen waren, mußte sich nach den Seelenverfassungen dieser Kreise richten. Man hatte da theosophische Literatur gelesen und sich für gewisse Dinge eine gewisse Ausdrucksform angewöhnt. An diese mußte ich mich halten, wenn ich verstanden sein wollte.
Erst im Laufe der Zeit ergab sich mit der vorrückenden Arbeit, daß ich immer mehr auch in der Ausdrucksform die eigenen Wege gehen konnte.
Es ist daher dasjenige, was in den Nachschriften der Vorträge aus den ersten Jahren der anthroposophischen Wirksamkeit vorliegt, zwar innerlich, geistig ein getreues Abbild des Weges, den ich einschlug, um die Geist-Erkenntnis stufenweise zu verbreiten, so daß aus dem Naheliegenden das Fernerliegende erfaßt werden sollte; aber man muß diesen Weg auch wirklich nach seiner Innerlichkeit nehmen.
Für mich waren die Jahre etwa von 1901 bis 1907 oder 1908 eine Zeit, in der ich mit allen Seelenkräften unter dem Eindruck der an mich herankommenden Tatsachen und Wesenheiten der Geistwelt stand. Aus dem Erleben der allgemeinen Geist-Welt wuchsen die besonderen Erkenntnisse heraus. Man erlebt viel, indem man ein solches Buch wie die «Theosophie» aufbaut. Es war bei jedem Schritte mein Bestreben, nur ja im Zusammenhange mit dem wissenschaftlichen Denken zu bleiben. Nun nimmt mit der Erweiterung und Vertiefung des geistigen Erlebens dieses Streben nach einem solchen Zu-
sammenhang besondere Formen an. Meine «Theosophie» scheint in dem Augenblicke, wo ich von der Schilderung der Menschenwesenheit zur Darstellung der «Seelenwelt» und des «Geisterlandes» komme, in einen ganz anderen Ton zu verfallen.
Die Menschenwesenheit schildere ich, indem ich von den Ergebnissen der Sinneswissenschaft ausgehe. Ich versuche die Anthropologie so zu vertiefen, daß der menschliche Organismus in seiner Differenziertheit erscheint. Man kann ihm dann ansehen, wie er in seinen unterschiedenen Organisationsweisen auch in unterschiedener Art mit den ihn durchdringenden geistig-seelischen Wesenhaftigkeiten verbunden ist. Man findet die Lebenstätigkeit in einer Organisationsform; da wird das Eingreifen des Ätherleibes anschaulich. Man findet die Organe der Empfindung und Wahrnehmung; da wird durch die physische Organisation auf den Astralleib verwiesen. Vor meiner geistigen Anschauung standen diese Wesensglieder des Menschen: Ätherleib, Astralleib, Ich usw. geistig da. Für die Darstellung suchte ich sie an das anzuknüpfen, was Ergebnisse der Sinneswissenschaft waren. - Schwierig wird für den, der wissenschaftlich bleiben will, die Darstellung der wiederholten Erdenleben und des sich durch diese hindurch gestaltenden Schicksales. Will man da nicht bloß aus der Geistschau sprechen, so muß man auf Ideen eingehen, die sich zwar aus einer feinen Beobachtung der Sinneswelt ergeben, die aber von den Menschen nicht gefaßt werden. Der Mensch stellt sich vor eine solche feinere Betrachtungsweise in Organisation und Entwickelung anders hin als die Tierheit. Und beobachtet man dieses Anderssein, so stellen sich aus dem
Leben heraus die Ideen vom wiederholten Erdenleben ein. Aber man beachtet es eben nicht. Und so erscheinen dann solche Ideen nicht aus dem Leben geholt, sondern willkürlich gefaßt oder einfach aus älteren Weltanschauungen aufgegriffen.
Ich stand mit vollem Bewußtsein diesen Schwierigkeiten gegenüber. Ich kämpfte mit ihnen. Und wer sich die Mühe nehmen wollte, nachzusehen, wie ich in aufeinanderfolgenden Auflagen meiner «Theosophie» das Kapitel über die wiederholten Erdenleben immer wieder umgearbeitet habe, gerade um dessen Wahrheiten an die Ideen heranzuführen, die von der Beobachtung in der Sinneswelt genommen sind, der wird finden, wie ich bemüht war, der anerkannten Wissenschaftsmethode gerecht zu werden.
Noch schwieriger stellt sich von diesem Gesichtspunkte aus die Sache bei den Kapiteln über die «Seelenwelt» und das «Geisterland». Da erscheinen für den, der die vorangehenden Ausführungen nur so gelesen hat, daß er von dem Inhalte Kenntnis genommen hat, die dargestellten Wahrheiten wie willkürlich hingeworfene Behauptungen. Aber anders ist es bei dem, dessen Ideen-Erleben durch das Lesen dessen, was an die Beobachtung der Sinneswelt angeknüpft ist, eine Erkraftung erfahren hat Für ihn haben sich die Ideen zu selbständigem innerem Leben losgelöst von dem Gebundensein an die Sinne. Und nun kann dann der folgende Seelenvorgang in ihm sich ereignen. Er wird das Leben der losgelösten Ideen gewahn Sie weben und wirken in seiner Seele. Er erlebt sie, wie er durch die Sinne Farben, Töne, Wärme-Eindrücke erlebt. Und wie in Farben, Tönen usw. die Natur-
welt gegeben ist, so ist ihm in den erlebten Ideen die Geist-Welt gegeben. - Wer allerdings so ohne inneren Erlebnis-Eindruck die ersten Ausführungen meiner «Theosophie» liest, daß er nicht ein Umwandeln seines bisherigen Ideen-Erlebens gewahr wird, wer gewissermaßen an die folgenden Ausführungen, trotzdem er das Vorangehende gelesen hat, so herangeht, als ob er das Buch mit dem Kapitel «Seelenwelt» zu lesen beginnen würde, der kann nur zu einem Ablehnen kommen. Ihm erscheinen die Wahrheiten als unbewiesene Behauptungen hingepfahlt. Aber ein anthroposophisches Buch ist darauf berechnet, in innerem Erleben aufgenommen zu werden. Dann tritt schrittweise eine Art Verstehen auf. Dieses kann ein sehr schwaches sein. Aber es kann - und soll - da sein. Und das weitere befestigende Vertiefen durch die Übungen, die in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? » geschildert sind, ist eben ein befestigendes Vertiefen. Zum Fortschreiten auf dem Geisteswege ist das notwendig; aber ein richtig verfaßtes anthroposophisches Buch soll ein Aufwecker des Geistlebens im Leser sein, nicht eine Summe von Mitteilungen. Sein Lesen soll nicht bloß ein Lesen, es soll ein Erleben mit inneren Erschütterungen, Spannungen und Lösungen sein.
Ich weiß, wie weit das, was ich in Büchern gegeben habe, davon entfernt ist, durch seine innere Kraft ein solches Erleben in den lesenden Seelen auszulösen. Aber ich weiß auch, wie bei jeder Seite mein innerer Kampf darnach ging, nach dieser Richtung hin möglichst viel zu erreichen. Ich schildere dem Stile nach nicht so, daß man in den Sätzen mein subjektives Gefühlsleben verspürt.
Ich dämpfe im Niederschreiben, was aus Wärme und tiefer Empfindung heraus ist, zu trockener, mathematischer Stilweise. Aber dieser Stil kann allein ein Aufwecker sein, denn der Leser muß Wärme und Empfindung in sich selbst erwachen lassen. Er kann diese nicht in gedämpfter Besonnenheit einfach aus dem Darsteller in sich hinüberfließen lassen.
XXXIV.
In der Theosophischen Gesellschaft war kaum irgend etwas von Pflege künstlerischer Interessen vorhanden. Das ist von einem gewissen Gesichtspunkte aus damals durchaus begreiflich gewesen, durfte aber nicht so bleiben, wenn die rechte geistige Gesinnung gedeihen sollte. Die Mitglieder einer solchen Gesellschaft haben zunächst alles Interesse für die Wirklichkeit des geistigen Lebens. In der sinnlichen Welt zeigt sich für sie der Mensch nur in seinem vergänglichen, vom Geiste losgelösten Dasein. Kunst scheint ihnen ihre Betätigung innerhalb dieses losgelösten Daseins zu haben. Daher scheint sie außerhalb der gesuchten geistigen Wirklichkeit zu stehen.
Weil dies in der Theosophischen Gesellschaft so war, fühlten sich Künstler nicht zu Hause in ihr.
Marie von Sivers und mir kam es darauf an, auch das Künstlerische in der Gesellschaft lebendig zu machen. Geist-Erkenntnis als Erlebnis gewinnt ja im ganzen Menschen Dasein. Alle Seelenkräfte werden angeregt. In die gestaltende Phantasie leuchtet das Licht des Geist-Erlebens herein, wenn dieses Erleben vorhanden ist.
Aber hier tritt etwas ein, das Hemmungen schafft. Der Künstler hat eine gewisse ängstliche Stimmung gegenüber diesem Hereinleuchten der Geistwelt in die Phantasie. Er will Unbewußtheit in bezug auf das Walten der geistigen Welt in der Seele. Er hat völlig recht, wenn es sich um die «Anregung» der Phantasie durch dasjenige bewußt-besonnene Element handelt, das seit dem Beginn des Bewußtseins-Zeitalters im Kulturleben das herrschende geworden ist. Diese «Anregung» durch das
Intellektuelle im Menschen wirkt ertötend auf die Kunst.
Aber es tritt das gerade Gegenteil auf, wenn Geistinhalt, der wirklich erschaut ist, die Phantasie durchleuchtet. Da aufersteht wieder alle Bildkraft, die nur je in der Menschheit zur Kunst geführt hat. Marie von Sivers stand in der Kunst der Wortgestaltung darinnen; zu der dramatischen Darstellung hatte sie das schönste Verhältnis. So war für das anthroposophische Wirken ein Kunstgebiet da, an dem die Fruchtbarkeit der Geistanschauung für die Kunst erprobt werden konnte.
Das «Wort» ist nach zwei Richtungen der Gefahr ausgesetzt, die aus der Entwickelung der Bewußtseinsseele kommen kann. Es dient der Verständigung im sozialen Leben, und es dient der Mitteilung des logisch-intellektuell Erkannten. Nach beiden Seiten hin verliert das «Wort» seine Eigengeltung. Es muß sich dem «Sinn» anpassen, den es ausdrücken soll. Es muß vergessen lassen, wie im Ton, im Laut, und in der Lautgestaltung selbst eine Wirklichkeit liegt. Die Schönheit, das Leuchtende des Vokals, das Charakteristische des Konsonanten verliert sich aus der Sprache. Der Vokal wird seelen-, der Konsonant geistlos. Und so tritt die Sprache aus der Sphäre ganz heraus, aus der sie stammt, aus der Sphäre des Geistigen. Sie wird Dienerin des intellektuell-erkenntnismäßigen, und des geistfliehenden sozialen Lebens. Sie wird aus dem Gebiet der Kunst ganz herausgerissen.
Wahre Geistanschauung fällt ganz wie instinktiv in das «Erleben des Wortes». Sie lernt auf das seelengetragene Ertönen des Vokals und das geistdurchkraftete Malen des Konsonanten hinempfinden. Sie bekommt Verständnis für das Geheimnis der Sprach-Entwickelung.
Dieses Geheimnis besteht darin, daß einst durch das Wort göttlich-geistige Wesen zu der Menschenseele haben sprechen können, während jetzt dieses Wort nur der Verständigung in der physischen Welt dient.
Man braucht einen an dieser Geisteinsicht entzündeten Enthusiasmus, um das Wort wieder in seine Sphäre zurückzuführen. Marie von Sivers entfaltete diesen Enthusiasmus. Und so brachte ihre Persönlichkeit der anthroposophischen Bewegung die Möglichkeit, Wort und Wortgestaltung künstlerisch zu pflegen. Es wuchs zu der Betätigung für Mitteilung aus der Geistwelt hinzu die Pflege der Rezitations- und Deklamationskunst, die nun immer mehr einen in Betracht kommenden Anteil an den Veranstaltungen bildete, die innerhalb des anthroposophischen Wirkens stattfanden.
Marie von Sivers' Rezitation bei diesen Veranstaltungen war der Ausgangspunkt für den künstlerischen Einschlag in die anthroposophische Bewegung. Denn es führt eine gerade Linie der Entwickelung von diesen «Rezitationsbeigaben» zu den dramatischen Darstellungen, die dann in München sich neben die anthroposophischen Kurse hinstellten.
Wir wuchsen dadurch, daß wir mit der Geist-Erkenntnis Kunst entfalten durften, immer mehr in die Wahrheit des modernen Geist-Erlebens hinein. Denn Kunst ist ja aus dem ursprünglichen traum-bildhaften Geisterleben herausgewachsen. Sie mußte in der Zeit, als in der Menschheitsentwickelung das Geist-Erleben zurücktrat, ihre Wege sich suchen; sie muß sich mit diesem Erleben wieder zusammenfinden, wenn dieses in neuer Gestalt in die Kulturentfaltung eintritt.
XXXV.
Der Beginn meiner anthroposophischen Betätigung fällt in eine Zeit, in der bei Vielen eine Unbefriedigtheit mit den Erkenntnisrichtungen der unmittelbar vorangehenden Zeit vorhanden war. Man wollte einen Weg aus demjenigen Seinsgebiete herausfinden, in das man sich dadurch abgeschlossen hatte, daß man als «sichere» Erkenntnis nur gelten gelassen hatte, was mit mechanistischen Ideen erfaßt werden kann. Mir gingen diese Bestrebungen mancher Zeitgenossen nach einer Art von Geist-Erkenntnis recht nahe. Biologen wie Oskar Hertwig, der als Schüler von Haeckel begonnen, dann aber den Darwinismus verlassen hatte, weil nach seiner Ansicht die Impulse, die dieser kennt, keine Erklärung des organischen Werdens abgeben können, waren für mich Persönlichkeiten, in denen sich mir das Erkenntnis-Sehnen der Zeit offenbarte.
Aber ich empfand, wie auf all diesem Sehnen ein Druck lastete. Der Glaube, man dürfe als Wissen nur ansehen, was mit Maß, Zahl und Gewicht im Reich der Sinne erforscht werden kann, hat diesen Druck als sein Ergebnis gezeitigt. Man wagte nicht, ein innerlich aktives Denken zu entfalten, um durch dieses die Wirklichkeit näher zu erleben, als man sie mit den Sinnen erlebt. So blieb es denn dabei, daß man sagte: mit den Mitteln, die man bisher zur Erklärung auch der höheren Wirklichkeitsformen wie der organischen angewendet hat, geht es nicht weiter. Aber wenn man dann zu Positivem kommen sollte, wenn man sagen sollte, was in der Lebenstätigkeit wirkt, da bewegte man sich in unbestimmten Ideen.
Es fehlte bei denjenigen, die aus der mechanistischen Welterklärung herausstrebten, zumeist der Mut, sich zu gestehen: wer diesen Mechanismus überwinden will, der muß auch die Denkgewohnheiten überwinden, die zu ihm geführt haben. Ein Geständnis wollte nicht erscheinen, das die Zeit gebraucht hätte. Es ist dieses: mit der Orientierung auf die Sinne hin dringt man in das ein, was mechanistisch ist. Man hat sich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts an diese Orientierung gewöhnt. Man sollte jetzt, da das Mechanistische unbefriedigt läßt, nicht mit derselben Orientierung in höhere Gebiete dringen wollen. - Die Sinne im Menschen geben sich ihre Entfaltung selbst. Mit dem, was sie sich so geben, wird man aber niemals etwas anderes als das Mechanische schauen. Will man mehr erkennen, so muß man von sich aus den tiefer liegenden Erkenntniskräften eine Gestalt geben, die den Sinnes-Kräften die Natur gibt. Die Erkenntniskräfte für das Mechanische sind durch sich selbst wach; diejenigen für die höheren Wirklichkeitsformen müssen geweckt werden.
Dieses Selbst-Geständnis des Erkenntnisstrebens erschien mir als eine Zeit-Notwendigkeit.
Ich fühlte mich glücklich, wo ich Ansätze dazu wahrnahm. So lebt in schönster Erinnerung in mir ein Besuch in Jena. Ich hatte in Weimar Vorträge über anthroposophische Themen zu halten. Es wurde auch ein Vortrag in kleinerem Kreise in Jena veranlaßt. Nach demselben gab es noch ein Zusammensein mit einem ganz kleinen Kreise. Man wollte über dasjenige diskutieren, was Theosophie zu sagen hatte. In diesem Kreise war Max Scheler, der damals in Jena als Dozent für Philo-
sophie wirkte. In eine Erörterung über dasjenige, was er an meinen Ausführungen empfand, lief bald die Diskussion ein. Und ich empfand sogleich den tieferen Zug, der in seinem Erkenntnisstreben waltete. Es war innere Toleranz, die er meiner Anschauung entgegenbrachte. Diejenige Toleranz, die für denjenigen notwendig ist, der wirklich erkennen will.
Wir diskutierten über die erkenntnistheoretische Rechtfertigung des Geist-Erkennens. Wir sprachen über das Problem, wie sich das Eindringen in die Geistwirklichkeit nach der einen Seite ebenso erkenntnistheoretisch müsse begründen lassen, wie dasjenige in die Sinnes-Wirklichkeit nach der andern Seite.
Schelers Art, zu denken, machte auf mich einen genialischen Eindruck. Und bis heute verfolge ich seinen Erkenntnisweg mit dem tiefsten Interesse. Innige Befriedigung gewährte es mir immer, wenn ich - leider ganz selten - dem Manne, der mir damals so sympathisch geworden war, wieder begegnen konnte.
Für mich waren solche Erlebnisse bedeutsam. Jedesmal, wenn sie kamen, war wieder eine innere Notwendigkeit da, die Sicherheit des eigenen Erkenntnisweges aufs neue zu prüfen. Und in diesem immer wiederkehrenden Prüfen entfalten sich die Kräfte, die dann auch immer weitere Gebiete des geistigen Daseins erschließen.
Es liegen nun aus meinem anthroposophischen Wirken zwei Ergebnisse vor; erstens meine vor aller Welt veröffentlichten Bücher, zweitens eine große Reihe von Kursen, die zunächst als Privatdruck gedacht und verkäuflich nur an Mitglieder der Theosophischen (später Anthroposophischen) Gesellschaft sein sollten. Es waren
dies Nachschriften, die bei den Vorträgen mehr oder weniger gut gemacht worden sind und die - wegen mangelnder Zeit - nicht von mir korrigiert werden konnten. Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn mündlich gesprochenes Wort mündlich gesprochenes Wort geblieben wäre. Aber die Mitglieder wollten den Privatdruck der Kurse. Und so kam er zustande. Hätte ich Zeit gehabt, die Dinge zu korrigieren, so hätte vom Anfange an die Einschränkung «Nur für Mitglieder» nicht zu bestehen gebraucht. Jetzt ist sie seit mehr als einem Jahre ja fallen gelassen.
Hier in meinem «Lebensgang» ist notwendig, vor allem zu sagen, wie sich die beiden: meine veröffentlichten Bücher und diese Privatdrucke in das einfügen, was ich als Anthroposophie ausarbeitete.
Wer mein eigenes inneres Ringen und Arbeiten für das Hinstellen der Anthroposophie vor das Bewußtsein der gegenwärtigen Zeit verfolgen will, der muß das an Hand der allgemein veröffentlichten Schriften tun. In ihnen setzte ich mich auch mit alle dem auseinander, was an Erkenntnisstreben in der Zeit vorhanden ist. Da ist gegeben, was sich mir in «geistigem Schauen» immer mehr gestaltete, was zum Gebäude der Anthroposophie - allerdings in vieler Hinsicht in unvollkommener Art - wurde.
Neben diese Forderung, die «Anthroposophie» aufzubauen und dabei nur dem zu dienen, was sich ergab, wenn man Mitteilungen aus der Geist-Welt der allgemeinen Bildungswelt von heute zu übergeben hat, trat nun aber die andere, auch dem voll entgegenzukommen, was aus der Mitgliedschaft heraus als Seelenbedürfnis, als Geistessehnsucht sich offenbarte.
Da war vor allem eine starke Neigung vorhanden, die Evangelien und den Schriftinhalt der Bibel überhaupt in dem Lichte dargestellt zu hören, das sich als das anthroposophische ergeben hatte. Man wollte in Kursen über diese der Menschheit gegebenen Offenbarungen hören.
Indem interne Vortragskurse im Sinne dieser Forderung gehalten wurden, kam dazu noch ein anderes. Bei diesen Vorträgen waren nur Mitglieder. Sie waren mit den Anfangs-Mitteilungen aus Anthroposophie bekannt. Man konnte zu ihnen eben so sprechen, wie zu Vorgeschrittenen auf dem Gebiete der Anthroposophie. Die Haltung dieser internen Vorträge war eine solche, wie sie eben in Schriften nicht sein konnte, die ganz für die Öffentlichkeit bestimmt waren.
Ich durfte in internen Kreisen in einer Art über Dinge sprechen, die ich für die öffentliche Darstellung, wenn sie für sie von Anfang an bestimmt gewesen wären, hätte anders gestalten müssen.
So liegt in der Zweiheit, den öffentlichen und den privaten Schriften, in der Tat etwas vor, das aus zwei verschiedenen Untergründen stammt. Die ganz öffentlichen Schriften sind das Ergebnis dessen, was in mir rang und arbeitete; in den Privatdrucken ringt und arbeitet die Gesellschaft mit. Ich höre auf die Schwingungen im Seelenleben der Mitgliedschaft, und in meinem lebendigen Drinnenleben in dem, was ich da höre, entsteht die Haltung der Vorträge.
Es ist nirgends auch nur in geringstem Maße etwas gesagt, was nicht reinstes Ergebnis der sich aufbauenden Anthroposophie wäre. Von irgend einer Konzession an
Vorurteile oder Vorempfindungen der Mitgliedschaft kann nicht die Rede sein. Wer diese Privatdrucke liest, kann sie im vollsten Sinne eben als das nehmen, was Anthroposophie zu sagen hat. Deshalb konnte ja auch ohne Bedenken, als die Anklagen nach dieser Richtung zu drängend wurden, von der Einrichtung abgegangen werden, diese Drucke nur im Kreise der Mitgliedschaft zu verbreiten. Es wird eben nur hingenommen werden müssen, daß in den von mir nicht nachgesehenen Vorlagen sich Fehlerhaftes findet.
Ein Urteil über den Inhalt eines solchen Privatdruckes wird ja allerdings nur demjenigen zugestanden werden können, der kennt, was als Urteils-Voraussetzung angenommen wird. Und das ist für die allermeisten dieser Drucke mindestens die anthroposophische Erkenntnis des Menschen, des Kosmos, insofern sein Wesen in der Anthroposophie dargestellt wird, und dessen, was als « anthroposophische Geschichte» in den Mitteilungen aus der Geist-Welt sich findet.
XXXVI.
Nicht eigentlich in den Rahmen dieser Darstellung gehört eine Einrichtung, die innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft so entstanden ist, daß dabei an einen Zusammenhang mit der Öffentlichkeit gar nicht gedacht worden ist. Sie soll nun doch charakterisiert werden, weil auch von ihr her der Inhalt zu Angriffen auf mich genommen worden ist.
Einige Jahre nach dem Beginne der Tätigkeit in der Theosophischen Gesellschaft trug man von einer gewissen Seite her Marie von Sivers und mir die Leitung einer Gesellschaft von der Art an, wie sie sich erhalten haben mit Bewahrung der alten Symbolik und der kultischen Veranstaltungen, in welchen die «alte Weisheit» verkörpert war. Ich dachte nicht im entferntesten daran, irgendwie im Sinne einer solchen Gesellschaft zu wirken. Alles Anthroposophische sollte und mußte aus seinem eigenen Erkenntnis- und Wahrheitsquell hervorgehen. Von dieser Zielsetzung sollte um das Kleinste nicht abgegangen werden. Aber ich hatte immer Achtung vor dem historisch Gegebenen. In ihm lebt der Geist, der sich im Menschheitswerden entwickelt. Und so war ich auch dafür, daß, wenn irgend möglich, Neu-Entstehendes an historisch Vorhandenes anknüpfe. Ich nahm daher das Diplom der angedeuteten Gesellschaft, die in der von Yarker vertretenen Strömung lag. Sie hatte die freimaurerischen Formen der sogenannten Hochgrade. Ich nahm nichts, aber auch wirklich gar nichts aus dieser Gesellschaft mit als die rein formelle Berechtigung, in histo-
rischer Anknüpfung selbst eine symbolisch-kultische Betätigung einzurichten. Alles, was in den «Handlungen» inhaltlich dargestellt
wurde, die innerhalb der von mir gemachten Einrichtung gepflogen wurden, war ohne historische Anlehnung an irgend eine Tradition. Im Besitze der formellen Diplomierung wurde nur solches gepflegt, das sich als Verbildlichung der anthroposophischen Erkenntnis ergab. Und getan ist dies worden aus dem Bedürfnis der Mitgliedschaft heraus. Man strebte neben der Verarbeitung der Ideen, in die gehüllt die Geist-Erkenntnis gegeben wurde, etwas an, das unmittelbar zur Anschauung, zum Gemüt spricht. Und solchen Forderungen wollte ich entgegenkommen. Hätte sich das Angebot von Seite der angedeuteten Gesellschaft nicht eingestellt, so hätte ich die Einrichtung einer symbolisch-kultischen Betätigung ohne historische Anknüpfung getroffen.
Aber eine «Geheimgesellschaft» war damit nicht geschaffen. Wer an die Einrichtung herantrat, dem wurde in der allerdeutlichsten Weise gesagt, daß er keinem Orden beitrete, sondern daß er als Teilnehmer von zeremoniellen Handlungen eine Art Versinnlichung, Demonstration der geistigen Erkenntnisse erleben werde. Wenn einiges in den Formen verlief, in denen in hergebrachten Orden Mitglieder aufgenommen oder in höhere Grade befördert wurden, so hatte auch das nicht den Sinn, einen solchen Orden zu führen, sondern eben nur den, geistiges Aufsteigen in Seelen-Erlebnissen durch sinnliche Bilder zu veranschaulichen.
Daß es sich dabei nicht um die Betätigung in irgend einem bestehenden Orden, oder um Übermittelung von
Dingen handelte, die in solchen Orden übermittelt wurden, dafür ist ein Beweis der, daß an den von mir eingerichteten zeremoniellen Handlungen Mitglieder der verschiedensten Ordensströmungen teilnahmen und in ihnen eben ganz anderes fanden als in ihren Orden.
Einmal kam eine Persönlichkeit, die zum erstenmal eine Handlung bei uns mitgemacht hatte, unmittelbar nach derselben zu mir. Diese Persönlichkeit war in einem Orden hochgraduiert. Sie wollte, unter dem Eindrucke des Miterlebten, mir ihre Ordens-Insignien übertragen. Denn sie vermeinte, sie könne nun, nachdem sie einen wirklichen Geistinhalt erlebt habe, weiter das im Formellen Steckenbleibende nicht mehr mitmachen. Ich brachte die Sache in Ordnung. Denn Anthroposophie darf keinen Menschen aus den Lebenszusammenhängen, in denen er ist, herausreißen. Sie soll zu diesen Zusammenhängen etwas hinzufügen, aber nichts von ihnen nehmen. So blieb denn die betreffende Persönlichkeit in ihrem Orden und machte im weiteren bei uns die symbolischen Handlungen mit.
Es ist nur zu begreiflich, daß im Bekanntwerden von Einrichtungen wie die geschilderte, sich Mißverständnisse einstellen. Es gibt eben viele Menschen, denen gerade die Äußerlichkeit des Hinzugehörens zu etwas wichtiger erscheint als der Inhalt, der ihnen gegeben wird. Und so wurde auch von manchen Teilnehmern von der Sache gesprochen, als ob sie einem Orden angehörten. Sie verstanden nicht zu unterscheiden, daß ihnen bei uns ohne Ordenszusammenhang Dinge demonstriert wurden, die sonst nur innerhalb von Ordenszusammen-hängen gegeben wurden.
Es wurde bei uns eben auch auf diesem Gebiete mit den alten Traditionen gebrochen. Es wurde gearbeitet, wie man arbeiten muß, wenn man in ursprünglicher Art den Geist-Inhalt erforscht aus den Bedingungen des vollbesonnenen Seelen-Erlebens.
Daß man später in Bescheinigungen, die von Marie von Sivers und mir bei der Anknüpfung an die historische Yarker-Einrichtung unterschrieben worden sind, hat die Ausgangspunkte für allerlei Verleumdungen nehmen wollen, ist etwas, das, um solche Verleumdungen zu schmieden, das Lächerliche mit der Grimasse des Ernstes behandelt. Unsere Unterschriften waren unter «Formeln» gegeben. Das Übliche war eingehalten worden. Und während wir unsere Unterschriften gaben, sagte ich mit aller Deutlichkeit: das alles ist Formalität, und die Einrichtung, die ich veranlasse, wird nichts herübernehmen von der Yarker-Einrichtung.
Es ist selbstverständlich nachträglich leicht, Erwägungen darüber anzustellen, wieviel «gescheiter» es doch gewesen wäre, nicht an Einrichtungen anzuknüpfen, die sich später von den Verleumdern mit gebrauchen ließen. Aber ich möchte, in aller Bescheidenheit, bemerken, daß ich in dem Lebensalter, das hier in Betracht kommt, noch zu den Leuten gehörte, die bei andern, mit denen sie zu tun hatten, Geradheit und nicht Krummheit in den Wegen voraussetzten. An diesem Glauben an die Menschen änderte auch das geistige Schauen nichts. Dieses soll nicht dazu mißbraucht werden, die inneren Absichten der Mitmenschen zu erforschen, wenn diese Erforschung nicht im Verlangen der betreffenden Menschen selbst liegt. In andern Fällen bleibt die Erforschung des
Innern anderer Seelen etwas dem Geist-Erkenner Verbotenes, wie die unberechtigte Öffnung eines Briefes etwas Verbotenes bleibt. Und so steht man Menschen, mit denen man zu tun hat, so gegenüber wie jeder andere, der keine Geist-Erkenntnis hat. Aber es gibt eben den Unterschied, den andern für geradlinig in seinen Absichten zu nehmen, bis man das Gegenteil erfahren hat, oder der ganzen Welt harmvoll gegenüberzustehen. Ein soziales Zusammenwirken der Menschen ist bei der letztern Stimmung unmöglich, denn ein solches kann sich nur auf Vertrauen, nicht auf Mißtrauen aufbauen.
Diese Einrichtung, die in einer Kult-Symbolik gab, was Geist-Inhalt ist, war für viele Teilnehmer an der Anthroposophischen Gesellschaft eine Wohltat. Da wie auf allen Gebieten des anthroposophischen Wirkens auch auf diesem alles ausgeschlossen war, was aus dem Rahmen des besonnenen Bewußtseins herausfiel, so konnte nicht an unberechtigte Magie, an Suggestionswirkungen und dergleichen gedacht werden. - Aber die Mitglieder bekamen das, was auf der einen Seite zu ihrer Ideen-Auffassung sprach, auch noch so, daß das Gemüt in unmittelbarer Anschauung mitgehen konnte. Das war für viele etwas, das sie auch wieder in die Ideengestaltung besser hinein-führte. Mit dem Kriegsbeginn hörte dann die Möglichkeit auf, in der Pflege solcher Einrichtungen fortzufahren. Man hätte, trotzdem nichts von einer Geheimgesellschaft vorlag, die Einrichtung für eine solche genommen. Und so schlief diese symbolisch-kultische Abteilung der Anthroposophischen Bewegung seit Mitte 1914 ein.
Daß aus dieser für jeden, der die Sache mit gutem Willen und Wahrheitssinn ansieht, absolut einwandfreien
Einrichtung heraus solche Persönlichkeiten, die daran teilgenommen haben, zu verleumderischen Anklägern geworden sind, ist eine jener Abnormitäten im Menschheits-Verhalten, die entstehen, wenn sich Menschen, die doch innerlich nicht echt sind, an Bewegungen mit echtem Geist-Inhalt heranmachen. Sie erwarten Dinge, die ihrem Trivial-Seelenleben entsprechend sind, und indem sie solche selbstverständlich nicht finden, wenden sie sich gegen die Einrichtung, der sie sich - aber mit unbewußter Unaufrichtigkeit - erst zugewendet haben.
Eine Gesellschaft wie die Anthroposophische konnte nicht anders, als aus den Seelenbedürfnissen ihrer Mitglieder heraus gestaltet werden. Es konnte nicht ein abstraktes Programm geben, das da besagte: in der Anthroposophischen Gesellschaft wird dies und das getan, sondern es mußte aus der Wirklichkeit heraus gearbeitet werden. Diese Wirklichkeit sind aber eben die Seelenbedürfnisse der Mitglieder. Anthroposophie als Lebensinhalt wurde aus ihren eigenen Quellen heraus gestaltet. Sie war als geistige Schöpfung vor die Mitwelt getreten. Viele von denen, die einen inneren Zug zu ihr hatten, suchten mit andern zusammenzuarbeiten. Dadurch ergab sich eine Gestaltung der Gesellschaft aus Persönlichkeiten, von denen die einen mehr Religiöses, andere Wissenschaftliches, andere Künstlerisches suchten. Und was gesucht wurde, mußte gefunden werden können.
Schon wegen dieses Arbeitens aus der Wirklichkeit der Seelenbedürfnisse der Mitglieder, müssen die Privat-drucke anders beurteilt werden, als das in die volle Öffentlichkeit von Anfang an Gesandte. Als mündliche, nicht zum Druck bestimmte Mitteilungen waren die Inhalte
dieser Drucke gemeint. Und, worüber gesprochen wurde, war abgelauscht den im Laufe der Zeit auftretenden Seelenbedürfnissen der Mitglieder.
Was in den veröffentlichten Schriften steht, ist den Forderungen der Anthroposophie als solcher entsprechend; an der Art, wie die Privatdrucke sich entfalteten, hat im angedeuteten Sinne die Seelenkonfiguration der ganzen Gesellschaft mitgearbeitet.
XXXVII.
Während die anthroposophischen Erkenntnisse in die Gesellschaft so getragen wurden, wie sich das - zum Teile - aus den Privatdrucken ergibt, pflegten Marie von Sivers und ich in gemeinsamen Arbeiten namentlich das künstlerische Element, das ja vom Schicksal bestimmt war, ein Belebendes der anthroposophischen Bewegung zu werden.
Da war auf der einen Seite das Rezitatorische, mit seiner Hinorientierung auf die dramatische Kunst, das den Gegenstand der Arbeit bildete, die getan werden mußte, damit die anthroposophische Bewegung den rechten Inhalt bekäme.
Da war aber auf der andern Seite für mich die Möglichkeit, mich auf den Reisen, die im Dienste der Anthroposophie gemacht werden mußten, in die Entwickelung der Architektur, Plastik und Malerei zu vertiefen.
Ich habe an verschiedenen Stellen dieser Lebensbeschreibung von der Bedeutung gesprochen, die das Künstlerische für einen Menschen hat, der innerhalb der geistigen Welt erlebt.
Nun konnte ich aber die meisten Kunstwerke der Menschheitsentwickelung bis in die Zeit meines anthroposophischen Wirkens hinein nur in Nachbildungen studieren. An Originalen war mir nur zugänglich, was in Wien, Berlin und einigen Orten Deutschlands ist.
Als nun die Reisen für die Anthroposophie in Gemeinsamkeit mit Marie von Sivers gemacht wurden, traten mir die Schätze der Museen im weitesten europäischen Umkreise entgegen. Und so machte ich vom Beginne des
Jahrhunderts ab, also in meinem fünften Lebensjahrzehnt, eine hohe Schule des Kunststudiums, und im Zusammenhange damit, eine Anschauung der geistigen Entwickelung der Menschheit durch. Überall war da Marie von Sivers mir zur Seite, die mit ihrem feinen und geschmackvollen Eingehen auf alles, was ich in der Kunst- und Kulturanschauung erleben durfte, selbst in schöner Weise alles, ergänzend, miterlebte. Sie verstand, wie diese Erlebnisse in all das flossen, was dann die Ideen der Anthroposophie beweglich machte. Denn es durchdrang, was an Kunst-Eindrücken meine Seele empfing, das, was ich in Vorträgen wirksam zu machen hatte.
Im praktischen Anschauen der großen Kunstwerke trat vor unsere Seelen die Welt, aus der noch eine andere Seelenkonfiguration aus älteren Zeiten in die neuen herüberspricht. Wir konnten die Seelen versenken in die Geistigkeit der Kunst, die noch aus Cimabue spricht. Aber wir konnten uns auch durch das Anschauen in der Kunst in den gewaltigen Geisteskampf vertiefen, den Thomas von Aquino in der Hochblüte der Scholastik gegen den Arabismus führte.
Für mich war die Beobachtung der baukünstlerischen Entwickelung von besonderer Bedeutung. Im stillen Anblick der Stilgestaltung erwuchs in meiner Seele, was ich dann in die Formen des Goetheanums prägen durfte.
Das Stehen vor dem Abendmahl des Lionardo in Mailand, vor den Schöpfungen Raphaels und Michel Angelos in Rom und die im Anschlusse an diese Betrachtungen mit Marie von Sivers geführten Gespräche müssen, wie ich glaube, gerade dann gegenüber der Schicksalsfügung
dankbar empfunden werden, wenn sie erst im reiferen Alter zum ersten Male vor die Seele treten.
Doch ich müßte ein Buch von einem nicht geringen Umfange schreiben, wenn ich auch nur kurz schildern wollte, was ich in der angedeuteten Art erlebte.
Man sieht ja, wenn die geistige Anschauung dahinter steht, so tief in die Geheimnisse der Menschheitsentwickelung hinein durch den Blick, der sich in die «Schule von Athen» oder in die «Disputa» betrachtend verliert.
Und schreitet man mit der Beobachtung von Cimabue durch Giotto bis zu Raphael vor, so hat man das allmähliche Abdämmern einer älteren Geist-Anschauung der Menschheit zu der modernen, mehr naturalistischen vor sich. Was sich mir aus der geistigen Anschauung als das Gesetz der Menschheitsentwickelung ergeben hatte: es tritt, sich deutlich offenbarend, in dem Werden der Kunst der Seele entgegen.
Es gab ja immer die tiefste Befriedigung, wenn ich sehen konnte, wie durch dieses fortwährende Eintauchen in das Künstlerische die anthroposophische Bewegung neues Leben empfing. Man braucht, um mit den Ideen die Wesenhaftigkeiten des Geistigen zu umfassen und sie ideenhaft zu gestalten, Beweglichkeit der Ideen-Tätigkeit. Die Erfüllung der Seele mit dem Künstlerischen gibt sie.
Und es war ja durchaus nötig, die Gesellschaft vor dem Eindringen aller derjenigen inneren Unwahrheiten zu bewahren, die mit der falschen Sentimentalität zusammen-hängen. Eine geistige Bewegung ist ja diesem Eindringen immer ausgesetzt. Belebt man den mitteilenden Vortrag durch die beweglichen Ideen, die man selbst dem Leben in dem Künstlerischen verdankt, so wird die aus der Sen-
timentalität kommende innere Unwahrhaftigkeit, die in dem Zuhörenden steckt, hinweggebannt. - Das Künstlerische, das von Empfindung und Gefühl zwar getragen wird, das aber aufstrebt zur lichterfüllten Klarheit in der Gestaltung und Anschauung, kann das wirksamste Gegengewicht gegen die falsche Sentimentalität geben.
Und da empfinde ich es denn als ein besonders günstiges Geschick für die anthroposophische Bewegung, daß ich in Marie von Sivers eine Mitarbeiterin vom Schicksal zuerteilt bekam, die aus ihren tiefsten Anlagen heraus dieses künstlerisch-gefühlsgetragene, aber unsentimentale Element mit vollem Verständnis zu pflegen verstand.
Es war eine fortdauernde Gegenwirkung gegen dieses innerlich unwahre sentimentale Element notwendig. Denn in eine geistige Bewegung dringt es immer wieder ein. Man kann es nicht etwa einfach abweisen, oder ignorieren. Denn die Menschen, die sich zunächst diesem Elemente hingeben, sind in vielen Fällen in ihren tiefsten Seelenuntergründen doch Suchende. Aber es wird ihnen zunächst schwierig, zu dem mitgeteilten Inhalt aus der geistigen Welt ein festes Verhältnis zu gewinnen. Sie suchen in der Sentimentalität unbewußt eine Art Betäubung. Sie wollen ganz besondere Wahrheiten erfahren, esoterische. Sie entwickeln den Drang, sich mit diesen sektiererisch in Gruppen abzusondern.
Das Rechte zur alleinigen orientierenden Kraft der ganzen Gesellschaft zu machen, darauf kommt es an. So daß nach der einen, oder der andern Seite Abirrende immer wieder sehen können, wie diejenigen wirken, die die zentralen Träger der Bewegung sich nennen dürfen, weil sie deren Begründer sind. Positives Arbeiten für die In-
halte der Anthroposophie, nicht kämpfend gegen Auswüchse auftreten, das galt Marie von Sivers und mir als das Wesentliche. Selbstverständlich gab es Ausnahmefälle, in denen auch das Bekämpfen notwendig wurde.
Für mich ist zunächst die Zeit bis zu meinem Pariser Zyklus von Vorträgen etwas als Entwickelungsvorgänge in der Seele Geschlossenes. Ich hielt diese Vorträge 1906 während des theosophischen Kongresses. Einzelne Teilnehmer des Kongresses hatten den Wunsch ausgesprochen, diese Vorträge neben den Veranstaltungen des Kongresses zu hören. Ich hatte damals in Paris die persönliche Bekanntschaft Edouard Schurés, zusammen mit Marie von Sivers gemacht, die schon längere Zeit mit ihm in Briefwechsel gestanden hat und die sich mit Übersetzung seiner Werke beschäftigt hatte. Er war unter den Zuhörern. So hatte ich auch die Freude, Mereschkowski und Minsky und andere russische Dichter öfters unter den Zuhörern zu haben.
Es wurde von mir in diesem Vortragszyklus das gegeben, was ich an den für das Menschenwesen leitenden spirituellen Erkenntnissen als in mir «reif» empfand.
Dieses «Reif-Empfinden» der Erkenntnisse ist etwas Wesentliches im Erforschen der geistigen Welt. Um dieses Empfinden zu haben, muß man eine Anschauung erlebt haben, wie sie zunächst in der Seele herauftaucht. Man empfindet sie zuerst noch als unleuchtend, als unscharf in den Konturen. Man muß sie wieder in die Tiefen der Seele hinuntersinken lassen zur «Reifung». Das Bewußtsein ist noch nicht weit genug, den geistigen Inhalt der Anschauung zu erfassen. Die Seele in ihren geistigen Tiefen muß mit diesem Inhalt in der gei-
stigen Welt ungestört durch das Bewußtsein zusammensein.
In der äußeren Naturwissenschaft behauptet man eine Erkenntnis nicht früher, als bis man alle nötigen Experimente und Sinnesbeobachtungen abgeschlossen hat, und bis die in Betracht kommenden Rechnungen einwandfrei sind. - In der Geisteswissenschaft ist keineswegs weniger methodische Gewissenhaftigkeit und Erkenntnis-Disziplin notwendig. Man geht nur etwas andere Wege. Man muß das Bewußtsein in seinem Verhältnis zu der erkennenden Wahrheit prüfen. Man muß in Geduld, Ausdauer und innerer Gewissenhaftigkeit «warten» können, bis das Bewußtsein diese Prüfung besteht. Es muß sich in seinem Ideenvermögen auf einem gewissen Gebiete stark genug gemacht haben, um die Anschauung, um die es sich handelt, in das Begriffsvermögen hereinzunehmen.
Im Pariser Zyklus von Vorträgen habe ich eine Anschauung vorgebracht, die eine lange «Reifung» in meiner Seele hat durchmachen müssen. Nachdem ich auseinandergesetzt hatte, wie sich die Glieder der Menschenwesenheit: physischer Leib, Ätherleib - als Vermittler der Lebenserscheinungen -, Astralleib - als Vermittler der Empfindungs- und Willenserscheinungen - und der «Ich-Träger» im allgemeinen zu einander verhalten, teilte ich die Tatsache mit, daß der Ätherleib des Mannes weiblich; der Ätherleib der Frau männlich ist. Damit war innerhalb der Anthroposophie ein Licht geworfen auf eine Grundfrage des Daseins, die gerade damals viel behandelt worden ist. Man erinnere sich nur an das Buch des unglücklichen Weininger: «Geschlecht und Charakter» und an die damalige Dichtung.
Aber die Frage war in die Tiefen der Menschenwesenheit geführt. Mit seinem physischen Leib ist der Mensch ganz anders in die Kräfte des Kosmos eingefügt als mit seinem Ätherleib. Durch den physischen Leib steht der Mensch in den Kräften der Erde; durch den Ätherleib in den Kräften des außerirdischen Kosmos. Männlich und Weiblich wird an die Weltgeheimnisse herangeführt.
Für mich war diese Erkenntnis etwas, das zu den erschütterndsten inneren Seelen-Erlebnissen gehörte. Denn ich empfand immer von neuem, wie man sich geduldig-wartend einer geistigen Anschauung nähern muß, und wie man dann, wenn man die «Reife des Bewußtseins» erlebt, mit den Ideen zugreifen muß, um die Anschauung in den Bereich der menschlichen Erkenntnis hereinzuversetzen.
XXXVIII.
In dem folgenden wird die Darstellung meines Lebensganges von einer Geschichte der anthroposophischen Bewegung schwer zu trennen sein. Und dennoch, ich möchte nur so viel aus der Geschichte der Gesellschaft bringen, als für die Darstellung meines Lebensganges notwendig ist. - Dies wird schon bei der Namensnennung der tätigen Mitglieder in Betracht kommen. Ich komme mit der Schilderung eben zu nahe an die Gegenwart heran, als daß nicht Namensnennungen allzu leicht auf Mißverständnisse stoßen könnten. Bei allem guten Willen wird mancher, der einen andern genannt findet und sich nicht, eine bittere Empfindung haben. - Ich werde im wesentlichen mit Namen nur diejenigen Persönlichkeiten, die außerhalb ihrer Wirksamkeit in der Gesellschaft im geistigen Leben Zusammenhänge haben, nennen; dagegen nicht diejenigen, die solche Zusammenhänge nicht in die Gesellschaft mitgebracht haben.
In Berlin und in München waren gewissermaßen die zwei entgegengesetzten Pole der anthroposophischen Wirksamkeit zu entfalten. Es kamen ja an die Anthroposophie Persönlichkeiten heran, die weder in der naturwissenschaftlichen Weltanschauung noch in den traditionellen Bekenntnissen dasjenige an geistigem Inhalt fanden, was ihre Seelen suchen mußten. In Berlin konnte ein Zweig der Gesellschaft und eine Zuhörerschaft für die öffentlichen Vorträge nur aus den Kreisen derjenigen Persönlichkeiten entstehen, die auch alles ablehnten, was an Weltanschauungen im Gegensatze zu den traditionellen Bekenntnissen sich gebildet hatte. Denn die Anhänger
solcher auf Rationalismus, Intellektualismus usw. begründeten Weltanschauungen fanden in dem, was Anthroposophie zu geben hatte, Phantastik, Aberglaube usw. Eine Zuhörer- und Mitgliederschaft erstand, welche die Anthroposophie aufnahm, ohne mit Gefühl oder Ideen nach anderem als nach dieser gerichtet zu sein. Was man ihr von anderer Seite gegeben hatte, das befriedigte sie nicht. Dieser Seelenstimmung mußte Rechnung getragen werden. Und indem das geschah, vergrößerte sich immer mehr die Mitglieder- wie auch die Zuhörerzahl bei öffentlichen Vorträgen. Es entstand ein anthroposophisches Leben, das gewissermaßen in sich geschlossen war und wenig nach dem blickte, was sonst an Versuchen sich bildete, in die geistige Welt Blicke zu tun. Die Hoffnungen lagen in der Entfaltung der anthroposophischen Mitteilungen. Man erwartete, im Wissen von der geistigen Welt immer weiter zu kommen.
Anders war das in München. Da wirkte in die anthroposophische Arbeit von vornherein das künstlerische Element. Und in dieses ließ sich eine Weltanschauung wie die Anthroposophie in ganz anderer Art aufnehmen als in den Rationalismus und Intellektualismus. Das künstlerische Bild ist spiritueller als der rational istische Begriff. Es ist auch lebendig und tötet das Geistige in der Seele nicht, wie es der Intellektualismus tut. Die tonangebenden Persönlichkeiten für die Bildung einer Mitglieder- und Zuhörerschaft waren in München solche, bei denen das künstlerische Empfinden in der angedeuteten Art wirkte.
Das brachte nun auch mit sich, daß in Berlin ein einheitlicher Zweig der Gesellschaft von vornherein sich gestaltete. Die Interessen derjenigen, die Anthroposophie
suchten, waren gleichartig. In München gestalteten die künstlerischen Empfindungen in einzelnen Kreisen individuelle Bedürfnisse, und ich trug in solchen Kreisen vor. Zu einer Art Mittelpunkt dieser Kreise bildete sich derjenige allmählich aus, der sich um die Gräfin Pauline v. Kalckreuth und Frl. Sophie Stinde, die während des Krieges Verstorbene, gruppierte. Dieser Kreis veranstaltete auch meine öffentlichen Vorträge in München. Das immer tiefer gehende Verständnis dieses Kreises erzeugte in ihm ein schönstes Entgegenkommen für dasjenige, was ich zu sagen hatte. Und so entfaltete sich die Anthroposophie innerhalb dieses Kreises in einer Art, die aus der Sache heraus als eine sehr erfreuliche bezeichnet werden konnte. Ludwig Deinhard, der ältere Theosoph, der Freund Hübbe-Schleidens, stellte sich sehr bald sympathisch in diesen Kreis hinein. Und das war sehr wertvoll.
Der Mittelpunkt eines andern Kreises war Frau von Schewitsch. Sie war eine interessante Persönlichkeit, und deshalb wohl war es auch, daß gerade bei ihr auch ein Kreis sich zusammenfand, der weniger auf Vertiefung ging wie der eben geschilderte, sondern mehr auf das Kennenlernen der Anthroposophie als einer Geistesströmung unter den andern der damaligen Gegenwart.
In dieser Zeit hatte ja auch Frau von Schewitsch ihr Buch: «Wie ich mein Selbst fand» erscheinen lassen. Es war ein eigenartiges starkes Bekenntnis zur Theosophie. Auch das trug dazu bei, daß diese Frau der interessante Mittelpunkt des geschilderten Kreises werden konnte.
Für mich - und auch für viele Kreisteilnehmer - war Helene von Schewitsch ein bedeutsames Stück Geschichte. Sie war ja die Dame, wegen der Ferdinand Lassalle gegen
einen Rumänen im Duell sein frühzeitiges Ende gefunden hat. Sie hat dann später eine Schauspielerlaufbahn durchgemacht und war in Amerika mit H.P. Blavatsky und Olcott befreundet worden. Sie war eine Weltdame, deren Interessen in der Zeit, in der meine Vorträge bei ihr stattfanden, stark vergeistigt auftraten. Die starken Erlebnisse, die sie gehabt hat, gaben ihrem Auftreten und dem, was sie vorbrachte, ein außerordentliches Gewicht. Durch sie hindurch, möchte ich sagen, konnte ich auf das Wirken Lassalles und dessen Epoche sehen, durch sie auf manches Charakteristische im Leben H. P. Blavatskys. Was sie sagte, war subjektiv gefärbt, von der Phantasie vielfach willkürlich geformt; aber, wenn man das in Rechnung zog, so konnte man das Wahre durch manche Verhüllung doch sehen, und man hatte die Offenbarung einer doch ungewöhnlichen Persönlichkeit vor sich.
Andere Münchner Kreise waren in andrer Art gestaltet. Ich gedenke oft einer Persönlichkeit, die mir in mehreren dieser Kreise entgegentrat, eines außerhalb des engeren Verbandes der Kirche stehenden katholischen Geistlichen, Müller. Er war ein feiner Kenner Jean Pauls. Er gab eine recht anregende Zeitschrift «Renaissance» heraus, in der er einen freien Katholizismus verteidigte. Er nahm von Anthroposophie so viel, als ihn bei seinen Anschauungen interessieren konnte, war aber immer wieder skeptisch. Er machte Einwendungen, aber in einer so liebenswürdigen und zugleich elementarischen Art, daß durch ihn oftmals ein schöner Humor in die Diskussionen kam, die sich an die Vorträge anschlossen.
Ich will mit den Charakteristiken, die ich von Berlin und München als den entgegengesetzten Polen des anthroposophischen
Wirkens gebe, nichts über den Wert des einen oder andern Poles sagen; es traten da eben Verschiedenheiten bei Menschen auf, die man im Arbeiten zu berücksichtigen hatte, die in ihrer Art gleichwertig sind - wenigstens hat es keine Bedeutung, sie vom Gesichtspunkte des Wertes aus zu beurteilen.
Die Art des Münchner Wirkens führte dazu, daß der Theosophische Kongreß, der 1907 von der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft veranstaltet werden sollte, in München stattfand. Diese Kongresse, die vorher in London, Amsterdam, Paris abgehalten wurden, enthielten Veranstaltungen, die theosophische Probleme in Vorträgen oder Diskussionen behandelten. Sie waren den gelehrten Kongressen nachgebildet. Auch die administrativen Fragen der Theosophischen Gesellschaft wurden behandelt.
An alledem wurde in München manches modifiziert. Den großen Konzertsaal, der für die Tagung dienen sollte, ließen wir - die Veranstalter - mit einer Innendekoration versehen, die in Form und Farbe künstlerisch die Stimmung wiedergeben sollte, die im Inhalt des mündlich Verhandelten herrschte. Künstlerische Umgebung und spirituelle Betätigung im Raume sollten eine harmonische Einheit sein. Ich legte dabei den allergrößten Wert darauf, die abstrakte, unkünstlerische Symbolik zu vermeiden und die künstlerische Empfindung sprechen zu lassen.
In das Programm des Kongresses wurde eine künstlerische Darbietung eingefügt. Marie von Sivers hatte Schurés Rekonstruktion des eleusinischen Dramas schon vor langer Zeit übersetzt. Ich richtete es sprachlich für eine Aufführung ein. Dieses Drama fügten wir dem Programm
ein. Eine Anknüpfung an das alte Mysterienwesen, wenn auch in noch so schwacher Form, war damit gegeben - aber, was die Hauptsache war, der Kongreß hatte Künstlerisches in sich. Künstlerisches, das auf den Willen hinwies, das spirituelle Leben fortan nicht ohne das Künstlerische in der Gesellschaft zu lassen. Marie von Sivers, welche die Rolle der Demeter übernommen hatte, wies in ihrer Darstellung schon deutlich auf die Nuancen hin, die das Dramatische in der Gesellschaft erlangen sollte. - Außerdem waren wir in einem Zeitpunkt, in dem die deklamatorische und rezitatorische Kunst durch Marie von Sivers in dem Herausarbeiten aus der inneren Kraft des Wortes an dem entscheidenden Punkte angekommen war, von dem aus auf diesem Gebiete fruchtbar weitergegangen werden konnte.
Ein großer Teil der alten Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft aus England, Frankreich, namentlich aus Holland waren innerlich unzufrieden mit den Erneuerungen, die ihnen mit dem Münchner Kongreß gebracht worden sind. - Was gut gewesen wäre, zu verstehen, was aber damals von den wenigsten ins Auge gefaßt wurde, war, daß mit der anthroposophischen Strömung etwas von einer ganz andern inneren Haltung gegeben war, als sie die bisherige Theosophische Gesellschaft hatte. In dieser inneren Haltung lag der wahre Grund, warum die anthroposophische Gesellschaft nicht als ein Teil der theosophischen weiterbestehen konnte. Die meisten legten aber den Hauptwert auf die Absurditäten, die im Laufe der Zeit in der Theosophischen Gesellschaft sich herausgebildet haben und die zu endlosen Zänkereien geführt haben.
Nachwort
Hier bricht die Lebensbeschreibung jäh ab. Am 30. März 1925 verschied Rudolf Steiner.
Man hat sein ganz dem Opferdienst der Menschheit geweihtes Leben mit unsäglicher Feindschaft vergolten; man hat seinen Erkenntnisweg in einen Dornenweg verwandelt. Er aber hat ihn für die ganze Menschheit durchschritten und erobert. Er hat die Grenzen der Erkenntnis durchbrochen: sie sind nicht mehr da. Vor uns liegt dieser Erkenntnisweg in der kristallklaren Helle der Gedanken, von der auch dieses Buch Zeugnis ablegt. Er hat den menschlichen Verstand zum Geist emporgehoben, ihn durchdrungen, verbunden mit der geistigen Wesenheit des Kosmos. Damit hat er die größte Menschentat vollbracht. Die größte Gottestat lehrte er uns verstehen. Die größte Menschentat vollbrachte er. Wie sollte er nicht gehaßt werden mit aller dämonischen Macht, deren die Hölle fähig ist?
Er aber hat mit Liebe vergolten, was an Unverständnis ihm entgegengebracht worden ist.
Er starb, - ein Dulder, Lenker, ein Vollbringer,
in einer Welt, die ihn mit Füßen trat
und die emporzutragen er die Kraft besaß.
Er hob sie hoch, sie warfen sich dazwischen,
sie spieen Haß, verrammten ihm die Wege,
verschütteten was im Entstehen war.
Sie wüteten mit Gift und Flamme,
frohlocken jetzt, besudeln sein Gedächtnis. -
«Nun ist er tot, der euch zur Freiheit führte,
zum Lichte, zum Bewußtsein, zum Erfassen
des Göttlichen in einer Menschenseele,
zum Ich, zum Christus.
War es Verbrechen nicht, dies Unterfangen?
Er tat was schon Prometheus büßte,
Was Sokrates der Schierlingsbecher lohnte,
was schlimmer war, als Barabbas' Vergehen,
was nur am Kreuze seine Sühne findet:
Er lebte euch die Zukunft dar.
Wir, die Dämonen, können dies nicht dulden,
wir hetzen, jagen den, der solches wagt,
mit allen Seelen, die sich uns ergaben,
mit allen Kräften, die uns zu Gebote.
Denn uns gehört die Zeitenwende,
uns diese Menschheit, die, des Gottes bar,
hinsiecht in Schwäche, Wahn und Laster.
Wir lassen das Erbeutete nicht fahren,
zerreißen den, der solches wagt.»
Er wagte es - und trug sein Los.
In Liebe, Langmut, im Ertragen
der Unzulänglichkeit, der Menschenschwächen,
die stets sein Werk gefährdeten,
die stets sein Wort mißdeuteten,
die seine Nachsicht stets verkannten,
in ihrer Kleinheit sich nicht selbst erfaßten,
weil seine Größe sich dem Maß entzog.
So trug er uns, - und uns verging der Atem
beim Folgen seiner Schritte, bei dem Fluge,
der schwindelnd hoch uns hinriß. Unsre Schwäche,
sie war das Hemmnis seines Fluges,
sie legte sich wie Blei um seine Füße...
Jetzt ist er frei. Ein Helfer denen droben,
die Erderrungenes entgegennehmen
zur Wahrung ihrer Ziele. Sie begrüßen
den Menschensohn, der seine Schöpferkräfte
entfaltete im Dienst des Götterwillens,
der dem verhärtetsten Verstandesalter,
der trockensten Maschinenzeit
den Geist einprägte und entlockte...
Sie wehrten's ihm.
Die Erde webt im Schatten,
im Weltenraum erbilden sich Gestalten,
der Führer harrt, der Himmel ist geöffnet,
in Ehrfurcht und in Freude stehn die Scharen.
Doch graue Nacht umfängt den Erdenball.
Marie Steiner, 1925
| vorige GA ◁ ■ ▷ nächste GA |
Weitere Medien
Im Bereich «Weitere Medien» findest du je nach Verfügbarkeit noch folgenden zusätzliche Medien
| vorige GA ◁ ■ ▷ nächste GA |
Unbearbeitete Version vom der ehemaligen fvn-Webseite: GA 28 als Pdf
e-book
Unbearbeitete Version vom der ehemaligen fvn-Webseite: GA 28 als mobi
Unbearbeitete Version vom der ehemaligen fvn-Webseite: GA 28 als epub
Audio
Gerne kannst du dein Audio mit einbringen. Bitte per Kontaktfomular bei François melden.
Lesekreis
Gerne kannst du/ihr euren Lesekreis mit einbringen. Abgeschlossene oder laufende Lesekreise. Bitte per Kontaktfomular bei François melden.
Schulungsmaterial
Gerne kannst du dein Schulungsmaterial mit einbringen. Bitte per Kontaktfomular bei François melden.
Stimmen
Gerne kannst du uns auch deine Stimme zukommen lassen. Bitte per Kontaktfomular bei François melden.
| vorige GA ◁ ■ ▷ nächste GA |
Literatur
- Rudolf Steiner: Mein Lebensgang, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; Tb 636, ISBN 978-3-7274-6361-7 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |







