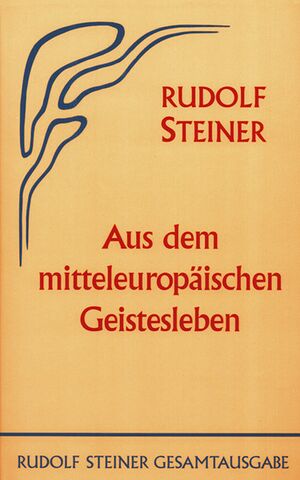Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 65
RUDOLF STEINER
VORTRÄGE
ÖFFENTLICHE VORTRÄGE
Aus dem mitteleuropäischen
Geistesleben
Fünfzehn öffentliche Vorträge
gehalten zwischen dem 2. Dezember 1915
und dem 15. April 1916
im Architektenhaus zu Berlin
GA 65
1962
Inhaltsverzeichnis
- ZUR EINFÜHRUNG
- GOETHE UND DAS WELTBILD DES DEUTSCHEN IDEALISMUS Berlin, 2. Dezember 1915
- DIE EWIGEN KRÄFTE DER MENSCHENSEELE Berlin, 3. Dezember 1915
- BILDER AUS ÖSTERREICHS GEISTESLEBEN IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT Berlin, 9. Dezember 1915
- MENSCHENSEELE UND MENSCHENGEIST Berlin, 10. Dezember 1915
- FICHTES GEIST MITTEN UNTER UNS Berlin, 16. Dezember 1915
- FAUSTS WELTWANDERUNG UND SEINE WIEDERGEBURT AUS DEM DEUTSCHEN GEISTESLEBEN Berlin, 3. Februar 1916
- GESUNDES SEELENLEBEN UND GEISTESFORSCHUNG Berlin, 4. Februar 1916
- ÖSTERREICHISCHE PERSÖNLICHKEITEN IN DEN GEBIETEN DER DICHTUNG UND WISSENSCHAFT Berlin, 10. Februar 1916
- WIE WERDEN DIE EWIGEN KRÄFTE DER MENSCHENSEELE ERFORSCHT? Berlin, 11. Februar 1916
- EIN VERGESSENES STREBEN NACH GEISTESWISSENSCHAFT INNERHALB DER DEUTSCHEN GEDANKENENTWICKELUNG Berlin, 25. Februar 1916
- WARUM MISSVERSTEHT MAN DIE GEISTESFORSCHUNG? Berlin, 26. Februar 1916
- NIETZSCHES SEELENLEBEN UND RICHARD WAGNER Berlin, 23. März 1916
- DIE UNSTERBLICHKEITSFRAGE UND DIE GEISTESFORSCHUNG Berlin, 24. März 1916
- DIE DEUTSCHE SEELE IN IHRER ENTWICKELUNG Berlin, 13. April 1916
- LEIB, SEELE UND GEIST Berlin, 15. April 1916
- HINWEISE
- Literatur
ZUR EINFÜHRUNG
Wir übergeben der Öffentlichkeit eine Anzahl von Vorträgen, die Rudolf Steiner in Berlin für das große Publikum gehalten hat. Berlin war der Ausgangspunkt für diese öffentliche Vortragstätigkeit gewesen. Was in anderen Städten mehr in einzelnen Vorträgen behandelt wurde, konnte hier in einer zusammenhängenden Vortragsreihe zum Ausdruck gebracht werden, deren Themen ineinander übergriffen. Sie erhalten dadurch den Charakter einer sorgfältig fundierten methodischen Einführung in die Geisteswissenschaft und konnten auf ein regelmäßig wiederkehrendes Publikum rechnen, dem es darauf ankam, immer tiefer in die neu sich erschließenden Wissensgebiete einzudringen, während den neu Hinzukommenden die Grundlagen für das Verständnis des Gebotenen immer wieder gegeben wurden.
GOETHE UND DAS WELTBILD DES DEUTSCHEN IDEALISMUS Berlin, 2. Dezember 1915
Die Vorträge auf dem Gebiete der Geisteswissenschaft, die 1ch nun schon seit einer langen Reihe von Jahren von dieser Stelle aus innerhalb der Winterjahreszeit halten durfte, versuchte ich immer zu beginnen mit einer Betrachtung über den Zusammenhang jener besonderen Anschauung über die geistige Welt, die innerhalb dieser Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist, vertreten wird, mit dem allgemeinen Geistesleben. Und schon im vorigen Winter versuchte ich - was ganz besonders in unserer gegenwärtigen schicksaltragenden Zeit naheliegen muß - aus den Empfindungen heraus, die gegenwärtig innerhalb des deutschen Volkes leben, den Blick hinzulenken auf diejenige Zeit deutscher Geistesentwickelung, in welcher aus dem Ureigensten des deutschen Wesens heraus gesucht wurde in einer im eigentlichsten Sinne idealistischen Form ein Zusammenhang, ein Zusammenleben mit der geistigen Welt. In unserer Zeit, in welcher das deutsche Volk sich gegen eine Welt von Gegnern erhalten muß in seinem Dasein, in seinen Daseinshoffnungen, muß es ja besonders naheliegen, hinzublicken auf diejenige Zeit, von der einer der volkstümlichsten Geschichtsschreiber des deutschen Volkes sagt: es sei die Zeit, in welcher die idealistischen Geister dieses deutschen Volkes gezeigt haben, daß deutsches Wesen auch in der Zeit der äußersten Bedrängnis, in der Zeit der äußersten Befeindung, diejenige Größe zu retten vermag, welche gerettet
werden kann durch Pflege des geistigen Lebens, so wie es eingeboren erscheint gerade den tiefsten Charaktereigentümlichkeiten dieses Volkes. Wir brauchen dabei nicht in den Fehler unserer Gegner zu verfallen, die heute in einer so merkwürdigen, in einer so absonderlichen Weise glauben, die Bedeutung des eigenen Volkes dadurch besonders charakterisieren zu müssen, daß sie das Wesen der Gegner herabsetzen. Man braucht nicht in den Fehler zum Beispiel derjenigen zu verfallen, von denen wir jetzt hören, daß die deutsche Weltanschauung selber dazu verführen müsse, das deutsche Volk in das wüsteste Kriegstreiben hineinzuleiten. Wir können vielmehr, ohne in den Fehler der Herabsetzung der Gegner zu verfallen, den Blick hinwenden auf dasjenige, was das deutsche Volk glaubt, glauben muß nach seinem ganzen Wesen: daß seine weltgeschichtliche Aufgabe aus der tiefsten Innerlichkeit seiner Natur heraus begründet ist. Und man braucht auch nicht, was heute so viele von Deutschlands Gegnern tun, aus dem unmittelbaren Haß und der Antipathie der Gegenwart heraus sich die Anschauung über das Volkstümliche, sei es des eigenen, sei es des anderen Volkes, zu bilden.
Und deshalb sei der Ausgangspunkt genommen zur heutigen Betrachtung von einer Anschauung, einer Idee, die in einer Zeit, die weit hinter der unseren so schicksaltragenden Zeit zurückliegt, ein hervorragender Geist aus verhältnismäßiger Seelenruhe heraus sich damals bilden konnte über das, was innerhalb der Volksgemeinschaften der neueren Zeit das Wesen des deutschen Volkes ausmacht, - Schillers großer Freund Wilhelm von Humboldt, der sich in so wunderbarer Weise vertiefen konnte in das Wesen der Entwickelung der Menschheit, der in so feinsinniger Art des Menschen Bedürfnis innerhalb der weltgeschichtlichen Entwickelung darzustellen wußte. Im Jahre 1830,
als Wilhelm von Humboldt einen Blick zurückwarf auf das, was ihm Schillers Freundschaft war, was aber auch Schillers Bedeutung für die Entwickelung des deutschen Volkes war, was Schillers ganze geistige Entwickelung war, sprach er sich in der folgenden Art über das deutsche Wesen aus:
«Die Kunst nun und alles ästhetische Wirken von ihrem wahren Standpunkte aus zu betrachten, ist keiner neueren Nation in dem Grade als der deutschen gelungen, auch denen nicht, welche sich der Dichter rühmen, die alle Zeiten für groß und hervorragend erkennen werden. Die tiefere und wahrere Richtung im Deutschen liegt in seiner größeren Innerlichkeit, die ihn der Wahrheit der Natur näher erhält, in dem Hange zur Beschäftigung mit Ideen und auf sie bezogenen Empfindungen und in allem, was hieran geknüpft ist. Dadurch unterscheidet er sich von den meisten neueren Nationen und, in näherer Bestimmung des Begriffes der Innerlichkeit, wieder auch von den Griechen. Er sucht Poesie und Philosophie, er will sie nicht trennen, sondern strebt sie zu verbinden; und solange dies Streben nach Philosophie, auch ganz reiner, abgezogener Philosophie, das auch sogar unter uns nicht selten in seinem unentbehrlichen Wirken verkannt und gemißdeutet wird, in der Nation fortlebt, wird auch der Impuls fortdauern und neue Kräfte gewinnen, den mächtige Geister in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts unverkennbar gegeben haben.»
So weist einer, der sich viel mit den Empfindungen, die dazu gehören, um dies zu wissen, beschäftigt hat, auf dasjenige hin, wovon er glauben mußte, daß es in der Aufgabe, in der unmittelbaren Bestimmung des deutschen Volkes selber liegt.
Und wenn wir hinblicken auf dasjenige, was dem deutschen
Wesen von der geistigen Seite aus das Gepräge gegeben hat in der großen Zeit, in der der deutsche Idealismus das Deutschtum auf den Schauplatz der Gedanken gehoben hat; und wenn wir hindeuten auf das Ende des achtzehnten, auf den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts mit alledem, was sich entwickelt hat bis in die unmittelbare Entwickelungsphase unserer Zeit herein, dann erblicken wir etwas, was sich nicht etwa umfassen läßt mit dem ja gewiß bedeutungsvollen, aber nicht eben sehr hohen Begriff, sagen wir, der Internationalität der Wissenschaft und dergleichen, die sich, insofern sie die Wissenschaft be-trifft, ja von selber versteht. Aber was in Deutschlands größten Zeiten in bezug auf die Geistesentwickelung so gewaltig hervortrat, das war, daß damals durch diejenigen Geister, die gerade damals sich so innig verbunden fühlten mit dem deutschen Volkstum, wie zum Beispiel Fichte, her-vorgetreten ist die Frage nach der ganzen Bedeutung des Wissens, desjenigen, was der Mensch durch das Wissen, das er sich als Wissenschaft entwickelt, erreichen kann; nach dem Verhältnis dieses Wissens zu dem Geheimnis der Welt, zum Ewig-Wirkenden, Ewig-Geistigen in der Welt selber. Daß das Wissen in Frage gestellt worden ist, daß das Wissen selber zum Rätsel geworden ist und daß der Mensch gerade durch diesen Zug nach der Rätselhaftigkeit des Wissens hin die Angelegenheit dieses Wissens zu einem persönlichen und dennoch objektiven und sachlichen Menschheitsinteresse machen mußte, das ist das ungeheuer Bedeutungsvolle. Warm sich verbunden fühlen in jeder Faser seines Wesens mit dem, was der Mensch durch ein Ideelles in seinem Streben, durch das Wissensstreben erreichen kann; lichtvoll nach Wissenschaft streben und dabei dennoch die Frage aufwerfen können: Kann man über dieses Wissen oder vielmehr muß man sogar über dieses Wissen hinausschreiten,
wenn man zu dem Tiefsten kommen will, was den Menschen mit den ewigen Quellen des Daseins verbindet? Und der Grund, warum dieses Rätsel in einer besonders intensiven Weise sich vor die deutsche Seele in ihren besten Geistern hinstellen konnte, liegt darin, daß sich innerhalb der Zeit des deutschen Idealismus das Streben geltend machte, das Wissen nicht nur als etwas zu haben, was einen in Begriffen über die Welt unterrichtet, als etwas, dem man kühl gegenübersteht, indem man die Erscheinungen der Welt zergliedern will, sondern das Wissen zu haben als etwas, das in der ganzen Seele lebt, das den Menschen trägt. Gerade aus der Sehnsucht nach der Lebendigkeit des Wissens, aus dem innigen Sich-verbunden-Fühlen mit dem Wissen entstanden ja auch die großen Rätselfragen des Wissens. Es scheint, als ob man ein Wissen nur haben wolle, eine Wissenschaft nur pflegen wolle, wenn diese Wissenschaft auch wirklich so leben könne, daß man in dem Erleben des Wissens auch den Weg finden könne zu den Quellen des Daseins.
Es ist reizvoll zu sehen, wie deutsche Geister in ihrem Wissen, in ihrer Wissenschaft in einem viel höheren Sinne leben wollen, als das gewöhnlich gemeint ist, wenn man von dem Zusammenhange des Lebens mit der Wissenschaft spricht. Ich habe im vorigen Winter in einem ähnlichen Zusammenhange Fichtes Eigenart zu charakterisieren versucht, dieses edlen deutschen Geistes, der in einer der schwersten Zeiten der Entwickelung des deutschen Volkes sein Geistesstreben ganz in den Dienst seines Volkes gestellt hat, der aus der Vertiefung seines Geistes die wunderbarsten Kraftworte zur Beflügelung der deutschen Begeisterung gefunden hat. Es gehört zu dem, was Fichte seinem Volke sein konnte, dazu die Art, wie er sich mit Wissensstreben verbunden fühlte, wie er sich zum deutschen Idealismus zu
erheben bestrebt war. Ein Bild, das uns erhalten ist, kann nns das in schöner Weise veranschaulichen. Forberg, der Fichte reden gehört hat, wenn dieser versuchte, aus der Tiefe seines Weisheitsstrebens heraus lebendig zu machen, was er als seine Verbindung mit dem webenden, waltenden Weltengeist ansah, sagte über Fichtes Art, über geistige Angelegenheiten zu sprechen, die folgenden schönen
Worte:
«Fichtes öffentlicher Vortrag... rauscht daher wie ein Gewitter, das sich seines Feuers in einzelnen Schlägen entladet. Er rührt nicht. . . , aber er erhebet die Seele . . . ; er will große Menschen machen. Fichtes Auge ist strafend, und sein Gang ist trotzig. Fichte will durch seine Philosophie den Geist des Zeitalters leiten. . . . Seine Phantasie ist nicht blühend, aber energisch und mächtig. Seine Bilder sind nicht reizend, aber kühn und groß. Er dringt in die innersten Tiefen seines Gegenstandes ein und schaltet im Reiche der Begriffe mit einer Unbefangenheit herum, welche verrät, daß er in diesem unsichtbaren Lande nicht nur wohnt, sondern herrscht.»
Und wenn man Fichtes deutsche Art charakterisieren will, muß man hinweisen darauf, wie er, indem er also in dem Reich der Begriffe herrschen wollte, innerhalb dieses Reiches der Begriffe etwas suchte, was mehr war als dasjenige, was man oftmals Begriffe und Ideen nennt, was ein Aufleben derjenigen Kräfte der menschlichen Seele war, die eins sind mit den schöpferischen Kräften des ganzen Daseins, jenen schöpferischen Kräften, die draußen in der Natur leben, die den Menschen selber in die Natur herein-gestellt haben, die das geschichtliche Leben leiten und lenken, die alles Dasein durchweben und durchwallen. Um aber solche Anschauung in voller Lebendigkeit zu gewinnen, konnte Fichte nicht stehen bleiben bei der Abstraktheit der
Begriffe, bei Begriffen, die nur Anschauung sind. Dazu brauchte er Begriffe, die unmittelbar durchlebt und durchseelt waren von einem Wirkenselement, das der menschlichen Seele so nicht nur aufleuchtet, sondern aufkraftet, so daß diese menschliche Seele, indem sie sich zunächst von der äußeren Welt abzieht, gerade dem Innersten der Wirklichkeit sich verbunden fühlt. Und so lenkte denn Johann Gottlieb Fichte seine Betrachtung hin auf ein Lebendiges, im Willen Sich-Erkraftendes in der menschlichen Seele. Und was er da erfühlte als in seinen Willen hereinströmend, das erlebte er so, als ob die göttlich-geistigen Kräfte, welche durch die Welt wallen und weben, hereinkommen würden in die Seele, und die Seele selber sich ruhen fühlte innerhalb des göttlichen Erlebens. Will man diesen Zug bei Johann Gottlieb Fichte einen mystischen nennen, so muß man von diesem Ausdruck nur alles entfernen, was irgendwelche Nebelhaftigkeit in die Weltanschauung hineinbringt; man muß diesen Begriff dann mit alledem zusammenbringen, was gerade höchste Erkenntnisenergie in Fichtes ganzem Streben ist. Dann erscheint einem gerade deutscher Idealismus wie zusammengedrängt in einem Brennpunkte, nicht nur dann, wenn Fichte über deutsches Volkstum spricht, sondern dann gerade am allerbesten, wenn er spricht von den höchsten Angelegenheiten, denen sich sein Denken und, man könnte sagen, sein inneres Erleben zuwendet. Indem er den waltenden Willen in der eigenen Seele sich zu vergegenwärtigen versucht, ihn lebendig werden lassen will vor denen, zu denen er spricht, spricht er über diesen Willen so, als ob er sich bewußt wäre, daß in diesem Willen dasjenige lebt, was das innerste Wesen der ganzen Welt ist. So spricht er, als ob er den erhabenen Weltenwillen selber in dem eigenen Willen der menschlichen Seele pulsierend fühlt, wenn diese menschliche Seele durch ihr Erkenntnisstreben
auf das innerste Abffießen und Tätigsein des Willens selber zurückgeht. Wunderbare Worte spricht da Fichte:
«Jener erhabene Wille geht sonach nicht abgesondert von der übrigen Vernunftwelt seinen Weg für sich. Es ist zwischen ihm und allen endlichen vernünftigen Wesen ein geistiges Band, und er selbst ist dieses geistige Band innerhalb der Vernunftwelt.... Ich verhülle vor dir mein Angesicht und lege die Hand auf den Mund. Wie du für dich selbst bist und dir selbst erscheinest, kann ich nie einsehen, so gewiß ich nie du selbst werden kann. Nach tausendmal tausend durchlebten Geist-Erleben werde ich doch noch ebensowenig begreifen als jetzt, in dieser Hütte von Erde. - Was ich begreife, wird durch mein bloßes Begreifen zum Endlichen; und dieses läßt auch durch unendliche Steigerung und Erhöhung sich nie ins Unendliche umwandeln. Du bist vom Endlichen nicht dem Grade, sondern der Art nach verschieden. Sie machen dich durch jene Steigerung nur zu einem größeren Menschen und immer zu einem größeren; nie aber zum Gotte, zum Unendlichen, der keines Maßes fähig ist.»
So spricht Fichte dasjenige an, was er als den Welten-willen erfühlt, indem er sein Erkenntnisstreben vertieft, auf daß es finden könne, was im Innersten der Seele diese Seele mit den Quellen des Daseins zusammenhält; dasjenige, aus dem die Seele heraus schaffen muß, wenn sie sich so fühlen will, daß sie mit ihrem Schaffen in Einklang steht mit den geschichtlichen und mit den ewigen Mächten, die alles Dasein selber leiten. Daß Wissenschaft durch eine idealistische Betrachtung des Lebens zu einer solchen Erfassung der menschlichen Innerlichkeit führen müsse, daß in dieser Innerlichkeit zugleich umgriffen wird das Innerste des Weltendaseins im menschlichen Streben, das ist der Grundzug des deutschen Idealismus. Und mit solchem
Idealismus stehen im Grunde genommen auch die philosophischen Genossen Fichtes vor den großen Rätselfragen des Daseins.
Von einem gewissen Gesichtspunkte aus versuchte ich im vorigen Winter gerade diesen Schauplatz der Gedanken innerhalb des deutschen Idealismus und das Weltbild dieses deutschen Idealismus darzustellen. Ich unternahm es damals zu zeigen, wie Fichte versuchte, das Weltendasein durch das Erleben der innersten Natur des menschlichen Willens selber zu erfassen, indem er die menschliche Seele dort ergreifen wollte, wo sich der Wille in ihr vertiefen kann. Jch wollte zeigen, wie Fichte, indem er bis zum menschlichen Ich in seiner Wesenheit vorzudringen versuchte, nicht davon befriedigt sein konnte, dieses Ich im Sein zu erfassen oder im bloßen Denken zu erfassen, etwa im Sinne des Descartes mit seinem «Ich denke, also bin ich», sondern wie Fichte das Ich, das innerste Wesen der Menschenseele, so erfassen wollte, daß in ihm etwas liegt, was sein Dasein aus dem Grunde nie verlieren kann, weil es dieses Dasein in jedem Augenblicke neu schaffen kann. Den lebendigen, immer schöpferischen Willen als Ursprungsquelle des menschlichen Ich wollte Fichte aufzeigen; nicht durch ein Urteil etwa der Art:
Ich denke, das ist etwas, also bin ich - nicht dadurch wollte Fichte das Wesen des Ich finden, sondern dadurch, daß er aufzeigte: Nun, wenn dieses Ich auch in irgendeinem Augenblicke nicht wäre, oder wenn man von ihm sagen müßte aus irgendwelchen Anzeichen, daß es nicht wäre, so wäre dieses Urteil ungültig aus dem Grunde, weil dieses Ich ein schöpferisches ist, weil es in jedem Augenblick aus den Tiefen dieses Ich heraus sein Dasein wiedererzeugen kann. In diesem fortwährenden Wiedererzeugen, in diesem Fortdauern des Schöpferischen, in diesem Zusammenhange mit dem Schöpferischen der Welt versuchte Fichte das Wesen des Ich
im Willen zu erkennen, es im Willen zu erhalten, lebendig das Erkenntnisstreben zu gestalten.
Und Schelling, Fichtes philosophischer Genosse, der dann in vieler Beziehung so weit über ihn hinausgegangen ist, er stellte sich vor die Natur so hin, daß ihm diese Natur nicht war, was sie sonst in vieler Beziehung der äußeren Wissen-schaft ist: eine Summe von Erscheinungen, die man zergliedert; sondern die Natur war für Schelling das, was dem Menschengeiste ähnlich in seiner Wesensart ist, nur daß der menschliche Geist in der Gegenwart dasteht, sich selber erlebt, die Natur aber diesen Geist durchlebt hat, so daß er in ihr nun verzaubert ruht, so daß er hinter ihrem Schleier sich verbirgt und durch ihre äußeren Erscheinungen sich offenbart. Wie man einen Menschen betrachtet in bezug auf seine Physiognomie, so daß man diese Physiognomie nicht nur der Form nach wie eine Bildsäule beschreibt, sondern daß man durch die Physiognomie hindurchblickt auf das, was lebendig seelisches Leben ist, was durchblickt durch die physiognomischen Züge, was durchgeistigt und durchwärmt die äußere Form - so wollte Schelling durch die äußeren Erscheinungen der Natur, durch die äußeren Offenbarungen wie durch die Physiognomie der Natur auf das, was in der Natur geistig ist, zurückgehen, den Geist in der Seele vereinigen mit dem Geist in der Natur. Und daraus entsprang ihm jene einseitige, aber kühne Art des Erkenntnisstrebens, die sich in Schellings Wort ausdrückt: «Die Natur begreifen, heißt die Natur schaffen!» Daß in der menschlichen Seele etwas sein könnte, was sich selber nur ins schöpferisch lebendige Dasein aufzuraffen braucht, und indem es also schafft, zwar nicht die äußeren Erscheinungen der Natur schafft, aber Bilder schafft, welche gleich sind demjenigen, was hinter der Natur schafft, das lebt in den Worten: «Die Natur verstehen, heißt die Natur schaffen!» Man braucht heute
wahrlich nicht diese Philosophie des deutschen Idealismus dogmatisch zu nehmen; man braucht nicht ihr Anhänger zu sein, darauf kommt es nicht an. Sondern worauf es ankommt, das ist: die Kraft, die innere Seelenart kennenzulernen, aus der solche Richtung des geistigen Lebens entspringt. Und so könnte jemand im vollsten Sinne des Wortes ein Gegner der Dogmen des deutschen Idealismus sein, aber etwas unverwüstlich Lebendiges, etwas Zukunfttragendes finden in der Art, wie dazumal die menschliche Seele eindringen wollte in die tiefsten Geheimnisse des Daseins.
Und auf Hegel darf dabei hingewiesen werden, den Dritten in dieser Reihe, der sich nicht scheute, in die kältesten Gefilde des reinen Denkens hinaufzusteigen. Denn Hegel glaubte, wenn die Seele sich abziehe von aller Wärme der äußeren Anschauung, von allem unmittelbaren Ruhen im Naturdasein, wenn sie ganz allein bei den Begriffen sei, die so in der Seele leben, daß diese Seele gar nicht mehr mit ihrer Willkür bei dem Denken der Begriffe dabei ist, sondern die Seele sich überläßt dem Vorgang, wie ein Begriff aus dem andern hervorgeht, wie Begriffe in ihr walten, ohne daß sie sich irgendwie auf etwas anderes als auf diese waltenden reinen, kristallklaren und durchsichtigen Begriffe wendet, die sie in ihr so walten und weben läßt, wie sie selber wollen, nicht wie die Seele will, - dann liege, so glaubte Hegel, in diesem Ablaufen, in diesem Hineinfließen der Begriffe eine Vereinigung der Seele mit dem waltenden Weltengeist selber, der sich in Begriffen auslebt, der durch die Jahrmillionen hindurch, indem er durch die Unendlichkeit hindurch seine Begriffe befehlend sandte, aus der Verdichtung dieser Begriffe die äußere Welt hervorgehen ließ und dann den Menschen hineinstellte so, daß der Mensch in seiner Seele erwecken kann diese Begriffe, aus denen die Welt selber hervorgegangen ist.
Ist es gewiß wieder einseitig, wie Hegel sich also in die Daseinswelt vertieft, indem er durch das Auspressen aller übrigen Wirklichkeit aus der reinen Begriffswelt zu den Quellen des Daseins vorzudringen versucht; ist es einseitig dadurch, daß damit der Weltengeist, der durch die Welt wallt und webt, wie zu einem bloßen Logiker gemacht wird, der aus bloßer Logik heraus die Welt zaubert, so zeigt doch auch dieses Streben, das unmittelbar urständet im deutschen Wesen und deutscher Art, wie der deutsche Geist aus seinem Erkenntnisstreben heraus seiner Art nach die Verbindung suchen will dessen, was in der Seele lebt, was in der Seele unmittelbar in ihrer Innerlichkeit angeschaut werden kann und was, indem es so angeschaut wird, zu gleicher Zeit den in der Welt flutenden Geist ergreift. Ergreifen des Weltengeistes durch den Geist, den man in der Seele entwickelt, das ist der Grundzug dieses Strebens. Und mag die rechte Art, also sich zu dem Weltenleben und seiner Erkenntnis zu stellen, erst in fernster, fernster Zukunft von der Menschenseele in einigermaßen befriedigender Art gelöst werden, die Art und Weise, wie sie innerhalb des deutschen Idealismus versucht worden ist, diese Weise, den Weltengeist zu suchen, sie ist so innig zusammenhängend mit dem deutschen Wesen und ist zu gleicher Zeit die Art, wie in unserer Zeit das Ewige in der zeitlichen Menschen-seele gesucht werden muß.
Man sieht, wie innig verwoben dem deutschen Streben gerade diese Art des Erkennens ist, wenn man im Aufgang des neueren Geistesstrebens sich ansieht, wie zwei Erscheinungen einander gegenüberstehen am Ende des sechzehnten, am Anfang des siebzehnten Jahrhunderts; das ist ja die Zeit, in der sich diejenigen Kräfte zuerst herausbilden, die der neueren Weltanschauung die Impulse gegeben haben für die europäische Entwickelung. Man sieht in interessanter
Weise, wie sich die deutsche Seele zu dieser Morgenröte des geistigen Lebens stellt, wenn man zum Beispiel im Bilde nebeneinander stellt, eben am Ende des sechzehnten, Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, auf der einen Seite - man mag sich sonst zu diesem merkwürdigen Geist stellen wie man will, wir wollen ihn heute nur im Zusammenhang der Entwickelung des neueren Geistesstrebens betrachten-, wenn man hinstellt Jakob Böhme und ihn vergleicht mit einem ungefähr gleichzeitig Strebenden im Westen Europas, mit einem Geist, der auch charakteristisch ist für sein Volk, wie Jakob Böhme charakteristisch ist für sein Volk, mit Montaigne.
Montaigne, er steht ebenfalls da groß, bedeutsam, ausdrückend eines der Elemente, die da heraufkommen in der Morgenröte des neueren Geisteslebens. Er ist der große Zweifler. Er ist derjenige, der aus der französischen Kultur heraus etwa den folgenden Impuls bekommt: Da schauen wir die Welt an. Sie offenbart uns durch unsere Sinne ihre Geheimnisse. Wir versuchen durch unser Denken, diese Geheimnisse zu enthüllen. Allein wer kann irgendwie sagen, so meint Montaigne, daß die Sinne nicht trügen; daß dasjenige, was den Sinnen sich offenbart aus den Tiefen der Welt heraus, irgendwie einen Zusammenhang, der sich einem vergegenwärtigen kann, haben könne mit den Quellen des Daseins. Und wer kann verkennen, so meint dieser große Zweifler, daß, wenn man nun sich zwar nicht auf die Sinne verläßt, aber auf das Urteil, auf das Denken, wenn man sich Beweise sucht und jeder Beweis wiederum nach einem Beweise verlangt, und der neue Beweis wiederum nach einem anderen Beweise, daß man dann so fortgehen kann an der Kette von Beweisen und auch fortgehen muß, weil all das, was man bewiesen zu haben glaubt, wiederum flüchtig erscheint, wenn man es genauer betrachtet. Weder das Denken noch das sinnliche Anschauen kann irgendeine Gewißheit
geben. Daher ist ein Weiser derjenige, so meint Montaigne, der nach einer solchen Gewißheit gar nicht sucht; der mit einer innerlichen Ironie zu den Erscheinungen der Welt und zu den Erkenntnissen der Quellen des Daseins steht; der weiß, daß man zwar über alle Dinge nachdenken und sie anschauen kann, aber daß man dadurch nur ein Wissen erlangt, das man ebensogut zugeben wie ablehnen kann, ohne daß man irgendwie eine Hoffnung haben könnte, etwas anderes durch geistiges Streben zu erlangen, als eben ein solches, zu welchem man sich nur zweifelnd und ironisch verhalten kann.
Gleichzeitig steht innerhalb des deutschen Wesens Jakob Böhme, der den Gang unternimmt, durch bloße innere Entwickelung von Seelenkräften, durch bloßes Hineintauchen in das, was die Seele aus ihren Tiefen heraufholen kann, den Gang unternimmt in die Untergründe der menschlichen Seele. Und dadurch, daß er diese Untergründe der menschlichen Seele so findet, wie er eben glaubt, sie finden zu können, war er sich klar darüber, war er überzeugt, daß, indem er da hinuntersteigt in die Tiefen der menschlichen Seele, er in diesen Tiefen zugleich hereinfluten vernimmt die Quellen alles Daseins, des natürlichen und des geistigen, des ganzen umfänglichen Daseins. Hinunter in die Tiefe der Seele bedeutet zugleich für Jakob Böhme ein Hinaus in das waltende göttliche Geistesleben der Welt. Und so suchte Jakob Böhme diesen Weg; daß auf diesem Wege von einem Zweifel, von einer ironischen Stimmung im Montaigneschen Sinne überhaupt nicht die Rede sein kann, weil Jakob Böhme in seiner Art sich klar darüber ist, daß er im Geiste lebt, weil man nicht zweifeln kann an demjenigen, in dem man lebt, an dem man mitschafft, indem man sich hinein vertieft. Und man möchte sagen: Nur ein Wieder-aufleben dieses Bestrebens Jakob Böhmes in einer höheren
Form liegt in dem, was auf dem Schauplatz des deutschen Idealismus durch die eben genannten Geister lebt. Und diese eben genannten Geister wenden im Grunde alle wiederum den Blick hin auf eine Persönlichkeit, die - wie sehr man das auch von einem engherzigen Standpunkte zuweilen sogar bezweifelt hat - in ihrem ganzen Wesen, in ihrer ganzen Art aus der tiefsten Volkstümlichkeit der Deutschheit hervorgegangen ist, auf Goethe. Und Fichte, der nur nach Klarheit ringende Philosoph, der nie zufrieden war, wenn er das, was er auszusprechen hatte, nicht in Begriffen mit scharfen Umrissen aussprechen konnte, Fichte, der gelten konnte als ein trockener, nüchterner Erkenntnis-mensch - so war nicht seine Art, aber so ist dasjenige, was sein Streben charakterisiert -, der weit, weit mit der Eigenart seines Wesens von Goethe entfernt gedacht werden könnte, - Fichte hat die schönen Worte an Goethe gerichtet, in denen er aussprechen wollte, wie er sich mit dem Höchsten, das er aus sich hervorzubringen strebte, in Einklang zu stellen versuchte mit dem, was Goethe durch seine Natur war. Als Fichte die erste, die abstrakteste Gestalt, man möchte sagen die kälteste, geschichtlichste Gestalt seiner «Wissenschaftslehre» zum Druck gebracht hatte, da legte er das Buch Goethe vor und schrieb an Goethe:
«Ich betrachte Sie und habe Sie immer betrachtet, als den Repräsentanten (der reinsten Geistigkeit des Gefühls) auf der gegenwärtig errungenen Stufe der Humanität. An 5ie wendet mit Recht sich die Philosophie. Ihr Gefühl ist derselben Probierstein!»
Worte, die jeder der anderen Genannten in derselben Weise an Goethe hätte richten können, ja die jeder derselben sogar in der einen oder anderen Art geschichtlich nachweislich an Goethe gerichtet hat.
Und als Schiller versucht hatte, in seinen, wie ich im
vorigen Winter mir auch hier zu charakterisieren erlaubte, viel zu wenig gewürdigten «Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen», aus den Tiefen der Kantischen Philosophie heraus sich die Frage zu beantworten: Wie muß die menschliche Seele streben, damit sie in dem harmonischen Zusammenwirken aller ihrer Kräfte wirklich zu einem Zusammenleben mit dem Weltengeiste in Freiheit kommt? -und als Schiller seinen Blick auf Goethe richtete, da erschien ihm in Goethe auch so etwas, wie der deutsche Geist in einem seiner Mittelpunkte, der da sucht, aus der tiefsten Innerlichkeit seines Wesens heraus das Höchste, zu dem er kommen wollte, vor die Welt hinzustellen. Schiller bewunderte an dem Streben der alten Griechen die reine freie Menschlichkeit, jene reine freie Menschlichkeit, die auf der einen Seite sich wenden darf zu der äußeren Natur, die aber diese Natur nicht mit einer solchen äußeren Notwendigkeit auf sich wirken läßt, wie das neuere Geistes-streben, bei dem der Mensch in seinem Streben unfrei wird gegenüber dem Zusammenhange der Natur. Diese griechische Natur, die auf der anderen Seite wiederum ihrer selbst im tiefsten Seelenhaften sich so gewahr wurde, daß sie sich erfühlte wie die Natur selber, auch in ihrem Innern, dieses Griechentum, das vor Schillers Seele stand wie ein Muster alles menschheitlichen Strebens und Sichauslebens, das sah Schiller neuerdings in Goethes Art und Leben aufleuchten vor dem neueren Völkergeiste. Und das charakterisiert Schiller ungefähr in derselben Zeit, in welcher Fichte die eben angeführten Worte an Goethe schrieb, in einem Briefe an Goethe mit den folgenden Worten:
«Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuerter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber
Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen, in der Aliheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf. Von der einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu den mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, daß Sie ihn in der Natur gleichsam nacherschaffen, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudringen. Eine große und wahrhaft heldenmäßige Idee, die zur Genüge zeigt, wie sehr Ihr Geist das reiche Ganze seiner Vorstellungen in einer schönen Einheit zusammenhält. Sie können niemals gehofft haben, daß Ihr Leben zu einem solchen Ziele zureichen werde, aber einen solchen Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr wert, als jeden anderen zu endigen - und Sie haben gewählt, wie Achill in der Ilias, zwischen Phthia und der Unsterblichkeit. Wären Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren worden, und hätte schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine idealisierende Kunst Sie umgeben, so wäre Ihr Weg unendlich verkürzt, vielleicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in die erste Anschauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Notwendigen aufgenommen, und mit ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Stil in Ihnen entwickelt. Nun, da Sie ein Deutscher geboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl, als entweder selbst zum nordischen Künstler zu werden, oder Ihrer Imagination das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhilfe der Denkkraft zu ersetzen, und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären.»
Das Schöpferische aus der tiefsten Innerlichkeit heraus, das nicht nur das Gegenwärtige schafft, das selbst das Vergangene neu aus dem eigenen Wesen wieder herausgebiert:
den Goethegeist. Wunderbar charakterisiert ihn Schiller selbstlos in diesem Briefe, in dem er so recht die Grundlage zu der Freundschaft dieser beiden Geister, Goethe und Schiller, gelegt hat; wunderbar charakterisiert Schiller diese Innerlichkeit des Schaffens des Goetheschen Geistes. Und wahrhaftig, so erscheint Goethe mit seinem ganzen Streben im Bilde des deutschen Idealismus.
Deshalb konnte aus dem Streben der Goetheschen Persönlichkeit heraus eine dichterische Gestalt erstehen, die -ich glaube nicht, daß man vorurteilsvoll sein muß, um das zu sagen - in ganz einzigartiger Weise eben in die Welt-dichtung und überhaupt in das ganze Schöpfen der Welt sich hineinstellt, die Figur, die Gestalt des Faust. Wie steht er da, dieser Faust? Als der höchste Repräsentant des menschlichen Strebens, aber doch - er ist ja im Grunde genommen Universitätsprofessor - als Repräsentant des Erkenntnis-, des Wissensstrebens steht er da! Und gleich im Beginn des «Faust», was wird da zum Rätsel, was wird da zur großen Frage? Das Wissen selber, das Erkenntnisstreben wird zur Frage! Zwei Elemente leben sich aus in dieser Faust-Dichtung. Und auf dieses Ausleben der zwei Elemente muß man hinweisen, wenn man auf der einen Seite den Grundcharakter der Goetheschen Faust-Dichtung verstehen will und auf der anderen Seite ihren Zusammenhang mit der innersten Natur des deutschen Geistesstrebens.
Gewiß, beliebt ist heute nicht gerade der Ausdruck Magie und alles dasjenige, was damit zusammenhängt. Aber Goethe hat notwendig gefunden, seinen Faust hinzustellen vor die Magie, nachdem diesem Faust das Wissen, die Erkenntnis zur Frage, zum Rätsel geworden ist. Und daß
man heute imstande ist, alles, was im üblichen Sinne mit dem Begriffe Magie zusammenhängt, von einem tieferen geistigen Streben zu trennen, das wird ja insbesondere meine Aufgabe sein, morgen in dem Vortrage, wo ich sprechen will über die ewigen Kräfte der menschlichen Seele, zu zeigen. Allein man kann die Art und Weise, wie Goethe seinen Faust zur Magie greifen läßt, vielleicht doch sich ganz getrennt denken von allem, was an wüstem Aberglauben, was an nebulosem Streben mit dem Worte Magie und mit dem magischen Streben überhaupt verbunden ist. Man kann schon über Nebendinge hinwegsehen und einmal auf die Hauptsache, nämlich auf den Grundzug menschlichen Strebens, wie er sich im Faust ausdrückt, selber hinsehen.
Warum muß sich Faust, der sich wirklich in allen menschlichen Wissenschaften umgetan hat, bei allen menschlichen Wissenschaften sich Klarheit hat verschaffen wollen über dasjenige, was dem Dasein als Quelle zugrunde liegt, warum muß sich Faust zur Magie wenden, zu einer ganz anderen Art, mit der Natur in Zusammenhang treten, als es die Art des gewöhnlichen Wissensstrebens ist? Warum? Aus dem Grunde, weil Faust dasjenige erlebt hat, was man an Wissensstreben erleben kann; weil er erlebt hat, was der Mensch fühlen kann, der eine Sehnsucht nach den Tiefen des Weltenwesens hat; was der Mensch fühlen kann, wenn er in sich lebendig fühlt, was die äußere Wissenschaft umfassen kann. Diese Wissenschaft vergegenwärtigt die Gesetze der Natur in Begriffen, in Ideen. Aber stehe ich mit diesen Begriffen in dem Dasein drinnen, oder habe ich in diesen Begriffen nur etwas, was sich als ein Gespenst fortwebt in meiner eigenen Seele und was vielleicht mit Bezug auf dieses Bild klar, nicht aber mit Bezug auf sein Leben klar, einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Quellen des Daseins hat? Was sich in dieser Art als Frage in die Seele
hereindrängt, man kann es in verschiedenartiger Weise empfinden. Man kann es schwach, aber man kann es auch stark empfinden, so daß das Rätsel, das sich durch diese Empfindungen in die Seele hineinlebt, wie ein Alpdruck wird, von dem diese menschliche Seele sich erlösen will. Denn die Seele kann sich sagen: All dieses Wissen ist ja nur etwas, was man sich auf Grund des Daseins bildet. All dieses Wissen ist ja etwas, was vom Dasein abgezogen ist. Aber ich muß doch mit dem, was ich in mir erlebe, in das Dasein hinuntersteigen.
Dasjenige was, man möchte sagen, Schelling in seiner Vermessenheit glaubte, Faust kann es eben nicht glauben:
daß, indem man in Begriffen lebt, man in der Natur drinnen schafft. Er will vielmehr hinuntersteigen in die Natur. Er will die Natur aufsuchen da, wo sie im Schaffenden lebt. Er will eine Tätigkeit entfalten, die so ist, daß die menschliche Seele sie vollbringt, die aber, indem diese Tätigkeit in der Seele drinnen ist, Naturschaffen und Seelenschaffen zugleich ist. Weil Faust das auf keine andere Weise vermag, versucht er es, indem er in sich zu beleben sucht den Weg, den alte Magier versucht haben. Faust versucht etwas in seiner Seele zu haben, was nicht bloß die Natur in Begriffen in ihm abbildet, sondern was ihm erscheint in dem, was hinter den Erscheinungen lebt und hinter den Erscheinungen schafft. Das Geistige in dem Naturschaffen, das durch die Welt flutet und webt, das in Lebensfluten, im Taten-sturm auf- und abwallt, das sucht er nicht bloß ins Wissen hereinzubringen, sondern er sucht sich mit ihm lebendig zu verbinden. Er sucht den Weg zu ihm so, daß das geistige Schaffen der Natur neben ihm steht, wie Menschenseele neben Menschenseele verkörpert hier im physischen Dasein darinnen steht, so daß man das Dasein erlebt, nicht bloß davon weiß.
Und damit steht Faust in der Tat so der Natur gegenüber, wie - man braucht eben nur auf einen Geist wie Jakob Böhme, auf seine Art, hinzuweisen, man braucht nur auf dasjenige hinzusehen, was zugrunde liegt dem deutschen philosophischen Streben der idealistischen Zeit -, da steht Faust, sehnsüchtig Erkenntnisse erwartend von gewissen Verrichtungen, zu denen er sich aufschwingen will, so der Natur gegenüber, so neben der Natur, wie es dem innersten Leben und Weben gerade des deutschen Geistes angemessen ist: sich in der Seele die Natur zu erschaffen und zur lebendigen Wissenschaft, zur lebendigen Erkenntnis werden zu lassen. Deshalb muß Goethe seinen Faust mit der Magie zusammenbringen.
Mit etwas anderem bringt Goethe seinen Faust noch zusammen, mit etwas, was vielleicht noch mehr als das magische Element, das uns in den ersten Szenen entgegentritt und dann mehr in einer, ich möchte sagen, unmittelbar dramatischen Weise fortgeht, während es sich als magisches Element verliert - was vielleicht noch mehr als dieses magische Element als wunderbar erscheint für diese Goethesche Faust-Dichtung, was nun auch innig verwoben ist gerade mit dem Geistesstreben des deutschen Volkes.
Versuchen wir - wie gesagt, ohne uns dogmatisch oder irgendwie über den Wert auszusprechen - uns zu Jakob Böhme zu stellen; versuchen wir gerade eine der Seiten des Jakob Böhmeschen Strebens vor unserer Seele lebendig zu machen. Eine große Frage steht vor Jakob Böhme in bezug auf die Rätsel des Daseins, die Frage, die aus der Welten-betrachtung entsteht, wenn man sagt: Die Welt wird durch-waltet von dem Weltengeiste in seiner Güte, in seiner Weisheit. Derjenige, der sich in den Weltengeist zu vertiefen vermag, empfindet das Fluten der Weisheit der Welt, das Fluten auch der Güte der Welt. Aber da stellt sich hinein
das Böse, das Böse in der Form des Leidens, das Böse in der Form der menschlichen Taten. Wenn man nun nicht auf die Abstraktion des Gedankens sieht, sondern wenn man sieht auf ein empfindungs- und gefühlsmäßiges Erkenntnisstreben, auf ein Erkenntnisstreben, das den ganzen Menschen ergreift, so steht man bewundernd vor der Art und Weise, wie sich Jakob Böhme die Frage nach dem Ursprung des Bösen aufwirft. Er kann überhaupt nicht umhin, sich zu sagen: Den Weltengeist, den göttlichen Weltengeist, man muß ihn verbunden denken mit den Quellen des Lebens; aber man findet nicht den Ursprung des Bösen, wenn man sich also in den Weltengeist vertieft. Und das Böse ist doch da. - Mit einer ungeheuren Intensität ersteht vor dem Erkenntnisstreben Jakob Böhmes die Frage nach dem Ursprung des Bösen. Er sucht sie dadurch zu beantworten, daß er nach dem Bösen fragt, wie man etwa fragt nach dem Ursprung der Taten des Lichtes. Das, was Jakob Böhme tiefsinnig entwickelt hat, es kann der Kürze der Zeit halber nur durch diesen Vergleich hier anschaulich gemacht werden. Wie man nämlich niemals aus dem Licht heraus dasjenige ableiten kann, was sich als die Taten des Lichtes zeigt, sondern dazu immer die Finsternis braucht; wie man aber die Finsternis, mit der das Licht zusammen erscheinen muß, niemals aus dem Licht selber ableiten kann, wie man vielmehr zu diesem Urgrund des Lichtes gehen muß, wenn man die Taten des Lichtes in der äußeren Natur prüfen will, so versucht Jakob Böhme, auch nicht im Göttlichen, sondern in dem, was sich neben das Göttliche hinstellt, wie der Schatten, wie die Finsternis neben das Licht, die man nicht im Lichte sucht, für die man aber auch nicht in derselben Weise Gründe braucht, wie für das Licht selber, - so versucht Jakob Böhme das Wesenhafte, nicht bloß das Prinzipielle des Bösen zu finden. Er sucht es dadurch zu finden,
daß er eben den vorher charakterisierten Gang in die Untergründe des Seelischen unternimmt und im Seelischen zugleich das Weltendasein an seinen Quellen zu ergreifen versucht. So stellt er sich dem Bösen gegenüber nicht wie etwas, das man im Begriffe erkennt, sondern wie etwas, das er in seiner Realität, in seiner Wirklichkeit zu erfassen versucht. In seiner Art sich zum Bösen als zu etwas zu stellen, das man nicht dem Begriff, sondern der Wirklichkeit nach erfassen will, folgt wiederum Schelling in seiner so bedeutungsvollen Abhandlung «Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände», 1809. So folgt Schelling Jakob Böhme bewußt in dem Aufsuchen des Bösen.
Goethe hat aus der Tiefe des deutschen Wesens heraus noch in einer ganz anderen Art diese Rätselfrage nach dem Bösen empfunden. Man denke nur, welche Klippe es eigentlich war, in einer solchen Weise eine Dichtung zu schaffen, wie Goethe sie in seiner Faust-Dichtung geschaffen hat. Auf der einen Seite mußte Goethe ein rein innerliches Streben darstellen, das ja im Grunde genommen, wie man glauben könnte, nur zum Ausdruck zu bringen war, wenn man einen Menschen hinstellt, der lyrisch sich zur Welt stellt. Goethe sucht es dramatisch zu beleben, wie Faust vor der Welt steht. Er sucht es allerdings dadurch, daß er das, was in der Seele lebt, zugleich so aufleuchten läßt, daß es innerlich in der Seele lebendig, daß es ein Außerliches wird. Das Dramatische stellt den Menschen nicht nur so in die Welt hinein, wie er lyrisch in derselben steht, sondern wie er tätig in derselben steht. Dadurch ist Goethe in der Lage, wie er es als Dramatiker muß, den Menschen aus der Subjektivität, aus der bloßen Innerlichkeit des Wesens in die äußere Welt zu führen. Aber man versuche sich vorzustellen, welche Klippe in dem lag, was man in der folgenden
Art charakterisieren kann. Nun soll Faust streben, wie der Mensch, wenn er die Rätsel des Daseins auf sich wirken läßt, vorwärts geht in der Welt, ein Kämpfer wird in der Welt. Und dennoch, solche Kämpfe, die aus Rätselfragen der Erkenntnis hervorgehen, sind innere Kämpfe. Da steht der Mensch in der Regel allein, damit ist in der Regel nichts Dramatisches verbunden. Dramen verlaufen anders als so, daß man einfach das Innere der menschlichen Seele abrollen läßt. Wodurch ist denn Goethe eigentlich in die Lage versetzt worden, dasjenige, was im Grunde nur eine innere Angelegenheit der menschlichen Seele ist, zum lebendig-dramatischen Bilde werden zu lassen? Allein dadurch, daß er ebenso, wie er auf der einen Seite durch die Magie das Innere des Menschen hinausführt in die Natur, auf der anderen Seite dieses Innere des Menschen hinausführt in die große Welt, indem er zu zeigen versucht, daß, wenn man das Böse aufsucht und es in seiner Wirklichkeit erfahren will, man es nicht bloß als inneres Prinzip auffassen kann und für es eine innere Erklärung suchen soll, sondern daß man gerade heraustreten muß in das Leben, so wie es einem lebensvoll entgegentritt. Daher kann Goethe nicht den Blick auf das Böse hinlenken so, daß er in ihm etwas findet, was bloße Philosophie ist, sondern er muß auf Wesenhaftes den Blick lenken, auf einen, der den Faust bekämpft, auf einen, der die Verkörperung des Bösen ist, der so lebendig ist als Prinzip des Bösen, wie der Mensch hier in seinem physischen Leibe lebendig ist. Und er muß empfinden können, muß zeigen können, daß der Kampf mit dem Bösen nicht bloß ein abstraktes innerliches Kämpfen ist, sondern daß es ein Kampf ist, der stündlich, augenblicklich geführt wird, in dem der Mensch lebt. In alledem, was er tut, trifft er wesenhaft das Böse. So wurde diese Klippe überbrückt. So wurde wirklich ins unmittelbare Dasein, ins wesenhafte
Dasein hinaus geschaffen, was sonst abstraktes philosophisches Prinzip ist. Zum Gehen, zum Wandeln, zum Handeln, zum Kämpfen wurde gebracht, worüber man sonst spricht. Aus diesen Gründen mußte auf der einen Seite das magische Element aufleben in dem Faust, indem Faust die Hülle der Natur zu durchdringen versucht. Nach der andern Seite mußte das Böse als wesentlich Faust gegenübergestellt werden, als etwas, was viel mehr ist als das, was man gewöhnlich Idee und Begriff nennt; was man gewöhnlich so auffaßt, als ob es nur im Innern der Seele lebt, das mußte, sich verkörpernd, in die Welt hinaus gestellt werden. Und damit mußte in der Dichtung eben zu jener Vertiefung in der Auffassung des Bösen gegriffen werden, die wir als einen so wunderbaren Grundzug des deutschen Geistesstrebens finden, von Jakob Böhme herauf durch alle tieferen deutschen Geister, die sich nicht befriedigen können, indem sie das Böse nur aufsuchen in philosophischen Begriffen, sondern die hinauswollen in die Welt. Und indem sie hinausgehen in die Welt, begegnen sie dem Bösen, so wie man leibhaftig einem anderen Menschen, der physischen Welt begegnet. Um das Innere geistig zu erschließen, mußte sich das Streben verbinden einer solchen Anschauung des Bösen. Das heißt: Wie auf der einen Seite die Natur durch die Magie bis zu ihren Quellen erfühlt werden soll, so soll das geistige Leben dadurch, daß das Böse selber als ein geistig wirksames Wesen aufgezeigt wird, in das menschliche Leben hineingestellt werden. So erhebt Goethe als Dichter den Menschen auf den Schauplatz des Ideals, aber des lebendigen Ideals.
Und er war noch in einer andern Weise damit vor eine Klippe gestellt, er, der große Künstler, von dem Schiller sagte, daß er ein Griechenland aus seiner eigenen Innerlichkeit heraus gebären könne. Er war noch in einer anderen
Weise vor eine Klippe gestellt, vor eine Klippe, die man vielleicht erst nach und nach in ihrer vollen Bedeutung sehen wird. Da steht in Faust der strebende Mensch vor uns. Es ist von vielen Faust-Erklärern hervorgehoben worden, daß Goethe ein Großes dadurch getan habe, daß er den Faust erlöst werden läßt, daß Faust nicht, wie das in früheren Faust-Darstellungen der Fall war, etwa untergeht, sondern daß Goethe ihn erlöst sein läßt, weil man ja in Gemäßheit der neueren Weltanschauung annehmen muß, daß im Menscheninnern die Kräfte liegen, die den Sieg über das Böse erlangen können. Ja, was das eigentlich für eine Folge hat für die Anschauung der ganzen Faust-Dichtung, das bedenkt man gewöhnlich nicht. Man sagt so vor sich hin: Der Goethesche Faust konnte nur das werden, was er geworden ist, wenn Goethe eben von vorneherein den Gedanken hatte, die innerste Menschennatur so zu berücksichtigen, daß der Faust erlöst werden könne. Man denkt sich ein Drama, man denkt sich überhaupt ein Kunstwerk, das in der Zeit verläuft und das groß sein soll, so, daß man von Anfang an weiß, was zuletzt herauskommen muß. Und das müßte eigentlich sein. Denn von den höchsten Lebensrätseln muß ja der Mensch, wie man so meint, seine Überzeugung mitbringen. Eigentlich wird damit nichts mehr und nichts weniger ausgesprochen, als daß der «Faust» schon seiner außeren Natur nach die langweiligste Dichtung von der Welt sein müßte. Denn schließlich weiß jeder Pedant heute, oder glaubt es wenigstens zu wissen, daß der Mensch, wenn er richtig strebt, zuletzt erlöst werden soll. Und nun soll einer der größten Dichter eine grandiose Weltendichtung aufführen, um diese selbstverständliche Wahrheit durch alle möglichen Gestaltungen zu zeigen! Und dennoch, Goethe ist es gelungen, nun nicht in irgendeiner abstrakten Weise den eben ausgesprochenen Gedanken zu verkörpern, sondern
lebendiges Leben vor uns hinzustellen durch eine lange, lange Bilderreihe. Warum? Einfach aus dem Grunde, weil er gezeigt hat, wie dasjenige, was in abstrakte Gedanken innerlich gefaßt eben eine Trivialität, eine Selbstverständlichkeit wäre, in ganz anderer Art ins Leben sich hinein-stellt; weil er versucht, das Leben zu erweitern auf der einen Seite nach der magischen, auf der andern Seite nach der spirituellen, nach der geistigen Seite hin; weil ihm das Naturstreben kein Wissens- sondern ein magisches Streben ist; weil das Streben nach dem Bösen oder das Erkennen des Bösen nicht bloß eine philosophische Sache sondern eine Lebenssache ist. Wie wird das eine Lebenssache, was sonst nur inneres abstraktes Streben der Seele ist? So wird es eine Lebenssache, daß der Mensch, wenn er nun in dem Sinne der Natur gegenübersteht, wie Faust im Sinne seines Strebens der Natur gegenübersteht, ja über das abstrakte Wissen hinaus will. Dasjenige, was da nur im Begriffe drinnen leben kann, was sich so als Ideen, als Begriffe fort-spinnt, über das will Faust hinaus. Er will hinein in die Sphäre der Natur, wo schaffendes Leben ist, mit dem sich das eigene schaffende Leben der Seele verbindet, um mit dem Schaffen der Natur über das bloß abstrakte Begriffs-leben hinauszukommen.
Da kommt man aber, wenn man die Sache im vollen Leben ergreift, in dasjenige im Menschen hinein, woraus der Mensch wiederum herauskommt dadurch, daß er sich eben ein Bewußtsein in seinen Begriffen erwerben kann. Man braucht ja nur zurückzugehen zu dem, was zum Beispiel aus einem ernsten Erkenntnisstreben heraus die griechischen Stoiker wollten. Sie wollten eine die Welt abglättende, die Welt überschauende Weisheit, die nicht irgendwie noch etwas zu tun hat mit menschlicher Leidenschaft. Der Mensch sollte leidenschaftslos werden, leidenschaftslos
sein, um im ruhigen begrifflichen Erfassen der die Welt durchwallenden Weisheit selber seine Seele aufgehen zu fühlen. Warum wollten denn das die Stoiker? Weil sie fühlten: Man kommt aus einem gewissen Rausch des Lebens, aus einem halb unbewußten Untergetauchtsein in das Leben heraus dadurch, daß man zu dem leidenschaftslosen Begriff kommt. Der Stoizismus besteht gerade in dem Suchen eines rauschfreien Lebens.
Nun steht durch den Gang der Menschheitsentwickelung diejenige Persönlichkeit, die in Faust repräsentiert werden soll, vor der Natur so, daß das Wissen für sie zur Frage wird, dasjenige, wodurch sich der Mensch zu retten versucht aus dem Rausche des Lebens heraus. Er kann hineinkommen in den Rausch des Lebens; indem er mit den Schaffenskräften der Seele untertaucht, nimmt er eben nicht diejenigen Kräfte auf, mit denen er sich gerade erhoben hat, sondern er taucht unter, sucht Untergründe der Seele mit den Untergründen der Natur zu verbinden. Daraus entsteht aber dasjenige, was nun der Irrtum des Faust im ersten Teil der Dichtung ist, das Untertauchen in die Sinnlichkeit, in das sinnliche Leben, sogar ins äußere triviale Leben, das er durchmachen muß in der eigenen Persönlichkeit, weil er das, was in der eigenen Persönlichkeit lebt, was in den Tiefen der Seele lebt, verbinden soll mit dem, was in den Tiefen des Weltdaseins lebt. Lebensvoll den Irrtum, durch den der Mensch in seiner Seele geprüft werden kann, darzustellen, das wird die Aufgabe des ersten Teiles des «Faust» und auch noch eines großen Stückes im zweiten Teil des «Faust» .
Inwiefern der Mensch, indem er die Welt persönlich, die Welt in ihrer Macht durch das Wissen ergreifen will, der Gefahr sich aussetzt, in das Persönliche unterzutauchen und in den Strudel des Lebens hereingerissen zu werden, das
wird im «Faust» dargestellt. Und das hängt nicht ab von irgendeiner abstrakten Lehre, sondern davon, wie dieser Faust im Willen, in seinem Charakter ist. Dadurch wird die Dichtung eigentlich erst zur Dichtung. Und auf der andern Seite: indem der Mensch nach einer wirklichen Erkenntnis des Bösen strebt und nicht zufrieden ist mit einer prinzipiellen, mit einer begrifflichen Auffassung des Bösen, muß er ja dasjenige, was das gewöhnliche Seelenleben ist, durchbrechen; denn da findet er nur Begriffe, Ideen, Empfindungen. Er muß hindurch durch dieses Seelenleben, er muß dahin, wo der Mensch, ohne durch die Sinne das Wesenhaft-Wirkliche zu sehen, durch die reinen Seelen-erlebnisse ein Wesenhaft-Wirkliches wahrnimmt, aus dem Geiste heraus ein Wesenhaft-Wirkliches wahrnimmt. Das wird die Aufgabe desjenigen, der das Böse in seiner Wirklichkeit erlebend erkennen will. Das wird die Aufgabe des Faust gegenüber dem Mephistopheles. Aber der Mensch kann ja gar nicht so, wie er zunächst ist, an dieses Böse herankommen. Es ist geradezu eine Unmöglichkeit, an das Böse heranzukommen, so wie der Mensch zunächst ist; denn die Welt muß man erkennen, und man kann sie nur erkennen, indem man sie in der Seele erkennt. Man muß sich Begriffe machen. Man muß das, was in der Seele erlebt werden kann, in der Seele haben. Man kann ja, wie neuere Philosophen so recht und so unrecht zugleich versichert haben, sein Bewußtsein nicht überschreiten. Aber wenn man im Bewußtsein bleibt, so bleibt das Böse nur abstrakter Begriff, tritt nicht wesenhaft auf.
Faust steht vor einer großen, sozusagen unmöglichen Aufgabe. Doch groß ist, wie es im «Faust» selber heißt, «der Unmögliches begehrt». Faust steht vor der geradezu unmöglichen Aufgabe, das, was allein Quell seines Bewußtseins ist, zu überschreiten, aus dem Bewußtsein herauszugehen.
Das wird sein weiterer Weg, der Weg aus dem gewöhnlichen Bewußtsein der Seele heraus. Wir werden morgen von dem Erkenntnisweg sprechen aus dem gewöhnlichen Bewußtsein zu denjenigen Gefilden hin, wo der Geist unmittelbar als Geist ergriffen wird. Vor Faust steht dies als eine Aufgabe. Das Böse wesenhaft kann er nicht finden auf dem Felde, auf welches das Bewußtsein zunächst gerichtet ist. Daher muß er wiederum, und jetzt nicht in allgemeiner trivialer abstrakter Weise, dazu kommen, die Versöhnung des Menschen mit dem Dasein zu finden, sondern so, wie er es als individueller Mensch vermag. Es muß gezeigt werden, wie er aus dem gewöhnlichen Bewußtsein herausfindet zu einer Erfassung des Lebens, die nun aus tieferen Kräften des Seelischen stammt.
So sehen wir Faust hingehen, indem er, ich möchte sagen, überall das Weltendasein angreift und betastet, innerlich betastet, um zu sehen, wo er die Pforte findet, um durch die Hülle ins Innere zu kommen. So sehen wir, wie er sich auf-schwingt so weit, daß er, indem er die Seele umgewandelt und immer mehr umgewandelt hat, im Erleben wirklich in diejenigen Tiefen heruntersteigt, nach denen Jakob Böhme strebte und die uns im zweiten Teile des «Faust» dann dadurch angedeutet werden, daß Faust ein Weitestes, ein Größtes, ein Höchstes und zugleich Tiefstes, das er schon in seinem Gang zu den Müttern angestrebt hat, findet, indem ihm die Sinne schwinden, indem er erblindet und in seinem Innern nun inneres helles Licht auflebt. Aus dem gewöhnlichen Bewußtsein heraus zu einem anderen Bewußtsein, zu einem Bewußtsein, das in den Tiefen der Seele schlummert, wie die Tiefe der Quellen der Natur unter der Hülle der Natur schlummert, die man mit den äußeren Sinnen sieht, zu einem tieferen Bewußtsein, das den Menschen zwischen Geburt und Tod immerdar begleitet,
das aber im gewöhnlichen Bewußtseinsfelde nicht vorhanden ist, dazu muß Faust geführt werden. In zwiefacher Weise muß Faust geführt werden durch die Erkraftung des ideellen Lebens zu den Pforten, die aus der Abstraktheit der Idee in das Lebendige des geistigen Daseins selber hinführen: Als Magier klopft Faust an die Pforte zum Dasein, die aus der bloßen Betrachtung der Natur zum Mitschöpfen an der Natur führt; in seinem Umgang, im lebendigen, dramatischen Umgang mit Mephistopheles und mit alledem, was sich daran gliedert, klopft Faust an die andere Pforte, an jene andere Pforte, die aus dem gewöhnlichen Bewußtsein der Seele hinausführt zu einem Überbewußtsein, zu einem übersinnlichen Bewußtsein, das eine geistige Welt, aus der auch das Böse wirklich stammt, hinter dem gewöhnlichen Seelendasein so erschließt, wie die äußere natürliche Offenbarung eben nur der Ausdruck ist desjenigen, was ganz in der Natur lebt und webt.
Durch die Verbindung mit dem, was, man kann sagen, dem deutschen Volksgeiste ureigentümlich ist, hat Goethe eine Dichtung geschaffen, die eigentlich im allerschwierigsten Sinne nur eine Dichtung werden konnte. Denn das Unsinnlichste, das dem Sinnlichen ganz Ferne, das rein Innerliche, sollte dramatisch gestaltet werden. Aber dieses Innerliche wird nur dramatisch, wenn man es erweitert nach zwei Grenzen hin. Und Goethe hat die Notwendigkeit dieses Erweiterns nach zwei Grenzen hin empfunden. Damit hat er sich die Möglichkeit geschaffen, diese einzigartige Dichtung, auf die gewissermaßen innerhalb eines anderen Volkes gar keiner in derselben Weise gekommen ist, in die Weltenentwickelung hineinzustellen.
Man kann, wenn man diese Gedanken hat, noch vielleicht die Frage aufwerfen: Ja, aber hat damit Goethe nicht eigentlich eine Dichtung geschaffen, zu deren Verständnis
man viel, viel Vorbereitung braucht? Es scheint fast so. Denn die Kommentare, welche die Gelehrten, die deutschen und außerdeutschen Gelehrten, über Goethes «Faust» geschrieben haben, füllen mehrere Bibliotheken, nicht bloß eine. Aber wenn man danach auch glauben könnte, es gehöre viel Vorbereitung dazu, die Faust-Dichtung zu verstehen, dann muß doch wiederum der Gedanke vor einem aufleuchten: Woraus hat denn Goethe diese Faust-Dichtung eigentlich gemacht? Aus einem abgezogenen philosophischen Streben heraus? Aus Spekulation über die magischen Grundlagen der Natur? Oder aus Spekulation über die Quellen, über die Ursprünge des Bösen? Nein, wahrhaftig nicht! Das Puppenspiel hat er gesehen, eine reine Volksdarstellung, das Volksschauspiel von dem Faust, das den einfachsten Gemütern vorgeführt wurde, hat er gesehen, und was darinnen lebt und webt, hat er umgeschaffen in seinem Sinn. Gerade die Faust-Dichtung stellt uns daher im besten Sinne ein Kunstwerk und ein Geisteswerk dar, das, wenn man nur auf das Allerallgemeinste der Entstehung sieht, zeigt, wie dieser Gipfel deutschen Geisteslebens aus dem unmittelbarsten Volkstum, das heißt aus dem Elementarsten des Volksgeistes hervorgequollen ist, wie zusammenhängt deutsches idealistisches Geistesstreben mit dem Wesen des deutschen Volksgeistes. Auch historisch ist es nachweisbar an dem Hervorgehen der höchsten Dichtung der Menschheit aus dem einfachsten Volksschauspiel. Dies ist ein bedeutungsvolles welthistorisches Schauspiel, daß ein Geist, der sich so tief einsenken kann in seinem innern Arbeiten in das Volkstum wie Goethe, der aus dem primitivsten Volkstum heraus ein Allerhöchstes zu schaffen vermag, ein Allerhöchstes, das, wie wir zeigen konnten, zusammenhängt auch mit dem bedeutsamsten philosophischen Streben, mit dem philosophischen idealistischen Streben
in Deutschlands großer Geisteszeit. Man sieht im Faust - wie gesagt, die Dinge dürfen nicht dogmatisch genommen werden - den strebenden Fichte. Inwiefern? Fichte sucht nicht wie Descartes, wie Cartesius, durch das Sich-zum-Bewußtsein-Bringen des Denkens das Sein, das Ich zu ergreifen, sondern Fichte sucht das Sein, das Ich zu ergreifen, indem er sich zusammenstellt mit den weltschöpfe-rischen Kräften, die in das Innere der Seele hereinspielen, so daß das Ich sich in jedem Augenblick selber schafft. Wir sehen dies, nur in das dramatische Wollen, ins unmittelbar Lebendige umgesetzt, in Faust wiederum aufleuchten. Faust ist nicht zufrieden mit dem Selbst, das ihm überliefern konnte das menschliche Wissensstreben, sondern er will das eigene Selbst in der Geisteswelt unmittelbar erleben. Der ganze Fortgang der dramatischen Handlung im «Faust» besteht ja darin, daß das Ich in seinem Umgang mit der Welt sich neu schafft, sich immer erhöht. Fichte lebt in dem Goetheschen Faust; auch Schelling lebt in dem Goetheschen Faust, indem Faust auf der einen Seite versucht, das Wahre der Magie mit seiner Seele zu vereinigen, aber auch das wahre Streben in die Untergründe der Seele sucht; indem er dasjenige, was in dem gewöhnlichen Seelenleben, in Denken, Fühlen und Wollen nicht gefunden werden kann, in seinem Umgang mit dem Repräsentanten des Bösen, als eines unmittelbaren Geistes, zu finden sucht. Faust sucht wahrhaftig die Natur da auf, wo sie im Schaffen lebt. Schelling hatte sie, ich möchte sagen, in einer vermessenen Weise erklärt, als er sagte: Die Natur verstehen, heißt die Natur schaffen! - Fichte steht auf gesünderem Boden, indem er sagt: Die Natur verstehen heißt, sich mit seinem eigenen Schaffen in das Schaffen der Natur hineinzuleben. - Aber nian sieht, wie die Kraft nach einem tieferen Erkenntnis-streben, nach den Quellen des Daseins auch in Fichte lebt.
Hegel strebte nach dem nüchternen Gedanken, und man kann nicht nüchterner sein als Hegel. Der Weltengeist, mit dem sich die Seele in der Hegelschen Philosophie zu vereinigen versucht, wird zum bloßen Logiker. Den göttlichen Weltengeist sich zu denken als eine logische Seele, welche die Welt nur logisch aufbaut! Man darf es nicht dogmatisch nehmen, aber nehmen muß man es als Ausdruck des Strebens, das selbst noch in der äußersten Logik mystisch bleibt, das nach einer Vereinigung des Tiefsten der Seele mit dem Gipfel des ganzen Weltendaseins selber in Natur und Geschichte sucht. So muß auch Hegel genommen werden, daß man das eigene Selbst nicht finden kann in dem, was uns die Sinne liefern, sondern allein in dem, was die Menschen-seele in sich erreichen kann, wenn sie aus der Sinnenwelt herauskommt. Das ist auch bei Hegels Philosophie angestrebt. Und Faust, nachdem ihm das Augenlicht erloschen ist, leuchtet im Innern helleres Licht. Was Hegel auf dem rechten Wege sucht, nur nicht als rechtes Ziel gewahr werden kann, das sucht Faust: das eigene Selbst ruhend aufgehen zu lassen im Welten-Selbst, sich mit diesem zu vereinigen, um so das Welten-Selbst im eigenen Selbst zu erleben.
Kann man nicht sagen, wie Wilhelm von Humboldt gesagt hat, dieses deutsche Streben hat auch in einer schönen Weise nicht nur versucht, den Zusammenklang zwischen Philosophie - wenn man das Streben nach einer Weltanschauung so nennen will - und der Poesie, der Kunst überhaupt, herzustellen, sondern der deutsche Geist hat dieses Streben auch im Faust in einer ganz einzigartigen Weise zur äußeren Ausgestaltung, zum äußeren Ausdruck gebracht? Charakterisiert sich nicht gerade das, was Deutschtum ist, in diesem harmonischen Zusammenklingen desjenigen, was die Phantasie schafft, und desjenigen, was der Wahrheitssinn sucht? Findet man nicht sonst in der Welt zu
allermeist die Anschauung, die Phantasie schaffe eben in Freiheit, aber in Unwirklichkeit? Der Wahrheitssinn schafft zwar nach dem Notwendigen des Daseins, aber er kommt dadurch nicht zu einem wirklichen Leben, nur zu einer Vergegenständlichung, zu einem Repräsentieren des Erlebens. Die Phantasie aus ihrer Unwirklichkeit herauszuholen und das, was sie zu schaffen vermag, so zu beleben, daß das Geschaffene mit dem lebendigen Geist zusammenlebt, so daß Einklang, harmonischer Einklang zwischen Poesie und Philosophie auch einmal in einem Werke der Kunst dastehen kann, - das versucht Goethe aus der ganzen Ursprünglichkeit und dem wahrhaftig gar nicht Philosophischen seines Wesens heraus. Und hat er es, dieses Harmonisierende zwischen Poesie und Philosophie, zwischen Phantasie und Weltanschauung erreicht, indem er sich verbunden hat mit den Quellen des Allervolkstümlichsten des deutschen Wesens, so darf man sagen: So wie dieses Goethesche Schaffen - man könnte es auch an anderen seiner Werke zeigen, aber es zeigt sich am klarsten, am ausdrücklichsten an seinem «Faust» - sich da zeigt im Zusammenhang mit dem, was wiederum die idealistische deutsche Weltanschauung gesucht hat; da ist es zwar, so wie es jetzt vor uns steht, scheinbar das Geistesgut von Wenigen, die sich besonders dazu vorbereiten. Man kann auch den Blick darauf werfen, daß im Grunde genommen Anhänger und Gegner im weiteren Verlauf des deutschen Geisteslebens bis in unsere Zeit herein sich auseinanderzusetzen versuchten mit den Wegen, die dazumal in der Goethe-, Schiller-, Schelling-, Hegel-Zeit genommen worden sind. Unendliche Mühe hat man aufgewendet, um so recht zu verstehen, was dazumal an Wegen genommen wurde, auf denen man die Quellen des Daseins finden kann. Wer sich tiefer einläßt auf dasjenige, was auf dem Schauplatz
des deutschen Idealismus gelebt hat, der wird vielleicht aber zu der Anschauung kommen, daß dasjenige, was da ausgestaltet worden ist, doch nicht das Gut nur Weniger, nur Einzelner zu bleiben braucht. Gewiß, wenn man sich heute, so wie Fichte, Schelling, Hegel selber ihre Weltanschauung dargestellt haben, darein vertiefen will, wenn man sich auf ihre Bücher einläßt, so schlägt man in begreiflicher Weise die Bücher bald wieder zu, wenn man nicht ein besonderes Studium daraus machen will. Denn begreiflicherweise kann man sagen: Dieses alles ist ja ganz unverständlich. Daran soll auch weiter gar nicht Kritik geübt werden gegenüber denjenigen, die das Unverständliche und Unverdauliche davon behaupten. Aber es gibt eine Möglichkeit, und diese Möglichkeit ist durch die menschliche Entwickelung eigentlich geboten, daß das, was so scheinbar ein unverdauliches Gut für wenige ist, ganz populär werden kann, wirklich Eingang finden kann in das ganze geistige Kulturleben der Menschheit. Daß man einmal das Welten-streben des Menschen in solcher Weise erfaßt, wie es im deutschen Idealismus erfaßt worden ist, dazu war notwendig, daß einige einmal sich ganz und gar der besonderen Ausgestaltung von Begriffen, von Ideen widmeten, daß sie das in einer Einsamkeit des geistigen Lebens versuchten, die eben als solche einzig dasteht.
Aber dabei braucht es nicht zu bleiben. Möglich ist es, dasjenige, was in Fichte in so abstrakten, so abstrusen, wie viele von ihrem Standpunkte aus mit Recht vielleicht sagen werden, vertrackten Gedanken lebt, so populär darzustellen - ich weiß, daß ich damit für viele etwas Paradoxes sage, aber die Zeit wird lehren, daß es richtig ist -, wenn man sich in den Geist, in die Art hineinlebt, so darzustellen, daß man es dem Knaben, dem Mädchen in frühester Jugend unmittelbar beibringen kann; daß es eingesehen werden
kann so, wie man etwas einsieht, was ganz in der Natur des menschlichen Lebens liegt, wenn man dieses menschliche Leben ergreifen will. Und so mit all den anderen dieser Geisteshelden! Geradeso kann man das, wie man das bei den Grimmschen Märchen kann. Es gehört nicht mehr geistige Regsamkeit der Seele dazu, Goethe, Fichte, Schelling, Hegel in dem Tiefsten ihrer Schöpfungen zu erkennen, zu erfühlen, zu empfinden, als zum richtigen phantasiemäßigen Erfassen eines Märchens gehört, wie es in den Grimmschen Märchen steht. Aber der Weg wird den Menschen erst dazu führen müssen, so mit etwas zu leben, was zum Höchsten gehört, das die Menschheit an Erkenntnis- und an Dich-tungswesen durchgemacht hat. Und das ist die Bedeutung dieses idealistischen Strebens des deutschen Geistes. Wenn man einmal zeigen wird, wie man in einfacher Weise das Wesen der Seele erfassen kann, indem man appelliert an die schöpferischen Kräfte, die jedem aufgehen werden, wenn man ihn nur in der rechten Weise hinweist, dann wird man dasjenige in einfacher Weise, in elementarer Weise, in unmittelbarer Weise an den Menschen heranbringen, wozu Fichte, um es zum erstenmal zu finden, allerdings eine besondere Höhe des Geistes brauchte. So ist es auch für das andere. Aber ist das gar so unerhört, was ich da sage? Ich glaube nicht, daß es derjenige so unerhört finden wird, der sich daran erinnert, wie er in der Schule begreifen gelernt hat den pythagoräischen Lehrsatz. Aber er ist deshalb doch wohl nicht aufgelegt, sich für einen Pythagoras zu halten, obwohl die geistige Stufe, die Geisteskraft des Pythagoras dazu notwendig war, um damit den pythagoräischen Lehrsatz zuerst zu finden. Ein intensiver Strom geistigen Weltenerlebens wird gehen von dem, was allerdings in einsamen abstrusen Gedanken innerhalb des deutschen Idealismus beste deutsche Geister gesucht
haben, bis herunter in das gewöhnlichste Streben und Leben des Menschen.
Und vieles, unendlich vieles wird dieses gewöhnliche Streben des Menschen haben, wenn es sich in richtiger Weise zu stellen vermag zu dem immer Schöpferischen und bis in sein bewußtes Stehen im Unendlichen hinein Sich-schöpfe-risch-Fühlen des menschlichen Ich. In diesem Aufgehen in der schaffenden Natur wird die Menschenseele erst die großen Schönheiten der sich offenbarenden Natur erleben und fühlen können. Und in ähnlicher Weise gilt das für die andern Elemente dieses deutschen Geisteslebens.
Man muß dies fühlen, dann überkommt einen das rechte Empfinden von dem Zusammenhang des deutschen Strebens mit dem gesamten Weltenstreben. Und diese Empfindung in unseren Tagen aufleben zu lassen, es erscheint unserer schicksaltragenden Zeit gegenüber gewiß angemessen. Und es gehört schon zu dem, worin die deutsche Seele ihre Kraft findet. Dafür zum Schlusse ein Beispiel.
Noch bevor aus den Weltenzusammenhängen heraus, aus der Geschichte heraus, die Einheitsgestaltung des deutschen Volkes, der deutsche neue Staat entstanden ist, schreibt ein unbekannt gebliebener Geist in der Betrachtung des Goethe-schen «Faust» schöne Worte hin. 1865 war es. Ich führe diese Worte eines sonst ganz unbekannten «Faust»-Erklärers nur an, weil sie das aussagen, was unzählige andere auch genauso gefühlt haben. Unzählige der besten deutschen Geister haben, seit es jene Erhebung im deutschen Idealismus gegeben hat, von der wir auch heute wieder gesprochen haben, den Zusammenhang gefühlt zwischen den Wegen, welche die Idee, die der Idealismus nimmt in den Geist der Natur und in die tieferen Grundlagen des Seelisch-Geistigen selber. Sie haben gefühlt, daß es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was der deutsche Geist auf seiner Höhe für
den Gedanken geschaffen hat, was er als Summe von Gedanken und künstlerischen Schöpfungen der Menschheit übergeben hat, einen Zusammenhang zwischen all diesem und dem, was an Kräften auch leben kann in der deutschen Tat, in dem, was nun das deutsche Volk zu tun hat, wenn es auf anderem Schauplatze als auf dem des Gedankens seine Weltenkämpfe auszuführen hat. Den Zusammenhang zwischen dem deutschen Geistesleben und der deutschen Tat haben gerade diejenigen am tiefsten empfunden, die den deutschen Gedanken und das deutsche idealistische Schaffen am höchsten in ihrer Art zu stellen wußten. Und aus der Betrachtung der Vergangenheit des deutschen Idealismus mit seiner Erhebung zu den Höhen, wo der Gedanke in das Leben des Geistes einführt, - aus der Betrachtung dieser Sphäre des deutschen Idealismus ist immerdar hervorgegangen die schönste Hoffnung dafür, daß das deutsche Volk aus demselben Urquell heraus den Impuls zur Tat finden werde, wenn es ihn braucht.
Was an vielen gezeigt werden könnte, an einem - und gerade absichtlich an einem ganz wenig Bekanntgewordenen, Kreyssig, einem «Faust»-Erklärer, sei das zum Schlusse angeführt. Kreyssig, indem er eine Schrift über den Goethe-schen «Faust» geschrieben hat, in der er sich klar zu werden versuchte in seiner Art, 1865, was Goethe mit seinem «Faust» eigentlich gewollt hat, er schließt mit den Worten:
«Und so wüßten wir denn auch den Gesamteindruck, den die Betrachtung dieses immerhin unvollendet und Bruchstück gebliebenen Riesendenkmals unserer großen Bildungs-epoche Lhinterläßt], hier nicht besser zusammenzufassen als in die einfache Erinnerung an eine Stelle aus dem berühmten Vermächtnisse des damals 75jährigen Dichtergreises an die für das Auftreten in neuen Bahnen sich rüstende jüngere Welt.»
Goethes Gedanken selber führt Kreyssig an, da wo er ins Auge faßt die Art, wie Goethe bis ins hohe Alter den Weg in die geistige Welt hinein gesucht hat. Kreyssig sagt aus, wie ihm die Kraft, die in diese geistige Welt hinein-führt, zusammenzuhängen scheint mit jener Kraft, die die deutsche Tat schaffen soll in fernen, fernen Zeiten, die Goethe als Greis nur ahnen konnte:
Der ernste Stil, die hohe Kunst der Alten,
Das Urgeheimnis ewiger Gestalten,
Es ist vertraut mit Menschen und mit Göttern,
Es wird in Felsen wie in Büchern blättern.
Denn was Homer erschuf und Scipionen,
Wird nimmer im gelehrten Treibhaus wohnen!
Sie wollten in das Treibhaus uns verpflanzen;
Allein die deutsche Eiche wuchs zum Ganzen!
Ein Sturm des Wachstums ist ihr angekommen,
Sie hat das Glas vom Treibhaus mitgenommen.
Nun wachs, 0 Eich', erwachs zum Weltvergnügen.
Schon seh ich neue Sonnenaare fliegen.
Und wenn sich meine grauen Wimpern schließen,
So wird sich noch ein mildes Licht ergießen,
Von dessen Widerschein von jenen Sternen
Die späten Enkel werden sehen lernen,
Und in prophetisch höheren Gesichten
Von Welt und Menschheit Höh'res zu verrichten.
Und der «Faust»-Erklärer fügt hinzu - 1865-:
«Fügen wir noch den Wunsch hinzu, daß das des von besseren Sternen mit mildem Lichte auf uns herabblickenden Meisters Wort in Erfüllung gehen möge an seinem in Dunkel, Verwirrung und Drang, aber, so Gott will, mit unver-wüstlicher Kraft seinen Weg zur Klarheit suchenden Volke, und daß ,
welche der Dichter des «Faust» von den kommenden Jahrhunderten erwartet, auch die deutsche Tat nicht mehr als symbolisches Schemen, sondern in schöner, lebenfreudiger Wirklichkeit neben dem deutschen Gedanken und dem deutschen Gefühle einst ihre Stelle und ihre Verherrlichung finde!»
So dachte eine deutsche Persönlichkeit 1865 den deutschen Gedanken im Zusammenhang mit der erhofften deutschen Tat. Wie mögen die entkörperten Seelen solcher Persönlichkeiten hinblicken auf das Feld, auf dem heute die deutsche Tat zu ihrer Verwirklichung aufgerufen ist!
Aber das darf gerade im Zusammenhang mit dem Glauben, Lieben und Hoffen solcher Persönlichkeiten gesagt werden, und vor allem auch der Persönlichkeiten, die entweder schaffend oder verstehend innerhalb des Weltbildes des deutschen Idealismus gestanden haben, es darf gesagt werden: Der Deutsche braucht nicht, wenn er erkennen will die Impulse, die ihn beseelen sollen, irgend welchen Gegner herabzusetzen. Er braucht sich bloß zu besinnen auf das, wovon er glauben muß, daß es nach dem Innersten seines Wesens seine Weltaufgabe ist. Er braucht sich also darauf zu besinnen, daß er hinaufblickt zu der Art und Weise, wie es die Väter, die Vorfahren, bis in seine Zeit heruntergeschickt haben; wie es Kraft geworden ist für die Gegenwart, und wie aus dieser Kraft, die ihm vor Augen steht, die ihm in der Seele lebt, aus der Gegenwart die Hoffnung in die Zukunft erquillen darf.
Wahrhaftig, so kann man im Zusammenhang der Gegenwart mit dem deutschen Idealismus aus innerstem Fühlen heraus sagen: Indem der Deutsche auf die Vergangenheit des Gedankens oder dessen, was er außerhalb des Gedankens erstrebt hat, hinblickt, erfühlt er seine Weltaufgabe; er darf sie fühlen in dieser schicksaltragenden Zeit, er
darf sie fühlen aus seiner Liebe zu seiner Vergangenheit, und aus dem Glauben an die Kraft der Gegenwart, die ihm wird, wenn er die rechte Liebe zu dem hat, was ihm die Vergangenheit gebracht hat. Und aus dieser Liebe und aus diesem Glauben, aus diesem Doppelverhältuis zwischen Vergangenheit und Gegenwart, wird in der rechten Weise ersprießen, was uns über Blut und Schmerzen hinweg doch eine beseligende Gegenwart erscheinen läßt: die deutsche Hoffnung auf die Zukunft. So kann zu einem Dreiklang gerade durch eine Vertiefung in das Idealistische des deutschen Wesens entstehen die Liebe zur deutschen Vergangenheit, der Glaube an die deutsche Gegenwart, die Hoffnung auf die deutsche Zukunft.
DIE EWIGEN KRÄFTE DER MENSCHENSEELE Berlin, 3. Dezember 1915
Betraditungen über die ewigen Kräfte der Menschenseele vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, wie diese Geisteswissenschaft hier gemeint ist, sind in unserer Zeit natur-gemäß, man möchte sagen, ganz selbstverständlich Mißverständnissen ausgesetzt. Und ganz selbstverständlich ist es, von diesem oder jenem Gesichtspunkte aus, der zweifellos von einer gewissen Seite her berechtigt ist, widerlegt zu werden. Bei solchen Widerlegungen findet nur das Folgende statt: Derjenige, der solche Ergebnisse der Geisteswissenschaft zu widerlegen vermeint, bringt diese oder jene Gründe vor und meint dann, dasjenige sei getroffen, was er getroffen haben will, und mit seinen Gründen könne der Geisteswissenschafter ganz und gar nicht einverstanden sein. Gerade eine solche Betrachtung, wie sie heute hier aus den Ergebnissen der Geisteswissenschaft heraus angestellt werden soll, ist den angedeuteten Mißverständnissen ausgesetzt, denn die Sache liegt gewöhnlich so - ja, man kann sagen, in den Fällen, die zutage getreten sind, liegt die Sache immer so -, daß derjenige, der widerlegt, Dinge vorbringt, mit denen der Geisteswissenschafter durchaus einverstanden ist, absolut einverstanden ist. Nur daß Geisteswissenschaft etwas zu sagen hat, was von solchen Einwänden gar nicht berührt wird, von solchen Einwänden, die der Geisteswissenschafter oftmals in einem viel weiteren Umfange gelten läßt als derjenige, der die Einwände macht.
Dies gilt namentlich in bezug auf die Frage, die heute
gestellt werden soll, und für das, was von seiten naturwissenschaftlicher Weltanschauung oftmals dazu vorgebracht wird. Der Geisteswissenschafter, ich habe das oftmals von dieser Stelle aus betont, aber ich muß heute einleitungsweise doch noch einmal darauf hinweisen, der Geisteswissenschafter steht keineswegs in irgendeinem Gegensatz zu der auf die großen Errungenschaften der neueren Zeit begründeten naturwissenschaftlichen Weltanschauung, insbesondere dann nicht, wenn es sich um Fragen des menschlichen Seelenlebens handelt. Gewiß, es wird von mancher Seite, die in einem heute noch gültigen Sinne Psychologie, Seelenkunde treiben will, mancherlei vorgebracht über den Ewigkeitscharakter eines menschlichen Seelenkernes. Dann kommt der Natur-wissenschafter, und ich sage ausdrücklich, oftmals mit vollem Rechte, und sagt: Da sehen wir die menschlichen Seelen-äußerungen, des Menschen Denken, des Menschen Fühlen, des Menschen Wollen, wie sie sich äußern von der Geburt oder von dem Zeitpunkte an, da der Mensch bewußte Vorstellungen entwickeln kann, bis zum Tode hin. Blicken wir dieses Seelenleben an - so muß der Vertreter der natur-wissenschaftlichen Weltanschauung sagen -, dann erscheint es im engsten Sinne gebunden an die körperlichen Vorgänge; und man kann aufzeigen, wie es gebunden ist an die körperlichen Vorgänge, wie die körperlichen Verrichtungen sich vom zartesten Kindesalter an nach und nach entwickeln und wie sich mit diesen körperlichen Vorgängen, indem sie sich, wie man sagt, vervollkommnen, die Fähigkeiten des Denkens, des Wahrnehmens, des verständigen Wahrnehmens ganz parallel entwickeln. Man kann wiederum sehen, wie mit dem Hinschwinden der physischen Verrichtungen des Menschen auch die seelischen Verrichtungen allmählich in den Hintergrund treten, allmählich zurückgehen, ab-fluten. Ja, man kann noch mehr zeigen. Man kann zeigen,
wie bei Krankheit oder dergleichen, durch Ausschaltung irgendeiner Gehirntätigkeit, irgendeines Teiles des Nervensystemes Teile des geistigen Lebens verschwinden; wie Unfähigkeit an Stelle der Fähigkeit tritt, wenn organische Funktionen ausgeschaltet werden. Man könnte, was angeführt worden ist, noch ins Unendliche vermehren. So kann man mit Recht sagen: Ist denn nicht alles, was der Mensch mit seinem Denken, Fühlen und Wollen entwickelt, an die physischen Verrichtungen gebunden, die allmählich durch die Naturwissenschaft entdeckt werden, wie die Flamme gebunden ist an das Brennmaterial der Kerze? Und in der Tat, manche sogenannte Beweise, die für den Bestand eines Seelenkernes innerhalb des gewöhnlichen Denkens, Fühlens und Wollens vorgebracht werden, sie gleichen wirklich etwa einer Vorstellung, die man sich bilden würde von der Art, daß man sagt, man fände etwas in der Flamme, das doch nicht vergehen könne, wenn das Material der Kerze irgendwie der Flamme entzogen werde. Man kann sagen: Vieles in der gewöhnlichen Seelenlehre ist den Gründen, den Beweisarten nach so aufgebaut, daß es ganz genau dem Gedanken entspricht, den man haben würde, um zu beweisen, daß das, was in der Flamme lebt, nicht verschwinden könne, wenn man der Flamme das Brennmaterial wegnimmt.
Nun muß durchaus betont werden, daß in bezug auf all das, was eben angedeutet worden ist, Geisteswissenschaft ganz auf dem Boden der Naturwissenschaft steht, ja, wie wir gerade durch die heutige Betrachtung sehen wollen, intensiver, stärker noch sich auf diesen Boden der Natur-wissenschaft stellen muß, als es die Naturwissenschaft selber nach dem heutigen Stand ihres Forschens tun kann. Geisteswissenschaft steht auch in methodischer Beziehung, in Beziehung auf die Art und Weise des wissenschaftlichen
Denkens und der wissenschaftlichen Gesinnung durchaus so, daß sie dieselbe Richtung verfolgt, die für das menschliche Forschen durch die neueren Methoden der Naturwissenschaft angegeben worden ist. Allein so, wie diese neueren Methoden der Naturwissenschaft angewendet worden sind auf das Seelenleben, zeigen sie durchaus, daß sie gerade zu denjenigen Gebieten nicht hinführen, auf denen die eigentlichen Rätselfragen des menschlichen Seelenlebens gefunden werden.
Um nicht bloß allgemeine Bemerkungen zu machen, mö chte ich einen konkreten Fall ins Auge fassen. Einer derjenigen neueren Wissenschafter, der die Seelenkunde ganz auf den Boden der naturwissenschaftlichen Denkweise stellen wollte, war der ja auch hier in diesen Vorträgen schon öfter erwähnte Psychologe Franz Brentano. Er fiel mit seinem wissenschaftlichen Streben gerade in die Zeit der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, in welcher mit Recht die naturwissenschaftliche Denkweise auf die Persönlichkeiten dieses Zeitalters einen großen, einen überwältigenden Eindruck machte, so daß man sich mit keiner Art wissenschaftlicher Forschung dem entziehen wollte, was in der Fruchtbarkeit naturwissenschaftlicher Anschauung lag. Und eben einer derjenigen, die da ganz mitgegangen sind und etwa gesagt haben: Wenn streng wissenschaftliche Ergebnisse erreicht werden sollen, so müssen sie durch eine Methode erreicht werden, die nach dem Muster der Naturwissenschaft aufgebaut wird, sonst sind sie keine wirklich wissenschaftlichen Ergebnisse, - eine der Persönlichkeiten, die so sich gestellt haben zur Seelenforschung wie zur Naturforschung, war Franz Brentano. Seine Thesen, die er aufgestellt hat im Beginn seines Lehramtes in Würzburg in den fünfziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, lauteten etwa so: Die Zukunft der Seelenforschung hängt ganz
davon ab, daß sie sich in denselben Bahnen bewegt wie die Naturforschung. - Nun ist gerade mit Bezug auf die Hoffnungen, die die Seelenforschung für unser Zeitalter und die Zukunft haben kann, Franz Brentano eine charakteristische persönlichkeit. Er hat begonnen, eine «Psychologie» zu schreiben, ein Buch, das im engeren Kreise der Seelenforscher eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Er hat versprochen, als der erste Band seiner Seelenkunde erschien, noch vor Ablauf des Jahres, in dem der Band erschienen ist - es war 1874-, werde der zweite Band und dann in rascher Folge der dritte Band erscheinen. Es ist nichts bisher erschienen außer dem ersten Band! Und das ist gerade deshalb charakteristisch, weil Franz Brentano eine der gewissenhaftesten, eine der energischsten Denkerpersönlichkeiten ist.
Franz Brentano begibt sich auf den Weg, Seelenkunde zu treiben im Geiste der neueren Naturwissenschaft. Er kommt zunächst dazu, das Seelenleben, so wie es sich im gewöhnlichen Menschendasein darstellt, zu prüfen; zu untersuchen, wie, indem der Mensch innerhalb der gewöhnlichen physischen Welt lebt, sich Gedanke an Gedanke reiht; welches die Gesetze dafür sind, daß ein Gedanke den anderen hervorruft; welches die Gesetze dafür sind, daß in der menschlichen Seele diese oder jene Lustempfindung, diese oder jene Schmerzempfindung Platz greift. Kurz, dieses Seelenleben, das da abläuft innerhalb des gewöhnlichen physischen Daseins des Menschen, bemühte er sich, im naturwissenschaftlichen Sinne zu untersuchen. Das Ziel der Seelenkunde steht diesem Seelenforscher schon vor Augen, allein er sieht keine Möglichkeit, irgend etwas zu tun, um diesem Ziel auch nur irgendwie näher zu kommen. Da ist charakteristisch ein Ausspruch Franz Brentanos, der in folgender Weise lautet:
«Für die Hoffnungen eines Platon und Aristoteles, über
das Fortleben unseres besseren Teiles nach der Auflösung des Leibes Sicherheit zu gewinnen, würden dagegen die Gesetze der Assoziation von Vorstellungen, der Entwickelung von Überzeugungen und Meinungen und des Keimens und Treibens von Lust und Liebe alles andere, nur nicht eine wahre Entschädigung sein.... Und wenn wirklich... » - er meint die neuere naturwissenschaftliche Denkungsart - «den Ausschluß der Frage nach der Unsterblichkeit besagte, so wäre [dieser Verlust] für die Psychologie ein überaus bedeutender zu nennen.»
Ganz charakteristisch ist Franz Brentano für jene Vertreter neuerer Seelenkunde, die sich zwar auf den Boden der neueren Naturwissenschaft stellen wollen, also das Seelenleben genau so beobachten wollen, wie man sonst die äußeren Naturerscheinungen beobachtet, denen aber gerade die wichtigen, die bedeutungsvollen, die mit dem Menschenleben innig zusammenhängenden Fragen entschlüpfen, indem sie ihre Betrachtungen anstellen. Wir können, so sagt etwa Brentano, im Sinne der neueren Naturwissenschaft zu einer Anschauung kommen, wie sich Vorstellungen verketten, wie sich Meinungen in der Menschenseele festsetzen, wie Lust und Leid sich gegenseitig bedingen, aber man kann zu der wichtigen Frage, welches die ewigen Kräfte der Menschenseele sind, aus dem, was man zunächst durch diese Methode erreichen will, keine Stellung nehmen. - Und so ist denn immer mehr und mehr, muß man sagen, aus den Schriften, aus der Literatur über Seelenkunde, in der neueren Zeit die Frage nach den ewigen Kräften des Menschen-daseins geschwunden. Man versuche nur einmal die Literatur der Seelenkunde zu durdiblättern, und man wird sehen, wie wahr das ist, was ich eben angedeutet habe.
Geisteswissenschaft versucht nun, durchaus aus der Gesinnung naturwissenschaftlicher Denkungsweise heraus den
Weg zu finden zu den Seelenrätseln des Menschen. Aber sie überzeugt sich davon, daß die Denkweise, die auf der einen Seite so fruchtbar ist für die Betrachtung, für die Erforschung der Geheimnisse der äußeren Natur, verinnerlicht und damit ganz und gar umgestaltet werden muß, wenn man von derselben Gesinnung aus Geisteswissenschaft treiben will, von der aus man Naturwissenschaft treibt. Geisteswissenschaft zeigt, daß diejenigen Verrichtungen des Seelenlebens, welche im gewöhnlichen Denken, Fühlen und Wollen zwischen Geburt und Tod ablaufen, wirklich nichts enthalten, was nicht so an den physischen Leib gebunden wäre, wie die Flamme an den Stoff der Kerze gebunden ist. Geisteswissenschaft zeigt, daß man eben mit denjenigen Verrichtungen des Seelenlebens, die vollständig tauglich sind für das gewöhnliche Leben, auch vollständig tauglich sind für das gewöhnliche wissenschaftliche Forschen, nicht heran-kommt an das, was als Ewiges in der Seele vorhanden ist. Geisteswissenschaft zeigt, daß die Seele des Menschen, so wie sie nun einmal im Alltagsleben und in der gewöhnlichen wissenschaftlichen Forschung ist, an die physischen Verrichtungen des Leibes gebunden ist, und daß man das, was ewig in der Seele ist, erst aufsuchen muß dadurch, daß man von den gewöhnlichen Seelenverrichtungen aus einen Weg sucht dahin, wohin diese gewöhnlichen Seelenverrichtungen gar nicht reichen, wohin sie nicht kommen, wenn sie nur das vollbringen, was im alltäglichen Leben und der gewöhnlichen Wissenschaft vollbracht wird. Ein inneres Entwickeln der Seelenfähigkeiten zu einem Punkte hin, der für das gewöhnliche Leben durchaus überflüssig ist, das ist notwendig, wenn man die ewigen Kräfte der Menschenseele finden will.
Nun habe ich in früheren Vorträgen von gewissen Gesichtspunkten aus über diese Entwickelung der Seelenfähigkeiten
des Menschen zu einer anderen Anschauung hin, als es die alltägliche ist, schon gesprochen. Ich will heute von einem gewissen anderen Gesichtspunkte aus die Frage in ein anderes Licht wiederum stellen.
Das, was man gerade als das Wichtigste der gewöhnlichen Wissenschaft, das Wichtigste des gewöhnlichen Lebens zum Beispiel beim Denken, beim Vorstellen bezeichnet, das kommt in einer ganz anderen Weise als in diesem alltäglichen Leben für die Geistesforschung in Betracht. Im gewöhnlichen Leben handelt es sich darum, daß wir etwas erkennen dadurch, daß wir uns Gedanken machen über irgend etwas, was von außen zunächst an uns herantritt. Was von außen herantritt, wir nehmen es wahr; auch das im geschichtlichen Werden stehende, wir nehmen es wahr, wir machen uns Gedanken darüber, erforschen dadurch die Gesetze der äußeren Tatsachen und des geschichtlichen Werdens. Der Gedanke tritt in uns auf, und gerade dadurch, daß wir uns Gedanken machen können, daß unsere Gedanken einen gewissen Inhalt haben, wissen wir etwas über die Außenwelt. Und so ist es recht für das Stehen im alltäglichen Leben. So ist es auch recht für die Verrichtungen der gewöhnlichen Wissenschaft.
Will man aber das Denken in einer solchen Art fassen, wie es gefaßt werden muß, um zu wahren geisteswissenschaftlichen Ergebnissen zu kommen, so muß man es in der folgenden Art erfassen. Ich will durch einen Vergleich, den ich auch hier schon einmal gebraucht habe, zeigen, in welch ganz anderer Art sich der Geistesforscher zum Denken, zum Vorstellen stellen muß, als sich der Mensch im gewöhnlichen Leben oder in der gewöhnlichen Wissenschaft dazu stellt. Ich deutete es schon einmal an: Wenn wir unsere Hände gebrauchen zu irgendeiner äußeren Arbeit, so kommt es darauf an zunächst, daß wir diese äußere
Arbeit verrichten, daß die Ergebnisse dieser äußeren Arbeit da seien. Was da in der Außenwelt verwirklicht ist dadurch, daß wir arbeiten, darauf wird gesehen. Aber das ist nicht das einzige Ergebnis der Arbeit. Die Außenwelt muß auf dieses Ergebnis schauen, und sie hat ein Recht, darauf zu schauen. Aber indem der Mensch immer wieder und wiederum dieses oder jenes verrichtet, macht er dabei die Kraft seiner Hände, seiner Arme zu gleicher Zeit stärker, und nicht nur stärker, sondern auch geschickter, dieses oder jenes zu tun. Man kann sagen - wenn wir das Wort gebrauchen dürfen, das natürlich nur in relativem Sinne richtig ist -: Der Mensch macht die Geschicklichkeit seiner Hände und seiner Arme vollkommener dadurch, daß er arbeitet. Das ist in bezug auf die äußere Arbeit vielleicht etwas höchst Geringfügiges, wenn nur darauf gesehen wird, wodurch sich das Ergebnis der Arbeit in den Zusammen-hang des menschlichen Lebens hineinstellt. In bezug darauf ist es ein Nebenergebnis, daß die menschliche Hand und die menschlichen Arme geschickter werden. Aber für den Menschen kommt es sehr darauf an. Oder selbst wenn man das nicht gelten lassen wollte, es ist eben dies als ein Neben-ergebnis da! Damit können wir aber dasjenige, was der Mensch im Vorstellen, im Denken erreicht, vergleichen. Im gewöhnlichen Leben und in der gewöhnlichen Wissenschaft kommt es darauf an, daß man sich einen gewissen Inhalt der Gedanken bildet. Gewiß, so ist es auch ganz recht. Aber indem man sich diesen Inhalt der Gedanken bildet, indem man also denkt, geschieht wirklich mit dem Denken etwas Ähnliches, wie mit der Kraft der Hand und des Armes geschieht, wenn man arbeitet. Das Denken macht innerlich etwas durch, und auf dieses, was wirklich nun für das gewöhnliche Leben und für die gewöhnliche Wissenschaft, auch in bezug auf deren Errungenschaften, ein ganz Nebensächliches
ist, gerade auf dieses muß nun die geisteswissenschaftliche Forschung ihren inneren Blick richten: auf das, was im Denken geschieht. Die Seele muß hingelenkt werden nicht auf den Inhalt der Gedanken, sondern auf die Tätigkeit. Und auch nicht auf die bloße Tätigkeit, sondern auf das, was in der Tätigkeit des Denkens - wenn ich den Ausdruck, der nur relative Gültigkeit hat, noch einmal gebrauchen darf - nach der Richtung der Vervollkommnung hin, der Ausbildung des Denkens hin, geschieht.
Darauf muß der Seelenblick des Menschen eingestellt werden. Und möglich muß es sein, um in Gebiete zu kommen, wo sich die ewigen Kräfte des Seelenlebens erschließen, abzusehen von dem, was Inhalt des Denkens ist, und den Seelenblick hinzurichten auf die Verrichtung, auf die Tätigkeit des Denkens, auf das, was man tut, indem man denkt. Systematisch, methodisch wird das erreicht durch eine intime innere Verrichtung, die man auch ein intimes inneres Seelenexperiment nennen kann, und die ich schon öfter hier mit dem Ausdruck Meditation bezeichnete. Man muß das Wort Meditation nur in dem Umfange nehmen, in dem es hier gemeint ist, als technischen Ausdruck für das Erstreben, eine solche Fähigkeit auszubilden, durch die der Seelenblick hingerichtet werden kann gerade auf diese Entwickelung des Denkens. Und man kann wirklich diese Einstellung der inneren Seelenkräfte nach dieser Richtung hin erreichen durch das, was man als Meditation bezeichnet, wenn diese Meditation in rechtem Sinne getrieben wird. Ich kann hier selbstverständlich immer in bezug auf das, was Meditation ist, nur das Prinzipielle angeben. Das Genauere ist in meinen Büchern zu finden, namentlich in dem Buche: «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», wo im einzelnen die Seelenverrichtungen, gleichsam die inneren Seelenexperimente auseinandergesetzt werden,
die das ganze Seelenleben auf den Weg bringen, der eben prinzipiell jetzt hier angedeutet werden soll. Es muß das Denken, das Vorstellen öfter in eine Möglichkeit gebracht werden, so daß es gleichsam dasteht, wie äußere Dinge dastehen, daß man es anschauen kann, daß man es gleichsam fester hält, im inneren Seelenvermögen fester hält, als man gewöhnt ist, es zu halten, wenn man das Denken nur so verlaufen läßt, daß es einem zum Verständnis der äußeren Welt dient. Und um die Seele in eine solche Richtung zu bringen, muß man immer wieder und wiederum, nun aus innerster Freiheit und Willkür heraus, dem Denken eine Richtung geben, die man ihm nur gibt, um das eben Angedeutete wirklich innerlich zu verspüren, innerlich zu erleben, um dieses Denken so zu erkraften, daß man das Angedeutete innerlich erleben kann. Dazu muß man in das Denken, in das Vorstellen herein Inhalte, Gedanken, Vorstellungen bringen, auf die man nun sein ganzes inneres Seelenleben zusammenzieht, so daß man wirklich die Welt und alles, was um uns herum ist, vergißt, den ganzen Ablauf des übrigen Seelenlebens außer acht läßt, um nach einem Punkte, nach einem Gedanken-inhalt, den man selber in den Mittelpunkt des Vorstellens gestellt hat, alle seine Seelenkräfte hinzukonzentrieren, hinzurichten. Es ist eine scheinbar anspruchslose Betätigung des inneren Seelenlebens, aber man könnte mit Bezug auf das, was hier gemeint ist, wie es im Goetheschen «Faust» heißt, sagen: «Zwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer!» Es ist leicht im allgemeinen, dem Denken eine solche Richtung zu geben, wie sie hier angedeutet ist. Aber um wirklich die innere Kraft aufzubringen, die notwendig ist, um das Denken in seinem Tun zu betrachten, muß der Vorgang immer und immer wiederholt werden. Je nach der Anlage des Menschen dauert es wochen-, monate-,
jahrelang, bis irgendein Ergebnis erreicht wird. So daß allerdings die meisten Menschen, wenn sie einen solchen inneren Weg nehmen, längst die Geduld verloren haben, wenn es zu irgendeinem Ergebnis kommen könnte.
Dann muß dabei noch dieses bei ü cksichtigt werden:
Wenn wir aus unserem Seelenleben, so wie es uns die Erinnerung etwa darbietet, irgendeinen Gedanken nehmen, so kann uns dieser Gedanke, den wir öfter gedacht haben, der an das oder jenes Äußere anknüpft, zu der angedeuteten Verrichtung nicht viel helfen. Denn wenn der Mensch aus dem Umfang seines Seelenlebens einen Gedanken heraufholt, dann verknüpft sich mit diesem Gedanken eine Unsumme von mehr oder weniger sonst unbewußt darin lebenden Empfindungen und Empfindungsresten; und man erlebt an diesem Gedanken manches, was man nur dadurch erlebt, daß sich der Gedanke mit vielem anderen, das uns für das gewöhnliche Leben nicht bewußt ist, in Zusammenhang gebracht hat. Man kann nicht wissen, ob das, was man an diesen Gedanken dann erlebt, nicht irgendwie eine Reminiszenz, irgendeine verborgene Erinnerung aus dem gewöhnlichen Leben ist. Und schließlich, wenn man einen Gedanken nimmt, der an irgend etwas Äußeres anknüpft, so kann man auch nicht so ganz sicher sein. Denn, indem wir uns einen Gedanken an der äußeren Welt bilden, geht dieser Gedanke allerdings in unser Bewußtsein hinein, aber wir sind uns nie völlig klar bewußt, welchen Eindruck wir mehr oder weniger unbewußt noch nebenher bekommen. Man kann sich meinetwillen irgendeinen Gedanken von einem äußeren Gegenstand, den man gesehen hat, in das Bewußtsein versetzen. Und es kann, indem man nun alle Seelenkraft darauf konzentriert, ganz gut irgend etwas, was man sich nicht in einer unmittelbaren Anschauung zum Bewußtsein brachte, dann auftauchen, und man kann
glauben, man habe das, was man da erlebt, irgendwie aus unbekannten Welten heraufgebracht, während man es nur aus der eigenen Seele, aus dem Teile, der sonst unbewußt bleibt, heraufgebracht hat. Daher ist es am besten, wenn man solche Vorstellungen bildet, die man gut überschauen kann und bei denen man nicht der Gefahr ausgesetzt ist, daß sie irgend etwas aus dem Seelenleben heraufholen und uns dann ein Erleben vorgaukeln, das nichts anderes ist als Reminiszenzen des eigenen unterbewußten Seelenlebens. Damit das nicht stattfindet, ist es gut, sich einen Gedanken zu bilden oder einen Gedanken aus der Literatur der Geisteswissenschaft zu nehmen, den man überschauen kann, an den man sozusagen noch keine Gewohnheiten geknüpft hat, von dem man weiß, wie sich seine einzelnen Teile zusammensetzen, von dem man weiß, daß er nicht in unterbewußter Weise etwas heraufruft aus dem Seelenleben, das sich einem dann vor Augen stellt, statt daß man etwas Neues erlebt. Ich habe daher oftmals gesagt: Da es gar nicht darauf ankommt, daß man durch diese Verrichtungen des Seelenlebens, die man Meditation nennt, irgend etwas Äußeres erkennt, irgend eine äußere Wahrheit sich vergegenwärtigt, so ist es gut, sinnbildliche Vorstellungen zu nehmen, über die man von vorneherein klar ist: sie drücken nichts Äußerliches aus, sie werden nur in den Mittelpunkt des Denkens gestellt, um das Denken daran zu betätigen, um das Denken daran zu erkraften. Denn es kommt alles darauf an, die Verrichtungen des Denkens lebendig zu ergreifen, indem man sie verrichtet. Aus freier innerer Betätigung muß man in den Mittelpunkt des Seelenlebens einen Inhalt stellen, und dann sich ganz und gar auf diesen Inhalt beschränken. Es brauchen nur Minuten auf den einzelnen Inhalt für die einzelne Übung verwendet zu werden, denn es kommt in der Regel gar nicht auf
die Länge der Zeit an, sondern darauf, wie weit es einem wirklich gelingt, die Seelenkraft so zu konzentrieren, daß sie sich auf einen Punkt hinrichtet und dadurch innerlich erkraftet, innerlich erstarkt, so daß diese innere Denk-tätigkeit nicht unbemerkt bleibt, sondern eben mit solcher Stärke auftritt, daß man sie innerlich verspüren, daß man sie innerlich erleben kann. Wenn man nun mit genügender Geduld und Ausdauer und Energie immer wieder und wiederum ein solches Seelenexperiment macht, so kommt man zuletzt dazu, das Denken, dasjenige, was sonst sich entzieht als innerer Denkprozeß, wirklich vor seine Seele hinzustellen, wirklich in ganz anderer Weise sich zu seiner Innerlichkeit stellen zu können, als man sich sonst zu dieser Innerlichkeit gestellt hat. Man kommt dazu, etwas ganz Neues in sich zu entdecken. Neu ist es aber nur für das Bewußtsein; es ist immer da im Menschen. Die Seelen-verrichtungen, die man vollbracht hat, führen bloß dazu, es zu bemerken. Es ist in jedem Menschen immer vorhanden, was man da entdeckt. Aber wie einen neuen Menschen im Menschen, wie etwas, von dem wir bemerken, daß es uns auch ausfüllt, was wir bisher nicht gewußt haben -, einen neuen Menschen im Menschen können wir jetzt umfassen mit der Kraft, die wir gewahr worden sind durch die Erfassung, durch die innerliche Erkraftung, Erstarkung des Denkens. Und das führt uns nun, wenn wir es genügend lange, genügend intensiv und geduldig treiben, wirklich über die Sphäre dessen hinaus, was wir im gewöhnlichen Denken und Vorstellen haben, führt uns zu einer ganz anderen Anschauungsweise unserer Seele, als diejenige ist, an die wir gewohnt sind. Aber wir bemerken zugleich etwas, was allerdings erst an einem Punkt bemerkt werden kann, der da liegt, wo der Mensch wirklich bei einem Ergebnis ankommt. Man muß geduldig abwarten,
bis eintritt, was jetzt erzählt wird als ein Ergebnis, zu dem man eben kommt. Man kommt zu einem erschütternden Ergebnis.
Dieses erschütternde Ergebnis erinnert immer wiederum an einen Ausdruck, der oft gebraucht worden ist im Laufe der menschlichen Entwickelung. Er ist gebraucht worden innerhalb derjenigen Kreise, die etwas davon gewußt haben, daß es eine solche Erweiterung des Seelenlebens gibt wie diejenige ist, von der hier gesprochen wird. Nun muß man allerdings, um das zu erläutern, was hier gemeint ist, sagen: Geisteswissenschaft in dieser Art, wie sie hier gemeint ist, ist erst in unserem Zeitalter möglich. Die Menschheit ist in Entwickelung. Was in einem späteren Zeitalter in irgendeiner Art auftritt, war in einem früheren Zeitalter nicht möglich. Ist doch auch die neuere Naturwissenschaft, wie sie sich etwa seit den Zeiten des Galilei, des Kepler, des Kopernikus entwickelt hat, in älteren Epochen der Menschheitsentwickelung nicht möglich gewesen. Aber diese älteren Epochen mußten vorangehen. Man versuchte sich in diesen älteren Epochen in ganz anderer Weise in das Innere der Natur einzuleben, als das in der gegenwärtigen Epoche der Fall ist. Wie die Naturwissenschaft in ihrer neueren Gestalt zum Beispiel in der griechisch-römischen Zeit noch nicht möglich gewesen ist -rein äußerlichen Tatsachen nach nicht möglich gewesen ist, nicht nur einem Prinzip nach -, so ist Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist und ihrer Methode nach hier geschildert wird, etwas, was in unserer Zeit erst aufdämmern kann innerhalb der Menschheitsentwickelung. Aber wie man sich auch vor der gegenwärtigen Naturwissenschaft in diese Natur vertieft hat nach Art derjenigen Menschheitskräfte, die eben dazumal innerhalb der menschlichen Entwickelung an der Oberfläche lagen, so hat man auch
früher gesucht, zu den ewigen Kräften der Menschenseele zu kommen und in der anderen Art der Vorzeit die menschlichen Seelenkräfte weiter zu entwickeln, so daß sie in alter Art dasjenige schauen konnten, was als Ewiges der menschlichen Seelenentwickelung zugrunde liegt. Damals hat man schon in einem viel gebrauchten Wort darauf hingewiesen, wozu man kommt durch eine Entwickelung des inneren Seelenlebens, wie sie angedeutet worden ist; man hat gesagt, der Mensch müsse, um die ewigen Gründe seines Seelenlebens zu erreichen, an die Pforte des Todes herantreten. Dieses Wort: «an die Pforte des Todes heran-treten», man lernt es in seiner vollen Bedeutung dadurch erkennen, daß man es wirklich bis zu einem gewissen Punkte jenes innerlichen Erlebens bringt, das eben geschildert worden ist als Meditation. Man kommt nämlich an einen Punkt, wo man zwar in sich einen wirklichen zweiten Menschen entdeckt, einen Menschen, der eben nur durch das erkraftete Denken so umfaßt werden kann, wie man durch das gewöhnliche umfassende Wollen, durch das, was man sonst in sich betätigen kann, den gewöhnlichen physischen Menschen erfaßt. Man kommt zu diesem zweiten Menschen in sich, der innerlich sozusagen befühlt wird von dem sich erkraftenden Denken, aber man kommt zugleich dazu, einzusehen, durch unmittelbares Anschauen einzusehen, wie dieser zweite Mensch zusammenhängt, jetzt nicht mit aufbauenden, sondern mit abtragenden Kräften unseres menschlichen Organismus. Man kommt dazu einzusehen, daß man im Grunde genommen die Bedingungen des Todes seit der Geburt oder, sagen wir, seit der Empfängnis in sich trägt; daß gewisse Vorgänge im Menschen real sind, die sich abspielen und die, wenn sie an einem gewissen Punkte angelangt sind, eben zum Tode führen müssen. Neben dem, was den Menschen belebt, neben dem,
was der aufsteigende Lebensprozeß ist, den man ja auch mit den gewöhnlichen Seelenkräften nicht anschauen kann, steht dasjenige, was abtragende Seelenkräfte sind, was, ich möchte sagen, zerstörende Seelenkräfte sind. Und mit der höchsten Blüte dieser zerstörenden Seelenkräfte, mit dem, was im Menschen waltet und webt als, man kann sagen, Todesursache, als fortdauernde Todesursache, sieht man aufs innigste verbunden dasjenige, was nun dieser zweite Mensch ist, den man gleichsam innerlich durchfühlt mit dem Denken. Wahrhaftig, nur durch eine innere Erfahrung kann man dazu kommen, solches zu behaupten, was ich jetzt behaupte. Gerade so wenig, wie jemand, der nicht weiß, daß in der Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerteilt wird, etwas über den Wasserstoff oder Sauerstoff auszumachen vermag, gerade so wenig vermag man aus dem gewöhnlichen Seelenleben heraus irgend etwas auszumachen über das Erlebnis, das jetzt angedeutet worden ist und das eben zu allen Zeiten mit den Worten ausgesprochen worden ist: man trete an die Pforte des Todes heran.
Man erlebt, daß ebenso wie im Wasser etwas ist, das man auch nicht unmittelbar, wenn man das Wasser beschaut, sehen kann als Wasserstoff und Sauerstoff, so auch etwas im Menschen ist, was mit seinem Denken, zugleich aber auch mit den ihm den Tod gebenden Kräften zusammenhängt. Man schaut in sich den Menschen, der es bewirkt, daß man gerade das reinste, das abstrakteste Denken, dasjenige, was einen für das gewöhnliche Leben am weitesten bringt, zwischen Geburt und Tod haben kann, daß man es aber nicht haben könnte, wenn nicht die todgebenden Kräfte im Menschen zu ihrer höchsten Blüte kommen würden. Und indem man gerade durch die Erkraftung des Denkens das in sich entdeckt, was den Tod
bringt, gliedert sich unmittelbar eine Erfahrung an, ein inneres Erfahrungswissen - man kann es nicht anders nennen, als ein inneres Erfahrungswissen -, nicht etwas, was durch einen Vernunftschluß jemals zu erreichen wäre; ebensowenig wie wenn man das Wasser äußerlich anschaut, durch einen Vernunftschluß zu erreichen ist, daß da Wasserstoff und Sauerstoff darinnen ist. Man erlangt die Erfahrung, daß man sich sagt: Man schaut jetzt hinaus über den Umfang desjenigen, was das gewöhnliche Bewußtsein überschaut und lernt in sich kennen den Menschen, der zwischen Geburt und Tod mit den todgebenden Kräften zusammenhängt. Aber man lernt ihn zugleich so kennen, daß man, indem man ihn durchschaut, in diesem zweiten Menschen dasjenige kennen lernt, was da war vom Menschen, bevor er durch die Geburt oder sagen wir die Empfängnis in das physische Dasein hereingetreten ist. Man lernt von diesem Momente an wissen, daß nicht nur die Vererbe-Kräfte von den Vorfahren, von Vater und Mutter, den Menschen in das Dasein hereingestellt haben, sondern daß sich verbunden haben mit dem, was in der Vererbungsströmung liegt, geistige Kräfte, die aus einer rein geistigen Welt heraus gekommen sind.
Man ist gewohnt, im gewöhnlichen Leben nur dasjenige «Wissen» zu nennen, wozu man dadurch kommt, daß man gewisse Tatsachen aufzeigt, die schon vor der Erlangung des Wissens da sind. Für die geistigen Tatsachen wäre diese Denkweise genau dasselbe, wie wenn man sagen würde: Ich will einem anderen etwas mitteilen, aber ich spreche es nicht aus, denn dadurch, daß ich es ausspreche, ist es nicht mehr eine objektive Tatsache, die da ist; es muß sich von selber machen. - So wie man in dem Aussprechen etwas erzeugt, was sich aber doch nicht bloß seinem Inhalte nach in dem Ausgesprochenen erschöpft, so ist
das geisteswissenschaftliche Erkennen an eine Tätigkeit gebunden, in der dasjenige erst aufgeht, was Inhalt des Wissens ist, so wie sich erst im Sprechen das erzeugt, was der Inhalt des Sprechens ist. Und man kommt jetzt wirklich dazu, einzusehen, daß auf geistigen Gebieten in einer höheren Form dasjenige vorhanden ist, wozu sich die Naturwissenschaft seit ungefähr der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts durchgerungen hat: das, was man «Umwandlung der Kräfte» nennt. Umwandlung der Kräfte ist es zum Beispiel - nun in der einfachsten Form -: Sie drücken auf den Tisch, und die Kraft Ihres Druckes, die Arbeit Ihres Druckes verwandelt sich in Wärme. Ihre Druckkraft ist nicht verlorengegangen, sondern sie hat sich umgewandelt. Dieses Gesetz der Umwandlung der Kräfte hat ja die naturwissenschaftliche Gesinnung ergriffen und dadurch eine große Bedeutung erlangt. Derjenige, der als Geisteswissenschafter sich bis zu dem Punkte bringt, den ich angedeutet habe, der lernt erkennen, daß dasjenige, was unserem ganzen Denken zugrunde liegt und was ich eben jetzt «die todbringenden Kräfte» genannt habe, in der Tat ewige Lebekräfte sind, aber als ewige Lebekräfte sich nur betätigen können, wenn sie nicht einen Organismus, einen physischen Organismus ergreifen. Wenn sie vor der Geburt oder, sagen wir, vor der Empfängnis, in der rein geistigen Welt vorhanden sind, da sind sie ewige Lebekräfte. Und sie müssen die Form der ewigen Lebekräfte verlieren, sie müssen sich umwandeln in solche Kräfte, die nun zwischen Geburt und Tod das Organ des physischen Denkens aufbauen. Sie haben damit zu tun, daß sie das Organ des physischen Denkens aufbauen. Sie können also erst wiederum sich in ihrem Geistcharakter betätigen, wenn das Organ des physischen Leibes, das Denkorgan, abgebaut ist. Daher ist es wirklich unmöglich, innerhalb des physischen
Lebens das zu finden, von dem jetzt gesprochen worden ist. Denn man könnte gar nicht im gewöhnlichen Sinne denken, wenn man das finden könnte, wovon gesprochen worden ist. Man denkt im physischen Leben - das zeigt insbesondere die Geisteswissenschaft - mit dem Denkorgan. Nicht das Denken ist von dem ewigen Wirken und von den ewigen Kräften der menschlichen Seele geschaffen, sondern das Denkorgan; das muß zunächst immer da sein, damit das Denken sich betätigen kann. Dieses gewöhnliche physische Denken müßte also aufhören, wenn man gerade das anschauen wollte, worauf es ankommt. Nicht das Denken kommt aus den ewigen Kräften, sondern das Denk-Organ, das hinter dem Denken verborgen bleibt. Und gerade dieses Denkorgan muß verborgen bleiben, damit das Denken zum Vorschein kommen kann.
Daher macht man auch, indem man in dieser eben angedeuteten inneren Seelenentwickelung vorschreitet, eine Erfahrung, die, ich möchte sagen, nicht minder erschütternd ist als diejenige, die eben bezeichnet worden ist mit dem hergebrachten Ausdruck «an die Pforte des Todes herankommen». Man macht die Erfahrung: Ja, dein Denken, das erkraftest du also; dein Denken, das wird in sich stärker, so daß es innerlich fühlen kann einen zweiten Menschen, der in dir ist. - Aber eines gilt vor allen Dingen für dieses Denken. All das, was ich sagte, ist nur in der Hauptsache gemeint, aus dem Grunde, weil ja, indem man sich also im Innern der Seele entwickelt, immer ein Rest des gewöhnlichen Denkens bleibt, sonst würde man aus dem gewöhnlichen Denken herausspringen und in das andere hineinspringen müssen. Es ist also, was ich sage, immer nur vergleichsweise gemeint, das heißt so, daß es nicht in vollem Sinne, sondern nur in der Hauptsache gilt.
Das, was als besonders charakteristisch, als besonders bedeutsam
hervortritt, indem das Denken sich erkraftet, ist etwas, was gerade eine gewisse Wichtigkeit darstellt für das gewöhnliche Seelenleben und jetzt für dieses Seelenleben, das sich erkraftet hat, eigentlich aufhört. Es besteht die Möglichkeit, durch das gewöhnliche Gedächtnis, durch das gewöhnliche Erinnerungsvermögen das zu behalten, was man also durch das Denken erreicht. Auch die Bequemlichkeit des gewöhnlichen Lebens hört auf, daß man einfach seine Gedanken dem Gedächtnis übermittelt und sie dann hat und sich nur zu erinnern braucht; auch das hört eigentlich auf. Man ist also, wenn man sein Denken erkraftet hat, trotz der Erkraftung zu einem Punkt gelangt, wo man fortwährend, indem man sich versetzt in dieses erkraftete Denken, vor dem Gefühle steht, daß sich einem dieses Denken gleich wieder verliert, indem es entsteht. Und das ist gerade die Schwierigkeit, die da macht, daß sehr viele Menschen die Geduld verlieren und gar nicht dazu kommen, solche inneren Seelenkräfte zu entwickeln, wie sie hier gemeint sind. Jemand, der Übungen wie die angedeuteten macht, der macht sie vielleicht lange; aber er beachtet nicht, daß man das, was man da erzeugt, eben so schwer behalten kann, wie man manchmal einen Traum behalten karin. Man weiß, wenn man aufwacht, ganz genau: Du hast dieses oder jenes geträumt, - aber man kann es nicht festhalten, es entschwindet. Und so ist es mit dem, was man da errungen hat. Es kann nur mit außerordentlicher Schwierigkeit dem gewöhnlichen Gedächtnis einverleibt werden.
Daher ist es auch, wenn man geisteswissenschaftliche Wahrheiten vorträgt, so, daß man sie immer erst im Moment zu erzeugen hat; so sonderbar, so paradox es klingt, es ist eben wahr, daß man sie nicht aus dem gewöhnlichen Gedächtnis herausholen kann. Und warum ist das so? Aus dem Grunde, weil eben der Mensch, wie er im gewöhnlichen
Leben steht, fortwährend die Tendenz hat, das, was er ja eigentlich erreicht durch die Formung, die Bildung des Organes des Denkens, das, was aus dem Ewigen herauskommt, in das Körperliche hinunter entschlüpfen zu lassen. Indem man es kaum erlangt hat, was einem da das Ewige präsentiert, entschlüpft es einem schon in das gewöhnliche Denkorgan hinein. Das heißt, es geht über in das gewöhnliche Seelenleben und verliert damit eben seine Ewigkeitsform. Fortwährend sieht man eigentlich, daß man im Entstehen etwas erfaßt, was einem sogleich wieder entschlüpft. Und erst lange Übung ist notwendig, um einigermaßen zu beobachten, was da entsteht und gleich wieder vergeht; um dasjenige, was da entstehend gleich wieder vergeht, in der Seele zu haben. So, merkt man, hat man eigentlich ein ganz anderes Bewußtsein nötig, als das Bewußtsein ist, das eben aus dem gewöhnlichen Denkorgan stammt. Und man kommt allmählich darauf - was wiederum ein erschütterndes Seelenerlebnis ist -: Ja, da erlangst du etwas durch deine Seelenentwickelung; aber mit dem Bewußtsein, das du da hast, das dir gerade in der fruchtbarsten Weise dient im gewöhnlichen Leben, kannst du es doch nicht festhalten. Denn dieses gewöhnliche Bewußtsein ist darauf organisiert, daß ihm gerade das Ewige entschwindet, damit es tüchtig sei. Da kommt zuletzt die Überzeugung heraus: Du brauchst ein anderes Bewußtsein, du brauchst ein Bewußtsein, das über dasjenige Bewußtsein hinausgeht, das dir für das gewöhnliche Leben fruchtbar wird, denn mit diesem Bewußtsein kannst du das Ewige nicht festhalten.
Daher ist es notwendig, daß solche reinen Gedanken-übungen, wie sie als ein Glied des meditativen Lebens bezeichnet worden sind, durch andere Übungen ergänzt werden, die man nun Willensübungen, Willens-Gefühlsübungen
nennen kann. Es genügt nicht, daß man das Denken, das Vorstellen, in der angedeuteten Weise innerlich erkraftet, denn man würde gerade durch dieses innerliche Erkraften dazu kommen, daß einem das Entstehende fortwährend vergeht. Daher muß die Geisteswissenschaft auch den Rat geben, den Willen in einer anderen Weise zu behandeln, als er im gewöhnlichen Leben behandelt wird. Der Wille im gewöhnlichen Leben verläuft so im Seelen-leben, daß eigentlich die Aufmerksamkeit beim Wollen verwendet wird auf dasjenige, was geschehen soll, auf dasjenige, was aus dem Willen in die Tat hinausfließt, selbst wenn wir innerlich nur wollen, wenn es bei der Absicht bleibt - beim innerlichen Vorstellen des Wollens. Es wird immer die Aufmerksamkeit auf dasjenige gerichtet, in das sich der Wille auslebt, in das der Wille einfließt. Wenn man also dieselbe Mühe auf eine innerliche Willenskultur verwendet, wie sie in der angedeuteten Weise verwendet werden kann auf die Vorstellungs-, auf die Denkkultur, so kann man den Willen bis zu einem Punkte hin bringen, durch den man eine Entwickelungsmöglichkeit des Willens erlangt, die notwendig ist, um zu den ewigen Kräften der Menschenseele heranzukommen. Dazu ist allerdings notwendig, daß man innerliche Willensübungen so vornimmt, daß man wirklich recht intensive Seelenruhe herstellt, das Auf- und Abwogen der Begehrungen, das Auf- und Ab-wogen der sonstigen Wunschimpulse, die im Leben eine große Rolle spielen, beruhigt, daß man gewissermaßen vollständige Meeresstille in seinem inneren Seelenleben herstellt und dann sich darauf besinnt, was man vielleicht zu irgendeiner Zeit gewollt hat. All die Lebendigkeit, in die das Wollen versetzt wird, wenn es unmittelbar gegenwärtiges Wollen ist, nimmt man sozusagen dadurch weg, daß man erinnertes Wollen vor sich hinstellt, daß man etwa am
Abend zurückschaut auf das, was man während des Tages gewollt hat, und jetzt dieses Wollen so auf sich wirken läßt, daß man nicht etwa ein innerlicher Kritiker wird, sondern daß man dieses Wollen anschaut; daß man es anschaut jetzt, wo es nicht mehr unmittelbar dazu verleitet, die Aufmerksamkeit allein auf die äußeren Taten hinzu-lenken, sondern wo man nun dadurch, daß das Wollen sich im inneren Seelenleben von der äußeren Tätigkeit losgelöst hat, wo man die Aufmerksamkeit auf dasjenige hinlenken kann, was das Seelenleben ist und im Wollen verrichtet. Man kommt auch weiter auf diesem Gebiete, wenn man sich anstrengt, ich möchte sagen, wiederum wie ein rein innerliches Experiment, dasjenige, was man aus diesem oder jenem Grunde gut fand zu wollen, in das Innere seines Seelenlebens zu stellen, und dann in feiner, in intimer Weise sich vergegenwärtigt: Was erlebst du, indem du deine Seele hineinversetzest in die Lage, das zu wollen? - wobei man ganz absieht von dem, was mit dem Gewollten selbst zusammenhängt, sondern sich nur versetzt in das, was die Seele innerlich erfühlt, indem sie das Wollen durchmacht.
Wiederum sind lange Übungen nach jener Richtung hin notwendig, wenn man zu einem Ergebnis kommen will; aber man kommt zu einem Ergebnis: man entdeckt nämlich, daß man eigentlich während des Lebens einen unsichtbaren, einen unwahrnehmbaren Zuschauer fortwährend mit sich trägt. Wiederum einen Menschen, einen neuen Menschen entdeckt man, allerdings einen Menschen, der immer da ist, der aber nicht beachtet wird. Ebensowenig, wie der vorhin charakterisierte innere Mensch im Vorstellen, im Denken beachtet wird, wird im Wollen, weil die Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes gelenkt wird, dieser innere Zuschauer bemerkt. Dieser innere Mensch ist aber jetzt tatsächlich ein Bewußtsein, das unbewußt - wenn ich den
paradoxen Ausdruck gebrauchen darf - immer in uns ist, das nicht heraufgehoben wird in das gewöhnliche Bewußtsein, das aber doch da ist.
Es ist schwierig, über diese Dinge zu reden aus dem Grunde, weil man über Dinge spricht, die zwar Realitäten sind, aber dem Menschen eigentlich ungewohnt sind; ungewohnt deshalb, weil sie im gewöhnlichen Leben nicht zum Bewußtsein gebracht werden. Der Geisteswissenschafter redet von nichts Neuem. Er redet von nichts, was nicht vorhanden wäre. Er zeigt nur auf, was in jedem Menschen vorhanden ist. Aber um es aufzuzeigen, ist es eben notwendig, sich ihm so zu nahen, daß man sich ihm tätig naht; daß man nicht bloß Tatsachen aufzeigt, die ein Sein verbürgen wollen, sondern für die Beobachtung erst hervorbringt, was ist, was aber nur durch die Tätigkeit aufgezeigt werden kann.
Und nun, wenn man es auf diesem Gebiete bis zu einem gewissen Punkt gebracht hat, dann geschieht in der Seele wiederum etwas, was einen zur tiefsten Erschütterung bringen kann. Man lernt jetzt in umfänglichem Maße etwas kennen, das man ja im äußeren Leben namentlich innerhalb der Absichten, der Wünsche, des Willens, die man in der Seele hat, fortwährend erlebt, aber, ich möchte sagen, nur seiner Außenseite nach, nur stückweise erlebt. Man erlebt in umfänglicher Weise, was man nennen kann: das unmittelbare Anschauen, das unmittelbare Erfühlen dessen, was Leid, was Schmerz ist. Denn es ist im Grunde genommen mit jedem Stück dieser Erringung des sonst unbewußt bleibenden Bewußtseins Entbehrung, Schmerz verbunden. Aber die beiden Erlebnisse gliedern sich nun zusammen. Das eine Erlebnis, das einen bis zu der Wahrnehmung, ich möchte sagen, der Blüte der Sterbekraft im Menschen ge-führt hat, und dasjenige Erlebnis, das einen geführt hat bis
zu der Wahrnehmung eines unbewußtenBewußtseins, das im Menschen immer vorhanden ist, das dem Menschen immer als Beobachter zuschaut, - diese beiden Erlebnisse gliedern sich zusammen. Von dem ersten Erlebnis merkt man: Das kann im Grunde genommen nicht als solches Sein bezeichnet werden, wie sonst irgend ein Seiendes bezeichnet wird. Das kann sich nicht halten im Sein, wenn es nicht von einem Bewußtsein getragen wird, wenn es, mit anderen Worten, nicht von einem gewissen Bewußtsein erinnert wird. Und man macht eine Entdeckung - eines der großartigsten, gewaltigsten inneren Erlebnisse, die man zunächst auf dem Erkenntnisweg haben kann -, man macht die Entdeckung:
Was du also erzeugst aus einer Erkraftung deines Denkens heraus, es ist wie ein flüchtiger Traum. Es kann an die Erinnerungsfähigkeit des gewöhnlichen Bewußtseins nicht heran. Wenn du aber dasjenige, was im Wollen lebt, als deine Beobachtung, als dein unterbewußtes Bewußtsein, wirklich auch in dir erkraftest, so ist dies jetzt das Bewußtsein, welches das andere erfassen kann, das sonst nicht zur Erinnerung kommen kann, und welches es halten kann.
Und jetzt ist man bei dem Erlebnis, das sich in bezug auf die wissenschaftliche Gesinnung ganz mit der Art vergleichen läßt, wie man es im äußeren Naturleben macht, wie man das äußere Naturleben beobachtet. Man sieht die Pflanze an. Man sieht, wie sie es bis zum Keime bringt in der Blüte und wie dieser Keim, wenn er in die Erde gesenkt wird, der Anfang einer neuen Pflanze ist. Das Ende bringt man mit dem Anfang zusammen, um einen Zyklus, einen Kreis aufzustellen. In derselben Weise, allerdings auf einer höheren Stufe, wird Ende und Anfang des physischen Menschenlebens erfaßt. Man weiß, daß dasjenige, das vor der Geburt, oder sagen wir der Empfängnis, vorhanden war, sich aus der geistigen Welt heraus vereinigt hat mit
dem, was in der physischen Vererbungslinie liegt, was dieses physisch Organisierte im Menschen durchwallt und durchwebt. Man weiß, daß dies sich so auslebt, daß es ein Organ hervorbringt, daß dieses Organ es zum Denken bringt, und daß dessen äußerste Ausgestaltung es bis zur Erinnerung bringt; daß es aber damit, indem es aus der geistigen Welt herausgetreten ist, in dieser Umwandlung eine Form erreicht hat, die sozusagen eine höchste Blüte ist, die nun von einem Bewußtsein erfaßt werden muß, das ganz anderer Art ist als das, durch das es zunächst aus der geistigen Welt herauskommt, hervorgebracht wird. Dieses Bewußtsein liegt wie ein Bewußtseins-Same, wie etwas, was als Wollen zugrunde liegt, aber im gewöhnlichen Wollen, weil die Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet ist, nicht zum Bewußtsein kommt. Das, was als todgebend im Menschen liegt, verbindet sich, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes schreitet, mit diesem Bewußtseins-Samen, der im Wollen liegt. Und das gewöhnliche physische Leben ist nur wie ein Auseinanderhalten des einen und des anderen. Wir leben so lange physisch, als das eine und das andere auseinandergehalten ist, solange als wir uns mit unserem Sein dazwischen stellen. Im Todeserlebnis tritt das ein, daß das erste von dem zweiten erfaßt wird, daß das Bewußtsein das erstere erfaßt und hinausträgt durch die Pforte des Todes wiederum in die geistige Welt hinein.
Ebenso, wie man am Pflanzensamen in der Blüte sieht, daß er den Zyklus wieder beginnt, wenn er durch die nötigen Zwischenbedingungen hindurchgeht, ebenso erlebt man, daß dasjenige, was vor der Geburt vorhanden war, was als todgebend im Menschen liegt, zu einem erneuerten Erdenleben herabsteigt, wenn es durch geistige Bedingungen hindurchgegangen ist. Man verbindet Ende und Anfang ganz im Sinne der naturwissenschaftlichen Gesinnung und kommt
dadurch zu einer Bekräftigung dessen, was in einer der schönsten Phasen des neuzeitlichen Geisteslebens hervorgetreten ist und - so könnte man sagen - wie aus dem Denken eines tiefen Denkers hervorgesprungen ist: was durch Lessing hervorgetreten ist, als er seine reifste Schrift «Die Erziehung des Menschengeschlechtes» abschloß mit dem Hinweis auf die Denknotwendigkeit von den wiederholten Erdenleben. Damals sprang es wie aus einem Denken, das sich zu einer unabhängigen Weltanschauung durchgerungen hatte. Die neuere Geisteswissenschaft strebt an, das, was sich so in Lessings Denken hereingestellt hat, diese Lehre von den wiederholten Erdenleben wirklich wissenschaftlich, aber, wie wir sehen, innerlich wissenschaftlich zu erhärten! Sie wird heute ebenso als etwas Phantastisches, als etwas Träumerisches angesehen, wie zu einer gewissen Zeit, die gar nicht weit hinter uns liegt, die Lehre angesehen wurde: Lebendiges kann nur aus Lebendigem entstehen. -Aber wer eine solche Anschauung zu vertreten hat, die er als Wahrheit erkannt hat, der weiß auch, daß die Wahrheit einen schwierigen Weg zu gehen hat in der Menschheit, aber diesen Weg auch findet!
Phantastisch, träumerisch war es für die Mehrzahl der Menschen, als die neueren naturwissenschaftlich gesinnten Menschen aufgetreten sind und gesagt haben: Da meint der Mensch, daß ein Firmament oben den Raum begrenzt, während doch dieses Firmament nichts anderes ist als der Ausdruck des Endes des Schauvermögens selber. Was ihr als Firmament anschaut, das wird nur hervorgerufen durch euch selber; bis dahin dringt eben euer Blick, bis dahin dringt eben euer Schauen! Das ist nicht äußerlich in der Natur da, sondern äußerlich in der Natur ist die Raumes-unendlichkeit da, in die unzählige Welten eingebettet sind! -Auf dem Standpunkt, auf dem man dazumal stand, als die
alte Vorstellung des Raumesfirmamentes zu überwinden war, auf diesem Standpunkt steht Geisteswissenschaft heute, ich möchte sagen, mit Bezug auf das geistige Firmament der menschlichen Seele zwischen Geburt oder Empfängnis und Tod. Der Mensch sieht zunächst nach der Empfängnis, nach der Geburt hin oder bis zu einem Punkte, bis zu dem hin eben sein Erinnerungsvermögen reicht, und bis zu seinem Tode. Aber da ist nichts, was das Leben begrenzt, ebensowenig wie das Firmament den Raum begrenzt. Sondern hinter dem dehnt sich aus, was der Mensch nicht schaut, weil er nicht versucht, sein Erkenntnisvermögen, sein Denkvermögen über dieses Zeitenfirmament hinaus auszudehnen. Da draußen, außerhalb dieses Firmaments, liegen die wiederholten Erdenleben und die dazwischen liegenden Leben, in denen die Seele in einer rein geistigen Welt lebt.
Es ist gewiß vielleicht noch schwieriger, sich in diejenigen Vorstellungsverläufe einzugewöhnen, die notwendig sind, um zu dieser Hinwegräumung des geistigen Firmamentes zu kommen, als es schwierig war, zur Hinwegräumung des physischen Firmamentes zu kommen. Aber unsere Zeit ist durchaus reif, aus naturwissenschaftlicher Gesinnung heraus, ich möchte sagen, dasjenige, was die äußerliche Naturwissenschaft erreichen kann, selber zu überschreiten. Und daher stehe ich auch nicht an, wenn das auch zu noch viel ärgeren Mißverständnissen führen muß als das bisher Gesagte, die konkrete Anwendung, die besondere Anwendung jener Art des Geistesforschens, die ich eben charakterisiert habe, in einem besonderen Fall zu machen, der uns ja zu allen Zeiten, aber insbesondere in unserer schicksaltragen-den Zeit interessieren kann.
Man spricht und wird immer mehr sprechen von den unsterblichen Kräften der Menschenseele, wenn man wiederum
zu einer wahren Seelenkunde kommt. Aber man wird auch wieder sprechen lernen von dem, was unsichtbar in dem Sichtbaren waltet, was unwahrnehmbar für die gewöhnliche Geschichtsbetrachtung im Verlauf des menschlichen Lebens waltet. Wir haben im Zusammenhang mit den ewigen Kräften der Menschenseele von dem Tode gesprochen, der ja eine Rätselfrage bildet, nicht nur für denjenigen, der da sagt, er begehre ein Leben über die Pforte des Todes hinaus, sondern für den vor allen Dingen, der das Leben selber begreifen muß; denn vieles zum Begreifen des Lebens liegt in der Enträtselung des Geheimnisses des Todes. Aber in unserer Gegenwart tritt der Tod noch in einer ganz anderen Weise an uns heran, mitten unter Schmerz und Leid, aber allerdings auch unter Zukunftshoffnung und Zukunftssicherheit. Der Tod tritt so auf, daß er blühende Menschenleben erfaßt, jetzt nicht in der Weise, daß gewissermaßen die todgebenden Kräfte im Inneren ablaufen - je nachdem es dem Menschen zugeteilt ist; das kann heute nicht weiter ausgeführt werden, könnte aber auch im Sinne der Geisteswissenschaft charakterisiert werden -, also nicht bloß so tritt der Tod auf, daß diese tod-bringenden Kräfte von innen heraus, vom Organischen heraus, den physischen Leib hinwegnehmen von dem, was sich dann als das höhere Bewußtsein im Willensleben mit dem Ewigen verbindet, was todbringend ist, was aber mit dem Ewigen eins ist -, nicht bloß so tritt der Tod an uns heran, sondern so, daß er durch gewaltsame Eingriffe von außen, sagen wir, durch eine Kugel oder sonst wirkt und den physischen Menschenleib gewaltsam hinwegnimmt von dem Seelischen in der Blüte des Lebens. Obwohl ich einiges Genauere gerade darüber in acht Tagen in dem Vortrage über «Menschenseele und Menschengeist» angeben werde, möchte ich es wagen, ein Forschungsergebnis, das auf dem
Wege liegt, der eben charakterisiert worden ist, hier einfach zu erzählen.
Vollständig auseinanderzusetzen, wie ganz derselbe Weg, der eben für die gewöhnlichen, einfachen Ergebnisse aufgezeigt worden ist, dahin führt, auch das zu erforschen, von dem jetzt geredet werden soll, das würde ja viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber es ist ganz derselbe Weg, der uns im weiteren Verlaufe auch zu der Erkenntnis gerade der großen Lebenszusammenhänge führt.
Das müssen wir uns ja vergegenwärtigen: verloren geht keine Kraft; sie bleibt vorhanden, sie verwandelt sich. Wenn nun der physische Leib durch einen äußeren Einfluß, sagen wir durch eine Kugel, in der Blüte des Menschenlebens hinweggenommen wird, so sind ja aus den allgemeinen Menschenanlagen heraus solche Kräfte vorhanden, die den Menschen lange noch hätten versorgen können in bezug auf sein Leben in der physischen Welt. Diese Kräfte gehen nicht verloren. Der Geistesforscher muß fragen: Woher kommen diese Kräfte, wohin gehen sie? Eine bedeutungsvolle Frage tritt uns da vor die Seele. In einem Vortrag im vorigen Winter habe ich von dem Gesichtspunkte aus, wie diese Kraft in der Gegenwart fortlebt, gesprochen. Jetzt will ich davon sprechen, insofern diese Kräfte an den geschichtlichen Verlauf der Menschheit geknüpft sind. Der Geistesforscher muß fragen: Wo treten diese Kräfte, die da aufhören in einem Menschen zu wirken, wenn sein Leib gewaltsam von ihm genommen ist, anderswo wieder auf? Gerade so, wie man in der Naturwissenschaft sucht, wenn irgendeine Kraft verloren geht, wie diese Kraft, in andere Formen verwandelt, wieder auftritt, so sucht der Geistesforscher in den geistigen Welterscheinungen, um dasjenige, was auf der einen Seite verloren geht, auf der anderen Seite wiederzufinden. Und gerade indem man dasjenige sucht, wovon
hier die Rede ist, kommt man darauf, sich zu sagen:
Es treten in der Menschheitsentwickelung Kräfte auf, nun, die wir etwa beobachten, wenn wir einen Menschen erziehen. Da beobachten wir, wie ein Mensch fähig werden kann, dieses oder jenes zu denken, zu tun oder zu fühlen. Da leiten wir die in ihm vorhandenen Anlagen so, daß wir wissen: wir tun nichts besonderes, wenn wir allgemein menschliche Fähigkeiten entwickeln. Wir wissen, wenn er später dieses oder jenes kann: es ist dadurch gekommen, daß dieses oder jenes in ihm entwickelt worden ist.
Aber daneben, neben alledem treten im Menschenleben andere Kräfte auf, Kräfte, die man genialische Kräfte nennt, Kräfte, die erscheinen, während man einen Menschen erzieht. Man kann viel dümmer sein, als der, den man erzieht: diese genialischen Kräfte kommen doch heraus. Sie treten zutage. Man spricht von einer göttlichen Begnadung, von einem Herauskommen von Kräften, ohne daß man dazu etwas tun kann. Ich meine natürlich dabei nicht bloß die Kräfte, die die höheren Genialitäten, die höheren Genies zeigen, sondern geniale Kräfte, die eben in jedem Menschen sind. Der einfachste Mensch braucht in den alltäglichsten Verrichtungen, um wirklich vorwärts zu kommen, diese oder jene Erfindungskräfte. Es ist nur ein Grad-unterschied zwischen dem, was man im gewöhnlichen Leben braucht, und den höchsten genialen Kräften. Diese genialen Kräfte, sie treten, man möchte sagen, aus dem Dämmerdunkel des Werdens heraus; sie treten im Menschen auf wie etwas, was ihm durch den Weltengeist, durch den die Welt durchwaltenden göttlichen Geist, verliehen ist, wie man zunächst sagt, ohne daß man behaupten kann, man habe sie erzogen, man habe sie durch Erziehung herausgepflegt. Und da stellt sich denn das merkwürdige, überraschende Resultat heraus, daß diese Kräfte, die also als erfindende,
als geniale Kräfte zutage treten, umgewandelte Kräfte sind. Umgewandelt sind diejenigen Kräfte in genialische Kräfte, die verschwinden, wenn dem Menschen von außen der physische Leib genommen wird, den er im gewöhnlichen Verlauf, ohne daß ihn die Kugel getroffen hätte, noch hätte behalten können. Ein überraschender Zusammenhang, der sich da ergibt: Die Kräfte, die der Mensch in den Tod hinein trägt dadurch, daß er auf gewaltsame Weise durch die Pforte des Todes geht, daß ihm von außen, nicht durch innere organische Vorgänge der physische Leib genommen wird, diese Kräfte gehen nicht verloren; diese Kräfte treten auf, und zwar nicht bloß im späteren Erdenleben des einzelnen Menschen - das zeigt sich in ganz anderer Art -, sondern sie treten im geschichtlichen Verlaufe auf, sie treten bei ganz anderen Menschen auf. Sie werden gleichsam -wenn ich den trivialen, den philiströsen Ausdruck gebrauchen darf - in das geschichtliche Werden eingelagert. Und was Kräfte eines gewaltsamen Todes sind in der Vorzeit, das verwandelt sich in einer früheren oder späteren Nachzeit in geniale Kräfte, die innerhalb der Menschheitsentwickelung auftreten.
Wenn man die Geisteswissenschaft bis in solche Punkte hinein verfolgt, so treten für den, der Übung hat im Denken, ich meine innere Übung hat in dem, welche Wege das Denken nehmen muß, um an Realitäten heranzukommen, wahrhaftig Zusammenhänge auf, die in der geistigen Welt zutage treten - die aber nicht wunderbarer sind, als wenn geheimnisvolle Naturzusammenhänge auftreten -, Zusammenhänge, die eben nur in einer höheren Sphäre leben, und weil sie in einer höheren Sphäre leben, für die Erhöhung unseres Lebens um so wichtiger sind, wichtiger sind als das, wie die Seele sich fühlt im Dasein, wie die Seele sich auch religiös durchdringen kann mit dem Weltenzusammenhang,
wichtiger sind als die bloßen äußeren Natur-erkenntnisse. Geisteswissenschaft will nicht irgendeine Religion ersetzen; das religiöse Gefühl hat einen ganz anderen Ursprung. Aber Geisteswissenschaft ist, wenn man so sagen kann, geeignet, diese religiösen Gefühle zu vertiefen, sie selbst bei denen anzuregen, die durch die Einflüsse der neueren Naturwissenschaft alles religiöse Gefühl verloren haben. Geisteswissenschaft zeigt Zusammenhänge, ganz aus der Gesinnung naturwissenschaftlicher Denkweise heraus, innerhalb des geistigen Lebens. Nicht als ob dadurch alle Weltenrätsel gelöst würden, aber, was sonst sich nur als Tatsache neben Tatsache stellt, das wird innerlich durchleuchtet, in ähnlicher Weise, wie die Naturtatsachen durchleuchtet werden, wenn man sie an der Kette der Ursachen und Wirkungen verfolgen kann.
Nun möchte ich zum Schlusse etwas sagen, was nicht in einem denklogischen Zusammenhange steht als Schluß-betrachtung mit dem eben Ausgeführten - am nächsten Freitag werde ich weiter darüber zu sprechen haben -, sondern etwas, was nur wie durch eine Empfindungslogik damit verbunden ist, eine Empfindungslogik, die jedem begreiflich sein muß, der mit dem, was in unserer Zeit uns alle durchdringt, uns alle bewegt, zusammenhängt.
Das ist es ja gerade, daß wir sehen das Volk Mitteleuropas eingekreist, bedrängt, um sein Dasein kämpfend. Gestern versuchte ich zu zeigen, was innerhalb dieses Daseinskreises an geistigen Bestrebungen vorhanden ist. Nun glaube ich wirklich nicht gewaltsam, ich möchte sagen, um der Zeit in äußerlicher Weise zu dienen, das herbeizerren zu müssen, was ich zu sagen habe. Ich habe gestern versucht zu zeigen, wie im deutschen Geistesleben, gerade als dieses deutsche Geistesleben seine Erkenntniswege durch seine großen Philosophen in idealistischer Weise gesucht hat, ein
Weg liegt in die geistigen Welten hinein. Man darf es nicht dogmatisch nehmen - wie ich gestern immer wieder betont habe -, sondern man muß es nach der Art des Suchens nehmen, nach der Art des Strebens nehmen. Man muß die Richtung prüfen, nach welcher sich die inneren Seelenkräfte der deutschen idealistischen Philosophen bewegten. Und wenn man dann in einer Weise, wie ich das gestern auseinanderzusetzen versuchte, verfolgt, wie sich in Kant, in Goethe, in Fichte, in Schelling, in Hegel, auf der einen Seite durch abstraktes, durch nüchternes Denken, auf der anderen Seite durch energische Willensanschauungen, wie bei Fichte, oder durch gewaltige dichterische Gestaltungskräfte, wie bei Goethe, Deutschlands idealistische Weltanschauungswege eröffneten, so hat man darinnen etwas, was sich einem darstellt, wie wenn nun die Volksseele selber, diese deutsche Volksseele als Ganzes, in Meditation sich versenkt hätte, die Meditation einer ganzen Volksseele in der idealistischen Entwickelung vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts in das erste Drittel des neunzehnten Jahrhunderts herein! Wer in der Meditation, in der besonderen Ausbildung des Denkens, des Fühlens, des Wollens den Weg sieht in die geistigen Welten hinein, der darf, ohne eine solche Behauptung irgendwie gewaltsam herbeizerren zu müssen, sagen, was wirklich für den modernen Geistesforscher innigste Überzeugung sein kann: Der Fortschritt in der Geisteswissenschaft kann sich darstellen wie die Entwickelung eines Keimes, der in der deutschen idealistischen Philosophie versenkt ist; der überhaupt im ganzen idealistischen deutschen Geistesstreben um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts vorhanden ist und so fort-gewirkt hat bis in unsere Tage herein, wie ich das gestern versuchte zu charakterisieren. Wahrhaftig, in alledem, was ich seit Jahren hindurch hier in diesen Vorträgen habe sprechen
können, war immer das Bewußtsein: Es ist nichts anderes, was jetzt als Geisteswissenschaft gegeben wird -wenn das auch ganz paradox klingen wird -, als der Goetheanismus, der deutsche Idealismus. Ich meine diesen konkreten Idealismus, wie er um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts hervorgetreten ist im deutschen Geiste, in unsere Zeit übertragen; nicht einfach historisch angeschaut, wie er dazumal war, sondern lebendig erfaßt in unserer Zeit! Und ich war mir bewußt, niemals im Grunde genommen etwas anderes als Goetheanismus vorzutragen, indem ich Geisteswissenschaft, im Sinne wie sie in unserer Zeit sein kann, vortrug. So sonderbar das auch manchem in unserer heutigen Zeit klingen mag, - gerade wenn man die Sache so ansehen muß, dann findet man fest verankert das Streben nach der geistigen Welt in dem, wozu sich als einem höchsten Gipfel, als einem höchsten innerlichen Gipfel das deutsche Geistesstreben einmal erhoben hat.
Und wenn man diesen Zusammenhang in seiner Seele wirken läßt, so kann er sich in unsere schicksaltragenden Tage so hineinstellen, daß nun dasjenige, was auf der einen Seite in äußerster Ausgestaltung der geistigen Anstrengungen vom deutschen Volke gesucht worden ist, nur wie eine andere Seite desjenigen ist, was in unserer Zeit wirken muß, damit die geschichtliche, dem deutschen Volke in unseren Tagen gestellte Aufgabe auf den äußeren Feldern der Taten gelöst werden könne. Gerade deshalb findet man innig verbunden alles, was das deutsche Volk vollbringt, mit dem tiefsten Seelenleben, mit dem, was groß und bedeutend war in einer Zeit, als in bezug auf die Außenwelt dem deutschen Volke gleichsam derBoden unter den Füßen weggezogen war. Daher darf man sagen: Wenn sich jetzt neben dem äußerlichen Kampfe, den die Waffen entscheiden werden und über
den zu reden nicht eigentlich dem Geistesbetrachter ziemt, weil Dinge entschieden werden, über die nicht Worte entscheiden werden, sondern die Waffen -,wenn sich neben diesem Kampfe etwas entwickelt hat, was uns so merkwürdig entgegentönt dadurch, daß dieses deutsche Geistesleben von den Gegnern herabgesetzt wird, so daß man glauben könnte, diese Gegner finden nur dadurch die Möglichkeit, ihr eigenes Geistesleben in besonderem Licht erglänzen zu lassen, daß sie das deutsche Geistesleben herabsetzen, dann führt eine Betrachtung der inneren Bedeutung, der inneren Weltbedeutung des deutschen Geisteslebens gerade dazu, zu empfinden, wie wenig es der Deutsche nötig hat, sein eigenes Geistesleben so zu betrachten, daß in einem Vergleich das Geistesleben der anderen etwa herabgesetzt werden müßte. Der Deutsche darf bloß auf die ihm aus dem Innersten des Weltengeistes heraus gestellte Aufgabe blicken, um zu wissen, was er in der Welt zu verrichten hat, was er in die Zukunft hinüberzutragen hat.
Daher darf man aus dem tiefsten Bewußtsein heraus sagen: Dieser deutsche Volksgeist, der in der Allheit des deutschen Lebens waltet, der da waltet im deutschen Gedanken, in der, wie ich es angedeutet habe, deutschen Meditation, der da waltet in der deutschen Tat, dieser deutsche Volksgeist darf darauf hinweisen, wenn ihm jetzt in solch unverständiger Weise von da und dort entgegengehalten wird, er hätte geradezu eine Weltanschauung hervorgebracht, welche auf Gewalt und Macht allein ausginge, - er darf darauf hinweisen, wie er durch seinen Zusammenhang mit dem Geistigen dieses sonderbare Gerede widerlegen kann. Und wenn gar davon gesprochen wird, daß der deutsche Volksgeist in der geschichtlichen Entwickelung seine Rolle ausgespielt habe, dann darf gerade aus dem Umstand, daß der Keim zum höchsten Geistesleben
in der angedeuteten Meditation des deutschen Volksgeistes lebt, daß man sich bloß vorzustellen braucht, wie jene Keime Blüten und Früchte werden, aber Blüten und Früchte erst in der Zukunft werden müssen, - dann kann durch das echte Bewußtsein, das aus solchem Denken, aus solchem Empfinden, das aus solchem Fühlen fließt, gesagt werden: Denen, die da heute diesen deutschen Volksgeist herabsetzen oder ihm gar seine geistig fruchtbaren Kräfte für die Zukunft weigern wollen, denen hält, aus dem Bewußtsein seiner geistigen und seiner geschichtlichen Taten und Aufgaben heraus, dieser deutsche Volksgeist das Schicksalsbuch entgegen, das er durch eine Betrachtung der deutschen Aufgabe und des deutschen Geisteswesens in richtiger Weise zu entziffern glaubt. Und er sagt allen denen, die nicht nur mit den Waffen, sondern mit Wortwaffen glauben gegen das deutsche Geistesleben auftreten zu müssen und ihm den Untergang prophezeien, er glaubt diesen aus einer sicheren, auf die Erkenntnis des Verlaufes des deutschen Geisteslebens gegründeten Überzeugung heraus entgegenhalten zu können eine Seite des Schicksalsbuches der Entwickelung der Menschheit. Und auf dieser einen Seite steht - was auch gesagt, was auch behauptet werden mag -: die Zukunft des deutschen Geistes, die Zukunft der deutschen Volksseele!
BILDER AUS ÖSTERREICHS GEISTESLEBEN IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT Berlin, 9. Dezember 1915
Betrachten Sie dasjenige, was den Gegenstand des heutigen Vortrages bilden soll, nur wie eine Einschaltung in die Vortragsfolge dieses Winters. Sie rechtfertigt sich vielleicht eben gerade aus unserer schicksaltragenden Zeit heraus, in welcher die beiden mitteleuropäischen Reiche so eng miteinander verbunden den großen Forderungen des geschichtlichen Werdens in unserer Gegenwart und für die Zukunft entgegengehen müssen. Auch glaube ich mich berechtigt, einiges zu sagen gerade über das Geistesleben Österreichs, da ich ja bis gegen mein dreißigstes Jahr hin mein Leben in Österreich zugebracht habe und von den verschiedensten Seiten nicht nur Gelegenheit, sondern die Notwendigkeit hatte, in das österreichische Geistesleben mich vollständig hineinzufinden. Andererseits darf gesagt werden, daß dieses österreichische Geistesleben ganz besonders, ich möchte sagen, schwierig für die Ideen, den Begriff, für die Vorstellung des Außenstehenden zu fassen ist, und daß vielleicht unsere Zeit gerade es immer mehr und mehr notwendig machen wird, daß die Eigentümlichkeiten auch dieses österreichischen Geisteslebens einem größeren Kreise vor das seelische Auge treten. Nur werde ich nicht in der Lage sein, wegen der Kürze der Zeit, etwas anderes zu geben als, ich möchte sagen, zusammenhanglose Bilder, anspruchslose Bilder aus diesem österreichischen Geistesleben der verschiedensten Schichten; Bilder, die durchaus keinen Anspruch darauf
machen sollen, wiederum ein vollständiges Bild zu geben, sondern nur die eine oder andere Vorstellung bilden sollen, die etwa Verständnis suchen könnte für das, was jenseits des Inn und der Erzberge an Geistesleben vorhanden ist.
Im Jahre 1861 trat ein außer seiner Heimat weniger genannter, dem österreichischen Geistesleben lebendig verwobener Philosoph, Robert Zimmermann, an der Wiener Universität sein Lehramt an, das er dann bis in die neunziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts hinein verwaltete. Er wirkte nicht nur geistig erweckend für viele, die durch die Philosophie auf ihrem Seelenwege geführt wurden, sondern er wirkte auch auf die Seelen derjenigen, die in Österreich zu lehren hatten, dadurch, daß er den Vorsitz hatte der Real- und Gymnasialschul-Prüfungskommission. Und er wirkte vor allen Dingen dadurch, daß er ein liebes, gütiges Herz hatte für alles dasjenige, was an aufstrebenden Persönlichkeiten vorhanden war; daß er ein verständnisvolles Eingehen hatte für alles, was sich überhaupt im geistigen Leben geltend machte. Als Robert Zimmermann im Jahre 1861 sein philosophisches Lehramt an der Wiener Universität antrat, sprach er in seiner akademischen Antrittsrede Worte, die einen Rückblick auf die Weltanschauungsentwickelung in Österreich im neunzehnten Jahrhundert geben. Sie zeigen in aller Kürze, was es dem Österreicher in diesem Jahrhundert schwierig machte, zu einer sich selber tragenden Weltanschauung zu kommen.
Zimmermann sagt: «Jahrhundertelang war in diesem Lande der drückende Bann, der auf den Geistern lag, mehr als der Mangel an ursprünglicher Anlage imstande, ein selbständiges Aufblühen der Philosophie nicht nur, sondern auch den werktätigen Anschluß an die Bestrebungen anderer Deutschen zurückzuhalten. So lange die Wiener Hochschule zum größten Teil in Ordenshänden sich befand,
herrschte in ihren philosophischen Hörsälen die mittelalterliche Scholastik; als sie mit dem Anbruch einer aufgeklärten Zeit ungefähr nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts in weltliche Leitung überging, machte das von obenher angeordnete Maßregelungs- und Bevormundungs-system der Lehrer, Lehren und Lehrbücher die unabhängige Entwickelung eines freien Gedankenganges unmöglich. Die Wolffsche Philosophie» - also etwas, was im übrigen Deutschland durch Kant überwunden war - «in Federscher Abschwächung mit wenigen Brocken englischen Skeptizismus versetzt, wurde die geistige Nahrung der wissensdurstigen Jugend Österreichs. Wer wie jener feingebildete Mönch von St. Michael in Wien nach Höherem Verlangen trug, hatte keine andere Wahl, als nach abgestreiftem Klosterkleid heimlich den Weg über die Grenze in Wielands gastfreundliche Freistätte zu suchen. Dieser Barnabitermönch, den die Welt unter dem bürgerlichen Namen Karl Leonhard Reinhold kennt, und jener Klagenfurter Herbert, der einstige Hausgenosse Schillers, sind die einzigen öffentlichen Zeugen für die Beteiligung der verschlossenen Geister-welt diesseits des Inn und der Erzberge an dem gewaltigen Umschwung, von welchem gegen das Ende des verflossenen, des philosophischen Jahrhunderts, die Geister des jenseitigen Deutschland sich ergriffen fanden.»
Man kann begreifen, daß ein Mann so spricht, der aus einem begeisterten Freiheitssinn heraus an der Achtundvierziger-Bewegung sich beteiligt hatte, der dann in einer vollständig unabhängigen Weise gedachte, sein philosophisches Lehramt auszufüllen. Man kann sich aber auch fragen:
Ist nicht vielleicht dieses Bild, das der Philosoph da fast in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zeichnet, doch von einigem Pessimismus, einiger Schwarzseherei gefärbt? Diese Schwarzseherei tritt bei dem Österreicher leicht ein,
wenn er sein eigenes Land beurteilt, durch die Aufgaben, die gerade Österreich zugewachsen sind dadurch, daß sich das Reich durch die historischen Notwendigkeiten - ich sage ausdrücklich: durch die historischen Notwendigkeiten - aus einem vielgestaltigen, vielsprachigen Völker-gemisch zusammensetzen und seine Aufgaben innerhalb dieses vielsprachigen Völkergemisches finden mußte. Und wenn man vielleicht gerade aus gutem österreichischem Bewußtsein heraus eine solche Frage stellt, da kommen einem allerlei andere Vorstellungen in den Sinn.
Da kann man dann zum Beispiel an einen deutschen österreichischen Dichter denken, der so recht ein Kind der österreichischen, sogar der südösterreichischen Berge ist; ein Kind des Kärntnerlandes, das oben hoch in den Kärntnerbergen geboren ist und durch einen inneren geistigen Drang sich bewogen fühlte, herunterzusteigen in die Bildungsstätten. Ich meine den außerordentlich bedeutenden Dichter Fercher von Steinwand. Unter Fercher von Steinwands Dichtungen finden sich nun sehr merkwürdige Darbietungen. Nur eine einzige Probe möchte ich als ein Bild für dieses österreichische Geistesleben vor Ihre Seelen stellen, als ein Bild, welches sogleich wachrufen kann etwas von dem, wie der Österreicher aus seinem innersten, ursprünglichsten, elementarsten Geistesdrang heraus mit gewissen Zeitideen zusammenhängen kann. Fercher von Steinwand, der so wunderbare «Deutsche Klänge aus Österreich» zu dichten verstand, der aus so innigem Gemüt heraus alles zu gestalten verstand, was Menschenseelen bewegt und bewegen kann, er wußte sich auch zu erheben mit seiner Dichtung in die Höhen, wo der Menschengeist zu erfassen versucht, was im innersten Weltenweben lebt und wirkt. So zum Beispiel in einem Gedicht, das lang ist, von dem ich aber nur den Anfang vorlesen will, und das da heißt: «Chor der Urtriebe.»
In den unbegrenzten Breiten
Unsrer alten Mutter Nacht,
Horch - da scheint mit sich zu streiten
Die geheimnisvolle Macht!
Hö ren wir die Ahnung schreiten?
Ist die Sehnsucht aufgewacht?
Ward ein Geistesblitz entfacht?
Gleiten Träume durch die Weiten?
Wie sich an Kräften die Kräfte berauschen,
Seliges Tauschen!
Plötzliches Eilen,
Stilles Verweilen,
Schwelgendes Lauschen
Wechselt mit Winken
Staunenden Bangens!
Reiz des Erlangens
Steigt, um zu sinken,
Sinkt, um zu hassen,
Weiß vor dem blassen
Bild des Umfangens
Haß nicht zu fassen.
Dunkle Verzweigungen
Sprießender Neigungen
Suchen nach Ranken.
Schwere Gedanken
Dämmern und wanken
Über den Weiten,
Scheinen zu raten
Oder zu leiten.
Was sie bereiten,
Sind es die Saaten
Riesiger Taten,
Strahlender Zeiten?
Wer das Erwühlte
Schöpferisch fühlte!
Wer es durchirrte,
Selig genießend,
Oder entwirrte,
Hohes erschließend!
Droben bewegt sich's wie Geisterumarmung,
Wir in Erwarmung,
Wir auch gewinnen,
Suchen und sinnen,
Seh'n uns gehoben,
Höchstem Beginnen
Glücklich verwoben.
Die uns umwehen,
In uns entstehen:
«Ihr seid's, Ideenl - -»
Der Dichter sieht, da er sich zu vertiefen sucht in den «Chor der Urtriebe», die weltschöpferisch sind, wie Ideen zu ihm kommen. Zu jener Welt gerade sucht er sich aufzuschwingen, die gelebt hat in den Geistern, von denen ich mir gestattete, in der vorigen Woche zu sprechen, in Fichte, Schelling und Hegel. Wir fragen uns aber vielleicht, wie konnte in Fercher von Steinwands Seele jenes innige Band gewoben werden, das ihn doch verknüpfen mußte - und es hat ihn wirklich verknüpft - zwischen dem Drang seiner Seele, der erwachte in dem einfachen Bauernbuben aus den kärntnerischen Bergen, und zwischen dem, was in der Blüte deutscher Weltanschauungsentwickelung die größten idealistischen Philosophen von ihrem Gesichtspunkte aus zu erstreben suchen. Und da fragen wir denn: Wo konnte Fercher von Steinwand das finden, da nach Robert Zimmermanns Worten Schiller, Fichte, Hegel in Österreich gerade in
der Jugendzeit Fercher von Steinwands - er ist geboren 1828 - nicht vorgetragen wurden, da sie gerade in seiner Jugendzeit dort zu den verbotenen Früchten gehörten? Aber die Wahrheit, sie dringt überall durch. Als Fercher von Steinwand das Gymnasium absolviert hatte und, mit seinem Gymnasialzeugnis ausgerüstet, nach Graz, nach der Universität Graz ging, da ließ er sich in Vorlesungen einschreiben. Und da war eine Vorlesung, die gerade der ihn aufnehmende Dozent in Naturrecht las. Er ließ sich in das Naturrecht einschreiben und konnte natürlich hoffen, daß er da viel von allerlei Begriffen und Ideen über die Rechte hören werde, die dem Menschen von der Natur angeboren sind, und so weiter. Aber siehe da! Unter dem anspruchslosen Titel «Naturrecht» sprach der gute Edlauer> der Grazer Universitätsprofessor, der Jurist, das ganze Semester hindurch von nichts anderem als von Fichte, Schelling und Hegel. Und so machte denn Fercher von Steinwand seinen Kursus Fichte, Schelling, Hegel in dieser Zeit durch, ganz unabhängig von dem, was man nach einer äußerlichen Auffassung des österreichischen Geisteslebens für verboten halten konnte, was vielleicht auch wirklich verboten war. Ganz unabhängig davon, was sich an der Oberfläche abspielte, lebte sich also in diesen Zusammenhang mit höchstem geistigen Streben eine Persönlichkeit ein, die da nach einem Weg in die geistigen Welten suchte.
Nun, gerade wenn man sich einläßt darauf, solchen Weg eines Österreichers zu verfolgen in die geistigen Welten hinein, so muß man berücksichtigen - wie gesagt, ich will nichts begründen, sondern nur Bilder geben -, daß die ganze Artung dieses österreichischen Geisteslebens viele, viele Rätsel demjenigen bietet - ja, ich kann nicht anders sagen -, der nach einer Lösung von Rätseln sucht. Wer aber gerne betrachtet, wo Gegensätze so nebeneinander stehen in den
menschlichen Seelen, der wird manches außerordentlich Bedeutungsvolle gerade an der Seele des Österreichers finden. Schwieriger als in anderen Gegenden, zum Beispiel in deutschen, hat es der österreichische Deutsche, sich heraufzuarbeiten, ich möchte sagen, nicht so sehr in die Bildung, sondern in die Handhabung der Bildung, in das Mitmachen der Bildung. Mag es pedantisch ausschauen, aber ich muß es doch sagen: es ist schwierig gemacht dem Österreicher schon durch die Sprache, so mitzutun in der Handhabung seines geistigen Lebens. Denn dem Österreicher ist es außerordentlich schwierig, so zu reden, wie etwa die Reichs-deutschen sprechen. Er wird sehr leicht in Versuchung kommen, alle kurzen Vokale lang, alle langen Vokale kurz zu sagen. Er wird sehr häufig in die Lage kommen, der «Sôn» und die «Sohne» zu sagen, statt der «Sohn» und die «Sonne». Woher kommt so etwas? Das kommt daher, daß das österreichische Geistesleben notwendig macht - es soll nicht kritisiert, sondern nur beschrieben werden -, daß derjenige, der sich, ich möchte sagen, aus dem Mutterboden des Volks-lebens heraufarbeitet in eine gewisse Bildungs- und Geistes-sphäre, einen Sprung über einen Abgrund zu machen hat -aus der Sprache seines Volkes in die Sprache der gebildeten Welt hinein. Und da gibt ihm natürlich nur die Schule die Handhabe. Die Mundart sagt überall richtig; die Mundart wird nichts anderes sagen als: Der «Suun», recht lang, für der «Sohn», D'«Sün», ganz kurz, für die «Sonne». Aber in der Schule wird es einem schwierig, sich hineinzufinden in die Sprache, die nun, um die Bildung zu handhaben, erlernt werden muß. Und dieses Überspringen des Abgrundes, das bewirkt es, daß es eine eigene Schulsprache gibt. Diese Schulsprache ist es, nicht irgendeine Mundart, die überall verleitet, die langen Vokale kurz und die kurzen Vokale lang zu sprechen. Daraus ersehen Sie, daß man im Geistesleben
drinnenstehend schon überall eine Kluft hat gegen-über dem Volkstum. Aber dieses Volkstum wurzelt wiederum so tief bedeutsam, nicht so sehr vielleicht in eines jeden Bewußtsein, sondern, man möchte sagen, in eines jeden Blut, so daß innerlich erlebt wird die angedeutete Kraft, und sogar in bedeutsamer, tief in die Seele einschneidender Weise erlebt werden kann. Und da kommen dann Erscheinungen zutage, die ganz besonders wichtig sind für den, der betrachten will das Hineinstellen des österreichischen höheren Geisteslebens in das Geistesleben des österreichischen Volkstums und den Zusammenhang zwischen beiden. Indem sich der Österreicher in die Bildungssphäre heraufarbeitet, wird er, ich möchte sagen, auch in bezug auf manche Prägung des Gedankens, manchePrägung der Ideen in eine Sphäre gehoben, so daß wirklich eine Kluft ist zum Volkstum hin. Und da kommt dann das zustande, daß mehr, als es sonst der Fall ist, nach dem Volkstume, gerade in dem Österreicher, der sich in das Geistesleben hineingefunden hat, etwas entsteht von einem Sich-hingezogenFühlen zum Volkstum, das nicht ist ein Heimweh nach etwas, was man erst vor kurzer Zeit verlassen hat, sondern ein Heimweh nach etwas, von dem einen doch in gewisser Beziehung eine Kluft trennt, demgegenüber man aber nicht umhin kann, aus dem Blut heraus, es zu erschaffen, sich hineinzufinden.
Und nun denken wir uns zum Beispiel einen Geist - und er kann für das österreichische Geistesleben ganz typisch sein-, der durchgemacht hat, was ihm bieten konnte eine österreichische wissenschaftliche Bildung. Er lebt nun darinnen. Er ist in einer gewissen Weise durch diese wissenschaftliche Bildung getrennt von etwas, das er eben nicht mit gewöhnlichem, sondern mit einem viel tieferen Heim-weh erreichen kann, von seinem Volkstum. Dann tritt auch
unter Umständen so etwas auf wie ein inneres Erleben der Seele, in dem sich diese Seele sagt: Ich habe mich in etwas hineingelebt, das ich ja anschauen kann mit den Begriffen, mit den Ideen, das von dem Standpunkte der Intelligenz aus gewiß mich da oder dort hinführt, um die Welt zu verstehen und das Leben im Zusammenhang mit der Welt zu verstehen; aber da gibt es jenseits eines Abgrundes etwas wie eine Volksphilosophie. Wie ist doch diese Volksphilo-sophie? Wie lebt sie in denen, die nichts wissen und auch gar keine Sehnsucht haben, etwas zu wissen von dem, in das ich mich eingelebt habe? Wie schaut es da drüben, jenseits des Abgrundes, aus? - Ein Österreicher, in dem so lebendig geworden ist dieses Heimweh, das viel tiefer ist, als es sonst auftreten kann, dieses Heimweh nach dem Quell des Volkstums, aus dem man herausgewachsen ist, ein solcher Österreicher ist lose ph Misson.
Misson, der in seiner Jugend in einen Orden eintrat, nahm diejenige Bildung auf, auf die Robert Zimmermann hingewiesen hat, lebte in dieser Bildung und war in dieser Bildung auch tätig; er war Lehrer an den Gymnasien in Horn, in Krems, in Wien. Aber mitten in dieser Handhabung der Bildung entstand ihm, wie in einem inneren Seelenbild, durch die vertiefte Heimatliebe die Philosophie seines einfachen Bauernvolkes Niederösterreichs, aus dem er herausgewachsen ist. Und dieser Joseph Misson im Ordenskleid, der Gymnasiallehrer, der Lateinisch und Griechisch zu lehren hatte, vertiefte sich so in dieses sein Volkstum, wie aus der Erinnerung heraus, daß dieses Volkstum in einer lebendigen Weise dichterisch sich in ihm offenbart, so sich offenbart, daß dadurch eine der schönsten, der herrlichsten Dialekt-Dichtungen, die es überhaupt gibt, entstanden ist. Ich will nur, um Ihnen ein Bild vor die Seele zu malen, ein kleines Stück aus dieser Dialektdichtung vortragen,
die 1850 nur zum Teil erschienen ist - sie ist dann nicht vollendet worden -, gerade dasjenige Stück, in dem Joseph Misson so recht die Lebensphilosophie des nieder-österreichischen Bauern zur Darstellung bringt. Das Gedicht heißt: «Da Naaz» - der Ignaz -, «a niederösterreichischer Bauernbui geht in d' Fremd.» Also, der Naaz ist herangewachsen im niederösterreichischen Bauernhaus, und er ist so weit, daß er nun seinen Weg in die Welt zu machen hat. Er muß Vater und Mutter, das elterliche Haus, verlassen. Da werden ihm die Lehren mitgegeben, die nun so recht eine Lebensphilosophie darstellen. Man muß nicht die einzelnen Grundsätze, die der Vater zu dem Buben sagt, nehmen, sondern man muß sie in ihrem geistigen Zusammenhang nehmen; wie da geredet wird über die Art und Weise, wie man sich zum Glück, wenn es kommt, zum Schicksal zu verhalten hat; wie man sich zu verhalten hat, wenn einem dieses oder jenes zustößt; wie man sich zu verhalten hat, wenn einem jemand Gutes tut; wie man sich zu verhalten hat zu freundlichen Leuten und wie zu denen, die einem Leids tun. Und ich möchte sagen: Dem, der seine philosophischen Studien durchmachte bis zu dem Grade, daß er vollständig Theologe geworden ist, dem geht jetzt diese Bauernphilosophie auf. - Der Vater sagt also zu dem Naaz, als der Naaz in d' Fremd geht:
Aus dem ersten Gesang.
Lehr vo main Vodern auf d'Roas.
Naaz, iaznloos, töös, wos a ta so, töös sockt ta tai Voda.
Gootsnom, wails scho soo iis! und probiast tai Glück ö da Waiden.
Muis a da sogn töös, wo a da so, töös los der aa gsackt sai.
Ih unt tai Muida san olt und tahoam, woast as ee, schaut nix außa.
Was ma sih schint und rackert und plockt und obi ta scheert töös
Tuit ma für d'Kiner, wos tuit ma nöd olls, bolds' nöd aus der Ort schlog'n! -
I is ma aamol a preßhafts Leut und san schwari Zaiden,
Graif an s'am aa, ma fint toos pai ortlinga rechtschoffan Kinern,
Gern untern Orm, auf taas mer d'Ergiibnus laichter daschwingan. -
Keert öppa sGlück pal dia ai, soo leeb nöd alla Kawallaa.
Plaib pain ann gleicha, Mittelstroß goldas Moß, nöd üwa t'Schnua haun.
5' Glück iis ja kugelrund, kugelt so laicht wida toni wia zuuaha.
Geets owa gfalt und passiat der an Unglück, socks nöd ön Leuden.
Tui nix taglaicha, loß s goa nöd mirka, sai nöd goa zu kloanlaud.
Klock's unsan Heagoot, pitt'en, iih so ders, er mochts wida pessa!
Mocka'r und hocka'r und pfnotten und trenzen mit den kimt nix außa.
Kopfhängad, grod ols won amt' Heana s Prot häden gfressa:
Töös mochts schlimmi nöd guit, gidanka'r ös Guidi no pessa!
Schau auf tai Soch, wost miit host, denk a wenk füri aufs künfti! -
Schenkt ta w'ea wos, so gspraiz ti nöd, nimms und so dafüa: gelts Goot!
Schau Naaz, mirk ta dos fai: weng da Höflikeit iis no koans gstroft woan! -
Holt ti nea ritterla, Fremd zügelt t'Leud, is a Sprichwoat, a Worwoat.
Los ti no glai ö koan Gspül ai, keer di nöd fainl nochn Tonzplotz.
Los ta ka Koatn nöd aufschlogn, suich da tai Glück nöd in Trambuich.
Gengan zween Wö unt tor oani is naich, so gee du en olden.
Geet oana schips, wos aa öftas iis, so gee du en groden -
Schau auf tain Gsund, ta Gsund lis pai olln no allwail tos Pessa.
So mer, wos hat tenn aa Oans auf da Welt, sobolds nöd ön Gsund hod?
Kimst a mol hahm und tu findst ö ten Stübl uns oldi Leud nimma,
Oft samma zebn, wo tai Aeln und Aanl mit Freuden uns gewoaten,
Unsari Guittäter finten und unsa vastoabani Freundschoft!
Olli, sö kenan uns glai - und töös, Naaz, töös is dos Schöner!
Wiedergabe:
Eine Lehre von meinem Vater für die Wanderschaft
Ignaz, nun höre zu, das, was ich dir sage, das sagt dir dein Vater.
In Gottes Namen, weil es doch so sein muß, und du dein Glück in der weiten Welt versuchen sollst,
Deshalb muß ich dir das sagen, und was ich dir sage, das beherzige wohl.
Ich und deine Mutter sind alt und zu Hause geblieben; du weißt, dabei kommt nichts heraus.
Man schindet sich viel, müht sich ab, arbeitet hart und schwächt sich sorgend durch Arbeit -
Man tut dies den Kindern zu Liebe; was möchte man nicht alles tun, sobald sie nicht auf falsche Wege geraten.
Ist man später schwach und kränklich geworden, und kommen schwere Zeiten
Springen sie uns auch liebevoll, man findet solches bei ordentlichen, rechtschaffenen Kindern,
Helfend bei, damit man eine Erleichterung habe, zu leisten, was der Staat und das Leben verlangen.
Sollte etwa das Glück bei dir einkehren, so leb nicht wie ein Kavalier.
Bleibe so, wie du warst, bei dem goldenen Maß der Mittelstraße, weiche nicht ab von dem rechten Lebenswege.
Das Glück ist rund wie eine Kugel; es rollt ebenso leicht von uns weg, wie zu uns.
Gelingt etwas nicht, oder trifft dich ein Unglück, so sprich davon nicht zu den Menschen.
Bleib' gelassen; lasse dir nichts anmerken; sei nicht kleinmütig;
Klage alles nur Gott; bitte ihn; ich sage dir, er macht alles wieder besser!
Bekümmert tun, sich zurückziehn, saure Gesichter machen, weinerlich sein: dadurch wird nichts erreicht.
Den Kopf hängen lassen, als ob einem die Hühner das Brot weggegessen hätten:
Das bessert nichts Schlimmes, geschweige denn macht es das Gute noch besser!
Bewahre deinen Besitz, den du mit dir nimmst; sorge ein wenig für die Zukunft.
Schenkt dir jemand etwas, so nimm es, ohne dich zu zieren, und sage dafür: vergelte es Gott! -
Beachte, Ignaz; und erinnere dich daran wohl: der Höflichkeit wegen ist noch niemand bestraft worden! -
Zeige dich nicht widerborstig, die Fremde macht den Menschen bescheiden; dies ist ein Sprichwort und ein Wahrwort.
Lasse dich nicht zum Spielen verführen; mache dir nicht zu viel aus dem Tanzplatz.
Lasse dir nicht die Karten legen; und suche dein Schicksal nicht nach dem Traumbuch.
Gehen zwei Wege, und einer ist neu, so gehe du den alten.
Geht einer ungerade, was des öfteren ist, so gehe du den geraden.
Behüte deine Gesundheit; die Gesundheit ist von allen Gütern das bessere.
Gestehe mir doch zu: was besitzt man in der Welt wfrklich, wenn man nicht die Gesundheit hat?
Kommst du einst nach Hause, und findest du uns alte Leute nicht mehr in diesem Stübchen,
Dann sind wir da, wo dein Großvater und deine Großmutter in Freuden uns erwarten,
Wo uns unsere Wohltäter finden und unsere verstorbenen Verwandten.
Alle werden uns sogleich wiedererkennen - und dies, Ignaz, ist etwas sehr Schönes.
Nun heißt es -:
Aus dem zweiten Gesang.
Wia da Naaz dos väterlichi Haus verloßt und ihm saim olden Laid s'Gloat geben.
Vodar und Muidar iazt sa -n -ih: «Gelts Goot, für ols, wos ma hopts Guids ton,
Wünsch enk recht herzlih, taß nah long lepts und aa tabei gsund plaibts!»
«Wos Goot will», sockt t'Muida und wischt min Fürtazipf t'Aung aus,
«Ruift und ta Hea vo tera Wöld o, so samma jo gfoßt trauf.
Mänichen Menschen iis früaher aufgsetzt und mänichen späder.
Ih unt tai Voda, mir petten, Naaz, taß ta koan Unglück nöd zuisteßt.
Gengan a Neichtli mit tia und bigloaten dih pis zu da Moata;
Pist amol z Piasenrait, keerst pai da Moam ai, fintst schon an Aufnom,
Richst olles Schöni aus, Naaz, und lossens aa viii mol grüaßen;
Kons amol a kemma, wirds uns aa rechtschaffa gfreun, wons uns hoamsuicht!»
Sockt das alt Muiderl und bint ihm an Guglhupf, Baudexen und aa
Noh dazui an Scherzen wais Prot in a neugwaschas Tüachel.
Hoamlih gibt's ihm noh in an Popierl drei spannaichi Zwoanzka.
Extra gibt ihm da Vada an Zwieguldner, mehr kon a nöd gebn.
«S'Geld, Naaz, is pai uns Piglem nimm valiab midn Willn, Naaz.»
Ee t'Tür aufgeet, schaut da Naaz und pitracht sih noh's Stübl.
«Main!» sockt t'Muida, «töös iis a schlims Zoachar -ols säächast as nimmer!»
Glängt mit zween Fingern ös Waihprunkesterl, wos glaih pai da Tür hängt:
«Gootsnom!» sockt Muida, macht eam a Kreuz aufn Hirn midn Damar - unt gengan -
«Jazn is's Ernst, Naaz, iaz pflat dih Goot, schau daß da guit geet, Naaz!
Los a zu Zaiden was hörn, auf daas ma doh gleiwel aa wissen,
Wia oder wonn oder wos oder gsezter wais daaß da wos faalat. -
Kimst über t Graanitz, nim noh früaher a Schmutzerl vol Erten
Trinks in an gwasserten Wai, es hilft für die ungrische Krongat!»
Pflaten sih nohmol und nohmol und gengan pitrüabt ausanonda.
Hunotmal klöckt nöd, schaun sa sih um und winkan min Hänten.
«Schau auf tai Aufweising», schreit noh da Voda von waiden, «vaioi's nöd!»
«Gee zu da Moam hin», schreit dos alt Muiderl, «mir grüaßens, vogiß nöd.»
Wiedergabe:
Wie Ignaz das väterliche Haus verläßt und seine Eltern ihm das Geleit geben
Vater und Mutter, nun sage ich Vergelts Gott, für alles was ihr mir Gutes getan habt,
Ich wünsche euch von Herzen, daß ihr noch lange lebt und dabei gesund bleibt.
Wie Gott will, sagt die Mutter und wischt sich die Augen mit dem Tuchzipfel aus,
Ruft uns der Herr aus der Welt ab, so sind wir darauf gefaßt.
Manchen Menschen ist es früher aufgegeben und manchen später.
Ich und dein Vater beten, Ignaz, daß dir kein Unglück zustößt.
Wir gehen noch ein Stück Weg mit dir und begleiten dich bis zum Muttergottesbild.
Bist du erst einmal in Piasenrait, so kehre bei der Muhme ein, dort findest du sicher Aufnahme.
Bestelle ihr alles Schöne, Ignaz, wir lassen sie auch vielmals grüßen.
Wenn sie einmal kommen kann, wird es uns wirklich freuen, wenn sie uns besucht,
So spricht das alte Mütterchen und bindet ihm einen Napfkuchen, Backwerk und auch dazu noch einen Kanten Weißbrot in ein frischgewaschenes Tüchlein.
Heimlich gibt sie ihm noch, in Papier gewickelt, drei glänzend neue Zwanziger.
Der Vater gibt ihm ein Zwei-Gulden-Stück, mehr kann er nicht geben.
Das Geld ist bei uns knapp, Ignaz, nimm mit dem guten Willen vorlieb.
Bevor die Tür aufgeht, schaut sich Ignaz um und betrachtet noch einmal das Stübchen.
0 weh, sagt die Mutter, das ist ein schlimmes Zeichen, so als sähest du's nie wieder,
Langt mit zwei Fingern ins Weihwasserkesselchen' das neben der Tür hängt.
In Gottes Namen, sagt die Mutter und macht ihm ein Kreuz auf die Stirn mit dem Daumen - und sie gehen.
Jetzt wird es Ernst, Ignaz, nun behüte dich Gott, laß es dir gut gehen, Ignaz,
Laß auch von Zeit zu Zeit von dir hören, damit wir auch immer wissen, wie es dir geht oder ob dir was fehlt.
Wenn du über Granitz kommst, nimm vorher eine Handvoll Erde,
Trink das in verdünntem Wein, es hilft gegen das Fieber.
Sie sagen sich Behüte dich, noch einmal und noch einmal, und gehen betrübt auseinander.
Hundertmal reicht nicht, daß sie sich umschauen und mit den Händen winken
Achte auf deinen Ausweis, ruft der Vater noch von weitem, verlier ihn nicht.
Geh zu der Muhme hin, ruft das alte Mütterchen, wir lassen sie grüßen, vergiß das nicht.
Die ganze Philosophie des Bauernvolkes taucht da vor dem Ordensmann auf, und so lebendig, daß man sieht, wie innig er damit verwachsen ist. Aber mit noch etwas anderem ist er verwachsen: mit demjenigen, was so gründlich zusammenhängt mit dem österreichischen Charakter, mit dem Charakter des österreichisch-deutschen Bauerntums in den Alpen: mit der unmittelbar urwüchsigen Naturanschauung, die aus dem unmittelbarsten Zusammenleben mit der Natur heraus ist. Dem, was da in Joseph Misson wieder lebendig wird, verdankt man die Schilderung eines Gewitters. Anschaulich wird da geschildert, wie der Naaz nun reist und wie er an einen Platz kommt, wo Heideschafe weiden, die ein Hirte, den man dort einen Holdar nennt, genau zu beobachten weiß: wie sie sich benehmen, wenn ein Gewitter kommt. Nun sagt er sich selber, was er da sieht:
Wia'n Naaz a Wöder dawischt unt er sih nöt aus unt nöd ein woaß.
«Oans», sockt a, «töös», sockt a, «setz dir iazt fest und teng dir wo'st ausroast»
Geet auf t'Hoad und schaut - iaz mochts auf oamol an Dunnrer!
Gleich trauf wida'r - und wia romaats über t Beringer umi.
Purrt und saust waitmächti in Holz trinat, daß's völli aus iis!
«No, woo dos ausloßt, unsar Heagoot sai eane gnädi!»
Sockt drauf da Holdar, nimmt sain Gebernitz um und «wanns nur»,
Sockt er und schaut auf die Guirkan, «wanns nur nöd eppa'r an Schaur hod!»
«So, wia mir zimt», so sockt er, «so san zwoa Wödarn painander.»
(Dieses Zusammenströmen von zwei Gewittern ist nun anschaulich geschildert.)
Und ta Hund reckt t Goschn int Höh und schmöckt wia da Luft geet.
Zoigt' ön Schwoaf ain, geet droaf ruhi zum Holdar - unt guscht sih.
Jazn is's still und schwül und s Laab töös zidat in Poman.
T Vögel t schloifan in t'Nöster unt t'Schoof dee stenkat die Köpf zsom. -
Wiedergabe:
Wie der Ignaz in ein Wetter gerät und nicht aus noch ein weiß
Hör einmal, sagt er sich, setz dir jetzt und denk dir aus, welchen Weg du nimmst.
Er geht auf die Heide und schaut - auf einmal kracht ein Donner,
Gleich darauf wieder, und wie es rumort über die Berge hinüber!
Es knarrt und saust gewaltig im Holze, als ob's völlig aus sei.
Na, wen das trifft, dem sei der Herrgott gnädig,
Sagt sich da der Bursche, nimmt seinen Mantel um und sagt,
Wie er nach den Wolken schaut, wenn es nur nicht etwa noch regnet.
Wie mir scheint, sagt er, sind zwei Gewitter durcheinander.
Und der Hund streckt die Schnauze in die Höhe und schnuppert, wie die Luft weht,
zieht den Schwanz ein, geht darauf still zum Burschen und legt sich neben ihn.
Jetzt ist es still und schwül, und das Laub zittert in den Bäumen,
Die Vögel schlafen in den Nestern, und die Schafe stecken die Köpfe zusammen.
Das macht er sich alles gegenwärtig, der gute Naaz, und dann sagt der Dichter, der beschrieben hat mittlerweile, wie der Naaz in «a Lucka» - in eine Felsenhöhle, eine Stein-höhle - hineingegangen ist. Er wartet dort, bis das Schlimmste vorüber ist. Dann hängt er seine Stiefel auf die andere Achsel und geht wieder weiter. Aber das Abenteuer mit dem Wetter ist noch nicht aus. Der Naaz kommt an ein Bächelchen; das ist selbstverständlich angeschwollen von dem Wetter. Der Naaz sieht das:
«Schaut wia'ra Nor, tös Bachl is gros, iazt kon a nid umi! -
Töös owa», sockt a, «wiat toh wos sain? iozt kann ik nid umi!»
Er schaut wie ein Narr, der Bach ist zu groß, jetzt kann er nicht hinüber.
Aber so etwas, sagt er, was soll das sein?
Jetzt kann ich nicht hinüber!
Nun, in einer solchen Weise wollte Misson, dieser wirklich aus der Tiefe des Volkstums heraus schaffende Mensch, die Gestalt des Naaz verkörpern. Wenn man gerade eine solche Gestalt nimmt, so sieht man, wie tief, tief in den unterbewußten Seelenfächern, könnte ich sagen, das österreichische Volkstum sitzt bei denjenigen Seelen, die sich auch hinaufgearbeitet haben in eine hohe Bildungssphäre. Und man sieht an einem solchen Beispiel, was aus dem Volkstum bleibt für die Seele in die höhere Bildungssphäre hinauf, wenn man dieses österreichische Volkstum betrachtet.
Man muß sagen: Mystiker, so etwa in dem Sinne, daß die menschliche Seele so recht die Vertiefung in das Innenleben, so recht sich klar zu werden versucht, was da im Innern des Menschen lebt und webt, - solche Mystiker sind in Österreich nicht recht zu finden. Mystiker, die sich viel mit dem menschlichen Ich befassen, können dort nicht gedeihen. Dagegen in einer gewissen Weise die geheimnisvollen Naturmächte mehr als nur poetisch fühlen, ich möchte sagen, die Gnomen, die Kobolde, die Geister der Natur in ihrer Lebendigkeit fühlen, auch mit einem gewissen Humor, so daß man sich im rechten Augenblick nicht gezwungen fühlt, die volle Realität zuzugeben, sondern im Miterleben der Natur das, was in der Natur lebt und webt, als ein höheres Geistiges zu empfinden, - das ist wiederum österreichisch. Daher wird man Mystiker, die etwa Nachfolger von Eckhart, Johannes Tauler sein könnten,
innerhalb des österreichisch-deutschen Volkstums nicht leicht finden können.
Dagegen ist so recht eine österreichische Gestalt der merkwürdige Bauernphilosoph Conrad Deubler, der mitten in den Gebirgen drinnen, in Goisern, 1814 geboren, 1884 dort als Gastwirt gestorben ist, der durchaus ganz Bauer gewesen und geblieben ist; ein Mann aber, der die neueren Ideen des Darwinismus, die Entwickelungsgeschichte, so lebendig ergriffen hat, durchdrungen hat mit seinem Bauernverstand, mit einem gewissen, ich möchte sagen, kurz angebundenen Bauernverstand, - Conrad Deubler, ein solcher Philosoph konnte gedeihen; ein Philosoph, der sich nicht viel einließ auf weitschweifige Begründungen, sondern es gefiel ihm diese Lehre, und nun brachte er aus dem österreichischen Gemüt alles auf, was diese Lehre so plausibel erscheinen lassen konnte. Er brachte aus einem ursprünglichen, elementarischen Bauernverstand heraus eine, ich möchte sagen, ins österreichisch-bäuerische umgesetzte Darwinistische Auffassung zustande, durch die er in einem ausgiebigen Briefwechsel stehen konnte mit dem bedeutenden Theologen und Schriftsteller David Friedrich Strauß, mit Feuerbach, mit Ernst Haeckel und so weiter. Die ganze Weite des Naturbildes mit dem Verstande zu erfassen, liegt dieser österreichischen Seele eher, als sich etwa nur mystisch in das Innere zu vertiefen. Man findet deshalb im österreichischen Bauerntum einzelne Menschen, die jedes Kräutelchen im Gebirge kennen, die auch mit dem ganzen inne-ren Weben des Kräutelchens seelisch verbunden sind, die sich zum Beispiel auf solche Philosophen wie Ennemoser, wie Ekartshausen einlassen, die mehr in der ganzen Breite ein gewisses tieferes Naturbild geben wollen, die auch den Menschen in dieses Naturbild hineinstellen wollen. Aber man wird innerhalb dieses österreichischen Bauerntums und
demjenigen, was aus diesem Bauerntum erwächst, nicht leicht einen reinen Mystiker finden, der sich auf Betrachtung der menschlichen Seele einläßt, mit Abwendung des Blickes von der äußeren Sinnenwelt. Denn das unmittelbare Zusammenhängen mit demjenigen, was auf die Sinne Eindruck macht, das ist es, was dem, der es sieht, das österreichische Gemüt charakterisiert im weitesten Umkreis, -das Sehen von mehr als Sinnlichem, aber das unmittelbare Sehen - das Sehen, was nicht nachzudenken braucht, jenes Sehen, das, ich möchte sagen, zuweilen den Verstand überspringt und unmittelbar in das Herz hineingeht.
Daher kann man sagen, daß aus der österreichischen Poesie ein unmittelbares Zusammenklingen der Seele mit der Landschaft stattfindet, bisweilen in einer so schmerz-bewegenden Weise, wie bei Lenau; aber überhaupt dieses Aufgehen mit der ganzen Seele in dem, was unmittelbar von dem Menschen getan, was von ihm vollbracht werden kann, ohne daß es zusammenhängt mit der unmittelbaren Nützlichkeit, - das ist etwas, was zu den Gemütseigenschaften des Österreichers gehört.
Ich möchte sagen, auf der einen Seite, diesseits der Leitha, hat man in den österreichischen Bergen, den österreichischen Gegenden etwas, was sich im Bilde darstellen läßt, wie ich es versuchte bei Joseph Misson. - Kommt man über die Leitha hinüber, jenseits hat man unmittelbar den Zusammenhang mit der weiten Natur in den ungarischen Heiden; aber man hat auch ein Zusammenleben mit dem, was im Sinnlichen, ich möchte sagen, geistig tönt, was das Sinnliche geistig so auszuschöpfen versucht, wie es sich nur ausschöpfen läßt. Derjenige, der selber einmal nach Ungarn hinübergekommen ist, eine ungarische Musikbande sich angehört hat mit alledem, was diese Leute von ihrer Seele hineinlegen in ihr so einfaches und so wunderbares Spiel,
in dem dämonisch rast der Schmerz, dämonisch rast die Lust und das Ausgelassensein des Lebens zugleich, der versteht ein Gedicht wie das des Ungarn Sza'sz, das sich bezieht auf dieses unmittelbare Zusammenleben mit dem Sinnen-fälligen, das aber geistig, tief geistig und seelisch empfunden wird:
Hör', o hör' der Geige Singen!
Wie sie klagt und wie sie weint;
In vier Saiten so viel Trauer,
So viel Schmerz und Gram vereint!
Wie der Nachtigallen Flöten
In dem stillen schatt'gen Wald,
Wie an Mutters Grab das Schluchzen
Der verlass'nen Waise schallt.
Hör', o hör' der Geige Klingen,
Acht' auf ihrer Saiten Sang,
Wie's auf ihnen wogt und braust
Beim Rákóczi-Sturmesklang -
Das ist Klage, das ist Trauer,
Die bedrückt und doch erhebt,
Die das Einst beweint, doch hoffend
Einer schönen Zukunft lebt.
Horch, ein Fluch ertönt - und Schwerter
Mischen klirrend sich darein -
Schlachtgetös' - und alles, alles
Nur ein Fiedelbogen klein.
Hör', o hör' der Geige Tönen,
Wie sie spornt und lacht und weint,
In vier Saiten solch' Empfinden,
So viel Lust und Schmerz vereint! -
Man muß schon hinschauen, um die einschlägigen Dinge zu verstehen, man muß schon hinschauen auf das innige Verwobensein der Sinne mit der Außenwelt, so daß die Sinne in ihrem Verwobensein mit der Außenwelt innerhalb des Sinnlichen das Geistige leichter erschauen, als wenn dieses Geistige intellektuell im Geiste aufwacht. Man kann sagen: Wenn es sich darum handelt, unmittelbar aus dem Herzen heraus ein Urteil zu fällen, Kritik oder Zustimmung zur Welt zu üben, so wird sich der Österreicher unter Umständen etwas zutrauen. Er wird sich auch, namentlich wenn er etwas gelernt hat, gerne in abstrakten Begriffen bewegen, er wird gerne etwas auf die Kultur des Kopfes geben, vor allen Dingen aber festgewurzelt sein wollen in der Kultur des Herzens. Aber der Weg vom Kopf zum Herzen, der Weg vom Herzen zum Kopfe, der ist halt gar so lang, und der ist gar so schwierig zu finden! Da bleibt man oftmals im Mittelpunkte leicht stehen!
Es ist im gewissen Sinne doch recht charakteristisch, was zum Beispiel ein guter Kenner des Österreichertums, ein Zeitgenosse, über eine österreichische Persönlichkeit, den einstigen Wiener Burgtheater-Direktor Max Burckhard, sagte: daß nämlich bei diesem urösterreichischen Mann, Max Burckhard, trotz all seiner Energie das gerade das Charakteristische war, daß er sich niemals so recht dem Übergang vom Gefühl zum Verstand oder vom Verstand wiederum zum Gefühl unterziehen wollte. Beide wollte er so getrennt walten lassen. Während Max Burckhard Wiener Burgtheater-Direktor war, so erzählt Hermann Bahr, und im Burgtheater das von sehr vielen Leuten als besonders bedeutend angesehene Stück Wilbrands «Der Meister von Palmyra» aufgeführt werden sollte, das ja für viele etwas ungeheuer Hochgeistiges ist, da wollte Burckhard nicht heran, das Stück aufzuführen. Er konnte nicht verstehen,
warum man etwas so Bedeutendes darinnen sehe; er hat es immer abgelehnt. Da haben es wohlmeinende, das heißt, Wilbrand und dem «Meister von Palmyra» wohlmeinende Leute zustande gebracht, daß sich Burckhard wenigstens eingelassen hat darauf, in einer wirklich hohen Gesellschaft einer Vorlesung des «Meister von Palmyra» beizuwohnen. Er kannte das Stück selbstverständlich, aber es sollte ihm nicht vorgelesen werden, sondern es sollten alle die schönen, ästhetischen Stellen, die Abhandlungen auf ihn wirken, die die dazu eingeladenen wirklichen Professoren und Ä sthetiker über das Meisterhafte dieses Stückes vorzubringen hatten. Nun, Burckhard war wirklich ein recht gescheiter Mann, der, wenn es darauf ankam, dialektisch seinen Mann stellte und in die geistigen Ideen hineinkonnte. Er hörte sich das Stück an. Er hörte nicht nur die Vorträge der Ästhetiker und Professoren an, «wie aus den Tiefen der Menschnatur heraus hier etwas geschöpft sei, das in die höchsten Regionen des geistigen Lebens hineinweise». Er hörte auch, wie nach allen Kapiteln der Ästhetik die schönen Charakteristiken aufzufassen sind. Er schwieg. Er ließ sich nicht ein darauf, irgendwie diese Gedankengänge mitzumachen. Er konnte sie selbstverständlich begreifen. Ein Leichtes wäre es ihm geworden, die Sache zu widerlegen von seinem Standpunkte aus, sich einzulassen darauf. Bei einer anderen Gelegenheit würde er das vielleicht getan haben, sich einzulassen in weitschweifige Diskussionen über die Sache. Er blieb still, er sagte nichts. Da machten sich Damen, insbesondere die Frau des Hauses, an ihn heran:
ob er denn nicht wenigstens sagen wollte, wie er sich verhielte zu all den geistreichen Ausführungen über eines der geistreichsten Stücke, die jemals geschrieben worden seien. Es sei doch Pflicht des Burgtheaters, das weltepochemachende Stück aufzuführen. Er ließ sich aber nicht auf
eine Diskussion ein. Er sagte: «Ich führe es nicht auf!» Und warum? Warum? Man wollte von ihm jetzt hören, dem geistreichen Manne, wie er sich zu alle den stundenlang geistreich abgehandelten Dingen verhielte. Da sagte er bloß: «Weil's a Holler ist!» - «A Holler» ist etwas, was in Österreich dasselbe bedeutet, wie in Berlin «Quatsch». Aber auf eine Diskussion ließ er sich nicht ein. Das ist charakteristisch zu nehmen. Er verließ sich auf sein unmittelbares Herzensurteil, auf dasjenige, was ihm sein Gemüt sagte, und er fand es nicht notwendig, sich einzulassen in Erörterungen der Dialektik und so weiter; seine ganze Kritik war die, daß es ein «Holler» ist.
Und so ist es interessant zu sehen eigentlich, wie in der Zeit, in welcher innerhalb des übrigen Gebietes deutschen Volkswesens die wunderbarsten, die herrlichsten Diskussionen über die Bedeutung, die Natur und das Wesen des Dramas gepflogen wurden, Diskussionen, an denen sich beteiligt haben auch Goethe und Schiller in einer so tiefgründigen Weise - ich meine namentlich Ende des achtzehnten Jahrhunderts, Anfang des neunzehnten Jahrhunderts -, wie sich in dieser Zeit auch in Österreich eine Diskussion über Ästhetik, über die Bedeutung und das Wesen des Dramas entzündete. Aber woran entzündete sich dort in Österreich die Diskussion über das Drama? In einer sehr merkwürdigen Weise entzündete sich in Österreich all dasjenige, was dort für und gegen diese Art und Weise vorgebracht worden ist; was innerhalb des Schiller-Goethe-Kreises und der weiteren Kreise des ganzen deutschen Geisteslebens in einer so bekannten tiefgründigen Weise aus dem Unsinnlichen des Geistes heraus diskutiert worden ist, das alles entzündete sich wiederum in Österreich auf eine ganz eigentümliche Weise, nämlich am Tanz. Über zwei Arten des Tanzes kam man im Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts dort in eine ganz energische, bedeutsame Diskussion hinein. Da hatte gewirkt um die Wende des Jahrhunderts als Meister des Tanzes Noverre; und sein Schüler war dann Muzzarelli. Muzzarelli vertrat einen Tanz, eine Tanzart, bei der es hauptsächlich darauf ankam, schöne Bewegungen, künstliche Bewegungen zu machen, künstliche Bewegungen durch ihre Linien ineinander zu verschlingen, wo also das äußere Raumesbild des Sichdarbietens in Betracht gezogen wurde. Nun trat im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts ein Gegner dieser Tanzform, Salvatore Vigano, auf. Und für diese Tanzform des Salva-tore Vigano, dessen Frau namentlich in meisterhafter Weise die von ihm vertretene Tanzform tanzte, machte man, was für eine andere Tanzform nicht gilt, ganze Texte. Ganze Geschichten, ganze Erzählungen wurden umgekleidet in die Tanzform, so daß in den Situationen, in den Gebärden, in der Ausdrucksform, Geschehendes, zu erzählender Inhalt, zum Ausdruck gebracht wurde. Und nun soll man sich nur einmal vertiefen, was für weitgehende, die Leidenschaften aufwühlenden Diskussionen sich entsponnen haben darüber, welcher Tanz nun künstlerisch der richtige ist.
Da war der schon damals alt gewordene österreichische Dramatiker Ayrenhoff, der Verfasser einer großen Anzahl von Stücken, der ganz auf der Seite des Muzzarelli-Tanzes stand, der sich in der ablehnendsten Weise gegen Salvatore Vigano aussprach und gegen das Unmögliche, daß man in so unkeuscher Weise inneres Fühlen durch den Tanz zum Ausdruck brachte. Daß man sogar ganze Stücke, wie «Richard Löwenherz» oder wie «Die Tochter der Luft», her-tanzen wollte, konnte Ayrenhoff nicht begreifen. Ayren-hoff hatte eben - und das ist das Eigentümliche in dieser Zeit für das damalige Österreichertum - sich herangebildet in Anschauung der schönen Form, des Linienschwunges,
und auch seine Dramen waren nach dieser Art aufgebaut. Schwung der Linien in der Darstellung der Charaktere, darauf sehen, wie sich auflöst irgendeine Situation in einen Witz, oder das Übergehen einer Situation in einen Witz, darauf kam es an. Auf diese außerordentlichen Formen kam es an. Das sah er nun auch in dem Tanze des Muzzarelli. Und er war ein für die damalige Zeit für Österreich bedeutender Dichter. Seine Bedeutung kann schon daraus hervorgehen, daß er von Friedrich dem Großen, der sich sOnst auf die damalige deutsche Literatur nicht einließ, außerordentlich anerkannt wurde. Und «Die Postkutsche», ein Lustspiel von Ayrenhoff, nannte Friedrich der Große «das beste Lustspiel, das überhaupt geschrieben ist außer den Lustspielen des Moliére». Ja, Friedrich der Große ging so weit, daß er sich einmal bei einer Parade den Feldmarschall-Leutnant - denn das war Ayrenhoff und zugleich Dichter - zeigen ließ, weil er, Friedrich der Große, sich so für ihn interessierte.
Auf der anderen Seite, auf der Seite Viganos, stand nun Heinrich lose ph von Collin> der aus Belgien stammte; aber Belgien gehörte ja damals in gewissem Sinne zu Österreich. Er hat das Trauerspiel «Regulus» geschrieben, aber auch noch andere Stücke. Collin trat nun mit aller Begeisterung für den Ausdruck im Tanze ein. Und er richtete seine Dramen nun wiederum so ein, daß sie Innerliches in dem, was dargestellt wurde, zum Ausdruck brachten; daß es nicht so sehr ankam auf die Art und Weise, wie sich Situationen und Witze ablösten, auf die äußeren Formen, sondern darauf, daß das Innere der Menschennatur sich aussprach in dem, was über die Bühne ging. Und gerade Robert Zimmermann, der tief eingewurzelt ist im österreichischen Geistesleben, hat sehr schön von diesem Heinrich Collin gesprochen, indem er gezeigt hat, daß dieser Heinrich Collin,
der im Grunde ja auch in Österreich ganz vergessen ist, der uns aber tief hineinführen kann in den Gang des österreichischen Geisteslebens, der nichts gewußt hatte von Fichte, in seinen Dramen dieselbe Art der Seelengesinnung hat aufleben lassen, die in Fichtes philosophischen Darstellungen lag. Zum Überfluß hat noch der Bruder Heinrich Collins, Matthäus von Gallin, ausdrücklich gezeigt, wie Heinrich Collin nichts gewußt hat von Fichte, wie er ganz und gar aus einem merkwürdigen Parallelismus des geistigen Lebens heraus in seiner österreichischen Art zu einem Fichteanismus, aber dichterisch, gekommen ist, auf die Art, wie ich es eben beschrieben habe.
Ohne auf die Anschauung zu reflektieren, ohne in der Anschauung aufzugehen, kommt also Fichte wiederum zu dem, was ich vor acht Tagen dargestellt habe. Er sagt: Die äußere Sinneswelt, dasjenige, was der Mensch in dem sinnlichen, äußeren Dasein auslebt, ist das versinnlichte Material unserer Pflicht. - Indem ihm nun die Pflicht so tief gegenständlich gegenübertrat und zu gleicher Zeit mit dem die Welt durchziehenden göttlichen Weben und Wesen verwandt wird, kommt Fichte dazu zu sagen: Man darf nicht etwa in der Weise denken, daß das äußere sinnliche Glück dem zuteil werden könnte, der treu seine Pflicht erfüllt, sondern - wenn das auch in einer gewissen Weise etwas einseitig ist, in der Art und Weise, wie es dargestellt wird, drückt sich die Energie eines gewissen Strebens des deutschen Idealismus darin aus; die Dinge dürfen nicht dogmatisch genommen werden -, sondern was Fichte sagt, ist:
Derjenige, der ganz in seiner Pflicht aufgeht, darf auch gar keinen Anspruch darauf machen, daß sich dafür in der äußeren Sinneswelt irgendwie der Lohn findet. Daher wird das wahrhaft Tragische - das war Fichtes Überzeugung -dann erscheinen, wenn die Pflicht nicht irgendeinen Lohn
findet, sondern gerade Unglück findet in der äußeren Sinneswelt.
Denselben Zug stellt Heinrich Collin in seinen Dramen dar. Er will die auf sich gebaute Menschenseele, die in sich leben kann, ohne daß sie das Glück der Sinnenwelt mit der Pflicht zusammenbringt, dramatisch verkörpern. Und so entsteht ein tief ethischer Zug, der aber wiederum innig zusammenhängt mit dem unmittelbaren Anschauen der Welt, wie sie sich darbietet vor den Sinnen; der sogar heraus entstanden ist aus einer Ästhetik, die sich am Tanze ausgebildet hat.
Dieses Zusammengewachsensein mit der Anschauung, dieses Leben in der unmittelbaren Empfindung und auch das Hineinstellen desjenigen, was das Herz erlebt in der unmittelbaren Empfindung, das Abgeneigtsein, den Weg zu suchen vom Kopf zum Herzen, das muß man als eine der Charakteristiken ansehen, die wirklich tief verbunden sind mit diesem österreichischen Geistesleben. Und so erscheint uns gar manches in diesem österreichischen Geistesleben so, daß Gegensätze in ihm vorhanden sind, aber Gegensätze, die, wenn man sie in der richtigen Weise auf sich wirken läßt, begreiflich erscheinen bei Menschen, die innerhalb Europas in schwierige Aufgaben, in die Vermittlung des Westens mit dem Osten, hineingestellt sind und, ich möchte sagen, in jeder Kleinigkeit der Lebensführung empfinden müssen dieses Hineingestelltsein.
Man kann sagen: Wo wir anfassen dieses österreichische Geistesleben, da erscheint es uns so: Unmittelbar wird angefacht an der Außenwelt das Allerinnerste, ohne Vermittelung einer mystischen Dialektik. Und aus diesem Untergrund heraus ist eine so sympathische Erscheinung zu erklären - wie gesagt, ich will nur Bilder hinstellen -, wie der österreichische Philosoph Bartholomäus von Carneri.
1821 ist er geboren in Trient, der Sohn eines österreichischen Staatsbeamten; von Geburt aus - er war ein Zwillingskind - verkrüppelt, lebt er sich schon durch eine schwere, leidvolle Jugend hindurch, lernt dann, nachdem er sich hineingelebt hat in die ganze Vielgestaltigkeit des österreichischen Geisteslebens, den Darwinismus kennen. Der Darwinismus wird für Carneri nicht etwas, was er einfach annimmt, sondern der Darwinismus wird für ihn etwas, was ein Lebensrätsel selber wird. Daß die Welt im Sinne des Darwinismus sich durch die äußerlich anschau-bare Entwickelung erklären lassen soll, ist ihm begreiflich, trotzdem er sich tief in den deutschen Idealismus eingelassen hat. Aber in einer gewissen Beziehung wird der Darwinismus für Carneri, den österreichischen Philosophen, ein Lebensrätsel: Wie verhält es sich mit des Menschen Sittlichkeit, des Menschen Ethik, wenn der Darwinismus richtig ist? Und so wird Bartholomäus von Carneri, man kann sagen, der größte Ethiker, der größte Sittenlehrer des Darwinismus. Er deutet den Darwinismus so, daß er suchte innerhalb der rein natürlichen Entwickelung, wie sich die Naturkräfte bis zum Menschen herauf komplizieren, so daß er in dieser Komplikation der Naturkräfte, so wie sie sich konfigurieren, noch eine Vergeistigung sieht. Er will keinen Riß zwischen Natur und Geist, aber er will nicht bei der Natur stehen bleiben. Er will in der Konfiguration der Naturkräfte den Geist aus sich selber herausjagen. Gleichsam will er das Angebundensein der menschlichen Ethik, des menschlichen sittlichen Lebens an die im Sinne des Darwinismus gehaltene Naturerklärung finden. So entsteht für Carneri unmittelbar aus der ihm durch den Darwinismus anschaulich erscheinenden Welt die Notwendigkeit, eine Ethik zu schaffen, ich möchte sagen, das, was das menschliche Herz sich vorsetzen will und muß, unmittelbar anzuschließen
an die Geheimnisse, an die Rätsel der Natur. Und interessant ist es gerade an Bartholomäus von Carneri zu sehen, wie er nun nach einer einheitlichen Weltanschauung strebt, nach einer Weltanschauung, die durchaus im Geiste der Zeit, im Geiste des Materialismus des neunzehnten Jahrhunderts, den Darwinismus gelten läßt, aber ihn nur gelten lassen kann, wenn in der Natur selber überall Geistigkeit sprossen und sprießen kann, aber eine solche Geistigkeit, die unmittelbar im Gefühl erfaßt wird, die nicht erst heruntergeholt wird wie bei Fichte aus irgendwelchen übersinnlichen Sphären, sondern die ihm unmittelbar während des Durchlebens der Sinnlichkeit erscheint. Es ist merkwürdig, wie aus einer solchen Persönlichkeit gerade das Charakteristische des Österreichertums erscheint, aus einer Persönlichkeit wie Carneri, der nun aber auch in anderer Weise sich einheitlich in die Welt hineinstellen will, der überall darauf ausgeht, zu zeigen, wie auf der einen Seite die Natur bis zum Geiste hinaufkommt, auf der anderen Seite der Geist bis zur Natur hinunterwirkt, wie eine Einheit in allem lebt. Dieser Carneri sucht auch im Leben diese Einheit darzustellen. Er suchte sie in das Leben hineinzubringen. Und so entsteht denn eine von den Persönlichkeiten, die insbesondere in den sechziger, den siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts in Österreich als feine Charakterköpfe auftraten, eine von den Persönlichkeiten, die dann auch politisch tätig waren. Carneri stand an der Seite der durchgeistigten österreichischen Politiker der siebziger Jahre, Plener, Beer, Herbst> Berger und so weiter. Aber überall wo er sprach - und er nahm oft das Wort -, durchtönte seine Rede etwas von einem hohen Idealismus, aber eben von einem solchen Idealismus, der im Darwinismus wurzelte, der sich durch sein Wurzeln im Darwinismus bewußt war: Ich darf Idealist sein, denn
meine Ideale kommen mir unmittelbar in den Sinn, wenn ich mich so recht in die Entwickelung der Natur hineinvertiefe.
Es ist derselbe Geist, auf einem anderen Gebiete, der dann wiederum in Robert Hamerling gewaltet hat. In Robert Hamerling, in dem sich, ich möchte sagen, der österreichische Deutsche schon dadurch zum Ausdruck brachte, daß etwa wie eine Art Wahlspruch Hamerlings war: «Österreich ist mein Vaterland, Deutschland ist mein Mutter-land», der zusammenfaßte ein gutes Österreichertum mit einem guten Deutschsein. In diesem Hamerling kam ja alles, was Durchdringen des Idealismus mit unmittelbarem Fühlen und mit Anschauung genannt werden kann, unmittelbar zum Ausdruck. Man hat oftmals ja auch innerhalb Österreichs, wo man es hätte besser verstehen können, abgeurteilt über Hamerlings anschaulich sinnliche Bilder, ich möchte sagen, sinnlich durchtränkte Bilder, zum Beispiel in seinem «Ahasver», auch in der «Aspasia» und im «König von Sion». Aber man hatte dabei nicht begriffen, daß gerade der Idealismus, dieser, ich möchte sagen, bei Hamerling österreichische Idealismus das Sinnesbild brauchte, um sich darin anschaulich zu machen, um nicht zu kranken an der Spaltung der Welt in das Sinnliche auf der einen Seite und in das Geistige auf der anderen Seite. Und so wurde für Hamerling geradezu das durchgeistigte Sinnliche, der ästhetische Idealismus dasjenige, wonach er als einem Zukunftsbild hinordnete sein ganzes Fühlen, sein ganzes Empfinden und sein ganzes Denken. Und in vielem tritt gerade bei solchen Geistern, wie Carneri und Hamerling, das Schwierige des österreichischen Geisteslebens zutage, das eben darin besteht, daß man in ein vielgestaltiges Menschengewoge hineingestellt ist und sich zurechtzufinden hat. Daher die Erscheinungen, die so oftmals auftreten innerhalb
des österreichischen Geisteslebens, wo klare Anschauung über dieses oder jenes stehen bleibt bei der bloßen Schilderung und nicht den Übergang findet irgendwie zu der Tat und dann ausläuft in einem gewissen Pessimismus. Daher sind gewisse Erscheinungen allein im Geistesleben Österreichs möglich.
Ist es nicht eigentlich etwas doch sehr Eigentümliches, daß es einen Österreicher gibt in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, der in der Nähe von Znaim geboren ist und der den urösterreichischen Namen Karl Postl trägt, der auch Geistlicher auf den Wunsch seiner Mutter wurde, dann aber ebenfalls wie der Barnabitermönch Karl Leonhard Reinhold das Ordenskleid abstreift und verschwindet. Er ist verschwunden. Dann erscheint ein Buch: «Austria as it is» - «Österreich wie es ist», von Amerika herüber; es schildert österreichische Anschauungen. 1828 war das. Dann erscheinen von diesem selben Karl Postl, der sich aber nicht Karl Postl, sondern Charles Sealsfield nannte, zum Beispiel Darstellungen des untergehenden Indianertums, aus denen man sieht, wie grundgesund die unmittelbare Naturanschauung dieses Mannes ist. Kein Mensch hatte dazumal eine Ahnung, daß sich in diesem Charles Sealsfield der einfache Karl Postl aus Österreich verbirgt. Alle die Geschichten, die sonst über ähnliche Gegenstände erscheinen - man überzeuge sich nur davon -, sind sozusagen vom Stand-punkte einer gewissen Bildung aus geschrieben, in einer gewissen Art geschrieben, daß man die Theorie merkt. Diese Postl-Geschichten sind so geschrieben, daß das Auge unmittelbar hineinwächst in das, was es sieht; zusammen-wächst die ganze Seele mit der unmittelbaren Anschauung. Dann verlebt er seine Lebenszeit vom dreißigsten Jahre an bis in die sechziger Jahre im Kanton Solothurn in der Schweiz, wo er auch begraben ist. Er kommt wieder zurück
und schildert wirklich in einer anschaulichen Weise auch das Leben der Deutschen in Amerika, so daß es heute noch als bedeutsam auf die Seele wirken müßte, wenn man es nur läse.
Eine spezifisch österreichische Erscheinung ist auch eine Persönlichkeit, von der ja nicht mehr die jüngeren, aber vielleicht die älteren der hier versammelten Zuhörer noch kennengelernt haben diejenigen Bücher, die geschrieben sind zunächst, wie auf dem Titel so züchtig steht, «für Jungfrauen»; «Weihgeschenk für Jungfrauen» steht da. Eine Geschichte, eine wunderbar anschauliche Geschichte, von Goetheschem, man könnte fast sagen, von griechischem Geiste durchtränkt. Auf dem Titel steht: «Weihgeschenk für Jungfrauen» von Christian Oeser, «Briefe über die Hauptgegenstände der Ästhetik». In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in der ersten Auflage erschienen, erlebten diese Bücher viele Auflagen. Derjenige, der sie heute noch liest, bekommt in ihnen immer noch etwas, was das Herz weiten kann, was die Seele durchwärmen kann. Christian Oeser - ja, wer ist Christian Oeser? Dieser Christian Oeser ist derselbe Mann, der zum Beispiel 1839 in Preßburg ein Drama erscheinen ließ - von dem kein Mensch wußte, wer der Verfasser war -, «Leben und Taten des Emerich Tököly» «von A. Z.», das heißt also von A bis Z, so daß zwischen A bis Z alle Buchstaben dazwischen sind. Diejenigen, die etwas verstanden von dramatischer Charakteristik, sahen in der Figur des Tököly einen ungarischen Götz. Es ist eine unmittelbar mit dem Goetheschen «Götz von Berlichingen» zu vergleichende Darstellung, die herausgeboren ist aus den Kämpfen, die sich, eigentlich kurz bevor das Drama entstanden ist, in Ungarn abgespielt haben, und viele, viele Seelen ergriffen haben, die Welt bewegt haben. Das Drama, es ging in die Welt hinaus, und
noch mehrere von demselben Verfasser. Man wußte nicht, von wem es ist. Das blieb so. Im Jahre 1869 faßte die deutsche Schiller-Stiftung einen Beschluß, das damalige Unterstützungsgehalt auszuzahlen an eine Frau Therese Schröer in Wien. In der Urkunde, mit der das Gehalt ausbezahlt wurde, stand, man habe erfahren, daß die Witwe eines der würdigsten deutschen Schriftsteller nicht in ihr angemessenen, und dessen Verdiensten angemessenen Verhältnissen lebe, und daß man ihr daher dieses Jahresgehalt auszahle. Es war die Witwe von Tobias Gottlried Schröer, des Verfassers vieler Dramen, die ungenannt bleiben mußten, des Verfassers auch jenes «Weihgeschenkes für Jungfrauen», das von Goetheschem Geiste durchtränkt ist; eines stillen Mannes, der Realschul-Professor in Preßburg war, der aber als solcher mit den höchsten Problemen des Menschenlebens rang, der arm war und den niemand kannte. Selbst in seiner eigenen Stadt konnte und durfte niemand etwas wissen davon, daß dieser Mann der Verfasser dieser Dramen sei.
Ähnliche Erscheinungen wären viele anzuführen. Sie zeigen, wie man, um österreichisches Geistesleben kennenzulernen, nicht dasjenige ins Auge fassen muß, was, ich will sagen, als eine mehr oder weniger katholische, als eine mehr oder weniger protestantische Strömung durch die Entwickelung der Zeiten geht, sondern wie man dieses österreichische Geistesleben anfassen muß da, wo es elementar aus der Wurzel des Volkstums heraus wirkt und da, wo es, so wirkend aus der Wurzel des Volkstums heraus, unmittelbar in seiner großen Bedeutung erscheinen kann. Man darf das österreichische Geistesleben nicht durch die Brille ansehen, daß Österreich ein mehr katholisches Land ist. Dieses österreichische Geistesleben arbeitet sich auf der einen Seite zur Wurzel des Volkstums durch, wie man es bei Misson gesehen hat; auf der anderen Seite arbeitet es sich aber wiederum
in einer merkwürdigen Weise zu Höhen hinauf. Man bedenke zum Beispiel die folgenden Erscheinungen:
Als der protestantische Pädagoge Friedrich Dittes, der in der sogenannten Liberalen Ära der österreichischen Entwickelung aus Deutschland geholt und an die Spitze des K. K. Wiener Pädagogiums gestellt wurde, sich nach bedeutenden Pädagogen der unmittelbaren Vergangenheit umsah, da fand er, der protestantische Pädagoge, der aus Deutschland geholt worden war, als einen der allerbedeutendsten Pädagogen der unmittelbaren Vergangenheit den Österreicher Vincenz Eduard Milde. 1811 ist eine «Erziehungslehre» von Milde erschienen. Wir haben in Misson einen Geist kennengelernt, der im Ordenskleide sich hinaufarbeitete zu dem, was, ich möchte sagen, die Handhabung des Bildungslebens ist, der dann sich wiederum hinunterarbeitete zur Wurzel des Volkstums, und seinen «Naaz» schuf: Bauernphilosophie! In Milde sehen wir einen anderen Priester, einen guten Katholiken; einen Katholiken, in dem Friedrich Dittes, der protestantische Pädagoge, einen der bedeutendsten pädagogischen Vorgänger findet. Über den Unterschied der Konfessionen hinüber reicht sich das geistige Leben in einer wunderbaren Weise die Hand. Ich möchte statt einer langen weiteren Beschreibung Ihnen nur eine Stelle aus Mildes Erziehungslehre vorlesen, damit Sie sehen, wie in diesem 1811 erschienenen Buche in einer seelendurchtränkten Weise das pädagogische Wirken aufgefaßt wird; wie hier im Gegensatze zu Misson, der sich hinunterarbeitete in das Volkstum, zu den höchsten Anschauungen, den idealsten Anschauungen allgemein menschlichen Wirkens durch die Pädagogik der katholische Priester Milde sich hinaufarbeitet, wie ernst, wie würdig, wie ungeheuer tief er den pädagogischen Beruf nimmt. So beschreibt er, wie der Lehrer sich verhalten solle, damit er
das richtige Verhältnis gewinne zu dem Zögling; zunächst:
«1. Durch fleißiges Studium der Anthropologie; 2. durch Lektüre richtig gezeichneter Biographien, mit Wahrheit geschilderten Erziehungsgeschichten; 3. durch den bedächtigen Umgang mit Kindern, durch unbemerktes ruhiges Beobachten derselben, besonders ihres Verhaltens gegen andere Kinder; 4. durch Zurückerinnern an seine eigenen Jugend-jahre, durch Nachdenken über den Gang, die Veranlassung, die Mittel und Hindernisse seiner eigenen Bildung, über den Unterschied zwischen seiner gegenwärtigen und ehemaligen Art, zu denken und zu empfinden; 5. durch Nachdenken über das Gelingen und Mißlingen seiner Bemühungen für die Bildung des Zöglings; 6. durch Beobachtung des Verfahrens anderer Erzieher und des Erfolges ihrer Art, die Kinder zu behandeln»; - endlich - «7. durch Bemerkung des Ganges der Entwickelung der sich selbst überlassenen Natur. »
Auf einer gesunden Anthropologie, das heißt Menschen-kunde, sollten aufgebaut werden die Sinne des Lebens. Dann sollte der Lehrer unablässig mit sich zu Rate gehen, gleichsam meditierend, um immer den Weg zu finden zu den kindlichen Seelen. Eine wirklich seelendurchtränkte Erziehungsanschauung gießt sich auch über dieses ganz bemerkenswerte Werk aus, das sozusagen in der Stille des österreichischen Geisteslebens entstanden ist durch einen Mann, der im äußeren Leben Geistlicher war, der es bis zum Erzbischof von Wien gebracht hat und der in seiner Weise wirklich dasjenige österreichische Geistesleben repräsentiert, auf das man so großen Wert legen und dem man so große Bedeutung beilegen muß; jenes österreichische Geistesleben, das auf das Allgemein-Menschliche hingeht und im Grunde überall den Zusammenhang doch mit den Wurzeln des Volkstums wahrt. Ja, 1811, sage ich, erscheint
in diesem Österreich ein tonangebendes Werk über Erziehungslehre, das viel gewirkt hat, das auch noch in den sechziger, siebziger Jahren eben von dem protestantischen Pädagogen Dittes wirklich außerordentlich gerühmt worden ist, das noch vor ganz kurzer Zeit von dem österreichischen Pädagogen Franz Tomberger in einem kurzen Abriß herausgegeben worden ist. Man muß nur bedenken, was das bedeutet. 1811 war erst eine kurze Zeit verflossen, seit in sehr, sehr weiten Gegenden der österreichischen Lande, namentlich der deutsch-österreichischen Lande, der Lehrer in einer sehr merkwürdigen Stellung war, nicht nur im Dorfe, sondern auch in der Stadt. Nicht nur, daß der Lehrer etwa kein Schulhaus hatte - ein Schulhaus war in weiten Gegenden, kurz bevor diese «Erziehungslehre» erschienen ist, eine Seltenheit; um den Lehrer gruppierten sich die Schüler, der Lehrer ging von Haus zu Haus, einmal war er da, ein andermal im nächsten Haus; wo gerade Platz war, da gab er Schule. Aber das war nicht das einzige. Zum Beispiel ein Gehalt dem Lehrer zu bezahlen, ja, das hätte man nicht verstehen können; das ist doch etwas, was frei gegeben werden muß! Aber der Lehrer brauchte auch ja nur im Winter die Schüler zu unterrichten; im Sommer brauchte man die Kinder ja ohnedies draußen auf dem Felde. Nun, damit er nicht eben Hungers stirbt, so spricht man ihm das Recht zu, während des Sommers die Kühe zu hüten, ein «Holdar» zu sein. Aber das hinderte nicht, daß all das entstand, was ich eben geschildert habe. Und das hinderte nicht, daß nach verhältnismäßig so kurzer Zeit aus dem österreichischen Geistesleben heraus ein nicht nur so muster-gültiges, sondern epochemachendes Werk über Erziehungskunst erschien. Man muß sich bekannt machen mit diesem Nebeneinanderstehen der Gegensätze, die aus der Schwierigkeit des österreichischen Lebens entspringen.
Damit aber hängt es zusammen, daß der Österreicher auch dasjenige braucht, was in den verschiedensten Formen im Wienertum im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts auftrat. Eigentlich ist ein Stück Wienertum auch dasjenige, was Sie ja hier in Berlin vor einiger Zeit kennenlernen konnten, obwohl es bis zu einem gewissen Grade recht «entwienert» worden war, wie Kenner allgemein zugaben, - was Sie kennenlernen konnten durch die Aufführung des «Alpen-könig und Menschenfeind» von Ferdinand Raimund, mit der Gestalt des Rappenkopf, und, was ja auch bekannt ist von dem gleichen Verfasser, des «Verschwender». Ich will nicht von einer allgemein bekannten Sache sprechen, sondern ich will mehr zeigen, wie das österreichische Geistesleben da und dort gleichsam durch das Aufspritzen einer Woge veranschaulicht werden kann, die im Bilde sichtbar macht, was in Österreich lebt. Deshalb will ich weniger von Ferdinand Raimund sprechen, als von dem, der ihn dann im Herzen der Wiener, in das sich Raimund recht sehr eingelebt hatte, in den dreißiger, vierziger Jahren ablöste:
Nestroy. Und Johann Nestroy ist als ein Volksdramatiker, ich möchte sagen, so recht eine österreichische Frucht. Zwar hat man sogar hören müssen von manchen gescheiten Leuten der Gegenwart, Nestroy werde sogar von seinen Landesgenossen so charakterisiert, daß er kein richtiger Wiener sei, weil er namentlich in der ersten Zeit seines Wirkens den Wienern nur derbe Wahrheiten gesagt habe, nicht Volksstücke nur geschaffen habe, wo die biederen Leute immer recht haben, sondern wo er so recht den Leuten, verzeihen Sie den harten Ausdruck, den Kopf waschen konnte. Solche Stücke bildeten den Inhalt seiner ersten theatralischen Laufbahn. Er hat eigentlich in großer Fülle geschaffen; in dreizehn Jahren sind an die siebzig solcher Possen entstanden. Aber sie enthalten wirklich jenes Österreichertum,
von dem der, der es kennt, eben weiß, wie es in Nestroy wirklich verkörpert war. Denn es ist gar nicht richtig, wenn man glauben wollte, der Österreicher habe dazumal vom Theater herunter hören wollen biedere Darstellungen von Charakteren, von solchen Leuten, die Recht geben der Einfachheit des Lebens. Nein, das war dazumal -und Nestroy wuchs aus dem heraus -, was man verlangte, daß man sagen konnte: Nun, der hat es ihnen aber heute wieder einmal gegeben, das heißt, er hat ihnen so recht den Kopf gewaschen. Und mit solcher Kopfwäscherei unterhielt eigentlich Nestroy, selbst spielend am Wiener Karl-Theater, die Wiener wirklich so, daß man sagen kann: Man sieht in dem Geiste, der in diesen Nestroyschen Volkspossen, man möchte sagen, Volks-Stadtpossen lebt, walten jenen österreichischen Geist, der es nötig hat, sich sowohl in der Kritik des Lebens wie auch im Scherze über das Leben, im Humor des Lebens, hinwegzusetzen über manche Schwierigkeit; der es da brauchte, nach harter Arbeit in einer leichten und doch wiederum nicht so ganz von Sympathie und Antipathie freien Weise in der Seele sich es wohlergehen zu lassen. Und so ist Nestroy wirklich eine typische Figur des österreichischen Stadtvolkstheaters so um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Seine Lebensauffassung, seine Auffassung der Lebensereignisse ließ er durch eine Person einmal etwa in der folgenden Weise aussprechen: Ich glaube von jedem Menschen das Schlechteste, selbst von mir, und ich habe mich noch selten getäuscht! - Mit dieser Lebensauffassung schuf er, der persönlich gütige, lieb reiche Mensch, der im persönlichen Umgang eigentlich nur liebe und gütige Worte hatte, wirklich Charakterfiguren, die in einer leichten Weise die Lebensauffassung des in Wien zusammengedrängten damaligen Österreichertums veranschaulichen, jenes Österreichertums, das hart bei der Arbeit sein
wollte, das aber aus dem Herzen heraus, ohne viel Dialektik, sich eine Lebensauffassung zimmern wollte, die auch Humor haben mußte, die auch den Ernst des Lebens nicht gar zu sehr übertreiben sollte. In der Art und Weise, sich zum Leben zu stellen, lag eben sehr viel. So schuf Nestroy eine Figur, die unter diesem Namen oder unter einem anderen Namen immer wieder auftauchte; einmal nannte er sie «Schnoferl». Und dieser Schnoferl hatte auch ein Verhältnis zum Leben. Da spricht er sich zum Beispiel einmal aus, wie es ihm im Leben mit der Liebe gegangen ist: «Mit der Liab gingat's prächti bei miar, s' war scho recht, ober mit der Geguliab steht's ollweil schlecht!» Dieser selbe Schnoferl, der das Leben, wie gesagt, nicht ohne Humor auffassen kann, sagt einmal über das, was er in seinem eigenen Herzen erblickt: «Die pragmatische Geschichte meines Herzens zerfällt in drei miserable Kapitel: zweck-lose Träumereien, abbrennte Versuche und wertlose Triumphe.» Das sind die drei miserablen Kapitel. Nestroy stellte solche Charaktere mit einer großen Schärfe dar, so daß ein bedeutender Wiener Kritiker einmal sagte: Man sah in Nestroy den dämonischen Ausdruck, der sich bis zum Teuflischen steigern konnte, wenn er seine Augen spielen ließ von der Bühne aus in das Publikum hinein. - Und so brachte Nestroy gut zum Ausdruck eine gewisse des Humors bedürftige Lebensauffassung des Österreichs in den Jahren vor 1848 oder sogar schon vom Anfang der vierziger Jahre.
Dann kam eine Zeit, wo man eine Weile nicht ertragen konnte dieses Ausgießen von Gut und Böse, dieses Nestroysche Jenseits von Gut und Böse, von guten und überguten und bösen Leuten. Da wollte man mehr biedere Gestalten haben, da wollte man mehr gerührt sein und weniger geschimpft sein. Man hatte einmal für eine Zeitlang das Schimpfen
satt, man wollte gerührt sein. Das paßte Nestroy nicht recht, und da sagte er: Ja, früher hat man noch etwas da-von gewußt, was ein Lebensbild ist; in neuer Zeit ist ein Lebensbild - wenn man nach denjenigen geht, die jetzt Lebensbilder für die Bühne entwerfen -, wenn drinnen nur drei G'spaß vorkommen - bei Nestroy lief ein Scherz dem anderen nach -, lauter Leichen in ihrem Blute, Totengräber und flennende Leute. Da wollte er nicht recht mit. Aber er konnte dann doch wiederum mitgehen mit der Zeit. Und so fand denn Nestroy einen eigentümlichen, ich möchte sagen, menschheitlich freien Standpunkt gerade über das schwierige Jahr 1848 hinüber. Er war ein freisinniger Mann, er war ein Mann, der durchaus auf Seiten der Fortschrittsmenschen stand, der sich auch nach keiner Richtung hin in irgendeine Abhängigkeit begab, aber er fand zu gleicher Zeit wiederum für manches Freiheitsgeschrei, für diejenigen, die bis zu einem gewissen Punkte nur gehen, wiederum die rechten Worte. Und so brachte er es denn zustande, daß er gerade in dieser schwierigen Zeit aufrecht erhielt den österreichischen Humor. Man sehe nur: In einem Stück, das gerade in einer der schwersten Zeiten Österreichs entstand, «Freiheit in Krähwinkel» - er hat selber auch in diesem Stück gespielt-, da schildert dieser Österreicher, wie der Bürgermeister von Krähwinkel sich die Freiheit vorstellt. Er läßt es aussprechen durch den Polizeidiener Klaus:
«Freiheit is gar was Schreckliches. Der Herr Bürgermeister sagt immer: Der Regent ist der Vater, der Untertan is a klein's Kind, und die Freiheit is a scharf's Messer.» Und einer derjenigen, der das ein bißchen in Nestroyscher Weise überschaut, der die Krähwinkler auch in ihrem Freiheitsstreben überschaut, der charakterisiert sie in derselben Form:
«Nein, i kenn die Krähwinkler, man muß sie nur austoben lassen; is der Raptus vorbei, dann werden's dasig - und wir
fangen s' mit der Hand -, da woll'n wir's hernach recht zwicken, das Volk.» In der Rolle, die Nestroy selber gespielt hat, der er den Namen «Ultra» gegeben hat, tritt nun ein Freiheitsheld auf, der nun wirklich so geschildert wird, daß sich noch einmal der Humor über ihn hermachen kann. Nestroy sprach das Folgende durch den Ultra. Nach-dem der Kampf, der sich entsponnen hatte, glücklich abgegangen ist, da verkündigt er die Freiheit: «Ich verkünde für Krähwinkel Rede-, Preß- und sonstige Freiheit. Gleich-gültigkeit aller Stände, offene Mündlichkeit, freie Wahlen nach vorhergegangener Stimmung, eine unendlich breite Basis, welche sich nach und nach auch in die Länge ziehen wird, und zur Vermeidung aller diesfälligen Streitigkeiten gar kein System.» Dann kommt Ultra - man muß sich ihn immer von Nestroy selber dargestellt denken - zu einer Anschauung über das, was die Reaktion eigentlich ist. Was ist Reaktion? «Also», sagt Ultra, «wie's im Großen war, so haben wir's hier im Kleinen gehabt. Die Reaktion ist ein Gespenst, aber Gespenster gibt es nur für die Furchtsamen: drum sich nicht fürchten davor, dann gibt's gar keine Reaktion.»
Aber in der Persönlichkeit des Nestroy selber liegt wiederum etwas wie ein durchaus richtiges Stellen seiner eigenen Persönlichkeit in das Leben hinein. Solch ein Mensch wie Nestroy war durchaus eine Persönlichkeit, die den Tiefen der Seele zugänglich war. Aber das, was er schuf, wollte er aus dem unmittelbaren Leben und für das unmittelbare Leben schaffen. Und so ist denn Nestroy durchaus nicht darauf gestimmt, etwa über das Ich Erwägungen anzustellen. Er kam einmal in einen gesellschaftlichen Zusammenhang mit dem tiefsinnigen, nicht genug hochzuschätzenden Dichter Friedrich Hebbel, dem großen Dichter Hebbel. Nun aber, Hebbel und Nestroy, das war wie Nord- und
Südpol selbstverständlich. Friedrich Hebbel, schon äußerlich tadellos im Anzug, korrekt in jeder Geste, Nestroy ungezogen in jeder Geste, mit einem bäuerischen Anzug, den er mit einer besonderen Würde zur Schau trug! Nun lernte Nestroy noch gar solche Dichtung wie «Judith und Holofernes» kennen, eine Dichtung, in der Hebbel tatsächlich unendliche Tiefen des menschlichen Seelenlebens ausgeschöpft und so in dramatischer Form verkörpert hat, daß man sagen muß: Es ist wirklich ein wunderbares, in menschliche Geisteshöhen gehendes Ringen mit den Lebensproblemen des Daseins, - aber für Nestroy deshalb nichts, möchte man sagen, weil es nicht gerade so leicht unmittelbar humoristisch genommen werden kann. Er nahm es aber doch humoristisch, eben zum Hohn, indem er sagte: No, das ist nichts! Er dachte auch ungefähr: Das ist ein Holler! Ich mache jetzt einen Holofernes, Judith und Holofernes, das muß das Richtige werden; das is doch nichts, was der Hebbel gemacht hat. - Nun aber wollte er in Holofernes eine Gestalt schaffen, die so ganz auf ihr Inneres, auf ihr menschliches Ich gewendet war. Da konnte dieser Nestroy auch so recht einen Menschen hinstellen, der ganz aus der Fülle des seelischen Willens heraus schuf und etwas wollte. Aber er wollte doch nur sozusagen auf echt österreichisch in dieses Ich hinein. Ja, nicht durch Spekulation, nicht durch Dialektik, auch nicht durch dramatische Dialektik! Also wie eine Gestalt des Holofernes hinstellen, die voller Ich-lichkeit, voller Kraft der Persönlichkeit ist, die so stark ist, daß sie schauen will, wer stärker ist, «Ich» - oder, wie er sagte - «I oder I !», so daß sie sich doppelt fühlt. Also will sie mit sich selber raufen, damit sie sieht, wer stärker ist, I oder 1. Das wird Nestroys Holofernes. Aber er weiß sich eben durchaus richtig hineinzustellen ins Leben. Und als er hört, daß man sagt: Er verleugne doch ein rein
künstlerisches Prinzip mit seinen unmittelbar aus dem Volkstum schaffenden Stücken, - ja, da sagte er, solch einen Vorwurf ließe er sich nicht machen, denn die Leute sollten doch bedenken, was das eigentlich heißt: Volksstücke schreiben. Wer Volksstücke schreibe und wolle sich gar mit dem Goethe vergleichen, der sei gerade so wie einer, der einen Zwetschgenkrampus macht, und sich als Nebenbuhler von Canova aufspielen wollte. Ein Zwetschgenkrampus ist eine Figur, wie man sie am Nikolaustage aus gedörrten Pflaumen als Kasperl oder Nikolaus zusammenfügt.
Man muß auch diese Seite des Österreichertums durchaus kennen. Denn sie ist tief, tief verwoben mit dem, was in der österreichischen Seele nach einer gewissen Lebensauffassung sucht, die ich etwa in der folgenden Weise charakterisieren möchte: Aus der Schwierigkeit seines Lebens heraus hat dieser Österreicher das Bedürfnis, auszuruhen in einer Anschauung des Lebens, die vergessen läßt den Ernst des Lebens und die doch wiederum in der unterbewußten Seele Kräfte bringt, um dem Leben gegenüber gewappnet zu sein. Gewiß, Nestroy ist tiefer als diejenigen, die ihn dann abgelöst haben am Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Man kann Nestroys Possen nicht etwa vergleichen mit denen von Berg, der ja gewiß in derselben Zeit mehr geschrieben hat, aber heruntergesunken war auf ein viel tieferes Niveau. Aber es gehört in die ganze Gestaltung der Seele dieses Österreichers hinein diese eigentümliche Lebensauffassung, die doch wiederum auf ein Allgemein-Menschliches hinausgeht. Und auch diese Lebensauffassung zeigt, daß in Österreich etwas aus viel tieferen Menschheitsquellen heraus kommt und das seelische Leben gestaltet, als all dasjenige, was gewöhnlich als Ideen gefaßt wird, die zusammenziehen die menschliche Entwickelung. Man darf sich den Österreicher nicht in dieses oder jenes Vorurteil
eingesponnen denken, sondern man muß, um ihn kennen zu lernen, das österreichische Volkstum ins Auge fassen.
Ich konnte es heute nur in einigen Bildern vor Ihre Seelen hinstellen; ich habe sie wahrhaftig nicht etwa ausgesucht auf das Ziel hin, den Österreicher liebenswürdig zu machen, sondern ihn einfach zu schildern, wie er ist. Ich wollte auch nichts Besonderes zusammenfassen, sondern ich wollte nur einzelne Züge zeigen, selbstverständlich ganz einzelne verlorene Züge, die aber doch dieses oder jenes anschaulich machen können, anschaulich machen können vor allen Dingen wie eine besondere Note, ein besonderer Ton, in diesem Österreichertum lebt, lebt über das Ganze dieser österreichischen Kultur hinweg, von solchen Gestalten, die ich Ihnen heute geschildert habe, bis hinüber etwa zu dem Madjaren Emmerich Mada'ch, jenem Manne, der die ja auch in weitem Kreise bekannte «Tragödie des Menschen» geschaffen hat. Aus einem leidvollen Leben heraus, wirklich wiederum aus einem leidvollen Leben heraus, hat sich dieser Madách erhoben zu einer in seinem Sinne gelegenen Ausgestaltung einer Lebensanschauung des Menschen. Er zeigt die Schöpfung des Menschen, Adam und Eva. Er zeigt, wie Adam und Eva in die Welt hereingestellt sind durch den göttlichen Schöpfer, diese Welt als ein Rätsel empfindend. Nun wird ihnen vorgeführt durch Luzifer, was da folgt. Adam wird gezeigt, wie er wiederum leben wird, wie er wiederkommen wird in der ägyptischen Zeit, wie er da leben wird als ein Ägypter, als ein Pharao; wie Eva seine Sklavin sein wird. Die Ägyptische Kultur mit alledem, was sie auslösen kann in der Seele des wieder-verkörperten Adam, wird von dem Dichter vorgeführt. Und weiter werden wir geführt in die römische Zeit; Adam wird wiedergeboren in der Zeit des römischen Kaisertums.
In die Zeit des Christentums hinein wiederum, in die Zeit der französisch-englischen Kultur, in die Zeit der deutschen Kultur; an das Ende der Erdenzeit wird er hingestellt in einer Verkörperung. Das ganze Menschenleben wird an ihm vorübergeführt.
Man sieht es ist vieles an Wegen vorhanden, die hinauf-führen aus demjenigen, was an Freude, an Leid, in der österreichischen Seele entstehen kann, hinauf bis in die Gipfel menschlicher Welt- und Lebensanschauungen. Und eine besondere Note ist es, so daß man sagen muß: Es entspricht gerade durch das Anschauen dieser besonderen Note, dieses besonderen Tones im österreichischen Volkstum auch schon einer inneren Notwendigkeit, daß zum Beispiel die Deutsch-Österreicher abgetrennt wurden eine Zeitlang von dem allgemeinen deutschen Geistesleben. Gerade durch diese Abtrennung haben sie ihr Innerstes recht entwickelt, haben sie dasjenige, was ihnen ureigentümlich ist, in der richtigen Weise herausgestellt. Durch solche Ab-trennung wird aber dasjenige, was die Völker verbindet, wahrhaftig nicht ertötet. Und dasjenige, was wir heute sehen, jenes Zusammenwirken der beiden mitteleuropäischen Reiche zu einem großen Gesamtbegriff Mitteleuropa, zu einem Gesamtwesen Mitteleuropa, das ist fest verankert sowohl in den Bewohnern des einen wie in den Bewohnern des anderen Reiches, wenn man gerade in die Tiefen des Seelenlebens hineinschaut. Das zeigt sich einem in den Tiefen des Volkstums, wie da, wo sich zum Beispiel der Wille Österreichs auslebt, wiederum auf den Höhen des österreichischen Wirkens gedacht wird. Als, wie es schien, im Jahre 1866 ein tiefer Spalt gerissen war zwischen Herzen, die doch innerlich gerade bei den besten Österreichern tief verbunden waren mit den Herzen des großen deutschen Reiches, da war auch auf der Höhe des Menschentums nach
diesem Jahre 1866 nicht eine Stimmung etwa aus dem Tone heraus, der nach Rache schreit. Da war nicht eine Stimmung, die an anderen Orten später war, nachdem ein Volk besiegt worden war, wo man sagte, man müsse immer und immer wiederum in der Seele den Rachegedanken lebendig machen. Nein, sondern es wurde eine Thronrede gehalten unmittelbar nach 1866 in Österreich, die enthielt die Worte: «Nicht der geheime Gedanke der Wiederver-geltung sei es, der unsere Schritte lenkt; eine edlere Genugtuung sei uns beschieden, wenn es uns gelingt durch das, was wir leisten und was wir schaffen, Ungunst und Feind-schaff in Achtung und Zuneigung zu verwandeln.»
So drückt sich auch in solchen Worten jenes Band aus, das heute zu so schöner Verwirklichung gekommen ist zwischen dem österreichischen Herzen und dem deutschen Herzen. Jenes Band, das ja in einer wirklich aus österreichischer Seele heraussprossenden Weise von Hamerling mit den schon erwähnten Worten ausgesprochen worden ist: Österreich ist mein Vaterland, in Deutschland aber empfinde ich mein Mutterland. - Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl lebte so, daß man das anschaulich machen kann durch einige Worte, die in Österreich entstanden sind. Merkwürdige Worte, vielleicht nicht in einer vollkommen befriedigenden Form, aber doch Worte, die vielleicht gerade in unserer Zeit vorgelesen werden dürfen. Ich werde erst nachher sagen, in welcher Zeit diese Worte geschrieben sind. Da heißt es in einem Gedicht «Österreich und
Deutschland»:
Laßt Rußland, England klüglich sich beraten,
Es auch vielleicht nicht unwillkommen finden,
Wenn wir ein wenig hier in Kampf geraten,
Wenn man uns will das gute Recht entwinden!
Ilir, deutsche Brüder, werdet hier nicht - raten,
Des Feindes Angriff wird uns nur verbinden
Und unter uns wird jeder Ehrgeiz schwinden
Vor dem: Ein Volk zu sein in Wort und Taten.
Und hat das Eine unter uns gefehlet,
War eine Zwietracht wo in deutschen Herzen,
Nur Eines ist es, was uns jetzt beseelet:
Was uns gemeinsam ist an Lust und Schmerzen!
So sei denn auch gemeinsam uns beschieden!
Ein deutscher Krieg, wenn nicht ein deutscher Frieden!
Es könnten Worte sein, die in unserer Zeit geschrieben worden sind. Sie sind aber geschrieben im April des Jahres 1859 von dem Sohne jenes Tobias Gottfried Schröer, von dem ich Ihnen gesprochen habe, von Karl Julius Schröer, der in Österreich, von Zisleithanien herüber, in Wien wirkte. Er wirkte in einer Art, von der man sagen kann, daß sie geeignet wiederum war, auf der einen Seite die Verbindung der Seele herzustellen mit dem, was im Volke lebt und webt, und auf der anderen Seite die Seelen hinauf-zutragen zu den Höhen des geistigen Lebens -, Karl Julius Schröer, der zuerst als Direktor der Wiener evangelischen Schulen, und dann als Professor für deutsche Literatur an der Technischen Hochschule eine segensreiche Tätigkeit entfaltet hat. Ich selber fühle mich - verzeihen Sie diese persönliche Bemerkung - mit dieser Tätigkeit tief verbunden, denn Karl Julius Schröer war einstmals mein lieber Lehrer. Dieser Karl Julius Schröer, er hat auf der einen Seite seine volkstümlichen Forschungen hineingetragen in die wirklich tiefen Untergründe des Volkstums. Zunächst hat er Weihnachtsspiele drucken lassen, die gespielt worden sind unter den Bauern in der Weihnachtszeit, die aber so recht aus dem
Volke selber hervorgegangen waren. Dann war er ein Mundartforscher, ein Forscher, welcher die Eigentümlichkeiten der österreichischen Mundart in den Gotscheerlanden in Krain, bei den Zipser Deutschen, bei den sogenannten Heanzen in West-Ungarn, der die Mundart auch Nieder-österreichs durchforscht hat, der überall hingewiesen hat auf den unmittelbaren Zusammenhang alles österreichischen Geisteslebens mit den Wurzeln im Volkstum; und der auf der anderen Seite die Seelen hinaufgetragen hat zu den Höhen der Goetheschen Weltanschauung durch eine Faust-Forschung, und in diesem Sinne wiederum wohltätig auf seine Schüler gewirkt hat. Dieser Mann hat nun 1859 in dieser Art Österreichs Einheit mit Deutschland zum Ausdruck gebracht. Ich habe seine Worte angeführt, um zu zeigen, wie herauswächst aus österreichischem Volkstum dasjenige, worauf wir heute sehen müssen als auf ein schönes, herrliches Ideal, das sich aus den großen Forderungen und hingebungsvollen Taten unserer Gegenwart heraus entwickeln soll: ein Mitteleuropa, in dem zusammenwirkt alles dasjenige, was eigentlich aus den Herzen heraus längst zusammenwirkte. Und gerade durch eine Betrachtung des besonderen Tones, der im österreichischen Volkstum, im österreichischen Geistesleben waltet, wird man sagen können: Das, was da erreicht werden sollte in Abgetrenntheit, es wird sich zu der mitteleuropäischen Entwickelung Heil und Segen auch in innigerer Weise verbinden können mit dem, was im weiteren Umkreis deutsches Wesen ist. Und so sehen wir denn, ich möchte sagen, auch wenn wir mit Verständnis des Wesens des Volkstums hinsehen auf das, was sich aus Blut und Leiden und Schmerzen in unserer Zeit als ein Zukunftsideal Mitteleuropas entwickeln will -, so sehen wir denn, daß sich da etwas entwickelt, was durch die hingebungsvollen mutigen Taten der Waffen geschaffen
werden muß, was aber fest urständet, so urständet, daß doch darin die Gewähr für seine Dauer gesehen werden kann, in den Herzen, in den Seelen derer, die sich näher miteinander verbinden und sich zu gemeinsamer Tat verbunden haben.
Wahrhaftig, lassen Sie mich damit schließen: Dasjenige, was sich historisch jetzt zusammenfügt, es fügt sich nicht nur durch äußere Notwendigkeit zusammen, es fügt sich zusammen durch die inneren Bande der Seelen, der Herzen der Bevölkerungen Mitteleuropas.
MENSCHENSEELE UND MENSCHENGEIST Berlin, 10. Dezember 1915
Derjenige wird immer in bezug auf die Auffassung in eine sdilefe Stellung kommen gegenüber der Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist und wie ich sie seit Jahren hier vortragen durfte, der in dieser Geisteswissenschaft, namentlich in ihren Wegen und Methoden etwas der gewöhnlichen Menschennatur, dem gewöhnlichen Menschenleben ganz absonderlich Fernes, Fremdes, gewissermaßen Jenseitiges sieht; der in der Geistesforschung etwas sieht, das nur erworben werden kann durch besondere, außerordentliche Gaben, die der gewöhnlichen Menschennatur nicht zugänglich seien. Demgegenüber wurde ja hier immer wieder und wiederum betont: Geisteswissenschaft will nichts anderes sein, als für das geistige Gebiet die echte Fortsetzung der naturwissenschaftlichen Weltanschauung, insofern diese in der neueren Zeit ihre Methoden gefunden hat, die sie in bezug auf die Erforschung der materiellen, der äußerlich sinnlichen Erscheinungen, zu früher ungeahnten Ergebnissen und Erfolgen geführt hat. Die Schwierigkeit in der Auffassung der ganzen Gesinnung und der ganzen Absicht der Geisteswissenschaft liegt darinnen, daß es der Mensch vom Gesichtspunkte der gegenwärtigen Weltanschauungsgesinnung aus schwer hat, einzusehen, daß diese Geisteswissenschaft im Grunde genommen nichts anderes will, als die inneren menschlichen Denk- und sonstigen Seelenerlebnisse in einer ähnlichen Weise auszubilden, durch rein innerliche Vorgänge auszubilden, wie gewisse äußerliche
Hantierungen, gewisse äußerliche Verrichtungen verfeinert und ausgebildet werden im naturwissenschaftlichen Experiment. So wie das naturwissenschaftliche Experiment, durch das der Natur ihre Geheimnisse abgelauscht werden sollen, im Grunde genommen nichts anderes ist, als eine Verfeinerung, in gewissem Sinne eine Erhöhung, wenn ich das Wort brauchen darf, von Verrichtungen, die sonst auch mit äußerlich materiellen Dingen vorgenommen werden, die nur in einem gewissen, sagen wir, methodischen Sinne vorgenommen werden, so daß durch ihre Zusammenstellung die Natur ihre Geheimnisse der Menschenseele enthüllt. So wie das naturwissenschaftliche Experiment nichts anderes ist als eine Fortsetzung gewissermaßen der äußeren Betätigung des Menschen, so ist auch das geisteswissenschaftliche Forschen nichts anderes als eine Fortsetzung, sagen wir, eine Verfeinerung desjenigen, was die Menschenseele im gewöhnlichen Verlaufe des Lebens und in der gewöhnlichen Wissenschaft an Denk- und anderen Seelenverrichtungen vollbringt. Das ist die eine Schwierigkeit, daß der Weg von dem einen zu dem anderen nicht immer zum Beispiel in der heute vor acht Tagen hier angedeuteten Weise gesucht wird.
Die andere Schwierigkeit besteht darinnen, daß der Mensch den Ergebnissen der Naturwissenschaft gegenüber viel mehr als er glaubt, dasjenige, was ihm dargeboten wird, hinnimmt, wenn er es nach seinem gesunden Menschenverstande einleuchtend findet, auch dann, wenn er nicht die Methoden selbst anwendet, die Experimente im Laboratorium oder auf der Klinik selber ausführen kann. Es besteht da nicht das Begehren, unmittelbar alles selbst zu suchen, sondern sich mit dem gesunden Menschenverstand zu dem zu stellen, was der Forscher gibt, der sich bekannt gemacht hat mit der Handhabung der Methoden. In bezug auf Geisteswissenschaft liegt für den Forscher gar
nichts anderes als bei der Naturwissenschaft vor. Er gibt von sich aus in derselben Weise, aus derselben Denkrichtung heraus dasjenige, was er nun durch intime innere Seelenvorgänge so objektiv erforscht, wie die Naturgeheimnisse durch die Experimente erforscht werden. Und er rechnet ebenso darauf, daß die Zustimmung erfolgt durch den gesunden Menschenverstand, der für dasjenige spricht, was das innere Experiment, wie ich mich heute vor acht Tagen ausdrückte, zu geben hat. Nun besteht aber gegenüber den Ergebnissen der Geisteswissenschaft, gegenüber den Geheimnissen des Ganges der Entwickelung, der Schicksale der menschlichen Seele, das Begehren aller Menschen, nicht nur Forschungsergebnisse entgegenzunehmen, sondern dasjenige, was sie auf diesem Gebiete für richtig halten sollen, selber mehr oder weniger zu erforschen. Diejenigen Wege, die die Seele bei jedem Menschen nehmen kann und die zum Beispiel in meinem Buche: «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» angedeutet sind, ergeben nun zwar für jede Menschenseele die Möglichkeit, sich zu überzeugen und in sich selber zu bewahrheiten, was der Geistes-forscher zu sagen hat, indem eben in der Seele diese intimen, inneren Vorgänge erlebt werden. Aber es müssen eben diese Wege gegangen werden. Und da erhebt sich dann, obzwar immer wieder und wiederum von vielen mit diesem Wege der Anfang gemacht wird, die innerliche subjektive Schwierigkeit, daß diese Wege - ich kann nicht sagen schwierig sind, aber schwierig befunden werden von den Menschenseelen, daß sie die Geduld verlieren nach den ersten Schritten, oder mindestens nicht die Neigung haben, sie mit derselben Gewissenhaftigkeit zu machen, mit der der Naturforscher ein Experiment herrichtet. Und bei alledem spricht ein gewisser Glaube in der Menschenseele mit, ein Glaube, der gegenüber der wirklichen Geistesforschung ein Vorurteil ist; aber im
Menschenleben entscheiden eben in den meisten Fällen Vorurteile. Es erhebt sich der Glaube, daß die Menschenseele, so wie sie einmal ist, wenn sie sich nur ein wenig besinnt, wenn sie nur ein wenig diejenigen Denkgewohnheiten entwickelt, diejenigen Denkverrichtungen erlebt, auslebt, die so unmittelbar im Leben gegeben sind, dann doch darauf kommen müsse, welches die Geheimnisse der inneren Menschennatur sind. Man hat das Gefühl: Es darf nicht schwierig sein, das Allerrätselhafteste, das es auf der Welt gibt, in der äußeren Welt gibt, den Menschen selber, in seiner Wesenheit zu erkennen. Man hat einmal dieses Gefühl, es dürfe nicht schwierig sein. Um den inneren Zusammenhang eines Uhrwerkes zu erkennen, läßt man sich darauf ein, die Dinge zu studieren. Gegenüber dem Kompliziertesten, dem Rätselhaftesten, das es in der uns umgebenden Sinnes-welt gibt, der Menschennatur, möchte man sich eigentlich am liebsten dem Glauben hingeben, daß die volle Wahrheit über das Wesen des Menschen jeder erkennen könne, ohne daß er sich erst auf einen gewissen Standpunkt vor-bereitet, ohne daß er erst innerliche Seelenwege macht, um die eigene Natur zu erkennen. Man kann ja meinen, es wäre ja recht gut, bequem, schön vielleicht, wenn das so wäre, wenn man gar keine Vorbereitung brauchte, um das Menschenwesen zu erforschen. Aber man kann demgegenüber nur sagen: Es ist eben nicht so, sondern es bedarf, um das Menschenwesen in seiner innersten Natur zu erforschen, der Wege der Geistesforschung. Das ist eine Wahrheit. Und ob oder wie der Mensch sich damit abfindet, das kommt nicht in Betracht gegenüber dieser Wahrheit. Der Mensch muß sich erst durch einen Vorbereitungsweg die Mittel aneignen, durch die er sich sein eigenes Geheimnis enthüllen kann.
Und trotzdem: Dasjenige, was Ausgangspunkte sind, das ist durchaus kein Geheimnis. Schon der Vortrag vor acht
Tagen hat das zeigen können, und ich will mit ein paar Worten heute noch einmal auf das Prinzipielle wenigstens zurückkommen. Jeder Mensch denkt im Leben, bildet sein Denken weiter aus, wenn er es dem wissenschaftlichen Gebrauche weiht. Das Denken, das Vorstellen ist eine alltägliche innere Seelenbetätigung. Auf nichts anderes kommt es nun an, als diesem Denken gegenüber sich in einer solchen Weise zu stellen, wie man sich eben im gewöhnlichen Leben und in der gewöhnlichen Wissenschaft nicht stellt, um die Wege des Geistigen zu erforschen. Im gewöhnlichen Leben und in der gewöhnlichen Wissenschaft bildet sich der Mensch Vorstellungen, Begriffe und Ideen, um durch diese etwas Äußerliches abzubilden. Und er ist dann befriedigt, wenn er in seinen Vorstellungen sich etwas Äußerliches abbildet. Er nennt mit Recht für das gewöhnliche Leben und für die gewöhnliche Wissenschaft dies die Wahrheit, daß er sich Vorstellungen machen kann, die ihm eine äußerliche Wirklichkeit abbilden, innerlich vergegenwärtigen, sie ihn innerlich nacherleben lassen. Nun ist darauf aufmerksam gemacht worden, daß da, wo dieses gewöhnliche Vorstellen des alltäglichen Lebens und auch das Denken der gewöhnlichen Wissenschaft endet, erst dasjenige anfängt, was notwendig ist für die Erforschung des geistigen Lebens des Menschen. Das heißt: das Denken, dasselbe Denken, das man im alltäglichen Leben handhabt, hat man nur in einer anderen Weise innerlich zu erleben, in einer anderen Weise innerlich zu erkraften, als es im gewöhnlichen Leben und innerhalb der gewöhnlichen Wissenschaft erlebt und erkraftet wird. Es wird erkraftet, wie ich angedeutet habe, durch jenen inneren Vorgang, der gewissermaßen - das Wort soll nicht mißverstanden werden - das innerliche, intime, rein seelische Experiment darstellt, der es wenigstens einleitet durch den Vorgang, den man wirkliches Meditieren -
wenn es nicht pedantisch klingen würde, könnte man sagen «im technischen Sinne des Wortes» - nennt. Da wird gedacht, um das Denken innerlich zu erkraften, um den Vorgang des Denkens zu erleben. Den erlebt man ja gewöhnlich nicht. Man glaubt ihn im gewöhnlichen Leben oder in der gewöhnlichen Wissenschaft zu erleben. Man erlebt ihn da nicht. Man hat ihn, man handhabt ihn, man wendet dieses Denken an; aber die Seele ist dabei auf die Außenwelt gerichtet, auf etwas Wirkliches außer dem Denken. Daß man auf das Denken selber hin achten kann, darauf kommt es an. Dazu muß es aber verstärkt werden. Das heißt: es muß so getrieben werden, wie es eben im Sinne der Meditation getrieben wird, daß man das Denken in Bewegung bringt, nun nicht um sich etwas Äußerliches zu vergegenwärtigen, nicht um etwas Äußerliches innerlich aufleben zu lassen, abzubilden, sondern um innerlich nur diesen Vorgang, diesen Prozeß des Denkens zu erleben und im Erleben anzuschauen. Darauf kommt es an. Und dazu ist es eben notwendig, daß man nun nicht sich den Seelenvorgängen des gewöhnlichen Lebens überläßt, sondern durch innere Willkür, aus völlig freiem Willen heraus -ich gebe hier das Prinzipielle, das Genauere finden Sie in meinem Buche: «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» - leicht überschaubare Vorstellungen, in das Denken hinein versetzt, solche Vorstellungen, bei denen man sicher sein kann, daß nicht allerlei innere Reminiszenzen auftauchen und einem das kläre Erleben des Vorganges verdunkeln; am besten sinnbildliche Vorstellungen, die gar nichts Äußeres abbilden sollen, die gar nicht dazu dienen sollen, ein Äußerliches wirklich zu vergegenwärtigen, sondern die nur dazu dienen sollen, das Denken in Fluß, in Bewegung zu bringen und dadurch innerlich zu erkraften, so daß man dieses Denken nicht bloß übt, sondern innerlich
erlebt, daß man sich nun wirklich äls innerlicher Denkmensch erlebt, so wie man sich sonst innerlich in seinem Muskelgefühl erlebt.
Wenn man auf diese Weise nach der einen Seite hin die Seelenentwickelung treibt, so kommt man dadurch, wie ich dargestellt habe, zu einem gewissen Punkte, der ein bedeutsames, ja, ein erschütterndes inneres Erlebnis darstellt. Und ich will noch einmal charakterisieren, wie man sich durch dieses Erlebnis ganz anders zur Menschennatur stellt, als man sich zu ihr gewöhnlich im Leben stellt. Es stimmt mit der naturwissenschaftlichen Denkungsweise, diese sogar bis in ihre äußersten Konsequenzen treibend, die geisteswissenschaftliche Auffassung vollständig überein. Innerhalb des gewöhnlichen Denkens, das man als in der Sinnenwelt verkörperter Mensch treibt, braucht man zu diesem Denken ein Organ. Und nicht nur dies, sondern jedesmal, wenn man denkt, muß erst ein innerlicher Vorgang ablaufen, der nicht ins Denken, gar nicht einmal ins Bewußtsein hereinfallen kann, der vorangehen muß dem Denken. Das Denken kann erst ablaufen, wenn es innerlich organmäßig vorbereitet ist. So daß jedesmal, wenn man denkt, zweierlei verläuft: ein Prozeß, von dem man nichts weiß, der erst den Organismus, den äußeren Leib zubereitet, so daß da jene Vorgänge stattfinden, die dann als Gedanke, als Vorstellung zum Bewußtsein kommen. Dadurch daß man meditiert, daß man gleichsam alle Seelenkräfte konzentriert auf eine bestimmte Vorstellung, sie so zusammendrängt, im Denken stille hält, nicht den Ablauf des Denkens so verfließen läßt wie im gewöhnlichen Leben, sondern im Denken stille hält, das heißt, den Gedanken anhält, und nun denkt, nicht um etwas Äußerliches abzubilden, sondern um das innerliche Denken zu erspüren, den Prozeß des Denkens zu erspüren, - indem man dies vollbringt, merkt man innerlich:
Was man eigentlich bisher getrieben hat als Denken, wie man sich im Denken betätigt hat, das hört auf. Man kommt nicht aus einer klären Auffassung des Bewußtseins heraus, man kommt nicht in ein Nebuloses hinein; aber dieses Denken, das an dem Prozeß der äußeren Welt in seinem Flusse fortgeführt wird, das hört als solches auf. Man kommt in ein innerliches Erlebnis, das einen zunächst viel mehr mit einem selbst zusammenführt, das einen hineinführt in denjenigen Vorgang, der vorgedanklich ist, der erst unseren Leib zubereitet, damit wir das Denken entfalten können. Man kommt unter das Denken hinunter. Das läßt sich nicht auf eine andere Weise beweisen, als nur im unmittelbaren Erleben. Dasjenige Denken, das man im gewöhnlichen Leben hat, das erscheint einem wie ein hin-laufender Fluß. Jetzt weiß man: jetzt ist man in einer tieferen Schichte des Seins, jetzt ist man in dem Prozeß drinnen, den man im gewöhnlichen Leben nicht erleben kann, weil er dem Denken vorangehen muß.
Das ist der Prozeß, der aber, wenn er in Geduld, mit Ausdauer und Energie fortgesetzt wird, wie es vor acht Tagen angegeben worden ist, weit führt; es dauert für einen Menschen kürzer, für manchen Menschen jahrelang, obwohl die einzelne Übung nicht übertrieben werden soll. Dieses innerliche Erlebnis führt dahin, dasjenige, was im Denken liegt, jetzt nicht bloß zu erdenken, sondern zu erleben. Das heißt: das Denken nicht so zu erleben, wie es ein Äußeres äbbildet, sondern wie es im Menschen gestaltet, wie es erst den Organismus ergreift und im Menschen gestaltet. Zunächst weiß man nicht, was dieses innere Erlebnis eigentlich bedeutet. Man fühlt sozusagen, wie wenn man an der oder jener Stelle unter das gewöhnliche Seelenleben herunterkäme in eine Welt hinein, die man bisher nicht gekannt hat. Dann aber lernt man als erstes bedeutsames
Ergebnis kennen dasjenige, was als Lebendiges im Denken liegt und was vorangegangen ist unserer physischen Leibes-gestaltung, vorangegangen ist vor allen Dingen demjenigen Punkte des menschlichen Erlebens, bis zu dem man sich im späteren Leben zurückerinnert, bis zur Geburt, bis zur Empfängnis und weiter hinauf. Das heißt, man lernt sich erkennen als Geistesmensch, der nun nicht in uns lebt, um den Organismus als Organ zur Wahrnehmung der äußeren Welt zu benutzen, sondern als Geistesmensch, der gestaltet hat vor unserer Geburt, oder, sagen wir, vor der Empfängnis dasjenige, was von dem Menschengeist, von der Menschenseele aus am menschlichen Leibe gestaltet werden muß. Man lernt erlebend erkennen, was sich aus jener Dreiheit gestaltet, die sich ergibt aus Väter und Mutter, aber auch aus dem, was jenseits der Vererbungslinie liegt und herunterkommt aus der geistigen Welt, um sich mit dem zu verbinden, was durch die Vererbungslinie gegeben wird. Dazu ist eben nur notwendig, den Prozeß des Denkens zu vertiefen, den Prozeß des Denkens innerlich zu erkraften. Man kann sich hinführen - natürlich nicht durch das gewöhnliche Denken - zu der Anschauung - denn eine Anschauung muß es sein - desjenigen, was unserer Geburt oder unserer Empfängnis vorangegangen ist, was aus der geistigen Welt herunterkommt, um sich in der physischen Welt mit dem physischen Leibe, der durch die Vererbungsströmung gegeben ist, zu verbinden. Derjenige, der einen Beweis dafür verlangt, müßte sich erst bekannt machen mit der Natur alles gewöhnlichen Beweisens. Tatsachen kann man überhaupt nicht beweisen. Man denke nur einmal, daß niemals irgend jemand einen Walfisch gesehen hätte. Es würde niemals jemand beweisen können aus irgendwelchen zoologischen Kenntnissen heraus, daß es einen Walfisch gibt. Es gibt keine Möglichkeit, aus irgendwelchen Begriffen
und Vorstellungen zu der Wirklichkeit hinzuführen, wenn der Verlauf der Begriffe und Vorstellungen so gemeint ist, wie er eben für das gewöhnliche Leben abläuft. Und so führt dies, was uns auf der einen Seite hinausführt aus der Welt, in der wir leben zwischen Geburt und Tod, hinein in jene Welt, aus der wir geschritten sind herein in unsere physische Verkörperung, in die wir hinausschreiten, wenn wir durch die Pforte des Todes gehen. So führt der Weg, der nach der einen Seite uns hinausführt aus dieser sinnlichen Welt, in die geistige Welt, durch eine besondere innere Entwickelung, eine besondere innere Handhabe des Denkens. Und da muß denn gesagt werden: Obzwar Geisteswissenschaft in ihrer ganzen Gesinnung, in ihrer ganzen Stellung zur Welt wirklich aus dem Geiste der naturwissenschaftlichen Gesinnung heraus arbeitet, ergibt sich eben doch jene Verschiedenheit von der gewöhnlichen Naturwissenschaft, die dadurch bedingt ist,däß die Naturwissenschaft auf die äußere Welt gerichtet ist und daß die Geisteswissenschaft dasselbe, was die Naturwissenschaft für die äußere Welt tun will, für die Welt des Geistes tun will. Dadurch allerdings stellt sich trotz des völligen Einklanges ein Unterschied - nicht ein Gegensatz, ein Unterschied - heraus, der sich von vielen Seiten her charakterisieren ließe, der sich aber für unsere heutigen Zwecke in der folgenden Weise charakterisieren läßt: Für das gewöhnliche Leben und die gewöhnliche Wissenschaft ist dasjenige, was wir im Denken vollbringen, das Schlußergebnis, dasjenige, zu dem wir hinkommen wollen. Indem wir denkend arbeiten in der äußeren Wirklichkeit, kommen wir eben zu dem, was wir haben wollen von der äußeren Wirklichkeit. Alle die Verrichtungen, sofern sie Seelenverrichtungen sind, die wir anwenden zur Brkenntnis der äußeren Welt und des Lebens in dieser äußeren Welt, sind nur Vorbereitung da, wo es sich um den geisteswissenschaftlichen
Weg handelt. In der äußeren Wissenschaft, in der äußeren Welt denkt man, damit man zu dem Denkergebnis kommt. Aber dieses Denken, wie man es da übt, das bereitet nur die Seele zu, damit die Seele durch dieses Denken zu einem Punkte des inneren Erlebens kommt, auf dem ihr entgegentritt die geistige Welt. Alles das also, was uns das äußere Leben an Denken, an Denk-kraft, an Denkergebnissen der äußeren Wissenschaft geben kann, das wird in der Geisteswissenschaft anders verwendet als im gewöhnlichen Leben und der gewöhnlichen Wissenschaft. Es wird so verwendet, daß es nur das Denken, die denkende Seite des Menschengeistes und der Menschen-seele bildet zu einem gewissen Punkte hin. Was Ergebnis ist im gewöhnlichen Leben, in der gewöhnlichen Wissenschaft, ist lebendige Vorbereitung für die Geisteswissenschaft. Und dasjenige, was sich dann als Tatsache ergibt, wie ich es eben in der elementarsten Art geschildert habe, kommt nicht während der Anstrengung. Die innere Anstrengung geht nur dahin, die Seele bis zu einem gewissen Punkte zu führen. Da bleibt man noch im Grunde genommen im Bereich des gewöhnlichen Lebens, solange man sich innerlich anstrengt, solange man in der Meditätion drinnen ist. Erst dann, wenn man eben die Anstrengung vollzogen hat, wenn man nun sie auf die Seele hat wirken lassen und dann wiederum unterdrückt und ruhig wartet, kommen die geisteswissenschäftlichen Ergebnisse. Die können nur auftreten als geistige Tatsachen, zu deren Anblick man sich so vorbereitet hat, daß man sich das innerliche geistige Auge geschaffen hat. Wie die Natur im menschlichen Organismus das Auge heraustreibt aus dem Leibe, damit es entgegenblickt der äußeren Welt und das Licht und die Farben empfängt, so arbeitet man durch alles das, was Denken, was innerliche Seelenänstrengung sein kann, darauf hin, dem
entgegenzugehen, das einem eben von der anderen Seite entgegenkommen soll und entgegenkommen muß. Innere Offenbarung, inneres Herankommen an die Seele muß dasjenige sein, was einem als Tatsache der geistigen Welt entgegentritt. Das ist die eine Seite.
Von der anderen Seite kann man sägen: sie ist ebenso ein innerlich intimes Erleben des Willens, wie das, was ich geschildert habe, ein innerliches Erleben des Denkens war. Im gewöhnlichen Leben verrichtet man seine Handlungen, die aus den Willensimpulsen, aus Wunsch und Begehren hervorgehen. Aber man wendet die Aufmerksamkeit nicht darauf, daß in diesem Willen etwas Besonderes steckt. Daß in dem Wollen des Menschen etwas Besonderes steckt, darauf kommt man, wenn man sich, sei es auch nur für Minuten, meditierend aus dem Leben zurückzieht und darauf hinsieht, wie man gewollt hat; wenn man innerlich die Seele nicht auf ein Wollen richtet, das in die äußere Handlung übergeht, sondern auf ein innerliches Beschauen des Wollens. Derjenige übrigens, der seine Gedankenmeditation in der richtigen Weise vollführt, kommt ganz von selbst zu diesem innerlichen Beschauen des Wollens. Denn es ist das Meditieren, insofern es auch nur ein In-die-Mitte-des-Bewußtseins-Stellen eines Gedankens ist, zugleich ein intimes Aufbringen eines inneren Willensvorganges. Man erlebt das Wollen so, daß man mit ihm innerlich beisammen ist. Durch die Verstärkung, durch die Erkraftung desjenigen, was schon für das vorige Seelenerleben Meditieren genannt worden ist, ergibt sich ganz von selbst, daß man die Aufmerksamkeit lenken lernt auf den innerlichen Vorgang des Wollens so, wie man sie niemals darauf richtet, wenn das Wollen eben in das äußere Handeln übergeht, weil man da seine Aufmerksamkeit auf dasjenige richtet, was man in der äußeren Sinnenwelt will. Aber man muß seine Aufmerksamkeit
auf einen Willensvorgang richten, insofern das Wesentliche dieses Willensvorganges im Innern der Seele abläuft. Es muß wiederum ein ganz innerlich intimer Prozeß sein. Und gerade dieses Wollen erkennt man am allerbesten im Meditationsprozeß selber, wenn man nur den Meditätionsprozeß wirklich innerlich erlebt. Und da stellt sich denn heraus, daß man dann, indem man dies immer weiter und weiter in innerlicher Ausdauer und Energie vollbringt, endlich zu einem Punkte kommt, wo man einen inneren Beobachter in sich entdeckt. Es ist schwierig, so etwas zu sagen, weil es so ferne den gewöhnlichen Denk-gewohnheiten liegt, so daß es aussieht, als ob man von etwas furchtbar Phantastischem spräche, während man von einer Realität spricht, auf die man wirklich kommt. Man entdeckt also einen inneren Menschen in sich, der fortwährend hinschaut auf dasjenige, was in unseren Willensentschlüssen, in unserem ganzen Wollen vorgeht, - einen Beobachter, von dem man im gewöhnlichen Leben nichts weiß, weil man eben nicht seine Aufmerksamkeit auf ihn richtet. Nicht ein gedachtes, sondern ein reales Wesen schaut in uns wirklich fortwährend zu und steckt in unserem Willen. So wie wir uns mit unseren Gedanken verhalten zu den Dingen der äußeren Wahrnehmung, so verhält sich etwas in uns zu unserer Willensentfaltung. Was die Farbe, die Töne für die Sinne sind und für das Bewußtsein, das die Außenwelt wahrnimmt, das ist unser Wollen für einen innerlichen Beobachter. Da steckt ein innerlicher Beobachter in uns, für den wir genau so in unseren Willensentschlüssen, in unseren Willensvollführungen das Material der Beobachtung liefern, wie uns die Farben, wie die Töne das Material der Beobachtung uns für die Außenwelt liefern.
Es ist eben schwierig, über diese Dinge zu sprechen, weil man glaubt, man rede über etwas Ausgedachtes, während
man eben über etwas redet, was, wenn sich die Seele vorbereitet hat, ihr wiederum entgegenkommt. Dieses höhere Bewußtsein ist nun solcher Art, daß man wirklich das ganz erschütternde Erlebnis in der Seele durchmacht: man kommt wie durch einen innerlichen Sprung aus alledem, worin man mit dem gewöhnlichen Seelenleben verbunden ist, heraus und vermag sich in diesen Beobachter, wenn auch nur, ich möchte sagen, für einen Augenblick hineinzuversetzen. Es gibt schon der Augenblicke genug. Man fühlt sich seinem ganzen Menschen gegenüber, so wie er im gewöhnlichen Leben dasteht, jetzt in derselben Weise, wie man sich sonst mit diesem gewöhnlichen Menschen fühlt gegenüber den Dingen, den farbigen und tönenden Dingen der äußeren Natur. Wenn man dieses Erlebnis weitertreibt, dann merkt man auf einem gewissen Punkt des inneren Erlebens, was es heißt, innere Seelentätigkeit zu entfalten, die sich nicht des Orgänes der Leiblichkeit bedient, sondern dieser äußeren Leiblichkeit gegenübersteht wie einem äußeren Gegenstand, wie der gewöhnliche Mensch dem Tisch oder dem Stuhl oder irgendeinem sonstigen äußeren Gegenstand gegenübersteht. Sein Seelenleben außer dem Leibe zu erleben, das ist es, was man eben wiederum nur erleben kann. Und dann weiß man, wie das Leben ausschaut, das durch die Pforte des Todes durchgeht, das leibfrei lebt, wenn ihm auch der physische Leib zerstört wird. Es ist innerlich webendes Seelenleben, das dann in die geistige Welt hinübertritt, um durch die geistige Welt sich hindurchzuleben und aus der geistigen Welt nunmehr die Kräfte zu nehmen. Man lernt sie in ihrer Eigenart kennen, diese Kräfte, die allmählich die Vorbereitung dazu sind, daß das Seelen-wesen, nachdem es durch das Leben zwischen Tod und neuer Geburt durchgegangen ist, zu einer neuen Erdenverkörperung herabsteigt.
Von dem, was im Wollen des Menschen vorliegt, ausgehend, von dem, was im Denken, im Vorstellen vorliegt, ausgehend, also von dem gewöhnlichen Menschen ausgehend, kommt man zu den Ergebnissen der Geisteswissenschaft. Und diese Ergebnisse der Geisteswissenschaft sind nicht etwas, was der Geistesforscher für sich hätte. Es ist der größte Irrtum zu glauben, daß der Geistesforscher irgend etwas Neues in der Seele schafft gegenüber dem, was schon da ist. Wahrhaftig, ebensowenig wie derjenige, der als Naturforscher der Natur gegenübertritt, irgend etwas schafft, sondern nur der Natur ihre Geheimnisse ablauscht, ebensowenig schafft in bezug auf das innere Seelenleben der Geistesforscher irgend etwas. Er kommt nur an das heran, was vorgeburtlich ist, was nach dem Tode weiterlebt, an das, was die ewigen Kräfte der Menschenseele sind, was Menschengeist und Menschenseele sind.
Auch hier mischt sich wiederum, ich möchte sagen, ein halb oder manchmal auch ganz egoistisches Vorurteil in dasjenige, was der Geistesforscher eigentlich sagen will, hinein. Man sagt sich nun einmal im Leben: Der Geistes-forscher kann etwas, was andere Menschen nicht können -und man überträgt das dann auf seinen Menschenwert, man überträgt das auf seine Bedeutung als Mensch. Aber er hat nichts anderes in sich, als was jeder gewöhnliche Mensch in sich hat. Denn dasjenige, was er entdeckt als vorgeburtlich, das ist immer in der menschlichen Natur, und das wird bei ihm nicht anders dadurch, daß er dann sich ein Wissen davon erwirbt. Dasjenige, was hinausgeht durch die Pforte des Todes, das ist beim Geistesforscher so vorhanden, wie es in jedem Menschen vorhanden ist. Und das Wissen, das der Geistesforscher erwirbt, verhält sich nicht anders zu der Wirklichkeit des seelisch-geistigen Daseins des Menschen, als sich das Wissen der Naturwissenschaft zu der
äußeren Natur verhält. Es wäre sogar gut, wenn in der Literatur, die über solche Dinge handelt, gewisse Worte nicht gleich so genommen würden, daß man sozusagen innerlich - verzeihen Sie den Ausdruck - Weihrauch streut, innerlich etwas ganz Besonderes in seinem Gefühle durchmachen möchte. Man bezeichnet oftmals denjenigen, der also in die geistige Welt hineinschauen kann, als einen Eingeweihten. Dann aber, wenn das Wort «Eingeweihter» ausgesprochen wird, verbindet man damit etwas, als ob man nun einen ganz besonderen Menschen vor sich hätte. Das soll man gerade vermeiden, sondern man soll die Dinge so nehmen, wie sie in Gemäßheit der eben gegebenen Schilderungen zu nehmen sind. Und der Geistesforscher selber ist davon überzeugt: nur die eingangs genannten Vorurteile wirken dagegen, daß man seine Ergebnisse nicht gerädeso aufnimmt nach dem gesunden Menschenverstand, wie man die Ergebnisse des Chemikers, des Physikers und so weiter aufnimmt. Denn prinzipiell ist kein Unterschied.
Indem man das Denken in der Weise bildet, wie es geschildert worden ist, kommt man dazu, nach der einen Seite in die geistige Welt hineinzukommen. Es kommt einem das vorgeburtliche Leben entgegen, das Leben der Menschen-seele in der geistigen Welt, und von da ausgehend dann eine Anschauung der geistigen Welt selber mit ihren Geistes-wesen. Das kommt einem so entgegen, daß man es anschaulich hat. Aber man muß sich darüber klar sein, daß diese Anschauung sich unterscheidet von den Anschauungen, von den Wahrnehmungen, Empfindungen, die man gegenüber der äußeren Sinnenwelt hat. Wer glaubt, dieses Anschauen könne ihm so aufgehen, daß es gleichsam nur eine nebelärtige Wiederholung der Anschauung der Sinnenwelt ist, irrt sich vollständig. Man muß sich vielmehr klar sein, daß alles, was die Sinnenwelt eben zur Sinnenwelt macht,
daran liegt, daß wfr es mit unseren Organen anschauen. Solche Farben, wie sie in der äußeren Sinneswelt sind, können nur durch ein Auge wahrgenommen werden, solche Töne, wie sie in der äußeren Welt sind, nur durch ein sinnliches Ohr gehört werden. Dennoch kann man von Anschauen, von geistigem Anschauen sprechen. Man kann von einem Seelen-, von einem Geistesauge sprechen, wenn man sich nach dieser Seite hin der geistigen Welt nähert, um dieses Goethe-Wort «Geistesauge» zu brauchen. Nur dadurch unterscheidet sich dieses Anschauen, daß man sich bei einem solchen wahren Hellsehen immer bewußt ist - so wie man sich beim Schreiben bewußt ist, daß man dasjenige, was als Wirklichkeit zum Ausdruck kommen soll, selber als Anschauung hinstellt; daß man die Anschauung selber hervorruft. Aber bei diesem Selberhervorrufen folgt man einer inneren Wirklichkeit, einer geistigen Wirklichkeit, wie man auch beim Schreiben nicht etwas Beliebiges hinkritzelt, sondern eine innere Wirklichkeit zum Ausdruck bringt, allerdings eine innere Wirklichkeit, die der äußeren Welt ange-hört. Dieses viel aktivere, immer tätige innere Mitarbeiten mit der Anschauung ist gerade das, was dieses - ich sage jetzt: währe - innere Hellsehen unterscheidet von der äußeren Sinnenwahrnehmung, die uns passiv gegeben wird, die an uns heranrückt, indem wir ihr das Auge entgegenhalten. Aber auch zu dieser Fähigkeit, die geistige Welt auf geistige Art nachzuzeichnen, kommen wir nur, wenn wir die Vorbereitung getroffen haben, so daß uns die geistige Welt als Ergebnis entgegenkommt. Aus diesem Erlebnis heraus zeichnet dann die Seele die Anschauung, und sie hat das Bedürfnis dazu, weil es einem inneren Triebe entspricht, dasjenige nun auch wirklich anschaulich vor sich zu haben, was sonst eben als Erlebnis webt und lebt, aber noch nicht Wirklichkeit, Realität ist.
Und wenn man wiederum nach der anderen Seite geht, wenn man durch den Willen aus der Sinnenwelt so hinausgeht, wie geschildert worden ist, und zu dem innerlichen Beobachter kommt, der einen wirklich begleitet, der aber nicht beobachtet wird, weil ihm die Aufmerksamkeit im gewöhnlichen Leben entzogen wird, dann fühlt man: Da in dir ist immer einer, der dir zuschaut, der seinerseits zum Ausdruck bringt, was du willst, worauf du deine Absichten richtest, was deiner Wunsch-, deiner Wollensphäre angehört. Aber dieses Zuschauen stellt sich jetzt so dar, daß man innerlich mittätig fühlt diesen Zuschauer, diesen höheren Menschen im Menschen, diesen Geistesmenschen im Leibes-menschen. Man fühlt, wie er mittut, wie sein Tun in allem, allem darin ist. Ich nannte dieses innerliche Mittun einen Beobachter, weil man dadurch zu seinem Verständnis kommt; aber es ist nicht ein Beobachter im Sinne des Zu-schauens, sondern im Sinne des Mittuns. Den Menschen, der durch die Todespforte schreitet, fühlen wir schon jetzt in unserem Leibe, wenn wir uns auf diese Weise dazu bringen, daß er in uns tätig ist. Aber wir müssen dann diese innere Tätigkeit, wenn wir das andere «Hellsichtigkeit» genannt haben, «Hellhörigkeit» nennen. Geistesohren, um wieder ein Goethe-Wort zu gebrauchen, gehen auf im Innern der Seele. Man lebt sozusagen in einem nur geistig vernehmbaren schwingenden Tönen, von dem man weiß, daß es innerlicher Realität entspricht. Man weiß, daß man selber unmittelbar geistige Wesenheit ist und sich nun begeben kann in die «Gesellschaft» - um dieses triviale Wort zu gebrauchen - der anderen Geistwesen, die in der geistigen Welt sind.
Nun muß man aber allerdings, wenn die Ausdrücke «Hellhörigkeit», «Hellsichtigkeit» gebraucht werden, immer darauf aufmerksam machen, daß gerade von diesem
Punkte aus gewichtige und, ich muß sogar sägen, gerechtfertigte Einwände und Mißverständnisse sich erheben gegen die Geisteswissenschaft. Denn mit Recht - und ich bitte zu beachten, daß ich sage mit Recht - sind die Worte «Hellsichtigkeit», «Hellhörigkeit» und so weiter in weitesten Kreisen mißachtet und als etwas angesehen, was im Grunde genommen jedenfalls nicht zu einer besseren Erkenntnis der Wirklichkeit führen kann als das gewöhnliche Denken und Vorstellen, sondern was im Gegenteil in allerlei Phantastisches, in allerlei Träumereien, ja, in krankhafter Weise eben wegführen muß von der wahren Wirklichkeit. Aber auch hier steht Geisteswissenschaft nicht nur auf demselben Boden wie die Naturwissenschaft, sondern im Gegenteil: wahre Geisteswissenschaft zieht gerade die alleräußersten Konsequenzen. Und was in diesem Zusammenhänge hier charakterisiert worden ist und wofür die Worte «Hellsichtigkeit», «Hellhörigkeit», die nun einmal da sind, gebraucht worden sind, das hat eben ganz und gar nichts mit demjenigen zu tun, was oftmals im gewöhnlichen Leben also genannt wird; inwiefern dies damit nichts zu tun hat, möchte ich jetzt durch eine Auseinandersetzung, die vielleicht weit hergeholt ist, veranschaulichen.
Indem wir unser Denken im gewöhnlichen Leben aufwenden, üben, ausüben, gebrauchen wir unseren Leib zu unserem Denken. Wie viel von unserem Leibe, das braucht jetzt nicht betrachtet werden. Inwiefern das Denken das Nervensystem zu seinem Organ hat, darauf soll jetzt, wie gesagt, nicht Rücksicht genommen werden. Nun habe ich in dem Vorträge heute vor acht Tagen darauf hingewiesen, daß dieses gewöhnliche Denken damit zusammenhängt, daß in uns von dem Momente an, wo wir denkend sein können im Leben, in uns eigentlich ein Abbäuprozeß stattfindet, ein Abbauprozeß in bezug auf feine Lebensvorgänge.
Das zeigt die Geisteswissenschaft. Ich kann das heute nur anführen. Ich habe letztes Mal, in dem Vortrag heute vor acht Tagen, genauer darüber gesprochen, es soll aber in den folgenden Vorträgen immer mehr im einzelnen ausgefü hrt werden.
Bis zu dem Punkte, bis zu dem man sich im Leben zurückerinnert, verläuft nämlich im Menschen ein Prozeß, und zwar zuerst vorgeburtlich, vor der Empfängnis, in der rein geistigen Welt. Es verläuft ein Prozeß, der hinzielt auf Verrichtungen, die den Organismus gewissermaßen aufbauen, die in der Lebensrichtung des Organismus liegen. In dem Augenblick, bis zu dem wir uns im Leben zurück-erinnern, da tritt das ein, daß diese innerliche Kräftebetätigung, welche die noch nicht denkende Denkwesenheit, Denkkraft ist, aufhört am Menschen aufzubauen. Von diesem Augenblicke an baut sie im Menschen ab, übt eigentlich fortwährend Zerstörungsprozesse aus, die sich dann summieren und die endlich den äußeren physischen Tod des Menschen herbeiführen, die den Leib des Menschen hinweg-nehmen von seiner Seele und seinem Geiste. So daß wir gerade, wenn wir das Denken geisteswissenschaftlich durch-forschen, es leiblich gebunden fühlen an einen Abbauprozeß, an einen Prozeß, der, indem das Denken so verläuft wie im gewöhnlichen Leben, abbaut. Es muß der Abbau dann immer wiederum ersetzt werden, indem das Denken stille-steht im Schlafe. Aber der Abbauprozeß ist stärker, ist intensiver und führt endlich langsam den Tod herbei, insofern er mit jenen Prozessen des Organismus zusammen-hängt, die eben in dem Organismus des Denkens verankert sind. Selbstverständlich hängt der Tod auch mit anderen Prozessen zusammen. So hängen wir, indem wir dieses gewöhnliche alltägliche Denken entwickeln, von unserer Organisation so ab, daß dieses Denken eigentlich mit einem
Zerstören des Organismus verbunden ist. Mit dem, was uns den Tod bringt im Organismus, ist also dasjenige verbunden, was im höchsten Maße die Blüte des menschlichen inneren Erlebens für diese Welt zwischen Geburt und Tod ist.
Das ist eine Tätigkeit, die nun erhöht werden muß in dem Prozeß, in den inneren Seelenverrichtungen, die angeführt worden sind. Das Denken durch Meditation und auch die Willensentfaltung durch Meditation bringen den Menschen dazu, daß er von seiner Leiblichkeit unabhängig wird, daß er sich aus seiner Leiblichkeit heraushebt und eine besondere Seelenbetätigung ausführt, in der er sich wissend außer seiner Leiblichkeit und unabhängig von seiner Leiblichkeit erhält. Das «außer» ist nicht so sehr räumlich gemeint, sondern so gemeint, daß der Mensch sich von der physischen Leibestätigkeit unabhängig weiß. Bei demjenigen nun, was im gewöhnlichen Leben Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit und so weiter genannt wird, was sich bis zur Hälluzination und Illusion verdichten kann, liegt nun der verhängnisvolle Aberglaube vor, man könne dadurch zu Einsichten in die Welt kommen, die über Geburt und Tod hinaus liegt. Man kann aber durch dasjenige, was im gewöhnlichen Leben Helisehen, Hellhören genannt wird, nicht hinauskommen zu irgendwelchen Vorgängen, Ereignissen in der geistigen Welt, die über Geburt und Tod hinaus liegt. Denn für das gewöhnliche, alltägliche Denken müssen wir sozusagen etwas, was eine Ganzheit ist in unserem Leibe, zerstören, und wir müssen es in dem Maße zerstören, als das eben in der - um jetzt das Wort zu gebrauchen - normalen Lebenstätigkeit liegt. Wir stellen uns mit unserem ganzen Menschen hinein in die Umwelt und lassen ihn abbauen, indem wir das Denken üben, ausführen. Bei dem, was man gewöhnlich Hellsehen, Helihören nennt, wird nun nicht der ganze Mensch der Welt gegenübergestellt,
sondern es wird in krankhafter Weise nur ein Teil der Welt gegenübergestellt, so daß der Mensch nicht hinausgeht über das Denken, sondern hinuntergeht; nicht in das Übersinnliche sich erhebt, sondern in das Untersinn-liche sich herunterrückt. Dadurch, daß er in diesem gewöhnlichen Heilsehen weniger von seinem Organ ergreift als im gewöhnlichen Denken, in diesem gewöhnlichen Hellsehen, also dadurch, daß er nur einen Teil seines Organismus ergreift, kommt er zu Halluzinationen, zu Illusionen, die gewiß auch auf eine Realität hindeuten, aber auf eine solche, die weniger wirklich ist als unsere gewöhnliche Sinneswirk-lichkeit, die wir zwischen Geburt und Tod erleben. Dieser gewöhnliche Hellseher mit seinem untersinnlichen Hell-sehen, das eben entweder verstanden werden muß als etwas, was unter die gewöhnliche Wirklichkeit hinunter-gehen muß oder sonst verkannt wird und zu Träumerei und Phäntästerei, zu krankhafter Weltanschauung führt, dieses untersinnliche Hellsehen beruht darauf, daß man weniger von der Welt sieht, als man durch das gewöhnliche Vorstellen der Sinnenwelt wahrnimmt. Man geht sozusagen auch aus der Welt heraus, aber auf eine krankhafte Weise; man beschränkt sich auf etwas, was unter der Wirklichkeit des gewöhnlichen Erlebens liegt. Und dieses halluzinierende, illusionierende Hellsehen hängt stärker an der Körperlichkeit, und jetzt an der krankhaften Körperlichkeit, als das gewöhnliche Denken, Fühlen und Wollen.
Daher steht Geisteswissenschaft auf dem Standpunkt, daß gerade mit dem, was wahres Hellsehen, wahres Hell-hören ist, alle diese krankhaften Kräfte, die den Menschen zu untersinnlichem Anschauen führen können, überwunden werden. Was der wirkliche Geistesforscher entwickelt, ist nicht dasselbe wie das, was der krankhafte Mensch entwickelt, wenn er, wie man es so nennt im gewöhnlichen
Leben, hellsichtig wird und zu Halluzinationen kommt, sondern es ist gerade das, was die Hälluzinations-Kräfte im Menschen überwindet, was alle Halluzinätions-Kräfte im Menschen ausrottet, was all dasjenige, was zu Illusionen führt, tötet im Menschen. Zur geistigen Wirklichkeit kommt man eben gerade dadurch, daß man sich nach der anderen Seite entfernt von jenem krankhaften Ins-UntersinnlicheHinuntertauchen, was man im gewöhnlichen Leben Hellsichtigkeit oder Hellhörigkeit nennt. Daher ist dasjenige, was hier geschildert worden ist, das ja gerade darin besteht, daß man nicht wie beim gewöhnlichen Hellsehen tiefer in seinen Organismus hinuntertaucht, sondern sich über ihn erhebt, unabhängig von ihm wird, und dadurch in der geistigen Welt schaut und hört, ein Hellsehen, das im Gegensatz zum gewöhnlichen Helisehen ein absolut gesundender Prozeß ist. Es kann nur gesundend sein, kann nur zu einer Erhöhung alles illusionsfreien menschlichen Erlebens führen gegenüber dem Erleben, wie es in der gewöhnlichen Sinneswelt vorhanden ist. Während der Hälluzinierende, der Illusionierende, derjenige, den man oftmals im gewöhnlichen Leben einen Hellseher nennt, eben ein Phantast ist, weil er in das Untersinnliche hinuntergeht, ist bei dem, der wahres Helisehen und wahres Hellhören entwickelt, dasjenige, was gesunde Lebensauffassung ist, nur eben erhöht, so daß bei ihm sogar viel weniger eine Illusion möglich ist gegenüber der Welt, als bei demjenigen, der bloß mit seinen gesunden fünf Sinnen und seinem gesunden Menschenverstand in die Welt hineingeht.
Hier liegt ein Quell unendlicher Mißverständnisse, weil man immer wieder und wieder das, was als wahres Hell-sehen geschildert worden ist, mit demjenigen verwechselt, was man im trivialen Leben so oftmals Hellsichtigkeit, Hell-hörigkeit und so weiter nennt, was aber auf irgend einen
Defekt im physischen Organismus zurückgeht. Man kann einen solchen Defekt haben oder durch allerlei Unnatürlichkeiten selber hervorrufen, insofern ja dadurch auch bequemer und leichter zu erreichen ist, was man mit dem verwechselt, was durch eine Fortbildung der gesunden menschlichen Anschauungsweise erreicht werden kann. Das muß ausdrücklich betont werden, daß das Überwinden des unter-sinnlichen Verhaltens der Seele gerade dasjenige ist, was in der allerbesten Weise - viel gesünder als durch den gesunden Menschenverstand - gerade durch eine wahre Hellsichtigkeit und wahre Hellhörigkeit erreicht wird.
So kann man sägen: Geisteswissenschaft ist ein Aufsuchen - man redet nicht einmal richtig, wenn man von einer Fortentwickelung der Seele spricht -, es ist ein Aufsuchen desjenigen, was in der Menschenseele und im Men-schengeist als die tieferen Kräfte liegt, auf die man nur den Blick nicht hinrichtet, weil man sozusagen das Geistesohr und Geistesauge, das Organ dafür nicht geschaffen hat und den Blick im gewöhnlichen Leben nicht darauf hinrichtet. Ein Aufsuchen der ewigen Kräfte der Menschenseele ist es. Und wenn man das festhält, dann kommt man dazu, folgendes zu sagen, das ja, wenn man es so ausspricht, überraschend sein kann, das aber für den, der den eigentlichen Tatbestand durchschaut, eine Selbstverständlichkeit ist. Äußerlich angeschaut, ist Geisteswissenschaft, das heißt die wirkliche Erkenntnis der Menschenseele und des Menschen-geistes, heute noch etwas, was von dem größten Teil der Menschheit als eine Phantästerei, als Träumerei, als etwas Unsinniges angesehen wird, dem sich eben so ein paar Menschen hingeben können, denen eigentlich ihr gesunder Menschenverstand durch irgend etwas abhanden gekommen ist. Innerlich angesehen, der Wahrheit nach angesehen, hat eigentlich der Geistesforscher keinen Gegner in der Welt.
Und das Kuriose ist dabei, daß der Geistesforscher nichts anderes behauptet als etwas, worin ihm im Grunde genommen jeder Mensch zustimmt - mit den ällergeringsten Ausnahmen, die wiederum auf besonders absonderlichen Seelenzuständen beruhen. Mit geringen Ausnahmen muß ihm eigentlich jeder Mensch in Wahrheit zustimmen - nur weiß er es nicht, nur glaubt er, daß er ihm nicht zustimmen kann. Das ist es! Denn wer sich nur dessen bewußt ist, daß er denkend durch die Welt geht, der kann in Wirklichkeit nicht mehr Gegner des Geistesforschers sein. Denn jeder, der denkend durch die Welt geht, zeigt damit, daß das Denken etwas in der Welt bedeutet; er gibt damit zu, daß das Denken ein Prozeß ist, der sich über der Sinnenwelt abspielt. Indem wir denken, erleben wir innerlich etwas, was sich über der Sinnenwelt abspielt, was nicht zur Sinnen-welt hinzugehört, man kann vielleicht auch sagen, was sich unter der Sinnenwelt abspielt. Das gibt man in dem Momente zu, wo man genau denkt. Man gibt es eben nicht zu, und dadurch ist man Gegner der Geisteswissenschaft. Man gibt es in dem Momente zu, wo man sich klar macht, daß das Denken auch im gewöhnlichen Leben kein Bild von der äußeren Welt entwickeln könnte, wenn es in dieser äußeren Welt, in der Sinnenwelt darin stände. Denn wenn das Denken zur Sinnenwelt gehörte, so könnte es ebensowenig ein Bild machen der Sinnenwelt, wie die Flamme ein Bild machen kann von der Kerze. Sie ist Produkt der Kerze, aber das Produkt kann niemals ein Bild machen. So daß derjenige, der in diesem Sinne Gegner der Geistigkeit des Denkens sein will, überhaupt Gegner der Geistigkeit sein müßte. Denn das Denken ist in sich selbst etwas über der Sinneswelt, weil es durch innerliche Aufraffung, durch eine innerliche Seelentätigkeit hervorgerufen wird, also nicht bloß durch Prozesse, die sich so abspielen wie die übrigen
Leibesprozesse. Das ergibt sich eben einfach dadurch, daß man dieses Denken urteilen läßt über die Sinnenwelt. Und indem man dieses zugibt, daß das Denken nicht heraus-quillt aus der Sinnenwelt, sondern daß es urteilt über die Sinnenwelt, stellt man sich schon auf den Standpunkt, daß das Denken als solches nicht zur Sinnenwelt gehört, daß es etwas Geistiges ist. Wollte man sich auf den Standpunkt stellen, daß es nichts Geistiges ist, daß es aus der Sinnen-welt herausquillt, dann müßte man seine Gegnerschaft ganz anders einrichten. Und nur der darf wirklich konsequenterweise Gegner der Geistigkeit des Denkens sein, der sagt:
Ich glaube nicht, daß dieses Denken irgendeine Bedeutung über die Sinneswelt hat, also höre ich auf zu denken. Ich erkräfte mich nicht innerlich zu irgend einem Gedanken, sondern ich überlasse mich der Sinneswelt; da muß ja das Denken dann von selber kommen. - Wer das Denken nicht abschäfft, kann niemals Gegner der Geistigkeit des Denkens sein, wenn er nur wirklich richtig denkt; wenn er nur mit seinem Denken bis zu den entsprechenden Konsequenzen geht. In der Tat, in der Praxis sind alle diejenigen, die denken, dieser Anschauung. Denn jede andere Anschauung ist nicht eine Gegnerschaft gegen die Geisteswissenschaft, sondern eine Gegnerschaft gegen sich selbst. Man behauptet etwas anderes, als man in der Praxis übt. Wer das Denken überhaupt ausübt, bekennt damit, daß das Denken geistig ist.
Geisteswissenschaft vollbringt nun nichts anderes, als daß sie dieses Denken aus der Abstraktion, aus der Bildhäftigkeit, aus dem, daß es bloß etwas bedeutet, heraushebt und daß sich der Geistesforscher so in den Prozeß des Denkens hineinlebt, daß ihm das Denken ein Erleben wird. Und in dasselbe Erleben, das man sonst im Denken hat, auf das man aber nur nicht achtet, so daß man nicht einsieht, daß
es ein Erleben ist, in dieses Erleben steckt man sich hinein. In dem Augenblick, da man das Denken nicht mehr nimmt wie im gewöhnlichen Leben, wo es etwas bedeutet, etwas äbbildet, sondern so nimmt, wie man sonst im Leibe physisch lebt, den Lebensprozeß erlebt -, in diesem Augenblick schleicht sich die geistige Welt, schleichen sich geistige Wesenheiten, schleicht sich die wirklich spirituelle Welt in das erlebte Denken hinein, und das andere ist ein selbstverständlicher Fortgang.
Der Geistesforscher braucht sich also auf nichts anderes zu berufen, als was jeder Mensch eigentlich zugibt, der das Denken praktisch übt. Denn in dem, was er zugibt, bei der Denkausbildung, findet sich die geistige Welt. Im Denken steckt der Mensch schon heilsehend in der geistigen Welt drinnen, nur daß er statt des lebendigen Denkens dasjenige Denken bekommt, das bloß ein Spiegelbild ist. Daher kann ich hier den schon oftmals geschilderten Vergleich wieder aussprechen. Wenn man vor einem Spiegelbild steht, erlebt man sich innerlich, aber man erlebt sich so, daß der Spiegel das Bild gibt. Es ist im Spiegel alles, nur daß er das tote Bild gibt, das nicht erlebt wird. Wie wenn man sich das Spiegelbild wegsuggerieren könnte und nun das Ganze bildhaft in sich erleben würde, so ist es, wenn man im Denken von seiner Bildnatur abkommt, die sich wirklich zu dem erlebten Denken wie die Spiegelung verhält, und zu dem Erleben des Denkens selber übergeht. Da schleichen sich eben, wie gesagt, hinein die geistigen Welten in das Denken. Das eigene Ich, das tiefere Ich, der in uns lebende Zuschauer schleicht sich also in die in der geschilderten Weise innerlich durchbildete Welt des Wollens hinein.
Wiederum ist ist im Grunde genommen jeder Mensch, wenn er sich selbst versteht, Anhänger der Geisteswissenschaft, auch in bezug auf dieses Wollen. Denn wer nicht
zugibt, daß im Willen etwas steckt, was ebenso innerlich bewußt ist, wie wir bewußt sind in unserem gewöhnlichen physischen Denken, wer nicht zugibt, daß da ein weiterer, innerlicher Mensch im Menschen drinnen steckt, kommt durch konsequentes Denken dazu, sich sagen zu müssen:
Leugne ich, daß sich da etwas in mir vollzieht, was sich zu mir verhält, wie meine Anschauung sich in der Tat zur äußeren Natur verhält, glaube ich, daß der bloße physische Organismus mein Wollen vollzieht, dann muß ich die Konsequenz daraus ziehen: dann muß ich mich nicht mehr innerlich zu einem Wollen aufraffen, dann muß ich nicht daran glauben, ich könnte einen Schritt im Leben durch einen innerlich geistig gefaßten Antrieb machen, sondern ich muß mich hinlegen und warten, bis mein Organismus in der Welt herumwandelt und dasjenige tut, dem ich dann bloß zuzuschauen brauche. Wer also das Wollen nicht so leugnet, daß er sich auf den Diwan hinlegt und sagt:
Ich leugne das Wollen, das ist im physischen Organismus verankert, - der glaubt an diesen inneren Zuschauer. Und das andere ist dann nur ein Weiterentwickeln dieser unmittelbar durch wahres, gesundes, inneres Sichversenken erlangten Überzeugung, daß dieser Zuschauer da ist. Daher kommt der Geistesforscher zu der Einsicht: Gegner habe ich eigentlich gar nicht in Wirklichkeit. Gegner sind die Menschen immer nur von sich selber. Sie geben in der Theorie, durch ihre mißverstandenen Begriffe nicht zu, was sie praktisch, indem sie leben, zugeben. Der Geistesforscher spricht einfach aus, was in jedes Menschen natürlicher Welt-auffassung liegt. Und so wird man immer mehr und mehr einsehen, daß der Geistesforscher nichts anderes ausspricht, als was die Menschen eigentlich im gewöhnlichen natürlichen Leben zwischen den Zeilen des Lebens unbewußt als ihre greifbare Weltanschauung darleben, wenn sie es
auch aus Mißverständnis nicht aussprechen. Das wird man immer mehr und mehr gerade gegenüber der Geisteswissenschaft einsehen. Dann wird Geisteswissenschaft nicht mehr als etwas Absonderliches erscheinen, sondern als die selbstverständliche Erklärung und als die selbstverständliche Durchgeistigung, die man für das Leben braucht.
Und so kommen wir als Geistesforscher auf diese Weise nach zwei Seiten hinaus aus derjenigen Menschennatur, die im gewöhnlichen Leben dasteht und die sich in der gewöhnlichen Wissenschaft betätigt. Wir kommen hinaus nach der Seite der Hellsichtigkeit, im wahren Sinne des Wortes verstanden, wie es dargestellt worden ist; auf der anderen Seite nach der Richtung der Hellhörigkeit, wo man sich hineinlebt in seinen eigenen Zuschauer, der dann mit anderen Geisteswesen in der geistigen Welt lebt, die der Mensch beschreitet, wenn er durch die Pforte des Todes geschritten ist. Man kommt da aber in eine unmittelbar innerliche Beweglichkeit, in eine Tätigkeit hinein; da ist alles ebenso tätig, wie hier alles passiv ist.
Wenn man sich nun das gewöhnliche Leben, die gewöhnlichen inneren Seelenerlebnisse ansieht, so muß man sagen:
Diese inneren Erlebnisse des Menschen sind so, daß fortwährend, ohne daß es der Mensch weiß, die Gegenstände der Hellsichtigkeit und Hellhörigkeit in ihm sind, daß fortwährend in seinem gewöhnlichen Seelenleben diese Gegenstände tätig wirksam sind. Es bleibt wirksam in uns, was von der geistigen Welt in uns hereinkommt, indem es durch die Empfängnis und die Geburt geht. Das ist dasjenige, was der Mensch, wenn er es nun bemerkt, mehr das Geistige in seinem Seelenleben nennt. Dasjenige aber, was durch die Pforte des Todes schreitet, was in dem Willen liegt, so liegt, daß es wie ein innerer Zuschauer ist, das ist dasjenige, was der Mensch, wenn er es nicht im Zusammenhänge mit dem
ganzen Mäkrokosmos, sondern im gewöhnlichen Seelen-erlebnis in sich hat, mehr das Seelische in sich nennt. Und das Geistige und Seelische in all der Mannigfaltigkeit, in all der Vielartigkeit, wie sie auftreten, führen zuletzt auf diese beiden Einschläge in die menschliche Natur zurück. Der Geist, der liegt immer in dem, was wir nach der Denkseite hin entwickeln. Man wird dadurch geistreich -wenn das Wort jetzt nur im technischen Sinne gebraucht werden darf -, daß man, ohne die Wege des Geistesforschers zu gehen, die einem da noch im Unbewußten bleiben können, dieses Denken zu immer größerer innerer Beweglichkeit, zu immer größerer Erfindungsgabe ausbildet, so daß einem Gedanken reichlicher zufließen, so daß sie verwandter sind dem, was innerlich zusammengehört in der Ideenfolge, die man haben kann. Durch dieses Geistreicherwerden, in dem also das lebt, was seiner wirklichen Wesenheit nach durch den angeführten Denk-Meditationsweg gefunden werden kann, durch dieses Geistige in der Menschenseele lernt man vorzugsweise im Leben - aber jetzt praktisch, nicht theoretisch gemeint - dasjenige, was man Menschenkenntnis nennen kann. Man lernt, was einen an-leitet, den Menschen in der richtigen Weise in die Welt hineinzustellen. Man lernt, was überhaupt die Zusammenhänge der Welt vor der eigenen Seele enthüllt. Man entfernt sich dadurch in einer gewissen Weise, indem gerade der Geist sich ausbildet, von dem, was sich so recht als physischer Mensch ausdrückt. Man nähert sich durch die Ausbildung seines Geistigen dem, was nun gerade vorzugsweise tätig wär, damit wir in die Sinneswelt hereinkamen. Dadurch entfernt man sich in einer gewissen Weise durch das Geistreichwerden von dem, was unmittelbar in der Sinneswelt erlebt wird. Daher rührt es, daß man durch das Geistreichwerden in eine gewisse kühle Atmosphäre hineinkommt.
Aber durch das Überschauen der weisheitvollen Zusammenhänge der Welt, die sich vor der inneren Seele enthüllen, kann man in dieser Richtung weit kommen. Man kann vieles zusammentragen in der Welt, empfinden, was der andere nicht empfindet, in der Lage sein, vieles auszusprechen an Weltzusammenhängen, auch Dinge erfinden, die dann aus den Weltzusammenhängen heraus in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Man kann auf diese Weise weit kommen. Das ganze verläuft so, daß die Welt, ich möchte sagen, lichtvoller wird, daß sie für uns durchschaubar wird. Es ist das Geistreichwerden, das Aufgehen des Geistes im menschlichen Innern wie eine Vorstufe, wie eine noch nicht von wahrer Hellsichtigkeit durchtränkte Vorstufe eines Hineingehens in die Welt, aus der wir herausgekommen sind durch die Empfängnis oder durch die Geburt.
Man wird nicht seelenreich, sondern man wird seelenvoll. Das Seelische liegt, indem es sich entwickelt, in der Vertiefung des inneren Erlebens. Wer das Seelische in sich vertieft, kommt noch nicht zum hellhörigen Erleben seines inneren Beobachters, aber dieser Beobachter wirkt in ihm auf eine besonders starke und intensive Weise, so daß sein inneres Seelenerleben wirklicher wird, als es sonst ist. Er wird seelenvoll. Dadurch lernt er weniger im Leben das, was Menschenkenntnis ist, was umfassendes, lichtvolles Anschauen der Weltverhältnisse und des Zusammenhanges des Menschen mit den Weltverhältnissen ist, aber er wird innerlich realer in seinem Erleben. Die Seele wird intensiver, sie wird innerlich erkraftet. Was im Willen lebt, man möchte sagen, im Willen schwingt und flutet während des Lebens, Lust und Leid, Freud' und Schmerz, die auf- und abiluten und im Grunde innerlich zusammenhängen mit der Willens-natur des Menschen - es könnte das streng psychologisch
bewiesen werden, aber dazu ist keine Zeit -, das wird in einer intensiveren Weise erlebt, wenn der Mensch in dieser Weise erstarkt in sich. Nicht nur was in ihm selbst als Lust und Leid vorhanden ist, was an inneren Gefühlen aus ihm aufsteigt, wird intensiver erlebt, sondern er kann gerade durch dieses Erstarken des Seelischen seine Lust und sein Leid ausdehnen auf dasjenige, was Lust und Leid, was Freude und Schmerz, was Glück und Elend in anderen Wesen ist, die um ihn herum sind. Das hängt mit dem Seelenvollen zusammen. Das aber hängt wiederum zusammen mit dem, was als Wesen der einzelnen Individualität durch die Pforte des Todes geht, was mitgenommen wird durch die Pforte des Todes, indem es sich in der heute vor acht Tagen beschriebenen Weise mit dem verbindet, was nun der Geist ist und was durch die Meditation im Denken erreicht wird.
So wird man stark in der Liebe, indem die Seele sich er-stärkt. So wird man licht im Geiste, wenn der Geist sich erstarkt. Aber indem man den Geist erstarkt, entfremdet man sich ja auf der anderen Seite in der Weise, wie ich es geschildert habe, dem Zusammenhänge mit der innerlichen Leibeswirklichkeit, mit der Wirklichkeit, die einen in die Sinneswelt hineinstellt. Daher muß man nicht in einer falschen Weise wirklichkeitsfeindlich werden, denn sonst könnte man mit diesem Entfernen nach der Richtung des Geistigen, mit dem Verlassen der Leiblichkeit sehr leicht wirklichkeitsfremd werden. Man könnte den Zusammenhang verlieren, den das lebendige Denken mit der Wirklichkeit hat, auch wenn er nicht bewußt wird, sondern nur unbewußt erlebt wird, wie es im gewöhnlichen Leben der Fall ist. Dann würde man durch eine Abirrung des Geistes dahin kommen, wo sich die Gedanken - einer aus dem anderen - herausspinnen, wo man aber in diesen Gedanken
nicht mehr so intensiv drinnen lebt, daß man den Zusammenhang mit der Wirklichkeit hat. Man kommt gerade dann in einen seelischen Vorgang hinein, innerhalb dessen man denken kann, aber man verliert den Zusammenhang mit der Wirklichkeit. Man wird zum Zweifler, zum Skeptiker. Und man wird, wenn sich das bis zu einem gewissen Grade steigert, alle Qualen der Skepsis durchmachen können, man wird dasjenige, was im Denken sich vollzieht, abspielt, nur für Sophistik halten können. Man wird zum Skeptiker, der nicht aus dem Quell der Wirklichkeit seine geistige Nahrung hat.
Und indem man gewissermaßen nach der anderen Seite abirrt, nach jenem Prozeß, der den Willen innerlich erkraftet, der den Kreis des innerlichen Lust- und Leid-, Freud- und Schmerzerlebens erweitert über dasjenige hinaus, was in einem selbst ist, kann es sein, daß diese innere Seibstes-Nätur noch so stark ist, daß sie das, was sich er-stärkt, von sich nicht losläßt. Dann kann es sein, daß, während der Mensch in der Tat mit der Umgebung lebt, sein Mitfühlen, sein Miterleben mit der Umgebung seinen Egoismus erstarkt. Und es kann dann sogar sein, daß sich das Mitfühlen, Miterleben verbirgt hinter der Maske des Egoismus, daß das Anschauen des Schmerzes und Leides eigentlich nur durch das, was es in einem selbst anrichtet, zum Miterleben wird, währenddem das wirkliche Mitgefühl darinnen besteht, daß man das eigene Selbst ausbreitet über dasjenige, was der ändere erlebt. So kann es sein, extrem ausgedrückt, daß das Unangenehme, das Unbehagliche, das uns der Schmerz bereitet, dann in ganz egoistischer Weise erlebt wird, wenn das innere Selbst das erstarkte Seelenleben nicht entläßt.
Aber deshalb wurzelt die Liebe doch in dem erstarkten Seelenleben. Und Menschenseele ist dasjenige, was den
Quell der Liebe gerade so in sich trägt, wie den Quell der Welterkenntuis dasjenige in sich trägt, was Geist ist. Geist eröffnet uns, offenbart uns das Licht, das uns die Welt beleuchtet; Seele zündet in uns dasjenige an, was uns mit jeglichem Wesen, mit dem Innern eines jeglichen Wesens verbindet, was uns als Mensch unter Menschen, was uns überhaupt unter anderen Menschen unmittelbar leben läßt. Liebe ist das Urelement des Seelischen. Licht in der geistigen Welt ist das Urelement des Geistigen. Wer nun also wirklich den geistesforscherischen Weg, sei es auch nur ein Stück, gehen will - denn schon wenn man ihn nur ein Stück geht, kann man sich davon überzeugen -, der erreicht zu sehen, daß Wahrheit ist in dem, was der Geistesforscher zu behaupten hat.
Wer den Weg der Geistesforschung geht, hat daher vor allen Dingen darauf zu achten, daß dasjenige, was er als Geist entwickelt, nicht die Grundlage des seelischen Lebens vermissen läßt. Der Geist kann sich nur dadurch von der Wirklichkeit der eigenen Persönlichkeit und damit von dem Ergreifen der Weltwirklichkeit entfernen, daß in der Seele nicht Liebe waltet. Wenn in der Seele Liebe waltet, wenn die Seele durchwallt und durchkraftet wird von dem Element der Liebe, dann ist sie stark genug, um den Geist zu halten, in welch lichtvolle Höhen er sich auch erheben mag. Und wiederum, wenn der Mensch es nicht verschmäht, Weisheit zu suchen in der Welt, weisheitsvolle Zusammenhänge - nicht Weisheit, die mit Gescheitheit identisch ist, sondern demutsvolle Weisheit, die in der Welt waltet -, wenn er diese Weisheit in sich selber sich vergegenwärtigen will und nun nicht bloß mit dem Verstande, nicht bloß mit der Abstraktion erfaßt, sondern untertauchen läßt in die liebevolle Seele; wenn alles das, was Weisheit, Licht ist, durchwärmt wird von dem, was in der Seele aufsteigt, was
den Menschen ins Leben als einen Menschenliebenden hin-einstellt, so wie ihn anderseits die Weisheit, der Geist zum Menschenkenner macht, dann hinwiederum ist dieses geeignet, den Menschen vom Egoismus abzuleiten und die Liebe wirklich hinaufzutragen in dasjenige, was er, indem er zu der Liebe die Erkenntnis hinzufügt, als ein Überschauen der Welt erleben kann: der Geist, der in der lieben-den Seele wurzelt, warme Seelenliebe, die sich vom Geiste durchleuchten läßt, das ist ein Menschheitsideal.
Und im Grunde genommen gibt eben dieses Menschheitsideal ein jeder zu, wie das ausgeführt worden ist. Geisteswissenschaft hat nur durch Mißverständnisse Gegner. So daß man auch in besonderem Falle sagen kann: der Geistes-wissenschafter ist wirklich mit dem, was die Leute sagen, ja gerade oftmals mit dem, was sie gegen die Geisteswissenschaft sagen, völlig einig. Wenn zum Beispiel im September-Heft des «Neuen Merkur» Leonard Nelson einen sehr geistvollen Aufsatz über die gegenwärtigen Zeitaufgaben in bezug auf Philosophie geschrieben hat, so scheint es so, als ob all das, was Nelson, der zu den geistreichsten Menschen der Gegenwart gehört, dort ausspricht, sich prägen ließe als Gegnerschaft gegen die Geisteswissenschaft. Die Gegenprobe wäre die, daß der Geistesforscher zu nichts, was dieser Mann sagt, nein zu sagen braucht. Da stellt Leonärd Nelson auf der einen Seite dar, wie der Mensch ausartet, wenn er bloß den Verstand ausbildet; wie er dadurch in eine Abstraktion hineinkommt, die ihn zu keiner wirklich lebens-vollen Philosophie führen kann. In viel konsequenterem, höherem Sinn muß das der Geistesforscher zugeben, der die Qual der Skepsis, der Zweifelsucht, die zum Leiden wird, aufzeigt, wenn der Geist in einseitiger Weise, ohne den Wurzeigrund der Seelenliebe, sich entwickeln will. Nur weist Nelson eben auf das Denken hin und weiß nichts
davon, daß sich in dieses selbe Denken, wenn es erlebt wird, eine ganz andere Welt einschleicht, eine Welt, die viel inhaltsreicher ist als die sinnliche Welt und die ihm verschlossen bleibt. Man ist mit dem, was er positiv behauptet, völlig einverstanden. Nur läßt er sich nicht darauf ein, mit sich selbst einverstanden zu sein, er mißversteht sich selber. Ebenso ist man einverstanden, wenn er nach der anderen Seite sagt: Wenn der Mensch sich nun in seine eigene Natur vertieft, in sich hineinbrütet, da kommt ein falscher Mystizismus zutage, da kommt der Mensch in ein nebuloses innerliches Träumen hinein. Nur durch das Denken will er nicht verankert sein; gerade vom Gefühl glaubt er, dem Weltengrunde näher zu sein. In Wahrheit ist es nur ein Subjektives, was da erreicht wird. Vollständig einverstanden ist der Geistesforscher damit, was in positiver Weise gesägt wird. Nur weiß der Verfasser des Aufsatzes wiederum nicht, daß man damit etwas ganz Neues entdeckt, wenn man nur den rechten Weg geht. Er versteht sich selber nicht und widerlegt sich im Grunde nur selber, indem er eine ändere Anschauung hat, als er, wenn ich den paradoxen Ausdruck gebrauchen darf, als Anschauung betätigt, praktisch ausübt. Dasjenige, was er tut, ist völlig übereinstimmend mit der Geisteswissenschaft. Der Geistes-forscher ist im Grunde genommen von dem, was die Menschen wirklich meinen, kein Gegner; und sie sind nur deshalb Gegner, weil sie sich mißverstehen und dadurch ihn mißverstehen, an ihm vorbeireden.
Das sieht man auch, wenn der Mensch, der da glaubt, auf einem anderen Boden der Weltanschauung als dem der Geisteswissenschaft stehen zu müssen, und zwar gerade aus den sicheren Ergebnissen der Naturwissenschaft heraus, sich einmal gehen läßt und dasjenige, was er sich nur vormacht, ersetzt durch das, was in ihm auf naturgemäße Weise lebt.
Ich habe gestern über einen Denker gesprochen, und aus dem Vorgebrachten werden Sie ersehen haben, daß ich diesen Denker aufs höchste achte. Es ist der österreichische Philosoph Bartholomäus von Carneri. Ich schätze Carneri deswegen, weil er mit so starkem Geiste versuchte, eine Ethik, eine Sittenlehre aus dem Darwinismus heraus zu entwickeln. Aber er steht auf dem Boden, der Gedanken hervorbringt, die sich selbstverständlich zu dem, was die Geisteswissenschaft sägt, gegnerisch verhalten, weil er sich selber wiederum nicht versteht, weil er Dinge vorbringt, die dem widersprechen, was er betätigt. Nehmen wir einmal an, ein solcher Mann läßt sich gehen und lebt innerlich das, was er nur in einer für sich selbst mißverständlichen Weise ausdenkt. Nehmen wir an, ein solcher Mensch käme zu einem Augenblick, wo er sich dem Leben überließe und nicht seinem auf schiefen Bahnen gehenden Denken. Nehmen wir an, er überließe sich elementar dem Leben und spräche aus innerer Kraft, derselben Kraft, die ihn auch zu seinem schiefen Denken gebracht hat. Bei Carneri können wir das beobachten. Carneri war eigentlich schon als Krüp-pel geboren worden, mit einer verkrümmten Wirbelsäule, war unter den größten Qualen herangewachsen und ein sehr älter Herr geworden. Das Leben war für ihn wirklich Qual. Er konnte nur mit der linken Hand schreiben, die rechte Hand war das ganze Leben hindurch völlig gelähmt, ebenso sonst die ganze rechte Seite in gewisser Beziehung unbrauchbar, dazu fortwährend jene Störungen des Atmens, die mit einem solchen Organismus verbunden sind. Dabei stand der Mann ganz auf darwinistischem Boden und suchte zugleich eine Weltanschauung auch für die Ethik zu begründen, die absieht von dem, was man in mißverstandener Weise Dualismus nennt, aber eben in mißverstandener Weise. Schließlich könnte man auch behaupten: Wasser ist
nur eine Einheit. Wasser ist aber keine Einheit, denn es besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Man durchbricht wahrhaftig nicht das Monon, wenn man von Leib, Seele, Geist spricht, aber Carneri glaubte das nun einmal. Wir können ihn da gerade fassen.
Ich bringe da etwas aus dem Leben vor, das selbstverständlich für viele, die gewohnt sind, in der gegenwärtigen Weise philosophisch zu denken, als etwas Belächelnswertes aufgefaßt werden kann. Aber es zeigt wirklich anschaulich, wie Carneri, also der Mann, der die Ethik aus dem Materialismus heraus zaubert, der die selbständigen Kräfte des menschlichen Innern eigentlich theoretisch leugnet, in einem Moment, der ihm aufdrängte aus seinem tiefsten Innern heraus zu sprechen, sein eigener Gegner wird und für einen Moment so spricht, wie wenn er der beste Anhänger einer Lehre wäre, welche die Selbständigkeit des Geistes und der Seele des Menschen, wie ich das heute dargestellt habe, anerkennt. Da erzählt eine Freundin von Carneri, Marie Eugenie delle Grazie, wie sie einmal mit ihm, als er schon ein hohes Alter erreicht hatte, zusammengewesen war, nachdem er wiederum einen Anfall gehabt hatte, der so recht zeigte, wie die Unbehaglichkeiten das Leben zur Qual machen können. Sie sägte zu ihm: «Wie konnten Sie das ertragen all die Jahre her und sich dabei dieses Lächeln bewahren, diese Güte und Lebensfreude?» Marie Eugenie delle Grazie, die österreichische Dichterin, sagte es nicht nur, sondern sie «schrie gequält auf», als dieser Mensch die Schwierigkeit des Atmens so qualvoll empfand und einen Erstickungsanfall hatte. Dann beschreibt sie weiter:
«Langsam hob er das tief auf die Brust herabgesunkene Haupt, wischte mit der bebenden Linken den Schweiß von Stirn und Wangen, atmete tief auf und sah mich an mit einem Blick, der wieder ganz Sonne und Überwindung war.
, lächelte er dann. , er lächelte aufs neue, - er wies auf seinen noch zuckenden Körper - ...»
Weiter schreibt Marie Eugenie delle Grazie: «Draußen war es Frühling. Ein blühender Apfelbaum wiegte sich vor dem offenen Erkerfenster. Die leuchtenden Dulderaugen an seiner Schönheit festsäugend, sprach Carneri leise: »
Und er hat das oft getan. Aber er ist mit seinem Denken nicht nachgekommen jener inneren Gesinnung, die die Stärke des Seelischen betont in diesen Augenblicken, wo er sich als der Sieger über das bloß Äußerliche des Leibes-lebens fühlte.
Die materialistische Anschauung glaubt: wenn man den Menschen als Leibeswesen vor sich hat, so gehen da gewisse Vorgänge in seinem Leibe vor sich, und diese Vorgänge haben dasjenige zur Folge, was Denken, was Fühlen, was Wollen ist. Der Geistesforscher steht nicht auf dem Boden, diese Anschauung widerlegen zu wollen. Das ist eben das Eigentümliche, daß sein Verhältnis zu den anderen Wissenschäften
nicht das des Widerlegens sein kann. Sondern er steht auf dem Boden, das alles zuzugeben: Ja, es ist ganz richtig, daß jeder Gedanke, der sich äußert, einem Gehirn-vorgang entspricht. Da geht etwas vor im Gehirn!
Das wird das höchste Ideal der Naturwissenschaft sein, aufzuzeigen, welches der organische Vorgang des Denkens ist. Aber wie steht nun dieser organische Vorgang zu dem Denken? Ich kann es jetzt nur vergleichsweise ausdrücken, was aber ausführlich dargestellt werden könnte. Doch gerade durch einen Vergleich wird es recht gut verstanden werden können. Wenn der Mensch über eine Straße geht und die Straße etwas weichen Boden hat, so daß sich jeder Tritt einprägt, sind hinterher die Spuren zu sehen. Da könnte jemand kommen und sagen: Ja, da sind gewisse Ausprägungen in der Erde - ich untersuche jetzt in der Erde die Kräfte, die diese Ausprägungen vom Inneren der Erde heraus formen, die bewirkt haben, daß der Weg in solch einer Weise geformt worden ist. Jemand, der nur auf die Erde schaut und vergißt, daß ein Mensch darüber gegangen ist, könnte das glauben. Gerade so verfährt derjenige, der im Gehirn und in den wirklichen Prozessen, die sich darin abspielen, die das Denken begleiten, die Ursachen des Denkens sucht. So wenig wie die Formen der Tritte aus dem Innern der Erde heraus kommen, so wenig kommt dasjenige, was da im Gehirn zu finden ist, aus dem Innern des Menschen heraus, sondern es wird auf lebendig seelischem Wege hineingeprägt, gerade so wie die Tritte in den Boden. Und wie derjenige falsch denkt, der die Tritte aus den Kräften der Erde selber ableiten will und nicht aus dem Menschen, der sie hinein getreten hat, ebenso falsch denkt derjenige, der glaubt, aus den inneren Vorgängen des Nervensystems das ableiten zu können, was sich imVerlaufe des Denkens unter diesen Nervenvorgängen im Gehirn abspielt.
Das sind die Spuren, die diese lebendige Seele einprägt. Diese lebendige Seele sieht man nicht darinnen, aber sie wirkt und west darinnen. Und sie kann nicht gefunden werden durch äußere Forschung, sondern ihre Wege, ihre Schicksale, ihr Leben können nur gefunden werden durch diejenigen Prozesse, die rein innere Seelen-prozesse sind und von denen heute gesprochen worden ist als den Wegen, auf denen man findet Menschenseele und Menschengeist!
Ich darf zum Schlusse in ein paar Worte paradigmatisch zusammenfassen, was ich auszusprechen versuchte als die Charakteristik des Menschengeistes, der vor allen Dingen wirksam ist, um aus der ganzen Welt herein die Kräfte zu tragen, aber nicht bloß Kräfte, wie die äußeren Naturkräfte, sondern solche, die jetzt wirklich Kräfte des inneren Menschen sind und innerlich durchgeistigen, was durch die Vererbungsströmung gegeben ist. In dem aber lebt und drückt sich aus - dadurch, daß es gefunden werden kann als ein innerlicher Zuschauer, oder vielleicht besser gesagt, als geistiger Zuhörer im Willen - das Seelische. So durchdringt den Menschen Seele und Geist. So sind Seele und Geist aber auch beteiligt an der Art, wie sich der Mensch nicht nur in die zeitlichen, sondern in die ewigen Welten hineinstellt. Und aus dem, was gesagt worden ist, geht hervor, daß der Geist hinaufführt zu jenen lichten Höhen, wo wir die Welt durchschauen und in ihrem Zusammenhange mit dem Menschen selber sehen können, wo die Seele den Menschen innerlich erstärkt, wo die Seele Quell ist dessen, was Menschenliebe ist, was Menschenerkenntnis ist. Geist ist etwas, was unter dem Symbol des Lichtes, aber eben des innerlichen Lichtes, angeschaut werden kann. Seele ist etwas, was unter dem Symbolum der inneren Wärme angeschaut werden kann, die sich ausbreitet über das ganze Leben und den
Kreis erweitert, in dem die Seele lustvoll und leidvoll, schmerzvoll und freudig das Leben durcherleben kann. So daß sich ausdrücken läßt dasjenige, was Verhältnis zwischen Menschenseele und Menschengeist ist, und wiederum, was zusammen Menschenseele und Menschengeist im Menschen sind, im gesamten Menschen, der da besteht aus dem Leiblichen, das aber der Träger ist des innerlichen Menschen, der sich selber durchgeistigt und den Leibesmenschen durchseelt, und der das eigentliche Ewige in dem Zeitlichen ist, - so daß sich dieses Verhältnis ausdrücken läßt durch die Worte, mit denen ich diese Betrachtung abschließen will:
Wenn der Mensch, warm in Liebe,
Sich der Welt als Seele gibt,
Wenn der Mensch, licht im Sinnen,
Von der Welt den Geist erwirbt,
Wird in Geist - erhellter Seele,
Wird in Seele- getragenem Geist
Der Geistesmensch im Leibesmenschen
Sich wahrhaft offenbaren.
FICHTES GEIST MITTEN UNTER UNS Berlin, 16. Dezember 1915
Wir versetzen uns nach Rammenau in der Oberlausitz, einem Orte in der Nähe von Kamenz, wo Lessings Wiege gestanden hat. 1769 sei das Jahr. Ein verhältnismäßig wenig großes Häuschen steht an einem Bach. Nachweislich seit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges war das Bandwirkerhandwerk bei den Geschlechtern dieses Hauses erblich. Ein durchaus nicht einmal mäßiger Wohlstand, sondern eigentlich ziemliche Armut herrschte in dem Hause. An dem Häuschen fließt ein Bach vorbei, an dem Bache steht ein siebenjähriger Knabe, verhältnismäßig klein, eher gedrungen für sein Alter gewachsen, mit roten Badten, mit lebhaften, aber in diesem Augenblidt von schwerem Leid zeugenden Augen. Der Knabe hat eben in den Bach hinein ein Buch geworfen. Das Buch schwimmt fort. Der Vater kommt aus dem Hause hinzu und wird etwa die folgenden Worte zu dem Knaben gesprochen haben: Gottlieb, was fällt dir wohl ein! Was dein Vater für teures Geld erworben hat, um dir eine große Freude zu machen, das wirfst du ins Wasser! - Der Vater war sehr böse, denn er hatte dem Knaben Gottlieb das Buch vor ganz kurzer Zeit als Geschenk gegeben, dem Knaben, der bis dahin aus Büchern nichts vernommen hatte als dasjenige, was man vernehmen kann aus der Bibel und aus dem Gesangbuch.
Was war nun eigentlich vorgegangen? Der junge Gottlieb hatte mit einer großen inneren Kraft bisher aufgenommen, was ihm gegeben worden war vom Inhalte von Bibel und
Gesangbuch, und er war ein Knabe, der gut gelernt hatte in der Schule. Der Vater wollte ihm eine Freude machen und kaufte ihm eines Tages zum Geschenk den «Gehörnten Siegfried». Der Knabe Gottlieb vertiefte sich in die Lektüre des «Gehörnten Siegfried» ganz hinein, und die Folge davon war, daß er gescholten werden mußte wegen seiner Vergeßlichkeit und Unaufmerksamkeit in bezug auf all dasjenige, wofür er sich vorher interessiert hatte, in bezug auf seine Schulsachen. Das ging dem Knaben zu Herzen. Er hatte sein neu bekommenes Buch, den «Gehörnten Siegfried», so lieb, er hatte solch tiefes Interesse, solche tiefe Anteilnahme dafür gefaßt. Aber auf der anderen Seite stand der Gedanke lebendig vor seiner Seele: Du hast deine Pflicht versäumt! Das ging in dem siebenjährigen Knaben vor. Da ging er hin zum Bach, und warf kurzerhand das Buch in den Bach. Er bekam seine Strafe, weil er dem Vater wohl die Tatsache und seine Vornahme sagen konnte, nicht aber den eigentlichen tieferen Grund.
Wir verfolgen den Knaben Gottlieb in diesem seinem Alter in noch andere Lebenslagen hinein. Wir sehen ihn zum Beispiel weit entfernt von seiner Eltern Häuschen, draußen auf einsamer Weide stehen, nachmittags von vier Uhr ab, den Blick in die Ferne gerichtet, ganz und gar versunken in den Anblick der Ferne, die um ihn ausgebreitet war. So steht er noch um fünf, so steht er um sechs Uhr, so steht er, als es zum Gebet läutet. Und der Schäfer kommt und sieht den Knaben so stehen. Er pufft ihn und macht ihn darauf aufmerksam, daß er mit ihm nach Hause gehen soll.
Zwei Jahre nach dem Zeitpunkt, den wir eben angenommen haben, 1771, ist der Freiherr von Miltitz beim Gutsbesitzer in Rammenau. Er wollte dahin kommen von seinem eigenen Gutsbesitz in Oberau an einem Sonntag, um das Mittagsmahl einzunehmen und einige Geselligkeit zu
haben mit seinen Gutsnachbarn. Er wollte außerdem vorher die Predigt hören. Er kam aber zu spät an und konnte den ihm als biederen Mann bekannten Prediger von Rammenau nicht mehr hören. Die Predigt war schon vorüber. Das tat ihm sehr leid, und daß es ihm sehr leid tat, wurde unter den Gästen, dem Wirte und den anderen Versammelten vielfach besprochen. Da sagte man: Ja, im Dorf ist aber ein Knabe, der kann vielleicht die Predigt wiederholen; man weiß das von diesem Knaben. Und es wurde geholt der jetzt neunjährige Gottlieb. In seinem blauen Bauernkittel kam er, man stellte einige Fragen an ihn, er beantwortete sie kurz mit Ja und Nein. Er fühlte sich sehr wenig zu Hause in der vornehmen Gesellschaft. Da machte man ihm den Vorschlag, er solle die Predigt, die er eben vorher gehört habe, wiederholen. Er ging in sich, und aus einer tiefen inneren Beseeltheit heraus, mit innigstem Anteil an jedem Worte, wiederholte er vom Anfang bis zum Ende die Predigt, die er gehört hatte, vor dem Gutsnachbar seines Gutsherrn. Und so wiederholte er sie, daß man das Gefühl hatte, alles, was er sagte, käme unmittelbar aus seinem eigenen Herzen; er hätte es so in sich aufgenommen, daß er es ganz mit sich verbunden hatte. Mit innerem Feuer und Wärme, immer mehr in Feuer, immer mehr in Wärme kommend, brachte der neunjährige Gottlieb die ganze Predigt vor.
Dieser neunjährige Gottlieb war der Sohn Christian Fichtes, des Bandwirkers. Der Gutsherr von Miltitz fand sich im Innersten erstaunt über das, was er auf diese Weise erlebt hatte, und sagte, er müsse für die Weiterentwickelung dieses Knaben sorgen. Und die Abnahme einer solchen Sorge mußte den Eltern wegen ihrer kümmerlichen äußeren Verhältnisse etwas außerordentlich Willkommenes sein, trotzdem sie ihren Knaben innigst liebten. Denn es waren
nach Gottlieb noch viele Kinder gekommen, es war eine große Familie geworden, und man mußte die Hand des Freiherrn von Miltitz ergreifen, die sich so hilfreich bot. Und gleich mitnehmen wollte der Freiherr von Miltitz den jungen Gottlieb, den Neunjährigen, so tief ergriffen war er von dem, was er an ihm erlebt hatte. Und er nahm ihn mit zu sich nach Oberau bei Meißen. Aber der junge Gottlieb fühlte sich dort gar nicht zu Hause, in dem großen Hause, das so abstach von alledem, was er gewohnt worden war in seinem ärmlichen Bandwirkerhäuschen. In all dem Vornehmen fühlte er sich ganz und gar unglücklich. Da gab man ihn in die Nähe nach Niederau zu einem Pfarrer, der Leberecht Krebel hieß. Und da wuchs denn Gottlieb heran in einer innigen, von Liebe getragenen Umgebung, mit dem ausgezeichneten Pfarrer Leberecht Krebel. Tief, tief fand er sich hinein in all das, was ihm durch die Gespräche schimmerte, die für den ungemein begabten Knaben der wackere Pfarrer führte. Und als Gottlieb dreizehn-jährig war, da konnte er mit Unterstützung seines Wohltäters in Schulpforta aufgenommen werden.
Nun war er versetzt in die strenge Disziplin von Schulpforta. Diese Disziplin wollte ihm gar nicht besonders behagen. Er merkte, daß die Art und Weise, wie die Zöglinge zusammenlebten, manches von Verheimlichung, manches von List im Verhalten gegenüber den Lehrern und Erziehern notwendig machte. Dabei war er ganz und gar unzufrieden mit der Art und Weise, wie ältere Jungen da zu «Obergesellen», wie man es nannte, für die jüngeren Jungen gesetzt wurden. Gottlieb hatte schon zu jener Zeit «Robinson» und manche andere Geschichte in sich aufgenommen. Unerträglich war ihm dies Schulleben zunächst geworden. Er konnte es mit seinem Herzen nicht vereinigen, daß es irgendwo, wo man der geistigen Welt entgegenwachsen
sollte - so fühlte er-, Verheimlichung, List, Täuschung gäbe. Was tun? Nun, er beschloß, in die weite Welt hinaus durchzugehen. Er machte sich denn auch auf, ging einfach durch. Auf dem Wege kommt ihm der innerlich von Empfindung tief getragene Gedanke: Hast du recht getan? Darfst du das tun? Wo holt er sich Rat? Er fällt auf die Knie nieder, verrichtet ein frommes Gebet und wartet, bis ihm aus den geistigen Welten heraus irgendein innerer Wink gegeben werde, was er tun soll. Der innere Wink ging dahin, daß er umkehrte. Er kehrte freiwillig um. Das große Glück war, daß dort ein außerordentlich liebevoller Rektor war, der Rektor Geisler, der sich die ganze Sache von dem jungen Gottlieb erzählen ließ und der tiefes inneres Miterfühlen hatte mit Gottlieb; der ihn nicht strafte, der ihn sogar in eine Lage versetzte, daß der junge Gottlieb jetzt viel mehr mit sich und der Umgebung zufrieden sein konnte, als er es eigentlich nur zu wünschen vermochte. Und so konnte er sich auch anschließen an die begabtesten Lehrer.
Seinem Streben wurde nicht leicht Nahrung gegeben. Der junge Gottlieb, der schon in diesem Lebensalter naeh dem Höchsten verlangte, durfte das, wovon er durch Hören-sagen bisher gehört hatte, eigentlich nicht lesen: Goethe, Wieland, namentlich aber Lessing, sie waren dazumal eine verbotene Lektüre in Schulpforta. Aber ein Lehrer fand sich, der konnte ihm eine merkwurdige Lektüre geben: Lessings «Anti-Goeze», jene von innerer Kraft getragene Streitschrift gegen Goeze, in der alles enthalten war, was an hoher, aber freimütiger Denkungsweise, in einer freien und freimütigen Sprache Lessing als sein Glaubensbekenntnis vorzubringen hatte.
So nahm Gottlieb in verhältnismäßig jungen Jahren auf, was er aus diesem «Anti-Goeze» entnehmen konnte. Nicht
nur eignete er sich die Ideen an - das wäre für ihn sogar das allerwenigste gewesen -, den Stil, die Art, sich zu den höchsten Dingen zu verhalten, die Art, sich in eine Weltanschauung hineinzufinden, das nahm der junge Gottlieb auf.
Und so wuchs er denn heran in Schulpforta. Als er seine Abgangsprüfungsarbeit zu machen hatte, machte er diese über ein literarisches Thema. Eine merkwürdige Abgangs-arbeit. Ganz und gar fehlte darin, was viele junge Leute tun: daß sie ihre Schulaufgaben mit allerlei philosophischen Ideen durchsetzen. Nichts von Philosophie, nichts von philosophischen Ideen und Begriffen fand sich in dieser Abgangsarbeit. Dagegen verriet sich schon darin, daß der junge Mann darauf ausging, Menschen zu beobachten, sie anzuschauen bis in ihr innerstes Herz hinein, eine erstrebte Menschenerkenntnis. Das kam gerade in dieser Schulaufgabe ganz besonders zum Ausdruck.
Nun war mittlerweile der wohltätige Freiherr von Miltitz gestorben. Was als Unterstützung in so großmütiger Weise für den jungen Gottlieb, Johann Gottlieb Fichte, dargeboten worden war, versiegte. Fichte machte sein Abiturientenexamen in Schulpforta, ging nach Jena und in tiefster Armut mußte er dort leben. Nichts konnte er mitmachen von dem, was damals Jenensisches Studentenleben war. In harter Arbeit mußte er sich von Tag zu Tag er-dienen, was er für das nackte Leben brauchte. Und nur wenige Stunden konnte er verwenden, um seinem innigst strebenden Geiste selber Nahrung zuzuführen. Jena erwies sich als zu klein. Johann Gottlieb Fichte konnte sich dort nicht ernähren. Er dachte, er könne das leichter in Leipzig, der größeren Stadt. Dort versuchte er sich auf jene Stellung vorzubereiten, die für ihn das Ideal des Vaters und der Mutter war, die innerlich fromme Leute waren: für
eine sächsische Pfarre, für eine Predigerstelle. Hatte er doch, ich möchte sagen, sich selber wie vorbestimmt gezeigt für eine solche Predigerstelle. Er konnte in den Überlieferungen der Schrift so aufgehen, daß er schon im Vaterhause immer wieder aufgefordert wurde, kleine Betrachtungen über diese oder jene Bibelstelle zu halten. Dazu wurde er auch wieder aufgefordert, als er bei dem wackeren Pfarrer Leberecht Krebel war. Und immer, wenn er wiederum für kurze Zeit zu Hause weilen konnte, in dem Orte, in dem das bescheidene Häuschen seiner Eltern stand, dann durfte er - denn der Pfarrer des Ortes hatte ihn gern - dort predigen. Und er predigte so, daß das, was er von sich zu geben vermochte, das biblische Wort in einer selbständigen, aber durchaus der Bibel entsprechenden Auffassung, wie aus einer heiligen Begeisterung heraus getragen war.
So wollte er sich denn in Leipzig für seinen ländlichen theologischen Beruf vorbereiten. Aber es war schwierig. Schwierig war es für ihn, eine Erzieherstelle zu bekommen, die er glaubte ausfüllen zu können. Mit Korrekturen, mit Hauslehrertum beschäftigte er sich. Aber hart wurde ihm dieses Leben. Und vor allen Dingen: er konnte während dieses Lebens nicht dazu kommen, wirklich sich selber geistig weiter zu bringen. Sechsundzwanzigjährig war er schon. Es war eine harte Zeit für ihn. Er hatte eines Tages gar nichts mehr und keine Aussicht, in den nächsten Tagen etwas zu bekommen; keine Aussicht, daß er, wenn es so fort ginge, auch nur den bescheidensten Beruf jemals erreichen könne, den er sich vorgesetzt hatte. Von zu Hause konnte er nur in der allerspärlichsten Weise unterstützt werden; wie ich schon sagte: es war eine mit Kindern sehr reich gesegnete Familie.
Da stand er eines Tages vor dem Abgrund, und die Frage tauchte wie eme wilde Versuchung vor seiner Seele auf:
Keine Aussicht für dieses Leben? - Nicht ganz mochte er es sich zum Bewußtsein gebracht haben, aber im Untergrund des Bewußtseins lauerte der selbstgesuchte Tod. Da kam zur rechten Zeit der ihm befreundet gewordene Dichter Weiße. Er bot ihm eine Hauslehrerstelle in Zürich an und sorgte dafür, daß er diese Hauslehrerstelle auch wirklich in drei Monaten antreten konnte. Und so finden wir denn vom Herbst 1788 an unseren Johann Gottlieb Fichte in Zürich. Versuchen wir wiederum mit dem Seelenblick ihn zu verfolgen, wie er im Münster von Zürich auf der Kanzel steht, jetzt ganz ausgefüllt von seiner eigenen Auffassung des Johannes-Evangeliums, schon ganz erfüllt von dem Bestreben, dasjenige, was in der Bibel zum Ausdruck kommt, in einer eigenen Weise wiederzugeben. So daß man, wenn man seine begeisternden Worte im Dom von Zürich ertönen hörte, glauben konnte, es sei einer aufgestanden, der die Bibel in einer ganz neuen Weise, wie durch eine neue Inspiration, in ein ganz neues Wort hinein zu gießen vermochte. Diesen Eindruck hatten ja gewiß viele, die ihn damals im Dom von Zürich hörten.
Und dann wiederum verfolgen wir ihn in eine andere Lebenslage hinein. Er wurde Erzieher im Hause Ott, im Gasthof «Zum Schwert» in Zürich. Er schickte sich nur im geringen Maße hinein in die eigentümliche vorurteilsvolle Anschauung, die man ihm dort entgegenbrachte. Mit seinen Zöglingen war er gut ausgekommen, weniger gut mit deren Eltern. Und wir spüren, was Fichte ist, aus dem Folgenden. Eines Tages bekam die Mutter der Zöglinge eine merkwürdige Zuschrift von dem Hauslehrer. Was stand in dieser Zuschrift? Ungefähr stand darin: das Erziehen sei eine Aufgabe, der er sich - er meinte sich selber, Johann Gottlieb Fichte - gern unterwerfen möchte. Und was er von den Zöglingen wisse und an ihnen kennen gelernt habe, gebe
ihm die sichere Aussicht, daß er mit ihnen recht viel machen könne. Aber die Erziehung müsse an einem gewissen Punkte aufgenommen werden; vor allen Dingen müsse die Mutter erzogen werden. Denn eine Mutter, die sich zum Zögling so verhalte, die sei das größte Hindernis für eine Erziehung im Hause. - Ich brauche nicht auszumalen, mit welch eigentümlichen Empfindungen die Frau Ott in Zürich dieses Schriftstück las. Aber die Sache wurde noch einmal überbrückt. Johann Gottlieb Fichte konnte in dem Hause Ott in Zürich in einer gesegneten Weise wirken, bis in den Frühling 1790, also mehr als anderthalb Jahre.
Aber Fichte war durchaus nicht geeignet, dasjenige, was seine Seele umfaßte, einzuschließen in seinen Beruf. Er war durchaus nicht geeignet, den Blick hinwegzuwenden von dem, was in der Geisteskultur um ihn herum vorging. Er wuchs durch den inneren Eifer und durch den inneren Anteil, den er an allem nahm, was in der Welt geistig um ihn herum vorging, hinein in das, was geistig um ihn herum vorging. Ja, er wuchs in das alles hinein. Hinein wuchs er im Schweizerlande in das, was dazumal an Gedanken alle Menschen erfüllte, was herübergedacht wurde von der ausbrechenden französischen Revolution. Wir können ihn belauschen, möchte ich sagen, wie er in Olten, als er einen besonders begabten Menschen findet, mit diesem über die Fragen diskutiert, die in einer so bedeutsam eingreifenden Weise dazumal Frankreich und die Welt erfüllten; wie er fand, daß das die Ideen seien, denen man sich jetzt widmen müsse; wie er all dasjenige, was aus seiner tiefen Religiosität und aus seinem scharfen Geiste heraus ihn innerlich beschäftigte, hineintrug in die Gedanken der Menschenbeglückung, in die Gedanken der Menschenrechte, der hohen Menschenideale.
Fichte war kein Selbstling, der bloß starr aus seinem
Innern heraus seine Seele entwickeln konnte. Diese Seele wuchs zusammen mit der Außenwelt. Diese Seele fühlte wie unbewußt die Pflicht eines Menschen, nicht nur für sich selbst zu sein, sondern als ein Ausdruck dazustehen dessen, was die Welt will in der Zeit, in der man lebt. Das war ein tiefstes Fühlen, ein tiefstes Empfinden in Fichte. Und so wuchs er denn zusammen gerade in der Zeit, in der er, man möchte sagen, am allermeisten empfänglich war für das Zusammenwachsen seiner Seele mit dem, was in seiner geistigen Umgebung lebte und webte, - so wuchs er zusammen mit dem schweizerischen Element, und aus diesem schweizerisch-deutschen Element heraus finden wir immer einen Einschlag in dem ganzen Fichte, wie er später wirkt und lebt.
Man muß ein Verständnis haben für den tiefgehenden Unterschied dessen, was in der Schweiz lebt, von dem, was schon, ich möchte sagen, ein wenig nördlich in Deutschland lebt, wenn man den Eindruck begreifen will, den gerade schweizerische Umgebung, schweizerisches Menschentum und Menschenstreben auf Fichte machte. Es unterscheidet sich zum Beispiel wesentlich von anderem Deutschtum dadurch, daß es alles, was geistiges Leben ist, mit einem gewissen selbstbewußten Element durchdringt, so daß das ganze Kulturelement einen politischen Ausdruck bekommt; daß alles so gedacht wird, daß der Mensch sich durch das Gedachte hineingestellt fühlt in das unmittelbare Handeln, in die Welt. Kunst, Wissenschaft, Literatur, sie stehen wie einzelne Nebenflüsse des gesamten Lebens für dieses schweizerische Deutschtum da.
Das war es, was sich auch mit Fichtes Seelenelement in der schönsten Weise verbinden konnte. Er war auch ein Mensch, der nicht irgendeine menschliche Betätigung oder irgendeine menschliche Bestrebung einzeln denken konnte.
Alles Einzelne mußte sich in das Gesamte des menschlichen Tuns und des menschlichen Sinnens und des menschlichen Empfindens und der ganzen menschlichen Weltanschauung eingliedern. Dabei war unmittelbar verbunden auch in Fichte dasjenige, was er wirken konnte, mit seiner immer stärker und stärker werdenden unmittelbaren Persönlichkeit. Wer Fichte heute liest, wer sich auf seine ja auch inhaltlich oftmals so trocken erscheinenden Schriften, auf das Geistsprühende einzelner Abhandlungen, einzelner Schriften einläßt, der wird keine Vorstellung von dem bekommen, was Fichte gewesen sein muß, wenn er all sein inneres Feuer, sein inneres Dabeisein bei dem, was er geistig meinte und was er geistig durchdrungen hatte, in die Rede hineinlegte. Denn in die Rede floß aus dasjenige, was er war. Daher versuchte er auch - es war ein mißglückter Versuch -, sogar damals in Zürich eine Redeschule zu gründen. Denn er glaubte, daß durch die Art und Weise, wie das Geistige an den Menschen gebracht werden kann, in der Tat in ganz anderer Art gewirkt werden kann, als bloß durch den sei es auch noch so gediegenen Inhalt.
Einen anregenden, die Seele tief ergreifenden Umgang hat Fichte auch gerade in Zürich im Hause Rahn gefunden, eines damals begüterten Schweizers, der der Schwager Klo pstocks war. Und innige Neigung zu der Tochter, zu Johanna Rahn, faßte Fichte. Innige Freundschaft, die sich immer mehr zur Liebe hin entwickelte, verband ihn mit der Nichte Klopstocks. Zunächst war die Hauslehrerstelle in Zürich nicht mehr recht haltbar. Fichte mußte weiter sehen. Er wollte nicht etwa jetzt schon, bevor er etwas war in der Welt - das sprach er dazumal genügend oft aus -, irgendwie in das Haus Rahn als Mitglied treten und etwa von den Mitteln des Hauses Rahn leben. Er wollte weiterhin seinen Weg in der Welt suchen; wir dürfen bei ihm
nicht sagen: sein Glück, sondern wir müssen sagen: seinen Weg in der Welt suchen.
Er ging wiederum nach Deutschland zurück, nach Leipzig. Er dachte sich dort eine Zeitlang aufzuhalten; er hoffte dort dasjenige zu finden, was sein eigentlicher Beruf sein könne, jene Form des seelischen Ausdrucks zu finden, die er zu seinem Lebenswege machen wollte. Dann wollte er nach einiger Zeit zurückkehren, um dasjenige frei auszuarbeiten, was er mit seiner Seele vereint hat. Da geschah etwas Unerwartetes, das seine Lebenspläne alle änderte. Rahn brach zusammen, verlor sein ganzes Vermögen. Nicht nur die Sorge quälte ihn jetzt, daß die Leute, die ihm die liebsten waren, in Armut verfallen waren, sondern er mußte nun gewissermaßen den Wanderstab ergreifen und weiter in die Welt ziehen, mußte seine Lieblingspläne aufgeben, die sich ihm vom Innern der Seele heraus eröffnet hatten.
Zunächst bot sich ihm eine Hauslehrerstelle in Warschau. Allein, schon als er dort ankam und sich vorstellte, fand die Aristokratin, in deren Haus er eintreten sollte, daß die schon damals und auch später von manchen fest, energisch gefundenen Bewegungen Fichtes eigentlich linkisch seien; daß er gar keine Begabung hätte, sich in irgendeine Gesellschaft hineinzufinden. Man ließ ihn das merken. Das konnte er nicht vertragen. Da ging er denn fort.
Sein Weg führte ihn nun an diejenige Stätte, wo er zunächst glauben konnte, einen Menschen zu finden, den er unter allen Menschen nicht nur seiner damaligen Gegenwart, sondern des ganzen Zeitalters, am höchsten verehrte und dem er nahegetreten war, nachdem er eine Zeitlang ganz in der Weltanschauung Spinozas aufgegangen war; einen Menschen, dem er nahegetreten war, indem er seine Schriften studiert hatte, in die er sich ganz, ganz hineingefunden hatte, so daß, wie ehemals die Bibel oder andere Schriften,
jetzt in einer ganz besonderen neuen Form die Schriften dieses Mannes vor ihm standen, - nämlich Immanuel Kant. Er machte den Weg nach Königsberg. Und er saß zu Füßen des großen Lehrers und fand sich ganz hinein in die Art und Weise, wie seine Seele widerspiegeln konnte dasjenige, was er für die größte Lehre hielt, die der Menschheit jemals gegeben worden war. Und es verband sich in der Seele Fichtes dasjenige, was in seiner Seele lebte, aus seinem frommen Sinn heraus, aus seinem Sinnen über die göttliche Weltenlenkung und über die Art und Weise, wie die Geheimnisse dieser Weltenlenkung von jeher der Menschheit, der Welt verkündet worden sind, mit dem, was er gelernt und gehört hatte von Kant. Und das, was in seiner Seele entstand, verarbeitete er zu einem Werke, dem er den Titel gab «Kritik aller Offenbarung». 1792 war das. 1762 ist Fichte geboren, dreißigjährig war er. Ein Merkwurdiges trat dazumal ein. Kant empfahl sogleich einen Verleger für das Werk, von dem er hingerissen war: «Kritik aller Offenbarung.» Das Werk ging in die Welt hinaus ohne den Namen des Verfassers. Kein Mensch hielt es für etwas anderes als ein Werk Immanuel Kants selber. Die guten Kritiken flogen nur so von allen Seiten herbei. Unerträglich war das Fichte, der mittlerweile, wiederum durch Vermittlung Kants, eine ihm jetzt sehr zusagende Hauslehrerstelle in dem ausgezeichneten Hause Krockow, in der Nähe von Danzig, bekommen hatte, wo er auch seinen geistigen Bestrebungen frei nachleben konnte. Unerträglich war es ihm, so vor der Welt dazustehen, daß man eigentlich, indem man über sein Werk sprach, einen andern meinte. Der bald vergriffenen ersten Auflage folgte eine zweite. Da nannte er sich. Jetzt machte er allerdings eine merkwürdige Erfahrung. Nun, jetzt geradezu das Entgegengesetzte von dem zu sagen, was man früher gesagt
hatte, war doch wenigstens einer großen Anzahl von Kritikern nicht möglich; aber man dämpfte das Urteil herab, das man früher gehabt hatte. Es war wieder ein Stück Menschenkenntnis, das sich Fichte angeeignet hatte.
Nachdem er eine Zeit in dem Krockowschen Hause verbracht hatte, konnte er den Plan fassen, nach der Art und Weise, wie er jetzt in die Welt hineingestellt war, nicht etwa äußerlich, sondern geistig - er hatte gezeigt, daß er etwas vermochte -, zurückzugehen in das Haus Ralin; nur so wollte er Klopstocks Nichte für sich gewinnen, jetzt konnte er es tun. Und da ging er denn 1793 wiederum nach Zürich zurück. Klopstocks Nichte wurde seine Frau.
Nicht nur, daß er jetzt im tiefsten Sinne an dem weiter-arbeitete, was er als Kantische Ideen aufgenommen hatte, sondern er vertiefte sich auch weiter in all das, was ihn schon bei seinem ersten Aufenthalt in Zürich beschäftigt hatte; er vertiefte sich in das, was jetzt durch die Welt ging an Ideen von Menschenzielen und Menschenidealen. Und er verwob die Art und Weise, wie er selber denken mußte über Menschenstreben und Menschenideale, mit dem, was jetzt durch die Welt ging. Und er war eine so selbständige Natur, daß er nicht anders konnte, als der Welt zu sagen, was er denken mußte über dasjenige, was jetzt die radikalsten Naturen über den Menschheitsfort-schritt dachten. «Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution>, das war das Buch, das jetzt 1793 von ihm erschien.
Gleichzeitig mit der Ausarbeitung dieses Buches ging ein fortwährendes innerliches Weiterarbeiten an den Weltanschauungsideen, die er aus der Kantischen Weltanschauung heraus für sich genommen hatte. Es müsse eine Weltanschauung geben, so sagte er sich, welche aus einem obersten Impuls für das menschliche Wissen alles Wissen erleuchten
könne. Und diese Weltanschauung, die nach dem Höchsten so fragt, daß man kein Höheres mehr für das Wissen jemals auffinden könne, das schwebte Fichte als ein Ideal vor.
In einer merkwürdigen Weise verketten sich die Umstände. Während er noch also mit der inneren Ausarbeitung seiner Ideen beschäftigt war, bekam er eine Zuschrift von Jena, von Jena-Weimar. Solchen Eindruck hatte dort gemacht, was Fichte geleistet hatte, daß, als Karl Leonhard Reinhold von der Jenenser Universität abging, Fichte auf Grundlage dessen, was er geleistet hatte, aufgefordert wurde, die Professur der Philosophie zu übernehmen. Mit innigster Befriedigung begrüßten diejenigen, die dazumal an dem Geistesleben der Universität Jena beteiligt waren, die Idee, diesen Geist, der ihnen auf der einen Seite wie ein Brausekopf, auf der anderen Seite aber wie ein gerade in Weltanschauungsfragen nach dem Höchsten hin Streben-der erschien, an die damals berühmteste und besuchteste Hochschule des deutschen Volkes zu holen.
Und jetzt versuchen wir einmal, ihn als Verwalter der angetretenen Lehrerstelle ins geistige Auge zu fassen. Was sich ihm als seine Weltanschauung eingegeben hatte, wollte er denen überbringen, die jetzt vom Jahre 1794 ab seine Zöglinge waren. Aber Fichte war nicht ein Lehrer wie andere. Sehen wir zuerst darauf, was sich ihm in seiner Seele ergeben hatte. Man kann es nicht mit seinen Worten unmittelbar sagen - das würde zu lange dauern -, aber man kann es ganz aus seinem Geist heraus charakterisieren. Nach einem Höchsten suchte er, nach einem solchen, wo der Menschengeist das Weltenströmen, das Weltengeheimnis an einem Punkte erfassen konnte, wo der Geist unmittelbar eins war mit diesem Weltenströmen, mit diesem Weltengeheimnis. So daß der Mensch, indem er hineinsah in dieses Weltengeheimnis, sein eigenes Dasein mit diesem
Geheimnis verbinden konnte, es also wissen konnte. Das konnte man nicht in irgend einem äußeren sinnlichen Dasein finden. Das konnte kein Auge, kein Ohr, kein anderer Sinn, das konnte auch nicht der gewöhnliche menschliche Verstand finden. Denn all dasjenige, was man mit den Sinnen äußerlich schauen kann, das muß erst der menschliche Verstand kombinieren, das hat sein Sein in der äußeren Welt; man kann es nur seiend nennen, wenn man das Sein sozusagen bekräftigt bekommt durch das, was man sinnlich beobachtet. Das ist kein wahres Sein. Mindestens kann man über das wahre Sein desjenigen, das sich nur den Sinnen darbietet, zunächst gar kein Urteil gewinnen. Im Innersten des Ich selber muß der Quell alles Wissens aufgehen. Das kann aber nicht ein fertig Seiendes sein, denn ein fertig Seiendes im Innern wäre gleich dem, was als ein fertig Seiendes den äußeren Sinnen gegeben wird. Das muß ein Schaffendes sein. Das ist das Ich selber, jenes Ich, das sich in jedem Augenblick neu schafft; jenes Ich, dem nicht ein fertiges Sein, sondern eine innere Tathandlung zugrunde liegt; jenes Ich, dem das Sein deshalb nicht genommen werden kann, weil sein Sein in seinem Schaffen, in seinem Selbstschaffen besteht. Und in dieses Selbstschaffen fließt hinein alles das, was wahres Sein hat. Also hinaus mit diesem Ich aus allem Sinnensein, hinein in die Sphären, wo der Geist wallt und webt, wo der Geist als Schaffendes wirkt! Anfassen dieses geistige Leben und Wirken da, wo das Ich vereinigt ist mit dem geistigen Wirken und Weben der Welt; sich durchdringen mit dem, was nicht äußeres, fertiges Sein ist, sondern was aus dem Quell des göttlichen Weltenlebens heraus das Ich schafft, zuerst als Ich, und dann als dasjenige, was die Ideale der Menschheit sind, was die großen Pflichtideen sind.
Das war die Kantische Philosophie in Fichtes Seele geworden.
Und so wollte er vor seine Zuhörer auch nicht eine fertige Lehre bringen; darauf kam es ihm nicht an. Das war bei Fichte kein Vortrag wie ein anderer Vortrag, das war keine Lehre wie eine andere Lehre ist. Nein, wenn dieser Mann sich vor den Lehrtisch stellte, dann war das, was er dort zu sagen hatte oder, besser gesagt, was er dort zu tun hatte, das Ergebnis einer langen, vielstündigen Meditation, in der er vermeinte innerlich, in dem über alles sinnliche Sein erhaben sich selbst schaffenden Ich herein-fließen zu sehen das göttliche Sein, das göttlich-geistige Weben und Wirken, das die Welt durchzieht und durch-wallt. Nachdem er lange Zwiesprache bei sich selber darüber gehalten hatte, was der Weltengeist der Seele zu sagen hat über die Weltgeheimnisse, ging er vor seine Zuhörer hin. Dann kam es ihm aber nicht darauf an, mitzuteilen, was er mitzuteilen hatte, sondern darauf, daß sich eine gemeinsame Atmosphäre von ihm über seine Zuhörer hin ausbreite. Darauf kam es ihm an, daß dasjenige, was in seiner Seele über die Weltengeheimnisse lebendig geworden war, auch in der Seele seiner Zuhörer unmittelbar lebendig werde. Wecken wollte er geistiges Leben, wecken wollte er geistiges Sein. Herausholen wollte er aus den Seelen seiner Zuhörer selbstschöpferisches geistiges Tun, indem sie an seinen Worten hingen. Nicht teilte er bloß mit. Von folgender Art etwa war das, was er seinen Zuhörern geben wollte. Eines Tages, als er anschaulich machen wollte dieses Selbstschöpferische des Ich - wie auch im Ich alle Denk-tätigkeit werden kann und wie der Mensch nicht anders zu einem wirklichen Erfassen der Weltengeheimnisse kommen kann als dadurch, daß er dieses Selbstschöpferische im Ich erfaßt -, als er die geistige Welt mit seinen Zuhörern er-greifend, gleichsam jedem die geistige Hand führend in die geistige Welt hinein, dieses erreichen wollte, da sagte er
zum Beispiel: Denken sie sich einmal die Wand, meine Hörer! Nun, ich hoffe, Sie haben jetzt die Wand gedacht.
Die Wand ist jetzt als Gedanke, als Vorstellung in Ihrer Seele. Jetzt denken Sie sich den, der die Wand denkt.
Sehen Sie ganz ab von allem Denken der Wand. Denken Sie ganz, ganz den, der die Wand denkt!
Unruhig wurden manche Zuhörer, aber zu gleicher Zeit im tiefsten Innern ergriffen von der unmittelbaren Art, von dem unmittelbaren Verhältnis, in das sich Fichte zu seinen Zuhörern versetzen wollte. Geist aus Fichtes Seele sollte den Geist in seinen Zuhörern erfassen.
Und so wirkte der Mann jahrelang, niemals zweimal ein und dieselbe Vorlesung haltend, immer neu und neu gestaltend. Denn darauf kam es ihm nicht an, dieses oder jenes in Sätzen mitzuteilen, sondern darauf, immer Neues in seinen Zuhörern zu wecken. Und immer wieder wiederholte er: Darauf kommt es gar nicht an, daß dasjenige, was ich sage oder den Menschen zu sagen habe, von diesem oder jenem wieder gesagt werde, sondern darauf, daß es mir gelinge, in den Seelen solche Flammen zu erwecken, welche die Veranlassung werden, daß ein Jeder ein Selbstdenker werde; daß keiner das sagt, was ich zu sagen habe, sondern daß ein jeder angeregt wird durch mich, das zu sagen, was er selber zu sagen hat. - Nicht Schüler, Selbstdenker wollte Fichte erziehen. Wenn wir die Geschichte der Wirkungen Fichtes verfolgen, so können wir begreifen: Eigentliche Philosophenschüler hat gerade dieser deutscheste der deutschen Philosophen nicht gebildet; eine Philosophen-schule hat er nicht gegründet. Tüchtige Männer sind überall hervorgegangen aus diesem unmittelbaren Verhältnis, in das er sich zu seinen Schülern versetzt hat.
Nun, Fichte war sich bewußt - und mußte sich ja bewußt sein, da er das Bewußtsein des Menschen bis zu dem
unmittelbaren Erfassen der schaffenden geistigen Wirklichkeit hinführen wollte -, daß er auf ganz besondere Art sprechen mußte. Die ganze Art Fichtes war gerade schwer zu begreifen. Im Grunde genommen hatten alle, die irgendwie teilnahmen an seiner Lehrart, dergleichen, wie er es dazumal in Jena übte, noch nicht vernommen. Selbst Schiller war erstaunt darüber, und zu Schiller sprach er einmal über die Art und Weise, wie er eigentlich in seinem eigenen Bewußtsein sich sein Wirken vorstellte, zum Beispiel folgendermaßen: Wenn die Menschen das lesen, was ich spreche, dann können sie so, wie sie heute lesen, unmöglich darauf kommen, was ich eigentlich sagen will. - Da nahm er eines seiner Bücher in die Hand und versuchte vorzulesen, so wie er dachte, daß dasjenige, was er zu sagen hatte, vorgelesen werden müsse. Dann sagte er zu Schiller: Sehen Sie, die Leute können heute nicht innerlich deklamieren. Weil aber das, was in meinen Perioden enthalten ist, erst durch wahres innerliches Deklamieren her-ausgeholt werden kann, kommt es eben nicht heraus.
Allerdings war es etwas ganz anderes, was Fichte aus seinen eigenen Perioden herausholte. Was er sprach, es war gesprochene Sprache. Daher sollte man Fichte auch heute noch in der Mitte des ganzen Seelenlebens suchen, dem man sich widmen kann als dem Seelenleben des ganzen deutschen Volkes; man sollte auch heute noch immer die Über-windung haben, mit innerlicher Deklamation, mit innerlichem Hinhören, das aufzunehmen, was bei Fichte sonst so trocken und so nüchtern erscheint.
So stehen wir, indem wir Fichtes geistige Entwickelung an unserer Seele vorüberziehen lassen, gewissermaßen auf einem der geistigen Gipfel seines Seins. Und der Blick mag wohl zurückschweifen auf diesen merkwürdigen Geistesgang.
Wir haben Johann Gottlieb Fichte aufgesucht, wie er vor dem Freiherrn von Miltitz in dem blauen Bauernkittel dastand, ein richtiges rotwangiges, kurzgedrungenes Bauernkmd, mit keiner anderen Bildung, als die ein Bauern-kind haben kann, aber so, daß diese Bildung schon bei dem Neunjährigen innerstes Eigentum der Seele war. Wir haben ein Beispiel vor uns, wie aus dem deutschen Volke, ganz aus dem deutschen Volke eine Seele herauswächst, die zunächst nichts hereinbekommt, als was innerhalb dieses deutschen Volkes lebt, lebt in der unmittelbaren Art der Lebensweise dieses Volkes. Wir verfolgen diese Seele durch schwierige Lebenslagen, diese Seele, die eigentlich als ein Ideal betrachtet, in dem Volke stehen zu bleiben, aber sich überlassen muß dem innersten Impuls, dem innersten Antrieb ihres Wesens. Wir verfolgen diese Seele, wie sie hin-aufsteigt zu den höchsten Höhen menschlich inneren Geschehens, Arbeitens, wie sie zum Menschenbildner wird in der Art, wie wir es eben schildern durften. Wir verfolgen den Weg, den eine deutsche Seele machen kann, die unmittelbar aus dem Volke herauswächst und die nur durch eigene Kraft zu den höchsten Höhen des geistigen Seins hinaufsteigt.
Bis zum Frühling 1799 versieht Fichte also sein Lehramt in Jena. Es hatte schon früher allerlei Mißhelligkeiten gegeben. Denn ein Mensch, mit dem sich so ohne weiteres leicht auskommen ließ, ein Mensch, der geneigt wäre, damit es sich mit ihm leicht auskommen ließe, allerlei Umschweife im Leben zu machen, allerlei weiche Bewegungen in seinem Verhalten vor den Leuten zu machen, ein solcher Mensch war allerdings Fichte ganz und gar nicht. Aber ein Wichtiges tritt uns doch hervor, das bedeutsam ist für das ganze deutsche Leben in der damaligen Zeit.
Derjenige, der insbesondere tiefe Befriedigung hatte -
und in dieser Befriedigung einverstanden war mit Goethe -darüber, daß er diesen Mann, Fichte, an seine Universität nach Jena berufen konnte, war Karl August. Und ich glaube, man darf ein Urteil hervorrufen über die ganze Vorurteilslosigkeit Karl Augusts, der den Mann an seine Universität berief, der in der freiesten Weise die Kantische Philosophie auf die Offenbarung angewendet hatte, aber nicht nur dies - der den Mann an seine Universität berief, der in der freiesten, in der rückhaltlosesten Weise eingetreten war für die freiesten Menschheitsentwickelungsziele. Ich glaube, man würde Karl August, diesem großen Geist, nicht Recht tun, wenn man nicht auf den hohen Grad von Vorurteilslosigkeit aufmerksam machen würde, den dieser deutsche Fürst dazumal brauchte, um Fichte zu berufen. Eine Verwegenheit nannte Goethe diesen Ruf. Aber ich möchte sagen, Karl August und Goethe, die ja vor allen Dingen die Seele dieses Rufes waren und sein mußten, sie nahmen es gegen eine Welt von Vorurteilen auf sich, Fichte nach Jena zu bringen. Ich sage, es wäre fast ein Unrecht, nicht aufmerksam zu machen, in welchem Grade gerade die Vorurteilslosigkeit Karl Augusts entwickelt war. Und zu diesem Zwecke möchte ich einen Satz aus dem Buche Fichtes vorlesen, das da den Titel hat «Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution»: «Sie» - er meint die Fürsten Europas, auch die Fürsten Deutschlands -, «die größtenteils in der Trägheit und Unwissenheit erzogen werden, oder wenn sie etwas kennen, eine ausdrücklich für sie verfertigte Wahrheit kennen; sie, die bekanntermaßen an ihrer Bildung nicht fort-arbeiten, wenn sie einmal regieren, die keine neue Schrift lesen, als höchstens etwa wasserreiche Sophistereien, und die allemal, wenigstens um ihre Regierungsjahre hinter ihrem Zeitalter zurück sind...» Das stand in dem letzten
Buch, das Fichte geschrieben hatte - und Karl August berief diesen Mann an seine Universität.
Wenn man sich ein wenig in die ganze Lage vertieft, in der Fichte und diejenigen waren, die ihn berufen haben, kommt man zu der Anschauung: Eigentlich haben die Mensdien, die von der Gesinnung des großen, freiherzigen Karl August und Goethes waren, einen Feldzug unternommen gegen diejenigen, die in ihrer unmittelbaren Umgebung waren und die durchaus so wenig wie möglich einverstanden waren mit der Berufung Fichtes. Und es war ein Feldzug, der gar nicht leicht zu unternehmen war, denn, wie gesagt, Staat zu machen in dem Sinne, wie man gerne Staat macht in der Welt, war mit Fichte nicht möglich. Fichte war schon ein Mensch, der durch seine Schiefheiten, durch seine Schroffheiten jeden verletzte, von dem man eigentlich gerne wollte, daß er nicht verletzt werde. Fichte war kein Mensch, der mit der Hand eine weiche Bewegung machte. Fichte war ein Mensch, der, wenn ihm etwas nicht recht war, mit der Faust seine Stöße in die Welt hinein machte. Die Art und Weise, wie Fichte mit seiner vollen Kraft dazumal das, was er der Welt mitzuteilen hatte, in die Welt hineinstellte, war Goethe und Karl August nicht leicht; es war ihnen sehr schwierig, sie ächzten etwas darunter.
Und so nach und nach zogen die Ungewitter herauf. Da wollte Fichte zum Beispiel Vorlesungen über Moral halten, Vorlesungen, die als «Vorlesungen über die Moral für Ge-lehrte> gedruckt sind. Er fand keine Stunde, als nur den Sonntag. Das aber war etwas Schreckliches für alle, die da glaubten der Sonntag werde entheiligt, wenn man über Moral im Fichteschen Sinne zu den Studenten in Jena am Sonntag spreche. Und alle möglichen Klagen kamen vor die Weimarer Regierung, vor Goethe, aber auch vor Karl
August. Der ganze Jenaer Professorensenat sprach sich darüber in dem Sinne aus, daß es doch ungeheueres Aufsehen und Mißhelligkeiten hervorrufe, wenn Fichte am Sonntag - und er hatte ohnedies die Stunde gewählt, in der Nachmittagsgottesdienst war - moralische Vorlesungen an der Universität hielte. Karl August mußte schon in dieser Angelegenheit, ich möchte sagen, den Gegnern Fichtes zuerst das Feld räumen. Doch wäre es wiederum nicht gut, wenn man nicht heute wiederum zu Gehör brächte, in welcher Weise er es getan hatte. Karl August schrieb dazumal an die Universität Jena:
«So haben Wir nach Eurem Antrag resolviert, daß dem mehrerwähnten Professor Fichte die Fortsetzung seiner moralischen Vorlesungen am Sonntage äußersten Falles nur in den Stunden nach geendigtem Nachmittagsgottesdienst gestattet sein solle.> Das Dekret bezog sich ausdrücklich auf den Umstand, daß «etwas so Ungewöhnliches, als die Anstellung von Vorlesungen am Sonntag während der zum öffentlichen Gottesdienst bestimmten Stunden» vorlag. Indem Karl August aber dieses Dekret herausgab, konnte er doch nicht umhin, noch die Worte dazu zu fügen: «Wir haben uns gern überzeugt, daß, wenn dessen (Fichtes> moralische Vorlesungen dem ... eingehefteten treiflichen Aufsatz gleichen, sie von vorzüglichem Nutzen sein können.» Aber es bohrte weiter. Die Gegner ließen nicht mehr locker, könnte man sagen. Und so kam es denn 1799 zu jenem unseligen Atheismus-Streit, durch den Fichte von seinem Lehramt in Jena weichen mußte. Forberg, ein jüngerer Mann, hatte in der Zeitschrift, die Fichte dazumal herausgab, einen Aufsatz geschrieben, der von gewisser Seite her des Atheismus angeklagt worden war. Fichte fand schon seinerseits unvorsichtig, was dieser junge Mann geschrieben hatte, und er wollte Randbemerkungen
dazu machen. Damit war aber Forberg wiederum nicht einverstanden. Und Fichte in seiner freien Weise, die er nicht nur im Großen, die er bis ins Kleinste hinein betätigte, wollte durchaus nicht etwa, weil er nicht damit einverstanden war, diesen Aufsatz zurückweisen. Er wollte auch nicht Randbemerkungen gegen den Willen des Verfassers machen. Aber er schickte einen eigenen Aufsatz «Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltenregierung», voraus. Hierin standen Worte, die ganz durchtränkt waren von wirklicher, man darf sagen, ins Geistigste hinaufgehobener, wahrer, inniger Gottesverehrung und Frömmigkeit, aber eben ins Geistigste hinauf-gehoben, in jenes Geistige, von dem Fichte sagen wollte, daß es das einzig Wirkliche sei; daß man die Wirklichkeit überhaupt erst erfassen könne, wenn man sich mit seinem Ich im Geistigen bewegend, in der geistigen Strömung der Welt drinnen stehend fühlt. Nicht durch irgendwelche äußere Offenbarung oder äußere Wissenschaft müsse man dann das Dasein Gottes erfassen, sondern im lebendigen Wirken und Weben. Das Schaffen der Welt müsse man erfassen, indem man drinnen strömt, selber sich schaffend unaufhörlich und sich damit seine Ewigkeit gebend.
Aber dieser Aufsatz Fichtes wurde erst recht des Atheismus angeklagt. Es ist unmöglich, diesen Streit, diese Atheismus-Anklage in aller Ausführlichkeit zu erzählen. Es ist im Grunde schrecklich zu sehen, wie Goethe und Karl August gegen ihren Willen Partei nehmen mußten gegen Fichte; wie sich Fichte aber nirgends abhalten läßt, nun, ich möchte sagen, eben mit der Faust gerade vor sich hinzuschlagen, wenn er glaubte, daß er dasjenige in der Welt durchbringen müsse, was er durchzubringen hat. So kommt es denn dahin, daß Fichte hört: man will etwas gegen ihn unternehmen, will ihm einen Verweis geben. Goethe und
Karl August wäre es am liebsten gewesen, wenn man diesen Verweis hätte geben können. Fichte sagte sich: Einen Verweis wegen desjenigen, was man aus den innersten Quellen des menschlichen Wissens herauszuschöpfen hat, hinzunehmen, hieße, die Ehre - nicht die Ehre der Person, sondern die Ehre des Geistesstrebens - selber verletzen. Und da schrieb er denn zunächst an den Minister Vogt in Weimar einen Privatbrief, der dann aber zu den Akten gegeben wurde, in dem er sagte: Einen Verweis werde er sich nimmermehr geben lassen; nein, lieber würde er seinen Abschied nehmen. Und wenn Fichte schrieb über Dinge dieser Art, so schrieb er, wie er sprach. Man sagte: Er sprach schneidend, wenn es nötig war. So schrieb er auch schneidend - jedem, wer es auch war. Man konnte nicht anders, wenn man nicht alles drunter und drüber gehen lassen wollte in Jena, als die Entlassung annehmen, die Fichte nicht eigentlich angeboten hatte, denn man hatte ja einen Privatbrief zu den Akten genommen. So kam es dazu, daß Fichte auf diese Weise sein so segensreiches Lehramt in Jena verlassen mußte.
Wir sehen ihn bald darauf in Berlin auftreten. Wir sehen ihn da auftreten, indem er jetzt wiederum von einer neuen Seite her das Stehen des Ich im wehenden und waltenden Weltengeist erfaßt: «Die Bestimmung des Menschen» schrieb er dazumal. Er schrieb sie aber so, daß er sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen in dieses Werk hineinlegte. Zeigen wollte er in diesem seinem Werk, wie zu einer wesenlosen Weltanschauung diejenigen führen, die nur äußerlich die Sinnenwelt betrachten, und sie nur mit dem Verstande kombinieren. Wie man auf diese Weise nur zu einem Traum vom Leben kommt, das bildet den Inhalt des ersten Teiles. Wie man abkommt, die Welt als eine Kette von äußerlichen Notwendigkeiten zu betrachten, ist
der Inhalt des zweiten Teiles. Und den Inhalt des dritten Teiles der «Bestimmung des Menschen> bildet dann die Auseinandersetzung, wie es der Seele wird, wenn sie versucht, in ihrem Innern dasjenige zu erfassen, was an dem inneren Leben schafft, und was dadurch nicht nur ein Abdruck, sondern ein Mitschaffen ist an jenem großen Schaffen alles Weltendaseins. An seine Frau, die er damals in Jena zurückgelassen hatte, schrieb Fichte, nachdem er abgeschlossen hatte mit der Schrift: Ich habe noch niemals einen so tiefen Blick in Religion getan, als während ich diese Schrift «Bestimmung des Menschen» abgeschlossen habe.
Mit einem kurzen Zwischenraum, 1805, während dem er sich an der Universität Erlangen aufhielt, verbrachte Fichte dann das Leben, das er noch in der Welt zu führen hatte, in Berlin, zuerst Privatvorträge haltend in den verschiedensten Wohnungen, Vorträge, die eindringlich waren; später zur Mithilfe an der neu begründeten Universität berufen, wovon wir ja gleich noch zu sprechen haben.
Ich sagte, mit einem kurzen Zwischenraum in Erlangen hat er nun wiederum in Berlin gewirkt. Denn immer und immer neu aus seiner Seele herausgeschöpft war dasjenige, was er den Leuten zu geben hatte, wiederum neu in Ideal-form gießend, was er zu geben hatte, trug er in Erlangen mit vollem Eifer seine Wissenschaftslehre, seine Weltanschauung vor. Merkwürdig - während er in Jena, als er mit seinen Vorträgen begann, einen wachsenden Zulauf hatte und das in Berlin auch so war, nahm die Zuhörer-schaft in Erlangen im Laufe des Semesters bis auf die Hälfte ab. Nun, man weiß ja, wie gewöhnlich Professoren diese Abnahme hinnehmen; wer das erlebt hat, weiß, daß das eben hingenommen wird. Für Fichte war das nicht so. Als die Zuhörerschaft in Erlangen auf die Hälfte herabgekommen
war, ergriff er einmal das Wort - allerdings dann nur vor denen, die es hörten, nicht vor denen, die weggeblieben waren, aber er setzte voraus, daß sie es erfahren würden -, und hielt eine jener Donnerreden, in der er den Leuten begreiflich machte, daß sie, wenn sie nicht hören wollten, was er ihnen zu sagen habe, nur für äußeres historisches Wissen, nicht für vernünftiges Wissen zu haben seien. Und nachdem er hinzugefügt hatte, was der Mensch im Leben werde, wenn er als geistig Strebender nicht dieses vernünftige Wissen sich erwerben wolle, sagte er: «Die Zeit, in der ich lese? - Ich habe zwar gehört, wie wenig zufrieden man sei mit der Wahl der Stunde. Ich will dies nicht nach der Strenge nehmen, folgernd aus Prinzipien, die sich eigentlich von selbst verstehen und die hierbei angewendet werden müßten. Ich will die, welche es trifft, nur für übel unterrichtet halten und sie besser berichten. Sie können nämlich sagen: dies sei von jeher so gewesen. Falls dies wahr wäre, müßte ich erwidern, daß es von jeher sehr übel mit der Universität bestellt gewesen sei... Ich selbst habe in Jena ein ähnliches Collegium, wie dieses, Sommer und Winter von 6-7 Uhr vor Hunderten gelesen, welches sich gegen den Schluß sehr zu verstärken pflegte. Ich muß nur gerade heraussagen: als ich hier ankam, wählte ich diese Stunde, weil keine andere übrig. Seit ich die Denkart darüber erkannt habe, werde ich sie mit Bedacht wählen und dies künftigen Sommer tun. Der Grund aller jener Mißbräuche ist der: es zeigt sich ein tiefes Unvermögen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, und eine Fülle von Flachheit und Langeweile, wenn man, nachdem so Gott will um 12 Uhr das Mittagessen verzehrt ist, es nicht länger in der Stadt aushalten kann. Und wenn Sie mir den Beweis führten - der, wie ich hoffe, nicht zu führen sein wird -, daß in Erlangen seit seiner Erbauung, daß in ganz
Franken, ja in ganz Süddeutschland dies Sitte sei, so werde ich mich nicht scheuen, darauf zu antworten, daß demnach in Erlangen und in Franken und in ganz Süddeutschland die Flachheit und Geistlosigkeit ihren Sitz aufgeschlagen haben müsse.» Eine Donnerrede hielt er. Man mag von einer solchen Donnerrede denken wie man will, echt Fichtesch ist sie, Fichtesch in der Art, daß Fichte eben drinnen stehen wollte und auch immer drinnen stand in dem, was er geistig an die Menschen heranbringen wollte; daß Fichte mit dem, was er sprach, nicht bloß etwas sagen, sondern etwas für die Seelen tun, die Seelen ergreifen wollte. Darum war jede Seele, die wegblieb, ein wirklicher Verlust, nicht für ihn, sondern für das, was er für die Menschheit erzielen wollte. Ein Tun war für Fichte das Wort. So stand er in der geistigen Welt drinnen, und das gab ihm die Möglichkeit, mit anderen gleichzeitig wie in einer gemeinsamen geistigen Atmosphäre in der geistigen Welt drinnen zu stehen; daß er wirklich nicht nur theoretisch den Satz verfocht: Die äußere Sinneswelt ist nicht das Wirkliche, sondern der Geist, und derjenige der den Geist kennt, der sieht auch hinter allem Sinnensein das geistige Sein.
Nicht nur Theorie war ihm das, sondern so war es ihm praktische Wirklichkeit, daß sich einmal später in Berlin das Folgende abspielen konnte: Er hatte in seinem Vortragsraum seine Zuhörer versammelt. Der Vortragsraum war in der Nähe des Spreekanals. Plötzlich kam eine furchtbare Botschaft: Kinder, unter diesen auch Fichtes Knabe, hatten unten gespielt, ein Knabe war ins Wasser gefallen, und man sagte, es sei Fichtes Sohn. Fichte machte sich mit einem anderen Freunde auf, und während die Zuhörer alle herumstanden, zog man den Knaben aus dem Wasser. Der Knabe sah Fichtes Sohn sehr ähnlich, aber
er war es nicht. Einen Augenblick aber mußte Fichte glauben, es sei sein Sohn. Das Kind wurde tot aus dem Wasser gezogen. Er bemühte sich um das Kind. Derjenige, der da weiß, welch inniges Familienleben im Hause Fichtes zwischen Fichte, Frau Johanna und diesem einzigen Sohne, der der einzige blieb, waltete, der weiß, was Fichte in jenem Augenblick durchgemacht hat: den größten Schrecken, den er hat durchmachen können, und den Übergang von dem größten persönlichen Schrecken zur größten persönlichen Freude, als er seinen Sohn wiederum in seine Arme schließen konnte. Dann ging er in ein Nebenzimmer, kleidete sich um und setzte seinen zweistündigen Vortrag in der Weise fort, wie er ihn sonst immer gehalten hatte, vollständig in der Sache drinnen.
Übrigens nicht nur das. Proben solchen Drinnenstehens in dem geistigen Leben hat Fichte oft und oft gegeben. Da finden wir ihn zum Beispiel gerade während seiner Berliner Zeit so, daß er den Leuten Vorlesungen hält, die eine Kritik des damals gegenwärtigen Zeitalters sein sollten, eine schwere Anklage dieses Zeitalters. Er nahm so die einzelnen Zeitalter der Geschichte durch. Das allein, in dem er lebe, sagte er, sei dasjenige, in dem die Selbstsucht bis zum höchsten gekommen sei. Und in dieses Zeitalter der Selbstsucht fand er hineingestellt als den, der die Selbstsucht in der Person verkörperte, Napoleon. Fichte dachte sich im Grunde dazumal, während das Napoleonische Chaos über Mitteleuropa hereinbrach, nie anders als den Gegner im Geiste gegenüber Napoleon. Und eine Charakteristik Napoleons ist da, von der man sagen kann: In dem, wozu der vorhin geschilderte Bauernknabe im blauen Kittel herangereift war, in dem deutschen Mann erstand ein Bild Napoleons, ebenso hervorgehend aus innerster deutscher Kraft und deutscher Anschauung wie aus höchster
philosophischer Lebensauffassung. Wir sind zu einem Menschendasein in der Gegenwart gekommen, so sagte Fichte, in der man die Erkenntnis verloren hat, daß Geistesweben und Geisteswesen die Welt durchpulst und auch durch das Menschenleben geht, durch die Menschenentwikkelung zieht, als sittliche Impulse die Menschen von Epoche zu Epoche trägt und daß der Mensch nur insofern etwas wert ist im Verlaufe der Geschichte, als er getragen wird von dem, was sich erhält an sittlichen Impulsen, an moralischer Weltordnung von Epoche zu Epoche. Davon aber weiß man nichts. Zu einem Zeitalter ist man gekommen, wo man Geschlecht nach Geschlecht in der Welt auftreten sieht wie Kettenglied an Kettenglied. Vergessen haben die Besten, so sagte Fichte, was sich durch diese Kettenglieder hindurchziehen muß als moralische Weltanschauung. In diese Welt herein ist Napoleon versetzt. Eine Quelle ungeheurer Kraft, aber ein Mensch, so sagte Fichte, in dessen Seele zwar einzelne Bilder von Freiheit zu finden sind, aber niemals eine wirkliche Idee, ein wirklicher Begriff von wahrer umfassender Freiheit, wie sie wirkt von Epoche zu Epoche in dem sittlichen Ideal der Menschen, in der moralischen Weltordnung. Und von diesem Grund-mangel, daß eine Persönlichkeit, die nur Hülle ist, die keinen Seelenkern hat, solche Kraft entfalten kann, von dieser Erscheinung her leitete Fichte die Persönlichkeit und das ganze Unglück, wie er es sagte: Napoleon.
Wenn man dies nebeneinanderstellt: Fichte, den kraft-vollsten deutschen Weltanschauungsmann mit seiner Idee von Napoleon, und Napoleon selber, so muß man, um die ganze Lage klar zu machen, wohl hinweisen auf einen Ausspruch Napoleons, den er, wie erzählt wird, auf St. Helena nach seinem Sturze getan hat, denn dadurch wird erst die ganze Lage im Grunde genommen beleuchtet: Alles, alles
wäre gegangen. Ich ware nicht gefallen gegen alle die Mächte, die sich gegen mich aufgerichtet haben. Nur mit einem habe ich nicht gerechnet, das hat mich eigentlich zum Sturze gebracht: mit den deutschen Ideologen! -Mögen die kleinen Geister über die Ideologie dieses oder jenes sprechen, diese Selbsterkenntnis Napoleons wiegt, ich denke, mehr als alles, was man gegen Fichtes Idealismus, der aber durchaus praktisch war, einwenden möchte.
Daß es schließlich einem solchen Idealisten, wie es Fichte war, nicht schwer ist, auch einmal praktisch zu sein, bei Fichte können wir es geradezu beweisen, richtig historisch beweisen. Es war nämlich notwendig geworden, daß er als Kompagnon, als Gesellschafter in das Geschäft seines Vaters eintrat, das nun seine Brüder übernommen hatten. Da war er nun Teilhaber an dem Bandwirkergeschäft seines Hauses. Die Eltern lebten noch. Und man kann nun auch verfolgen, wie er sich als Geschäftsteilhaber eines Bandwirkergeschäftes ausnahm. Er war ein guter, vorsichtiger Geschäftsmann, der seinen Brüdern, die reine Geschäftsleute geblieben sind, wirklich sehr an die Hand gehen konnte. Gegenüber all denen, die da sagen: Ach diese Idealisten, sie verstehen nichts vom praktischen Leben, das sind Hirngespinstmacher! - konnte Fichte aus dem innersten Wesen seines ganzen Daseins heraus gerade in den Vorträgen, die er über «Die Bestimmung des Gelehrten» hielt, Worte sagen, die immer wiederum wiederholt werden müssen gegenüber denjenigen Menschen, die von dem Unprak-tischen der Ideale sprechen, von dem Unpraktischen überhaupt der geistigen Welt. Als Fichte über die Bestimmung des Gelehrten sprach, sagte er in der Vorrede die folgenden Sätze: «Daß Ideale in der wirklichen Welt sich nicht darstellen lassen, wissen wir anderen vielleicht so gut als sie, vielleicht besser. Wir behaupten nur, daß nach ihnen die
Wirklichkeit beurteilt, und von denen, die dazu Kraft in sich fühlen, modifiziert werden müsse. Gesetzt, sie könnten auch davon sich nicht überzeugen, so verlieren sie dabei, nachdem sie einmal sind, was sie sind, sehr wenig; und die Menschheit verliert nichts dabei. Es wird dadurch bloß das klar, daß nur auf sie nicht im Plane der Veredlung der Menschheit gerechnet ist. Diese wird ihren Weg ohne Zweifel fortsetzen; über jene wolle die gütige Natur walten und ihnen zu rechter Zeit Regen und Sonnenschein, zuträgliche Nahrung und ungestörten Umlauf der Säfte, und dabei - kluge Gedanken verleihen!» Dieser deutsche Mann wußte schon über die Bedeutung der Ideale, auch über die Bedeutung des praktischen Lebens im rechten Sinne Bescheid. Aber Fichte war eben diese auf sich selbst gestellte Natur. Mag man das Einseitigkeit nennen, -solche Einseitigkeit muß zuweilen im Leben auftreten, wie Kräfte im Leben wirken müssen, die zuweilen über das Ziel hinausgehen müssen, damit sie, indem sie über das Ziel hinausgehen, das Rechte wirken.
Gewiß, in Fichtes Verhalten war manche Schroffheit gemischt, als er in Jena den Leuten nicht bloß moralische Vorlesungen halten wollte, sondern allen Schlendrian, allen Suff, alles Herumbummeln der Studenten auch praktisch bekämpfen wollte. Er hatte schon einen gewissen Anhang in der Studentenschaft gewonnen. Es hatte zudem eine Anzahl Leute eine Eingabe gemacht, daß man diese oder jene Vereinigung, die besonders bummelte, abschaffen wolle. Aber er war nun eben eine schroffe Natur, er war ein Mensch, der nicht weiche Handbewegungen zu machen wußte, sondern mit der Faust zuweilen auch derb vor sich hinschlug - selbstverständlich alles symbolisch gemeint. Da kam denn doch das zunächst, daß einem größeren Teil der Jenenser Studentenschaft die praktische moralische
Wirksamkeit Fichtes recht zuwider war. Und sie rotteten sich zusammen und warfen ihm die Fenster ein. Was dann Goethe, der Fichte verehrte, der von Fichte verehrt wurde, zu dem guten Witz veranlaßte: Nun ja, das ist der Philosoph, der alles auf das Ich zurückführt. Es ist ja allerdings eine unbequeme Art, von dem Dasein des Nicht-Ich überzeugt zu werden, wenn einem die Fenster eingeworfen werden; das hat man aus dem Nicht-Ich heraus als sein Gegenteil gesetzt!
Aber das alles kann uns kein Beweis dafür sein, daß Fichtes Art zu philosophieren nicht in vollem Einklange gestanden hätte mit Goethes Art zu philosophieren. Und tief wahr empfand Fichte, als er am 21. Juni 1794, bald nachdem er seine Vorträge in Jena begonnen hatte, mit der Übersendung der Korrekturbogen seiner Wissenschaftslehre an Goethe schrieb: «Ich betrachte Sie, und habe Sie immer betrachtet als den Repräsentanten . . . (der reinsten Geistigkeit des Gefühls> auf der gegenwärtig errungenen Stufe der Humanität. An Sie wendet mit Recht sich die Philosophie: Ihr Gefühl ist derselben Probierstein.» Und Goethe schreibt an Fichte, als er die Wissenschaftslehre übersandt bekommen hatte: «Das Übersendete enthält nichts, das ich nicht verstände oder wenigstens zu verstehen glaubte, nichts, das sich nicht an meine gewohnte Denkungsweise willig anschlösse.» Und weiter schreibt Goethe dem Sinne nach: Ich glaube, Sie werden dasjenige, womit die Natur mit sich zwar immer einig war, womit die Menschenseelen aber einig werden müssen, auf eine rechte Art vor diese Menschenseelen bringen können. - Und wenn heute jemand, der jene Wissenschaftslehre, die dazumal Fichte hat drucken lassen, trocken und ungoethisch finden würde, etwa behaupten wollte, daß Goethe für diese Sache keinen Sinn gehabt hätte, dann würde man ihm erwidern
müssen, was ich erwidert habe, als ich im Weimarer Goethe-Schiller-Archiv die Briefe Fichtes an Goethe im GoetheJahrbuch 1894 herausgab. Es finden sich im Goethe-Schiller-Archiv von Goethe selbst geschriebene Auszüge aus Fichtes Wissenschaftslehre, wo Goethe Satz für Satz niedergeschrieben hat, was ihm an Gedanken beim Lesen von Fichtes Wissenschaftslehre aufschoß. Und schließlich begreift man auch, wie einer der deutschesten Deutschen, Goethe, dazumal aus der reinsten Geistigkeit des Gefühls, aus der heraus er eine neue Weltanschauung suchte, die Hand reichen mußte dem, der aus Vernunft-Energie heraus als der deutscheste der Deutschen dazumal nach einer philosophischen Weltanschauung suchte. Hat es Goethe doch einmal, als er von seinem Verhältnis zur Kantschen Philosophie sprach, schön in Worte gebracht. Er sagte ungefähr so, nicht wörtlich, aber dem Sinne vollständig entsprechend: Da trat Kant auf und sagte, indem der Mensch den Blick in die Welt richte, könne er nur ein Sinneswissen haben. Das Sinneswissen sei aber bloß Erscheinung, bloß etwas, was der Mensch selber durch seine Auffassung in die Welt hineinbringe. Das Wissen müsse abgesetzt werden, man könne nur durch einen Glauben zur Freiheit, zur Unendlichkeit, zu einer Auffassung des göttlich-geistigen Daseins selber kommen. Und was man unternehmen wollte, um nicht zu einem Glauben zu kommen, sondern zu einem unmittelbaren Anschauen der geistigen Welt, zu einem Leben und Weben des eigenen Schaffens in dem Schaffen des göttlichen Weltengeistes, und wovon Kant glaubt, man könne es nicht unternehmen, von dem sagt Kant, es würde sein «das Abenteuer der Vernunft». Und Goethe meint:
Nun, so müßte man denn entschieden wagen, dieses Abenteuer der Vernunft mutig zu bestehen! Und wenn man schon einmal an der geistigen Welt nicht zweifle, sondern
an Freiheit und Unsterblichkeit, an Gott glaube, warum sollte man dieses Abenteuer der Vernunft nicht wacker bestehen und sich mit dem Schaffenden der Seele in die schaffende Geistigkeit versetzen können, die die Welt durchwallt und durchwebt, in der Welt selber? - Nur auf eine andere Art, als Goethe es bestehen wollte, fand er es dennoch bei Fichte.
Und es mußte einmal, wenn auch in Schroffheit, auftreten dieses Hindrängen nach der Geistigkeit, nach dem Erfassen der schaffenden Weltweisheit, indem sich das schaffende Ich in der schaffenden Weltenwesenheit, mit ihr eins, darinnen erlebt. Und das sollte nach Fichtes Anschauung durch seine Wissenschaftslehre geschehen. Wie wir es charakterisieren konnten, ist es eine unmittelbare Tat des deutschen Volkes, denn wir sehen aus dem deutschen Volke Fichtes Seele zu der Höhe hinaufwachsen, und Fichte war sich dessen bewußt, daß im Grunde seine Philosophie immer ein Ergebnis seines lebendigen Verkehrs mit dem deutschen Volksgeist war. Damit hat der deutsche Volksgeist das, was er selber über Welt und Leben und über Menschenziele zu sagen hatte, vor die Welt hingestellt. Hingestellt so, wie es allerdings nur sein konnte, indem es auf den ersten Anhub geschah in einer so schroffen Persönlichkeit, wie es Fichte war.
Leicht zu behandeln war Fichte nicht. Als zum Beispiel in Berlin die Universität begründet werden und Fichte den Plan ausarbeiten sollte, bildete er sich eine Idee von der Universität und arbeitete den Plan zu dieser Idee auch in allen Einzelheiten aus. Aber was wollte er denn? Er wollte etwas so grundsätzlich Neues in der Universität zu Berlin schaffen, dazumal im Beginn des 19. Jahrhunderts, daß -wir dürfen es sagen, ohne daß dagegen auch nur irgendein Widerspruch auftauchen könnte - dieses Neue heute
noch nirgend in der Welt verwirklicht ist; daß die Welt noch auf die Verwirklichung wartet. Man hat selbstverständlich den Plan Fichtes nicht verwirklicht, obzwar er, wie er sich ausdrückte, nichts anderes wollte, als die Universität zu einem Institut machen, das da bedeutet: «Eine Schule der Kunst des wirklichen Verstandesgebrauches.> Also nicht Menschen, die das oder jenes wissen, sollten aus der Universität hervorgehen, die Philosophen oder Naturwissenschafter oder Mediziner oder Juristen seien, sondern Menschen, die im Gesamtgefüge der Welt so drinnen-stehen, daß sie die Kunst des Verstandesgebrauches vollständig handhaben können. Denken wir uns, was das für ein Segen wäre, wenn es irgendwo in der Welt eine solche Universität gäbe! Wenn wirklich irgendwo eine Kunstschule verwirklicht wäre, aus der Menschen hervorgingen, die ihr inneres Seelisches so lebendig gemacht haben, daß sie sich wirklich frei bewegen würden in dem, was Wesens-logik des Daseins ist.
Aber leicht handhabbar war diese Persönlichkeit schon nicht; groß, um der Geschichte einen mächtigen Einschlag zu geben, dazu war sie da. Fichte wurde auch der zweite Rektor der Universität. Er faßte seinen Beruf so energisch auf, daß er nur vier Monate Rektor sein konnte. Länger ertrugen weder die Studenten noch die beteiligten Behörden das, was er durchführen wollte. Das alles aber ist aus deutschem Volkstum heraus, gerade wie es bei Fichte auftrat, aus deutschem Volkstum heraus geschmiedet. Denn als er seine «Reden an die deutsche Nation» hielt, über die ich ja hier schon zum wiederholten Male, und zwar nicht nur während des Krieges, sondern auch vor dem Kriege -wie überhaupt über die große Erscheinung Fichtes - gesprochen habe, da wußte er, daß er dem deutschen Volke das sagen wollte, was er gleichsam durch sein meditatives
Zwiegespräch mit dem Weltengeist erlauscht hatte. Nichts anderes wollte er hervorrufen dazumal, als: in ihren Seelen sollte sich bewegen dasjenige, was sich aus dem tiefsten Quell des Deutschseins in den Seelen der Menschen bewegen kann. Diese Art und Weise, wie sich Fichte zu seiner Zeit und zu denjenigen stellte, von denen er wollte, daß sie ihre Seelen in eine Richtung bringen, die den Aufgaben im Weltendasein gewachsen ist, - das war allerdings nicht geeignet, auf Flachlinge, auf oberflächliche Leute einen anderen Eindruck zu machen, als höchstens den der Neugierde. Aber den wollte Fichte ganz und gar nicht erzeugen. Es ist ja selbstverständlich immer das Alierleichteste, wenn so etwas wie Fichtes Geistigkeit in die Welt tritt, sich darüber lustig zu machen. Nichts leichter, als Kritik zu üben, sich lustig zu machen. Das taten die Leute ja genügend. Das brachte Fichte in ernste Lagen. Zum Beispiel, gleich als er an die Universität Jena kam, war er schon in einer recht ernsthaften Lage dadurch, daß er nicht so recht einverstanden sein konnte mit denen - nun ja, die auch Philosophen waren. Da war zum Beispiel an der Jenenser Universität derjenige, der der erbeingesessene Philosoph war. Schmid hieß er. Der hatte sich über dasjenige, was Fichte bis dazumal geleistet hatte, der jetzt sein Kollege werden sollte, so abfällig ausgesprochen, daß es eigentlich schon schandhaftig war, daß nun Fichte der Kollege werden sollte. Da sagte denn Fichte wieder einige Worte in jener Zeitschrift, in der sich Schmid ausgesprochen hatte. Und es ging so hin und her. Fichte trat sein Lehramt in Jena eigentlich an, indem er in die Jenaer Zeitschrift, in der Schmid geschrieben hatte, einrücken ließ: Ich erkläre, daß für mich Herr Schmid nicht mehr vorhanden sein wird in der Welt. - So stellte er sich neben seinen Kollegen hin.
Das war eine ernste Lage. Eine weniger ernste, aber deshalb
nicht minder bezeichnende war diese: Es erschien dazumal in Berlin eine Zeitschrift «Der Freimütige». Kotzebue, der «berühmte> deutsche Dichter Kotzebue und noch ein anderer hatten Anteil an der Herausgabe dieser Zeitschrift, stellten sie zusammen. Man kann eigentlich nicht recht herausbekommen - ich glaube wirklich, nicht einmal durch ganz intimes Hellsehen könnte man herausbekommen! -was eigentlich dieser Kotzebue dazumal in den Vorträgen von Fichte wollte. Aber nur eine Zeitlang konnte man es nicht recht herausbekommen. Später stellte es sich heraus, denn es erschienen im «Freimütigen>, der sich dazumal in Berlin recht wichtig machte, die hämischsten Angriffe über die Vorträge von Fichte. Fichte wurde es einmal, nun, sagen wir, zu dumm. Und siehe da, er nahm sich eine Nummer dieses «Freimütigen> und zerpflückte sie vor den Zuhörern, zerpflückte sie so, daß er - was er auch konnte -einen unüberwindlichen Humor ausgoß über dasjenige, was dieser «Freimütige» zu sagen hatte. Das Gesicht eines der Zuhörer, von dem man früher nicht wußte, warum er eigentlich teilnahm, wurde immer länger und länger. Und schließlich stand Herr Kotzebue mit langem Gesicht auf und erklärte, das brauche er sich nicht mehr länger anzuhören! Dann ging er fort, erschien nicht wieder. Aber Fichte war ganz froh, daß er ihn los war.
Ja, Fichte konnte nach der Art, wie er sich praktisch in das Leben hineinstellte, das er als das innerste Leben des Menschendaseins gestalten wollte, auch schon einen Ton finden, der durchaus unmittelbar die Lage ergriff. Trotzdem er ganz in der geistigen Welt lebte, war er nicht ein weltfremder Idealist, aber er war ein Mann, der ganz auf sich selber ruhte und der dasjenige, was er als sein Wesen in sich, auf sich selber ruhend, fand, mit allem Ernst nahm. Daher konnte er auch in einer gewissen Zeit, als Napoleon
Preußen überwunden hatte, als die Franzosen in Berlin waren, nicht in Berlin bleiben. Er wollte nicht in der Stadt sein, die französisch unterjocht war. Er ging nach Königsberg, später nach Kopenhagen. Er kehrte erst wieder zurück, als er als der deutsche Mann auftreten wollte, der das innerste Wesen seines Volkstums, des Volksseins, seiner Volksart, vor seine Volksgenossen hinstellte in den «Reden an die deutsche Nation».
Mit Recht empfindet man Fichte wie einen unmittelbaren Ausdruck des deutschen Volkstums, wie den Ausdruck dessen, was als Geist im Grunde immerdar, insofern wir die Deutschheit in ihrem Geiste zu erfassen in der Lage sind, mitten unter uns lebt, - nicht nur in Gedanken, wie es etwa so schön ein Philosoph ausgesprochen hat, der als Philosoph gar nicht in Übereinstimmung war mit Fichte, Robert Zimmermann, der da sagte: «Solange in Deutschland ein Herz schlägt, das die Schmach fremder Zwingherrschaft zu fühlen vermag, wird das Andenken des Mutigen fortleben, der im Moment der tiefsten Erniedrigung, unter den Trümmern der zusammengebrochenen Monarchie Friedrichs des Großen, mitten in dem von Franzosen besetzten Berlin, vor Augen und Ohren der Feinde, unter Spionen und Angebern, die von außen durchs Schwert geknickte Kraft des deutschen Volkes von innen durch den Geist wieder aufzurichten und in demselben Augenblicke, da die politische Existenz desselben für immer vernichtet zu sein schien, durch den begeisternden Gedanken allgemeiner Erziehung, ein solches in künftigen Generationen neu zu erschaffen unternahm.> Mögen wir auch heute -das möchte ich wiederholentlich hier aussprechen -, in bezug auf den Inhalt von vielem, was in den «Reden an die deutsche Nation», ja, was in den anderen Schriften Fichtes steht, ganz anders denken müssen, darauf kommt
es nicht an. Darauf kommt es an, daß wir fühlen den deutschen Geist, der durch seine Erzeugnisse fließt, und die Erneuerung des deutschen Geistes mit Bezug auf seine Stellung im Weltenall, wie sie gegeben ist in den «Reden an die deutsche Nation». Daß wir das als den Geist fühlen, der mitten unter uns ist, und den wir ergreifen nur in dem einen Beispiel Fichtes, durch das er sich in einer allerdings zuerst weit hintönenden Art in die deutsche Entwickelung hineingestellt hat. Kraftvoll und energisch, aber tief innerlich, so wollte sich dieser Geist hineinstellen in die Weltenentwickelung. Daher fand Fichte noch in der Zeit, als schon sein Lebensabend hart herankam, die Möglichkeit, gerade in der intimsten Art wiederum einmal seine ganze Wissenschaftslehre umgießend und erneuernd, wiederum sie meditierend, im Herbste 1813 vor seine Berliner Zuhörer zu bringen, was er als seine tiefsten Gedanken erfaßt hatte. Da warf er noch einmal, wiederum in der geschilderten Art die Seele seiner Zuhörer ergreifend, den Blick darauf, wie unmöglich der Mensch hinter das Dasein und seine Wirklichkeit kommen kann, der nicht dieses Dasein im Geiste, jenseits aller Sinnlichkeit, erfassen will. Denjenigen Menschen aber, die da glauben, im Sinnen-Sein und dem, was nur nach dem Sinnen-Sein geformt ist, irgendein wahres Dasein zu erblicken, den Menschen rief er zu in den Vorträgen, die zum Letzten gehören, das Fichte gesprochen hat: «Ihr Wissen geht auf im Unverstande und einem leeren Worte; und darüber lobpreisen sie sich wohl, und finden ganz recht, daß es so ist. Zum Beispiel Sehen: Es wirft sich ein Bild des Gegenstandes auf die Netzhaut. Auf der ruhigen Wasserfläche spiegelt sich auch ein Bild des Gegenstandes. Sieht darum, unserer Meinung nach, die Wasserfläche? Was ist nun das Mehr, das hinzukommen muß zwischen dieses Bild und das wirkliche Sehen, das bei uns
ist, bei der Wasserfläche nicht? Darüber geht ihnen auch nicht einmal die Ahnung auf, denn bis dahin geht nicht ihr Sinn.> Einen besonderen Sinn, einen neuen Sinn, so sagt Fichte, muß man in sich gewahr werden, wenn man erleben will jenes Sein im Geiste, das alles andere Sein erst begreiflich macht. «Ich bin, und ich bin mit allen meinen Zielen nur in einer übersinnlichen Welt!» Das ist eines der Worte, die Fichte selbst geprägt hat und die wie das Leitmotiv durch alles hindurchgehen, was Fichte zeit seines Lebens gesprochen hat, was er in einer anderen Art bekräftigte noch einmal in jenem Herbst 1813. Und wovon sprach er damals? Daß die Menschen sich bewußt werden müssen, daß man auf die Weise, wie man im gewöhnlichen Leben und in der gewöhnlichen Wissenschaft die Dinge und die Welt sieht, niemals hinter das wahre Sein kommen könne. Da müsse man sich gewahr werden, daß ein übersinnlicher Sinn in einem jeden Menschen lebe und daß der Mensch aufgehen könne in einer übersinnlichen Welt, mit diesem Sinne sich hineinleben könne als ein Schaffender in seinem Ich im schaffenden, webenden Weltengeist. Es ist, so sagt Fichte, wie wenn ein Sehender in eine Welt von Blinden kommt und ihnen die Welt der Farben und Formen begreiflich machen will, und die Blinden leugnen es ihm ab. So leugnet der, der materialistisch gesinnt ist, weil er nicht den Sinn dafür hat, gegenüber dem, der da weiß: Ich bin, und ich bin mit all meinen Zielen und Schaffen in der übersinnlichen Welt. Und so prägte dazumal Fichte seinen Zuhörern dieses Sein im Übersinnlichen, dieses Leben im Geistigen, diese Handhabung eines Über-sinnlich-Sinnlichen ein, daß er sagte:
«Der neue Sinn ist demnach der Sinn für den Geist; der, für den nur Geist ist, und durchaus nichts Anderes, und dem auch das Andere, das gegebene Sein, annimmt die
Form des Geistes, und sich darein verwandelt, dem darum das Sein in seiner eigenen Form in der Tat verschwunden ist.>
Es ist ein Großes, daß in dieser Weise das Bekenntnis des Geistes abgelegt worden ist innerhalb der deutschen Geistesentwickelung vor denen, die suchen wollten, was im höchsten Sinne das deutsche Volk zu sprechen hat, wenn es aus dem Innersten seines Wesens heraus spricht. Denn das hat durch Fichte dieses deutsche Volk gesprochen. Und mehr als für irgendeinen anderen ist es für Fichte wahr, daß der deutsche Volksgeist auf der damaligen Stufe, wie er sprechen konnte, zu dem deutschen Volk gesprochen hat.
Ob wir ihn äußerlich anschauen, diesen Fichte, ob wir auf seine Seele den Seelenblick hinwenden, immer erscheint er uns als der unmittelbarste Ausdruck des deutschen Volkstums selber, desjenigen, was innerhalb der Deutschheit nicht nur zu irgendeiner Zeit da ist, was immer da ist; was, wenn wir es nur zu ergreifen wissen, immer mitten unter uns ist. Gerade durch das, was Fichte ist, wie er sich uns darstellt, darstellt so, daß wir wie plastisch sein Bild vor unserer Seele haben, wohl ihn schauen, wohl ihm zuhören möchten im Geiste, wenn er eine Atmosphäre bildet, die sich ausbreitet zwischen seiner Seele und der Seele seiner Zuhörer, daß wir ihm ganz nahe sein wollen: das macht, daß wir ihn fühlen können, ich möchte sagen, wie einen legendarischen Helden, wie einen Geisteshelden, der da als ein Anführer seines Volkes im Geiste immer geschaut werden kann, wenn dieses Volk ihn nur recht versteht. Es kann ihn schauen, indem es sich ihn plastisch vor die Seele stellt als einen seiner besten Geisteshelden.
Und heute, im Zeitalter der Tat, da das deutsche Volk in einer unvergleichlichen Weise ringen muß um sein Dasein, um seine Existenz, darf vor unserer Seele, vor unserem
Geiste aufstehen das Bild desjenigen, der Deutschheit, deutsches Wesen, von dem höchsten Gesichtspunkte aus, aber auch in der energischsten, in einer einzigen Weise zu schildern vermochte; so zu schildern vermochte, daß wir bei ihm mehr als bei einem andern glauben können: Wir haben ihn unmittelbar unter uns, wenn wir ihn recht verstehen. Denn alles ist bei ihm so sehr aus einem Guß, es stellt sich unmittelbar so dar, daß er in aller Lebendigkeit unter uns dasteht, indem wir ihn betrachten; ob der einzelne Zug aus der Ganzheit seines Wesens hervorgeht oder ob wir intimste Seiten seiner Seele auf uns wirken lassen, er steht als Ganzheit vor uns da. Er kann nicht anders von uns erfaßt werden, sonst ist er stümperhaft, oberflächlich erfaßt.
Ja, er kann erschaut werden, wie er die Seelen zum Sich-hingeben an die Daseinskräfte der Welt, schaffend im Schaffenden, innerhalb seines Volkes entzündet, wie er mit dieser Seele aufsteigt zu dem Erleben im Geiste, und wie er sich als Leben einfügt in den Entwickelungsfortschritt seines Volkes. Man öffne nur das Seelenauge. Man wird ihn nicht verstehen, wenn man ihn nicht also plastisch versteht. Wenn man aber sein Seelenauge für seine Volks-größe öffnet, dann steht er mitten unter uns.
Die Art und Weise wie er gesucht hat, in anderer Weise als andere Lehrer zu wirken, indem er, sich hinstellend vor seine Zuhörer, nicht sprach, sondern tat mit seinen Worten, so tat, daß ihm gleichgültig war, was er sagte, weil es in der Seele des Zuhörers nur entzünden sollte die eigene Tat, weil mit der Seele etwas geschehen sollte, etwas getan werden sollte, und weil die Seelen anders den Saal verlassen sollten, als sie hineingegangen waren, - dies bewirkt das ganz Eigentümliche, daß er uns lebendig werden muß in der Art und Weise, wie er wirkte aus dem Volke
in das Volk, und daß wir glauben, ihn zu hören, wenn er das, was er erlauscht hat in einsamen Meditationen, durch die er sich wohl vorbereitete zu jedem gesprochenen Vortrag, was er erlauscht hat in seinem Selbstgespräch mit dem Weltengeist, nun nicht hinstellte vor seine Zuhörer, sondern in das Wort, das Tat ist, umwandelte, so daß er diejenigen, zu denen er gesprochen hatte, als andere Menschen entließ. Andere Menschen waren sie geworden -aber nicht durch seine Kraft, sondern durch die Erweckung und Entzündung ihrer eigenen Kraft. Wenn wir ihn in solcher Art richtig verstehen, dann können wir glauben, ihn hellhörend zu vernehmen, wie er mit seinem Wort, mit der Schärfe, mit dem scharfen Messer seines Wortes unmittelbar den Geist ergreifen will, den er vorher in der Seele ergriff, indem er, wie gesagt worden ist von ihm, nicht bloß gute, sondern große Menschen in die Welt hineinstellen wollte durch seine Pflege der Seele.
Man kann, wenn man so recht lebendig macht, was er war, nicht anders als seine Worte hören, seine Worte, die aus dem Geiste selber zu kommen scheinen, der sich in diesem Fichte nur ein Werkzeug machte, um zu sprechen, aus dem Geiste der Welt selber heraus zu sprechen, befeuernd, Feuer und Wärme und Licht erweckend. Herzhaftigkeit rollte in seinen Worten, Sittenmütigkeit trieben sie vor sich her. Herzhaftigkeit wurde aus seinen Worten, wenn sie durch die Ohren in die Seelen, in die Herzen der Zuhörer strömten, Sittenmütigkeit trugen diese Worte in die Welt hinaus, wenn mit dem Feuer, das diese Worte in den Seelen der Zuhörer entzündet haben, diese Zuhörer, wie wir so oft hören von denen, die Fichtes Zeitgenossen waren, als die tüchtigsten Männer in die Welt hinauszogen. Man öffne das Geistesohr, und man kann vernehmen, wenn man Fichte überhaupt versteht, unmittelbar wie
einen Gegenwärtigen den, der aus dem Geiste seines Volkes heraus spricht. Und wer ein Ohr hat für solche Volksgröße, der wird sie hören mitten unter uns. Und selten wird ein Geist so vor uns stehen, daß wir alles dasjenige verfolgen können, was er ist bis in jede einzelne Tat des Lebens hinein. Die Pflicht, die moralische Weltordnung, wie er sie vertrat auf der Höhe seiner Philosophie, sehen wir sie nicht schon, wenn wir den Knaben schauen, wie er mit sieben Jahren, weil er aus der Neigung heraus Liebe zum «Gehörnten Siegfried» erfaßt hat, diesen ins Wasser wirft, da er sich nicht in Übereinstimmung mit seinen Pflichten fühlt? Finden wir den sinnenden Mann, der sich zu seinen Vorträgen vorbereitet, der den Geist auf die Geheimnisse der Welt zu richten weiß, nicht schon in dem Knaben, der draußen auf der Weide steht und stundenlang den Blick nach einer Richtung in die Geheimnisse der Natur hinein-schweifen läßt, bis der Schäfer kommt und ihn nach Hause führt? Fühlen wir nicht das ganze Feuer, das Fichte beseelte, das ihn auf seiner Lehrkanzel in Jena beseelte, und später, als er zu den Repräsentanten, wie er sagte, seines ganzen Volkes in den «Reden an die deutsche Nation> sprach? Fühlen wir es nicht schon da, wo er, die Predigt des Landpfarrers wiederholend, Eindruck auf den Freiherrn von Miltitz machte? Fühlen wir nicht in allem einzelnen, selbst in den kleinsten Handlungen seines Lebens, wenn wir nur ein wenig geistig fühlen können, diesen Geist ganz nahe? Fühlen wir nicht, wie Seelenhaftigkeit, Herzhaftigkeit, Sittenmütigkeit von diesem Geiste ausströmt in die ganze nachherige deutsche Entwickelung? Fühlen wir nicht das ewig Lebendige, das da lebt, wenn wir auch mit dem Einzelnen nicht übereinstimmen können, in den «Reden an die deutsche Nation>? Trotzdem sie 1824 zweimal von der Zensur konfisziert worden sind, waren sie nicht tot zu
machen. Sie leben gerade heute und müssen leben in den Seelen.
Wie wir ihn schauen können, diesen Fichte, mitten unter uns! Wie wir ihn hören können, wenn wir ihn recht verstehen! Wir können ihn fühlen, wenn wir mit der Seele fühlen, wie er seine Zuhörer begeistert, wie er das ganze deutsche Volk in seiner ferneren Entwickelung begeistert, wie das, was er geschaffen hat, was er ausströmen ließ durch die fortlaufende Entwickelungsströmung seines Volkes, unvergänglich bleiben muß! Wir können nicht anders, wenn wir ihn recht verstehen, wir müssen diesen Geist Fichtes fühlen mitten unter uns.
FAUSTS WELTWANDERUNG UND SEINE WIEDERGEBURT AUS DEM DEUTSCHEN GEISTESLEBEN Berlin, 3. Februar 1916
Obwohl ich in diesem Winter an dieser Stelle schon einmal an Goethes «Faust» anknüpfte bei der Betrachtung über Goethes Weltbild im Zusammenhang mit dem deutschen Idealismus, so werde ich mir doch gestatten, als eine Art von Einleitung zu den angekündigten sechs Vorträgen Ihnen heute wiederum mit einer Betrachtung von Goethes «Faust» zu kommen. Ich glaube nämlich, daß sich in der Tat in Anknüpfung an Goethes «Faust» gerade für diejenige Weltanschauung, welche hier von mir vertreten wird, so viele Gesichtspunkte ergeben, daß gerade auf das Folgende, das in den nächsten Zeiten hier gesprochen werden wird, manches Licht fallen wird. Allerdings werde ich ja auch heute nur in der Lage sein, aphoristische Bemerkungen über das Thema zu machen, welches ich mir gestellt habe, denn dieses Thema ist an sich so reichhaltig, daß man immer nicht weiter kommen kann, als diesen oder jenen Gesichtspunkt aus einer Fülle von Gesichtspunkten herauszuheben. Und selbstverständlich ergibt sich dann auch, daß man mit jeder solchen Betrachtung Goethes «Faust» gegenüber auch einseitig sein muß. Das muß man aber schon auf sich nehmen.
Nach einer Betrachtung von Goethes «Faust», die, könnte man sagen, mehr als ein halbes Jahrhundert in Anspruch genommen hatte, hat mein alter Freund und Lehrer
Karl Julius Schröer die dritte Auflage seiner «Faust»-Ausgabe 1895 abgeschlossen mit einem Vorwort, in dem sich die Worte finden: «Nur des Deutschen Denkungsart war es bestimmt, das Faust-Problem zu lösen.» Und im Wesentlichen an diese Worte möchte ich meine heutigen Betrachtungen anknüpfen.
Das Faust-Problem wird ja nach einer gewiß berechtigten Meinung Herman Grimms, der so tief in all dem drinnen stand, was Goethe erstrebt und erlebt hatte, durch die Jahrhunderte, ja Jahrtausende der Ausgangspunkt sein für immer wiederkehrende Betrachtungen von Goethes «Faust», die sich ganz gewiß in der Aufeinanderfolge der Zeiten erheblich voneinander unterscheiden werden. Gerade mit Bezug darauf hat Herman Grimm schon in den siebziger Jahren ein sehr bedeutsames Wort gesprochen, das ich einleitungsweise nun auch anführen möchte. Her-man Grimm sagte dazumal: «Wir stecken heute noch zu tief in der Welt drin, welche Goethe im zweiten Teil des Stückes allegorisch und symbolisch darstellen wollte; auch hier werden spätere Zeiten erst den richtigen Standpunkt gewinnen.» Man kann sagen: ein ebenso bescheidener als hoher Standpunkt, den hier Herman Grimm einnimmt; denn er spricht durchaus aus einem tiefen Bewußtsein heraus, was eigentlich alles in diese Faust-Dichtung, die der \Velt durch Goethe gegeben wurde, hineingegossen ist. Und Herman Grimm sagt weiter: «Wir würden Goethes Faust zu wenig tun, wenn wir ihn nur für das nähmen, als das seine bunt wechselnden Erlebnisse ihn erscheinen lassen, und es wird noch eine Zeit kommen, wo die Erklärer dieses Gedichtes sich mehr mit dem, was in ihm liegt, beschäftigen werden, als mit dem, was bloß an ihm hängt.»
Gewiß, solche Aussprüche müssen auch heute noch in vieler Beziehung gelten. Dennoch sind, seit Herman Grimm
diese Worte niedergeschrieben hat, wiederum Jahrzehnte verflossen, und man darf heute vielleicht schon die Hoffnung hegen aus mancherlei Vertiefung, die das Geistesleben doch erfahren hat, daß man mehr hineinkommen kann, als es damals möglich war, in das, was in «Faust» liegt, gegenüber dem, was am «Faust» hängt, wie Herman Grimm sich ausdrückt.
Und so möchte ich denn heute Ihre Gedanken vorzugsweise darauf lenken, wie sich jene Weltwanderung gestaltete, die Faust, man kann sagen, von seiner Studierstube aus in die Welt unternimmt, in der ja die Menschen mehr oder weniger leben, und wie er durch diese Weltwanderung sich allmählich erhebt zu Gesichtspunkten einer Weltanschauung im weitesten Sinn des Wortes, welche eine Art Wiedergeburt Fausts aus dem deutschen Geistesleben heraus darstellt, insofern Goethe selbst an diesem deutschen Geistesleben teilgenommen hat. Ich glaube, man wird zu einem vollen Verständnis der Faustgestalt und ihrer Bedeutung für das Leben wohl nur kommen können, wenn man sich von vornherein darein zu vertiefen sucht, was eigentlich in jenem Augenblicke in Fausts Seele lebt, da wir ihn als dichterische Gestalt im Beginne der Faust-Dichtung, wie sie nun einmal durch Goethe fertig geworden ist, vor uns haben. In einer tief bedeutsamen Weise spricht ja das, was in Faust lebt, gleich der Eingangs-Monolog:
«Habe nun, ach, Philosophie...» und so weiter aus. Aber man muß doch wiederum aus einer Vertiefung in all das, was sich später im Verlauf der Geschehnisse vollzieht, welche die Faust-Dichtung darstellt, eine Art Licht darauf zurückwerfen, was in Fausts Seele in dem Augenblick lebt, den uns die Dichtung in ihrem Anfange darstellt. Faust steht da gegenüber denjenigen Wissenschaften, die er ja als die Wissenschaften der vier Fakultäten aufzählt, und wir
sehen ganz deutlich aus demjenigen, was er ausspricht, wie unbefriedigt er ist gegenüber den Wissenschaften, die da auf seine Seele gewirkt haben. Wir können die Frage aufwerfen: Was will Faust denn nun eigentlich? Und vielleicht kann diese Frage nur genügend beantwortet werden, wenn man im weiteren Verlauf des ersten Monologes gerade ins Auge faßt, daß sich Faust ja, trotzdem er die Wissenschaften der vier Fakultäten in sich aufgenommen hat, der Magie, das heißt demjenigen ergeben hat, was er als die traditionelle, als die herkömmliche geschichtliche Magie aus den verschiedenen Schriften über diese Magie hat kennenlernen können.
Ich möchte gleich aufmerksam darauf machen, daß leicht ein Mißverständnis über den ersten Faust-Monolog entstehen kann dadurch, daß man etwa glauben könnte, der Augenblick, in dem sich Faust der Magie ergibt, fiele mit dem Augenblick zusammen, in dem er diesen Monolog spricht, und Faust wäre vorher, bevor jene Empfindungen durch seine Seele gehen, die in diesem Monolog leben, noch nicht der Magie ergeben gewesen. Das würde ein Mißverständnis sein und würde das Verständnis des ganzen Seelenzustandes Fausts überhaupt außerordentlich erschweren. Man muß vielmehr annehmen, daß Faust bereits in dem Augenblick, da er seine Empfindungen in jenem Monolog ausspricht, tief drinnen lebt in dem, was er als die Magie anspricht; daß er viele Studien über diese Magie gemacht hat. Und wir können dies aus der Faust-Dichtung selber erweisen. Als später der Pudel, der Faust vom Osterspazier-gang begleitet, verschiedene Gestalten annimmt und Faust nicht weiß, was in diesem Pudel steckt, da greift Faust nach einem magisch-okkulten Buch und weiß nun ganz genau, nach seiner Meinung wenigstens, in welcher Weise er durch allerlei Beschwörungsformeln dieser Bücher hinter das Geheimnis
dieses Pudels kommen könne, wie er sich dieser geistigen Erscheinung gegenüber, die er vor sich zu haben glaubt, zu benehmen habe. Man muß also annehmen, daß Faust sich gewissermaßen schon in diesen Dingen bewandert gemacht hat.
Nun vernehmen wir, daß sich Faust ein magisches Buch nimmt, und daß er seiner Unbefriedigung dadurch entgegenkommen will, daß er sich zunächst an den Geist der großen Welt wendet, an den Geist des Makrokosmos, wie er es ausspricht. Was will er eigentlich? Was er will, wird man vielleicht nur ersehen können, wenn man sich ein wenig in Goethes Seele selber vertieft, die ja ihre Empfindungen in die Faustfigur gelegt hat, wenigstens in jener Zeit, in der der erste Faust-Monolog und die ersten Partien des «Faust» überhaupt entstanden sind.
Welcher Welt und Weltanschauung stand denn eigentlich Goethe gegenüber? Goethe stand derjenigen Weltanschauung gegenüber, welche auf Grundlage dessen aufgebaut werden konnte, was man über Natur- und Geistesleben erkannt hatte. Er stand mitten drinnen in der Weltanschauung, die durchaus mit den naturwissenschaftlichen Offenbarungen rechnete, wie sie durch Kopernikus, Galilei, Kepler und so weiter gegeben waren. Goethe stand demjenigen gegenüber, was man etwa im Sinne Kants die Weltanschauung der Aufklärung nennen könnte, das Hineinkommen in die Geheimnisse der Natur auf dem Wege des die Erfahrungen der Sinne und auch die Erfahrungen der Geschichte zusammenfassenden Verstandes. Was sich der Menschen-seele ergibt an Ideen, die, wie wir heute sagen, in gesunder Weise durch den normalen Verstand gefaßt werden und die sich ergeben über dasjenige, was die normale Erfahrung der äußeren Sinne erkunden kann, eine solche Weltanschauung war es, die Goethe umgab. Wie konnte er sich mit seinen
Bedürfnissen in das Weltbild hineinleben, das eine solche Weltanschauung geben konnte? Er konnte sich nicht völlig in eine solche Weltanschauung hineinleben; denn was Goethe unablässig wollte, und was er nun seinen Faust wollen läßt, das ist ein unmittelbares Zusammenwachsen des innersten Seelischen mit dem, was draußen die Welt durchwebt und durchlebt, ein Zusammenwachsen der Seele selbst mit den in der Welt vorhandenen Weltgeheimnissen, mit den tieferen Offenbarungen und den sich offenbarenden Kräften und Wesenheiten der Welt.
Nun stand Goethes Faust mit der Anschauung der Aufklärung der Natur und dem Geist der Welt so gegenüber, daß ihm das, was auf die eben charakterisierte Art eine Weltanschauung ergeben konnte, weit entfernt erschien davon, die Wesenheiten fassen zu können, die die Welt durchwalten und die er mit den innersten Kräften der Seele fassen wollte, mit denen er zusammenleben wollte. Denn was ihm diese auf die damalige Wissenschaft aufgebaute Weltanschauung geben konnte, das gab ihm höchstens ein Wissen, etwas, was den Kopf, was den Verstand ausfüllte, was sich aber nicht so weit identifizieren konnte mit dem menschlichen inneren Erleben, daß man wirklich mit diesem innerlich Erlebten hätte hineinkommen können in die Kräfte, die in Natur und Geisterwelt leben und weben. Suchen muß ich so etwa, sagt Goethes Faust, den innersten Kräften und Wesenheiten der Welt so beizukommen, daß, indem ich sie erfasse, meine Seele drinnen steckt in dem geistig-natürlichen Weben und Leben der Welt. Fasse ich aber nur dasjenige, was nach dem gegenwärtigen Standpunkt einer wissenschaftlichen Weltanschauung erfaßbar ist, so erfasse ich gleichsam nur in trokkener, nüchterner Weise mit dem Wissen diese geheimnisvollen Zusammenhänge der Welt, dasjenige, was die Welt
im Innersten bewegt. Und dieses Wissen kann mir niemals jene Fülle geben, die irn Ergreifen dessen liegt, was mich mit den Weltengeheimnissen zusarnmenleben läßt.
Und so will denn Goethes Faust sich auf eine andere Art hineinvertiefen in dasjenige, was die Welt durchwebt und durchlebt, in die Natur- und Geisteswelt. Und da Goethe ganz sicher niemals auf dem Standpunkte gestanden hat, auf dem heute und zu allen Zeiten viele Menschen stehen, daß dasjenige, was gerade zu ihrer Zeit lebt und errungen ist, das unbedingt Richtige ist - demgegenüber man sagen kann, wie so herrlich weit wir es gebracht haben -, so will Goethe anknüpfen an dasjenige, was vorangegangen ist, aus dem sich ja doch das Gegenwärtige heraus entwickelt hat. Und er läßt daher auch seinen Faust anknüpfen an diejenige Weltanschauung, aus der sich das ihn umgebende Weltbild herausgestaltet hat, anknüpfen an eine Weltanschauung, die allerdings den Glauben hatte, daß man mit dem, was sie sich errang, hineinkam in ein Miterleben mit den Geheimnissen des Daseins. Was war das für eine Weltanschauung?
Nun, man braucht nur so etwas in die Hand zu nehmen, wie die Werke des Agrippa von Nettesheim oder irgendeines anderen ähnlichen Philosophen des Mittelalters, und man wird eine Einsicht bekommen können, was Goethes Faust mit der Anrufung des Geistes des Makrokosmos eigentlich meint. Solche Begriffe, solche Ideen, wie sie Faust in der Philosophie der Aufklärung umgaben - ich meine den Faust Goethes, nicht den Faust des sechzehnten Jahrhunderts -, hatte man noch nicht zu der Zeit, in der etwa Agrippa von Nettesheim schrieb. Da machte man sich noch nicht in solch abgezogenen Begriffen ein Bild von der Welt wie im Zeitalter der Aufklärung, sondern da lebte man, indem man philosophische Weltanschauungen ausbildete,
ich möchte sagen, in Bildern, in Imaginationen. Aber man lebte auch in dem Glauben, daß man etwas herbeiführen könne, wodurch sich Natur und Geisteswelt intim darüber aussprechen, was sie eigentlich sind. Und was man nun als Weltbild bekam, war zugleich mit dem Fühlen und Empfinden der Seele verwoben, war in einer gewissen Weise gleich mit dem, was die Seele in sich selbst erlebte. Heute würde man sagen: Es war sehr anthropomorphistisch. Gewiß, das war es; es war so, daß der Mensch in dem, was er aus der Welt herausabstrahierte, Kräfte fühlte, die den Kräften der eigenen Seele verwandt waren. Von Sympathien und Antipathien der Dinge und ähnlichen Kräften sprach man im Naturdasein, wie man sie erlebte im eigenen Seelendasein. Aber weiter: Man glaubte in dieser Zeit, in der Agrippa von Nettesheim schrieb, wenig dem, was der Mensch durch sich selber erringen kann, was der Mensch einfach dadurch erringen kann, daß er die Kräfte seines Seelenlebens ausgestaltet, daß er dasjenige, was Erkenntniskräfte sind, entwickelt, um ihnen eine höhere Form zu geben, als diejenige ist, die der Mensch von Natur aus hat. Man glaubte nicht an die Forschungskraft der menschlichen Seele selbst; man glaubte vielmehr daran, daß man durch allerlei äußere Verrichtungen, diese oder jene Experimente - aber nun nicht Experimente in unserem heutigen Sinne - gewissermaßen dem Geistigen, das in der Natur webt, Gelegenheit gibt, zu zeigen, wie es in den Naturtatsachen lebt. Durch allerlei Veranstaltungen glaubte man hinter die Geheimnisse der Natur zu kommen. Man glaubte nicht, daß das Bewußtsein unmittelbar in die Natur eindringen kann durch Kräfte, die es sich erwirbt. Man glaubte, man müsse diese oder jene Verrichtungen, diese oder jene Veranstaltungen machen, um gleichsam dadurch, daß man Zauber ausgeübt hat, die Natur so zum Sprechen zu bringen, daß
sie ihren Geist ausdrückt. Abgesondert von dem menschlichen Bewußtsein selber wollte man das suchen. Man wollte etwas draußen in der äußeren Welt tun, durch das die Natur ihre Geheimnisse verrät und durch das sie endlich ausspricht, wie die Kräfte in der Natur liegen, aus denen dann der Mensch selber sich aus Natur und Geisteswelt heraus auferbaut. Also gerade das wollte man, wonach es Goethes Faust gelüstet: zusammenleben mit dem Weben und Wesen der Natur selber; und man glaubte, solches zu erreichen.
Was als Natur und Geisteswelt also vor den Menschen stand, das war durchgeistet. Und die weltnotwendige Entwickelung hat an die Stelle dessen ein äußeres Naturbild setzen müssen, eben das Naturbild eines Kopernikus, eines Kepler, eines Galilei, oder das, was daraus entstanden ist, ein Naturbild, aus dem gerade das entfernt ist, was diese mittelalterlichen Philosophen aus der Natur heraus suchen wollten. In diesem Weltbild des Kopernikus, Kepler und Galilei und dem, was daraus entstanden ist, waren eben jene Ideen das Maßgebende, Ausschlaggebende, das Berechtigte, die Goethes «Faust» nicht dicht genug vorkamen, nicht innerlich voll genug waren, um mit ihnen so ausgestattet der Welt gegenüberzutreten, daß man diese Welt voll miterleben kann in seiner eigenen Seele.
Und so lebt in Fausts Seele in dem Augenblick, in den uns der erste Monolog versetzt, der Drang, durch jene alte Magie die Weltengeheimnisse mitzuerleben, die Welten-gesetzmäßigkeit und die Weltenwesenheit mit den eigenen Seelenerlebnissen zu verbinden. Und das glaubte er zu er-reichen, indem er sich den Formeln und den Bildern hingibt, die aus dem Buche heraus, das er in die Hand nimmt, den Makrokosmos repräsentieren sollen.
Nun ist aber Faust - der Goethesche Faust, nicht der des
sechzehnten Jahrhunderts - ich betone es ausdrücklich -, sondern eben der Mensch, die Persönlichkeit seiner Zeit. Die Menschheit rückt eben in ihrer Organisation vor, wenn es auch einer groben Betrachtung nicht anschaulich ist. In dieser Zeit konnte man nicht mehr auf dieselbe Art hinter die Geheimnisse des Daseins kommen wie etwa Agrippa von Nettesheim. Man konnte sich nicht mehr dem Glauben hingeben, daß dasjenige, was man, sei es durch Imagination, sei es durch äußere Veranlassung, durch zauberhaftes Experimentieren erlangt, wirklich etwas zu tun habe mit dem, was die Welt im Innersten bewegt. Und so sieht sich endlich Faust davor gestellt zu erkennen: Ja, ich versuche es so, wie es diese Alten gemacht haben, mich zu verbinden mit den geistigen, mit den natürlichen Kräften des Daseins - aber was gibt mir das? Führt mich das wirklich hinein in das, was in der Natur und Geisteswelt lebt und webt? Nein, ein Schauspiel gibt es mir - welch ein Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur!
Und in diesem Sinne ist denn der Goethesche Faust wirklich der Repräsentant der Goethe-Zeit. Unmöglich ist es geworden, auf diesem Weg hinzukommen zu den Quellen des Daseins, zu erfassen die unendliche Natur, nicht sie bloß wissend zu durchdringen mit Ideen oder mit Naturgesetzen, sondern zu erleben. Es kann ihm nicht gelingen, weil die Zeit vorüber ist, wo man glauben konnte, daß auf diesem Wege eine wirkliche Erkenntnis der Natur und Geisteswelt zu erreichen ist. Ein Schauspiel! Und er wendet sich ab von demjenigen, was ihm die Betrachtung der Zeichen des Makrokosmos geben kann. Er wendet sich zum Mikrokosmos, zum Erdgeist.
Was ist dieser Erdgeist? Nun, wenn man das Ganze nimmt, was im Goetheschen «Faust» sich in Anknüpfung an die Erscheinung des Erdgeistes darstellt, so findet man,
daß dieser Erdgeist der Repräsentant alles dessen ist, was im Laufe des geschichtlichen Werdens im weitesten Umfange über die Erde hinströmt, was so wirkt, daß aus ihm herauskommt in unsere Seele, in unser Herz, in unser ganzes Innerstes hinein dasjenige, was in unseren tiefsten Trieben liegt, was gleichsam die Erde umkreist und uns Menschen mit unserem Inneren hineinstellt in seine Strömungen. Goethe selbst hat in einer Skizze, die er später für seinen «Faust» gemacht hat> gleichsam zusammenfassend die Idee dieses Erdgeistes bezeichnet als Welt- und Tatengenius. Damit werden wir wieder darauf hingewiesen, daß eigentlich das, was Goethe in seiner Dichtung als Erdgeist anspricht, etwas ist, was im Laufe des geschichtlichen Werdens lebt, was hereinwirkt in unsere Seele, insofern wir Kinder eines bestimmten Zeitalters sind, insofern in uns gewisse Triebe leben, in uns eine gewisse Form desjenigen lebt, was im Dasein in der einen oder in der anderen Art zu erreichen ist. Das aber ist abhängig davon, wie wir in einer gewissen Epoche gerade hineingestellt sind in das, was herausströmt aus dem durch alle Erdenzeiten waltenden Erdgeist. So darf denn dieser Erdgeist, wie es im «Faust» steht, sagen:
... im Tatensturm
Wall' ich auf und ab,
Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein glühend Leben,
So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.
Nun wird uns ein Wort, ich möchte sagen, gegenständlicher, das im «Faust» ausgesprochen ist und das einen
eigentlich oftmals beirrt, gegenüber leicht geschürzten Erklärungen, die davon gegeben werden. Ich möchte nicht in den Fehler verfallen, in den viele nur allzuleicht verfallen, in ein solches Gedicht wie die Faust-Dichtung alles Mögliche hineinzutragen. Und ich weiß sehr wohl: fast jede Er-klärung, die man ausspintisieren kann, paßt, wenn man sie nur geschickt dreht, fast auf alles. Ich möchte versuchen, alles, was ich zu sagen habe, aus der Faust-Dichtung selber herauszuheben. Ich meine jetzt in diesem Augenblicke das
Wort:
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen...
Die eine charakterisiert Faust so, als ob sie in all dem lebte, was die Triebe dieses Erdenlebens sind. Von der anderen Seele sagt er ausdrücklich, daß sie sich erheben will aus dem Dust des Erdenlebens zu den Gefilden hoher Ahnen. Nun, ich meine, eine leichtgeschürzte Erklärung ist es, wenn man einfach sagt: das ist die niedere und das die höhere Menschennatur. Gewiß, mit solchen Abstraktionen trifft man immer ein annähernd Richtiges. Man kann gar nicht fehl gehen, denn je abstrakter man ist, desto richtiger wird man sich in der Regel aussprechen. Aber bei einer solchen Dichtung wie der Faust-Dichtung kommt es darauf an, genau, konkret die Empfindungen zu treffen, welche in der Dichtung verkörpert sind. Und es scheint mir in der Tat, wenn Faust von seinen zwei Seelen spricht, die eine Seele diejenige zu sein, welche vor allen Dingen erlebt, was menschliches Inneres ist, dasjenige erlebt, in das herein-strömen die Kräfte, die Impulse des Erdgeistes, diejenige Seele, die vernimmt, wie aus den tiefen Untergründen des menschlichen Daseins der einzelnen menschlichen Individualität Impulse heraufsteigen und das Seelenleben erfüllen.
Die andere Seele scheint mir eben diejenige zu sein, die sich betätigt hat in dem Streben nach dem, was der Geist des Makrokosmos enthüllen soll, die sich erheben will aus dem bloßen Dust des Erdendaseins zu den Gefilden hoher Ahnen, das heißt zu all dem Geistigen, was in Natur- und Geisteswelt lebt und woraus der Mensch nicht nur als geschichtliches Wesen, sondern woraus er als totales, als Gesamtwesen, als Natur- und geschichtliches Wesen entstanden ist, zu dem Universum, wie es sich nach und nach im Verlauf der Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen herausgebildet hat, in das die Geister der Jahrhunderte, Jahrtausende und Jahrmillionen ihre Impulse gelegt haben. Zu dem Universum also, zu den geistigen Ahnen, aus denen sich dieser Mensch auf der Erde herausgebildet hat, will sich diese Seele erheben. Gewiß, sobald man solche Dinge in so scharf umrissenen Worten ausspricht, wie ich es eben getan habe, macht man den Sinn wiederum etwas einseitig. Auch das soll durchaus nicht geleugnet werden. Aber trotzdem glaube ich, die zwei Empfindungsrichtungen, die in Fausts Seele leben und die er als seine zwei Seelen bezeichnet, sind diese: Die eine davon geht nach dem Makrokosmos, nach dem Universum hinaus und umschließt Geistes-wesen, als Ganzes, als Großes, und Natur zugleich, den ganzen Kosmos, insofern der Mensch in diesem Kosmos als ein Mikrokosmos begründet ist. Und in der anderen Empfindungsrichtung glaube ich dasjenige erkennen zu müssen, was aus der Strömung des geschichtlichen Werdens in die menschliche Seele hereinfließt und den Menschen zum Glied, zum Kinde einer ganz bestimmten Zeit macht; so daß wir mit dem Erdgeiste als dem Gegensatz des Geistes der großen Welt zugleich zu dem geführt werden, was sich in der eigenen Seele als das Streben regt gegenüber den einzelnen Äußerungen, bei denen es im einzelnen Menschenleben
ja doch immer bleiben muß, den vollen Menschen zu umfassen. Diesem Geist, der den Menschen zum ganzen Menschen macht, und zwar jetzt als geschichtliches Wesen, glaubt sich Faust gleichfühlen zu dürfen, indem er dem Erdgeist gegenübersteht. Aber der Erdgeist weist ihn ab. Er verweist ihn auf den Geist, den er begreift. Und er macht es ihm zugleich verständlich, wie er nicht ihm gleiche, dem Erdgeiste selber. Was liegt da eigentlich zu Grunde?
Nun, was zu Grunde liegt, kann man vielleicht erkennen, wenn man den weiteren Fortgang der Goetheschen Faust-Dichtung ins Auge faßt. Wohin fühlt sich denn Faust sogleich gestellt, nachdem er vom Erdgeist zurückgewiesen ist? Wagner fühlt er sich gegenübergestellt! Und man darf schon so viel des edelsten Humors in Goethes Weltdichtung suchen, daß man gewissermaßen der Meinung sein kann:
Indem der Erdgeist Faust von sich weist und hinweist auf den Geist, den er begreift, weist er ihn in einer gewissen Beziehung wirklich zu dem Geiste Wagners, dem ja Faust sogleich im nächsten Augenblicke gegenübersteht. Also dieser Erdgeist will Faust eigentlich sagen: Werde dir erst bewußt, wie ähnlich das, was in deinem Innern lebt, was dir verliehen ist aus dem Geist der Erde heraus, doch der ganzen Formung der Wagnerschen Seele ist! - Und was geht denn aus dieser Wagnerschen Seele im Gesamtverlauf des Goetheschen Gedichtes hervor? Ja, wir sehen, wie Wagner weiter lebt das Gedicht hindurch bis zu einem gewissen Zeitpunkt, der uns genau bezeichnet wird im zweiten Teil von Goethes «Faust» in der klassischen Walpurgisnacht, wo dasjenige, was Wagner aus seiner Weltanschauung heraus hervorgebracht hat, der Homunculus, sich auflösen muß in dem Weben und Walten des ganzen Welten-geschehens, wie es Goethe in den verschiedenen Gestalten der klassischen Walpurgisnacht charakterisiert. Und so
werden wir denn geführt, ich möchte sagen, zu dem Ideale, zu dem Endziel des Wagnerschen Strebens. Als das dürfen wir doch wohl diese Hervorbringung des Homunculus bezeichnen.
Was ist denn dieser Homunculus? Gewiß, die Goethesche Faust-Dichtung - und das ist das unvergleichlich Große an ihr - stellt in einer großartigen, dramatischen Weise diese Dinge dar, die sonst oftmals nur Gegenstände einer abstrakten philosophischen Betrachtung sind. Aber das ist eben das Große, daß es einmal in der Welt hat gelingen können, dasjenige, woran sich andere Menschen nur in philosophischen Ideen machen können, wirklich zur dichterischen, zur echt künstlerischen Gestaltung zu bringen. Was ist denn dieser Homunculus, diese Homunculus-Idee, wenn wir Goethes Weltanschauung, mit seinem künstlerischen Empfinden verwoben, vor uns hinstellen? Wagner steckt eben in derjenigen Weltanschauung drinnen, die geworden ist bis zu der Zeit hin, in die der junge Goethe sich hineinversetzt fühlt, in der Weltanschauung, die gewissermaßen bloß mit der mechanistischen Naturanschauung und Geschichtsanschauung rechnet, die als ein erstes Produkt herausgekommen ist durch dasjenige, was - gewiß aus einer Notwendigkeit heraus - Kopernikus, Galilei, Kepler aus dem alten Weltbild machen mußten. An Stelle des Lebendigen, des Organischen, das in der vor-kopernikanischen Weltanschauung in das menschliche Weltbild, in das Weltbild der Philosophen verwoben war, tritt jetzt ein Weltbild, das immer mehr und mehr - und bis in unsere Zeit herein hat sich das ja in allerhöchstem Maße herausgebildet - nur Begriffe und Ideen in sich verwob, welche die Welt wie eine mechanische darstellen. Und so konnte denn auch Wagner zwar noch immer an der Gewohnheit festhalten, daß sich aus der Gesamtwelt, aus dem Gesamtkosmos
das Verständnis für die Gestaltung des Menschen ergeben müsse. So konnte er denn bis zu der Anschauung kommen, daß sich durch ein entsprechend kompliziertes inechanistisches Aneinanderfügen dessen, was als mechanische Gesetze die Welt durchwebt und durchlebt, auch der Mensch müsse erschaffen lassen. Und diese Erschaffung des Menschen, die in das Bild, in die Vorstellung des Menschen, in das, was man vom Menschen erfühlen und erweisen und erleben kann, nur das hereinbringt, was aus dem mechanistischen Weltenbild erfließt, das sehen wir in dem, was das Ideal des Wagner darstellt, in dem Homunculus.
Der Erdgeist weist Faust also klar dahin, wohin er eigentlich kommen wurde, wenn er auf der Stufe der Weltanschauung stehen bliebe, auf der er eben noch steht. Klar weist er ihn hin, und man möchte sagen: Sehen wir denn nicht, wenn wir tiefer hinunter schürfen wollen in das, was der Faust-Dichtung an Empfindungen, an Gefühlen zu Grunde liegt, daß, wenn Faust stehen bleibt bei dem, wo er steht vor seiner Weliwanderung, so würde er dahin kommen, wohin Wagner kommt: den Menschen wie einen Mechanismus zu erfassen, der doch erst lebensfähig ist, auch als Idee, wenn er in dem aufgehen kann, was die Welt selber durchlebt und durchwogt und wohin sich gerade Faustens Seele ergießen will zu einem höheren, erlebten Erkennen, gegenüber dem Erkennen, das Wagner erreichen kann, der ganz in der Weltanschauung der Aufklärung drinnensteht.
Nun muß man ein wenig in Goethes Seele selbst hineinschauen, wenn man dahinterkommen will, welches die Rolle des Homunculus im ganzen «Faust» eigentlich ist. Wir wissen, wenn wir Goethes Weltanschauung etwas durchforscht haben, wie Goethe auf eigenen Wegen Erkenntnis suchte, wie er hinter die Erscheinungen der Natur
kommen wollte. Ich habe im Laufe vieler Jahre in den Einleitungen meiner Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften und auch in meinem Buche «Goethes Weltanschauung» darzustellen versucht, wie Goethe in dieser Richtung gearbeitet hat. Goethe versuchte, auf seinen eigenen Wegen sich Aufklärung darüber zu verschaffen, was in den Vorgängen und Wesenheiten der äußeren Natur lebt. Und er bildete in einem gewissen Gegensatz zu dem, was ihn als Wissenschaft umgab, seine Metamorphosen-Lehre aus, seine Ideen von der Urpflanze, dem Urtier, von dem Urphänomen. Was wollte er denn eigentlich damit? Was er damit wollte, steht in innigem Zusammenhang mit dem, was er in seinen «Faust» hinein ergießen wollte, und mit dem, was so recht zeigt, wie Goethe doch aus einer ganz anderen Erkenntnisgesinnung heraus strebte als die Wissenschaft um ihn herum. Eine Briefstelle, in der Goethe zur Darstellung bringen will, was sich ihm auf seiner Welten-wanderung durch Italien gezeigt hat über die Urpflanze, über jenes geistige Bild, das er in jeder Pflanze suchte und das ihm zugleich alles Pflanzenleben und alles einzelne Pflanzengestalten erklären sollte, besagt: Wenn man diese Urpflanze hat, wenn man wirklich das erfaßt hat, was diese Urpflanze sein soll, dann hat man etwas, woraus man einzelne Pflanzenformen, die ganz gut leben könnten, sogar erfinden könnte. - Das weist tief in Goethes wissenschaftliches Streben hinein. Goethe wollte durch sein wissenschaftliches Streben nicht zu solchen Ideen kommen, wie die Weltanschauung der Aufklärung um ihn herum. Goethe wollte zu Ideen kommen, die gewissermaßen in der Seele nur repräsentieren, rege machen dieselben Kräfte, die wir draußen in den Pflanzen, in den Tieren, in der ganzen Natur selber haben. Goethe wollte damit zusammenschließen, was in der Pflanze wächst und geschieht, und er wollte
nicht eine Idee haben, die sich bloß als eine Abstraktion gegenüber dem, was da draußen in der Natur webt und lebt, ausnimmt; er wollte eine Idee haben, der gegenüber man sagen kann: sie lebt in der Vorstellung als etwas, was gleichgeartet ist dem, was draußen in der Pflanze lebt. Goethe wollte also nicht Ideen gewinnen, von denen man sagen kann, sie bilden dasjenige ab, was draußen in der Welt ist, aber in Wirklichkeit ist das, was draußen in der Welt ist, ganz anders. Goethe wollte Ideen gewinnen, durch die in der Seele auf seelengemäße Art auflebte, was draußen auf naturgemäße Art lebt. Das war sein ganzes Streben. Goethe wollte also eine Erkenntnis, die man als lebendige Erkenntnis, als Zusammenleben mit der Natur ansprechen kann. Das heißt, er wollte mit den Ideen, die er hatte, durch die Natur und ihre Gestaltungen so gehen können, daß sich diese Ideen so verhalten, daß sie das Eigenleben der Natur und ihrer Gestaltung darstellen. Wie sich die Gestalten der Natur verwandeln, so soll sich das, was in der Seele lebt, verwandeln. Es soll in der Seele gar nicht etwas leben, was die Seele nur abgezogen, abstrahiert hat von der Natur, sondern es soll die Seele zusammengeflossen sein mit der Natur, sich mit ihr zusammengelebt haben. Goethe strebte nach einer Erkenntnis, die er wirklich in wunderbarer Weise und künstlerisch darstellt in dem Schicksal des Homunculus in der klassischen Walpurgisnacht. Homunculus ist in bezug auf den Menschen eine abgezogene Idee, die daher auch beim bloßen Mechanismus, bei der bloßen Abstraktion stehen bleiben muß. Wie nun Goethes Ideen, Goethes metamorphosische Ideen, nicht solche Ideen sein sollen, sondern wie sie darstellen, was an Kräften, an Lebewesenheit in der Natur selber ist, so muß dieser Homunculus, belehrt durch eine Naturanschauung, die der Natur noch näher stand als diejenige, die
Goethe umgab, belehrt durch die Natur-Ideen der alten griechischen Philosophen, des Thales, des Anaxagoras, belehrt aber auch durch das Verwandlungswesen Proteus, sich auflösen. Wie sich die Goetheschen metamorphosischen Ideen mit der Natur selber vereinen sollten, so soll mit dem Weltengeschehen der Homunculus sich vereinen. Er kann so, wie er aus Wagners Anschauungen hervorgegangen ist, nicht leben. Da ist er abgezogene Idee, bloßer Gedanke. Er muß sich mit dem Dasein verbinden. Als der Homunculus erfaßt wird von dem Lebendigen, da ist die Rolle des Wagner ausgespielt.
Faust muß eine Weltwanderung beginnen, die ihn über das hinausführt, was er auch hätte erreichen können, was aber sich in dieser Weise ausspielen muß, wie sich die Rolle des Wagner mit der Erzeugung des Homunculus ausgespielt hat. Und zu diesem Ziele zeigt uns Goethe, wie Faust nun nicht diejenigen Kräfte entwickelt als seine Erkenntnis-kräfte, die ihn zum Makrokosmos führen in dem Sinne, wie der Makrokosmos einzig und allein nach der Kopernikanischen, Keplerschen, Galileischen Weise erfaßt werden kann; sondern Goethe zeigt uns, wie Faust nun gerade dasjenige will, was der Erdgeist aus dem Reich der innersten, man könnte auch sagen, der untersten Kräfte des Seelendaseins heraus geben kann. Mit den Kräften, die daher kommen können, soll Faust seine Weltenwanderung beginnen. Und nun sehen wir Faust diese Weltenwanderung durchlaufen in denjenigen Ereignissen, die zunächst im ersten Teil von Goethes «Faust» dargestellt sind. Da sehen wir, wie Mephistopheles Faust gegenübertritt. Ich will mich hier nicht auf alle möglichen Erklärungen ein-lassen, was eigentlich dieser Mephistopheles ist; aber ich will auf dasjenige eingehen, was uns die Notwendigkeit zeigt, daß Goethe über das im ersten Teil des «Faust»
Dargestellten hinausgehen muß. Nach dem, was wir eben schon betrachtet haben, hat Goethe Faust gewissermaßen zunächst als ohnmächtig gegenüber dem Geiste des Makrokosmos hingestellt. Aber er stellt ihn sogleich nicht in derselben Weise als ohnmächtig gegenüber dem Erdgeiste hin. Aber Faust - das muß man durchaus betonen - bleibt zunächst noch bei dem stehen, was eine abgelebte Zeit, aus der heraus die Menschheit wiederum zu entwickelterer Weltanschauung gekommen war, noch als etwas Richtiges oder wenigstens als etwas Mögliches angesehen hat. Ich will mich nicht darauf einlassen, was Mephistopheles seelisch in seinem Verhältnis zu Faust wird, auch nicht darauf, wie Mephistopheles mehr oder weniger eine realistische, mehr oder weniger eine mythologische Figur ist. Ich will nur darauf aufmerksam machen, was mit Faust unter dem Einflusse des Mephistopheles geschieht.
Auf der einen Seite waren es in der alten Zeit Magie, Imaginationen oder äußere Verrichtungen, durch die man hinter die Geheimnisse der Natur kommen wollte. Faust kann da nicht mit, das sehen wir gleich. Auf der anderen Seite war aber noch etwas anderes mit dem - ich möchte sagen - Weltengeheimnis-Suchen der alten Zeiten verknüpft, etwas, was sich bis in unsere Zeiten herein erhalten hat: der Glaube, daß man irgend etwas über die Geheimnisse, die im Menschen walten, dadurch ergründen könne, daß man des Menschen gesunde Seelenkraft gleichsam herablähmt - über diese gesunde Seelenkraft werden wir insbesondere morgen in ihrem Zusammenhang mit der Geistesforschung sprechen - und daß man etwas aus dem Menschen herausstellt, was geringer ist, als diese gesunde Seelenkraft, die man vielleicht uneigentlich, aber mit einem uns in diesem Augenblick doch verständlichen Wort die normale Seelenkraft nennen kann. Man braucht nur an
Worte zu erinnern wie Hypnotismus, Somnambulismus, an alle die Formen des abergläubischen Helisehens, und man hat das ganze weite Gebiet dessen, wohinein wir, vielleicht auf eine nicht gleich durchsichtige Weise, durch die Geschehnisse des ersten Teiles von Goethes «Faust» geführt werden. Und Mephisto ist einfach, ich möchte sagen, ein solcher Abgesandter des Erdgeistes, der Faust für eine Weile dahin bringt, wirklich ähnlich zu werden dem mittelalterlichen Faust, sei es dem wirklichen historischen Faust, der 1509 in Heidelberg promoviert wurde, der wirklich eine historische Persönlichkeit ist, sei es dem Faust des Volksbuches oder einer der anderen zahlreichen Figuren, auch dem Faust des Puppenspiels, den Goethe kennengelernt hat. Dieser Faust des Puppenspiels, dieser Faust des sechzehnten Jahrhunderts, wie er sich dann weiter durch die Jahrhunderte hinaufgelebt hat, ist gar nicht zu verstehen, ohne daß man Rücksicht nimmt auf ungesunde, auf krankhafte Kräfte der menschlichen Seele, wie wir sie heute nennen müssen, auf solche Kräfte der menschlichen Seele, die durch ein Herabdämpfen, Herablähmen des menschlichen Bewußtseins, wie es im normalen Leben vorhanden ist, erreicht werden. Sei es, daß man Fausts Lebensgeschichte - desjenigen Faust, der 1509 in Heidelberg promoviert wurde - liest, sei es, daß man sich in das «Faust»-Buch vertieft, das 1589 erschienen ist -, man findet da auf der einen Seite eine wirkliche, auf der anderen Seite eine dichterische Persönlichkeit, die im höchsten Grade das ist, was man heute mit einem mehr oder weniger treffenden Wort «medial» nennt, medial mit all den krankhaften, abnormen Erscheinungen, die mit der Medialität verbunden sind.
Nun kommt nicht unmittelbar zum Ausdruck, daß Goethe Faust etwa medial erscheinen lassen wollte von der
Erscheinung des Erdgeistes an bis zum Ende des ersten Teiles seines «Faust», aber was sich abspielt, führt uns wirklich in dieses Gebiet hinein. Und man möchte Mephistopheles als denjenigen Geist bezeichnen, der in Fausts Natur ein solches Weltbild hervorruft, von dem Leute glauben können, daß es tiefere Geheimnisse des Daseins löst, solche Leute nämlich, die zum menschlichen vollen Bewußtsein eben kein rechtes Vertrauen haben und sich daher dem Glauben hingeben, daß man dieses Bewußtsein erst herablähmen, trüben muß, um hinter die Geheimnisse des Daseins zu kommen. In einem Buche, das gewiß einseitig, aber durchaus nicht unverdienstlich ist, hat Kiese-wetter den Mephistopheles dargestellt wie eine Art zweites Ich des Faust, aber nicht etwa als ein höheres Ich, sondern als dasjenige Ich, welches man erkennt, wenn man absieht von dem, das sich im normalen höheren Geistesleben in einem Menschen auslebt, und hinuntersteigt zu den Gebieten des Seelenlebens, wo sich die Triebnatur, wo sich, ich möchte sagen, das Untersinnliche - keineswegs das Übersinnliche! - auslebt. In einer Weise, die allerdings nicht gleich an der Oberfläche liegt, die aber doch dem ganz klar wird, der die Geschehnisse im ersten Teil des «Faust» verständnisvoll verfolgt, kommt nun zur Anschauung, daß Faust auf seiner Weltenwanderung jetzt wirklich all das erkennen lernt, von dem geglaubt werden kann, daß man es erreiche auf dem Wege eines solchen abnormen, herab-gedämpften, herabgestimmten, somnambulen oder im gewöhnlichen, trivialen Sinne hellseherischen Bewußtseins. Aber etwas anderes wird uns noch anschaulich gemacht, etwas, was außerordentlich wesentlich ist sowohl für das Verständnis der Menschenseele als auch für das Verständnis der «Faust»-Dichtung. Während Faust sich nun in all das einlebt, was man mit tieferen, aber nur untersinnlichen
Triebkräften gewiß erkennen kann, was sich dann ausdrückt in der Hexenküche, in der Walpurgisnacht und so weiter, lebt er sich zugleich hinein, wir dürfen sagen, in tragisch-moralische Verirrungen, in ein Walten ungestümer Triebe. Gewiß, was uns zum Beispiel als Gretchen-Dichtung entgegentritt, gehört zu den vollendeten Blüten der Weltliteratur. Aber es gehört vielleicht gerade deshalb zu den vollendeten Blüten der Weltliteratur, weil es dem Dichter gelungen ist, das Tragische darzustellen, das aus den menschlichen Trieben fließt, die sich nicht abklären durch das, was man die höhere Menschennatur im wahren Sinne des Wortes nennen kann. Und Mephisto wirft für Faust zusammen ein gewisses Welterkennen, eine Befriedigung der Erkenntnis, mit diesem Heraufkommen der blinden Triebnatur aus den Untergründen der Seele, wo der Mensch sich eben seinem Wesen überläßt, ohne daß er seinen Lebenswandel begleitet mit einer moralischen Welten-beurteilung. Das ist in großer, in grandios tragischer Weise in Goethes Dichtung dargestellt. Aber es zeigt uns doch zugleich, wie alles, was sich auf dem Gebiete dessen auslebt, was man so oft als Heliseherei bezeichnet - wir werden morgen über diese Dinge wiederum genauer sprechen -, was man somnambule Heilseherei nennen könnte, die dadurch entsteht, daß das Bewußtsein ins Krankhafte herabgedämpft wird, daß zu den Erkenntniskräften die Leiblichkeit des Menschen verändert und in dieser, wenn auch feinen Veränderung benützt wird; wie all das, was auf diesem Gebiet erreicht wird, genau auf derselben Höhe der Menschennatur steht wie die blinde Trieb- und Leiden-schaftsnatur. Dieses für viele Menschen grausame Ergebnis geht aus der Art hervor, wie Goethe darstellt, daß die eben genannte Hellseherei, der Somnambulismus entsteht, wenn man in Erkenntniskräfte umwandelt, was in den Trieben
des Menschen lebt, in denjenigen Trieben, die sich noch nicht zur normalen menschlichen Erkenntnisfähigkeit her-aufgeklärt haben, in den blinden, unbewußten Trieben, die zwar Impulsen folgen, aber nicht vom Gebiete moralischer Beurteilung durchwobenen Impulsen. Und Goethe will darstellen, daß eine solche Anschauung der Welt, wie sie sich in der Hexenküche, in der Walpurgisnacht ausdrückt, nur das Gegenbild ist von blindem Walten der Triebe, wo der Mensch waltet mit seinem krankhaften Seelenleben. Diese innige Zusammengehörigkeit des niederen menschlichen Trieblebens mit dem, was oftmals als Hellseherei angesehen wird und wovon man glaubt, daß es zu höheren Erkenntnissen über die Menschennatur führen könne, weil man kein Vertrauen zu der normalen Menschennatur hat, wird in dramatisch großartiger Weise im ersten Teil des «Faust» charakterisiert. Und es wird mit hinlänglicher Klarheit ausgesprochen, daß derjenige, der zu solcher Hellseherei kommt, sich keineswegs über den normalen Menschen erhebt, sondern hinuntersinkt unter dasjenige, was gewöhnliche wissenschaftliche Erkenntniskräfte sind, in dieselben Regionen des menschlichen Daseins hinunter-sinkt, wo die blinden Triebe walten. Will man die Physiologie der blinden Triebe im Feineren studieren, so kann man sich in den Kundgebungen der Somnambulen, der Hypnotisierten, der Medien ergehen. Will man aber - und davon wollen wir eben morgen genauer sprechen - in die wirklichen höheren Geheimnisse des Daseins eindringen, so muß man gerade wissen, daß man sich mit einem solchen Hellsehen nicht über den normalen Menschen erhebt, sondern unter den normalen Menschen heruntersinkt, - einem Hellsehen, das Goethe, indem er nicht Moral predigen, sondern künstlerisch darstellen will, dramatisch verwebt in die Verirrungen der menschlichen Untersinnlichkeit des
menschlichen unterbewußten Wesens. Das mußte Faust während jener Weltenwanderung durchmachen, die uns im ersten Teil dargestellt ist.
Und nun sehen wir, wie Goethe in merkwürdiger Art, gleich im Beginn des zweiten Teiles, Faust dem Natur- und Geistesleben gegenübergestellt sein läßt. Er deutet es sehr klar, ich möchte sagen, großartig klar an, selbstverständlich nicht mit philosophisch abstrakten Worten, sondern durch Gestaltungskraft. Die Frage soll uns heute gar nicht berühren, die ja auch von einzelnen «Faust»-Erklärern gestellt worden ist, ob denn nun wirklich eine solche Persönlichkeit wie Faust von den schweren Verbrechen gesunden könne, die er auf sich geladen hat innerhalb der im ersten Teil dargestellten Geschehnisse, wenn er sich, wie man gesagt hat, in die weite Natur hinausbegibt und das erlebt, was gleich im Beginne des zweiten Teiles dargestellt wird. Inwiefern in Fausts Seele die Schuld, die er auf sich geladen hat, weiter waltet, darüber wollen wir uns heute nicht ergehen. Die kann ja weiter walten. Was Goethe darstellen will, ist aber, wie Faust sich hinauserhebt aus der Verstrickung in die untersinnliche Menschlichkeit. Und da sehen wir den Faust im Beginne des zweiten Teiles gleich, ich möchte sagen, in der gesundesten Weise in die Natur hineingestellt und sehen in der gesundesten Weise die geistige Welt auf ihn wirken. Denn was Goethe darstellt, indem er den Chor der Geister auf Faust wirken läßt, ist wirklich nur eben äußere dramatische Darstellung eines Vorganges, den man mit einem mehr oder weniger zutreffenden Worte als einen innerlichen Vorgang bezeichnen kann, der sich geradeso abspielt, wie sich der Vorgang abspielt, wenn der Genius den Dichter erfaßt, wo nicht durch irgend etwas im äußeren Sinne Zauberhaftes auf den Menschen gewirkt wird, wo auch nicht das menschliche
Bewußtsein herabgedämpft wird, wie zu irgend einem somnambulen Schauen, sondern wo in das menschliche Bewußtsein etwas hereinfließt, was zwar geistiger Einfluß ist, was aber nicht in ein herabgestimmtes, in ein herabgedämmertes Bewußtsein hereinfließt, sondern in dasjenige Bewußtsein, das sich in gesundester Weise in Natur und geschichtliches Leben der Menschheit hineinstellt. Und ist Faust nun auf seiner Weltenwanderung jetzt weiter, als er etwa da war, als er das Zeichen des Makrokosmos anschaute und die Welt als ein Schauspiel ansprach? Ja, Faust ist weiter, ganz beträchtlich weiter! Und Goethe will darstellen, daß Fausts gesunde Natur eben die Anfechtungen überstanden hat, die Mephistopheles bisher über ihn gebracht hat und die darin bestanden, daß er ihn hinunterdrängen wollte in das Untersinnliche, in dasjenige, was im Menschen lebt, wenn Triebkräfte und nicht erhöhte Erkenntnis-kräfte zu irgend einer Weltanschauung gebracht werden. Faust hat in dem Augenblick, der uns im Beginne des ersten Teiles dargestellt wird, das Buch des Nostradamus aufgeschlagen. Das Zeichen des Makrokosmos tritt vor seine Seele. Er versucht, sich in das hineinzuversetzen, was ihm durch die Worte und Zeichen dieses Makrokosmos repräsentiert werden konnte. «Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!» Faust strebt in diesem Augenblick, man möchte sagen, in eine Art krankhaften Seelenlebens hinein, in dem er ja dann auch verbleibt, wenn das Wort «krankhaft» hier auch nicht im philiströsen Sinne aufgefaßt werden darf.
Nachdem Faust ins gesunde Natur- und Geist-Erleben hineingestellt war und der Geist nun auf sein normales Bewußtsein gewirkt hat, spricht er ein anderes Wort aus, ein Parallel-Wort, möchte ich sagen, zu dem Wort «Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!» Faust stellt sich
den Erscheinungen gegenüber die durch den Sonnenschein hervorgerufen werden; aber er wendet sich ab und wendet sich dem Wasserfall zu, der in Farben widerspiegelt dasjenige, was die Sonne vermag. «So bleibe denn die Sonne mir im Rücken», sagt Faust. Er will die Spiegelung dessen, was die Sonne hervorruft, anschauen. «Am farbigen Abglanz haben wir das Leben» - eine wunderbare Steigerung gegenüber dem ersten Wort: «Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!» Jetzt kann Faust erfassen, wie in dem, was ihm als Natur entgegentritt, wirklich Geistiges lebt, weil er sich in der richtigen Weise zu dem zu stellen weiß, was in der Natur in dem Sinne des Wortes lebt, mit dem der zweite Teil des «Faust» abschließt: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis» - im Gleichnis erfassend, was geistig in der Natur lebt. Und so sehen wir, wie im Beginne des zweiten Teiles des «Faust» durch eine Wirkung der geistigen Welt auf das normale Bewußtsein Faust zu einer gesunden Stellung gegenüber der Welt gebracht wird; wie er jetzt wirklich nicht mehr, ich möchte sagen, in dem Glauben eingesponnen ist, daß man durch Zurückgehen auf die alte Magie etwas erreichen kann, und wie er jetzt auch gelernt hat, daß man mit all dem, was falsches Hell-sehen, was Somnambulismus ist, nichts erreichen kann. Jetzt stellt er sich als ein gesunder Mensch der Welt gegenüber und kann dennoch im farbigen Abglanz das Leben, das heißt, das erlangen, was hinter der Natur- und Geschichtswelt liegt.
Und wirklich, wir sehen nun, wie Faust sich immer mehr und mehr zu dem entwickelt, wozu sich Goethe selber entwickeln wollte. Natürlich, wenn wir auf Goethes Weltanschauungs-Entwickelung hinschauen, dann erscheint uns alles, ich möchte sagen, mehr in abstrakter, philosophischer Form. Aber das ist eben, wie ich schon sagte, das Großartige,
das Goethe gerade gelungen ist, äußerlich dramatisch auszugestalten, wozu sich andere Menschen nur in Philosophien erheben können. Und so sehen wir, daß sich Faust nun auch in die Welt des geschichtlichen Werdens hineinzustellen vermag, daß er aus diesem geschichtlichen Werden das Ewig-Bedeutungsvolle, das Geistig-Wirkliche herauszufinden in der Lage ist. Dazu ist aber notwendig, daß Faust nun wirklich in seiner Seele eine Steigerung seiner Erkenntnis-Kräfte erlebt. Durch dasjenige, was er mit Mephistopheles erlebt hat, hat er keine Steigerung, sondern ein Herabdämpfen seiner Erkenntniskraft erlebt, ist er nicht sehend, ist er blind gemacht worden. Jetzt verlangt er aus dem geschichtlichen Werden heraus eine Gestalt wie Helena wiederum lebendig vor sich hingestellt zu haben. Wie kann er das erlangen? Eben dadurch, daß er etwas in sich ausbildet, was so schön und tief in der Szene dargestellt ist, die den «Gang zu den Müttern» darstellt. Goethe hat selber Eckermann gestanden, daß er die Veranlassung, diese Mütter-Szene in seinen zweiten Teil des «Faust» hineinzugeheimnissen, durch das Lesen des Plutarch bekommen hat, wo dargestellt ist, wie eine Persönlichkeit des Altertums in einer schwierigen Lage wie wahnsinnig herumgelaufen sei und von den «Müttern» gesprochen habe, von jenen Müttern, als welche Göttinnen bezeichnet worden waren, die tief im Verborgenen alter Mysterien verehrt wurden. Warum soll denn Faust zu diesen Müttern herabsteigen? Goethe spricht sich zu Eckermann in einer merkwürdig geheimnisvollen Weise aus. Er sagt, daß er sich in bezug auf diese Szene am allerwenigsten verraten hätte. Wir dürfen durchaus annehmen, daß Goethe das nicht in vollen, klaren, abstrakten Begriffen herausgebracht hat, was aber wirklich in voller, klarer Erkenntnis als sein Gang zu den Müttern in seiner Seele lebte. Ich habe öfter
über diesen Gang zu den Müttern gesprochen, möchte heute nur andeuten: Wenn wir uns in die alte Weltanschauung, in die Goethe da den Faust versetzt, in die klassische Zeit des Griechentums, in die er uns schon vorher versetzt, wo er die Helena antrifft, - wenn wir uns in diese antike Welt vertiefen, in die ja Faust nun auch untertauchen soll, so finden wir, daß diese antike Welt aus sich etwas herausstellte mit den Kräften, die den antiken Menschen eben noch eigen waren: Erkenntniskräfte, die, man möchte sagen, tiefer hineingelangen in das Geschehen der Welt, weil sie noch tiefer mit der Natur des Daseins verbunden waren als die Erkenntniskräfte der Seelen derjenigen Zeit, in der Goethe lebte, die sich von dem unmittelbaren Leben mit dem Naturdasein schon mehr abgetrennt hatten und den Weg wieder zurückfinden mußten in das Naturdasein. Aber es ist auch schon angedeutet worden, daß der Mensch, wenn er hineintaucht in sein Seelenleben, etwas finden kann, was jetzt nicht gleich ist mit dem, was vorhin angedeutet worden ist als die untersinnlichen Triebkräfte, als diejenigen Impulse, die den Menschen blind lassen, aber eben doch als Impulse wirken; sondern daß der Mensch hinuntertauchen kann mit vollem Bewußtsein in die Tiefe seines Seelenlebens, und zwar mit nichts anderem als dem, was sein normales Bewußtsein ist, das nur tiefer in seine Seele hineintaucht. Dann erlangt er durch dieses Eintauchen in seine tieferen Seelenkräfte etwas, was ganz anders ist als die eben geschilderten untersinnlichen Seelenkräfte des Somnambulismus oder des Hypnotismus oder ähnliche Erscheinungen des menschlichen Lebens. Er erlangt die Möglichkeit, so tief in seine Seele hinunterzusteigen, daß er wirklich Kräfte heraufbringt, die ebenso bewußt sind, und die er ebenso beherrscht wie die Kräfte des normalen Bewußtseins, denen gegenüber er nicht Sklave ist wie im
Somnambulismus oder in der gewöhnlichen Medialität. Und daß Faust zu den Müttern hinuntersteigt, nachdem er so weit, wie es angegeben worden ist, gesundet ist, das ist eben die dramatische Darstellung dieses Hinuntersteigens zu jenen Seelenkräften, die, wenn wir sie in unserer Seele erfassen, einen inneren höheren Menschen der äußeren Welt entgegenbringen, so daß wir auch in der äußeren Welt mehr ersehen können als das, was die bloßen Sinne oder der an die Sinne gebundene Verstand sehen.
Und jetzt sehen wir, wie Faust seine Weltenwanderung im Aufstiege weiterführen kann dadurch, daß er in die Tiefen des Seelenlebens bewußt hinuntertaucht; und wie nun in Gegensatz dazu Wagner mit seinem Homunculus gestellt wird, der nur zu der abstrakten Menschheits-Idee kommt, die aufgehen muß im Leben, die sich nicht halten kann, die vor einer Erkenntnis, welche sich in die Welt einleben will, wenn sie bloß mechanistisch bleibt, zerstiebt. Das wird demjenigen, was Faust im Aufstiege seiner Weltenwanderung erreicht, gegenübergestellt. Aber noch etwas anderes! Klar werden wir auch darauf hingewiesen, wie Mephistopheles wirklich diejenigen Kräfte an Faust herangebracht hat, die untersinnlich sind, indem Mephistopheles zwar noch nicht endet, aber, man möchte sagen, moralisch endet, wenn das Wort hier angewendet werden darf, in der klassischen Walpurgisnacht, als er sich mit den Phorkyaden vereinigt, mit denjenigen Wesenheiten, die aus dem Dunkel und aus dem Abgrund heraus geboren werden, aus jenem Abgrund, der eben die niedere Menschennatur darstellt. Das wird uns, wenn man wirklich darauf eingeht, was Goethe nach seinem eigenen Wort in den «Faust» hineingeheimnißt hat, recht klar, recht deutlich dargestellt. Die Kräfte, die jetzt der Mephistopheles in der klassischen Walpurgisnacht verwandt mit sich empfindet, die sind
nichts Übermenschliches, die sind etwas Untermenschliches. Man kann nicht mit denjenigen Erkenntniskräften, die über die gewöhnlichen Erkenntniskräfte hinausgehen, zu einer anderen Anschauung der Welt kommen, als so, daß das erhöht, bereichert wird, was man in den gewöhnlichen Erkenntniskräften hat. Aber mit den untersinnlichen Erkenntniskräften kommt man zu etwas, was im Grunde genommen ärmer ist als das normale menschliche Leben. Und es kann nicht oft genug betont werden, daß es auch im «Faust» ausgesprochen worden ist, daß das Leben, das durch ein Herabdämmern des menschlichen Bewußtseins, sei es durch Somnambulismus, sei es durch Mediumismus, erreicht wird, ärmer ist als dasjenige, was der Mensch mit seinem normalen Bewußtsein der Welt gegenüber erreicht. Der Mensch hat, wenn er sich mit seinem normalen Bewußtsein die Welt anschaut, seine zwei Augen, durch die er in die Welt hinausschaut. Das ist ein gewisser Reichtum der Sinnenwelt gegenüber. Da, wo Mephistopheles bei den Geistern der Dunkelheit ist, haben diese zusammen ein Auge und müssen es einander reichen. Sie sind ärmer. Mephistopheles gehört einer Welt an - wenigstens fühlt er sich verwandt mit dieser Welt -, die ärmer ist als die normale Menschenwelt. Diese Welt kann Faust nun eigentlich nichts mehr bieten, nachdem er selber den Gang hinunter zu den Müttern, das heißt, zu den bewußten tieferen Kräften der Menschenseele, angetreten hat, zu denen ihm eben Mephistopheles noch den Schlüssel reichen kann, in die ihn aber Mephistopheles selber gar nicht einführen kann.
Und nun sehen wir, wie Goethe Faust auf einer höheren Stufe seiner Weltenwanderung in der richtigen Weise zu stellen vermag zu dem realen, zu dem wirklich fortleben-den Geiste der Vergangenheit. Ja, Goethe läßt neben die Überschrift des dritten Aktes des zweiten Teiles schreiben:
Klassisch-romantische Phantasmagorie. Nicht als Wirklichkeit kommt das herauf, sondern «im farbigen Abglanz» hat er das Leben. Er erfaßt es mit den tieferen, aber bewußten Kräften der Menschenseele und streift es dann wiederum ab, wie uns im vierten Akt des zweiten Teiles dargestellt ist. Und so könnten wir, wenn es die Zeit gestattete, noch vieles beibringen, was uns deutlich machen würde, wie Goethe seinen Faust eine Weltwanderung durchmachen läßt, heraus aus den Verirrungen, die sich ergeben, wenn man kein Vertrauen zu dem normalen menschlichen Bewußtsein hat. Die alte Magie, der Faust zuerst zu verfallen droht, der er sich ergeben hat, die hat kein Vertrauen zu dem, was das Bewußtsein zu geben vermag, und sondert die Geschehnisse, die da draußen zauberhaft in allerlei Zeremonien verlaufen sollen, vom Bewußtsein ab. Was sich da außerhalb des vollen Bewußtseins in einem Weben und Wirken der Geister abspielt, soll die geistige Welt offenbaren; aber nicht das, was sich im normalen Bewußtsein, sondern was sich im Unterbewußten, in den dunklen Trieben abspielt, soll erklären, was als Geheimnis die Welt durchwallt. Daraus mußte Goethe seinen Faust herausführen zu dem, was ohne irgendwelche Beeinträchtigung des normalen Bewußtseins, durch ein Weiterentwickeln des normalen Bewußtseins als geistige Welt erkannt werden kann. Das ist, wie mir scheint, sehr deutlich, wenn auch nicht als eine Idee - das hat Goethe selber ausgesprochen -, aber als ein Impuls, der ganz künstlerisch gestaltet ist, in Goethes «Faust» unter vielem anderen wirklich auch verkörpert. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es, wenn ich das triviale Wort gebrauchen darf, wirklich ganz in der Rolle des Goetheschen Faust, wenn er nun, nachdem er also die Vertiefung des normalen Bewußtseins gefunden hat, wirklich dahin gekommen
ist, alles falsche Suchen auf einem falschen, magischen, somnambulen Wege von sich zu weisen, und der Welt gegenüber stehen will als ein Mensch, der das Höhere eben auch nur durch eine Erhöhung der Seelen-kräfte erkennen will.
So lesen wir im zweiten Teil des «Faust»:
Unselige Gespenster! So behandelt ihr
Das menschliche Geschlecht zu tausend Malen;
Gleichgültige Tage selbst verwandelt ihr
In garstigen Wirrwarr netzumstrickter Qualen.
Dämonen, weiß ich, wird man schwerlich los,
Das geistig-strenge Band ist nicht zu trennen...
Und weiter:
Noch hab' ich mich ins Freie nicht gekämpft.
Könnt' ich Magie von meinem Pfad entfernen,
Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen,
Stünd' ich, Natur! vor dir ein Mann allein,
Da wär's der Mühe wert ein Mensch zu sein.
Ein Mensch will Faust sein, der weder durch äußeren Zauber, noch durch innere Trübung des Bewußtseins der Welt des Geistes gegenübersteht und diese Welt des Geistigen von diesem Bewußtsein aus auch einzuführen vermag in das soziale Menschenleben, in das Leben der Tat. Und das wird gegen den Schluß des zweiten Teiles des «Faust» in einer so wunderbaren, in einer so grandiosen Weise dargestellt. So hat denn Goethe auf seine Art darzustellen versucht, wie der Mensch durch eine Entwickelung der in ihm liegenden Kräfte zu den Geheimnissen des Daseins wirklich vordringen kann, indem er die sich dem Menschen in die Wege stellenden Verirrungen auch klar und dramatisch dargestellt hat.
Man möchte sagen, der Mensch, der aus den Menschenkräften selber heraus zu einem Zusammenleben mit der geistigen Welt kommen will, stand wirklich in einer faustischen Gestalt - nicht dadurch, daß er Faust heißt, sondern wirklich in einer faustischen Gestalt - schon dem Augustin gegenüber, der ja dem Manichäer-Bischof Faustus die Möglichkeit zulegt, durch eine innere Erhöhung der menschlichen Erkenntniskräfte den Weltengeheimnissen nahe zu kommen. Goethe fand, indem er den mittelalterlichen Faust auf sich wirken ließ, eine Welt vor, die im Grunde genommen schon ihr Urteil über diese Art von Faust ausgesprochen hat. Das Urteil war gefällt, daß ein solcher Mensch als ein böses Glied vom Strome der Menschheit abfallen müsse, der in einer solchen Weise aus seinen eigenen Kräften heraus zu den Geheimnissen des Daseins kommen wolle. Goethe konnte sich mit dieser Anschauung nur nicht einverstanden erklären. Goethe war sich klar darüber, daß der Mensch nur dann wirklich ein ganzer Mensch sein kann, wenn er imstande ist, das Faust-Streben zu verwirklichen, wenn auch nicht in jener alten Weise, in der es der Faust des Volksbuches oder der des sechzehnten Jahrhunderts verwirklichen wollte. Und Goethe konnte zu dieser Anschauung deshalb kommen, weil er tief verwoben war mit demjenigen, was man, wie ich hier ja schon öfter gesagt habe, den Idealismus, den Weltanschauungs-Idealismus in der deutschen Geistesentwickelung nennen kann.
Ich versuchte in diesen Vorträgen Gestalten wie Fichte, Schelling, Hegel, in ihrem - allerdings nur philosophischen - Streben hinzustellen, die geistige Welt zu erfassen. Ich habe auch hinlänglich darauf aufmerksam gemacht, daß man durchaus nicht ein dogmatischer Anhänger irgendeines Fichteanismus oder Schellingianismus oder Hegelianismus zu sein braucht, um die ganze Größe dieser Gestalten,
die kämpfend im deutschen Idealismus drinnen stehen, wirklich auf sich wirken zu lassen. Als Erkenntnissucher, als Menschen mit einem bestimmt gearteten Seelen-leben nehme man sie. Man sehe ganz ab von dem, was im Einzelnen der Inhalt ihrer Weltanschauung ist. Aber sie stehen doch in einem Weltanschauungsstreben darinnen, das innig verwandt ist mit dem Goetheschen Weltanschauungsstreben und das sich im Grunde genommen für den, der die tieferen Zusammenhänge erschauen kann, als das deutsche Weltanschauungsstreben vom Ende des achtzehnten Anfang des neunzehnten Jahrhunderts zeigt, das berufen ist, weiterzuwirken innerhalb der deutschen Entwickelung.
Wir wissen, daß Kant ein Goethe nicht verwandtes Weltanschauungsstreben entwickelt hat. Ich habe auch darauf öfter aufmerksam gemacht. Hier kann es nicht begründet werden, ich will es nur anführen. Kant kam zu der Anschauung, daß der Mensch im Grunde genommen nicht hineinschauen kann in die tieferen Quellen des Natur- und Geistesdaseins. Und er sprach es aus, daß der Mensch, wenn er mit seinen Ideen sich wirklich in das Weben des Welten-daseins hineinleben wollte, ein ganz anderes Erkenntnisvermögen haben müßte, als ihm wirklich zugeteilt ist. Dann müßten in seine Erkenntnis nicht bloß Begriffe und Ideen, welche die Dinge abbilden, hereinfließen, sondern der lebendige Strom des Daseins selber. Man kann es ermessen, daß Goethe das empfunden hat, zum Beispiel an seiner Metamorphosen-Idee mit der Urpflanze, dem Urtier, was Kant aus dem menschlichen Erkenntnisvermögen aus-schloß. Und Kant sagte: Derjenige, der sich dem Glauben anschließen wollte - ich führe ungenau an, aber es entspricht ungefähr dem Wortlaut -, daß er wirklich hinein-schaut in die Quellen des Daseins, müßte sich zu einem
Abenteuer der Vernunft versteigen, zu einer Art anschauender Urteilskraft; er müßte nicht nur begreifen, er müßte innerlich erlebend anschauen und anschauend erleben den Strom des Weltendaseins selber.
In dem schönen kleinen Aufsatz über «Anschauende Urteilskraft» ergeht sich Goethe über diese Kantische Idee, und sagt ausdrücklich: Wenn man sich mit Bezug auf die Ideen von Freiheit und Unsterblichkeit in eine höhere Region erheben kann, - warum soll man denn nicht auch mit demjenigen, was die menschliche Seele sonst in der Natur, in sich erleben kann, das Abenteuer der Vernunft kühn und mutig bestehen?! - Was will denn eigentlich Goethe? Das heißt nichts anderes als: Goethe will eine solche Erkenntnis in sich rege machen, die in ihm möglich macht, mit dem, was er in der Seele hat, nun wirklich im lebendigen Weltendasein unterzutauchen, nicht bloß zu wissen das Weltendasein, sondern es mitzuerleben. Goethe strebte selber nach einer solchen Erkenntnis und nach einer solchen Stellung zu den Welterscheinungen, wie er sie dramatisch in seinem «Faust» verkörpert. Und Goethe hatte in sich die Überzeugung ausgebildet, daß der Mensch nicht nur ein Wissen erwerben kann, welches eine außer ihm befindliche Welt abbildet, sondern daß er in sich eine Vorstellungswelt rege machen kann, welche den Strom des Weltendaseins miterlebt; daß dies aber nur möglich ist, wenn man das unternimmt, was Kant noch als ein Abenteuer der Vernunft bezeichnet: die tieferen Seelenkräfte heraufzuholen, die mehr erkennen können, als die bloßen Sinne und der auf die Sinne beschränkte Verstand. Und das ist das Großartige, daß Goethe dasjenige, was er als den Nerv seines eigenen Erkenntnisvermögens betrachtete, zugleich als einen Lebensimpuls auffaßte, daß er das Erkenntnisproblem nicht bloß philosophisch zu lösen sich
gedrungen fühlte, sondern als lebendiger Mensch; daß für ihn die Frage, was man erkennen kann von der Welt und womit man wirken kann innerhalb der Welt der Taten, was man in seiner Seele als Erkenntnisinhalt und als Wirkungsimpuls für die Welt der Taten innehaben kann, ein Lebensproblem wird. Das ist das Große, das Bedeutsame, daß ihm davon Glück und Verderben des Menschen abhängt; daß ihm davon Befriedigung einer Sehnsucht abhängt, die den ganzen Menschen angeht. Dadurch aber hat das Erkenntnisproblem für Goethe ein künstlerisches, ein dramatisches, ein Lebensproblem im weitesten Umfang des Wortes werden können. Und weil Goethe die Erkenntnis als etwas faßte, was wirklich in das Leben hineinführt, wurde in seiner Darstellung Faust wirklich dadurch, daß er gewissermaßen mit der Goetheschen Weltanschauung selber zusammenwächst, befriedigt in dem, was er sucht. Denn, suchte nicht im Grunde genommen seine Seele von Anfang an das Zusammenleben mit dem, was in der Natur geistig ausgebreitet ist? Als Suchen ist es im Faust von Anfang an. Um es einigermaßen in sich zu verwirklichen, brauchte er seine Weltenwanderung. Als er noch in seiner Welt, in dem «verfluchten, dumpfen Mauerloch> ist, - was hat er denn da für eine Sehnsucht?
0 sähst du, voller Mondenschein,
Zum letztenmal auf meine Pein,
Den ichso manche Mitternacht
An diesem Pult herangewacht:
Dann über Büchern und Papier,
Trübsel'ger Freund, erschienst du mir!
Ach! könnt' ich doch auf Bergeshöh'n
In deinem lieben Lichte geh'n,
Um Bergeshöhle mit Geistern schweben,
Auf Wiesen in deinem Dämmer weben,
Von allem Wissensqualm entladen,
In deinem Tau gesund mich baden!
Er will hinaus mit seiner Seele, sich vereinigen mit dem, was in der Natur lebt. Er ist dahin gekommen, er ist nach seiner Weltenwanderung wiedergeboren in dem, was Goethe durchseelt und durchlebt als das, was man nennen kann: die höchste, die schönste Blüte des deutschen Geistes-lebens.
Deshalb kann man sagen, daß Goethe das, was er sich selber errungen hat in einem kämpfenden Erkenntnis- und Weltenleben, wirklich auch durch sein ganzes Leben hindurch - denn «Faust» begleitete ihn sein ganzes Leben hindurch - in seinen «Faust» hineingeheimnißt hat. Viele Geheimnisse sind noch in diesem «Faust». Aber auch das ist darinnen, daß Faust auf seiner Weltenwanderung so weit kommt, daß er durch die Erfahrungen des eigenen Lebens reif wird in sich aufzunehmen, was sich Goethe selber, nicht als ein Abenteuer der Vernunft, sondern als etwas erworben hatte, zu dem man gelangen kann, wenn man zu den «Müttern» hinabsteigt, das heißt, wenn man in seiner Seele auf gesunde Weise eine Entwickelung der schon vorhandenen normalen Geisteskräfte versucht. Weder ein Unter-sinnliches noch ein Außersinnliches, sondern ein wirklich Übersinnliches findet man auf diese Art. Und daß innerhalb der deutschen Geistesentwickelung ein solches Werk wie der «Faust» möglich geworden ist, das charakterisiert diese ganze deutsche Geistesentwickelung, das bestimmt die Stellung, welche diese deutsche Geistesentwickelung innerhalb der ganzen Weltenentwickelung haben muß.
Es war immer ein Bewußtsein davon vorhanden, daß mit dem «Faust» mehr gegeben ist als bloß dasjenige, was
in Goethe lebte. Gewiß, es gab immer auch in der äußeren Welt Mephisto-Naturen; die können so etwas, wie es im Goetheschen Faust lebt, nicht begreifen. Und zum Schluß möchte ich Sie nur hinweisen auf eine solche äußere Mephisto-Natur. Ich möchte zum Schluß noch eine Kritik des Goetheschen «Faust» vorlesen, die im Jahre 1822 entstanden ist, aus der Sie sehen können, daß man den «Faust» auch anders beurteilt hat, als ihn diejenigen beurteilen, die versuchen, sich selbstlos in diesen «Faust» hineinzuvertiefen. Man möchte sagen, eine Kritik, die einen tröstet darüber, daß so sehr häufig die Mephisto-Naturen in der Welt dem entgegentreten, was in ehrlicher, sich überzeugender Weise suchen will nach den Quellen und Gründen des Daseins. So selten sind ja auch solche Naturen wie diejenige, die da 1822 über «Faust» geschrieben hat, in der Gegenwart nicht. Nachdem ich Sie in die Wanderung zu führen versuchte, die Faust durchgemacht hat, lassen Sie uns auch etwas hören von dem Echo, das «Faust» bei einer Mephisto-Natur gefunden hat. Ich werde diejenigen Stellen auslassen, die sich nicht für eine öffentliche Vorlesung eignen, weil sie zu zynisch sind. Schon der Prolog im Himmel, wo der Herr mit Mephisto über Fausts Natur diskutiert, zeigt diesem Mann, nachdem er festgestellt hat, «daß Herr von Goethe ein sehr schlechter Versifex sei», das Folgende:
«Dieser Prolog ist ein wahres Muster, wie man nicht in Versen schreiben soll.»
Und nun fährt der Kritiker weiter fort - 1822, sehr verehrte Anwesende! -:
«Die verflossenen Zeitalter haben nichts aufzuweisen, das in Rücksicht auf anmaßende Erbärmlichkeit mit diesem Prolog zu vergleichen ware... Ich muß mich aber kurz fassen, weil ich ein lang und leider auch langweiliges Stück Arbeit übernommen habe. Dem Leser soll ich beweisen, daß
der berüchtigte Faust eine usurpierte und unverdiente Celebrität genießet und sie nur dem verderblichen Gemeingeiste emer Associatio obscurorum vivorum verdanke ... Mich veranlasset keine Celebritäts-Rivalität, über des Herrn von Goethes Faust die Lauge strenger Kritik auszugießen. Ich wandle nicht auf seinem Pfade zum Parnasse und würde mich freuen, wenn er unsere deutsche Sprache mit einem Meisterwerke bereichert hätte... Unter der Menge von Bravorufern mag zwar meine Stimme verhallen, doch genügt mir, mein Möglichstes getan zu haben; und gelingt es mir, auch nur einen Leser zu bekehren und von Anbetung dieses Ungeheuers zurückzubringen, so soll mich meine undankbare Mühe nicht gereuen... Der arme Faust spricht ein ganz unverständliches Kauderwelsch, in dem schlechtesten Gereimsel, das je in Quinta von irgendeinem Studenten versifiziert worden ist. Mein Präceptor hätte mich durchgehauen, wenn ich so schlechte Verse wie die folgenden gemacht hätte:
0 sähst du, voller Mondenschein,
Zum letztenmal(e) auf meine Pein,
Den ich so manche Mitternacht
An diesem Pult(e) herangewacht.
Von dem Unedlen der Diktion, von der Erbärmlichkeit der Versifikation, werde ich in der Folge schweigen; an dem, was der Leser sah, hat er Beweise genug, daß der Herr Verfasser in Beziehung auf den Versebau sich auch nicht mit den mittelmäßigen Dichtern der alten Schule messen könne...
Der Mephistopheles erkennt selbst, daß Faust schon vor dem Kontrakte von einem Teufel besessen war. Wir aber glauben, daß er nicht in die Hölle, sondern in das Narrenhaus gehöre, mit allem was sein ist, nämlich Händ und
Füßen, Kopf und so weiter. Von sublimem Gallimathias, Unsinn in hochtönenden Worten, haben uns manche Dichter Muster gegeben, aber den Goetheschen Gallimathias mögte ich als ein genre nouveau den popularen Galli-mathias nennen, denn er wird in der gemeinsten und schlechtesten Sprache vorgetragen...
Je mehr ich über diese lange Litaney von Unsinn nachdenke, je mehr wird mir wahrscheinlich, es gelte eine Wette, daß, wenn ein berühmter Mann sich einfallen lasse, den flachesten, langweiligsten Unsinn zusammenzustoppeln, so werde sich doch eine Legion alberner Literatoren und schwindelnder Leser finden, die in diesem plattfüßigen Unsinne tiefe Weisheit und große Schönheiten zu finden und herauszuexegesieren wissen werden.»
Und so geht es weiter. Zuletzt sagt er noch:
«Kurz, ein miserabler Teufel, der bei Lessings Marinelli in die Schule gehen könnte. Diesem nach kassiere ich im Namen des gesunden Menschen-Verstandes das Urteil der Frau von Staël zugunsten des gedachten Fausts und verurteile ihn nicht in die Hölle, die dieses frostige Produkt abkühlen könnte, da sogar dem Teufel dabei winterlich im Leibe ist, sondern um in die Cloacam parnassi prezipieret zu werden. Von Rechtswegen. »
Die Welt geht über solche Urteile hinweg. Und die Welt wird in dem «Faust» einen der tiefsten Versuche des Menschengeistes sehen, nicht nur auf philosophische Weise, sondern auf dramatische, auf ganz lebendige Weise das Erkentnis- und Menschheitsproblem im weitesten Sinne vor die Menschen hinzustellen, es überhaupt erst zu ergründen. Und es war immer ein Bewußtsein davon vorhanden, daß es Goethe gelungen ist, nicht nur einseitig die Goethesche Weltanschauung und Goethesche Empfindungen in seinem «Faust» auszusprechen, sondern, wie Herman Grimm wiederum
so schön sagt, die ganze Weltanschauung des ganzen Jahrhunderts. Und das wird wohl ein Wort sein, das Herman Grimm mit Recht gesprochen hat. «Wir haben», meint er, «eine eigene Literatur, deren Zweck es ist, nicht nur Goethes Credo, sondern das Credo seines gesamten Jahrhunderts in Faust nachzuweisen.»
Ich könnte im übrigen darauf hinweisen, wie tief gegründet die Wiedergeburt Fausts nach seiner Weltenwanderung im ganzen deutschen Geistesleben ist. Welche Tiefe dieses deutsche Geistesleben selber durchgemacht hat, zeigt sich daran, daß die ganze Fülle dieses Geistesstrebens in einem solchen Werke wie dem Goetheschen «Faust» zum Ausdruck kommen konnte, und Herman Grimms Worte werden wohl wahr sein: nicht bloß Goethes Weltanschauung, sondern die Weltanschauung des ganzen Jahrhunderts. Und eine Weltanschauung, wie sie in kommende Jahrhunderte im allerweitesten Sinne hineinleben wird, ist in Goetes «Faust» zum Ausdruck gekommen. Daß das deutsche Geistesleben dieses Werk hervorbringen durfte, wird für alle künftigen Zeiten eine Tatsache sein, die gegenüber allen Vorurteilen über das deutsche Geistesleben anerkannt werden wird von denen, die unbefangen und objektiv dieses deutsche Geistesleben erfassen können. Indem der deutsche Geist des Menschen tiefstes Streben durch Goethe im «Faust» auf eine so große Weise zum Ausdruck gebracht hat, hat dieser deutsche Geist für alle Zukunft zu allen Menschen der Erdenentwickelung ein unvergängliches Wort der Erkentnis des menschlichen Lebens im Sein und im freien Wollen und im Wirken ausgesprochen, ein Wort, das da bleiben wird, so wie bleiben wird dasjenige, was wahre, tiefe Früchte des deutschen Geisteslebens sind. Zu diesen tiefsten, wahrsten, unvergänglichen Früchten wird dasjenige gehören, was wir im «Faust» finden können. Und
so darf man sagen: Man lernt ein Stück vom Unvergänglichen des deutschen Geistes selber kennen, indem man sich in Goethes «Faust» versenkt. Und dieser deutsche Geist hat zur ganzen Welt gesprochen, indem er aussprechen konnte solches, wie es nun im «Faust», um wiederum dieses Goethe-Wort zu gebrauchen, in einem offenbaren Geheimnis verborgen ist - offenbar, wenn man es nur sucht. Auch gegenüber dem «Faust» darf man das Goethe-Wort selber anwenden: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.» Aber man darf dieses Wort erweitern: In Werken, die aus dem Vergänglichen heraus so sich zum Ewigen hin-neigen, wie der Goethesche «Faust», spricht zu gleicher Zeit das Unvergängliche in einer ewigen Art zur Ewigkeit des Menschendaseins.
GESUNDES SEELENLEBEN UND GEISTESFORSCHUNG Berlin, 4. Februar 1916
Unter den mancherlei Vorurteilen, die man der Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist, entgegenbringt, sind auch diejenigen, welche die Methoden der Geistesforschung, dasjenige, was man als Wege der Geistesforschung bezeichnen kann, in irgendeinen Zusammenhang bringen mit einem unnormalen, krankhaften Seelenleben. Obgleich nun derjenige, welcher genauer verfolgt, was sich über den Gang jener Seelenentwickelung sagen läßt, der in die Geistesforschung hineinführen soll, entweder nur aus Dilettantismus, aus Unkenntnis oder aber aus Übelwollen heraus im Grunde genommen zu einem solchen Vorurteil kommen kann, so muß ja doch auch einmal über dieses Vorurteil gesprochen werden. Denn es sind in der Welt reichlich vorhanden sowohl Unkenntnis in dem angegebenen Sinne wie auch Übelwollen. Ich will nicht auf einzelne Angriffe eingehen, die gegen die Geisteswissenschaft gerade von dieser Seite her unternommen worden sind, sondern ich möchte nur im allgemeinen die möglichen Angriffe, die möglichen Einwände und Vorurteile besprechen und zeigen, wie ungerechtfertigt sie gegenüber dem Wesen der wahren Geistesforschung eigentlich sind. Dazu muß ich allerdings von einem gewissen Gesichtspunkte aus kurz einiges von dem vorbringen, was schon Gegenstand der Vorträge war, die ich im Beginne des Winters hier gehalten habe. Ich muß in ganz skizzenhafter Weise den Weg der Geistesforschung charakterisieren.
Der Weg der Geistesforschung - das wurde hier ja immer wieder und wiederum betont - ist ein rein innerlicher Seelenweg, ist ein Weg, welcher nur durchgemacht wird innerhalb des Seelenlebens selbst, und er besteht in gewissen Verrichtungen des Seelenlebens, in gewissen Übungen des Seelenlebens, welche dieses Seelenleben von dem Punkte aus, auf dem es im gewöhnlichen Leben steht, zu einem anderen Punkte führen, von dem aus es eben in der Lage ist, heranzutreten an das, was man die geistige Welt nennen kann. Nun habe ich, vieles zusammenfassend, gerade in einem der Vorträge, die ich in diesem Winter gehalten habe, die Übungen, die der Geistesforscher durchzumachen hat, in zwei Hauptgruppen behandelt. Die einen Übungen, welche darin bestehen, daß man in einer gewissen Weise sein Denken anders formt, als es im gewöhnlichen Leben ist: Übungen des Denkens. Sie gehören zur ersten Gruppe der geistesforscherischen Übungen. Übungen des Willens, in einer gewissen Weise vorgenommen, gehören zur zweiten Gruppe der geistesforscherischen Übungen.
Ich werde heute, kurz zusammenfassend selbstverständlich, vieles sagen müssen, zu dessen vollem Verständnis entweder notwendig ist dasjenige, was in früheren Vorträgen gesagt worden ist, oder das Nachlesen zum Beispiel meines Buches «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» oder des zweiten Bandes meiner «Geheimwissenschaft». Denn ich werde vorzugsweise versuchen auseinanderzusetzen, inwiefern das Denken durch gewisse Übungen, die man technisch Meditation, Konzentration des Denkens nennt, gegenüber dem gewöhnlichen Denken verändert wird. Ich will nicht darauf eingehen, wie diese Übungen gemacht werden, sondern gleich erwähnen, daß es bei den eigentlichen Denkübungen darauf ankommt, etwas in das Bewußtsein heraufzuheben, was immer im
menschlichen Denken und gerade im gesundesten menschlichen Denken vorhanden ist, aber innerhalb dieses gesunden menschlichen Denkens des Alltags mehr oder weniger unbewußt bleibt aus dem Grunde, weil wir dieses Denken des Alltags im Sinne dessen vollziehen, was man Anpassung an die Gesetzmäßigkeiten, an die Vorgänge der Außenwelt nennen könnte. Wir nehmen ja nicht nur die Außenwelt durch unsere Sinne wahr; wir denken über die Außenwelt, wir bilden uns Vorstellungen, die zu Gedanken werden, wir verbinden diese Vorstellungen in unserem Gedankenleben. Wir verbinden sie, wenn es sich um gesundes, zur Wirklichkeit gehörendes Denken handelt, in ganz bestimmter, gesetzmäßiger Weise. Allein selbst dasjenige, was man Logik nennt, kann nur beschreiben, wie Urteile vor sich gehen, wie geurteilt wird, wie das Denken sich gewissermaßen innerlich bewegt, um zu dem zu kommen, was man Wahrheit nennt. Die eigentliche Verrichtung des Denkens, das innerliche Tun des Denkens, bleibt im wesentlichen im gewöhnlichen Denken unbewußt. Was im gewöhnlichen Denken vor sich geht, aber unbewußt bleibt, so zu behandeln, daß es heraufgehoben wird ins volle Bewußtsein, so daß wir nicht bloß unsere Gedanken gleichsam unter dem Zwange der Weltenströmungen weben und leben lassen, sondern daß unser voller, bewußter Wille in dem Denken drinnen zum Vorschein kommt, - das ist das Ziel, das mit der einen Gruppe der Übungen angestrebt wird.
Man muß sich sagen, wenn man das Denken, das Vorstellen, wie es verfließt, wirklich betrachtet, daß wir es vollziehen im Sinne desjenigen, was uns wie ein Zwang der Strömung der Wirklichkeit aufgedrängt wird. Die Übungen, die nun insbesondere Denkübungen sind, zielen darauf hinaus, ins Bewußtsein solche Vorstellungen und
auf eine solche Art Vorstellungen hereinzunehmen in den Vorgängen, die man eben Meditation, Konzentration des Denkens nennt, daß man in dem ganzen Vorgang des Meditierens, dieses Konzentrierens, den bewußten Willen immer waltend hat, daß kein Augenblick da ist, in dem der bewußte Wille nicht waltete. Und da stellt sich eben heraus, wenn man die nötige Geduld und die nötige Ausdauer und Energie hat, solche Übungen vorzunehmen, daß man dahin kommt, die Tätigkeit des Denkens, die Denktätigkeit, gewissermaßen loszulösen von demjenigen, was im gewöhnlichen Leben das Gedankensein ist, daß man lernt, sich zu konzentrieren nicht bloß auf das Gedachte, sondern auf den Vorgang des Denkens, auf jenes innere Weben und Leben der Seele, das sich vollzieht, indem man denkt. Und ich habe auch auseinandergesetzt, mit welchen Begleiterscheinungen diese innere Entdeckung verknüpft ist, die darinnen besteht, daß man die Denktätigkeit im Denken gewahr wird. Die Begleiterscheinung ist diese, daß man gewissermaßen die Gedanken selbst, von denen man sonst gewöhnt ist, daß man sie in der Denktätigkeit immer hat, als etwas Sekundäres betrachten kann, ja, daß man sie zuletzt ganz aus der Denktätigkeit heraußen hat. Man beginnt mit gewissen Gedanken, man geht aber über zu einer bloßen bewußten willentlichen, voll willentlichen Denktätigkeit. Man gelangt in die Lage, die Gedanken aus- und einzuschalten und bewußt zu walten in der Denktätigkeit. Da tritt als Begleiterscheinung dieses auf, daß man allerdings nunmehr sich erfestet, erkraftet in diesem willentlichen Handhaben der Denktätigkeit. Aber zugleich kommt man in eine gewisse Leerheit des Bewußtseins, in ein leeres Weben und Leben des Bewußtseins hinein. Daher, so sagte ich, dürfen diese Übungen, die sich auf die bloße Denk-tätigkeit beziehen, niemals allein vorgenommen werden.
Ja, es werden die Übungen der Meditation und Konzentration schon so vorgenommen, daß, indem man sie im Bewußtsein durchmacht, zugleich das gewöhnliche Willens-element eine Schulung durchmacht; daß man dazu kommt, das, was im Willen im gewöhnlichen Leben verborgen ist, nun wiederum ins Bewußtsein heraufzuheben. Und da kommt man dazu, etwas ganz Reales im gewöhnlichen Wollen, in der gewöhnlichen Willenstätigkeit zu finden, etwas, was wiederum immer da ist, was aber sonst im Unbewußten des Menschen drunten stecken bleibt. Man kann nicht irgend etwas wollen, man kann auch nicht irgendein Wollen in die Handlung ausfließen lassen, ohne daß dasjenige, von dem ich rede, in der Betätigung vorhanden ist. Aber es bleibt unbewußt. Durch diejenigen Übungen, die eben wiederum in einer Art Konzentration, Meditation, in einem inneren, jetzt mehr, ich möchte sagen, auf das Affektleben bezügliche Vornehmen der Seele beruhen, gelangt man dazu, das zu entdecken, was sich sonst, indem man will, indem man einen Willen ausfließen läßt in die Handlung, unbewußt in das Wollen oder in das Handeln ergießt, was man aber nicht anschaut. Nunmehr entdeckt man es. Man entdeckt nun im Willen merkwürdigerweise etwas, was bewußtseinsähnlich ist. Man entdeckt ein anderes Bewußtsein, als das gewöhnliche Bewußtsein ist. Man entdeckt - und man muß dies, was jetzt angeschaut wird, nicht wie ein Bild nehmen, sondern wie eine Realität, wie eine Wirklichkeit -, daß uns fortwährend ein anderes Bewußtsein als unser gewöhnliches Tagesbewußtsein begleitet, daß wir uns - wenn der paradoxe Ausdruck gebraucht werden darf - dieses anderen Bewußtseins eben nur nicht bewußt sind. Man entdeckt einen anderen Menschen im Menschen. Man entdeckt dasjenige, was man nennen kann: ein uns fortwährend zuschauendes Bewußtsein.
Und man lernt dieses Bewußtsein, das man also in den Verrichtungen seines Wollens entdeckt, handhaben wie das gewöhnliche Bewußtsein. Man lernt auch dieses Bewußtsein nunmehr so zu verbinden mit den Ergebnissen, die man durch die Denkübungen erreicht hat, daß die zwei sich gewissermaßen miteinander verbinden und daß man nun in die Lage kommt, Verrichtungen der Seele vorzunehmen, von denen man jetzt erst weiß, daß sie völlig frei sind von jeder Mitwirkung der Leiblichkeit. Das letztere muß eben eine innere Erfahrung sein, und es wird eine innere Erfahrung.
Also man entwickelt das Seelenleben zu einem anderen Bewußtsein, als das gewöhnliche ist, und gibt diesem Seelen-leben dadurch einen Inhalt, daß man den Willen im Denken entdeckt, daß man das Denken als diese Tätigkeit in sich entdeckt. Nicht in solch abstrakter Weise, wie das durch die gewöhnlichen Philosophien oder sonstigen Wissenschaften geschieht, sondern in lebendiger Weise entdeckt man die Denktätigkeit als Willenstätigkeit. Man kann nun auch sagen, daß man im Denken den Willen entdeckt, und man kann sagen, daß man im Willen ein Bewußtsein entdeckt, das man so als ein denkendes Bewußtsein ansprechen kann, wie sonst das gewöhnliche alltägliche Bewußtsein, das wir im Leben haben, ein denkerisches Bewußtsein ist. Man entdeckt im Denken den Willen, im Willen ein objektives, von uns sonst nicht gehandhabtes - wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf -, sich selber handhabendes Denken, einen Denker in uns, der in uns steckt, der objektiv vorhanden ist. Damit ist im wesentlichen dasjenige charakterisiert, was erzielt werden soll.
Noch andere Begleiterscheinungen dieses Vorgangs müssen charakterisiert werden, damit man ein vollständiges Bild davon hat, wenn man dabei angekommen ist, das
Denken als Tätigkeit zu entdecken, in sich wirklich in seinem Denken das zu finden, was sonst unbewußt bleiben kann; ich habe das in früheren Vorträgen ausführlicher geschildert. Dann sieht man sich vor etwas gestellt, wie man sich sonst vor die Gegenstände und Vorgänge der Außenwelt gestellt findet. Aber eine Eigentümlichkeit tritt auf, die wichtig ist, die wesentlich ist. Was man jetzt erlebt mit Hilfe des also entwickelten Denkens und jenes Bewußtseins, von dem ich eben gesprochen habe, jenes anderen Bewußtseins, als das gewöhnliche ist, - was man so entdeckt, das unterscheidet sich ganz wesentlich von den Seelenerlebnissen, die man sonst im gewöhnlichen Leben hat. Man mag jetzt den Vorgang mehr materialistisch oder mehr spirituell deuten, darauf kommt es nicht an, wie es überhaupt bei den heutigen Betrachtungen nicht auf Deutung, sondern auf Erfahrung ankommen wird. Dasjenige, was in unserem gewöhnlichen Erleben durch die Wahrnehmungen in uns eingeflossen ist, was zu Gedanken, zu Vorstellungen geworden ist, wandelt sich nämlich so um, daß es im Gedächtnis, in der Erinnerung, wie man sagt, haften bleiben kann, wenn auch natürlich hinter diesem Haftenbleiben ganz andere Vorgänge dahinterstecken. So wie die Erlebnisse des gewöhnlichen Wahrnehmens und gewöhnlichen Denkens durch einen gewissen Seelenvorgang die Möglichkeit gewinnen, im Gedächtnis unmittelbar aufbewahrt zu werden, wie sie gewissermaßen ohne unser Zutun zu unserem Gedächtnisschatze werden, so ist es nicht der Fall bei denjenigen Erfahrungen, die wir auf die Weise, die ich eben geschildert habe, mit dem entwickelten Bewußtsein und der entwickelten willenserfülltenDenktätigkeit machen. Diese Erfahrungen werden gemacht, aber sie gehen vorüber, indem sie gemacht werden, so daß man sie eigentlich nur einen Augenblick festhalten kann. Sie prägen sich nicht
em in unser organisches Leben. Man kann ihre Flüchtigkeit mit der Flüchtigkeit von Traumerlebnissen vergleichen. Aber man sagt damit nicht mehr als einen Vergleich. Denn der Traum hat schließlich noch immer die Eigentümlichkeit, daß er wenigstens in einer gewissen Weise unmittelbar durch sich selber im Gedächtnis behalten werden kann. Dasjenige, was auf die geschilderte Weise in der geistigen Welt als geistige Erfahrung gemacht wird, spielt sich ab, geht aber nun durch sich selbst nicht in den gewöhnlichen Gedächtnisschatz über. Und das ist das eigentümliche, daß man, wenn man im Geiste der Wirklichkeit gegenüberstehen will, niemals so verfahren kann, daß man dasjenige, was man einmal erfahren hat, einfach aus seinem Gedächtnis herausholen kann und es dann wieder hat. Man würde es dann nicht wieder haben; sondern man muß die Erfahrung von neuem machen. Selbstverständlich bereitet sich dasjenige, was ich geschildert habe, langsam vor; durch alle möglichen Stadien bereitet es sich vor. Aber wozu man zuletzt kommt, wenn man all die Dinge beachtet, die zum Beispiel in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» geschildert sind, das ist dasjenige, was ich eben geschildert habe.
Nun werden Sie sagen: Also können eigentlich die geistigen Erfahrungen nur gemacht werden und müssen dann vergessen werden. Das müßten sie auch, wenn nichts anderes dazu käme. Und das andere, das jetzt dazu kommt, ist zu gleicher Zeit die besondere Tatsache des geistigen Verlierens, die ins Auge gefaßt werden muß, wenn man einsehen will, welche Beziehung zwischen dem gesundesten Seelenleben und der Geistesforschung herrscht, und wie unbegründet die Vorurteile sind, die darauf hinausgehen, daß Geistesforschung irgendwie etwas mit krankhafter Seelen-entwickelung zu tun haben könnte. Das Eigentümliche, um
das es sich handelt, ist, daß sich derjenige Bewußtseinszustand entwickelt, welcher durch den wahrhaftigen, durch den rechten geisteswissenschaftlichen Weg erlangt wird. Er kommt zustande, er ist dann da für unser Seelenleben. Aber der gewöhnliche Bewußtseinszustand, mit dem wir sonst im Alltagsleben drinnenstehen, bleibt so bestehen, wie er vorhanden war, bevor wir in diesen anderen Bewußtseinszustand eingetreten sind. Das heißt: wir bleiben in genau derselben Weise urteilsfähig oder meinetwillen auch mangelhaft urteilsfähig, wie wir vorher waren; wir bleiben zunächst in derselben Weise affektvoll oder weniger affektvoll, wie wir vorher waren. Zunächst besteht die Möglichkeit, mit dem neu errungenen Bewußtsein den anderen Menschen, der man vorher war und der man nun geblieben ist, mit derselben Objektivität zu beobachten, wie man heute diejenigen Vorgänge beobachten kann, die man etwa gestern seelisch durchlebt hat. So wenig wird irgend etwas am gewöhnlichen Bewußtsein dadurch verändert, daß man dieses andere Bewußtsein errungen hat, wie das Seelenleben, das man gestern durchgemacht hat, irgendwie dadurch verändert wird, daß man es heute betrachtet. Und wenn es verändert wird, wenn man etwas hineinphantasiert, dann ist eben die Betrachtung nicht diejenige, die irgend zu einer Objektivität führen kann; dann muß sich irgend etwas vollzogen haben, was nicht in der Ordnung ist. Man steht also seinem gewöhnlichen Seelenleben so gegenüber, wie man, ich möchte sagen, einem vorangegangenen Seelenerlebnis gegenübersteht. Das gewöhnliche Seelenleben bleibt vollständig intakt. Und man muß, wenn man geisteswissenschaftliche Erfahrungen aufbewahren will, im Gedächtnis erst dasjenige, was man im Geiste erlebt hat, herübernehmen in das gewöhnliche Bewußtsein, das sich erhalten hat, und kann es dann selbstverständlich,
wie man Erlebnisse des gewöhnlichen Bewußtseins behalten kann, im Gedächtnis aufbewahren. Das aber ist immer notwendig, daß das gewöhnliche Bewußtsein neben dem neu errungenen Bewußtsein steht und daß dasjenige, was für das gewöhnliche Leben vorgenommen wird, nicht mit dem neu errungenen Bewußtsein, sondern mit dem gewöhnlichen Bewußtsein vorgenommen wird. Will man also die geisteswissenschaftlichen Erfahrungen dem gewöhnlichen Gedankenleben, das sich in der Erinnerung bewahren kann, einverleiben, so muß man sie erst aus dem anderen Bewußtsein herübernehmen. Will man einsehen, daß diese geistigen Erlebnisse wahr sind, so kann man das nicht in dem anderen Bewußtsein erfahren - das muß ausdrücklich betont werden -, sondern man muß sie mit dem gewöhnlichen Bewußtsein beurteilen. Sie müssen durchaus der Urteilskraft des gewöhnlichen Bewußtseins unterzogen werden. Die Einsicht in den geistigen Tatbestand erlangt man durch das entwickelte Bewußtsein; die Einsicht in die Wahrheit dieses geistigen Tatbestandes erlangt man zunächst durch seine ganz gewöhnliche gesunde Urteilskraft, die vollständig intakt erhalten bleibt, wenn alle Übungen in der richtigen Weise absolviert werden.
Dadurch aber unterscheidet sich das Bewußtsein, von dem ich eben jetzt gesprochen habe, von allen krankhaften Seelenzuständen. Es unterscheidet sich dadurch von krankhaften Bewußtseinszuständen, daß sich die krankhaften Bewußtseinszustände aus den gesunden - meinetwillen -herausentwickeln, daß diejenigen, die noch als gesund angesehen werden können, übergehen in die kranken Bewußt-seinszustände. Das veränderte Bewußtsein löst das erste ab. Aber wenn Sie sich auch nacheinander denken können:
gesundes Bewußtsein, krankes Bewußtsein, wiederum gesundes Bewußtsein, so können Sie nicht im eigentlich bewußten
Sinne denken, daß man zu gleicher Zeit normal, verständig - und verrückt ist. Denn man wäre dann nicht verrückt. In dem Augenblicke, wo man seine Verrücktheit mit dem nor,nalen Verstande beurteilen kann, ist man doch wahrhaftig nicht verrückt. Das ist die besondere Tatsache, die ins Auge gefaßt werden muß, daß alles veränderte Bewußtsein, alles krankhafte Bewußtsein aus dem gesunden hervorgeht wie eine Metamorphose, und daß man niemals eigentlich von einem Doppel-Ich sprechen sollte - was schon der ausgezeichnete Kriminalanthropologe Benedikt gerügt hat -, sondern sprechen sollte für die gewöhnlichen pathologischen Erscheinungen von einem veränderten Bewußtsein.
Damit ist zu gleicher Zeit charakterisiert, worauf die geisteswissenschaftlichen Übungen abzielen, wohin das, was man Geistesforschung nennt, den Menschen eigentlich führt. Nun ist es ganz begreiflich - ich sage ausdrücklich: ganz begreiflich -, daß derjenige, der zunächst nicht das ganze Wesen der hier angeführten Sache kennt, leicht zu dem Vorurteile kommen kann: Nun ja, da hat irgend jemand mit seinem Seelenleben Unfug getrieben und ist zu einem abnormen Seelenleben gekommen. Vielleicht könnte man auch ganz hübsch, wie man das ja sonst macht, etwa neben den gewöhnlichen abnormen, krankhaften Seelenerscheinungen, die alle im Grunde genommen dadurch charakterisiert werden müssen, daß in der Wirklichkeit nicht das eine Bewußtsein neben dem anderen vorhanden sein kann, sondern daß sich das eine aus dem anderen entwickeln, das eine das andere ablösen muß, - man könnte neben diesen krankhaften Seelenerscheinungen ja einfach neue registrieren - man macht es so-, bei denen eben das eine Bewußtsein neben dem anderen bestehen könnte. Denn derjenige, der mit diesen Dingen nicht bekannt ist, kann ja zunächst im Grunde genommen
zu keinem anderen Urteil kommen, als daß der Betreffende, der zu einem solchen anderen Bewußtsein gekommen ist, im Grunde genommen einem unnormalen Denken, oder auch einem unnormalen Wollen oder Fühlen in irgendeiner Weise unterliegt.
Diese Dinge sind zunächst ganz begreiflich, obwohl sie ja schließlich auf keinem anderen Gebiete stehen als auf dem, wie derjenige, der auf einer bestimmten bäuerlichen Bildungsstufe steht - damit soll durchaus keine Herab-würdigung gemeint sein! -, denjenigen, der sich zum Beispiel den ganzen Tag mit recht gescheiten mathematischen Operationen befaßt, von seinem Standpunkte aus auch als einen Verrückten ansehen kann, denn es liegt so in der menschlichen Natur, alles, was man nicht selber denkt und woran man nicht selber glaubt, eben als ein Abnormes anzusehen. Im Grunde genommen liegt hinter den Vorurteilen, die vielfach gerade von dieser Seite aus der Geisteswissenschaft entgegengebracht werden, auch nichts anderes als der eben gekennzeichnete Trieb der Menschennatur, nur dasjenige gelten zu lassen, was man eben selber innerlich erleben kann.
Nun aber handelt es sich darum, daß ja allerdings auch objektiv viel Gelegenheit gegeben ist, wahre Geistesforschung mit allerlei Unfug zu verwechseln. Geistesforschung
- das ist ja in gewissem Sinne durch die Notwendigkeiten des Lebens gegeben - wird zunächst gerade so zu einem kleineren, geschlossenen Kreis von Menschen sprechen, so wie es schließlich auf anderen Gebieten auch geschieht. Gewiß, man macht heute vielfach denjenigen, die die Aufgabe haben, zu den Menschen über Geistesforschung zu sprechen, den Vorwurf, sie sprächen in allerlei kleinen Zirkeln und dergleichen, sie sprächen zu Menschen, die sich gewissermaßen erst bereit erklärt haben, die Dinge anzuhören. Ja,
aber ich kann keinen objektiven Unterschied zwischen diesem Vorgang und dem anderen sehen, daß am Beginne eines Semesters eine Anzahl von Studenten bei irgendeinem Dozenten eingeschrieben wird, und dieser dann auch eben zu diesem geschlossenen Kreise spricht. Und ich kann, wenn nicht sonstiger Unfug getrieben wird, auch nicht einsehen, warum der geschlossene Kreis eines Hörsaales weniger eine Sekte genannt werden sollte, wenn man den Ausdruck gebrauchen will, als eine Anzahl von Leuten, die irgend etwas Geisteswissenschaftliches hören. Aber man hat es im Geisteswissenschaftlichen allerdings zunächst mit Dingen zu tun, die ja nicht durch die Vorgänge, die Geschehnisse des äußeren physischen Planes so ohne weiteres kontrolliert werden können. Wenn einem jemand sagt: irgendein zusammengesetzter Körper bestehe aus diesen oder jenen Elementen, so kann man durch äußere Mittel so etwas unmittelbar nachprüfen. Auch alle geisteswissenschaftlichen Resultate kann man nachprüfen, aber es ist notwendig, daß man erst den Weg des Geistesforschers geht, der geschildert worden ist. Also obzwar diese Dinge nachprüfbar sind, können sie nicht so in der gewöhnlichen Seelenverfassung nachgeprüft werden, in der andere, rein in der äußeren physischen Welt vor sich gehende Dinge nachgeprüft werden können. Daher kommt es - und ich brauche wohl jetzt keinen ausführlichen Gedankenübergang zu machen, um die Erfahrung, die ich charakterisieren will, anzuführen -, daß auf diesem Gebiete, wo eben die Nachkontrolle nur bei Anwendung der entsprechenden Mittel herbeigeführt werden kann, tatsächlich in ungeheuerstem Maße dasjenige blüht, was man nennen kann Autoritätsglaube an das, was ausgesprochen wird, was man nennen kann überhaupt die Phrase, das bloße Hinreden. Ja, aus Antrieben, die hier nicht charakterisiert zu werden brauchen, schließen sich
leicht Gesellschaften gerade zu geisteswissenschaftlichem Leben zusammen, die zu ihrem ersten Grundsatze mit einem gewissen Recht Toleranz, gegenseitige Liebe und gegenseitiges Vertrauen machen. Das ist ein schöner Grundsatz. Aber die Erfahrung hat vielfach gezeigt, daß nirgends mehr gestritten wird und nirgends mehr Uneinigkeit herrscht als in solchen Gesellschaften. Und obwohl solche Gesellschaften oftmals auf ihre Fahne geschrieben haben, die Wahrheit als das Höchste zu verehren, so kann man wiederum die Erfahrung machen, daß auf keinem Gebiet oftmals die Wahrheit weniger respektiert wird als innerhalb von Gesellschaften, die vorgeben, solche entsprechenden Ziele zu haben. Und so kommt es denn allerdings, daß innerhalb von Kreisen, wo angeblich Geisteswissenschaft getrieben wird, viel Unfug herrscht. Und dann ist es schwierig für denjenigen, der sich nicht auf die Sache selber einläßt, sondern die Dinge nach den äußeren Symptomen und nach den äußeren Vorgängen beurteilt, das Wahre von dem Unfug zu unterscheiden. Und ich möchte nun im weiteren Verlauf dieser heutigen Betrachtungen einiges beibringen, welches die Möglichkeit geben kann, Wahrheit und Unfug auf diesem Gebiet zu unterscheiden. Ich möchte vor allen Dingen betonen, daß man nicht zu strenge Kritik üben soll an den Vorurteilen, die der Geistesforschung gerade von der heute charakterisierten Seite aus entgegengebracht werden, daß man vielmehr diese Vorurteile sogar im weitesten Umfange begreiflich finden kann. Ich will nun gleich etwas ganz Konkretes erwähnen.
Wenn man in einer gewissen Weise in die geistige Welt eingetreten ist, wenn man geistige Erfahrungen gemacht hat, also die geistige Wirklichkeit kennengelernt hat, dann kommt man zu dem, was ich hier ja auch schon öfter charakterisiert habe, was Sie aber in den genannten Büchern genau
charakterisiert finden können, - man kommt zu dem, was man imaginative Erkenntnis nennt, nicht, weil es sich nur eben um Übungen in der Phantasie, um eine bloße Imagination im gewöhnlichen Sinne handelt, sondern weil man in die Lage kommt, dasjenige, was man erlebt, bildhaft ausdrücken zu müssen. Selbstverständlich dasjenige, was der Mensch zunächst an Vorstellungsvermögen hat, auch in alledem, wie er die Vorstellungen in Worte bringen kann, wie er die Vorstellungen charakterisieren kann, das bezieht sich ja auf die physische Welt. Wenn man nun in eine ganz andere Welt versetzt wird und sie dann nicht anders charakterisiert, nämlich schon für sich selber diese andere Welt als bildhaft charakterisiert, so bildet man falsche Vorstellungen über sie aus. Man muß dann dasjenige, was im Einzelnen, Konkreten über die geistige Welt angegeben wird, immer mit dem Bewußtsein aufnehmen, daß alles, was der Geistes-forscher schildert, aus vollbewußter Willenstätigkeit heraus fließt, daß er also nicht aus irgendeinem unbestimmten dämmerigen Bewußtseinszustand heraus, nicht aus einem visionären Bewußtsein heraus schildert, sondern daß er gerade im Gegensatz zu jedem abgedämmerten oder visionären Bewußtsein bewußt, mit vollem Willen dasjenige ausbildet, was er als Imagination, als Bilder für die geistigen Erlebnisse darstellt. Wie er dasjenige, was er darstellt, in diesem Sinne gibt, daß alles von ihm willentlich durchdrungen ist, so muß es auch in diesem Sinne aufgenommen werden.
Zur Darstellung der geistigen Erlebnisse, die im Seelen-leben deshalb doch real anwesend sind, wenn sie auch bildlich dargestellt werden müssen, ist es selbstverständlich notwendig, daß man Bildhaftes aus dem gewöhnlichen Leben nimmt, daß man also dasjenige, was geistig erlebt wird, dadurch charakterisiert, daß man das eine mit dieser Farbe, das andere mit jener Farbe bezeichnet und so weiter. Dabei
besteht aber eine gewisse - aber jetzt rein seelisch-geistige, nicht physiologisch-organische - Notwendigkeit zur Schilderung des einen, sagen wir, diese Farbe, diesen Ton und dieses Tasterlebnis, zur Schilderung des andern irgend etwas anderes zu verwenden. Und gerade so, wie man, wenn man in einer bestimmten Sprache redet, nicht erst auseinandersetzt, daß dieses Wort diese Bedeutung, jenes Wort jene Bedeutung hat, so muß selbstverständlich, wenn man im Konkreten die geistigen Erlebnisse genau schildert, die Bilderwelt, in der man sich auszudrücken hat, da sein wie eine innere Sprache, wie etwas, durch das man vergegenwärtigt, repräsentiert das eigentlich erst dahinterstehende geistige Erlebnis. Tritt nun - ich habe dasjenige, was ich jetzt hier auseinandersetze, in Einzelheiten genau in der sechsten Auflage meiner «Theosophie» auseinandergesetzt -eine solche Schilderung eines geistigen Erlebnisses auf und wird dieses oder jenes geistige Wesen rot, blau und so weiter beschrieben, was ganz richtig ist, wodurch es wirklich repräsentiert, nicht nur charakterisiert wird, dann kann selbstverständlich derjenige, der diese Beschreibung entgegennimmt und der ganz unbekannt ist mit der Art und Weise, wie sie eigentlich gemeint ist, sagen: Das kennen wir! Das kennen wir aus dem Gebiet der Psychologie! Wir kennen gut jene Seelenleben, in denen als sekundäre Sinnesempfindung oder als Halluzination oder auch als Illusion Seelenerlebnisse auftreten, die rein aus dem Inneren hervorgehen. - So ist es durchaus berechtigt, wenn zum Beispiel darauf hingewiesen wird, daß es Menschen gibt - nach gewissen Erfahrungen, die gesammelt worden sind, hat sogar ein Achtel aller Menschen diese Eigenschaft -, die zum Beispiel, wenn sie einen gewissen Ton wahrnehmen, ohne daß sie irgendeine Farbe sehen, eine Farbe hinzufügen, aber so, daß sie einem ganz gegenständlich wird.
Solche Farbenerscheinungen, die nicht durch einen äußeren Eindruck hervorgerufen sind, sondern die sich aus dem Inneren heraus zu einem Ton hinzugesellen - ich will jetzt die verschiedenen Hypothesen, die darüber gemacht worden sind, nicht ausführen -, nennt man sekundäre Sinnes-empfindungen. Und was Menschen auf diese Weise erleben können, kann ja so weit gehen, daß ihnen, wenn sie zum Beispiel eine gedruckte Sache in die Hand nehmen, die einzelnen Buchstaben nach ihrem Inhalt, je nachdem es ein o oder ein a ist, in anderen Farben erscheinen. Kurz, der Psychiater kann selbstverständlich sagen: Diese Sachen kennen wir. Und er kann das dann ganz besonders sagen, wenn nun Seelenerlebnisse mit dem vollen Charakter der Sinnesempfindungen auftreten, aber von innen heraus als Halluzinationen gebildet sind. Und wenn man oftmals Halluzinationen nimmt, die besonders lebendig plastisch vor die Seele treten, dann kann man sagen: Ja, ist denn nicht das krankhafte Seelenleben in der Lage, wirklich innerlich Wirkungen hervorzurufen? Und hört man dann, was von dieser oder jener Seite vorgebracht wird, die Behauptung: sie hätten sich in bezug auf das Seelenleben entwickelt, - so findet man ganz dasselbe. Das Bedeutsame ist nur, daß eben wegen des genannten Unfugs, der angeführt worden ist, sehr häufig bei Menschen, die dazu besondere Dispositionen haben, sekundäre Sinnesempfindungen oder halluzinatorische Zustände auftreten und dann behauptet wird, daß das «höhere Erlebnisse» seien, daß sie damit wirklich etwas aus der geistigen Welt gegeben hätten. Ich habe schon gestern in Anknüpfung an den «Faust» darauf hingewiesen: damit ist gar nichts aus der geistigen Welt gegeben, sondern das sind bloße Umwandlungen des inneren Trieblebens, das ist bloß aus dem Inneren des Menschen aufgestiegen. Das gibt nicht mehr als das normale
Seelenleben, sondern es gibt weniger, weil es etwas gibt, was unter dem normalen Seelenleben wirkt und was sich nur, indem es ins Bewußtsein heraufgehoben wird, eben in Dinge umsetzt, die so aussehen wie das gewöhnliche Seelenleben. Aber es ist ein beträchtlicher Unterschied zwischen dem, was wahre Geistesforschung und, wenn man den Ausdruck anwenden will, wahres Hellsehen erlangt, und diesem im gewöhnlichen Leben oftmals auch «Hell-sehen» Genannten.
Und diesen gewaltigen Unterschied wird man merken, wenn man dasjenige nimmt, was gesagt worden ist: In aller Tätigkeit des Geistesforschers, in aller Tätigkeit des wahren Hellsehers steckt voll willentliche Tätigkeit drinnen, ist kein Element, bei dessen Zustandekommen man nicht dabei ist, während die Vision gerade das Eigentümliche hat, daß sie zustande kommt, ohne daß der Wille darin tätig ist. Und man kann sogar - trotzdem sich das für viele außerordentlich paradox ausnehmen wird - die Frage: Wodurch unterscheidet sich denn der Geistesforscher von dem gewöhnlichen Visionär, von dem Halluzionär? -damit beantworten, daß man sagt: Dadurch unterscheiden sie sich, daß eben der Geistesforscher nie in dem gewöhnlichen Sinne Visionen und Halluzinationen hat, daß er gerade durch seine Ausbildung in der Geisteswissenschaft über die Möglichkeit ganz hinauskommt, jemals Halluzinationen oder Visionen im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu haben. Und damit hängt es zusammen, daß das, was geistesforscherisches Erlebnis ist, sich - wie ich gesagt habe -nicht unmittelbar festsetzen darf in der menschlichen Organisation, sondern daß es immer wiederum neu erfahren werden muß.
Würde sich die geisteswissenschaftliche Erfahrung so, wie sie unmittelbar ist, im Organismus festsetzen, so könnte sie
allerdings zu einem illusionären Leben füliren, weil sie dann durch sich selbst aus dem Organismus aufsteigen, weil sie im Organismus haften und der Mensch die Gewalt darüber verlieren würde. Willentlich kann er immer nur bei der Erzeugung sein, wenn er jedesmal, ich möchte sagen, jungfräulich herantritt, wie er zum Beispiel an einen äußeren Eindruck herantritt. Und nur durch dieses jedesmalige jungfräuliche Herantreten an das geistige Erlebnis kann er wissen, daß er aus der geistigen Welt einen Eindruck hat, wie er durch das gewöhnliche Leben weiß, daß er, wenn er einen äußeren Gegenstand, etwa eine Uhr sieht, diese Uhr nicht halluziniert, sondern daß wirklich ein äußerer Eindruck vorliegt. Durch das, was sich zwischen ihm und der Uhr neuerdings abspielt, kann er dasjenige, was er jetzt in unmittelbarer Tätigkeit an der äußeren physischen Welt erlebt, von dem unterscheiden, was in ihm aufsteigt, was ihn etwa zu irgendeiner Halluzination oder Illusion zwingen könnte. Und wiederum nur dadurch, daß er sich gegenüber den geistigen Erlebnissen die eben geschilderte Jungfräulichkeit erhält, daß er sie wirklich nicht in die Leiblichkeit ein-preßt, sondern immer wieder von neuem macht, weiß er, daß er nicht dem, was aus seiner Organisation aufsteigt, gegenübersteht, sondern daß er immer objektiven Erlebnissen gegenübersteht, die aus einer geistigen Welt herauskommen. Und man lernt allerdings nun noch, wenn man wirklich auf die geschilderte Weise im lebendigen Erfassen der geistigen Welt drinnen steckt, jene innere Energie, jene innere Kraft, die man braucht, um willentlich, sagen wir, zur imaginativen Erkenntnis zu kommen, merkwürdigerweise als die gleiche Kraft erkennen, welche Illusionen und Halluzinationen vertreibt, durchschaut. Das ist es, worauf es ankommt. Nicht die Kraft, wodurch Halluzinationen entstehen, ruft man auf, sondern gerade diejenige Kraft, wodurch
man Illusionen und Halluzinationen und Wahnvorstellungen, und wie alle diese Dinge heißen mögen, zerstiebt.
Und so könnte man auch noch etwas anderes anführen, welches wiederum in ganz leicht begreiflicher Weise als ein Einwand gemacht werden könnte. Wenn derjenige, der in bezug auf diese Dinge noch Laie ist, davon hört, daß der Mensch, welcher seine geistigen Erlebnisse durch den Ausdruck «Farbenwelt» oder «Tonwelt» wiedergibt, wie Sie ja zum Beispiel in meiner «Theosophie» die Seelenwelt und die Geisteswelt in dieser Weise illustriert, als imaginative Welten geschildert finden, so könnte er sagen: Ja, wenn man also in die Lage kommen muß, in dieser Weise die geistige Welt als farbige Welt, als tönende Welt zu erkennen, gilt das alles auf der einen Seite als halluzinatorische, als visionäre Tätigkeit, als pathologische Zustände; auf der anderen Seite wissen wir aber auch - kann er einwenden -, daß derjenige, der blind geboren ist, durch keinen Vorgang der geistigen Schulung zu solchen Visionen, die in farbigen Bildern spielen, oder der taub geboren ist, zu solchen Gehörshalluzinationen gebracht werden kann. Und man kann daraus sehr leicht die Widerlegung formen, daß man sagt: Also haben wir es doch rein mit der Ausbildung von demjenigen zu tun, was doch an dem Vorhandensein gewisser Organe hängt.
Ein Einwand, der von diesem Gesichtspunkt aus gemacht wird, hat für den, der die Dinge durchschaut, gerade soviel Wert wie die Frage: Ob denn nun jemand, der ganz gute Gedanken hat, diese Gedanken in einer Sprache ausdrücken kann, die er augenblicklich nicht gelernt hat. Er kann die Gedanken natürlich nicht in einer Sprache ausdrücken, die er nicht gelernt hat, ganz selbstverständlich. So kann derjenige, der blind geboren ist, nicht in Farben zum Ausdruck
bringen, was er geistig erlebt. Deshalb kann er doch geistig genau dasselbe erleben, was der andere erlebt, der es in Farben auszudrücken vermag, das heißt, der es sich auch selber, in Farben illustriert, willentlich eben auf diese Art zum Ausdruck bringt. Es ist allerdings oftmals notwendig, daß man die Dinge wirklich genau kennen lernt, wenn man die Berechtigung oder Nicht-Berechtigung von Einwänden durchschauen will.
Wenn man nun aber die Dinge nicht nach ihrem inneren Charakter, nach ihrem inneren Wesen betrachtet, sondern danach, wie sie äußerlich auftreten, so wird man sehr leicht finden, daß es ja nun doch - wenn ich mich des trivialen Ausdrucks bedienen darf - recht verrückte Zwickel gibt, welche irgendeiner Bewegung angehören, die sich eine geistesforscherische nennt, und die einem mit allerlei Zeug kommen, das man mehr oder weniger wirklich in die Rubrik hineinbringen kann, welche der Psychiater sehr gut kennt. Wenn zum Beispiel irgend jemand an einen Psychiater herankommt und ihm erzählt, er wäre der wiedergeborene Johannes, so wird es jedenfalls ganz berechtigt sein, wenn der Psychiater sagt: Wir haben es mit einem gewöhnlichen Größenwahnsinnigen zu tun. Man hat es auch vom geisteswissenschaftlichen Standpunkte mit einem gewöhnlichen Größenwahnsinnigen aus dem Grunde zu tun, weil der wirklich wiedergeborene Johannes dies in einer solchen Form nicht aussprechen würde. Aber davon ganz abgesehen, muß man sich klar sein: wenn man es mit solchen Erscheinungen zu tun hat, die wirklich als krankhaft bezeichnet werden müssen, so kann man danach das Wesen der Sache nicht charakterisieren; denn man muß die ganze Art und Weise, wie sich Geistesforschung in unsere gegenwärtige Zeit hereingestellt hat, ins Auge fassen. Man muß sich klar sein darüber, daß heute eine Weltanschauungsrichtung
herrschend ist, die sehr, sehr viele Menschen aus verschiedenen Gründen unbefriedigt läßt. Ich brauche nicht auszuführen - denn das ist zu genau und zu weit bekannt-, warum verschiedene religiöse Weltanschauungsströmungen viele, viele Menschen heute unbefriedigt lassen. Ich brauche aber nur darauf aufmerksam zu machen, daß ja auch diejenigen Weltanschauungen, die sehr häufig auf dem sogenannten festen Boden der naturwissenschaftlichen Denkweise gebaut werden, viele Leute unbefriedigt lassen, und zwar aus einem zweifachen Grunde. Erstens zum Teil aus dem Grunde, weil ja derjenige, der sich die naturwissenschaftliche Denkweise aneignet, wirklich erkennt, daß in den naturwissenschaftlichen Ergebnissen, wie man sie so haben kann, in der Regel nicht die Antworten auf die großen Fragen liegen, sondern höchstens die Hinweise auf die Fragen selber. Naturwissenschaftliche Bücher werden für den, der die Sache genau sehen kann, in der Regel eigentlich nicht zu Antworten, sondern erst recht zu Fragen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber noch andere Gründe, warum der Aufbau einer Weltanschauung auf einer naturwissenschaftlichen oder überhaupt auf einer heute modernen Grundlage manchen unbefriedigt läßt. Da muß man schon sagen: Auf naturwissenschaftlicher oder historischer Grundlage sich heute eine Weltanschauung aufzubauen, dazu gehört sehr viel. Dazu gehört vor allen Dingen, daß man sich Mühe gibt, viele, viele Tatsachen und Tatsachen-Verkettungen kennen zu lernen. Man kann durchaus nicht immer sagen, daß derjenige, der sich nicht auf Grundlage der naturwissenschaftlichen Denkweise eine Weltanschauung aufbauen will, dies wirklich deshalb tut, weil er einsieht: es läßt sich nichts Befriedigendes, nichts leichthin Befriedigendes darauf aufbauen; sondern sehr häufig ist es einfach die Bequemlichkeit,
auch das Unvermögen, sich mit den nötigen Tatsachen und Tatsachen-Verkettungen bekannt zu machen. Man scheut zurück davor, mit der Schwierigkeit, die die heutige Wissenschaft allerdings bietet, für sich selber zurecht zu kommen. Und da stellt es sich denn heraus, daß sehr viele Menschen es bequemer finden, nicht den langen Weg der Vorbereitung zu gehen, der auf eine gewisse Wissenschaftlichkeit Anspruch macht, sondern bequemer finden, dasjenige aufzunehmen, was man ja in der Tat aufnehmen kann -manchmal als bloße Phrase, als schöne Redensart -, dasjenige, was auf irgendeine Art aus der Geisteswissenschaft heraus kommt. Es gefällt einem auch, weil es zunächst an das Persönliche anknüpft, was den Menschen persönlich unmittelbar interessiert. Es gefällt einem mehr, es befriedigt einen mehr, als wenn man bei der Natur anfängt und dann versucht, zu irgendeinem Verständnisse des Menschen heraufzukommen, soweit es sich aus der Naturwissenschaft gewinnen läßt. So hat man einen weiten und immer entsagungsvollen Weg zu gehen. Den will mancher meiden. Daher kommt es eben, daß Menschen, die eigentlich keine Möglichkeit haben, für ihre Befriedigung etwas zu gewinnen durch das, was die gegenwärtige Zeitbildung bietet, an die Geisteswissenschaft herankommen und daß sie dann in der Geisteswissenschaft nicht das ausbilden, was aus der Geisteswissenschaft kommt, sondern in die geistes-wissenschaftliche Weltenströmung hineintragen, was sie vorher in ihrem ganzen Organismus, in ihrer ganzen Seele haben.
Wenn nun jemand, der in seinen ganzen Affekten, in seinem ganzen emotionellen Leben etwas hat, was man, wenn man die Dinge äußerlich symptomatisch beschreibt, als Neigung zum Größenwahn bezeichnen kann - ich weiß sehr gut, daß ich damit nur ein Symptom ausdrücke-, so
kann es natürlich sehr leicht geschehen, daß diese Neigung zum Größenwahn nun hereingetragen wird in die geisteswissenschaftliche Bewegung. Und dann ist es ganz selbstverständlich, daß der Betreffende dasjenige, was er über den Menschen hört, in unmittelbaren Zusammenhang bringt, nun nicht in objektiver Weise mit dem Menschlichen, sondern mit demjenigen, was gerade er durch seine Neigung an Gefühlen, an Emotionen entwickelt. Und dann geschieht es eben, daß er es, wenn er das Gesetz der wiederholten Erdenleben kennen lernt, selbstverständlich sehr befriedigend findet, wenn er auf irgendeine Weise erträumen kann, er sei, sagen wir, der wiedergeborene Soundso. Da ist allerdings derjenige, der die Dinge vernünftig überlegt, sich ganz klar darüber, daß den Betreffenden das, was er selbst hineingebracht hat in die Geisteswissenschaft, zu einer solchen Idee gebracht hat und daß ihn nicht die Geisteswissenschaft zu dieser Idee gebracht haben kann. Und derjenige, der das in Betracht zieht, was nur als ganz kurze Andeutungen über den Weg der Geistesforschung im letzten Kapitel meiner «Theosophie» steht - er braucht gar nicht einmal mehr kennen zu lernen -, und der es dann noch wirklich ernst nimmt mit dem, was aus der heutigen offiziellen Psychiatrie, aus der anerkannten Psychiatrie zu gewinnen ist, der kann unmöglich zu der Idee kommen, daß aus dem geisteswissenschaftlichen Weg selber irgend etwas zur Erkrankung des Seelenlebens beigetragen werden kann. Umgekehrt aber können die geisteswissenschaftlichen Verrichtungen verzerrt, karikiert werden durch dasjenige, was in die Geisteswissenschaft hineingetragen wird durch Menschen, die eben die nötigen Anlagen dazu haben. Es könnte einer statt in die geisteswissenschaftliche Weltanschauungsströmung, sagen wir, ins Börsenleben hineinkommen, und er könnte solche Anlagen haben, die sich zum Größenwahn
ausbilden; dann würde er selbstverständlich seine größenwahnsinnigen Ideen in allerlei Vorstellungen ausleben, welche mit dem Börsenleben zusammenhängen. Er würde sich vielleicht als ein besonderer Börsenkönig vorkommen oder dergleichen. Kommt er statt ins Börsenleben in die geisteswissenschaftliche Weltanschauungsströmung hinein, so lebt er dieselben Anlagen aus, indem er sich, nun meinetwegen, für den wiedergeborenen Johannes hält.
Und so kann man sagen: Es leidet in einem gewissen Sinne die Geistesforschung selber unter der Tatsache, daß gerade viele Leute, die mit ihrem Weltanschauungsstreben gescheitert sind an dem, was sonst heute für das Weltanschauungsstreben geboten wird, in irgendeine geistesforscherische Strömung hineinkommen und dann dasjenige, was sie sonst in einer ganz anderen Weise ausgelebt haben würden, eben in allerlei geisteswissenschaftliche Ideen kleiden. Man kann nun leicht die Erfahrung machen, daß gerade in Kreisen, die sich aus Leuten zusammensetzen, welche sich wegen eines gescheiterten Weltanschauungsstrebens zu einer geistesforscherischen Richtung bekennen, viele gerade in dem Augenblick an die Geistesforschung herantreten, wo sie irre werden an dem, was ihnen die Außenwelt bieten kann. Nun denken Sie einmal, was da eigentlich für eine Tatsache auftritt. Vorher hat der Mensch gelebt mit seinen Anlagen, die selbstverständlich einmal zu irgendeiner Abnormität des Seelenlebens führen müssen. Diese Abnormität des Seelenlebens wäre ganz gewiß aufgetreten. Aber in dem Augenblick, wo sie noch kaschiert ist, wo er sich nun in der Außenwelt nicht mehr recht auskennt, wendet er sich zu irgendeiner geistesforscherischen Richtung. Die Folge davon ist, daß er selbst nicht in der Weise, wie ich es auch gleich andeuten werde, durch die geistesforscherische Richtung etwa gerettet werden kann,
sondern daß er dasjenige, was in ihm rumort, in die geistesforscherische Richtung hineinträgt. Und durch alle diese Tatsachen kann es gerade vorkommen, daß man, weil man auch sonst mit Mißgunst auf eine solche geistesforscherische Richtung sieht, ihr gewissermaßen in die Schuhe schiebt, daß sie solche Menschen seelisch krank gemacht habe. Selbstverständlich wird auf der einen Seite jeder gesunde Psychiater und jeder gesunde Geistesforscher sich über den wahren Vorgang ganz klar sein. Nun, um Weiteres auf diesem Gebiet zu verstehen, wird es gut sein, daß man noch einmal ins Auge faßt, wie die zwei Bewußtseinsarten, von denen gesprochen worden ist, sich wirklich nicht so verhalten müssen, daß das eine sich aus dem andern entwickelt, das eine das andere ersetzt, sondern daß sie nebeneinander bestehen, daß volles Bewußtsein vorhanden ist für zwei Seelenleben, die aber nicht auseinanderfallen. Diese zwei Seelen sollen nicht mehr bezeichnen als dasjenige, was schon im Konkreten charakterisiert ist. Das also muß man ins Auge fassen.
Nun kann man die Frage aufwerfen: Hat nun diese Geistesforschung als solche für das gewöhnliche Leben, für das äußerliche Leben in der physischen Welt irgend welche positive Bedeutung? Man könnte meinen, daß sie keine Bedeutung habe, denn es ist ja gerade gesagt worden: Unmittelbar kann dasjenige nicht ins gewöhnliche Bewußtsein einfließen, was in der geistigen Welt erlebt wird. Aber es kann zum Beispiel doch das Folgende eintreten. Es kann eintreten, daß der Mensch in der geistigen Welt dies oder jenes wahrnimmt, was ein moralischer Impuls ist, ein moralisches Motiv, das man nur aus der geistigen Welt erkennen kann. Es kann allerdings unsere moralische Anschauung aus der geistigen Welt heraus bereichert werden. Ebenso kann auf der anderen Seite unsere Naturanschauung
aus der geistigen Welt heraus bereichert werden. Nun, halten wir den Fall fest, daß man aus der geistigen Welt also durch eine geistige Erfahrung einen moralischen Antrieb erhält, das heißt einen Antrieb, dies oder jenes im ganz gewöhnlichen physischen Leben zu tun. Dann muß nach dem, was auseinandergesetzt worden ist, dieser moralische Antrieb, der zunächst in der geistigen Welt erlebt wird, herübergenommen werden ins gewöhnliche physische Bewußtsein und da gerechtfertigt werden, ja, so in die Welt hineingestellt werden, wie man sonst moralische Antriebe in die Welt hineinstellt. Damit wird alle Möglichkeit wegfallen, daß man etwa in der Welt auftritt und sagt: Ich muß jetzt dies oder jenes tun, denn dies ist meine Mission -eine Redewendung, die man sehr, sehr häufig hört gerade auf den Gebieten, die ich so nur charakterisieren konnte, daß ich sagte: Es wird Unfug getrieben damit. Die Motivierung aus der geistigen Welt heraus wird bei dem wahren Geistesforscher niemals in einer solchen Weise auftreten. Was er aus der geistigen Welt heraus empfängt, tritt in sein gewöhnliches Bewußtsein ein, und er stellt sich nun, indem er diejenigen Vorstellungen entwickelt, die angepaßt sind an die äußere physische Welt, mit seinem Willens-impuls in diese physische Welt hinein - ebenso, wie wenn man einen Impuls erhält, um irgendeinen naturwissenschaftlichen Zusammenhang zu erkennen. Man wird diesen naturwissenschaftlichen Zusammenhang nicht von vornherein wie eine Erleuchtung hinstellen, sondern ihn her-übernehmen ins gewöhnliche Bewußtsein, ihn am gesunden Menschenverstand und an all dem prüfen, was man bisher an Erkenntnissen hat auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, und wird nun anfangen, indem man ihn herüber-genommen hat, ihn in das System naturwissenschaftlichen Wissens hineinzustellen, das man sich ausgebildet hat.
Wenn man dies ins Auge faßt, dann wird niemals eintreten können, daß man in einen Zwiespalt, in eine Disharmonie kommt mit dem äußeren physischen Leben. In einen solchen Zwiespalt, in eine solche Disharmonie kann aber derjenige kommen, der sich auf Grundlage von zwangs-mäßig in ihm wohnenden, als Zwangstriebe in ihm wohnenden Impulsen diese Mission zuschreibt, die dann selbstverständlich, weil sie nur aus seinem Inneren heraus kommt, gar nicht angepaßt ist an die äußere Welt, möglichst schlecht in die äußere Welt hineinpassen wird. Er wird eher ein zerstörendes Individuum sein als ein solches, welches das Zusammenleben bereichern könnte durch dasjenige, was in der geistigen Welt erfahren werden kann. Mit allen diesen Dingen macht aber der Gang, der eingehalten wird auf dem Wege, der zur Geistesforschung führen soll, gründlich bekannt. Und man muß sagen: Alles dasjenige, was sich sonst an die geschilderte Übungsgruppe des Denkens und des Willens reiht, ist im wesentlichen dazu da, damit der Mensch auf der einen Seite wirklich nichts Ungesundes hinaufträgt in sein geistiges Leben aus dem gewöhnlichen physischen Leben, daß er wirklich frei werde mit seinem geistig-seelischen Erleben von dem Leibesleben, und daß er auf der anderen Seite nicht dasjenige, was auf geistigem Gebiet erfahren werden kann, dadurch karikiert, daß er es - statt in die gesunde Vernunft, in das normale Affekt-leben - ins krankhafte Affektleben, ins Pathologische her-einnimmt. Wenn aber in einer so gearteten gesunden Weise dasjenige entwickelt wird, was dem Erleben in der geistigen Welt eigentlich zu Grunde liegt, dann hat man nicht nur etwas Gesundes in dem geistesforscherischen Wege, sondern man hat etwas Gesundendes, man hat wirklich etwas, was den Menschen auch in bezug auf seine Gesundheitsverhältnisse weiterbringt. Aber es muß so verlaufen, wie ich es
heute geschildert oder wenigstens skizziert habe. Verwechslungen, die dann zu den mißlichsten Vorurteilen führen, werden immer auftreten.
So kommt die Geistesforschung zu einer tieferen Erfassung des menschlichen Inneren, zu einem Erschauen von mehr im menschlichen Inneren, als in diesem menschlichen Inneren mit der gewöhnlichen Seelenstimmung erschaut werden kann. Und man kann dann, wenn man das Wort nicht mißbraucht, eine solche Anschauung desjenigen, was im Inneren über das gewöhnliche Seelenleben hinaus lebt, eine mystische Anschauung des eigenen Inneren nennen. Man kann ein solches Leben ein Leben in Mystik nennen. Wiederum ist es ganz begreiflich, wenn derjenige, der diesen Dingen gegenüber Laie ist, sagt: Ja, eine Mystik kennen wir ganz gut; wir haben sie ganz gut kennen gelernt, nur bezeichnen wir sie mit dem Titel: mystisches Irresein. - Denn es gibt in der Tat einen pathologischen Zustand, der streng begrenzt werden kann, den man als mystisches Irresein bezeichnet, der in einer gewissen Weise aus rein pathologischen Untergründen heraus zu einer Seelenschau führt, die aber rein organisch-physiologisch ist, meinetwillen zu einem inneren Grübeln, in dem man dann dazu kommt, allerlei religiöse Schauungen, die visionärer Art sind, in seinem Inneren zu finden. Kurz, es gibt dasjenige, was man in der Psychiatrie mystisches Irresein nennt.
Derjenige, der auf dem gesunden Boden der Geistesforschung steht, wird nicht etwa auftreten und nun den Psychologen in Grund und Boden kritisieren wollen, obwohl es natürlich genug solcher Leute gibt, die glauben, auch von Geisteswissenschaft etwas zu verstehen. Er wird nicht sagen: Wo du von mystischem Irresein sprichst, da haben wir es mit einer gottgeheiligten Person zu tun, der mehr geoffenbart wird als anderen. Nein, der gesunde
Geistesforscher bezeichnet den mystisch Irren eben auch als mystisch Irren wie der Psychiater selber, gerade in demselben Sinn und auch mit derselben Vorsicht, auf die ich heute nicht einzugehen brauche. Mit Bezug auf alles dasjenige, was überhaupt gesunde, natürliche Berechtigung hat, da steht gesunde Geisteswissenschaft vollständig auf dem Boden gesunder Naturwissenschaft, leugnet nichts ab, was naturwissenschaftlich als berechtigt angenommen ist, auch nicht in solchen Dingen, die eben jetzt besprochen worden sind. Und so kann sich der Geistesforscher, ohne in Dilettantismus zu verfallen, wenn er die Dinge zu beurteilen vermag, ganz gut sachgemäß, positiv mit dem Psychiater einigen über alle pathologischen Erscheinungen, die äußerlich mit Irre-Symptomen bezeichnet werden, meinetwillen als mystisches Irresein, als religiöser Wahnsinn oder dergleichen. Niemals wird er ableugnen, daß diese Dinge vorhanden sind und im konkreten Fall da und dort auftreten.
Aber wenn nun wirklich mit innerer Energie wahre Geistesforschung getrieben wird, dann kommt man allerdings dazu, daß gewisse Arten des abnormen Seelenlebens durch das, was der Betreffende seelisch erlebt, auf die Art, wie es heute geschildert worden ist, geheilt, ausgeglichen werden. Wenn der Betreffende, der solche Übungen macht, auf die heute hingedeutet worden ist und wie sie in den genannten Büchern ausführlicher dargestellt sind, zur wahren Mystik kommt, zu dem, was einem objektiv in der menschlichen Seele als geistig-seelische Erfahrung entgegentreten kann, dann kann er vorher sogar Neigung, Disposition zu mystischem Irresein gehabt haben: das wird sich verlieren, das wird gerade korrigiert werden! Alle falsche Mystik wird in dem angedeuteten Sinne durch wahre Mystik vertrieben. Und es kann sogar viel weiter gehen. Dispositionen zu Größenwahn, Dispositionen zu anderen
Dingen können dadurch überwunden werden, daß man sich in dieser Weise in das geisteswissenschaftliche Leben hineinfindet. Gar nicht zu reden davon, daß allerdings, je stärker und stärker dieses Hineinleben in das Geistig-Seelische ist, die Energien, die da entwickelt werden, auch weiter, bis in das Leibesleben hinein, sich geltend machen können. Aber ich will auf dieses Kapitel, das ja nur im Einzelnen, Speziellen, besprochen werden kann, heute nicht eingehen. So hat das Hineinleben in die Geistesforschung auch auf diesem eingeschränkten Gebiete, von dem heute gesprochen worden ist - und das könnte eigentlich ja über alle Erscheinungen des krankhaften Seelenlebens in einer gewissen Weise ausgedehnt werden -, nicht nur etwas Gesundes, sondern es hat etwas Gesundendes. Und in diesem Sinne muß es auch verstanden werden. Immer muß man sich eben klar sein darüber, daß das, was als Geistesforschung auftritt, deshalb, weil es abweicht von den Erfahrungen des gewöhnlichen Seelenlebens, eben sehr leicht Verwechselungen mit dem abnormen Seelenleben unterliegen kann, und daß das abnorme Seelenleben auch selbst verwechselt werden kann - von seinem Träger selbstverständlich - mit demjenigen, was gesundes Seelenleben ist. Und da erfährt man ja auch bei den Trägern des abnormen Seelenlebens, indem sie sich in eine geistesforscherische Richtung hineinbegeben, die sonderbarsten Dinge. Es ist jetzt - um nur eines hervorzuheben - so viel in der Literatur vorliegend für die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Grade vorwärts zu kommen auf dem geistesforscherischen Wege, daß ihn unter Umständen jeder, und jeder gefahr-los, wenn er nur irgend die Vorschriften beachtet, anwenden kann. Nehmen wir nun an, jemand will vorwärtskommen. Es drängt ihn zunächst ein innerer Impuls, ein Trieb, vorwärts zu kommen. Es ist ja oftmals die Neugierde,
die Sensationslust, in die geistige Welt hineinzuschauen. Da tritt im Verlaufe seines Strebens sehr häufig das auf, daß er das nicht erreicht, was er sich anfangs vorstellt. Die Gründe, warum dies oder jenes nicht erreicht wird, die Gründe, warum dies oder jenes verkehrt erreicht wird, sind in den genannten Büchern genugsam auseinandergesetzt. Der Betreffende ist aber, weil er eben nicht wirklich hinein will in die geisteswissenschaftliche Weltanschauungsströmung, abgeneigt, zu sagen, daß er nicht vorwärts kommt oder daß er zu einer Karikierung von geistes-wissenschaftlicher Anschauung kommt, und gibt nicht zu, daß er dies oder jenes nicht beachtet hat, sondern er ist häufig geneigt zu sagen: Die Vorschriften haben die Schuld; ich bin zu dem oder jenem gekommen, was mir abnorm erscheint, die Vorschriften haben die Schuld oder derjenige, der die Vorschriften gegeben hat. Und es bildet sich besonders aus irgendeiner krankhaften Disposition sehr leicht der Glaube heraus, der sich charakterisieren läßt durch eine Art Verfolgungswahn gerade gegenüber demjenigen, der die Anleitung in irgendeiner Weise gegeben hat, um durch Übungen den Seelenweg in die geistige Welt hinein zu machen. Das ist eine sehr, sehr häufige Erscheinung, eine Erscheinung, die immer wieder vorkommt und die ausgenützt werden kann, weil man sich selbstverständlich auf das Zeugnis solcher Leute sehr leicht berufen kann. Ich will nicht auf einzelne Fälle hinweisen, sondern nur zeigen, wie dadurch, daß krankhaftes Seelenleben in die geisteswissenschaftliche Weltanschauung hineingetragen wird, in der Tat die geisteswissenschaftliche Weltanschauung als solche verkannt werden kann. Wenn man sich mit dieser geistes-wissenschaftlichen Weltanschauung bekannt machen will, wird man deshalb gut tun, sie da kennen zu lernen, wo sie ihrem Wesen nach erkannt werden kann.
Und da wird sich eben durchaus herausstellen, daß wahr ist, was ich in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?> gesagt habe, all das, was ich heute und was ich sonst geschildert habe: daß der Mensch zu gewissen erschütternden Erlebnissen kommt, die ihn in einer gewissen Weise aus dem Gleichgewicht bringen können, aber so aus dem Gleichgewicht bringen wie eine objektive Tatsache, nicht wie dasjenige, das aus dem Innern auftaucht. Aus all diesen Gründen kann es vorkommen, daß in verschiedenen Schriften, die von solchen Dingen handeln - ich habe das in dem genannten Buche ausgesprochen -, ja viel von den Gefahren gesprochen wird, die mit dem Aufstiege in die höheren Welten verbunden sind. Die Schilderungen, die da zuweilen von solchen Gefahren gemacht werden, sind wohl geeignet, ängstliche Gemüter nur mit Schaudern auf dieses höhere Leben blicken zu lassen. Doch muß gesagt werden, daß diese Gefahr nur dann vorhanden ist, wenn die nötigen Vorsichtsmaßregeln außer acht gelassen werden. Wenn dagegen wirklich alles beachtet wird, was wahre Geistesschulung an die Hand gibt, dann erfolgt der Aufstieg so, daß die Gewalt der Erscheinungen an Größe überragt, was die kühnste Phantasie sich ausmalen kann. Und wenn davon gesprochen wird, der Mensch lerne gleichsam an allen Ecken und Enden drohende Gefahren kennen, so muß er diesen Gefahren kühn und mutig ins Auge schauen. Es wird ihm möglich, sich solcher Kräfte und Wege zu bedienen, welche der sinnlichen Wahrnehmung entzogen sind. Und er wird von Versuchungen bedroht, sich gerade dieser Kräfte im Dienste eines eigensüchtigen, ungesunden Interesses zu bemächtigen oder aus Mangel an klarem Denken über die Verhältnisse der Sinneswelt in irrtümlicher Weise diese Kräfte zu verwenden. Aber von einem Hineinkommen in ein ungesundes
Seelenleben kann, wenn alle Regeln in der entsprechenden Weise wirklich beachtet werden, nicht gesprochen werden. Und wenn sie nicht in der entsprechenden Weise beachtet werden, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dasjenige nicht erreicht wird, was erreicht werden soll. Das hat die Geisteswissenschaft ja schließlich mit anderen Dingen im Leben auch gemein. Wenn jemand in der Schule etwas lernen soll und statt in die Schule immer hinter die Schule geht, so wird er auch nicht das erreichen, was in der Schule erreicht werden soll. Trotzdem dies ein sehr trivialer Vergleich ist, ist es doch ein treffender Vergleich.
Es könnte noch lange gesprochen werden über die verschiedenen Irrtümer und Vorurteile, welche der Geisteswissenschaft entgegengehalten werden können. Derjenige, der tief drinnensteht in dieser Geisteswissenschaft selber, der weiß, daß in ihr vieles anders ist, als man es heute in dem gewöhnlichen Bildungs- und Weltanschauungsleben gewöhnt ist. Vieles ist anders. So hat zum Beispiel jüngst einmal ein Kritiker über mein Buch «Theosophie> gesagt:
Nun ja, da werden verschiedene Dinge behauptet, die müßte man aber doch erst objektiv prüfen. - Wenn also da behauptet wird, man könne in der geistigen Welt dies oder jenes sehen, dann bestände die objektive Prüfung nach diesem Kritiker darin, daß fünf bis sechs Geistes-forscher nebeneinandergesetzt werden hüben und drüben und daß sie nun über ein und dieselbe Sache ihre geistesforscherischen Erlebnisse zum besten geben. Wenn sie übereinstimmen, sagt man dann vom Standpunkte dieses Kritikers aus, dann ist es selbstverständlich richtig. Der Mann hat das Buch «Theosophie» kritisiert. Aber wenn er es wirklich gelesen hat - und man ist fast versucht zu glauben, daß er ein so geschriebenes Buch überhaupt nicht zu verstehen in der Lage ist -, dann hätte er erkennen müssen,
daß von diesem Wege überhaupt nicht die Rede sein kann; daß die einzige richtige Prüfung aber möglich ist, indem er versucht, sich selber auf den geistesforscherischen Weg zu begeben. Da kann jeder nachforschen und wird finden, daß sich alles durch seine eigene Nachforschung bestätigt. Warum alles dies nur möglich ist, das habe ich in einer Anmerkung zur sechsten Auflage meiner «Theosophie» jüngst auseinandergesetzt. Aber man muß sich eben auf die Sache selber einlassen. Man muß sich heute schon einmal, ich möchte sagen, zu dem Gesichtspunkt erheben können, daß Geisteswissenschaft etwas ist, was zwar in wahrem, echtem Sinne eine Fortsetzung der naturwissenschaftlichen Denkungsweise ist, welche die Morgenröte der neueren Zeit gebracht hat; daß man aber gerade deshalb, weil sie ebenso, wie Naturwissenschaft in die sinnlichen Vorgänge, in die geistige Welt eindringen und deren Geheimnisse erforschen will, auch anders vorgehen muß als die bloß auf das Außere gerichtete naturwissenschaftliche Denkweise. Und wenn man dann die Sache selbst in dieser Art durchschaut, dann wird man finden, daß im Grunde genommen die Art, wie Geisteswissenschaft aufgenommen wird, sich doch wirklich hinsichtlich Verständnis und auch hinsichtlich Böswilligkeit gar nicht so sehr unterscheidet von der Art, wie andere Geistesbewegungen aufgenommen wurden, die den herkömmlichen Anschauungen ungewohnt waren, - denn nichts anderes als ungewohnt ist diese Geisteswissenschaft. Gewiß, derjenige, der zu den höheren Geist-Erlebnissen kommen will, hat einen langen, langen Weg durchzumachen, bevor er dahin kommen kann. Aber wir leben heute einmal in einer Zeit der Entwickelung der Menschheit, wo jeder bis zu einem gewissen Grade in sich selber das entwickeln kann, was ihn wenigstens zu der Überzeugung, zu der eigen errungenen Überzeugung kommen lassen kann, welches
Wesens der geisteswissenschaftliche Weg ist. Um zu verstehen, daß die geisteswissenschaftlichen Ergebnisse wahr sind, braucht man nur gesunden Menschenverstand zu haben; das ist oftmals hier betont worden. Denn derjenige, der sie erforschen kann, kann ihre Wahrheit selber erst durch den gesunden Menschenverstand, den er daneben haben muß, erkennen und bestätigt finden. Und der Naturwissenschaft gegenüber kann man eher sagen, daß einen Geisteswissenschaft zunächst zu den Fragen hinführt, die die Natur aufgibt, daß sie einem den ganzen Inhalt der Natur bereichert, als daß sie einen in einer philiströs pedantischen Weise in leichter Art abfertigte mit einem rasch zu findenden sogenannten «Sinn des Lebens». Sie findet schon den Sinn des Lebens, aber in einer anderen Weise, als man sich oftmals denkt.
Dasjenige also, was zum Verständnis der Geistesforschung notwendig ist, macht nicht notwendig, daß man nun selber einen weiten Weg macht, und auch dasjenige, wessen man in der Gegenwart sozusagen zur Sicherheit seiner Seele bedarf - zu jener Sicherheit, die man gewinnen kann, wenn man weiß, daß diese Seele durch Geburten und Tode geht, daß sie nicht der Zeitlichkeit, sondern der Ewigkeit angehört -, zu dem, dessen man so bedarf, braucht man allerdings auch nicht einmal an die Geistesforschung selber heranzutreten; sondern wenn der Geistesforscher schildert, was er erforscht hat und diese Schilderung sachgemäß gibt, dann hat man darin schon dasjenige, dessen man bedarf. Ich habe das hier oftmals schon erwähnt, es kann aber nicht oft genug wiederholt werden: Gerade so wenig, wie man einem Bilde gegenüber das Bedürfnis zu empfinden braucht, die Tatsache selbst einmal vor sich zu haben, sondern am Bilde Genüge findet, so handelt es sich darum, daß man für gewisse Seelenbedürfnisse wirklich genug in der Schilderung
hat, die derjenige gibt, der selbst Geistesforscher ist. Ja, dieser selbst kann das, was er für seine Seelenbedürfnisse haben will, nicht nur durch seine Geistesforschung haben, sondern auch dadurch, daß er es herausholt aus den geistigen Welten und hinunterträgt in die Welt, in der er selber lebt, indem er es für sich selber schildert. Daß es heute aber auch notwendig ist, auch jene Übungen anzugeben, durch die man gewisse Schritte in der Geistesforschung unternehmen kann, hängt ja nicht damit zusammen, daß etwa nur derjenige die Früchte der Geistesforschung haben kann, der in die geistige Welt selber hineingeht, sondern mit etwas ganz anderem hängt dies zusammen. Es hängt damit zusammen, daß allerdings die gegenwärtige Menschheit auf einem Punkt ihrer Entwickelung steht, wo sie die Dinge nicht bloß auf Autorität hinnehmen will, wo sie wirklich wenigstens bis zu demjenigen Grade zu einer Entwickelung kommen will, daß sie sagen kann: Ich kann auch bis zu einem gewissen Grade dann beurteilen, was der Geistesforscher sagt. - Deshalb wird die geistesforscherische Entwickelung schon den Weg nehmen, daß eine größere Anzahl von Personen sich finden werden, welche die ersten Schritte, die schon sehr weit führen, auf geistesforscherischem Gebiete unternehmen, um - ohne auf Autorität und nicht nur auf das bloße Wahrheitsgefühl hin, das für die Seelenbedürfnisse auch genügt - dasjenige annehmen zu können, was aus den geistigen Welten durch Geistesforschung herausgeholt wird. Für die Seelenbedürfnisse wäre Selbstforschung nicht nötig. Für die Bedürfnisse der Zeit aber wird sich Selbstforschung immer mehr und mehr herausbilden. Für die Bedürfnisse der Seele genügt es geradeso, dasjenige zu hören, was der Geistesforscher sagt, wie es genügt für den gewöhnlichen Menschen, wenn er gar nicht im chemischen Laboratorium chemische Versuche
macht, sondern die Ergebnisse der Chemie hinnimmt für das gewöhnliche Leben. Schlage sich nun jeder einmal an die Brust und sage sich, wieviel er von seinen naturwissenschaftlichen Anschauungen anders übernommen hat als auf Autorität hin. Zweifellos, niemals war im Grunde genommen, wenn man die Sache der Wahrheit nach betrachtet, der Autoritätsglaube ein so großer, wie gerade heute, trotzdem das manchem heute als ein vollständig paradoxer Ausspruch erscheint.
Wenn man alle diese Dinge in Erwägung zieht, so muß man sagen: Geisteswissenschaft muß allerdings etwas sein, was sich in die Geistesentwickelung der Menschheit, von der Gegenwart an in die Zukunft, hineinstellen will, nicht deshalb, weil sie sich diese Mission selber nur aus geistigen Welten zuschreibt, sondern weil man erkennen kann nach dem, was heute in der Menschheit als Bedürfnis lebt, was als Entwickelungsmöglichkeit lebt, daß Geisteswissenschaft ebenso ein notwendiges Produkt ist in der weiteren Fort-entwickelung, wie es der Kopernikanismus, wie es der Galileismus, wie es der Keplerismus in der Morgenröte der neueren Zeitentwickelung war. Wer diese Dinge durchschaut, der wird nicht verzweifeln können, auch nicht kleinmütig werden können gegenüber alle dem, was an Mißverständnissen der Geistesforschung entgegengebracht wird. Er wird nicht kleinmütig werden können, sondern er wird gerade, wenn er die großen Beispiele der Geschichte betrachtet, einsehen, wie immer wieder und wiederum allem, was sich als Neues einfügen muß in die geistige Entwickelung der Menschheit, Vorurteile entgegengebracht werden. Wie dem Kopernikanismus Vorurteile entgegengebracht werden mußten, wie er auf kirchlichem Gebiete sogar erst im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts geglaubt zu werden erlaubt wurde, so müssen im Grunde genommen
auch der Geisteswissenschaft Vorurteile entgegengebracht werden.
Aber derjenige, der den Gang der Wahrheit durch die menschliche geschichtliche Entwickelung ein wenig betrachtet hat, der weiß, daß die Wahrheit etwas ist, was der Menschenseele innig verwandt ist. Man kann die Wahrheit verkennen, aber wenn sie auch in einer Zeit, in einem Zeitalter so stark verkannt würde, daß sie zunächst verschwinden müßte, sie würde demnächst wiederum sich erheben! Denn sie hat Kräfte, durch die sie sich durch die engsten Spalten der Felsen von Vorurteilen im Entwickelungsgange der Menschheit hindurchdrängt. Man kann die Wahrheit hassen. Aber wer die Wahrheit haßt, wird im Grunde genommen nur sich selber benachteiligen können. Man kann die Wahrheit in irgendeinem Zeitalter zurückdrängen, aber die Wahrheit kann nicht vollständig unterdrückt werden, aus dem Grunde, weil sie - und das sei jetzt bildlich ausgesprochen - gewissermaßen die Schwester der menschlichen Seele ist. Die menschliche Seele und die Wahrheit sind Schwestern. Und wie zwischen Geschwistern zuweilen Zwietracht ausbrechen kann, aber immer wieder und wiederum Einigung kommen wird, wenn man sich des gemeinsamen Ursprungs in rechtem Sinne erinnert, so werden auch, wenn zwischen Menschenseele und der Wahrheit Zwietracht und Haß und Verkennung ausbricht, immer wieder Zeiten kommen, wo erkannt werden wird von beiden Seiten hey, wo bekräftigt werden wird von beiden Seiten her, daß Wahrheit und Menschenseele zusammengehören und einen Ursprung haben in dem urewigen Geiste der Welt. Deshalb wird sich derjenige, der solches durchschaut, was ich jetzt versuchte bildlich auszusprechen, mit Recht sagen können, was in einem Sprichworte liegt, mit dem ich diese heutigen Betrachtungen abschließen will, in einem jener
Sprichworte, von denen man sagt in gewissen Gegenden Deutschlands: Ein Sprichwort - ein Wahrwort. Ja, ein Sprichwort und ein Wahrwort ist es: Man kann die Wahrheit drücken, aber nicht zerdrücken!
ÖSTERREICHISCHE PERSÖNLICHKEITEN IN DEN GEBIETEN DER DICHTUNG UND WISSENSCHAFT Berlin, 10. Februar 1916
#G065-1962-SE315- Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben
#TI
ÖSTERREICHISCHE PERSÖNLICHKEITEN
IN DEN GEBIETEN
DER DICHTUNG UND WISSENSCHAFT
Berlin, 10. Februar 1916
#TX
Solche Betrachtungen wie die des heutigen Abends sollen Zwisdienbetraditungen sein in der fortlaufenden Darstellung, die hier sonst aus dem geisteswissensdiafllidien Gebiete heraus gegeben wird. Insbesondere möchte ich am heutigen Abend versuchen, einiges von dem weiter auszubauen, was ich angedeutet habe in der im vorigen Dezember gehaltenen Darlegung österreichischer Geistes- und Kulturverhältnisse. In unserer Zeit, in der durch schwere Ereignisse und Erlebnisse der Begriff Mitteleuropa, auch mitteleuropäisches Geistesleben, sich immer mehr und mehr als ein lebendiger herausbilden muß, scheint es ja wohl berechtigt zu sein, wenn auf die ja im besonderen doch weniger bekannten Verhältnisse des Geisteslebens Österreichs der eine oder der andere Blick geworfen wird.
Hermann Bahr, der ja in weitesten Kreisen bekannt ist als ein geistreicher Mann, als ein die mannigfaltigsten Gebiete des Schrifttums pflegender Mann, stammt, ich möchte sagen, aus einer urösterreichischen Gegend, aus Ober-Österreich, und hat in verhältnismäßig jungen Jahren Frankreich, Spanien, Rußland besucht, hat dazumal, wie ich wohl weiß, die Meinung gehabt, daß er das Wesen der französischen, ja, auch der spanischen Geisteskultur, der russischen Geisteskultur bis zu einem gewissen Grade treu darstellen könne. Er hat sich ja sogar so sehr in die spanische
Politik hineinbegeben, daß er, wie er damals versicherte, als er zurückgekommen ist, einen feurigen Artikel in Spanien geschrieben hat gegen den Sultan von Marokko. Nun, seit Jahrzehnten schon hält er sich nach seiner Weltwanderung in Österreich auf, tätig als Dramatiker, als Redakteur, als allgemeiner Kunstbetrachter, auch als Biograph zum Beispiel des so viel verkannten Max Burckhardt und so weiter. Ich habe bis in diese Tage zu verfolgen gesucht, was Hermann Bahr schreibt. In der letzten Zeit, ja eigentlich schon seit langer Zeit, findet man bei ihm ein Bestreben, das er oftmals selber so ausgedrückt hat, daß er sich auf der Suche befinde, Österreich zu entdecken. Nun denken Sie sich, der Mann, der glaubte, französisches, sogar spanisches Wesen zu kennen, der über russisches Wesen ein Buch geschrieben hat, geht dann in sein Heimatland zurück, ist ein solcher Angehöriger seines Heimatlandes, daß er bloß fünf Worte zu sprechen braucht, und man erkennt sogleich den Österreicher; dieser Mann sucht Österreich! Es scheint dies sonderbar. Es ist aber durchaus nicht so. Dieses Suchen stammt aus der ganz berechtigten Empfindung, daß ja im Grunde genommen auch für den Österreicher Österreich, österreichisches Wesen, ich möchte sagen, österreichische Volkssubstanz nicht ganz leicht zu finden ist. Ich möchte an einigen typischen Persönlichkeiten einiges darstellen von diesem österreichischen Volkstum, insofern es sich im österreichischen Geistesleben auslebt.
Viele Menschen waren in der Zeit, als ich noch jung war, der Ansicht, der damals berechtigten Ansicht, daß man bei Betrachtungen über Kunst, Kunstwesen, Literatur, Geistes-entwickelung zu sehr den Blick in die Vergangenheit richte. Insbesondere tadelte man viel herum an der wissenschaftlichen Kunst- und Literaturgeschichte, für die irgendeine Persönlichkeit erst dann gilt, wenn sie nicht einmal vor
Jahrzehnten, sondern vor Jahrhunderten gelebt hat. Die Betrachtungen konnten sich dazumal wenig aufschwingen zu der unmittelbaren Anschauung der Gegenwart. Ich glaube, daß man heute etwas Entgegengesetztes empfinden könnte: In dem, was so gang und gäbe ist an Betrachtungen über Kunst und Künstler, erleben wir jetzt oft, daß ein jeder mehr oder weniger die Welt bei sich selbst anfangen läßt oder bei seinen unmittelbaren Zeitgenossen. Ich möchte hier nun nicht die Gegenwart des österreichischen Geisteslebens betrachten, sondern ein allerdings nicht weit zurückliegendes Zeitgebiet. Ich möchte auch nicht in beschreibender Weise vorgehen. Mit Beschreibungen hat man immer Recht und immer Unrecht zugleich. Man trifft die eine oder die andere Schattierung dieser oder jener Tatsache oder Persönlichkeit, und sowohl derjenige, der zustimmt, wie derjenige, der widerlegt, wird bei allgemeiner Charakteristik, bei allgemeinen Beschreibungen zweifellos Recht haben. Ich möchte vielmehr symptomatisch schildern. Ich möchte einzelne Persönlichkeiten herausgreifen und bei diesen Persönlichkeiten wiederum Züge, an denen so manches veranschaulicht werden kann, was im österreichischen Geisteswesen lebt. Man verzeihe mir, wenn ich von einer mir nahestehenden Persönlichkeit ausgehe. Ich glaube allerdings, daß das Nahestehen mich in diesem Fall nicht hindert an einer objektiven Beurteilung der betreffenden Persönlichkeit. Aber ich glaube andererseits, daß mir damit eine solche Persönlichkeit im Leben gegenübergetreten ist, die in einer gewissen Beziehung außerordentlich charakteristisch ist für Österreichs Geistesleben.
Als ich 1879 an die Wiener Technische Hochschule kam, da versah das Fach, das ja dort selbstverständlich wie ein Nebenfach vertreten wurde, die deutsche Literaturgeschichte, Karl Julius Schröer. Er ist wenig bekannt geworden und
von denjenigen, die ihn kennengelernt haben, viel verkannt worden. Ich glaube nun durchaus, daß er zu denjenigen Persönlichkeiten zählt, die verdienen, in der Geistesgeschichte Österreichs fortzuleben. Ein bedeutender Literaturhistoriker hat allerdings einmal in einer Gesellschaft, bei der ich neben ihm saß, sich sonderbar über Karl Julius Schröer ausgesprochen. Es war die Rede von einer deutschen Fürstin, und der betreffende Literarhistoriker wollte sagen, daß die deutsche Fürstin, so begabt sie sonst auch sei, doch manchmal, wie er sich ausdrückte - allerdings in ihren literarischen Urteilen -, «sehr daneben hauen könne»; und als Beispiel führte er an, daß sie Karl Julius Schröer für einen bedeutenden Mann halte. Schröer trat um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts an einem bedeutsamen Punkte des österreichischen Geisteslebens, in Preßburg, an einem evangelischen Lyzeum als Lehrer der deutschen Literaturgeschichte auf. Später versah er dann dasselbe Fach an der Budapester Universität. Karl Julius Schröer war der Sohn Tobias Gott fried Schröers, der in dem vorigen Vortrag über Österreichertum von mir erwähnt worden ist. Tobias Gottfried Schröer war im Grunde auch eine für Österreich außerordentlich bedeutsame Persönlichkeit. Er hatte das Preßburger Lyzeum begründet und wollte dieses Lyzeum zu einer Pflegestätte deutschen Geisteswesens machen. Was er sich vorgesetzt hatte, war, denjenigen Deutschen Österreichs, die mitten in anderer Bevölkerung saßen, das volle Bewußtsein ihres Wesens als Zugehörigen zum deutschen Geistesleben voll zum Bewußt-sein zu bringen.
Tobias Gottfried Schröer ist eine Persönlichkeit, die einem geistesgeschichtlich so entgegentritt, daß man eine gewisse Rührung empfinden möchte, denn man hat immer das Gefühl: wie es doch in der Welt möglich ist, daß ein bedeutender
Geist durch die Ungunst der Zeitverhältnisse völlig unbekannt bleiben kann, völlig unbekannt insofern man «bekannt sein» das nennt, daß man weiß, diese oder jene Persönlichkeit hat existiert und hat dieses oder jenes geleistet. Allerdings, die Leistungen Tobias Gottfried Schröers sind durchaus nicht unbekannt und auch nicht ungeschätzt geblieben. Ich will nur hervorheben, daß schon 1830 Tobias Gottfried Schröer ein sehr interessantes Bühnenstück, «Der Bär», geschrieben hat, das in seinem Mittelpunkt die Persönlichkeit des Zaren Iwan IV. hat, und daß Karl von Holtei von diesem Drama gesagt hat, daß Schröer, wenn die dargestellten Charaktere seine Schöpfungen seien, etwas außerordentlich Bedeutsames geleistet habe. Und sie waren bis auf Iwan IV. Schröers Erfindung. Allerdings, der besonnene Mann, der durchaus nicht irgendwie radikal gesinnte Tobias Gottfried Schröer, hatte einen Fehler. Man konnte dazumal die Leute das, was er schrieb, sozusagen nicht lesen lassen, das heißt, diese Ansicht war bei der Zensur vorhanden. Und so kam es denn, daß er seine Werke alle im Auslande drucken lassen mußte und daß man ihn als den bedeutenden dramatischen Dichter, der er war, eben durchaus nicht kennen lernen konnte. Er schrieb 1839 ein Drama «Leben und Taten des Emmerich Tököly und seiner Streitgenossen». In diesem Werke tritt einem in einem großen historischen Gemälde alles entgegen, was an Geistesströmungen in Ungarn zu jener Zeit vorhanden war. Und in der Gestalt Tökölys selber tritt einem entgegen, was Kritiker der damaligen Zeit mit Recht einen ungarischen Götz von Berlichingen genannt haben, nicht so sehr, weil Tököly ein Götz von Berlichingen genannt werden mußte, sondern weil es Schröer gelang, Tököly in einer so anschaulichen Weise auf die Beine zu stellen, daß sich die dramatische Figur Tökölys nur mit dem Götz von Berlichingen
vergleichen ließ. Nur durch merkwürdige Verwechselung kam es zuweilen, daß Tobias Gottfried Schröer anerkannt wurde. So zum Beispiel schrieb er eine Schrift «Über Erziehung und Unterricht in Ungarn». Diese Schrift wurde von vielen als etwas Außerordentliches angesehen. Aber sie wurde auch verboten, und es wurde darauf aufmerksam gemacht, was eigentlich dieser Verfasser - der im Grunde genommen der ruhigste Mann der Welt war - für ein gefährlicher Mensch sei. Aber der Palatin von Ungarn, Erzherzog Joseph, las diese Schrift. Nun legte sich der Sturm, der sich über diese Schrift erhoben hatte. Da erkundigte er sich nach dem Verfasser. Den wußte man nicht. Aber man mutmaßte, daß es der Rektor einer ungarischen Schule sei. Und Erzherzog Joseph, der Palatin von Ungarn, nahm sogleich den Mann - es war nicht der rechte! - ins Haus zum Erzieher seines Sohnes. Auch eine Anerkennung einer Persönlichkeit! Solche Dinge sind gerade mit Bezug auf diese Persönlichkeit manche passiert. Denn diese Persönlichkeit ist dieselbe, welche unter dem Namen Christian Oeser allerlei Schriften geschrieben hat, welche viel verbreitet worden sind: eine «Ästhetik für Jungfrauen», eine «Weltgeschichte für Töchterschulen». Wenn Sie diese «Weltgeschichte für Töchterschulen» eines protestantischen Verfassers lesen, so werden Sie es gewiß recht auffällig finden, und doch ist es wahr, daß sie einmal sogar in einem Nonnen-kloster als die entsprechende Weltgeschichte eingeführt worden ist - wahrhaftig, in einem Nonnenkloster! Der Grund dazu war der, daß dem Titelblatt gegenüberstehend sich ein Bild der heiligen Elisabeth befindet. Ich überlasse es Ihnen, etwa zu glauben, daß die Freisinnigkeit der Nonnen etwas dazu beigetragen haben könnte zur Einführung dieser «Weltgeschichte für Töchterschulen» gerade in einem Nonnenstift.
Aufgewachsen in der Atmosphäre, die von diesem Manne ausstrahlte, war nun Karl Julius Schröer. Karl Julius Schröer war in den vierziger Jahren an die damals im Auslande berühmtesten deutschen Universitäten gegangen, nach Leipzig, Halle und Berlin. 1846 kehrte er zurück. In Preßburg, an der Grenze zwischen Ungarn und dem deutschen Österreich, an der Grenze aber auch zwischen diesen Gebieten und wiederum slawischem Gebiet, übernahm er zunächst den deutschen Literaturunterricht am Lyzeum seines Vaters und versammelte um sich alle diejenigen, die dazumal deutschen Literaturunterricht aufnehmen wollten. Nun ist es charakteristisch, mit welchem Bewußtsein, mit welcher Gesinnung zunächst Karl Julius Schröer, dieser Typus eines Deutsch-Österreichers, seine damals ja kleine Aufgabe anfaßte. Er hatte sich mitgebracht aus seinem Studien-gange, den er in Leipzig, Halle und Berlin absolviert hatte, ein Bewußtsein von deutschem Wesen, ein Wissen von dem, was aus dem deutschen Geistesleben im Laufe der Zeit nach und nach hervorgequollen war. Danach hatte er in sich die Anschauung gefaßt: Dieses deutsche Wesen ist für die neuere Zeit und für die Kultur der neueren Zeit etwas, was sich nur vergleichen läßt mit dem Wesen der Griechen für das Altertum. Nun fand er sich - ich möchte sagen, angefüllt von dieser Gesinnung - mit seiner Aufgabe, die ich eben charakterisiert habe, nach Österreich hineingestellt, dazumal wirkend für die Erhöhung, für die Erkraftung des deutschen Bewußtseins derjenigen, die in der Mannigfaltigkeit der Bevölkerung durch dieses deutsche Bewußtsein ihre Kraft bekommen sollten, um in der rechten Weise sich hineinstellen zu können in die ganze Mannigfaltigkeit des Volkslebens Österreichs. Nun kam ihm nicht nur das deutsche Wesen wie das alte griechische Wesen vor, sondern Österreich selber verglich er wiederum - 1846 war das -
mit dem alten Mazedonien, mit dem Mazedonien Philipps und Alexanders, das griechisches Wesen nach dem Osten hinüber zu tragen hatte. So faßte er nun das auf, was er im Kleinen zu leisten hatte. Ich möchte Ihnen einzelne Aussprüche aus den Vorträgen, die er dazumal am Lyzeum in Preßburg gehalten hat, zur Verlesung bringen, damit Sie sehen, aus welchem Geiste Karl Julius Schröer seine kleine, aber von ihm weltgeschichtlich genommene Aufgabe faßte. Er sprach über die Gesinnung, aus der er deutsches Wesen erklären, darstellen und denen, die ihm zuhörten, zu Herzen und zur Seele bringen wollte. «Von diesem Standpunkte aus», sagte er, «verschwanden natürlich die einseitigen Leidenschaften der Parteien vor meinem Blicke:
man wird weder einen Protestanten noch einen Katholiken, weder konservativen noch subversiven Schwärmer hören und einen für deutsche Nationalität Begeisterten, nur insofern als durch dieselbe die Humanität gewann und das Menschengeschlecht verherrlicht wurde!» Mit diesen Empfindungen im Herzen ließ er nun sich aufrollen die Entwickelung des deutschen Literaturlebens, die Entwickelung der deutschen Dichtung seit den Zeiten des alten Nibelungenliedes bis in die nach-Goethesche Zeit hinein. Und das sprach er offen aus: «Wenn wir den Vergleich Deutschlands rnit dem antiken Griechenland und der deutschen mit den griechischen Staaten verfolgen, so finden wir eine große Ähnlichkeit zwischen Österreich und Mazedonien. Wir sehen die schöne Aufgabe Österreichs in einem Beispiele vor uns: den Samen westlicher Kultur über den Osten hin auszustreuen.>
Nachdem er solche Sätze ausgesprochen hatte, ließ Karl Julius Schröer den Blick über die Zeiten schweifen, in denen das deutsche Wesen infolge verschiedener Ereignisse von anderen Völkern ringsumher gründlich verkannt worden
ist. Darüber sprach er sich so aus: «Der deutsche Name wurde gering geachtet von den Nationen, die ihm so viel zu danken hatten; der Deutsche wurde damals in Frankreich geradezu Barbaren gleichgeschätzt.» 1846 zu seinen Zuhörern am deutschen Lyzeum in Preßburg gesprochen! Aber demgegenüber lebte in Karl Julius Schröer der ganze Enthusiasmus, die ganze Begeisterung für das, was er, man könnte sagen, als deutsche Geistessubstanz ansah nicht für das, was man im ethnographischen Sinne bloß die Nationalität nennt, sondern für das Geistige, das all dasjenige durchtränkt, was deutsches Wesen zusammenhält.
Ich führe einzelne Aussprüche Karl Julius Schröers aus dieser jetzt schon lange hinter uns liegenden Zeit aus dem Grunde an, um zu zeigen, wie eigentümlich gerade in hervorragenderen Geistern dasjenige lebt, was man Sich-Bekennen zur deutschen Nationalität nennt. Im Grunde genommen müssen wir uns durchaus vorhalten, daß die Art und Weise, wie der Deutsche zu seiner Nationalität steht, von den anderen Nationalitäten Europas gar nicht verstanden werden kann, denn es ist grundverschieden von der Art, wie die anderen Nationalitäten zu dem stehen, was sie ihre Nationalität nennen. Wenn man gerade bei den hervorragenderen, tiefer empfindenden Deutschen sich umsieht, findet man, daß sie im besten Sinne dadurch Deutsche sind, daß sie Deutschtum sehen in dem, was geistig durchpulst, aber auch als von diesem Geistigen tingierte Kraft das durdipulst, was sich zum Deutschtum zählt; daß ihnen das Deutschtum etwas wie ein Ideal ist, etwas, zu dem sie hinaufblicken, das sie nicht bloß als Volksorganismus ansehen. Und darinnen liegen viele von den Schwierigkeiten, warum deutsches Wesen - auch in unseren Tagen, und besonders in unseren Tagen - so mißverstanden, so gehaßt wird. Solche Deutsche wie Karl Julius Schröer wollen
ihr Deutschtum sich erringen durch Erkenntnis, dadurch sich erringen, daß sie Einblick gewinnen in die Lebens- und Wirkensmöglichkeiten, die der lebendige Organismus einer Nation darbietet. Und immer wieder schweift der Blick Karl Julius Schröers nicht in Hochmut, sondern in Bescheidenheit hinauf zu der Frage: Welche welthistorische Sendung in der Entwickelung des Menschengeschlechts hat dasjenige zu erfüllen, was man in diesem besten Sinne des Wortes Deutschtum und deutsches Wesen nennen kann? Und vor der Weltgeschichte will es gerechtfertigt sein, was sich an Anschauungen über deutsches Wesen aufbaut. Vieles könnte noch gesagt werden über diese besondere Stellung gerade solcher Geister zum deutschen Wesen. So sagt Karl Julius Schröer einmal aus dieser Gesinnung heraus: «Man nennt die Weltepoche, die mit dem Christentum beginnt, auch die germanische Welt; denn obwohl auch die anderen Völker an der Geschichte großen Anteil haben, so sind doch fast alle Staaten Europas von Germanen gegründet... » -das ist eine Wahrheit, welche man jedenfalls heute außerhalb der deutschen Grenzpfähle nicht gerne - nun, hören tut man sie ja nicht -, aber sich nicht gerne zum Bewußtsein bringt - ... . Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Österreich, selbst Rußland, Griechenland, Schweden und so weiter, sind von Germanen gegründet und von deutschem Geiste durchdrungen.»
Und dann führt Karl Julius Schröer für seine Zuhörer einen Ausspruch eines deutschen Literarhistorikers, Wackernagel, an: «Durch ganz Europa floß nun...» - nämlich nach der Völkerwanderung - «Ein germanisches Blut, rein, oder römisch-keltisches verquickend, floß nun Ein germanischer Lebensgeist, nahm den Christenglauben... auf seine reineren, stärkeren Fluten und trug ihn mit fort.» Es war damals keine Zeit, in welcher so wie heute der Haß
Europas herausgefordert hätte, solche Anschauungen darzulegen. Es waren Anschauungen, die in grundehrlicher Weise aus der Betrachtung des deutschen Wesens bei diesem Geiste folgten. Und so drückte er sich aus: «Die Kulturvölker Europas sind Eine große Familie und ein einziger großer Gang der Nationen Europas ist es, der durch alle Irrtümer hindurch zur Quelle der Wahrheit und wahrhaften Kunst zurückführt, auf dem alle Nationen die Deutschen begleiten, oft überholen, am Ende aber eine nach der anderen hinter ihnen zurückbleiben. Die romanischen Völker sind gewöhnlich die Ersten in Allem: Italiener, dann Spanier, Franzosen, dann kommen die Engländer und Deutschen. Bei Einem dieser Völker kulminiert gewöhnlich eine jede Tendenz der Zeiten. Doch hat in letzter Zeit in Kunst und Wissenschaft auch den Engländern schon ihr Stündchen geschlagen...» - 1846, allerdings mit Bezug auf die Entwickelung des Geisteslebens gesagt und gemeint - ... . und die Zeit ist angebrochen, wo die deutsche Literatur sichtbar über Europa zu herrschen beginnt, wie vordem die italienische und französische!»
So war der Mann hineingestellt in seine österreichische Heimat. Und da ich ihm später sehr nahegetreten bin, weiß ich es wohl, daß sie ihm nichts, aber auch gar nichts war, das irgendwie mit dem Wort bezeichnet werden könnte:
er hätte die Herrschaft irgendeiner Nation über die andere gewollt - auch innerhalb Österreichs nicht. Wenn man solche Gesinnung, wie sie Karl Julius Schröer hatte, eine nationale nennen will, so ist sie vereinbar mit dem Geltenlassen einer jeden Nationalität, insofern sich diese Nationalität aus dem Keim, aus dem Quell ihres eigenen Wesens heraus wiederum neben anderen geltend machen will und diese anderen nicht beherrschen will. Nicht darum war es ihm zu tun, Vorherrschaft des deutschen Wesens über irgendeine andere Nationalität
oder über ein berechtigtes nationales Bestreben zu kultivieren, sondern darum, innerhalb des deutschen Wesens zur vollen Entfaltung zu bringen, was innerhalb dieses deutschen Wesens veranlagt ist. Und das ist das eigentümliche gerade dieses Mannes, daß er mit seinem ganzen ästhetischen Empfinden, mit seinem ganzen Fühlen, künstlerischen Fühlen, volkstümlichen Fühlen, aber auch mit seinem wissenschaftlichen Streben sich hineinverflochten fühlte in dasjenige, was im österreichischen Volkstum lebte. Er wurde gewissermaßen ein Betrachter dieses österreichischen Volkstums.
Und so sehen wir, daß er in den fünfziger Jahren schon aus inniger Liebe zum Volke jene wunderbaren deutschen Weihnachtsspiele, die sich in der deutschen Bevölkerung Ungarns erhalten haben, sammelt, «Deutsche Weihnachts-spiele aus Ungarn» herausgibt, jene Weihnachtsspiele, welche in den Dörfern gespielt werden zur Weihnachtszeit, zur Dreikönigszeit. Merkwürdige Spiele! Gedruckt sind sie eigentlich erst worden - und Schröer war einer der ersten, der derlei Dinge drucken ließ - in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Sie haben sich von Geschlecht zu Geschlecht in der bäuerlichen, in der ländlichen Bevölkerung erhalten. Vieles ist seitdem an solchen Weihnachts-spielen in den verschiedensten Gegenden gesammelt worden, viel ist darüber geschrieben worden. Mit solch inniger Liebe, mit solch intimem Verbundensein mit dem Volkstum, wie Karl Julius Schröer dazumal seine Einleitung zu den «Deutschen Weihnachtsspielen aus Ungarn» geschrieben hat, ist kaum irgend etwas nachher auf diesem Gebiete geschrieben worden. Er zeigt uns, daß sich immer Manuskripte vom Spiel von Geschlecht zu Geschlecht erhalten haben, wie sie eine heilige Handlung waren, auf die man sich wohl vorbereitete in den einzelnen Dörfern, wenn die
Weihnachtszeit herankam; wie wochenlang diejenigen, die ausgesucht wurden zu spielen, das heißt herumzugehen im Dorfe und in den verschiedensten Lokalen dem Volke diese Spiele vorzuspielen, in denen die Erschaffung der Welt, die biblische Geschichte des Neuen Testaments, das Auftreten der drei Könige und dergleichen dargestellt wurde. Schröer schildert, wie diejenigen, die sich vorbereiteten auf solche Spiele, wochenlang sich nicht nur durch Auswendiglernen, durch Eintrichtern von seiten irgendeines Regisseurs vorbereiteten, sondern wie sie sich vorbereiteten durch gewisse Regeln; wie sie wochenlang keinen Wein tranken, wie sie wochenlang andere Vergnügungen des Lebens unterließen, um gewissermaßen die rechten Gefühle zu haben, um in solchen Spielen auftreten zu dürfen. Wie deutsches Wesen das Christentum aufgenommen hat, man sieht es gerade, wie dieses Christentum in diese merkwürdigen Spiele eingeflossen ist, die ja zuweilen derb, die aber immer tief zu Herzen sprechend und außerordentlich anschaulich sind. Später haben, wie gesagt, auch andere diese Dinge gesammelt; allein keiner ist mehr mit einer solchen Hingabe seiner Persönlichkeit, mit einem solchen Verbundensein mit dem, was sich da auslebt, herangetreten wie Karl Julius Schrö er, wenn auch seine Darstellungen heute, wissenschaftlich genommen, längst veraltet sind.
Dann wandte er sich zur Betrachtung des deutschen Volkstums, wie es überall ausgebreitet ist in dem weiten Gebiete Österreich-Ungarns, des deutschen Volkstums, wie es im Volke lebt. Und zahlreiche Abhandlungen sind von Karl Julius Schröer vorhanden, in denen er dieses Volkstum darstellt nach seiner Sprache, nach seinem durch die Sprache sich ausdrückenden Geistesleben. Wir haben ein Wörterbuch, eine Darstellung der Mundarten des ungarischen Berglandes, derjenigen Gegend, die am Südhange der
Karpathen damals durch deutsche Ansiedler besiedelt war, die es auch heute noch ist, obwohl das Gebiet zum großen Teil magyarisch ist. Wir haben mit ungeheurer Liebe durch Karl Julius Schröer, ich möchte sagen, jedes Wort aufgezeichnet, welches dem Dialekt dieser Gegend anklingt; aber wir haben es immer so aufgezeichnet, daß man aus seinen Darstellungen entnimmt, wie sein Interesse darauf ausgegangen ist, zu suchen, welches die Kulturaufgabe, welches die besondere Art und Weise des Lebens war bei dem Volke, das, von weither kommend, zu einer gewissen Zeit sich da nach Osten hineindrängen mußte, um mitten unter anderer Bevölkerung zeitweilig sein eigenes Volkstum zu pflegen, später sich daran zu erinnern, um dann in anderem Volkstum nach und nach aufzugehen. Was Schröer auf diesem Gebiete geleistet hat, wird vielfach für kommende Zeiten etwas darstellen wie wunderschöne Erinnerungen an das Ferment, das deutsches Wesen im weiten Österreich gebildet hat.
Später kam Karl Julius Schröer dann nach Wien. Er wurde Direktor der evangelischen Schulen und später Professor der deutschen Literaturgeschichte an der Wiener Technischen Hochschule. Und wie er auf diejenigen zu wirken verstand, die empfänglich waren für die Darlegung unmittelbar empfundenen Geisteslebens, das habe ich selber erlebt. Dann wandte er sich immer mehr und mehr Goethe zu, lieferte dann seinen, in mehreren Auflagen erschienenen «Faust»-Kommentar und schrieb 1875 eine Geschichte der deutschen Dichtung, die viel angefeindet worden ist. Sie wurde zum Beispiel dazumal, nachdem sie erschienen war, eine Literaturgeschichte aus dem Handgelenk genannt. Eine Literaturgeschichte nach den Methoden, die dann in der Schererschen Schule üblich geworden ist, ist die Schröersche Literaturgeschichte allerdings nicht. Aber sie ist eine
Literaturgeschichte, in der sonst nichts steht als dasjenige, was der Verfasser erlebt hat, erlebt hat an den dichterischen Werken, an der Kunst, an der Entwickelung des deutschen Geisteslebens im neunzehnten Jahrhundert bis zu seiner Zeit; denn das wollte er damals darstellen. Der ganze Lebens- und geistige Entwickelungsgang Karl Julius Schröers kann nur beurteilt werden, wenn man die durch das österreichische Wesen bedingte Art von Schröers ganzer Persönlichkeit ins Auge faßt, das wissenschaftlich Künstlerische in unmittelbare Verbindung zu bringen, ja, in unmittelbarer Verbindung mit dem Volkstum zu erleben, jenem Volkstum, das insbesondere in Österreich, ich möchte sagen, an jedem Punkte seiner Entwickelung ein Problem aufgibt, wenn man solche zu erleben und zu beobachten nur versteht. Und man muß oftmals, vielleicht auch im Auslande, nachdenken: Ist dieses Österreich eine Notwendigkeit? Wie stellt sich dieses Österreich eigentlich hinein in die Gesamt-entwickelung der europäischen Kultur?
Nun, wenn man dieses Österreich so ansieht, erscheint es eben als eine Mannigfaltigkeit. Viele, viele Nationen und Volkstümer aneinander grenzend, durcheinander geschoben, finden sich dort, und das Leben des Einzelnen wird durch diese Untergrundlagen eben auch schon als Seelen-leben, als ganzes Persönlichkeitsleben vielfach ein kompliziertes. Dasjenige, was jetzt von einem Volk in das andere spielt, was dadurch an Nichtverstehen und wiederum Verstehenwollen und an Schwierigkeiten des Lebens zutage tritt, es tritt einem ja, mit anderen geschichtlichen Bedingungen des österreichischen Lebens verquickt, auf Schritt und Tritt in Österreich entgegen. Es gibt einen Dichter, der mit großer, aber, ich möchte sagen, bescheidener Genialität verstand darzustellen gerade etwas von dieser Art des österreichischen Wesens. Man sah ihn am Ende der achtziger, in
den neunziger Jahren in Wien zuweilen auftreten, wenn man in das in Wien und auch in gewissen sonstigen literarischen Kreisen berühmte Café Griensteidl kam. Ja, dieses Café Griensteidl gehört im Grunde genommen zur österreichischen Literatur; so sehr, daß ein Schriftsteller, Karl Kraus, als es abgerissen worden ist, eine Artikelserie geschrieben hat: «Die demolierte Literatur». Heute liest man ja vielfach noch wie von einem schönen Angedenken von diesem Café Griensteidl. Verzeihen Sie, daß ich dies ein-füge, aber es ist zu interessant, denn man sah im Café Griensteidl gewissermaßen, wenn man so zu gewissen Tageszeiten hinkam, wirklich einen Ausschnitt österreichischen Literatentums. Nur liest man heute vielfach, wenn man über diese Dinge liest, aus den Zeiten des eben später zur Berühmtheit gelangten Kellners Heinrich, des berühmten Heinrich vom Griensteidl, der wußte, was jeder Mensch, schon wenn er zur Türe hereinkam, für Zeitungen vorgelegt haben mußte. Aber das war nicht mehr die echte Zeit, die des etwas fidelen Heinridis, sondern die echte Zeit war die des Franz vom Griensteidl, der noch die Zeiten erlebt hat, in denen Lenau und Grillparzer und Anastasius Grün in jenem Café Griensteidl jeden Tag oder jede Woche zweimal versammelt waren, und der noch mit seinem unendlich würdigen Auftreten zuweilen, wenn man gerade auf eine Zeitung warten mußte, einem von allen diesen Literatur-größen in seiner Art zu erzählen wußte. Wie gesagt, in dem Kreise der Leute dort trat auch zuweilen Jakob Julius David auf. Eigentlich trat David erst am Ende der achtziger und Beginn der neunziger Jahre literarisch innerhalb des österreichischen Geisteslebens auf. Wenn man so bei ihm saß -er sprach wenig; er hörte fast noch weniger, wenn man mit ihm sprach, denn er war im höchsten Grade schwerhörig. Er war in sehr bedeutendem Maße kurzsichtig und sprach
in der Regel aus einer gepreßten Seele heraus, aus einer Seele, die etwas von dem erfahren hatte, wie oftmals im Leben das, was man Schicksal nennt, schwer auf der Seele lastet. Wenn ich den halbblinden und halbtauben Mann sprach, mußte ich oftmals denken, wie stark sich Österreichertum gerade in dieser Persönlichkeit aussprach, die eine gedrückte Jugend durchgemacht hatte, eine Jugend voll Entbehrungen und Armut ausgehalten hatte im Tale der Hanna, in jenem Tal, das von der March durdiflossen ist, wo deutsche Bevölkerung, ungarische Bevölkerung, slawische Bevölkerung aneinandergrenzen und überall unter-mischt sind. Wenn man von diesem Tal nach Wien hinunterfährt, dann kommt man überall an armseligen Hütten vorbei; insbesondere war das so in den Zeiten, in denen David jung war. Aber diese armseligen Hütten haben vielfach Menschen als Bewohner, von denen jeder in seiner Seele das österreichische Problem birgt, das, was in seiner ganzen ausgebreiteten Eigenart das österreichische Problem enthält, die ganze Mannigfaltigkeit des Lebens, das die Seele herausfordert. Diese Mannigfaltigkeit, die erlebt sein will, die nicht mit ein paar Begriffen, mit ein paar Vorstellungen abgetan werden kann, die lebt in diesen merk-würdigen, in einer gewissen Weise geschlossenen Naturen. Wollte ich charakterisieren, wie diese Naturen sind, die dann ganz besonders aus dem österreichischen Leben heraus David geschildert hat, so müßte ich sagen: Es sind Naturen, die tief fühlen mit dem Leid des Lebens, die aber auch dasjenige in sich haben, was sonst eben nicht so sehr häufig in der Welt vorhanden ist: das Ertragen des Leides zu einer gewissen Stärke zu machen. Es sind sogar schwer Worte zu finden für dasjenige, was aus dem vielfach mühseligen Erleben gemacht wird gerade in diesen österreichischen Gegenden. Man hat keine Sentimentalität, aber eine starke Möglichkeit,
die Mannigfaltigkeit des Lebens, die ja natürlich Zusammenstöße hervorbringt, auch in den untersten Bauernständen zu erfahren, zu erleben. Aber das verwandelt sich nicht in Lebensüberdruß, nicht in irgendeine welt-schmerzliche Stimmung. Das verwandelt sich in etwas, was nicht Trotz ist und doch die Stärke des Trotzes hat. Es verwandelt sich, wenn ich so sagen darf, Schwäche in Kraft. Und diese Kraft lebt sich aus in dem Gebiete, in das sie sich dann eben hineingestellt findet durch die Notwendigkeiten des Lebens. Und Schwäche, die in gewisser Weise zu Stärke umgebildet war, bei David zeigte sie sich. Halb blind und halb taub war dieser Mann. Aber er sagte mir einmal: Ja, meine Augen können in der Ferne nicht viel sehen, aber um so mehr, wie mit einem Mikroskop, sehe ich in der Nähe. - Das heißt, in der Nähe beobachtete er durch seine Augen wie durch ein Mikroskop alles genau; aber er betrachtete es so genau, daß man sagen muß: In dasjenige, was er mit seinen Augen sah, in das mischte sich hinein, wie es erklärend, wie es erhellend, etwas Großes, was dahinter stand. Und wie ein Ersatz für den weiten Umblick trat bei diesem Mann in dem kleinen Gesichtsfelde, das er mit seinen mikroskopischen Augen übersah, ein tiefer Blick auf, eine Sucht, hinter die Gründe der Dinge zu kommen. Und das übertrug sich auf sein ganzes Seelenleben. Dadurch sah er den Menschen, die er schildern wollte, tief, tief ins Herz hinein. Und viele, viele Typen österreichischen Lebens konnte er dadurch dichterisch hinstellen, dramatisch, novellistisch, auch lyrisch. Wie diese ganze österreichische Stimmung sich in der Seele nicht zur Sentimentalität, sondern zu einer gewissen inneren Stärke bilden kann, die nicht Trotz ist, aber die Stärke des Trotzes enthält, das ergibt sich besonders da, wo Jakob Julius David selber spricht. Da sagt er:
Allmächtiger! Du hast mir viel genommen,
Du weißt allein, was ich verloren;
Mein Auge sieht die schöne Welt verschwommen,
Und nur gedämpft, gedämpft und leise kommen
Des Lebens Laute in mein krankes Ohr.
Einst tat mir's weh - und war zu meinem Frommen,
Ich dank' Dir's heute, schalt ich Dich zuvor -
Du hast mir vielen Jammer, manches Grauen
Erspart zu hören und erspart zu schauen . . .
Wahrhaftig, der ganze Mann war so, daß er manches nicht sehen und nicht hören mußte, um manches aus den Tiefen der Seele herauszubringen, was er dichterisch verkörpern wollte. Wie gesagt, in einzelnen Symptomen möchte ich aufzeigen, was sich in solchen österreichischen Lauten ausspricht. Und man darf keinen Zug von Sentimentalität hineintragen, wenn Jakob Julius David von seinem Geschicke etwa so spricht:
Im Westen siehst du grau zu Tal
Die schwersten Wolken hangen -
Das mahnt der Tage mich zumal,
Die mir vergangen . . .
Im Osten schläft im Wetterlicht
Die künft'ge Glut verborgen -
Gewittert's mir, gewittert's nicht?
Das ist mein Morgen . . .
Dazwischen zuckt ein Endchen Blau,
Als ob's vor beiden scheute.
Die Deutung kennst Du, edle Frau:
Das ist mein Heute . . .
Aber dieses «Heute», das pflegt er sich, das saugt er aus, das wurde für ihn die Möglichkeit, österreichisches Volkstum in einer solchen Weise zu schildern, daß man überall ganz merkwürdigerweise bei ihm Einzelschicksale vor sich erblickt - viele seiner Novellen haben ja nur wenige Personen -, Einzelschicksale, bei denen man sich sagen muß:
Wie die Personen aufeinanderplatzen dadurch, daß sie durch Verwandtschaft oder durch anderes in der Welt nebeneinandergestellt werden, das ist im höchsten Maße ergreifend, das führt uns tief hinein in Wirklichkeiten. Aber was Jakob Julius David so, ich möchte sagen, mikroskopisch und doch bewegt und lebendig erfaßt, tritt sehr selten so auf, daß nicht irgendwie ein großes Gemälde des Welt-geschichtlichen dahintersteht, auf dessen Hintergrund sich das Einzelne abspielt.
Dieses Im-Zusammenhang-Denken des Kleinen, das darum nicht schattenhaft verschwommen wird, weil es auf solchem Hintergrund erscheint, daß dieses Sich-abspielen-Lassen des Kleinen gefärbt ist von dem Großen des welt-geschichtlichen Werdens, das ist es ja auch, was wir als das Charakteristischste finden bei einem ja bekannteren, aber leider nicht bekannt genug gewordenen österreichischen Dichter, bei dem größten Dichter Österreichs in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, bei demjenigen Dichter, dessen Heimat wir finden, wenn wir nur etwas westwärts gehen von Jakob Julius Davids Heimat: bei Robert Hamerling.
Es ist merkwürdig, wie das, was bei einzelnen Persönlichkeiten innerhalb des österreichischen Geisteslebens auftritt, sich anscheinend stößt, wie es aber doch, wenn man es von einem gewissen höheren Gesichtspunkte betrachtet, als Eigenschaft neben Eigenschaft sich hinstellt und zu einer großen Harmonie zusammenfließt. Es ist merkwürdig:
Karl Julius Schröer wollte Robert Hamerling durchaus nicht gelten lassen. Ihm war er ein Dichter von untergeordneter Bedeutung, ein Dichter, der vor allen Dingen sich seine dichterische Kraft durch seine Gelehrsamkeit zerstört haben soll. Dagegen ist es in Robert Hamerling dasselbe an Gesinnung, dasselbe an edelster Erfassung des deutschen Wesens, das ich an einer solch charakteristischen Persönlichkeit wie Karl Julius Schröer zu schildern versuchte. Aber auch das ist eigentümlich bei Hamerling, und was ich Ihnen hier an typischen Persönlichkeiten schildere, finden Sie über das österreichische Volkstum im Kleinen bei vielen, vielen ausgebreitet. Ich suche eben nur charakteristische Züge herauszugewinnen, die wirklich als Einzelzüge sich darstellen lassen, aber so, daß sie für das Ganze stehen können. Eigentümlich ist bei Robert Hamerling das Herauswachsen aus dem Kleinsten. Aus dem nieder-österreichischen Waldviertel stammt er, aus jener armen Gegend, die ihre Früchte nur schwer trägt, weil es ein steiniger Boden ist, der aber vielfach mit Wald bedeckt ist, einer Gegend, die lauschig, anmutig ist, die in ihrer hügeligen Natur besonders bezaubernd werden kann. Aus dieser eigentümlichen Natur und aus der Begrenztheit des Wesens der Menschen wuchs Robert Hamerlings weiter Geist heraus, wirklich, er wuchs heraus. Und er wuchs hinein in ein ebensoldies Stehen zu dem deutschen Wesen, wie Karl Julius Schröers Geist. Wir sehen das in einer der besten Dichtungen Robert Hamerlings, «Germanenzug», wo ja gerade die Art und Weise ganz besonders deutlich zum Ausdruck kommt, wie in Robert Hamerling, dem österreichischen Dichter, deutsches Wesen lebte. Die alten Germanen ziehen von Asien herüber, lagern sich am Kaukasus. Wunderbar, ich möchte sagen, mit zauberischer Anschaulichkeit ist geschildert, wie der Abend hereinbricht, wie die Sonne untergeht, Dämmerung waltet, der
Mond erscheint, wie sich das ganze Germanenheer lagert, Schlaf sich ausbreitet und nur der eine blondgelockte Jüngling, Teut, wacht; wie diesem Teut der Geist Asia erscheint, der die Seinen nach Europa entläßt, und wie der Geist Asia den Teut mit dem durchdringt, was den Germanen bis hin zu ihrer Entwickelung im Deutschtum von der Geschichte bevorsteht. Da wird das Große groß, da wird aber auch schon mit edler Kritik dasjenige, was zu tadeln ist, ausgesprochen. Da wird mancher Zug, den insbesondere solche Menschen am Deutschtum sehen, wie Robert Hamerling, von der Göttin Asia ausgesprochen. Da wird von der Zukunft gesprochen:
Doch wie auch stolz du aufstrebst, and're Schwärme
Hoch überschwebend, stets noch eine Lohe
Wirst du bewahren uralt heil'gen Brandes.
Fortleben wird in dir die traumesfrohe
Gott-Trunkenheit . . .
Du strebst nur, weil du liebst: dein kühnstes Denken
Wird Andacht sein, die sich in Gott will senken.
So Asia zu dem blonden Teut, dem Führer der Germanen nach Europa, voraussprechend von dem Genius des Deutschtums, und weiter sprechend:
Kennst du die höchste Bahn für euer Ringen,
Wenn ihr dereinst erstarkt in sich'rer Einheit?
Kennst du im Meer der Zeiten die Fanale,
Die, fernher winkend mit der Flamme Reinheit,
Euch hin zum letzten, schönsten Ziele bringen?
Hoch oben glänzen sie mit ew'gem Strahle
Die heil'gen Ideale
Der Menschheit: Freiheit, Recht, und Licht und Liebe!
Das sind die letzten voll erglühten Flammen
Des Urlichts - sie zu schüren allzusammen
In eine Glut im hadernden Getriebe
Des Völkerlebens: das ist deine Sendung . . .
Und Robert Hamerling konnte gar nicht anders, als die Einzelheiten, die er zum Beispiel als Epiker oder als Dramatiker darstellt, im Zusammenhang mit der großen geistigen Entwickelung der Menschheit betrachten. Ich möchte sagen, alle diese Betrachter da drüben in Österreich haben seelisch etwas von dem mikroskopischen Sehen, das aber unter die Dinge greifen will; und Robert Hamerling zeigt es am schönsten. Und sie haben etwas in bezug auf das westliche Österreich, wovon man sagen kann: Es hat eine gewisse Berechtigung, das Einzelne hineinzustellen in das große Ganze. Denn wie da in manchen Gegenden des westlichen Österreichs die Täler zwischen den Bergen stehen, das drückt sich wiederum aus in demjenigen, was in einem solchen Dichter wie Robert Hamerling lebt. Wir sehen schon, Mannigfaltiges lebt sich aus in diesem österreichischen Geistesleben in allen Seiten, die vielleicht einander abstoßen, die aber doch eine Mannigfaltigkeit darstellen, die im ganzen Bilde der Kultur, das man sich entwerfen kann, Einheitlichkeit ist.
Und in dieser Mannigfaltigkeit schiießen sich nicht wie zu einer Disharmonie, sondern in gewissem Sinne wie zu einer Harmonie die Klänge zusammen, die von den anderen Nationalitäten herkommen. Es ist ja selbstverständlich nicht möglich, auch nur einzelnes Kleines über das zu sagen, was da von den anderen Nationalitäten hereintönt in das gesamte österreichische Geistesleben. Nur wiederum wenige Symptome seien charakterisiert. Da haben wir zum Beispiel innerhalb der tschechischen Literatur - in bezug auf diese
Darstellungen muß ich selbstverständlich zurückhaltend sein, da ich der tschechischen Sprache nicht mächtig bin -, da haben wir einen neueren Dichter, einen jüngst verstorbenen Dichter, der wirklich - wie einer, der über ihn geschrieben hat, sich aussprach - für sein Volk etwas Ähnliches geworden ist, wie man es von einem großen tschechischen Musiker gesagt hat: daß er da war wie ein Walfisch im Karpfenteich. So ist ja Jaroslav Vrchlický in dieses Geistesleben seines Volkes hineingestellt. Vor seinem Geiste steht die ganze Weltgeschichte auf: ältestes Menschheitsleben ferner Vergangenheit, ägyptisches, europäisches Leben des Mittelalters und der Neuzeit, hebräisches Geistesleben, die ganze Weltgeschichte lebt auf in seinen lyrischen Dichtungen, lebt auf in seinen Dramen, in seinen Erzählungen, -und überall lebendig. Eine ungeheure Produktivität liegt in diesem Jaroslav Vrchlický - Emil Frida heißt er mit seinem bürgerlichen Namen. Und wenn man bedenkt, daß dieser Mann ein großes, großes Gebiet der Literatur anderer Völker für sein Volkstum übersetzt hat, zu seiner ungeheuer weitverbreiteten Produktion hinzu, dann kann man ermessen, was ein solcher Geist für sein Volkstum ist. Ich muß Ihnen ablesen, denn sonst könnte ich einige derjenigen Dichter der Weltliteratur vergessen zu erwähnen, die Vrchlický für die tschechische Literatur übersetzt hat: Ariost, Tasso, Dante, Petrarca, Leopardi, Calderon, Camöens, Moliére, Baudelaire, Rostand, Victor Hugo, Byron, Shelley, Gorki, Schiller, Hamerling, Mickiewicz, Balzac, Dumas und andere. Es ist berechnet worden, daß Vrchlický von Tasso, Dante und Ariost zusammen allein 65 000 Verse übersetzt hat. Dabei stand dieser Mann, ich möchte sagen, wie die Verkörperung seines Volkstums innerhalb desselben da. Als er auftrat in den stürmischen siebziger Jahren - er ist 1853 geboren - war gerade eine schwierige Zeit innerhalb
seines Volkstums zwischen all den Gegensätzen, die her-eingetreten waren; gegenüber dem Deutschtum waren noch allerlei gegensätzliche Parteien innerhalb seines eigenen Volkstums entstanden. Anfangs wurde er viel angefochten. Es gab Leute, die da sagten, er könne nicht tschechisch; es gab Leute, die sich lustig machten über das, was Vrchlický schrieb. Aber das hörte sehr bald auf. Er erzwang sich die Anerkennung. Und 1873 war er, man möchte sagen, wie ein Friedensengel unter den sich furchtbar befehdenden Parteien. Von allen wurde er anerkannt, und von allen ließ er in seinen volkstümlich dichterischen Werken auferstehen ganze Gemälde der Weltenentwickelungen; just nicht - das ist auffällig - etwas aus dem russischen Volkstum! Ein Mann, der eine kurze Biographie über ihn geschrieben hat - vor dem Kriege -, ermahnte ausdrücklich in dieser Biographie: Man möge gerade an diesem Manne sehen, wie wenig das Märchen begründet sei, daß die Tschechen oder überhaupt die westlichen Slawen, wenn sie in sich gehen, irgend etwas zu erwarten haben von dem großen russischen Reich, wie es oftmals gesagt wird.
In einer anderen Weise sehen wir dieses sich Ausbreitende, dieses: das Einzelerlebnis zu sehen auf dem Hintergrunde der großen Menschheits- und Weltenzusammenhänge, - in einer anderen Weise sehen wir es bei einem Dichter, auf den ich auch schon im letzten Vortrage über das Österreichertum hingewiesen habe, bei dem magyarischen Dichter Emmerich Madách. Madách ist geboren 1823. Madách hat geschrieben, man muß sagen, wirklich durchdrungen von voller magyarischer Gesinnung, neben anderem, das hier nicht erwähnt werden kann, «Die Tragödie des Menschen». Diese «Tragödie des Menschen» ist wiederum etwas, das jetzt nicht anknüpft an die großen Menschheitsereignisse,
sondern diese Menschheitsereignisse selber unmittelbar darstellt. Und man möchte sagen, wie Madách, der Magyar, der Angehörige des östlichen Österreich, in der «Tragödie des Menschen» darstellt, das unterscheidet sich zum Beispiel von den Gestalten, die - im «Ahasver», «König von Sion», der «Aspasia» - Hamerling nun auf seine Art aus dem großen Gemälde der Weltgeschichte heraus schuf. Das unterscheidet sich so, wie sich die Berge des westlichen Österreich von den weiten Pußten des östlichen Österreich unterscheiden oder vielmehr - ich möchte noch genauer sagen - wie die Seele, wenn sie in den oftmals so wunderschönen, besonders wenn sie sonnendurchglänzt sind, schönen Tälern West-Österreichs aufgeht und den Blick gehen läßt über die Berge hin, die diese Täler begrenzen, - wie die Seele sich bei diesem Aufgehen unterscheidet von jener ins Weite, aber Unbestimmte hinausgehenden Stimmung, die sie überfällt, wenn die ungarische Pußta mit ihrern weiten Ebenencharakter auf diese Seele wirkt. Sie kennen ja aus Lenaus Dichtungen, was diese ungarische Pußta der Seele des Menschen werden kann.
Eine merkwürdige Dichtung, diese «Tragödie des Menschen» . Wir werden da direkt hineinversetzt in den Beginn der Schöpfung. Gott tritt auf neben Luzifer. Adam träumt unter Luzifers Eindruck die künftige Weltgeschichte. In neun bedeutsamen Kulturbildern geschieht das. Im Anfange werden uns entgegengeführt der Herr und Luzifer; Luzifer, der sich geltend machen will in seinem ganzen Wesen gegenüber dem Schöpfer dieses Daseins, in das das Wesen des Menschen hineinverflochten ist. Und Luzifer ermahnt den Weltenschöpfer, daß er auch da sei und daß er von gleichem Alter sei wie der Weltenschöpfer selber. Der Weltenschöpfer muß in einer gewissen Weise Luzifer
als seinen Helfer gelten lassen. Wir hören in der Dichtung das bedeutsame Wort: «Hat die Verneinung» - nämlich Luzifer - «nur den kleinsten Halt, hebt eine Welt sie aus den Angeln bald.» Damit droht Luzifer dem schöpferischen Geist. Der Herr übergibt Luzifer zwei Bäume, den Baum der Erkenntnis und den Baum der Unsterblichkeit. Aber damit versucht Luzifer die Menschen. Und er versucht Adam, dadurch verliert Adam das Paradies. Und außer dem Paradiese macht Luzifer den Adam bekannt mit dem, was in Madáchs Anschauungen die Erkenntnis der Naturkräfte, dieses ganzen Gewebes der Kräfte ist, die durch Menschenerkenntnis gewonnen werden können durch die vor den Sinnen sich ausbreitenden Naturerscheinungen. Das unsichtbare Spinngewebe der Naturgesetze ist es, über das Luzifer den Adam außer dem Paradiese unterrichtet. Und dann wird uns vorgeführt, wie Luzifer Adam träumen läßt von dem ferneren Weltenschicksale. Da sehen wir, wie Adam im alten Ägyptenlande als ein Pharao wiederverkörpert wird, wie Eva ihm in ihrer Wiederverkörperung entgegentritt als die Gattin eines Sklaven, der mißhandelt wird. Tiefe Wehmut erfaßt Adam; das heißt, er sieht es in seinem Traum, in dem ihm sein späteres Leben, alle seine späteren Verkörperungen vor das Seelenauge treten. Er sieht es so an, daß ihn tiefe Erbitterung darüber erfaßt, was aus der Welt werden soll. Und weiter wird uns vorgeführt, wie Adam in Athen als Miltiades wiederverkörpert wird, wie er des Volkes Undank erfahren muß; weiter wird uns vorgeführt, wie er in dem alten Rom, in der Kaiserzeit, die niedergehende Kultur und das Hereindringen des Christentums zu beobachten hat. Unter Kreuzfahrern spater in Konstantinopel tritt uns in einem neuen Leben Adam entgegen. Als Kepler wird er wiederverkörpert am Hofe Kaiser Rudolfs; als Danton innerhalb der französischen
Revolutionszeit. Dann wird er in London wieder-verkörpert. Da lernt er dasjenige kennen, wodurch Luzifer nach der Anschauung Madáchs charakteristisch für die Gegenwart wirkt. Es müssen schon die Worte ausgesprochen werden, die einmal darin stehen: «Alles ein Jahrmarkt, wo alles handelt, kauft, betrügt, Geschäft ist Betrug, Betrug ist Geschäft.» Es ist nicht unter dem Einfluß des Krieges geschrieben, denn die Dichtung ist in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden. Dann wird Adam in einem weiteren Leben an das Ende der Erdenzeit geführt, in eine Eislandschaft und so weiter. Interessant zweifellos, aber man möchte auch sagen, wie die ungarische Pußta ins Unendliche auslaufend und vieles unverständlich lassend, vieles Unbefriedigende enthaltend - so ist diese Dichtung. Und nur sporadisch merkt man, daß der Dichter eigentlich meint: das Ganze ist ja ein Traum, den Luzifer in Adam anregt. Und der Dichter will eigentlich sagen: So würde die Welt, wenn nur Luzifer wirken würde. Aber auch der Mensch wirkt hinein. Der Mensch hat seine Kraft zu suchen und Luzifer entgegenzuwirken. Aber das wird kaum angedeutet, bloß, ich möchte sagen, am Schluß angedeutet, aber so, daß das, was als Positives auftritt gegenüber dem Negativen, gegenüber dem Traurigen, gegenüber dem Leidvollen, auch zusammengefaßt werden muß, wie Leid, das zu trotziger Kraft sich entwickelt. «Kämpfe und vertraue», das wird dem Adam eingeschärft. So wird uns aber gar nicht vorgeführt, was der Mensch sich erkämpfen kann. Was die Welt würde, wenn sie nur der Natur allein überlassen wäre, das wird dargestellt. Und aus tiefer Innerlichkeit, aus schwerer Lebenserfahrung ist diese Dichtung erwachsen.
Madách ist auch eine von den Naturen, die man, nur wiederum in einer anderen Art, so charakterisieren kann,
daß man sagt: Oh, diese Mannigfaltigkeit des Lebens, das an die geschichtlichen Bedingungen Österreichs geknüpft ist, das zog durch seine Seele; aber dabei auch die Kraft, Schwäche in Stärke umzuwandeln.
Aus altem ungarischem Adel ist Madách. Er wächst im Neograder Komitat heran. Seinen Vater verliert er ganz früh. Die Mutter ist eine geistig starke Frau. Madách wird ein träumerischer, sinnender Mensch. 1849, nach der Revolution, hat er einen Flüchtling aufgenommen, der zwar schon weg ist, als die Polizei ihn sucht; aber die Polizei kommt doch darauf, daß Madách diesen Flüchtling bei sich aufgenommen hatte. Madách wird der Prozeß gemacht und er wird vier Jahre ins Gefängnis, ins Zuchthaus gesetzt. Nicht so sehr das Zuchthaus, das er eben wie eine historische Notwendigkeit hinnahm, ist es, was auf Madách mit schwerem Leid wirkte, aber daß er sich trennen mußte von seiner Frau, von seiner Familie, die ihm wie das andere Selbst war, die er zärtlichst liebte, - daß er sie diese vier Jahre nicht sehen, vier Jahre nicht teilnehmen sollte an diesem Leben, das zerschmetterte ihn, das war das eigentliche schwere Schicksalserlebnis, das ihn an der Menschheit hätte zweifeln lassen, wenn ihm nicht in jeder Stunde, da er im Zuchthaus lebte, die Hoffnung vor Augen gestanden hätte: du wirst sie dann wiedersehen. Und da schrieb er seine Gedichte, wo er sich ausmalt, wie er durch die Türe hineingehen werde. Noch als er wirklich entlassen war, auf dem Wege schrieb er ein letztes dieser Gedichte, worin er in wunderbarer Weise ausmalt seinen Himmel, der ihn nun empfangen würde. Und er kam wirklich nach Hause. Die Frau, die er so zärtlich liebte, war ihm mittlerweile untreu geworden, sie war mit einem anderen davon-gegangen. Und durch das Tor, durch das er eintreten wollte im Sinne des Gedichtes, das er hingeschrieben hatte, mußte
er treten in sein treulos verlassenes Heim. In Visionen stand der Verräter und sein Verrat oftmals vor seinem Auge. Aus solchen Untergründen heraus bildeten sich ihm seine geschichtlichen, seine Menschheitsempfindungen, seine Weltenempfindungen. Das muß man allerdings auch ins Auge fassen, wenn man in richtiger Weise die Dichtung, gegen die man vielleicht vieles einwenden könnte, würdigen will.
Denn das ist es - und es ware interessant, dies ganz im einzelnen auszuführen -, daß schon einmal die Mannigfaltigkeit, die im österreichischen Leben ist und die durch solche Dinge herbeigeführt wird, wie ich sie angeführt habe, wieder und wiederum den Blick doch weiten und einem Aufgaben stellen kann, so daß man unmittelbar seine eigenen Erlebnisse anknüpfen muß an die großen Erlebnisse der Menschheit, ja, an die Aufgaben der Menschheit. Und wie bei Hamerling, trotzdem er sein halbes Leben auf dem Krankenbett lag, jeder Ton, den er dichterisch von sich gegeben hat, zusammenhing mit unmittelbarstem Erleben, so auf der anderen Seite auch bei Emmerich Madách.
Sehen Sie, diese Mannigfaltigkeit, - man kann die Frage aufwerfen: Mußte sie denn im Laufe der Menschheitsentwickelung in Mitteleuropa zusammengeschmiedet werden? Liegt darinnen irgendeine Notwendigkeit? Man bekommt allerdings, wenn man die Sache genauer betrachtet, den Einblick in eine solche Notwendigkeit, das Mannigfaltigste von Menschheitsgemütern auf einem Flächenraume auch zu äußeren gemeinsamen Schicksalen zusammengefügt zu finden. Und ich möchte sagen, es trat mir immer wie ein Sinnbild dessen, was da an Volksgemeinschaft, an Volks-mannigfaltigkeit vorhanden ist, vor Augen, daß ja auch die Natur, und zwar merkwürdigerweise gerade um Wien herum, etwas von einer großen Mannigfaltigkeit schon in der Erde geschaffen hat. Geologisch gehört das sogenannte
Wiener Becken zu den interessantesten Gebieten der Erde. Da findet man gewissermaßen wie in einem irdischen Mikrokosmos, wie in einer kleinen Erde, alles zusammengetragen, was aufeinander wirkt, aber einem auch versinnbildlicht dasjenige, was einem erklären kann das, was sonst ausgebreitet ist in der Erdoberfläche. Und tief anregend ist die Betrachtung dieses Wiener Beckens mit den zahlreichen Geheimnissen der Erdentstehung, die man da studieren kann, für denjenigen, der für naturwissenschaftliche Betrachtungen Interesse und Verständnis hat. Man möchte sagen, schon die Erde selbst entwickelt da in der Mitte Europas eine Mannigfaltigkeit, die zu einer Einheit verbunden ist. Und das, was da in der Erde geologisch vorhanden ist, spiegelt sich im Grunde genommen nur in dem, was über diesem Erdboden in den Gemütern der Menschen sich abspielt.
Wahrhaftig, nicht um für Österreich Propaganda zu machen, sondern nur um charakteristisch zu schildern, sage ich dieses alles. Aber dieses Charakteristische tritt einem eben entgegen, wenn man Österreich schildern will. Und, ich möchte sagen, ins Gebiet der exakten Wissenschaft, der Geologie hinübergetragen, hat man ja in Österreich etwas, was dem entspricht, was Österreichs große Dichter gerade als ihr Eigentümlichstes für sich zu beanspruchen haben. Wenn man Hamerling beobachtet, wenn man Jakob Julius David beobachtet, wenn man andere große Dichter Österreichs betrachtet: das Charakteristische ist, daß sie überall an das große Menschheitsschicksal anknüpfen wollen. Es ist auch das, was sie am innigsten, am tiefsten befriedigt. Ein Mann, der mir befreundet war, schrieb zur tiefen Befriedigung Hamerlings dazumal einen Roman, in dem er versuchte, mittelalterliches Erkenntnisleben kulturhistorisch in einzelnen Gestalten zum Ausdruck zu bringen. «Der
Alchimist» heißt dieser Roman. Er ist von Fritz Lemmer-mayer. Und Fritz Lemmermayer ist kein hervorragendes Talent. Er ist sogar ein Talent, das kaum nach diesem Roman wieder irgend etwas Bedeutendes geleistet hat. Aber man sieht, daß das Wesen, das durch das Volkstum geht, den Einzelnen ergreifen kann und sich auch da in diesen Nichtbegabten charakteristisch zum Ausdruck bringt, im ganzen Wollen zum Ausdruck gebracht wurde.
Wie gesagt, sogar in die exakte Wissenschaft der Geologie kann so etwas herüberspielen. Es entspricht wohl einer tiefen Notwendigkeit, daß dies bei der großen Persönlichkeit des Wiener Geologen Eduard Sueß, vielleicht eines der größten Geologen aller Zeiten, der Fall ist, dem das Studium der Verhältnisse des Wiener Beckens zu verdanken ist. Gerade der Anblick dieses Wiener Beckens mit seiner ungeheuren Mannigfaltigkeit, die sich zu einer wunderbaren Einheit wiederum verbindet, könnte in einem instinktiv aufgehen lassen eine große, gewaltige geologische Idee, die in diesem Manne zum Vorschein kommt und von der man sagen muß, daß sie sich nun wirklich aus dem Österreichertum heraus - denn Eduard Sueß ist in seinem ganzen Wesen eine ur-österreichische Persönlichkeit -, aus dem österreichischen Wesen heraus entwickeln konnte: diese Einheit in der Mannigfaltigkeit, ich möchte sagen, dieser mikroskopische Abdruck der ganzen Erdengeologie in dem Wiener Becken. Das tritt uns wiederum darin entgegen, daß Eduard Sueß in unserer Zeit, das heißt im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, den Entschluß fassen konnte, wirklich in seinem dreibändigen großen Werke «Das Antlitz der Erde» ein Buch zu schaffen, in dem alles dasjenige, was in der Erde geologisch wirkt und lebt und wirkte und lebte, zu einem bedeutenden, abgerundeten Bilde im Großen gefügt wird, so daß einem die Erde überschaubar
wird. Überall wird die Sache exakt behandelt, aber wenn man das ganze Antlitz der Erde erblickt, wie es Sueß geschaffen hat, so erscheint einem die Erde gleichwohl als ein Lebendiges, so wiederum, daß man unmittelbar sieht: Die Geologie kommt aus der Erde. Wenn man Sueß weiter verfolgte, würde etwas geschaffen, wobei der Planet unmittelbar angefügt würde an den ganzen Kosmos. Sueß bringt die Erde in dieser Beziehung so weit, daß gewissermaßen die Erde lebt und man nur das Bedürfnis hat, weiter zu fragen: Wie lebt jetzt diese Erde im ganzen Kosmos, nachdem man sie geologisch verstanden hat?
Wie in der österreichischen Dichtung vieles mit der österreichischen Landschaft, mit der österreichischen Natur zusammenhängt, so glaube ich, daß auch mit der Geologie des engeren Österreichs gerade die Tatsache zusammenhängt, die vielleicht auch nur nicht genug gewürdigt wird in dem Geistesleben der Menschheit: daß von Wien aus dieses Buch auf dem Gebiet der Geologie hat entstehen können, dieses Buch, das ebenso exakt wissenschaftlich wie genialisch veranlagt und durchgeführt ist und in dem wirklich alles, was die Geologie bis zu Sueß geschaffen hat, in einem Gesamtbilde verarbeitet wird, aber so, daß man wirklich zuletzt glaubt, die ganze Erde nicht mehr als das tote Produkt der üblichen Geologie, sondern als ein Lebendiges vor sich zu haben. Ich meine, daß auf diesem Gebiet geradezu in die wissenschaftlichen Leistungen - durchaus nicht irgendwie in die Objektivität der Wissenschaften, die gewiß dadurch nicht gefährdet wird - dasjenige hineinspielt, was gerade aus dem Österreichertum des Eduard Sueß kommen konnte. Und wenn man in dieses Österreichertum so nach den verschiedensten Gebieten hineinsieht, da merkt man: Solche Gestalten leben wirklich, wie sie Jakob Julius David geschaffen hat, bei denen sich der
Seele oftmals eine einzige Seeleneigenschaft bemächtigt, weil die anderen durch die Schwierigkeiten des Lebens zurückgedrängt werden, und sie so erfüllt, daß die einzelne Seele ihre Stärke, aber auch ihre Kraft und ihre Beruhigung und ihren Trost hat. Diese Gestalten werden insbesondere interessant, wenn diese Seelen zu Erkenntnismenschen heranreiften.
Und da ist eine Gestalt aus dem ober-österreichischen Lande, aus der Ischler Gegend - ich habe auf den Namen auch schon in dem vorigen Vortrage hingewiesen -, da ist der merkwürdige Bauernphilosoph Conrad Deubler. Wirklich, denkt man sich jede Gestalt, die Jakob Julius David so aus dem österreichischen Leben heraus geschaffen hat, ein wenig jünger, denkt man sich die Ereignisse dieses Lebens weg, die dieses Leben später geformt haben, und denkt sie hinein in die Seele des Conrad Deubler, so könnte eine jede solche Gestalt Conrad Deubler werden. Denn auch dieser Conrad Deubler ist gerade für den Menschen der österreichischen Alpenländer ungemein charakteristisch. Zu Goisern im Ischler Lande geboren, wird er Müller, später Gastwirt, ein Mensch, der tief veranlagt ist zum Er-kenntnismenschen. Wenn ich jetzt über Conrad Deubler das Folgende spreche, so bitte ich, das nicht damit in einen Mißklang zu bringen, daß selbstverständlich hier sonst nicht eine Weltanschauung vertreten wird, wie sie Conrad Deubler hatte; daß immer betont wird, daß über so etwas, wie Conrad Deubier es dachte, hinausgegangen werden muß zu einer Vergeistigung der Weltanschauung. Aber darauf kommt es nicht an, daß man an gewissen Dogmen festhält, sondern darauf kommt es an, daß man jedes menschliche Erkenntnisstreben in seiner Ehrlichkeit und Berechtigung einzusehen vermag. Und wenn man vielleicht auch mit nichts einverstanden sein kann, wozu sich Conrad
Deubler eigentlich bekannte, so bedeutet doch die Betrachtung gerade dieser Persönlichkeit, insbesondere im Zusammenhang mit Charakteristiken des österreichischen Lebens, etwas, was typisch ist und was namentlich bedeutsam ist, indem es ausdrückt, wie nach Ganzheit aus jenen Verhältnissen heraus gestrebt wird, die in vieler Beziehung geistig sich vergleichen lassen mit dem räumlichen Eingeschlossen-sein durch die Berge. Conrad Deubler ist ein Erkenntnis-mensch, trotzdem er nicht einmal richtig schreiben gelernt hat, trotzdem er eine ganz mangelhafte Schulbildung hatte. Jakob Julius David nennt seine Persönlichkeiten, die er schildert, skizziert, «Sinnierer». In meiner Heimat, im nieder-österreichischen Waldviertel, würde man sie vielfach «Simulierer» genannt haben. Das sind Menschen, die durch das Leben sinnend gehen müssen, die aber mit dem Sinnieren etwas Gefühlvolles verbinden, die das Leben viel bekritteln. Man nennt das in Österreich: Man «raunzt» über das Leben. «Geraunzt» wird ja viel über das Leben. Aber diese Kritik ist nicht eine trockene Kritik, diese Kritik ist etwas, was sich unmittelbar in inneres Leben verwandelt, insbesondere bei solchen Gestalten wie Conrad Deubler. Er ist von Anfang an ein Erkenntnismensch, trotzdem er nicht ordentlich schreiben konnte. Er geht immer auf Bücher aus. Da ist es zunächst in seiner Jugend ein tüchtiges Buch, ein Buch, das strebt aus dem Sinnlichen ins Geistige hinein: Grävell, «Der Mensch». Das liest Deubler 1830 -1814 ist er geboren -, und Sintenis, «Der gestirnte Himmel», Zschokkes «Stunden der Andacht». Aber er fühlt sich in diesen Dingen nicht so recht zu Hause, er kann mit diesen Dingen nicht mitgehen. Er ist eine sinnende Natur, und er ist von Begeisterung durchdrungen, Befriedigung der Seele nicht nur für sich zu finden, sondern auch für diejenigen, die sein Dorf mit ihm bewohnen. Es strebt etwas
in diesen Leuten aus der überlieferten Weltanschauung heraus. Da wird Conrad Deubler dann mit dem bekannt, was dazumal die Zeit am tiefsten bewegt hat, die Zeit aufgerührt hat - er wird bekannt mit Schriften, die aus dem Darwinischen Geiste heraus geschrieben worden sind. Er wird bekannt mit Ludwig Feuerbach, mit David Fried-rauch Strauß. Er wird später mit Ernst Haeckels Schriften bekannt, aber dies eben später. Er liest das alles, er verschlingt es. Nur nebenbei will ich erwähnen: Weil er sich mit solcher Lektüre befaßt und solche Dinge auch seinen Dorfgenossen vorgelesen und eine Art Bibliothek für seine Dorfgenossen begründet hat, hat er mehrere Jahre Zuchthaus als Strafe bekommen. Es war in den Jahren 1852 bis 1856, - wegen Religionsstörung, Gotteslästerung und Verbreitung von gotteslästerlichen Anschauungen! Aber wie gesagt, das möchte ich nur nebenbei erwähnen, denn Conrad Deubler ertrug die ganze Sache mannhaft. Für ihn handelte es sich ja aus einem Grundtriebe seiner Seele heraus darum, zur Erkenntnis vorzudringen. Und so sehen wir denn bei diesem Bauern dasjenige, was wir gleich zum Schluß noch bei einem anderen Geiste, ich möchte sagen, noch auf einem höheren Gesichtskreis des Lebens sehen dürfen -, so sehen wir denn bei diesem Geiste, wie versucht wird, naturwissenschaftliche Denkweise mit dem tiefsten Bedürfnisse der Seele in Einklang zu bringen. Daß Conrad Deubler zu einer ganz naturalistisch-materialistischen Auffassung des Lebens kommen konnte, das soll uns, wie gesagt, nicht weiter berühren. Denn nicht darauf kommt es an, sondern darauf, daß doch in solchen Leuten der Drang lebte, die Natur selber vergeistigt zu schauen. Wenn sie sie auch zunächst nur sinnlich gelten lassen - in ihnen allen lebt der Drang, die Natur geistig hinzunehmen. Und aus solcher Naturanschauung muß sich im Laufe der Menschheitsentwickelung
dennoch eine vergeistigte Anschauung des Lebens ergeben. So ist denn dieser einfache Bauer nach und nach eine gerade bei den erleuchtetsten Geistern der materialistischen Epoche berühmte Persönlichkeit geworden. Er war ein leidenschaftlicher Reisender und lernte nicht nur in früher Jugend in Wien kennen, was er kennenlernen wollte, er unternahm auch Reisen zu Feuerbach nach Nürnberg. Aber vor allem ist es interessant, wie sein Wirtshaus in Goisern für die bedeutendsten Leute auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, Naturweltanschauung ein Aufenthaltsort wurde. Haeckel kehrte wiederholt bei Deubler ein, hielt sich ganze Wochen dort auf. Feuerbach kehrte oftmals dort ein. Mit David Friedrich Strauß, mit dem materialistischen Vogt, dem sogenannten dicken Vogt, mit allen möglichen Leuten unterhielt Deubler einen Briefwechsel, bei dem uns das Unorthographische, das Ungrammatikalische nicht stören darf, bei dem uns vielmehr das Urwüchsige des Erkenntnismenschen auffallen muß.
Und ich möchte sagen, dieser Zug, der bei Deubler im bäuerlich Groben zutage tritt, er tritt uns in höchst feinsinniger Art bei dem Manne entgegen, auf den ich ja im vorigen Vortrag auch schon hingewiesen habe, bei Bartholomäus von Carneri, dem eigentlichen österreichischen Philosophen vom letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts. Carneri ist auch derjenige Geist, der vom Darwinismus zunächst überwältigt wird, der aber gerade so recht zeigt, wie unmöglich es ihm ist, Wissenschaft wirklich so zu nehmen, wie man sie in Mitteleuropa zu nehmen gezwungen ist; wie es unmöglich einem solchen Geiste ist, Wissenschaft nicht an das innerste Streben des Menschen anzugliedern, nicht den Weg zu suchen, der von Wissenschaft zu religiöser Vertiefung und religiöser Versenkung hinüber führt. Gerade Bartholomäus von Carneri ist einer
von den Geistern, für die es gilt, wenn Asia zu dem blonden Teut sagt, daß das ernsteste Denken im deutschen Geiste aus der Liebe hervorgehen und zur Gott-Innigkeit kommen will. Wenn uns auch diese Gott-Innigkeit bei Carneri, ich möchte sagen, im atheistischen Kleide entgegentritt, so tritt sie uns doch aus dem intensivsten, ehrlichsten Geistesstreben entgegen. Carneri steht als Philosoph, als Weltanschauungsmensch ganz auf dem Boden der Auffassung, daß alles, was Geist ist, dem Menschen zunächst nur am Stoff erscheinen kann. Und nun steht Carneri unter dem Einflusse einer merkwürdigen Täuschung. Man könnte sagen, er steht unter dem Einfluß der Täuschung, daß er nun die Welt in lauter Begriffen und Ideen, in lauter Vorstellungen und Empfindungen betrachtet, die aus dem Geiste heraus geboren sind, mit denen er glaubt, nur Materielles, nur Sinnliches erfassen und umfassen zu können. Wenn einer Sinnliches ansieht, so sagt ungefähr Carneri, kann dieses Sinnliche geteilt werden, aber die Teilung geht nur so weit, daß wir dieses Begrenzte mit den Sinnen überschauen. Wenn aber die Teilung weitergeht, wenn die Differenzierung so fein wird, daß kein Sinn mehr sie überschauen kann, dann muß dieses, was da im differenzierten Stoff lebt, vom Denken erfaßt werden, und dann ist es Geist, -geistig aus dem Glauben heraus, daß eigentlich nur Natürliches natürlich begriffen werde. Das ist sehr charakteristisch, weil die Weltanschauung Carneris wirklich instinktiv vergeistigter Materialismus, man könnte sogar sagen, reinster Spiritualismus ist. Und nur durch den Hang der Zeit, durch die Wirkung der Zeit trat die Täuschung ein, als ob dasjenige, was nur geistig gemeint sein kann, wenn Carneri davon spricht, im Grunde genommen nur Äußerungen des Stofflichen wären. Aber was Carneri so instinktiv idealistisch, bewußt naturalistisch erfaßt, muß
er notwendigerweise an die Ethik angliedern. Und das, was der Mensch sich sittlich erarbeitet, wird für Carneri, weil er einen gewissen Monismus der Weltanschauung anstrebt, selber nur zu einer Summe höherer Naturgesetze. Und so verlegt Carneri gerade dadurch, daß er der charakterisierten Täuschung unterliegt, das Sittliche, die höchsten Impulse des sittlichen Handelns, in die Menschenseele wie Naturimpulse hinein. Und da sieht man besonders, was eigentlich bei solchen Geistern wie Carneri im Grunde tätig ist. Sie lebten in ihrer Jugend in einer Weltanschauung, die einen gründlichen Schnitt zwischen Geist und Natur machte. Das konnten sie nicht mit dem Drang ihrer Seele vereinen. Was die Naturwissenschaft seit drei bis vier Jahrhunderten hervorgebracht hat, das hatte diese Geister zu einem instinktiven Erfassen gebracht: Nein, die Natur kann das nicht sein, was sie im Grunde genommen nach den alten Überlieferungen ist oder sein sollte, die Natur kann in vielen ihrer Gebiete nicht einfach ein verlassenes Kind der Götter sein. Was Gesetzmäßigkeit der Welt ist, muß in der Natur leben.
Und trotzdem solche Menschen nur Naturalisten sein wollten, war es im Grunde genommen zunächst der Drang, der Natur ihren Geist zu lassen, was in ihnen lebte. Dadurch sind diese Menschen so ungeheuer charakteristisch. Und wenn selbst bei Sueß, dem Geologen, nachgewiesen werden kann, wie aus seinem Österreichertum die besondere Färbung, die menschliche Färbung seines großen Geologie-Werkes hervorgegangen ist, so könnte man das Entsprechende auch bei einem Philosophen wie Carneri nachweisen, wenn man jetzt sein Seelenleben verfolgte. Gerade was sich aus der Anschauung in bezug auf den gesetzmäßigen Zusammenhang der verschiedensten national gefärbten Menschengemüter ergibt, wie sie sich in Österreich finden,
das bewirkte besonders, daß da in komplizierter Gestalt, in mannigfaltiger Gestalt Menschenbilder auf Menschen-bilder so vor die Seele traten, daß Rätsel über Rätsel entstand. Und indem man Menschenerlebnisse betrachtete, Menschen, die man täglich vor sich hat, betrachtete man etwas, wo das Natürliche ins Moralische herauf spielt und das Moralische wieder ins Natürliche hinunter spielt. So war es denn auch, daß sich bei Carneri eine edle ethische Weltanschauung über den historischen Menschheitsverlauf innig mit einem gewissen Naturalismus vermischte, der aber im Grunde genommen nur ein Übergangsprodukt, ein Übergangsstadium ist, aus dem am allermeisten gerade dasjenige als ein späteres Stadium gefunden werden könnte, was hier vertreten wird als Geisteswissenschaft, wenn man sich nur dessen bewußt ist, daß alles in der Welt seine geschichtliche Entwickelung braucht.
So verbindet sich bei Carneri ein gewisser Blick über das ethische, geschichtliche ethische Leben der Menschheit mit dem natürlichen Leben. Naturleben und Geschichtsleben fließen ihm in eins zusammen. Er schärft an den von ihm so wunderbar, ich möchte sagen, so lieb intim betrachteten Naturerscheinungen seinen Blick für die Menschheitserscheinungen, insofern sie sich zwischen Volk und Volk abspielen. Das eine klärt immer über das andere auf. Und Carneri hatte ja nun insbesondere dadurch Gelegenheit, daß er durch lange Zeit Abgeordneter des österreichischen Parlaments war und daß er die Grundbedingungen des damaligen Österreichs in ehrlichster Weise in seine Seele aufnahm, mittun zu können an der Entwickelung des Schicksals Österreichs. 1821 ist er in Trient geboren als der Sohn eines höheren österreichischen Staatsbeamten. Es ist merkwürdig, daß ich Ihnen heute vielfach solche Persönlichkeiten schildern muß, die äußerlich von tiefem Leide
geplagt werden. Ein Zwillingskind war Carneri. Seine Zwillingsschwester entwickelte sich ganz gut. Er aber war von Anfang an mit einer Verkrümmung der Wirbelsäule behaftet. Er war sein Leben lang krank, halbseitig gelähmt. Auch er war mit Conrad Deubler in Korrespondenz. Und obwohl ich schon von anderer Seite her aufmerksam gemacht habe, wie eigentlich dieses äußere Leben Carneris war, so möchte ich Ihnen doch noch die Worte vortragen, die Carneri am 26. Oktober 1881 an Deubler schrieb, damit Sie sehen, was für ein außerordentlich physisch geplagter Mann dieser Carneri war. «Wissen Sie», so schrieb Carneri an Deubler, «daß mir die Schilderung Ihres Heims das Herz recht schwer gemacht hat? Es hat mich an meine gesunde Zeit erinnert. Ich habe den Wald knapp hinter dem Hause und betrete ihn seit Jahren nicht mehr, da ich nur auf ganz ebenen Wegen gehen kann. Auf jeden höheren Naturgenuß habe ich längst verzichtet, aber auch auf alles, was man gesellige Unterhaltung nennt. Ich kann übrigens nicht sagen, daß ich mich dadurch weniger glücklich fühle. Durch einen Muskelkrampf am Halse (torticollis intermittens), der sich oft über den halben Körper ausdehnt, ist meine Existenz eine außerordentlich beschwerliche. Aber ich mache mir nichts daraus, und darauf kommt's an. Kurz, es wird schwer möglich sein, daß ich Sie besuche; ist es aber eines Tages durchführbar, so geschieht's. Wir halten übrigens fest zusammen, auch ohne uns von Angesicht zu An-gesicht zu kennen, und das ist die Hauptsache.»
Und ich habe hier schon einmal vorgelesen, wie die österreichische Dichterin Marie Eugenie delle GTazie, welche Carneri gut kannte, aus einer ergreifenden Szene das Äußere Carneris schilderte. Sie schildert es folgendermaßen: ... . #SE065-356
und Lebensfreude?> schrie ich gequält auf, als Carneri einmal in meiner Gegenwart einen solchen Anfall erlitt. Langsam erhob er das tief auf die Brust herabgesunkene Haupt, wischte mit der bebenden Linken den Schweiß von Stirn und Wangen, atmete tief auf und sah mich an mit einem Blicke, der wieder ganz Sonne und Überwindung war. lächelte er dann. , er lächelte aufs neue, , er wies auf seinen noch zuckenden Körper,
So spricht einer, der allerdings aus der vorher charakterisierten Täuschung heraus glaubt, Naturalist zu sein, der aber aus dem Naturalismus heraus eine edle Ethik gesogen hat. Aber er zeigt uns auch eine Persönlichkeit, die in gewisser Beziehung vieles wie konzentriert, wie vereinigt in sich trägt, was echt österreichisch ist, dieses: eine Eigenschaft der Seele zur Stärke der ganzen Seele machen und es nicht ertragen können, daß Schwäche als Schwäche wirkt -ich sage nicht: genommen wird, sondern wirkt -, das war besonders in diesem Carneri ausgebildet. Und das Sinnige ist über seine ganze Philosophie ausgegossen. Und wenn Sie seine Werke lesen, werden Sie dieses Sinnige finden. Sie werden aber auch das unendlich liebende Eingehen auf die Tatsachen des Lebens finden. Es tritt uns übrigens schon hervor in seinen Gedichten, in seinen verschiedenen Schriften, die schon von 1840 an erschienen. Und der ganze Carneri - es war wunderbar, ihn anzuschauen. Er steht lebendig
vor mir, wenn ich hinuntersah von der Galerie des österreichischen Abgeordnetenhauses. Es war das immer ein wichtiger Tag, wenn man wußte: Carneri werde sprechen, Carneri, der halb Gelähmte, der nur auf ebenen Wegen gehen konnte, der nur so sprechen konnte, daß gewissermaßen die halbe Zunge an dem Sprechen teilnahm, daß auch nur das halbe Hirn an dem Denken teilnahm, - dieser Carneri hatte den Sieg über seine äußere Leiblichkeit erfochten; daß er dastand nun, und daß aus seiner Rede ungeheuerster Scharfsinn herausklang, mit dem er durchschaute alles, was zu durchschauen war, was zu geißeln war. Und überall traf er das richtige Wort, das wie ein Pfeil hinschoß auf diejenigen, die es treffen sollte, und das überall anfeuern konnte dasjenige, was er anfeuern wollte. Carneri war viel zuviel Idealist, als daß nach seinen Reden immer hätten Taten folgen können. Aber seine Reden waren in einer gewissen Weise gefürchtet. In wissenschaftlicher Weise trug er dasjenige vor seinem Parlament vor, was er in seinem ganzen Denken trug - man möchte sagen:
Österreich. Dieses lebte und dieses sprach. Und ob er da sprach, wo er mit etwas einverstanden sein konnte, oder ob er als Gegner sprach, - dasjenige, was erkennender österreichischer Patriotismus war, das sprach immer aus Carneri; ein solcher Patriotismus, welcher die Aufgaben dieser österreichischen Volksgemeinschaft in dem ganzen geschichtlichen Werden der Menschheit sucht. Und auch wenn er über das Einzelne sprach - nicht etwa dadurch, daß er abstrakt sprach, sondern in der ganzen Färbung, wie er sprach -, lebte ein großer historischer Zug. Und selbst wo er tadeln mußte, wo er bitter tadeln mußte, da lebte in seinen Gedanken die Blutsverwandtschaft, möchte ich sagen, dieses Denkers Carneri mit dem Österreichertum. Deshalb wird derjenige, der das weiß, nie vergessen können, wie aus
Carneris Munde einmal geklungen haben mußten die Worte aus einer seiner letzten Reden, wo er manches herankommen sah, was die Gegner Mitteleuropas überschätzt haben, was nicht so war, wie die Gegner Mitteleuropas geglaubt haben, was aber doch von vielen aus Unverstand hätte her-aufgeführt werden können. Carneri war einer von denen, die es von ferne sahen, die sich aber vor allen Dingen nicht bloß kritisierend daran beteiligen wollten, daß Österreich wirklich stark bleibe. Deshalb wirkte auch sein Tadel so, daß er in der Seele bleiben konnte. Und nicht vergessen haben diejenigen, die gehört haben einen solchen Tadel, einen solchen von der tiefsten Empfindung durchdrungenen Tadel, den er in einer seiner letzten glanzvollsten Reden ausgesprochen hat, wo er sagte: «Ich dokumentiere damit meine Überzeugung, . . . die in zwei Worte sich zusammenfassen läßt, in zwei Worte, die ich - und ich habe in meinen sechzig Jahren manchen ernsten Moment durchgemacht - heute zum erstenmal in meinen Leben ausspreche:
Armes Österreich!» Daß solche Worte gesprochen werden konnten, daß es Menschen gab, die so empfanden, darin liegen vielfach die Kräfte, die heute ihr Gegenbild in Schmähungen der Gegner Österreichs, außerhalb Österreichs, bei den Feinden Österreichs haben. In Carneri lebte etwas von dem Geiste derer, die Österreich kraftvoll in seiner Mannigfaltigkeit zum Einklang zu bringen bestrebt waren, weil sie die Notwendigkeit des Einklanges dieser Mannigfaltigkeit eingesehen haben.
Zuletzt wurde er blind. Seinen achtzigsten Geburtstag feierte er im Jahre 1909 - bis dahin war er blind geworden. Als Blinder schrieb er dazumal an seiner Dante-Übersetzung. Er diktierte aus dem Gedächtnis heraus, denn er hatte Dantes Göttliche Komödie in seiner Seele, konnte sie aus dem Gedächtnis heraus übersetzend diktieren. Er hatte
damals sein Leben hinter sich. In vielen lebt es weiter, in mehr Menschen, als man glaubt. Er war blind geworden, schwach geworden. Als blinder Mann im Rollsessel saß er; achtzig Jahre hatte er hinter sich, sechzig Jahre in Wirksamkeit. Das «erkannte» - in Paranthese sage ich das -, als dieser Mann achtzig Jahre und blind geworden war, die Wiener Universität «an», indem sie ihm, als achtzigjährigem blinden Mann, das Doktor-Diplom ausfertigte und es aussprach, daß sie etwas von seinen Verdiensten verstehe, mit den Worten: «Wir schätzen es hoch, daß Sie es vermocht haben, Ihren wissenschaftlichen Ideen eine solche Form zu geben, welche dieselben befähigt, auch in weitere Kreise des Volkes zu dringen, und daß Euer Hochwohlgeboren auch in Ihrer öffentlichen Tätigkeit neben der edelsten Hingabe an Österreich stets jene Grundsätze der Freiheit vertreten haben, ohne deren rückhaltlose Anerkennung eine erfolgreiche Förderung der Erkenntnis und der wissenschaftlichen Arbeit nicht moglich ist.» Man muß doch froh sein, daß derlei Dinge, wie sie Carneri zum Segen seines Landes und, ich darf auch schon sagen, zum Segen der Menschheit geleistet hat, doch wenigstens anerkannt werden; wenn man auch, bevor sie anerkannt werden, achtzig Jahre alt, blind und taub werden kann. Nun, das ist so der Gang der heutigen Entwickelung.
Ich habe Ihre Geduld leider schon viel zu lange in An-spruch genommen; aber ich könnte lange fortfahren, indern ich versuchte, nicht durch Beschreibung, sondern durch Symptome zu schildern, worin, wie ich glaube - selbstverständlich nicht immer in solcher Veredelung -, österreichisches Volkstum lebt, worinnen sich das aber auch erweist, was dieses österreichische Volkstum ist, wenn es sich in seinen edelsten Blüten zeigen kann. Ich habe diese edelsten Blüten angeführt, weil ich glaube, daß es gut ist, wenn die
Bevölkerung Mitteleuropas sich nunmehr in unserer schweren Zeit genauer kennen lernt, auch geistig kennen lernt. Denn die Zeit schmiedet aus diesem Mitteleuropa ein Ganzes, und in diesem Ganzen waltet schon ein einheitlicher Geist. Und je näher man diesen einheitlichen Geist kennen lernt, desto lebensvoller wird er einem erscheinen, und desto mehr Vertrauen wird man zu ihm haben können. Um so mehr wird man glauben können, daß er trotz aller Verkennung nicht überwältigt werden kann. In den deutschen Vertretern Mitteleuropas lebt ja vielfach das, was ich schon charakterisieren mußte als ein nicht einfach instinktives Hingeben der Nationalität, sondern ein Ansehen des Nationalen wie ein Ideal, zu dem man sich hin entwickeln will, das in der Geistigkeit, in der Kraftentfaltung besteht, dem man sich immer nur nahen kann und das man erst recht würdigen kann, wenn man es im Zusammenhange mit dem betrachtet, was zum Heile der ganzen Menschheit führt. Wirklich, es ist schon gerade bei den deutschesten Deutschen etwas, wenn sie von ihrer Nationalität sprechen, was die anderen nicht verstehen können; denn niemals lebt in den Deutschen etwas anderes als die Pflicht: Du mußt das entwickeln, was sich durch deine Nationalität in der Welt ausleben will! Entwickelungspflicht ist gewissermaßen National-Sein. Daher immer der Drang: hineinzu-stellen das Erfühlen der eigenen Nationalität in das Erfühlen der Ziele der ganzen Menschheit. Und so war es auch bei Carneri, daß er zusammengefügt fand in seiner Seelenbetrachtung das, was ethisch als die Grundzüge der ganzen Menschheitsentwickelung verbunden werden muß mit Naturgesetzmäßigkeit. Das war für ihn eine Einheit. Aber das betrachtete er so liebevoll, daß sich für ihn auch die deutschen, die germanischen Ideale hineinstellten in das, was historische Entwickelung der ganzen Menschheit
ist. Und er konnte vergleichen, und nur deshalb, weil er wirklich verglich, deshalb fühlte er sich berechtigt dazu, über das Germanische so zu denken, wie er dachte. Ich hätte viel mehr davon zu sagen - die Zeit ist nicht mehr ausreichend. Solch ein Geist wie Carneri sieht sich erst die Wesenheiten der verschiedenen Nationen an, dann gestattet er sich, den Wert seiner eigenen Nation vor sich selber im rechten Bilde auftauchen zu lassen. Er betrachtet im Zusammenhang mit anderen National-Substanzen die eigene National-Substanz. So sagt er sich von diesem Gesichtspunkte aus: Mit allem Deutschen ist vereinbar die Freiheit aller Nationen, das Geltenlassen jedes Nationalen, denn das liegt in der ganzen deutschen Entwickelung. Und dem widerspricht für Carneri das panslawistische Ideal zum Beispiel, das von vornherein von der Anschauung ausgeht, jeder Nation müsse einmal die Vorherrschaft zuerteilt werden; das dahin arbeitet, die Vorherrschaft zu bekommen. Demgegenüber sagt Carneri: Die Führung des germanischen Geistes, die Europa beherrscht und bis in den fernen Westen reicht, entstammt dem Sittlichkeitsbegriff, der auf dem günstigen Boden, der ihn zum Blühen gebracht hat, gemeinnützige Früchte trägt. Sie kann darum nicht anders als dauern, solange diese Welt bewohnbar ist. Und gerade in der Zeit, als Carneri dem österreichischen Parlament angehörte, war die Situation Mitteleuropas, insbesondere auf politischem Gebiete und auf dem Gebiete der politischen Betrachtung so, daß England und englische Verfassung wie ein Vorbild angesehen wurden. Viele Politiker wollten geradezu die Verfassung aller Länder dem englischen Vor-bilde nachbilden. Und vieles andere in England wurde als Vorbild angesehen. Carneri stand durchaus in einer solchen Politik drinnen, wo viele seiner Genossen so dachten. Carneri aber wollte zur Klarheit kommen. Carneri wollte in
der Menschheitsbetrachtung objektiv sein. Aber aus dieser Objektivität heraus ergab sich für ihn sein Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem germanisch-deutschen Wesen und seine objektive Beurteilung eines Landes wie England. Was ich jetzt von ihm mitteilen werde, hat Carneri nicht nur vor dem Kriege geschrieben - er ist ja lange vor dem Kriege gestorben -, er hat es in den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts geschrieben. «England» - sagt er -, «das Land des anhaltenden Fortschritts schlechthin, wird allgemeinen Ideen sich zuwenden, soll es nicht herabsteigen von der stolzen Höhe, die es erklommen hat. Nichts charakterisiert es besser, als die Tatsache, in der selbstbewußten Entfaltung seiner Größe so
geworden zu sein, daß es den größten Dramatiker der Welt geboren zu haben - durch die Deutschen erfahren mußte!» Das ist in einem solchen Geiste wie Carneri nicht irgendein Chauvinismus, das ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem deutsch-germanischen Wesen; aus Erkenntnis heraus ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das gerade aus tiefer Erkenntnis heraus erwächst, und das sich nicht gestatten will, in der Welt aufzutreten und das in Anspruch zu nehmen, was es in Anspruch nehmen darf, bevor es sich rechtfertigen kann vor der gesamten Mission der Erdenmenschheit. Das ist etwas, was, ob es nun in Deutschland, ob es in Österreich gesprochen wird, wenig Verständnis finden kann bei den anderen, weil es im Grunde genommen gerade die nationale Auffassung des spezifischen Deutschtums ist.
In bezug auf Österreich aber habe ich Ihnen, wie ich glaube, mehr als es beschreibende Worte können, etwas von dem Österreichertum dadurch charakterisiert, daß ich einiges von lebendigen Menschen zeigte. Und ich hoffe, das Österreichertum in diesen lebendigen Menschen so getroffen zu haben, daß durch die Anschauung dieser lebendigen
Menschen die Überzeugung entstehen kann, daß dieses Österreich nicht nur ein zusammengewürfeltes Mannigfaltiges ist, das durch irgendeine Willkür zusammengetragen ist, sondern daß es einer inneren Notwendigkeit entspricht. Die Menschen, die ich Ihnen anzuführen versuchte, sie beweisen das. Und sie beweisen das, meine ich, dadurch, daß man von ihnen als von tief denkenden, aus tiefem Temperament heraus sich eine Weltanschauung oder eine Kunst suchenden Seelen heraus sagen kann, was auf einem anderen Gebiete und in anderer Beziehung gesagt worden ist mit Bezug auf den österreichischen Feldmarschall Radetzky. Man hat mit Bezug auf den österreichischen Feld-marschall Radetzky einmal das Wort gesagt, das dann geflügelt worden ist: «In deinem Lager ist Österreich!» Ich glaube, man kann das Wort erweitern und von solchen Menschen, wie ich sie Ihnen zu deuten versuchte, sagen, indem man damit zeigt, daß in suchenden Seelen Österreich lebt, Österreich lebt wie etwas, das sie als eine Notwendigkeit empfinden: «In ihren Gedanken lebt Österreich!» Und ich glaube, es lebt Österreich auf eine lebendige Art.
WIE WERDEN DIE EWIGEN KRÄFTE DER MENSCHENSEELE ERFORSCHT? Berlin, 11. Februar 1916
#G065-1962-SE364 - Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben
#TI
WIE WERDEN DIE EWIGEN KRXFTE DER
MENSCHENSEELE ERFORSCHT?
Berlin, 11. Februar 1916
#TX
Über die große Zeit der Geistesentwickelung, die man nennen kann die Zeit des deutschen Idealismus, habe ich hier im Verlaufe der gehaltenen Vorträge öfter gesprochen. Und im wesentlichen ist ja wohl auch in weiteren Kreisen heute bekannt, was der ganze intime geistige Entwickelungsgang von Kant bis über Hegel herauf für das Geistesleben der Menschheit überhaupt bedeutet. Allerdings möchte ich nicht versäumen, wenn so etwas erwähnt wird, zugleich hinzuzusetzen, daß die großen Denkergestalten, die dabei in Betracht kommen, niemals eigentlich richtig gewürdigt werden, wenn man auch nur einigermaßen noch auf dem Boden steht, der einen dazu bringt, dasjenige, was ein Mensch als eine von ihm erkannte oder, sagen wir besser, gemeinte Wahrheit ausspricht, als Dogma hinzunehmen. Man kann darüber hinaus sein; dann ist man in der Lage, die Formulierung irgend einer menschlichen Meinung, einer menschlichen Aufstellung vollständig fallen zu lassen. Aber zu schauen die Art und Weise, wie ein Mensch nach Wahrheit gestrebt hat, wie gewissermaßen der Wahrheitstrieb in ihm lebte, das Wie des Suchens nach Wahrheit, das ist dasjenige, was als das ewig Interessante bleibt gegenüber den Gestalten namentlich der Denker der Vorzeit. Und unter vielem anderen kann insbesondere gegenüber den Denkern des deutschen Idealismus bleiben dasjenige, was einem sozusagen immer wieder fühlbar wird, wenn
man sich in sie vertieft: daß sie sich errungen haben ein gewisses Orientierungsvermögen über dasjenige, was der Mensch Wahrheit, Wahrheitsforschung, Weltanschauung nennen kann, daß sie gewissermaßen gewußt haben, wie unmöglich es ist, sich in der Welt zu orientieren, wenn man nur darauf angewiesen ist, die Eindrücke der Welt zu nehmen, sie auf sich wirken zu lassen, um gewissermaßen wie ein Spielball ihnen hingegeben zu sein. Diese Denker wußten vor allen Dingen, daß das, was entscheiden kann über Wahrheitssinn, über Weltanschauungssinn, in dem Tiefsten der menschlichen Seele selber zu suchen ist, da heraufgeholt werden muß.
Ein weniger anerkannter Nachzügler dieser großen Denker, der auch weniger bekannt geworden ist, war nun Karl Rosenkranz. Und dieser Karl Rosenkranz hat in den sechziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts versucht, dasjenige vor seinem geistigen Auge Revue passieren zu lassen, was sich als Anschauung über die menschliche Seele und deren Kräfte seit dem deutschen Idealismus durch die Einflüsse einer mehr naturwissenschaftlichen Denkweise entwickelt hat. Wie sich nun Karl Rosenkranz, der fein-gebildete, feinsinnige Hegelianer, über diese Seelenforschung der dreißig Jahre, die auf die Zeit des deutschen Idealismus gefolgt sind, ausgesprochen hat, das möchte ich Ihnen in der Einleitung zu den heutigen Betrachtungen einmal vorlesen. Karl Rosenkranz schrieb 1863:
«Unsere Tagesphilosophie kommt so oft auf die Kantsche zurück, weil dieselbe der Ausgang unserer großen philosophischen Epoche gewesen ist. Sie sollte aber von Kant nicht bloß diejenigen Seiten aufgreifen, die ihr bequem sind, sondern sie sollte ihn in seiner Totalität zu begreifen suchen. Dann würde sie auch begreifen, daß man auf Kant wohl als Begründer unserer deutschen Philosophie
und als ein Ideal philosophischen Strebens zurückgehen kann, nicht aber um bei ihm stehen zu bleiben. Die Bescheidenheit der Wissenschaft besteht darin, Grenzen, die man für sich erkennt, anzuerkennen, und nicht mit einem Scheinwissen sie zu überfliegen, nicht aber darin, seinen Stolz mit der Demut eines unkritischen Nichtwissens oder schwächlichen Zweifelns aufzublähen und von der Geschichte überwundene Standpunkte deshalb als absolute zu proklamieren, weil man sich auf andern, selbstgemachten nicht halten konnte. Unserer Tagesphilosophie ist über allen Induktionen, über aller physikalischen und physiologischen, psychologischen und ästhetischen, politischen und historischen Mikrologie der Begriff des Absoluten» - und unter «absolut» versteht ja Karl Rosenkranz die Philosophie des Geistes -, «ohne welchen doch wirkliche Philosophie nicht bestehen kann, verloren gegangen. Für diesen Begriff hört alles Anschauen, alles Entdecken durch Teleskope und Mikroskope, alles Berechnen auf, er kann nur noch gedacht werden.»
Das kann man sagen von diesen Denkern: Sie haben einen Sinn gehabt für die Produktivität des Denkens; sie haben ein Vertrauen gehabt in die Kraft des Denkens, die, indem sie sich in sich selber verstärkt, in sich finden kann jenen Quell, aus dem heraussprudelt dasjenige, was über die Welt aufzuklären vermag. Und sie haben gewußt:
Wenn auch die äußeren Methoden und Instrumente der Naturforschung noch so vervollkommnet werden - auf dem Gebiet, das durch die äußeren Methoden, durch die äußeren Instrumente erobert werden kann, ist das, was des Menschen eigentlich Geistbelebendes ist, nicht zu finden. Ich habe mir schon öfter hier zu sagen erlaubt, daß diejenige Geisteswissenschaft, die in diesen Betrachtungen vertreten sein will, nicht etwa in irgend einem auch wie immer gearteten
Widerspruch mit der naturwissenschaftlichen Weltanschauung unserer Zeit stehen kann, daß sie im Gegenteil in vollständigem Einklange mit jeder berechtigten Aufstellung der naturwissenschaftlichen Weltanschauung steht. Nicht irgend etwas von einer neuen Religion will diese Geisteswissenschaft sein, eine echte, wahre Fortsetzerin gerade der Naturwissenschaft beziehungsweise der naturwissenschaftlichen Denkweise will sie sein. Und sagen kann man gerade: Für den, der die Entwickelung der Natur-wissenschaft betrachtet nun wiederum in der Zeit, die verflossen ist, seit Karl Rosenkranz das Ihnen Vorgelesene niedergeschrieben hat, bietet sie, wenn man sich wirklich in sie einzulassen vermag, auf jedem Gebiete Impulse, die unmittelbar in diese Geisteswissenschaft hineinführen, hineindrängen. Und gerade dann bietet diese Naturwissenschaft solche Impulse, wenn man sich da auf sie einläßt, wo sie selber versucht, ihre Betrachtungen so auszudehnen, daß sie nach dem Gebiete des Geistigen hingehen.
Nun gibt es eine Wissenschaft, die besonders geeignet ist, einem klar zu machen, wohin Naturwissenschaft kommt, wenn sie an das Gebiet des Geistigen so herantreten will, wie es ihr und ihren Methoden richtig, gemäß ist. Diese Wissenschaft nennt man mit einem etwas schwerfälligen Wort Psycho-Physiologie, und wir haben es in der Regel bei den Psycho-Physiologen mit Menschen zu tun, welche wohl verstehen, gründlich verstehen, die naturwissenschaftlichen Methoden zu handhaben, die man sich in den verschiedenen wissenschaftlichen Werkstätten aneignen kann. Jetzt gibt es ja auch schon psychologische Laboratorien, und wir haben in diesen Psycho-Physiologen auch Menschen, welche genau vertraut sein können - ich will selbstverständlich damit nicht dem Einzelnen gerade ein besonders gutes Zeugnis ausstellen, deshalb sage ich: welche besonders
vertraut sein können - mit der naturwissenschaftlichen Denkweise, mit der Art und Weise dieser natur-wissenschaftlichen Denkungsart, sich zur Welt und ihren Erscheinungen zu stellen. Wir können nun irgendwo anfassen dasjenige, was auf diesem psycho-physiologischen Gebiete geleistet worden ist. Wollen Sie sich in kurzem unterrichten, so rate ich Ihnen, zu der «Physiologischen Psychologie» von Theodor Ziehen zu greifen, weil sie einen raschen Überblick gibt und weil sie im Grunde genommen, selbst die älteren Auflagen, auf der vollständigen Höhe der heutigen diesbezüglichen Forschung steht. Aber man könnte ebensogut diese physiologische Psychologie bei irgendeinem anderen Autor aufsuchen. Wenn man sich nun auf diese physiologische Psychologie einläßt, so bekommt man einen Begriff, wie derjenige, der naturwissenschaftliche Methoden handhabt im Sinne der naturwissenschaftlichen Denkweise, an den Menschen herantritt, um dasjenige zu untersuchen, was, ich möchte sagen, klinisch und im Sinne des physikalischen Laboratoriums, oder des psychologischen Laboratoriums meinetwillen, erfahren werden kann am Menschen, was untersucht werden kann am Menschen, indem der Mensch sich geistig-seelisch äußert. Und man darf sagen, wenn auch noch das, was auf diesem Gebiete Wissenschaft ist, heute vielfach ein Ideal darstellt, so sind überall schon die verschiedenen Wegrichtungen nach diesem Ideal hin zu sehen, und derjenige, der nicht vorurteilsvoll ist, wird die großen Verdienste der einzelnen Forschungen auf diesem Gebiete voll anerkennen wollen. Selbstverständlich sind im Sinne der heutigen naturwissenschaftlichen Denkungsweise diese Forscher bemüht, für alles, was geistig-seelisch verläuft am Menschen, das Physikalische, das Leiblich-Körperhafte zu suchen, diejenigen Vorgänge zu suchen im Menschenleib, die sich abspielen, während
sich ein Seelisch-Geistiges in uns zuträgt. Und gerade auf diesem Gebiete sind, wie gesagt, schon Wegrichtungen eröffnet. Und da erfährt man denn zunächst etwas sehr Eigentümliches. Und in diesem Augenblick, in dem ich Ihnen zu schildern versuche, was man da erfährt, betone ich es ausdrücklich, daß ich mich zunächst vollständig auf den Boden dessen stelle, was auf diesem Gebiet der Wissenschaft berechtigt ist. Man erfährt etwas Eigentümliches; man erfährt, daß die Forscher auf diesem Gebiete dem, was man Vorstellungsleben nennt, also das Leben der menschlichen Vorstellungen, in einer, man kann sagen, wirklich großartigen Weise nachgehen können. In unserem Seelen-leben werden die Vorstellungen durch äußere Eindrücke, die wir empfinden können, angeregt. Diese Vorstellungen gesellen sich zueinander, sie sondern sich voneinander. Darin besteht ja unser Seelenleben, insofern es Vorstellungsleben ist: Wir machen uns von der Außenwelt nach ihren Eindrücken innere Bilder, diese Bilder gruppieren sich. Das ist ein großer Teil unseres Seelenlebens. Nun kann der Psycho-Physiologe verfolgen, wie sich die Vorstellungen innerlich vergesellschaften, wie sie sich bilden, und er kann überall die leiblich-körperhaften Vorgänge so verfolgen, daß er immer sieht: Auf der einen Seite ist der seelische Vorgang im Vorstellungsleben da, und auf der anderen Seite ist der leiblich-physische Vorgang da. Und es wird niemals irgendwie gelingen können, wenn man nur vorurteilslos ist, ein wirkliches Seelenleben im Menschen zu entdecken, zu dem nicht ein solches leiblich-physisches Gegenbild wirklich aufgewiesen werden könnte, wenn auch der Nachweis heute noch vielfach, wie gesagt, ein wissen-schaftliches Ideal ist. Und so ist es denn außerordentlich reizhaft, außerordentlich interessant, in dem menschlichen Denkapparat - jetzt wirklich Denkapparat, im richtigen
Sinne gefaßt, insofern er leiblich-physisch konstruiert ist-, zu verfolgen, wie da alles vor sich geht, indem der Mensch sein Vorstellungsleben innerlich erlebt. Und gerade in dieser Beziehung finden Sie in dem angeführten Buch von Theodor Ziehen außerordentlich Bedeutsames, ja, ich möchte sagen, wissenschaftlich außerordentlich Vernünftiges.
Aber nun das andere Eigentümliche. In dem Augenblicke, wo man im Seelenleben sprechen muß von Gefühl und insbesondere von Wille, da versagt diese PsychoPhysiologie nicht nur, ich möchte sagen, instinktiv, sondern sie versagt bei dem wirklich modernen Psycho-Physiolo-gen sogar ganz bewußt. Und Sie können in dem Buch von Ziehen finden, wie er in dem Augenblicke, wo von Gefühl und von Wille geredet werden soll, sich überhaupt nicht darauf einläßt, die Untersuchungen bis dahin fortzuführen. Wie redet er von Gefühlen? Nun, er sagt es klipp und klar:
Der Naturforscher spricht nicht von einem selbständigen Gefühlsleben im Menschen, sondern indem man die Ein-drücke bekommt von außen - es sind diese Eindrücke stärker oder schwächer, sie haben diese oder andere Eigenschaften -, danach bildet sich ein gewisser «Gefühlston». Er redet nur von Gefühlston, also gewissermaßen von einer Art und Weise, wie sich hereinsenkt erst die Empfindung und dann die Vorstellung ins Seelenleben. Das heißt, der Psycho-Physiologe verliert - verzeihen Sie den trivialen Ausdruck, aber man muß schon so sagen - verliert den Atem in dem Augenblicke, wo er vom Vorstellungsleben und seiner Parallelisierung im psycho-physiologischen Mechanismus übergehen soll zum Gefühlsleben. Und wenn er so ehrlich ist wie Theodor Ziehen, so gesteht er das, indem er einfach ausspricht, wie er es tut: Früher haben die Menschen ja noch naiv gedacht, haben von drei Seelenkräften gesprochen, von einem Denken oder Vorstellen, von einem
Fühlen, von einem Wollen. Allein von einem Fühlen, von einem wirklichen Seelenwesen, das da in Lust und Unlust wie ein Reales lebt, kann gar nicht die Rede sein für den Naturforscher. Das sind alles nur Töne, in denen schattiert auftritt, was Vorstellungs- beziehungsweise Empfindungsleben ist. Also bewußt, nicht nur unbewußt, verliert der Forscher den Atem; bewußt hört er auf, wissenschaftlich zu atmen.
Und in noch stärkerem Maße tritt das auf, wenn von der dritten Seelenkraft geredet wird, vom Willen. Vom Willen finden Sie in der Psycho-Physiologie nichts als das eine, das ausgesprochen wird: Man kann ihn nicht finden, unmöglich finden gerade mit den Mitteln einer vernünftigen naturwissenschaftlichen Denkungsweise. Es ist ein interessantes und ein außerordentlich wichtiges Ergebnis, das festgehalten sein will, das man ernst nehmen muß. Der Naturforscher kann sagen: Nun, ich habe diese meine naturwissenschaftliche Auffassung; mit dieser naturwissenschaftlichen Auffassung finde ich gewissermaßen den Denk-apparat, den Vorstellungsapparat für das Seelenleben, insofern es im Vorstellungsleben abläuft; um das andere kümmere ich mich nicht! - Das kann mit einem vollen Rechte der naturwissenschaftliche Forscher sagen. Der dilettantische Weltanschauungsmensch, der sich heute gern den hochtrabenden Titel Monist beilegt, wird ja allerdings nicht leicht bemerken, daß ganz willkürlich der Atem unterdrückt worden ist, sondern er wird glauben, er atme fort, indem man herübergeht vom Vorstellungsleben in das Gefühls- und Willensleben hinein, und er wird in dem Gefühls- und Willensleben nur eine Art Entwickelungsprodukt des Vorstellungslebens sehen. Da kommt man dann selbstverständlich - wirklich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit - zu dem merkwürdigen Ergebnis, daß solche
Leute sagen - und das tut leider auch Theodor Ziehen -:
Der Wille ist überhaupt nicht vorhanden, der Wille ist eine reine Erfindung.
Was haben wir denn eigentlich, wenn wir bei irgendeiner unserer Betätigungen vom Willen sprechen? Nun, Wille ist ja, wie die Leute in trivialer Anschauungsweise meinen, schon vorhanden, wenn ich nur die Hand bewege. Aber da habe ich zunächst den Eindruck, empfinde einen Vorstellungseindruck, der mich veranlaßt, die Hand zu bewegen. Und dann geht mein Vorstellungsleben über zu der Anschauung meiner bewegten Hand, die ich vielleicht auch mit anderen Sinnen wahrnehme als mit dem Auge. Aber ich habe nur eine Summe der Vorstellungen. Ich gehe einfach über von den Eindrucks-Vorstellungen zu den Bewegungs-Vorstellungen. Das heißt, ich schaue mir eigentlich fortwährend nur zu. Und wenn man überhaupt gegenüber diesen Auseinandersetzungen - ich sage jetzt: des dilettantischen Monismus, der Weltanschauung sein will -, nur ganz Mensch sein kann, so müßte man fühlen, wie man gerade dasjenige ausmerzt, was des Menschen intimste innerliche Erlebnisse sind: das Gefühls- und das Willens-leben, - wenn man den Menschen zu dem macht, wozu er gemacht werden muß, wenn man Naturwissenschaft nicht Naturwissenschaft sein läßt, sondern wenn man aus ihr in dilettantischer Weise eine Weltanschauung machen will.
Für den Geistesforscher hat aber der Weg der Natur-wissenschafter eine außerordentlich große Bedeutung, denn dieser Weg ist heute schon so weit beschritten, daß klar gezeigt wird, wie weit naturwissenschaftliche Forschungsart kommen kann. Es kann schon eine deutliche Grenze aufgezeigt werden. Gerade nun, wenn man sich vertieft in diejenigen Denker, die der naturwissenschaftlichen Richtung vorangegangen sind, in die Denker des deutschen
Idealismus, so findet man bei ihnen ein klares Bewußtsein, daß die höheren Geheimnisse der Welt erforscht werden müssen dadurch, daß man sich versenkt in dieses menschliche Innere. Man hat ja sogar diese Denker deshalb verspottet, daß sie gleichsam wie einen Knäuel diese Welten-geheimnisse aufdröseln, alle aus dem menschlichen Innern heraus entwickeln wollen. Aber charakteristisch ist es auch, wozu es gerade diese Denker gebracht haben, und charakteristisch ist es dann besonders für den Betrachter, was herauskommt, wenn er vergleicht, was die deutschen Idealisten erreicht haben und was dann durch die naturwissenschaftliche Denkungs- und Forschungsweise erreicht worden ist. Was haben diese deutschen Idealisten erreicht, diese viel verspotteten deutschen Idealisten? Hegel - ich darf vielleicht, ohne unbescheiden zu scheinen, auf die Darstellungen aufmerksam machen, die ich über Hegel gegeben habe in den «Rätseln der Philosophie», in der neuen Auflage meiner «Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten Jahrhundert», - Hegel hat versucht, alles dasjenige, wie man sagt, im reinen Gedanken zu erfassen, was draußen in der Welt webt und lebt, gewissermaßen das ganze Gedankennetz herauszusaugen aus der Fülle der Erscheinungen, der Tatsachen und Dinge der Welt. Man wird aber schon zugestehen müssen trotz aller Einwände, daß dieses Gedanken-netz nicht durch Anschauung gewonnen werden kann, nicht durch äußere Beobachtung gewonnen werden kann. Denn man versuche es nur einmal, bloß die Außenwelt auf sich wirken zu lassen, nicht in sich zu erzeugen den Quell des Denkens, der die Seele aktiv macht, - nichts wird herauskommen von Gedanken! Will man aber nicht die Gedanken anwenden auf die Welt, will man den Gedanken jede Bedeutung absprechen, weil sie sich notwendigerweise aus dem menschlichen Inneren wirklich, man könnte sagen, herausspinnen
müssen, dann müßte man verzichten auf jedes gedankliche Besprechen der Welt. Und das wird nicht einmal Haeckel tun wollen!
Indem man den Gedanken überhaupt handhabt, gebraucht, lebt man ganz im Gedanken, in dem Bewußtsein, daß man durch den Gedanken irgend etwas ausdrückt, das Bedeutung hat für die Welt selber. Die Hegelianer waren sich nur dessen bewußt, indem sie den Gedanken handhabten, daß der Gedanke inneres Erlebnis ist und, trotzdem er inneres Erlebnis ist, objektive Bedeutung für das Welten-dasein hat. Aber sehe man einmal genauer zu, was nun die ganze idealistische Denkungsart - ich will jetzt sagen:
durch den Gedanken und in dem Gedanken, für dessen Beobachtungsart sie eine solche Übung gehabt hat - erreicht hat. Man kann eigentlich heute kaum jemandem zumuten, zum Beispiel Hegels Schriften auf dasjenige durchzunehmen, was ich jetzt anführen will. Aber wenn es nun doch jemand tut, so kommt er auf Folgendes: Hegel ist Meister in dem Handhaben des Gedankens, der gar nicht beeinflußt ist von irgendeinem sinnlichen Eindruck von außen, er ist Meister in der Entwickelung eines Gedankens aus dem anderen heraus, so daß man einen ganzen lebendigen Gedanken-Organismus in seinem - nun, gebrauchen wir das schreckliche Wort - System hat. Aber schauen wir uns diesen Hegel mit all seinen Gedanken näher an. Wir können ihn, möchte ich sagen, in zwei Teile teilen. Einen ersten Teil, da entwickelt er Gedanken. Aber alle diese Gedanken beziehen sich auf dasjenige, was äußerlich sinnlich in der Welt ist. Es sind nur, möchte ich sagen, innere Widerspiegelungen dessen, was äußerlich sinnlich in der Welt ist. Und der zweite Teil bezieht sich auf die geschichtliche Entwickelung der Menschheit, auf die sozialen, auf die staatlichen Begriffe, und er gipfelt zuletzt in dem, was der Mensch an
Vorstellungen, an Gedanken, an Ideen entwickeln kann, die sich dann empfindungsgemäß als Religion, anschauungsgemäß als Kunst, und den Ideen gemäß als Wissenschaft ausleben. Also dasjenige, wozu Hegel treten will, indem er den Gedanken in sich belebt, das betrachtet er als den innersten Quell des Weltendaseins, das verfolgt er bis zu der Blüte der Entwickelung in Religion, in Kunst, in Wissenschaft. Aber Religion, Kunst und Wissenschaft - sind sie nicht wiederum bloß etwas, was für die äußere physische Welt eine Bedeutung hat? Oder könnte sich jemand vorstellen, daß der Inhalt der religiösen Überzeugung irgendwie eine Bedeutung haben könnte für eine geistige Welt? Oder könnte er sich gar dem Glauben hingeben, daß die Kunst, die durch das sinnliche Werkzeug sprechen muß, irgendeine Bedeutung haben kann - eine unmittelbare Bedeutung selbstverständlich - innerhalb der geistigen Welt? Oder unsere Wissenschaft? Nun, von der werden wir noch sprechen.
Hegel findet wohl den Gedanken, aber er findet nur einen solchen Gedanken, der, obzwar er im Innern lebt und webt, nur Äußeres abbildet. Dieser Gedanke kann sich nicht einleben in irgendeine Welt, die da sein könnte außer der sinnlich-physischen Welt. Eine geistige Welt kommt durch den Hegelianismus nicht zustande, sondern nur das geistige Bild der physischen Welt.
Und die Naturwissenschaft? Gerade die recht ernst zu nehmende Naturwissenschaft, die darauf gefolgt ist, prüft nun diesen Gedanken, dieses Gedankenleben des Menschen, und findet: Sie kommt damit, indem sie den Denkapparat gleichsam im Menschen für das Gedankenleben findet, bis zum Gefühls-, bis zum Willensleben; da muß sie stehenbleiben. Muß man jetzt nicht annehmen, wenn man beides wirklich zusammenhält: Zwar strebte der Hegelianismus
zum Beispiel, oder überhaupt jene idealistische Weltanschauung, von der wir gesprochen haben, auf der einen Seite wirklich in eine geistige Welt hinein - fand er aber mehr, als bloß das geistige Gegenbild dessen, was nicht geistig ist? Muß man nicht auf der anderen Seite sagen: Also konnte auch dieser Hegelianismus, konnte dieser Idealismus nicht sich den Zugang verschaffen zu dem, was er seinem Dasein nach deshalb schon zugeben muß, weil der Gedanken keine Bedeutung haben könnte als rein Geistiges gegenüber der Wirklichkeit, wenn es nicht eine geistige Welt gäbe? Es ist das Interessante, daß alles das, was der deutsche Idealismus eben noch an Gedanken hervorgebracht hat, zwar aus der geistigen Welt fließt, daß in ihm aber nichts anderes ist als dasjenige, wofür wirklich die naturwissenschaftliche Denkungsweise den Denkapparat annehmen kann. Das heißt aber mit anderen Worten: Will man nun wirklich in die geistige Welt hinein, und will man so hinein, daß man vor der Naturwissenschaft bestehen kann, dann muß man in das Gebiet des Fühlens und Wollens hinein, aber nicht in dem Sinne, wie man fühlt und will im gewöhnlichen Leben, sondern so wie der Naturforscher hineintritt in die Welt der Natur.
Nun habe ich hier von anderen Gesichtspunkten her öfter die Wege angegeben, wie man, im strengsten Sinne auf naturwissenschaftlichem Boden stehen bleibend, wirklich in die geistige Welt eintreten kann. Ich wollte heute durch diesen historischen Überblick nur noch zeigen, wie durch das Denken, das man gewöhnlich kennt, selbst wenn es zu solcher Reinheit, zu solcher kalten, nüchtern eisigen Reinheit getrieben ist wie im deutschen Idealismus, zwar zu der Überzeugung kommen kann: Es gibt eine geistige Welt - denn dieses Denken ist nicht durch einen äußeren Eindruck gewonnen, das muß selber aus der geistigen Welt
stammen -, aber man kann durch dieses Denken in die geistige Welt nicht eintreten.
Warum kann man durch dieses Denken in die geistige Welt nicht eintreten? Ich habe diese Frage öfter, wie gesagt, von anderen Gesichtspunkten hier behandelt. Sie sei heute noch einmal von einem anderen Gesichtspunkt wiederum ins Auge gefaßt. Man kann nicht eintreten, weil man in der neueren Zeit wirklich immer mehr dazu gekommen ist, das aus diesem Denken zu tilgen, was der Naturforscher auch gar nicht mehr darin findet - nämlich Gefühl und Wille herauszutilgen aus diesem Denken. Daß das so ist, dazu braucht man sich nur vor die Seele zu führen, worauf die große, hauptsächlichste Bedeutung der naturwissenschaftlichen Denkungsweise beruht. Sie beruht darauf, daß man möglichst, ich möchte sagen, alles Seelische in sich ertötet, herablähmt, wenn man an die Beobachtung der Natur geht. Der Naturforscher wird streng ausschalten wollen - sei es, daß er beobachtet die Dinge und ihre Tatsachen, sei es, daß er experimentiert - all das, was aus seinem Gefühl, all das, was aus seinem Willen herstammt. Er wird in dasjenige, was er ausdrücken will über das Beobachtete, niemals hineinsprechen lassen, was er den Dingen gegenüber empfindet, was ihm gewissermaßen lieber wäre, wenn's Wahrheit wäre, als dasjenige, was die Dinge sagen, wenn man ganz mit Ausschaltung des eigenen Seelenlebens an die Natur geht und die Natur sich nur selber aussprechen läßt. Man kann sagen, da die naturwissenschaftliche Entwickelung der neueren Zeit drei bis vier Jahrhunderte hinter uns liegt: Man hat wirklich schon eine gute Schule durchgemacht in bezug auf das, was man naturwissenschaftlich Objektivität nennt. Selbstlos, im guten Sinne wissenschaftlich und in vieler Beziehung veredelnd hieße für das menschliche Leben, was man etwa
Ausschalten des Selbst gegenüber der Sprache der Naturerscheinungen nennen kann. Man hat große Fortschritte darin gemacht, man hat es weit gebracht. Und man hat es in der Psycho-Physiologie sogar so weit gebracht, so zu denken, daß man in dem Denken nicht mehr findet Gefühl und Wille. Das heißt: Es ist schon praktisch geworden, lebendig geworden, was Methode der Forschung war. Ausschalten soll man das Seelische bei der Naturbeobachtung. Man hat gelernt, es nun so auszuschalten, daß man es nicht mehr finden kann auf dem ganzen Felde der Beobachtung. Unbewußt bleibt in unserem Denken, wenn wir uns ganz passiv der Außenwelt hingeben, wie es das Ideal des Naturforschers sein muß - wenn er auch die Experimente zusammenstellt, so muß das doch sein Ideal sein -, unbewußt bleibt in dem Denken dasjenige, was man nennen kann: Wille. Es ist gerade das Bestreben, den Willen ganz auszuschalten aus dem Denken, wenn man in bezug auf die Natur im heutigen Sinne forscht. Unbewußt bleibt er, denn man braucht immer einen Willen, wenn man einen Gedanken zum anderen fügt - selber tun sie das nämlich doch nicht - oder wenn man einen Gedanken vom anderen scheidet. Trotzdem bleibt es doch das Ideal der Naturforschung, von diesem Willen, der im Gedankenleben liegt, so viel wie möglich zu unterdrücken. Dadurch ist es natürlich ganz selbstverständlich, daß das naturwissenschaftliche Ideal das innere Seelenleben, ich möchte sagen, für die menschliche Gewohnheit ersterben macht. Und viel mehr als an etwas anderem liegt es an diesem - und ich sage ausdrücklich: berechtigten - naturwissenschaftlichen Ideal, daß die Ausschaltung des Seelischen so hat stattfinden können, wie sie stattgefunden hat, daß man gerade absehen muß von allem Seelischen, ausschalten muß alles Seelische, wenn man treu im Sinne der heutigen Naturforschung der Natur folgen will.
Das aber hat auch noch eine andere Seite. Und diese andere Seite zu betrachten, ist außerordentlich wichtig. Was sucht denn der Mensch eigentlich, wenn er Erkenntnis sucht? Nun, zunächst, wenn er Erkenntnis sucht, sucht er irgend etwas, was abgesehen von ihm wahr ist. Denn wenn er sich die Wahrheit nicht abgesondert von sich denken würde, so könnte er sie sich ja in jedem Augenblicke selber machen. Daß er das nicht will, das wird ja ohne weiteres zugegeben werden. Sucht also der Mensch nach einem Ideal der Erkenntnis, so sucht er gerade in sich etwas zu beleben, wozu er mdglichst wenig selber beiträgt. Bedenken Sie nur, was man heute gegen selbstgemachte Begriffe gerade auf wissenschaftlichem Gebiete hat! Also man strebt an, in der Erkenntnis etwas zu haben, was zwar, ich möchte sagen, spiegelt die äußere Wirklichkeit, was aber ebensowenig zu tun hat mit dieser äußeren Wirklichkeit, wie etwa das Spiegelbild mit dem, was abgespiegelt wird. Wie das Spiegelbild nicht verändern kann, was abgespiegelt wird, so soll auch das, was sich als Erkenntnisinhalt in der Seele belebt, nicht verändern, was sich draußen abspielt. Dann muß man aber alles Seelische ausschalten, dann kann das Seelische gar keine Bedeutung haben für die Erkenntnis. Und wenn man so intensiv anstrebt Ausschaltung der Seele, ist es nicht zu verwundern, daß auf diesem Gebiet das Seelische nicht gefunden werden kann. Daher muß Geistesforschung gerade da beginnen, wo naturwissenschaftliche Denkungsweise enden muß. Das heißt, es muß in dem Denken dasjenige aufgesucht werden, was in dem Denken Wille ist. Und das geschieht bei all dem, was die Seele durchzumachen hat in jenen inneren Experimenten, von denen hier ja öfter gesprochen worden ist, was die Seele durchzumachen hat, indem sie das Denken innerlich erkraftet, innerlich verstärkt, so daß dem Denken nicht mehr
unbewußt bleibt der im Denken wirkende Wille, sondern bewußt wird dieser Wille, so daß der Mensch wirklich dahin kommt, sich so zu erleben, daß er gewissermaßen im Denken lebt und webt, in dem Leben und Weben der Vorstellungen selber drinnen ist und jetzt gar nicht mehr hin-blickt auf die Vorstellungen selber, sondern auf dasjenige, was er tut. Und darinnen muß der Mensch immer mehr und mehr, ich möchte sagen, Techniker werden, immer mehr und mehr innere Praxis sich erwerben, sich einleben in das, was von ihm selber geschieht, indem das Vorstellungsleben sich abspielt. Und alles, was der Mensch da in sich entdeckt, bleibt sonst zwischen den Zeilen des Lebens. Das lebt immer im Menschen, aber es dringt nicht herauf ins Bewußtsein, der Wille wird unterdrückt in dem Vorstellungsleben. Wenn man eine solche innere Vitalität, eine solche innere Lebendigkeit in sich entwickelt, daß man nicht nur Vorstellungen hat, sondern mit seinem Erleben hineingeht in dieses Auf- und Abwogen, in dieses Werden und Vergehen der Vorstellungen, und wenn man das so weit treiben kann, daß man gar nicht mehr in seine Aufmerksamkeit hereinholt den Inhalt der Vorstellungen, sondern nur diese Tätigkeit, dann ist man auf dem Wege, den Willen in der Vorstellungswelt zu erleben, an der Vorstellungswelt wirklich etwas zu erleben, was man sonst im Leben nicht erlebt. Das heißt, man muß gerade, wenn man das treu einhält, wozu die naturwissenschaftliche Vorstellungsweise selber führt, ganz und gar hinausgehen über die Art und Weise, wie Naturwissenschaft forscht. Man muß gewissermaßen nicht das nehmen, was Naturwissenschaft erkundet, sondern man muß sich selber zuschauen beim Naturwissenschafttreiben. Und was auf diese Weise geübt wird, und was wirklich nur zu Erfolgen führen kann, wenn es jahrelang geübt wird - alle wissenschaftlichen
Resultate werden ja auch nur in langer Arbeit erreicht -, was auf diese Weise erreicht wird, das ist ein Einleben des Bewußtseins wirklich in eine ganz andere Welt. Dasjenige, was erreicht wird, das läßt sich eben nur erleben; das läßt sich beschreiben, aber es läßt sich nicht äußerlich aufzeigen, es läßt sich nur erleben. Denn dasjenige, was erreicht wird, das ist, ich möchte sagen, in der Praxis das, worauf schon die naturwissenschaftliche Denkweise deutet. Diese naturwissenschaftliche Denkweise sagt uns ja: Geh' ich auf meinem Wege fort, so komme ich an eine Grenze. Ich gehe so weit, als ich noch etwas vom Menschen finde. Da finde ich nicht eine Welt, in der Wille und Gefühl ist. - Aber diese Welt, wo man Gefühl und Wille ebenso objektiv entdeckt, wie sonst hier die Pflanzen und Mineralien, diese Welt findet man, wenn man zwischen den Zeilen des sonstigen Vorstellungslebens dieses innere Erleben der Vorstellungen in der Seele wirksam machen kann. Nur erlebt man jetzt dasjenige, was man sonst nur ahnen kann. Der Naturforscher wird heute schon mehr oder weniger geneigt sein zu sagen: Es ist ein blinder Aberglaube, wenn irgend jemand behauptet, das, was in der physischen Welt als Denken, als Vorstellen bekannt ist, das könne sich irgendwie vollziehen ohne einen Denkapparat, ohne ein Gehirn, ohne ein Nervensystem. Der Naturforscher behauptet es aus seiner Theorie heraus. Leicht könnte man glauben - und Dilettanten in bezug auf diese Geistesforschung glauben es -, daß die Geistesforschung dieser Behauptung des Naturforschers unrecht geben muß. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, der Geistesforscher steht, insofern sich diese Behauptung gut aus den naturwissenschaftlichen Tatsachen ergibt, gerade voll auf dem Boden der Naturforschung auf diesem Gebiete. Nur, daß er sogar erlebt, was der Naturforscher aus der Theorie heraus behandelt. Erlebt man es nämlich, dieses
Weben und Leben, das ich angedeutet habe, in der Vorstellungswelt, dann weiß man: Jetzt ist man erst da angelangt, wozu der Denkapparat einem nichts mehr geben kann. Alles Denken, das man bisher geleistet hat, ist an den Denkapparat gebunden. Jetzt ist man erst angelangt bei jenem inneren Erleben, Erweben, das nicht mehr an den Denkapparat gebunden ist.
Aber man ist zugleich bei etwas angelangt, was, wenn man es sagt, selbstverständlich zunächst vor den gewohnten Vorstellungsarten der Gegenwart verrückt erscheint. Aber alles, was in der Wissenschaft einmal aufgetreten ist und sich einfügen mußte der Geistesentwickelung der Welt, war ja zuerst verrückt und dann selbstverständlich. Es erscheint zuerst verrückt, aber es ist doch eine Wahrheit. Man ist, indem man dieses innere Weben und Leben wirklich innerlich regsam gemacht hat, aus der Welt draußen, die man zwischen Geburt oder, sagen wir, zwischen Empfängnis und Tod hier auf der Erde erlebt, - man ist draußen. Man ist in einer Welt, die man nicht im physischen Leibe erleben kann. Man ist vielmehr in der Welt, der man angehört hat vor der Geburt oder, sagen wir, als das Geistig-Seelische sich erst angeschickt hat, sich allmählich an dasjenige anzupassen, was ihm von der Vererbungsströmung an Körperlichem gegeben worden ist, oder was es sich selber gibt -darauf wollen wir heute nicht eingehen. Man ist in den Kräften drinnen, die den Denkapparat nicht gebrauchen, um ein Vorstellungsleben zu entwickeln, sondern Kräften, die den Denkapparat erst bilden und fertig ausbilden erst im Grunde genommen im Leben nach der Geburt. Denn das innere Nervenleben, das innere Nervenweben wird ja erst ausziseliert, ausplastiziert im Verlauf der ersten Jahre und noch lange hinaus, wenn wir unser physisches Dasein betreten haben. Man ist in den Kräften drinnen, die als plastische
Kräfte diesen Menschen innerlich formen, damit er das werden kann, was er ist; damit er ein Geschöpf seines geistig-seelischen Selbstes ist. Nur darf man eben nicht glauben, daß man dieses Draußensein nicht in vollem, und ich meine jetzt, praktischem Ernste nehmen müsse. Denn sehen Sie, es wird aus einer selbstverständlichen Schwäche der Menschennatur heraus an den Geistesforscher immer wieder die Anforderung gestellt werden, zunächst dasjenige zu erkennen, was unmittelbare Gegenwart ist, was so, ich möchte sagen, mehr das verworrene Geistige der physisch-sinnlichen Welt ist. Hier in der physisch-sinnlichen Welt lernt man die Dinge kennen mit den Sinnen. Das aber, was diese Sinne selber erst geformt hat, das, was als der Baumeister diesen Sinnen zugrunde liegt, das lernt man kennen, wenn man sich aus der physischen Lebenszeit hinaus in die Zeit zu versetzen weiß - auf die Art, wie's geschildert worden ist -, die vorangegangen ist dem physischen Leben und die nachfolgen wird dem physischen Leben. Man lernt eine Welt kennen, mit der diese Welt hier im Grunde genommen keine Ähnlichkeit hat. Und in dem, was ich geschildert habe als inneres Erleben der Denktätigkeit statt der Gedanken, eröffnet sich eine wirklich geistige Welt, in dem eröffnet sich wirklich die Welt, in der der Mensch mit anderen Geistwesen zusammen ist, wenn er nicht im physischen Leibe verkörpert ist. Ebenso konkret, ebenso innerlich anschaulich wie die äußere, wirkliche, physische Welt ist diese Welt, die sich da ausbreitet. Nur muß, wie ich auch schon hier ausgeführt habe, noch etwas anderes dazutreten.
Wir sehen, bei dem Wege, der durch das Denken genommen wird, kommt alles an auf ein Erkraften, auf ein Verstärken des Denkens, auf ein innerliches kraftvolles Erleben des Denkens. So kommt es darauf an, daß zuletzt vor diesem
innerlichen kraftvollen Erleben der Inhalt des Denkens liegt, selbstverständlich nur im Bewußtsein liegt, und die Seele sich wirklich selber erleben kann im Weben des Vorstellens. Aber es muß hinzutreten, als ein Parallel-Experiment, möchte ich sagen, unseres Lebens eine Kultur, eine Entwickelung des Willenselementes, des Willens- und Gefühlselementes. Nun, während alles darauf ankommt bei der Entwickelung des Denkens in die geistige Welt hinein, dieses Denken innerlich zu erkraften, ich möchte sagen, es zu erwesen, kommt alles bei der anderen Entwickelung des Willens darauf an, daß man die umgekehrten Eigenschaften entwickelt: Seelenruhe, Gelassenheit; daß man imstande wird, sich dem, was wir unsere Handlungen, die Entfaltungen unseres Wollens nennen, so gegenüberzustellen, wie man es gerade lernen kann an der Naturforschung. Nicht, daß man ein kalter, wie eine Zitrone ausgesogener Mensch wird; das wird man nicht. Im Gegenteil, alles, was sonst vielfach unbenutzt bleibt von dem tiefer liegenden Temperament und den Affekten, tritt so recht vor die Seele, wenn es der Beobachtung unterzogen wird, die aus Gelassenheit und Seelenruhe kommt. Wenn man sich erst übt, so übt, wie etwa Goethe sich geübt hat im Anschauen der Pflanzen-und der Tiertypen, wenn man sich erst übt, die Außenwelt so zu beobachten, daß man wirklich Selbstverleugnung übt und dies dann nicht pedantisch theoretisch überträgt auf die Selbstbeobachtung, sondern sich die entsprechende Bekräftigung aneignet und dann den Blick, den man geschärft hat an der Natur, auf sich selber zurückwendet, dann findet man die Möglichkeit, das eigene Seelenleben, insoferne es sich entwickelt aus Wollen und aus Gefühl, aus Sympathien und Antipathien und als Willensimpulse in die Handlungen fließt, - man gewinnt die Möglichkeit, dieses Seelen-leben so zu betrachten, daß man nun nicht im bildlichen
Sinne, sondern wirklich so neben sich steht und bewußt anschaut diesen Menschen, wie man einen anderen Menschen anschauen kann, oder, wie ich heute vor acht Tagen gesagt habe: wie man auch sein eigenes Leben von gestern in der Erinnerung trägt, weil man es auch nicht verändert. Man schaut das, indem man ein Bewußtsein herausholt aus dem gewöhnlichen Bewußtsein. Man kommt da wirklich zu der Möglichkeit, sich zu sagen: Man hält stille innerhalb des sonstigen Stromes der Seelenerlebnisse, die aus Gefühl und Wille stammen. Dadurch, daß man selber stille hält, daß man vollständige innere Ruhe bekommt, daß man wirklich stehen bleibt, nicht mitgeht mit den Affekten, nicht mitgeht mit den Willensimpulsen und so weiter, sondern eben stehen bleibt mit der Seele, - verdoppelt man sich selbstverständlich. Denn es wäre vom Übel, wenn man, wie gesagt, eine ausgepreßte Menschenzitrone würde, wenn man nicht vollständig auch in dem ganzen Temperamentsmenschen drinnen stehen bliebe, der nun weiter geht; wenn man nicht mitleben könnte mit all seinen Affekten und Temperamenten. Aber der andere, den ich im vorigen Vor-trage den Zuschauer benannt habe, der bleibt stehen: Dadurch bleibt er da, und das eigene Seelenleben beginnt wirklich, sich um ihn zu bewegen, wie die Planeten um die Sonne sich bewegen. Alles ein geistiger Vorgang! Es ist schwierig, dieses Stille-stehen-Lernen, aber man kann das Willensleben nicht beobachten, wenn man nicht stillestehen kann. Wenn man mitgeht mit dem Strom des Willenslebens, so ist man immer in allem drinnen. Wenn man stehen bleibt, dann kann man es beobachten, weil es sich gewissermaßen, wenn ich den groben Ausdruck gebrauchen darf, an einem reibt, indem es vorübergeht, indem es sich von einem entfernt. Dies alles muß aber nicht Theorie bleiben - das Theoriebleiben kann nichts nützen -, sondern
es muß wirklich innere Lebenspraxis werden. Dann ist es kein Bild, sondern Wirklichkeit, daß da ein zweiter Mensch aus dem ersten heraustritt und sich mit diesem vereinigt. Wie sich unter gewissen Bedingungen der Sauerstoff mit dem Wasserstoff vereinigt, so vereinigt sich, wie ich eben geschildert habe, mit dem Menschen, den man ergriffen hat, der mit dem Vorstellungsleben mitlebt und mitwebt, der zweite Mensch. Und das ist nun wirklich ein Mensch, der außerhalb der Vorstellungen lebt. Während man früher in den Vorstellungen eine geistige, konkrete Welt entdeckt, in der es geistige Wesen gibt, wie es hier auf Erden Tiere und Mineralien gibt, so entdeckt man, wenn hinzukommt das, was ich zuletzt geschildert habe, durch das In-Ruhe-Stehen des zweiten Menschen gegenüber den Willensimpulsen, -so entdeckt man in der Tat dasjenige, was aus dieser geistigen Welt immer heraus sich in die physische hinein entwickelt, sich zum Physischen findet; was immerdar in der geistigen Welt danach strebt, einen physischen Ausdruck zu finden entweder durch Vereinigung mit der Physis, wie das beim Menschenleben oder beim Tierleben der Fall ist, oder durch unmittelbare Ausgestaltung, wie es zum Beispiel beim Kristall der Fall ist.
Und jetzt beginnt für das innerliche Erleben dasjenige, was heute von den Menschen wieder vielfach als verrückt angesehen wird, innerliche Erfahrung zu werden; was Lessing gesagt hat, was er so schön ausdrückt in seiner «Erziehung des Menschengeschlechts», jetzt beginnt es Erfahrung zu werden. Jetzt weiß der Mensch - indem er diesen inneren Stillstand gegenüber seinem Leben in Willensimpulsen erreicht hat -, daß etwas in ihm lebt, was auf der einen Seite gerade mit diesem Leib sich vereinigen wollte, weil es solche Kräfte früher entwickelte, wie es jetzt wiederum entwickelt, wie sie sich jetzt zeigen, und wie
sie in diesem Leibe leben, so wie der Keim in der Pflanze lebt. Und wie der Keim in der Pflanze der Quell einer neuen Pflanze ist, so ist dasjenige, was jetzt in dem Menschen also erfaßt wird, der Quell eines zukünftigen Lebens, das erfaßt wird, wenn die Zeit zwischen dem Tod und der Geburt oder einer neuen Empfängnis abgeschlossen wird. Die wiederholten Erdenleben werden ein Gedanke, der eine wirkliche Fortsetzung des naturwissenschaftlichen Entwickelungsgedankens ist. Und nur derjenige, der sein Denken nicht weit genug bringen kann, um einzusehen, daß das, was da im Menschen lebt, wirklich in diesem Menschen, sofern er ein physisches Wesen ist, so lebt, wie physisch der Pflanzenkeim in der Pflanze lebt für eine neue Pflanze, daß da ein geistig-seelischer Mensch lebt, so lebt, daß dieser geistig-seelische Mensch, ich möchte sagen, zunächst seine Hülle hat in dem physisch-leiblichen Menschen, aber die Keimanlage ist für ein folgendes Erdenleben, - nur derjenige, der nicht scharf genug denken kann, der nicht wirklich die Gedanken, die heute schon da sind und die auch in der Naturwissenschaft verwendet werden, nicht ausdenken kann, dem kann die Notwendigkeit entgehen, von der naturwissenschaftlichen Denkungsweise heraus diese ewigen Kräfte der Menschensele zu suchen, die ganz naturwissenschaftlich gesucht werden, indem zuerst einfach, ich möchte sagen, im Ernste die Naturwissenschaft beim Wort genommen wird: daß sie stille stehen muß gegenüber dem Gefühls- und Willensleben, dann aber gerade in dieses Gefühls- und Willensleben hineingelangen wird, indem es dort aufgesucht wird, wo es sonst unbewußt bleibt: im Denken. Und daß auf der anderen Seite das Denken da aufgesucht wird, wo es sich sonst verbirgt; denn im Willen, wo es hineinfließt, verbirgt sich dieses Denken. Dadurch aber, daß gerade diese Naturwissenschaft recht ernst genommen
wird, entdecken sich diese ewigen Kräfte der Menschenseele, die man nicht erreichen kann, wenn man nur so abstrakt den Menschen betrachtet und sich sagt: Nun, in diesem Menschen muß auch ein Ewiges sein, - und die Linien meinetwillen nach hinten und vorne verlängert; denn so kommt man nicht zu diesem Ewigen. Diese Linien sind keine gerade fortlaufenden Linien. Gerade so, wie ich - wenn ich eine Pflanze vor mir habe, diese Pflanze den Keim bildet und in dem Keim die Anlage zur neuen Pflanze ist - von Pflanze zu Pflanze gehen muß, Glied für Glied aneinanderfügen muß, so muß ich beim Menschen in seinem gegenwärtigen Sein dasjenige suchen, was ihn zu einem nächsten Lebenssein führt, und in diesem Lebenssein wird sich wiederum der Keim finden für ein weiteres Lebenssein. Und ebenso findet sich - wenn wir eben dieses Zweite erreichen: Ruhe im Willensleben -, ich möchte sagen, wie ein anderes Gedächtnis, das aufleuchtet, der Rückblick auf die früheren Erdenleben. Allerdings, die meisten Menschen werden ziemlich früh stehen bleiben, wenn sie sich also einer Forschung unterziehen sollen, die nicht eine Forschung ist, die so bequem ist wie die äußere Naturforschung. Da hat man vor sich das Objekt oder das Experiment, da gibt man sich passiv hin, da beobachtet man. Nein, so läßt sich die geistige Welt nicht beobachten! Die geistige Welt läßt sich nur ergreifen, wenn man wirklich sein Inneres ändert, lebendig macht für die geistige Welt. Für die physische Welt hat man die Hände; für die geistige Welt muß man erst dasjenige zu dem Greifen der Vorstellungen herausbilden, was wie innere Hände, wie innere Greiforgane erfassen kann die geistige Welt. Immer aktiv, immer tätig ist der Forscher, wenn er wirklich in der geistigen Welt drinnen steht.
Nun sagte ich aber, man bleibt meistens früh stehen, man
wird den Weg, der ein mühseliger ist, nicht leicht bis an ein erfolgreiches Ende führen. Allerdings, die Wünsche, die bei diesem Erforschen der ewigen Kräfte der Menschenseele erfüllt werden können, diese Wünsche haben gewiß viele Leute - denn nicht wahr, «schön», «unendlich schön» ist es, in frühere Erdenleben zurückzuschauen! Man erlebt es ja immer wieder, wie die Menschen das schön finden. Diejenigen, die ein bißchen hineingerochen haben in dasjenige, was Geistesforschung ist, und sich dann Geistesforscher nennen, bei denen erleben wir es immer wiederum, daß sie in ihre früheren Erdenleben zurückschauen. Es sind allerdings diese früheren Erdenleben dann Erdenleben von selbstverständlich bedeutsamen Menschen, die man auch findet, wenn man die Geschichte da oder dort aufschlägt. Ich habe einmal teilgenommen - ich habe das schon öfter erwähnt - an einem Caféhaustisch einer österreichischen Stadt. Da waren vereinigt: Seneca, nein - Marc Aurel, der Herzog von Reichstadt, Marquise Pompadour, Marie Antoinette, Kaiser Josef und Friedrich der Große. Und alle diese Leute glaubten wirklich an diese ihre Rückschau in frühere Erdenleben!
Bei der wirklichen Rückschau hat es etwas Unangenehmes für die gewöhnlichen Wünsche. Diese Rückschau befriedigt nämlich wirklich nichts anderes als die Erkenntnis. Und man muß ein reines Erkenntnisstreben haben, wenn man überhaupt irgend etwas erreichen will auf diesem Ge-biete. Hat man nicht dieses reine Erkenntnisstreben, dann kann man nichts erreichen. Man kann schon in bezug auf die äußere Natur nichts erreichen, wenn man nicht eben jene Selbstlosigkeit im guten und schlechten Sinne, von der ich gesprochen habe, entwickeln kann. Aber das muß noch gesteigert sein, wenn man nun etwa die Rückschau in frühere Erdenleben entwickeln will. Und da, wenn sie selbst
im eigenen Erleben auftritt, diese Rückschau - erstens enttäuscht sie einen meistens in dem Sinne, auf den jetzt gedeutet worden ist; aber sie kann niemals auftreten - das ist eben ein Erfahrungssatz -, wenn man dasjenige, was man dadurch erfährt, noch in diesem Erdenleben irgendwie verwenden könnte. Ich sage: bei sich selbst auftreten. Also jedesmal, wenn eine Rückschau in frühere Erdenleben wirklich in einem selber auftritt, so kann sie nur die Erkenntnis befriedigen. Sie kann niemals einem irgend etwas helfen für die Befriedigung irgendwelcher Wünsche in dem Erdenleben, in dem man drinnen steht. Wenn also jemand glaubt, er müsse seine früheren Erdenleben kennen, um so recht seine Stellung in der Welt zu würdigen, so wird er, wenn er auf eigene Forschung hin diese früheren Erden-leben erkennen lernen will, sehr fehl gehen. Und auch in vieler anderer Beziehung werden die Wünsche, die irgend-jemand hat, sehr selten irgendwie befriedigt bei wirklicher, echter Geistesforschung.
In bezug auf diese Wünsche muß zum Beispiel folgendes bemerkt werden: Zunächst ist es so, daß derjenige, der sich mehr als Laie oder als Dilettant in die Geistesforschung hineinbegibt - aber das kann selbstverständlich jeder, Sie können das Betreffende nachlesen aus meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» -, der sich so hineinbegibt als Laie, er strebt vor allen Dingen an, recht viel zu sehen, recht viel zu schauen in der geistigen Welt. Das ist selbstverständlich und natürlich. Und so könnte er dann glauben, daß der erfahrene Geistesforscher ihm rät, sich nur ja recht viel zu befassen und alle mögliche Zeit, die er hat, nun anzuwenden auf die Geistesforschung. Der seiner Verantwortung sich bewußte und kundige Geistes-forscher wird das gar nicht tun. Er wird es auch selber nicht bei sich so halten, sondern er weiß, daß es von großem
Übel ist, wenn man das gewöhnliche Denken, das Denken, das man in der äußeren Welt anwenden muß, abzieht von der äußeren Welt, nachdem man Geistesforscher geworden ist; daß es von Übel ist, wenn man das Denken, das hingeordnet ist auf die äußere Welt, nun zurückzieht und nichts mehr von der äußeren Welt wissen will. Wenn man ein Denk-Asket wird, meinetwillen, und alles Denken nur verwendet, um ja sich hineinzubohren in die geistige Welt, wird man in Wirklichkeit nichts erreichen. Man wird ein schwärmerischer Grübler werden. Man wird dasjenige in sich erleben, was nahe, ich möchte sagen, an irgendeinen religiösen Wahnsinn grenzen könnte. Wird man aber wirklich Geistesforscher, so ist notwendig, daß man alle Vorsichtsmaßregeln berücksichtigt - und Sie finden sie sämtlich aufgezählt in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» -, um ein vernünftiger Mensch zu bleiben, derselbe vernünftige Mensch, wie ich heute vor acht Tagen gesagt habe, der man war, bevor man in die geistige Forschung eingetreten ist, - wenigstens nicht weniger vernünftig. Und um das zu erreichen, dazu versucht der Geistesforscher gerade, sein Interesse rege zu erhalten für alles, was in der Außenwelt eben sein Interesse erregen kann. Ja, man wird gerade, wenn man in der geistesforscherischen Entwickelung drinnen steht, und als vernünftiger Mensch darinnen steht, immer mehr und mehr Bedürfnis haben, seine Horizonte in bezug auf Weltbeobachtung und Mitleben mit der Welt zu erweitern, nicht zu verengern, sich mit möglichst vielem zu befassen, was nur mit Erfahrungen, Beobachtungen, Erlebnissen der äußeren, physischen Welt zusammenhängt. Denn je mehr man abgelenkt wird von dem, wohinein man gerade gelangen will, desto besser. Dadurch erreicht man, daß das Denken immer wieder und wiederum, ich möchte sagen, diszipliniert
wird an der äußeren, physischen Welt und sich nicht auf die freie Fluchtbahn begibt, auf die sich die Seele leicht begeben kann, wenn sie sich nun zurückzieht von der äußeren Welt und sich möglichst nur hineinvergräbt in dasjenige, in dem sie zu leben glaubt als in einem geistig Erweiterten. Also, das Interesse, das ist dasjenige, was wie ein äußerer praktischer Rückhalt eben zur Geistesforschung dazugehört.
Daher wird insbesondere dem Anfänger in der Geistes-forschung geraten werden müssen, seine gewöhnliche Lebensweise nicht erheblich zu ändern, sondern gewissermaßen unvermerkt für diese äußere Lebensweise in die Geistes-forschung einzutreten. Wenn man die äußere Lebensweise zu stark ändert, dann ist der Kontrast zu wenig groß - und er muß groß sein - zwischen dem inneren Erleben und dem Erleben mit der äußeren Welt. Alles, was heute so vielfach angestrebt wird von den Menschen, die - nun, wie soll ich sagen - ihr Heil darin suchen, sich von der Welt zurückzuziehen, Kolonien zu gründen, lange Haare zu tragen, wenn man vorher kurze getragen hat, oder, wenn man vorher als Dame lange getragen hat, nachher kurze zu tragen, oder besondere Kleider anzulegen und so weiter, und auch sich andere Lebensgewohnheiten anzueignen, - alles das ist vom Übel. Das ist deshalb vom Übel, weil man zweierlei von sich verlangt: sich einzugewöhnen in eine neue Lebensweise und zugleich sich einzugewöhnen, sich einzuleben in die geistige Welt. Das aber muß bestehen bleiben, was ich heute vor acht Tagen hier ausführte, was ich versuchte recht scharf auszuführen: Während bei irgendeinem pathologischen Zustand, der sich im Bewußtsein herausbildet, dieser pathologische Zustand da ist und der vernünftige Mensch fort ist, muß beim Entwickeln des Selbstbewußtseins für die Geistesforschung der alte Mensch ganz dableiben, wie er ist, und neben dem das andere Bewußtsein
stehen, - immer müssen die beiden nebeneinander da sein. Man kann sagen, trivial ausgedrückt: Beim Geistesforscher ist das so, daß das entwickelte Bewußtsein, das Erleben in einer anderen Welt, das er hat, vollständig gesondert dasteht von dem, was er sonst in der Welt ist.
Es ist nichts anders geworden mit dem, was man sonst in der Welt ist, als es früher war. Und man sieht auf das, was man sonst in der Welt war, wie man auf seine gestrigen Erlebnisse hinschaut. Und wie man diese gestrigen Erlebnisse nicht mehr antasten kann, so tastet man nicht an dasjenige, was man war, bevor man in die geistige Welt eingetreten ist. Wenn man ein verrückter oder ein hypnotisierter oder irgendwie sonst pathologisch zu nehmender Mensch ist, so ist man es und kann nicht daneben irgendein vernünftiger Mensch sein. Denn Sie werden niemals entdecken, daß einer zugleich vernünftig und ein Narr ist. Darin besteht eben gerade dasjenige, worauf es ankommt, daß man sagen kann: Das pathologische Bewußtsein ist ein verändertes Bewußtsein; das Bewußtsein hat eine Metamorphose erfahren. Bei dem richtigen Drinnenleben in der geistigen Welt hat es gar keine Metamorphose erfahren, sondern es hat sich das neue Bewußtsein neben das alte hin-gestellt. Und das ist das Wesentliche, worauf es ankommt, so daß der Mensch die beiden Bewußtseine wirklich voll überschauen kann.
Eine weitere, ich möchte sagen, Unbequemlichkeit beim Erreichen solcher geistigen Ziele, wie sie angegeben worden sind, kommt daher, daß ja nun selbstverständlich der naturwissenschaftlich Denkende sich daran gewöhnt, auf seinem Felde zu bleiben und die ganze Welt umfassen möchte mit dem, was sich aus seinem Felde ergibt; daß er daher ablehnt - wenn er es nur für sich täte, so käme nichts darauf an -, als eine Weltanschauung dasjenige zu
suchen, was gerade jenseits seiner Weltauffassung lebt. Alle Größe des gewöhnlichen Lebens, sogar auch des praktischen Lebens, alle Größe auch der Naturwissenschaft beruht auf der Denkweise, die sich im Laufe der letzten drei bis vier Jahrhunderte herausgebildet hat. Und meistens wird von der Geisteswissenschaft nicht geringer, sondern oftmals höher geachtet dasjenige, was die Naturwissenschaft leistet für das Leben, auch für das äußere Leben; sie wird voll anerkannt von der Geisteswissenschaft. Aber gerade diese Geisteswissenschaft weiß auch, daß das naturwissenschaftliche Denken - verzeihen Sie wiederum einen trivialen Ausdruck - leicht ist, wenn man abweist dasjenige, was man als Gedanke braucht. Wahrhaftig, heute ist es schon so, daß zu der Erfindung des Experimentes viel mehr gehört, als zu dem Beobachten dessen, was durch das Experiment einem vor Augen tritt. Leicht und bequem ist das Gedanken-Ablesen von der Natur. Dazu braucht man wenig innere Aktivität. Gar nicht zu vergleichen ist diese Aktivität mit der, die man braucht, wenn man das in sich entwickeln will, wovon heute gesprochen worden ist. Und so kommt es denn, daß diejenigen, die sich ihrem Bewußtsein nach auf den strengen Boden der Wissenschaft stellen, ihrem Instinkte nach aber der Bequemlichkeit des abgelesenen Denkens sich überlassen, selbstverständlich sagen:
Nun ja, das ist so etwas Ausgedachtes, Ausspintisiertes, was von dieser Geisteswissenschaft kommt. Aber es besteht eben das, was man sich vielleicht ohne Hochmut und ohne Über-hebung gestehen muß: Es gehört ein scharfsinnigeres Denken dazu, um die geisteswissenschaftlichen Wahrheiten einzusehen. Aber einem scharfsinnigen Denken ergeben sie sich zum Beispiel schon, wenn der Betreffende, dem sie sich ergeben sollen, auch kein Geistesforscher geworden ist. Autoritätsgläubig wollen ja heute die Menschen nicht sein; aber,
Hand aufs Herz - ich habe das schon öfter auch gesagt:
Wie viele Leute glauben denn, trotzdem sie niemals das entsprechende Experiment gesehen haben, daß sich Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen läßt, oder andere Dinge! Wenn man nämlich den Dingen auf den Grund geht, so war keine Zeit so von Autoritätsgläubigkeit durchdrungen wie gerade die heutige Zeit, und so keine Zeit den Dogmen unterworfen wie die heutige. Nur daß man heute sagen kann, wie ich vor Jahrzehnten es ausgesprochen habe in meiner Einleitung zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften, daß die Leute das Dogma der Erfahrungen glauben, während früher die Leute das Dogma der Autorität hingenommen haben. Gerade so, wie man verwenden kann im praktischen Leben, ohne selber im Laboratorium gewesen zu sein, dasjenige, was aus dem Laboratorium kommt, so kann man durch entsprechendes wirklich angestrengtes Denken dasjenige für seine Weltanschauung anwenden, was der Geistesforscher zutage fördert und wovon er weiß, daß er es in der geistigen Welt drinnen wirklich entdeckt hat.
Das sind solche Unbequemlichkeiten gegenüber der Geistesforschung; doch viele solche Unbequemlichkeiten könnten aufgezählt werden. Die Hauptsache ist diese, daß die Menschen sehr leicht zurückschrecken vor dem, was sich wie eine Art von Seelenstimmung ergeben muß, wenn der Weg in die geistige Welt hinein genommen wird. Zunächst
- und ich möchte dasjenige, was ich zu sagen habe, gewissermaßen historisch entwickeln - sind es Gedanken der historischen Entwickelung. Die meisten Menschen sagen zum Beispiel: Ach, da hat es so viele Philosophen und Philosophien in der Welt gegeben, und alle haben etwas anderes behauptet. Oh, es ist am besten, sich mit diesen Philosophen und Philosophien überhaupt gar nicht zu befassen! Aber solch ein Urteilen entsteht nur unter dem Einflusse des Glaubens,
daß man einen Philosophen nur dann erfassen kann, wenn man ihn als einen Dogmatiker und nicht, ich möchte sagen, wie einen inneren Gedankenkünstier auffaßt. Man kann ihn erfassen wie einen inneren Gedankenkünstler, dann wird man gerade dann recht viel von ihm haben, wenn man ihn recht intim studiert, recht intim ihn auf sich wirken läßt und ihm womöglich gar nichts davon glaubt, dann zu dem anderen geht und wiederum sieht ein ernstes Streben, das darin lebt im Wahrheitsstreben, und man wird vielseitig. Man wird sich gerade dadurch den Sinn erwerben für das Drinnenstehen in der geistigen Welt. Allerdings erlebt man dann, daß man sich klar wird darüber, gerade wenn man echt den Wegen in der Gegenwart der Naturforschung folgt: Alles, was man aus der Beobachtung und dem Experiment holt, ist im Grunde genommen inneres Erleben, und das Äußere sollte niemals Naturgesetz oder so etwas genannt werden, sondern - Goethe hat schon den großartigen Ausdruck gewählt - Urphänomen, Urerscheinung. Und wenn mehr erlebt wird in der äußeren Sinneswelt, so ist es erlebt durch die Betätigung des Innern. Das Denken muß untergreifen unter das Phänomen. Man kann nicht ohne das Denken unter das Phänomen hinunterkommen. Dazu gehört ein inneres Erkraften des Denkens, ein wirkliches inneres kraftvolles Erleben und Fortsetzen der Linie des Denkens.
Das will man unter dem Einflusse der naturwissenschaftlichen Denkungsweise nicht. Daher hat von dieser Seite die naturwissenschaftliche Denkungsweise heute wirklich noch etwas von dem letzten Reste der alten Zauberei, so paradox das klingt. Hier erzeigt sich uns klar, daß dasjenige, was wir heute naturwissenschaftliches Experimentieren und Beobachten nennen, sich in gerader Linie entwickelt hat aus der alten Zauberei, wo man geglaubt hat, durch Veranstaltungen -
im Verlaufe der Veranstaltungen durch das Zeremonielle, das man zugrunde gelegt hat - etwa zu erfahren, was man nicht innerlich miterlebt. Man schauderte zurück vor dem innerlichen Erleben. Man wollte nicht hinein in die Dinge und wollte sich diktieren lassen von den Geistern draußen, die da zauberhaft in den Phänomenen leben, dasjenige, was man durch das Hinein-fließen-Lassen des inneren Erlebens in das äußere allein finden kann. Aber all solches ist gerade so, wie wenn jemand sagen würde: Die Zeiger der Uhr gehen vorwärts, weil darinnen ein kleiner Dämon sitzt, ein kleiner Elementar-geist. Es ist zwar heute nur noch leise zu bemerken, aber im naturwissenschaftlichen Experiment, oder wenn die Physiologen kommen und kleine Froschleichen zerschneiden, um innere Teile zu sehen, da haben Sie immer noch im Gemüte jenen Schauer vor den Naturgeheimnissen, der in der alten Zauberei vorhanden war. Das muß auch noch heraus! Man muß nicht in innere Ohnmacht fallen, wenn man das Denken über die Natur ausdehnen soll. Man muß die Kraft haben, mit dem Denken wirklich unterzugreifen unter die Naturerscheinungen. Unter den modernen Errungenschaften - Errungenschaften sind ja alle - zeigt uns diese besondere Schwäche dasjenige, was sich im landläufigen Sinne so kundgibt, daß man wiederum durch äußere Veranstaltungen den Geist erforschen will, indem sich die Leute anschicken, zum Beispiel sich um einen Tisch herum zu setzen, um durch allerlei mechanische, wiederum äußere Veranstaltungen, nicht durch Untertauchen mit dem eigenen Geist in die Wesenheiten der Welt, sondern durch äußere Veranstaltungen den Geist zu suchen. Natürlich suchen sie nur, nun, sagen wir, in Klopftönen oder etwas anderem den Geist. Daß sie ihn vielleicht viel näher finden könnten, wenn sie daran dächten, daß wenn acht um den
Tisch herumsitzen, acht verkörperte Geister da sind, die anders wahrzunehmen sind als gerade der Geist, der gerade durch allerlei Unsinn an den Tisch klopft, - daran denken die Menschen nicht. Und so ist denn wie die andere Seite, wie eine groteske Seite das Gegenbild des Experimentierens zur Tagesordnung geworden, wo man wirklich auf die grobklotzigste Weise den Geist suchen will durch Dinge, die man gerade zu überwinden hat.
Dann hat aber dieses, was man heute vielfach im landläufigen Sinn Weltanschauung nennt, noch eine andere Seite. Es ist ganz natürlich, daß sich nach und nach, ich möchte sagen, eine Scheu ausgebildet hat, diese innere Seelenaktivität wirklich zu entwickeln, denn man hält sie für etwas wirklich bloß Subjektives. Man glaubt, daß man bloß ein Subjektives herausarbeitet. Daß man unter dem Subjektiven das Objektive findet, das wird man eben erst gewahr, wenn man wirklich in die Sache eindringt. Man scheut zurück, das Innere wirklich zu entwickeln. Es wäre gerade so, als wenn man vor der Geburt zurückschrecken würde, Arme und Beine zu entwickeln, weil man glauben würde, man trüge dadurch etwas Subjektives in die Welt hinaus und Arme und Beine könnten niemals etwas Objektives wahrnehmen. Man schreckt zurück, man will also das Innere nicht entfalten. Man will dasjenige, was, wie wir gesagt haben, mit Recht an den bloßen Denkapparat geknüpft wird, allein entwickeln. Das heißt, man will nur den Denkapparat in sich wirken lassen, man zieht sich wirklich auf das unaktive Vorstellungsleben zurück. Und die Folge davon ist, daß sich allerlei Weltanschauungen entwickeln, über die man auch gerade mit dem modernen Psychiater eins werden könnte, wenn man sich nur auf einen ganz objektiven, unbefangenen Standpunkt stellt. Man kann sich gerade mit dem modernen Psychiater schon einigen zum
Beispiel über das, was man heute Monismus nennt. Man ist sich klar darüber, daß diejenigen Menschen, die im heutigen grob materiellen Sinne Monisten sind, den Mut nicht haben, die innere Aktivität zu entwickeln, daß sie nur den Denkapparat in sich wirken lassen und aus dem Denkapparat selbstverständlich nur eine Abspiegelung der äußeren physischen Welt bekommen können. Schlagen Sie sich irgendwo ein psychiatrisches Buch auf, so werden Sie die Definition dieser Sache finden: Da entsteht eine Summe von Ideen, welche der Betreffende für richtig hält, weil er sich nicht bewußt ist, daß sie nur von dem Denkapparat stammen; er hält diese Ideen im absoluten Sinne für richtig. Das nennt man im psychiatrischen Sinne heute Wahn-ideen im Gegensatz zu Zwangsideen. Viele Wahnideen sind heute Weltanschauung! Wenn Sie auf die geisteswissenschaftliche Weltanschauung eingehen, so werden Sie sehen, daß sie weder in den einen noch in den anderen Fehler verfallen kann, weder in den Aberglauben der äußeren Natur-anschauung, die noch immer etwas von Zauberei, das heißt, Aberglauben, zugrunde legt, noch hinüberspielen kann in das Gebiet der Wahnideen, weil der Geistesforscher eben gerade da sich ganz klar macht, daß er das, was er innerlich zur Erforschung der Welt erzeugt, selber erzeugt, selber hervorbringt, und auch weiß: Er darf es selber erzeugen, selber hervorbringen. Dann kann es die äußere Welt berühren. So kann er niemals in eine Weltanschauung verfallen, die nur eine Wahnidee wäre.
Aber, wie schon oft angedeutet: Die Dinge, von denen auch heute wiederum gesprochen worden ist, entstehen, wenn die naturwissenschaftliche Denkungsweise, wie sie sich seit drei bis vier Jahrhunderten herausgebildet hat, fortgesetzt wird. Aber sie muß so fortgesetzt werden, daß nicht bloß betrachtet wird, sondern erlebt wird die Wahrheit.
Daher ist ein gewisses in das geistigste Leben hinein-gehendes künstlerisches Empfinden eine viel bessere Vor-bereitung für das geisteswissenschaftliche Erleben als jede andere Vorbereitung. Und man wird daher immer finden, daß das asketische Sich-Zurückziehen von der Kunst, wie es gerade bei Menschen, die Bestrebungen der geistigen Erforschung der Dinge haben, so oftmals bemerkbar ist, -daß dieses von großem Übel ist, daß in der Tat auch über dieses künstlerische Gebiet der Gesichtskreis des Menschen durch die Geistesforschung erweitert wird. Hegel konnte eine metaphysische Bedeutung der Kunst zum Beispiel nicht finden. Für ihn war die Kunst nur die höchste Blüte dessen, was sich hier in der physischen Welt ausbildet. Aber für den, der in die geistige Welt wirklich eindringt, ist es klar:
Dasjenige, was hier Phantasie bleiben muß, solange sie sich auf der physischen Welt bewegt als eine menschliche Seelen-kraft, das ist doch herausgeboren aus dem Geistigen, das ist das physische Abbild für das Geistige, das ist der Bote, der aus der geistigen Welt kommt. Und kann man nur diese übersinnliche Sendung der Kunst fassen, so hat man ja schon, ich möchte sagen, einen Anfang für das wirklich lebendige, stimmungsvoll lebendige Eindringen in die geistige Welt. Sonst aber wird es dieser Geisteswissenschaft lange noch so gehen, wie es jedem geistigen Impuls gegangen ist, der sich in die Geistesentwickelung der Menschheit hat einfügen müssen. Ich habe hier oftmals darauf aufmerksam gemacht, daß ja die weitaus größte Zahl der Menschen der Kopernikanischen Weltanschauung feindselig gegenüberstand, begreiflicherweise, denn sie widersprach allen Denk-gewohnheiten. Man hatte bis dahin gedacht: Die Erde steht still, man steht fest auf der stillstehenden Erde, die Sonne bewegt sich, die Sterne bewegen sich. Nun sollte man auf einmal alles umdenken. Und man kann noch nicht einmal
sagen, daß dieser Kopernikanismus gerade dadurch groß geworden ist, daß er, wie es heute der Monismus gerade fordert, nur auf das äußere Sinnliche sah; denn das äußere Sinnliche ist gerade mit dem zusammenstimmend, was man früher gedacht hat. Die äußere Sinnenwelt zeigt uns selbst, für diese Sinnenwelt selber, daß die Erde still-steht und die Sonne sich bewegt. Der Kopernikanismus ist gerade dadurch zu etwas Neuem gekommen, daß er der sinnlichen Auffassung widersprach. Und heute muß man dadurch zu etwas Neuem kommen, daß man der gewöhnlichen Seelenauffassung selbstverständlich widerspricht, daß man gerade dasjenige, wovon man so leicht glauben möchte, das sei zunächst selber etwas, was als ewige Kraft der Menschenseele bezeichnet werden kann, nämlich Denken, Fühlen und Wollen, daß man das gerade bezeichnet als das, was nun als innerer Schein, als innerer Abglanz des eigentlich Ewigen sich erweist, und daß das eigentlich Ewige, die wirklich ewigen Kräfte der Menschenseele, unter diesem Schein liegen. Und erst, wenn man das Vorstellen, das Denken so vertieft, daß man aus dem gewöhnlichen Denken heraus an das aktive Denken kommt, wo das Denken Wille wird - aber erlebter, nicht bloß wie bei Schopenhauer angeschauter Wille - und wo das Wollen Denken wird dadurch, daß man es in Ruhe deuten kann, erst dann entdeckt man die ewigen Kräfte der Menschenseele, und man wird gewahr, daß man dieser physische Mensch ist, ich möchte sagen, ganz nach einem Naturgesetz, nur in einem höheren Sinne aufgefaßt. Dieser physische Mensch ist man dadurch, daß man aus geistigen Kräften umgewandelt ist. In der Naturwissenschaft weiß jeder: Wenn er so über den Tisch streicht, entsteht Wärme. Da glaubt er an die Umwandlung der Kräfte. Man nennt das heute Umwandlung der Energien. Umwandlung der Energien, Umwandlung
der Kräfte ist auch in der geistigen Welt vorhanden. Was wir sonst geistig sind, wandelt sich um ins Physische. Diese Umwandlung des Geistigen ist gerade so, wie wenn durch Reibung Wärme entsteht.
Bloß Umänderung der Denkgewohnheiten wird nötig sein. Das ist für manche Leute schwer. Denn nicht nur, daß sie Denkgewohnheiten haben, von denen sie nicht losgelassen werden, - sogar zu Begriffen haben sich diese Denk-gewohnheiten verhärtet. Und wenn heute einer von Fortsetzung der Naturwissenschaft spricht, von lebendiger Fortsetzung, wie sie hier gemeint ist, dann guckt derjenige, der so ganz dick drinnen steht, knüppeldick drinnen steht in den Denkgewohnheiten, und sagt: Der will eine neue Religion stiften, das ist ganz klar, der will eine neue Religion stiften! Das alles muß man begreiflich finden, selbstverständlich finden. Und man wird es begreiflich finden, wenn man nur ein wenig über den Gang der Geistesentwickelung der Menschheit hin den Seelenblick schweifen läß. Aber für dasjenige, was die Besten der Menschen angestrebt haben, gibt von einem gewissen Gesichtspunkte aus Geisteswissenschaft doch, ich möchte sagen, eine gewisse Befriedigung. Nicht eine leichte Befriedigung. Vor dieser leichten Befriedigung - das ist auch wiederum etwas, was der Geisteswissenschaft entgegen ist - vor dieser leichten Befriedigung fürchten sich sogar die Menschen. So gibt es einen, der wandte einmal ein: Ja, diese Geisteswissenschaft will die Fragen, die Geheimnisse der Welt beantworten. Ach, wie öde wird das Leben dann sein, wenn alle Fragen beantwortet sind; denn gerade darin, daß man Fragen haben kann, liegt das Leben. - Solche Leute, die so denken, würden sich wundern, was ihnen geschieht, wenn sie in die wirkliche Geisteswissenschaft eintreten! Allerdings, der Bequemling glaubt, Geisteswissenschaft sei so etwas wie ein
geistiges Morphium zu seiner Beruhigung. Das ist sie gar nicht. Die Fragen werden nämlich nicht weniger, die Rätsel werden nicht weniger, sondern gerade vermehrt. Immer neue und neue Rätsel entstehen. Und wenn man als gewöhnlicher Materialist Haeckels «Welträtsel» oder seine besseren Werke in die Hand nimmt, dann wird man Antworten haben! Für den Geistesforscher sind da erst die Fragen; da springen erst die Fragen heraus. Und er weiß, daß die Fragen, die ihm entstehen, nicht durch Theorien, sondern durch Erleben beantwortet werden. Er sieht auf eine Entwickelung von unendlicher Perspektive. Und indem er Fragen aufwirft, belebt er gerade das Seelenleben, bereitet es vor auf die Antworten, die von immer neuen und neuen Geschehnissen gegeben werden. Reicher, unendlich reicher wird das Leben, weil die Fragen vermehrt werden. Wiederum eine Unbequemlichkeit für viele, die Behagen und nicht Erkenntnis suchen.
Aber im Ganzen ist Geisteswissenschaft schon etwas, was doch die besten Menschen gesucht haben, und was schon der junge Goethe im Auge hatte, als er einem Weisen, den er so verborgen hält, nachspricht:
Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot!
Auf, bade, Schüler, unverdrossen
Die irdsche Brust im Morgenrot!
Ja, man muß es nur finden, dieses Morgenrot! Wer es sucht aus dem Grunde, weil er sich vor der Sonne fürchtet, wird dieses Morgenrot nicht im richtigen Sinne finden. Und das ist derjenige, der sich als Geistesforscher fürchten würde vor dem ganzen, vollen, lebendigen Menschendasein. Wer sich nun in irgendein ästhetisches Wolkenkuckucksheim zurückziehen wollte, um die geistige Welt zu finden, der
gleicht einem Menschen, der das Morgenrot sucht, weil er sich vor der Sonne, vor der voll scheinenden Sonne fürchtet. Aber man kann auch noch in anderem Sinne das Morgenrot suchen, in dem Sinne, daß es einem der Nachglanz der Sonne ist, die immer scheint und die da auch schien, bevor sie uns für unseren Tag aufgegangen ist, für andere Gebiete. Sucht man so das geistige Morgenrot, dann wird einem die eröffnete Geist-Erkenntnis zum Mittel, zum Werkzeug für das Gebiet, aus dem man herausgekommen ist vor der Verwandlung in das physische Menschendasein und in das man nach der Verwandlung des physischen Menschen-daseins zurückkehrt, zu jener geistigen Kraft, mit der man wirklich wissenschaftlich sich selber offenbart das Gesetz der wiederholten Erdenleben. Geisteswissenschaft wird dann zu dem Morgenrot, das man erlebt als einen Nach-glanz der Sonnenwirksamkeit, die man nicht unmittelbar haben kann, indem man den Sonnenglanz beobachtet, der einem zugeteilt ist auf dem Gebiet, auf dem man einmal steht hier in der physischen Welt, zu jenem Sonnenglanz, der sich ausbreitet in der geistigen Welt, in die man eintritt dadurch, daß man gerade den Mut und die Kraft hat, herauszutreten aus der sinnlich-physischen Welt, um in eine andere einzutreten, und in dieser anderen Welt, die man erleben kann, in dem Sinne erleben kann, wie Hegel nun wiederum richtig ahnte, indem er sagte: 0 wie elend ist der Gedanke, der die Unsterblichkeit erst jenseits des Grabes sucht. Suchst du die unsterblichen, suchst du die ewigen Kräfte der Menschenseele, du kannst sie schon finden. Aber sie müssen gesucht werden.
Weil der Mensch ein solches Doppelwesen ist, deshalb kann er die andere Seite seines Wesens wirklich auch finden. Und für diejenigen, die vom Standpunkte des gewöhnlichen Monismus aus das Forschen nach den ewigen Kräften
der Menschenseele verpönen, weil dadurch die Seele in zwei Teile auseinandergerissen wird, für diese muß immer wiederum das gelten, daß man sagt: Ja, ist man kein Monist mehr, wenn man zugibt, daß das Monon Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerfällt und zerfallen muß für die Erkenntnis, wenn man es erkennen lernen will? Man ist wahrhaftig nicht weniger Monist, wenn man zugibt, daß wahr-hafte Erkenntnis des eigentlich seelischen Wesens, dasjenige gesucht werden muß, aus dem das Monon, die Einheit, die Ganzheit Mensch wird. Aber sicher ist derjenige, der solche Wege einschlägt, wie sie heute versucht worden sind zu charakterisieren, daß er nichts verliert von dem, was die Welt ihm ist und was er sich selber sein kann in der Welt dadurch, daß er in die geistige Welt eintritt; daß nicht eine Verarmung desLebens, sondern eineBereicherung des Lebens eintritt, und von diesem Gesichtspunkte aus eine höhere Befriedigung des Lebens. Es pulst etwas Neues durch Sinn und Gemüt, durch Denken und Herz, wenn dasjenige Sinn und Gemüt und Denken und Herz durchdringt, was erregt werden kann dadurch, daß keine Furcht da ist vor der Ohnmacht, kein Zurückscheuen da ist vor dem Mut, die dazu gehören, nun innerlich über sich selber hinauszukommen. Und das ist im Grunde genommen das, was die Besten angestrebt haben.
Aber wie alles erst in einem bestimmten Zeitpunkte eintreten konnte in die Geistesentwickelung, so konnte Geisteswissenschaft auch nur in einem bestimmten Zeitpunkt eintreten. Aber mag sie angefeindet, mag sie feindselig betrachtet werden, mag sie verhöhnt, verspottet werden -sie wird ebenso wahr fortleben, wie anderes fortgelebt hat, was verhöhnt, verspottet worden ist. Als zuerst aufgetreten ist derjenige, der gesagt hat: «Alles Leben stammt vom Leben», sprach er etwas aus, wofür man ihn dazumal auch
dem Schicksal des Giordano Bruno entgegengehen ließ. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit. So verwandeln sich in der Welt die Wahrheiten in der menschlichen Auffassung aus Verrücktheiten in Selbstverständlichkeiten. Für viele ist Geisteswissenschaft heute eine Verrücktheit. In der Zukunft wird ihr auch dieses Los zufallen, eine Selbstverständlichkeit zu werden.
EIN VERGESSENES STREBEN NACH GEISTESWISSENSCHAFT INNERHALB DER DEUTSCHEN GEDANKENENTWICKELUNG Berlin, 25. Februar 1916
Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist, wurde öfter innerhalb dieser Vorträge von mir charakterisiert. Sie will eine wahre Fortsetzung der naturwissenschaftlichen Weltanschauung, ja, des naturwissenschaftlichen Forschens überhaupt sein dadurch, daß sie zu denjenigen Kräften der menschlichen Seele, welche zunächst, wenn der Mensch der äußeren sinnlichen Welt gegenübersteht und sich zur Erforschung seiner Sinne und des Verstandes bedient, der an das Gehirn gebunden ist, - daß sie zu diesen Kräften, deren sich also auch alle äußere Wissenschaft bedient, hinzufügt diejenigen, welche im gewöhnlichen Leben und in der Arbeit der gewöhnlichen Wissenschaft in der Seele schlummern, aber aus dieser Seele hervorgeholt werden können, entwickelt werden können und dadurch den Menschen in die Möglichkeit versetzen, sich in lebendige Beziehung zu versetzen zu dem, was als geistige Gesetze, geistige Wesenheiten die Welt durchwebt und durchwirkt und durchwest, und dem der Mensch mit seinem innersten Wesen ja auch angehört, angehört mit denjenigen Kräften seiner Wesenheit, welche durch Geburten und Tode gehen, welche die ewigen Kräfte seiner Wesenheit sind. In der ganzen Gesinnung, in der wissenschaftlichen Gesinnung will diese Geisteswissenschaft eine wahre Fortsetzerin der Naturwissenschaft sein. Und dasjenige, was sie von der Naturwissenschaft
unterscheidet und was eben charakterisiert wurde, muß in ihr vorhanden sein aus dem Grunde, weil man gerade, wenn man in die geistige Welt eindringen will, eindringen will in derselben Art, wie die Naturwissenschaft in die natürliche Welt eindringt, andere Kräfte für die geistige Welt braucht. Man braucht die Bloß legung von erkennendem Vermögen in der menschlichen Seele, von erkennenden Kräften, welche abgestimmt sind auf die geistige Welt.
Heute will ich nun im besonderen zeigen, daß diese Geisteswissenschaft, wie sie in der Gegenwart als Ausgangspunkt für eine geistige Entwickelung der Menschenzukunft auftreten will, nicht durch eine bloße Willkür aus dem geistigen Leben hervorgeholt oder in das geistige Leben hineingestellt wird, sondern fest verankert ist in den bedeutendsten, wenn auch vielleicht durch die Verhältnisse der neueren Zeit vergessenen Bestrebungen des deutschen Geisteslebens. Und da werden uns immer wieder und wiederum entgegentreten - und sie müssen auch heute erwähnt werden, obwohl ich sie in den Vorträgen, die ich im vorigen und in diesem Winter hier gehalten habe, wiederholt dargestellt habe -, es müssen uns immer wieder und wiederum entgegentreten, wenn wir von des deutschen Volkes größtem geistigen Aufschwung sprechen, von dem eigentlichen Gipfel seines Geisteslebens, die drei Gestalten: Fichte, Schelling und Hegel.
Fichte erlaubte ich mir, so wie er fest drinnen steht im deutschen Geistesleben, in einem besonderen Vortrage im Dezember zu charakterisieren. Heute möchte ich im besonderen darauf aufmerksam machen, wie Fichte dadurch, daß er unablässig gesucht hat nach einem festen Punkt im eigenen menschlichen Innern, nach einem lebendigen Mittelpunkt des menschlichen Seins, in einer gewissen Weise ein
Ausgangspunkt von Bestrebungen in der Geisteswissenschaft ist. Und er ist ja zugleich - das wurde insbesondere im Fichte-Vortrag hier erwähnt - derjenige Geist, der, ich möchte sagen, wie aus einer tiefen Empfindung heraus dasjenige, was er zu sagen hatte, wie bekommen durch ein Zwiegespräch mit dem deutschen Volksgeiste selber empfand. Ich habe aufmerksam gemacht, wie Fichte im Gegensatz zu der westlichen Philosophie zum Beispiel, zu der westlichen Weltanschauung, vor allen Dingen darauf bedacht ist, allen Quell einer höheren menschlichen Weltauf-fassung durch eine Bloßlegung der menschlichen inneren Kräfte, der menschlichen Seelenkräfte zu erlangen. Das menschliche Ich-Wesen, der Mittelpunkt des menschlichen Seelenseins, ist für Fichte etwas, das im Innern des Menschen sich fortwährend erschafft, so daß es dem Menschen niemals verloren gehen kann, weil der Mensch Anteil hat nicht nur an dem Sein dieses Mittelpunktes des menschlichen Wesens, sondern Anteil hat an den schöpferischen Kräften dieses menschlichen Wesens. Und wie stellt sich Fichte vor, daß dieses Schöpferische im Menschen verankert ist in dem Allschöpferischen der Welt? Als das Höchste, zu dem der Mensch zunächst gelangen kann, wenn er versucht, sich einzuleben in dasjenige, was in der Welt als das Göttlich-Geistige webt und west. Als solches oberstes Göttlich-Geistiges erkennt Fichte dasjenige an, was willensartig ist, was als von der Weltenpflicht durchzogener Welten-wille alles durchpulst und alles durchsetzt und mit seinem Strom durchzieht die eigene menschliche Seele, in dieser eigenen menschlichen Seele selber aber nun nicht als Sein, sondern als Schöpferisches erfaßt wird. So daß der Mensch, wenn er sein Ich ausspricht, sich eins wissen kann mit dem in der Welt wirkenden Weltenwillen. Das Göttlich-Geistige, das die Welt, die äußere Natur dem Menschen
vorangestellt hat, will gleichsam hinein in den Mittelpunkt des menschlichen Wesens. Und der Mensch wird gewahr dieses innere Wollen, spricht dieses als sein Selbst, als sein Ich an.
Und so fühlte sich Fichte mit seinem Ich ruhend, aber in dieser Ruhe zugleich - der Widerspruch ist durchaus gewollt gesagt - aufs äußerste bewegt in dem schöpferischen Weltenwillen. Daraus wird ihm dann die Kraft, die er in seinem ganzen Leben betätigt hat. Daraus wird ihm auch die Kraft, all das äußere Sinnliche, wie er sagt, anzusehen als ein bloßes verstofflichtes Werkzeug für die Pflicht des Menschen, die in seinem Willen pulsiert. So ist für Fichte das eigentlich Geistige dasjenige, was als Wollen hereinströmt in die menschliche Seele. Die Außenwelt ist ihm das versinnlichte Material der Pflicht. Und damit sehen wir ihn, wie er immer wieder und wiederum durch sein ganzes Leben den Menschen hinweisen will auf den Quellpunkt, auf den lebendigen Quellpunkt des eigenen Inneren.
Ich habe aufmerksam gemacht im Fichte-Vortrage, wie Fichte vor seine Zuhörer trat, zum Beispiel in Jena, und versuchte, jeden einzelnen Zuhorer in seiner Seele zu ergreifen, damit dieser gewahr würde, wie im Innern das Allschöpferische geistig lebt. So sagte er zu seinen Zuhörern: «Denken Sie sich die Wand!» Da sahen die Zuhörer zur Wand hin, konnten die Wand denken. Nachdem sie eine Weile die Wand gedacht hatten, sagte er: «Nun denken Sie denjenigen, der die Wand gedacht hat.» Da waren die Zuhörer zuerst etwas verblüfft. Sie sollten sich, jeder sich selber, innerlich ergreifen, innerlich geistig ergreifen. Aber es war zugleich der Weg, jeden Einzelnen auf das eigene Selbst hinzuweisen, ihn darauf hinzuweisen, wie er die Welt nur erfassen kann, wenn er sich in seinem tiefsten
Inneren findet und dort entdeckt, wie hineinströmt dasjenige, was die Welt will und was im eigenen Wollen als Quellpunkt des eigenen Wesens aufgeht. Man sieht vor allen Dingen - und ich will heute mich nicht wiederholen in bezug auf den Vortrag, den ich im Dezember hier gehalten habe -, wie in Fichte lebt eine Weltanschauung der Kraft. Daher konnte auch derjenige, der ihm zuhörte -und viele haben in ähnlicher Weise gesprochen - sagen:
Seine Worte rauschten «daher wie ein Gewitter, das sich seines Feuers in einzelnen Schlägen entladet». Und Fichte wollte, indem er also unmittelbar die Seele ergriff, an die Seele heranbrachte das göttlich-geistige Wollen, das durch die Welt geht, nicht bloß gute, er wollte große Menschen erziehen. Und so lebte er sich in ein lebendiges Zusammensein seiner Seele mit dem Weltenseelensein hinein und betrachtete dieses gerade wie das Ergebnis eines Zwiegespäches mit dem deutschen Volksgeist und fand aus diesem Bewußtsein heraus jene kraftvollen Worte, mit denen er sein Volk in einer der schwersten Zeiten Deutschlands aufmunterte und erkraftete. Er fand gerade aus diesem Bewußtsein heraus die Macht, so zu wirken, wie er in den «Reden an die deutsche Nation», weithin sein Volk befeuernd, sprechen konnte.
Wie der Folger Fichtes steht nun Schelling da, gerade in seinen besten Seiten, man könnte sagen, wie Fichte mehr oder weniger vergessen. Wenn Fichte mehr dasteht wie der Mann, der das Wollen, das Weltenwollen ergreifen und in dem eigenen Worte das Weltenwollen fortrollen lassen will, wenn dieser Fichte dasteht wie der Mann, der gewissermaßen den Begriffen und Vorstellungen befiehlt, so steht Schelling vor uns da, wie er vor seinen begeisterten Zuhörern gestanden hat - und es hat viele solche gegeben, ich habe selber noch Leute gekannt, die den altgewordenen
Schelling sehr gut gekannt haben -, er steht da vor uns, nicht wie Fichte, der Befehler der Weltanschauung, er steht da wie der Seher, aus dessen Augen funkelte, was er im Worte begeistert mitzuteilen hatte über Natur und Geist. So stand er schon in den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts vor seinen Jenenser Zuhörern, gewissermaßen an der damaligen Mittelpunkts-Universität des deutschen Volkes, so stand er später wieder in München, so in Erlangen, so in Berlin später in den vierziger Jahren, überall etwas wie ein Seher von sich ausströmend, wie umfiossen von Geistigkeit, wie heraussprechend aus der Geistigkeit. Damit Sie einen Begriff bekommen, wie eine solche Gestalt in der damaligen Blüte des deutschen Geisteslebens vor Menschen stand, die ein Empfinden dafür hatten, möchte ich Ihnen einige Worte zur Vorlesung bringen, welche niedergeschrieben sind von einem Zuhörer, von einem treuen, weil immer wieder mit Schelling zusammentreffenden Zuhörer: Gotthill Heinrich Schubert. Ich möchte Ihnen die Worte vorlesen, die Schubert über die Art und Weise geschrieben hat, wie Schelling vor seinen Zuhörern stand, «schon als ein Jüngling unter Jünglingen», dazumal in den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts in Jena. Darüber schreibt Schubert, der selber ein tief geistiger Mensch war, ein Mensch, der sich wunderbar vertieft hat in die Geheimnisse der Natur, der versuchte, das geheimnisvolle Weben der menschlichen Seele bis in die Traumwelt und in die abnormen Erscheinungen des Seelenlebens hinein zu verfolgen, der aber imstande war, auch hinaufzusteigen zu den höchsten Höhen des denkerischen menschlichen Lebens. Dieser Schubert schreibt über Schelling:
«Was war es, das Jünglinge wie gereifte Männer von ferne und nahe so mächtig zu Schellings Vorlesungen hinzog? War es nur die Persönlichkeit des Mannes oder der
eigentümliche Reiz seines mündlichen Vortrags, darinnen diese anziehende Macht lag?» - Schubert meint, das sei es nicht allein gewesen, sondern: «In seinem lebendigen Worte lag eine hinnehmende Kraft, welcher, wo sie nur einige Empfänglichkeit traf, keine der jungen Seelen sich erwehren konnte. Es möchte schwer sein, einem Leser unserer Zeit» - 1854 schreibt das Schubert, schon als alter Mann-, «der nicht wie ich jugendlich teilnehmender Hörer war, es begreiflich zu machen, wie es mir, wenn Schelling zu uns sprach, öfter so zu Mute wurde, als ob ich Dante, den Seher einer nur dem geweihten Auge geöffneten Jenseits-welt, läse oder hörte. Der mächtige Inhalt, der in seiner wie mit mathematischer Schärfe im Lapidarstile abgemessenen Rede lag, erschien mir wie ein gebundener Prometheus, dessen Bande zu lösen und aus dessen Hand das unverlöschende Feuer zu empfangen die Aufgabe des verstehenden Geistes ist.» - Dann aber sagt Schubert weiter:
«Aber weder die Persönlichkeit, noch die belebende Kraft der mündlichen Mitteilung konnten es allein sein, welche für die Schellingsche Philosophie, alsbald nach ihrem öffentlichen Kundwerden durch Schriften, eine Teilnahme und eine Aufregung für oder wider ihre Richtung hervorriefen, wie dies vor und nachher in langer Zeit keine andere literarische Erscheinung in ähnlicher Art vermocht hat. Man wird da, wo es sich um sinnlich wahrnehmbare Dinge oder natürliche Erscheinungen handelt, einem Lehrer oder Schriftsteller es sogleich anmerken, ob er aus eigener Anschauung und Erfahrung spricht oder bloß von dem redet, was er von anderen gehört, ja, nach seiner eigenen selbstgemachten Vorstellung sich ausgedacht hat. Nur was ich selbst gesehen und erfahren, das hat für mich Gewißheit; ich kann davon mit Überzeugung reden, die sich auch Anderen in sieg-reicher Weise mitteilt. Auf die gleiche Weise, wie mit der
äußeren Erfahrung, verhält es sich mit der inneren. Es gibt eine Wirklichkeit von höherer Art, deren Sein der erkennende Geist in uns mit derselben Sicherheit und Gewißheit erfahren kann, als unser Leib durch seine Sinne das Sein der äußeren, sichtbaren Natur erfährt. Diese, die Wirklichkeit der leiblichen Dinge, stellt sich unseren wahrnehmenden Sinnen als eine Tat eben derselben schaffenden Kraft dar, durch welche auch unsere leibliche Natur zum Werden gekommen. Das Sein der Sichtbarkeit ist in gleicher Weise eine wirkliche Tatsache, als das Sein des wahrneh-menden Sinnes. Auch dem erkennenden Geiste in uns hat sich die Wirklichkeit der höheren Art als geistig-leibliche Tatsache genaht. Er wird ihrer inne werden, wenn sich sein eigenes Erkennen zu einem Anerkennen dessen erhebt, von welchem er erkannt und aus welchem nach gleichmäßiger Ordnung die Wirklichkeit des leiblichen wie des geistigen Werdens hervorgeht. Und jenes Innewerden einer geistigen, göttlichen Wirklichkeit, in der wir selber leben, weben und sind, ist der höchste Gewinn des Erdenlebens und des Forschens nach Weisheit... Schon zu meiner Zeit» - schreibt Schubert weiter - «gab es unter den Jünglingen, die ihn hörten, solche, welche es ahnten, was er unter der intellektuellen Anschauung meinte, durch welche unser Geist den unendlichen Urgrund alles Seins und Werdens erfassen muß.»
An diesen Worten des gemütstiefen und geistvollen Schubert kann zweierlei auffallen. Das Erste ist, daß er fühlte - und wir wissen, daß es bei anderen ebenso war, die Schelling hörten -: dieser Mann spricht aus unmittelbar geistiger Erfahrung heraus, er prägt seine Worte, indem er hineinschaut in eine geistige Welt und so aus unmittelbar geistigem Erleben heraus eine Weisheit prägt, welche von dieser geistigen Welt handelt.
Das ist das Bedeutsame, das unendlich Bedeutsame an
dieser großen Zeit des deutschen Idealismus, daß unzählige dann im Leben draußen stehende Menschen Persönlichkeiten gehört haben wie Fichte, wie Schelling und, wie wir gleich sehen werden, Hegel, und aus den Worten dieser Persönlichkeiten heraus den Geist sprechen hörten, in dessen Reich hineinblickten diese Genien des deutschen Volkes. Wer die Geistesgeschichte der Menschheit kennt, der weiß, daß solches Verhältnis des Geistes zur Zeit nur innerhalb des deutschen Volkes vorhanden war und wegen des Wesens des deutschen Volkes vorhanden sein konnte, daß dies ein besonderes Ergebnis dessen ist, was tief wurzelt in den Untergründen des deutschen Wesens selber. Das ist das eine, das man daran sehen kann.
Das andere ist, daß aus dieser Zeit heraus sich Menschen bildeten, welche ihr eigenes Verhältnis zur geistigen Welt, so wie etwa Schubert, entzünden konnten an diesen großen, bedeutenden, eindrucksvollen Persönlichkeiten. Aus solcher Seelenlage ging bei Schelling hervor ein Denken über die Natur und ein Denken über Seele und Geist, die, man möchte sagen, durchaus den Charakter des innigsten Lebendigen trugen, aber auch den Charakter trugen, von dem man sagen kann: er zeigt, wie der Mensch bereit ist, mit seiner Seele unterzutauchen in alles Sein und in allem Sein, vor allen Dingen in dem Natursein, dann auch im Geistessein, das Leben, das unmittelbare Leben zu suchen. Erkenntnis wird unter den Einflüssen dieser Denkungsweise etwas ganz Besonderes: Erkenntnis wird inneres Erleben, wird Miterleben mit den Dingen.
Ich habe ja immer wieder zu sagen: Es kommt nicht darauf an, daß man sich heute in irgend einer dogmatischen Weise auf den Boden dessen stellt, was inhaltlich diese Geister gesagt haben. Man braucht gar nicht einverstanden zu sein mit dem, was sie inhaltlich gesagt haben. Es kommt
auf die Art des Strebens an, auf die Art und Weise, wie sie suchen die Wege in die geistige Welt hinein. So innig verbunden fühlte sich Schelling - wenn er das auch einseitig ausgesprochen hat - mit dem, was in der Natur lebt und webt, daß er einmal den Ausspruch tun konnte: «Die Natur erkennen, heißt die Natur schaffen.» Gewiß, bei einem solchen Ausspruch wird der seichte Oberflächling immer Recht haben gegenüber dem Genialen, der wie Schelling einen solchen Ausspruch aus der Tiefe seines Wesens heraus tut. Lassen wir das Recht dem seichten Oberflächling, aber seien wir uns klar: Wenn man auch die Natur nur nachschaffen kann in der menschlichen Seele, - bei Schelling bedeutet der Ausspruch: «Die Natur erkennen heißt die Natur schaffen» ein inniges Verwobensein der ganzen menschlichen Persönlichkeit mit dem Naturdasein. Und das wird für Schelling die eine Offenbarung des Göttlich-Geistigen, und die Seele des Menschen die andere Offenbarung. Sie stehen einander gegenüber, sie entsprechen einander. Der Geist hat sich zuerst in der seelenlosen Natur, die allmählich sich beseelt vom Pflanzen- zum Tierreich herauf und zum Menschen, gleichsam den Boden geschaffen, in dem dann gedeihen kann die Seele, die an sich selber unmittelbar das Geistige erlebt, in unmittelbarer Wirklichkeit erlebt.
Wie anders sieht, wenn man es richtig versteht, das aus, was da lebt als eine erstrebte geistige Naturerkenntnis, als dasjenige, was, sagen wir, aus der romanischen Volkstümlichkeit hervorgeht. Man hat innerhalb der deutschen Geistes-entwickelung nicht nötig, in den Ton zu verfallen, in den jetzt Deutschlands Feinde verfallen, wenn man charakterisieren will das Verhältnis des deutschen Geisteslebens zu anderem Geistesleben Europas. Man kann durchaus auf dem Boden der Tatsächlichkeit bleiben. Daher ist nicht aus
eng nationalen Gefühlen heraus dasjenige gesagt, was nun gesagt werden soll, sondern aus der Tatsächlichkeit selber heraus. Man vergleiche ein solches Eindringenwollen in die Natur, wie es bei Schelling vorhanden ist, wo die Natur erfaßt werden soll so, daß das eigene Leben der Seele unter-taucht in dasjenige, was draußen lebt und webt. Man vergleiche das mit dem, was gerade charakteristisch ist für das westliche Weltanschauungsbild, das seine höchste Höhe erreicht hat bei Descartes, Cartesius, Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, aber seine Fortsetzung gefunden hat bis in unsere Tage herein und für das westliche Volkstum ebenso charakteristisch ist wie Fichtes, Schellings Streben für das deutsche Volkstum charakteristisch ist. Wie Fichte und Schelling später, stellt sich auch Cartesius gegenüber der Welt der Natur. Er stellt sich zuerst auf den Standpunkt des Zweifels. Er sucht auch im eigenen Innern einen Kernpunkt, durch den er zu einer Sicherheit über das Dasein der Welt und des Lebens kommen kann. Sein berühmtes «Cogito ergo sum» ist ja bekannt - «Ich denke, also bin ich.» Auf was stützt er sich? Nicht wie Fichte auf das lebendige Ich, dem man sein Sein nicht nehmen kann, weil es fortwährend aus dem Weltenwillen sich erschafft. Auf das Denken, das schon da sein soll, stützt er sich, auf dasjenige, was im Menschen schon lebt: Ich denke, also bin ich, - was einfach widerlegt werden kann mit jedem Nachtschlafe des Menschen, denn da kann man ebensogut sagen: Ich denke nicht, also bin ich nicht. Irgendwie Fruchtbares folgt nicht aus dem Descartesschen «Ich denke, also bin ich». Aber wie wenig diese Weltanschauung geeignet ist, mit dem eigenen Seelenwesen unterzutauchen in die Natur, das geht am besten daraus hervor, wenn man ein einziges äußeres Kennzeichen anführt. Descartes versuchte zu charakterisieren die die Seele umgebende Natur. Und er suchte selbst
die Tiere als bewegte Maschinen, als seelenlose Maschinen anzusprechen. Nur der Mensch selber, so meinte er, könne von sich so reden, als ob er eine Seele hätte. Die Tiere sind bewegte Maschinen, sind seelenlose Maschinen.
So wenig ist die Seele aus diesem Volkstume heraus in die Möglichkeit versetzt, unterzutauchen in das innere Leben des Außendinges, daß sie nicht finden kann die Beseelung innerhalb der tierischen Welt. Was Wunder, daß sich das dann fortsetzte bis in den Materialismus des achtzehnten Jahrhunderts herein und fortsetzte - wie wir heute noch mit einigen Worten erwähnen werden - bis in unsere Tage herein, wie in jenem Materialismus des achtzehnten Jahrhunderts, in jenem Materialismus, der die ganze Welt nur als einen Mechanismus auffaßte, und der sich zuletzt darüber klar wird, besonders bei de Lamettrie in seinem Buche «L'homme-machine» sogar dahin gelangt ist, den Menschen selber nur als bewegte Maschine aufzufassen. Das alles liegt keimhaft schon in Cartesius.
Goethe, aus seinem deutschen Bewußtsein heraus, lernte kennen diese Weltanschauung des Westens, und er sprach sich aus seinem deutschen Bewußtsein heraus aus: Da bieten sie uns eine Welt bewegter Atome, die sich stoßen und zerren. Wenn sie die mannigfaltigen, die schönen, die großen, erhabenen Erscheinungen der Welt dann wenigstens ableiten wollten aus diesen einander stoßenden, zerrenden Atomen. Aber nachdem sie dieses trostlose, öde Weltenbild hingestellt haben, lassen sie es hingestellt sein und tun nichts dafür, um zu zeigen, wie die Welt aus diesen Atomhäufungen hervorgeht.
Der Dritte, der zu nennen ist unter denjenigen Geistern, die gewissermaßen den Weltanschauungshintergrund bilden, aus dem auch alles hervorgesprossen ist, was der Deutsche geistig in jener Zeit durch Goethe, Schiller, Herder,
Lessing und so weiter geleistet hat, - der Dritte, der zu nennen ist: Hegel, in ihm sehen wir zugleich die dritte Seite des deutschen Wesens verkörpert. Wir sehen in ihm eine dritte Art, in der Seele den Punkt zu finden, durch den sich diese Menschenseele unmittelbar eins fühlen kann mit der ganzen Welt, mit dem, was göttlich-geistig die Welt durchpulst, durchwebt und durchsetzt. Sehen wir bei Fichte den Willen unmittelbar ergreifen im Innersten des Menschen, bei Schelling, ich möchte sagen, das Gemüt, so sieht man bei Hegel ergreifen den menschlichen Gedanken. Aber indem Hegel versucht, den Gedanken nicht bloß als menschlich, sondern in seiner Reinheit, losgelöst von allen sinnlichen Empfindungen und Wahrnehmungen, unmittelbar in der Seele zu ergreifen, fühlt sich Hegel so, als ob er, indem er in dem Leben und Weben und Werden des reinen Gedankens lebt, zugleich lebt in dem Gedanken, der nicht nur in der Seele lebt, sondern der in der Seele nur erscheinen soll, weil er sich in ihr offenbart, als göttlich-geistiges Denken alle Welt durchziehend. Wie die göttlich-geistigen Wesen ihre Gedanken gleichsam durch die Welt sprühen, wie sie die Welt denken und fortwährend denkend gestalten, das offenbart sich, wenn der Denker einsam in sich aufleben läßt das reine Denken, das Denken, das nicht aus der äußeren Sinneswelt entlehnt ist, sondern das der Mensch findet als in sich aufsprießendes Denken, wenn er sich seinem Innern hingibt. Im Grunde genornmen ist ja dasjenige, was Hegel da will, wenn man so sagen möchte, ein mystisches Wollen. Aber es ist kein unklarer, kein dunkler, kein nebuloser Mystizismus. Der dunkle, der unklare, der nebulose Mystizismus will sich in möglichst dunklen Gefühlen vereinigen mit dem Weltengrunde. Hegel will auch die Vereinigung der Seele mit dem Weltengrund, aber er sucht sie in der Kristallklarheit, in der Durchsichtigkeit des Denkens,
er sucht in dem inneren Erleben, er sucht Gedankenmäßiges der Welt. In vollendeter Klarheit sucht er dasjenige für die Seele, was man sonst bloß glaubt in unklarer Mystik zu erlangen.
Das alles zeigt, wie diese drei bedeutenden Geister von drei verschiedenen Seiten her bemüht sind, die menschliche Seele durch Hingabe an die Gesamtwirklichkeit zum Miterleben dieser Gesamtwirklichkeit zu bringen, wie sie überzeugt sind davon, daß in der Seele etwas gefunden werden kann, was die Welt in ihren Tiefen miterlebt und so ein befriedigendes Weltenbild ergibt.
Fichte spricht 1811, 1813 zu seinen Berliner Studenten von der Erlangung eines solchen Weltenbildes so, daß man sieht: er ist sich wohl bewußt, man müsse erstreben gewisse, in der Seele schlummernde Erkenntniskräfte. Fichte sagt dann in den genannten Jahren zu seinen Berliner Studenten: Wenn man dasjenige, was angestrebt werden muß, um die Welt wirklich innerlich geistig zu begreifen, wirklich haben will, so ist es notig, daß der Mensch einen in sich selber schlummernden Sinn, einen neuen Sinn, ein neues Sinnesorgan findet, erweckt. So wie im physischen Körper das Auge herausgebildet wird, so muß aus der Seele im Fichteschen Sinne ein neues Sinnesorgan entwickelt werden, wenn hineingeschaut werden soll in die geistige Welt. Daher sagt Fichte kühn in diesen Jahren, in denen, soweit er es erreichen konnte in seinem verhältnismäßig kurzen Leben, seine Weltanschauung zum höchsten Gipfel gelangt ist, zu seinen Zuhörern: Mit dem, was ich Ihnen zu sagen habe, ist es, wie wenn unter eine Welt von Blinden ein einziger Sehender tritt. Was er ihnen zu sagen hat von der Welt des Lichts, der Welt der Farben, das macht sie zunächst betroffen, davon werden sie zunächst sagen, es sei Unsinn, weil sie nichts ahnen können.
Und Schelling - wir sehen es schon in dem Ausspruch, den Schubert über ihn getan hat - hat aufmerksam gemacht auf die intellektuelle Anschauung. Was er in seine Worte prägte, wofür er eine Weisheit prägte, das suchte er zu erkunden in der Welt dadurch, daß er das in ihm gelegene Organ zu einer «intellektuellen Anschauung» entwickelt zu haben glaubte. Aus dieser intellektuellen Anschauung heraus spricht Schelling so, daß er wirken konnte, wie es eben charakterisiert worden ist.
Hegel wendet sich dann von seinem Standpunkte aus gegen diese intellektuelle Anschauung. Er war des Glaubens, wenn man diese intellektuelle Anschauung besonders geltend mache, so wolle man einzelne Ausnahme-Menschen kennzeichnen, Menschen, die gewissermaßen durch eine höhere Anlage fähig geworden seien, hineinzuschauen in die geistige Welt. Hegel war vielmehr im tiefsten Sinne davon überzeugt, daß das Hineinschauen in die geistige Welt jedem Menschen möglich ist, und das wollte er gründlich betonen.
So standen sich diese Geister nicht nur in dem gegenüber, was sie inhaltlich gesagt haben, sondern sie standen sich auch in so tiefgehenden Anschauungen gegenüber. Aber darauf kommt es nicht an, sondern auf die Tatsache, daß sie alle im Grunde genommen das erstreben, was man im wahren Sinne Geisteswissenschaft nennen kann: das Erleben der Welt durch dasjenige, was in des Menschen tiefstem Innern sitzt. Und darinnen sind sie, wie Fichte, wie Hegel, wie Schelling es oftmals ausgesprochen haben, einig mit dem größten Geiste, der aus deutschem Volkstum heraus geschaffen hat, mit Goethe.
Goethe spricht in einer wunderschönen kleinen Abhandlung, die er «Anschauende Urteilskraft» überschrieben hat, von dieser anschauenden Urteilskraft. Was meint Goethe
mit dieser anschauenden Urteilskraft? Die Sinne schauen zunächst die äußere physische Welt an. Der Verstand kombiniert, was diese äußere physische Welt ihm darbietet. Wenn die Sinne die äußere physische Welt anschauen, so sehen sie nicht den Grund der Dinge, meint Goethe; der muß geistig angeschaut werden. Da muß das, was Urteilskraft ist, nicht bloß kombinieren, da muß das, was als Begriffe und Ideen entsteht, nicht bloß so entstehen, daß es etwas anderes abbilden will, da muß in der Kraft, die Begriffe und Ideen bildet, etwas leben vom Weltengeiste selber. Da muß die Urteilskraft nicht bloß denken, da muß die Urteilskraft anschauen, geistig anschauen, wie sonst die Sinne anschauen. Goethe ist ganz einig mit denjenigen, die gewissermaßen den Hintergrund des Weltanschauungsbildes gegeben haben, wie sie sich auch mit ihm einig fühlen. So wie Fichte etwa, als er seine scheinbar so abstrakte Wissenschaftslehre in der ersten Auflage veröffentlichte, sie bogenweise an Goethe schickte und ihm schrieb: Die reine Geistigkeit des Gefühles, die man an Ihnen sieht, muß auch dem, was wir schaffen, Probierstein sein.
Ein wunderbares Verhältnis geistiger Art ist überhaupt zwischen den drei genannten Weltanschauungspersönlichkeiten und Geistern wie Goethe; wir könnten dann auch Schiller, wir könnten dann auch Herder, wir könnten sie alle anführen, die in einer so großen Zeit unmittelbar aus den Tiefen des deutschen Volkstums heraus geschöpft haben.
Man muß sagen, über all dem, was da entstand in Fichte, Schelling, Hegel, auch in den anderen, ist etwas enthalten, was in keinem einzigen voll zum Ausdruck kommt: Fichte sucht die geistige Welt zu erkennen, indem er den Willen erlebt, wie er hereinströmt in die Seele; Schelling wendet sich mehr zum Gemüte, Hegel zu dem Gedankeninhalt der Welt, andere zu anderem. Über allem schwebt gewissermaßen
wie die Einheit, die sich auf drei oder so und so viel verschiedene Arten äußert, das, was man wirklich nennen kann: das Streben des deutschen Volksgeistes selber, der sich durch keine einzelne Persönlichkeit voll aussprechen kann, der sich wie in drei Schattierungen zum Beispiel in bezug auf ein Weltenbild in Fichte, Schelling und Hegel ausspricht. Wer nicht als dogmatischer Anhänger oder Gegner zu diesen Persönlichkeiten steht - über solche Kinderei könnte man heute hinaus sein, daß man Anhänger oder Gegner eines Geistes sein will, wenn man ihn in seiner Größe einsehen will -, sondern ein Herz und einen Sinn und ein offenes Empfinden hat für ihr Streben, der wird überall, in allen ihren Äußerungen etwas durch-hören wie die deutsche Volksseele selber, so daß gleichsam dasjenige, was sie sagen, immer mächtiger ist als dasjenige, was unmittelbar zum Ausdruck kommt. Das ist so das Merkwürdige und Geheimnisvolle dieser Geister. Und daher kommt es nun, daß spätere, weit geringere Persönlichkeiten, als diese großen, genialischen, sogar zu bedeutenderen, zu eindringlicheren geistigen Wahrheiten kommen konnten, als diese führenden und tonangebenden Geister selber. Das ist das Bedeutsame: Durch diese Geister spricht sich eben etwas aus, was mehr ist als diese Geister, was der zentrale deutsche Volksgeist selber ist, der fortwirkt, so daß dann Geringere kommen konnten, weit weniger Begabte, und in diesen weit weniger Begabten derselbe Geist zum Ausdrucke kommt, aber sogar auf eine geisteswissenschaftlichere Art, als bei Fichte, Schelling, Hegel selber. Sie waren diejenigen, die zuerst, ich möchte sagen, den Ton angegeben hatten und zum ersten Mal etwas der Welt mitteilten, es herausholten aus dem Quell des geistigen Lebens. Das ist selbst dem Genialischen schwierig. Nachdem aber die Anregung, die große, die gewaltige Anregung gegeben war,
kamen kleinere Geister. Und man muß sagen: Diese kleineren Geister, sie haben zum Teil dasjenige, was darstellt den Weg hinein in die geistigen Welten, noch tiefer, noch bedeutungsvoller getroffen als diejenigen, von denen sie abhängig waren, die ihre Lehrmeister waren.
So sehen wir bei Immanuel Hermann Fichte, dem Sohn des großen Johann Gottlieb Fichte, wie er auf seine Art nach einer Geisteswissenschaft strebt, und zwar so, daß er in dem sinnlichen Menschen, der vor uns steht, den die äußeren Sinne und die äußere Wissenschaft ergreifen, einen höheren Menschen sucht, den er einen ätherischen Menschen nennt, und in dem die Bildekräfte liegen für diesen physischen Menschen, der aufgebaut wird, bevor der physische Leib seine Vererbungssubstanz von den Eltern erhält, der sich erhält als die Summe der Bildekräfte, wenn der physische Leib durch die Pforte des Todes geht. Von einem ätherischen Menschen, von einem innerlich erkrafteten und von Kraft erfüllten ätherischen Menschen, der ebenso den ewigen Kräften des Universums angehört, wie der Mensch hier als physischer Mensch den physischen Kräften der Vererbungsströmung angehört, davon spricht Immanuel Hermann Fichte, wohl aus dem Umgang mit seinem Vater heraus, der ihm ein guter Erzieher war.
Und man möchte sagen: Wie zu höheren Höhen getragen finden wir das Fichtesche, das Schellingsche Streben bei einem Manne, der wenig bekannt geworden ist, der geradezu zu den vergessenen Geistern des deutschen Geisteslebens gehört, aber in dem gerade tief wurzelt, was Wesen des deutschen Volksgeistes ist, - in Troxler. Troxler - wer kennt Troxler? Und dennoch, wie steht dieser Troxler vor uns? Schon unter dem Einflusse namentlich von Schelling schreibt er 1811 seine tiefsinnigen «Blicke in das Wesen des Menschen» und hält dann 1834 seine Vorlesungen über
Philosophie. Diese Vorlesungen sind gewiß nicht pikant geschrieben, um das ausländische Wort für etwas Ausländisches zu gebrauchen, aber sie sind so geschrieben, daß sie uns zeigen: Da spricht ein Mensch, der nicht bloß mit dem Verstande, mit dem man nur Endliches erfassen kann, sich der Welt nähern will, sondern es spricht einer, der die ganze Persönlichkeit des Menschen mit all ihren Kräften hingeben will an die Welt, damit diese Persönlichkeit, wenn sie in die Weltenerscheinungen untertaucht, eine Erkenntnis mitbringt, die befruchtet ist von dem Miterleben, von dem intimsten Miterleben mit dem Sein der Welt. Und Troxler weiß etwas davon, daß unter denjenigen Kräften der Seele, die zunächst der äußeren Natur und ihrer Sinnlichkeit zugewendet sind, höhere geistige Kräfte leben. Und auf eine merkwürdige Art sucht nun Troxler den Geist über sich selbst zu erhöhen. Er spricht von einem übergeistigen Sinn, der im Menschen erweckt werden könne, von einem über-geistigen Sinn, der da schlummert im Menschen. - Was meint Troxler damit? Er meint damit: Der Geist des Menschen denkt sonst nur in abstrakten Begriffen und Ideen, die trocken und leer sind, die bloße Bilder der Außenwelt sind; in derselben Kraft, die in diesen abstrakten Begriffen und Ideen lebt, lebt aber auch etwas, das der Mensch erwecken kann als eine geistige Wesenheit. Dann schaut er in übersinnlichen Bildern so, wie man die äußere Wirklichkeit mit Augen schauen kann. Im gewöhnlichen Er-kennen liegt zuerst das Sinnesbild vor, und der Gedanke kommt hinzu im Erkenntnisvorgang, der Gedanke, der nicht sinnlich-bildhaft ist. Im geistigen Erkenntnisvorgang liegt das übersinnliche Erlebnis vor; dieses könnte als solches nicht angeschaut werden, wenn es sich nicht durch eine dem Geist naturgemäße Kraft in das Bild ergösse, das sie zur geistig-anschaulichen Versinnlichung bringt. Ein solches
Erkennen ist für Troxier das des übergeistigen Sinnes. Und was diesem übergeistigen Sinn bei Troxler nebenher geht, nennt er den übersinnlichen Geist, den Geist, der sich erhebt über das bloße Anschauen des Sinnlichen, und der als Geist miterlebt, was da draußen in der Welt webt und west. Wie brauchte ich für diejenigen verehrten Zuhörer, die einen solchen Vortrag wie den, den ich am Freitag vorletzter Woche gehalten habe, angehört haben, noch zu er-wähnen, daß in diesem übergeistigen Sinn und übersinnlichen Geist des Troxler die Keime - wenn auch erst die Keime, aber so doch die Keime - zu dem liegen, was ich als die zwei Wege in Geisteswissenschaft hinein zu charakterisieren hatte.
Aber noch in einer anderen Weise spricht Troxler wunderbar es aus. Er sagt: Wenn der Mensch zunächst so, wie er mit seiner Seele, mit seinem ewigen Menschen hineingestellt ist in seine physische Leiblichkeit, - wenn der Mensch da dem Moralischen, dem Religiösen, aber auch der äuße-ren unmittelbaren Wirklichkeit gegenübersteht, dann entwickelt er drei Kräfte: Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei Kräfte, die er fortentwickelt, entwickelt er im Leben innerhalb des physisch-sinnlichen Leibes. Es gehört einfach zu dem Menschen, so wie er dasteht in der physisch-sinnlichen Welt, daß er in Glaube, in Liebe, in Hoffnung lebt. Aber Troxler sagt: Dasjenige, was als Glaube, als berechtigter Glaube hier innerhalb des physischen Leibes der Seele des Menschen eigen ist, das ist gewissermaßen das Äußere für eine tiefere Kraft, die in der Seele drinnen ist, die durch diesen Glauben als Göttliches in die physische Welt hereinscheint. Aber hinter dieser Glaubenskraft, zu der, um sie zu entfalten, durchaus der physische Leib gehört, liegt ein übersinnliches Hören, das heißt der Glaube ist gewissermaßen dasjenige, was der Mensch macht aus dem übersinnlichen
Hören. Indem er sich für das übersinnliche Hören des sinnlichen Werkzeuges bedient, glaubt er. Kommt er aber los von seinem sinnlichen Leib, erlebt er sich im Seelischen, so geht ihm aus derselben Kraft, die im Sinnesleben zum Glauben wird, das übersinnliche Hören auf, durch das er sich hineinvertiefen kann in eine Welt der geistigen Ton-erscheinungen, durch die geistige Wesenheiten und geistige Tatsachen zu ihm sprechen.
Und die Liebe, die der Mensch hier im physischen Leibe entfaltet, welche die Blüte des Menschenlebens auf Erden ist, sie ist der äußere Ausdruck für eine Kraft, die dahinter liegt: für geistiges Fühlen oder Tasten, sagt Troxler. Und wenn der Mensch dieselbe Kraft, die hier als Blüte des moralischen Erdendaseins, des religiösen Erdendaseins lebt, wenn er diese Liebe noch vertieft, wenn er zu den Untergründen dieser Liebe geht, dann entdeckt er in sich, daß der geistig-seelische Mensch geradeso Fühlorgane hat, durch die er die geistigen Wesenheiten und geistigen Tatsachen berühren kann, wie er mit seinen sinnlichen Fühl- oder Tastorganen die physisch-sinnlichen Tatsachen berühren kann. Hinter der Liebe liegt das geistige Fühlen oder Tasten, wie hinter dem Glauben das geistige Hören liegt.
Und hinter der Hoffnung, die der Mensch in dieser oder in jener Weise hat, liegt das geistige Sehen, das Hineinsehen durch den geistigen Sinn des Sehens in die geistige Welt.
So sieht Troxler hinter dem, was der Mensch selbst als Glaubens-, als Liebe-, als Hoffnungskraft darlebt, nur den äußeren Ausdruck für höhere Kräfte: für ein geistiges Hören, für ein geistiges Fühlen, für ein geistiges Schauen oder Sehen. Und dann sagt er: Wenn der Mensch sich der Welt so hingeben kann, daß er mit seinem geistigen Hören, geistigen Fühlen, geistigen Schauen sich hingibt, dann leben in ihm nicht nur Gedanken auf, die so äußerlich abstrakt
vielfach die äußere Welt wiedergeben, sondern, wie Trox1er sich ausdrückt, «sensible Gedanken», Gedanken, die selber gefühlt werden können, das heißt, die lebendige Wesen sind, und «intelligente Gefühle», das heißt nicht bloß dunkle Gefühle, in denen man das Weltendasein fühlt, sondern etwas, wodurch die Gefühle selber intelligent werden. Wir wissen aus dem eben erwähnten Vortrag, daß es eigentlich der Wille ist, nicht die Gefühle; aber bei Troxler liegt durchaus der Keim zu alle dem, was man heute in der Geisteswissenschaft darstellen kann. Wenn der Mensch also überhaupt zu diesem Schauen, zu diesem Hören, Tasten der geistigen Welt erwacht, erwacht in diesem Fühlen Gedankenleben, durch das sich der Mensch mit dem lebendigen Gedanken verbinden kann, der in der geistigen Welt webt und lebt, so wie der Gedanke wesenhaft, nicht bloß abstrakt, in uns lebt. So tief fühlt Troxler sein Streben nach Geisteswissenschaft. Und ich möchte eine Stelle aus Troxler vorlesen, aus der Sie gerade werden ersehen können, wie tiefgehend dieses Streben bei Troxler war. Er sagt einmal:
«Schon früher haben die Philosophen einen feinen, hehren Seelleib unterschieden von dem gröberen Körper, oder in diesem eine Art von Hülle des Gesichts angenommen, eine Seele, die ein Bild des Leibes an sich habe, das sie Schema nannten, und das ihnen der innere höhere Mensch war... In der neuesten Zeit selbst Kant in den Träumen eines Geistersehers träumt ernsthaft im Scherze einen ganzen inwendigen, seelischen Menschen, der alle Gliedmaßen des auswendigen an seinem Geistesleib trage.»
Dann macht Troxler noch auf andere aufmerksam, die mehr oder weniger geahnt haben, aus der Tiefe des deutschen Geistesstrebens heraus geahnt haben diese andere Seite des Weltenwesens. Troxler sagt weiter:
«Lavater dichtet und denkt ebenso, und selbst, wenn Jean Paul humoristisch über das Bonnetsche Unterziehröckchen und das Platnersche Seelenschnürleibchen scherzt, die im gröberen Körperüberrock und Marterkittel stecken sollen, so hören wir ihn doch auch wieder fragen: Wozu und woher wurden diese außerordentlichen Anlagen und Wünsche in uns gelegt, die bloß wie verschluckte Diamanten unsere erdige Hülle langsam verschneiden? Warum wurde ich auf den schmutzigen Erdenkloß ein Geschöpf mit unnützen Lichtflügeln geklebt, wenn es in die Geburtsscholle zurückfaulen sollte, ohne sich je mit ätherischen Flügeln loszuwinden?»
Auf solche Strömungen im deutschen Geistesleben macht Troxler aufmerksam. Und dann geht ihm der Gedanke auf, daß nunmehr eine besondere Wissenschaft ersprießen könnte, eine Wissenschaft, die Wissenschaft ist, aber die es zum Beispiel mit der Poesie gemeinschaftlich hat, daß sie entsteht aus der menschlichen Seele, indem nicht eine einzelne Seelenkraft, sondern die ganze menschliche Seele sich hingibt, um die Welt mitzuerleben.
Wenn man so von außen den Menschen anschaut, meint Troxler, so lernt man Anthropologie kennen. Anthropologie ist dasjenige, was entsteht, wenn man mit den Sinnen, mit dem Verstande untersucht, was der Mensch darbietet, was sich am Menschen offenbart. Damit findet man aber nicht das volle Wesen des Menschen. Was Troxler in dem charakterisierten Sinne nennt geistiges Hören, geistiges Tasten, geistiges Schauen, was er nennt übersinnlichen Geist, übergeistigen Sinn, das gehört dazu, um etwas Höheres am Menschen zu schauen. Eine Wissenschaft steht vor seiner Seele, welche entsteht nicht aus den Sinnen, nicht aus dem bloßen Verstande heraus, sondern aus diesem höheren Erkenntnisvermögen des Menschen heraus. Und über diese
Wissenschaft spricht sich Troxler sehr charakteristisch in der folgenden Weise aus. Er sagt - 1835 sind die folgenden Worte Troxlers geschrieben -:
«Wenn es nun höchst erfreulich ist, daß die neueste Philosophie, welche wir längst als diejenige anerkannt haben, die alle lebendige Religion begründet, und in jeder Anthroposophie, also in Poesie, wie in Historie sich offenbaren muß, emporwindet, so ist doch nicht zu übersehen, daß diese Idee nicht eine wahrhafte Frucht der Spekulation sein kann, und die wahrhaftige Persönlichkeit oder Individualität des Menschen weder mit dem, was sie als subjektiven Geist oder endliches Ich aufstellt, noch mit dem, was sie als absoluter Geist oder absolute Persönlichkeit diesem gegenüberstellt, verwechselt werden darf.»
Da ersteht vor Troxlers Sinn in den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts der Gedanke der Anthroposophie, jener Wissenschaft, die im wahren Sinne des Wortes eine auf menschliche Kraft begründete Geisteswissenschaft sein will. Geisteswissenschaft kann, wenn sie die Keime richtig zu verstehen vermag, die aus der fortlaufenden Strömung des deutschen Geisteslebens ihr kommen, eben sagen: Bei den westlichen Völkern zum Beispiel kann ja selbst irgend etwas, was mit Geisteswissenschaft zu vergleichen ist, was mit Anthroposophie zu vergleichen ist, entstehen; aber es wird dort immer so entstehen, daß es neben dem fortlaufenden Strom der Weltanschauung, neben dem, was dort Wissenschaft ist, einherläuft, daher sehr, sehr leicht zu Sektiererei oder zu Dilettantismus neigt. Im deutschen Geistesleben - und in dieser Beziehung steht das deutsche Geistesleben einzig da - ergibt sich Geisteswissenschaft als etwas, was gerade auf naturgemäße Weise hervorgeht aus den tiefsten Impulsen, aus den tiefsten Kräften dieses deutschen Geisteslebens. Selbst wenn dieses deutsche
Geistesleben wissenschaftlich wird in bezug auf die geistige Welt und ein Streben nach geistiger Erkenntnis entwickelt, so liegen in diesem Streben schon die Keime zu demjenigen, was Geisteswissenschaft werden muß. Daher sehen wir auch niemals wiederum verglimmen dasjenige, was in dieser Weise durch das deutsche Geistesleben strömt.
Oder ist es nicht etwa geradezu wunderbar, daß im Jahre 1856 ein kleines Büchelchen erschien von einem Waldecker Pfarrer - in Sachsenberg in Waldeck, da war er Pfarrer. In diesem kleinen Büchelchen - wie gesagt, auf Übereinstimmung, auf den Inhalt kommt es dabei nicht an, sondern auf das Streben - ist in einer der Hegelschen ganz entgegengesetzten Art versucht, für die menschliche Seele etwas zu finden, wodurch diese menschliche Seele mit Erweckung der in ihr schlummernden Kraft sich selber anschließen kann an die ganze hehre erwachende geistige Welt. Und in bewundernswerter Weise ist dies von dem einfachen Pfarrer Rocholl in Sachsenberg im Fürstentum Waldeck dargestellt in seinem Büchelchen: «Beiträge zu einer Geschichte deutscher Theosophie» - ein kleines Büchelchen, aber voll von wirklichem innerem Geistesleben, von einem Geistesleben, bei dem man ersehen kann, daß derjenige, der es in seiner Einsamkeit gesucht hat, überall die Möglichkeit findet, aus dem einsamen inneren Erleben der Seele aufzusteigen zu weiten Ausblicken in die Welt, die hinter der sinnlichen verborgen ist und doch diese sinnliche immer trägt, so daß man nur eine Seite der Welt hat, wenn man dieses sinnliche Leben betrachtet. Man weiß nicht, was man an einem solchen Büchelchen, das ja gewiß heute einen phantastischen Eindruck machen muß - aber darauf kommt es auch nicht an -, zuerst bewundern soll; ob man bewundern soll mehr die Tatsache, daß der einfache Landpfarrer sich in die tiefsten Tiefen geisterkennerischen
Strebens hinein findet, oder aber, ob man mehr bewundern mag die Grundlagen der fortlaufenden Strömung des deutschen Geisteslebens, die selbst in dem einfachsten Menschen solche Blüten treiben kann. Und wenn wir Zeit hätten dazu, so könnte ich Ihnen Hunderte und Hunderte von Beispielen anführen, aus denen Sie sehen würden, wie allerdings nicht auf dem Gebiete des äußerlich Anerkannten, sondern mehr auf dem Gebiet der vergessenen Geistestöne, aber dennoch lebendig fortlebender Geistestöne überall solche Menschen vorhanden sind, die dasjenige, was man ein geisteswissenschaftliches Streben innerhalb der deutschen Gedankenentwickelung nennen kann, herauftragen bis in unsere Tage.
Schon als ich die erste Auflage meiner «Welt- und Lebensanschauungen» schrieb, die jetzt unter dem Titel «Rätsel der Philosophie» vor mehr als einundeinhalb Jahren wieder erschienen sind, machte ich aufmerksam auf einen wenig gekannten Denker: Carl Christian Planck. Aber was half es denn viel, auf solche Geister aufmerksam zu machen
- zunächst? Solche Geister sind mehr zu fassen wie ein Ausdruck, wie eine Offenbarung dessen, was nun lebt, was in dem bewußten Wissenschaftstreiben nicht zum Ausdruck kommt, aber dennoch dieses Wissenschaftstreiben vielfach trägt und hält. Gerade aus den tiefsten Tiefen des deutschen Wesens gehen solche Geister hervor, wie auch Carl Christian Planck einer ist. Planck hat ein Buch geschrieben:
«Wahrheit und Flachheit des Darwinismus», ein sehr bedeutendes Buch. Er hat auch ein Buch geschrieben über die Erkenntnis der Natur. Von diesem Buch will ich nur das Folgende erwähnen, obwohl im Grunde genommen jede Seite interessant ist:
Wenn die Menschen heute über die Erde sprechen, so sprechen sie, ich möchte sagen, im geologischen Sinne. Die
Erde ist ihnen der mineralische Körper, und der Mensch wandelt so als ein fremdes Wesen darauf herum. Für Planck ist die Erde mit allem, was darauf wächst und einschließlich des Menschen ein großer Geist-Seelenorganismus, und der Mensch gehört dazu. Man hat die Erde einfach nicht begriffen, wenn man nicht gezeigt hat, wie im ganzen Organismus der Erde der physische Mensch vorhanden sein muß, indem sich seine Seele äußerlich verkörpert. Die Erde als ein Ganzes wird gefaßt, all ihre Kräfte von den physischesten bis heran zu den geistigsten werden als ein Ganzes erfaßt. Ein einheitliches Weltenbild, das geistgemäß ist, um diesen Goetheschen Ausdruck zu gebrauchen, will Planck aufstellen. Aber Planck ist sich bewußt - er ist in dieser Beziehung einer der charakteristischsten Denker des neunzehnten Jahrhunderts -, wie dasjenige, was er zu schaffen in der Lage ist, wirklich nun hervorgeht aus dem tiefsten Inneren des deutschen Volksgeistes. Das bringt er in der Schrift «Grundlinien einer Wissenschaft der Natur», die 1864 erschienen ist, in folgenden schönen Worten zum
Ausdruck:
«Welche Macht tiefgewurzelter Vorurteile von der bisherigen Anschauung aus seiner» - des Verfassers - «Schrift entgegensteht, dessen ist er sich vollkommen bewußt; allein wie schon die Arbeit selbst, trotz aller Ungunst der Umstände, die zufolge der ganzen Lage und Berufstellung des Verfassers» - er war nämlich ein einfacher Gymnasiallehrer, nicht ein Universitätsprofessor - «einem Werke dieser Art sich entgegenstellte, doch ihre Durchführung und ihren Weg in die Uffentlichkeit sich erkämpft hat, so ist er auch gewiß, daß das, was sich jetzt erst seine Anerkennung erkämpfen muß, einst als die einfachste und selbstverständlichste Wahrheit erscheinen wird, und daß darin nicht bloß seine Sache, sondern die wahrhaft deutsche Anschauung der
Dinge über alle noch unwürdig äußerliche und undeutsche Auffassung der Natur und des Geistes siegen wird.
Was in unbewußter tiefsinniger Ahnung schon unsere mittelalterliche Dichtung vorgebildet hat, das wird endlich in der Reife der Zeiten an unserer Nation sich erfüllen. Die unpraktische, mit Schaden und Spott heimgesuchte Innerlichkeit deutschen Geistes (wie Wolfram von Eschen-bach sie in seinem «Parzival» schildert)» - das ist 1864, lange vor Wagners geschrieben! -, «erringt endlich in der Kraft ihres unablässigen Strebens das Höchste, sie schaut den letzten einfachen Gesetzen der Dinge und des menschlichen Daseins selbst auf den Grund; und was die Dichtung phantastisch mittelalterlich in den Wundern des Grals versinnbildlicht hat, dessen Herrschaft ihr Held erringt, das erhält umgekehrt seine rein natürliche Erfüllung und Wirklichkeit in der bleibenden Erkenntnis der Natur und des Geistes selbst.»
So spricht derjenige, der dann die Zusammenfassung seines Weltenbildes gegeben hat unter dem Titel «Testament eines Deutschen», in dem wirklich versucht wird, wiederum auf einer höheren Stufe, als dies Schelling möglich war, Natur und Geist zu durchdringen. 1915 ist dieses «Testament eines Deutschen» in neuer Auflage erschienen. Ich glaube nicht, daß sich viele Menschen damit beschäftigt haben. Diejenigen, die sich berufsmäßig mit so etwas beschäftigen, die hatten ja anderes zu tun: in demselben Verlage, in dem dieses «Testament eines Deutschen» erschienen ist mit einer echt deutschen Weltanschauung, erschienen ja die Bücher von Bergson, von jenem Bergson - er heißt noch immer Bergson! -, der die gegenwärtige Zeit dazu benutzt, um nicht nur zu schmähen sondern in wirklichem Sinne zu verleumden, was aus deutschem Geistesleben hervorgegangen ist; der es fertig gebracht hat, die ganze gegenwärtige
Geisteskultur der Deutschen als eine mechanistische zu bezeichnen. Ich habe schon einmal hier gesagt: wenn er schrieb, die Deutschen sind heruntergekommen von ihrer Höhe, auf der sie unter Goethe, Schiller, Herder, Schelling und Hegel gestanden haben, denn jetzt machen sie eine mechanische Kultur, so hat er wahrscheinlich geglaubt, die Deutschen würden ihren Gegnern, wenn sie mit Kanonen anrücken, Novalis oder Goethes Gedichte vordeklamieren! Aber aus dem Umstande, daß er jetzt nur Kanonen und Flinten sieht - oder auch wahrscheinlich nicht sieht -, macht er die deutsche Kultur zu einer vollständig mechanistischen.
Nun, ebenso wie die anderen Dinge, die ich in dieser Zeit spreche, in den Jahren vor dem Kriege immer wieder und wiederum gesagt worden sind, auch vor den Angehörigen anderer Nationen - so daß sie nicht etwa als durch das Verhältnis des Krieges veranlaßt aufgefaßt werden dürfen -, habe ich in dem Buch, das bei Kriegsbeginn abgeschlossen war, eben der zweiten Auflage meiner «Welt-und Lebensanschauungen», Bergsons Philosophie darzustellen versucht. Und ich habe in diesem selben Buch gleichzeitig aufmerksam gemacht, wie, ich möchte sagen, einer der blendendsten Gedanken bei Bergson, unendlich viel größer, einschneidender und tiefer - wiederum haben wir einen solch vergessenen Ton des deutschen Geisteslebens -bei dem wenig bekannten Wizlhelm Heinrich Preuß schon 1882 erschienen ist. Bergson macht nämlich an einer Stelle seiner Bücher darauf aufmerksam, wie man auszugehen habe bei der Weltenbetrachtung nicht von dem Mineral-reich und vom Pflanzenreich und Tierreich und dann erst den Menschen daran zu gliedern habe, sondern vom Menschen; wie der Mensch das Ursprüngliche ist und die anderen Wesenheiten in der fortlaufenden Strömung, in der er
sich entwickelte, während er das Erste war, abgestoßen hat als weniger Vollkommenes, so daß die anderen Natur-reiche sich aus dem Reich des Menschen heraus entwickelt haben.
Ich habe in meinen «Rätseln der Philosophie» darauf aufmerksam gemacht, wie der einsame tiefe Denker, aber auch energische, kraftvolle Denker, Wilhelm Heinrich Preuß, in seinem Buche «Geist und Stoff», und im Grunde genommen schon früher als 1882, diesen Gedanken in mächtiger, in mutvoller Weise dargestellt hat, - den Gedanken, daß man nicht zurecht komme mit dem im bloß westlichen Sinne aufgefaßten Darwinismus, sondern daß man sich vorzustellen hat: Wenn man zurückgeht in der Welt, so hat man zuerst den Menschen. Der Mensch ist das Ursprüngliche, und indem der Mensch sich weiterentwickelt, stößt er gewisse Wesenheiten aus, zuerst die Tiere, dann die Pflanzen, dann die Mineralien. Das ist der umgekehrte Entwickelungsgang.
Ich kann heute nicht darauf eingehen - in Vorträgen der früheren Jahre bin ich auf diesen Gedanken sogar öfters eingegangen -, aber ich will heute erwähnen, daß diese geistgemäße Weltanschauung in den achtziger Jahren voll da-steht innerhalb der deutschen Geistesströmung in dem Buche von Preuß «Geist und Stoff». Eine Hauptstelle aus meinem Buche «Die Rätsel der Philosophie» möchte ich Ihnen vorlesen, damit Sie sehen, wie sich da mit gewichtigen Worten eine eindringliche Weltanschauung, die in der ganzen Strömung, die ich Ihnen heute charakterisiert habe, liegt, die in das Geistesleben der Menschheit hineinströmt. Da sagt Preuß
«Es dürfte... an der Zeit sein, eine... Lehre von der Entstehung der organischen Arten aufzustellen, welche sich nicht allein auf einseitig aufgestellte Sätze aus
der beschreibenden Naturwissenschaft gründet, sondern auch mit den übrigen Naturgesetzen, welche zugleich auch die Gesetze des menschlichen Denkens sind, in voller Übereinstimmung ist. Eine Lehre zugleich, die alles Hypothesierens bar ist und nur auf strengen Schlüssen aus naturwissenschaftlichen Beobachtungen im weitesten Sinne beruht; eine Lehre, die den Artbegriff nach tatsächlicher Möglichkeit rettet, aber zugleich den von Darwin aufgestellten Begriff der Entwickelung hinübernimmt auf ihr Gebiet und fruchtbar zu machen sucht.
Der Mittelpunkt dieser neuen Lehre nun ist der Mensch, die nur einmal auf unserem Planeten wiederkehrende Spezies: Homo sapiens. Merkwürdig, daß die älteren Beobachter bei den Naturgegenständen anfingen und sich dann dermaßen verirrten, daß sie den Weg zum Menschen nicht fanden, was ja auch Darwin nur in kümmerlichster und durchaus unbefriedigender Weise gelang, indem er den Stammvater des Herrn der Schöpfung unter den Tieren suchte - während der Naturforscher bei sich als Menschen anfangen mußte, um 50 fortschreitend durch das ganze Gebiet des Seins und Denkens zur Menschheit zurückzu-kehren!... Es war nicht Zufall, daß die menschliche Natur aus der Entwickelung alles Irdischen hervorging, sondern Notwendigkeit. Der Mensch ist das Ziel aller tellurischen Vorgänge, und jede andere neben ihm auftauchende Form hat aus der seinigen ihre Züge entlehnt. Der Mensch ist das erstgeborene Wesen des ganzen Kosmos... Als seine Keime entstanden waren, hatte der gebliebene organische Rückstand nicht die nötige Kraft mehr, um weitere menschliche Keime zu erzeugen. Was noch entstand, wurde Tier oder Pflanze...»
1882 aus dem, was die Menschenseele geistig erleben kann, dargestellt innerhalb des deutschen Geisteslebens!
Dann kommt hinterher Bergson und stellt den Gedanken keinesfalls in einer solch kraftvollen, eindringlichen, mit dem innersten Leben der Seele zusammenhängenden Art dar, sondern, man möchte sagen, leicht geschürzt, trippelnd mehr und unbestimmt. Und die Menschen sind überwältigt von Bergson und wollen nichts wissen von Preuß. Und Bergson weiß anscheinend nichts von Preuß. Aber das ist bei jemandem, der über Weltanschauungen schreibt, ungefähr ebenso schlimm, wie wenn er davon etwas weiß und es nicht sagt. Aber wir wollen bei Bergson nicht untersuchen, ob er es gewußt hat und nicht gesagt hat, oder ob er es nicht gewußt hat, nachdem jetzt hinlänglich nachgewiesen ist, daß Bergson nicht nur Gedanken aus Schopenhauer entlehnt und in seiner eigenen Form wiedergibt, sondern auch der gesamten Philosophie des deutschen Idealismus, zum Beispiel Schelling und Fichte, Gedanken entnommen hat, als deren Schöpfer er sich zu betrachten scheint. Es ist in der Tat eine besondere Methode, das Verhältnis eines Volkstums zum anderen so zu charakterisieren, wie das Bergson jetzt fortwährend seinen Franzosen gegenüber macht, indem er deutsche Wissenschaft und die deutsche Erkenntnis als etwas besonders Mechanisches hinstellt, nachdem er sich zuvor bemüht - was ja wahrscheinlich keine sehr mechanische Tätigkeit ist -, seitenlang diese deutschen Weltanschauungspersönlichkeiten erst auszuschreiben. Nachderhand merkt man, daß der ganze Bergson überhaupt hätte schweigen können, wenn er nicht auf Grundlage der deutschen Weltanschauungspersönlichkeiten seine Weltanschauung aufgebaut hätte, die ja im Grunde genommen nichts anderes ist, als Cartesiusscher Mechanismus, der Mechanismus des achtzehnten Jahrhunderts, aufgewärmt durch etwas romanisch verstandenen Schellingianismus und Schopenhauerianismus.
Wie gesagt, man muß schon so sachgemäß die Dinge charakterisieren; denn das muß vor unserer Seele stehen, daß wir, wenn wir von dem Verhältnis des deutschen Wesens in der Gesamtentwickelung der Menschheit reden, nicht nötig haben, dieselbe Methode der Herabsetzung anderer Volkstümer einzuschlagen, die heute bei unseren Gegnern so weidlich angewandt wird. Der Deutsche ist in der Lage, auf das Tatsächliche hinzuweisen, und er wird nun aus der schweren Prüfung der gegenwärtigen Zeit auch die Kraft gewinnen, da noch in dieses deutsche Wesen mit seiner Seele unterzutauchen, wo es ihm bisher nicht gelungen ist. Die vergessenen Seiten des Strebens nach Geisteswissenschaft, sie werden wieder erinnert werden. Ich darf das immer wieder und wiederum sagen, nachdem ich mich seit mehr als dreißig Jahren bemühe, eine andere Seite vergessenen Strebens der deutschen Erkenntnis zu betonen.
Aus dem, was ganz und gar aus dem nur auf die Außenwelt gerichteten Erkennen des britischen Wesens hervorgegangen ist, haben wir die sogenannte Newtonsche Farbenlehre. Und die Macht des britischen Wesens, nicht nur äußerlich, sondern innerlich, geistig, ist so groß, daß diese Newtonsche Farbenlehre sich aller Geister, die über solche Dinge denken, bemächtigt hat. Nur Goethe, aus jenem Wesen heraus, das aus dem deutschen Volkstum gewonnen werden kann, er hat sich aufgelehnt gegen die Newtonsche Farbenlehre auf physikalischem Gebiete. Gewiß, die Newtonsche Farbenlehre ist, ich möchte sagen, in einem speziellen Kapitel dasselbe, was de Lamettries «L'Hommemachine» für alle seichten Oberflächlinge der Welt sein kann. Nur ist der Fall mit der Farbenlehre besonders tragisch. Seit 35 Jahren, wie gesagt, bemühe ich mich, die ganze Bedeutung der Goetheschen Farbenlehre darzustellen, den ganzen Kampf der deutschen Weltanschauung, die
in bezug auf die Farbenwelt in Goethe hervortritt, gegen die mechanistische Auffassung, die im britischen Volkstume wurzelt bei Newton. Das Kapitel «Goethe im Recht gegen Newton», es wird auch einmal zur Geltung kommen, wenn dasjenige immer mehr zur Geltung kommt, was nicht immer bewußt, aber doch lebendig wirksam fortlebt und was immer für denjenigen, der schauen will, geschaut werden kann. Und es wird zur Geltung kommen, gerade aus den Prüfungen unserer Zeit heraus, das innigste Bewußtsein des Deutschen von der Tiefe seines Erkenntnisstrebens.
Es ist fast eine Selbstverständlichkeit, und deshalb so leicht begreiflich wie alle oberflächlichen Selbstverständlichkeiten, wenn die Leute heute sagen: Wissenschaft ist ja selbstverständlich international. Der Mond ist auch international! Dennoch, was die einzelnen Menschen zu sagen haben über den Mond, das ist ganz und gar nicht international. Goethe, als er reiste, schrieb an seine deutschen Freunde zurück: «Nach dem, was ich bei Neapel, in Sizilien von Pflanzen und Fischen gesehen habe, würde ich, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, sehr versucht sein, eine Reise nach Indien zu machen, nicht um Neues zu entdecken, sondern das Entdeckte nach meiner Art anzusehen.» Gewiß ist die Wissenschaft international. Man kann die entsprechenden Ausführungen nicht leicht widerlegen, weil sie selbstverständlich sind, wie alles Oberflächliche selbstverständlich ist. Aber wie gesagt, sie ist auch international wie der Mond. Aber was die einzelnen Völker aus der Tiefe, aus der Wurzel ihres Volkstums heraus zu sagen haben über dasjenige, was international ist, das ist das Bedeutsame, das ist auch das Wirksame, das trägt die Menschheitsentwickelung aus der Art und Weise, wie sich die Art des einzelnen Volkes zu dem international zu Erkennenden zu stellen hat, weiter. Darauf kommt es an.
Bis heute kann man allerdings noch nicht sagen, daß gerade dasjenige, was im tiefsten Sinne deutsches Wesen darstellt auf dem Erkenntniswege, einen bedeutenden Eindruck gemacht hat in der Folgezeit. Innerhalb des deutschen Wesens selber wirkten Fichte, Schelling und Hegel zunächst so groß, daß die Nachwelt wie betäubt war und daß sie zunächst nur das eine oder das andere, die eine oder die andere Seite hervorbrachte, daß sogar der un-deutsche Materialismus innerhalb des deutschen Geisteslebens platzgreifen konnte. Besonders lehrreich ist es aber, wenn man sieht, wie das, was urdeutsch ist, in anderem Volkstum wirkt, wenn es darin untertaucht. Und urdeutsch ist zum Beispiel Schelling. Schelling hat viel gewirkt, zum Beispiel innerhalb des russischen Geisteslebens. Innerhalb des russischen Geisteslebens sehen wir, wie Schelling aufgenommen wird, wie seine gewaltigen Anschauungen der Natur, aber namentlich der Geschichte - für Naturanschauung hat der Russe nicht viel Sinn - aufgenommen wird. Aber wir sehen auch, wie gerade das Wesentliche, worauf es ankommt, im Osten Europas durchaus nicht verstanden werden kann. Ja, es ist besonders interessant - und Sie können das Genauere ja nachlesen in meiner Schrift «Gedanken während der Zeit des Krieges» -, wie dieser Osten Europas im neunzehnten Jahrhundert nach und nach herausleitet eine vollständige Ablehnung gerade des Geisteslebens nicht nur Mittel-, sondern sogar Westeuropas. Und man bekommt einen Eindruck vom deutschen Geistesleben, gerade wenn man sieht, wie dieses Wesentliche, das ich heute herauszuarbeiten versuchte, dieses Drinleben mit der Seele in Natur- und Geistesentwickelung, nicht verstanden werden kann gerade im Osten, wo man die Dinge äußerlich hinnimmt. Diesem Osten ist ja das Bewußtsein im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts gerade bei den Intellektuellen
furchtbar angeschwollen, - nicht bei den Bauern selbstverständlich, die auch von dem Kriege, selbst wenn sie ihn führen, nicht viel wissen. Merkwürdig geht es allerdings mit diesem Geistesleben des Ostens. Ich habe es ja schon einmal ausgeführt: Siawophilismus tritt uns in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, in den dreißiger Jahren auf, gerade befruchtet von Fichte, Schelling und Hegel; aber er tritt so auf, daß man Fichte, Schelling und Hegel nur äußerlich nimmt, ganz äußerlich, daß man davon keine Ahnung hat, wie Fichte, Schelling und Hegel
- die Werkzeuge des Willens, des Gemüts, des Denkens -, gerade sich objektiv zusammenleben mit dem, was äußerlich die Welt durchwebt und durchlebt. Und so konnte es kommen, daß dieses in bezug auf seinen Erkenntnissinn noch tief in mittelalterlichem Fühlen lebende Russentum gerade Fichte, Schelling und Hegel so aufnahm, daß eine fast größenwahnsinnige Anschauung im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts sich ausbildete, die auf literarischem und Erkenntnisgebiet wirklich eine Art Umsetzung des - sei es gefälscht oder nicht gefälscht - Politischen Testamentes Peters des Großen ist.
Was haben sie alles da drüben mit der deutschen Weltanschauung zu machen gewußt! Ich habe in einem der Vorträge, die ich erst vor kurzer Zeit gehalten habe, dargestellt, wie Goethes «Faust» so recht hervorwächst aus dem, was wir auch heute wieder als deutsche Weltanschauung auf unsere Seele wirken lassen konnten. Wir brauchen aber nur zu hören Worte von Pissarew - der als russischer Geist tief beeinflußt ist von Goethe - über Goethes «Faust», und wir werden sehen, wie nicht verstanden werden kann, was gerade mit dem Allercharakteristischsten, mit dem Allerwesenhaftesten der deutschen Volksseele zusammenhängt. Pissarew sagt zum Beispiel: «Die kleinen Gedanken und
die kleinen Gefühle mußten zu Perlen der Schöpfung gemacht werden» - im meint er nämlich die kleinen Gedanken, die menschlichen Gefühle, die nur so den Menschen angehen! - «Goethe hat dieses Kunststück zustande gebracht, und ähnliche Kunststücke werden bis jetzt für den allergrößten Sieg der Kunst gehalten; aber man macht solchen Hokuspokus nicht nur in der Sphäre der Kunst, sondern auch in allen übrigen Sphären menschlicher Tätigkeit.»
Es stellt ein interessantes Kapitel dar, wie in einer nur äußerlichen Weise bei Geistern wie zum Beispiel Iwan Wassilijewitsch Kirejewski oder bei Chomjakow gerade das, was groß und bedeutsam als Innerlichkeit lebt, aber als klare Innerlichkeit, wie das verdunkelte und nebulose Gefühlsduselei erzeugend in solchen Geistern weiter gelebt hat -und wir könnten eine stattliche Reihe bis in die heutigen Tage herein gerade von russischen Weltanschauungsgeistern anführen -, wie in diesem russischen Weltanschauungs-geiste allgemein sich die Überzeugung gebildet hat: Das, was da westlich von uns lebt, ist greisenhafte Kultur, ab-gelebte Kultur; das ist reif zum Aussterben. Das russische Wesen ist da, das muß ersetzen, was da in Mitteleuropa -und sie meinten damals auch Westeuropa im neunzehnten Jahrhundert, dazu namentlich England -, was da in England lebt.
Das ist nicht etwa von mir an dem einen oder anderen Punkt herausgesucht, sondern das ist ein durchgehender Zug im russischen Geistesleben, der charakterisiert diejenigen, auf die es ankommt, die tonangebend sind. Bei Kirejewski steigert sich das etwa 1829 zu einem Ausspruch, den ich gleich verlesen werde, und man wird sehen aus einem solchen Ausspruch, daß dasjenige, was einem heute vom Osten entgegentönt, nicht eben erst heute entstanden ist,
sondern daß das tief wurzelt in dem, was da allmählich in diesem Osten sich angesammelt hat.
Vorher will ich aber noch etwas anderes anführen. Vom Slawophilismus geht die ganze Sache aus, von einem scheinbar wissenschaftlich-theoretischen Aufgeschraubtwerden von der Bedeutung des russischen Volkes, das ablösen muß das alte, greisenhafte, in lauter abstrakten Begriffen, in lauter kalten Nützlichkeitsvorstellungen verkommende Europa. Ja, man findet das, wie gesagt, immer wieder im russischen Geistesleben. Aber woher kommt denn eigentlich diese Slawophilie, woher stammt sie denn eigentlich? Wodurch sind denn diese Menschen im Osten darauf aufmerksam geworden auf das, was sie spater in allen Variationen wiederholt haben: Die Leute in Mitteleuropa und Westeuropa sind verkommen, sind greisenhaft; sie haben es dahin gebracht, alle Liebe, alles Gefühlsmäßige aus dem Herzen auszuschalten und nur im Verstande zu leben, was zum Krieg und zum Haß der einzelnen Völker führt. Im russischen Reich lebt die Liebe, lebt der Friede, lebt auch eine Wissenschaft, die aus Liebe, aus Friede hervorgeht. Woher haben denn diese Menschen das? Aus deutscher Weltanschauung haben sie es! Herder ist der erste Slawophile im Grunde genommen. Herder hat zuerst dies ausgesprochen, was berechtigt war zu seiner Zeit, was auch berechtigt ist, wenn man auf die Tiefe des Volkswesens schaut, das wahrhaft nichts mit dem heutigen Kriege und mit alledem zu tun hat, was zu diesem Kriege geführt hat. Man kann aber auf dieses hinweisen, was bei den sogenannten Intellektuellen geführt hat zu dem Größenwahn: Wir stehen da im Osten, da drüben ist alles, alles greisenhaft, das muß alles ausgerottet werden, und an die Stelle dessen muß treten die Weltanschauung des Ostens.
Führen wir uns nur solche Worte ganz tief zu Gemüte,
wie wir sie bei Kirejewski finden. Er sagt 1829: «Das Schicksal jedes europäischen Staates hängt von der Vereinigung aller übrigen ab; - das Schicksal Rußlands hängt von Rußland allein ab. Aber das Schicksal Rußlands ist in seiner Bildung beschlossen: diese ist die Bedingung und Quelle aller Güter. Sobald alle diese Güter unser sein werden, -werden wir uns dieselben mit dem übrigen Europa teilen, und unsere ganze Schuld werden wir ihm hundertfach heimzahlen.»
Hier haben Sie von einem tonangebenden Menschen, auf den immer wieder gerade die Geister, welche die fortlaufende Strömung des russischen Geisteslebens mehr ablehnten, gefußt haben. Hier haben Sie es ausgesprochen:
Europa ist zum Untergang reif, die russische Kultur muß es ersetzen. Die russische Kultur hat alles dasjenige in sich, was zukunftssicher ist. Also eignen wir uns alles an. Und wenn wir alles haben, nun, dann werden wir gütig sein, dann werden wir uns mit den anderen entsprechend teilen. Das ist das literarische Programm, schon 1829 aufgestellt innerhalb der russischen Menschheit von einem Geiste, in dessen Unreife, in dessen Gefühlsduselei hinein selbst Fichte, Schelling und Hegel gewirkt haben.
Es ist überhaupt eine merkwürdige Auffassung da im Osten. Lassen Sie mich das zum Schluß noch ausführen. Da ist zum Beispiel 1885 ein merkwürdiges Buch erschienen von Sergius Jushakow, ein merkwürdiges Buch, wie gesagt. Dieser Jushakow findet, daß Rußland eine große Aufgabe hat. 1885 findet er diese Aufgabe noch mehr gegen Asien hinüber gerichtet. Da drüben in Asien, so meint er, leben die Nachkommen der alten Iranier - zu denen er auch die Inder rechnet, die Perser rechnet - und der alten Turanier. Die haben ein langes Kulturleben hinter sich, haben es zu dem gebracht, was sich heute in ihnen darbietet.
In dieses lange Kulturleben haben die westlichen Menschen - so sagt Jushakow 1885 - eingegriffen, haben eingegriffen mit dem, was sie werden konnten aus ihren Grundempfindungen, aus ihrer Weltanschauung heraus. Aber Rußland muß in der richtigen Weise eingreifen.
Ein merkwürdiger Panasiatismus, 1885 von Jushakow ganz programmäßig in einem dicken Buche ausgesprochen! Er sagt: In einem schönen Mythos - der aber wahr ist -haben diese asiatischen Völker ihr Schicksal dargestellt. Da gibt es die iranischen Völker drüben, welche gekämpft haben gegen Ahriman, so sagt Jushakow, gegen den bösen Geist Ahriman, der Unfruchtbarkeit und Dürre und Un-moralität wachruft gegen die Menschen, alles dasjenige, was die menschliche Kultur stört. Verbunden haben sie sich mit dem guten Geist Ormuzd, dem Gott des Lichtes, dem Geist, der alles die Menschen Fördernde gibt. Aber nachdem es die Asiaten eine Weile dazu gebracht haben, daß sie die Segnungen des Ormuzd innerhalb ihres Geisteslebens empfangen haben, da wurde Ahriman mächtiger. Was aber haben die europäischen Völker des Westens, so meint Jushakow, den Asiaten gebracht? Und das ist recht interessant. Jushakow stellt das so dar, daß diese westlichen Völker mit ihrem Kulturleben, das nach seiner Anschauung aber versumpft und greisenhaft ist, nach Asien zu den Indern, zu den Persern hinübergegangen sind, daß sie ihnen all dasjenige abgenommen haben, was sie der Ormuzd, der gute Ormuzd hat erkämpfen lassen. Dazu waren die westlichen Völker da. Rußland wird nun hinübergehen nach Asien - nicht ich sage dies, sondern der Russe Jushakow sagt es -, denn in Rußland wurzelt in einer tiefen Kultur das Bündnis zwischen dem alle Fruchtbarkeit entwickelnden Bauern und dem alle Ritterlichkeit in sich tragenden Kosaken - wie gesagt, nicht ich sage es,
Jushakow sagt es -, und aus dem Bündnis des Bauern und des Kosaken, das hinübergehen wird nach Asien, wird etwas anderes entstehen, als was die westlichen Völker den Asiaten haben bringen können. Die westlichen Völker haben den Asiaten die Ormuzd-Kultur abgenommen; die Russen aber, das heißt die Bauern und die Kosaken, werden sich verbinden mit dem armen, durch die Westler geknechteten Asien und werden mit ihm kämpfen gegen Ahriman und sich ganz mit ihm verbinden. Denn dasjenige, was als ein Zusammengehen mit der Natur selber sich die Asiaten unter Ormuzd' Führung erworben haben, das nehmen ihnen die Russen nicht weg, sondern die verbinden sich mit ihnen, um neuerdings mit ihnen gegen Ahriman zu kämpfen.
Und genauer schildert dieser Mann, 1885, wie sich eigentlich diese westlichen Völker verhalten haben gegen die asiatischen, von Ahriman geplagten Menschen. Da schildert er - er hätte dazumal noch wenig Veranlassung gehabt dazu - nicht die Deutschen, aber er, Jushakow, der Russe schildert die Engländer. Und er sagt von den Engländern, diese glaubten nach alledem, was sie darleben: die asiatischen Völker seien nur da, damit sie sich in englische Gewebe kleiden, untereinander mit englischen Waffen kämpfen, mit englischen Werkzeugen arbeiten, aus englischen Gefäßen essen und mit englischem Flitter spielen. Und weiter sagt Jushakow, 1885: «England beutet Millionen von Hindus aus, seine ganze Existenz aber hängt von dem Gehorsam der verschiedenen Völker ab, von denen die reiche Halbinsel bewohnt wird; ich wünsche meinem Vaterlande nichts Ähnliches - ich kann mich nur freuen, daß es von diesem so glänzenden wie traurigen Zustand hinreichend entfernt ist.»
Aus diesen, 1885, nicht nur bei Jushakow, sondern bei
vielen auftretenden Empfindungen heraus wird es ja wohl wahrscheinlich gekommen sein, daß sich Rußland zunächst nicht verbunden hat mit den Asiaten, um ihnen gegen Ahriman, den bösen Ahriman zu helfen, sondern daß es sich zunächst mit jenem «so glänzenden wie traurigen Zustande» Englands verbunden hat, um das «greisenhafte», «versumpfte» Europa in Grund und Boden zu treten.
Das, was einstmals die Weltgeschichte sehen wird in diesem Ring, der sich um Mitteleuropa herum schließt, das kann im Grunde genommen recht einfach ausgesprochen werden. Man braucht nur ein paar Zahlen zu nennen. Diese paar Zahlen wirken außerordentlich lehrreich, denn sie sind Wirklichkeit. Einmal wird doch die Geschichte die Frage aufwerfen, ganz abgesehen davon, daß dieser gegenwärtige Kampf der allerschwierigste, der allerbedeutungsvollste, der allergrößte ist, der in der Entwickelung der Menschengeschichte vorgekommen ist, ganz abgesehen davon, bloß auf die Verhältnisse der Zahlen gesehen: Wie wird man beurteilen einmal, daß 777 Millionen Menschen einen Ring schließen um 150 Millionen Menschen? 777 Millionen Menschen stehen in der sogenannten Entente im Ring geschlossen um 150 Millionen Menschen herum und erwarten nicht einmal von der kriegerischen Tapferkeit die Entscheidung, sondern von der Aushungerung. Das ist der bessere Teil der Tapferkeit wahrscheinlich nach den Anschauungen der 777 Millionen Menschen! Neidisch um den Boden, auf dem sich ein Geistesleben entwickelte, wie wir es dargestellt haben, braucht man auch gerade nicht zu sein, denn da sprechen auch wieder die Zahlen. Die 777 Millionen Menschen leben auf 68 Millionen Quadratkilometern, gegenüber 6 Millionen Quadratkilometern, auf denen die 150 Millionen Menschen leben. Das wird die Geschichte einmal ins Auge fassen, daß 777 Millionen Menschen
auf 68 Millionen Quadratkilometern stehen, ringförmig geschlossen gegen 150 Millionen Menschen auf 6 Millionen Quadratkilometern. Der Deutsche braucht nur auf diesem so wie auch auf anderen Gebieten diese Tatsächlichkeit sprechen zu lassen, welche einen daran verhindert, in einseitig nationales Zetern und Wettern und in haßerfülltes Reden zu kommen, in das Deutschlands Feinde kommen.
Ich will jetzt nicht reden über diejenigen Gebiete, die hier nicht hergehören, die durch die Waffen entschieden werden. Aber wir sehen ja hinlänglich, wie hinweggehoben über den Kampfplatz der Waffen heute wirklich eingeschlossen ist, was man als deutsche Kultur hegen und tragen will, eingeschlossen ist von Haß und Verleumdung, von wirklicher Verleumdung, nicht bloß von Haß; wie unsere traurige Prüfungszeit dazu verwendet wird, gerade das zu schmähen und zu verdammen, was sich in solcher Art in die Weltgeschichte, in die Gesamtentwickelung der Menschheit hineinzustellen hat. Denn was ist es eigentlich, was uns in diesem deutschen Geistesleben mit all seinen bewußten und vergessenen Tönen entgegentritt? Ein Großes ist es deshalb, weil es die zweite große Erkenntnisblüte ist und die zweite große Kunstblüte der Menschheit überhaupt. Die erste große Kunstblüte war das Griechentum. Die deutsche Entwickelung hat um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts eine Blüte hervorgebracht, von der selbst ein Geist wie Renan gesagt hat, als er, nachdem er alles Übrige in sich aufgenommen hatte, die deutsche Entwickelung in Goethe und Herder kennen lernte:
«Ich glaubte in einen Tempel zu treten, und von dem Augenblick an machte mir alles, was ich bis dahin für eine der Gottheit würdige Pracht gehalten hatte, nur noch den Eindruck welker und vergilbter Papierblumen.» Was das
deutsche Geistesleben geleistet hat, so sagt Renan, indem er es mit dem anderen vergleicht, ist wie die DifferentialRechnung gegenüber der Elementar-Mathematik. Dennoch weist Renan - auf derselben Seite, auf der er diese Worte an David Friedrich Strauß geschrieben hat, auf jene Strömung in Frankreich hin, die für den Fall eines Verlustes von Elsaß-Lothringen den «Vertilgungskampf gegen die germanische Rasse» forderte. 1870 ist dieser Brief geschrieben.
Anerkannt ist ja dieses deutsche Geistesleben immer wieder und wiederum worden. Aber heute muß es verkannt werden. Denn wie könnten sonst eigentlich die Worte gefunden werden, die in dem Ring, der uns umschließt, gesprochen werden!
Schauen wir hinüber, jetzt nicht mit den Augen Jushakows, sondern mit unbefangenem Auge nach jenem Asien. Da sehen wir alt geworden eine Menschenkultur, die auch nach Erkenntnis strebte, die aber nach einer alten, nach der vorchristlichen Weise nach Erkenntnis strebte. Da sucht man das Ich abzudämpfen, um aufzugehen in dem Welten-all, in Brahman oder Atman, mit Auslöschung des Ich. Das ist nicht mehr möglich. Nachdem sich der größte Impuls in die Menschheitsgeschichte eingelebt hat, der ChristusImpuls, muß das Ich selber sich erhöhen, sich erkraften, sich verstärken, nicht sich herabdämpfen wie im morgen-ländischen Geistesleben, sondern im Gegenteil sich erkraften, verstärken, um als Ich sich mit dem Geistig-Göttlichen in der Welt zu verbinden, das die Welt durchpulst und durchwebt und durchlebt. Das ist das Bedeutsame, wie das wieder aufleuchtet im deutschen Geistesstreben. Und dieses, was einzig ist und was als einer der wesentlichsten Töne eingegliedert werden muß der Gesamtentwickelung der Menschheit, das lebt eben auf den 6 Millionen Quadratkilometern gegenüber den 68 Millionen Quadratkilometern.
Diese Tatsache müssen sich diejenigen verschleiern, die, wie gesagt, nicht mit den Waffen kämpfen, aber die mit Worten kämpfen und mit Worten verleumden dieses mitteleuropäische Geistesleben, diese Tatsache müssen sie sich mit Nebel bedecken. Sie dürfen sie nicht sehen. Wir aber müssen uns das gestehen, müssen uns zu erklären versuchen, wie es möglich ist, daß diese Leute so verblendet sein können, gerade das, was die Tiefe dieser Verbindung der eigenen Seele mit dem Geistesleben draußen in der Welt ist, zu verkennen.
Boutroux, der ganz kurze Zeit vor dem Kriege hier in Deutschland herumgezogen ist, sogar an Universitäten über die Geistesverbrüderung Deutschlands und Frankreichs gesprochen hat, erzählt jetzt seinen Franzosen vor, wie die Deutschen alles innerlich erfassen wollen. Er macht sogar einen Witz: Wenn ein Franzose einen Löwen oder eine Hyäne kennen lernen will, so geht er in die Menagerie. Wenn ein Engländer einen Löwen oder eine Hyäne kennen lernen will, macht er eine Weltreise und studiert alle Dinge, die sich auf den Löwen oder die Hyäne beziehen, an Ort und Stelle. Der Deutsche geht weder in die Menagerie noch auf Reisen, sondern zieht sich in sein Stübchen zurück, geht in sein Inneres, und aus dem Inneren erschafft er den Löwen oder die Hyäne. So faßt er die Innerlichkeit auf. Es ist ein Witz. Man muß sogar sagen, es ist vielleicht sogar ein guter Witz. Die Franzosen haben ja immer gute Witze gemacht. Schade nur, daß dieser Witz - von Heinrich Heine ist, und Boutroux ihn nur nachgesprochen hat.
Aber nun, wenn man so übersieht, wie diese Leute sich benebeln wollen, kommt man eben doch auf Verschiedenes. Man kommt darauf, sich zu fragen: Wie suchen denn diese Menschen je nach ihrem Volkstume sich hinwegzutäuschen über dasjenige, was eigentlich deutsches Wesen ist? Bei den
Russen muß es immer eine neue Mission sein. Ich habe das auch dargestellt in meinem Schriftchen: «Gedanken während der Zeit des Krieges». Es muß ihnen die Möglichkeit gegeben werden, die westeuropäische Kultur, die mittel-europäische Kultur zu ersetzen, weil es dem russischen Menschen - so sagt man ja wohl im Osten - auferlegt ist, die abstrakte, die bloß verstandesmäßige, die auf den Krieg gebaute Kultur zu ersetzen durch die auf das Herz, auf den Frieden, auf das Gemüt gebaute russische Kultur. Das ist die Mission.
Den Engländern - man möchte ihnen nicht unrecht tun, wahrhaftig, man möchte ganz objektiv bleiben, denn es ziemt den Deutschen wirklich nicht, in einseitiger Weise bloß aus nationalen Gefühlen heraus zu sprechen. Das soll auch gar nicht geschehen; aber wenn man, wie in den allerletzten Zeiten in England deklamieren hört, daß die Deutschen nach dem Worte leben: «Macht geht vor Recht», dann muß man doch erinnern daran, daß es eine Philosophie gibt von Thomas Hobbes, eine englische Philosophie, in der zuerst in aller Breite bewiesen ist, daß Recht keinen Sinn hat, wenn es nicht aus der Macht herausquillt. Die Macht ist der Ursprung des Rechts. Das ist der ganze Sinn der Hobbes'schen Lehre. Nachdem von berufener Stelle gesagt wurde - es gibt auch eine unberufene berufene Stelle, aber es ist eben doch eine berufene Stelle in der Außenwelt -, daß die Deutschen nach dem Satze leben «Macht geht vor Recht», daß sie es weit gebracht haben nach dem Grundsatze «Macht geht vor Recht», glaube ich nicht, daß man unobjektiv ist, wenn man dem entgegenhält, daß das gerade ein englischer Grundsatz ist, der sich dem Engländer tief eingeprägt hat. Ja, da kann man wohl sagen: Sie brauchen eine neue Lüge. Und das wird kaum etwas anderes sein, als ein terminus technicus.
Die Franzosen - womit benebeln sich sie? Ihnen möchte man am allerwenigsten unrecht tun. Und so sei das Wort eines ihrer eigenen Dichter genommen, Edmond Rostands. Der Hahn, der krähende Hahn, er spielt eine große Rolle in der Darstellung von Edmond Rostand. Er kräht, wenn des Morgens die Sonne aufgeht. Da bildet er sich allmählich die Vorstellung, daß die Sonne nicht aufgehen könnte, wenn er nicht in seinem Krähen die Ursache wäre, daß die Sonne aufgeht. Man hat sich gewöhnt - und das ist ja wohl auch der Gedanke des Rostand -, daß in der Welt nichts geschehen kann ohne Frankreich. Man braucht sich nur zu erinnern an das Zeitalter Ludwigs XIV. und an all dasjenige, was Franzosentum war, bis sich Lessing, Goethe, Schiller und andere davon emanzipiert haben, und man kann sich schon vorstellen, wie da die Einbildung entsteht:
Ach, die Sonne kann nicht aufgehen, wenn ich nicht dazu krähe. Nun also, man braucht eine neue Einbildung.
Italien - ich hörte von einem nicht unbedeutenden Politiker Italiens vor dem Kriege den Ausspruch: Ja, unser Volk ist im Grunde genommen auf einem Standpunkt angelangt, so lässig, so verfault, daß wir eine Auffrischung brauchen, daß wir etwas brauchen, was uns belebt. Eine neue Sensation also! Sie drückt sich ja auch darinnen aus, daß gerade die Italiener, um sich zu benebeln, etwas ganz besonders Neues erfunden haben, was man bisher noch nicht gekannt hat, einen neuen Heiligen, nämlich, Sacro Egoismo, den heiligen Egoismus. Wie oft ist er angerufen worden, bevor Italien an den Krieg herangetrieben worden ist, der heilige Egoismus! Also ein neuer Heiliger, - sein
Hierophant: Gabriele d'Annunzio. Man kann es heute noch nicht ermessen, wie in der Geschichte fortleben wird der neue Heilige, der Sacro Egoismo und sein Hierophant, sein Hoherpriester, Gabriele d'Annunzio!
Da kann man innerhalb des deutschen Wesens bleiben bei demjenigen, was wirklich diesem deutschen Wesen einverwoben ist und was diesseits und jenseits der Erzberge bei den Deutschen Usterreichs und bei den Deutschen Deutschlands einmütig empfunden wurde als des deutschen Volkes
- jetzt nicht im russischen Sinne Mission, sondern im ganz gewöhnlichen Sinne - welthistorische Sendung. Und da darf ich wohl abschließen mit den Worten, auf die ich schon aufmerksam gemacht habe, als ich, sprechend über die Zusammengehörigkeit der österreichischen Geisteskultur mit der deutschen, auch über Robert Hamerling sprach. Vor Robert Hamerling, dem deutschen Dichter Öster-reichs, steht, 1862, als er seinen «Germanenzug» schreibt, die Zukunft des deutschen Volkes, die er dadurch ausdrücken will, daß er sie schon den Genius des deutschen Volkes aussprechen läßt, als die Germanen als Vorboten der Deutschen von Asien herüberziehen. Sie lagern sich an der Grenze von Asien nach Europa. Wunderschön ist die Szene von Robert Hamerling geschildert: Unter-gehende Sonne, aufgehender Mond. Die Germanen lagern. Nur ein Einziger wacht, der blonde Jüngling Teut. Ein Genius erscheint ihm. Dieser Genius spricht zu Teut, in dem Robert Hamerling festhalten will den Repräsentanten der späteren Deutschen. Schön spricht er aus:
Wem bricht dereinst das Wort aus Seelentiefen
Wie deinem Volk, so reich, so zart, so mächtig?
Wer haucht so weihevoll in Saitenklänge
Sein Innerstes? Wem zieh'n den Sinn so prächtig
Ins Himmelsblau granit'ne Hieroglyphen
Des Seelenaufschwungs und des Lebens Enge?
Wer knüpft zuletzt die Stränge
Des forschenden Gedankens an die Sterne
So kühn und strebt und kämpft auf allen Bahnen?
Wen führt so hoch, so tief sein Drang, sein Ahnen?
Wer faßt so treu das Nahe wie das Ferne?
Wo spiegelt jede Erd- und Himmelszone
Sich wie in deinem Denken, o Teutone?
Und was einstmals drüben in Asien lebte, was wie VäterErbgut die Deutschen mitbrachten aus diesem Asien, es steht vor Robert Hamerlings Seele. Fest steht es vor seiner Seele, was da war wie ein Hineinschauen in die Welt so, daß herabgedämpft wird das Ich, herabgedämpft wird die Leiblichkeit, um zu schauen, was die Welt durchlebt und durchwebt, was aber in einer neuen Form auftauchen muß in der nachchristlichen Zeit, in der Form, daß es aus dem vollbewußten Ich, aus der vollbewußten Seele heraus-spricht. Diesen Zusammenhang mit der alten Zeit in dem Streben des deutschen Volkes nach dem Geiste, - wie schön drückt auch das Robert Hamerling aus:
Doch wie auch stolz du aufstrebst, and're Schwärme
Hoch überschwebend, stets noch eine Lohe
Wirst du bewahren, uralt heil'gen Brandes:
Fortleben wird in dir die traumesfrohe
Gotttrunkenheit, die sel'ge Herzenswärme
Des alten asiat'schen Heimatlandes.
Geruhigen Bestandes
Wird dieser heil'ge Strahl, ein Tempelfeuer
Der Menschheit, frei von Rauch, mit reiner Flamme
Fortglüh'n in deiner Brust und Seelenamme
Dir bleiben und Pilote deinem Steuer!
Du strebst nur, weil du liebst: dein kühnstes Denken
Wird Andacht sein, die sich in Gott will senken.
So knüpft der deutsch-österreichische Dichter graue Vorzeit an unmittelbare Gegenwart an. Und in der Tat, es ist ja hervorgegangen aus diesem schönen Streben des deutschen Wesens, das wir heute zu charakterisieren versuchten, daß alles Erkennen, alles Bestreben sein wollte dasjenige, was man nennen kann: ein Opferdienst vor dem Göttlich-Geistigen. Auch Wissenschaft, auch Erkennen des Geistigen soll wie ein Opferdienst wirken, soll so wirken, daß Jakob Böhme sagen konnte: Wenn man geistig sucht, das ist so, daß man es dahin bringen muß, seinen Weg zu gehen:
Wandelnd in Gott - Und strebend in Gott -
Und sterbend in Gott - Und begraben werdend in Gott.
Hamerling drückt das so aus, daß er sagen läßt den deutschen Genius zu Teut:
Du strebst nur, weil du liebst: dein kühnstes Denken
Wird Andacht sein, die sich in Gott will senken.
Die Gottverwandtschaft desjenigen, was die deutsche Seele erstreben will, wird da so schön zum Ausdruck gebracht. Das zeigt uns, wie tief verankert wahres geistiges Streben im deutschen Volkstume ist. Das erzeugt aber in unserer Seele offenbar auch den Gedanken, den kraftvollen Gedanken, daß man sich verbünden kann mit diesem deutschen Volksgeiste, denn in demjenigen, was er hervorgetrieben hat in den geistigen Leistungen - es leitet eine Strömung die andere - wirkt dieser deutsche Volksgeist. Es kommt in den großen, unsterblichen Taten, die in der Gegenwart verrichtet werden, zum Ausdruck. Lassen Sie mich zum Schluß in die vier Zeilen des Deutsch-Österreichers Robert Hamerling zusammenfassen, was sich als deutscher Glaube, als deutsche Liebe, als deutsche Hoffnung der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft ergibt, wenn der Deutsche sich verbindet mit dem, was seines Volkes tiefste Wesenheit ist. Lassen Sie mich das, was da als Kraft - als Kraft, die Zuversicht hat dahingehend, daß, wo solche Keime sind, auch später noch, in spätesten Zeiten kraftvoll sich Blüten und Früchte, trotz aller Feinde, im deutschen Volkstum entwickeln müssen -, lassen Sie uns das, was da als Kraft in seiner Seele steht, zusammenfassen in die Worte des deutsch-österreichischen Dichters Robert Hamerling:
Und wenn je dem deutschen Namen
Feindlich sich der Tag erweist,
Finden wird von Meer zu Meere
Seine Bahn der deutsche Geist!
WARUM MISSVERSTEHT MAN DIE GEISTESFORSCHUNG? Berlin, 26. Februar 1916
Einiges von dem, was Antwort geben kann auf die Frage: Warum mißversteht man die Geistesforsdiung? - habe idi mir sehon erlaubt vorzubringen in dem Vortrage, den ich vor einigen Wochen hier gehalten habe über «Gesundes Seelenleben und Geistesforschung». Heute möchte ich noch auf andere Gesichtspunkte eingehen, welche in einer umfassenderen Weise Antwort auf die gestellte Frage geben können. Selbstverständlich kann es nach der ganzen Haltung, wie die verehrten Zuhörer gewohnt sind, sie in diesen Vorträgen zu finden, auch heute nicht meine Absicht sein, auf einzelne da oder dort auftretende Angriffe gegenüber dem, was hier Geistesforschung genannt wird, einzugehen. Wenn aus gekränktem Ehrgeiz, aus sonstigen Motiven heraus, da oder dort sich Gegnerschaft vielleicht sogar aus den Kreisen derer erhebt, welche vorher glaubten, ganz gute Bekenner dieser Geisteswissenschaft zu sein, so sind das Angelegenheiten, bei denen sich gerade zeigt, wenn man genauer auf sie eingeht, wie wenig bedeutsam gegenüber den großen Aufgaben, welche die Geistesforschung zu erfüllen hat, solche Einwände eigentlich sind. Daher kann sich nur hie und da die Notwendigkeit aus äußeren Gründen ergeben, auf das eine oder andere einzugehen. Wie gesagt, es ist nicht meine Absicht. Meine Absicht ist diese, zu zeigen, wie man wirklich Schwierigkeiten haben kann in bezug auf das Verständnis der hier gemeinten Geisteswissenschaft,
wie es aus der Zeitbildung, aus dem, was man sich aneignen kann an Denkgewohnheiten, an Empfindungen, an Weltanschauungsgefühlen aus unserer Gegenwart heraus, wie es aus alle dem für die Seele schwierig werden kann, Verständnis der Geisteswissenschaft entgegenzubringen. Gewissermaßen nicht die unberechtigten Einwände möchte ich in ihren Gründen erklären, sondern die aus der Zeitbildung heraus bis zu einem gewissen Grade, man möchte sagen, durchaus berechtigten Einwände, diejenigen Einwände, die begreiflich sind für eine Seele der Gegenwart.
Geisteswissenschaft hat es ja nicht nur zu tun mit Einwänden, die sich ergeben gegenüber anderen Geistesströmungen der Gegenwart; Geisteswissenschaft hat, so kann man wohl sagen, heute noch fast alle anderen Geistesströmungen in einer gewissen Weise, gerade von dem Gesichtspunkte aus, der eben erwähnt worden ist, gegen sich. Wenn materialistische oder mechanistische Weltanschauungen oder, wie man sich heute gebildeter ausdrücken will, monistische Weltanschauungen auftreten, so erheben sich Gegner, die von einem gewissen geistigen Idealismus ausgehen. Die Gründe, welche solche geistigen Idealisten für ihre Weltanschauung gegen den Materialismus vorzubringen haben, sind in der Regel außerordentlich schwerwiegend und bedeutsam. Es sind Einwendungen, deren Bedeutung von dem Geistesforscher durchaus geteilt werden kann, die er durchaus auch verstehen und in derselben Weise auffassen kann, wie der bloß von einem gewissen geistigen Idealismus Ausgehende. Allein der Geistesforscher spricht ja über die geistige Welt nicht bloß so, wie etwa, sagen wir, geistige Idealisten vom Schlage der Ulrici, Wirth, Immanuel Hermann Fichte - der aber allerdings, wie wir gestern gesehen haben, schon tiefer eingeht - und
andere. Er spricht nicht bloß in abstrakten Begriffen mit Hindeutungen darauf, daß es hinter der sinnlichen Welt noch eine geistige Welt geben müsse; er kann diese geistige Welt nicht unbestimmt lassen, nicht in bloßen Begriffen erfassen, er muß übergehen zu einer wirklichen Beschreibung der geistigen Welt. Er kann sich nicht nur bloß auf eine begriffliche Hindeutung, auf eine unbekannt bleibende geistige Welt, die aber da sein müsse im Sinne der geistigen Idealisten, einlassen, sondern er muß eine konkrete, eine in einzelnen Wesenheiten, die nicht physisches, sondern bloß geistiges Dasein haben, in Beschreibungen sich ergebende geistige Welt geben; kurz, er muß eine geistige Welt geben, welche so mannigfaltig, so inhaltsvoll ist, wie nur die physische Welt ist, ja eigentlich viel, viel inhaltsvoller sein müßte, wenn sie in Wirklichkeit beschrieben würde. Und wenn er also nicht nur davon spricht, daß es eine geistige Welt im allgemeinen gäbe, die man durch Begriffe beweisen könne, sondern wenn er bestimmt von einer geistigen Welt als etwas Glaubbarem, als etwas ebenso Wahrnehmbarem spricht, wie die Sinneswelt wahrnehmbar ist, dann hat er zu Gegnern nicht bloß die Materialisten, sondern dann hat er zu Gegnern auch diejenigen, welche nur in abstrakten Begriffen vom Standpunkte eines gewissen geistig-begrifflichen Idealismus aus über die geistige Welt sprechen wollen. Endlich hat er zu Gegnern diejenigen, die da glauben, daß durch die Geisteswissenschaft irgendeine Art des religiösen Empfindens getroffen werden könne, die da glauben, die Religion sei gefährdet, ihre Religion gerade sei gefährdet, wenn eine Wissenschaft der geistigen Welt auftritt. Und es könnten ja noch viele einzelne Strömungen genannt werden, die der Geisteswissenschafter im Grunde genommen alle in der angedeuteten Weise gegen sich haben muß, heute noch begreiflicherweise gegen sich
haben muß. Also gewichtige, bis zu einem gewissen Grade, von einem gewissen Gesichtspunkte aus berechtigte Einwände, sie möchte ich namentlich besprechen.
Und da ist immer wieder und wiederum der erste, gerade in unserer Zeit bedeutsame Einwand gegen die Bestrebungen der Geisteswissenschaft der, der von seiten der naturwissenschaftlichen Weltanschauung herkommt, derjenigen Weltanschauung, welche ein Weltenbild gestalten will auf Grundlage der in berechtigter Weise als größten Triumph der Menschheit angesehenen Fortschritte der neueren Naturwissenschaft. Und immer wieder und wiederum muß es gesagt werden, daß es schwierig ist einzusehen, daß der wirkliche Geistesforscher ja im Grunde genommen durchaus nichts, aber auch gar nichts in Abrede stellt von dem, was in berechtigter Weise für ein Weltenbild aus den Ergebnissen der neueren Naturwissenschaft folgt; daß er im Gegenteil im vollsten Sinne des Wortes auf dem Boden dieser neueren Naturwissenschaft selber steht, insoweit sie eine berechtigte Grundlage zu einer Weltanschauung ist.
Schauen wir uns von einem gewissen Gesichtspunkte auch heute wiederum diese neuere naturwissenschaftliche Richtung an. Es können ja immer nur einzelne Gesichtspunkte herausgehoben werden. Da stehen wir vor allen denjenigen Menschen, die in berechtigter Weise Schwierigkeiten machen gegenüber der Geisteswissenschaft, weil sie sagen: Zeigt uns denn nicht diese moderne Naturwissenschaft durch den Wunderbau des menschlichen Nervensysteln, des menschlichen Gehirns insbesondere, wie dasjenige, was der Mensch seelisch erlebt, abhängig ist von dem Bau und den Verrichtungen dieses Nervensystems und dieses Gehirns? Und leicht kann man eben glauben, der Geistesforscher wollte leugnen, was da der naturwissenschaftliche Forscher von seinem Gebiete aus eigentlich sagen muß. Nur der dilettantische Geistesforscher
und diejenigen, die Geistesforscher sein wollen, aber im Grunde genonunen kaum auf die Würde eines Dilettanten Anspruch machen können, die richten ja da viel Unheil an, weil man die wahre Geistesforschung immer wiederum mit deren scharlatanhaften oder dilettantischen Treiben verwechselt. Schwierig ist es zu glauben, daß zum Beispiel gerade auch mit Bezug auf die Bedeutung des physischen Gehirn- und Nervensystembaues der Geisteswissenschafter eigentlich noch mehr auf naturwissenschaftlichem Boden steht, als der Naturforscher selbst.
Nehmen wir ein Beispiel. Ich wähle absichtlich nicht ein neueres Beispiel, obwohl bei dem schnellen Gang der modernen Naturwissenschaft mancherlei sich rasch ändert und ältere Forschungen leicht überholt werden durch spätere. Ich wähle absichtlich nicht ein neueres Beispiel, was man auch tun könnte; sondern ich wähle den ausgezeichneten Gehirnforscher und Psychiater Meynert, indem ich dasjenige, was er aus seiner Gehirnforschung heraus zu sagen hatte über die Beziehungen von Gehirn und Seelenleben, einmal zum Ausgangspunkt machen möchte. Meynert ist ein guter Kenner des menschlichen Gehirns, des menschlichen Nervensystems im gesunden und kranken Zustand. Seine Schriften, die gerade auf seinem Gebiete tonangebend waren am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, müssen jedem, der mit ihnen bekannt wird, im höchsten Grade Achtung einflößen. Nicht nur vor der rein positiven Forschung, sondern auch vor dem, was solch ein Mann zu sagen hat über die angedeutete Frage. Und das muß ja besonders betont werden: Wenn Leute, welche auf leichte Weise hineingekommen sind in irgendeine geisteswissenschaftlich sein sollende Weltanschauung, dann, ohne irgend etwas zu wissen, ohne jemals einen Blick durch ein Mikroskop oder durch ein Fernrohr getan zu haben oder etwas
getan zu haben, was ihnen nur im entferntesten eine Möglichkeit geben würde, sich eine Vorstellung zu machen über diesen Wunderbau des menschlichen Gehirns zum Beispiel, wenn solche Leute über die Niedrigkeit des Materialismus sprechen, dann kann man es verstehen, wenn auf der anderen Seite bei der Gewissenhaftigkeit der Forschung, bei der Sorgfältigkeit der Methoden man sich gar nicht einlassen will auf dasjenige, was da von scheinbar geisteswissenschaftlicher Seite entgegnet wird. Wenn jemand wie Meynert sich auf das Studium des Gehirns einläßt, so findet er zunächst, wie dieses Gehirn in komplizierter Weise
- Meynert meint, aus einer Milliarde etwa - in seiner äußeren Rinde aus einer Milliarde von Zellen besteht, die alle ineinanderarbeiten, die ihre Fortsetzungen aussenden nach den verschiedensten Gliedern des menschlichen Leibes, ihre Fortsetzungen aussenden in die Sinnesorgane hinein, wo sie zu Sinnes-Nerven werden, ihre Fortsetzungen aussenden bis zu den Bewegungsorganen und so weiter. Einem solchen Gehirnforscher zeigt sich dann, wie Verbindungsfasern führen von dem einen Fasersystem zu dein anderen, und er kommt dann zu der Anschauung, daß dasjenige, was der Mensch als Vorstellungswelt erlebt, was sich ihm in Begriffen, in Vorstellungen trennt und verbindet, wenn die Außenwelt durch seine Sinnesorgane einen Eindruck macht, vom Gehirn aufgenommen, verarbeitet wird, und daß es aus der Art und Weise der Verarbeitung das hervorbringt, was man Seelenerscheinungen nennt. Wenn dann selbst Philosophen kommen und sagen: Ja, aber die Seelenerscheinungen sind doch etwas ganz anderes als Bewegungen des Gehirns, als irgendwelche Vorgänge im Gehirn, - wenn selbst Philosophen kommen und so sprechen, dann ist dagegen zu sagen, daß dasjenige, was sich als Seelenleben für einen solchen Forscher aus dem Gehirn heraus ergibt, ja nicht
weiter in wunderbarer Weise sich ergibt, als, sagen wir zum Beispiel, eine Uhr, von der man auch nicht annehmen wird, daß ein besonderes Seelenwesen drinnen lebt, das Zeichen für die Zeit gibt; oder, sagen wir, ein Magnet, der aus seinen rein physischen Kräften heraus einen Körper anzieht. Was sich da als ein Magnetfeld um das Physische herum tätig erweist - warum sollte denn das nicht, in größeren Komplikationen aufgefaßt, aus dem Gehirn heraus-geboren, das menschliche Seelenleben sein? Kurz, man darf keineswegs dasjenige, was von dieser Seite kommt, gering anschlagen. Man darf ihm keineswegs unter allen Umständen, ohne daß man auf die Sache genauer eingeht, seine Berechtigung absprechen. Man kann spotten darüber, daß dieses Gehirn durch das Abrollen seiner Vorgänge dasjenige hervorbringen soll, was das komplizierteste Seelen-leben ist, doch findet man gleicherweise in der Natur von solchen Vorgängen übergenug, bei denen man sich von vornherein auch nicht darauf einlassen wird, einfach von einem zugrunde liegenden Seelenleben zu sprechen. Nicht dadurch, daß man von vorgefaßten Meinungen ausgeht, sondern dadurch, daß man sich auch einläßt auf dasjenige, was berechtigt ist bei den Menschen, die Schwierigkeiten haben, an die Geistesforschung heranzukommen, dadurch allein kann, ich möchte sagen, in den verwirrten Schädeln der Weltanschauungen Ordnung und Einklang geschaffen werden.
So spricht gar nichts dagegen, daß durch einen bloßen mechanischen Vorgang, insofern er sich in der Mechanik des Gehirns und des Nervensystems abspielt, dasjenige erzeugt werden könne, was man im gewöhnlichen Sinne des Lebens als Seelenleben auffaßt. In so komplizierter Weise kann das Nervensystem und das Gehirn eingerichtet sein, daß sich durch das Abrollen seiner Vorgänge das Seelenleben
des Menschen ergibt. Daher wird niemand durch diejenigen Betrachtungsweisen, die bloß auf dem Boden einer solchen Naturbetrachtung stehen, die Berechtigung eines naturwissenschaftlichen, materialistischen Weltenbildes in Abrede stellen können. Und man muß sagen, gerade aus dem Grunde, weil Naturwissenschaft es zu solcher Vollkommenheit und zu so berechtigtem Ideal gebracht hat auf ihrem Gebiete, ist es eigentlich für die Geisteswissenschaft heute schwierig, sich dieser Naturwissenschaft gegenüber-zustellen, aus dem einfachen Grunde, weil der Geistes-wissenschafter die Möglichkeit und Fähigkeit haben muß, gerade das Berechtigte, das von dieser Seite kommt, voll anzuerkennen. Deshalb aber muß auch immer wieder und wiederum betont werden, daß durch eine bloße Komposition dessen, was der äußeren Naturbetrachtung, auch wenn sie sich auf unser eigenes menschliches Leben erstreckt, entgegentreten kann, niemals, aber auch niemals eine geistige Weltanschauung geschaffen werden kann. Will man zum Seelenleben kommen, dann muß dieses Seelenleben in sich selber erlebt werden, dann muß dieses Seelenleben nicht erfließen aus äußeren Vorgängen, dann muß man nicht sagen, das Gehirn könne nicht aus sich die Seelenvorgänge hervorbringen, sondern man muß die Seelenvor-gänge erleben.
Auf einem gewissen Gebiete kann nun jeder das Seelische erleben, unabhängig erleben von den Gehirnvorgängen. Das ist auf sittlichem Gebiete, auf dem Gebiete des sittlichen Lebens. Und hier ist es von vornherein klar, daß dasjenige, was dem Menschen vorleuchtet als sittliche Impulse, sich nicht ergeben kann aus irgend einem Abrollen von bloßen Gehirnvorgängen. Aber ich sage ausdrücklich:
was sich dem Menschen ergeben kann als sittliche Antriebe, insofern der Wille, insofern das Gefühl darinnen wirkt,
insofern das Sittliche erlebt wird. Also auf diesem Gebiete, wo die Seele sich in ihrer Unmittelbarkeit erfassen muß, kann jeder darauf kommen, daß die Seele für sich ein Eigenleben, unabhängig von der Leiblichkeit, hat. Allerdings hat nicht jeder die Fähigkeit, zu diesem innerlichen Erfassen, zu diesem Sich-innerlich-Erkraften im sittlichen Leben, hinzuzufügen, was Goethe zum Beispiel in dem gestern erwähnten Aufsatz über «Anschauende Urteilskraft>, aber auch an vielen anderen Stellen seiner Werke hinzugefügt hat. Nicht jeder kann wie Goethe aus dem tiefsten inneren Erleben heraus sagen: Wenn man schon in der sittlichen Welt sich erhebt zu Antrieben, die unabhängig von der Leiblichkeit wirken, warum sollte diese Seele dann nicht fähig sein, mit Bezug auf anderes Geistiges, wie Goethe sagt im Gegensatz zu Kant, das «Abenteuer der Vernunft» - so hat Kant alles Hinausgehen über die sinnlichen Anschauungen genannt - «das Abenteuer der Vernunft mutig zu bestehen>? Das heißt, nicht nur dadurch zu einem geistig-seelischen Leben überzugehen, daß man innerlich erlebt, wie die sittlichen Impulse aus den Tiefen der Seele sich heraufheben, daß sie sich nicht aus dem Gehirn-leben heraus ergeben, sondern auch andere geistige Erlebnisse zu haben, die da bezeugen, daß die Seele geistig wahrnimmt geradeso mit geistigen Organen, wie wir Sinnliches wahrnehmen mit sinnlichen Organen. Dazu gehört aber, daß zu dem gewöhnlichen Leben in der Welt, dem man sich passiv hingibt, hinzutritt ein anderes, ein Leben der inneren Aktivität, ein Leben der inneren Tätigkeit. Und das ist es, was heute vielen abhanden kommt, die gewohnt worden sind, für alles, was sie als Wahrheit ansprechen sollen, sich von irgendwoher diese Wahrheit diktieren zu lassen. Auf irgend etwas, was nicht inneres Erleben ist, sondern was von außen erscheint, sich auf einen festen Boden
stützen, das wollen die Menschen. Was in der Seele selber erlebt wird, das erscheint ihnen als etwas innerlich Willkürliches, innerlich nicht fest von etwas Getragenes. Was wahr sein soll, das soll fest stehen an dem, was äußerlich fest steht, zu dessen Existenz man selber gar nichts beigetragen hat.
So ist es allerdings richtig, wenn man denkt auf dem Gebiete der Naturforschung. In die Naturforschung wird man nur allerlei unnützes Zeug hineintragen, wenn man zu dem, was die äußeren Sinne bieten, und dem, was man durch das Experiment oder durch die Methode aus dem beobachteten äußeren Sinnenstoff machen kann, allerlei Phantasieprodukte hinzubringt. Auf dem Boden der Naturwissenschaft ist das voll berechtigt. Aber wir werden gleich nachher sehen, wie wenig es berechtigt ist auf dem Boden der Geistesforschung. Aber schon wenn man sich einläßt auch auf das Berechtigte der naturwissenschaftlichen Weltanschauung, kann man an ihr sehen, wie sie schwach wird durch dieses Nichtgewohntsein des Sich-innerlich-Erkraftens, wie sie schwach wird, wenn sie eine Tätigkeit ausüben soll, die unerläßlich ist, wenn man in der Geisteswissenschaft nur ein wenig vorwärts kommen will. Um vorwärts zu kommen in der Geisteswissenschaft, ist es nicht nötig, daß man allerlei nebuloses Zeug treibt, daß man sich so dressiert, daß man zu gewissen im gewöhnlichen Sinne des Wortes hellseherischen Erfahrungen kommt, durch Halluzinationen, durch Visionen und so weiter, -das ist nicht das Erste, das ist auch nicht das Letzte; das wurde schon in dem Vortrage über «Gesundes Seelenleben und Geistesforschung» auseinandergesetzt. Was aber unerläßlich ist, wenn man zu einem tieferen Verständnis - ich will nicht sagen, zu einem berechtigten Anhänger - der Geisteswissenschaft kommen will, das ist ein durchgearbeitetes
Denken, ein wirklich durchgearbeitetes Denken. Und die Durcharbeitung des Denkens leidet in hohem Grade dadurch, daß man sich gewöhnt hat, nur immer die Erscheinungsform zu beobachten. Äußerlich in der sinnlichen Welt, in der äußeren Beobachtung oder im Experiment, da überläßt man sich dem, was die äußere Natur aussagt, und man vertritt auf diesem Gebiete, was das Experiment sagt. Man traut sich gar nicht - und wiederum hat man Recht auf diesem Gebiete -, irgend etwas zu sagen als zusammenfassendes Gesetz, was nicht von außen diktiert wird. Darunter aber leidet die innere Aktivität der Seelen-tätigkeit. Der Mensch gewöhnt sich, passiv zu werden; der Mensch gewöhnt sich, nur darauf zu vertrauen, was ihm gewissermaßen von außen gedeutet und geoffenbart wird. Und Wahrheit zu suchen durch eine innere Erkraftung, durch eine innere Betätigung, das fällt ganz aus seiner Seelengewohnheit heraus. Aber nötig ist es vor allen Dingen, wenn man in die Geisteswissenschaft eintritt, daß das Denken ausgearbeitet wird, daß das Denken so ausgearbeitet wird, daß einem nichts entgeht an gewissen leichtgeschürzten Einwänden, die gemacht werden können, daß man sich Einwände selber machen kann vor allen Dingen, daß man voraussieht, welche Einwände gemacht werden können; daß man sich diese Einwände selber macht, um einen höheren Gesichtspunkt zu gewinnen, der mit Berücksichtigung der Einwände die Wahrheit fände. Da möchte ich Sie aufmerksam machen als auf ein Beispiel, ein Beispiel unter hunderten und tausenden, die geradezu angedeutet werden könnten, bei Meynert. Ich tue das aus dem Grunde, weil ich Ihnen ja gerade anführen durfte, daß ich Meynert als einen ausgezeichneten Forscher ansehe, damit man nicht sagt, ich will hier die Leute irgendwie niedrig stellen. Ich nehme, wenn es sich um Widerlegungen handelt, nicht
Leute, die ich gering achte, sondern gerade Leute, die ich aufs höchste schätze.
Da tritt uns bei Meynert entgegen, wie er zum Beispiel sich denkt das Zustandekommen der Vorstellung des Raumes, der Zeit im Menschen. Meynert meint so: Nehmen wir einmal an - es liegt uns dieses Beispiel ja jetzt besonders nahe -, ich höre mir einen Redner an. Ich werde die Vorstellung gewinnen, daß seine Worte nach und nach, in der Zeit gesprochen sind. Woher rührt das, sagt Meynert, daß man die Auffassung hat: die Worte werden nach und nach in der Zeit gesprochen? Also Sie können sich jetzt vorstellen, daß Meynert von Ihnen allen spricht, die Sie meine Worte so auffassen, daß sie Ihnen nach und nach in der Zeit erscheinen. Da sagt er: Ja, diese Zeit entsteht erst durch die Auffassung des Gehirns; daß wir ein Wort hinter das andere uns gestellt denken, das entsteht erst durch die Auffassung des Gehirns. Die Worte kommen an uns heran, sie kommen an unsere Sinnesorgane heran, sie gehen von diesen Sinnesorganen in einer Weiterwirkung zum Gehirn. Das Gehirn hat gewisse innere Organe, durch die es die Sinneseindrücke verarbeitet. Und da entsteht - innerlich -durch gewisse Organe die Zeitvorstellung. Die Zeitvorstellung wird also da erschaffen. Und so werden alle Vorstellungen aus dem Gehirn heraus erschaffen.
Daß Meynert damit nicht nur etwas Untergeordnetes meint, das können Sie aus einer gewissen Bemerkung in sei-nem Vortrag «Zur Mechanik des Gehirnbaues» ersehen, wo er sich über das Verhältnis der Außenwelt zum Menschen ausspricht. Er sagt da, daß der gewöhnliche, naive Mensch annehme, die Außenwelt sei so da, wie er sie in seinem Gehirn erzeugt. Meynert sagt: Die gewagte Hypothese, welche der Realismus macht, besteht darin, daß die Welt, welche dem Gehirn erscheint, auch vor oder nach dem Vorhandensein
von Gehirnen bestünde. Der Bau des bewußtseinsfähigen Gehirnes aber, welcher dasselbe zur Gestaltung der Welt als zuständig gelten läßt, führt zur Negation dieser Hypothese. Das heißt: Das Gehirn baut sich die Welt auf. Die Welt, so wie sie sich der Mensch vorstellt, so wie er sie vor sich hat als seine Sinnenwelt, ist durch Vorgänge des Gehirns, von innen heraus, erschaffen. Und so schafft der Mensch nicht nur die Bilder, sondern so schafft er auch den Raum, die Zeit, die Unendlichkeit. Für alles das, sagt Meynert, existieren gewisse Mechanismen des Gehirns. Daraus schafft der Mensch zum Beispiel die Zeit.
Es ist schade, daß man in solchen Vorträgen, die ja kurz sein müssen, nicht immer auf alle einzelnen Übergänge dieser Gedanken sich einlassen kann. Darum mag manches undurchsichtig erscheinen. Aber worin der eigentliche Nerv einer solchen Denkweise liegt, wird ja zu ersehen sein. Man muß nämlich sagen: Sobald man überhaupt auf dem Wege ist, das Gehirn als den Schöpfer des Seelenlebens, wie es der Mensch zunächst hat, anzusehen, so ist dasjenige, was da Meynert sagt, durchaus berechtigt. Es liegt auf diesem Wege, man muß dazu kommen. Und man kann nur entgehen einer solchen Folgerung, wenn man ein so in sich ausgearbeitetes Denken hat, daß einem die oftmals sehr einfachen Gegengründe sogleich an die Seele herantreten. Denken Sie nur, was die Folgerung wäre, wenn Meynerts Auseinandersetzung richtig wäre: Sie sitzen alle da, Sie hören sich das an, was ich spreche. Durch den Bau Ihres Gehirns ordnet sich Ihnen das in der Zeit an, was ich spreche. Nicht nur, daß Ihr Gehörnerv das in Gehörbilder umsetzt, sondern es ordnet sich Ihnen das, was ich spreche, sogar in der Zeit an. Sie haben also alle eine Art von Traumbild dessen, was hier gesprochen wird, selbstverständlich auch desjenigen, der hier vor Ihnen steht. Was
dahinter ist, dafür nimmt der naive Realismus, meint Meynert, an, daß da ein Mensch steht gleich Ihnen, der das alles spricht. Aber dazu ist keine Nötigung vorhanden; denn diesen Menschen mit seinen Worten, den erzeugen Sie in Ihrem Gehirn; da kann etwas ganz anderes dahinter sein.
Der einfache Gedanke, der sich aufdrängen muß, daß es doch darauf auch ankommt, daß zum Beispiel ich jetzt meine Vorstellungen selber in der Zeit anordne, so daß die Zeit nicht bloß in Ihrem Gehirne bei Ihnen lebt, sondern daß die Zeit schon darinnen lebt, wie ich ein Wort nach dem anderen stelle - dieser leicht erlangbare Gedanke kommt gar nicht, wenn man sich in einer gewissen Richtung fortbohrt. Daß also die Zeit ein Objekt hat, daß sie da draußen lebt, man kann es in diesem Fall, den ich Ihnen angeführt habe, sehr leicht einsehen. Aber wer einmal in einer ganz bestimmten Richtung des Denkens ist, der sieht nicht links, sieht nicht rechts, sondern er geht in seiner Richtung weiter und kommt da zu ungeheuer scharfsinnigen, zu höchst bemerkenswerten Ergebnissen. Aber darauf kommt es eben gar nicht an. Alles, was sich im Laufe eines solchen Gedankenganges an scharfsinnigen Ergebnissen herausstellen kann, das kann streng bewiesen sein, die Beweise können streng ineinander greifen. Sie werden bei Meynert nirgends einen Denkfehler entdecken können, wenn Sie in seinem Strome weitergehen. Aber darauf, daß das Denken so in sich durchgearbeitet ist, daß einem die Gegeninstanzen beikommen, daß das Denken aus sich selber heraus findet, was den ganzen Strom aus seinem Bette herauswirft, darauf kommt es an. Und dies, das Denken so beweglich, so aktiv zu machen, das verhindert eben gerade die auf der anderen Seite sehr berechtigte Vertiefung in die Außenwelt, so wie die Naturwissenschaft sie anstreben
muß. Daher liegt hier aus der Zeit heraus nicht eine subjektive, sondern eine ganz objektive Schwierigkeit vor, wie Sie sehen. Man kann das auf allen möglichen Gebieten erleben.
Wie nagen doch die Philosophen seit weitaus mehr als hundert Jahren herum an dem alten Kantischen Wort, womit er den Gottes-Begriff aus den Angeln heben will. Wenn man bloß hundert Taler denkt, so sind diese um keinen einzigen Taler weniger als hundert wirkliche Taler. Hundert gedachte, hundert mögliche Taler seien ganz genau dasselbe, wie hundert wirkliche Taler! Auf dieses, daß begrifflich, gedanklich, hundert mögliche Taler alles enthalten, was hundert wirkliche Taler enthalten, baut sich bei Kant die ganze Widerlegung des sogenannten ontologischen Gottesbeweises auf. Nun wird man, wenn man bewegliches Denken hat, sogleich auf den bestimmtesten Einwand kommen: Hundert gedachte Taler sind für denjenigen, der bewegliches Denken hat, ausgearbeitetes Denken hat, nämlich genau um hundert Taler weniger als hundert wirkliche Taler! Ganz genau um hundert Taler sind sie weniger. Es handelt sich eben darum, daß man aufmerksam darauf gemacht wird, wie man zu denken hat, nicht bloß, daß dasjenige, was man denkt, sich logisch beweisen läßt. Selbstverständlich ist das Kantische Ideengewebe so fest gestützt, daß sich nur mit äußerstem Scharfsinn auch logische Fehler darin nachweisen lassen. Aber darauf kommt es an, daß man nicht bloß das im Auge hat, was sich einem innerhalb gewisser denkgewohnter Strömungen ergibt, sondern daß das Denken ausgearbeitet ist, so daß man wirklich mit seinem Denken in der objektiven Welt drinnensteht, - daß man nicht bloß mit seinem Denken in sich selbst drinnen-steht, sondern in der objektiven Welt, daß einem aus der objektiven Welt selber die Gegeninstanzen zuströmen. Nur
ein ausgearbeitetes Denken gelangt dahin, daß ihm solche Gegeninstanzen zuströmen, und nur dadurch erlangt man mit seinem Denken eine gewisse Verwandtschaft mit dem Denken, das objektiv die Welt durchpulst und durchwest.
Ich sagte, daß es darauf ankommt, gewissermaßen das Seelische in Tätigkeit zu erfassen. Daß es sich wirklich darum handelt, daß der Mensch, wenn er das Seelische ergreifen will, nicht bloß Schlüsse zieht, die darauf fußen, daß es unmöglich sei, aus dem Gehirn und seinen Vor-gängen heraus Seelenleben zu entwickeln; sondern dieses Seelenleben muß unmittelbar erlebt werden, unabhängig erlebt werden vom Gehirnleben. Dann kann vom Seelen-leben gesprochen werden. Eben dieses innere tätige Erleben sehen heute die Menschen so an, als ob bloß in der Phan-tasie innerlich etwas aufgebaut würde, während der wahre Seelenforscher genau weiß, wo Phantasie steckt und wo durch die Entwickelung des eigenen Seelenlebens dasjenige beginnt, wo er nicht aus der Phantasie heraus spinnt, sondern wo er sich verbunden hat mit der geistigen Welt und aus der geistigen Welt selber heraus schöpft dasjenige, was er dann in Worte oder Begriffe oder Ideen oder Vorstellungen prägt. Die Seele wird nur auf diese Weise zu einem Wissen von sich selbst gelangen können.
Ich werde jetzt vor Ihnen eine scheinbar recht paradoxe Anschauung zu entwickeln haben, aber eine Anschauung, die doch auch einmal ausgesprochen werden muß, weil sie das Wesen der Geistesforschung eigentlich erst so recht beleuchten kann. Nach dem, was ich vorhin gesagt habe, können Sie schon merken, daß der Geistesforscher gar nicht irgendwie abgeneigt ist, abgeneigt sein kann der Annahme, daß das Gehirn aus sich selber gewisse Vorstellungen heraustreibt, so daß dasjenige, was entstehen kann an Seelen-leben ohne innerliche Mitarbeit, wirklich bloß Gehirnprodukt
sein kann. Und eine gewisse Gewohnheit, die gerade durch die Gegenwartsbildung entstanden ist, besteht nämlich in folgendem: Der Mensch wird aus dem angedeuteten Grunde abgeneigt, irgend etwas, was er für wahr halten soll, durch innere Betätigung zu suchen. Er verurteilt das alles als Phantasie oder Träumerei, und dann bringt er es nicht bloß theoretisch in seinen Anschauungen, sondern praktisch dahin, daß er wirklich dasjenige, was die Seele in sich erarbeitet, ausschaltet, daß er das in seinem Arbeiten hin zu einem Weltenbilde möglichst ausschaltet. Wenn man so das Seelenleben ausschaltet, dann kommt als Ideal das Bild der materialistischen Weltanschauung zustande. Was tut man denn eigentlich, wenn man dieses innere Leben ausschaltet? Ja, wenn man dieses innere Leben ausschaltet, so ist es ungefähr so, wie wenn man sein leiblich-physisches Leben entläßt von dem Seelenleben. Gerade so wie der Uhrmacher, der an der Uhr gearbeitet hat, der seine Gedanken hineingearbeitet hat, die Uhr, wenn sie fertig ist, sich selber überläßt und die Uhr selber dann die Erscheinungen hervorbringt, die erst durch die Gedanken des Uhrmachers in sie hineingelegt sind, so kann in der Tat das Seelenleben weitergehen, im Gehirn weitergehen, ohne daß die Seele dabei ist. Und daran gewöhnt sich der Mensch gerade unter der gegenwärtigen Bildung. Er gewöhnt sich nicht nur, die Seele zu leugnen, sondern in der Tat die Seele auszuschalten; kurz, nicht durch innere Aktivität auf sie einzugehen, sondern sich auf das Ruhekissen dessen zu legen, was bloß aus dem Gehirn heraus erzeugt wird. Und das Paradoxe, das ich sagen will, ist, daß die rein materialistische Weltanschauung, wie sie auftritt, in der Tat ein Gehirnprodukt ist, daß sie in der Tat durch die Selbst-bewegung des Gehirns automatisch erzeugt wird. Indem die Außenwelt sich im Gehirn spiegelt, das Gehirn passiv
in Bewegung bringt, entsteht dieses Weltbild des Materialisten. Das Kuriose ergibt sich, das Sonderbare, daß der Materialist sogar für sich ganz recht hat, wenn er eben zuerst das Seelenleben ausgeschaltet hat. Weil er sich auf das Ruhekissen des reinen Gehirnlebens begeben hat, so kann ihm gar nichts anderes erscheinen als das reine Gehirn-leben, das eben aus sich selber nun das Seelenleben so erzeugt, wie es im geistigen Bilde grob geformt Carl Vogt, der Naturforscher, gesagt hat: Das Gehirn schwitzt Gedanken aus, wie die Leber Galle ausschwitzt. - Diejenigen Gedanken, die auf dem Felde des Materialismus entstehen, sind allerdings ausgeschwitzt. Das Bild ist grob, aber sie sind in der Tat aus dem Gehirn heraus entstanden, wie die Galle aus der Leber herauskommt. Dadurch entstehen die Irrtümer. Nicht dadurch, daß man einfach etwas Falsches sagt, entstehen die Irrtümer, sondern dadurch, daß man etwas Richtiges sagt, das auf einem eingeschränkten Felde gilt, das sogar auf dem Felde gilt, das man einzig und allein nur haben will.
Von der Neigung, das Denken nicht anzustrengen, es nicht zu vertiefen, wie es hier ausgeführt wurde gerade in den letzten Vorträgen, das innere Seelenleben nicht regsam zu machen, von dieser Neigung, sich bloß zu überlassen dem, was der Körper kann, kommt die materialistische Weltanschauung. Die materialistische Weltanschauung kommt nicht aus einem logischen Irrtum, sondern sie kommt aus der Neigung des Gemütes, sich gar nicht innerlich zu betätigen, sondern sich dem zu überlassen, was das Leibliche sagt. Hier liegt das Geheimnis der Schwierigkeit der Widerlegung des Materialismus. Wenn derjenige, der sein Seelenleben nicht betätigen will, Betätigung von vornherein ausschließt und es im Grunde bequemer findet, nur dasjenige zu produzieren, was ein Gehirn produziert, dann
ist es nicht zu verwundern, daß er auf dem Gebiet des Materialismus stecken bleibt. Darauf kann er allerdings nicht eingehen, daß ja dieses Gehirn selber - Gott sei Dank, daß er es hat, denn er würde es sich mit all seiner materialistischen Weltanschauung nicht gestalten können! - daß dieses Gehirn selber aus der Weisheit der Welt heraus geschaffen ist und daß es, weil es geschaffen, auferbaut ist aus derWeisheit derWelt, so eingerichtet ist, daß es selber wiederum so wirken kann, wie eine Uhr fortwirkt; so daß es durchaus materiell sein und durch sich weiter produzieren kann. Diese Weisheit ist eine Art Phosphoreszieren, ein Phosphoreszieren, das da ist im Gehirn selber; es bringt dasjenige heraus, was schon geistig hineingelegt ist. Aber darauf braucht sich ja der Materialist nicht einzulassen, sondern er überläßt sich einfach dem, was aus dem Geistigen heraus, ich möchte sagen, in die Materie sich verdichtet hat und was nun wie beim Werke der Uhr abraspelt an geistigen Erzeugnissen.
Sehen Sie, so sehr steht der Geistesforscher auf dem Boden der berechtigten Naturanschauung, daß er genotigt ist, etwas auszusprechen, was manchen Leuten so paradox erscheinen könnte wie das eben Gesagte. Aber Sie sehen daraus, daß man schon auf den Nerv der Geisteswissenschaft eingehen muß, wenn man über diese Geisteswissenschaft urteilen will. Und begreiflich ist es auch zu finden, weil ja dasjenige, was da wieder gesagt werden kann, so gut begründet ist, - begreiflich ist es ja auch, daß so viele Einwände und Mißverständnisse auftreten. Die Geistes-forschung, die ernst auftritt, wird allzu leicht verwechselt mit alledem, was dilettantisch getrieben wird und was äußerlich eben sehr leicht verwechselt werden kann mit wahrer, gründlicher Geistesforschung. Es ist oftmals gerade mir ein Vorwurf daraus gemacht worden, daß die Schriften,
die ich über Geisteswissenschaft schrieb, wie man sagt, nicht populär genug sind; daß auch die Vorträge, die ich hier halte, nicht populär genug sind. Nun, weder schreibe ich meine Schriften noch halte ich meine Vorträge dazu, um jemandem zu gefallen, um irgend jemandem so zu Herzen zu sprechen, wie er es gerade haben will; sondern ich schreibe meine Schriften und halte meine Vorträge so, wie ich glaube, daß sie geschrieben und gehalten werden müssen, damit die Geisteswissenschaft in der richtigen Weise vor der Welt vertreten werden könne. In älteren Zeiten hat es ja auch Geisteswissenschaft gegeben - ich habe das öfter erwähnt -, obwohl die Geisteswissenschaft durch den Fortschritt der Menschheit sich ändern mußte und damals aus anderen Quellen hervorging als die Geisteswissenschaft von heute. Da hat man von vornherein an den Stätten, wo Geisteswissenschaft vorgetragen worden ist, nur diejenigen zugelassen, die man für reif befunden hat. Heute wäre ein solches Vorgehen ganz unsinnig. Heute leben wir im öffentlichen Leben, und es ist selbstverständlich, daß dasjenige, was erforscht wird, in das öffentliche Leben hineingetragen wird, daß alles Geheimtun und dergleichen eine Torheit wäre. Mehr kann gar nicht dieses Geheimtun sein, als dasjenige, was sonst auch heute im öffentlichen Leben vorhanden ist: daß denen, die schon irgend etwas durchgenommen haben, dann eine Möglichkeit geboten wird, in engeren Vorträgen etwas Weiteres zu hören. Doch das macht man auch an Universitäten, das ist im ganzen äußeren Leben so. Und wenn man da spricht von irgendeinem Geheimtun, so ist das ebensowenig berechtigt und ebenso unbegründet, wie wenn man von Geheimtun bei Universitätsvorträgen spricht. Aber damit nicht jeder, der sich keine Mühe geben will, in die Sache einzudringen, in sogenannten populären Schriften, die ihm so recht zum Munde gehen, eindringen
könne, besser gesagt glauben könne, eindringen zu können, werden die Schriften so geschrieben und die Vorträge so gehalten, damit schon einige Anstrengung notwendig ist und man auf dem Weg hinein in die Geheimwissenschaft schon einiges Denken anwenden muß. Ich bin mir voll bewußt, wie stachelig-wissenschaftlich manches ist, was ich vorbringe, für diejenigen, die solch Stachelig-Wissenschaftliches nicht wollen. Aber das muß sein, damit Geisteswissenschaft sich in der richtigen Weise in die Geisteskultur der Gegenwart hineinstellen kann. Darüber braucht man sich nicht zu wundern, wenn da oder dort in kleineren oder größeren Kreisen Menschen Geisteswissenschaft treiben, die keine Ahnung haben von den Fortschritten der Wissenschaft in unserer Zeit und mit einer gewissen Autorität auftreten wollen, - daß von seiten der Wissenschafter dann die Geisteswissenschaft angeschwärzt wird. Schon also in der Form, in der Art der Mitteilungen muß etwas Besonderes, etwas Bedeutungsvolles gesehen werden. Das muß darin gesehen werden, daß innere Betätigung, Aktivität der Seele nötig sei, um zu sehen, wie das eigentliche Seelische als etwas lebt, das sich des Leibes als eines Werkzeu-ges bedient, das aber mit dem Leiblichen nicht einerlei ist.
Nun, wenn man das alles richtig anschaut: Woher kommen denn die Mißverständnisse? Wenn die Seele sich also entwickelt, wenn sie die in ihr schlummernden Kräfte, wie das öfter hier ausgeführt worden ist, entwickelt, dann ist die erste dieser schlummernden Kräfte die Denkkraft, die so entwickelt werden muß, wie es auch eben jetzt wieder angedeutet worden ist. Wenn die Seele die in ihr schlummernden Kräfte so entwickeln will, so braucht sie eine gewisse innere Stärke, eine gewisse innere Kraft. Sie muß sich anstrengen innerlich. Das liebt man gerade unter dem Einflusse der heutigen Zeit nicht, dieses innerliche Anstrengen.
Am ehesten lieben es noch Künstler. Aber auch auf dem Gebiete der Kunst ist man ja heute schon so weit gediehen, daß man am liebsten die Natur bloß abschreiben möchte und keine Ahnung davon hat, daß die Seele innerlich sich erkraften, innerlich sich etwas erarbeiten muß, um zu dem, was die bloße Natur ist, etwas Besonderes, Neues hinzuzutun. Die Denkkraft also ist das erste, was erkraftet werden muß. Dann müssen auch, wie die Vorträge der letzten Wochen gezeigt haben, Gefühl und Wille erkraftet werden. Und diese Erkraftung, das ist es, was man eigentlich dann nur so bezeichnet, daß man sagt: Ja, da entsteht ja bei dieser Geisteswissenschaft alles nur auf innerliche Weise. Davor scheut man zurück, auf innerliche Weise irgend etwas sich erkraften zu lassen, und man läßt sich gar nicht ein auf den beträchtlichen Unterschied, der da sein muß zwischen der Auffassung der äußeren Natur und der Auffassung der geistigen Welt.
Fassen wir diesen Unterschied einmal recht kräftig, recht bedeutsam ins Auge. Welcher Unterschied tritt da auf? In bezug auf die äußere Natur sind uns unsere Organe schon gegeben. Das Auge ist uns gegeben. Goethe hat nun aber das schöne Wort ausgesprochen: «Wär' nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken?» So wahr es ist, daß Sie mich nicht hören würden, wenn ich nicht sprechen würde, daß Sie erst mir entgegenkommen müssen mit ihrem Zuhören, um das zu verstehen, was gesagt wird, so wahr ist es für Goethe, daß aus dem Sonnenlichte selber, allerdings auf dem Umwege durch allerlei Vererbungs- und komplizierte Naturvorgänge, das Auge entstanden ist, daß das Auge nicht nur im Schopenhauerischen Sinne Licht schafft, sondern daß es selber durch das Licht geschaffen ist. Das ist festzuhalten. Aber man könnte sagen: Gott sei Dank für diejenigen, die materialistisch sein wollen: sie brauchen
sich nicht mehr ihre Augen zu schaffen, denn diese Augen werden aus dem Geistigen heraus geschaffen; sie haben sie schon, und indem sie die Welt auffassen, gebrauchen sie diese schon fertigen Augen. Sie lenken diese Augen entgegen den äußeren Eindrücken, und die äußeren Eindrücke spiegeln sich; mit der ganzen Seele spiegeln sie sich in den Sinnesorganen. Nehmen wir einmal an, der Mensch könnte mit seinem heutigen Bewußtsein die Entstehung des Auges erst miterleben. Nehmen wir das an. Nehmen wir an, der Mensch trete als Kind in die Natur herein, nur mit Veranlagung für die Augen. Die Augen müßten sich ihm erst durch die Einwirkung des Sonnenlichts ergeben. Was würde da auftreten im Wachstum des Menschen? Das würde auftreten, daß durch die ja selbst noch nicht zu sehenden Sonnenstrahlen die Augen herausgeholt würden aus der Organisation, und indem der Mensch spürt: ich habe Augen, spürt er im Auge das Licht. Indem er das Auge weiß als das seine, als seine Organisation, spürt er das Auge drinnen lebend im Licht. So ist es im Grunde genommen auch heute bei den Sinneswahrnehmungen: der Mensch erlebt sich selber, indem er im Licht erlebt, - mit seinem Auge im Licht erlebt dasjenige, was bei der Sinneswahrnehmung entwickelt ist, wo wir - wie gesagt, Gott sei Dank - die Augen schon haben.
Das muß aber auch bei der Geistesforschung sein. Da muß wirklich aus der noch immer ungeformten Seele her-ausgeholt werden das Organische. Da muß erst das geistige Hören, das geistige Schauen herausgeholt werden. Es muß das Organische, gleichsam das Geistesauge, Geistesohr - um diese Ausdrücke Goethes immer wieder zu gebrauchen -erst aus dem Inneren herausgeholt werden. Da muß man wirklich in der geistigen Welt sich durch die Entwickelung seiner Seele erfühlen, und dann, indem man sich darin erfühlt,
bildet man sich die Organe, und in den Organen erlebt man die geistige Welt ebenso, wie man in den Organen des physischen Leibes die physisch-sinnliche Welt erlebt. Also da muß erst dasjenige geschaffen werden, was der Mensch hier für die Sinnesanschauung schon hat. Er muß die Kraft haben, die Organe erst zu schaffen, um in den Organen sich in der geistigen Welt zu erleben.
Dem steht entgegen dasjenige - und es ist wirklich nichts anderes -, was aus der heutigen Bildung heraus erzeugte innerliche Schwäche des Menschen genannt werden kann. Schwachheit, das ist es, was den Menschen zurückhält, sein Inneres so - es ist ein dummer Ausdruck zu sagen: in die Hand zu nehmen, aber sagen wir es -, sein Inneres so in die Hand zu nehmen, daß es wirklich so innerlich tätig ist, wie es wäre, wenn der Mensch erst die Hände schaffen würde, um den Tisch zu berühren. So schafft er sein Inneres, um zu berühren, was geistig ist, und mit Geistigem berührt er Geistiges. Schwäche also ist es, die die Menschen abhält, zum wirklichen Geistesforschen vorzudringen. Und Schwäche ist es, welche die Mißverständnisse hervorruft, die der Geistesforschung entgegenstehen, - innerliche, seelische Schwäche, keine Möglichkeit vor Augen zu sehen -da man noch in Faustizismus hineinragt -, innerlich Wirkliches zu innerlich geistigen Organen umzubilden, um die geistige Welt zu ergreifen. Das ist das Eine.
Und ein Zweites liegt noch vor, das man schon auch einsehen kann, wenn man es nur einsehen will: Vor dem Unbekannten hat der Mensch immer ein sonderbares Gefühl; vor allen Dingen hat er vor dem Unbekannten das Gefühl der Furcht. Nun ist es zunächst für alles dasjenige, was man in der Sinnenwelt erleben kann, ein völlig Unbekanntes, was nicht nur in der geistigen Welt erforscht werden kann, sondern wovon man auch reden muß, wenn
man von der geistigen Welt spricht. Furcht hat man vor der geistigen Welt, aber eine Furcht ganz besonderer Art, nämlich eine Furcht, die nicht zum Bewußtsein kommt. Und wodurch entsteht die materialistische, die mechanistische, die, wie man eben heute «gebildeter» sagt - materialistisch ist sie ja doch! - monistische Weltanschauung? Sie entsteht dadurch, daß in der Seele Furcht vorhanden ist vor jenem Durchbrechen der Sinnlichkeit, weil man Furcht hat eben davor, daß, wenn man durchbreche durch die Sinnlichkeit zu dem Geistigen, man ins Unbekannte kommt, ins Nichts, wie Mephistopheles zu Faust sagt. Und Faust sagt: «In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden.» Furcht vor dem, was man nur als das Nichts ahnen kann, aber maskierte Furcht, Furcht, die eine Maske trägt! Man muß sich da schon einmal bekannt machen, daß es unter- oder unbewußte Seelenvorgänge gibt, Seelenvorgänge, die da unten wuchern im Seelenleben. Es ist merkwürdig, wie die Menschen sich da täuschen über gar manches. So zum Beispiel ist ja eine sehr häufige Täuschung diese, daß man über dasjenige, was man so recht aus einem knüppeldicken Egoismus heraus eigentlich will, sich nicht gesteht, daß man es aus Egoismus heraus will. Sondern man erfindet allerlei Ausflüchte, wie selbstlos, wie liebevoll man dies oder jenes tun will. Man breitet so eine Maske über den Egoismus hinüber. Das tritt ja besonders sehr häufig bei Gesellschaften zum Beispiel auf, die sich zusammenschließen, um recht die Liebe zu pflegen. Ja, man kann geradezu Studien über solche Maskiererei des Egoismus gar häufig machen. Ich habe einen Mann gekannt, der erklärte immer wieder und wiederum, dasjenige, was er treibe, treibe er ganz gegen seine eigentliche Absicht und gegen dasjenige, was er liebt; er treibe es nur, weil er es notwendig erachte zum Heile der Menschheit. Ich mußte immer wieder sagen: Machen
Sie sich nichts vor! Sie treiben das aus Ihrem Egoismus heraus deshalb, weil's Ihnen gefällt, und dann ist es schon besser, wenn man sich die Wahrheit gesteht. Dann steht man auf dem Boden der Wahrheit, wenn man sich gesteht, daß einem die Dinge gefallen, die man unternehmen will, und sich keine solche Maske vorhält.
Furcht ist es, was heute führt zur Ablehnung der Geisteswissenschaft. Aber diese Furcht gesteht man sich nicht. Man hat sie in seiner Seele, aber man läßt sie nicht herauf ins Bewußtsein und erfindet Gründe, Beweisgründe gegen Geisteswissenschaft, Beweise dafür, daß der Mensch sogleich ins Phantasieren hineinkommen müsse, wenn er den festen Boden der sinnlichen Anschauung verläßt und so weiter. Ja, man erfindet sehr komplizierte Beweise. Man stellt ganze Philosophien auf, die wiederum logisch unanfechtbar sein können. Man erfindet ganze philosophische Weltanschauungen, die eigentlich nichts anderes zu bedeuten haben für den, der Einsicht hat in solche Dinge, als daß alles, was man da erfindet - sei es transzendentaler Realismus, empiristischer Realismus, sei es mehr oder weniger spekulativer Realismus, metaphysischer Realismus und wie diese «ismen» alle heißen -, der Furcht entspringt. Man erfindet diese «ismen», die aus sehr strengen Gedankengängen ausgearbeitet werden. Aber sie sind im Grunde genommen nichts anderes, als die Furcht davor, die Seele auf den Weg zu bringen, der dahin führt, das, was man als das Unbekannte empfindet, in seiner Konkretheit zu erleben. Das sind die beiden hauptsächlichsten Gründe für das Mißverstehen der Geisteswissenschaft: Schwäche des Seelenlebens, Furcht vor dem vermeintlichen Unbekannten. Und wer sich auf die menschliche Seele versteht, kann die heutigen Weltanschauungen darauf analysieren. Auf der einen Seite entstehen sie aus der Unmöglichkeit, das Denken
selber so zu erkraften, daß ihm die Gegeninstanzen gleich ankommen, und auf der anderen Seite liegt vor die Furcht vor dem Unbekannten. Da macht man es ja manchmal sogar so, daß, weil man Furcht hat in das sogenannte Unbekannte einzudringen, man das Unbekannte als Unbekanntes lieber gelten läßt, und daß viele davon sprechen:
Ja, wir geben zu: hinter der Sinneswelt liegt noch eine geistige Welt, aber der Mensch - wir können das streng beweisen - kann nicht darin eindringen. Die meisten fangen dann an, wenn sie beweisen wollen: «Schon Kant hat gesagt», weil sie immer voraussetzen, daß derjenige, zu dem sie sagen: «Schon Kant hat gesagt>, von Kant gar nichts irgendwie versteht. Die Menschen erfinden also Beweise dafür, daß der menschliche Geist nicht eindringen könne in die Welt, die hinter der Sinnlichkeit liegt. Das sind nur Ausflüchte, so geistreich sie sein mögen, Ausflüchte gegenüber der Furcht. Aber sie nehmen doch an, daß etwas hinter der Sinnlichkeit ist. Das nennen sie das Unbekannte und gründen lieber im Spencerschen Sinne oder in anderem Sinne einen Agnostizismus, als daß sie den Mut finden würden, wirklich ihre Seele hineinzuführen in die geistige Welt.
In der letzten Zeit ist ja eine merkwürdige Weltanschauung entstanden, die sogenannte Weltanschauung des Als-ob. Ja, sie ist auch nach Deutschland hereinverpflanzt worden:
Hans Vaihinger hat ein dickes Buch geschrieben über die Weltanschauung des Als-ob. In dieser Weltanschauung des Als-ob sagt man: Der Mensch kann nicht davon sprechen, daß solche Begriffe wie Einheit seines Bewußtseins wirklich einer Wirklichkeit entsprechen, sondern der Mensch muß schon einmal die Erscheinungen der Welt so betrachten, als ob es eine einheitliche Seele gäbe, als ob irgend etwas zu Grunde läge, was als einheitliche Seele gedacht wird.
Atome - die Als-ob-Philosophen können ja nicht leugnen, daß noch keiner ein Atom gesehen hat und daß man gerade das Atom so denken muß, daß man es nicht sehen kann, denn auch das Licht soll ja erst durch die Schwingungen des Atoms entstehen. Also die Als-ob-Philosophen sind wenigstens so weit, von jener Fabulistik, die noch da oder dort herumspukt von der Atomwelt, nicht zu sprechen. Aber sie sagen: Nun, es erleichtert eben die Anschauung der sinnlichen Welt, wenn man sich die sinnliche Welt so denkt, als ob Atome da wä ren.
Derjenige, der ein tätiges Seelenleben hat, wird bemerken, welch Unterschied ist, ob er sich mit seinem tätigen Seelen-leben in einer geistigen Wirklichkeit drinnen bewegt, in dem einheitlichen Seelenweben, oder bloß in äußerer, verstandesmäßiger Realistik einen Begriff geltend macht, als ob die Erscheinungen der menschlichen Betätigung durch ein Seelenwesen zusammengefaßt werden. Wenigstens wenn man wirklich auf dem praktischen Boden der Weltanschauungen steht, wird man die Als-ob-Philosophie nicht gut anwenden können. So ist zum Beispiel ein heute sehr geschätzter Philosoph Fritz Mauthner' der ja geradezu als eine große Autorität angesehen wird, weil er nun endlich den Kantianismus überkantisiert hat. Während Kant noch die Begriffe als etwas auffaßte, womit man die Wirklichkeit zusammenfaßt, sieht Mauthner bloß noch in der Sprache dasjenige, worinnen eigentlich die Weltanschauung beschlossen liegt. Und so hat er nun glücklich seine «Kritik der Sprache» zustande gebracht und ein dickes «Philosophisches Wörterbuch» von diesem Gesichtspunkte aus geschrieben und vor allen Dingen eine Anhängerschaft sich erworben, die ihn für den großen Mann ansieht. Nun, ich will heute auf Fritz Mauthner nicht eingehen, ich will nur sagen: Man könnte sich nun bemühen, die Als-ob-Philosophie
auf diesen Fritz Mauthner anzuwenden. Man könnte sagen: Lassen wir es dahingestellt sein, ob der Mann Geist hat, Genialität hat, aber betrachten wir dasjenige, was er geistig ist, so als ob er Geist hätte. Man wird sehen, wenn man aufrichtig zu Werke geht, daß einem das nicht gelingt. Das Als-Ob läßt sich nicht anwenden, wo die Sache nicht vorhanden ist.
Kurz, notwendig ist schon, um es noch einmal zu sagen, daß man auf den Nerv der Geisteswissenschaft selber eingeht und daß man gerade in der Geisteswissenschaft dasjenige kennt, was diese Geisteswissenschaft als berechtigt anerkennen muß auf dem Boden, auf dem Mißverständnisse entstehen können. Denn so wahr diese Mißverständnisse auf der einen Seite Mißverständnisse sind, so wahr ist auf der anderen Seite, daß diese Mißverständnisse dennoch berechtigt sind, wenn die Geisteswissenschaft nicht voll in der Möglichkeit drinnensteht, mitdenken zu können auch das, was der Naturforscher denkt. Der Geistesforscher muß schon in der Lage sein, mit dem Naturforscher mitdenken zu können. Ja, er muß sogar den Naturforscher zuweilen etwas prüfen können und namentlich diejenigen etwas prüfen können, welche da immer betonen, auf dem festen Boden der Naturforschung zu stehen. Allerdings, wenn man manchmal auch nur in äußerlicher Weise prüft, wie es da steht mit einer scheinbar rein positivistischen Weltanschauung, welche ablehnt alles Geistige, dann zeigt sich das Folgende. Wie Sie wissen: Ich unterschätze nicht Ernst Haeckel, wo die Schätzung berechtigt ist, ich erkenne ihn voll an. Aber da, wo er von Weltanschauung spricht, da zeigt sich gerade bei ihm namentlich jene Schwäche des Seelenlebens, die nicht in der Lage ist, irgend etwas anderes zu verfolgen, als den einen Strom, den er eingeschlagen hat. Und da kommt man zum Beispiel auf das, was immer
wieder betont werden muß, wenn man auf dem Boden eines ernsten Arbeitens in der Gegenwart steht. Man kommt auf die unendlich verbreitete Oberflächlichkeit des Denkens und das ganze Lügenhafte des Lebens. Da sieht man beispielsweise, wie Ernst Haeckel darauf hinweist, daß einer der Größten, auf die er sich selbst berufen will> Karl Ernst von Baer ist. Und immer wieder finden wir Karl Ernst von Baer angeführt als einen Mann, der beweisend sein soll für die rein materialistische Weltanschauung, die Haeckel aus seinem Forschen ableitet. Wieviele Menschen gehen nun hin, um einen Einblick zu gewinnen in das, was eigentlich in dem heutigen Wissenschaftsbetriebe steckt, - wieviele Menschen gehen nun hin und fassen so etwas an? Wieviele Menschen bleiben dabei stehen, daß sie bei Haeckel lesen:
Karl Ernst von Baer kann angesehen werden als einer, der so spricht, wie Haeckel daraus ableitet! Da glaubt man selbstverständlich, daß Baer so etwas spricht, wie Haeckel daraus ableiten kann. Nun, ich will Ihnen einige Stellen aus Karl Ernst von Baer vorlesen: «Der Erdkörper ist nur das Samenbeet, auf welchem das geistige Erbteil des Menschen wuchert, und die Geschichte der Natur ist nicht nur die Geschichte fortschreitender Siege des Geistigen über den Stoff. Das ist der Grundgedanke der Schöpfung, dem zu Gefallen, nein, zu dessen Erreichung sie Individuen und Zeugungs-Reihen schwinden läßt und die Zukunft auf dem Gerüste einer unermeßlichen Vergangenheit erbaut.»
Eine wunderbar geistgemäße Auffassung der Welt hat der, den Haeckel alle Augenblicke anführt für seine Auffassungsweise! Nachgehen muß man der wissenschaftlichen Entwickelung. Würde das nur ein wenig heute bei denen der Fall sein, die dazu berufen sein wollen, so würde man nicht so furchtbar gegen jene Oberflächlichkeit zu kämpfen haben, die die unzähligen Vorurteile und Irrtümer erzeugt,
die als Mißverständnisse dann einem solchen Streben wie der Geisteswissenschaft entgegenstehen.
Oder schauen wir uns einmal wirklich einen ehrenwerten Mann an im Weltanschauungsstreben des neunzehnten Jahrhunderts: David Friedrich Strauß, einen ehrenwerten Mann - ehrenwert sind sie ja alle! Er will, nachdem er von anderen Anschauungen ausgegangen ist, zuletzt sich ganz stellen auf den Boden: Das Seelische ist nur ein Produkt des Stofflich-Materiellen. Der Mensch ist ganz und gar aus dem, was der heutige Materialismus Natur nennen will, hervorgegangen. Wenn man vom Wollen spricht, so ist kein wirkliches Wollen vorhanden, sondern da kreisen Gehirnmoleküle irgendwie, und da entsteht dann als Dunst das Wollen. Dabei sagt David Friedrich Strauß: «Im Menschen hat die Natur nicht bloß überhaupt aufwärts, sie hat über sich selbst hinaus gewollt.» Das ist: Die Natur will! Man ist dabei angelangt, um Materialist sein zu können, seine Worte nicht einmal mehr ernst zu nehmen. Man leugnet dem Menschen das Wollen ab, weil der Mensch sein soll wie die Natur, und spricht dann: daß die Natur gewollt hat. Man kann allerdings über solche Sache leicht hinweggehen. Aber wer es ernst nimmt mit dem Weltanschauungsstreben, wird wohl einsehen, daß in solchen Dingen die Quellen unzähliger Verirrungen liegen und daß diese Dinge sich einimpfen dem öffentlichen Bewußtsein. Und aus dem, was dann aus dieser Einimpfung entsteht, entstehen die Mißverständnisse gegenüber wahrer Geisteswissenschaft und wahrer Geistesforschung.
Und von der anderen Seite kommen ja diejenigen Einwendungen, die nun die Bekenner dieses oder jenes Religionsbekenntnisses haben, die glauben, ihre Religion sei gefährdet, wenn eine Geisteswissenschaft kommt. Ich muß immer wieder und wiederum betonen: Es sind die Leute
ganz derselben Gesinnung, die entgegengetreten sind Kopernikus, Galilei und so weiter mit dem Einwurf, die Religion sei gefährdet, wenn man vorstellen müsse, daß sich die Erde um die Sonne bewegt. Man kann diesen Leuten gegenüber immer nur sagen: Wie kleinmütig seid ihr eigentlich innerhalb eurer Religionen! Wie wenig habt ihr eure Religion erfaßt, wenn ihr sogleich die Furcht habt, daß eure Religion gefährdet sein könne, wenn irgend etwas erforscht wird! Da muß ich immer wieder jenen Theologen erwähnen, der ein guter Theologe und ein gläubiger Anhänger seiner Kirche geblieben ist, mit dem ich befreundet war, der dann in den neunziger Jahren zum Rektor an die Wiener Universität gewählt worden ist und der bei seiner Rektoratsrede, die er über Galilei hielt, sagte: Es gab einmal Menschen - man weiß, innerhalb einer gewissen Religionsgemeinschaft hat es diese Menschen bis zum Jahre 1822 herein gegeben, wo man dann erlaubt hat, an die Kopernikanische Weltanschauung zu glauben! - es hat einmal Menschen gegeben, die da glaubten, daß durch so etwas wie Kopernikanische oder Galileische Weltanschauung die Religionen gefährdet werden können. Heute müssen wir so weit sein, sagte dieser Theologe, dieser gläubige Priester und Anhänger seiner Kirche bis zu seinem Totenbett, daß wir gerade die Religion vertieft finden, verstärkt finden dadurch, daß wir in die Herrlichkeit der Werke des Göttlichen hineinblicken, daß wir sie immer mehr und mehr erkennen lernen. Das war christlich gesprochen!
Aber immer mehr und mehr werden die Menschen auftauchen, die sagen: Ja, diese Geisteswissenschaft sagt dies oder jenes über Christus; das darf man nicht sagen. Den Christus stellen wir uns so und so vor. Man kann dann sogar kommen und diesen Leuten sagen: Was ihr vom Christus behauptet, das lassen wir ja durchaus gelten, gerade
so wir ihr es sagt. Wir sehen nur noch etwas mehr. Wir nehmen diesen Christus nicht bloß als ein Wesen, wie ihr es nehmt, sondern als ein Wesen, sogar als kosmisches Wesen, das der Erde Sinn und Bedeutung im ganzen Weltenall gibt. Aber das darf man nicht. Man darf nicht hinausgehen über dasjenige, was gewisse Leute als das Richtige ansehen. Geisteswissenschaft gibt Erkenntnisse. Durch die Erkenntnis der Wahrheit kann man niemals irgendwie etwas be-gründen wollen, was man eine Religionsschöpfung nennt, trotzdem es immer wieder Toren geben wird, die von Geisteswissenschaft sagen, sie wolle eine neue Religion stiften. Geisteswissenschaft will keine neue Religion stiften. Religionen werden gestiftet auf ganz andere Art. Das Christentum ist gestiftet worden durch seinen Stifter dadurch, daß der Christus Jesus auf der Erde gelebt hat. Und so wenig, wie irgendeine Wissenschaft begründen wird den Dreißigjährigen Krieg, wenn sie ihn erkennt, so wenig wird sie begründen irgend etwas anderes, was in der Wirklichkeit da war. Religionen gründen sich auf Tatsachen, auf Tatsachen, die geschehen sind. Geisteswissenschaft kann nur den Anspruch darauf machen, diese Tatsachen anders zu begreifen, oder vielleicht nicht einmal anders, sondern nur in einem höheren Sinne zu begreifen, als man es ohne die Geisteswissenschaft kann. Aber ebenso wahr ist es, daß dadurch, daß man nun, sei es von einem noch so hohen Standpunkte, den Dreißigjährigen Krieg begreift, man nicht irgendwie etwas begründet in derWelt, was mit dem Dreißig-jährigen Krieg zusammenhängt, ebensowenig wird begründet irgendeine Religion durch das, was Geisteswissenschaft erst erfassen soll. Immer ist es die Oberflächlichkeit, die sich auch in den Empfindungen manchmal beschränkt fühlt und die nicht eingehen will auf die Dinge, um die es sich eigentlich handelt. Wenn man auf die Geisteswissenschaft
einginge, so würde man erkennen, daß zwar die materialistische Weltanschauung die Menschen leicht abführt von religiösem Empfinden, von religiösem Vertiefen, daß aber Geisteswissenschaft gerade dasjenige im Menschen begründet, was tieferes religiöses Erleben sein kann, aber deshalb begründet, weil sie tiefere Wurzeln der Seele bloßlegt und dadurch den Menschen auch auf eine tiefere Weise zum Erleben dessen hinführt, was äußerlich geschichtlich als Religion hervorgetreten ist. Nicht eine neue Religion wird Geisteswissenschaft stiften. Sie weiß zu gut, daß das Christentum der Erde einmal Sinn gegeben hat. Sie wird nur versuchen, dieses Christentum noch mehr zu vertiefen, als es andere, die nicht auf dem Boden der Geisteswissenschaft stehen, vertiefen können. Aus dem Materialismus allerdings ist so etwas erfolgt, wie zum Beispiel David Friedrich Strauß gefolgert hat, der den Auferstehungsglauben einen Humbug nennt und dann sagt: Die Auferstehung mußte vorgeschoben werden, denn Christus Jesus hat manche edlen Dinge gesagt, manche Wahrheiten gesagt. Aber wenn man Wahrheiten sagt, meint David Friedrich Strauß, macht man auf die Leute keinen besonderen Eindruck; man muß das mit einem großen Wunder, dem Wunder der Auferstehung, verbrämen. Dadurch wäre alle christliche Entwickelung doch ein Ergebnis eines Humbugs! Das allerdings hat der Materialismus gebracht. Das wird die Geisteswissenschaft nicht bringen! Die Geisteswissenschaft wird gerade dasjenige, was im Auferstehungsgeheimnis lebt, aus ihren Untergrundlagen heraus zu begreifen versuchen, um dasjenige, was der Materialismus einen Humbug genannt hat, in der rechten Weise vor die Menschheit hinzustellen, die nun weitergedrungen ist und es in der alten Weise nicht mehr einsehen kann. Aber hier soll nicht religiöse Propaganda gemacht werden, sondern nur auf die Bedeutung der
Geisteswissenschaft und auf Mißverständnisse aufmerksam gemacht werden, die ihr entgegenstehen, und die von einem vermeintlich religiösen Leben herkommen.
Heute sind die Menschen noch nicht so weit, daß der Materialismus schon ein schlimmes sittliches Resultat in weiterem Umfange hätte, aber er würde es bald haben, wenn die Menschen nicht dazu kommen können, durch Geisteswissenschaft wiederum in die geistigen selbsttätigen Grundlagen des seelischen Lebens einzudringen. Auch für dasjenige, was die Menschheit als sittliches Leben braucht, wird Geisteswissenschaft etwas bedeuten, was eine Wiedergeburt auf einer höheren Stufe dieses sittlichen Lebens den Menschen geben kann.
Nur im allgemeinen können diese Dinge charakterisiert werden. Die Zeit gestattet es nicht, sie in ausführlicher Weise zu schildern. Ich habe mich bemüht, einige der Mißverständnisse wenigstens zu charakterisieren, die man immer wieder und wiederum findet, wenn Geisteswissenschaft beurteilt wird. Auf dasjenige, was aus der ganzen natürlichen Oberflächlichkeit unserer Zeit herauskommt, möchte ich mich eigentlich nie einlassen, jedenfalls nicht in dem Sinne, um irgend etwas zu widerlegen. Manchmal könnte man sich höchstens in dem Sinne darauf einlassen, daß man ein klein wenig Stoff zum Lächeln oder vielleicht auch Lachen gibt.
Wie gesagt, auf diejenige Art von Oberflächlichkeit, die sich da heute ausbreitet und die doch in gewissem Sinne tonangebend ist, weil Druckerschwärze auf weißem Papier noch immer eine große Zauberwirkung hat - auf diese Oberflächlichkeit kann man sich nicht einlassen. Aber insofern muß man doch von ihr sprechen, als ja die Einwände, die gemacht werden, wenn sie auch gar nichts besagen, sich der Öffentlichkeit einimpfen. Und die Mißverständnisse,
die dann getragen werden von dem, was aus solchem Einimpfen hervorgeht, sind doch dasjenige, mit dem der heute auf Schritt und Tritt zu kämpfen hat, der es mit so etwas wie Geisteswissenschaft ernst nimmt. Immer wieder begegnet man Einwänden, die nicht etwa entspringen - nun, sagen wir auch da - aus irgendeiner Betätigung der Seele, sondern die eingeimpft sind von der allgemeinen Oberflächlichkeit, die in unserer Zeit waltet und webt. Aber derjenige, der in der Geisteswissenschaft drinnensteht, der weiß, wie ich das oftmals hier ausgeführt habe, daß es mit dieser Geisteswissenschaft so gehen muß und so gehen wird, wie es mit alledem gegangen ist, was sich in gewissem Sinne als ein Neues der Geistesentwickelung der Menschheit ein-verleiben muß. Von gewisser Seite her hat man eine solche Begegnung zuteil werden lassen der neueren naturwissenschaftlichen Weltanschauung, bis diese mächtig geworden ist und durch äußere Machtfaktoren wirken kann und nicht mehr bloß durch ihre eigene Kraft zu wirken brauchte. Dann kommt die Zeit, wo man, auch ohne daß man von selbst die Seele betätigt, Weltanschauungen erbauen kann auf solchen die Macht besitzenden Faktoren. Ist denn zwischen zwei Dingen ein großer Unterschied? Diejenigen, die heute monistische Weltanschauungen vielfach begründen, dünken sich wunderbar erhaben, großartig erhaben über diejenigen, die vielleicht auf dem Boden einer religiös-theologisch gefärbten Weltanschauung stehen und nach der Ansicht der zuerst Genannten ganz dogmatisch begrenzt sind, nur auf Autorität schwören. Für den, der hineinsieht in die Art und Weise, wie Mißverständnisse entstehen, ist es in bezug auf das, was die Seele des Menschen wirklich erarbeitet, kein größeres Verdienst, ob man auf den Kirchen-vater Gregor, Tertullian, Irenaeus oder Augustinus schwört und sie auch als Autorität anschaut, oder ob man den
Kirchenvater Darwin, Haeckel, Helmholtz, insofern einem diese wirklich Kirchenväter sind, anschaut und auf sie schwört. Nicht darauf kommt es zunächst an, ob man auf den einen oder anderen schwört, sondern darauf kommt es an, wie man selbst drinnen steht in dem Erarbeiten einer Weltanschauung. Und in einem höheren Sinne, in einem viel höheren Sinne als das der bloße abstrakte Idealismus konnte, wird für die Geisteswissenschaft gelten: Erst wird ihr überall mit Mißverstehen und Irrtümern begegnet; dann aber wird das, was zuerst als Phantastik, als Träume-rei erschien, eine Selbstverständlichkeit. So ist es mit dem Kopernikanismus, so mit dem Keplerismus gegangen, - so geht es mit alledem, was sich der geistigen Entwickelung der Menschheit einverleiben soll. Zuerst ist es ein Unsinn, dann wird es eine Selbstverständlichkeit. So ergeht es auch Geisteswissenschaft.
Aber diese Geisteswissenschaft, sie hat der Menschheit -wie aus alledem, was ich in anderen Vorträgen sagte, und wohl auch aus dem heutigen wiederum hervorgehen kann -etwas Gewichtiges zu sagen. Sie hat der Menschheit dasjenige zu sagen, was hinweist auf jenes lebendig Wesen-hafte, das den Menschen erst dadurch zum Menschen macht, daß es sich ihm nicht der passiven Betrachtung darbietet, nicht sich ihm von außen offenbart, sondern daß er es selber lebendig ergreifen muß, daß er sein Dasein nur durch seine Mittätigkeit erkennen kann. Überwunden wird werden müssen die Schwäche, welche alles für Phantastik ansieht, dessen Sein nicht im passiven Sich-hingeben, sondern nur im tatigen innerlichen Mitarbeiten mit dem Welten-ganzen erfaßt werden kann. Dann wird der Mensch erst wissen, was er ist und was seine Bestimmung ist, wenn er einsehen wird, daß die Erkenntnis davon ihm nur werden kann, wenn sie eine tätige Erkenntnis wird. Der Geist hat
schon seine Kraft, sich durchzuringen, und er wird sich durchringen gegen alle in dem heute gemeinten Sinne berechtigten Mißverständnisse, auch um so mehr gegen diejenigen, die aus der Oberflächlichkeit der Zeit heraus kommen. Denn es ist ein schöner Ausspruch, welchen Goethe im Einklang getan haben will, wie er selber sagt, mit einem alten Weisen:
Wär' nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das Licht erblicken?
Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken?
Das göttlich-geistig Wesenhafte, das durch die Welt webt und west und lebt, es ist dasjenige, aus dem wir urständen, hervorgegangen sind. Auch unser Materielles ist aus dem Geistigen geboren. Und nur, weil es schon geboren ist und der Mensch es nicht in eigener Tätigkeit noch zu erzeugen braucht, glaubt der Mensch, wenn er Materialist ist, heute einseitig daran. Das Geistige, das muß in lebendiger Tätigkeit erfaßt werden. Da muß sich das Göttlich-Geistige erst einweben, da muß die geistige Sonne ihre Organe erst im Menschen schaffen. So könnte man den Goetheschen Ausspruch verändern, indem man sagt: Wird nicht das innere Auge geistessonnenhaft, - es kann niemals das Licht, das das Wesen des Menschen ist, erblicken. Kann sich die menschliche Seele - so wollen wir die heutige Betrachtung abschließen - nicht einen mit demjenigen, aus dem heraus sie ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, mit dem Göttlich-Geistigen, das mit ihrer eigenen Wesenheit eine Wesenheit ist, dann wird ihr nicht aufgehen können der Lichtblick hinein in das Geistige, dann wird ihr das geistige Auge nicht entstehen können, dann wird sie Göttliches im geistigen Sinne niemals entzücken können, dann wird die Welt für
die menschliche Erkenntnis leer und öde sein. Denn nur dasjenige können wir finden in der Welt, wozu wir uns die Organe schaffen.
Wär' nicht das äußere physische Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken? Wird nicht das innere Auge geistessonnenhaft, nimmermehr können wir das Geisteslicht der menschlichen Wesenheit erblicken. Wird nicht des Menschen eigene innere Tätigkeit wirklich geistig-göttlich selber, - wirklich, nimmermehr kann durch des Menschen Seele pulsieren dasjenige, was ihn erst zum wahren Menschen macht: der die Welt durchlebende, durchwebende und durchwirkende und in ihm zum Men-schenbewußtsein, wenn auch nicht zum Gottesbewußtsein, kommende Geist der Welt.
Ich werde dann am 23. und 24. März hier noch sprechen, anknüpfend an die tragische Weltanschauung Nietzsches mit Wagner und über einige intimere, genauere Wahrheiten, welche die menschliche Seele dahin führen können, daß sie wirklich durchbricht die Sinneswelt und ins lebendige Geistesleben hineinkommt. Ich werde dann über diesen Weg der menschlichen Seele in die geistige Welt noch genauer sprechen, als es bisher hat geschehen können.
NIETZSCHES SEELENLEBEN UND RICHARD WAGNER Berlin, 23. März 1916
Als eine der größten Seelentragödien stellt sich Nietzsches Geistesleben hinein in die Entwickelung der Menschheit in bezug auf Geisteskultur im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts und leuchtet nicht nur durch die Art ihres Verlaufes, sondern vor allen Dingen durch ihren ganz besonderen Bezug auf vieles, das seelisch in der Gegenwart lebt, leuchtet herüber in die unmittelbare Gegenwart.
In den Vorträgen, die ich im Verlaufe des Winters halten durfte, habe ich von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu charakterisieren versucht das deutsche Geistesleben in der Zeit, die man nennen kann die große Zeit des deutschen Idealismus, in der Zeit, in welcher aus unermeßlichen Tiefen, und vielleicht kann man sagen, noch mehr aus starken Kräften der Menschenseele heraus ein Fichte, ein Schelling, ein Hegel und andere versuchten, ein Weltanschauungsbild zu schaffen, das wirklich eine Art von Hintergrund ist zu jener gewaltigen Blüte des neuzeitlichen Geisteslebens, die sich darlebt in Herder, Lessing, Goethe, Schiller und den anderen, die zu ihnen gehören. In einem der letzten Vorträge suchte ich dann zu zeigen, wie der Ton des deutschen Geisteslebens, der durch diese großen Geister angeschlagen worden ist, fortgelebt hat bis in unsere Tage herein, aber man kann sagen: mehr fortgelebt hat unter der
Oberfläche des populär gewordenen Geisteslebens, so daß er uns vielfach erschienen ist wie ein verklungener Ton, wie ein vergessenes Streben innerhalb der deutschen Geistesentwickelung des neunzehnten Jahrhunderts und bis in die Gegenwart herein.
Und in der Tat, derjenige, der den gewaltigen Einschnitt betrachtet, der um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts platzgreift im mitteleuropäischen Kulturleben, kann leicht begreifen, warum der damals charakterisierte Ton eigentlich mehr oder weniger nur unvermerkt fortklang. Aus einer intellektuellen und mit der intellektuellen verwandten Geisteskraft heraus suchte das deutsche Geistesleben um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, durch die genannten Geister in die Tiefen der Weltengeheimnisse einzudringen. Und man wird nicht allzu schlecht Hegel verstehen, wenn man ein wenig eingeht auf das, was in seinem Bewußtsein lebte: daß es ihm gelungen sei, die menschliche Gedankenentwickelung überhaupt so weit zu treiben, daß innerhalb dieser menschlichen Gedankenentwickelung ein Höchstes zunächst erreicht war. Und der eben schon genannte Einschnitt zeigt uns, wie gerade das Denken, wie gerade das intellektuelle Leben nach dem ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts dazu gebracht war, daß zunächst notwendig wurde, kann man sagen, eine Art von Ausruhen, eine Art von Atemschöpfen. So intensiv, so kraftvoll mit den innersten und, wenn das Wort nicht mißverstanden wird, kann man sagen, mit den abstraktesten Kräften der Seele sich beschäftigen konnten nur Geister, welche mit einer solchen Energie wie Fichte, Schelling und Hegel an ihr Geisteswerk gehen konnten. Und man konnte den weit ausholenden Atem, der notwendig war zu jener Weite idealistischer Weltanschauung,
nicht durchhalten. Die Folge davon war, daß ein Erlahmen eintrat, welches bis in unsere Tage herein mit Bezug auf all dasjenige, worinnen gerade diese Geister das Höchste gesucht haben, von einem gewissen Unverständnis zeugt, von einer gewissen Lähmung, könnte man sagen, zeugt. So hoch hinauf, wie das Denken, wie das Fühlen, wie das rein seelische Wollen, das sich nicht auf das Äußere, sondern auf das Seelenleben selber richtet, bei Fichte, Schelling und Hegel war, so hoch hinauf konnte man in der Gesamt-kultur nicht steigen. Den Wirklichkeitswert in diesem Streben, den konnte man nicht durchhaltend empfinden. Aber man empfand, daß da gesucht werden sollte durch dieses Streben Wirklichkeit. Und es entstand, wie eine Fortsetzung dieses Streb ens, ein Durst nach Wirklichkeit, ein Durst nach demjenigen, worauf der Mensch fest fußen kann. Das drückte sich dadurch aus, daß man zunächst wie in eine scharfe Gegnerschaft trat gegen all das, was die genannten Geister geschaffen haben. In ihren abgezogenen Gedankengängen konnte man die Wirklichkeit nicht finden, nach der man dürstete. Und so kam es, daß der Durst nach Wirklichkeit sich vor allen Dingen ersättigen wollte an dem, was die äußeren Sinne boten, daß der menschliche Geist zunächst eindringen wollte in all das, was die auf die Sinne und den an das menschliche Gehirn gebundenen Verstand beschränkte, strenge, sichere Naturwissenschaft begründen konnte als eine Weltanschauung.
Der tonangebende Geist, durch dessen Betrachtung man geradezu einsehen kann, worauf es bei diesem Einschnitte im neuzeitlichen Geistesleben ankam, ist Feuerbach. Man braucht nur einige wenige Gedanken seiner Weltanschauung zu charakterisieren, so sieht man, worauf es ankommt. Feuerbach ging aus gerade von Hegel. Er ging aus von dem idealistischen Weltenbilde, das der deutsche Geist geschaffen
hat. Aber ihm trat gerade lebendig vor die Seele: Was ist denn das alles, was etwa ein Hegel angestrebt hat? Was ist denn auf dem Wege zu finden, der in solch abgezogenen Gedankenbewegungen verläuft? Da ist nichts zu finden, was in den Geist selber hineinführt. Alles, was auf diesem Wege zu finden ist über eine geistige Welt, ist nichts anderes, als dasjenige, was die Seele aus sich selber heraus schafft, was die Menschenseele in sich selber auf der Grundlage ihrer sinnlichen Leibeswirklichkeit findet, wozu sie sich durchringt. All das von ihr selbst Geschaffene, das projiziert sie gewissermaßen hinaus in die Welt, das wird ihr Geisteswelt. Und so geht aus dem Durst nach Wirklichkeit hervor ein Hineinstellen des Menschen in das Weltanschauungsbild, so wie er unmittelbar in der Sinnenwelt da ist. Man wollte den Menschen als Vollmenschen nehmen, aber gerade deshalb mußte man aus dem, was man als Wirklichkeit ansah, weglassen, was sich auf dem Wege dieses Geisteslebens ergab. Und so richtete sich der Blick hin auf den Menschen, wie er sich darbietet innerhalb des Reiches, das man nun einzig und allein als Wirklichkeit bezeichnen konnte, innerhalb des Reiches der Sinne und dessen, was der an das Gehirn gebundene Verstand aus diesem Reiche der Sinne machen konnte.
Wie stand nun der Mensch vor sich selber da mit einer solchen Weltanschauung? Der Mensch stand vor sich selber da so, daß er ja wissen konnte: In dir geht eine geistige Welt auf, in dir geht eine Welt auf, die du nicht missen darfst, wenn du der wahren Menschenwürde teilhaftig sein willst. In dir lebt etwas, was weit, weit über die Natur hinausgehen muß. - Aber wie konnte der Mensch zurechtkommen mit dem, was er in sich hervorbringen, schöpferisch in sich betätigen mußte und was ihm nicht in dem Sinne wie das Naturdasein nunmehr als Wirklichkeit
erscheinen konnte? Diese Frage, ins Empfindungsmäßige übersetzt, sie bildet, kann man sagen, einen durchgreifenden Nerv des ganzen Weltanschauungsstrebens in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, ja, bis in unsere Tage herein. Der Mensch, der sich vor sich selber nicht rechtfertigen kann mit dem, was er geistig hervorbringt:
das wurde die große Frage, das wurde das bange Lebens-rätsel, nicht so sehr in dieser Formulierung, in der ich es ausspreche, aber in den Empfindungen und Gefühlen, in denen es sich heraufdrängte aus den Untergründen gerade der am meisten strebenden Seelen.
Und die Geister, die im neunzehnten Jahrhundert auftauchten, welche Weltanschauungsfragen aufwerfen mußten, und die sich nicht durchringen konnten zu jenem verklungenen Ton im deutschen Geistesleben, von dem vor einigen Wochen die Rede war, die standen dieser eben charakterisierten Lebensfrage, Weltanschauungsfrage zunächst so gegenüber. Es ist, wie wenn für eine Zeit nicht die starken Kräfte gefunden werden konnten bei den ton-angebenden Trägern der Weltanschauung, um auch nur in irgendeiner Weise etwas zu finden, was Antwort geben konnte auf die Fragen, die eben gekennzeichnet worden sind. Da stellt sich eine merkwürdige Tatsache ein. Diejenigen, die Philosophen, tonangebende Philosophen sind, die aus der Naturwissenschaft eine Weltanschauung zu zimmern versuchen, sie alle fühlen sich gewissermaßen in dieser eben geschilderten Kraftlosigkeit. Und diese Kraft-losigkeit durchdringt im Grunde genommen die Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts.
In einer merkwürdigen Weise stand nun gerade derWeltanschauung Feuerbachs und damit allem, was jetzt den Grundton abgab, ein Musiker gegenüber, eine Persönlichkeit, in der nicht so sehr abstraktes Denken lebte, die zunächst
gar nicht in abstraktem Denken die gangbaren Wege gehen wollte, die sonst in Weltanschauungsfragen gegangen werden, um hinzukommen zur Lösung der Welträtsel. Eine Persönlichkeit stand der Feuerbachschen Fragestellung gegenüber, die im tiefsten Innersten musikalisch lebte und wirkte und wirken wollte: Richard Wagner. Es war in den vierziger Jahren, da Richard Wagner sich in seiner Seele auseinandersetzte mit der Feuerbachschen Weltanschauung. Vor Richard Wagners Seele, in der alles musikalisch lebte, nicht in Begriffen, Ideen und Gedanken, stand der Mensch, den man in den Mittelpunkt der Weltanschauung hineingerückt hatte und der aus den Gründen, die vorhin charakterisiert worden sind, eben zunächst der bloße Sinnesmensch war. Aber es stand eben dieser Mensch einer musikalisch wirkenden Seele gegenüber. Das musikalische Element lebt und webt ja zunächst im Sinnlichen. Aber es kann nicht bloß im Sinnlichen weben und leben, wenn es so erfaßt wird wie in Richard Wagners Seele. Hier im Musikalischen wirkt das Sinnliche selber als ein Geistiges, - es muß ja als ein Geistiges wirken. Denn wenden wir die Sinne in die Natur, wohin wir wollen - was im wahrsten Sinne des Wortes musikalischer Inhalt ist, kann uns ja nicht unmittelbar aus der Natur entgegentreten. Goethe sagt:
Die Musik ist reinste Form und Gehalt, denn sie hat nicht, wie die anderen Künste, ein eigentliches Vorbild in der Natur, und dennoch - ganz und gar wirkt sie in den Sinn herein; und alles, was in den Sinn hereinwirkt, ist wiederum geistig. So ist im Musikalischen ein Element gegeben, das nicht erreicht werden kann, wenn man die Wege der bloßen Naturanschauung geht, das in dem Menschen, den Feuerbach hineinstellte in das Naturbild, nicht erschaut werden kann. Und wiederum ist im Musikalischen ein Element, das dem Drang der Zeit nach sinnenfälligem Wahrnehmen,
sinnenfälligem Auffassen in ganz außerordentlichem Maße entgegenkam. Und da Richard Wagners Seele in dem merkwürdigen, man kann nicht sagen Zwiespalt, sondern Zwei-klang lebte, ganz musikalisch zu sein, aber nicht als Philosophen-Seele, sondern als musikalische Seele eine Erkenntnis suchende Seele zu sein, so konnte es nicht anders kommen, als daß in Wagners musikalische Vorstellungen, in Wagners musikalisches Empfinden die genannten Fragen in einer ganz anderen Weise hereinspielten, als sie in eine Philosophen-Seele hätten hereinspielen können.
Und ein anderes kam hinzu. Es würde ja reizvoll sein, nun im Genaueren psychologisch zu charakterisieren, wie dieses zweite Element in Richard Wagners Seele zu dem eben Genannten hinzu kam. Aber dazu ist nicht die Zeit vorhanden. Ich will nur andeuten, welches dieses zweite Element ist und wie es sich zum ersten hinzu gesellte. Ein zweites Element tritt hinzu: die Anschauung dessen, was innerhalb Mitteleuropas aus dem germanischen Geist, aus der germanischen Seele heraus geschaffen war an Mythos, an Durchdringung des Lebens mit dem Mythischen. Wunderbar stand vor Wagners Seele nach und nach ein darin beschlossener Gegensatz, der so, wie er in Mitteleuropa auftrat, nirgends anders in der Geistesentwickelung der Menschheit vorhanden ist. Und neuerlich trat er, wie eine Erneuerung des germanischen Mythos, in Richard Wagners Seele auf. Da haben wir ein inniges Zusammenleben und Weben der Menschenseele mit allem Elementarischen in der Natur, ein liebevolles Eingehen gerade in das Sinnlich-Lebendige. Die Naturanschauung des Germanentums ist es, an die wir uns mit diesen Worten wenden, jene Natur-anschauung, die nur leben kann in Seelen, die keinen Zwiespalt unmittelbar fühlen zwischen dem Seelischen und dem Physischen im menschlichen Leben, weil sie das Seelische
so empfinden, daß dieses Seelische nicht nur im Menschen drinnen webt, sondern eins ist mit dem, was im Winde weht, im Gewitter wirkt, in allem, was draußen in der Natur wirkt und pulst als Seelisches und, ich möchte sagen, den Menschen selber, der im Innern erlebt werden kann, noch einmal draußen erlebt. Und zu diesem Erfühlen, zu diesem erkennenden Erfühlen und erfühlenden Erkennen der Natur, das wie ein Grundtrieb in allen Anlagen des Germanentums enthalten ist, kommt hinzu ein Hinaufschauen zu einer Götterwelt, die ja hinlänglich bekannt ist, die ja gedeutet werden kann in naturalistischer Weise -aber diese Deutung ist zum mindesten einseitig. Dieses Hinaufschauen zu Wotan, dieses Hinaufschauen zu Donar, dieses Hinaufschauen zu Baldur, zu den anderen germanischen Göttern und zu alle dem, was nun zusammenhängt im germanischen Mythos mit diesen germanischen Göttern, dieses Hinaufschauen ist wirklich dasjenige, was unmittelbar zeigt, die Welt durchwebend und durchlebend, dasjenige, was der Geistesmensch findet, wenn er sich nicht bloß hinausrichtet an die Natur, sondern wenn er sich selbst seiner eigenen Produktivität, seiner Schöpferkraft überläßt. Inhaltsvoll lebendig ist diese Welt germanischer Götter und Helden und Heldengenien. Aber sie ist nicht erschöpft, wenn man sie etwa als bloße Symbolik der Natur ansieht.
Nun hatte Richard Wagner die Anschauung aufgenommen: Der Mensch steht zunächst wie ein Ende des Natur-schaffens da. Was der Mensch an Vorstellungen über eine höhere Welt bildet, es entsteht ja im Menschen. Dem kann man nach neuerer Weltanschauung, wie sie sich eben herausgebildet hat, keine solche Wirklichkeit beimessen wie den Sinnesdingen. Da entstand in ihm die bange Frage:
Wie kann man denn überhaupt zu einem Schöpferischen
im Menschenleben kommen? Die Natur schafft. Sie schafft durch ihre verschiedenen Wesensstufen bis herauf zum Menschen. Der Mensch wird sich selbst gewahr. Der Mensch erlebt das, was er produziert. Es erscheint eben bloß als etwas vom Menschen Geschaffenes, das keinen Wirklichkeitswert hat. Wie kann man dem Vertrauen entgegenbringen, was da der Mensch in sich schafft? Wie kann man dem vertrauen, so daß es eine Grundlage bildet dafür, daß der Mensch sich nicht bloß hineinstellt in die Natur so, wie diese ihn geschaffen hat, sondern daß er selber sich mit etwas Gültigem in das Schaffen hineinstellen kann?
Eine Gestalt, eine Hauptgestalt mußte vor Wagners Seele treten, die in dieser Weise sich in die Natur hinein-stellt, aber auch mit all den Kräften, die die Natur ihr selbst gegeben hat, sich Festigkeit, Sicherheit, Fortentwickelungsfähigkeit über das Naturdasein hinaus verleiht. Aber von Feuerbach mußte Richard Wagner es annehmen, daß der Mensch, wenn er aus seinem Inneren heraus schafft, im Grunde genommen ja nur die Bilder, die seine Phantasie erwirkt, hinausprojiziert, ein nicht wirkliches Reich zum wirklichen Reich hinzu schafft. Welches Recht besteht in der menschlichen Seele - diese Empfindungs-, diese Gefühlsfrage entstand -, hinauszuschaffen über die Natur? Welches Recht gibt es, schon im Naturdasein selber, im wehenden Winde, in Blitz und Donner, Geistiges zu erahnen und noch mehr: über der ganzen Natur ein Geistiges zu schaffen, wie in der germanischen Mythologie? Wie kann man ein Verbindungsglied zwischen beiden finden? Philosophie konnte es in der damaligen Zeit nicht, insoferne sie tonangebende Philosophie war. Die musikalische Seele Richard Wagners unternahm es. Sie unternahm es tatsächlich aus einem Drange heraus, der zu gleicher Zeit ein tief charakteristischer Zug des neueren mitteleuropäischen Wesens überhaupt
war. Inwiefern? Ja, wenn man dasjenige, was germanischer Mythos, germanische Art des Eindringens in das Naturwesen ist, vergleicht mit dem, was griechischer Mythos, griechisches Eindringen in das Naturleben war, so kann nur ein äußerliches Beobachten glauben, daß beide auf einem und demselben Felde stehen. Denn das ist nicht der Fall. Auch da wäre es interessant, in die tieferen psychologischen Untergründe hineinzuleuchten, aber auch da kann wiederum nur mit einigen skizzenhaften Strichen charakterisiert werden.
Das ganze griechische Geistesleben ist daraufhin veranlagt, nach außen hin anzuschauen, und aus der plastischen Gestaltung, welche die Seele unternimmt mit dem, was sich von der Außenwelt darbietet, den Mythos zu schaffen, den Mythos in Formen, in plastischen Formen aufleben zu lassen. So wie der Grieche empfindet, wie der Grieche fühlt, so geht sein Empfinden, so geht sein Fühlen von seinem eigenen Wesen in die Außenwelt über, fließt in das äußere Dasein voll ein. Und so entstehen die wunderbar gerundeten plastischen Formen, die innerhalb des griechischen Mythos und dann wiederum heraus aus dem griechischen Mythos in der griechischen Kunst leben.
So ist ganz und gar nicht dasjenige, was im germanischen Mythos lebt. Nur mit Mühe kann man solche geschlossenen Formen, wie die Formen, die im griechischen Mythos lebend sind, die Götter- und Heroengestalten des griechischen Mythos, ich möchte sagen, hineinträumen in den germanischen Mythos. Wenn man das tut, wird im Grunde genommen aus diesem germanischen Mythos doch etwas ganz anderes. Will man den germanischen Mythos verstehen, muß man schweifen lassen können jenes liebevoll in das Naturwesen hineingehende Menschheitsempfinden, ohne es bis zur plastischen Gestaltung zu bringen, man muß schweifen lassen
dieses Wesen hinauf zu den Göttergestalten Wotan, Donar, Baldur und so weiter. Und man muß auch darauf verzichten, da oben festgerundete Gestalten zu schaffen. Will man sich wirklich in diesen Mythos hineinleben, so muß alles beweglich bleiben, so kann nur bewegte Plastik, plastische Bewegung wiedergeben, was eigentlich in den germanischen Seelen lebend war. Wie kann man denn dann aber, wenn man auf das Wesen der Sache selber eingeht, ein Band finden zwischen dem, was in der Natur empfunden wird, was einem unmittelbar in der Sinneswelt entgegentritt, und dem, was oben als Götterwelt erschaut wird? Man kann es nur - gerade dann weiß man, daß man es nur kann, wenn man in der richtigen Weise den Grundnerv des germanischen Mythos in sich aufgenommen hat -, man kann es nur im musikalischen Empfinden. Es gibt keine Möglichkeit, jene Strömungen zu finden, die die Seele verfolgen muß von Wotan herunter in das Naturdasein, und wieder hinauf vom Naturdasein in das Leben und Weben der Götter in Walhalla - es gibt keine andere Möglichkeit, als die musikalische Empfindung, jene musikalische Empfindung, welche in dem, was sie vor sich hat, unmittelbar ein Innerliches hat, das Geistige hat, ein Geistiges, das ganz und gar sinnlich sich auslebt.
Und das ist ja der Grundunterschied jener großen Epoche der Menschheitsentwickelung, die wir als griechische empfinden, und derjenigen, die wir dann als germanische empfinden. Im griechischen Geistesleben war das Ich noch nicht so lebendig, das Selbstbewußtsein des Menschen nicht so entwickelt, wie es sich innerhalb des germanischen Geisteslebens herauf in das deutsche Geistesleben entwickeln sollte. Der Grieche lebte mit seinem ganzen Seelenleben noch mehr nach außen. Das ist das Bedeutsame in dem Fortschritt der Menschheit, daß zu diesem griechischen
Leben nach außen die Erfassung im Innern, die Erkraftung im Innern hinzugekommen ist. Aber das Innere kann nicht gestaltet erfaßt werden. Soll es künstlerisch empfunden werden, so muß es ebenso musikalisch empfunden werden, wie das griechische Leben plastisch empfunden werden muß. Und so wie ein Übergang von der mehr selbstfreien Art der griechischen Weltanschauung zu der ich-durchdrungenen Art der neueren Weltanschauung stattfindet, so findet ein Übergang statt des plastischen Gestaltens zu dem musikalischen Empfinden im Fortschritte der Menschheit.
Das ist das ungeheuer Bedeutungsvolle, daß Richard Wagner die Persönlichkeit war, die nun nicht aus der Willkür der Seele heraus, sondern aus dem Miterleben dessen, was in der Zeit selber pulsierte, eben das als sein persönliches Erlebnis haben konnte, was Zeiterlebnis war. Das Musikalische, das also in der Weltanschauung sein mußte, das empfand die durch und durch musikalische Seele Richard Wagners. Und so kam es, daß Richard Wagner ganz aus dem Zeitbedürfnis, aus dem tiefsten Nerv des Geisteslebens der Zeit heraus, den Mythos mit dem Musikalischen verbinden konnte. Und was die fortlaufende Philosophie nicht sein konnte, nicht ausdrücken konnte in Worten, Begriffen und Ideen, im Musikalischen wurde es ausgedrückt. Da ist es darinnen. Und müssen wir das Philosophische, müssen wir das rein Geisteswissenschaftliche wie einen verklungenen Ton empfinden, so möchte man sagen: Wie ein Ersatz tritt das Musikalische durch Richard Wagner in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts herein, dieses Musikalische, das da wirklich ein Ersatz wird für den Erkenntnisweg, der sonst auf eine ganz andere Weise gesucht wird.
Nun trat, wie eben solche Ereignisse im Menschenleben notwendig wie ein inneres Schicksal eintreten, noch etwas
anderes für Richard Wagner ein. Die Bekanntschaft mit Feuerbach blieb doch für Richard Wagner etwas Unbefriedigendes. Zwar war er dadurch, daß er das musikalische Element als sein eigentliches Lebenselement hatte, stark genug, um das zu finden, was auf dem reinen Gedanken-wege nicht zu finden war; doch war in ihm wiederum, wie es im Sinne der neueren Zeit sein muß, der Drang vorhanden, auch bewußt das in sich aufzunehmen, was er tat, bewußt sich Aufklärung zu schaffen über das Verhältnis, in dem nun sein, von ihm ja durchaus als neu empfundenes künstlerisches Wirken zu den tiefsten Weltgeheimnissen des Daseins stand. Und da kam ihm die Schopenhauersche Philosophie wie eine Hilfe. Es kommt jetzt weniger darauf an, diese Philosophie so zu betrachten, wie sie unmittelbar objektiv genommen werden muß, sondern es kommt darauf an, sie so zu betrachten, wie sie auf Richard Wagner wirkte. Diese Schopenhauersche Philosophie zeigte ihm, daß der Mensch, wenn er sich an seine Intellektualität, an sein bloßes Vorstellen hält, eigentlich nimmermehr in die Geheimnisse des Daseins eindringen kann. Er muß viel tiefere Kräfte aus dem Untergrund seines Wesens herauf-holen, wenn er sich irgendwie zusammenleben will mit den Weltengeheimnissen. Daher war alles bloß Intellektuelle, alles bloß in Gedanken, in Begriffen, in Vorstellungen leben, für Schopenhauer etwas, was nun wirklich nicht nur bloße Bilder des Daseins hervorbrachte, sondern solche bloßen Bilder hervorbringen mußte, die eigentlich nur einen Traum vom Dasein geben. Will aber die Seele wirklich zusammenwachsen mit der Wirklichkeit, so darf sie nicht bloß denken, so muß sie tiefere Kräfte aus ihrem Unter-grunde hervorholen. Und Schopenhauer fand, daß der Mensch, wenn er die Kräfte des Daseins wirklich erkennen will, sie nicht im Gedanken, in der Vorstellung erfassen
kann, sondern daß er sie erfassen muß im lebendigen Willen, im Weben des Willens, nicht in der Intellektualität. Und weiter konnte Schopenhauer zeigen, wie aus diesem Willenselement heraus all dasjenige kommt, was auch am einzelnen Menschen wertvoll ist: alles Genialische, alles, was Hingebung und Opferwilligkeit gegenüber der Welt ist, ja, das Mitleid selber, das alles Sittliche durchzieht. All das steht mit tieferen Kräften im Zusammenhang, als bloß mit der Intellektualität. Kurz, der Mensch muß hinaus-dringen über das bloß Bildhafte, das Vorstellungsleben, muß sich verbinden mit demjenigen, woran der Durst nach Wirklichkeit, von dem wir ja gesprochen haben, mehr befriedigt werden kann, als an der bloßen Intellektualität, die an das Leibesleben des Gehirns gebunden ist. Aber in dem, was der Wille darlebt, fand Schopenhauer nicht nur den Mittelpunkt der Persönlichkeit des Menschen, sondern er fand darin auch den Mittelpunkt aller wirklichen Kunst. Alle anderen Künste, so stellt sich Schopenhauer vor, mussen aus dem Willen herausheben die Vorstellungen, müssen die Bilder gestalten. Eine Kunst gibt es nur, die nicht zum Bilde wird, sondern die den Willen unmittelbar so, wie er sich im Innern des Menschen offenbart, auch nach außen zu offenbaren vermag, und das ist die Musik. Dadurch tritt die musikalische Kunst für Schopenhauer in den Mittelpunkt überhaupt des ganzen neueren Kunstlebens, und dadurch, kann man auch sagen, empfindet Schopenhauer etwas von dem urmusikalischen Charakter alles wahren Weltanschauungsstrebens. Und wenn man sich auch nicht auf die Schopenhauerschen Ideen einlassen will oder vielleicht auch nicht einlassen kann, so muß man in dem, was Schopenhauer unbewußt über den menschlichen Willen und seinen Zusammenhang mit dem Musikalischen empfand, etwas erkennen, was wiederum im innigsten Zusammenhange
steht mit dem Lebensnerv des Geisteslebens in der neueren Zeit.
Wie mußte nun Richard Wagner mit seiner urmusikalischen Seele empfinden gegenüber einer Weltanschauung wie der Schopenhauerischen, die ihm zeigte, was Musik eigentlich im Gesamtweltenleben bedeutet? Hatte er nun nicht im Grunde genommen in der Musik das vor sich, von dem er sich sagen mußte: Wie auch das naturwissenschaftliche Weltenbild sich gestalten mag, die Tatsache der Musik wird in der Menschennatur durch das naturwissenschaftliche Weltbild niemals anschaulich, erklärlich gemacht. Da waltet im Menschen der Geist, wo der Mensch musikalisch wird, und dennoch hat man nicht nötig, in eine abstrakte Intellektualität, in abgezogene Begriffe, in eine bloße Vorstellungswelt hinaufzugehen, sondern man bleibt innerhalb des Gebietes des Sinnenfälligen. Und der Drang entstand in Richard Wagner, nun die Musik selber so zu gestalten, daß sie von ihm empfunden werden konnte als erfüllend gewissermaßen ein solches Ideal, zu dem sich Schopenhauer in bezug auf seine Anschauung über die Musik durchzuringen versuchte. Ein ausübender, produktiver Künstler wie Richard Wagner war gegenüber einer solchen Wahrheit doch noch in einer anderen Lage als Schopenhauer, der Philosoph. Schopenhauer, der Philosoph, konnte die Musik nur betrachten, wie sie sich ihm darbot. Sie erschien ihm gewissermaßen als Objekt, und in ihr ahnte er das Walten und Pulsieren des Willens. In Richard Wagner, dem produktiven Menschen, entstand etwas anderes. In ihm entstand jetzt wirklich der Drang, das Musikalische so fortzuentwickeln, daß in dem musikalischen Element, das er zum Ausdruck brachte, etwas wirkte, das genau zeigte, wie das Geistige mit dem Sinnlichen, man möchte sagen, musikalisch bewußt zusammenschmelzen kann.
Und von diesem Gesichtspunkte aus erscheint in der Tat der Tristan, «Tristan und Isolde», wie dasjenige Kunstwerk Richard Wagners - es ist ja entstanden erst nach «Tannhäuser», «Lohengrin» und so weiter - in dem er bewußt das musikalische Element so umgestalten wollte, daß alles, was da musikalisch als Ausdrucksmittel gegeben wurde für das Weben und Wirken des sinnlichsten Elementes, zu gleicher Zeit war wie ein metaphysisches, wie ein übersinnliches Wirken in dem sinnlichsten Element. So war bei Richard Wagner sein Ideal der Fortentwickelung des Musikalischen wirklich etwas wie ein Erkenntnisideal der neueren Zeit. Und wiederum am bewußtesten wird dieses Erkenntnisideal der neueren Zeit von Richard Wagner im Tristan angestrebt.
Tristan ist dasjenige Werk, an dem sich zunächst die Begeisterung Friedrich Nietzsches für Richard Wagner entzündet hat. In die Musik des Tristan suchte der junge Nietzsche einzudringen. Und dieses Eindringen in ein Element, das eben nur insoweit sinnlich war, wie in allem bloß Sinnlichen zugleich überall ein Geistiges pulsiert, -dieses Eindringen in den Tristan wurde für Nietzsche der Anlaß seines Erlebnisses, das er nun mit Richard Wagner hatte, mit Richard Wagners Kunst, mit Richard Wagners Weltanschauung; wurde der Anlaß zu dem Erlebnis, das Nietzsche hatte mit Schopenhauer und mit all dem, was sich nun an das Zusammenwirken der drei Seelen Nietzsche, Schopenhauer, Wagner knüpfen läßt. Und für Nietzsche, der eigentlich von der Philologie ausgegangen war, aber mit genial umfassendem Geist alles aufgenommen hat, was er aus der Philologie aufnehmen konnte, beginnt jetzt etwas Besonderes, etwas, womit, ich möchte sagen, die Einleitung, die Exposition gegeben ist zu seiner Lebenstragödie, die sich mit wunderbar innerer Notwendigkeit nun eigentlich abspielt,
trotz ihrer scheinbaren Widersprüche. Diese scheinbaren Widersprüche im Nietzscheschen Seelenleben sind nämlich nichts anderes, als die Widersprüche innerhalb eines tief ergreifenden, erschütternden Lebensdramas, einer Lebenstragödie; sie sind so, wie Widersprüche in einer Tragödie überhaupt sein müssen, weil das Leben selbst, wenn es in seinen Tiefen dahinströmt, nicht ohne Widersprüche da sein kann. Welches ist denn diese tiefste Eigentümlichkeit des Nietzscheschen Seelenlebens? Andere Geister, die in der neueren Zeit gestrebt haben, bilden sich, wenn sie das Bedürfnis dazu haben, eine gewisse Welt- und Lebensanschauung aus, eine Summe von Begriffen und Vorstellungen, vielleicht auch ein anderes Element der Seele, das hineinführen soll in die geheimen Untergründe des Daseins, und dann, wenn solche Geister, solche Seelen dahin kommen können, eine gewisse Widerspruchslosigkeit in den einzelnen Teilen der Weltanschauung zu finden, nehmen sie diese Weltanschauung auf, lehnen anderes, das ihrem Weltanschauungsbild widerspricht, ab und leben so mit ihrer in sich ausgebildeten Weltanschauung.
So zu leben war Nietzsches Seele ganz und gar nicht geeignet. Ein Grundunterschied gegenüber allen übrigen Weltanschauungsmenschen ist bei Nietzsche vorhanden. Nietzsche ist, wenn man ihn mit anderen Weltanschauungsmenschen vergleicht, kein produktiver Geist. Nietzsche ließe sich niemals, wenn man nicht äußerlich vorgehen will, vergleichen mit produktiven Geistern oder Philosophen wie Fichte, wie Schelling, wie Hegel, auch nur wie Feuerbach, auch nur wie Schopenhauer selber. Nietzsche ist keine Seele, in der unmittelbar Gedanken entspringen, die ihr glaubwürdig erscheinen, die ihr die Unterlagen sind für eine gewisse Meinung über die Welt. In diesem Sinne ist Nietzsches Seele gar nicht schöpferisch, wenn das auch zunächst
denen, die oberflächlich betrachten, nicht so aussieht. Zu anderem scheint Nietzsches Seele berufen zu sein. Während andere Weltanschauungsmenschen also Weltanschauungen ausbilden, gleichsam das Logische dieser Weltanschauungen zu erfassen streben, wird für Nietzsche notwendig, dasjenige, was die wichtigsten Weltanschauungen in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ihm bieten, so auf seine Seele wirken zu lassen, daß in der Seele die Empfindungsfrage entsteht: Wie läßt sich mit diesen Weltanschauungen leben? Was geben sie der Seele? Wie kann die Seele weiterkommen, indem sie diese Weltanschauungen auf sich wirken läßt? - Lebensfragen werden die Weltanschauungen der anderen, die Weltanschauungen, die überhaupt in der zweiten Hälfte des neunzehn-ten Jahrhunderts als die wichtigsten Weltanschauungen auftreten. Kann sich die Seele glücklich ihres Eigenwertes bewußt werden? Kann sie sich gesund entwickeln unter dem Einfluß dieser oder jener Weltanschauungen? Das wird für Nietzsche nicht die formulierte Frage, aber die empfindungsgemäße Frage, der innere Drang, der sich in seiner Seele auslebt. Daher kann man sagen: Nietzsche war es auferlegt, die wichtigsten tonangebenden Weltanschauungen in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in seiner eigenen Seele auf ihren Lebenswert und auf ihre Lebensfrucht hin zu erfahren, innerlich durchzumachen.
Und da entzündete sich dasjenige, was ihm noch während seiner vollen Jugendfrische aus der Philologie gekommen war - er wurde ja sogar schon mit vierundzwanzig Jahren Professor an der Universität von Basel, bevor er sein Doktorat gemacht hatte -, da entzündete sich ihm zunächst dasjenige, was sich ja eigentlich entzünden mußte bei einem Geiste, der mit seiner Zeit mitging. Wir haben ja charakterisiert, was da lebte und webte und sich darstellte
besonders in einem solchen Geiste wie Feuerbach, in einem solchen Geiste ferner wie Schopenhauer. Und durch die Persönlichkeit Richard Wagners trat es Nietzsche jetzt näher. Was wurde Wagner für Nietzsche denn in den sechziger Jahren? So sonderbar es klingt: Wagner wurde für Nietzsche im Grunde genommen Erkenntnisproblem. Wie läßt sich mit dem, was gerade im Sinne der neueren Geistes-entwickelung, der neueren Weltanschauung in dem Musiker Richard Wagner geworden war, wie läßt sich mit dem leben in einer Menschenseele, die die befruchtenden Kräfte des Lebens in sich erfahren will? Das wird für Nietzsche die Grundfrage. Und er muß sich diese Grundfrage, die für ihn Lebensempfindung wird, in Zusammenhang bringen mit seiner Philologie, mit dem, was ihm lebendig geworden war aus dem Griechentum heraus, das ja der vorzüglichste Gegenstand seines Studiums war. Zunächst war der Eindruck, den gerade das Musikalische in Tristan auf Nietzsche machte, ein überwältigender, so daß er das Gefühl hatte:
Da tritt wirklich etwas Neues herein in die neuzeitliche Geistesentwickelung, da ist Leben, das fruchtbar werden muß. Aber welches sind die intimeren Zusammenhänge, durch die dieses Leben für die Gesamtmenschheit fruchtbar werden kann?
Von dieser Frage aus blickte nun Nietzsche zurück in das Griechentum. Und indem er Richard Wagners Musikalisch-Künstlerisches empfand, stellte sich für Nietzsche das Griechentum eigentlich in einem ganz anderen Bilde dar, als das Bild war, das man früher über das Griechentum in gewissem Sinne doch als ein einseitiges empfunden hat. Wenigstens Nietzsche sah dasjenige, was über das Griechentum vor ihm gesagt worden war, wie etwas Einseitiges an. Hatte man doch, so meinte Nietzsche, immer wieder und wiederum aufmerksam machen wollen auf das heitere
Element des Griechen, auf das unmittelbar lebensfreudige Element des Griechen, als ob diese Griechen eigentlich im Grunde genommen nur die spielenden Kinder der Menschheit gewesen wären. Das konnte Nietzsche aus seiner Anschauung des Griechentums nicht zugeben. Ihm trat vielmehr vor die Seele, wie die besten Geister des alten Griechentums empfunden haben das innere Tragische, das Leid-volle alles physisch-sinnlichen Daseins, wie sie empfunden haben, wie der Mensch, der nur innerhalb des sinnlich-physischen Daseins lebt, eigentlich, wenn er nun höhere Bedürfnisse in der Seele trägt, dennoch ganz unbefriedigt bleiben muß. Nur der Ödling kann befriedigt sein innerhalb des sinnlich-physischen Daseins. Und Odlinge, Stumpflinge waren die Griechen für Friedrich Nietzsche nach seiner Anschauung nicht. Die Griechen empfanden vielmehr - das ging ihm aus einer genaueren Betrachtung dieses Griechentums hervor - das Tragische, das Leidvolle des unmittelbaren Daseins, und sie erschufen sich, so meinte Nietzsche, die Kunst, dasjenige, was sie aus ihrem Geiste hervorbringen konnten, gerade um hinwegzukommen über die Disharmonien des sinnlichen Daseins. Die Kunst im Geiste erschufen sie sich, um ein Element zu haben, das sie hinweghob über das Zwiespältige des äußeren sinnlichen Daseins. Die Kunst als Harmonisierung des sinnlichen Daseins, das wurde für Nietzsche die griechische Kunst. Und klar war ihm, daß dieses Streben nach einem geistigen Inhalte, der über den sinnlichen Inhalt hinwegführt, im innigen Zusammenhange stand damit, daß die Griechen noch in ihrer besten Zeit etwas in sich wirksam hatten von dem, was Schopenhauer unmittelbar den Willen nannte und was im Menschen wirkte im Untergrunde der Seele, was im Intellekt, in der Verständigkeit, im Vorstellen nur zu Bildern führt.
Und insbesondere blickte Nietzsche gern zurück ins älteste Griechentum. Ja, bei dem ältesten griechischen Philosophen, bei Thales, Anaxagoras, bei Heraklit namentlich, bei Anaximenes und so weiter fand Nietzsche überall, daß sie nicht so schufen, wie neuere Philosophen durch Denken, Denken und wieder Denken, sondern dadurch, daß sie tief in ihren Seelen noch etwas trugen von dem, was im unterbewußten Element des Willens wirkte, was nicht aufging in der bloßen Vorstellung und was sie hineintrugen in ihre Weltanschauung. All die großen Linien bemühte sich Nietzsche hinzustellen in den schönen Abhandlungen, die er über die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen geschrieben hat. In Sokrates aber empfand er den Menschen, der gewissermaßen die ursprünglich gesunden tieferen Willenskräfte abgelehnt hat durch die bloße Intellektualität. Daher war Sokrates für Nietzsche zwar der eigentliche Bringer des intellektualistischen Elementes, aber auch der Abtöter aller ursprünglichen großen Anlagen für eine geistige Entwickelung der Menschheit. Und indem das Sokratische Zeitalter eingeleitet wurde und bis in die neue Zeit herauf dauerte und in den Weltanschauungen sich auslebte, setzte die Menschheit den bloßen Traum der Intellektualität entgegen dem ursprünglichen elementarischen Drinnenstehen in dem, was mehr ist als bloßes Bild, was innere Wirklichkeit ist. Dieses sah nun Nietzsche wirksam in der Schopenhauerschen Behauptung: daß die Vorstellung bloßes Bild ist, daß aber die Wirklichkeit, nach der man dürstete, in den Gründen,unter der Oberfläche der bloßen Vorstellung, im menschlichen Willenselement lebe. In dieser Schopenhauerschen Behauptung fand Nietzsche etwas, was wiederum zurückging auf dasjenige Zeitalter, das durch das Zeitalter der Intellektualität abgelöst worden war. Und Richard Wagners Kunst erschien Nietzsche so wie eine Erneuerung
der Urkunst der Menschheit selber, wie etwas wirklich ganz Neues gegenüber dem, was die Menschheit bisher als Kunst gepflegt hatte und was nicht völlig Kunst werden konnte, weil es nicht bis hinunter ging in die Urelemente des menschlichen Seelenwesens selber.
So wurde für Friedrich Nietzsche - aus seiner Anschauung des Griechentums und aus seiner Anschauung über den Niedergang des tieferen Menschlichen im späteren Griechentum - Richard Wagner ein ganz Neues, eine ganz neue Erscheinung im Entwickelungsgang der Menschheit, ein Wiederheraufholen tieferer Elemente des Künstlerischen, als sie da sein konnten seit dem sokratischen Zeitalter. Denn das, was wirkliche menschliche Weltanschauung und Lebensgestaltung werden kann, muß aus diesen tieferen Untergründen hervorgehen. In welcher Kunst kann es dann leben? Im Musikalischen allein kann es leben im Sinne Nietzsches. Daher muß dasjenige, was sonst als Kunst auftritt, im Sinne Nietzsches aus dem Musikalischen, aus einem Ur-Musikalischen heraus geboren sein. Richard Wagner wurde wirklich für ihn diejenige Gestalt, auf die Nietzsche hinblickte, und die ihm, ich möchte sagen, die großen Zweifelsfragen seiner Weltanschauung löste. Denn Richard Wagner war ihm derjenige, der nicht philosophierte über die tiefsten Geheimnisse der Welt, sondern musizierte. Und im musikalischen Element lebt das Willenselement. Will man aber in der Menschheitsentwickelung selber dasjenige finden, aus dem alle Kunst entsprungen sein muß, auch die Dichtung, so muß man zurückgehen bis in ein Zeitalter, in dem das Musikalische, zwar auf naive, auf ursprünglichere Art, als bei Richard Wagner, aber doch als Musikalisches lebte.
Aus solchen Empfindungen ging Nietzsche der Gedanke zu seinem ersten Werk hervor: «Die Geburt der Tragödie
aus dem Geiste der Musik.> Denn dasjenige, was sonst künstlerisch lebte, es mußte hervorgegangen sein aus dem Element des Musikalischen. Und so wurde Nietzsches Erstlingswerk, ich möchte sagen, auf die Kunst übertragen die Weltanschauung Schopenhauers von dem Wirken des Willens als einem realen Elemente gegenüber der bloßen Vorstellung. Und Richard Wagner war die Erfüllung dessen, was notwendig eintreten mußte für Nietzsche. Man muß sich diese Dinge nun so vorstellen, wie sie leben mußten als innere Erfahrung einer so erkenntnisdurstigen Seele, wie es die Nietzsches war. Alles Glück, das Nietzsche erleben konnte, alle Erfüllung von Sehnsuchten und Hoffnungen, die ihm werden konnten, waren für ihn dadurch gegeben, daß er sich sagen konnte: Was durch den Sokratismus, durch den Intellektualismus zerstört worden war innerhalb der Menschheitsentwickelung, es kann wieder aufleben. Denn alle Kunst wird aus dem musikalischen Elemente entspringen, wie die griechische Tragödie aus dem musikalischen Element entsprungen ist. Und Richard Wagner zeigt bereits die Morgenröte. Es wird also erstehen.
Ganz persönliche Angelegenheit und Erkenntnisfrage zugleich wird nun Nietzsches Verhältnis zu Richard Wagner. Und das Bedeutungsvolle in Nietzsches eigenem Seelen-leben ist, daß er dasjenige, was er anstrebt, nicht als seine Ideale hinstellt, daß er nicht sagt: das oder das müsse geschehen. Also nicht aus seiner Seele heraus lebt zunächst dasjenige, was er als zu verwirklichen für notwendig hält, sondern er blickt immer auf Richard Wagners Seele hin, und in der Art und Weise, wie sich Richard Wagner als Künstler darlebt, werden ihm zugleich die Antworten für das, was er als seine Erkenntnisfragen stellen muß. Das ist das Bedeutsame im Nietzscheschen Leben.
Und jetzt wird Nietzsche zum Kritiker seiner Zeit, zum
Kritiker, ich möchte sagen, desjenigen vor allem, was sich ihm im deutschen Geistesleben im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts darstellt. Und als solcher Kritiker verfaßt Nietzsche seine vier «Unzeitgemäßen Betrachtungen». Bs hätten viel mehr werden sollen. Aber aus Gründen, die sich in unseren Betrachtungen dann ergeben werden, blieb es bei vieren. In lebendiger Anschauung, an dem Wirken Richard Wagners, im Ergreifen dessen, was in Wagners Musik wirkte, sah Nietzsche das Hinauswirken des Menschen und seiner Seele über die bloße Natur, die Möglichkeit, wirklich etwas zu finden, auch wenn man beim sinnlichen Element stehen bleibt, etwas zu finden, was den Menschen hinausträgt über die bloße Natur. Und nun stand Nietzsche der Welt gegenüber mit dieser Überzeugung, daß der Mensch, wenn er sich nur tief genug unter dem bloßen intellektuellen Elemente versteht, wirklich zum Geistigen kommen kann. In dieser Empfindung wandte sich Nietzsche zu dem, was die Zeit nun hervorgebracht hatte. Da muß man fragen: Was fand Nietzsche zunächst? Er fand, wie die Zeit wirklich im Grunde genommen in alle dem, was sich nun als tonangebende Weltanschauung ausgebildet hatte, überwältigt worden war, wenn auch nicht im engeren Sinne, so im weiteren Sinne, vom Feuerbachianismus, von diesem Hinblicken auf das bloße Sinnliche und auf den Verstand, der an das Gehirn gebunden ist.
Gewiß, ich weiß sehr gut, es kann allerlei Philosophen geben, die da sagen: Ach, über den Materialismus ist ja die Philosophie längst hinaus. - Aber wenn man das auch vermeint, in der ganzen Art des Denkens, in den Denk-gewohnheiten steckt man auch heute noch tief darinnen. Und Nietzsche sah um sich, wie seine Zeit tief darinnen steckte. Und er wählte sich nun eine charakteristische Persönlichkeit heraus: David Friedrich Strauß - Strauß, der
auch ausgegangen war vom Hegelianismus, der vom Hegelianismus zu einer Weltanschauung gekommen war, die er dann in seinem «Alten und neuen Glauben» zum Ausdruck brachte, der vom Hegelianismus ganz und gar zu der materialistischen Färbung des Darwinismus übergetreten war, der in der äußeren Welt, einschließlich nun aber auch der Welt des Menschen, nichts anderes sah, als Natur-entwickelung, der da vermeinte, daß der Mensch, wenn er fest auf dem Boden des neueren Wissens stehe, im Grunde genommen kein Christ mehr sein könne, weil er die geistigen Vorstellungen nicht in sich aufnehmen dürfe, welche das Christentum von einem verlangt. Diesen David Friedrich Strauß nahm sich Nietzsche gewissermaßen vor. Doch Nietzsche ging nicht vor, wie ein Philosoph sonst unmittelbar vorgeht, sondern anders. Für Nietzsche war ja nicht zunächst das Bild der Natur da, nicht irgendeine wissenschaftliche Gedankengewohnheit, sondern für Nietzsche war da die Empfindung: Wenn in unmittelbar geistigem Leben die Weltanschauungs-Entwickelung fortgeht, dann wird sie so fortgehen, wie sie beginnt mit dem, was aus der Musik und aus der ganzen Kunst Richard Wagners hervorgegangen ist.
Wie steht nun neben dem, was da werden kann, wenn Richard Wagners Kunst die Geistesentwickelung durchdringt, wie steht neben dem so etwas, wie die von vielen für die einzig gültige neuere philosophische Anschauung angesehene Anschauung des David Friedrich Strauß? So mußte sich Nietzsche fragen. Er fragte sich nicht: Ist das oder jenes falsch bei Strauß, kann man das oder jenes widerlegen? Darum handelte es sich für Nietzsche gar nicht; sondern darum handelte es sich für Nietzsche, zu zeigen, welches seelisch-geistige Menschheitselement in einer solchen Weltanschauung wie in der Straußschen lebt, wie der Mensch
sein muß, der eine solche Weltanschauung hervorbringt, eine solche Weltanschauung, welche nur am Grob-Materiellen und Sinnlichen hängt. Wie muß der Mensch sein neben dem Geistesmenschen, neben dem Menschen, der in allem, was in ihm lebt und webt, den Geist wirken läßt, neben Richard Wagner, - wie muß der Mensch sein, der solchen Materialismus hervorbringt, wie David Friedrich Strauß? Philister muß er sein! Daß die Weltanschauung der neueren Zeit deshalb so materialistisch geworden ist, weil das Philister-Element sich in ihr ausgegossen hat, das wollte Friedrich Nietzsche zeigen in seiner unzeitgemäßen Betrachtung «David Friedrich Strauß, der Philister und Schriftsteller». Später hat er den Titel geändert in « . .. Bekenner und Schriftsteller».
Und so zeigt er denn überall, wie eine gewisse triviale Denkungsweise, wie triviale Denkgewohnheiten, wie philisterhaftes Wesen David Friedrich Strauß davon abhalten, in dem Sinnlichen zugleich das Geistige zu sehen. Und immer weiter verglich Friedrich Nietzsche das, was sich ihm an der Persönlichkeit Richard Wagners als lebendige Empfindung ergibt mit dem, was in der Zeitbildung da ist unter dem Einflusse der materialistischen Denkungsart. Und weiter fragt er sich: Welches Verhältnis besteht zwischen einem solch produktiven Menschen wie Richard Wagner, der die inneren Kräfte der Menschenseele an die Oberfläche seines Wirkens trägt, und dem, was in der fortlaufenden hochangesehenen und bewunderten Zeitbildung lebt? Und da findet Nietzsche: Diese Zeitbildung ist so geworden, daß sie nun nach und nach keucht und schwer atmet unter ihrer Fülle von äußerem Wissen, unter ihrer Fülle von Historie, von Geschichte. Man weiß gewissermaßen alles oder sucht wenigstens alles zu wissen, sucht alles Mögliche historisch auf. Man kann auf alle Fragen historisch Antwort
geben. Aber lebendig machen in sich dasjenige, was man da weiß, aus der Seele heraus Menschliches gebären, das wird gelähmt unter der Fülle des Historischen. Und so nagt der Mensch an dem, was er historisch aufnimmt - ob er es historisch aufnimmt aus der Geschichte oder der Naturwissenschaft, das ist schon ganz gleich -, so nagt der Mensch und erstickt an dem Historischen. Und indem er in sich hineinschoppt das Historische, bleibt ihm in den Untergründen des Daseins stecken, was aus ihm heraus sollte, was der Mensch frei als Geist aus sich herausbringen sollte. «Nutzen und Schaden der Historie für das Leben», das wird die zweite «Unzeitgemäße Betrachtung».
Und dann richtet Nietzsche seinen Blick auf Schopenhauer selber, auf einen Geist - wie Schopenhauer im Sinne Nietzsches es war -, der es dahin gebracht hatte, alles dasjenige, was äußerlich lebt, eben für bloßen Traum anzusehen, so weit für bloßen Traum anzusehen, daß für Schopenhauer die Geschichte selber nichts anderes ist als eine Summe von sich wiederholenden Lebensabspielungen, die nur einen Wert bekommen, wenn man dasjenige, was in ihnen und hinter ihnen sich auslebt, in Betracht zu ziehen vermag. Einen solchen Geist wie Schopenhauer, der ganz und gar die Größe des Menschen im Produktiven sehen muß, betrachtet Nietzsche als das Ideal eines Menschen. Wiederum vergleicht er die Zeit mit dem, was ein solches Menschheitsideal darstellt. Da zeigt sich ihm: Schauen wir diesen, jenen Menschen an, schauen wir den dritten, den vierten Menschen an - was sind sie alle, verglichen mit dem, was aus der Schopenhauerschen Philosophie heraus als der Vollmensch erscheinen könnte? Wie gesagt, man mag darüber Anschauungen haben, welche man will, ein Bekenner oder Gegner sein, darauf kommt es nicht an, sondern darauf, wie Schopenhauer auf Nietzsche wirkte. Was
sind die einzelnen Menschen, gerade die gelehrtesten, die wissendsten, was sind sie gegen eine solche menschliche Persönlichkeit, die dasjenige herauszugestalten suchte aus der Seele, was menschlich in ihrer Allseitigkeit lebte? Stück-werke des Lebens sind sie, und daher ist die ganze Kultur Stückwerk. Daß eine Erneuerung, eine Erfrischung der ganzen Kultur unter dem Einflusse dessen, was nun in der Schopenhauerschen Philosophie lebt an Vollmenschheit, sein kann und daß dies dringend notwendig ist, zeigt Nietzsche in der dritten seiner «Unzeitgemäßen Betrachtungen»: «Schopenhauer als Erzieher».
Dann aber, als die Feste von Bayreuth herannahten, da wollte er zunächst das Positive schildern. Auch «Schopenhauer als Erzieher» ist noch, wie die anderen beiden «Unzeitgemäßen Betrachtungen», der Kritik der Zeit gewidmet. Was aber durch den produktiven Menschen der Zeit gegeben werden kann, wie die Zeit erneuert werden soll, wie aus dem, was in des Menschen tiefsten Seelenuntergründen lebt, Neues in die Zeit einfließen muß, das erschien Nietzsche in der Kunst Richard Wagners. Die verstand nun wirklich das Sinnliche unmittelbar so zu ergreifen, daß es als ein Übersinnliches sich darstellte. «Richard Wagner in Bayreuth» - die vierte «Unzeitgemäße Betrachtung», 1876, sie sollte zeigen, was Wagner der Welt werden konnte.
Nun war für Nietzsches Seelenleben diese Schrift «Richard Wagner in Bayreuth» zu gleicher Zeit in gewisser Beziehung der Abschied von der Freundschaft mit Richard Wagner. Von da ab beginnt die Freundschaft schnell zu erkalten und im Grunde genommen bald aufzuhören.
Und nun nehmen wir wiederum die ganze Innerlichkeit von Nietzsches Seele, das ganze Schwere, das auf ihr lastete aus Weltanschauungsfragen heraus, und man nehme dazu, daß ja Richard Wagner etwas geworden ist wie der Inhalt
von Nietzsches Seele, wie dasjenige, auf das hin er sein ganzes Denken und Fühlen und Empfinden zugespitzt hat. Und er muß sich trennen von Richard Wagner! Und völlig wird die Trennung, als Richard Wagner seinen «Parsifal» schrieb. Wir haben mancherlei in den Nietzsche-Veröffentlichungen, das hinweisen soll auf den eigentlichen Grund, warum Nietzsche sich von Wagner getrennt hat. Nicht einmal die Worte, die von Nietzsche selber mitgeteilt werden über seine Trennung von Richard Wagner, scheinen mir dasjenige zu sein, das überzeugend wirkt. Denn eine so künstlerische Persönlichkeit, wie Friedrich Nietzsche war, eine Persönlichkeit, die auch alles Weltanschauungsleben von dem Künstlerischen durchdrungen fühlen mußte, eine solche Persönlichkeit kann doch eigentlich unmöglich den «Parsifal» als ein ihm ganz unsympathisches Kunstwerk aus dem Grunde ansehen, weil er glaubt, daß Richard Wagner vorher die heidnische Götterwelt, Siegfried und die anderen hingestellt habe, und nun, eine Art Gegenreformator, in das Christentum zurückgeschwenkt sei. Was Nietzsche als das Niederfallen vor dem Kreuz bezeichnet, und was ihm unsympathisch gewesen sein soll, erscheint nicht überzeugend, wenn man in die ganze Fülle sowohl des Wagnerschen wie des Nietzscheschen Geisteslebens hineinsieht. Denn schließlich käme das auf die triviale Anschauung hinaus: Friedrich Nietzsche hätte wegen des Inhaltes in «Parsifal» nicht mit dem Kunstwerk des «Parsifal» gehen können; aus einem Nicht-Übereinstimmen mit dem Theoretischen wäre er abgefallen. Es wäre eigentlich furchtbar, wenn man so denken müßte über den Abfall Friedrich Nietzsches von Richard Wagner. Da war etwas ganz anderes, etwas, das, wie ich glaube, nur gefunden werden kann, wenn man mit einer tiefer schürfenden Seelenkunde versucht, die eigentlichen Untergründe aufzufinden. Sie
können allerdings hier in diesem kurzen Vortrage nur skizziert werden.
Was war denn im Grunde Richard Wagner gelungen? Wir haben gesehen: Richard Wagner ist ausgegangen in seiner Grund-Seelenempfindung von dem Feuerbachianismus, ist übergegangen zu einer Empfindung der Schopenhauerschen Weltanschauung, ist aber eigentlich immer durchdrungen gewesen von dem Lebenselement des Musikalischen. Alles, was er auch theoretisch geschrieben hat, geht nur parallel diesem Musikalischen. Und in der Musik
- wenn ich mich trivial ausdrücken darf - ist von ihm der Weg bezeichnet, wie durch das Eindringen in das Sinnliche zugleich das Übersinnliche, das Geistige, gefunden werden kann. Aber ausgegangen war er auch davon, daß man auf dem Wege des Intellektuellen, ich möchte sagen, in jenem verdünnten menschlichen Geistesleben, das sich bei Fichte, Schelling und Hegel auslebte, nicht finden kann ein Wirkliches, nicht dasjenige, wonach der Wirklichkeitssinn dürstet. Da mußte man den ganzen, vollen Menschen hineinstellen, und als wirklich ergab sich im Grunde genommen nur der Sinnesmensch. Wir haben gesehen, wie nur die Musik das Sinnliche und das Übersinnliche zugleich gab. Der Mensch stand also für Richard Wagner doch in dem Mittelpunkt seiner Weltanschauung. Aber hineingedrungen werden mußte in alle Tiefen des Menschen. Und nach der ganzen Art der Seele Richard Wagners konnte Wagner nur musikalisch eindringen in diese Tiefen des Menschen. Musikalisch suchte er einzudringen - ich sage ganz absichtlich:
musikalisch suchte er einzudringen - in die Tiefen der Menschenseele im «Parsifal». Wir haben in der Tat in der Musik des «Parsifal» vor uns ein Musikalisches, das zeigt, wie der Mensch im Mittelpunkt, ich möchte sagen, einer anthroposophisch wirkenden Weltanschauung gedacht werden
kann, empfunden werden kann, gefühlt werden kann, so gefühlt werden kann, daß das Sinnliche, das Musikalische so geistig wird, daß es die feinsten, intimsten Seiten der menschlichen Seele ergreift. Denn das geschieht in der Lösung des Grals-Problems in «Parsifal».
Das konnte Richard Wagner nur erreichen, indem sich in seinem Empfindungsleben, das eben ganz von musikalischem Element durchdrungen war, der Fortschritt vollzogen hatte von Feuerbach durch Schopenhauer zum unmittelbaren Ergreifen dessen, was in der Menschlichkeit lebte, die unter dem bloßen intellektualistischen und abstrakten Seelenelemente vorhanden ist. Richard Wagner war auf seine Art und hauptsächlich doch als Musiker durchgedrungen zum geistigen Menschen in seinem «Parsifal».
Richard Wagner war für Nietzsche Erkenntnisobjekt. Nietzsche lebte eigentlich bis zum Jahre 1876 viel mehr in Richard Wagner als in sich selber. Dasjenige, was er erhoffte, erstrebte für die neuere Geistesentwickelung, in Richard Wagner schaute er es an. Nicht aus seiner Seele schöpfte er es wie ein Ideal heraus. Jugendlich begeistert, jugendlich genial war Nietzsche, als ihm Richard Wagner entgegentrat. Eine völlig schon in einem späteren Entwickelungsmomente lebende Welt- und Lebensanschauung trat ihm in Richard Wagner entgegen. Dasjenige, was Wagner durchgemacht hatte, um seine Seele hineinzubringen in ein solches Gefühl, das über den «Siegfried» zum «Parsifal» kommen konnte, das, was Richard Wagner da in seiner Seele erlebte, das Erschütternde, was da zu durchleben war, es war schon durchlebt, als Nietzsche Wagner näher trat. Das schon Ausgeglichene, das schon von Harmonie Erfüllte, das schon Zukunftverheißende trat Friedrich Nietzsche entgegen, als er Richard Wagner kennen lernte und, ich möchte sagen, zu seinem Erkenntnisobjekt machte. Nietzsche konnte
das voll aufnehmen, was Richard Wagner durchgemacht hatte in den fünfziger Jahren, zum Beispiel, als er Worte aufschrieb wie jenes, das er 1854 an Röckel geschrieben hat über sein tief leidendes Gefühl vom Wesen der Welt. Dieses tief leidende Gefühl vom Wesen der Welt, das mußte umgewandelt sein in innere Seelenkraft, in Aktivität. Und als Nietzsche in den sechziger Jahren Richard Wagner näher trat, da konnte er an Wagner dasjenige erleben, zu dem das Seelenleid geworden war. Er, Nietzsche, konnte es erleben schon im Glanze eines Hoffnung erstrahlenden Lichtes. Auch solche Worte, wie die 1852 an Uhlig geschriebenen, zeigen, wie Richard Wagner Leiden gekannt hat, die Nietzsche im Griechentum geahnt hat, die er, Nietzsche, aber nur angeschaut und in ihrer Ausgeglichenheit bei Richard Wagner beobachtet hat. Solche Worte, wie Wagner an Uhlig geschrieben, zeigen, wie Richard Wagner dieses Leid kennen gelernt hat, wie er, bevor er dazu gekommen ist, in der Menschenseele die Kraft zu ahnen, die hinführen kann zum Tempel des Grals, die hinführen kann zu der Siegfried-Energie, kennen gelernt hat vorher den Zweifel an allem kleinen Menschlichen, aus dem sich ja doch das große Menschliche erst heraufarbeiten muß. So schreibt Richard Wagner: «Überhaupt, lieber Freund, werden meine Ansichten über das Menschengeschlecht immer düsterer; meist glaube ich doch empfinden zu müssen, daß diese Gattung vollständig zu Grunde gehen muß.»
Man muß nur diesen Zusammenhang nehmen, um die intimsten Saiten des menschlichen Seelenwesens erklingen zu hören: Vor dem Helden, der «durch Mitleid wissend» zum Tempel des Grals dringt, liegt all das, was man an Menschenzweifel und Menschenleid erleben kann, wenn man gerade in einer materialistischen Zeit das anschaut, was rings um einen herum ist. Den Aufstieg also vom Leid
zur Betätigu7ng des Schöpferischen, Richard Wagner hat ihn durchgemacht. Und strahlend schon als Sieger stand er im Grunde genommen vor Nietzsche, als dieser ihn kennen lernte. Nietzsche aber als jugendlich genialer Mensch wußte verständnisvoll, empfindungsgemäß verständnisvoll anzuschauen diese sieghafte Natur.
Aber es ging Nietzsche so, daß die Jugendkraft, die in ihm lebte, sich aufzuschwingen vermochte zu dem, was ihm in Richard Wagner entgegentrat, nicht aber später die gereifte Kraft, die die jugendliche Begeisterung, die Weite der Empfindungen abgestreift hatte und jetzt aus sich selber heraus gestalten wollte. Richard Wagner hatte den Feuerbachianismus durchgemacht. Nietzsche hatte ihn nicht durchgemacht, Nietzsche hat nicht gelitten am Feuerbachianismus, Nietzsche hat nicht das Allzumenschliche zuerst kennen gelernt, bevor er das Hohe und Ideale und Spirituell-Menschliche bei Richard Wagner auf sich hat wirken lassen. Und das scheint mir der psychologische Grund zu sein, warum die Seele Friedrich Nietzsches nun in Feuerbachianismus, wenn wir ihn im weiteren Sinne nehmen, zurückfiel, überwältigt wurde.
Nun, als Friedrich Nietzsche nicht mehr mitgehen konnte, da fiel von ihm ab, was nur aus der Begeisterung stammte und was aus der tiefer verstehenden Kraft hätte kommen müssen. Abfallen mußte er und erst für sich das durchmachen, worin Richard Wagner bereits Sieger geworden war. Da trat denn jene zweite Periode im Nietzscheleben ein, die beginnt mit der Veröffentlichung der AphorismenSammlung «Menschliches-Allzumenschliches», die dann weitergeht über den «Wanderer und sein Schatten» zu «Morgenröte» und «Fröhliche Wissenschaft», wo Nietzsche versucht, zurecht zu kommen mit der naturwissenschaftlichen Weltanschauung, mit alledem innerhalb der naturwissenschaftlichen
Weltanschauung, was nun schon einmal in der neueren Zeit aus dieser Weltanschauung heraus Grund-lage sein muß für jede höhere philosophische Weltanschauung.
Und das ist nun das Tragische in Friedrich Nietzsches Seele, das furchtbar Tragische, daß er ein Größtes vorher in jugendlicher Begeisterung mitgemacht hat und nun, als er zu sich selbst kam, heruntersteigen mußte, gewissermaßen bewußt heruntersteigen mußte, um nach dem höchsten Menschlichen das Allzumenschliche in seinen Zusammenhängen mit den Naturtatsachen zu erkennen. Aber Nietzsche hatte in sich den Mut, diesen schweren Erkenntnisweg durchzumachen. Er hatte in sich den Mut, sich nun wirklich zu fragen: Ja, wie nimmt sich denn nun dieses Seelenleben aus, wenn wir es im Lichte der Naturwissenschaft betrachten? Wenn wir es im Lichte der Naturwissenschaft betrachten, da hat der Mensch Leidenschaften. Sie scheinen aus dem Untergrund seines Willens hervorzugehen, aber wenn wir näher nachforschen, so finden wir allerlei bloß physiologische Gründe, Gründe dieses Leibeslebens. Wir finden, daß der Mensch Begriffe und Ideen darlebt. Aber wir finden überall die mechanischen Ursachen für diese Ideen, Begriffe. Wir finden endlich im Menschenleben Ideale. Der Mensch sagt sich, diese Ideale seien etwas Göttliches. Wenn wir aber nachforschen, was der Mensch eigentlich ist, so gewahren wir, wie er aus seinem physiologischen Element, aus seinem Leibeselement heraus seine Ideale gebiert und sie sich nur umträumt in etwas, was ihm von den Göttern geschenkt sein soll. Da ist das, was der Mensch im Alltagsleben als seine aus dem Leib herausgeborenen Sehn-suchten empfindet, was aus dem Fleisch, aus dem Blut heraus geboren ist, was sich ihm als Ideale darstellt, was aber nicht aus höheren geistigen Welten stammt, sondern eben
wie der Schaum ist, der aus dem Leibesleben heraufsteigt, nicht höchstes Menschliches - Menschliches-Allzumenschliches.
Nietzsche mußte, nachdem er durchlebt hatte, was ihm das neunzehnte Jahrhundert in seiner zweiten Hälfte durch Schopenhauer und Richard Wagner hatte geben können, zu einer eigenen Anschauung seiner Seele machen, was ihm die Naturwissenschaft geben konnte, und er mußte namentlich durchmachen - seine Schrift, mit der er dieses sein Lebensalter beginnt, war Voltaire gewidmet -, er mußte durchmachen, was man nennen kann ein Hineinfallen in jene tote Wissenschaft, in die Wissenschaft vom Mechanismus, vom Toten gegenüber dem Lebendigen, das Fichte als die eigentlich deutsche Weltanschauung in Anspruch genommen hat. Von westlicher Weltanschauung wurde Nietzsche in der zweiten Periode seines Lebens überwältigt. Ganz und gar fand er sich in diese westliche Weltanschauung hinein. Aber sie wurde für ihn nicht nur eine Gedanken-empfindung; er konnte sie nicht aufnehmen wie ein westlicher Geist. Er nahm sie auf, nachdem er so lange in der urgermanischen, deutschen Weltanschauung gestanden hatte. Sie wurde für ihn so, daß zum Beispiel alle Perspektiven drinnen lagen, welche die Seelen-Materialisten später aus diesen Weltanschauungen herausgetrieben haben. Mit scharfem Geiste konnte Nietzsche nachweisen, wie all das, was Ideale genannt waren und was man von Gott geschenkt glaubt, aus den Bedürfnissen der Menschennatur heraus kommen konnte, die mit Fleisch und Blut zusammenhängen. Nietzsche drückt sich selber so aus: alle seine Ideale kämen ihm vor wie aufs Eis gelegt, kalt geworden, weil sie ihm aus dem Menschlichen-Allzumenschlichen hervorgehend erschienen. Wahrhaftig, was kleine Geister, was die Stumpflinge dann hervorgebracht haben, indem sie diesen Gang der
Nietzscheschen Weltanschauungsentwickelung bis zum Exzeß ausgebildet haben, das liegt bei Nietzsche schon veranlagt da, aber so, daß es bei Nietzsche genial ist, bei denjenigen, die dann darauf aufgebaut haben, das Gegenteil von genial ist. Man könnte sogar sagen: Der ganze Stumpfsinn der modernen Psychoanalyse liegt schon in Nietzsches zweiter Entwickelungsperiode mit alle dem, was man da aus der unmittelbar menschlichen Natur in seelen-materialistischer Weise herzuleiten versuchte. Kleine Geister, die sagen sich: Nun ja, das können wir erforschen, und die Wahrheit muß man hinnehmen. - So können kleine Geister es selbst hinnehmen, bei Schopenhauer zum Beispiel abzuleiten, daß alles Streben nach einer Weltanschauung, alles Streben nach geistigem Zusammenhang mit der Welt, das über die bloße tatsächliche Wissenschaft hinausgeht - ja, es ist nicht ein Märchen, das ich erzähle -, eine Folge der menschlichen Sexualität ist. So daß alle Philosophie für gewisse Geister der Gegenwart ihren Grund in der menschlichen Sexualität hat, denn alles geistige Streben beruhe in der menschlichen Sexualität. Selbstverständlich war Nietzsche, der die Urgrundlage, die berechtigte Urgrundlage für das Seelische im Physiologischen, im rein Natürlichen sah, zu genial und, ich möchte sagen, zu taktvoll, um über das Erkenntnismäßige hinauszugehen. Aber er mußte ja eineWeltanschauung nicht bloß ausbilden. Kleinere Geister sagen sich eben: Das ist Wahrheit, die muß man hinnehmen. So muß man auch als Wahrheit hinnehmen, daß Philosophie nur eine Folge der Sexualität ist. - Aber Nietzsche mußte vor allen Dingen erleben, auf das Fruchtbringende in der menschlichen Natur zu sehen, das unter dem Einfluß einer Wahrheit stehen kann. Erkenntnis als Lebensschicksal, das ist das Charakteristische in Nietzsches Seelentragödie.
Und so fing etwas an in Nietzsches Seele zu leben in
dieser zweiten Epoche seines Seelenlebens. Nietzsche war zu groß, um es weit kommen zu lassen, aber es wirkte fernerhin als ein Untergrund der Ekel vor einer bloß naturalistischen Seelenkunde, vor einer bloß naturalistischen Erklärung alles Moralischen, wie er es versucht hatte, der Ekel vor dem, was entstehen kann, wenn man auf diesem, doch auch so berechtigt erscheinenden, seelen-materialistisch erscheinendem Gebiet weitergeht, - der Ekel. Nun denke man sich das Tragische in einer solchen Seelenentwickelung, die erst der Menschheit ganzes fruchtbringendes Glück erlebt in Schopenhauer und Richard Wagner und dann durch die notwendige Entwickelung und den Zusammenhang mit dieser notwendigen Entwickelung der Zeit, wie sie Nietzsche selber hatte, dazu gezwungen wird, eine Weltanschauung in sich auszubilden, der gegenüber das Erlebnis beginnt, überall in dem Punkte des Seelenlebens Ekel-erlebend zu werden, und die Notwendigkeit, sich vor dem Lebens-Ekel nun zu retten.
Wir sind nun schon nahe an und in den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts mit Bezug auf das Seelen-leben Friedrich Nietzsches. Aus der naturwissenschaftlichen Weltanschauung heraus hatte er sich für sein Seelen-leben etwas gewonnen, was ihm den beginnenden Ekel zeigte mit all der Bitternis, mit der der Ekel also in der Seele tief innerlich walten kann. Und dasjenige, was Nietzsche in der «Fröhlichen Wissenschaft» auszusprechen versuchte, es ist ja nichts anderes im Grunde genommen als ein berauschtes Hinwegführen über den nicht zum Bewußtsein kommenden Ekel. Denn selbstverständlich, unter diesem Ekel leidet man, aber derlei Dinge bleiben im Unterbewußten. Es wird nicht ausgesprochen. Es wird etwas in der Seele ausgesprochen, was den Ekel verhüllt, was ihn überdeckt: «Fröhliche Wissenschaft» - in den Sätzen, in dem
ausgesprochenen Inhalte. Das, was ich also charakterisieren mußte als im Untergrunde der Seele liegend, das bildet dann den Übergang zu einer anderen Art von Weltbetrachtung, die jetzt Nietzsche weiter erleben mußte aus einer gewissen weitergehenden Vertiefung des naturwissenschaft-lichen Lebens des neunzehnten Jahrhunderts, wie er sie auch in das Erfassen des Seelenlebens hineintrug.
Und jetzt bildete sich etwas aus in Nietzsches Seele - von der man sagen kann: sie hat dieses Urgermanische, das in Richard Wagner, in Schopenhauer lebte, in sich aufgenommen, wie einen fortgehenden Trieb -, jetzt lebte sich in Nietzsche etwas Merkwürdiges aus. Jetzt kommt die letzte Periode seines Lebens, die dann zur Katastrophe führt. Und da wirkte in dieser Katastrophe - ohne daß man es merkt, wenn man nicht tiefer eingeht auf die Untergründe seines Seelenlebens -, jetzt wirkte zusammen dasjenige, was er sich geholt hatte aus der westlichen Philosophie, namentlich aus der französischen Moralphilosophie, aus Guyau, aus Stendhal, aber auch aus anderen, in die er sich ganz hineingefunden hatte, und was er aus diesen im Zusammenhang mit einem von ihm tiefer erfaßten Darwinismus gewonnen hatte, das wirkte zusammen mit dem osteuropäischen Element. Man kann die letzte Periode in Friedrich Nietzsche nicht verstehen, wenn man nicht in Erwägung zieht, wie in allen seinen Empfindungen, in allem, was er fühlte und dachte, dasselbe Element vorleuchtend wirkte, das zum Beispiel bei Dostojewski als psychologisches Element Dostojewskis Kunst durchdringt. Dieses Eigentümliche des russischen Ostens, daß im unmittelbar Natürlichen der ganze Mensch erfaßt wird, aber so, daß dieses unmittelbar Natürliche auch als Ausleben des Geistigen angeschaut, erfühlt wird, daß die Instinkte zugleich als geistig empfunden werden, daß dasjenige, was physiologisch lebt,
nicht so, wie im Westen und in Mitteleuropa, physiologisch empfunden wird, sondern seelisch empfunden wird, - das drängte sich jetzt in Nietzsche herein, in die Seele, auf die erschütternd sich niedergelassen hat dasjenige, was ich eben charakterisiert habe. In diese Seele drängte sich herein alles, was an Weltanschauungsrätseln vom Westen und vom Osten zusammenfloß. Im bloßen naturwissenschaftlich-physiologischen Seelenbetrachten konnte er das Allzumenschliche sehen. Da aber wäre es Ekel geworden, wenn er es weiter verfolgt hätte. Jetzt entnahm er eine Vertiefung aus der Betrachtung des menschlichen Lebens selber. Jetzt kam er eigentlich erst an das menschliche Leben heran, wo diese Betrachtung in ihm angeregt war, namentlich durch den Einfluß Dostojewskis.
Und nun entstand in ihm ein Drang, eine Sehnsucht nach einer geistigen Vertiefung dessen, was bloß in der Sinnen-welt sich darbietet. Und dieser Drang, diese Sehnsucht lebten sich bei ihm nun in dieser letzten Periode seines Lebens vermöge seiner Anlagen nur lyrisch aus. Und das hängt mit dem Unschöpferischen in Nietzsche zusammen. Er brauchte dasjenige, was auf ihn wirkte; das konnte er erleben. Schöpferische Geister konnten für ihn Objekt werden, wie Richard Wagner. Was die Weltanschauung seiner Zeit schuf, konnte für ihn Objekt werden. Was in der zweiten Periode seines Lebens, der Periode vom MenschlichenAllzumenschlichen und so weiter, aufzuckte und aufleuchtete wie Zukunfts-Seelenschöpfung, das trat jetzt in den Gesichtskreis der dritten Nietzscheschen Periode ein. Der Mensch wurde für ihn so, daß sich Nietzsche sagte: Dieser Mensch muß in den Mittelpunkt der Weltanschauung gerückt werden - aber etwa in dem Sinne, wie bei Troxler Anthroposophie auftritt im Sinne des Vortrages, den ich vor einigen Wochen hier halten konnte -: im Menschen
wollte er einen höheren Menschen suchen. Er hätte ihn finden können, wäre Nietzsche das gewesen, was man nennen könnte eine episch-dramatische Natur. Ist jemand eine episch-dramatische Natur, kann er aus sich herausgehen zur Anschauung des Geistes, dann entwickelt er die geistige Welt, dann stellt er sie hin. Das war Nietzsche nicht, Nietzsche war eine lyrische Natur. Damit dasjenige leben konnte, was in ihm Sehnsucht war, was in ihm Drang und Trieb war, brauchte Nietzsche etwas, was ihm in der Außenwelt entgegentrat. Es kam nicht aus seiner Seele eine geistige Welt herauf. Und so konnte denn, als er den höheren Menschen im Menschen suchte, dieser Mensch nur, ich möchte sagen, in seinem Lyrismus entstehen, denn der Lyrismus, das lyrische Element, das ist das Grundelement des Werkes «Also sprach Zarathustra», wo Nietzsche darstellen wollte, wie die Natur allerdings aus ihrem bloß Natürlichen heraufkommt zum Menschen, wie aber der Mensch über die Natur hinausgehen kann zum Übermenschen, wie der Mensch Übermensch werden kann dadurch, daß er die Entwickelung der Natur fortsetzt. Aber weil Nietzsche in seiner ganzen Seele nur lyrisch war, entstand dieser Über-mensch in ihm als Sehnsucht. Und im Grunde genommen -gehen Sie durch all dasjenige, was einem in dem lyrisch so großen, so gewaltigen Werke «Also sprach Zarathustra» entgegentritt, es ist nirgends der Übermensch zu ergreifen. Wo lebt er denn? Wo tritt er uns irgendwie gestaltet entgegen? Wo tritt uns irgendwie etwas entgegen, was als ein höherer Mensch im Menschen lebte und den Menschen über die Natur hinausführen könnte? Wo tritt uns irgendwo etwas entgegen, was ihn schildern würde? Überall treten uns entgegen lyrisch gestaltete Sehnsuchten' überall tritt uns entgegen großer, gewaltiger Lyrismus, aber nirgends irgend etwas, was man sozusagen geistig anfassen kann.
So viel wie ein unbestimmtes, nebelhaftes Bild eines Übermenschen konnte Nietzsche entgegentreten jetzt in der dritten Periode seines Lebens.
Und ein weiteres Nebelhaftes. Nietzsche konnte sich sagen: Betrachte ich dieses menschliche Leben, dann stellt es sich mir so dar, daß ich es erleben muß als gebildet aus gewissen Voraussetzungen heraus. Aber es muß Voraussetzungen in sich tragen, die allem wirklichen Natur- und Geist-Gestalten entsprechen. Und es lebte schon in Nietzsche der Gedanke: Die Pflanze entwickelt sich von der Wurzel bis zur Blüte und Frucht, und in der Frucht der Keim; und der Keim ist wieder Ausgangspunkt für die Wurzel, und aus der Wurzel kommt wieder die Pflanze. Ein Kreislauf, ein Werden, das sich rhythmisch vollzieht, das zu sich zurückkehrt: Ewige Wiederkehr auch des Men-schendaseins ist die Idee, die in Nietzsche entsteht. Aber wo ist dasjenige - was nun wiederum einer episch-dramatischen Natur aufgehen könnte - enthalten, das im gegenwärtigen Menschenleben wirklich das Geistig-Seelische als Kern oder Keim zeigt, als etwas, das sich in einem späteren Erden-leben wiederholen würde? Abstrakte ewige Wiederkehr tritt bei Nietzsche auf, aber nicht ein konkretes Ergreifen des wirklich Geistig-Seelischen im Menschen. Sehnsucht nach dem, was über den sinnlichen Menschen hinauswirkend sich gestalten kann, Sehnsucht nach jenem Rhythmus des Lebens, der in den wiederkehrenden Erdenleben auftritt, aber Unvermögen, in diese großen Geheimnisse des Daseins hineinzuschauen: die dritte Periode der Nietzscheschen Wirksamkeit.
Die erste Periode gibt ihm für seine Sehnsuchten und Hoffnungen, für seinen Erkenntnisdrang einen Menschen, den er vor sich hinstellen kann. Dieser Mensch wird ihm zuletzt so, ich möchte sagen, wie die Geheimnisse der Natur
für den Betrachter werden können. Man dringt so weit, als man selber die Anlagen dessen, was man suchen will, in sich hat. Weiter kann man nicht gehen. So konnte Nietzsche in Richard Wagner hineindringen, so weit Nietzsche selber die Anlagen zu Richard Wagners Welt- und Lebensgestaltung in sich trug. Ein Mensch in der ersten Periode seines Lebens, die Wissenschaft der Gegenwart in der zweiten Periode seines Lebens, die jetzt seine Hoffnungen, seine Sehnsuchten stillen soll. Dasjenige, was für die Zukunft bereit liegt in der Gegenwart an geistigen Keimen, in einer Geisteswissenschaft, wie wir sie heute denken, muß sich daraus herausentwickeln, daß man allgemein einsieht: In dem sinnlichen Menschen liegt der höhere Geistesmensch' in dem einen Erdenleben liegt die Folge früherer Erden-leben und der Ausgangspunkt späterer Erdenleben, desjenigen, was jetzt noch nicht da ist, was also nur als unbestimmt, als nebulos wirken kann. Nietzsche muß auch das durchleben: einen Gegenwartsmenschen' der ihm als Vollmensch entgegentritt; die Naturwissenschaft, an der sich der Wirklichkeitsdurst der neueren Zeit befriedigt; die unbestimmten Sehnsuchten der Zeit selber, die er noch nicht zu gestalten vermag.
Das sind die aufeinanderfolgenden äußeren Tatsachen, die Friedrich Nietzsche entgegentreten, entgegentreten mußten in demjenigen Zeitalter, das gewissermaßen innerhalb der deutschen Geistesentwickelung Atem schöpfen wollte, nachdem die intellektualistische Entwickelung auf einem Höhepunkt angekommen war, auf einem solchen Punkt, wo die Gedanken wirklich mystisch hineingelangen in die geistige Welt. Denn es ist eine Schopenhauersche, es ist eine Nietzschesche, es ist eine Täuschung aller derjenigen, die sich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts dieser Täuschung hingaben, daß die Hegelschen Gedanken
nur intellektualistisch gewesen seien. Aber der Glaube mußte entstehen, weil man die Weite des Atmens nicht hatte, um sich zu der Höhe und Energie der Hegelschen Weltanschauung emporzutragen. Aber dieses Atem-holen mußte ja entstehen aus dem einfachen Grunde, weil Hegel und die anderen Geister, die zu ihm gehören, zwar zu übersinnlichen Begriffen aufgestiegen waren, in diesen übersinnlichen Begriffen aber nichts Übersinnliches darin ist. Nehmen Sie die ganze Hegelsche Philosophie durch: sie ist entschieden durch übersinnliche Begriffe entstanden. Sie besteht aus drei Teilen: einer Logik, die aus übersinnlichen Begriffen besteht, einer Naturphilo sophie, einer Geistphilosophie, die aber die menschliche Seele nur umfaßt, sofern sie zwischen Geburt und Tod steht, dasjenige, was sich im Stofflichen und so weiter auslebt. Kurz, das Geistige in der Erkenntnis wird nur angewendet auf das, was in der sinnlichen Welt um uns ist. Die übersinnliche Erkenntnis ist da. Aber die übersinnliche Erkenntnis erkennt nichts Über-sinnliches. Daher mußte diese übersinnliche Erkenntnis, die nichts Übersinnliches erkennt, in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts dazu führen, daß man sie sozusagen als völlig unbefriedigend bezeichnete und sich an die sinnliche Welt selber wandte, und daß das musikalische Element eintreten konnte, die Brücke schaffen konnte herüber zu derjenigen Zeit, die nun aus Geistigem, unmittelbar durch Geist-Erkenntnis selber den Weg, von dem wir morgen wiederum im Spezielleren sprechen werden, zu erfassen versucht. Das ist das Bedeutungsvolle für das Geistesleben in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und bis in unsere Tage herein. An der zu Grunde gehenden übersinnlichen Erkenntnis und an der Überwältigung der menschlichen Seele durch die bloße sinnliche Erkenntnis, an dem Sich-Anklammern an dasjenige, was nun wie ein Ersatz
hereintrat aus einer ganz anderen Welt, entstanden Nietzsdies erschütternde Seelenerlebnisse.
Wie eine tiefe Seele in einer Zeit, die in den tonangeben-den Weltansehauungsströmungen keine Tiefe hatte, tra-gisch leiden mußte, das zeigt sich an Nietzsches Seele, und das ist im Grunde genommen die Tragödie, die sich durch Nietzsches Seele abgespielt hat: das Streben nach der Tiefe, nach einem Erleben in der Tiefe, die hätte da sein müssen, wenn Nietzsche zur Befriedigung hätte kommen sollen, die nicht da war und die endlich Nietzsches Geist in die völlige Verzweiflung hineinstürzte. Auf die physiologischen und medizinischen Untergründe seiner Krankheit brauche ich nicht einzugehen, aber dasjenige, was sich in seiner Seele abspielte, ist wenigstens mit seinen Hauptstrichen in dem charakterisiert, was ich versuchte zu charakterisieren. Und so sehen wir denn, wie dieses Weltanschauungsleben, das so überwältigt wird von der Strömung des Materialismus, auf eine über den Materialismus durch ihre Anlagen hinausstrebende Seele wirkt; wie tragisch bei einem tieferen Bedürfnis der Menschenseele der bloße Materialismus oder der bloße Positivismus oder überhaupt dasjenige wirken muß, was die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts einer solchen Seele bringen konnte. Deshalb wirkt es so tragisch, wenn man sieht, wie Nietzsche im Ausgangspunkte seiner Schriftstellerlaufbahn, als er, anknüpfend an die große Persönlichkeit Richard Wagners, seine «Geburt der Tragödie» schreibt, einträgt in das Exemplar, das er Richard Wagner selber überschicht: «Schaff das Tagewerk meiner Hände großer Geist, daß ich's vollende!» Den großen Geist der Welt fleht Nietzsche in dem intimen Widmungsspruche an, den er an Richard Wagner richtet, daß er ihm ein Tagewerk überliefere, an dem er erleben kann, was seine Seele erleben will, und durch das er der Menschheit
schildern kann, wie man den Geist erlebt in dem sinnlichen Erdenleben, wie der Mensch über das bloß Natürliche hinaus seine Seele führt, damit er auch den Weg in das Geistige hinein finden könne. Die Erfüllung der Tragödie mußte dadurch kommen, daß das neunzehnte Jahrhundert Nietzsche nicht geben konnte, was er vom großen Geiste erfleht hatte. Das Tagewerk seiner Hände konnte ihm der Geist nicht liefern. Dieser Geist des neunzehnten Jahrhunderts konnte es nicht liefern, und so konnte es von ihm auch nicht vollendet werden.
So haben wir denn gerade in dem, was Nietzsche später, namentlich am Schlusse seines bewußten Erdenlebens, bevor sein Leben in Umnachtung überging, geschaffen hat, Brocken, einzelne Ausführungen, Aphorismen, Entwürfe, Notizen aus und über Weltanschauungsfragen. Aber wir haben überall im Grunde genommen Ansätze, Fragen, Rätsel, die sphinxartig hineinschauen in die geistige Menschheitszukunft. Das darf man sagen gegenüber der Tatsache, daß auch Nietzsche unter denjenigen Geistern ist, die jetzt von Mitteleuropas Feinden so verketzert werden: In Friedrich Nietzsches Seele lebten Fragen, lebten Weltanschauungs-rätsel auf unmittelbar persönliche Art, die hinüberleuchten werden - ob im Zusammenhang mit der Persönlichkeit Friedrich Nietzsches oder von ihr abgetrennt, weil sie ja Friedrich Nietzsche auch nur aus dem treulich miterlebten Weltanschauungsleben des neunzehnten Jahrhunderts entnahm -, die hinüberleuchten werden nicht nur in die deutsche Geistesentwickelung, sondern in die gesamte geistige Menschheitsentwichelung einer vielleicht noch fernen Zukunft und die befriedigende Antworten finden werden, doch erst dann, wenn man - was Nietzsche noch nicht voll konnte - empfindend voll verstehen wird den tiefsten Sinn dessen, was Goethe meinte, als er den Spruch eines alten
Geistesforschers anführte, in dem darauf hingewiesen werden soll, daß der Mensch in die Tiefe der Welt wohl eindringen kann, daß er aber erst lebendig schöpferisch in sich durch Selbsterkenntnis diese Tiefe finden muß, ja, in sich gestalten muß. Nietzsche war auf diesem Wege in der Betrachtung Richard Wagners, konnte aber diesen Weg nicht zu Ende gehen. Dieser Weg wird immer wieder und wiederum die Wahrheit dieses von Goethe einem alten Gei-stesforscher zugeschriebenen Spruches erweisen, durch den Goethe zum Ausdruck bringen will, daß wir jede Tiefe, jede unendliche Tiefe in den Dingen der Welt finden können, wenn wir zunächst die Vertiefung in der eigenen Selbsterkenntnis gewonnen haben. Goethe drückt es aus in den Worten, mit denen wir diese Betrachtung heute abschließen wollen:
Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das Licht erblicken?
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken?
Jawohl, nur so viel Licht sieht der Mensch in der We]t' als er in sich anzufachen vermag. Nur so viel Göttliches findet der Mensch in der Welt, als er in sich selber durch Selbsterkenntnis zu gestalten vermag.
DIE UNSTERBLICHKEITSFRAGE UND DIE GEISTESFORSCHUNG Berlin, 24. März 1916
Die Lage eines Mensehen, der aus geisteswissenschaftlicher Grundlage heraus etwas sagen will über das seelische Wesen des Menschen, insofern dieses als unsterblich zu bezeichnen ist, wird vielleicht für eine schon sehr lange währende Zeit dadurch charakterisiert, daß ich über das Erscheinen eines Buches einleitungsweise spreche. Dieses Buch trägt den Titel «Athanasia oder die Gründe für die Unsterblichkeit der Seele».
Ich bemerke ausdrücklich, um nicht mißverstanden zu werden, daß die heutige Geistesforschung dieses Buch nicht als ein solches betrachten kann, welches aus dem Sinn dieser Geistesforschung heraus geschrieben ist. Geistesforschung im heutigen Sinne gab es dazumal noch nicht, wie aus vielen Vorträgen, die ich hier gehalten habe, hinlänglich hervorgehen konnte. Allein ich möchte sagen, für das Schicksal, welches alle diejenigen Auseinandersetzungen haben seit langer Zeit, welche hindrängen zu dem, was sich heute als Geisteswissenschaft ausbilden will, ist doch dasjenige, was sich mit dem Erscheinen dieses Buches abgespielt hat, wie ich glaube, nicht ohne Bedeutung. Also 1827 erscheint ein Buch «Athanasia oder die Gründe für die Unsterblichkeit der Seele». Derjenige, der dieses Buch herausgegeben hat, schreibt dazu eine merkwürdige Einleitung, ein merkwürdiges Vorwort, wie man sagt. Er schreibt, daß er bei einem sterbenden Menschen war und an seinem Bette das Manuskript
dieses Buches gefunden habe, daß er dann dieses Manuskript mit Einwilligung des Sterbenden übernommen habe, daß ihm nicht mehr so recht gesagt werden konnte, woher der Sterbende dieses Buch habe, das anscheinend für ihn, diesen Sterbenden, in den letzten Zeiten seines Lebens eine große, eine tiefgehende Seelenbedeutung hatte. Dann habe derjenige, der also das Buch herausgibt, gewartet, weil ihm der Inhalt so bedeutend vorkam, so wichtiges zu enthalten schien über der Seele Leben nach der Ablösung des physischen Leibes, daß er sich gar nicht denken konnte, daß dieses Buch nicht bestimmt sein werde, seinen Inhalt weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Da er aber, nachdem er lange genug gewartet habe, von nirgendwoher eine Veröffentlichung des Inhaltes erlebt habe, so unternehme er es jetzt selbst, dieses Buch zu veröffentlichen.
Was kann uns die berechtigte Forschung über die Entstehung dieses Buches nun sagen? Es liegt da die merkwürdige Tatsache vor, daß derjenige, der dieses Buch herausgegeben hat, mit dieser Vorrede, in der er ein so merkwürdiges Schicksal dieses Buches erzählt, dieses Buch selbst verfaßt hat, von Anfang bis zum Ende geschrieben und ohne seinen Namen veröffentlicht hat; daß er nur notig fand, wenn man so sagen darf - im allerbesten Sinne des Wortes ist es gemeint -, ein solches Märchen über das Buch zu erfinden, wie es eben angeführt worden ist. Es wird einem etwas erklärlicher, warum der Schreiber dieses Buches zu diesem Märchen gegriffen hat, wenn man weiß, daß er eine damals in weitesten philosophischen Kreisen bekannte Persönlichkeit war, ein Philosoph, der die tiefgehendsten Fragen des philosophischen Denkens behandelt hat: der Prager Philosoph Bernard Bolzano, der eine große Schülerzahl hatte, Schüler, die durch viele Jahrzehnte namentlich an österreichischen Universitäten wirkten, die
immer gestanden, welch tiefgehenden Einfluß sie aus den Lehren Bolzanos geschöpft haben. Also ein berühmter, eindringlich wirkender Philosoph, Bernard Bolzano, veröffentlicht ein Buch, in dem er über die Gründe für die Unsterblichkeit der Menschenseele spricht, und muß mit diesem Buch in der geschilderten Weise nach seiner eigenen Anschauung vor die Offentlichkeit treten. Warum hat er das getan? Nun, die Gründe sind ja sehr einleuchtend. In diesem Buche wird nicht nur gesprochen in der Weise, wie oftmals in philosophischen Schriften gesprochen wird, daß aus diesen oder jenen Gründen, die sich der menschlichen Logik ergeben, die Menschenseele unsterblich sei, sondern in diesem Buche wird davon gesprochen, wie der Mensch in sich ein Wesen findet, welches sich zwischen Geburt und Tod vervollkommnen könne, sich vervollkommnet in bezug auf sein Denken, vervollkommnet in bezug auf sein Fühlen, vervollkommnet in bezug auf sein Wollen; wie dieses Wesen, wenn es von den Menschen richtig erfaßt wird, aber zeigt, daß es nicht nur diejenigen Kräfte in sich trägt, die zu seiner Vervollkommnung führen bis zum Tode hin, sondern daß es Kräfte in sich trägt, welche dieses Seelenwesen weiter vervollkommnen, weiter ausbilden, welche weiter mit Inhalt erfüllt werden können, auch wenn das Menschenwesen durch die Pforte des Todes gegangen ist. Dann wird in diesem Buche auseinandergesetzt, wie man sich vorstellen müsse, wenn man also die menschliche Seele erfaßt, daß die menschliche Seele in einer gewissen Umgebung leben müsse, wenn sie durch die Pforte des Todes geschritten ist. Es wird auch angedeutet, wie diese menschliche Seele mit anderen geistigen Wesenheiten, die nicht wahrgenommen werden können, solange der Mensch im Leibe weilt, nach ihrem Tode verkehrt. Es wird angedeutet, welche Beziehung die menschliche Seele haben kann, nachdem
sie durch die Pforte des Todes gegangen ist, zu den zurückgebliebenen Angehörigen und Freunden, zu den ihr in Liebe zugetanen Seelen. Über alle diese Einzelheiten der durch die Pforte des Todes durchgegangenen Seele wird, wie gesagt, nicht vom Standpunkte der heutigen Geisteswissenschaft aus, sondern mit feinen, zartsinnigen Gründen gesprochen, die sich ein Philosoph ausgebildet hat, der nicht nur mit abstrakten Begriffen philosophiert, sondern der mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Menschenwesen dabei ist, wenn er sich Gedanken ausbildet, namentlich die Gedanken über jenes Weben und Wesen in dem Menschen selber, das wir das Seelische nennen. Aber Bolzano wußte zu gut: Solange man Logiker bleibt und auseinandersetzt, wie ein Begriff sich zu dem anderen gesellt, welche logischen Gründe es gibt für die Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit eines Urteils, solange man auseinandersetzt, wie die Aufmerksamkeit sich in der menschlichen Seele bildet, eventuell noch die Gründe für das Gedächtnis, für das Wollen, kurz, solange man alles das ausspricht, was die Seele ausführt, solange sie im Leibe weilt, solange kann man den Ruf eines wissenschaftlichen Philosophen haben. Spricht man aber über die menschliche Seele so, wie Bolzano in seiner «Athanasia» gesprochen hat, dann ist es fertig mit diesem Ruf als Philosoph. Dann ist man ein unwissenschaftlicher Mensch. Dann ist man ein Mensch, der allerlei Zeug daherredet, der nicht mehr ernst genommen werden kann von denen, die wissenschaftlich zu denken verstehen. Auch wer nicht wissenschaftlich denken gelernt hat, aber auf die Autorität derjenigen schwört, von denen er gehört hat oder von denen es öffentlich festgestellt ist, daß sie wissenschaftlich denken können, glaubt dann, daß er mit aller Gründlichkeit absprechen könne über den wissenschaftlichen Wert einer solchen Persönlichkeit. Wollte
Bolzano seinen Ruf als Philosoph retten, dann mußte er das geschilderte Manöver machen, dann mußte er den nachher kommenden Forschern überlassen, zu erkennen, wie das Buch von ihm selbst stammt. Und kein Bolzano-Kenner bezweifelt heute, und zwar aus den allerbesten Gründen, die äußerlich wissenschaftlich, geschichtlich nachgewiesen werden können, daß das betreffende Buch von Bolzano selber ist. Man sieht daraus etwas, das damals gegolten hat, das auch heute gilt: Man muß, wenn man offen und frei-mütig eintreten will für dasjenige, was nicht der physisch-sinnlichen Welt angehört oder sich über die physisch-sinnliche Welt sagen läßt, gewissermaßen sich schon aussetzen dem, daß man als ein ganz unwissenschaftlicher Mensch angesehen wird. Und da gilt in der Regel auch nicht die Tatsache, daß man etwa aus der Art und Weise, wie über solche Dinge gesprochen wird, erkennen könne, daß der Betreffende, der spricht, kein unwissenschaftlicher Mensch sei.
Und dennoch, so wie Geisteswissenschaft heute gerade über die Unsterblichkeitsfrage zu sprechen hat, so ist dieses Sprechen, wie ich hier oftmals schon betont habe, in vollstem Sinne eine Fortsetzung derjenigen menschlichen Geistesarbeit, die gerade auf naturwissenschaftlichem Gebiet zu so großen, jedenfalls von der Geisteswissenschaft voll anzuerkennenden Ergebnissen des menschlichen Lebens und Strebens geführt hat.
Deshalb möchte ich heute zunächst einiges von dem andeuten, das zeigen kann, wie die Inangriffnahme der Unsterblichkeitsfrage von der Geistesforschung aus so unternommen wird, daß in der Tat alles, was heute in diesem Sinne als Geistesforschung bezeichnet werden kann, die direkte, die unmittelbare Fortsetzung dessen ist, was natur-wissenschaftliches Denken als Beitrag zu einer Weltanschauung
im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts und bis heute gebracht hat.
In meinem Buche «Die Rätsel der Philosophie» finden Sie ein Kapitel, das überschrieben ist «Die Welt als Illusion». In diesem Kapitel will nicht ausgeführt werden, daß man wirklich die Welt, so wie sie sich darbietet den äußeren Sinnen und dem Menschendenken, das an das Gehirn gebunden ist, etwa als eine Illusion anzusehen hätte, aber es wird in diesem Kapitel gezeigt, wie viele gerade auf dem Boden der Naturwissenschaft stehende Denker des neunzehnten Jahrhunderts dahin gekommen sind, alles, was zunächst die Sinne wahrnehmen, und dann selbstverständlich auch, was das Denken über die Wahrnehmung der Sinne auszusagen hat, nicht von außen hereinfließt in die menschliche Seele, sondern gewissermaßen von der menschlichen Seele innerlich erst aufgebaut wird. Soweit es in populärer Art geschehen kann, möchte ich auf diese Gedanken, trotzdem sie sehr vielen der verehrten Zuhörer ferne liegen werden, doch einleitungsweise eingehen.
Wir sehen mit unseren Augen, wir hören mit unseren Ohren, wir nehmen die Welt mit unseren Sinnesorganen überhaupt wahr. Nun sagt derjenige, der gerade auf dem Boden der neueren Naturwissenschaft, der neueren physiologischen Forschung steht: Dasjenige, was die Sinne wahrnehmen, entsteht eigentlich erst durch eine Wechselwirkung der Sinne mit etwas ganz Unbekanntem in der Außenwelt. Der Forscher sagt da: Wenn das Auge eine Farbe wahrnimmt, wenn das Auge irgend einen Lichteindruck empfängt, so muß man sich doch überlegen, daß dasjenige, was außen auf das Auge wirkt, der Wahrnehmung ganz unbekannt bleibt. Der Mensch erlebt mit seiner Seele nur die Wirkung, welche das Äußere auf seine Seele ausübt. Daher kommt es, daß wir, wenn wir im gewöhnlichen
Leben durch die Welt gehen, die Dinge farbig, die Dinge als Ausdruck ihrer Lichtwirkungen sehen. Aber wenn wir zum Beispiel einen Schlag auf das Auge ausüben, so können wir ebenfalls einen, wenn auch unbestimmten Lichteindruck im Auge haben. Oder wenn wir in irgend einer Weise sonst dasjenige, was innerlich im Auge vorgehen kann, hervorrufen können, sagen wir irgendwie mit einer elektrischen Vorrichtung, so bekommen wir auch einen Lichteindruck. Das heißt das Auge antwortet allem, was von außen auf es wirkt, mit einem Lichteindruck. Es kann also da draußen vorkommen was immer, wenn das, was da draußen vorkommt, irgendwie auf das Auge einwirkt, so entsteht im Auge ein Lichteindruck. Das Auge schafft den Lichteindruck aus der Wirkung einer völlig unbekannten Außenwelt. Ebenso ist es mit dem Ohr. Ebenso ist es mit den anderen Sinnen. Daher stimmt zum Beispiel der Philosoph Lotze, ein hervorragender Philosoph des neunzehnten Jahrhunderts, Schopenhauer vollständig zu, indem er sagt: Alles, was wir als Lichtwirkung, als Farbe wahrnehmen, ist eigentlich erst durch die Wirkung einer unbekannten Welt in unserem Auge entstanden. Was wir als Töne hören, ist durch die Wirkung einer unbekannten Welt im Ohr entstanden. Wären nicht die Menschen da, die Augen und Ohren haben, so wäre die Welt finster und stumm, und man könnte niemals sagen, daß in dieser finsteren und stummen, unbekannten Welt irgend etwas waltet, was ähnlich wäre dem, was Augen sehen, Ohren hören.
Mit anderen Worten: Man ist ja im neunzehnten Jahrhundert unter dem Einfluß der Kantschen Philosophie darauf gekommen, daß der Mensch, damit er sich Erkenntnisse, Wahrnehmungen von dieser Umwelt verschaffen könne, eine innerliche Tätigkeit ausüben müsse, und daß durch diese innere Tätigkeit erst dasjenige, was er seine Umwelt
nennt, im Bilde entsteht. Man kann dann in Wirklichkeit davon sprechen, daß gerade für diese Leute, die als echte Denker auf dem Boden der Naturwissenschaft stehen, die Welt wie eine Illusion ist. Denn wenn da draußen, wo wir hier Säulen, wo wir allerlei Bilder an den Wänden sehen, etwas völlig Unbekanntes ist, das auf das Auge wirkt und woraus das Auge Farben und Formen schafft, so kann man nur sagen: Das, was da als unsere Umwelt uns erscheint, ist Bild, aus der eigenen Wesenheit des Menschen heraus geschaffen. Und was dahinter ist, kann allenfalls durch Hypothese konstruiert werden, wie es die neuere Physik tut, die allerlei Schwingungen im Äther und dergleichen hinter den Wahrnehmungen annimmt. So daß der Mensch, indem er durch die Welt geht, in Wechselwirkung mit einer unbekannten Außenwelt, einfach durch die Einrichtung seines Wesens, das, was er seine Welt nennt, sich selber aufbaut.
So genommen, wie es jetzt eben auseinandergesetzt worden ist, ist gegen diesen Gedankengang gar nichts, aber auch gar nichts einzuwenden. Dieser Gedankengang entspricht vollständig allem, was naturwissenschaftliche Forschung im neunzehnten Jahrhundert geliefert hat. Man kann sagen: Durchaus begreiflich ist ein solcher Ausspruch wie derjenige, den Hermann Helmholtz getan hat, der berühmte Physiologe und Physiker: Indem der Mensch eine Außenwelt wahrnimmt, nimmt er nicht wahr, was ist, was sich wirklich abspielt, sondern er nimmt nur Zeichen wahr. Nicht einmal Bilder, sagt Helmholtz, nimmt man wahr von dem, was wirklich ist, sondern nur Zeichen. Denn dasjenige, was unsere Augen und Ohren erschaffen von der Außenwelt, sind nur Zeichen für die Außenwelt. Wie gesagt, nichts ist gegen den Ernst und gegen die Logik dieses Gedankenganges irgendwie einzuwenden. Unmittelbar die Dinge genommen, wie sie sich darbieten, ist das so.
Man muß schon viel, viel tiefer in das Wesen des Menschen eingehen, wenn man wissen will, was hinter diesem Gedankengang eigentlich ist. Ich habe versucht, gerade das auch für die philosophische Welt zu zeigen, was hinter diesem Gedankengang ist und wie er die Möglichkeit bietet, daß man sich mit ihm zurechtfinde gegenüber dem menschlichen Wirklichkeitsbegriff. Ich habe den Versuch gemacht, den Weg dazu zu zeigen in einem Vortrag, den ich auf dem letzten Philosophenkongreß gehalten habe. Aber mit diesen Auseinandersetzungen begegnet man heute nur allgemeinen Mißverständnissen, wenn nicht etwas viel Schlimmerem. Derjenige, der die Aufgabe hat, sich in dem eben dargelegten Gedankengang zurechtzufinden, der muß eben zur Geisteswissenschaft vorschreiten. Und dann zeigt sich allerdings, daß man wirklich sagen kann: Die menschliche Seele erschafft, indem sie durch die Sinne wahrnimmt, dasjenige, was sie zunächst als ihre Welt bezeidinen muß. Sie schafft dieses. Sie schafft es wirklich. Aber warum schafft sie es, trotzdem das Schaffen im Wirklichen waltet? Nun, sie schafft es aus dem Grunde, weil die Menschenseele, das, was Menschenseele ist, mit dem Menschen nicht so zusammenhängt, daß man sagen kann: Da ist der menschliche Leib, und in diesem menschlichen Leibe wohnt die unsterbliche Seele drinnen, so wie irgend ein Mensch in seiner Wohnung wohnt und von seiner Wohnung aus die Außenwelt in irgend einer Weise beeinflußt oder durch Fenster die Außenwelt ansieht. Der Zusammenhang der Menschen-seele mit dem menschlichen Leibe muß eben ganz anders vorgestellt werden. Er muß so vorgestellt werden, daß gewissermaßen der Leib selber die Seele durch einen Erkenntnisprozeß in sich hält. In dem Sinne, wie Farben und Licht, wie Töne außer uns sind, in demselben Sinne ist die Menschenseele selber außerhalb des Leibes, und indem die
Wirklichkeit uns durch die Sinne Farben und Töne hereinträgt, in demselben Sinne leben gewissermaßen auf den Flügeln der Sinneswahrnehmungen die Inhalte der Seele. Die Seele darf nicht vorgestellt werden etwa nur als ein feineres leibliches Wesen, das im äußeren gröberen Leibe wohnt, sondern als ein Wesen, das selbst mit dem Leibe so verbunden ist, daß der Leib dieselbe Tätigkeit, die wir sonst im Erkennen ausüben, im Festhalten der Seele ausübt. Nur dann, wenn man versteht, wie im gewissen Sinne dasjenige, was wir unser Ich, was wir den Träger unseres Selbstbewußtseins nennen, in demselben Sinne außerhalb des Leibes ist, wie der Ton oder die Farbe, dann verstehen wir das Verhältnis der Menschenseele zum Menschenleibe. Indem der Mensch «Ich» ausspricht, nimmt er als Leibes-mensch gewissermaßen dieses Ich von derselben Wirklichkeitsseite her wahr, von der er Farben und Töne wahrnimmt. Und das Wesen des Leibes besteht darin, eben dieses Ich, das heißt, das eigene Wesen der Seele selber, wahrnehmen zu können. Um nun völlig den Wirklichkeitscharakter des eben Gesagten in sich zu erleben, dazu ist notwendig, daß eben der Mensch die oftmals hier schon auseinander-gesetzten Übungen, das heißt innere Verrichtungen mit seiner Seele vornehme.
Auch heute werde ich nicht das oft und oft Gesagte wiederholen, das ja jeder nachlesen kann in meinen Büchern «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», «Geheimwissenschaft» oder in der kurzen Skizze am Schlusse der «Theosophie». Auch heute werde ich nicht diese inneren Seelenverrichtungen im einzelnen schildern, sondern ich möchte vielmehr wiederum gewisse Gesichtspunkte angeben, welche zeigen können, wozu der Mensch kommt, wenn er in dem Sinne, wie es oftmals hier geschildert worden und in den betreffenden Büchern zu lesen ist, innere Verrichtungen
mit seiner Seele vornimmt, so daß das, was sonst als Denken, als Fühlen und als Wollen in der Seele abläuft, durch innere Anstöße, die sich die Seele im meditativen Leben gibt, sich weiter entwickelt; daß das etwas anderes wird als dasjenige, was im gewöhnlichen Leibesleben ist.
Wenn der Mensch die Denkverrichtungen vornimmt -auch das ist ja hier schon in den letzten Vorträgen auseinandergesetzt worden -, welche das Denken hinausführen über die Art eben gerade des Gedankenlebens, die man im gewöhnlichen Leben und auch in der gewöhnlichen Wissenschaft haben muß, dann kommt man dazu, zu denken, das heißt die innere Tätigkeit des Denkens zu verrichten, aber keinen bestimmten Gedanken mehr zu haben. Meditieren besteht ja darin, daß man, während man sonst gewissermaßen unter dem Eindruck der äußeren Welt denkt und sich über die Dinge Gedanken macht, das Denken als eine innere willkürliche Tätigkeit der Seele hervorruft, daß man die Aufmerksamkeit bei diesem Hervorrufen des Denkens nicht auf dasjenige lenkt, was gedacht wird, sondern auf die Tätigkeit des Denkens, auf jene feine Willenstätigkeit, die ja im Denken ausgeübt wird. Das habe ich in dem letzten Vortrag schon geschildert. Man denkt gewissermaßen mit einem Gedankeninhalt, den man durch eigene Willkür in sein Bewußtsein, in seine Seele hereingerückt hat. Man denkt so intensiv, so stark, so innerlich kraftvoll, daß man wirklich das erreicht, was man anfangs ja gar nicht erreichen will, aber was unter dem Einfluß einer solchen innerlichen Gedankenarbeit erreicht wird: Die Gedanken fallen ab, und man lebt nur im inneren Weben und Wirken einer
- nun, der Ausdruck sei gebraucht-, einer ätherischen Welt. Das Wort «ätherisch» ist hier in einer anderen Weise gebraucht, als die neuere Physik den Ausdruck gebraucht. Man lebt in einem Weben, in einem Pulsieren, und man
weiß, wenn man dieses Erleben lange genug betrieben hat:
Was man so in seinem Denken entdeckt hat, was man so losgelöst hat von seinem Denken, wie der Chemiker den Wasserstoff vom Wasser loslöst, damit er die Eigenschaft am Wasserstoff zeigen kann, die man nicht zeigen kann, solange der Wasserstoff im Wasser drinnen ist, - man weiß, wenn man die Tätigkeit des Denkens vom Denken losge-löst hat, daß man nun wirklich in einem Erleben außerhalb des Leibes ist. Man muß sich dann, indem man solch eine innere Seelenarbeit fortsetzt, immer klarer und klarer werden, wie eigentlich das Erlebnis ist, das man auf diese Weise in der Seele hervorgerufen hat. Wenn man Farben, Töne wahrnimmt im gewöhnlichen Leben - wie gesagt, das kann schon als Ergebnis der Naturwissenschaft gelten -, dann weiß man durch die Naturwissenschaft: Es wird in unserem Menschenwesen eine unbewußte Tätigkeit ausgeübt; denn daß durch das Auge, durch das Ohr, hervorgerufen wird die farbige, tönende Welt, das ist eine unbewußte Tätigkeit. Da wird eine unbewußte Tätigkeit ausgeübt, durch die etwas, was außen ist, in die Seele hereinspricht, in die Seele herein sich offenbart. Was man in dem inneren Ergreifen des Denkens erlebt, wenn man die entsprechenden Seelenübungen macht, das wird in derselben Weise nicht so erlebt, als wenn es aus unseren Muskeln, aus unserem Blut aufschösse, sondern es wird erlebt, als ob es aus dem ganzen umliegenden Weltenall hereinkäme, wie ein zu Erkennendes, wie etwas, was als Geistwesen in uns hereindringt und was nur eine gewisse Anziehungskraft hat zu unserem Leibe, so daß es unseren Leib anerkennt gewissermaßen als dasjenige, durch das es sich in die sinnliche Welt herein offenbaren will. Man schreitet, indem man so wie geschildert meditiert, in die Außenwelt selber hinein. Man taucht unter in diese Außenwelt, aus der uns Farben und Töne
kommen. Das heißt: Man macht sein Erleben leibfrei. Diese Leibfreiheit des Erlebens muß eben innerlich erfahren werden, muß erlebt werden. Es muß der Mensch durch Seelen-übungen dazu kommen, zu wissen, daß er in einem Elemente webt und pulst, das nicht an seinen Leib als sein Werkzeug gebunden ist. Aber Wille, innerliche Willkür ist jetzt in allem drinnen, was den Menschen also zur Freiheit vom Leibe führt - innerliche Tätigkeit, aber innerliche Tätigkeit auf einer höheren Stufe. Bedenken wir nur einmal, wenn es mit dem Menschenwesen folgende Bewandtnis hätte: Nehmen wir an - vorausgesetzt die Wahrheit dessen, was ich Ihnen als ein Ergebnis der neueren Physiologie, der neueren Naturwissenschaft auseinandergesetzt habe -, der Mensch wäre sich bewußt: Da muß irgend ein Unbekanntes sein, eine stumme, finstere Welt. Ich stehe darinnen, ich mache meine Augen auf. Dadurch, daß ich durch meine Augen wirke, dadurch schaffe ich die Farbe, schaffe ich die Formen. Dadurch, daß ich durch mein Ohr wirke, schaffe ich die Töne. Ich stelle die Töne, ich stelle die Farbe hinein in die Welt. Was würde der Mensch sagen müssen? Er würde sagen: Nun ja, dann ist ja die ganze Welt ein Traum, selbstverständlich ein Traum. Dann ist nichts von dem wirklich, was ich sehe und höre. Nur dadurch, daß diese innere Tätigkeit, die da ist, unbewußt bleibt, daß man nicht weiß, daß man das tut - durch das Auge hervorrufen die Farben, durch das Ohr hervorrufen die Töne -, nur dadurch ist man überhaupt ungestört in seinem äußeren Erleben. Denn wenn die Menschen immer sich bewußt wären, daß sie das tun, was ihnen die neuere Naturwissenschaft zuschreibt, dann würden sie ganz gewiß über die ganze Sinnenwelt genau ebenso sprechen, wie sie jetzt sprechen über das, was das auf die geschilderte Art ausgebildete menschliche Denken über eine Welt denkt, durch eine Welt
erlebt, die ebenso wirklidi, die ebenso real ist wie die Sinneswelt, die aber willkürlich durch Anstrengung des aus dem Denken heraus geborenen freien Willens vor uns selber hingestellt werden muß. Man möchte sagen: Für die meisten Menschen ist es gut, daß sie begnadet sind dazu, nichts zu wissen, wie sie sich Farben und Töne selber schaffen, sonst wären sie schon in der Lage, über diese farbige und tönende Welt genau ebenso zu sprechen, wie sie sprechen über die Welt, die der Geistesforscher vor sie hinstellt. Denn das ist ja das Charakteristische für die Welt, die der Geistesforscher vor die Seele hinstellt, daß man die Tätigkeit, die man sonst für die sinnliche Welt unbewußt ausübt, nun auf dieser höheren Stufe der Willenshandlung, die aus dem Denken herausgelöst ist, bewußt, voll bewußt ausübt. Sonst aber ist gegenüber der Sinneswelt gar kein Unterschied. Aber die Menschen sind nicht stark genug, sich an dasjenige zu halten, Vertrauen zu dem zu haben, was sie innerlich erst in das Dasein rufen müssen. Man möchte sagen, es ist gut, daß ein gütiger Gott den Menschen vorenthalten hat, zu wissen, daß sie sich das Licht der Sonne selber erschaffen, sonst würden sie es ableugnen, wie sie das Wesen der geistigen Welt ableugnen. - Die Menschen sind darauf angewiesen, sich von der Außenwelt, von der Autorität der Außenwelt diktieren zu lassen, was ist, was mit dem Sein behaftet ist. Sollen sie dazu etwas tun, um dieses Sein vor sich hintreten zu lassen, dann sind sie nicht stark, nicht vertrauensvoll genug zu dieser ihrer inneren Tätigkeit, um das, was sie nun so selber mitschaffen müssen, nun auch als eine Realität, als eine Wirklichkeit gelten zu lassen.
Wenn man nun wirklich durch die angedeuteten Übungen des Denkens den Willen im Denken ergreift, jene Wirklichkeit, die sich nicht in Gedanken einer Sinneswelt aus-lebt, ergreift, dann hat man zunächst - auch das ist öfters
schon angedeutet worden von einem anderen Gesichtspunkte aus - nicht schon eine geistige Wirklichkeit vor sich, sondern man hat nur ein Erlebnis, das besteht in einem Weben und Wesen und Werden; man hat gewissermaßen vor sich ein erweitertes Selbst, ein Selbst, das sich jetzt verbunden weiß mit der ganzen Welt, aus der ihm sonst die Töne und Farben sich offenbaren. Aber man webt und lebt in diesem Werden. Man weiß nur, daß die Art und Weise, wie man in diesem Werden lebt, Wirklichkeit ist, geistige Wirklichkeit ist, vom Leibe freie geistige Wirklichkeit ist.
Man kann eigentlich nicht vorsichtig genug sein bei der Schilderung solcher Dinge, denn es kann ja selbstverständlich leichten Herzens von irgend einer Seite her, die glaubt, sich recht wissenschaftlich dünken zu dürfen, eingewendet werden: Also behauptet der Geistesforscher, daß er schon durch das Ergebnis dieser einen Übung in die Welt untertaucht; er muß also eigentlich alles wissen, wenn er in jenem webenden Element lebt. Nun, was, statt von außen an den Menschen heranzukommen, nunmehr wie von innen wirkt, das muß deshalb nicht alle Geheimnisse, die es in sich trägt, enthüllen. Da kann man sagen, man darf es damit vergleichen, daß der Mensch ja auch ißt und trinkt und doch dasjenige, was an Prozessen in seinem Leibe vorgeht, wahrhaftig nicht kennt. Man lernt eine andere Welt ihrer Art, ihrer Wesenheit nach kennen, aber man lernt selbstverständlich nicht alle Geheimnisse jener Welt kennen, die wiederum alle im einzelnen erst erforscht werden müssen, eine Forschung, die genau ebensolche Sorgfalt und Ernst erfordert, wie die Erforschung der physisch-sinnlichen Welt, ja mehr. Aber es ist dieses Sich-hinein-Erleben in eine webende Welt doch zu vergleichen damit, wenn man etwa als physischer Mensch im Leibe die Fähigkeit errungen hätte, allerlei zu greifen, aber nichts ergreifen könnte,
wenn man um sich herum greift. Da würde man zwar wissen: man hat Organe um zu greifen, um Greifbewegungen auszuüben, aber man ergreift nichts. In dieser Lage würde man sein, wenn man nur die Übungsergebnisse hätte, die eben geschildert worden sind. Man würde innerlich im Geisteselement weben und leben, aber man würde sich vorkommen, als wenn man die Geistorgane nach allen Seiten ausstreckte, und zwar gewiß wäre: Du hast dich im Geiste ergriffen - aber man würde nichts von einer geistigen Umwelt noch wahrnehmen. Es würde nur ein allgemeines Leben und Weben und Werden des eigenen Selbstes im Geiste sein. Eine ungeheuere Einsamkeit, ja eine Bangigkeit, könnte den Menschen ergreifen, wenn er nur zu diesen Ergebnissen käme. Daher sind die Übungen, die die Seele verrichtet, wenn sie der wahrhaftigen Geistesforschung entnommen sind, so eingerichtet, daß nicht nur das Denk-leben ausgebildet wird, so daß es zu solchen Erlebnissen führt, wie sie geschildert worden sind, sondern es wird auch das Willensleben ausgebildet. Und diese Ausbildung des Willenslebens ist wieder etwas, was in der naturgemäßesten Weise sich aus dem gewöhnlichen Willensleben des Menschen ergibt. Das Nähere im einzelnen können Sie wiederum aus den genannten Büchern ersehen. Aber ich will wiederum von einem gewissen Gesichtspunkte aus die Wirkung, die Ergebnisse der Willensübungen, die bei der richtigen Meditation schon in die Meditation hineinverwoben sind, von einem gewissen Gesichtspunkte aus charakterisieren. Die Willensübungen führen den Menschen dahin, daß er sein eigenes Wollen beobachten kann. Die gewöhnliche Selbstbeobachtung, auch dasjenige, was man in der trivialen Mystik Selbstbeobachtung nennt, führt noch nicht dazu, daß man wirklich den Inhalt des eigenen Wollens so beobachtet, wie man sonst äußere Naturerscheinungen
beobachtet. Es führt durchaus noch nicht dazu, daß man gewissermaßen sein eigener Zuschauer werden könnte. Aber die wirklichen Übungen, die die Geistesforschung anzugeben vermag, gestatten dem Menschen, daß dasjenige, was sonst als Wille in seinem Leben sich abspielt und in die Handlungen ausfließt oder auch nur in Wünschen lebt, so angeschaut werden kann, wie sonst Dinge und Vorgänge um uns herum angeschaut werden können; daß sich der Mensch wirklich so außer sich zu versetzen vermag, daß er sich selber zuschaut, indem er dieses oder jenes will, indem er sich Ziele setzt im Leben. Man gelangt zu der Fähigkeit -nur das soll angedeutet werden - insbesondere dadurch -das kann natürlich nicht das ganze Leben ausfüllen, sondern nur ganz kurze, herausgerissene Meditationsaugenblicke des Lebens beanspruchen -, daß man das Wollen so einrichtet - und jeder wahrhaft Meditierende richtet das Wollen schon dadurch, daß er richtige Meditationen macht, so ein -, daß man nicht bloß so will, wie man im gewöhnlichen Leben will. Im gewöhnlichen Leben steigt irgend ein Wunsch auf. Er ist veranlaßt durch irgend eine innere Leibesanlage, oder er wird veranlaßt durch einen äußeren Eindruck, oder es vollzieht das Wollen diese oder jene Handlung, und damit wird in der Außenwelt etwas herbeigeführt. Dieses Wollen, das da lebt, kann man zwar beobachten, aber die Beobachtung wird einem erleichtert, wenn man versucht, dasjenige zu wollen - und wie gesagt, in der Meditation wird es gewollt -, was die Seele selber vorwärts bringt; wenn man sich selber gewissermaßen zum Objekt seines Wollens macht, wenn man etwas so will, daß man durch das, was man in der Seele verrichtet, nach und nach ein Anderer wird; daß die Seele feiner organisiert wird, daß die Seele empfänglicher wird, wenn man Willenshandlungen so ausführt, daß man sich entwickelt, daß man
bewußt vorrückt im Leben. Jeder der Meditationsübungen ausführt weiß, wie nach Jahren, nachdem er Meditations-übungen ausgeführt hat, die ganze Art, wie er über die Welt denkt, eine andere wird, als sie früher war. Er weiß, wie er in anderer Weise Leidenschaft mit Wünschen, und diese wieder mit Gedanken und so weiter verbindet. Er weiß, daß ein anderes Wesen, wenn auch in feinerer Weise, aus ihm geworden ist, das wahrgenommen werden muß. Sonst ist immer das Ich der Mittelpunkt des Wollens. Von dem Ich gehen die Strahlen des Wollens gleichsam aus, ergießen sich in die Gefühle, in die Handlungen. Bei diesem Wollen stellt sich der Mensch gewissermaßen außerhalb seines Ich und bringt durch das Wollen das Ich selber vorwärts. Daher ist die wahre Meditation dazu besonders geeignet, daß er der Zuschauer seines Wollens wird, daß er sich gewissermaßen außerhalb seiner zu versetzen weiß und gerade so, wie man Naturvorgänge anschauen lernt, auch dieses sein eigenes Wollen mit Gelassenheit anschauen lernt. Sonst steckt man mit allen Leidenschaften, mit allen Wünschen, mit allen Affekten in seinem Wollen drinnen. Dieses überwindet man für gewisse Augenblicke des Lebens, und man lernt, Zuschauer seines Wollens zu werden.
Bedenken wir nur: wenn man sonst etwas will, dann ist man bei dem was man will dabei, man steckt dann so drinnen, daß man es unwillkürlich, wenigstens in seinem Innern, verteidigt als sein Eigenes. Jedenfalls betrachtet man das Wollen nicht so, wie man, sagen wir, die Entstehung etwa eines Regenbogens betrachtet. Aber auf diesem Wege liegt das, was die Seele erreichen kann: daß man zuschaut dem Willensgeschehen, wie man der Entstehung eines Regenbogens oder dem Aufgang der Sonne zuschaut; daß man so objektiv dazu wird, so gelassen dazu wird. Da strebt man zunächst im Gedanken aus sich heraus -
denn zunächst ist es ein gedankliches Herausstreben aus sich selber-, um Zuschauer zu werden.
Nun macht man aber eine Entdeckung, die man wohl beachten muß, wenn man sich in die Wirklichkeit dieser Dinge einleben will. Man macht die merkwürdige Entdeckung, daß man das, was man anstrebt, zwar anstreben muß, daß man aber etwas ganz anderes erreicht. Und damit charakterisiere ich überhaupt ein Wesentliches beim geistesforscherischen Weg. Man muß sich beim geistesforscherischen Weg, wenn ich so sagen darf, auf den Weg machen. Man macht sich bei den ersten Übungen die ich geschildert habe dadurch auf den Weg, daß man meditiert, daß man Gedanken in die Seele hereinversetzt. Würde man nun aber glauben, daß das Festhalten dieser Gedanken, das Sich-Hineinbohren in diese Gedanken auch das Ziel ist, so würde das falsch sein. Denn das Ziel besteht gerade in der Überwindung dessen, was man zunächst unternommen hat: daß die Gedanken aufhören, unmittelbar Gedanken zu sein, daß uns nun die Tätigkeit des Denkens frei vom Gedanken erfaßt im Werden und Weben. Das ist das Charakteristische beim geistesforscherischen Weg, daß etwas unternommen werden muß und etwas anderes herauskommt. Und gerade dadurch, daß etwas unternommen wird, kommt etwas anderes heraus.
Und so ist es auch bei diesem zweiten, das ich zu schildern habe. Man strengt sich an auf die geschilderte Art -aber wie gesagt, Einzelheiten können Sie in den genannten Büchern finden -, man strengt sich an, sein eigener Zuschauer zu werden, also so aus sich herauszutreten im Vorstellen und seinem Wollen zuzuschauen, wie man sonst äußeren Naturereignissen zuschaut. Aber der Erfolg, der unter diesen Übungen eintritt, ist ein anderer als ein solcher, der etwa in der geraden Linie läge. Man könnte glauben,
man wird jetzt so, als wenn man nun ein Wesen aus sich machte, das hinsieht auf seine Willensströmungen. Das ist nicht der Fall, sondern der Erfolg besteht darin, daß gerade je mehr man auf diese Weise vorstellungsgemäß aus sich herausgeht, desto mehr einem in sich selber dasjenige verschwindet, was da herausgeht. In der Entwickelung des Denkens kommt man immer mehr und mehr in sich hinein. Das Selbst wird erweitert, das Selbst wird intensiver, kraftvoller. Bei diesem, was ich jetzt schilderte, kommt man nicht in sich hinein, sondern das eigene Selbst wird in gewisser Weise abgelegt; dafür aber bleibt ein Wollen im geistigen Gesichtsfeld, eine Willenshandlung. Und gleichsam aus der Fläche dieser Willenshandlungen von unten herauf, durch die Willenshandlungen hindurch steigt ein wirkliches Wesen, das ein höherer Mensch im Menschen ist. Dasjenige, was man in sich getragen hat immer durch das ganze Leben, aber nicht im Bewußtsein getragen hat, das steigt durch den Willen durch, das durchbricht ihn. Wie das Untere des Meeres etwa erscheinen würde, wenn es über die Oberfläche hervorbrechen würde, so erscheint jetzt ein Wesen, ein bewußtes Wesen, ein Wesen von höherem Bewußtsein, das ein objektiver Zuschauer aller unserer Willenshandlungen ist, ein wirkliches Wesen, das immer in uns lebt und das auf diese Weise den Willen durchbricht. Und dieses Wesen, das man also entdeckt in den Willensströmungen, dieses Wesen verbindet sich mit demjenigen, was man aus dem Denken gemacht hat. Diese zwei Wesen, die man in sich gefunden hat, verbinden sich miteinander. Und dadurch ist man jetzt nicht bloß in einem Wirken und Weben drinnen, sondern in einer wirklichen geistigen Welt mit wirklichen geistigen Wesenheiten und Tatsachen. In der steht nun das eigne Wesen drinnen, das auch aus dem Willen herausgeboren ist - aber in der
Gesellschaft anderer geistigen Wesen - und das durch Geburt und Tod geht. Den Menschen, der durch Geburt oder Empfängnis sich verbunden hat mit dem, was von Vater und Mutter stofflich abstammt, den Menschen, der sich erhält, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes tritt, den entdeckt man auf die Weise, daß man von zwei Seiten her dasjenige, was in uns wirkt und lebt, in sich lebendig macht.
Bei dem Denken, das man so allmählich entwickelt, liegt die Hauptsache darin, daß wir in diesem Denken wirklich schon etwas anderes entwickeln, als was in unserer gewöhnlichen Seele lebt, und das ist gerade das Schwierige. Der Mensch hängt so sehr an den Gewohnheiten, die er sich seelisch angeeignet hat im Verkehr mit der sinnlichen Außenwelt. Daher beunruhigen ihn eigentlich zunächst alle diese Eigenschaften, welche er sich auf diesem Geisteswege, wie er geschildert worden ist, aneignet. Eine Bangigkeit, eine Einsamkeit, eine Unruhe kann in ihn kommen. Wenn alles richtig ausgeführt wird, wie es von wahrer Geisteswissenschaft angegeben wird, ist das nicht der Fall. Ich habe darüber vor einigen Wochen in dem Vortrage gesprochen, den ich genannt habe «Gesundes Seelenleben und Geistesforschung». Aber uberall weiß man, gerade wenn man sich in diese geistige Welt auf die geschilderte Weise hineinlebt, wie eine gewisse Unruhe entstehen kann, ein gewisses innerliches Bangesein, ja sogar deutliche Anwandlungen von Furcht gegenüber der geistigen Welt, die über einen hereinbrechen will. Und daß dies vermieden werde, dafür gibt es schon bei wahrer Meditation Anhaltspunkte genug. Aber wenn jemand erwartet, daß das, was dann seine Seele tut in diesen neu hervorgerufenen Fähigkeiten, unmittelbar ähnlich ist mit dem, was die Seele der äußeren physischen Welt gegenüber tut, die sie den ganzen Tag um
sich herum haben muß, dann unterliegt er den schwersten Täuschungen und auch Enttäuschungen. Dann wird er unruhig aus dem Grunde, weil er sich sagt: Da lebe ich mich in ein Unbestimmtes, in ein Ungewohntes hinein. Ich habe immer in einer anderen Weise gedacht. Mein Denken war da so sicher, in der anderen Weise; es haftete sich an ein bestimmtes Sein an, das mir gegeben war. Jetzt soll mein Denken in einem Werden leben und soll nicht gewissermaßen sich selbst entfallen.
Das wird aber auf wahrem geistesforscherischem Wege dadurch hintangehalten, daß dieser wahre geistesforscherische Weg das mit sich bringt - er bringt es ganz von selbst mit sich, wenn er in richtiger Weise gegangen wird -, daß sich das, was wir Interesse nennen können, innerliches Seeleninteresse, in einer ganz anderen Weise für den Menschen kundgibt, als sich sonst das Seeleninteresse in der physischen Welt kundgibt. Es ist wirklich wahr: Man bekommt ein neues Interesse, eine ganz neue Art von Interesse, wenn man ein meditatives Leben führt. Immer wieder muß betont werden: Nicht etwa für das innere Leben allein will man Erfolg. - Diejenigen Geistesübungen sind von vorne herein nichts wert und müssen entschieden abgewiesen werden, die den Menschen untauglich machen für das äußere Leben. Der Mensch, der wahre Geistesübungen ausübt, der bleibt so fest im äußeren Leben drinnen stehen, wie er früher drinnen gestanden ist. Nein, sogar fester wird er sich noch hineinstellen in dieses äußere Leben. Er wird, wenn er einen bestimmten Beruf auszuüben hat, wo immer das Schicksal ihn hingestellt hat, diesen Beruf nicht schlechter ausfüllen, wenn er wahre Geisteswissenschaft hat, als er ihn vorher ausgefüllt hat. Und sicher kann man sein -verzeihen Sie den trivialen Ausdruck -, daß derjenige, der allerlei Rosinen in den Kopf bekommt dadurch, daß er
Geistesübungen durchmacht, der sich dann für zu gut hält für das, was er vorher war, ganz sicher auf einem Holzweg ist. Aber durch dasjenige in der Seele, was die eigentliche geistesforscherische Tätigkeit ist, bekommt man zu den alten Interessen, die sogar noch intensiver werden für die äußere Welt, neue hinzu, die die Seele in eine andere Richtung bringen.
Ich will zum Beispiel angeben, wie das ist für denjenigen, der Philosoph ist. Vielleicht ist das gerade nützlich anzugeben aus dem Grunde, weil ja die meisten Philosophen von vorne herein glauben - nun, daß sie viel besser alles aus der Geisteswissenschaft beurteilen können, als der Geistesforscher selber. Derjenige aber, der nicht selber Philosoph ist, wird schon unruhig gegenüber den vielen Philosophien, die es gibt. Nicht wahr, man soll nur einmal alle die «ianer», Kantianer, Hegelianer, Schopenhauerianer, Hartmannianer - man soll sie nur einmal alle, alle überschauen, so wird man sehen, auch wenn man noch andere dazu nimmt, daß man sich nicht in eine gewisse Unruhe bringen lasse: Nun, jeder hat anders gedacht, ich will doch etwas Sicheres haben im Denken! Diese Art wird beim Philosophen dann einen anderen Ausdruck bekommen. Der Philosoph, der selber ein «ianer» sein will, der bildet sich nun einen gewissen Gedankengang aus; auf den schwört er dann, und die anderen sind selbstverständlich alle Dummköpfe, die er widerlegen kann, oder doch wenigstens irrende Menschen. Derjenige aber, der sein Denken in der geschilderten Weise ausgebildet hat, der die Denkverrichtung im Denken mit enthalten hat, der liest Hartmann mit demselben Interesse wie Schopenhauer, wie Hegel, wie Schelling, wie Heraklit. Er kommt gar nicht dazu, den einen zu widerlegen und des anderen Anhänger zu werden, weil er ein gewisses Interesse bekommt an der Bewegung
des Denkens, am Drinnenstehen im Denken selber, weil er eine gewisse Freude, ein gewisses Wohlgefallen einfach an der Verrichtung des Denkens hat und weil er weiß, daß dieses Denken ohnedies nicht in einer solchen Weise zur Wirklichkeit hinführt, wie man gewöhnlich glaubt - daß nämlich die Gedanken einfach Abbilder sein können der Wirklichkeit -, sondern daß man nur kommt in ein Leben und Weben in der Denkarbeit. Ja, wenn man dies kann, dann kann man sich auf den Standpunkt stellen: Gewiß, der eine Philosoph hat von dem einen Gesichtspunkt, der andere von einem anderen Gesichtspunkt die Welt angesehen! - Und die philosophische Weltanschauung, die man dann bekommt, sieht man nicht anders an, als man einen Baum ansieht, der von verschiedenen Seiten photographiert wurde, wobei man dann auch nicht sagt: Ich erkläre die eine Photographie für falsch, das stimmt ja gar nicht mit der anderen, das ist ein ganz anderer Baum! - Denn das ist nur ein anderer Baum, weil er von einer anderen Seite photographiert ist. Wenn man auf die Tätigkeit des Photographierens sieht, und nicht auf die abstrakte Abbilderei, dann kommt man da selbst auf das Richtige. Und so ist es mit dem Denken. Man bekommt Interesse für die Beweglichkeit des Denkens, und man weiß, daß man in der geistigen Wirklichkeit lebt, wenn man im Denken selber lebt und webt. Man bekommt auch - und da geht es sogar viel tiefer - durch die Willensübungen etwas in seine Entwickelung herein, das wiederum manchen sehr stören kann, das sogar sehr störend auftreten würde, wenn man nicht genügend vorbereitet wäre, wie es aber in jeder wahren Geistesschulung der Fall ist. Ich möchte wiederum sagen:
Für das gewöhnliche Leben sind die Menschen bekannt damit, daß dasjenige, was in ihrem Willen liegt, ihnen eigentlich nur so erscheint, daß sie sich, wenn sie etwas
getan haben, was sie gut nennen, die Hände reiben; dann sind sie sehr zufrieden mit sich. Wenn sie etwas getan haben, was sie schlimm nennen in irgend einer Weise, dann machen sie sich Vorwürfe. Aber es bleibt bei diesen inneren Seelenprozessen. Der Mensch pendelt hin und her zwischen diesem Sich-die-Hände-Reiben aus Zufriedenheit über das, was er getan hat, und dem Sich-Vorwürfe-Machen. Wenn aber das Wollen in der Weise ausgebildet wird, daß der innere Zuschauer auftaucht, dann wird die Sache von einem größeren Ernst durchdrungen. Dann tauchen nicht mehr bloß Vorwürfe oder innere Befriedigung auf, sondern dann lernt man in dem, was da als Zuschauer das Wollen durchdringt und durch seine Oberfläche herauf-schießt, ein ganz reales Wesen kennen. Man lernt kennen:
Dasjenige, was dir sonst als Vorwurf und als innere Befriedigung erscheint, das ist eine reale Kraft. Diese reale Kraft ist da in der Welt, die wird weiter wirken. Man lernt im weiteren Verlauf erkennen, wie sich diese Kraft zu einem weiteren Schicksal gestaltet und als eine Tatsache das nächste Erdenleben beeinflußt, nachdem man durch das Leben zwischen Geburt und Tod hindurchgegangen ist. Was man da als den Willen durchsetzend erlebt, das würde dem, der nicht gut vorbereitet ist, wie ein Schatten nachgehen, wie etwas, was er immer mit sich nachschleift, wie seinen Schatten, wie ein wirklich reales Wesen. Alles hängt davon ab, daß man auch diesen Dingen gegenüber eben die ganze Bedeutung einzusehen lernt; daß man zum Beispiel lernt zu erkennen: Das, was einem da als Schatten nachgeht, braucht einen nicht zur Hypochondrie hinzuführen, sondern man muß es gelassen ansehen. Denn es ist gar nicht dasjenige, was für das gegenwärtige Leben eine Bedeutung hat, sondern was mit uns durch die Pforte des Todes hindurchgeht, was unter den Kräften ist, die die
Konfiguration, die Artung unseres nächsten Lebens mitbestimmen werden.
Kurz, die Interessen, die sich mit diesen entwickelten inneren Seelenbetätigungen verbinden, sind andere als die Interessen des äußeren Lebens, aber sie bringen von diesen Interessen des äußeren Lebens durchaus nicht ab. Sie stellen sozusagen nur alles an seinen richtigen Ort. Wenn jemand so, wie ich es geschildert habe, zum Bewußtsein dessen kommt, was durch Geburten und Tode geht, was das Unsterbliche an der Seele ist, dann wird er nicht etwa geringeres Interesse bekommen für dasjenige, was unmittelbar an äußeren physischen Tatsachen ihn umgibt, sondern er bekommt darüber ungefähr die Ansicht: Es gibt eine geistige Welt. In dieser geistigen Welt sind ebenso konkrete geistige Vorgänge und Wesenheiten, die er ja schauen kann, wie in der physisch-sinnlichen Welt. Aber dasjenige, was als physisch-sinnliche Welt da ist, das kann nur in der physisch-sinnlichen Welt geschaut werden. Was uns als physisch-sinnliche Welt umgibt, das erlischt selbstverständlich nach dem Tode. Nur weil wir in uns ein unsterbliches Wesen tragen, das in sich eine Wirklichkeit ist und das einer Wirklichkeit angehört, die über das Leibliche hinausgeht, tragen wir etwas durch des Todes Pforte hindurch, dringen in eine geistige Welt ein, in eine Welt, die wir durchleben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, und treten dann wiederum in ein weiteres Erdenleben ein.
Gerade wenn man nun, und zwar jetzt nicht abstrakt, sondern in lebendiger Empfindung weiß - und durch Geistesforschung lernt man das erst so richtig kennen - :
Diese sinnliche Welt kannst du nur in ihrer ganzen inneren Wesenheit durch deine Sinne und durch den an das Gehirn gebundenen Verstand kennen lernen - dann wird unter diesem lebensvollen Sich-Entwickeln - nicht durch irgend
eine Theorie, aber durch das, was das Leben in sich aufnimmt, unter dem Einfluß der Übungen, die dazu führen -gerade unser lebendiges Interesse erweckt für alles Sinnenfällige; das Interesse für die kleinsten Kleinigkeiten in der Welt wird gesteigert. Nur ein bestimmtes Interesse - das muß man schon mitnehmen - wird immer geringer und geringer:
das Interesse für dasjenige, was in der Sinneswelt schon als sogenanntes «Geistiges> erscheinen und in der Erscheinung selber, aus dieser Erscheinung heraus, Geistiges offenbaren soll. Man weiß, daß Geistiges ergriffen werden kann, wenn zuerst die Organe, die Geistesaugen und Geistesohren entwickelt werden - um diesen Ausdruck Goethes zu gebrauchen. Man weiß, daß man sich zu der geistigen Welt erheben muß, und man weiß, daß in der Sinneswelt diese Sinneswelt aus sich selber heraus begriffen werden muß, daß sie dasteht als dasjenige, was durch die Sinneswelt erfaßt werden muß. Daher verliert man das Interesse für alle diejenigen Veranstaltungen, die aus der Sinneswelt selber das Geistige suchen. Und während gerade bei wahrer Geistesforschung das Interesse größer wird für alles, was sich in der geistigen Welt abspielt, schwindet völlig das Interesse in dem Sinn, wie es bei vielen für die geistige Welt bloß Sensationslüsternen und allerlei Abergläubischen und Wundergläubigen vorhanden ist. Das Interesse, sagen wir, an spiritistischen Veranstaltungen, an mediumistischen Darstellungen, schwindet vollständig dahin. Es interessiert den Geistesforscher nicht, weil er weiß, daß in diesen Dingen nur irgend etwas Abnormes zum Vorschein kommen kann, was ja in der Sinneswelt begründet ist, was aber nicht über die Sinneswelt hinaus in die wahre geistige Welt hineinführen kann. Gewiß, er kann sich interessieren, wie man sich für irgend eine Theatervorstellung interessiert, für irgend etwas, was sonst als Experiment in der Welt auftritt.
Es soll auch nichts eingewendet werden gegen solche Veranstaltungen - selbstverständlich insofern sie nicht Schwindel sind -, daß sich dadurch allerlei sonst nicht ausdrückbare Naturzusammenhänge ausleben können. Aber es sind eben Naturzusammenhänge, und man weiß, daß man in nichts anderem lebt in diesen Dingen, als man auch lebt und webt mit den gewöhnlichen Sinnen, wenn das scheinbar auch noch so abnorm sein soll. Für alles das, was in dieses Gebiet, das ich eben berührt habe, gehört, schwindet, wie gesagt, das Interesse. Es wird zu einem bloßen Miterleben - nun, von allerlei Veranstaltungen. Und das gehört zu jedem wahren Geistesforscher, daß nicht der Aberglaube in ihm zunimmt, sondern daß der Aberglaube gerade mit Stumpf und Stiel ausgetrieben werde.
Man könnte nun sehr leicht glauben - weil das möglich ist, muß es besonders berührt werden -, daß der Mensch, der solches, wie ich das angedeutet habe, geistig erlebt - und er erlebt im Grunde nichts Geringeres als dasjenige in sich und in Verbindung mit der Welt, was er seine unsterbliche Seele nennen kann -, daß er nun eigentlich das Leben nach dem Tode vorausnehmen würde; daß er schon dasjenige erlebte, was dann nach dem Tode erlebt wird. In dieser abstrakten Form ist es nicht der Fall, und man muß schon genau denken über diese Dinge, wenn man sich von ihnen eine Vorstellung machen will. Dasjenige, was die Seele durchlebt nach dem Tode, oder sagen wir, vom Tode bis zur Geburt hin, erlebt man ungefähr so, wie wenn bewußt die Pflanze erleben würde alles das, was in ihrem Keime steckt, der alle Kräfte für die neue Pflanze darstellt. Man erlebt alles dasjenige, was notwendigerweise, wenn der Mensch durch den Tod durchgegangen ist, in der geistigen Welt durchgemacht werden muß, um das ganze Leben mit der neuen Leiblichkeit und den neuen Erlebnissen als ein
neues Schicksal in dem kommenden Erdenwerden vorzubereiten. Es ist das Keimeswesen in uns, das geeignet ist, zwischen Tod und neuer Geburt dasjenige in der geistigen Welt zu erleben, was dann ein neues Erdenleben vorbereitet, so daß wir dann diejenige Leiblichkeit haben, die wir brauchen, um die Anlagen zu haben, die wir früher vorbereitet haben in uns, damit wir uns in diejenige Lage hineinbringen, in die wir versetzt werden müssen, wenn sich unser Schicksal unserem früheren Erdenleben gemäß erfüllen soll. Daß diese Anlage in uns liegt, das erleben wir. Dazu nun, dieses Erleben vor sich zu haben, die geistige Welt vor der eigenen Seele zu haben, dazu ist natürlich notwendig, die Erfahrungen selbst durchzumachen zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, auf die man höchstens hinschauen kann, und die man im Wissen höchstens entwickeln kann, freilich in einem lebendigen Wissen, das innerliche Realität ist, während das Wissen von der Außenwelt, von der physischen Außenwelt, nur Gedankenbilder sind.
Sie sehen, ich müßte natürlich, um das, was ich nur angedeutet habe, noch genauer zu erörtern, viel, viel Zeit haben. Es wird das schon in kommenden Vorträgen geschehen können. Aber Sie sehen, es gibt einen gewissen bestimmten Weg, den man als den Weg der Geistesforschung bezeichnen kann und der dahin führt, ein innerlich anders geartetes Leben zu entwickeln, als das Leben der Seele in der äußeren, sinnlichen Wirklichkeit ist. Und in diesem Erleben ergreift die Seele sich selber so, daß sie in der innerlichen Kraft lebt und webt, die durch die Pforte des Todes geht.
Wahr ist es, was Fichte nur erahnte, indem er sagte: Die Unsterblichkeit ist nicht erst da, wenn wir durch des Todes Pforte gegangen sind, sondern sie ist da, wenn wir auch
noch im Leibe leben. Denn das Wesen, das durch den Tod geht, kann im Leibe erreicht werden von der menschlichen Erkenntnis. - Wodurch wird es erreicht? Auf eine merkwürdige Weise müssen wir uns aus der Geisteswissenschaft selbst heraus Vorstellungen machen, wodurch es erreicht wird.
Sie können ja die Frage aufwerfen: Wodurch kann der Mensch das alles, was jetzt geschildert worden ist als Ergebnis von Seelenübungen, erreichen? Wodurch können Seelenübungen zu so etwas führen? Sehen Sie, der Mensch klagt sehr häufig darüber - besonders dann, wenn er einen regen Erkenntnistrieb hat -, daß man die Wirklichkeit doch nicht ernstlich durchschauen könne, daß es Grenzen der Erkenntnis gebe. Wie oft habe ich auch in diesen Vorträgen hier auf das berühmte Ignorabimus des Du Bois-Reymond aufmerksam gemacht, wo gesagt wird, daß der Mensch ja bis zu einer Beobachtung der Weltenvorgänge und ihrer Grenzen kommen, aber nicht hineindringen könne in das Innere der Materie; daß er mit seinem Denken gleichsam nicht untertauchen könne in das Innere der Materie. Von aller Erkenntnis wird gesagt, daß eigentlich alle diese Erkenntniskräfte nicht ausreichen, um in die Natur völlig einzudringen.
Wenn man beginnt, die Seele innerlich so zu erkraften, wie es geschildert worden ist, da merkt man etwas ganz Bestimmtes. Da merkt man, wie es ungeheuer gut ist, daß für das äußere Erkennen solche Grenzen da sind. Denn wenn einen diejenigen Kräfte, die man zum äußeren Erkennen hat, dazu bringen würden, durch sich selber alle Natur zu durchschauen, so würden einen diese Kräfte verhindern, zu einer geistigen Erkenntnis zu kommen. Nur dadurch, daß man nicht alles, was in der Seele ist, verwenden kann zur äußeren Erkenntnis, bleibt einem etwas aufgespart, das man in der Weise, wie ich es auseinandergesetzt
habe, entwickeln kann. Nur dadurch, daß die volle unsterbliche Seele nicht in das Leibesleben eingeht, sondern sich noch etwas zurückbehält, wodurch im äußeren Leibesleben nicht alles durchschaubar ist, bleiben Kräfte innerlich aufgespart, die dann in der geschilderten Weise entwickelt werden können. Indem wir durch die Geburt oder, sagen wir, durch die Empfängnis uns mit dem physischen Material, das von den Vorfahren gegeben wird, verbinden, behalten wir von der unsterblichen Seele so viel zurück, daß wir auf der einen Seite verhindert sind, im Leibesleben die volle Natur zu durchschauen, Hypothesen und allerlei machen müssen über das, was in der Natur lebt. Aber wir haben dadurch im Hintergrund in unserem Wesen Kräfte, die wir in uns entwickeln können und die uns auf eine geistige Art eben in eine geistige Welt hineingehen lassen. Die unsterbliche Seele lebt im Menschen. Damit sie leben kann, muß dem Menschen auf sinnliche Art manches entrückt sein. Das ist wiederum so ein wichtiger Zusammenhang, auf den man hinschauen muß.
Es gibt also eine Geistesforschung, die uns unmittelbar mit dem unsterblichen Wesen des Menschen bekannt macht. Diese Geistesforschung ist anderer Art als die äußerliche Forschung. Bei der äußerlichen Forschung kann man so bleiben, wie man ist. Das ist ja gerade das, was den Leuten so entspricht. Dieselben Fähigkeiten, die sie sich einmal erworben haben, die behalten sie bei, wenn sie ins Laboratorium hineingehen, wenn sie Versuche anstellen, und irgend etwas über die äußere Natur erfahren können. Und dann verlangen diese Menschen auch, daß der Geist ebenso erforscht werden solle, indem man dieselben Fähigkeiten beibehält. Man kann nicht an den Geist heran, wenn man sich nicht selber erst in sich geistig macht, das heißt, dasjenige in sich aufsucht, was in jeder Menschenseele ist, was aber erst
zum Bewußtsein erhoben werden muß auf die beschriebene Art. - Aber es gibt vieles, vieles, was, ich möchte sagen, in der Gegenwart den Menschen noch die Wege verlegt, die sie zur Geisteswissenschaft führen können. Daher ist das Kapitel «Unsterblichkeitsfrage und Geistesforschung» heute noch ein so wenig anerkanntes, ein solches, auf das man sich so wenig einlassen will.
Sie können schon entnehmen aus dem, was ich gesagt habe, daß es notwendig ist, daß der Mensch gerade auf eine feine innerliche Art im Denken weben und leben lernt. Das heißt, er muß, wenn er ein Geistesforscher wird, nicht ein geringerer Denker werden, als diejenigen sind, die da glauben, sagen wir trivial, das Denken mit dem Löffel gegessen zu haben, die da behaupten, sie stehen auf dem festen Boden der äußeren Naturwissenschaft, der gar nicht im geringsten angefochten werden soll, - sondern man muß gerade eine größere Feinheit des Denkens ausbilden. Die liebt man in der Gegenwart nicht. In der Gegenwart liebt man es gerade, jenes, ich möchte sagen, handgreifliche Denken zu entwickeln, das sich auf Feineres, das in der Welt lebt und webt, gar nicht einläßt.
Ich tue es nicht gern : anknüpfen an etwas Persönliches, und diejenigen der verehrten Zuhörer, die oftmals in diesen Vorträgen waren, werden wissen, daß ich es eigentlich vermeide, auf all das einzugehen, was aus der äußeren Welt an Gegnerschaft und an allerlei Verkennungen gegenüber dem, was ich hier als Geisteswissenschaft vertrete, sich geltend macht, - daß ich darüber am liebsten hinweggehe, davon gar nicht rede. Allein wenn immer wieder und wiederum Dinge kommen, die dann doch wirken, die geglaubt werden, dann schaden sie der Sache. Persönlich möchte ich am liebsten über diese Dinge überhaupt nicht reden, aber der Sache wird geschadet, weil ja bedrucktes Papier heute
noch immer eine ungeheuere Autorität ist, weil es noch immer ungeheuer wirkt. Und so muß man schon manchmal um der Sache willen, wenn sich durch irgend ein Thema der Anlaß bietet, darauf eingehen, was der Geisteswissenschaft entgegensteht. Entgegensteht ihr das grobe Denken, das ja deshalb, weil es sich nicht einlassen kann auf feineres Weben im Gedankenleben, gar nichts anderes sehen kann als eine Phantasterei, als eine Spintisiererei in dem, was von der Geisteswissenschaft als der richtige geistesforscherische Weg angegeben wird. Dafür eben ein Beispiel. Und, wie gesagt, verzeihen Sie, wenn es ein an Persönliches anknüpfendes Beispiel ist, aber ich meine es ja nur insofern, als es sich der Geisteswissenschaft entgegenstellt, was dadurch wie in einer typischen Erscheinung zum Ausdruck kommt.
Da habe ich in einer gewissen Stadt vorgetragen über die Beziehungen, die im Wesen der einzelnen europäischen Völker herrschen, Beziehungen, die ich, wie sehr viele Zuhörer wissen, lange bevor dieser Krieg etwa die Veranlassung gegeben hat darüber zu sprechen, auch schon vorgetragen habe; Erkenntnisse, die ganz ohne Beziehung auf diesen Krieg gefunden worden sind, die sich aber so, wie sie dargestellt werden, eigentlich einleuchtend ergeben müssen. Denn wenn nun im Verlauf der Vorträge, die jetzt oftmals verbunden werden mit den geisteswissenschaftlichen Vorträgen, gesagt wird : die Völker des Westens, die Völker der europäischen Mitte, die Völker des Ostens unterscheiden sich durch das oder jenes, - man sollte glauben, daß eigentlich kein vernünftiger Mensch darauf kommen könnte, etwas anderes zu sagen als: Nun ja, der mag sich ja in bezug auf einzelne Eigenschaften irren, aber Unterschiede gibt es doch wahrhaftig. Es gibt doch nun wirklich verschiedene Charaktereigenschaften, andere bei den Deutschen, andere bei den Russen. Dieses abzuleugnen, kann doch nur dem allergröbsten
Denken entspringen. Und dennoch, ich habe, wie gesagt, in einer gewissen Stadt auch darüber vorgetragen. Schon in einem Tagblatt der betreffenden Stadt ist gerade das in der abfälligsten Weise besprochen und gesagt worden, daß gleichsam nur aus dem Krieg heraus diese Unterschiede konstruiert worden seien. Aber darüber könnte man hinweggehen, nach dem Beispiel, das ich neulich angeführt habe dafür, was auf diesem Gebiet geleistet wird. Aber nun denken Sie, damit war es einem Manne nicht genug, sondern der Mann hat sich sogar an eine Zeitschrift gewandt, und in einer Zeitschrift wird abgedruckt, was damals in dem Tagblatt erschienen ist, und daran die folgende nette Bemerkung geknüpft: «Der Vorwurf des Referenten» - also des Kritikers des Tagblattes der betreffenden Stadt -, «aus der gegenwärtigen Mächte-Konstellation gegensätzliche Kulturen rekonstruiert zu haben, trifft Steiner mit Recht. Es ist mir beim besten Willen nicht möglich, wie Steiner einen Wesensunterschied zwischen mitteleuropäischer und west- und osteuropäischer Kultur wahrzunehmen. Meines Erachtens ist die europäische Kultur ihrem Wesen nach vollkommen gleich.» Und so geht es weiter. Dies ist in einer mitteleuropäischen Zeitschrift erschienen. Sie können daran sehen, was für ein grobes Denken der Geisteswissenschaft als solcher gegenübersteht. Denn das, was ich Ihnen hier vorgelesen habe, ist in einem ausführlichen Artikel, der durch mehrere Nummern durchgeht, weiter ausgeführt. Der Gedanke, - nun, ich brauche ihn nur anzudeuten, dann werden Sie sehen, wie grob das Denken eines solchen Menschen ist: «Auch das intellektuelle Leben hat sich in dieser Richtung entwickelt und geht in diesem Streben auf. Die wilde Gier des europäischen Kulturmenschen nach dem Besitze irdischer Güter würde in einem raubtierartigen Kampf aller gegen alle ausarten, würden die Individuen nicht in
eiserne Staatsformen gezwängt.» Also nicht einmal das bemerkt dieses grobe Denken, wie diese «eisernen Staatsformen» zunächst mehr beteiligt sind an demjenigen, was sich in diesem Kriege abspielt. Mit solchem Denken hat man es zu tun. Solches Denken steht gegenüber dem, was gefordert werden muß gegenüber einer Erkenntnis einer solchen Frage, und so auch der Frage nach der Seelenunsterblichkeit. Und solches erscheint nicht in einer materialistischen Zeitschrift, sondern in einer Zeitschrift - sie trägt sogar die Überschrift «43. Jahrgang» -, die sich «Psychische Studien» nennt. Daß ich nicht aus persönlicher Kränkung das ausspreche, was ich eben ausgesprochen habe, das kann ich Ihnen aus der Zeitschrift selber beweisen. Sie wissen oder wenigstens sehr viele wissen, daß ich die Hauptgedanken, die dieser Herr hier in einer solchen Weise abkanzelt, in einer kleinen Schrift behandelt habe. Diese Schrift heißt «Gedanken während der Zeit des Krieges». In dieser Schrift stehen, wenn auch vielleicht in populärer Weise, genau dieselben Gedanken, wenigstens aus demselben Geiste, aus derselben Gesinnung heraus geschrieben. Noch in der Nummer, in der der Aufsatz steht, von dem ich Ihnen eben die charakteristischen Stellen vorgelesen habe, steht eine Rezension dieser Schrift «Gedanken während der Zeit des Krieges». In dieser Rezension wird die Schrift außerordentlich gelobt und gezeigt, wie verdienstvoll es ist, solche Gedanken zu äußern. Mir ist selbstverständlich, wenn ich gelobt werde, ebenso gleichgültig, wie wenn ich getadelt werde. Aber ich muß dasjenige, was schon einmal in der Zeitenbildung lebt, charakterisieren, damit nicht immer wieder und wiederum, wenn da und dort Schmähschriften auftauchen, einfach durch die suggestive Kraft dessen, was mit Druckerschwärze auf schmutziges Papier gekleckst ist, geglaubt werde, da das für diejenigen, die sonst vielleicht den Weg zur Geistesforschung
finden könnten, doch immer eine Art von Hindernis bildet. Auf das Groteske der Erfahrung, die man in einer solchen Weise in unserer Zeit machen kann, muß man schon hinweisen. Und nur aus diesem Grunde ist es auch, um Geisteswissenschaft gewissermaßen frei zu halten auf dem Boden, auf dem sie ist, in dem Lichte frei zu halten, in dem sie als wahre, echte, ehrliche Geisteswissenschaft erscheinen muß. Um sie in diesem Lichte frei zu erhalten, muß ich auch noch anderes berühren.
Ich habe ja schon aufmerksam gemacht im vorletzten Vortrage, wo ich über Mißverständnisse, die der Geisteswissenschaft entgegengebracht werden, gesprochen habe, auch in dem Vortrage «Gesundes Seelenleben und Geistes-forschung», daß der Geistesforschung nicht nur dasjenige entgegensteht, was von der mehr oder weniger materialistisch gesinnten Seite her kommt. Auf dieser Seite ist ja außerordentlich schwer etwas zu erreichen aus dem Grunde, weil die Dinge, die von dieser Seite vorgebracht werden, so furchtbar einleuchtend sind. Wenn ich irgend etwas charakterisiere, wie diese Zeitschrift, so tue ich es nur gezwungen. Wenn ich etwas im Ernste bekämpfe, so wende ich mich an solche, die ich eigentlich hoch schätze, die ich eigentlich hoch-stelle. So schätze ich auch hoch den eigentlichen Vater, möchte ich sagen, des neuzeitlichen Materialismus, Lamettrie. Das ist ein scharfsinniger Mann, und seine Gründe sind einleuchtend. Aber man kann eben das Einleuchtende dieser Gründe anerkennen, man kann sie geltend machen und man müßte doch, wenn daneben der geistesforscherische Weg geltend gemacht wird, die Bedeutung und das Wesen dieses geistesforscherischen Weges neben der Geltung dessen, was von materialistischer Seite her kommt, anerkennen. Lamettrie ist, wie gesagt, ein scharfsinniger Mann, und er hat in seinem Buche «Der Mensch eine Maschine» alles zusammengestellt,
was nachweisen kann, wie der Mensch abhängig ist von seiner Leiblichkeit. Nun könnte es aussehen, als ob Geisteswissenschaft alle Veranlassung hätte, solchen Dingen zu widersprechen. Nein, sie stimmt allem zu, wie ich sogar bewiesen habe in meinem letzten Vortrage, in einem energischeren Sinne, als die Materialistik selber. Denn es ist ja leicht einleuchtend und unwiderleglich, wenn Lamettrie aufmerksam macht, wie der Mensch abhängig ist in seiner Seelenverfassung von dem, was er ist. Selbstverständlich ist es sehr leicht zu beweisen, weil es so furchtbar einleuchtend ist, daß der Mensch abhängig ist davon, ob ihm irgend etwas schmeckt, ob ihm irgend etwas gut bekommt. Denken Sie an die Stimmung der Seele, die daraus hervorgeht. Lamettrie beschreibt das alles, und dadurch hat er im Grunde vorausgenommen all das, was über diese Sache gesagt werden kann. Ist es nicht höchst interessant - gerade in einer heutigen Zeit kann man das vorlesen -, was Lamettrie gesagt hat in seinem Buche «Der Mensch eine Maschine», weil es, wenn man es an einem anderen Orte vorlesen würde, keinen guten Eindruck machen würde. Aber hier in Mitteleuropa darf diese Stelle vielleicht mit einer größeren Gelassenheit als in Westeuropa vorgelesen werden. Da will Lamettrie nachweisen, was der Mensch eigentlich ist - wirklich nachweisen, wie der Mensch in bezug auf seine Seelenstimmung, ja in bezug auf seinen Charakter, auf das, was seelisch in ihm lebt, abhängt von dem, was er ißt, was seine Nahrung ist. Und da sagt Lamettrie - aber es ist wie gesagt mehr als ein Jahrhundert her, seitdem es gesagt worden ist -, da sagt Lamettrie in seinem Buch «Der Mensch eine Maschine»: «Das rohe Fleisch macht die Tiere wild; die Menschen würden es durch dieselbe Nahrung werden. Wie wahr das ist» - sagt Lamettrie, der Franzose -, «sieht man daran, daß die englische Nation, die das Fleisch weniger
gekocht als wir, es ganz roh und blutig ißt, eine Wildheit zeigt, die zum Teil durch jene Nahrungsmittel hervor-gebracht wird, zum Teil freilich audi durch andere Ursachen, welche nur die Erziehung unterdrücken kann. Diese Wildheit bringt in der Seele Hochmut, Haß, Verachtung anderer Nationen, Unlenksamkeit und andere Gefühle hervor, die den Charakter verderben, wie die groben Nahrungsmittel einen schwerfälligen und plumpen Geist erzeugen, dessen Haupteigenschaften Faulheit und Stumpfsinn sind.» Es ist vielleicht gerade in Mitteleuropa nicht uninteressant, das Urteil eines Franzosen, wenn es auch schon mehr als hundert Jahre alt ist, über die Engländer zu hören, damit man sieht, wie sich die Verhältnisse ändern und wie nicht immer in gleicher Weise von da und dort her und da und dort hin empfunden und gedacht worden ist. Dieser selbe Lamettrie sagt auch andere Dinge, die ganz selbstverständlich sind, so zum Beispiel sagt er - und er glaubt damit alles dasjenige abweisen zu müssen, was etwa aus dem Geiste heraus über den Geist gesagt werden kann -, er sagt zum Beispiel: «Eine kleine Faser würde aus Erasmus und Fontanelle zwei Toren gemacht haben.» Man kann das selbstverständlich zugeben und dennoch auf dem Boden der Geisteswissenschaft stehen, so wie es heute charakterisiert worden ist. Denn es gilt noch viel mehr, was man zugeben kann und was dennoch die Geistesforschung nicht erschüttern wird. Nehmen wir einmal an, wenn nur ein kleines Fäserchen bei jenem Erasmus anders wäre, so würde das bedingen, von der reinen Leiblichkeit aus, daß sein Leben statt das eines Genies vielleicht das eines Tropfes geworden wäre. Nun aber, wenn es so gekommen wäre, daß die Mutter, als er noch nicht geboren worden war, von einem Banditen ermordet und Erasmus noch vor der Geburt getötet worden wäre, - was wäre denn dann mit der
Seele des Erasmus geworden? Solche Dinge zu durchschauen, das vermag schon noch der wahre Geistesforscher. Denn das scheint noch zwingender zu sein, daß der Mensch von der Materie abhängig ist; denn es hätte ja nur der Fall zu sein brauchen, er wäre als kleiner Junge gestorben, dann wäre er nicht da.
Daß die Geistesforschung irgend etwas zu leugnen hätte, was von dieser Seite her kommt, das sollten ja diejenigen nicht glauben, welche mit ihren stumpfen Erwägungen der Geistesforschung in den Weg treten wollen. Aber auf diesem Boden sieht man gerade heute noch recht Unklares, Ungenaues. Daran hat das charakterisierte grobe Denken in erster Linie Anteil; anderes noch hat Anteil: das hat noch Anteil, daß die Geisteswissenschaft zu leiden hat nicht nur von denen, die ihr also entgegentreten, sondern es hat die Geisteswissenschaft gerade auch von denen zu leiden, die oftmals von irgend welcher Seite her ja gerade Bekenner einer gewissen geisteswissenschaftlichen Richtung sein wollen und die wiederum zusammenhängen mit allerlei merk-würdigen Gesellschaftselementen auch der Gegenwart. Und dadurch wird Geisteswissenschaft mit allerlei Zeug von denjenigen, die nicht zu unterscheiden wissen - ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, aber ich muß heute mit Bezug auf etwas anderes noch darauf eingehen -, mit anderem zusammengeworfen. Geisteswissenschaft baut nicht, wie Sie ja ersehen können aus einer Eigenschaft meiner Vorträge, die oftmals getadelt wird, nämlich daß sie zu schwer seien, Geisteswissenschaft baut nicht auf die leichtgläubige Menge, baut nicht auf diejenigen, die bequemen Sinnes irgend eine Überzeugung bekommen wollen, baut nicht auf diejenigen Menschen, die wie im Traume durchs Leben gehen und alles glauben, was ihnen nur durch ihre gewiß subjektive Überzeugungskraft übermittelt wird. Geisteswissenschaft
baut nicht auf dasjenige, was in der Welt des Aberglaubens lebt, und weil gewisse Dinge in der Öffentlichkeit auf materialistischer Seite mit Recht als Unfug besprochen werden, muß schon einmal auch in der Geisteswissenschaft selbst eine scharfe Grenze gezogen werden zwischen der ehrlichen, wahren Geistesforschung, die nur der Wahrheit folgt, und demjenigen, was sich so gerne oftmals an ihre Rockschöße knüpft und was von einer Seite herkommt, wo man mit dem Aberglauben der Menschheit rechnet, der ebenso vorhanden ist wie das Pochen auf das eigne Urteil; wo man den Menschen alles mögliche vor-macht, weil man heute noch Menschen genug findet, die alles mögliche glauben, wenn es ihnen nur aus einer angeblichen Geisteswelt - unbekannt woher - verkündet werden soll. Was von dieser Seite her mit Geisteswissenschaft verwechselt werden kann - wie gesagt, es muß darauf aufmerksam gemacht werden, um es abzuschütteln -, damit hat wahre Wissenschaft, und das ist Geisteswissenschaft, wenig zu tun.
Ich will nur auf einzelnes hinweisen, weil jetzt gerade auf materialistischer Seite diese Dinge öffentlich besprochen werden und ganz gewiß unter dem Einfluß der schwerwiegenden ernsten Zeitereignisse immer mehr und mehr werden besprochen werden. Ich will zeigen, wie unrecht diejenigen haben, die Geisteswissenschaft mit irgend einer Form, sei es des gewöhnlichen, sei es des höheren Aberglaubens, zusammenbringen, jenes höheren Aberglaubens, der allerlei Ziele in der Welt verfolgt und eigentlich nur im Grunde so wirkt, daß er zunächst die Menschen in die Welt stellt, die höhere Anlagen, eine hellsichtige Begabung haben sollen. Wahres Hellsehen besteht in dem, was oftmals und heute wiederum geschildert worden ist. Aber das, was die Leute heute Hellsehen nennen, ist eigentlich untersinnlich,
ist aber oftmals auch nur erschwindelt. Aber da rechnen wir eben nicht mit dem, was im Untergrunde steht, sondern mit der Wirkung. Darum muß man rechnen mit dem, was das erschwindelte Hellsehen mit dem Aberglauben zu machen in der Lage ist. Und da ist es möglich, daß allerlei unlautere Bestrebungen, Strömungen auftreten, wo man ganz etwas anderes erreichen will als dasjenige, was etwa auf dem Gebiete der Wahrheit liegt. Dasjenige, was die Menschen wissen müssen, was dadurch erreicht wird, ist, daß man zuerst - erlauben Sie den harten Ausdruck -die Menschen dumm macht, sie benebelt, indem man ihnen allerlei Okkultismen vorführt, was auf ihren Aberglauben wirkt, und mit den dummgemachten Menschen dann allerlei Dinge ausführt, die durchaus nicht auf das Gebiet der Lauterkeit und Ehrlichkeit gehören. Geisteswissenschaft hat ebenso den Beruf und die Notwendigkeit, auf diese Auswüchse des modernen Lebens hinzuweisen, wie der Materialismus. Und wenn sie dem Materialismus auf seinem Gebiete recht gibt in solchen Fällen, wie ich es bei Lamettrie gezeigt habe, so darf sie ihm auch recht geben, wenn er sich wendet gegen alle Auswüchse eines scheinbaren GeistErlebens, das aber nichts anderes ist als das Leben in dem blinden Aberglauben.
Da erschien 1912 ein Almanach, ein Jahrbuch, herausgegeben von einer Persönlichkeit, die in einer Stadt des Westens als eine höhere Hellseherin verehrt wird von vielen, die eben in der Weise benebelt werden, wie es eben erzählt worden ist. 1912 auf 1913, also im voraus, erschien dieses Jahrbuch. In diesem Jahrbuch, erschienen 1912 für 1913, findet sich über Österreich folgende Notiz: «Derjenige, der in Österreich zur Regierung bestimmt ist, wird nicht regieren. Regieren wird ein junger Mann, der vorläufig zur Regierung noch nicht bestimmt ist.»
Und mit noch größerer Deutlichkeit wird im Almanach für 1914, der schon 1913 erschienen ist, auf diese Sache zurückgekommen. Es kann leichtgläubige Menschen geben, die nichts mehr und nichts weniger glauben als : da habe sich eine große Prophetie erfüllt, denen gar nicht in ihrem blinden Glauben klar zu machen ist, daß hier unlautere, in der europäischen Welt lebende Strömungen gewirkt haben, welche den Aberglauben und allerlei dunkle Okkultismen benützt haben, um irgend etwas in die Welt hinein-zubringen. Wie das zusammenhängt mit allerlei unterirdischen Strömungen, das kann derjenige übersehen, der berücksichtigt, daß ein Pariser Blatt, «Paris am Mittag», lange, lange vor den gegenwärtigen Wirren und ungefähr gleichzeitig mit dem Erscheinen der eben besagten Notiz in dem gekennzeichneten Almanach einer angeblichen Hell-seherin - ein Pariser Blatt, das nun durchaus nicht Anspruch darauf macht, irgendwie okkultistisch zu sein, sondern das sich vergleichen läßt mit anderen Blättern, die am Mittag erscheinen, - daß dieses Blatt eben auch lange Monate vorher es als seinen Wunsch ausgedrückt hat, daß der österreichische Erzherzog Franz Ferdinand ermordet werden möge. Da wird man schon auf gewisse unterirdische Zusammenhänge kommen. Und dieses selbe Blatt hat bei der Besprechung der dreijährigen Dienstzeit geschrieben:
Unter den Allerersten, die ermordet werden, wenn es zu einer Mobilisierung kommen soll, wird Jaurés sein.
Dieselbe Persönlichkeit, die jenen Almanach erscheinen läßt, ist in den ersten Augusttagen 1914 nach Rom gereist, um dort gewisse Leute zu beeinflussen, die eben solchem Einflusse zugänglich sind, nach einer Richtung hin, von der ich nicht sagen will, daß sie mit den Hauptursachen der Stellung Italiens verknüpft ist, die aber schon gewirkt hat in dieser Sache.
Diese Dinge werden von mir nur deshalb besprochen, weil sie von anderer, von materialistischer Seite besprochen werden. Sie müssen aber besprochen werden, damit man sieht, daß wahre Geisteswissenschaft mit derlei Dingen, überhaupt mit allem auf die Leichtgläubigkeit der Menge rechnenden Aberglauben und mit dem, was unter dem Mantel des Aberglaubens im großen und im kleinen erschwindelt und getan wird, nichts zu tun hat. Geisteswissenschaft wird als wirkliche Wissenschaft, die sich neben die andere Wissenschaft hinstellen kann, eben erst erscheinen, wenn man sie wird frei halten von allem, was heute noch so leicht mit ihr verwechselt werden kann und was mit ihr nicht nur verwechselt wird unter dem Einfluß des beschränkten Urteils oftmals, das einfach nicht unterscheiden kann, sondern was auch verwechselt wird aus bösem Willen heraus. Und in der Literatur, die der Geisteswissenschaft entgegengeworfen wird, wird viel gewirtschaftet gerade damit, daß man dasjenige, was man eben erlügen muß, wenn man Geisteswissenschaft charakterisieren will, so erlügt, daß Geisteswissenschaft dadurch auf denselben Boden gerückt wird, wo diejenigen Dinge stehen, die selbstverständlich von Geisteswissenschaft so scharf bekämpft werden müssen, wie sie von der materialistischen Wissenschaft bekämpft werden.
Gerade indem man solche Dinge erkennen wird, wird aber Geisteswissenschaft immer mehr und mehr in ihrer Reinheit hervortreten in dem, was sie der Menschenseele sein kann. Zeugt nicht das Buch, das jetzt als neuestes Buch von Ernst Haeckel, das heißt, von einem ernsten Forscher erschienen ist, «Ewigkeitsgedanken», wie die bloße Naturwissenschaft gegenüber solch großen, in die Menschheitsentwickelung tief einschneidenden Ereignissen ratlos da-steht, indem sie nichts anderes zu sagen weiß durch das Buch des Ernst Haeckel als :
«Millionen von Menschen sind diesem entsetzlichen Völkerschlachten bereits zum Opfer gefallen. .. Müssen wir doch täglich in den Zeitungen die lange Liste von hoffnungsvollen Jünglingen und von treusorgenden Familienvätern lesen, welche in der Blüte der Jahre ihr Leben dem Vaterlande zum Opfer gebracht haben. Da erheben sich tausendfach die Fragen nach dem Wert und Sinn unseres menschlichen Lebens, nach der Ewigkeit des Daseins und der Unsterblichkeit der Seele ... Der jetzige Weltkrieg, in dem das Massenelend und die Leiden der Einzelnen unerhörte Dimensionen angenommen haben, muß allen Glauben an eine liebevolle Vorsehung zerstören ... Die Schicksale jedes einzelnen Menschen unterliegen ebenso wie die Geschicke jedes anderen Tieres dem blinden Zufall von Anfang bis zu Ende...» - Das ist es, was ein ernster Forscher wie Haeckel von seinem naturwissenschaftlichen Standpunkt aus noch allein zu sagen hat: Hunderte und Hunderte von Toten umgeben einen in diesen Wochen; das bezeugt, daß der Mensch keine geistige Bestimmung haben kann, denn man sieht ja, wie er einem blinden Schicksal verfällt.
Nicht etwa, daß eine solche Zeit die Gründe gäbe für die Geisteswissenschaft, aber man muß einsehen, was Geisteswissenschaft auf geistigem Gebiete für das Menschenleben werden kann: dasjenige, was den Menschen trägt, den Menschen hält, weil es ihn bekannt macht mit dem, womit ihn keine Naturwissenschaft bekannt macht. Naturwissenschaft kann den Menschen nur bekannt machen mit dem, wodurch sein Leib zusammenhängt mit dem sinnlichen Universum. Geisteswissenschaft macht den Menschen dadurch, daß sie ihm auf forscherischem Wege zeigt, daß er eine unsterbliche Seele hat, damit bekannt, daß man wissen kann: Diese Seele des Menschen hängt zusammen mit dem ewigen Werden. Der Mensch ist in der Ewigkeit verankert durch seine
Seele und seinen Geist, wie er in der Zeitlichkeit durch den Leib verankert ist.
Wenn man fragt, ob der Mensch so etwas braucht, so muß gesagt werden, daß es dafür keine Beweise geben kann, ebensowenig wie dafür, daß er essen und trinken muß. Aber so wie der Mensch erlebt durch den Hunger und Durst, daß er essen und trinken muß, so erlebt er an seiner Seele immer wieder, daß er wissen muß. Und je mehr man Wissen verlangt und nicht bloß Glauben, wird man erkennen, daß er wissen muß um die Unsterblichkeit seiner Seele. Man kann ableugnen, daß der Mensch dieses Wissen verlangt, aber die Ableugnung ist nur eine theoretische. Es wird immer mehr und mehr die Zeit kommen - und wir stehen schon an ihrem Anfang -, da wird, wie einfach der Hunger sich geltend macht im gesunden Menschenleibe, sich geltend machen bei dem Menschen, der sich hinüber-lebt in die Zeit, die mit der Gegenwart beginnt, der Durst nach Wissen von der geistigen Welt, nach Wissen von dem unsterblichen Charakter der Seele selber. Und ungestillter Durst wird es sein, wenn es eine Geisteswissenschaft nicht geben wird. Das wird sich zeigen in den Wirkungen. Theoretisch wird man es ableugnen können - in den Wirkungen wird es sich zeigen. Es wird sich zeigen darin, daß sich die Menschen in ihren Seelen verödet finden werden, nicht wissen werden, was sie mit dem Leben anzufangen haben, daß sie zwar die äußeren Verrichtungen vollführen, aber nicht wissen, welches der Sinn des Lebens ist, und daß sie verdursten an einem Drang nach dieser Enträtselung des Sinnes des Lebens. Nach und nach wird es sich in den Intellekt erstrecken; nach und nach wird sich zeigen, wie das Denken der Menschen immer gröber und gröber wird. Genug Grobheit haben wir ja schon heute an einem Beispiel gefunden. Kurz, die Entwickelung der Menschen
würde einen Abstieg erfahren, wenn sie nicht befruchtet werden könnte durch Geisteswissenschaft.
Mögen die Zeiten, die wir heute durchleben und die auf so vielen Gebieten den Menschen zum Ernst auffordern, auch ein Merkzeichen dafür sein, daß die Zeit beginnt, in der die Menschen ein Wissen um die Unsterblichkeit haben müssen und daß Geistesforschung der Weg dazu ist. Der Geistesforscher selbst weiß sich im Einklang mit all denjenigen, die, wenn sie auch noch nicht Geistesforschung gehabt haben, doch durch die ganze Art ihrer Seelenbetätigung in der geistigen Welt webend und lebend waren. Der Geistesforscher weiß sich im Einklang mit denjenigen, die einfach wußten, was leben in der geistigen Welt heißt. Als Goethe gefragt wurde, warum er die Pflanze durch Ideen erkennen wolle, da doch die Ideen etwas Abstraktes seien, sagte er: Dann sind meine Ideen, die ich in mir zu erleben glaube, unmittelbare Wirklichkeit, denn ich sehe ja meine Ideen in der Wirklichkeit drinnen. - Daher war es auch Goethe, der, wenn er auch noch nicht Geisteswissenschaft hatte, da, wo er durch den dichterischen Genius geistig-seelisch entrückt war, etwas zu sagen wußte in einer zwar dichterischen, aber treffsicheren Weise über den Charakter der geistigen Welt.
Haben wir doch heute sagen müssen : Derjenige, der sich durch die Entwickelung seines Denkens in die geistige Welt hineinlebt, er lebt und webt in den werdenden seelischen Wesenheiten. Und der Mensch ist auch, wenn er sich vom Leibe befreit weiß, eine geistig-seelische Wesenheit, die im Werdenden lebt. Das Gewordene, das fest Seiende, das ist nur in der äußeren sinnlichen Welt vorhanden, in der der Mensch lebt, solange er im Leibe ist und dann, wenn er nur durch den Leib wahrnimmt. Sobald der Mensch zu dem geistigen Wesen hinaufsteigt, wird er von dem Werdenden
ergriffen. Das weiß Goethe. Er weiß auch, daß der Mensch so, wie er sich durch sein eigenes Fühlen in sein inneres Wohlsein hineinlebt, sich auch hineinleben kann in ein Gefühl, das man wohl als Liebe bezeichnen darf. Das ist das Überraschende und wird es immer sein, wenn man zu Geistmenschen kommt, daß sie aus ihrem Leben in der geistigen Welt das Richtige sogar mit dem richtigen Wort zu sagen wissen. Deshalb weiß Goethe auch zu sagen: man lebe in dem Werdenden. Und wenn man sich hineinentwickelt in dieses Werdende, so leben die Gedanken in diesem Werdenden selber. Nicht die gewöhnlichen Gedanken -die müssen zuerst überwunden werden, die kann man nur im Sinnensein herinnen der Werdewelt als ein Bleibendes, ein Dauerndes, einverleiben. Erst dadurch, daß in dem Werdenden ergriffen wird das, was im Gedanken festgehalten werden kann, befestigt sich auch der Gedanke und wir können ihn mittragen mit der unsterblichen Seele durch die Pforte des Todes. Daher spricht Goethe gegen den Schluß seines Prologs im Himmel, den er auf der Höhe seines Lebens geschrieben hat, die schönen Worte aus, mit denen ich diese Betrachtungen heute abschließen will, weil in ihnen wirklich in einer Zeit, die vor der Entwickelung der Geistesforschung, wie wir sie heute meinen, liegt, ein Dichter aus dem dichterischen Genius heraus über die geistige Welt so spricht, wie man über sie sprechen muß aus Erkenntnis heraus, indem er zuerst hinweist, oder hinweisen läßt den Herrn auf dasjenige, was der Mensch braucht, solange er im sinnlichen Leibe lebt. Damit er nicht in Behaglichkeit, in Bequemlichkeit ausartet, weist der Herr den Mephisto hin auf diejenigen, die Geistwesen sind. Und leib-frei ist der Mensch selber ein solches Geistwesen. Goethe weist mit sicher treffenden Worten auf die Eigentümlichkeit der geistigen Welt hin. Denn Sie werden in diesen Worten
das erkennen, was ich selber erkennen mußte in ihnen. Nachdem ich das alles ausgebildet hatte, was ich heute vorgetragen habe, überraschte mich die wunderbare Übereinstimmung dieser Goetheschen Worte, die ich vorher nicht erkannt hatte, die wunderbare Übereinstimmung dieser wenigen Goethe-Worte mit dem Grundcharakter der Welt, der die unsterbliche Menschenseele angehört: «Doch ihr, die echten Göttersöhne» - es sind geistige Wesen gemeint, wie der Mensch ein Geistwesen als unsterbliche Seele ist -,
«Doch ihr, die echten Göttersöhne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,
Umfass' euch mit der Liebe holden Schranken,
Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Befestiget mit dauernden Gedanken.»
Hingewiesen ist auf dasjenige, was im reinen Geistwesen als sein Ureigentümliches lebt, was aber in der Menschen-seele erkannt wird als ihr unsterbliches Teil. In diesen Worten, die direkt eine Charakteristik desjenigen sind, was in der Menschenseele ergriffen werden kann, schon wenn sie im Leibe lebt, als das Unsterbliche, und wovon man wissen kann, daß es durch die Pforte des Todes geht, wenn sie eintritt in das Werdende und hinübernimmt in das reine Reich des Geistes dasjenige, was sie hier in schwankender Erscheinung erlebt hat, um es in Gedanken umzusetzen, die dann dauernd werden können und mitgenommen werden können durch die Pforte des Todes. Und was in schwankender Erscheinung lebt, befestigt die Seele, die durch des Todes Pforte tritt, als ein unsterbliches, als ein ewiges Wesen, in dauernden Gedanken, die fortan so ihr Leben ausmachen, wie hier in der physischen Welt der Leib das Leben der Seele sinnlich ausmacht.
DIE DEUTSCHE SEELE IN IHRER ENTWICKELUNG Berlin, 13. April 1916
Diejenigen der verehrten Zuhörer, weldie öfter bei diesen Vorträgen sind, die ich nun sthon seit Jahren hier in diesem Saale halten darf, wissen, daß ieh nur in den allerseltensten Fällen in diese Betrachtungen persönliche Bemerkungen einmische. Heute aber möchte ich Sie bitten, mir einleitungsweise eine solche persönliche oder wenigstens anscheinend persönliche Bemerkung zu gestatten. Denn ich müßte mir eigentlich recht albern, einfältig vorkommen, wenn ich glauben könnte, daß meine Ausführungen gerade zu diesem heute gestellten Thema etwas anderes sein könnten, als etwas höchst Unvollkommenes, ja vielleicht sogar Stümperhaftes. Dasjenige, was ich skizzenhaft andeuten will mit Bezug auf das Wesen und die Entwickelung der deutschen Volksseele, könnte der Teil, sagen wir, ein Kapitel einer Wissenschaft sein, die es aber heute noch nicht gibt, einer Wissenschaft, die einem vorschweben kann als ein hohes Ideal. Aber was müßte alles zusammenarbeiten, um eine solche Wissenschaft wirklich zustande zu bringen! Erstens müßte vielleicht nicht eine, sondern eine Reihe von Persönlichkeiten müßte zusammenwirken, die den hingebungsvollen Forschersinn für alles, was Volkswesen, Volksart, Volksentwickelung ausmacht, haben, den etwa Jakob Grimm gehabt hat, der ja seine Studien auf die beiden Außerungen der Volksseele, die Mythe, die Sage und die Sprache, hauptsächlich gelenkt hat. Allein derselbe Geist müßte sich verbreiten
über viele andere Außerungen des Volksseelen-wesens und müßte in der Lage sein, Gesetze über dieses Volksseelenwesen zu finden, welche sich mit einigen der so wunderbaren Gesetze vergleichen können, die über die Sprache zum Beispiel der deutsche ausgezeichnete Forscher Jakob Grimm gefunden hat.
Nun, selbstverständlich kann ich mich nicht einer solchen Wissenschaft rühmen. Allein es war mir doch Gelegenheit geboten, die langjährige Freundschaft eines guten Nachfolgers und Schülers Jakob Grimms zu genießen, des österreichischen Dialekt-, Sagen- und Mythenforschers, später auch Goethe-Forschers Karl Juijus Schröer. Ich habe darüber ja schon in diesen Vorträgen gesprochen, außer über das, was er, ich möchte sagen, so recht aus dem Geiste Jakob Grimms heraus zu erforschen versuchte, namentlich über die intimen Lebensbeziehungen der deutschen Volksseele zu den verschiedenen Volksseelen, die in Österreich walten. Was er über das Wesen und die Bedeutung der deutschen, in Österreich herrschenden Dialekte zu ergründen versuchte -und es sind da viele herrschend -, daran durfte ich durch viele Jahre - und ich darf sagen, mit innigem Anteil - teilnehmen, durfte dann auch sehen, wie Volkswesenheit, namentlich also deutsche Volkswesenheit sich da auslebt, wo sie sich hineinschieben muß in slawisches, in magyarisches Volkstum. Man konnte schon gerade in denjenigen Jahren, in denen ich jung war, Studien machen über die gegenseitigen Beziehungen von Volksseelen. Wenn man ins Auge faßte, was sich in den siebziger, in den achtziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts in Österreich abspielte, da konnte man lebendig anwenden, was solch ein Forscher, der Schüler Jakob Grimms ist, aus seiner Wissenschaft heraus über das Volksseelenwesen zur Geltung bringen kann. Und dann durfte ich das vertiefen, was sich mir auf diese
Weise geboten hatte, wiederum durch eine intime Freundschaft mit dem nun gleich Schröer längst schon verstorbenen Sagen- und Mythenforscher Ludwig Laistner, dem Freunde Paul Heyses. Und so war mir wenigstens Gelegenheit geboten, die Art und Weise kennenzulernen, wie man sich hineinleben kann in jene äußere Wissenschaft, die alles das zusammenfaßt, was gesetzmäßig im Volksseelenwesen und seiner Entwickelung waltet.
Zweitens aber müßte derjenige, der eine solche Wissenschaft begründen wollte, wie sie als Ideal mir vorschwebt, gründlich die Disziplin an sich selber erfahren haben, welche die moderne naturwissenschaftliche Denkungsweise und ihre Methoden geben. Dazu darf ich wenigstens sagen, daß ja meine ganze Jugendbildung auf Naturwissenschaft aufgebaut ist und daß ich lange Zeit eine gewisse Erziehung in dieser Methode genossen habe.
Aber noch eines Dritten bedarf all das, was durch eine im Sinne Jakob Grimms gehaltene Volksseelenkunde äußerlich gefunden und mit derjenigen Wahrheits- und Erkenntnisgesinnung durchtränkt ist, die aus naturwissenschaftlicher Disziplinierung heraus folgt. Wer dieses Ideal von Wissenschaft vor sich hat, müßte es nämlich dadurch begründen, daß er als Drittes hinzufügte zu diesen beiden dasjenige, was ich versuchte, als die moderne Geisteswissenschaft nun durch Jahre hindurch immer wieder in diesen Vorträgen darzulegen. Denn nur durch das Zusammenwirken dieser drei Geistesströmungen der menschlichen Seele könnte wirklich das zustande kommen, was aus einer Volksseelenwissenschaft heraus Licht verbreiten kann über die Eigentümlichkeiten des Waltens und Wirkens einer Volksseele. Und so möchte ich denn andeutungsweise und skizzenhaft, und aus den angegebenen Gründen selbstverständlich stümperhaft, heute einiges über Wesenheit und
Entwickelung der deutschen Seele, der deutschen Volksseele, sprechen.
Sie wissen, daß derjenige, der im Sinne der Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist, spricht, von Volksseele nicht in einem solchen Sinne spricht, wie man so sehr häufig von Volksseele redet, wenn man ein Abstraktling oder ein mehr oder weniger mechanistisch denkender Wissenschafter ist, sondern daß ein solcher Geistesforscher von der Volksseele als von etwas wirklich Vorhandenem spricht, so wie innerhalb der physischen Welt der einzelne Mensch vorhanden ist. Selbstverständlich kann ich im heutigen Vor-trage nicht all das wiederholen, was ich seit Jahren immer ausgeführt habe. Aber man braucht sich ja nur aus den hier oft angeführten Schriften die sogenannten Beweise dafür zu holen, wie berechtigt es ist, aus geisteswissenschaftlicher Forschung heraus, wirklich von solchen höheren, nicht bis zur physischen Verleiblichung heruntergestiegenen Seelen zu sprechen, wie das hier von der Volksseele geschehen soll. Will man aber im geisteswissenschaftlichen Sinne über die Volksseele sprechen, muß man zunächst gewisse Dinge ins Auge fassen, welche sich auf die einzelne Seele des Menschen beziehen. Denn zunächst haben wir ja das Wirken der Volksseele so vor uns, daß das Wirken der einzelnen Menschenseelen, die Artung der einzelnen Menschenseelen gewissermaßen herausströmt, herauskraftet aus dem, was Volksseele ist. Nun gibt es gewisse Dinge, welche im Leben, namentlich im seelischen Leben - aber dieses seelische Leben ist ja mit dem physischen Leben zwischen der Geburt und dem Tode innig verknüpft - für die Geistesforschung in einem ganz anderen Sinne noch in Betracht kommen, als sie in Betracht kommen für dasjenige, was man heute oftmals Naturwissenschaft nennt, oder wenigstens für dasjenige, innerhalb dessen man Naturwissenschaft heute so häufig begrenzt.
Zuerst muß ich da Ihren Blick auf die Entwickelung des einzelnen Menschen lenken. Es gibt für den Geistesforscher gewisse Abschnitte im menschlichen Leben, welche er besonders ins Auge fassen muß, um hinter die Geheimnisse der Entwickelung des Menschen, des ganzen, vollen Menschen zu kommen. Wie gesagt, ich kann heute das Einzelne nicht beweisen, ich kann nur Ergebnisse der Geistesforschung anführen. Ich muß in bezug auf die Begründung auf die früheren Vorträge oder auf meine Schriften verweisen. Ein solcher Abschnitt ist zunächst gegeben in denjenigen Jahren, in denen der Mensch in seiner Entwickelung dem Zahnwechsel unterworfen ist. Gewiß, vieles von dem, was ich jetzt werde sagen müssen, nimmt sich gegenüber den heute so fest geltenden und in so scharf umrissenen Begriffen eingeschnürten naturwissenschaftlichen Vorstellungen wie flüssig aus. Aber Geisteswissenschaft muß ja in vielen Fällen wirklich eine Rolle spielen, die ich etwa vergleichen möchte mit dem, was der Maler als Stimmung über eine Landschaft ausbreitet, die er sonst, insoferne Häuser und Bäume in Betracht kommen, in festen Umrissen malt. Was an Häusern und Bäumen in festen Umrissen da ist, was gewissermaßen scharf umrissene Zeichnung ist, wird erst in der richtigen Weise, ich will jetzt nur sagen, malerisch, wemi alles, was nun Stimmungsgehalt des Bildes ist, ausgegossen ist. Und dieser Stimmungsgehalt ist wahrhaftig nicht in so feste Formen zu bannen, wie dasjenige, was unten an Häusern, Bäumen und dergleichen gezeichnet wird. Also das siebente Jahr ungefähr - selbstverständlich sind alle diese Zahlen nur ungefähr aufzufassen -, die Zeit des Zahnwechsels, ist besonders ins Auge zu fassen. Und da erscheinen dem Geistesforscher in der menschlichen Entwickelung gewisse Vorgänge, die gewiß feiner sind, die, ich möchte sagen, wie nur in der Stimmung ausgegossen
sind über das menschliche Seelenleben, die aber zum Verständnisse dieses Seelenlebens von hoher Wichtigkeit sind. In diesem Zahnwechsel drückt sich für den Geistesforscher ein vollständiges Abstreifen desjenigen aus, was als physische Kräfte bis dahin in ihm gewirkt hat, und wie das Herausdrängen eines Wesens an die Oberfläche, das gewiß schon seit langem an die Oberfläche wollte, das aber, ich möchte sagen, wie eine Verdoppelung seines Wesens ist. Und in dem Ausstoßen der ersten Zähne und ihrem Ersatz durch die zweiten Zähne drückt sich nur an einer besonderen Stelle markant, besonders hervorragend etwas aus, was im ganzen menschlichen Organismus in dieser Zeit vor sich geht.
Nun muß der Geistesforscher ins Auge fassen, daß das, was uns in der menschlichen Entwickelung im ganzen, vollen Menschen entgegentritt, uns das äußerlich Materielle, das Stoffliche immer durchzogen, durchtränkt zeigt von Geistig-Seelischem. Wenn man aber menschliche Entwickelung ins Auge faßt so, wie man es heute wissenschaftlich gewöhnt ist, dann faßt man diese Entwickelung so auf, daß man die Ereignisse nun eigentlich bloß in der Zeitenfolge verfolgt. Man betrachtet einen früheren Zustand, einen späteren Zustand, wieder einen späteren und so weiter, und denkt sich den späteren aus dem früheren immer hervorgehend. So betrachtet man ja die Entwickelung. Aber wie es nicht richtig wäre, den menschlichen Organismus in räumlicher Beziehung so wie eine Maschine zu betrachten, daß man die angrenzenden Teile nur in Beziehung zueinander bringt, wie man ihn so betrachten muß, daß gewissermaßen geheimnisvolle Beziehungen zwischen den entferntesten Organen sind, die nicht räumlich aneinander grenzen, so muß man, wenn man den ganzen vollen Menschen betrachtet, auch dasjenige, was in der
Aufeinanderfolge der Zeit geschieht, so betrachten, daß sich die Dinge gewissermaßen nicht einfach in der Zeitenfolge auseinander entwickeln, sondern daß das, was mit dem Menschen geschieht, vielfach übereinander greift. Sie werden gleich sehen, in welchem Sinne ich das meine. Für den Geistesforscher ist es klar, daß sich in der menschlichen Entwickelung bis zum Zahnwechsel hin Geistig-Seelisches, nun sagen wir, aus seinem Inneren heraus drängt - ich kann heute wegen der Kürze der Zeit nicht bestimmter sprechen -, und durchtränkt, gewissermaßen physiognomiert das Stoffliche, das Materielle. Was drängt da eigentlich als Geistig-Seelisches gerade in der angedeuteten Zeit heraus?
Will man darauf kommen, so muß man zunächst einen Unterschied zwischen der Knaben- und der Mädchenentwickelung machen. So wollen wir denn zuerst sprechen von der Mädchenentwickelung bis zum Zahnwechsel. Man muß eine ganz andere Zeit der menschlichen Entwickelung ins Auge fassen, wenn man geisteswissenschaftlich darauf kommen will, was da eigentlich aus des Menschen Inneren nicht bloß in das Gesicht, sondern in die ganze Physiognomie des Menschen hineindrängt, was ihn auch durchdringt und durchtränkt bis zu seinem Zahnwechsel hin, was da in ihm arbeitet und wirkt und lebt und kraftet.
Will man finden, was da im Mädchen drinnen steckt und die Organe gleichsam plastisch formt, dann muß man zunächst den Blick wenden auf gewisse Eigentümlichkeiten, aber innere Eigentümlichkeiten, nicht auf dasjenige, was die Seele durch die Erziehung, durch die Schule gelernt hat, sondern auf die innere Konfiguration, auf die innere Formung der Seele. Zunächst, so etwa in der Zeit vom zwanzigsten Jahre an bis zum achtundzwanzigsten, dreißigsten Jahre hin, kommt seelisch dasjenige zum Vorschein, wird
für die äußere Beobachtung anschaulich, was man zunächst ins Auge fassen muß. Dann muß man beiseite lassen, was ungefähr in der Zeit vom achtundzwanzigsten Jahre bis zum fünfunddreißigsten, sechsunddreißigsten Jahre liegt, und muß wiederum das ins Auge fassen, was vom sechsunddreißigsten Jahre bis zum zweiundvierzig-, dreiundvierzig-, vierundvierzigsten Jahre in der betreffenden Seele liegt.
Wenn man den Menschen im allgemeinen prüft, so kann man ja allgemeinere Grundsätze geltend machen. Wenn man einen einzelnen Menschen prüfen will, so wird jeder selbstverständlich leicht einwenden können, aber der Einwand ist billig, ich kann jetzt nur nicht darauf eingehen -:
Nun ja, da muß man also, wenn man den Menschen verstehen will, bis zu seinem Zahnwechsel warten, bis er so alt geworden ist. Gewiß, für den einzelnen Menschen muß man ja auch warten, wenn man ihn verstehen will. Aber Sie wissen ja, Wissenschaft wird nicht bloß durch einzelne Beobachtungen erlangt, sondern dadurch, daß das, was in einem Falle beobachtet wird, auf das Allgemeine übertragen wird. Und nun muß man versuchen zu erkennen, wie gewisse Eigentümlichkeiten der Seele in der angedeuteten Art in diesen Jahren sich seelisch darleben. Und wenn man gewissermaßen - es ist ein grobes Wort, das ich dafür gebrauche - eine Art von Zusammenmischung der Eigenschaften in den ersten zwanziger Jahren und der Eigenschaften in den zweiten dreißiger Jahren bis zum zweiundvierzigsten, dreiundvierzigsten Jahre vornimmt und sich eine Vorstellung bildet, was das seelische Leben in diesen Jahren ist, dann kommt man darauf, daß sich das beim Mädchen bis zum Zahnwechsel hin in das Körperliche hineinpreßt, drängt. Wie sich das Körperliche auskonfiguriert, wie es sich plastisch bildet, darinnen wirkt und lebt dasjenige,
was in späteren Jahren erst als Seelenkonfiguration in der angedeuteten Art zum Vorschein kommt.
Betrachten wir nun den Knaben bis zum siebenten Jahre ungefähr, bis zum Zahnwechsel. Da müssen wir, wenn wir ihn verstehen wollen, nicht zwei Zeiträume, sondern einen Zeitraum der menschlichen Seelenentwickelung ins Auge fassen, nämlich den Zeitraum, der gerade etwa zwischen dem achtundzwanzigsten bis fünfunddreißigsten Jahre liegt. Wenn wir uns das, was in diesem Zeitraum seelisch zum Vorschein kommt, zu einer Vorstellung bilden und dann dasjenige ins Auge fassen, was drängt und treibt zur ganzen physiognomischen Ausgestaltung, gesetzmäßigen Ausgestaltung und Plastizierung des Knabenleibes, dann kommt man zu einem gewissen Verständnisse des Zusammenhanges zwischen dem Äußerlich-Leiblichen und dem Seelisch-Geistigen.
Dann hat man ins Auge zu fassen dasjenige, was im zweiten Zeitraum der menschlichen Entwickelung liegt. Dieser zweite Zeitraum dauert für den Geistesforscher vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, also so bis zum drei-zehnten, vierzehnten, fünfzehnten, sechzehnten Jahre. In der Zeit müssen wir wiederum unterscheiden zwischen dem Knaben- und dem Mädchenorganismus. Was der Mädchen-Organismus hier leiblich-seelisch weiter hinzufügt, ist jetzt gerade dasjenige, was der Knabenleib in seinen ersten sieben Jahren sich einverleibt. Also gerade dasjenige, was so zwischen dem achtundzwanzigsten und fünfunddreißigsten Jahre seelisch durchlebt wird und was sich der Knaben-leib dann in diesen Jahren einverleibt, das ist das, wovon wir früher sagen mußten, daß es der Mädchenleib sich in der Zeit bis zum Zahnwechsel einverleibt. So sehen wir also, daß da die Zustände eigentlich übereinander greifen; daß dasjenige, was später seelisch, also in dem verfeinerten
seelisch-geistigen Zustande, in dem verinnerlichten Zustande zum Vorschein kommt, zunächst im dumpfen Unterbewußten formend, belebend auf den Menschen wirkt, so wie er uns als physischer Mensch entgegentritt.
Und wenn wir dann die späteren Entwickelungszeit-räume ins Auge fassen, so müssen wir sagen, daß sie allerdings nicht so scharf begrenzt sind wie die ersten, daß aber für eine feinere Beobachtung des menschlichen Lebens in einer ähnlichen Weise spätere Zeitabschnitte wohl ins Auge zu fassen sind. Aber es tritt dasjenige, was dann entwickelt ist, in einer innerlicheren Form auf. Was früher an dem Organismus gearbeitet hat, wird von der Geschlechtsreife an so, daß es sich gewissermaßen zurückzieht von dem Durchtränken, sagen wir, Durchphysiognomieren des Organismus, und innerlich sich entwickelnd wird. Da kann dann von dem, der überhaupt einen Sinn für solche Beobachtungen hat, deutlich beobachtet werden, wie von der Geschlechtsreife an bis in die ersten zwanziger Jahre hin sowohl im männlichen wie im weiblichen Organismus in einer mehr individuelleren Art die beiden späteren Zeiträume - der einheitliche und der getrennte - noch durcheinanderwirken, wie aber dann gewissermaßen diese Unterscheidung aufhört, die Seele ein Einheitlicheres wird, so daß wir nicht mehr sagen können: Wir finden etwa von den ersten zwanziger Jahren an in der Seele selber dasjenige, was sich in einer solchen Weise auf andere Zeiträume beziehen ließe, wie sich die leiblich-seelische Entwickelung in den ersten zwei oder drei Lebensabschnitten charakterisieren läßt. Wir finden die Seele mehr aus einem Einheitlicheren heraus wirkend; wir finden sie mehr aus einer gewissen innerlichen harmonischen Fülle heraus sich als Einheitliches geltend machend. Dennoch können wir wiederum mit einer feineren Beobachtung scharf unterscheiden,
aber eben doch nur so, daß es wie eine Stimmung - und eine noch feinere Stimmung - ausgegossen ist über das Seelenleben, wie früher dieses Seelenleben selber über das Körperliche.
Wir können drei Zeiträume innerhalb der seelischen Entwickelung unterscheiden. Ich habe sie ja schon angedeutet:
von dem Anfang der zwanziger bis zum Ende der zwanziger Jahre; vom Ende der zwanziger Jahre bis zum fünfunddreißigsten, sechsunddreißigsten Jahre; vom sechsunddreißigsten Jahre bis zum zweiundvierzigsten, dreiundvierzigsten, vierundvierzigsten Jahre. Die Seele des Menschen macht da doch gewisse Entwickelungsphasen durch, die sich genau unterscheiden lassen, wenn sich auch, wie gesagt, dasjenige, was da zu unterscheiden ist, nur wie eine feinere Stimmung über das Seelenleben ausbreitet. Es ist ein Geistig-Seelisches in der Entwickelung in diesen Jahren. Und derjenige, der den Unterschied zwischen dem Geistigen und Seelischen kennt, von dem hier oftmals gesprochen wurde und auf den ich wieder zurückkommen werde, wird verstehen, was ich meine. In diesen Jahren, bis zum zweiundvierzigsten, dreiundvierzigsten, vierundvierzigsten Jahre hin, haben wir es mit der inneren Entwickelung allein, einer geistig-seelisch schattierten, zu tun. Dann beginnt eine mehr geistige Entwickelung des Inneren. Das Innere zieht sich noch mehr als in den vorhergehenden Jahren von dem Durchtränken und Durchdringen des Organismus zurück. Es lebt noch mehr in sich. Und die Möglichkeit, Zeitabschnitte für das Weitere zu unterscheiden, ist kaum angängig für den gegenwärtigen Entwickelungszustand der Menschheit. Erst wenn sich die Erden-entwickelung weitergeführt haben wird, wird sich auch für die folgenden Jahrzehnte des menschlichen Lebens eine Unterscheidung in der Weise wie für die früheren Jahre
finden lassen. So sehen wir, wie in einer ganz merkwürdigen Art Geistig-Seelisches zusarnmenwfrkt in dem, was uns als Mensch in der physischen Welt gegenübertritt.
Zu diesen Betrachtungen über die leiblich-seelisch-geistige Entwickelung des Menschen muß noch etwas hinzukommen, wenn man den Menschen so betrachten will, wie er sich ergibt, herauskraftend aus der Volksseele. Es muß hinzukommen ein Verständnis dafür, daß diese Menschenseele trotz aller Einwände des sogenannten Monismus etwas Zusammengefaßtes ist. Ich habe ja oftmals gesagt: wenn man nach der Ansicht gewisser Leute in bezug auf das Seelen- und Leibesleben Monist und nicht Dualist sein wollte, so müßte man ja auch das Wasser nur als eine Einheit betrachten und behaupten, man dürfe es durchaus nicht betrachten als etwas Zusammengesetztes aus Wasserstoff und Sauerstoff! Man kann selbstverständlich ein ganz guter Monist sein, wenn man das Wasser als aus Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzt betrachtet, ebenso, wie man ein ganz guter Monist sein kann, wenn man das menschliche Gesamtleben zusammenfaßt aus dem, was Seelisch-Geistiges ist und was Leiblich-Körperliches ist. Dabei bleibt der Mensch so, wie er uns in der äußeren physischen Welt entgegentritt, ein Monon, so wie das Wasser ein Monon ist.
Nun kann ich heute auf manches, was ich hier ja öfter ausgeführt habe, nicht zurückkommen. Sie können das in meinen Büchern «Die Geheimwissenschaft» oder auch «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» nach-lesen. Wer nicht die Zeit dazu hat, kann sich in dem kurzen Aufsatz, den ich in der jetzt eben zum Erscheinen kommenden Zeitschrift «Das Reich» geschrieben habe, über diese Dinge ganz kurz, auf wenigen Seiten unterrichten. Es muß eine Tatsache ins Auge gefaßt werden, die nicht mit den
gewöhnlichen Erkenntniskräften gefunden wird, sondern mit denjenigen Erkenntniskräften, die auf die Art entwikkelt werden, die ich oftmals hier geschildert habe. Es muß nämlich anerkannt werden eine gewisse Selbständigkeit des geistig-seelischen Lebens, eine Selbständigkeit, die auch wirklich im inneren Erleben und Erkennen beobachtet, erlebt werden kann. Es muß anerkannt werden, daß der Mensch imstande ist, durch Entwickelung gewisser Seelen-fähigkeiten das Geistig-Seelische so loszulösen von dem Leiblich-Physischen, wie der Chemiker den Wasserstoff vom Sauerstoff loslöst, wenn er das Wasser zerlegt, und daß man erkennen kann durch dieses Sicheinleben in das Geistig-Seelische, daß der Mensch durch dieses Geistig-Seelische oder sagen wir, in diesem Geistig-Seelischen andere Verbindungen eingehen kann, als bloß diejenige, die mit dem Physisch-Leiblichen besteht. So wie der Wasserstoff von dem Sauerstoff getrennt werden kann und sich dann mit anderen chemischen Elementen verbinden und andere Körper bilden kann, so geht dasjenige, was als Seelisch-Geistiges losgelöst wird in der übersinnlichen Er-kenntnis - eben nur zum Behufe der Erkenntnis -, andere Verbindungen ein, wenn das Physisch-Leibliche mit dem Tode abgeht; Verbindungen mit einer rein geistigen Welt. Sie umgibt den Menschen, wie hier oftmals ausgeführt worden ist, ebenso, wie ihn die physisch-sinnliche Welt umgibt, und leugnen kann sie nur, wer unter einer ähnlichen Gedankenverfassung leidet, wie derjenige, der noch nichts gehört hat und nichts weiß von der Luft und leugnet, daß die Luft, weil man sie nicht sehen kann, eben nicht da ist, weil im Raume nichts ist. Der Mensch gehört mit seinem Geistig-Seelischen einer geistigen Welt, einer wirklichen geistigen Welt an.
Eine weitere Erkenntnis der Geisteswissenschaft ist, daß
wir die beiden Wechselzustände zwischen Wachen und Schlafen so zu betrachten haben, daß das Seelisch-Geistige wirklich in einer gewissen Weise - es ist das aber mehr bildlich gesprochen - während des Schlafzustandes das Leiblich-Physische verläßt. Unsere Sprache ist eben nur für physische Zusammenhänge geschaffen. Man hat sozusagen keine Worte, um das auszudrücken. Man muß Worte nehmen, die die Sache mehr oder weniger bildhaft ausdrücken. Also das Geistig-Seelische verläßt das Physisch-Leibliche im Schlafzustand. Wir können also auch bildhaft sagen, dieses Geistig-Seelische ist außerhalb des Leiblich-Physischen während des Schlafes. Und wenn der Mensch wiederum aufwacht, so tritt das Geistig-Seelische in das Leiblich-Physische zurück. Das ist für denjenigen, der die Dinge durchmacht, die oftmals hier geschildert worden sind, ein wirklich erlebbarer Vorgang. Es ist nicht irgend etwas Ausgedachtes, sondern ein erlebbarer Vorgang. Und was aus dem Physisch-Leiblichen herausgeht, ist nicht nur dasjenige, was von unserem gewöhnlichen physischen Bewußtsein umfaßt wird, von jenem Bewußtsein, das ja für die physische Welt an den Leib gebunden ist - wie ich gerade in Vorträgen, die ich hier vor Wochen gehalten habe, ausgeführt habe -, sondern es ist noch ein tiefer Seelisches, ein Seelisches, das mit dem bewußt Seelischen verbunden ist, ein unterbewußtes, viel mächtigeres Seelisches, als das bewußte Seelische ist, ein Seelisches, das auf das Körperliche viel mehr wirken kann als das bewußte Seelische. Darüber kann ich vielleicht übermorgen weitere Ausführungen machen.
Nun müssen wir uns aber vorstellen, daß dieses Geistig-Seelische mit dem unterbewußten Geistig-Seelischen nicht bloß wirksam ist im unbewußten Zustande vom Einschlafen bis zum Aufwachen, sondern daß es ja den Organismus
auch vom Aufwachen bis zum Einschlafen durchdringt. Aber nur ein Teil davon, wie ich angedeutet habe, drückt sich im bewußten Geistesleben aus. Ein anderer Teil wirkt auf geistig-seelische Art, wirkt unten durch die ganze Entwickelung im menschlichen physisch-leiblichen Organismus. Dasjenige, was wir im Schlafe tun, wir tun es fort vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Nur ist, wie das schwächere Licht durch das stärkere verdunkelt wird, das, was da seelisch in unserem Leib als Unterbewußtes vorgeht, von dem für uns stärkeren Tagesbewußtsein übertönt.
Wenn wir solche Vorgänge studieren wollen, wie ich sie vorhin beschrieben habe, das Wirken einer späteren Lebenszeit in einer früheren, sagen wir, der seelischen Zustände vom achtundzwanzigsten bis zum fünfunddreißigsten Jahre in dem Knabenleib bis zum siebenten Jahre, dann müssen wir uns dieses Wirken des späteren Seelischen in dem früheren Leiblichen auch von der Art denken, wie immer Geistig-Seelisches unterbewußt in uns wirkt, immer unterbewußt in uns arbeitet durch das ganze Leben hindurch. Da unten geht Geistig-Seelisches vor sich, wirklich Geistig-Seelisches, nicht bloß feiner Leibliches. Da unten im menschlichen Organismus, in dem, was sich vollzieht, ohne daß das Bewußtsein, das den menschlichen Organismus mit seinem Wissen, mit seinem Erkennen begleitet, etwas davon weiß, in diesen untergestellten Partien des menschlichen Organismus, da lebt dann ein Teil des Geistig-Seelischen, ein Glied des Geistig-Seelischen während des wachen Tageslebens mit dem Geistigen der Umgebung so, wie unsere Lunge mit der Luft lebt, mit dem Geistigen der Umgebung, nur nicht der räumlichen Umgebung. Aber wie gesagt, auf diese feineren Begriffe kann ich nicht eingehen. Da entwickelt sich wirklich ein Leben geistig-seelischer Art zwischen einer geistigen Welt und dem
menschlichen Gesamtwesen, das ebenso wirklich, ebenso real ist, wie die Wechselwirkung zwischen der Luft und der Lunge.
Und unter dem, das sich da durch das ganze menschliche Leben hindurch abspielt, liegen die Einflüsse desjenigen, was wir Volksseele, Volksgeist und dergleichen nennen. So wie während der Zeit der individuellen menschlichen Entwickelung bis zum Zahnwechsel hin beim Mädchen oder beim Knaben dasjenige wirkt, was sich in der angedeuteten Weise später seelisch ausdrückt, so wirkt durch unser ganzes Leben hindurch ein vorhandenes Geistig-Seelisches, das ein höheres Geistig-Seelisches ist als das menschlich Geistig-Seelische, oder wenigstens ein Übergeordnetes. Das wirkt da herein, wirkt zusammen mit unserem eigenen, im Schlafe herausgezogenen Unterbewußten. Und es ist ein fortwährendes Zusammenwirken des Volksseelenhaften mit dem, was in uns auf die angedeutete Weise individuell ist, wie ein fortwährendes Wirken ist zwischen der menschlichen Lunge und der Luft. Nicht in der Sprache als solcher, nicht in dem, was sich als Kunst, als Dichtung eines Volkes, als Mythen eines Volkes zunächst auslebt - das alles sind die Wirkungen eines Über-, oder man könnte auch sagen Untersinnlichen -, sondern in einem viel Tieferliegenden gehen die geheimnisvollen Wechselwirkungen vor sich, die da bestehen zwischen dem Menschen mit Bezug auf ein gewisses Inneres, das ich eben charakterisiert habe in seinem Wesen, und dem, was wir Volksseele nennen.
Nun ist es nicht meine Art, wie Sie wissen, etwa im Sinne von Gustav Theodor Fechner oder ähnlichen, von mir übrigens hoch geschätzten Leuten, Anthropomorphismus zu treiben und anthropomorphistische Analogien zu suchen, sondern ich versuche, den Tatsachen ins Auge zu schauen, allerdings den Tatsachen ebenso in der physischen Welt wie
den Tatsachen, die sich in der geistigen Welt befinden und sich in der physischen Welt nur durch ihre Wirkungen zeigen. Da handelt es sich darum, zunächst einmal den Blick darauf zu wenden, wie denn die Eigentümlichkeit, der Charakter, die Wesenheit einer Volksseele überhaupt in den Menschen hineinwirken kann, worin diese Volksseele eigentlich besteht. Diejenigen, die billige Analogien machen, anthropomorphistisch vorgehen, nehmen den einzelnen Menschen, den Knaben, die Jugendentwickelung und so weiter, betrachten dann ein Volk, wie es sich auch aus gewissen Jugendanfängen bis zu einem gewissen Reifezustand hin entwickelt. Das, wie gesagt, ist nicht meine Aufgabe.
Wenn man nun vom geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkte, das heißt vorbereitet durch das, was ich oftmals hier als geisteswissenschaftliche Methode angedeutet habe, ins Auge faßt, was da in der geschilderten Weise in den Gesamtmenschen hereinwirkt und worin man die Volksseele zunächst vermuten kann, dann findet man ganz beträchtliche Charakterverschiedenheiten der einzelnen Volksseelen. Nun muß natürlich gerade dann, wenn von Volksseele gesprochen wird, ganz fest ins Auge gefaßt werden - ich wiederhole es nicht unabsichtlich -, daß wir ja mit den geisteswissenschaftlichen Begriffen etwas Biegsames, Schmiegsames, ich möchte sagen, in Farbenwirkung haben, während wir feste Konturen bei alle dem haben, was in der physischen Welt ist, so daß selbstverständlich sehr leicht Einwände gemacht werden können gegen dasjenige, was ich jetzt sagen werde. Aber wenn wir statt einer oder anderthalb Stunden ein paar Tage hätten, so könnten wir uns ja hier über alle diese Einwände verständigen. Selbstverständlich handelt es sich hier durchaus nicht darum, irgendeine Volksseele zu kritisieren, irgendeine Volksseele so darzustellen, als ob sie einen anderen Wert hätte als eine andere
Volksseele, sondern um objektive Charakteristik handelt es sich. Dadurch, daß manche; was ich jetzt zu sagen habe über die einzelnen Volksseelen, gesagt wird, wird der einen oder anderen noch nicht ein größerer oder geringerer Wert beigelegt, sondern es wird objektiv betrachtet.
Wenn man sich in das Wesen der italienischen Volksseele geisteswissenschaftlich vertieft, so findet man: Eine solche Volksseele wirkt nun nicht, wie ich es angedeutet habe, wie es im individuellen Menschenleben ist, so, daß ein späterer Zeitraum in einen früheren hinein seine Eigentümlichkeit prägt; sondern eine solche Volksseele wirkt aus gewissen Tiefen des Geisteswesens heraus das ganze Leben auf den Menschen ein. Selbstverständlich muß das nicht sein. Der Mensch kann das eine Volk verlassen, in das andere aufgenommen werden. Aber die Wirkungen sind trotzdem so, wenn sie sich dadurch auch modifizieren. Aber die Volksseele ist da, und das, was ich zu schildern habe, ist gewissermaßen eine Begegnung mit der Volksseele. Wer während seines ganzen Lebens in seinem Volke stehenbleibt, hat eben diese Wirkung sein ganzes Leben hindurch. Wer von einem Volk in das andere geht, wird eben zuerst die Wirkung der einen Volksseele, nachher auch die der anderen Volksseele haben. Darauf kommt es jetzt nicht an. Es wäre interessant, die einzelnen Wirkungen des Wechselns der Volksseele anzudeuten, aber dazu ist nicht die Zeit. Durch das ganze menschliche Leben hindurch kann also das, was von der Volksseele herkommt, auf dieselbe Art wirken, wie früher auf das individuelle Leben in den angegebenen Zeiträumen das, was von den Lebensstufen herkommt. Und betrachtet man die italienische Volksseele, betrachtet man sie in ihren Eigen-tümlichkeiten so, wie sie den Menschen ergreift, wenn sie dasjenige, was sie als Stimmungsgehalt zu geben hat, in die Seele hineinprägt, in den ganzen Menschen hineinprägt, so
findet man nun ganz merkwürdigerweise, daß eine gewisse starke Verwandtschaft besteht zwischen den Kräften dieser italienischen Volksseele und den individuellen Kräften, die der Mensch entwickelt eben vom Anfang der zwanziger Jahre bis zum siebenundzwanzigsten, achtundzwanzigsten, neunundzwanzigsten Jahre. Also man kann studieren die wirkliche innere Wesenheit der italienischen Volksseele, wenn man die Verwandtschaft, ich möchte sagen, die Wahlverwandtschaft studieren kann, die besteht zwischen dieser Volksseele und dem, was in der Menschenseele lebt zwischen dem zwanzigsten, einundzwanzigsten bis siebenundzwanzigsten, achtundzwanzigsten Jahre. Man muß nur wiederum hinzunehmen - aber so, daß dieses zweite Element nur anklingt - dasjenige, was so vom fünfunddreißigsten bis zum zweiundvierzigsten, dreiundvierzigsten, vierundvierzigsten Jahre in der Seele sich auslebt. Aber das stärkere Element der italienischen Volksseele ist dasjenige, was verwandt ist mit den ersten zwanziger Jahren. Es ist nur schattiert durch dasjenige, was sich eben in den späteren Jahren, wie ich angedeutet habe, auslebt. Es ergreift die Kraft der italienischen Volksseele das einzelne Individuum, den einzelnen Menschen, der sich in sie hineinstellt und sich in der Seele den Volksseelen-Stimmungsgehalt einprägen läßt, es ergreift ihn das so, wie am stärksten, am intensivsten ergriffen werden können seelisch-geistig überhaupt die Jahre zwischen dem zwanzigsten bis siebenund-zwanzigsten, achtundzwanzigsten Jahre.
Sie sehen, das menschliche Wesen ist etwas recht Kompliziertes, und man muß vieles, vieles zusammen schauen, wenn man dieses menschliche Wesen wirklich studieren will. Aber Sie werden aus dem Angedeuteten doch erkennen, daß über alles, was als italienisches Volkstum angesehen werden kann, wie eine Stimmung ausgegossen ist
dasjenige, was aus einer solchen Volksseele kommt, die in der angedeuteten Art verwandt ist mit der menschlichen Individualität. Etwas, was innig verwandt ist mit dem, was in der Seele lebt vom zwanzigsten bis zum achtundzwanzigsten Jahre ungefähr, prägt herein die italienische Volksseele in den Menschen.
Nimmt man die französische Volksseele, so prägt sie in derselben Art etwas in den Menschen herein, was ungefähr mit dem Seelenleben zwischen dem achtundzwanzigsten und fünfunddreißigsten Jahre verwandt ist. Nimmt man die britische Volksseele, dann prägt diese in den Menschen etwas herein, das heißt, gießt einen Stimmungsgehalt über das ganze menschliche Wesen aus von der Kindheit an, etwas, das dann mit den anderen Stimmungsgehalten zusammenwirkt, das verwandt ist mit der menschlichen Seele in ihrer Entwickelung zwischen dem fünfunddreißigsten, sechsunddreißigsten Jahre und dem zweiundvierzigsten, dreiundvierzigsten, vierundvierzigsten Jahre, aber abschattiert durch dasjenige, was vom Anfang der zwanziger Jahre in der Seele ist.
So kann man die Eigentümlichkeiten der Volksseele nur dadurch studieren, daß man gewissermaßen ihre Wahlverwandtschaft untersucht zu demjenigen, was man als die tiefere Charakteristik der menschlichen Einzelseele findet. Da hinein zu schauen und zu sehen, was für Kräfte drinnen walten, das ist die Aufgabe. Selbstverständlich wächst ja der Mensch als menschliche Individualität heute über das Nationale hinaus. Aber wenn man dasjenige betrachtet, wodurch der Italiener Italiener ist, so wird man gleichsam das Zusammenspielen der Volksseele mit der Einzelseele, ich möchte sagen, nicht wie in einem hervorgerufenen, aber in einem beobachteten Experimente sehen, wenn man das Zusammenspielen des Volksseelenwesens mit seinem Einzel-Seelenwesen
in der Zeit ergreift, die zwischen dem zwanzigsten, einundzwanzigsten und siebenundzwanzigsten, achtundzwanzigsten Jahre liegt.
Sie werden vielleicht glauben, solche Dinge, wie ich sie jetzt sage, seien irgendwie ausgedacht. Sie sind es ebensowenig, wie, sagen wir, auf einer ganz anderen Stufe die Jakob Grimmschen Lautgesetze, die Gesetze der Lautverschiebung, ausgedacht sind. Nicht wahr, das sieht auch ausgedacht aus, wenn man sagt: Worte, die verwandt sind, die in der Entwickelung sind, haben im Griechischen zum Beispiel ein «t», und dasselbe Wort, indem es sich bis zum Germanischen herauf entwickelt, an derselben Stelle ein «th» oder ein «z»; wenn es sich bis zum Neuhochdeutschen herauf entwickelt hat, ein «d». Diese Gesetze der Lautverschiebung zeigen, wie in der Aufeinanderfolge der Zeit Gesetzmäßigkeit waltet überall da, wo Seelisches mit ins Spiel kommt. Wenn man sie einfach so entwickelt, wie sie Jakob Grimm hingestellt hat, da erscheinen sie natürlich auch so in ihrer Abstraktheit; aber sie sind zu erhärten, zu erweisen in all den Fällen, auf die es ankommt, aus der ganzen Breite der Erfahrung heraus. Und so kann ich Ihnen heute auch nur diese Grundgesetze, die ich Ihnen andeutete, gewissermaßen charakterisieren. Aber derjenige, der nur eingehen will auf das, was die äußere Erfahrung eben einem Geiste bietet, wie ich ihn geschildert habe, der gerade wie Jakob Grimm das Volkswesen nach dem Verfahren der äußeren Wissenschaft erforschen kann, der wird überall die Bewahrheitung sehen. Es ist heute nur nicht Zeit, auf das, was ja sehr interessant wäre, einzugehen, zu zeigen, wie sich diese allgemeinen Gesetze bewahrheiten in allen Seelen-erscheinungen, und wie diese Seelenerscheinungen des Menschen und sein Auftreten in der physischen Welt, insoferne er irgendeinem Volksseelenwesen angehört, sich nur dadurch
erklären lassen, daß man auf diese Weise hinter die besondere Konfiguration seines Auftretens kommt.
Werfen wir noch einen Blick auf die russische Volksseele. Da stellt sich nun gar das Eigentümliche heraus, daß sich die Volksseeleneigentümlichkeit, der Volksseelen-Charakter, verwandt erweist mit einer Art von Mischung zwischen dem, was im einzelnen menschlichen Organismus von der Geschlechtsreife bis zu dem Anfang der zwanziger Jahre vor sich geht; und das ist abschattiert durch das, was vom zweiundvierzigsten, dreiundvierzigsten Jahre bis zum neunundvierzigsten, fünfzigsten Jahre vor sich geht. Wenn Sie sich diese zwei Seelencharaktere durcheinander kraftend denken, dasjenige also, was sozusagen von der Geschlechts-reife bis in die ersten zwanziger Jahre im Organismus wirkt, ihn noch durchtränkend, was aber auch im Seelischen wirkt, wenn Sie sich das überschattet, durchorganisiert denken von dem, was in einer so späten Zeit wirkt, dann bekommen Sie gewissermaßen - lassen Sie mich das grobe Wort für diese feine Sache aussprechen - ein arithmetisches Mittel heraus, das zeigt, welches gerade die Eigentümlichkeiten der russischen Volksseele sind. Denn mit den Kräften, die den eben charakterisierten Kräften im menschlichen Organismus ähnlich sind, wirkt die russische Volksseele.
Und sehr ähnlich wirken andere Gesamtseelen. Da können wir zum Beispiel eine Gesamtseele ins Auge fassen, die wirklich in tief eingreifender Weise vom Süden Europas durch ganz Europa gewirkt hat. Es kann sich ja jeder selbst ausmalen, wie dieses Gesamtseelenwesen gewirkt hat. Ich meine das Gesamtseelenwesen des Christentums. Gerade so, wie man vom Volksseelenwesen sprechen kann, kann man auch vom Gesamtseelenwesen des Christentums sprechen. Auch das, was vom Christentum, ich möchte sagen, ausströmt, auskraftet, durchdrang gestaltend, physiognomisierend
die Menschen durch lange, lange Zeit und wird sie weiter durchdringen. Nur unterliegt das auch einer Entwickelung. Aber auch da haben wir es zu tun mit einem solchen Wirken, das in einer ähnlichen Art zusammengesetzt werden muß; da haben wir es sogar mit einem Wirken zu tun - und daraus erklärt sich, warum das den Menschen so tief ergreift -, das sich zusammenzieht aus dem, was in der menschlichen Wesenheit zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife lebt, vermischt wiederum mit dem, was da lebt vom zweiundvierzigsten, dreiundvierzigsten Jahre bis zum neunundvierzigsten, fünfzigsten Jahre. Natürlich müssen es viel stärkere Kräfte sein, den Menschen durchorganisierend, als selbst der Volksseelencharakter, die ihn gewissermaßen religiös prägen. Derjenige, der die Stärke, mit der Religionen den Menschen geprägt haben, ins Auge faßt, wird das, was ich sage, nicht unbegreiflich finden.
Und stellen wir all diesem gegenüber, aber wirklich nicht um Werturteile zu fällen, sondern nur um Eigentümlichkeiten hervorzuheben, den Grundcharakter der deutschen Seele, der deutschen Volksseele. Gerade das, was ich über die deutsche Volksseele werde zu sagen haben, das ist wunderbar zu erhärten, nicht bloß aus den Anschauungen, die der Deutsche hat und haben kann über das, was in seiner Seele lebt und leibt, in der Seele lebt und aus der Seele leibt, sondern - wenn man in ruhigen, objektiver sich aussprechenden Zeiten, als die unsrigen es sind, die anderen Völker hört - ebenso aus den Äußerungen der anderen Völker, gerade aus den Eindrücken unbefangener Beobachtung bei den anderen Völkern. Diese deutsche Volksseele hat wirklich etwas höchst Eigentümliches; es ist ja, ich möchte sagen, gewissermaßen unbehaglich, das gerade als Deutscher sagen zu müssen - aber sie hat eben etwas
höchst Eigentümliches. Es sollen nicht Werturteile gefällt werden, sondern es soll objektiv zu Werke gegangen werden, wenn man ihren Grundcharakter prüft, so findet man, daß sie nun den Menschen durchtränkt, durchwirkt, ihm einen gewissen Stimmungsgehalt gibt, so daß die Kräfte, die in dieser Volksseele sind, verwandt sind mit all dem, was im Menschen seelisch ist vom Anfang der zwanziger Jahre bis in den Anfang der vierziger Jahre, bis zum zweiundvierzigsten, dreiundvierzigsten, fünfundvierzigsten Jahre. Das ist das Merkwürdige der deutschen Volksseele. Wenn das die anderen Nationen unbehaglich berühren sollte, dann brauchen sie sich ja nur damit zu trösten, daß dasjenige, was beim Menschen gewissermaßen ausgegossen ist über drei Lebensabschnitte, eben mit einer schwächeren Kraft wirkt, gewissermaßen verdünnt wirkt, während das, was die anderen Volksorganismen angeht, eben mit einer stärkeren Kraft wirkt, stärker den Menschen durchdringt. Ich möchte sagen, wie emem in bezug auf das andere, das ich gesagt habe, gerade an einzelnen Beispielen diese Dinge in einer wunderbaren Weise klar werden können, so können einem durch gewisse Erscheinungen die Tatsachen über die deutsche Volksseele klar werden, die eben angedeutet worden sind. Wer da in der Sprache, wie ich sagte, nicht unmittelbar die Volksseele selber betrachtet, sondern eine Wirkung der Volksseele, der wird sich nicht wundern, daß in der Sprache eben ein wunderbarer Genius wirkt. Es wirkt eben der Genius, der die Volksseele ist. Und wie oft ist die Sprache gescheiter als wir! Wie oft finden wir nachher erst das heraus, was in der Sprache genial ausgedrückt ist. Freilich kann man solche Dinge nur charakterisieren, wenn man sich bewußt ist, daß die Dinge, wie man sagt, eigentlich in einer Sprache nur so gesagt werden können, in einer anderen Sprache anders gesagt werden
müßten. Aber das, was ich jetzt sage, kann in deutscher Sprache gesagt werden. Dasjenige, was sich zum Beispiel in zwei Bezeichnungen ausdrückt, es ist wunderbar genial gestaltet: Wir sagen nicht «Vatersprache» und «Mutterland» in der gewöhnlichen Sprache. Wir sagen «Muttersprache» und «Vaterland». Und das drückt für den Geisteswissenschafter in vollster Beziehung aus die ganze Art und Weise, wie die heimatliche Landschaft durch die väterliche Vererbungsvermittelung auf den Menschen übergeht und wiederum in sein Unbewußtes hineinwirkt; und wie dasjenige, was in der Sprache lebt, von der mütterlichen Seite aus durch die Vererbungskräfte auf den Menschen überströmt. Aber vieles, vieles andere könnte angeführt werden. Für das, was ich eben als Eigentümlichkeit der deutschen Volksseele gesagt habe, trat mir eine Erfahrung immer wieder entgegen, eine Erfahrung, die ich ja vielleicht leichter machen konnte als mancher andere, da ich einen großen Teil meines Lebens, fast drei Jahrzehnte, in Österreich verbracht habe. Sehen konnte ich - in späteren Jahren im innigen Einklange mit der Mundartenforschung meines sehr verehrten Lehrers und Freundes Schröer -, wie die deutsche Volksseele sich entwickelt, wenn sie sich so hineinschiebt in andere Volksseelen-Gebiete, hineinschiebt in das tschechische Volksseelengebiet, in Ost-, in West-ungarn, wo ja unter dem schönen Namen Heanzen Deutsche leben bis nach dem Wiesenburger Komitat herauf. Dann kommen wir in die Gegenden unterhalb der Karpaten, wo die Zipser Deutschen leben; dann kommen wir nach Siebenbürgen, wo die Siebenbürgener Sachsen leben; dann in das Banat, wo die Schwaben leben. Alle diese Völkerschaften werden ja nach und nach - darüber sollen keine Werturteile und soll keine Kritik geltend gemacht werden -, von dem magyarischen Element vollständig aufgesogen.
Da kann man eine merkwürdige Eigentümlichkeit studieren. Man darf sie doch wohl aussprechen: wie leicht gerade der Deutsche seine Nationalität verliert, allmählich ab-streift, wenn er sich so in andere Nationalitäten hinein-schiebt. Das hängt mit dieser Eigentümlichkeit der deutschen Volksseele zusammen, von der ich eben gesprochen habe. Sie ergreift den Menschen, ich möchte sagen, in leichterer, feinerer Art mit den Kräften, die in der Individual-Entwickelung des Menschen zwischen den zwanziger und fünfundvierziger Jahren liegen. Aber indem sie ihn seelisch labiler charakterisiert, macht sie es ihm möglich, leichter sein Seelisches abzustreifen, sich zu entnationalisieren und sich hineinzunationalisieren in andere Nationen. Er ist nicht so stark, so innig durchtränkt von diesem deutschen Wesen, das aus der Volksseele kommt.
Ein anderes fügt sich hinzu zu dieser Tatsache. Ich kann diese Dinge ja nur andeuten. Würde man gerade im einzelnen, zum Beispiel an Hand der Schröerschen Ausführungen über Grammatik und seiner Wörterbücher der österreichisch-deutschen Mundarten, das, was ich jetzt gesagt habe, studieren, so würde man wahrhaftig den eben ausgesprochenen Satz so belegen können, wie nur irgendeinen naturwissenschaftlichen Satz. Eine andere Eigentümlichkeit, die aus dieser Tatsache des deutschen Seelenwesens folgt, ist diese, daß das deutsche Seelenwesen den gemüt-haften Anschluß an Heimatliches, Gleichartiges, das Zusammenleben mit Heimatlichem, Gleichartigem, braucht, um immer wieder und wiederum die Frische dieses Heimatlichen, Gleichartigen zu fühlen. Der Deutsche ist nicht imstande, sich mit starker innerer Kraft, die ihn unverändert läßt, wie etwa der Engländer, in fremdes Volkstum hin-einzuschieben. Er braucht, wenn er sein Volkstum so recht innerlich lebendig haben will, den unmittelbaren Zusammenhang
mit der ganzen Aura, mit der ganzen Atmosphäre des Volkstums. Daher entwickelt sich auch innerhalb dieser Aura, dieser Atmosphäre des Volkstums etwas, was im Umkreise so schwer verstanden wird, was so schwer hinein-geht in die fester konfigurierten Volksseelen, die gleich alles in ihre Kategorien hineinzwängen wollen und es dadurch verzerren; während in dem labilen, in dem leichten Gleichgewicht, in dem alles schwebt in der deutschen Volksseele, alles unmittelbar erfahren und erlebt sein will im lebendigen Zusammenhang mit dem Volksseelenelement selbst. Das zeigt sich so schön in gewissen Aussprüchen, die der hier oftmals schon erwähnte, wahrhaftig echt deutsche Geist Herman Grimm getan hat. Mehr als mancher andere ist er sich bewußt geworden - nicht in dieser ausgesprochen geisteswissenschaftlichen Form, wie ich es jetzt auseinander-setze, sondern in einem inneren Gefühl -, wie das deutsche Seelentum dieses unmittelbare, immer fortwährend gegenwärtige Befruchtetwerden der Gemüter braucht, und wie es nur da gedeihen kann. Da spricht er sehr schön aus, wie dasjenige, was der Deutsche formt, was der Deutsche bildet, eigentlich nur von dieser, in der eben angedeuteten Weise zu charakterisierenden deutschen Seele selbst wieder nur ganz voll verstanden werden kann, und wie dasjenige, was aus dieser Seele heraus erfaßt werden soll durch fremdes Volkstum, eben aus dem angedeuteten Grund verzerrt, karrikiert wird, weil auf die Feinheiten nicht eingegangen werden kann, die dadurch da sind, daß sich das deutsche Wesen ausbreitet über die Eigentümlichkeiten der Menschenseele vom zwanzigsten bis zum fünfundvierzigsten Jahre, wie ich es angedeutet habe. So sagt Herman Grimm sehr schöne, wunderschöne Worte - wenn sie auch vielleicht manchem Nicht-Deutschen nicht gefallen, aber sie sind wunderbar -, nicht nur schöne, sondern auch wunderbar richtige Worte:
«Ein Deutscher, der die Geschichte Frankreichs schreibt, die Italiens, die Rußlands, die der Türkei: darin findet kein Mensch etwas Ungehoriges, etwas sich Widersprechendes»; -Herman Grimm meint, weil diese deutsche Seele durch dieses Ausbreiten biegsam, schmiegsam ist, weiß diese deutsche Seele sich hineinzufinden in diese anderen Volksseelen -«aber ein Russe, Türke, Franzose, Italiener, die über deutsche Geschichte schreiben wollten! Und wenn das Buch einigen Unschuldigen imponieren sollte, weil es in einer fremden Sprache geschrieben ward, so braucht nur übersetzt zu werden. Ein Russe hat über Mozart und, durch den Erfolg seiner Arbeit gehoben, auch über Beethoven geschrieben. «Ist das Mozart, das Beethoven?» - fragt Her-man Grimm. - «Musik scheint doch eigentlich kein Vaterland zu haben. Diese beiden Leute» - Mozart, Beethoven -«sind zwei Komponisten, deren einer Mozarts Werke schrieb» - nach dem, was der Russe angibt - «und der andere die Beethovens, aber sie selber» - die Menschen meint er, die der Russe da beschreibt - «haben nichts gemein mit dem Buche und dessen Urteilen.»
Da wird hingedeutet auf dieses unmittelbare Zusammenleben, auf dieses unmittelbare Zusammenhängen. Und besonders schön sagt Herman Grimm in der Fortsetzung der eben angeführten Stelle:
«Ist das Goethe, über den Lewes zwei Bände geschrieben hat? Ich dächte, wir kennten ihn anders. Der Goethe des Mr. Lewes ist ein wackrer englischer Gentleman, der zufällig 1749 zu Frankfurt auf die Welt kam und dem Goethes Schicksale angedichtet sind, soweit man sie aus erster, zweiter, dritter, fünfter Hand empfangen hat, der außerdem Goethes Werke geschrieben haben soll. Das Buch ist eine fleißige Arbeit, aber von dem Deutschen Goethe steht wenig darin. Die Engländer sind Germanen wie wir, aber
sie sind keine Deutschen, und was Goethe uns war, das empfinden wir allein.»
Durch die angegebene Eigenschaft der deutschen Volksseele muß nämlich dasjenige, was Verständnis des deutschen Volksseelenwesens liefert, in diesem leichten Hingeben gesucht werden, das aber durchaus nicht verbunden zu sein braucht mit einer gewissen Schwäche, wie man so leicht denken könnte. Und gerade dieses könnte ja aus den Worten unbefangener Beobachter der deutschen Seele hervorgehen. Da ist zum Beispiel ein unbefangener Beobachter - ich scheue mich fast, diese Worte vorzulesen, weil es, wie gesagt, unbehaglich ist, als Deutscher solche Worte über die Deutschen gesprochen zu hören. Ein Gedicht heißt «An Deutschland». Man darf sagen, dieses Gedicht ist durchdrungen zugleich von der Vielfältigkeit, diesem labilen Gleichgewicht der deutschen Volksseele und der gerade aus diesem Gleichgewicht herausfließenden Stärke. Da sagt denn der Dichter:
Keine Nation ist größer als du;
Einst als die ganze Erde ein Ort des Schreckens war,
War unter den starken Völkern keines gerechter als du.
Du hast Friedrich Rotbart, und daneben Friedrich Schiller.
Der Kaiser, diesen Gipfel fürchtet der Geist, diesen Blitz.
Gegen Cäsar hast du Hermann, gegen Petrus Martin
Dein Atem ist die Musik - - - [Luther.
Mehr Helden hast du, als der Athos Gipfel.
Deine Ruhmestaten sind überall, seid stolz, ihr Deutschen!
Nun, es darf vielleicht aus diesem Grunde vorgelesen werden, da das Gedicht von Victor Hugo ist und 1871 geschrieben ist! Es ist der Teil eines Gedichtes, das er überschrieben hat «Wahl zwischen zwei Nationen». Der erste Teil ist «An Deutschland», und ich habe ihn eben vorgelesen. Der
zweite Teil ist «An Frankreich», und der lautet: «Oh, meine Mutter!» Ich möchte sagen: Es ist das sinnbildlich für die Schwierigkeit, die man hat, gerade das zu erfassen, was im eigenen Volksseelenwesen begründet ist.
Ich versuchte Ihnen anzudeuten, wie Tatsachen durchaus für dasjenige sprechen, was ich angegeben habe. Aber ich kann ja natürlich nur in ganz skizzenhafter Weise auf Einzelnes hinweisen, das die Richtung angibt, in der im empirischen Tatsachenmaterial gesucht werden kann.
Nun haben wir diese deutsche Volksseele in ihrer Entwickelung. Wir treffen sie bereits so, daß sie so wunderbar plastisch, großartig geschildert werden kann, im ersten Jahrhundert nach Christus durch Tacitus, was für frühere Jahrhunderte auf die germanische Volksseele zurückweist, aus der die deutsche Volksseele herausgewachsen ist. Wir sehen sie dann in ihrer Entwickelung durch das Mittelalter hindurch bis herauf zu ihren neueren Blüten, wo sie eingetaucht war in die Dichtung Goethes, Schillers, Herders, eingetaucht ist in die große musikalische Entwickelung des neueren deutschen Geisteslebens. Aber es schiebt sich hinein und durchdringt dieses Volksseelenwesen das Christentum - ein anderes gemeinschaftliches Seelenwesen. Gerade wenn man den Gang der Ereignisse recht im einzelnen untersucht, dann kann man sehen, wie diese großen Gesichtspunkte, die ich angegeben habe, sich im einzelnen da, wo sich das Volksseelenwesen ausdrückt, bestätigen. Zum Beispiel können wir fragen: Wenn das Wesen, das im Menschen unbewußt wirkt bis zur Geschlechtsreife hin, wirklich so ergriffen wird von einem solchen gemeinschaftlichen Bewußtsein wie dem Christentum, was will sich da einleben? Wir brauchen nur Worte zu nehmen, Fremdworte, die die deutsche Sprache durch das Christentum aufgenommen hat. Es sind solche Fremdworte in das deutsche Wesen eingegangen,
welche sich beziehen auf das, was in der sinnlichen Wahrnehmung, allerdings mit einem übersinnlichen Charakter, aufgefaßt werden muß, wozu man schon ein tieferes Seelenleben braucht, das sich in der Weise einprägen kann, wie ich es charakterisiert habe. So zum Beispiel ist das Wort «Natur» durch das Christentum nach Mitteleuropa in das deutsche Wesen hereingekommen. Freilich, wie es dazumal aufgefaßt worden ist, das Wort «Natur», davon hat derjenige keine Ahnung, der es nur in dem Sinne nimmt, wie wir es heute fassen. Aber in den Dialekten lebt es noch in der alten Bedeutung. Und da sehen wir, wie sich dieses Wort «Natur», das mit dem Christentum in Mitteleuropa eindringt, mit dem Volkstum weiter entwickelt. An diesem einen Wort «Natur» und an anderen Worten älterer Versionen, die auf diese Weise eingedrungen sind, kann man nachweisen, wie die angedeuteten Kräfte, die aus dem Christentum hereinkraften in die menschliche Individualität, wirksam sind in solchen Worten.
Nehmen wir eine Zeit, in welcher mehr wirksam war ein Hereinkraften einer anderen Volksseele in die deutsche Volksseele, sagen wir das dreizehnte Jahrhundert. Weil die deutsche Volksseele über die ganze Zeit der menschlichen Seelenentwickelung ausgegossen ist vom zwanzigsten bis zum fünfunddreißigsten, sechsunddreißigsten Jahre und noch später, weil sie also verbreitet ist über das alles, kann sie eben auch durch all die Eigenschaften, die ich angeführt habe, Einflüsse von außen aufnehmen. Wir werden gleich sehen, wie besonders gestaltet diese Einflüsse sind. Wir haben hier gesehen, wie das Christentum in sie eingeströmt ist. Wir könnten an Worten, an Wortwandlungen diese eigentümlichen Worte nachweisen, die als Fremdworte einströmten in der Zeit, in der das französische Volksseelenwesen eine besondere Stärke erlangt hatte, wie im dreizehnten
Jahrhundert. Da kommen ganz andere Worte herein, Worte, die das Innere der Seele ergreifen, Worte, die nur mit dem Unterbewußten erfaßt werden und ihre Entwickelung durchmachen, Fremdworte, ja, man weiß heute nicht mehr, daß es Fremdworte sind; sie werden deshalb dem Schicksale entgehen, als Fremdworte ausgemerzt zu werden. Worte, wie «Preis», «klar», kommen im dreizehnten Jahrhundert herein. Vor dem dreizehnten Jahrhundert gibt es das Wort «klar» nicht; «Preis», «etwas preisen», «einen Preis haben», kommt damals herein. Das sind Worte, die mit dem Seelenwesen zusammenhängen. Da wirkt das, was wir in dem französischen Volksseelenwesen erkannt haben, herein in das deutsche Volksseelenwesen.
So könnte man vielfach noch im einzelnen verfolgen, wie das deutsche Volksseelenwesen nun wiederum dadurch, daß fremdes Volksseelenwesen hereinwirkt, in Entwickelung begriffen ist. Aber gerade so, wie wir beim einzelnen Menschen das Ineinanderwirken der Zustände auch in der Zeitenfolge aufsuchen müssen, wie ich das im ersten Teil meines Vortrags angedeutet habe, so muß, wenn im vollen Sinne verstanden werden will die Entwickelung der deutschen Volksseele, das Wirken dieser deutschen Volksseele verstanden werden. Und das kann ich Ihnen in de? Kürze in der folgenden Weise charakterisieren. Wir finden die deutsche Volksseele, wie gesagt, schon in sehr alten Zeiten. Sie wissen, ich liebe nicht vage, mystische, insbesondere nicht materialistisch-mystische Begriffe, aber in diesem Fall werden Sie mir das Wort verzeihen: Diese deutsche Volksseele wirkt wie ein mächtiger Alchimist, bewirkend dasjenige, was unter Deutschen sich abspielt in der Mitte Europas von alten Zeiten, in vorchristliche Jahrhunderte weit zurück-gehend. Sie wirkt da schon so, daß das frühere Wirken mit dem späteren einen fortgehenden Zusammenhang hat, als
noch nicht die Rede davon sein konnte, daß die Konfiguration des französischen, spanischen, italienischen Wesens, ebenso des britischen Wesens, in seiner jetzigen Form vorhanden gewesen wäre. Sie wirkte durch die Jahrhunderte fort und wirkt heute. Wie wir oftmals in diesen Vorträgen gesagt haben: Sie trägt die Keime zu noch langem Wirken in sich. Gerade wenn man sie erkennt, kann man ihr dieses ansehen. Und sie kann so durch so lange Zeiten, in so vielen Wandlungen eben deshalb wirken, weil sie so ausgebreitete Kräfte in sich enthält, wie es die in der Menschenseele vom Anfang der zwanziger bis in die vierziger Jahre vorhandenen Kräfte sind. Sie wirkt aber, wie wir gesehen haben, schon in alten Zeiten. Aber wie wirkt sie da? Nun, wir sehen, wie dieser mächtige Alchimist, die deutsche Volksseele, auftritt, jene Zustände bewirkt, die da Tacitus schildert, wie später dann die Zeiten kommen, wo dasjenige, was aus dieser Volksseele herauskraftet, den Ansturm unternimmt gegen das südliche, westliche Wesen, das römische Wesen.
Nun sehen wir etwas höchst Eigentümliches. Gewisse Teile, die ursprünglich zusammenhingen mit dem deutschen Volksseelenwesen, schieben sich hinein in die Balkanhalbinsel, schieben sich hinein nach Spanien, nach dem heutigen Frankreich, schieben sich als Angelsachsen hinüber nach den heutigen britischen Inseln. Es wird dasjenige, was verbunden war mit der deutschen Volksseele durch das Blut, abgegeben an den Umkreis, an die Peripherie. Und die umliegenden Peripherie-Kulturen entstehen dadurch, daß andere Volksseelen wiederum wie die übersinnlichen Alchimisten wirken, daß zum Beispiel romanisches Wesen bis in die Sprache hinein in alchimistischer Weise zusammengemischt wird mit demjenigen, was alt-gallisches Wesen ist, in das aber hineingeströmt ist, was von deutschem
Volksseelencharakter verbunden war mit germanischem Blut, das in den Franken hineingezogen ist in das Franken-reich. Das ist dasjenige, was in Frankreich von der deutschen Volksseele selber vorhanden ist, was darinnen lebt, was durch den Alchimisten der französischen Volksseele mit dem anderen Element vermischt ist. Ebenso ist es mit dem italienischen Element, ebenso ist es mit dem britischen Element gegangen. Das angelsächsische Element, in einem Zustande, der noch eine verhältnismäßig frühe Entwickelung, ein früheres Entwickelungsstadium der deutschen Volksseele bezeugt, schob sich hinein in keltisches Wesen. Ihm kam romanisches Wesen entgegen. Daraus wurde gleichsam dasjenige, was der Alchimist der britischen Volksseele zu tun hatte, um das zustande zu bringen, was ich ja charakterisiert habe als die Wechselbeziehungen dieser einzelnen westlichen Volksseelen zu den einzelnen menschlichen Individuen, die ihren Seelenstimmungs-Charakter von den einzelnen Volksseelen haben. So daß, wenn wir in den Umkreis hineinsehen, wir überall wirklich uraltes germanisches Seelenelement darinnen haben. Das ist da. Und das, was entstanden ist in der Weise, wie ich es geschildert habe, ist eben dadurch entstanden - so wie man Stoffe in der Chemie durch gewisses Zusammenwirken von anderen Stoffen bekommt -, daß hier in dieser Weise Volksseelen-elemente zusammengemischt worden sind. Aber in der Mitte Europas ist dasjenige geblieben, was eine fortdauernde Entwickelung durchgemacht hat, was immer in der Linie und Strömung mit diesem weiten Charakter geblieben ist, den ich dargestellt habe.
Das ist der Unterschied zwischen dem Volke Mitteleuropas und denjenigen Völkerschaften, die rings herum sind. Das ist der Unterschied, der ins Auge gefaßt werden muß, wenn man verstehen will, wie diese deutsche Volksseele
sich dann weiter entwickelt hat. Wie innig fühlte sie sich noch immer verbunden mit dem, was ringsherum war! Wie hat sie dasjenige wieder zurückgeholt in einer gewissen Weise, was erst ausgeströmt ist von Mitteleuropa! Wie strömt zurück - und man braucht kein Rassenfanatiker zu sein, wenn man dies darstellt - aus dem Italienertum die italienische Kunst, wie strömt zurück der Geist Dantes in dasjenige, was deutsches Volksseelenwesen ist! Wie strömt zurück französisches Wesen, wie strömt zurück britisches Wesen! Bis in unsere Tage herein hat es geströmt, in einer Weise, wie ich das oftmals hier angedeutet habe. So sehen wir, daß dieses Eigentümliche in der Entwickelung der deutschen Seele liegt. Sie bleibt in Mitteleuropa, sie erzeugt sich eine Umgebung und tritt mit dieser Umgebung in Wechselwirkung. Dadurch, ich möchte sagen, befruchtet sie dasjenige, was wegen ihres ausgebreiteten Charakters nur in einzelnen Schattierungen sichtbar ist.
Dadurch ist es allein zustande gekommen, daß innerhalb dieser deutschen Volksseele wieder erneuert werden konnten und vervollkommnet werden konnten diejenigen Motive, die in dem Volksseelencharakter der Umgebung liegen. Wie sehen wir kaum angedeutet in der Umgebung dasjenige, was in dem deutschen Siegfried zutage tritt. Und wie sehen wir, wie das, was aus der Volksseelenkraft hereingekraftet ist in das Deutschtum, in einer bestimmten Zeit alles als Volksseele ergreifend, in der Siegfriedssage zum Ausdruck gekommen ist. Dann erholt sich diese Seele, macht
- gegenüber der Ausatmung im Siegfried - eine Einatmung, um im zwölften, dreizehnten Jahrhundert eine neue Ausatmung zu machen, einen neuen Ansatz, und den dem Siegfried entgegengesetzten Charakter aus sich hervorzubringen, den Parzival-Charakter. Und man braucht nur gegeneinanderzustellen diese beiden Charaktere, die wirklich
aus dem innersten Wesen und Weben des deutschen Volksseelenwesens heraus entstanden sind, man braucht nur diese beiden polarischen Gegensätze nebeneinanderzustellen, Siegfried und Parzival, und man wird die Weite der deutschen Volksseele und die Entwickelungsmöglichkeit erblicken, die sich ausspricht in dem Gang, den diese Entwickelung gemacht hat von dem Siegfried, dessen schon verschollenes Lied man wieder aufgefunden und niedergeschrieben hat in der Zeit, als Wolfram von Eschenbach seinen Parzival gedichtet hat. Ja, diese deutsche Volksseele durchläuft in langer Zeit dasjenige, was sie nur in langer Zeit durchlaufen kann wegen ihrer Weite. Darin ist das Bedeutsame ihrer Entwickelung ausgedrückt. Darin liegt dasjenige, was wir auch heute noch als unendlich breite Möglichkeiten in der Entwickelung der deutschen Volksseele erkennen können, wenn wir diese deutsche Volksseele in der richtigen Weise anschauen. Dasjenige aber, was sie ergreift, ergreift sie deshalb mit einer gewissen Stärke, weil sie es umfassend ergreift, weil sie es mit der Harmonie aller Seelenkräfte ergreift.
Man könnte mir leicht den Vorwurf machen, ich brächte hier Dinge vor, die doch nur an der Oberfläche des Lebens liegen. Das ist nicht der Fall, und ich will es nicht tun. Was ich als den Charakter der deutschen Volksseele ausgesprochen habe, tritt einem, wenn auch nicht in dieser abstrakten Art, wie ich es heute aussprechen mußte, ich möchte sagen, wirklich als empfindungsgemäßes Erkennen entgegen. Überall lebt das in irgend einer Form da, wo deutsche Seele lebt, und überall verhält sich deutsche Seele so zu den anderen Seelen, wie das heute charakterisiert werden mußte. So aber verhält sich die deutsche Seele auch zu dem, was als Christentum in sie einströmt, mit der Seele ganz erfassend dieses Christentum und es von innen heraus neu gebärend.
Man bleibt nicht bloß an der Oberfläche, an der gebildeten Oberfläche des deutschen Volksseelentums, wenn man so etwas charakterisiert, sondern man drückt schon dasjenige aus, was Grund-Charakter des gesamten deutschen Seelenwesens ist.
Ich könnte viele Beispiele anführen. Ich will nur eines anführen, das zeigt, wie in einer Persönlichkeit, die als katholischer Priester im deutschen Volksseelenwesen drinnen steht, empfindungsgemäß ein Bewußtsein von dem lebt, was ich heute erkenntnisgemäß angedeutet habe. 1850 schreibt Xavier Schmid in einem anspruchsiosen Büchelchen, in dem er für eine gemeinsame vertiefte Auffassung eines deutsch gefühlten Christentums eintreten will: «Wie Israel auserwählt war, den Christus leiblich hervorzubringen, so ist das deutsche Volk auserwählt, denselben geistig zu gebären. Wie bei jenem merkwürdigen Volke die politische Freiwerdung von der inneren bedingt war, so wird auch die Größe des deutschen Volkes wesentlich davon abhängen, ob es seine geistige Sendung erfüllt. » Wie ist da das Erfassen des Christentums im Geiste von diesem einfach gebildeten Priester Xavier Schmid gekennzeichnet! Es lebt das, was ich charakterisiert habe, schon durchaus bis in das tiefste Volksgemüt hinein, wenn man auch selbstverständlich andere Worte prägen müßte, als ich sie heute hier zu prägen hatte, um nun zu zeigen, wie im einfachsten Volksgemüt dasjenige lebt, was heute charakterisiert worden ist.
Und wie mit dem Geistigen zusammenhängt die Weite gerade des deutschen Volks-Charakters, man kann es, wenn man ein Auge dafür hat, auch an den Außenseiten studieren, die sich im Leben darbieten. Nur noch ein Beispiel. Vor mir habe ich zwei Abhandlungen, die eine von einem Deutschen, die andere von einem anderen. Jakob Grimm, der mit so tiefer Liebe erfaßt hat, was im deutschen Volkswesen
lebte, er hatte eine Ahnung von der Weite und Breite, die ich heute charakterisiert habe. Ihm, Jakob Grimm, war es gerade aus seiner Liebe zum deutschen Volke heraus klar, daß da selbstverständlich auch Schattenseiten sein müssen. Deshalb hat Jakob Grimm einen Aufsatz über die Pedanterie der Deutschen geschrieben, in dem er sich sogar bis zu dem Ausspruch versteigt: die Deutschen hätten die Pedanterie erfunden, wenn sie nicht schon in der Welt dagewesen wäre. Das ist aber auch für die Weite des deutschen Wesens bezeichnend. Der Aufsatz von Jakob Grimm über die deutsche Pedanterie, namentlich in der Sprache, ist sehr interessant. Aber der Deutsche hat dadurch schon diese Eigentümlichkeit, alles auch aus der Breite des Seelenlebens heraus zu erfassen.
Von einem Deutschen, von Professor Troeltsch, hören wir Worte über die deutsche Freiheit. Ich will mich selbstverständlich nicht auf seinen Standpunkt stellen, aber ich charakterisiere ja Seeleneigentümlichkeiten des deutschen Volkes. Da wird nun mit wirklich deutscher Gründlichkeit, aber auch mit deutschem Scharfsinn, so zu Werke gegangen, daß gezeigt wird, wie die Freiheit sich abschattiert nach dem italienischen, nach dem englischen, nach dem französischen Volks-Charakter. Gewissenhaft gibt er sich Rechenschaft, wie die Freiheitsidee bei diesen Völkern aufgefaßt wird. Und dann versucht er, jene Freiheitsidee, die das deutsche Volk hat, zu charakterisieren, jene Freiheitsidee, von der Herman Grimm selber auch gesagt hat, schöner als Troeltsch, aber fast mit ähnlichen Worten: «Dem deutschen Volke war es vorbehalten, jene Freiheit als Charakter des Menschen in der Idee zu erkennen, die die volle Ausgestaltung der menschlichen Individualität und Persönlichkeit vereinigt mit einem harmonischen Zusammenwirken in der Gesamtheit.» Wenn solche Leute die Freiheit
so charakterisieren, daß der Mensch in der Freiheit wirkt, dann ist immer gemeint, daß das, was aus seiner Seele als Freiheit fließen kann, sich eingliedert dem Geistesleben. Und insbesondere vor der Mitte des verflossenen Jahrhunderts hätte kein Deutscher von der Freiheit sprechen können, ohne diese Freiheit aus dem Tiefsten des Geisteslebens heraus zu charakterisieren. Erst nach den englischen Einflüssen in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts sind auch Deutsche mehr oder weniger davon abgekommen. Aber sie kommen nach und nach auch wieder darauf zurück. Und in dem erwähnten Aufsatz heißt es weiter:
«Will man eine Formel für die deutsche Einheit prägen, so wird man sagen können: organisierte Volkseinheit auf Grund einer pflichtmäßigen und zugleich kritischen Hingabe des Einzelnen an das Ganze, ergänzt und berichtigt durch Selbständigkeit und Individualität der freien geistigen Bildung.» - Immerhin eine, wenn auch vielleicht pedantisch zu nennende, aber aus der Fülle des geistigen Erfassens heraus geprägte Idee von der Freiheit, eine Antwort aus dem Geiste heraus auf die Frage: Was ist Freiheit?
Ich will Ihnen aus dem anderen Buche eine Antwort auf die Frage: Was ist Freiheit? vorlesen. Denn bei der Betrachtung der Volksseele kommt es nicht bloß darauf an, auf den Inhalt zu sehen. Gewiß kann jemand sagen: Ja, derjenige, von dem ich jetzt etwas lese, betrachtet etwas ganz anderes als der andere. Aber darauf kommt es nicht an, wenn man die Volksseelen betrachtet. Die Volksseelen werden ja unbewußt in die Strömung hineingetrieben, in der sie treiben. Und daß der eine diese Wirkung, der andere jene Wirkung, der eine diese Begriffe, der andere jene Begriffe, der eine diese Bilder, der andere jene Bilder hat, wenn sie auch beiderseits richtig sind, darum handelt es sich
nicht, wenn man die Volksseelen bei diesem unbewußten Wirken charakterisieren will.
«Was ist Freiheit?» sagt der andere. «Das Bild, das mir vorschwebt, ist eine große, mächtige Maschine. Setze ich die Teile so unbeholfen und ungeschickt zusammen, daß, wenn ein Teil sich bewegen will, er durch die anderen gehemmt wird, dann verbiegt sich die ganze Maschine und steht still. Die Freiheit der einzelnen Teile» - wohlgemerkt: die Freiheit der Teile der Maschine! - «würde in der besten Anpassung und Zusammensetzung aller bestehen.» - Um die menschliche Freiheit zu charakterisieren, sagt er das alles! -«Wenn der große Kolben einer Maschine vollkommen frei laufen soll, so muß man ihn den anderen Teilen der Maschine genau anpassen. Dann ist er frei... » - Um zu wissen, wie der Mensch frei wird, untersucht man also die Maschine! - « . . . dann ist er frei, nicht weil man ihn isoliert und für sich allein läßt, sondern weil man ihn sorgfältig und geschickt den übrigen Teilen des großen Gefüges eingefügt hat. Was ist Freiheit? Man sagt von einer Lokomotive, daß sie frei laufe. Was meint man damit? Man will sagen, die einzelnen Bestandteile seien so zusammengesetzt und ineinandergepaßt, daß die Reibung auf ein Minimum beschränkt wird. Man sagt von einem Schiff, das leicht die Wellen durchschneidet: wie frei läuft es, und meint damit, daß es der Stärke des Windes vollkommen angepaßt ist. Richte es gegen den Wind, und es wird halten und schwanken, alle Planken und der ganze Rumpf werden erzittern, und sofort ist es gefesselt.» - Jetzt zeigt er, daß das so geht bei der menschlichen Natur wie bei der Maschine, bei dem Dampfschiff und so weiter: «Es wird nur dann frei, wenn man es wieder abfallen läßt und die weise Anpassung an die Gewalten, denen es gehorchen muß, wieder hergestellt hat.»
Man kann sagen, an solchen Dingen kann man sehen, wie das Volksseelentum hereinkraftet in die menschlichen Individualitäten, das eine Mal so, wie ich es Ihnen bei dem Deutschen vorgelesen habe, das andere Mal, wie ich es Ihnen vorgelesen habe bei einem sehr bedeutsamen Amerikaner, bei Woodrow Wilson. Er ist ja ganz gewiß ein sehr bedeutsamer Amerikaner. Es handelt sich darum, zu sehen, wie der Mensch ergriffen wird von dem Volksseelentum. Man kann eben durchaus den Unterschied bemerken, wenn man hineingeht bis in diejenigen Tiefen des Menschenwesens, wo die Volksseelenwesenheit unbewußt hineinwirkt in das einzelne menschliche Individuum, so wie ich es charakterisiert habe.
Ich müßte noch vieles reden, wenn ich gerade die deutsche Seele in ihrer Entwickelung nach den angedeuteten Richtungen hin vollständig charakterisieren wollte. Aber ich denke, wenigstens skizzenhaft sind ja die Hauptgesichts-punkte angegeben, und sie bezeugen wohl, daß in diesem deutschen Volksseelenwesen doch etwas liegt, das schon durch seine Eigenart veranlagt ist, in anderes hineinzuwirken. Es hat ja hineingewirkt. Wir haben es gesehen, wie im Blut abgegeben worden ist an die Peripherie dasjenige, was in der Mitte geblieben ist, was sich da konzentriert hat. Es hat fortwährend abgegeben, ich möchte sagen, fortwährend ausgeatmet und wieder eingeatmet dasjenige, was Beziehungen sind zu den anderen Volksseelen der Umgebung.
In der Richtung, die ich angegeben habe, liegt eine Wissenschaft, die einmal, wenn sie da sein wird, das verständlich machen wird, was zwischen den Völkern besteht. Dann wird erst die große Möglichkeit gegeben sein, daß sich bewußt die Völker voll verstehen werden. Wir sehen da zugleich, wie groß der Abstand ist zwischen dem, was einem als ein Ideal des Völkerverstehens vorschweben kann, und
dem, was einem gerade in unserer schweren Zeit entgegen-tritt. Nicht abwägen, nicht bewerten wollte ich. Aber schließlich bewerten sich ja die Dinge in einer gewissen Weise selber.
Ich weiß nicht - ich sage das selbstverständlich nur in ganz bescheidener Art -, ob in einer ähnlichen Weise in Europas Peripherie Betrachtungen angestellt werden, die so nach Objektivität streben über die Beziehungen der italienischen Volksseele zur deutschen Volksseele, der französischen Volksseele, der britischen Volksseele zur deutschen, wie wir es heute hier getan haben. Aber vielleicht liegt das auch in einem eigentümlichen Charakterzug der deutschen Volksseele. Jedenfalls liegt es schon in der deutschen Volksseele, daß, wie mir scheint, der Deutsche besser verstehen kann die anderen, als sie ihn verstehen, wenn sie ihn auch just nicht so schlecht verstehen müßten, wie es jetzt in unserer schicksaltragenden Zeit der Fall ist.
Wirkt es nicht eigentlich wie ein Zum-Bewußtsein-Kommen, in was wir leben, wenn wir eine solche Betrachtung über das Volksseelenwesen nun messen an alledem, was uns heute entgegentönt über das Wesen des Deutschtums? Es ist schon unsere Zeit dazu angetan, daß man diese Dinge zusammenstellt. Es gab, wie Sie gesehen haben an Victor Hugo, Zeiten, in denen deutsches Wesen so angesehen werden kann, wie es im Sinne des heute Entwickelten, wenn auch nicht in diesen Begriffen, liegt. Ja, solches hat man immer wieder gefühlt. Und es waren doch recht, recht viele bis vor kurzer Zeit und sind gewiß auch jetzt noch manche,
- recht viele aber bis vor kurzer Zeit, die sich auch vernehmen ließen, wie unrecht es ist, deutscher Gesittung so zu begegnen, wie ihm zum Beispiel von seiten des Britentums begegnet worden ist. Da kann ich mich ja berufen auf Worte, die am 2. August 1914 gedruckt worden sind. Da
smd die Worte gedruckt worden: «Krieg Englands gegen Deutschland in Serbiens und Rußlands Interesse ist eine Sünde gegen die Gesittung.» Am 2. August 1914 standen diese Worte in den «Times» in London, und unterschrieben waren sie von C. G. Brown, Universität Cambridge, Bur-kitt, Universität Cambridge; Carpenter, Universität Oxford; Ramsay, früher Universität Aberdeen; Selbie, Universität Oxford, J. J. Thomson, Universität Cambridge . Und hinzugesetzt ist diesen Worten: Wir können es nicht wissen, aber es kann sich ergeben - so ungefähr heißt es-, daß durch allerlei Abmachungen unser Land in diesen Krieg verwickelt werden könnte. Wir wollen es nicht hoffen, wir müßten aber dann, wenn es geschähe, aus vaterländischer Gesinnung selbstverständlich - ja, es steht da so etwas wie: - den Mund halten. - Nun, diese Dinge sind ja natürlich nicht nur in England. - Aber wir wollen nicht hoffen - so schrieben die betreffenden Engländer weiter -, daß das kommen könnte gegenüber einem Volk, das so verwandt ist mit uns und das so viel Gemeinsames mit uns hat.
Da wurde das gefühlt, was nun später nicht ausgesprochen werden darf. Nun, manches darf ja natürlich bei uns auch nicht ausgesprochen werden, selbstverständlich. Und von dieser Seite her ist den Herren, deren Namen vorgelesen worden sind, ja kein besonderer Vorwurf zu machen. Aber es kommt vielleicht weniger darauf an, was ausgesprochen werden darf oder nicht ausgesprochen werden darf, sondern was ausgesprochen wird, wenn gewisse andere nicht sprechen können. Und da möchte ich sagen: Ich glaube es nicht, daß ein Wochenblatt innerhalb des deutschen Volksgebietes sich finden lassen könnte, welches ähnliche Worte über eine andere Nation in dieser jetzigen schweren Zeit schreiben würde, drucken lassen würde, wie
am 1O.Juli 1915 in einem englischen Wochenblatte, im «John Bull», einem der verbreitetsten Wochenblätter in England, geschrieben wurde, - geschrieben wurde da, wo die anderen schweigen müssen. Sagen Sie nicht: Der «John Bull» ist eben ein Schmähblatt! Ich sage: Ich kann nicht glauben, daß es möglich ist, daß in dem aller-, allerschmählichsten Blatt in einer ähnlichen Weise über eine andere Nation geschrieben werden könnte, als da steht, um deutsches Wesen zu charakterisieren. Ich lese nur einige Sätze vor: «Der Deutsche ist der Schandfleck Europas, und die Aufgabe des gegenwärtigen Krieges ist es, ihn von der Erde wegzuwischen... So wie er im Anfang war, so ist er jetzt und wird er ewig bleiben - schlecht, brutal, blutrünstig, grausam, gemein und berechnend. Er ist ein Lüstling, ist schmierig, windig, dickhäutig. Er lallt seine Sprache in Gutturallauten. Er säuft, ist geizig, raubgierig und niedrig-kriechend. Das ist die Bestie, die wir bekämpfen müssen . . . Er wohnt in Wohnungen, die gesundheitlich auf der Höhe eines Schweinestalles stehen.» Und nun erhebt sich das Wochenblatt zu einer Art von, ich möchte sagen, Gebet aus dieser Stimmung heraus: «Man betrachte die Geschichte, wo und wie man will, man findet den Deutschen stets als Bestie! . . . Nie wird Gott dir, englisches Volk, diese Gelegenheit wieder geben. Deine Mission ist es, Europa von diesem unreinen Tier, dieser Bestie, zu befreien. Solange diese Bestie nicht vertilgt ist, wird der Fortschritt der Menschheit verzögert. England nähert sich langsam, aber sicher dem letzten Meilenstein seines Geschickes, und wenn wir den passiert haben, und es kommt dereinst die Stunde, wo wir ins Tor des Himmels wollen, dürfen die Hunnen nicht der Grund sein, daß wir zurückgeschickt werden. Die Himmelstore würden uns aber vor der Nase zugeschlagen, denn die himmlischen Gefilde sind nur für die vorhanden,
die den Teufel vertilgt haben. Die Deutschen sind die Pestbeulen der menschlichen Gesellschaft. Und diese Kriegszeiten sind die X-Strahlen, die ihren wahren Charakter durchleuchten. Diese Pestbeule muß herausgeschnitten werden, und das britische Bajonett ist das Instrument für diese Operation, die an der Bestie vorgenommen werden muß, wenn unsere giftigen Gase sie chloroformiert haben.»
Ich weiß nicht, ob es wirklich innerhalb dessen, was das deutsche Volksseelengebiet umfaßt, möglich wäre, in einer ähnlichen Richtung ähnliche Worte zu finden. Davor, denke ich, wird gerade dasjenige, was man als deutschen Volksseelencharakter erkennen kann, den Deutschen bewahren.
Zum Schluß aber, mit ein paar Sätzen, möchte ich sagen:
Lange, lange möge den Deutschen sein Seelencharakter bewahren, in solch grotesken Wahnsinn zu verfallen. Wahnsinn ist es ja gewiß, aber der Wahnsinn hat Methode. Denn er ist es, der sich entwickelt, während die anderen Genannten schweigen müssen. Diese hier charakterisieren, was sie eigentlich gegen die Deutschen unternehmen müssen, wofür sie kämpfen, nicht nur auf dem Felde, wo mit den äußeren Waffen gekämpft wird, sondern auch auf dem geistigen Felde. Wir schauen uns das an. Wir halten es für Wahnsinn, wenn auch für Methode. Doch die anderen nennen das: «Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei!»
- «Kampf des Geistes gegen die Materie!» - Dazu brauche ich allerdings nichts weiter zu sagen und kann es Ihren eigenen Gedanken überlassen, was Sie darüber denken wollen.
Übermorgen werde ich dann über die Menschenseele und ihre Durchgänge in ihrer Entwickelung durch Geburt und Tod und ihren Zusammenhang mit dem Weltenall sprechen.
LEIB, SEELE UND GEIST Berlin, 15. April 1916
Gestatten Sie, daß ich heute in einer vielleicht etwas aphoristisch gehaltenen Form einige Andeutungen über das Wechselverhältnis von Leib, Seele, Geist im Menschen mache und dann, davon ausgehend, einiges bemerke über die Beziehungen des Menschen zu Geburt und Tod und zum Weltenall überhaupt. Es ist ja selbstverständlich, daß dies alles nur in Andeutungen geschehen kann. Allein diejenigen der verehrten Zuhörer, die einige oder alle der diesjährigen Wintervorträge gehört haben, werden gar vieles von dem, was heute nur aphoristisch vorgebracht werden kann, mehr oder weniger belegt finden in den vorangegangenen Betrachtungen, die ja auf wichtige Fragen des Geistes- und Seelenlebens im einzelnen eingegangen sind. Gerade im Laufe dieses Winters und des vorigen Winters gestattete ich mir öfters, die Bemerkung zu machen, wie Geisteswissenschaft, so wie sie gedacht ist in den Betrachtungen, die in diesen Vorträgen angestellt werden, nicht etwa etwas ist, das wie durch die Willkür eines einzelnen heute in die geistige Kulturentwickelung der Menschheit eintreten will, sondern daß sie tief begründet ist in dem Geistesleben, wie es sich im Laufe der Zeit allmählich herausentwickelt hat bis in unsere Tage. So daß man sagen kann: Es ist, gerade wenn man die Zeit des neunzehnten Jahrhunderts durchblickt, an vielen Stellen eine Art Ansatz
vorhanden zu einer solchen Geisteswissenschaft. Durch sehr begreifliche Verhältnisse ist es aber herbeigeführt worden, daß im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts, und namentlich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts die ja so außerordentlich erfolgreiche und in ihren Erfolgen durch die Geisteswissenschaft durchaus nicht anzuzweifelnde naturwissenschaftliche Denkweise die Geister in Anspruch genommen hat, und daß dadurch die Ansätze zu einer eigentlichen geisteswissenschaftlichen Weltanschauung mehr abgedämpft worden sind, als das vielleicht sonst der Fall gewesen wäre.
Insbesondere erscheint mir, daß in Goethes Weltanschauung alle bedeutungsvollsten ersten Ansätze zu einer Geisteswissenschaft liegen und daß im Grunde genommen, wenn Goethes Weltanschauung wirklich durchdrungen wird, man gar nicht zweifeln kann, daß in dieser Goetheschen Anschauung der Welt wirklich etwas wie ein Keim liegt, aus dem sich Geisteswissenschaft heraus entwickeln kann. Gewiß, man glaubte, gerade Goethe im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts so recht tief zu verstehen. Man versuchte es auch ehrlich. Aber was in ihm vorhanden ist als die bedeutungsvollsten Keime einer geisteswissenschaftlichen Welt-betrachtung, das gewinnt man doch eigentlich erst dann, wenn man nicht nur versucht, den Blick der Seele unmittelbar darauf zu lenken, was Goethe selber hervorgebracht hat, sondern wenn man versucht, sich ganz hinein zu versetzen in die Art und Weise, wie er gedacht, wie er die Dinge angeschaut hat, wenn man gewissermaßen nicht bloß sein Betrachter, sondern sein Nachleber werden will. Es ist ja bekannt, und ich habe auch in diesen Vorträgen öfter darauf aufmerksam gemacht, wie Goethe sich zu einer bedeutungsvollen Naturanschauung erhoben hat, sagen wir zunächst in seiner Betrachtung über die Metamorphose der
Pflanzen. Was wollte er mit dieser Metamorphose der Pflanzen? Nun, er wollte zunächst zeigen, daß dasjenige, was als Pflanzenwesen m Wurzeln, Blättern, Blütenblättern, in der Frucht sich darlebt, aus einzelnen Gliedern besteht, aber so, daß diese einzelnen Glieder auseinander hervorgehen, Verwandlungen voneinander sind. Er wollte eine umfassende Betrachtung des Pflanzenwesens zum Beispiel dadurch gewinnen, daß er zu zeigen versuchte: Was wir als gefärbtes Blumenblütenblatt anschauen, das ist von einem gewissen Gesichtspunkte aus innerlich wesentlich dasselbe, wie das grüne Pflanzenblatt, nur metamorphosiert, umgewandeltes Pflanzenblatt. Und wiederum umgewandeltes Blütenblatt sind die feinen Organe, die wir in der Blüte finden, die wir als Staubgefäße ansprechen und so weiter, bis zu der Frucht herauf. Alles entsteht an der Pflanze für Goethe dadurch, daß sich gewissermaßen nach rückwärts und vorne das Blatt umwandelt. Die ganze Pflanze wird ihm zum Blatte, aber zum Blatte, das sich in verschiedener Weise in Formen ausgestaltet. Dadurch verliert die geistige Betrachtung in Goethes Sinne, ich möchte sagen, die intensive Hinlenkung auf den einzelnen Teil der Pflanze, erhebt sich zu einem Ganzen der Pflanze, aber zu einem Ganzen, das geistig ist, und das er nun den Typus der Pflanze nennt. Merkwürdig ist ja, wie Goethe bei seiner Reise in Italien glaubte, immer gründlicher und gründlicher in seinem Geiste das erwecken zu können, was man nun nicht an der Pflanze mit äußeren Sinnen wahrnehmen kann, sondern was sinnlich - Goethe nennt es eine sinnlich-übersinnliche Form - in der Pflanze lebt und was sich eben in verschiedenen Gestaltungen ausformt als Blatt, als Blumenblatt, als Staubgefäß und so weiter. Er nennt diesen Typus, der sinnlich-übersinnlich ist, auch die Idee der Pflanze. Und ich habe ja auch schon in früheren Zeiten
hier davon gesprochen, was nach einem botanischen Vortrage, den der Jenenser Professor Batsch gehalten hat, zwischen Schiller und Goethe, die beide den Vortrag angehört hatten, gesprochen worden ist. Schiller hatte gefunden, das sei ja alles recht schön und gut, aber man habe kein Ganzes, es zerbröckele sich alles in lauter Einzelheiten, es sei keine Überschau da. Goethe nahm ein Blatt und zeichnete vor Schillers Augen eine ideelle Pflanze auf, eine Pflanze, die man nirgendswo äußerlich findet, von der er aber glaubte, daß sie für ihn als sinnlich-übersinnliche Form erfaßbar sei und in jeder Pflanze lebe, so daß jede Pflanze nur eine besondere Ausgestaltung dieser, wie er sagte, Urpflanze sei. Also etwas, was niemals da oder dort mit Augen zu finden ist, zeichnete Goethe auf. Schiller, der in solchen Dingen damals noch nicht ganz zu Hause war - es war in den Anfängen der neunziger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts -, konnte sich gar nicht zurechtfinden in dem, was da Goethe mit dieser Urpflanze wollte. Da sagte er: Ja, das ist eine Idee, es ist keine Anschauung; das nimmt man nirgends wahr! - Goethe wurde unwillig über diesen Einwand und sagte: Wenn das, was ich hier gezeichnet habe, eine Idee ist, so nehme ich meine Ideen mit Augen wahr! -Nun, das war gewiß nach der anderen Seite wiederum etwas extrem ausgedrückt, etwas übertrieben. Aber Goethe fühlte, daß er nicht bloß eine abstrakte Idee aufgezeichnet habe, sondern etwas, was sich ihm mit einer solch inneren Notwendigkeit in der Seele ergab, wie sich für das Auge das einzelne Pflanzenleben ergibt, wenn das Auge eben den Blick auf die einzelne Pflanze richtet. Dieses Leben mit dem Sinnlich-Ubersinnlichen, wie er es nannte, das war für Goethe eine Wirklichkeit, das war für Goethe eine Realität.
Nun setzte Goethe solche Betrachtungen mit Eifer und
mit wirklicher Anstrengung fort. Wer Goethes Bestrebungen studiert hat, weiß, daß er alle möglichen Beobachtungen mit wirklicher wissenschaftlicher Anstrengung, zusammen mit den Jenenser Professoren, namentlich mit Loder, gemacht hat. Goethe setzte mit Eifer die Bestrebungen fort, um zu irgend etwas zu gelangen, das ihm für das ganze Reich der Lebewesen eine ähnliche Betrachtungsweise rechtfertigen könnte. Und es ist ja bekannt - man braucht es in Goethes naturwissenschaftlichen Schriften nur nachzulesen -, wie er dann versucht hat, auch für die Formen des Menschlichen und Tierischen herauszufinden, wie die verschiedenen Organe im Grunde genommen nur Umwandlungen einer Grundform des Organes sind. Und wie gesagt, man kann es in Goethes naturwissenschaftlichen Schriften nachlesen, wie er gewissermaßen durch einen Geistesblitz, der aber vorbereitet war durch seine sorgfältigen anatomischen Studien, bei seiner zweiten italienischen Reise einen glücklich geborstenen Tierschädel fand und sich ihm daran enthüllte, wie die Knochen des Kopfes in ihrer Schaligkeit nur umgewandelt sind und wie ihre Urform dasjenige ist, was wir in der Wirbelsäule des Rückens als Wirbelknochen übereinander gelagert finden. Ein solcher Wirbelknochen, wovon 30 bis 33 übereinander gereiht sind, in der entsprechenden Weise umgewandelt, gewissermaßen von seinen inneren Triebkräften - verzeihen Sie den trivialen Ausdruck - aufgeplustert, innerlich ausgestaltet, gibt gewisse Glieder der Schädelhülle, so daß die Schädelhülle für Goethe sich als umgewandelter Wirbelknochen darstellt.
Es ist mir wohlbekannt, in welcher Weise diese Goethesche Anschauungsart durch moderne Anschauungen umgestaltet ist. Darauf kommt es jetzt nicht an, sondern es kommt auf die Denkweise an, nicht auf die Einzelheiten. Nun kann man voraussetzen, daß Goethe vielleicht in dem
Augenblicke, da ihm aufgegangen war: die Schädeiknochen seien umgewandelte Wirbelknochen, da wirkt und treibt etwas im Wirbelknochen, was, während es im Wirbelknochen versteckt blieb, sich auftreibt, - auf den Gedanken kam, daß auch das ganze Gehirn des Menschen umgewandelte Nervensubstanz sei, umgewandeltes Nervenglied, wie solche Nervenglieder nun im Rückenmark übereinander gegliedert sind. Das heißt, daß nicht nur die äußere Umhüllung des Rückenmarks und der Schädel sich als Umwandlungsformen aus einander darstellen, sondern daß das Gehirn sich selbst auf einer höheren Stufe als Umwandlung dessen zeige, was in der Rückenmark-Knochensäule drinnen als Nervenorgane, Ganglien, wenn man es so nennen will, übereinander gelagert ist. Dieser Gedanke lag dazumal nahe, als Goethe den anderen Gedanken mit einer für ihn absoluten Sicherheit gefaßt hatte. Aber er hat diesen Gedanken nicht ausgeführt, so daß man ihn zunächst nicht in seinen Schriften finden kann.
Ich darf vielleicht erwähnen, daß ich mich seit nun mehr als dreißig Jahren intensiv mit Goethes naturwissenschaftlichen Studien befaßt habe und daß mir von Anfang an klar war: der letzte Gedanke müsse sich bei Goethe an den ersten angereiht haben. Aber selbstverständlich würde es noch etwas Besonderes sein, wenn man nachweisen könnte, daß Goethe diesen Gedanken wirklich im Zusammenhang mit dem ersten gefaßt hat. Und als ich dann vom Jahre 1890 bis 1897 im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar arbeiten durfte, lag mir unter anderem selbstverständlich auch nahe, solchen Dingen nachzugehen. Und schon im Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, etwa im Jahre 1891 konnte ich ein Notizbuch aufschlagen, das Goethe in derselben Zeit geführt hat, in der er jene Entdeckung über die Wirbelnatur der Schädelknochen gemacht
hat. Und in diesem Notizbuch findet sich eingetragen mit den markanten Goetheschen Bleistift-Buchstaben - das ist also ein Notizbuch, das Goethe sich 1790 in Venedig angelegt hatte - : «Das Hirn selbst ist nur ein großes Hauptganglion. Die Organisation des Gehirns wird in jedem Ganglion wiederholt, so daß jedes Ganglion als ein kleines subordiniertes Gehirn anzusehen ist.»
Also das Gehirn, das ganze Gehirn ist nur dasjenige, was wir in jedem Gliede des Nervensystems finden, auf einer anderen Stufe der Entwickelung! Ich möchte heute Ihren Blick weniger auf diese Tatsache als solche hinlenken, sondern darauf, wie Goethes Geist veranlagt gewesen sein muß, um solches zu erkennen, um solche Zusammenhänge geltend zu machen in dem, was uns sinnlich-physisch in der tierischen, in der pflanzlichen, in der menschlichen Organisation umgibt. Was strebte denn Goethe da eigentlich an? Nun, wir sahen es ja. Er strebte an, zu dem, was die bloße Sinnesbeobachtung geben kann, ein Sinnlich-Über-sinnliches zu finden, etwas, was nur im Geiste erfaßt werden kann, was aber ebenso eine Wirklichkeit ist, wie dasjenige, was mit Augen geschaut werden kann. So daß Goethe zu dem extremen Ausspruch kam: Dann sehe ich meine Idee mit Augen! - Er konnte ja natürlich nur die Augen der Seele meinen, denn mit äußeren Augen kann man nicht Ideen sehen.
Um nun zu zeigen, wie in dem, was Goethe über die äußeren Zusammenhänge gedacht hat, dasjenige im Keim liegt, was Geisteswissenschaft heute zu sagen hat, muß ich nun gewissermaßen einen Sprung machen. Aber dieser Sprung wird dem naturgemäß erscheinen müssen, der versucht, allmählich in den Geist der Goetheschen Betrachtungsweise einzudringen. Wenn man nämlich weiterkommen will in dieser Betrachtungsweise, die Goethe aus seiner,
ich möchte sagen, instinktiven Genialität heraus zunächst auf die äußere Form des Lebens angewendet hat, so ist dazu schon notwendig, daß die Seele des Menschen jene inneren Entwickelungen durchmacht, von denen ich nunmehr seit Jahren und besonders auch in diesem Winter wiederum gesprochen habe, die Sie, wie ich das letzte Mal erwähnt habe, in kurzem angedeutet finden können, geschildert auf ein paar Seiten in dem Aufsatz, den ich in der eben erschienenen Zeitschrift «Das Reich» niedergeschrieben habe, und der einiges zusammenzieht aus dem, was Sie in meinen Büchern «Geheimwissenschaft», «Theo-sophie», oder «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» ausführlich geschildert finden. Ich möchte sagen:
Es muß dasjenige, was die Seele zunächst fähig macht, durch das Werkzeug des physischen Organismus die Welt anzuschauen, heraufgehoben werden durch besondere Seelenverrichtungen, die ich heute nicht wieder schildern kann, die ich aber oftmals hier geschildert habe. Durch diese inneren Übungen, durch diese inneren Seelenverrichtungen, muß die Seele fähig gemacht werden, wirklich das Seelisch-Geistige als solches zu sehen, also solches wahrzunehmen. Dasjenige, was bei Goethe mehr instinktiv auftritt, in bewußter Weise zum Gegenstande der Betrachtungen machen, das ist das Aufsteigen von Sinneswissenschaft zu Geisteswissenschaft.
Nun habe ich geschildert - und wie gesagt, in den genannten Schriften und Aufsätzen können Sie das nachlesen -, wie es die Seele durch gewisse innere Seelenverrichtungen, die sie mit sich selber vornimmt, in ihrem intimsten inneren Erleben wirklich dazu bringt, allmählich Erfahrungen, Erlebnisse zu haben, die ganz anderer Art sind als die Erlebnisse, die man im gewöhnlichen Leben durch das Instrument des Leibes hat; wie die Seele dazu kommt, indem
sie sich eben innerlich Anstöße gibt, die sie sich sonst im äußeren Leben nicht gibt, ein inneres Element wirklich so loszulösen von dem Leiblichen, wie - um das vorgestern Gesagte noch einmal zu wiederholen - der Sauerstoff aus dem Wasserstoff in dem bekannten chemischen Experiment herausgelöst wird. Durch solche Seelenübungen gelangt die Seele dazu, sich rein im Seelenelement selber zu erleben, das Seelische abgesondert von dem Leiblichen zu betrachten. Da man nicht immer wieder alles beweisen kann, so möchte ich darauf hinweisen eben, daß ich heute dies nur wie das Resultat voriger Vorträge geben werde, daß ich ja aber vieles über diese Loslösung des Seelischen aus dem Leiblichen gesagt habe.
Indem nun der Mensch dazu gelangt, das Geistig-Seelische als solches wahrzunehmen, losgelöst von dem Leiblichen, wird ihm das Leibliche etwas anderes und das Seelisch-Geistige auch etwas anderes. So wie nicht mehr Wasser da ist, sondern Sauerstoff und Wasserstoff, wenn man das Wasser im chemischen Experiment zerlegt, so wird das Leibliche ein anderes, es wird das Geistige ein anderes, selbstverständlich nur vor der inneren Betrachtung. Dann aber, wenn sich die Seele also befruchtet durch solche wirkliche, nun innere Geist-Seelen-Anschauungen, dann kommt man allmählich dazu, auch die äußere Welt wiederum ganz anders anzusehen als vorher. Denn diese äußere Welt ist ja wiederum allüberall vom Geistigen durchdrungen. Und dann wird, ich möchte sagen, die ganze Goethesche Metamorphosen-Lehre viel intensiver, viel in sich gesättigter. Wer zunächst durch das Instrument des äußeren Leibes nur die äußere Sinnenwelt und ihren Verlauf anschaut, der sieht ja nur das, was sich im materiellen Dasein ausdrückt. Er kann ahnen, daß durch das materielle Dasein der Geist sich offenbart. Aber den Geist selber, wie er waltet und webt
in dem Materiellen, den kann man erst sehen, wenn diejenigen Kräfte der Seele ausgebildet sind, von denen ich in den früheren Vorträgen gesprochen habe. Dann aber erscheinen einem auch diejenigen Organe, die man mit physischen Augen an dem Menschen und auch an den anderen Lebewesen sieht, in einem ganz anderen Lichte. Und dann erweitert sich dasjenige, was in Goethes Naturwissenschaft veranlagt ist, in einer großartigen Weise. Dann lernt man, eigentlich nur durch eine gradlinige Fortsetzung desjenigen, was in Goethes Ideen veranlagt ist, erkennen, wie uns das ganze menschliche Haupt entgegentritt als der Ausdruck desjenigen, was der Mensch eigentlich von innen heraus in der Welt ist. Dieses ganze menschliche Haupt erscheint einem als ein kompliziertes Umwandlungsprodukt von etwas anderem. Wir wissen - durch eine schon ganz äußerliche Betrachtung am Skelett kann man sich das am besten klar machen -, daß der Mensch ja sichtlich aus zwei Teilen besteht: aus seinem Haupte und aus dem übrigen Organismus, der im Skelett sogar nur durch kleine Bindeglieder mit dem Haupte verbunden ist. So daß wir den Menschen wirklich teilen können in den Hauptes-Teil und in den übrigen körperlichen Organismus, wenn wir ihn rein äußerlich-leiblich anschauen. Und nun kommt man darauf, wenn man, wie gesagt, seine Anschauungen befruchtet durch die innere Schauung, daß das ganze Haupt auf komplizierte Weise eine Umbildung des übrigen Organismus ist. Auf einer anderen Entwickelungsstufe ist der übrige Organismus in einer entsprechenden Art etwas Ähnliches wie das Haupt, wie der Wirbelknochen der Rückenmark-Säule etwas Ähnliches ist wie der Schädelknochen. Das ganze menschliche Haupt ist umgewandelt aus dem menschlichen übrigen Organismus. Und den Gedanken bekommt man klar, daß dieses menschliche Haupt gewissermaßen wie der
übrige Organismus ist, der die Bildungskräfte, die in ihm sind, weitergetrieben hat. Der übrige Organismus ist auf einer bestimmten Stufe stehengeblieben; es sind festgehalten die Bildungsgesetze auf einer bestimmten Stufe. Im Haupte sind sie weitergetrieben, sind weiter in die Form hinein verarbeitet, sind weiter in die Plastik ausgegossen, möchte ich sagen. Das ganze menschliche Haupt - umgewandelt der übrige Mensch, äußerlich-leiblich genommen!
Ich müßte lange sprechen, wenn ich auf Einzelheiten in dieser Beziehung eingehen w ü rde. Aber wenn man hier durch Wochen hindurch einen anatomisch-physiologischen Kursus halten könnte und auf die einzelnen Organe eingehen würde, die sich im Haupte und im anderen menschlichen Organismus finden, so würde man bis ins Einzelnste hinein im strengsten Sinne naturwissenschaftlich nachweisen können, wie der Grundgedanke, den ich jetzt nur andeuten kann, absolut zu belegen ist. Nun muß man aber, um sich gewissermaßen einer Erkenntnis des ganzen, vollen Menschen anzunähern, die ganze Bedeutung dessen, was also erkannt ist, ins Auge fassen, die ganze, volle Bedeutung. Wir haben ja dann im Menschen, so wie er vor uns leibt, im Grunde genommen ein Doppeltes vor uns: Wir haben sein Haupt vor uns auf einer ganz anderen Entwickelungsund Bildungsstufe als der übrige Organismus, und wir haben den übrigen Organismus vor uns, von dem wir sagen können: In ihm liegen Bildungskräfte, die nur auf einer früheren Stufe festgehalten sind, würden sie ausgestaltet, so würden sie zum Haupte werden können. Ebenso können wir sagen: Wenn das Haupt heute seine Bildungskräfte nicht vollständig ausgestaltet, sondern sie auf einer früheren Stufe gelassen hätte, so würde es nicht Haupt geworden sein, sondern es würde sich in einer äußeren Form als der übrige Organismus darleben.
Einen weiteren Einblick in diese Verhältnisse gewinnen wir, wenn wir nunmehr das Seelische des Menschen betrachten. Und dieses Seelische des Menschen kann nur dann betrachtet werden, wenn man wirklich von der gewöhnlichen menschlichen Erkenntnis aufsteigt zu dem, was ich vorhin gemeint habe und heute nur andeutungsweise schildern kann, mit der höheren Erkenntnis, mit der inneren, übersinnlichen Schauung. Sie wissen ja, es gibt auch eine sogenannte Psychologie, eine Seelenwissenschaft. Und insbesondere in unserer heutigen Zeit will diese Seelenwissenschaft durch ganz dieselbe Betrachtungsweise entstehen, die man in der äußeren Naturwissenschaft anwendet. Leute, die noch etwas von früherer Betrachtungsweise des Seelischen in sich hatten und dennoch den durchaus berechtigten Ansprüchen der modernen Naturwissenschaft voll Rechnung tragen wollten, versuchten, das Seelenleben des Menschen, wie es sich darlebt, zu durchschauen. Ein wirklich bedeutender Seelenforscher, der noch etwas von einer jetzt scheinbar überwundenen älteren Seelenwissenschaft in sich hatte und der modernen Naturwissenschaft voll Rechnung tragen wollte, ist Franz Brentano. Allein er konnte sich in seiner «Psychologie», die 1874 erschienen ist, auch zu nichts anderem erheben, als dazu, dasjenige, was in der Seele lebt, einzuteilen. Man teilt ja gewöhnlich dieses Seelenleben in Denken, Fühlen und Wollen ein. Brentano teilt es etwas anders ein. Franz Brentano ist eben ein solcher Seelen-betrachter, der sich nicht erheben kann zu einer geistigen Schauung, sondern der die Betrachtungsweise, die man sonst nur für die äußere Natur, für die Sinnesanschauung hat, auf das Seelenleben anwenden will. Er kommt nur zu einer Einteilung. Goethe sucht schon in der äußeren Natur nicht zu einer bloßen Einteilung zu kommen, zu dem, was man eine Systematik nennt, sondern er sucht zu einer
Metamorphose zu kommen, er versucht, die Umwandlung darzulegen, und dadurch gewissermaßen dasjenige, was übersinnlich lebt, in seiner verschiedenen Form-Umgestaltung zu verfolgen und eine Einheit der Überschau in dem Ganzen zu haben. Brentario, der Psychologe, zerlegt auch das Seelenleben und kommt wiederum mit den einzelnen Seelenerscheinungen nicht zurecht. Man muß wirklich sagen: Es ist eine harte Nuß, die man zu knacken hat, wenn man gerade die Psychologie der Gegenwart, wie sie sich insbesondere im neunzehnten Jahrhundert entwickelt hat, mit dem Blick des Seelenforschers, der aber geschult ist auf die Weise, wie ich es ja oftmals hier geschildert habe, durchblickt. Da findet man diese Ohnmacht, zu etwas anderem zu kommen als zu bloßen Einteilungen: Denken, Fühlen und Wollen.
Dasjenige, was Goethe schon durchleuchten lassen will durch alles Materielle, das lebt, diese Umformung und Umwandlung, dieses Leben, nun nicht in einer unbeweglichen Anschauung, die Ding neben Ding stellt und einteilt, sondern in einem Beweglichen, in einem Lebendigen. Dieses Leben in einer solchen Anschauung muß insbesondere auf das Seelenleben angewendet werden, wenn man das Seelen-leben wirklich erfassen will. Man kann nicht einfach das Denken, das Fühlen, das Wollen ins Auge fassen. Das ist ganz unmöglich, da kommt man eben nur zu der Einteilung in Denken, Fühlen und Wollen. Aber wenn man mit dem geistesforscherisch geschärften Blicke das Seelenleben nach Denken, Fühlen und Wollen untersucht, dann findet man darin gerade in einer viel intensiveren Art Metamorphose, Umwandlung als in dem, was durch die äußere Form der lebendigen Natur leuchtet. Man ergreift gewissermaßen die Umwandlung selber.
Kann man denn den Gedanken in seiner Wesenheit erkennen,
wenn man ihn nur als Gedanken erfaßt? Nein, das kann man eben nicht! Das zeigt sich gerade der geistigen Schauung. Der Gedanke verwandelt sich in der Seele selber ins Fühlen, und das Fühlen wiederum in den Willen. Und man muß die Metamorphose von Denken, Fühlen und Wollen in der inneren Beweglichkeit lebendig erfassen können, dann erfaßt man das Seelische. Das kann man nur, wenn man das Seelische losgetrennt hat von dem Leiblich-Physischen. Und da merkt man dann in unmittelbar innerem Erkenntniserleben, was geschieht, wenn wir einen Gedanken haben und ihn vergleichen mit einem Gefühl, Gefühle wieder vergleichen mit dem Willen. Wir kommen dazu, im innerlichen Erleben jeden Gedanken in uns anzuschauen, entstanden dadurch, daß das Gefühl sich umgewandelt hat. Jeder Gedanke ist ein umgewandeltes Gefühl, und zwar muß man, wenn man das innerlich anschauen will, jedesmal im Gedanken das nicht vollständige, aber halbe Ersterben des Gefühles wahrnehmen. Das Gedanken-leben ist ein erstorbenes Gefühlsleben. Im Gedanken lebt, ich möchte sagen, der Rest des Gefühlslebens. Umgewandeltes Gefühlsleben ist das Gedankenleben, aber so, daß das Gefühlsleben gewissermaßen aus einem lebendigen Zustand, von dem man innerlich erfaßt sein kann, übergeht in einen mehr erstorbenen Zustand.
Wenn man das so ausspricht, hört es sich eben abstrakt an. Wenn man es aber mit der Seelenschau innerlich lebendig durchlebt, wenn man wirklich all dasjenige durchlebt, was seine Gefühle in einen Gedanken übergehen läßt, zum Beispiel wenn man lebendig etwas gefühlt hat in der Gegenwart und dieses Gefühl später nur durch einen Erinnerungsgedanken sich vergegenwärtigt und nun den Weg verfolgt, wie das Gefühl Gedanke geworden ist, dann erlebt man etwas so Intensives innerlich, wie man etwa erlebt,
wenn man mit einem ursprünglichen, gesunden Familien-gefühl ein Familienglied vom Leben zum Tode übergehen sieht. Es wird schon im inneren Seelenleben dieses Seelen-leben selber, wenn man es erkennen will, mit intensiver innerer Lebendigkeit, mit intensivem innerem Anteil durchdrungen. Und es darf niemand glauben, daß der Aufstieg von der äußeren Naturbetrachtung zu dem, was man Betrachtung des Seelenlebens nennt, nur etwas Abstraktes sei oder nur dasjenige sei, was man oftmals als konfuse Mystik anspricht, die meistens nur darin besteht, daß man aus einem dunklen Gefühl heraus eine Weltanschauung aufbaut; sondern wahre Seelenwissenschaft entsteht durch inneres Erleben der Metamorphose der Seelen-tatsachen.
Aber auch der Gedanke kann wieder erweckt werden zum Gefühl, und er kann sich umgestalten in den Willen. Wenn man zuschaut in der Weise, wie es auch hier öfter angedeutet worden ist, wie ein Gedanke uns erfaßt als ein Ideal und dann uns durchpulst und sich mit Enthusiasmus seelisch durchdringt, so daß er Wille wird, dann erlebt man, ich möchte sagen, eine Geburt, wenn man das betreffende Erlebnis ins seelische Beobachten herauf erhoben hat. Dieses innere seelische Erleben, das ist dasjenige, was sich ergibt als eine Folge der Übungen, die zum Beispiel in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» geschildert worden sind. Dadurch aber wird, wie Sie sehen, ein inneres Seelenleben erschlossen, das ja hinter dem gewöhnlichen Seelenleben liegt. Das gewöhnliche Seelenleben verläuft in Denken, Fühlen und Wollen getrennt. Aber dieses Seelenleben, das ich eben geschildert habe, liegt hinter dem gewöhnlich der äußeren Sinnenwelt zugewendeten Denken, Fühlen und Wollen. Es ist nicht etwas, was der Geistesforscher etwa erst schafft; es ist etwas, was er nur
innerhalb des gewöhnlichen Denkens, Fühlens und Wollens erlebt, worauf er nur kommt. Er schafft es ebensowenig, wie jemand, der von draußen hereinkommt und den Tisch hier sieht, nun den Tisch schafft, obwohl er sein Bild schafft, indem er hereintritt und den Tisch anschaut. So schafft der Geistesforscher das Bild des Seelenlebens, das hinter dem gewöhnlichen Seelenleben liegt; aber dieses Seelenleben ist in jeder Menschenseele vorhanden. Es liegt, wenn man so sagen möchte, unter der Schwelle des gewöhnlichen Bewußtseins, das der Außenwelt oder überhaupt dem sinnlichen Erfassen zugewendet ist.
Ich möchte sagen, es sind auch Ansätze dazu vorhanden, dieses Seelenleben zu finden. Gerade in der Geistesentwickelung des neuzehnten Jahrhunderts sind solche Ansätze vorhanden. Solche Ansätze haben, weil ja eine Sehnsucht nach der Erkenntnis des Seelischen in allen Menschen ist, die Menschen sogar in weitesten Kreisen ergriffen. Einen von diesen Ansätzen haben wir in dem Begriff, den Eduard von Hartmann nicht gerade aufgebracht, aber verarbeitet hat, in dem Begriff des unbewußten Seelenlebens. Er leitete ja alles bewußte Seelenleben aus einem unbewußten Seelenleben her. Aber es steht eben doch schief um dieses Hartmannsche Unbewußte, aus dem Grunde, weil es ja nur negativ charakterisiert ist. Wenn man sagt: Was dem Bewußten zu Grunde liegt, ist ein Unbewußtes, so sagt man nicht mehr, als: alles, was hier außerhalb dieses Tisches ist, ist Nicht-Tisch, ist eben Untisch. Nun, wenn ich alles dasjenige, was hier sitzt und steht, als Nicht-Tisch, als Untisch, bezeichne, so habe ich noch nichts Besonderes gesagt. Es kann auch gar nicht anders als negativ bezeichnet werden, wenn man innerhalb des bewußten Seelenlebens mit der Erkenntnis stehen bleibt. Und das will ja Eduard von Hartmann. Man muß das Seelenleben innerlich befruchten, wie
dies hier oftmals geschildert worden ist, und es muß dieses gewöhnliche Seelenleben hinabsteigen zu dem anderen, so daß jenes unterbewußte, unbewußte Seelenleben erfaßt wird durch ein erweitertes Bewußtsein, durch ein anderes Bewußtsein, als das gewöhnliche Bewußtsein ist, das der Sinneswelt zugewendet ist.
Sie sehen, es wird also durch Geistesschau ein Seelenleben ergriffen. Dieses Seelenleben nun, das da ergriffen ist, das unmittelbar in der Geistesschau erscheint - was ist es denn anderes als dasjenige, was innerlich im Menschen wirkt und wovon man sich doch vorstellen muß, daß die äußere Leiblichkeit irgendwie sein Ausdruck, seine Offenbarung ist? Aber so, wie wir unser gewöhnliches bewußtes Seelenleben haben, so liegt gerade sein Vorzug darinnen, daß dieses bewußte Seelenleben nicht unmittelbar auf den Leib wirkt. Denken Sie sich nur einmal, wenn das bewußte Seelenleben auf den Leib wirken würde - ja, es ist wirklich nicht übertrieben, wenn ich das Folgende darstelle. Nehmen wir an, wir sehen die Hand eines fremden Menschen, wir wollten ihre Form auffassen. Würde uns diese Form nun nicht als bloße Idee erscheinen, sondern uns durchdringen, ganz wirklich innerlich lebendig werden, dann müßte unsere Hand sich metamorphosieren und selber so werden, wie die Hand des anderen Menschen ist. Wir müßten ganz aufgehen können, innerlich lebendig machen dasjenige, was wir nur in abstrakten Begriffen uns veranschaulichen. Und wenn wir einem ganzen, vollen Menschen gegenüberstünden und dieser einen so starken Eindruck auf uns machen würde, daß der Eindruck für uns nicht bloß in einer abstrakten Idee vorhanden wäre, so würden wir selber die Form dieses Menschen annehmen müssen. Also dasjenige, was als gewöhnliches bewußtes Seelenleben wirkt, würde gar nicht seine Aufgabe in der Welt erfüllen, wenn es nicht so weit
abgesondert wäre von unserem Leibesleben, daß es nicht eingreift in das Leibesleben und dieses sich selbständig entwickeln kann.
Aber wir brauchen ja nur zurückzugehen in der menschlichen Entwickelung, um wenigstens noch einen Anflug zu sehen von dem, was wir - ich habe vorgestern darauf hingewiesen - das Von-innen-heraus-Gestalten der Formen des menschlichen Organismus nennen können. Wenn wir den Menschen, namentlich in seiner allerersten Kindheit, betrachten, so sehen wir, wie sich dasjenige, was in ihm ist, plastisch zu dem formt, was er später entwickelt. Wie in die leibliche Form das Geistige hineingeht, das sehen wir da. Selbstverständlich gibt es viele Einwände gerade gegen die Behauptung, die ich jetzt mache. Allein, wie gesagt, man kann in einem einzelnen Vortrage nicht alles berühren. Diese Einwände sind sehr leicht aus der Welt zu schaffen, wenn man nur ausführlich darüber reden kann. Wir sehen also noch ein plastisches Walten dessen, was innerlich im Menschen ist, in der Jugendzeit des Menschen, in der Kindheit, und bei krankhaften Zuständen. Wir sehen, wie das Geistig-Seelische plastisch in die körperliche Bildung eingreift. Das gewöhnliche Seelenleben - man möchte sagen, Gott sei Dank - kann nicht in die Körperbildung eingreifen; es würde seine Aufgabe nicht erfüllen. Aber lesen Sie dieses ausgezeichnete Kapitel in Schleid's neuem Buch: «Vom Schaltwerk der Gedanken> nach, dieses schöne, ich möchte sagen, epochemachende Kapitel: «Die Hysterie - ein metaphysisches Problem>, dann werden Sie sehen, wie da verwiesen wird darauf, wie in der Tat Seelisch-Geistiges, in Gedanken Erfaßtes, in krankhaften Zuständen auf die plastische Bildung des Leibes wirkt. Wir sind eben dadurch gesund, daß es im normalen Zustande nicht so ist. Ich will nur das allerprimitivste Beispiel aus diesem Buche anführen.
Die Beispiele sind ja jedem, der sich mit solchen Dingen befaßt, immer bekannt gewesen; aber durch die Art und Weise, wie sie gerade in diesem Buche eingeführt werden, ist in der Tat etwas Epochemachendes geschehen. Das eine Beispiel: Ein Arzt kommt zu einer Dame ins Zimmer, in dem ein Ventilator summt. Da sagt sie - sie ist hysterisch, es ist ein krankhafter Zustand, mit dem er es zu tun hat -:
Da ist eine große Biene! Zunächst will ihr der Arzt selbstverständlich ausreden, daß es eine große Biene ist; es ist ja nur ein Ventilator. Da sagt sie: Wenn die mich stechen würde! Der Arzt will ihr zunächst auch noch klar machen, daß das auch noch nicht so schlimm wäre. Aber in dem Moment schon schwillt das Auge an zu einer hühnereigroßen Geschwulst.
Da sehen wir, wie der bloße Gedanke wirkt. Und wie gesagt, unsere gewöhnlichen Gedanken sind, Gott sei Dank, keine solchen Gedanken. Und dadurch sind sie gerade die rechten Gedanken für das gewöhnliche Leben, daß sie es nicht können. Sie plastizieren nicht in dieser Weise, sie gehen nicht hinunter in den Organismus. Da müssen schon krankhafte Zustände eintreten; aber dann sehen wir, wie der Gedanke das materielle Leben ergreifen kann. Schleich nennt das ganz richtig eine «Inkarnation des Gedankens». Aber man darf nicht glauben, daß man noch innerhalb des gewöhnlichen Seelenlebens stehen bleiben kann, wenn man von solchen Dingen spricht. Den gewöhnlichen Gedanken, den der Mensch hat, den hat er zur Erkenntnis der Welt und als Grundlage für sein Handeln, und wenn er ein gesunder Mensch ist, dann greift dieser Gedanke ganz gewiß nicht irgendwie plastizierend in das gewöhnliche Seelenleben ein, da müssen eben Krankheitszustände zu Grunde liegen. Aber in normaler Weise findet man - gerade wenn man geistig anschaut -, wie dasjenige, was Bildung des
Menschen ist, von Kindheit auf, dasjenige, was die Formen ausgestaltet, jetzt in gesunder Weise auf demselben Prinzip beruht, wie ja in der Tat das Geistig-Seelische, das aber jetzt noch unbewußt ist und als solches unbewußt bleibt, plastisch gestaltend bleibt. Und eben darinnen besteht ja das weitere Erleben des Menschen, daß das, was zuerst in den Organismus hineingeht, was zuerst den Organismus ergreift, später sich absondert von dem Organismus, geistigseelisch für sich besteht und eben als Geistig-Seelisches erlebt wird. Darin besteht ja die Fortentwickelung des Menschen als Individualität.
Ich habe Ihnen gewisse Gedankengänge angeschlagen; aber diese Gedankengänge sind wirklich keine ersonnenen, keine logisch irgendwie zusammengefügten Gedankengänge, sondern sie sind aus der Seelenschau herausgehoben. Und wie gesagt, es ist nicht ein Analogie-Spiel, sondern es ergibt sich der Seelenbeobachtung aus der entwickelten Seelen-Geistes-Erkenntnis, daß dasselbe, was als plastisches Prinzip in krankhaften Zuständen später eingreifen kann, auf normale Weise in das Kindheitsleben eingreift. Die Gedanken, die ich damit angeregt habe, führen weiter, - nicht durch logisches Ausspinnen, sondern indem man die seelisch-geistige Anschauung der Welt fortsetzt. Aus der Betrachtung des Leibeslebens wurde der Gedanke angeregt: Der Körper des Menschen, abgesehen vom Haupte, enthält dieselben Bildungskräfte wie das Haupt, nur auf einer nicht so weit vorgeschrittenen Stufe; das Haupt enthält dieselben Bildungskräfte wie der übrige Körper, aber auf einer weit vorgeschrittenen Stufe. Diese Gedanken verbinden sich in der inneren Anschauung miteinander. Jene intimere Bekanntschaft mit dem Naturleben erlangt man dadurch, daß man das Geistig-Seelische auch in der Natur kennen lernt. In der höheren Anschauung muß man sich durch das
intimere Kennenlernen des unterbewußten geistigen Lebens, wie ich es eben dargestellt habe, noch folgendes zur Klarheit bringen. Und das kann man durch diese intimere Bekanntschaft. Gewisse, ich möchte sagen, von Philosophen nur geahnte Gedanken werden innerlich vollständig klar durch die hier gemeinte Erkenntnisart. Immer wieder und wiederum kauen die Philosophen daran - ich meine das jetzt durchaus nicht in herabwürdigendem Sinne -, irgendeinen Begriff vom Stoff, von der Materie zu gewinnen. In seiner Ignorabimus-Rede hat Du Bois-Reymond in einer so glänzenden Weise all das zusammengetragen, was beweisen kann, daß eigentlich dasjenige, was Materie ist, oder, wie er sagt, wo Materie im Raume spukt, nicht ergriffen werden kann durch die Erkenntnis. - Materie bleibt im Grunde genommen für die gewöhnliche Erkenntnis immer etwas Unerkanntes, sie bleibt außerhalb der gewöhnlichen Erkenntnis. Durch geistige Erkenntnis kommt man wirklich darauf, daß die Materie selbst nicht wahrgenommen werden kann und daß der Stoff nicht in unser Inneres hereinkommen kann, ebensowenig wie das Messing eines Petschaftes, das ich im Siegellack abdrucke, in die Substanz des Siegellackes hineinkommen kann, trotzdem alles, was hineinkommen soll, sagen wir der Name Müller, vom Petschaft auf den Siegellack übergeht. Was äußerlich materiell ist, kann man nicht ins Innere hereinbekommen. Aber dasjenige, was hereinkommen soll, das kommt in einer ähnlichen Weise herein wie der Name Müller in den Siegellack. Also da hinaus, wo Materie im Raume ist, kann überhaupt das, was in uns ist, nicht dringen. An den Stoff kommt die gewöhnliche Erkenntnis nicht heran. Der Stoff ist eben nicht wahrnehmbar. Ich müßte wiederum vieles reden, wenn ich im einzelnen - was geschehen kann - darlegen wollte, daß der Stoff unmöglich als solcher wahrnehmbar
sein kann. Der Stoff ist immer nur hypothetisch zu den Wahrnehmungen hinzugedacht.
Worauf beruht denn das eigentlich? Es beruht darauf, daß wir überhaupt nichts Stoffliches wahrnehmen. Würde nur Stoff ausgebreitet sein und würden wir selber aus Stoff im gewöhnlichen Sinne bestehen, so würden wir nichts wahrnehmen können. Stoff ist nicht wahrnehmbar! Wodurch wird der Stoff wahrnehmbar? Der Stoff wird dadurch wahrnehmbar, daß außer dem Stoff - dieses «außer» müssen Sie jetzt nicht pressen -, noch vorhanden ist in der Welt, die uns umgibt, Äther, ätherische Wesenheit. Indem ich von ätherischer Wesenheit spreche, muß ich natürlich darauf verweisen, was ich öfter auch schon hier gesagt habe, daß der Begriff des Äthers, wie er hier gemeint ist, sich nicht deckt mit irgendeinem Äther-Begriff, wie ihn die Physik aufstellt, obwohl er sich natürlich vielfach damit berühren kann. Aber schließlich - was für einen Äther-Begriff hat denn die moderne Physik - diese moderne Physik, die eigentlich auf einem wunderbaren Wege ist bei denjenigen, die mit allem Rüstzeug der modernen Naturwissenschaft forschen, die sich alle Mühe geben, die naturwissenschaftliche Denkweise und Gesinnung auszubilden und immer mehr und mehr auszubilden? Von einzelnen Physikern, die man wirklich ernst nehmen muß, in ganz anderem Sinne ernst nehmen muß als das dilettantische Gerede von monistischer Weltanschauung, haben wir ja heute schon den Satz: Wenn man sich überhaupt eine Vorstellung von Äther machen will, so kann man das nur dadurch, daß man sich im Äther nichts von irgendwelchen materiellen Eigenschaften vorstellt; Äther muß geradezu so vorgestellt werden, daß von ihm alle materiellen Eigenschaften ferngehalten werden. Und jetzt gerade erleben wir das Wunderbare, daß zwei gegensätzliche Anschauungen der Dinge hart aneinanderstoßen.
Mitten in dieser aufgeregten Zeit erleben wir das Hart-aneinander-Stoßen zweier Weltanschauungsrichtungen mit Bezug auf die äußere, physische Welt, eine Tatsache von unnennbar großer Bedeutung für den, der so etwas in seiner ganzen Schwere zu beurteilen in der Lage ist. Wir erleben es, daß nun auch dasjenige, woran sich die Physiker bisher niemals eigentlich in einer rechten Weise gemacht haben, untersucht wird, nämlich die Schwerkraft. Und da erleben wir es - ich kann diese Dinge nur rein historisch andeuten -, daß auf der einen Seite die mehr materialistische Anschauung sich geltend macht und gewissermaßen versucht, aus Vorstellungen über das Materielle das Vorstellen über den Äther zu gewinnen, also aus rein materiellen Beschaffen-heiten heraus. Und auf der anderen Seite haben wir in einer wunderbaren Weise Untersuchungen über die Schwerkraft, von denen man sagen kann - und es ist auch schon gesagt worden -, daß sie bemüht sind, das Materielle abzustreifen und das Natürliche zu dematerialisieren, um die Schwerkraft zu begreifen, - zu entmaterialisieren. Kurz, will man heute verstehen, wozu wirkliche Wissenschaft drängt, so darf man nicht sich in irgend einer Weise trivial verlassen auf all die Redereien der sogenannten monistischen Weltanschauung, sondern man muß eingehen auf dieses wahrhafte und ernste, von wirklich imponierender methodologischer Disziplinierung durchzogene naturwissenschaftliche Bestreben, das, indem versucht wird, von der Materie herauf zum Ä ther zu kommen, immer mehr und mehr dahin strebt, das zu erreichen, was ich eben damit meinte, daß einzelne Physiker sogar sagen: Der Äther kann nur vorgestellt werden, wenn er nicht mehr mit materiellen Eigenschaften vorgestellt wird.
Der Geisteswissenschaft zeigt sich der Äther nun eben durch innere Anschauung und durch inneres Kennenlernen,
so wie man sonst das äußere Dasein, das sinnliche Dasein kennen lernt. Das ist eben nur durch die erste Stufe der Geistesschau möglich. Sie können das nachlesen in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?>. Da wird als die erste Stufe der Geistesschau - ich bitte den Ausdruck nicht mißzuverstehen - die sogenannte imaginative Erkenntnis angeführt. Aber das ist eben nur ein Ausdruck, ein Terminus. Gemeint ist diejenige Erkenntnis - ich habe das auch hier gerade in den letzten Vorträgen oftmals dargestellt -, bei der der Mensch die Wahrnehmungen nicht einfach hinnimmt, sondern die Wahrnehmungen sich selber aufbauen muß. So wie man sich etwa äußerlich dasjenige, was man auch in einer Wirklichkeit hat, aufbaut, wenn man es sich notiert, so wird die imaginative Erkenntnis das, was man geistig erlebt, eben innerlich zum Ausdruck bringen. Aber durch diese Erkenntnis gelangt man in der Tat dazu, sich eine Vorstellung vom Äther zu bilden, die nun nicht durch äußerlich materielle Vorstellungen wiederzugeben ist. Und dann gelangt man dazu, daß Äther draußen in der Welt verbreitet ist und die Möglichkeit bildet, daß die Dinge, bildlich gesprochen, uns ihre Oberfläche zuwenden, so daß sie wahrgenommen werden können, und daß Äther in uns ist, der dem äußeren Äther entgegenkommt. Äther von innen, Äther von außen begegnen sich, und dadurch wird das umfaßt, was uns ätherisch von den Dingen zufließt, was ätherisch von uns im Organismus aufsteigt. Das umfaßt sich innerlich, und dadurch entsteht erst dasjenige, was wir Wahrnehmung nennen. Was so schwierig macht, die Sinneswahrnehmung zu verstehen, das ist eben das Nicht-wissen von dem eben geschilderten Tatbestand.
Nehmen Sie nur das menschliche Auge! Dieses menschliche Auge gibt gerade dadurch Bilder von unserer Umgebung,
daß sich gewissermaßen innerhalb des Auges die materiellen Prozesse von draußen fortsetzen. Das, was in unserem inneren Auge vorgeht, ist ja nur, ohne daß wir mit unserem Bewußtsein dabei sind, eine Fortsetzung dessen, was draußen in der Welt an Lichtgesetzen vorhanden ist. Und indem sich der äußere Äther fortsetzt in unser Auge hinein, von dem inneren Äther ergriffen wird, dadurch entsteht diese Licht-Wahrnehmung. Das, was ich jetzt sage, ist eine unmittelbare Fortsetzung dessen, was in Goethes so schönem, bedeutsamem Kapitel über die physikalischen Farben und ihre Wahrnehmung steht.
So steigen wir von der äußeren Materie zum Äther auf, und dadurch kommen wir dem näher, was in uns lebt. Denn das ist jetzt das andere. Die Materie steigt zum Äther herauf, Äther haben wir in uns, innerer Äther geht die Wechselwirkung ein mit dem äußeren Äther. Das ist der eine Prozeß. Und jetzt betrachten wir es von der anderen Seite. Wir haben gesehen: Wenn wir unser Seelenleben haben, das bewußte Seelenleben, das im gesunden Zustande nicht in die Materie eingreifen darf, das aber dennoch die Möglichkeit von Bildungskräften enthält, dieses bewußte Seelenleben führt uns hinunter in ein unterbewußtes Seelenleben. Und dieses unterbewußte Seelenleben hat in sich, ich möchte sagen, eine ganz andere Kraft, als das bewußte Seelenleben. Das bewußte ist das abstrakte Seelenleben, das Seelenleben, das uns nicht wehtut. Ich möchte dafür nur das eine Beispiel anführen: Im bewußten Seelenleben können wir eine Lüge ruhig sagen, die tut uns nicht weh. Wenn aber die Lüge unterbewußt entsteht, dann schmerzt sie; das heißt, sie hat die Kraft, Realität zu entwickeln. Da, unter unserem bewußten Seelenleben ist erst das bildungsfähige Seelenleben, das Seelenleben, das jetzt nicht abgesondert von der Materie da ist, sondern nun eingreifen
kann in die Materie, aber zunächst nur in die Materie eingreifen kann, die ihr zur Verfügung steht. Dieses unter-bewußte Seelenleben, das kann nun wiederum eingreifen in das, was in uns als Äther ist. Und in dem, was hinter der Materie als Ä ther ist, und in dem, was unter unserem Bewußtsein als unterbewußtes Seelenleben ist, da entsteht eine Wechselwirkung, die hinter unserem Bewußtsein und über der Materie liegt. Das spielt sich ab in unserem Unter-grunde. Wenn Sie den Gedanken ausdenken, so können Sie sich jetzt leicht auch die krankhaften Seelenzustände erläutern. Es genügt die Zeit nicht, um auf sie einzugehen. Unterbewußtes - ich habe es öfter hier mit dem Ausdruck genannt, der vielleicht sogar mit Recht manchem zunächst schaudervoll erscheint, wirklich herausfordert, schlechte oder gute Witze darüber zu machen -, ich habe dieses unter-bewußte Seelenleben genannt: astralisches Innenleben des Menschen. Nun, auf den Ausdruck sollte es aber nicht ankommen. Wenn wir also den ganzen, vollen Menschen überschauen, besteht er natürlich aus Materie, so wie die anderen äußeren Dinge aus Materie bestehen, aus dem Ätherwesen, das er innerlich hat und das mit dem äußeren Äther in Beziehung tritt, und aus dem unterbewußten Seelenleben, das nun bildend in den Äther eingreifen kann. Und dasjenige, was entsteht in der Wechselwirkung zwischen dem unterbewußten Seelenleben das wir entdecken in der Geistesschau, in das wir untertauchen in der Geistes-schau, und dem webenden, wogenden Äther, das ist eben die Imagination, die erste Stufe der geistigen Schauung.
Und dann, wenn der Mensch sich nun durch Erkenntnis zu dem durchgerungen hat, was in ihm bewußt nicht erlebt wird, aber doch inneres Leben ist, dann erlebt er auch, wie dieses innere Leben sich als verwandt erweist mit dem, was nun im Äußeren lebt, aber nicht Materie ist, gar nicht
materiell vorgestellt werden darf - selbst nach der heutigen Physik -, wie das eins wird in ihm.
Noch näher können wir das, was ich oftmals in diesen Vorträgen charakterisiert habe als den inneren Menschen im Menschen, erfassen. Das bewußte Seelenleben geht hinunter zu einem unterbewußten Seelenleben, und dieses unterbewußte Seelenleben ist jetzt mächtiger als dieses bewußte und organisiert sich zusammen mit dem ätherischen Leben. Dadurch haben wir eigentlich dasjenige, was im menschlichen Seelenleben vorhanden ist. Und wenn der Mensch durch die Übungen, die in den wiederholt genannten Büchern und Aufsätzen geschildert sind, dieses Seelen-leben in sich erweckt, dann, erst dann nimmt er das, was man geistige Welt nennen kann, wirklich wahr, so wie er mit seinem physischen Organismus die äußere sinnliche Welt wahrnimmt. In der Durchorganisierung seines ätherischen Leibes liegt die Möglichkeit, eine geistige Welt wahrzunehmen und zu wissen, daß er nun selber aus dieser geistigen Welt heraus stammt.
Und jetzt erweitert sich der Gedanke und prägt sich mit dem anderen Gedanken, der aus Goethes Weltanschauung heraus gewonnen war, zusammen. Denn wenn man also den inneren Menschen erfaßt hat, kann man jetzt beginnen, sich zu fragen: Ja, wie ist es denn nun eigentlich mit diesen zwei Gliedern der menschlichen Natur, mit dem Haupt und dem übrigen Leib, die auf verschiedener Bildungsstufe stehen? Da kommt nun dazu, daß man dasjenige, was man geistig-seelisch vorstellen kann, in ganz andere Beziehungen zu dem Haupt bringen muß, als zu dem übrigen Organismus. Wenn man den geistigen Menschen im Hellsehen erfaßt - aber nicht so, wie es im Spiritismus oder in dem trivialen Aberglauben gemeint ist, sondern wirklich in dem Sinne, der hier immer charakterisiert wird -, den geistigen Menschen,
der dem äußeren Menschen zu Grunde liegt, auch dem Menschen, der das gewöhnliche Bewußtsein hat - denn das ist nichts unmittelbar Seelisches, sondern erst was darunter liegt -, wenn man diesen Menschen erfassen kann, so sieht man diesen inneren Menschen in einer ganz anderen Verbindung mit dem Hauptesteil des Menschen und mit dem, was der übrige Körper des Menschen ist. Und zwar findet man nun das Folgende: Wenn man das Haupt prüft, so hat man in dem Haupt plastisch ausgestaltet eine solche Formung, eine solche Gestaltung, daß da das Geistig-Seelische ganz in die Form hineingeflossen ist, das Geistig-Seelische sich ganz in der Form ausprägt und sich sogar in dieser Form so ausgeprägt hat, daß es noch etwas von seinen Bildungskräften zurückbehält. Und diese zurückbehaltenen Bildungskräfte sind diejenigen, die wir dann als unsere Gedanken entwickeln können. Aber was in unseren Gedanken nur abstrakt aus dem Kopfe heraus entwickelt wird, das liegt in der Gestalt, wie es nur unterbewußt erreicht werden kann, zu Grunde der Bildung unseres Kopfes, unseres Hauptes. Und in ganz anderer Weise liegt das Geistig-Seelische dem übrigen Organismus des Menschen zu Grunde. In den übrigen Organismus des Menschen gehen diese Bildungskräfte nicht so tief hinein, da behalten sie ihre gewisse Selbständigkeit; da lebt das Geistig-Seelische viel stärker neben dem Physisch-Leiblichen. Wenn ich bildlich, imaginativ-bildlich sprechen soll - diese Tautologie erlauben Sie mir -, möchte ich daher sagen: Wenn der Schauende das menschliche Haupt vor sich hat, so hat er eine geistig-seelische Form, aber daneben, nur äußerst spärlich, noch ein Geistiges. Wenn er den anderen Organismus des Menschen vor sich hat, so hat er die leibliche Form, aber reich entwickelt das Geistige, das sich nur noch nicht so weit in das Materielle hineinorganisiert hat wie im
Haupte. Im Haupte ist das Geistige viel mehr in die Materie ausgeflossen als im übrigen Organismus. Der Kopf des Menschen ist viel materieller als der übrige Organismus. Der übrige Organismus ist so, daß das Geistige noch wenig in das Materielle hineingeflossen ist und noch größere Selbständigkeit hat.
Nun gelangt jene Geistesschau, von der ich gesprochen habe, dazu, sich wirklich über die wesentliche Bedeutung dessen, was ich eben ausgesprochen habe, klar zu werden. Was ist denn da eigentlich in dem menschlichen Haupte an Bildungskräften, die gewissermaßen einen Punkt erreicht haben, der viel, viel weiter in der Entwickelung vorne liegt als dasjenige, was im übrigen Organismus zu beobachten ist? Lernt man anschauen, was dem Kopf zu Grunde liegt, lernt man die Geistesschau auf das menschliche Haupt übertragen, dann gelangt man selber zunächst dazu, seelisch zu erleben, was im menschlichen Haupt verarbeitet ist. Wenn man das seelisch erlebt, was im menschlichen Haupte an Bildungskräften drinnen ist - ich kann diese Dinge heute eben nur aphoristisch andeuten -, dann findet man, daß dies, was da verarbeitet ist, unmittelbar wirklich in eine geistige Welt hinein sich erweitert, daß man sich wirklich aus der geistigen Welt heraus die Bildungskräfte denken muß, - wenn das auch durch die menschliche Vererbungsströmung geht. Auch hier haben wir wiederum einen schönen Berührungspunkt der modernen Naturwissenschaft mit der Geisteswissenschaft. Es gibt überall solche Berührungspunkte. Es gibt heute Naturforscher, die auch durch ihre Naturforschung durchaus zugeben, daß solche kosmischen Bildungskräfte mitwirken bei dem, was am Menschen aufbaut, während er sich im Leibe der Mutter ausbildet. Wir haben also am menschlichen Haupte etwas, was sich aus dem Kosmos herein bildet. Im Menschenhaupte ist unmittelbar
ein Abdruck des Kosmos gegeben, wenn man auf das Seelische sieht.
Steigt man jetzt weiter auf zu dem Geistigen, auf die Art, wie ich es Ihnen geschildert habe, dann kommt man weiter zurück. Man erlangt nämlich folgende Kenntnis vom Haupte: Dieses menschliche Haupt ist bei der Geburt, eigentlich schon bald nach der Empfängnis, so beschaffen, daß seine Bildungskräfte ganz ins Materielle übergehen, nur wenig zurücklassen von dem Seelischen, ganz im Materiellen sich ausleben. Aber diese Bildungskräfte führen zurück in eine Zeit vor der Empfängnis. Sie führen zurück in die geistige Welt hinauf, so daß der Mensch eigentlich dasjenige, was aus dem Kosmos in der Hauptesbildung aufgeht, im wesentlichen durchlebt hat in der geistigen Welt, bevor er empfangen oder geboren worden ist. Und wenn wir von dem Seelischen ins Geistige gehen, so wird uns innerhalb dieses Geistes dann an der Hauptesbildung aufgehen, was aus einem früheren Erdenleben stammt. Gerade durch die Betrachtung des menschlichen Hauptes in geisteswissenschaftlicher Beziehung gelangt man von dem jetzigen Erdenleben unmittelbar in das frühere Erdenleben hinein. Und das ergänzt sich mit dem anderen Gedanken, wenn man jetzt betrachtet, was in dem übrigen Organismus, abgesehen vom Haupte, vorhanden ist. In diesem übrigen Organismus ist das seelisch-geistige Leben noch abgesondert, das ganze menschliche Leben, so wie es geführt wird von der Geburt bis zum Tode im Umgang mit der Außenwelt, in der Beziehung zu anderen Menschen, zu den Dingen dieser Welt, zu der Natur und allen geistigen Verhältnissen, in denen wir leben, zu allen sozialen Verhältnissen; das prägt sich aus in demjenigen, was geistig an uns ist, im übrigen Organismus, zusammengefaßt im menschlichen Herzen. Das ist nun nicht nur ein Bild, sondern das
ist wirklich eine geistig-physiologische Tatsache. Aber weil dieser menschliche Organismus mit der Geburt seine festgeprägte Form bekommen hat, kann es zunächst nur geistigseelisch bleiben. Aber als Bildungskräfte ist es vorhanden, als Bildungskräfte bleibt es vorhanden, und als Bildungs-kräfte geht es durch den Tod durch. Wenn wir seelisch dasjenige verfolgen, was im menschlichen Organismus ist, abgesehen vom Haupte, dann finden wir, wie uns der Geistes-blick in dasjenige hinausweist, was nach dem Tode liegt, und wenn wir den Menschen geistig betrachten, so finden wir, daß das sich umgestaltet in das nächste Erdenleben hinein.
Und weiter: Die konkrete Betrachtung lehrt uns, daß das Haupt, so wie es jetzt mit seinen inneren Bildungs-kräften sich ausprägt, das Ergebnis unseres Leibeslebens, abgesehen vom Haupte, in einem vorhergehenden Erden-leben ist. Unser Haupt ist wirklich metamorphosiert, umgestaltet aus einem früheren Erdenleben, und unser jetziger Organismus, abgesehen vom Haupte, mit all seinem Erleben behält die Bildungskräfte geistig-seelisch, gibt sie, indem er mit dem Tode abgeht, der geistigen Welt, und sie gestalten sich aus, so daß sie in dem nächsten Erdenleben an der Bildung unseres Hauptes teilnehmen. Und man gelangt zu dem großen, bedeutsamen Gesetze: In dem, was innere Bildungskräfte - wohlgemerkt innere Bildungskräfte - unseres Hauptes sind, haben wir das Bildungsergebnis dessen, worauf der übrige Organismus, abgesehen vom Haupte, in einem vorhergehenden Erdenleben veranlagt war, und in dem, was in unserem übrigen Organismus ringt und kraftet, haben wir dasjenige, was in die Hauptesbildung des nächsten Erdenlebens eingeht. Wenn man diese Erkenntnis haben wird, wird man einmal naturwissenschaftlich ernst, streng abgrenzen können, was innerhalb der Vererbungslinie
liegt und was nicht innerhalb der Vererbungslinie liegt. Auf diesem Gebiete wird ja die Naturwissenschaft erst noch einzelne sehr bedeutsame Pforten, möchte ich sagen, sich zu eröffnen haben, wenn sie sich begegnen will mit dem, was die Geisteswissenschaft ihrerseits über das Geistig-Seelische zu sagen hat.
Ich will nur auf eines aufmerksam machen. Gewiß, die Naturwissenschaft führt heute mit Recht gewisse Eigenschaften, die wir an uns haben, auf das Vererbungsprinzip zurück; wir haben sie von Vater und Mutter, Großvater, Großmutter und so weiter. Man soll nur ja nicht glauben, daß etwas damit gesagt wird, wenn der Naturforscher kommt und sagt: Ja, da führt der Geisteswissenschafter innere Bildungskräfte auf frühere Erdenleben zurück; wir erfahren ja das alles aus der Vererbung! Dasjenige, was naturwissenschaftlich aus der Vererbung erklärt werden kann, was in der physischen Fortpflanzungslinie liegen kann, das leugnet der Geistesforscher nicht, wie der Geistesforscher überhaupt ganz auf dem Boden der Naturforschung steht. Aber gewisse Pforten, sagte ich, muß die Naturwissenschaft erst eröffnen, gewisse Richtlinien muß sie erst einhalten. Denken Sie doch nur einmal an folgendes: Der Mensch wird reif in einem gewissen Lebensalter
- ich habe vorgestern darauf hingewiesen -, seinesgleichen hervorzubringen; die Geschlechtsreife wird erlangt. Da hat er alle Fähigkeiten also an sich, abzugeben an die nachfolgende Generation dasjenige, was er an leiblich-physischen Bildungskräften hat. Er muß es ja an sich haben. Es können nachher keine neuen Befähigungskräfte auftreten. Was der Mensch später an Fähigkeiten erwirbt, die er sich nun wiederum teilweise einverleibt, wie er sich vorher die Fortpflanzungsfähigkeit einverleibt, geht nicht in die Fortpflanzungsströmung über, sondern diese Fähigkeiten wirken
und kraften im Menschen so, daß sie den Keim bilden für dasjenige, was durch die Pforte des Todes geht, zwischen Tod und neuer Geburt durch die geistige Welt durchgeht und in einem nächsten Erdenleben neu sich verkörpert in der Weise, wie ich es geschildert habe. Es findet dann ein Übergang statt, und man kann sagen - so grotesk das heute noch klingt-: Hauptesbildung - aber wie gesagt, von innen heraus das Haupt durchgestaltet -, Hauptesbildung enthält Kräfte, die wir suchen müssen als geistig-seelisches Begleitelement des abgesehen vom Haupte vorhandenen Körpers in einem früheren Erdenleben. Aber, was wir jetzt außer unserem Haupte körperlich an uns haben, bevor das Geistig-Seelische sich noch in das Körperliche vollständig ergossen hat, das bereitet die Konfiguration und Gestalt des Hauptes in einem nächsten Erdenleben vor. Das ist gewiß heute noch eine paradoxe Behauptung, und dennoch, so baut sich eine den ganzen Menschen umfassende Metamorphosen-lehre auf, eine Metamorphosenlehre, die Geist, Seele und Leib umfaßt und die da zeigt, wie nun das Wirkliche, das im Menschen ist, durch Geburt und Tod geht und wie dieses Wirkliche im Menschen Beziehungen hat zum Weltenall. Dasjenige, was unmittelbar unserem Erdenleben angehört, was ist es denn eigentlich? Was gehort unmittelbar unserem Erdenleben an als einzelner Mensch, der da lebt zwischen Geburt und Tod? Unser Haupt! Was - wie wir gewöhnlich finden - äußerlich am geistigsten gestaltet ist, das ist am meisten verwandt mit der Erde. Was weniger mit der Erde verwandt ist, das geht auch in andere als Erdenwelten über in der Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Und wenn es, nachdem der Mensch durch die Pforte des Todes gegangen ist, aus dem Geistigen heraus die Kräfte gewonnen hat, sich umzugestalten zur Hauptesbildung, dann hat es sein Ziel erlangt.
Sie sehen, Geisteswissenschaft redet in einer ganz konkreten Weise von dem, was zum Ewigen des Menschen gehört. Und in einer sehr konkreten Weise weiß sie anzugeben, wie der Mensch im ganzen Weltenall drinnensteht. Sie weiß hinzuweisen darauf, wie dasjenige, was im menschlichen Haupte ist, gleichsam von den Erdenkräften so in Anspruch genommen ist, daß sich das ganze Geistig-Seelische in das Haupt ausgegossen hat, und wie das, was außer dem Haupte vorhanden ist, sich erst vorbereitet, um in dem nächsten Erdenleben dazu zu kommen. Wir sehen, wie sich Erdenleben an Erdenleben angliedert, um sich so wie Kettenglied an Kettenglied zur Ewigkeit zusammenzugliedern. Wenn der Mensch - jetzt nicht in äußerlicher, abstrakter Beschreibung, sondern innerlich - das erfaßt, was als innerer Mensch erlebt werden kann, wenn das Unterbewußte, das Ätherische ergreift und der innere Mensch rege wird, dann wird eben das Seelische ergriffen, und es kann über Geburt und Tod hinaus im Zusammenhang mit dem Weltenall begriffen werden. Und wenn der Mensch dies in sich erweckt hat, dann wird ebenso vor diesem inneren Menschen eine geistige Welt anschaulich, eine konkrete geistige Welt, wie vor den physischen Augen, die sich aus der umgeformten Materie herausbilden, die physische Welt anschaulich wird. Geistige Welt und seelische Welt, sie treten in einer ganz bestimmten, konkreten Weise auf. Und wie wir in der physischen Welt um uns herum durch unsere leibliche Organisation bekannt werden mit konkreten physischen Dingen und Wesenheiten, so werden wir durch den höheren Menschen, durch den Menschen, der geistig-seelisch im Menschen lebt, mit einer geistigen Welt in konkreten einzelnen Ausgestaltungen bekannt. Aber es muß das Geistig-Seelische in dem Menschen lebendig ergriffen werden, sonst bleibt es bei einer bloßen Ahnung, die sich nur in eine begriffliche
Konstruktion hineinfinden kann. Nur dadurch kann man zum Geist, zur Seele kommen, daß man aus dem gewöhnlichen Bewußtsein hinuntersteigt zu dem Unterbewußten und wirklich jetzt ein neues Bewußtsein für das Unterbewußte entwickelt und dadurch mit dem, was sonst die Materie durchgeistet als Äther, einen höheren Menschen im Menschen bildet. Das ist durch Erfahrung, durch wirkliches inneres Erleben auf den Wegen, die in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?> geschildert sind, möglich. Gelangt man nicht zu diesem Geistigen, dann bleibt man innerhalb dessen stehen, was sich vom Seelisch-Geistigen in dem leiblichen Organismus geltend macht. Man bleibt im Grunde genommen doch stehen in dem, was vom Menschen vorhanden ist zwischen Geburt und Tod, und kommt dann zu jener unklaren Mystik, die leider von vielen verwechselt wird mit wahrer, aber jetzt hell-klarer Mystik, die auf die Weise erlangt wird, wie ich es eben geschildert habe, durch das Erleben des inneren konkreten geist-seelischen Menschen. Und weil die verworrene, verschwommene Mystik verwechselt wird mit dem, was hell-klar wird im Inneren, deshalb wird das geisteswissenschaftliche Streben heute noch so vielfach mißverstanden. Jenes nebulose, nur auf dem Umweg des Leibes gefühlte innerliche Ich erweitert sich nicht wirklich zum Welten-Ich, sondern verschwimmt in einem allgemeinen Weltengefühl. Es wird einem schwer, das zum Ausdruck zu bringen. Jene unklare, verschwommene Mystik ist nur dasjenige, was das Seelische mit Hilfe des Leibesinstrumentes erleben kann. Das Seelische muß erst frei werden vom Leibe, dann, dann wird das Seelisch-Geistige wirklich erlebt. Und das Geistige muß geschaut werden, nicht aber mit denselben Erkenntniskräften, mit denen das Begriff-lich-Gesetzmäßige, Naturgesetzmäßige in der sinnlichen
Welt geschaut wird; denn das wird mit Hilfe des leiblichen Instrumentes geschaut, das geht auch nicht einmal mit uns durch die Todespforte hindurch. Naturgesetze haben nur eine Bedeutung zwischen Geburt und Tod, - nicht für die Natur selber, aber für uns. Aber wenn der Mensch den inneren Menschen erweckt und die geistige Welt um ihn herum ist, dann schaut er in eine konkrete geistige Welt, in der geistige Wesen sind, wie physische Wesen in der physischen Welt sind. Und dann kommt es nicht zu dem, wozu sonst eine ja auch ganz anerkennenswerte, aber eben beschränkte Metaphysik kommt: auf allen möglichen Wegen kommt man von einer bloßen Ahnung des Geistes, die man mit Begriffen verbrämt, zum Pantheismus, diesem Nebel-gebilde, das überall einen Allgeist sieht, so wie wenn man überall nicht einzelne Pflanzen und Tiere sehen wollte, sondern eine Allnatur. Mag man überall den Willen sehen, wie Schopenhauer, oder auf philosophischem Wege einen Panpsychismus finden, alle diese «Pane» kommen nur dadurch zustande, daß das Geistig-Seelische bloß mit dem Werkzeug des menschlichen Hauptes wirkt. Und im Grunde genommen konnte der bloße philosophische Idealismus, den ich in diesem Winter ja nun wiederholt wahrhaftig in seiner ganzen Größe zu schildern versuchte, auch zu nichts anderem kommen als zu einem begrifflichen Erfassen der Welt; denn die wirkliche Geisteswelt wird erst auf die Weise errungen, wie ich es angedeutet habe. Aber gerade wenn man nun diese konkrete Anschauung herausarbeitet - und ich konnte sie ja heute nur aphoristisch herausarbeiten -, dasjenige, was ich gesagt habe, ist wirklich alles mit der naturwissenschaftlichen Weltanschauung voll in Einklang zu bringen, verletzt auch nicht irgendein religiöses Gefühl. Sie werden das nächstens nachlesen können in meiner kleinen Schrift «Die Aufgabe der Geisteswissenschaft», die in
den nächsten Wochen erscheinen wird. Alles das, was ich so geschildert habe, setzt erst den Menschen in den Stand, die Welt, die um ihn herum ist, in allen ihren Erscheinungen zu begreifen. Die geistige Welt ist ja in der Außenwelt in ihren Wirkungen vorhanden, aber diese Wirkungen kann man erst voll begreifen, wenn man die geistigen Unter-grundlagen dieser Wirkungen erfaßt. Die seelischen Bildungskräfte, die derWelt zu Grunde liegen, die geistigen Wirkungskräfte - erst wenn man diese erfaßt, kann man einen Einblick in dasjenige gewinnen, was die Welt eigentlich ist.
Goethe wollte zunächst das Weben und Wogen des Geistes, das ihm selber unbewußt geblieben ist, im Abglanz des äußeren Materiellen sehen, und das konnte er dann nur im belebten Materiellen wahrnehmen durch seine Metamorphose. Es wird wirklich, wenn die Denkweise, die Goethe hatte, ausgedehnt wird auf Leib, Seele und Geist, eine wahre Wissenschaft von Leib, Seele und Geist erscheinen. Dann wird auch eine solche Wissenschaft möglich sein, wie ich sie vorgestern für das Begreifen der einzelnen Volks-seelen und für den auf der Erde sich abspielenden geschichtlichen Entwickelungsgang der Menschheit überhaupt angedeutet habe.
Man kann sagen: Sehnsucht, eine solche Geisteswissenschaft zu erlangen, war immer vorhanden. Wir nennen sie heute Anthroposophie, das heißt, ich versuche diesen Namen zu rechtfertigen für sie. Anthroposophie deshalb, weil Anthropologie den Menschen so betrachtet, wie man ihn betrachtet, wenn man sich nur äußerer Organe am Menschen bedient. Anthroposophie entsteht, wenn man den inneren, erweckten Menschen sich richten läßt auf dasjenige, was Mensch ist. Ich habe in früheren Vorträgen einen Ausspruch von Troxier aus dem Jahre 1835 angeführt, aus dem ersehen werden kann, wie eine solche Anthroposophie ersehnt
worden ist. Denn in der Zeit, in der mehr oder weniger auch unbewußt in den besseren Seelen überall die Goethesche Weltanschauung gewirkt hat, da war schon Sehnsucht und Hoffnung für eine solche Anthroposophie vorhanden. Und zum Belege dafür lassen Sie mich heute noch einen Ausspruch anführen, den Immanuel Hermann Fichte - ich habe auch ihn in einem der letzten Vorträge erwähnt - 1860 getan hat; er soll Ihnen beweisen, daß dasjenige, was heute hier als Geisteswissenschaft gesucht wird, durchaus etwas Ersehntes und Erhofftes in der Geistes-bewegung des neunzehnten Jahrhunderts ist, wenn es auch aus dem angeführten Grunde etwas abgedämpft war. Immanuel Hermann Fichte, der Sohn des großen Philosophen, sagt in seiner «Anthropologie» am Schlusse, 1860: «Aber schon die Anthropologie endet in dem von den mannigfaltigsten Seiten her begründeten Ergebnisse, daß der Mensch nach der wahren Eigenschaft seines Wesens, wie in der eigentlichen Quelle seines Bewußtseins, einer übersinnlichen Welt angehöre. Das Sinnenbewußtsein dagegen und die auf seinem Augpunkte entstehende phänomenale Welt mit dem gesamten, auch menschlichen Sinnenleben, haben keine andere Bedeutung, als nur die Stätte zu sein, in welcher jenes übersinnliche Leben des Geistes sich vollzieht, indem er durch frei bewußte eigene Tat den jenseitigen Geistesgehalt der Ideen in die Sinnenwelt einführt... Diese gründliche Erfassung des Menschenwesens erhebt nunmehr die in ihrem Endresultate zur .»
Die Anthroposophie, wie sie hier gemeint ist, ist wahrhaftig nichts willkürlich Erfundenes, sondern etwas Ersehntes und Erhoffies bei den besten Geistern des neunzehnten Jahrhunderts. Und ich bin für mich überzeugt davon, daß sie auf einem wirklichen Eindringen in den Geist der Goetheschen Weltanschauung fußt. Als vor einigen
Jahren die Frage war: Wie soll die Gesellschaft heißen, innerhalb welcher diese Geistesforschung, die hier gemeint ist, gepflegt wird? - Am liebsten hätte ich deshalb dazumal diese Gesellschaft «Goethe-Gesellschaft» benamt gefunden, wenn nicht der Name schon vergeben gewesen wäre an eine andere Goethe-Gesellschaft. Sie wurde mit dem Namen «Anthroposophische Gesellschaft» benamt; aber aus guten Gründen, denn Sie sehen: Dasjenige, was heute als Geisteswissenschaft auftritt, ist lange ersehnt und lange erhofft, und es ist dasjenige, was heute, ich möchte sagen, aus unterbewußten Seelengründen auf die Oberfläche befördert wird, nur das Erfüllen jener Hoffnungen, die wahrhaftig nicht bei den schlechtesten Geistern vorhanden waren.
Und noch in anderer Weise waren solche Hoffnungen vorhanden, in merkwürdiger Weise und gerade auch, möchte ich sagen, hervorgehend aus Goethescher Weltanschauung, bei einem Geiste, der so ganz mit seiner Seele in der Goetheschen Weltanschauung drinnen lebte - bei Herman Grimm. Hier tritt einmal etwas Wunderbares zutage. Herman Grimm ist ja Historiker, namentlich Kunsthistoriker. Er versuchte, wirklich aus Goethes Geiste - ich sage jetzt nicht, wie er ihn erfassen konnte, sondern wie er sich ihm einverleiben und einverseelen und einvergeistigen konnte - den Entwickelungsgang der historischen Erscheinungen im Sinne einer solchen Goetheschen Weltanschauung darzustellen. Worauf kommt er da? An einer Stelle eines Aufsatzes, den er über Macauley geschrieben hat, versuchte sich Herman Grimm klarzumachen, wie man so das geschichtliche Werden und das Drinnenstehen des einzelnen menschlichen Individuums in der Geschichte verstehen kann. Er versuchte einen Begriff zu bilden darüber: Wie steht der Mensch im Werdegang der Geschichte drinnen? Er schreckte noch zurück, denn als er den Aufsatz geschrieben hat - es
war im Beginne der siebziger Jahre -, war noch nicht die Zeit reif, Geisteswissenschaft in einer solchen Weise zu schildern, wie man sie heute schildern kann - wenn sie auch noch vielfach als Phantasterei oder als etwas Schlimmeres angesehen wird. Er versucht nicht, zur Geisteswissenschaft aufzusteigen, aber sich einen Gedanken zu bilden, von dem er sagt, er wolle ihn zunächst nur eine Phantasie sein lassen, einen Gedanken, durch den er sich vorstellen kann:
wie steht der einzelne Mensch zunächst für eine geschichtliche Betrachtungsweise im Weltenall drinnen?
Da spricht Grimm die folgenden Worte aus: «Es ist ein Zustand denkbar, daß der Geist eines Menschen, losgelöst von den körperlichen Banden, etwa wie ein bloßer Spiegel des Geschehenden über der Erde schwebte.» - Er entschuldigt sich förmlich damals noch, weil keine Geisteswissenschaft da sein konnte - «Ich stelle hier keinen Glaubens-artikel auf, es ist nur eine Phantasie. Nehmen wir an, für einige Menschen gestalte sich die Unsterblichkeit in dieser Weise» - wir haben sie, die Unsterblichkeit gestaltet sich in dieser Weise für die Geisteswissenschaft! ½. «daß sie unbeengt von dem, was sie früher verblendete, uber die Erde hin schweben und ihnen alle Schicksale der Erde und des Menschen vor der Geburt des Planeten an sich offenbarten..» Das Leben in der geistigen Welt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt muß sich Herman Grimm wenigstens hypothetisch phantastisch vorstellen, um sich das Hineingestelltsein des Menschen in die Geschichte auch wirklich vorstellen, denken zu können. Und deshalb sagt er: Nun, wie können wir den einzelnen Menschen auffassen? - «Nun plötzlich, träumen wir weiter» - man muß natürlich träumen, aber der Traum wird Wahrheit! -, «wäre dieser Geist, der so frei die Dinge überschaute, gezwungen, sich wieder dem Körper eines sterblichen Menschen zu verbinden. » - Das
heißt, Herman Grimm hat notwendig, um sich die Geschichte und das Stehen des Menschen in der Geschichte vorstellen zu können, an die wiederholten Erdenleben zu denken. Nur dadurch kann er sich die Geschichte vorstellen.
So schauten tiefere Geister die Geschichte und das geschichtliche Werden und das Drinnenstehen des Menschen an. Aber wie gesagt, solche Dinge strömten, ich möchte sagen, unter dem herrschenden Strom der mehr dem Materiellen, dem Stofflichen zugewandten WeltanschauungsEntwickelung der neueren Zeit und werden wohl an die Oberfläche getragen werden von unserer Zeit an, denn unsere Zeit spürt es schon, daß man den Geist und die Seele wieder erkennen müsse. Allerdings, man spürt das am meisten gerade, wenn man versucht, das geschichtliche Werden der Menschheit zu verstehen. Und heute liegt es nahe, das geschichtliche Werden der Menschheit zu verstehen zu suchen, da wir in einem so bedeutsamen Abschnitte dieses geschichtlichen Werdens stehen. Wenn man auf der einen Seite auf solch eine Anschauung der Geschichte blickt, wozu Her-man Grimm notwendig hat, die wiederholten Erdenleben sich vorzustellen, und dann auf eine andere geschichtliche Vorstellung blickt, da wird man so recht gewahr, wie weit es das bloße Haften an dem Stofflichen bringen kann, namentlich wenn der Mensch das geschichtliche Werden verstehen will.
Da habe ich einen Geist im Auge, von dem ich Ihnen am Schlusse jetzt noch kurz ein paar Sätze vorführen will, weil der natürlich ganz ferne steht von jedem Erfassen des Geistigen, des Seelischen. Und dennoch will er sich das geschichtliche Werden erklären, zum Beispiel warum Religionen in verschiedener Art entstanden sind, warum zu-nächst ein Polytheismus, eine Vielgötterei da war, dann Monotheismus gekommen ist, im Monotheismus wiederum
das Christentum entstanden ist, im Christentum wieder der Protestantismus entstanden ist -, äußerlich will das nun ein gewisser Geist erklären. Ja, daß da drinnen Geistig-Seelisches wirkt, dazu kann er sich natürlich nicht aufschwingen. Aber aus dem, was man äußerlich beobachten kann, allerdings auch nur in der groben Weise, wenn bloß durch die Werkzeuge des Leibes auf die Außenwelt, auch die Außenwelt der Geschichte, geschaut wird, versucht er sich nun klar zu machen, wie sich die Geschichte der Religionen entwickelt hat. Da sagt er - die Worte sind zu dem angezogenen Gedanken nicht besonders wichtig, aber ich werde sie doch einleitend lesen: «Solange die Konsolidation vorwärts schreitet, wird vornehmlich der Organismus der lebende sein, der im gegebenen Augenblicke am wohlfeilsten funktioniert, und diese Tendenz tritt gleich deutlich im abstrakten Denken wie im Handel und im Kriege hervor.> Also wenn man begreifen will, wie ein späterer Zustand aus einem früheren entsteht, so sieht man nach seiner Meinung, wie der spätere Zustand wohlfeiler wurde als der frühere.
Und das wendet er auf die Religionen an: «Den treffendsten Beleg zu diesem Prinzip liefert die Entwickelung der Religionen. Der Monotheismus ist wohlfeiler als der Polytheismus.> Das heißt: Die Menschen strebten nach und nach, es billig zu haben in der geistigen Welt. Da steigen sie vom Polytheismus zum Monotheismus vor, der ist billiger! Er braucht keinen so ausgebreiteten Kultus wie der Polytheismus! Also: «Der Monotheismus ist wohifeiler als der Polytheismus. Demzufolge konnten die zwei großen monotheistischen Religionen in Kairo und in Konstantinopel, den beiden Handelszentren des ersten Mittelalters, fort-leben, während der römische Kultus unterging, gleich wie der griechische und der ägyptische und wie die verschiedenen persischen Religionen.»
Also haben wir die späteren monotheistischen Religionen, weil sie billiger sind! Sie haben nur einen Gott, braudien also einen einfadieren Kultus, sind billiger! Dann sagt er weiter: «Im gleichen Sinne ist der Protestantismus billiger als der Katholizismus.» Wenn man nur das äußere anschaut, kann man es nicht leugnen, die protestantische Kirche hat nicht soviel Schmuck, hat noch nicht soviel Kultus entwickelt, ist billiger.
«Darum auch nahmen Holland und England» - nicht ich sage es! - «den Protestantismus an, als sie Italien und Spanien den Handel mit dem Orient entrissen.» Weil also Holländer und Engländer es billiger haben wollten, nahmen sie den Protestantismus an!
«Der Atheismus schließlich ist billiger als jedwede Religion, und es ist eine Tatsache, daß alle modernen Handelszentren zum Skeptizismus neigen, daß der moderne Staat selbst die Kultuskosten auf ein Minimum hinabzudrücken trachtet.» Hier haben wir den Kostenpunkt als Fortschritts-prinzip der Religionen! Allerdings ist das wieder ein Beispiel für diejenige Betrachtungsweise, die ich vorgestern angestellt habe: daß man da sehen kann, wie aus den verschiedenen Kulturen heraus das Bestreben ist, sich entweder mehr geistig-seelisch den Entwickelungsgang der Menschheit zu denken, oder mehr mit demjenigen, was nur in äußeren Anschauungen errungen werden kann.
Derjenige, der das geschrieben hat, ist Brooks Adams, ein Amerikaner, und Roosevelt hat die Vorrede zu diesem Buche geschrieben! Ich will zu diesen Gedanken weiter nichts hinzufügen. Sie zeigen, wo gewissermaßen der Asymptote nach gedacht dasjenige liegt, zu dem eine rein auf das äußerliche gerichtete Weltanschauung führen muß. Gewiß, was als Geistig-Seelisches erfaßt ist, wird einer rein äußerlichen Weltenbetrachtung vielfach wie ein bloßes Träumen
erscheinen. Träumen - ja, die Leute würden einem heute ja sogar das Träumen verzeihen vom materialistischen Gesichtspunkte. Ich bin überzeugt, wenn einer im Traum, was ja auch sein könnte, eine Maschine erfinden könnte, die er dann in der äußeren Wirklichkeit konstruiert, so würden die Leute an diesen Traum glauben. Es gehört natürlich nur die Kraft dazu, dasjenige, was bloß innerhalb des Geistig-Seelischen gefunden ist, in seiner Realität, in seiner Wirklichkeit zu erkennen.
Daß diese geistige Kraft zu den Entwickelungs- und Bildungsprinzipien gerade derjenigen Weltanschauungsentwickelung gehört, die sich durch das deutsche Geistesleben ausgesprochen hat, habe ich in den verschiedenen Vorträgen in dieser schweren Prüfungszeit gerade auszuführen versucht. Und wenn man eine Anschauung darüber gewonnen hat, was Geisteswissenschaft der Zukunft der Menschheit sein wird und sein muß, und sieht, wie, seit es eine deutsche Entwickelung gibt, die Bildungsprinzipien dieser deutschen Entwickelung nach dieser Geisteswissenschaft hin -nun, sagen wir - hinträumen, dann gibt das auch eine Festigkeit und Sicherheit, für deren Erlangung man innerhalb des Geisteslebens des eigenen Volkes stehen bleiben kann und nicht nötig hat, andere Geistesleben zu verunglimpfen, solche Hassesworte auszusprechen, wie wir sie vorgestern erst wiederum gehört haben, um innere Festigkeit, gewissermaßen innere Rechtfertigung in der Ablehnung des Fremden zu gewinnen. Das deutsche Geistesleben darf innere Rechtfertigung, innere Festigkeit gewinnen dadurch, daß es das, was in ihm selbst liegt, betrachtet.
Und so sei denn zum Schlusse dieses Vortrages ausgesprochen wie etwas, was als ein Gefühl in der Seele sich festsetzen kann, der Vergleich dessen, was Geisteswissenschaft will, mit dem, was vielfach als Keime gerade im
deutschen Bildungsleben lebt. Wie das Geistig-Seelische im deutschen Bildungsleben verankert ist, das gibt uns innere Gewißheit darüber, daß das Deutschtum nicht überwunden werden kann, denn es ist in der Welten-Menschheits-Entwickelung nach dem, was es als Keime in sich enthält, zu Großem bestimmt. Wir können heute sagen: England besitzt ein Viertel an Boden der gesamten trockenen Welt, des festen Landes, Rußland ein Siebentel, Frankreich ein Drei-zehntel, das deutsche Wesen kaum ein Dreißigstel des Bodens! So stehen diejenigen, die sich ausdehnen über ein Viertel, plus ein Siebentel, plus ein Dreizehntel des trockenen Landes, gegenüber denjenigen, die sich kaum auf einem Dreißigstel des trockenen Landes ausgebreitet haben. Und so müssen schon diejenigen, die sich auf diesem Dreißigstel ausgebreitet haben und mit Bewußtsein auf diesem Dreißigstel heute dem gegenüberstehen müssen, was auf einem Viertel, plus Siebentel, plus Dreizehntel steht, sich durchdringen mit dem, was aus der Erfassung des innersten Wesens heraus sich erleben läßt. Da läßt sich zweifellos aus inneren Notwendigkeiten heraus erleben: Diejenigen, die auf einem Dreizehntel plus Siebentel plus Viertel denen gegenüberstehen, die nur auf einem Dreißigstel stehen, sie dürfen die Letzteren nicht also überwinden, wie sie es heute vielfach in ihrem fanatischen Hassesideal sagen. Denn dasjenige, was auf diesem Dreißigstel lebt, scheint durch seine innere Beschaffenheit und Wesenheit für dasjenige bestimmt zu sein, was man innerhalb des irdischen Zusammenhanges ndch eine lange, lange Zeit und für menschliche Phantasie eine zeitliche Ewigkeit nennen kann. Dieses deutsche Wesen trägt die Sicherheit für seinen Bestand in sich. Und aus dieser Sicherheit geht hervor, was sich in wenigen Worten zusammenfassen läßt: Sie werden es nicht überwinden, denn soll die Welt Sinn haben, sie dürfen es nicht überwinden!
HINWEISE
Der vorliegende Band enthält die zwölfte der öffentlichen Vortragsreihen, die Rudolf Steiner seit 1903 in Berlin hielt. In seinem Buch «Mein Lebensgang» weist Rudolf Steiner auf diesen Teil seiner Vortragstätigkeit wie folgt hin:
«So war es nicht etwa die in der Theosophischen Gesellschaft vereinigte Mitgliedschaft, auf die Marie von Sivers (Marie Steiner) und ich zählten, sondern diejenigen Menschen überhaupt, die sich mit Herz und Sinn einfanden, wenn ernst zu nehmende Geist-Erkenntnis gepflegt wurde. Das Wirken innerhalb der damals bestehenden Zweige der Theosophischen Gesellschaft, das notwendig als Ausgangspunkt war, bildete daher nur einen Teil unserer Tätigkeit. Die Hauptsache war die Einrichtung von öffentlichen Vorträgen, in denen ich zu einem Publikum sprach, das außerhalb der Theosophischen Gesellschaft stand und das zu meinen Vorträgen nur wegen deren Inhalt kam.»
Der fünfte der vorliegenden Vorträge wurde erstmals in der von Marie Steiner herausgegebenen Schriftenreihe «Aus schicksaltragender Zeit» (Dornach 1930) veröffentlicht. Der sechste und zwölfte Vortrag wurden gesondert als Broschüre (Dornach 1938 bzw. 1944) herausgegeben. Der siebente Vortrag erschien als Heft V der Schriftenreihe der medizinischen Sektion am Goetheanum. Der erste bis vierte, sechste bis elfte und dreizehnte Vortrag erschienen erstmals in der Monatsschrift «Anthroposophie» (14. Jahrgang 1931/32, Nr. 6, 7, 8, 9, 10/11, 12; 15. Jahrgang 1932/33, Nr.1, 2, 3; 16. Jahrgang 1933/34, Nr. 1, 2). Beim vierzehnten und fünfzehnten Vortrag handelt es sich um Erstveröffentlichungen.
Bei der Herausgabe wurden die Arbeiten von C. S. Picht (1887-1954), von 1930-1935 Herausgeber der Monatsschrift «Anthroposophie», berücksichtigt.
Zu Seite
9 ... einer der volkstümlichsten Geschichtssreiber: Heinrich von Treitschke in «Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert», Leipzig 1879 ff., Band I Seite 279: Preußens Erhebung.
11
13 ... in einem äbnlichen Zusammenhange: «Aus schicksaltragender Zeit», Gesamtausgabe Dornach 1959, 2. Vortrag.
14 Friedrich Karl Forberg (1770-1848) «Fragmente aus meinen Papieren», Jena 1796, S. 70 f.
16 Wunderbare Worte spricht da Fichte: «Die Bestimmung des Menschen», Berlin 1800, Sämtl. Werke Bd. II, Drittes Buch, Glaube.
17 Schauplatz der Gedanken: Rudolf Steiner «Aus schicksaltragender Zeit», Gesamtausgabe Dornach 1959, 11. Vortrag.
18 Schellings Wort: «Über die Natur philosophieren, heißt die Natur schaffen.» Schelling «Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie», 1799.
23 schrieb an Goethe: Brief vom 21. Juni 1794.
24 Und das charakterisiert Schiller: Brief vom 23. August 1794.
31 Philosophische Untersuchung über das Wunder der menschlichen
Freiheit und die damit verwandten Gegenstände: F. W. Schellings
Philosophische Schriften. Erster (einziger) Band, Landshut 1800,
S. 397.
37 Den lieb' ich, der Unmögliches begehrt: Faust II, Zweiter Akt, Vers 7488.
47 f. er schließt mit den Worten: Fr. Kreyssig, «Vorlesungen über Goethes Faust», Berlin 1866, S. 254.
54 Seine Thesen: Abgedruckt in: Franz Brentano «Über die Zukunft der Philosophie», herausgegeben von Oskar Kraus, Leipzig 1929.
55 Es ist bisher nichts erschienen: C. S. Picht weist darauf hin, daß der von Oskar Kraus (Leipzig 1925) herausgegebene II. Band der «Psychologie» Franz Brentanos lediglich aus der erstmals 1911 erschienenen Schrift «Klassifikation der psychischen Phänomene» und einigen Abhandlungen aus dem Nachlaß besteht.
... folgender Ausspruch: Franz Brentano «Psychologie vom
empirischen Standpunkte» 1. Bd., Leipzig 1874, S. 20.
78 Lebendiges kann nur aus Lebendigem entstehen: Francesco Redi
(1626-1697) widerlegte die alte Lehre von der spontanen Ent
stehung niedriger Lebewesen in faulenden Substanzen.
81 In einem Vortrag im vorigen Winter: «Aus schicksaltragender
Zeit», Gesamtausgabe Dornach 1959, 3. Vortrag.
84 Am nächsten Freitag: 4. Vortrag dieses Bandes.
90 Robert Zimmermann (1824-1898), führender Asthetiker der Herbartschen Schule.
91 Christian Wolff (1679-1754), Vertreter des rationalistischen Dogmatismus. Siehe Rudolf Steiner, «Die Rätsel der Philosophie»:
Die Weltanschauungen des jüngsten Zeitalters der Gedankenent-wicklung. Gesamtausgabe, Stuttgart 1955.
Johann Georg Heinrich Feder (1740-1821), Philosoph der Leibniz-Wolffschen Schule. Sein Werk «Über Raum und Kausalität», Göttingen 1787, richtet sich gegen Kant.
Karl Leonhard Reinhold (1758-1823). Lehrer der Philosophie und Mathematik in Wien, trat nach Ablegung des Priesterkleides in Weimar zum Protestantismus über, wurde 1787 Professor der Philosophie in Jena, Wielands Schwiegersohn und Mitarbeiter am «Teutschen Merkur».
Franz Paul Baron von Herbert (1759-1811), Fabrikbesitzer in Klagenfurt, kam nach Jena, um Reinholds Vorlesungen zu hören, und verkehrte im Kreise Schillers.
92 Fercher von Steinwand (Johannes Klein fercher) (1828-1902). Sämtliche Werke, Wien 1903, 3 Bde.; Bd. I enthält «Deutsche Klänge aus Österreich». «Kosmische Chöre», herausgegeben von C. S. Picht, Stuttgart 1928. Siehe Rudolf Steiner «Mein Lebens-gang», Kap. VII, Gesamtausgabe Dornach 1962, Rudolf Steiner, «Vom Menschenrätsel» Gesamtausgabe Dornach 1957; «Veröffentlichungen aus dem literarischen Frühwerk» Rudolf Steiners. Heft 23.
95 Franz Edlauer (1829-1850), Professor an der juristisch-politischen Fakultät der Universität Graz, später in Wien. Vgl. «Vom Menschenrätsel», S. 106 f.
98 ff. Joseph Misson (1803-1875) war Piarist. Siehe auch «Vom Menschenrätsel», S. 124 ff.
112 Conrad Deubler (1814-1884), Tagebücher, Biographie und Briefwechsel, herausgegeben von Arnold Dodel-Port, 2 Teile, Leipzig
1886.
Joseph Ennemoser (1787-1854), irn Tiroler Aufstand 1809 Schreiber Andreas Hofers, 1813 Freiwilliger im Lützowschen Korps, 1819 bis 1837 Professor für Medizin in Bonn, später magnetopathischer Arzt in Innsbruck und München. Werke: «Der Magnetismus», Leipzig 1819; «Über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele», 2. Aufl. Stuttgart 1851.
Karl von Ekartshausen (1752-1803), Verfasser alchemistischer und mystischer Schriften.
113 Nikolaus Lenau (1802-1850). Siehe «Veröffentlichungen aus dem literarischen Frühwerk> Rudolf Steiners, Bd. I, S. 76 f.
Karl Szász (1859-1905), genannt «der ungarische Herder». Gebürtig aus Siebenbürgen, Honvedkämpfer, Gymnasiallehrer, zeitweilig kalvinistischer Seelsorger, später Ministerialrat im Unterrichtsministerium, 1883 reformierter Bischof der Donaudistrikte. Seine literarische Tätigkeit umfaßte alle Gebiete der Dichtung. Er übersetzte das Nibelungenlied, Goethe, Schiller, Byron u. a. ins Ungarische.
115 Max Burchhard (1854-1912), 1890-97 Direktor des Burgtheaters in Wien.
Hermann Bahr, «Erinnerung an Burckhard», Berlin 1913, S. 25 ff.
Adolf Wilbrandt (1837-1911), 1881-1887 Direktor des Wiener Burgtheaters.
118 Jean Georges Noverre (1727-1810), französischer Tänzer.
Antonio Muzzarelli (1744-1821), Italiener, seit 1791 Ballett- und Hofmeister am Wiener Nationaltheater.
Salvatore Vigano (1769-1821), Italiener, Verfasser des Ballett-buches «Die Geschöpfe des Prometheus», zu dem Beethoven die Musik schrieb. Seine Frau war die Wienerin Josepha Maria Mayer, genannt «Medina».
Cornelius Hermann von Ayrenhoff (1733-1819), österreichischer Offizier, 1794 Feldmarschalleutnant, schrieb als Anhänger Gottscheds nach französischem Muster Dramen und Lustspiele.
119 Heinrich Joseph von Collin (1771-1811). Sein Drama «Regulus», erschienen 1802, wurde von Goethe besprochen (Jenaische Allgemeine Literaturzeitung, 14. Februar 1805).
Robert Zimmermann, «Studien und Kritiken zur Philosophie und Asthetik», Wien 1870, 2. Bd., S.36 ff.
120 Matthäus von Gollin (1779-1824), Professor der Philosophie in Krakau, später in Wien, 1815 Erzieher des Herzogs von Reichstadt, Herausgeber der Sämtlichen Werke seines Bruders, Wien
1812-1814.
... das versinnlichte Material unserer Pflicht: «Unsere Welt ist das versinnlichte Material unserer Pflicht; dies ist das eigentlich Reelle in den Dingen, der wahre Grundstoff in den Erscheinungen.» J.G.Fichte, «Appellation an das Publikum über die ihm beygemessenen atheistischen Äußerungen. Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet, ehe man sie confisciert», Jena und Tübingen 1799. Siehe «Gesammelte Werke», Berlin 1845-1846, 2. Bd., S. 211.
121 Bartholomäus Ritter von Carneri (1821-1909). Siehe «Frühwerk», Band IV, S. 127 ff. «Bartholomäus Carneri, der Ethiker des Darwinismus»; Rudolf Steiner «Mein Lebensgang», Kap. IV; «Vom Menschenrätsel», S. 108 ff.
123 Ernst Edler von Plener (1841-1923), Führer der freisinnigen Deutschen. Siehe «Lebensgang», Kap. IV.
Adolf Beer (1831-1902), österreich ischer Geschichtsschreiber, 1868
Professor an der Technischen Hochschule in Wien, antiklerikaler
Politiker.
Eduard Herbst (1820-1892), Professor für Rechtsphilosophie und Staatsrecht in Lemberg, später in Prag, 1867-1870 Justizmiaister, führender Politiker der liberalen deutschen Linken.
Johann Nepomuk Berger (1816-1870), Advokat und Schriftsteller (Pseudonym Sternau), Vertreter der großdeutschen Richtung, 1868 bis 1870 Minister ohne Portefeuille.
124 Robert Hamerling (1830-1889). Siehe Rudolf Steiner, «Robert Hamerling. Ein Dichter und ein Denker und ein Mensch», Dorn-ach 1939; «Frühwerk» Band I und Heft 23; «Mein Lebensgang» Kap. XIII; «Vom Menschenrätsel» S. 131 ff.
125 Charles Sealsfleld (Karl Postl) (1793-1864), Journalist und Romanschriftsteller, zeitweilig Sekretär der Königin Hortense. Sein Werk «Austria as it is» wurde wegen der darin enthaltenen Charakterisierung des Metternichschen Systems in Österreich und vom Deutschen Bund verboten.
126 Christian Oeser (Tobias Gottfried Scbröer) (1797-1850), «Briefe an eine Jungfrau über die Hauptgegenstände der Ästhetik. Ein Weihgeschenk für Frauen und Jungfrauen» 1838. Vgl. Rudolf Steiner «Mein Lebensgang» Kap. V; «Vom Menschenrätsel» S. 90 ff.
127 Therese Schröer (1804-1896) schrieb «Ober praktische Kindererziehung», 1867, neu herausgegeben von Caroline von Heydebrand, Stuttgart 1927; «Briefe und Blätter von Frau Therese», herausgegeben von K. von Holtei 1868, neu herausgegeben von C. S. Picht, Stuttgart 1928.
128 Friedrich Dittes (1829-1896) trug auf einem Lehrertag in Chemnitz wichtige Vorschläge zur Neugestaltung des sächsischen Schulwesens vor. Er wurde daraufhin 1868 als Leiter des Pädagogiums nach Wien berufen. Als er später im Reichsrat für eine umfassende Schulreform eintrat, wurde er auf Betreiben der klerikalen Partei 1881 pensioniert.
Vincenz Eduard Milde (1777-1853), Professor der Pädagogik an der Wiener Universität, seit 1831 Fürstbischof von Wien.
130 Franz Tomberger (1837-1911), 1870-1878, also während Rudolf Steiners Schulzeit, Bezirksschulinspektor in Wiener-Neustadt.
131 Ferdinand Raimund (1790-1836), Schauspieler und Bühnen-dichter.
Johann Nepomuk Nestroy (1802-1862), Schauspieler und Possen-dichter. Die Posse «Freiheit in Krähwinkel» entstand 1848, die Parodie «Judith und Holofernes» 1847.
137 Ottokar Franz Berg (O. F. Ebersberg) (1833-1886) schrieb eine große Anzahl von Possen und Parodien.
Emmerich Madách (1823-1864), bis 1848 Notar im Komitat Nógrád, wurde nach der Niederschlagung der ungarischen Erhebung ein Jahr gefangen gehalten. Sein Hauptwerk «Die Tragödie der Menschheit», 1861, wurde mehrfach ins Deutsche übersetzt und von E. Paulay 1883 für die Bühne bearbeitet.
140 ... unmittelbar nach 1866: Tlironrede vom 22. Mai 1867.
141 Karl Julius Schröer (1825-1900), Lehrer und väterlicher Freund Rudolf Steiners. Siehe «Mein Lebensgang>; «Briefe» Band I; «Frühwerk» Band III; «Vom Menschenrätsel».
178 Leonard Nelson (1882-1927), «Vom Beruf der Philosophie unserer Zeit für die Erneuerung des öffentlichen Lebens», erschienen in der Monatsschrift «Der neue Merkur», München 1915, 2. Jg. 6. Heft. Nelson hielt die zur Psychologie entwickelte Selbsterkenntnis für die letzte Erkenntnisquelle.
181 Marie Eugenie delle Grazie (1864-1931), «Ecce Homo. B. Carneri», erschienen in «Neue Freie Presse», Wien, Nr. 16071 vom 19. Mai 1909; abgedruckt in «Anthroposophie» 14. Jg. 1931/32 S. 383 ff. Über delle Grazie siehe Rudolf Steiner «Mein Lebens-gang» Kap. IV; «Frühwerk» Heft 23; «Briefe» Band 1.
186 Wir versetzen uns nach Rammenau...: Vgl. «Johann Gottlieb Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel», herausgegeben von Immanuel Hermann Fichte, 1831/32, 2. Auflage Leipzig 1862, 2 Bände; Eduard Fichte, «Johann Gottlieb Fichte. Lichtstrahlen aus seinen Werken und Briefen nebst einem Lebensabriß», Leipzig 1863.
187 Ernst Hauhold Freiherr von Miltitz (1739-1774) war mit dem Gutsherrn von Rammenau, Johann Albericus von Hoffmann, verschwägert.
190 Aber ein Lehrer fand sich...: Magister Liebel.
191 ber ein literarisches Thema: «Oratio de recto praeceptorum poeseos et rhetorices usu» (Rede über die Regeln der Dicht- und Redekunst).
Nun war mittlerweile der wohltätige Freiherr von Miltitz gestorben: Miltitz starb 1774. Wahrscheinlich erhielt Fichte in Schulpforta ein Stipendium.
193 Christian Felix Weiße (1726-1804), Bühnendichter, Lyriker und Jugendschriftsteller. Vgl. Minor, «Chr. F. Weiße und seine Be-ziehungen zur deutschen Literatur», Innsbruck 1880.
194 ... in Olten: Im Mai 1789 besuchte Fichte die Versammlung der Helvetischen Gesellschaft in Olten, wo er den Dichter Johann Gaudenz Freiherr von Salis-Seewis kennenlernte.
197 ... eine Hauslehrerstelle in Warschau: in der Familie des Grafen von Plater.
198 ... in dem ausgezeichneten Hause Kroekow: Graf Krockow auf Krockow bei Danzig.
203 Denken Sie sich einmal die Wand...: Siehe Henrik Steffens, «Was ich erlebte», 10 Bände, Breslau 1840-1844, Band IV S. 79 f.
204 ... zu Schiller äußerte er sich: «Der Anschein der Härte in mei-nem Periodenbau kommt größtenteils daher, daß die Ltser nicht deklamieren können. Hören Sie mich gewisse meiner Perioden lesen, und ich hoffe, sie sollen ihre Härte verlieren.» Aus Fichtes Brief an Schiller vom 27. Juni 1795.
205 Bis zum Frühling 1799 versieht Fichte... sein Lehramt: Siehe hierzu Rudolf Steiner, «Methodische Grundlagen der Anthroposophie 1884-1901>, Gesarnmelte Aufsätze zur Philosophie, Naturwissenschaft, Ästhetik und Seelenkunde, Gesamtausgabe Dornach 1961.
208 Karl August schrieb... an die Universität Jena: Dekret an den akademischen Senat vom 28. Januar 1795.
Friedrich Karl Forberg, «Entwicklung des Begriffs der Religion», erschienen im «Philosophischen Journal» S. Band 1798.
212 Die Zeit, in der ich lese...: Siehe Eduard Fichte, «J. G. Fichte» (s. o.) S. 85 f.
214 Und eine Charakteristik Napoleons ist da: Staatslehre 1813. Sämtliche Werke Band IV.
215 Ausspruch Napoleons: «Und bekannt ist Napoleons Wort auf St. Helena: daß die deutschen Ideologen durch die unwiderstehliche Gewalt der Aufregung, welche sie in der Jugend entzündet, sein Reich gestürzt hätten. Dies schlechthin ihm unbekannte, von ihm verachtete Element hatte er nicht in seine Berechnungen aufgenommen, weil es seinem eigenen Geiste fern lag.» Aus «Johann Gottlieb Fichte, LichtstraMen aus seinen Werken und Briefen>, von Eduard Fichte, Leipzig 1863, S. 293.
216 Als Fichte über die Bestimmung des Gelehrten sprach: «Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten>, Jena 1794.
218 Was dann Goethe... zu dem guten Witz veranlaßte: «Außer den gedachten Unbilden brachte der Versuch, entschiedene Idealisten mit den höchst realen akademischen Verhältnissen in Verbindung zu setzen, fortdauernde Verdrießlichkeiten. Fichtens Absicht, sonntags zu lesen und seine von mehreren Seiten gehinderte Tätigkeit frei zu machen, mußte den Widerstand seiner Kollegen höchst unangenehm empfinden> bis sich denn gar zuletzt ein Studenten-haufen vors Haus zu treten erkühnte und ihm die Fenster einwarf: die unangenehmste Weise, vom Dasein eines Nicht-Ichs überzeugt zu werden.» Tag- und Jahreshefte 1795.
Und Goethe schreibt an Fichte: Brief vom 24. Juni 1794.
219 Goethes Verhältnis zur Kantschen Philosophie: Vgl. Anschauende Urteilskraft, 1817, gedruckt in der «Morphologie» 1820.
220 ... eine Idee von der Universität: Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt, die in gehöriger Verbindung mit einer Akademie der Wissenschaften stehe (Sämtliche Werke Band 8).
222 Karl Christian Erhard Schmid (1761-1812), Anhänger Kants, veröffentlichte im «Intelligenzblatt> der «Allgemeinen Literatur-zeitung> 1794 einen kränkenden Angriff gegen Fichte.
225 Ihr Wissen geht jetzt auf in dem Unverstande.. .: Siehe «Einleitungsvorlesungen in die Wissenschaftslehre, die transcendentale Logik und die Tatsachen des Bewußtseins>, vorgetragen im Winterhalbjahr 1812-1813. Nachlaß, Bonn 1834, 1. Band S. 18.
226 Der neue Sinn ist demnach der Sinn für den Geist: Siehe Nachlaß
1. Band S. 19.
232 ... bei der Betrachtung von Goethes Weltbild: Siehe 1. Vortrag dieses Bandes.
233 ... nach einer gewiß berechtigten Meinung Herman Grimms:
Siehe «Goethe-Vorlesungen», Berlin 1887, 11. und 12. Auflage 1923, 2. Band, 24. Vorlesung S. 221.
Herman Grimm sagte dazumal: Siehe «Fünfzehn Essays. Dritte Folge», Berlin 1882, S. 218 f.
238 ff. Agrippa van Nettesheim (1487-1535): Siehe Rudolf Steiner, «Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung», Gesamtausgabe Dornach
1960.
248 Goethes Naturwissenschaftliche Schriflen, herausgegeben von Rudoq Steiner, Kürschners Deutsche National-Literatur Band 33-36 (Stuttgart 1883-1897). Sonderausgabe der Einleitungen, Dornach 1926, Freiburg 1948.
Eine Briefstelle: «Ferner muß ich dir vertrauen, daß ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung ganz nahe bin und daß es das einfachste ist, was nur gedacht werden kann. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins unendliche erfinden, die konsequent sein müssen, das heißt, die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innere Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird sich auf alles Lebendige ausdehnen lassen.» Brief vom 17. Mai 1787 an Herder.
253 Carl Kiesewetter, «Faust in der Geschichte und Tradition», Leipzig 1893, 2. Auflage Berlin 1923, 2 Bände.
259 Goethe hat... Eckermann gestanden: «Ich kann Ihnen nichts weiter verraten, als daß ich beim Plutarch gefunden, daß im griechischen Altertum von Müttern als Gottheiten die Rede gewesen.» 10. Januar 1830.
266 Und Kant sagte: Siehe «Kritik der Urteilskraft» § 80.
270 eine Kritik des Goetheschen Faust: Franz von Spaun, «Protestation gegen die Staëllsche Apotheose des Goethischen Faustus» in «Vermischte Schriften», München 1822, Teil II S. 159-228.
272 f. wie Herman Grimm wiederum so schön sagt: Siehe: «Goethe-Vorlesungen» 2. Band, 25. Vorlesung S. 252.
276 in einem der Vorträge: Siehe 2. Vortrag dieses Bandes.
285 Moriz Benedikt, «Die Seelenkunde des Menschen als reine Erfahrungswissenschaft», Leipzig 1885.
315 . . . in der im vorigen Dezember gehaltenen Darlegung: Siehe
3. Vortrag dieses Bandes.
Hermann Bahr (1863-1934); Vgl. Rudolf Steiner, Briefe Band I; «Frühwerk» Band III S. 76 f.; «Vom Menschenrätsel» S. 161.
316 über russisches Wesen ein Buch: «Russische Reise», Dresden 1891.
318 Ein bedeutender Literaturhistoriker: Erich Schmidt (1853-1913),
1885-1886 Direktor des Goethe-Archivs in Weimar, dann Nachfolger von Wilhelm Scherer in Berlin. Vgl. «Mein Lebensgang» Kap. V, IX, XIV, XX.
319 «Der Bär» erschien erstmals anonym in Holteis «Jahrbuch deutscher Bühnenspiele», Berlin 1830.
320 «Über Erziehung und Unterricht in Ungarn» erschien unter dem Pseudonym Pius Desiderius, Leipzig 1853.
321 Nun kam ihm nicht nur das deutsche Wesen wie das alte griechische Wesen vor: Siehe K. J. Schröer, «Geschichte der deutschen Literatur», Vorlesungen aus dem Jahre 1846 am Lyzeum Preßburg, Pest 1853.
324 Durch ganz Europa...: Vgl. Wilhelm Wackernagel, «Geschichte der deutschen Literatur», Basel 1848, S. 14.
326 «Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungarn», Wien 1858. In der Inszenierung von Rudolf Steiner wurden diese Spiele in Deutschland seit 1910 von Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft dargestellt. Seit 1915 werden sie alljährlich auch am Goetheanum in Dornach aufgeführt. Siehe «Die Oberuferer Weihnachts-spiele. Mitgeteilt von Karl Julius Schröer, szenisch eingerichtet von Rudolf Steiner», Dornach 1957.
327 Wir haben ein Wörterbuch: K. J. Schröer, «Wörterbuch der Mundarten von Gottschee», Wien 1870; «Versuch einer Darstellung der Mundarten des ungrischen Berglandes», Wien 1864.
328 Geschichte der deutschen Dichtung: K. J. Schröer, «Die deutsche
Dichtung in ihren bedeutendsten Erscheinungen», Leipzig 1875.
Besprochen von Emil Kuh in «Allgemeine Zeitung», Augsburg
1875, Beilage Nr. 114/15: «Eine Literaturgeschichte aus dem
Handgelenk». Vgl. C. S. Picht, «Ein Karl Julius Schröer-Gedenken» in «Die Drei», Stuttgart 1925/26, Heft 9.
330 Karl Kraus (1874-1936), «Die demolierte Literatur», zuerst als Artikelserie in der «Wiener Rundschau» Januar 1897 erschienen.
Jakob Julius David (1859-1906), Lyriker und Dramatiker. Gesammelte Werke, München 1908, 7 Bände. - Die Hanna ist ein Distrikt in Mähren.
335 «Germanenzug» erschien erstmals in dem von E. Kuh herausgegebenen «Dichterbuch», Wien 1863.
338 Jaroslav Vrchlický (Emil Frida) (1853-1912), Professor an der Universität Prag.
346 Fritz Lemmermayer (1856-1932), Jugendfreund Rudolf Steiners. Vgl. «Mein Lebensgang» Kap. VII, VIII; F. Lemmermayer, «Erinnerungen», Stuttgart 1929.
Eduard Sueß (1831-1914), «Das Antlitz der Erde», Wien 1885 bis 1909, 3 Bände; «Der Boden der Stadt Wien nach seiner Bildungsweise, Beschaffenheit und seinen Beziehungen zum bürgerlichen Leben», Wien 1862.
349 Das liest Deubler.. . Maximilian Grävell, «Der Mensch», Berlin
1815. Heinrich Zschokke, «Stunden der Andacht», Aarau 1809 bis 1816, 6 Bände. Ein Buch von Sintenis «Der gestirnte Himmel» konnte nicht gefunden werden.
365 Karl Rosenkranz, «Psychologie oder die Wissenschaft vom subjektiven Geist»> 3. Auflage, Königsberg 1863, S. 482.
368 Theodor Ziehen, «Leitfaden der Physiologischen Psychologie in
16 Vorlesungen», 10. Auflage Jena 1914.
370 er sagt es klipp und klar: s. o. S. 3. Die beiden folgenden Zitate sind nicht wörtlich, sondern dem Sinn nach wiedergegeben.
403 Die Geisterwelt ist nicht verschlossen: Faust I, Nacht, Vers 442 ff. Voran geht die Zeile: «Jetzt erst erkenn' ich, was der Weise spricht...» Nach Scherer, «Aus Goethes Frühzeit» (1879) S.71 ff., soll es sich dabei um eine Anspielung auf eine Stelle in Herders «Älteste Urkunde des Menschengeschlechts» (1774-1776, 2 Bände) handeln.
404 ,wie Hegel nun wiederum richtig ahnte: «Nur das Natürliche ist . . . der Zeit untertan, insofern es endlich ist; das Wahre dagegen, die Idee, der Geist, ist ewig. Der Begriff der Ewigkeit muß aber nicht negativ so gefaßt werden als die Abstraktion von der Zeit, daß sie außerhalb derselben gleichsam existiere; ohnehin nicht in dem Sinn, als ob die Ewigkeit nach der Zeit komme ...» «Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften» § 258.
405 Alles Leben stammt vom Leben: Siehe Hinweis zu Seite 78.
412 Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860), «Der Erwerb aus einem vergangenen und die Erwartungen von einem zukünftigen Leben. Eine Selbstbiographie. Dem Herrn Dr. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling», Erlangen 1854-1856, 1. Band S. 389 f.
418 Julien Offray de Lamettrie (1709-1751), «L'homme-machine», Leiden 1748, deutsch von Ritter, Leipzig 1875.
Goethe, aus seinem deutschen Bewußtsein heraus: Vgl. «Dichtung und Wahrheit» Dritter Teil, 11. Buch.
421 Intellektuelle Anschauung: Siehe Schelling, Gesammelte Werke, Stuttgart und Augsburg 1856-1858, 4. Band S. 368 ff.
Hegel wendet sich . . . gegen diese intellektuelle Anschauung:
Siehe «Phänomenologie des Geistes», Vorrede.
424 Immanuel Hermann Fichte (1796-1879): Siehe «Die Rätsel der Philosophie», Reaktionäre Weltanschauungen; «Vom Menschenrätsel». Zu den folgenden Ausführungen siehe 1. H. Fichte, «Anthropologie», 2. verm. u. verb. Aufl. Leipzig 1860, § 118, 119.
Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866): Siehe Rudolf Steiner «Die Rätsel der Philosophie» Kap. Der Kampf um den Geist; «Vom Menschenrätsel». Werke Troxlers: «Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, Bildungsgang, Zweck und Anwendung derselben aufs
Leben, als Enzyklopädie und Methodologie der philosophischen Wissenschaften», Bern 1835, neu herausgegeben von Prof. F. Eymann, Bern 1942; «Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik>, Bern 1828, neu herausgegeben von W. Aeppli, Bern 1944; «Blicke in das Wesen des Menschen», Aarau 1812, neu herausgegeben von H. E. Lauer, Stuttgart 1921; «Fragmente», herausgegeben von W. Aeppli, Bern 1930.
428 Troxier sagt einmal: Die folgenden Zitate stammen aus den «Vorlesungen über Plilosophie» (s. o.) 6. Vortrag.
Kant, «Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik», Königsberg 1766.
429 lavater dichtet und denkt . . . Der Naturforscher und Philosoph Charles Bonnet (1720-1793) lehrte die Existenz eines ätherischen Seelenleibes. Lavater, auf den Bonnet Einfluß gewann, übersetzte eines sesner Hauptwerke zum Teil und gab es unter dem Titel «Philosophische Untersuchung der Beweise für das Christentum», Zürich 1771, heraus.
Ernst Platner, Mediziner und Philosoph, schrieb u. a. «Anthropologie für Ärzte und Weltweise», Leipzig 1772 f.
431 Rudolf Rocholl (1822-1905), «Beiträge zu einer Geschichte deutscher Theosophie. Mit besonderer Rücksicht auf Molitors Philosophie der Geschichte», Berlin 1856.
432 Carl Christian Planck (1819-1880), «Wahrheit und Flachlieit des Darwinismus», Nördlingen 1872; «Grundlinien einer Wissenschaft der Natur als Wiederherstellung der reinen Erscheinungsformen», Leipzig 1864. Das folgende Zitat entstammt dem letztgenannten Werk S. XIV. Aus dem Nachlaß herausgegeben von K. Köstlin, «Testament eines Deutschen. Philosophie der Natur und der Menschheit», Tübingen 1881, Neuausgabe Jena 1915. Über Planck siehe auch Rudolf Steiner «Vom Menschenrätsel».
434 Henri Bergson, «La signification de la guerre» in «Pages actuelles
1914/15», Paris 1915.
435 Wilhelm Heinrich Prei'ß (1843-1909), «Geist und Stoff. Erläutesungen des Verhältnisses zwischen Mensch und Universum nach dem Zeugnis der Organismen», 1882, 2. Aufl. 1899; «Die Bedeutung
des Lebens im Universum», herausgegeben von W. J. Stein, Stuttgart 1922. Über Preuß siehe auch Rudolf Steiner «Die Rätsel der Philosophie», Der moderne Mensch und seine Weltanschauung.
Bergson macht . . . darauf aufmerksam: «L'Evolution créatice», Paris 1907, 8. Aufl. 1911, S. 201.
438 . . . nachdem jetzt hinlänglich nachgewiesen ist: H. Bönke, «Plagiator Bergson. Zur Antwort auf die Herabsetzung der deutschen Wissenschaft durch Edmond Perrier», Berlin 1915.
440 Goethe im Recht gegen Newton: Titel eines Buches von Friedrich Grävell, Berlin 1857, Neuausgabe Stuttgart 1922.
Goethe, als er reiste . . .: Brief an Knebel vom 18.8.1787.
441 Rudolf Steiner, «Gedanken während der Zeit des Krieges. Für Deutsche und diejenigen, die nicht glauben, sie hassen zu müssen» (Berlin 1915), abgedruckt in «Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915-1921», Gesamtausgabe Dornach 1961.
442 Das . . . Politische Testament Peters des Großen gilt als Fälschung, die zwischen 1797 und 1836 entstanden ist. Vgl. Harry Breßlau, «Das Testament Peters des Großen» in «Historische Zeitschrift» Bd. 41, 1879; ferner L. Polzer-Hoditz, «Der Kampf gegen den Geist und das Testament Peters des Großen», Stuttgart 1922.
Dimitri Iwanowitsch Pissarew (1840-1868) übte durch seinen Realismus großen Einfluß auf die Jungrussen aus. Das Zitat entstammt Th. G. Masaryk, «Rußland und Europa», Jena 1913, II. Band S. 90.
443 Iwan Wasiljewitsch Kirejewski (1806-1854), in Petersburg kurze Zeit Herausgeber einer Zeitschrift «Der Europäer», wandelte sich von einem «Westler» zu einem entschiedenen Slawophilen.
Alexej Stepanowitsch Chomjakow (1804-1860), Geschichtsphilosoph.
444 Herder ist der erste Slawophile: Herder, «Ideen zur Geschichte der Philosophie der Menschheit», 16. Buch Kap. IV. Vgl. Konrad Bittner, «Herders Geschichtsphilosophie und die Slawen», Reichenberg 1929.
445 Das Schicksal jedes europäischen Staates.. .: Siehe J. W. Kirejewski, «Bericht über die russische Literatur» in Masaryk, «Rußland und Europa» (s. o.) I. Band S. 222.
Sergius Jushakow (1849-1910), «Der englisch-russische Konflikt>,
Petersburg 1885. Siehe hierzu und zu den folgenden Zitaten
Marian Zdziechowski, «Die Grundprobleme Rußlands. Literarisch-politische Skizzen». Aus dem Polnischen übersetzt von Adolf
Stylo, Wien 1907.
449 ich glaubte in einen Tempel zu treten: Ernest Renan an David Friedrich Strauß, Paris, 13. September 1870. Siehe Dav. Fr. Strauß, Gesammelte Schriften, Bonn 1876-1878, Band I S. 311 f.
451 Emile Boutroux, «L'Allemagne et la guerre» in «Pages d'histoire
1914/15», Paris 1915.
452 Thomas Hobbes (1588-1679) hält es für empirisch gegeben, daß im Verhältnis der Staaten untereinander nicht das Recht, sondern die Macht entscheidet. «De corpore politico», London 1650, Neuausgabe durch Ferd. Tönnies, London 1889.
453 Edmons' Rostand, «Chantecler», Paris 1910, ein satirisch-symbolisches Tierdrama.
456 . . . daß Jakob Böhme sagen konnte: Zusammenfassung eines
Zitates aus «Aurora oder die Morgenröte im Aufgang ...» in
«Alle Göttlichen Schriften», 3. Ausgabe Amsterdam 1730, Band I
S. 338; vgl. Rudolf Steiner «Die Rätsel der Philosophie», Die
Klassiker der Welt- und Lebensanschauung.
457 Und wenn je dem deutschen Namen . . .: Schlußstrophe des Gedichtes «An der Adria» in «Blätter im Winde. Neuere Gedichte», Hamburg 1887, S. 294.
462 Theodor Meynert (1833-1892), Psychiater und Gehirnanatom in Wien, erforschte die Funktion der Hirnteile. Meynert behandelte Rudolf Steiners Jugendfreund Alfred Stross; siehe Lemmermayer, «Erinnerungen» S. 39.
463 Meynert meint, aus einer Milliarde...: Siehe Meynert, «Zur Mechanik des Gehirnbaues» in «Sammlung von populärwissenschaftlichen Vorträgen». Über den Bau und die Leistungen des Gehirns (1892) S. 17ff.
472 . . . an dem alten kantischen Wort: «Und so enthält das Wirkliche nichts mehr, als das bloß Mögliche. Hundert wirkliche Thaler enthalten nicht das Mindeste mehr als hundert mögliche . . . Wenn ich also ein Ding . . . denke, so kommt dadurch, daß ich noch hinzusetze, dieses Ding ist, nicht das Mindeste zu dem Dinge hinzu . . . Denke ich mir nun ein Wesen als die höchste Realität (ohne Mangel), so bleibt noch immer die Frage: ob es existiere oder nicht.» «Kritik der reinen Vernunft», Riga 1781, Neuausgabe Leipzig 1930, S. 572.
475 Carl Vogt, «Physiologische Briefe an die Gebildeten aller Stände», Stuttgart 1847, S. 206.
484 Hans Vaihinger (1852-1933), «Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus», Berlin 1911. Vgl. Rudolf Steiner «Die Rätsel der Philosophie», Der moderne Mensch und seine Weltanschauung.
485 Fritz Mauthner (1849-1923), «Beiträge zu einer Kritik der Sprache», Stuttgart 1901-1902; «Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache», München 1910-191 l.
487 Karl Ernst von Baer (1792-1876), Professor der Anatomie in Königsberg und Petersburg, gilt als Begründer der modernen Entwicklungsgeschichte. Zu Baers Erwähnung bei Haeckel siehe u. a. «Anthropogonie», 4. Auflage Leipzig 1891, I. Band S. 43 ff.
. . . einige Stellen aus Karl Ernst von Baer: «Reden und kleinere Aufsätze», Petersburg 1864, I. Band S.71 f.
488 David Friedrich Strauß: «Der alte und der neue Glaube» IV. Abschnitt in «Gesammelte Schriften», Bonn 1876-1878, VI. Band S. 162.
489 Laurenz Müllner (1848-1911), «Die Bedeutung Galileis für die Philosophie», Inaugurationsrede, gehalten am 8. November 1894 in Wien, abgedruckt in «Die Drei» 16. Jg. 1933/34 S. 29 ff. Über Müllner vgl. Rudolf Steiner «Mein Lebensgang» Kap. VII.
Es gab einmal Menschen . . .: Bis 1822 standen Werke, die von der Bewegung der Erde um die Sonne handeln, auf dem Index der von der katholischen Kirche verbotenen Bücher.
495 Denn es ist ein schöner Ausspruch: Siehe «Entwurf einer Farben-lehre, Einleitung> in Goethes Naturwissenschaftliche Schriften (s. o.), S. 88.
499 Ludwig Feuerbach (1804-1872): Siehe «Die Rätsel der Philosophie», Die radikalen Weltanschauungen; Der Kampf um den Geist.
502 Goethe sagt: Siehe «Maximen und Reflexionen». Aus Wilhelm Meisters Wanderjahren. Nr.487.
510 Aber in dem, was der W'lle darlebt: Vgl. Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, II. Band 19. Kapitel, «Zur Metaphysik des Schönen und Ästhetik».
518 f. «Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik», Leipzig
1872.
520 «Unzeitgemäße Betrachtungen», Leipzig 1873-1876.
So schreibt Richard Wagner: Lugano, 22. Juli 1852 an Theodor Uhlig.
529 jene zweite Periode im Nietzscheleben: «Menschliches-Allzu-menschliches», Leipzig 1878, 2 Bände; «Der Wanderer und sein Schatten» (ebd. 1880); «Morgenröte» (ebd. 1881); «Die fröhliche Wissenschaft» (ebd. 1882).
536 «Also sprach Zarathustra» 3 Teile, Leipzig 1884.
543 «Athanasia oder die Gründe für die Unsterblichkeit der Seele», Sulzbach 1827, 2. Auflage 1838, anonym.
544 Bernard Bolzano (1781-1848), Philosoph und Mathematiker,
1805 zum Priester geweiht, Professor der Religionswissenschaften in Prag, 1819 wegen seiner freisinnigen Überzeugung abgesetzt. Hauptwerk «Wissenschaftslehre», Sulzbach 1837>4 Bände.
549 Arthur Schopenhauer, Schriften zur Erkenntnislehre, Über das Sehen und die Farben, 1816, 2. Aufl. 1854.
Hermann Lotze, «Grundzüge der Psychologie», Leipzig 1882, S. 15.
550 Hermann Helmholtz, «Die Tatsachen in der Wahrnehmung», Berlin 1879, S.12 f.
551 Rudolf Steiner, «Die psychologischen Grundlagen und die erkenntnistheoretische Stellung der Theosophie». Vortrag, gehalten am 8. April 1911 auf dem Philosophischen Kongreß in Bologna.
571 . . . was Fichte nur erahnte: «Ganz gewiß zwar liegt die Seligkeit auch jenseits des Grabes, für denjenigen, für den sie schon diesseits begonnen hat, und in keiner anderen Weise und Art, als sie diesseits, in jedem Augenblicke, beginnen kann . . . Wahrhaftig leben, heißt wahrhaftig denken und die Wahrheit erkennen.» «Die Anweisung zum seligen Leben...», Berlin 1806, in Sämtl. Werke (s. o.), V. Band S. 409 f.
575 Da habe ich in einer gewissen Stadt vorgetragen . . .: Vortrag, gehalten am 17. Mai 1915 in Linz, «Die übersinnliche Erkenntnis und ihre stärkende Seelenkraft in unserer schicksaltragenden Zeit».
576 Schon in einem Tagblatt: «Linzer Tagespost» vom 18. Mai 1915.
. . . an eine Zeitschrift gewandt: Alois Kaindl, «Geisteswissenschaft
und moderne Kultur» in «Psychische Studien», Leipzig, 42. Jg.,
8. und 9. Heft.
583 «Almanach de Mme. de Thébes. Conseils pour ìtre heureux», Paris 1912.
584 . . . im Almanach für 1914: «Das tragische Ereignis im österreichischen Kaiserhaus, das ich vorausgesagt habe, ist zwar noch nicht eingetreten, es wird aber ganz bestimmt, und zwar vor Ab-Lauf der ersten Hälfte des Jahres, eintreten.» (s. o.), Paris 1913, «Mes prédications de l'an passé».
. . . daß der österreichische Erzherzog Franz Ferdinand ermordet werden möge: Vgl. Karl Heise, «Die Entente-Freimaurerei und der Weltkrieg», 3. Aufl. Basel 1920, S. 76.
Unter den Allerersten, die ermordet werden: In seiner Rede vor der Kammer vom 4. Juli 1913 sagte Jean Jaurés, zu den Rechtsparteien gewandt: «Aus euren Zeitungen, aus euren Artikeln, hei euren Helfershelfern tönt - ihr versteht mich - fortgesetzt die Aufforderung zu einem Attentat gegen uns.»
585 Ernst Haeckel, «Ewigkeit. Weltkriegsgedanken über Leben und Tod, Religion und Entwicklungslehre», Berlin 1913, S. 9, 32, 24.
588 Als Goethe gefragt wurde . . .: Siehe Paralipomena zu den Annalen: Erste Bekanntschaft mit Schiller. 1794.
591 Jakob Grimm (1785-1863), der Begründer der deutschen Philologie und Altertumswissenschaft, 1830 Professor in Göttingen, unterzeichnete 1837 mit seinem Bruder Wilhelm die Protestation der Göttinger Sieben gegen die Aufhebung des hannoverschen Staatsgrundgesetzes und wurde deshalb seines Amtes enthoben und ausgewiesen. Seine Arbeiten zur Sprachgeschichte, insbesondere seine «Deutsche Grammatik>, 1819-1837, Neuausgabe 1870 bis 1898, 4 Bände, und zur Sagenkunde waren grundlegend. Er erkannte die Gesetzmäßigkeit des Lautwandels und brachte die von dem dänischen Sprachforscher Rask vorbereitete Erkenntnis der Lautverschiebung zu einem vorläufigen Abschluß.
593 Ludwig Laistner (1845-1896): Vgl. Rudolf Steiner «Mein Lebensgang» Kap. XV.
602 «Das Reich» München, l. Jg. Buch i, April 1916: «Die Erkenntnis vom Zustand zwischen dem Tode und einer neuen Geburt>.
606 Gustav Theodor Fechner (1801-1887): Siehe «Frühwerk» Rudolf Steiners, Band IV; «Die Rätsel der Philosophie», Der Kampf um den Geist; Moderne idealistische Weltanschauungen.
615 Heanzen (Ableitung umstritten): Deutsche Kolonisten in der Oststeiermark und im Burgenland, bis 1945 auch in Ödenburg, kamen unter Heinrich IV. um 1076 aus Oberfranken, spätere Zu-wanderer u. a. aus Salzburg.
Die Zipser Deutschen: Ihre Einwanderung in die Oberzips geht ins 12. bis 13. Jahrhundert zurück. Die Gemeinschaft der 24 Zipser Städte besaß bis 1876 Selbstverwaltung und eigenes Stadtrecht. Nach 1945 blieben nur kleine Gruppen in den slowakischen Städten zurück.
Die Siebenbürger Sachsen: Die ersten deutschen Einwanderer wurden im 12. Jahrhundert von dem ungarischen König Geisa II. nach Siebenbürgen gerufen. Sie kamen vorwiegend vom Niederrhein, ferner aus Mitteldeutschland und anderen Gebieten. Ihre Zahl betrug 1940 etwa 250000, heute noch 175 000.
Die Banater Schwaben: Überwiegend Nachkommen der Pfälzer, Lothringer, Mosel- und RIseinfranken und Alemannen, die im
18. Jahrhundert unter Karl VI., Maria Theresia und Joseph II. nach Vertreibung der Türken im Banat angesiedelt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils vertrieben.
618 Ein Deutscher, der die Geschichte Frankreichs schreibt: Herman Grimm, «Fünfzehn Essays. Erste Folge», 3. Aufl. Berlin 1884, S. 115 f.
George Henry Lewes (1817-1877), «Life of Goethe» 2 Bände, 1855, deutsch 1856/57.
Viktor Hugo: Vgl. «Frühwerk» Rudolf Steiners, Heft 4, Denker und Dichter im 19. Jahrhundert.
620 Wir brauchen nur Worte zu nehmen: Vgl. Rudolf Steiner, «Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen. Eine Anregung für Erzieher», 6 Vorträge, gehalten 1919/20 für die Lehrer der Freien Waldorfschule in Stuttgart, Dresden 1940.
627 Franz Xavier Schmid (1819-1883), «Die Grundfesten der Erkenntnis. Sieben philosophische Nachtwachen», 1850.
628 Jakob Grimm, «Über das Pedantische in der deutschen Sprache». Vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften am 21. Oktober 1847. Erschienen in: «Aus den kleineren Schriften von Jakob Grimm», 1874,2. Aufl. 1911, S. 302 ff.: «Das Pedantische aber, glaube ich, wenn es früher noch gar nicht vorhanden gewesen wäre, würden die Deutschen zuerst erfunden haben.»
Ernst Troeltsch (1865-1923), evangelischer Religionsforscher und Philosoph. Gesammelte Schriften 4 Bände, Berlin 1912-1925.
Dem deutschen Volke war es vorbehalten: Herman Grimm, «Fünfzehn Essays. Erste Folge», 3. Aufl. Berlin 1884, S. 99.
631 Woodrow Wilson (1856-1927) führte die Vereinigten Staaten
1917 in den Krieg gegen das Deutsche Reich, nachdem er kurz zuvor als «Friedenspräsident» wiedergewählt worden war. Rudolf Steiner stellte den abstrakten «Vierzehn Punkten» Wilsons die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus entgegen.
638 . . . bei seiner Reise in Italien: Siehe Goethes Naturwissenschaftliche Schriften (s. o.), Erster Band S.78 ff.: Geschichte meines botanischen Studiums.
640 Justus Christian Loder (1753-1832), Professor der Medizin in Jena, später in Halle.
Uns ist es ja bekannt . . .: s. o. S. 316 ff.: Zwischenknochen; Annalen 1790.
651 Eduard von Hartmann (1842-1906), «Philosophie des Unbewußten. Versuch einer Weltanschauung», Berlin 1869. Vgl. Rudolf Steiner «Die Rätsel der Philosophie», Moderne idealistische Weltanschauungen; ferner «Mein Lebensgang» Kap. VI, XVII; Briefe Band II; «Die Geisteswissenschaft als Anthroposophie und die zeitgenössische Erkenntnistheorie», Dornach 1950.
653 Carl Ludwig Schleich (1859-1922), «Vom Schaltwerk der Gedanken», Berlin 1917, S. 256 f.
673 Und zum Belege dafür: Immanuel Hermann Fichte, «Anthropologie».
675 Es ist ein Zustand denkbar: Herman Grimm, «Fünfzehn Essays. Erste Folge» (s. o.) S. 12. 677 Solange die Consolidation vorwärts schreitet: Brooks Adams, «Das Gesetz der Zivilisation und des Verfalls». Mit einem Essay von Theodore Roosevelt, Wien und Leipzig 1907.
Literatur
- Rudolf Steiner: Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben, GA 65 (2000), ISBN 3-7274-0650-X pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |