Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 354
RUDOLF STEINERVORTRÄGEVORTRÄGE FÜR DIE ARBEITER AM GOETHEANUMBAUDie Schöpfung der Welt und des MenschenÜber Welt- und Menschenentstehung
|
Inhaltsverzeichnis
GELEITWORT
zum Erscheinen von Veröffentlichung aus den Vorträgen Rudolf Steiners für die Arbeiter am Goetheanum vom August 1922 bis September 1924
Marie Steiner
Man kann diese Vorträge auch Zwiegespräche nennen, denn ihr Inhalt wurde immer, auf Rudolf Steiners Aufforderung hin, von den Arbeitern selbst bestimmt. Sie durften ihre Themen selber wählen; er regte sie zu Fragen und Mitteilungen an, munterte sie auf, sich zu äußern, ihre Einwendungen zu machen. Fern- und Naheliegendes wurde berührt. Ein besonderes Interesse zeigte sich für die therapeutische und hygienische Seite des Lebens; man sah daraus, wie stark diese Dinge zu den täglichen Sorgen des Arbeiters gehören. Aber auch alle Erscheinungen der Natur, des mineralischen, pflanzlichen und tierischen Daseins wurden berührt, und dieses führte wieder in den Kosmos hinaus, zum Ursprung der Dinge und Wesen. Zuletzt erbaten sich die Arbeiter eine Einführung in die Geisteswissenschaft und Erkenntnisgrundlagen für das Verständnis der Mysterien des Christentums.
Diese gemeinsame geistige Arbeit hatte sich herausgebildet aus einigen Kursen, die zunächst Dr. Roman Boos für die an solchen Fragen Interessierten, nach absolvierter Arbeit auf dem Bauplatz, gehalten hat; sie wurden später auch von andern Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft weitergeführt. Doch erging nun die Bitte von seiten der Arbeiter an Rudolf Steiner, ob er nicht selbst sich ihrer annehmen und ihren Wissensdurst stillen würde - und ob es möglich wäre, eine Stunde der üblichen Arbeitszeit dazu zu verwenden, in der sie noch frischer und aufnahmefähiger wären. Das geschah dann in der Morgenstunde nach der Vesperpause. Auch einige Angestellte des Bau-büros hatten Zutritt und zwei bis drei aus dem engeren Mitarbeiterkreise Dr. Steiners. Es wurden auch praktische Dinge besprochen, so zum Beispiel die Bienenzucht, für die sich Imker interessierten. Die Nachschrift jener Vorträge über Bienen wurde später, als Dr. Steiner
nicht mehr unter uns weilte, vom Landwirtschaftlichen Versuchsring am Goetheanum als Broschüre für seine Mitglieder herausgebracht.
Nun regte sich bei manchen andern immer mehr der Wunsch, diese Vorträge kennenzulernen. Sie waren aber für ein besonderes Publikum gedacht gewesen und in einer besonderen Situation ganz aus dem Steg-reif gesprochen, wie es die Umstände und die Stimmung der zuhören-den Arbeiter eingaben - durchaus nicht im Hinblick auf Veröffentlichung und Druck. Aber gerade die Art, wie sie gesprochen wurden, hat einen Ton der Frische und Unmittelbarkeit, den man nicht vermissen möchte. Man würde ihnen die besondere Atmosphäre nehmen, die auf dem Zusammenwirken dessen beruht, was in den Seelen der Fragenden und des Antwortenden lebte. Die Farbe, das Kolorit möchte man nicht durch pedantische Umstellung der Satzbildung wegwischen. Es wird deshalb der Versuch gewagt, sie möglichst wenig anzutasten. Wenn auch nicht alles darin den Gepflogenheiten literarischer Stilbildung entspricht, so hat es dafür das unmittelbare Leben.
Marie Steiner
DIE SCHÖPFUNG DER WELT UND DES MENSCHEN
ERSTER VORTRAG Dornach, 30. Juni 1924
Nun, hat jemand sich eine Frage ausgedacht?
Herr Dollinger: Ich möchte fragen, ob Herr Doktor nicht wieder sprechen könnte von der Schöpfung der Welt und des Menschen, da verschiedene Neue da sind, die das noch nicht gehört haben?
Dr. Steiner: Also gefragt ist, ob ich wiederum anfangen könnte, von Weltenschöpfung und Menschenschöpfung zu sprechen, weil sehr viel neue Kameraden da sind. Nun werde ich die Sache so gestalten, daß ich Ihnen zunächst klarzumachen versuche, wie ursprünglich die Zustände auf der Erde waren, welche auf der einen Seite zu all demjenigen geführt haben, was wir draußen sehen, und auf der anderen Seite zum Menschen.
Sehen Sie, der Mensch ist ja eigentlich ein sehr, sehr kompliziertes Wesen. Und wenn man glaubt, den Menschen nur dadurch verstehen zu können, daß man ihn seziert nach dem Tode, als Leichnam, so kommt man natürlich nicht dazu, den Menschen wirklich zu verstehen. Ebensowenig kann man die Dinge, die um uns herum sind, die Welt, verstehen, wenn man sie nur so betrachtet, daß man Steine, Pflanzen sammelt und die einzelnen Sachen anschaut. Man muß überall eben darauf Rücksicht nehmen können, daß dasjenige, was man untersucht, nicht im allerersten Anblick schon zeigt, was es eigentlich ist.
Wenn wir einen Leichnam anschauen - wir können ihn ja anschauen, kurz nachdem der Mensch gestorben ist: er hat noch dieselbe Form, dieselbe Gestalt, ist vielleicht nur blasser geworden; wir merken ihm an, der Tod hat ihn ergriffen, aber er hat noch dieselbe Gestalt, die der Mensch hatte, als er lebendig war. Nun denken Sie sich aber: Wie schaut dieser Leichnam, auch wenn wir ihn nicht verbrennen, wenn wir ihn verwesen lassen, nach einiger Zeit aus? Er wird zerstört, es arbeitet nichts mehr in ihm, was ihn wieder aufbauen könnte - er wird zerstört.
Nun, sehen Sie, der Anfang der Bibel wird sehr häufig von den Leuten belächelt, und zwar mit Recht, wenn er so ausgelegt wird, daß
einstmals irgendein Gott aus einem Erdenkloß einen Menschen geformt hätte. Man sieht das als eine Unmöglichkeit an - mit Recht natürlich. Es kann nicht irgendein Gott kommen und aus einem Erdenkloß einen Menschen machen. Er wird ebensowenig ein Mensch, wie eine Bildhauerstatue ein wirklicher Mensch wird, wenn man sie auch noch so sehr der Gestalt nach richtig macht, und ebensowenig, wie, wenn Kinder ein schönes Männchen aufbauen, dieses anfängt zu laufen. Also man lächelt mit Recht darüber, wenn Leute sich vorstellen, daß ursprünglich ein Gotteswesen aus einem Erdenkloß einen Menschen gemacht haben soll. Das, was wir als Leichnam vor uns haben, das ist ja nach einiger Zeit nun wirklich solch ein Erdenkloß, wenn es auch im Grab so ein bißchen auseinandergegangen ist, verschwemmt worden ist und so weiter. Zu glauben, daß wir aus dem also, was wir so vor uns haben, einen Menschen machen können, ist ja ein ebenso großer Unsinn.
Sehen Sie, auf der einen Seite gestattet man sich heute mit Recht, zu sagen, daß die Vorstellung unrichtig ist, daß der Mensch aus einem Erdenkloß geschaffen sein soll. Auf der anderen Seite gestattet man sich aber dann das andere: zu denken, daß der Mensch aus demjenigen bestehen soll, was Erde ist. Sie sehen schon, wenn man konsequent vorgehen will, geht das eine ebensowenig wie das andere. Man muß sich eben klar sein: Während der Mensch gelebt hat, ist etwas in ihm, was machte, daß er diese Form, diese Gestalt kriegte, und wenn das draußen ist, kann er nicht mehr diese Gestalt haben. Die Naturkräfte geben ihm nicht diese Gestalt; die Naturkräfte treiben diese Gestalt nur auseinander, machen sie nicht wachsen. Also ist es beim Menschen so, daß wir zurückgehen müssen zu dem Geistig-Seelischen, das ihn eigentlich beherrscht hat, solange er gelebt hat.
Nun, wenn wir draußen den toten Stein anschauen, aus dem toten Stein herauswachsen sehen die Pflanzen und so weiter: Ja, meine Herren, wenn man sich vorstellt, daß das immer so gewesen ist, so wie es heute draußen ist, so ist das geradeso, als wenn Sie etwa von einem Leichnam sagen, der war immer so, solange der Mensch auch gelebt hat. Dasjenige, was wir als Steine heute draußen in der Welt erblicken, was also Felsen sind, Berge sind, das ist ja geradeso wie ein Leichnam. Das ist auch ein Leichnam! Das war nicht immer so. Und geradeso wie
der Leichnam von einem Menschen nicht immer so war, wie er nun daliegt, nachdem das Geistig-Seelische draußen ist, so war auch dasjenige, was wir draußen erblicken, nicht immer so. Daß die Pflanzen wachsen auf dem toten Leichnam, nämlich dem Gestein, das braucht uns nicht zu verwundern; denn wenn der Mensch verwest, wachsen auch allerlei kleine Pflänzchen und allerlei Tierzeug aus seinem verwesenden Leichnam heraus.
Nicht wahr, daß uns das eine, das wir da draußen in der Natur haben, schön erscheint, und daß wir das, was wir am Leichnam sehen, wenn da allerlei Schmarotzerpflanzen herauswachsen, nicht schön finden, das kommt ja nur davon, weil das eine riesig groß und das andere klein ist. Wenn wir statt Menschen ein kleines Käferchen wären und auf einem verwesenden Leichnam herumgehen würden, und ebenso denken könnten wie die Menschen, so würden wir die Knochen des Leichnams als Felsen empfinden.Wir würden in dem, was dadrinnen verwest, Schutt und Gestein finden, würden da, weil wir ein kleines Käferchen wären, in dem, was da herauswächst, große Wälder sehen, würden da eine ganze Welt bewundern, sie nicht so schrecklich finden wie jetzt.
So wie wir zurückgehen müssen beim Leichnam auf dasjenige, was der Mensch war, bevor er gestorben ist, so müssen wir zurückgehen bei alledem, was Erde ist und unsere Umgebung, auf dasjenige, was einmal in alldem heute Toten gelebt hat, bevor eben die Erde im Großen gestorben ist. Und ehe die Erde nicht im Großen gestorben ist, konnte es keine Menschen geben. Die Menschen sind eigentlich gewissermaßen Schmarotzer auf der Erde. Die ganze Erde hat einmal gelebt, hat gedacht - alles mögliche war sie. Und erst, als sie Leichnam wurde, konnte sie das Menschengeschlecht schaffen. Das ist etwas, was eigentlich jeder einsehen kann, der nur wirklich denkt. Nur will man heute nicht denken. Aber man muß eben denken, wenn man auf die Wahrheit kommen will. So daß wir uns also vorzustellen haben: Dasjenige, was heute festes Gestein ist, wo Pflanzen herauswachsen und so weiter, das war ursprünglich durchaus nicht so, wie es heute ist, sondern wir haben es ursprünglich zu tun mit einem lebendigen, denkenden Weltkörper -mit einem lebendigen, denkenden Weltkörper!
Ich habe oft, auch schon zu Ihnen, gesagt: Da stellt man sich heute -was vor? Man stellt sich vor, daß ursprünglich ein riesiger Urnebel da war, daß dieser Urnebel in Drehung gekommen ist, daß sich dann abgespalten haben die Planeten, daß in der Mitte die Sonne geworden ist. Dies wird den Kindern schon ganz von früh äuf beigebracht. Und man macht ihnen auch einen kleinen Versuch vor, aus dem das hervorgehen soll, daß wirklich auf diese Weise alles entstanden ist. Da wird ein kleines Öltröpfchen genommen auf ein Glas Wasser, ein Kartenblatt, eine Nadel hineingesteckt, und weil das Öl auf dem Wasser schwimmt, läßt man das so drauf schwimmen. Mit der Nadel dreht man dann das Kartenblatt, und da spalten sich kleine Öltröpfchen ab, drehen sich weiter, und es entsteht wirklich ein kleines Planetensystem, in der Mitte drinnen mit der Sonne. - Nun ja, es ist ja ganz gut, wenn man auch sich selbst vergessen kann; aber der Schullehrer sollte in diesem Falle nicht sich selbst vergessen, sondern wenn er das macht, sollte er auch den Kindern sagen: Es ist da draußen ein riesiger Schulmeister im Weltenraum, der das gedreht hat! - Das ist eben die Geschichte:
man wird gedankenlos - nicht deshalb, weil die Tatsachen einem befehlen, gedankenlos zu sein, sondern weil man es will. Aber dadurch kommt man nicht zur Wahrheit. Wir müssen uns also vorstellen, daß da nicht ein riesiger Schulmeister war, der den Weltennebel gedreht hat, sondern daß in diesem Weltennebel selber etwas drinnen war, was sich bewegen konnte und so weiter. Da sind wir aber wiederum beim Lebendigen. Wenn wir uns selber drehen wollen, da brauchen wir nicht eine Nadel durch uns durchgesteckt, durch die der Schulmeister uns dreht; das paßt uns gar nicht - wir können uns selber drehen. Ein solcher Urnebel müßte vom Schulmeister gedreht werden. Ist er aber lebendig und kann er empfinden, denken, dann braucht er nicht den Weltenschulmeister, sondern dann kann er die Drehung selber bewirken.
Nun müßten wir uns also vorstellen: Dasjenige, was heute tot um uns herum ist, das war einstmals lebendig, war empfindsam, war ein Weltwesen, wenn wir dann weiter untersuchen, sogar eine große Anzahl von Weltwesen, und diese Weltwesen, die belebten das Ganze. Und die ursprünglichen Zustände der Welt rühren also davon her, daß im Stoff ein Geistiges drinnen gewesen ist.
Sehen Sie, was liegt nun allem zugrunde, was irgendwie stofflich ist? Denken Sie, ich habe einen Bleiklumpen in der Hand, ein Stück Blei. Das ist fester Stoff, richtiger fester Stoff. Ja, aber wenn ich auf ein glühendes Eisen oder auf irgend etwas Glühendes, auf Feuer, dieses Blei lege, so wird es flüssig. Und wenn ich es noch weiter mit Feuer bearbeite, so verschwindet mir das ganze Blei, es verdunstet dann, ich sehe nichts mehr davon. So ist es aber bei allen Stoffen. Wovon hängt es denn ab, daß ich einen festen Stoff habe? Es hängt davon ab, welche Wärme in ihm ist. Wie er ausschaut, hängt nur davon ab, welche Wärme in einem Stoffe ist.
Sie wissen, heute kann man schon die Luft flüssig machen; dann hat man flüssige Luft. Luft, wie wir sie in unserer Umgebung haben, ist ja nur luftförmig, gasförmig, solange eine bestimmte Wärme da ist. Und Wasser - Wasser ist flüssig, kann aber auch Eis sein, fest sein. Wenn man eine ganz bestimmte Kältetemperatur auf unserer Erde hätte, so gäbe es kein Wasser, sondern Eis. Nun, gehen wir aber in unsere Berge hinein: Wir finden da das feste Granitgestein zum Beispiel, anderes festes Gestein. Ja, wenn es übermäßig warm wäre, dann wäre festes Gestein, Granit, nicht da, sondern der wäre flüssig, flösse dahin, wie in unseren Bächen das Wasser.
Also, was ist denn das Ursprüngliche, was macht, daß irgend etwas fest oder flüssig oder luftförmig ist? Das macht die Wärme! Und ohne daß die Wärme zunächst da ist, kann überhaupt nichts fest oder flüssig sein. Wärme muß irgendwie tätig sein. Daher können wir sagen: Dasjenige, was ursprünglich allem zugrunde liegt, ist die Wärme oder das Feuer.
Und das zeigt auch die Geisteswissenschaft, die anthroposophische Forschung. Diese Geisteswissenschaft, diese anthroposophische Forschung zeigt, daß nicht ein Urnebel ursprünglich da war, ein toter Urnebel, sondern daß lebendige Wärme ursprünglich da war, einfach Wärme, die da gelebt hat.
Also, ich will annehmen einen ursprünglichen Weltenkörper, Wärme, die gelebt hat (siehe Zeichnung Seite 17, rot). Ich habe in meiner «Geheimwissenschaft im Umriß» diesen ursprünglichen Zustand - nicht wahr, auf Namen kommt es nicht an, man muß einen Namen haben -
so genannt, wie er vor alten Zeiten genannt worden ist: Saturnzustand. Es hat schon etwas zu tun mit dem Weltenkörper Saturn, aber das wollen wir jetzt nicht berühren.
In diesem ursprünglichen Zustand, da gab es noch keine festen Körper, keine Luft gab es dadrinnen, sondern nur Wärme; aber die Wärme lebte. Wenn Sie heute frieren - ja, Ihr Ich friert; wenn Sie heute schwitzen, wenn es Ihnen recht warm ist, wird Ihr Ich schwitzen, dem wird es recht warm. Und so sind Sie in der Wärme drinnen, bald im Warmen, bald im Kalten, aber immer in irgendeiner Wärme sind Sie drinnen. So daß wir auch heute noch sehen am Menschen: er lebt ja in der Wärme. Der Mensch lebt durchaus in der Wärme.
Wenn also die heutige Wissenschaft sagt: Ursprünglich war eine hohe Wärme da-, dann hat sie in einem gewissen Sinne recht; wenn sie aber meint, daß diese hohe Wärme tot war, so hat sie unrecht, denn es war ein lebendes Weltenwesen da, ein richtiges lebendes Welten-wesen.
Nun, das erste, was eingetreten ist mit dem, was da ein warmes Weltenwesen war, das war ja Abkühlung. Abkühlen tun sich ja die Dinge fortwährend. Und was entsteht, wenn sich irgend etwas, in dem man noch nichts unterscheiden kann als nur Wärme, abkühlt? Da entsteht Luft. Die Luft ist das erste, was entsteht - Gasiges. Denn wenn wir einen festen Körper immer weiter erhitzen, bildet sich in der Wärme das Gas; wenn aber etwas, was noch nicht Stoff ist, von oben herunter sich abkühlt, so bildet sich zunächst die Luft. So daß wir also sagen können: Das zweite, was sich da bildet, ist Luftiges, (siehe Zeichnung Seite 17, grün) richtiges Luftiges. Und dadrinnen, also in dem, was sich gewissermaßen als zweiter Weltenkörper gebildet hat, da ist alles aus Luft. Da ist noch kein Wasser, und da ist noch kein fester Körper drinnen. Da ist alles aus Luft.
Jetzt haben wir schon den zweiten Zustand, der sich im Laufe der Zeit gebildet hat. Und in diesem zweiten Zustand, da entsteht - aber neben dem, was ursprünglich da war - schon etwas anderes. Die heutige Sonne ist nicht so, ich habe aber doch in meiner «Geheimwissen-schaft» das Sonne genannt, eine Art Sonnenzustand, weil es ein warmer Luftnebel war. Ich habe Ihnen auch schon gesagt: Die heutige Sonne
ist das nicht; aber die ist auch nicht das, was ursprünglich dieser zweite Weltenkörper war. So also bekommen wir einen zweiten Weltenkörper, der sich aus dem ersten heraus bildet; der erste ist bloß warm, der zweite ist schon luftförmig.
Nun aber, in der Wärme kann der Mensch als Seele leben. Wärme macht auf die Seele den Eindruck der Empfindung, aber sie zerstört die Seele nicht. Sie zerstört aber das Körperliche. Wenn ich also ins Feuer geworfen werde, so wird mein Körper zerstört. Meine Seele wird dadurch, daß ich ins Feuer geworfen werde, nicht zerstört. Darüber werden wir noch genauer reden, denn die Frage erfordert natürlich Ausführliches. Nun, deshalb konnte auch der Mensch als Seele schon leben, als nur dieser erste Zustand, der Saturnzustand da war.
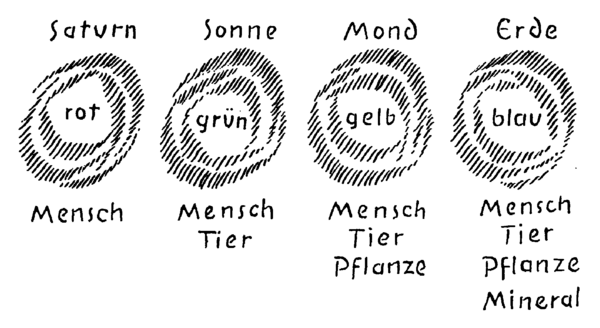
Da konnte der Mensch schon leben. Das Tier konnte da noch nicht leben, aber der Mensch konnte da schon leben. Das Tier konnte da noch nicht leben, weil beim Tiere, wenn das Körperliche zerstört wird, das Seelische mit beeinträchtigt wird. Beim Tier hat das Feuer auf das Seelische einen Einfluß. So daß wir bei diesem ersten Zustande annehmen: Der Mensch ist schon da, das Tier noch nicht. Als diese Umwandlung (Sonnenzustand) stattgefunden hat, war Mensch und Tier da. Das ist eben das Merkwürdige, daß nicht eigentlich die Tiere ursprünglich
da waren und der Mensch aus ihnen entstanden ist, sondern daß der Mensch ursprünglich da war und nachher die Tiere, die sich gebildet haben aus demjenigen, was nicht Mensch werden konnte. Der Mensch war natürlich nicht so als ein Zweifüßler herumgehend da, als nur Wärme da war, selbstverständlich nicht. Er lebte in der Wärme, war ein schwebendes Wesen, lebte nur im Wärmezustand. Dann, als sich das umwandelte und ein luftförmiger Wärmekörper entstand, da bildeten sich neben dem Menschen die Tiere, da traten die Tiere auf. Also die Tiere sind schon verwandt mit dem Menschen, aber sie entstehen eigentlich erst später als der Mensch entstehen kann im Lauf der Weltentstehung.
Was tritt jetzt weiter ein? Weiter tritt das ein, daß die Wärme noch mehr abnimmt. Und wenn die Wärme noch mehr abnimmt, dann bildet sich nicht nur Luft, sondern auch Wasser. So daß wir also einen dritten Weltenkörper haben (Zeichnung, gelb). Ich habe ihn - aus dem Grunde, weil er ähnlich sieht unserem Mond, aber doch nicht dasselbe ist - Mond genannt. Er ist nicht dasselbe wie der heutige Mond, aber etwas Ähnliches. Da haben wir also einen wasserigen Körper, einen richtig wässerigen Körper. Natürlich bleiben Luft und Wärme dabei, aber was da noch nicht vorhanden war beim zweiten Weltenkörper, das Wasser, das tritt jetzt auf. Und jetzt, weil Wasser auftritt, kann da sein: der Mensch, der schon früher da war, das Tier, und aus dem Wasser heraus schießen die Pflanzen auf, die ursprünglich nicht in der Erde wuchsen, sondern im Wasser wuchsen. Also da schießen heraus Mensch, Tier und Pflanze.
Sehen Sie, die Pflanzen wachsen ja scheinbar aus der Erde heraus. Wenn aber die Erde gar kein Wasser enthält, dann wachsen keine Pflanzen heraus; die Pflanze braucht zu ihrem Wachstum eben das Wasser. Es gibt ja auch Wasserpflanzen. So müssen Sie sich die ursprünglichen Pflanzen vorstellen wie die heutigen Wasserpflanzen -sie schwammen im Wasser drinnen -, wie Sie sich auch die Tiere vorstellen müssen mehr als schwimmende Tiere, und gar hier, im zweiten Zustand, mehr als fliegende Tiere.
Von allem, was ursprünglich da war, ist eben etwas zurückgeblieben. Weil ursprünglich, als der Sonnenzustand da war, als nur Mensch
und Tier da war, alles nur fliegen konnte - denn es war ja nichts zum Schwimmen da, es konnte nur alles fliegen -, und weil die Luft zurückgeblieben ist, auch jetzt noch, haben diese fliegenden Wesen Nachkommen gefunden. Unser heutiges Vogelgeschlecht, das sind die Nachkommen der ursprünglichen Tiere, die da entstanden sind im Sonnen-zustand. Nur waren sie dazumal nicht so wie heute. Dazumal waren sie nur aus Luft bestehend; luftartige Wolken waren diese Tiere. Hier (Mondenzustand) haben sie sich dann das Wasser eingegliedert. Und heute, meine Herren - ja, schauen wir uns nur einmal einen Vogel an! Der Vogel wird heute zum größten Teil recht gedankenlos angeschaut. Wenn wir die Tiere, die da vorhanden waren während des Sonnenzustandes, uns vorstellen sollen, müssen wir sagen: Die waren nur aus Luft; die waren schwebende Luftwolken. Wenn man sich heute einen Vogel anschaut: Dieser Vogel hat hohle Knochen, und in den hohlen Knochen ist überall Luft drinnen! Es ist sehr interessant, den heutigen Vogel auf das hin anzuschauen (es wird gezeichnet): Uberall drinnen in diesem Vogel, in die Knochen hinein, überall hinein ist Luft. Denken Sie sich weg alles, was nicht Luft ist, so kriegen Sie nur ein Luftiges:
den Vogel. Und hätte er nicht diese Luft, so könnte er überhaupt nicht fliegen. Der Vogel hat hohle Knochen, und dadrinnen ist er ein Luft-vogel. Das erinnert noch an den Zustand, wie es früher war. Das andere hat sich erst ringsherum gebildet in der späteren Zeit. Die Vögel sind wirklich die Nachkommen dieses Zustandes.
Schauen Sie sich den heutigen Menschen an: Er kann in der Luft leben; fliegen kann er nicht, dazu ist er zu schwer. Er hat nicht wie der Vogel hohle Knochen gebildet, sonst könnte er auch fliegen. Und dann würden sich nicht bloß Schulterblätter bei ihm finden, sondern die Schulterblätter würden auslaufen in Flügel. Der Mensch hat nur noch die Ansätze von Flügeln da oben in den Schulterblättern; wenn die auswachsen würden, würde der Mensch fliegen können.
Also der Mensch lebt in der umgebenden Luft. Diese Luft muß aber Wasserverdunstung enthalten. In der bloß trockenen Luft kann der Mensch nicht leben. Also Flüssigkeit muß da sein und so weiter. Aber es gibt ja einen Zustand, in dem der Mensch nicht in der Luft leben kann: das ist der Zustand während der Keimeszeit, während der Embryonalzeit.
Man muß sich also diese Dinge nur richtig anschauen. Während der Embryonalzeit bekommt dasjenige, was Menschenkeim ist - man nennt es Menschenembryo -, die Luft und alles, was es braucht, aus dem Leib der Mutter. Da muß es sein in einem Lebendigen drinnen.
Nun sehen Sie, die Sache ist aber so: Wenn der Mensch als Keim-wesen noch im Leibe der Mutter ist und herausoperiert wird, da kann er noch nicht in der Luft leben. Während des Keimzustandes ist also der Mensch darauf angewiesen, in einer lebendigen Umgebung zu leben. Und in diesem Zustand, wo es zwar Mensch, Tier und Pflanze gab, wo es jedoch noch nicht so war wie in der heutigen Welt, weil es da noch keine Steine gab, keine Mineralien, da war noch immer alles lebendig, da lebte der Mensch in diesem Lebendigen drinnen, geradeso wie er heute im Mutterleibe lebt. Nur wuchs er natürlich größer aus. Denken Sie sich, wenn wir nicht geboren werden müßten und in der Luft leben müßten, selber atmen müßten, so würde ja unsere Lebenszeit mit der Geburt zu Ende sein. Wir könnten als Embryo, als Keim nur zehn Mondmonate leben. Es gibt ja solche Wesen, die nur zehn Mondmonate leben; die würden nicht an die äußere Luft herankommen, sondern aus dem Inneren, aus dem Lebendigen das bekommen. So war es mit dem Menschen vor langer Zeit. Er wurde zwar älter, aber er kam nie aus dem Lebendigen heraus. Wäre dieser Zustand geblieben, er lebte noch immer darin. Der Mensch schritt nicht vor bis zur Geburt, sondern er lebte als Keim. Und dann war noch kein Mineral da, kein Stein da.
Wenn Sie heute den Menschen sezieren, so haben Sie seine Knochen; dadrinnen finden Sie ebenso den kohlensauren Kalk, wie Sie ihn hier finden im Jura. Da ist zwar das Mineral drinnen - das war damals noch nicht drinnen -, aber im Embryo, namentlich in den ersten Monaten, ist auch noch kein Mineral eingelagert, sondern da ist alles noch geformte Flüssigkeit, nur ein bißchen verdicklicht. Und so war es während dieses Zustandes, daß der Mensch noch nicht knochig war, sondern höchstens nur knorpelig war. Und so haben wir hier einen Menschen, an den uns nur noch dasjenige erinnert, was heute Menschenkeim ist. Warum kann der Menschenkeim nicht gleich außer dem
Leibe der Mutter entstehen? Weil heute die Welt eine andere geworden ist. Während der alte Mond bestanden hat - ich will es jetzt den alten Mond nennen, es ist nicht der heutige Mond, sondern das, was die Erde früher war -, während der alte Mond bestanden hat, war die ganze Erde ein Mutterleib, innerlich lebendig, ein richtiger Mutter-leib. Und Steine und Mineralien gab es noch nicht. Alles war ein riesiger Mutterleib. So daß wir sagen können: Unsere heutige Erde ist aus diesem riesigen Mutterleib hervorgegangen.
Noch früher, da war überhaupt auch dieser riesige Mutterleib nicht da; sondern noch früher, was war denn da vorhanden? Ja, noch früher, war eben, ich möchte sagen, das Frühere. Jetzt überlegen wir uns einmal, was das Frühere ist! Sehen Sie, der Mensch, wenn er im Mutter-leibe entstehen soll, wenn er ein Menschenkeim werden soll, muß ja zuerst empfangen werden. Da findet die Konzeption, die Empfängnis statt. Aber geht denn der Konzeption nicht etwas voraus? Der Konzeption geht voraus dasjenige, was bei der Frau die monatliche Periode ist. Da findet im weiblichen Organismus ein ganz besonderer Vorgang statt, der mit Ausstoßung von Blut verknüpft ist. Aber das ist ja nicht das einzige. Das ist ja nur das Physische davon, wenn das Blut ausgestoßen wird. Jedesmal, wenn das Blut ausgestoßen wird, wird etwas Geistig-Seelisches, etwas, was geistig-seelisch bleibt, mitgeboren, das es nur nicht, weil keine Empfängnis stattfindet, bis zum physischen Körper bringt, sondern das geistig-seelisch bleibt, ohne daß es zum physischen Menschenkörper wird. Dasjenige, was da vor der Empfängnis schon da sein muß, das war während des Sonnenzustandes da! Da war die ganze Sonne, diese ganzen Vorgänge der Erde, noch ein Weltenwesen, das von Zeit zu Zeit ein Geistiges ausstieß. Und so lebten Mensch und Tier im luftförmigen Zustande, ausgestoßen von diesem ganzen Körper. So daß also zwischen diesem Zustand (siehe Zeichnung, Sonne) und diesem Zustand (Mond) das eintritt, daß überhaupt der Mensch ein physisches Wesen wurde im Wasser. Vorher war er ein physisches Wesen nur in der Luft. Auch während dieses Zustandes (Mond), da war es zum Beispiel so, daß etwas Ähnliches da war wie die Empfängnis, aber noch nicht etwas Ähnliches wie die Geburt. Und wie war diese Empfängnis, währenddem dieser alte Mondenzustand da war?
Ja, meine Herren, der Mond ist da ein ganz weibliches Wesen; diesem ganz weiblichen Wesen, dem stand nicht gegenüber zunächst ein männliches Wesen, aber es stand ihm gegenüber alles, was außerhalb seines Weltenkörpers in der Zeit noch da war. Dieser Weltenkörper war ja da; aber außer ihm waren auch viele andere Weltenkörper; die hatten einen Einfluß. Und jetzt kommt die Zeichnung heraus, die ich schon einmal da gemacht habe.
Also es war da dieser Weltenkörper, ringsherum die anderen Weltenkörper, und diese hatten Einfluß in der verschiedensten Weise; von außerhalb kamen die Keime herein und befruchteten die ganze Mond-erde. Und wenn einer von Ihnen damals schon hätte leben können und hingekommen wäre und er hätte diesen ursprünglichen Weltenkörper betreten, so würde er nicht gesagt haben, wenn er wahrgenommen hätte: Da herein kommen allerlei Tropfen -, er würde nicht gesagt haben: Es regnet - heute sagen Sie: Es regnet -, damals würden Sie gesagt haben: Die Erde wird befruchtet! - Und so gab es Jahreszeiten, wo von überallher die Befruchtungskeime kamen, und andere Jahreszeiten, wo die Sache ausreifte, wo die Befruchtungskeime nicht kamen. So daß also dazumal eine Weltbefruchtung war. Aber der Mensch wurde nicht geboren, sondern nur befruchtet; er wurde nur durch Empfängnis hervorgerufen, und die Menschen kamen eben aus dem Ganzen des Erdenkörpers, wie er dazumal als Mondkörper war, heraus. Und ebenso wirkte die Befruchtung für Tier und Pflanzen aus der ganzen Weltumgebung herein.
Nun, sehen Sie, aus alledem, was da jetzt lebt als Mensch, Tier und Pflanze, aus alldem entsteht durch weitere Abkühlung eine spätere Verhärtung. Da (Mondenzustand) haben wir es noch mit Wasser zu tun, und höchstens durch weitere Abkühlung eine spätere Verhärtung. Da (Erde) kommt das Feste heraus, das Mineralische. So daß wir einen vierten Zustand haben (siehe Zeichnung Seite 17, blau): der ist unsere Erde, so wie wir sie heute haben, und der enthält Mensch, Tier, Pflanze, Mineral.
Meine Herren, betrachten wir jetzt einmal, wie es auf der Erde geworden ist, sagen wir mit einem Vogel. Der Vogel war hier noch, während der Zeit (im Sonnenzustand), ein reiner Luftibus, da bestand
er nur aus Luft, als solche Luftmasse schwebte er dahin. Jetzt während dieser Zeit (Mondenzustand) wird er wässerig, dicklich-wässerig, und es schwebten eisartige Wolken dahin - nur nicht wie unsere Wolken sind, sondern so, daß die Gestalt schon drinnen war. Was bei uns nur ungeformte Wasserbildungen sind, das waren dazumal geformte Wasserbildungen; das hatte so Skelettform, aber es war nur Wasserbildung. Und jetzt kommen die Mineralien; jetzt gliedert sich in dasjenige, was nur Wasserbildung ist, das Mineralische herein, kohlensaurer Kalk, phosphorsaurer Kalk und so weiter. Das geht dem Skelett entlang; da bilden sich die festen Knochen hinein. So haben wir zuerst den Luft-vogel, dann den wässerigen Vogel und zuletzt den festen Erdenvogel.
Beim Menschen konnte das nicht so gehen. Der Mensch konnte sich nicht einfach eingliedern dasjenige, was nur als Mineral entstand während seiner Keimzeit. Der Vogel kann das. Warum kann er das? Sehen Sie, der Vogel, der hat hier (Sonnenzustand) seine Luftgestalt bekommen; er lebt dann den Wasserzustand durch. Jetzt hat er nötig, das Mineralische, während er im Keim ist, nicht zu stark an sich herankommen zu lassen. Denn wenn zu früh dieses Mineral an ihn herankommt, dann wird er eben ein Mineral, dann verhärtet er. Der Vogel ist also jetzt, während er entsteht, noch gewissermaßen wässerig und flüssig; das Mineralische will aber schon heran. Was tut der Vogel? Ja, er weist es zunächst ab, er macht es um sich herum: er macht um sich herum die Eischale! Da ist das Mineralische. Die Eischale bleibt so lange, als der Vogel innerlich das Mineralische von sich fernhalten muß, also flüssig bleiben muß. Woher kommt das beim Vogel? Das kommt beim Vogel daher, daß er erst entstanden ist beim zweiten Zustand der Erde. Wäre er beim ersten dagewesen, so wäre er gegen die Wärme viel empfindlicher, als er es schon ist. Er ist gegen die Wärme nicht so empfindlich, weil er während des ersten Wärmezustandes noch nicht da war. Jetzt kann er dadurch, daß er damals noch nicht da war, die feste Eischale um sich herum bilden.
Der Mensch war während des ersten Wärmezustandes schon da und kann daher das Mineral nicht abhalten, solange er im Keimzustande ist; er kann keine Eischale bilden. Daher muß er anders organisiert werden. Er muß etwas Mineralisches schon aus dem Mutterleibe aufnehmen;
deshalb haben wir die Mineralbildung schon am Ende des Keimzustandes da. Er muß aus dem Mutterleib etwas Mineralisches aufsaugen. Da muß aber doch erst der Mutterleib das Mineral haben, das sich absondern kann. Es muß sich also beim Menschen das Mineralische ganz anders eingliedern als beim Vogel. Der Vogel hat luft-durchsetzte Knochen, wir haben markdurchsetzte Knochen. Wir haben Mark in den Knochen - ganz anders als der Vogel, nicht luftdurchsetzt wie der Vogel. Dadurch, daß wir solches Mark haben, dadurch hat die Mutter eines Menschen die Möglichkeit, innerlich schon Mineralisches an den Menschen abzugeben. Aber in der Zeit, in der nun Mineralisches abgegeben wird, kann der Mensch nicht mehr leben in der mütterlichen Umgebung; da muß er nach und nach geboren werden. Da muß er erst dann herankommen an das Mineralische. Beim Vogel haben wir das Geborenwerden nicht, sondern ein Auskriechen aus der Eischale - beim Menschen das Geborenwerden, ohne daß eine Eischale auftritt. Warum? Weil der Mensch eben früher entstanden ist, so kann bei ihm alles durch Wärme und nicht durch Luft abgemacht werden.
Sie sehen daraus diesen Unterschied, der heute noch da ist, den man heute noch beobachten kann, den Unterschied zwischen einem Ei-Tier und einem solchen Wesen, das wie der Mensch ist oder auch wie die höheren Säugetiere. Dieser Unterschied beruht darauf, daß der Mensch viel älter ist als zum Beispiel das Vogelgeschlecht, vor allen Dingen viel älter ist als die Mineralien. Daher muß er vor der Mineralnatur, wenn er noch ganz jung ist, während seiner Keimzeit im Mutterleib geschützt werden, und es darf ihm nur das zubereitete Mineralische gegeben werden, was durch den mütterlichen Leib kommt. Ja, es muß ihm sogar noch dasjenige, was durch den mütterlichen Leib zubereitet wird an Mineralischem, nach der Geburt eine Zeitlang verabreicht werden in der Muttermilch! Während der Vogel gleich geatzt werden kann mit äußeren Stoffen, muß der Mensch und das höhere Tier genährt werden mit demjenigen, was auch nur durch den mütterlichen Leib kommt.
Und nun ist die Sache so: Dasjenige, was im heutigen Erdenzustand der Mensch hat durch den mütterlichen Leib, das hatte er durch die Luft, durch die Umgebung während des früheren Zustandes. Da war
einfach dasjenige, was der Mensch das ganze Leben hindurch um sich hatte, milchartig. Heute ist unsere äußere Luft so, daß sie Sauerstoff und Stickstoff enthält und verhältnismäßig nur wenig Kohlenstoff und Wasserstoff, und vor allen Dingen sehr, sehr wenig Schwefel. Die sind weggegangen. Wie noch dieser Zustand da war (Mondenzustand), da war es anders; da war in der Umgebung nicht bloß eine Luft, die aus Sauerstoff und Stickstoff bestand, sondern da waren noch dabei Wasserstoff und Kohlenstoff und Schwefel. Das gab aber einen Milchbrei um den Mond herum, um diesen alten Mond, einen ganz dünnen Milch-brei, in dem gelebt wurde. Aber in einem dünnen Milchbrei lebt der Mensch auch heute noch, wenn er ungeboren ist! Denn nachher erst geht, wenn der Mensch geboren ist, die Milch in die Brust herein; vorher geht sie in dem weiblichen Körper in diejenigen Teile hinein, wo der Menschenkeim liegt. Und das ist das Eigentümliche, daß diejenigen Vorgänge, die im mütterlichen Organismus vor der Geburt nach der Gebärmutter hingehen, nachher weiter herauf in die Brüste gehen. Und so haben wir heute noch beim Menschen den Mondzustand erhalten, bevor er geboren wird, und den eigentlichen Erdenzustand von dem Moment an, wo der Mensch geboren wird, wo nur noch das Mondenhafte in der Milchernährung etwas nachdämmert.
So muß man eigentlich die Dinge, die mit der Erdenentstehung und der Menschenentstehung zusarnrnenhängen, erklären. Und es kann der Mensch heute, wenn er nicht an eine Geisteswissenschaft herandringt, sich gar nicht enträtseln, warum der Vogel aus einem Ei ausschlüpft und gleich mit äußeren Stoffen genährt werden kann, während der Mensch nicht aus einem Ei ausschlüpfen kann, sondern aus dem mütterlichen Leibe selber kommen muß und noch mit Muttermilch genährt werden muß. Warum? Ja, weil der Vogel später entstanden ist; er ist also ein äußerliches Wesen. Der Mensch ist früher entstanden und war, als dieser Zustand da war, eigentlich noch nicht so weit verhärtet, als der Vogel es ist. Daher ist er auch heute noch nicht so weit verhärtet, muß noch mehr geschützt werden, hat noch viel mehr von ursprünglichen Zuständen in sich.
Sehen Sie, weil man über so etwas heute überhaupt nicht mehr richtig nachdenken kann, mißversteht man dasjenige, was als Pflanzen,
Tiere und Menschen auf der Erde ist. Da ist der materialistische Darwinismus entstanden, der glaubte, zuerst wären die Tiere dagewesen und dann der Mensch - der hätte sich einfach aus den Tieren entwickelt. Wahr ist an der Sache, daß der Mensch mit den Tieren verwandt ist seiner äußeren Gestalt nach. Aber der Mensch war früher da und das Tier hat sich eigentlich später herausgebildet, als schon ein Verwandlungszustand in der Welt da war. Und so können wir sagen: Die Tiere stellen schon dar einen Zustand von Nachkommenschaft dessen, was früher da war, wo das Tier noch verwandter war mit dem Menschen. Aber wir dürfen uns niemals vorstellen, daß aus den heutigen Tieren heraus Menschen werden können. Das ist eben eine durchaus falsche Vorstellung.
Nun, schauen wir uns jetzt nicht das Vogelgeschlecht an, sondern schauen wir uns das Fischgeschlecht an. Das Vogelgeschlecht war für die Luft entstanden, das Fischgeschlecht, das ist fürs Wasser entstanden. Erst als dieser Zustand da war, den ich da den Mondenzustand nenne, erst da bildeten sich gewisse frühere luftartige Vogelwesen so um, daß sie durch das Wasser fischähnlich wurden. So also kamen zu dem, was hier (auf die Zeichnung deutend) vogelartig war, die Fische dazu. Die Fische sind, ich möchte sagen, verwässerte Vögel, vom Wasser aufgenommene Vögel. Wir können daraus ablesen, daß die Fische später entstanden sind wie die Vögel; sie sind erst entstanden, als schon das wässerige Element da war. Die Fische entstehen also während der alten Mondenzeit.
Und jetzt werden Sie sich auch gar nicht mehr verwundern: Was überhaupt da wässerig herumschwamm während der alten Mondenzeit, das schaute alles fischähnlich aus. Die Vögel schauten ja früher auch, trotzdem sie in der Luft flogen, fischähnlich aus, nur daß sie eben leichter waren. Und alles schaute fischähnlich aus in der alten Mondenzeit. Und nun ist es interessant, meine Herren, wenn wir heute einen Menschenkeim anschauen, so am einundzwanzigsten, zweiund-zwanzigsten Tage nach der Befruchtung - wie schaut er denn da aus? Da schwimmt er in diesem Wässerigen drinnen, das im Mutterleibe ist, und ausschauen tut er nämlich dann so (es wird gezeichnet): richtig wie ein kleines Fischlein! Diese Gestalt, die der Mensch richtig hatte während
der Mondenzeit, die hat er da noch in der dritten Woche der Schwangerschaft; die hat er sich bewahrt.
So daß Sie also sagen können: Der Mensch arbeitet sich erst heraus aus dieser alten Mondgestalt, und wir können es heute noch an dieser Fischgestalt sehen, die er im Mutterleibe hat, wie er sich da heraus-arbeitet. Überall, wenn wir die heutige Welt beobachten, können wir sehen, wie das frühere Leben war - so wie wir wissen, daß bei einem Leichnam das frühere Leben da war. So schilderte ich Ihnen ja heute dasjenige, was mineralisch auf der Erde entstanden ist, wie es früher war. Geradeso wie wir beim Leichnam sehen: er kann die Beine nicht mehr bewegen, die Hände nicht mehr bewegen, der Mund kann nicht mehr aufgemacht werden, die Augen nicht mehr aufgeschlagen werden, es ist alles unbeweglich geworden - das führt uns aber zurück in einen Zustand, wo alles beweglich war, die Beine beweglich, die Arme beweglich, die Hände beweglich, die Augen konnten aufgetan werden -, geradeso schauen wir hier auf einen Erdenleichnam, der übrig ist von einem Lebendigen, in dem die Menschen noch herumwandeln und die Tiere, und wir schauen zurück, wie die ganze Erde einmal lebendig war.
Aber es geht noch weiter, meine Herren. Sehen Sie, ich sagte Ihnen:
Wenn die Empfängnis da ist, so ist die Anlage zum physischen Menschen da, so bildet sich allmählich der Embryo. Was dem vorangeht, das habe ich Ihnen geschildert: Alles, was im weiblichen Organismus vorgeht, was sich in der Periode abstößt, was aber im Geiste auch zu einem Ausstoßen wird. Ja, bei diesem Vorgang ist immer etwas - wenn es auch bei gesunden Frauen nicht bemerkbar wird, wenn sie sich auch aufrecht erhalten, wenn sie gesunde Frauen sind -, aber es ist immer etwas von Fieber vorhanden, richtig etwas von Fieber vorhanden. Warum denn? Ja, weil ja ein Wärmezustand da ist; da lebt die Frau in der Wärme. Was ist das für ein Wärmezustand?
Das ist derjenige Wärmezustand, der sich erhalten hat von diesem alten ersten Zustand, den ich hier Saturn genannt habe! Da lebt noch dieser Fieberzustand fort. So daß wir sagen können: Diese ganze Entwikkelung ging aus von einer Art Fieberzustand unserer Erde, und die Abkühlung, die brachte erst dieses Fieber fort. Heute sind die meisten Menschen
durchaus nicht mehr fiebrig, sondern recht trocken und nüchtern. Aber wenn noch etwas, jetzt nicht durch äußere Wärme, aber innerlich auftritt, so daß wir mehr ähnlich werden einem inneren Leben, wie es in der Wärme ist, wenn da innerlich durch die Wärme etwas auftritt, dann kommen wir auch noch ins Fiebrige hinein.
Und so ist es schon, meine Herren: Man sieht überall noch an den Zuständen des heutigen Menschen, wie man zurückgehen kann in alte Zustände. Und so habe ich Ihnen also heute geschildert, wie nach und nach sich entwickelte Mensch, Tier, Pflanze, Mineral, indem der Wel-tenkörper, auf dem sich das entwickelte, immer fester und fester wird. Das wollen wir dann - heute ist Montag - am nächsten Mittwoch um neun Uhr weiter besprechen.
ZWEITER VORTRAG Dornach, 3. Juli 1924
Guten Morgen, meine Herren! Nun will ich heute weiterreden über Erdenschöpfung, Menschenentstehung und so weiter. Es ist Ihnen ja wohl klargeworden aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, daß unsere ganze Erde ursprünglich nicht so war, wie sie sich heute darstellt, wie sie heute ist, sondern sie war eine Art von Lebewesen. Und wir haben ja den vorletzten Zustand vor dem eigentlich irdischen Zustand, den wir besprochen haben, dadurch kennengelernt, daß wir sagen mußten: Wärme war da, Luft war da, Wasser war auch da; aber es war noch nicht eigentliche feste mineralische Erdenmasse da. Nur müssen Sie sich nicht vorstellen, daß das Wasser, das dazumal da war, schon so aussah wie das heutige Wasser. Das heutige Wasser ist ja erst so geworden dadurch, daß diejenigen Stoffe, die vorher im Wasser aufgelöst waren, sich aus dem Wasser heraus abgeschieden haben. Wenn Sie heute nur ein ganz gewöhnliches Glas Wasser nehmen, etwas Salz hineingeben, so löst sich das Salz im Wasser auf; Sie bekommen eine Flüssigkeit, eine Salzlösung, wie man sagt, die viel dicker ist als das Wasser. Wenn Sie hineingreifen, spüren Sie die Salzlösung viel dichter als das Wasser. Nun ist aufgelöstes Salz verhältnismäßig noch dünn. Es können auch andere Stoffe aufgelöst werden; dann kriegt man eine ganz dickliche Flüssigkeit. So daß also dieser Flüssigkeits-, dieser Wasser-zustand, der einmal auf unserer Erde in früheren Zeiten da war, nicht heutiges Wasser darstellt. Das gab es überhaupt dazumal nicht, da in allen Wassern Stoffe aufgelöst waren. Denken Sie doch: Alles dasjenige, was Sie in heutigen Stoffen drinnen haben, das Jurakalkgebirge zum Beispiel, das war aufgelöst dadrinnen; alles dasjenige, was Sie in härteren Gesteinen haben, die Sie nicht mit dem Messer ritzen können - Kalk können Sie immer noch ritzen mit dem Stahlmesser -, das war auch aufgelöst im Wasser. Man hat es also während dieser alten Mondenzeit mit einer dicklichen Flüssigkeit zu tun, in der alle Stoffe, die heute fest sind, aufgelöst enthalten waren.
Das heutige dünne Wasser, das im wesentlichen aus Wasserstoff und
Sauerstoff besteht, das hat sich erst später abgeschieden. Das ist erst entstanden während der Erdenzeit selber. So daß wir also einen ursprünglichen Zustand der Erde haben, der ein verdicklicht Flüssiges darstellt. Und ringsherum haben wir dann auch eine Art von Luft, aber wir haben keine solche Luft gehabt wie heute. Gerade wie das Wasser nicht so ausgeschaut hat wie unser heutiges Wasser, so war auch die Luft nicht so wie unsere heutige. Unsere heutige Luft enthält ja im wesentlichen Sauerstoff und Stickstoff. Die anderen Stoffe, die die Luft noch enthält, sind in sehr geringer Menge noch vorhanden. Es sind sogar Metalle als Metalle eigentlich noch in der Luft vorhanden, aber in furchtbar geringen Mengen. Sehen Sie, es ist zum Beispiel ein Metall, das Natrium heißt, in geringen Mengen in der Luft enthalten; überall, wo wir sind, ist das Natriummetall. Nun denken Sie aber doch, was das heißt, daß Natrium überall ist, das heißt, daß der eine Stoff, der in Ihrem Salz ist, wenn Sie auf dem Tisch Salz haben, in kleinen Mengen überall vorhanden ist.
Sehen Sie, es gibt zwei Stoffe - das eine ist dieser Stoff, den ich ihnen jetzt angeführt habe, das Natrium, das in ganz kleiner Menge überall in der Luft vorhanden ist; und dann gibt es einen Stoff, der gasförmig ist, und der spielt besonders eine große Rolle, wenn Sie Ihre Wäsche bleichen: das ist das Chlor. Das bewirkt das Bleichen. Nun, sehen Sie, das Salz, das Sie auf dem Tisch haben, das besteht aus diesem Natrium und aus dem Chlor, ist aus diesen zusammengesetzt. So kommen die Dinge in der Natur zustande.
Sie können fragen: Ja, wie weiß man, daß Natrium überall ist? -Ja, sehen Sie, es gibt heute schon die Möglichkeit, wenn man irgendwo eine Flamme hat, nachzuweisen, was für ein Stoff in dieser Flamme verbrennt. Wenn Sie zum Beispiel, sagen wir, dieses Natrium, das man metallisch kriegen kann, pulverisieren und in eine Flamme hineinhalten, so können Sie dann mit einem Instrument, das man das Spektroskop nennt, eine gelbe Linie darinnen finden. Es gibt zum Beispiel ein anderes Metall, das heißt Lithium; wenn Sie das in die Flamme hin-einhalten, so bekommen Sie eine rote Linie; da ist die gelbe nicht da, da ist die rote Linie da. Man kann also schon nachweisen mit dem Spektroskop, was für ein Stoff irgendwo vorhanden ist. Die gelbe Natriumlinie
bekornmen Sie fast aus jeder Flamme; das heißt, wenn Sie irgendwo, ohne daß Sie Natrium hineintun, eine Flamme anzünden, so kriegen Sie da die Natriumlinie in jeder Flamme. Also dieses Natrium ist heute noch in einer Flamme. Aber von allen diesen Metallen, namentlich aber vom Schwefel, waren früher riesige Mengen hier in der Luft vorhanden. So daß die Luft in jenem alten Zustand sozusagen höchst schwefelhaltig war, ganz ausgeschwefelt war. Wie wir also ein dickliches Wasser haben - wenn man nicht besonders schwer gewesen wäre, hätte man spazieren gehen können auf diesem Wasser; es ist so wie rinnender Teer zuweilen gewesen -, so ist die Luft auch dicker gewesen, so dick, daß man mit den heutigen Lungen darin nicht hätte atmen können. Die Lungen haben sich aber erst später gebildet. Die Lebensweise derjenigen Wesen, die dazumal da waren, war eine wesentlich andere.
#Bild s. 31
Nun, so müssen Sie sich vorstellen, daß die Erde einmal ausgesehen hat. Hätten Sie sich mit heutigen Augen auf dieser Erde befunden, dann würden Sie auch nicht auf eine solche Ansicht gekommen sein, daß da draußen Sterne sind, Sonne und Mond sind; denn die Sterne hätten Sie nicht gesehen, sondern Sie hätten eben in ein unbestimmtes Luftmeer hineingeschaut, das aufgehört hätte nach einiger Zeit. Man wäre sozusagen, wenn man dazumal mit den heutigen Sinnesorganen hätte leben können, wie in einem Weltenei drinnen gewesen, über das man nicht hinausgesehen hätte. Wie in einem Weltenei drinnen wäre man gewesen! Und Sie können sich schon vorstellen, daß dann auch die
Erde dazumal anders ausgesehen hat: ganz ausgefüllt mit einem riesigen Eidotter, einer dicklichen Flüssigkeit, und mit einer ganz dicklichen Luftumgebung - das ist das, was heute das Eiweiß im Ei darstellt.
Wenn Sie sich das ganz real vorstellen, was ich Ihnen da schildere, so werden Sie sich sagen müssen: Ja, dazumal konnten solche Wesen nicht leben, wie es die heutigen Wesen sind. Denn, natürlich, solche Wesen, wie die heutigen Elefanten und dergleichen, aber auch Menschen in der heutigen Gestalt, die wären da sozusagen versunken; außerdem hätten sie nicht atmen können. Und weil sie da nicht hätten atmen können, haben sie ja auch nicht Lungen in der heutigen Gestalt gehabt. Diese Organe bilden sich ganz in dem Sinne, wie sie gebraucht werden. Das ist das Interessante, daß ein Organ gar nicht da ist, wenn es nicht gebraucht wird. Also Lungen haben sich erst in dem Maße entwickelt, in dem die Luft nicht mehr so schwefelhaltig und metall-reich war, wie sie in dieser alten Zeit war.
Nun, wenn wir uns eine Vorstellung bilden wollen, was für Wesen dazumal gelebt haben, dann müssen wir zuerst diejenigen Wesen aufsuchen, welche in dem dicklichen Wasser gelebt haben. In diesem dicklichen Wasser haben Wesen gelebt, die heute nicht mehr existieren. Nicht wahr, wenn wir heute von unserer gegenwärtigen Fischform reden, so ist diese Fischform da, weil das Wasser dünn ist. Auch das Meerwasser ist ja verhältnismäßig dünn; es enthält viel Salz aufgelöst, aber es ist doch verhältnismäßig dünn. Nun, dazumal war alles mögliche in dieser dicklichen Flüssigkeit, in diesem dicklichen Meere, aus dem eigentlich die ganze Erde, der Mondensack bestanden hat, aufgelöst. Die Wesen, die darinnen waren, die konnten nicht schwimmen, wie die heutigen Fische schwimmen, weil eben das Wasser zu dick war; aber sie konnten auch nicht gehen, denn gehen muß man auf einem festen Boden. Und so können Sie sich vorstellen, daß diese Wesen eine Organisation hatten, einen Körperbau hatten, der zwischen dem, was man braucht zum Schwimmen: Flossen, und dem, was man braucht zum Gehen: Füße, mitten drinnen liegt. Sehen Sie, wenn Sie Flossen haben - Sie wissen ja, wie Flossen ausschauen -, die haben solche stachelige, ganz dünne Knochen (es wird gezeichnet), und dasjenige, was dazwischen ist an Fleischmasse, das ist vertrocknet. So daß wir eine
Flosse haben mit fast gar keiner Fleischmasse daran, mit stacheligen, zu Stacheln umgebildete Knochen - das ist eine Flosse. Gliedmaßen, die dazu dienen, auf Festem sich fortzubewegen, also zu gehen oder zu kriechen, die lassen die Knochen ins Innere zurücktreten und die Fleischmasse bedeckt sie äußerlich. So daß wir solche Gliedmaßen eben so auffassen können, daß sie Fleischmasse außen haben, die Knochen nur im Inneren; da ist die Fleischmasse das Hauptsächlichste. Das (es wird auf die Zeichnung verwiesen) gehört zum Gehen, das gehört zum Schwimmen. Aber weder Gehen noch Schwimmen gab es dazumal, sondern etwas, was dazwischen liegt. Daher hatten diese Tiere auch Gliedmaßen, in denen schon so etwas wie Stacheliges war, aber nicht der reine Stachel, sondern so, daß schon vorhanden war so etwas wie Gelenke. Es waren Gelenke, sogar ganz künstliche Gelenke; dazwischen war aber ausgespannt Fleischmasse wie ein Schirm. Wenn Sie heute noch manche Schwimmtiere anschauen, mit der Schwimmhaut zwischen den Knochen, dann ist das der letzte Rest dessen, was einstmals in höchstem Maße vorhanden war. Da waren Tiere vorhanden, welche ihre Gliedmaßen eben so ausstreckten, daß sie mit der Fleischmasse, die da ausgespannt war, getragen wurden von der dicklichen Flüssigkeit. Und sie hatten schon Gelenke an den Gliedern - nicht so wie die Fische heute, wo man keine Gelenke sieht -, sie hatten Gelenke. Dadurch konnten sie ihr halbes Schwimmen und ihr halbes Gehen dirigieren.
So, sehen Sie, werden wir aufmerksam gemacht auf Tiere, welche in der Hauptsache solche Gliedmaßen brauchen. Uns würden sie heute riesig plump vorkommen, diese Gliedmaßen: sie sind nicht Flossen, nicht Füße, nicht Hände, sondern plumpe Ansätze an dem Leib, aber ganz geeignet, in dieser dicklichen Flüssigkeit zu leben. Das war die eine Art von Tieren. Wenn wir sie weiter beschreiben wollen, so müssen wir sagen: Diese Tiere waren ganz darauf veranlagt, den Körper so auszubilden, daß diese Riesengliedmaßen entstehen konnten. Alles übrige war schwach ausgebildet bei diesen Tieren. Sehen Sie, dasjenige, was heute noch vorhanden ist an Kröten oder an solchen Tieren, die im Sumpfigen, also Dicklich-Flüssigen schwimmen, wenn Sie das nehmen, so haben Sie eben schwache, verkümmerte zaghafte Nachbildungen
von Riesentieren, die einmal gelebt haben, die plump waren, aber verkleinerte Köpfe hatten wie die Schildkröte.
Und in der verdicklichten Luft lebten andere Tiere. Unsere heutigen Vögel haben ja dasjenige annehmen müssen, was sie brauchen, weil sie eben in der dünnen Luft leben; daher mußten sie schon etwas von Lungen ausbilden. Aber die Tiere, die dazumal lebten in der Luft, die hatten keine Lungen, denn in dieser verdicklichten, schwefeligen Luft ging es nicht, mit Lungen zu atmen. Aber sie nahmen doch diese Luft auf, und sie nahmen sie so auf, daß es eine Art von Essen war. Diese Tiere konnten nicht in der heutigen Weise essen, denn es wäre ihnen alles im Magen liegengeblieben. Es war ja auch nichts Festes da zum Essen. Sie nahmen alles das, was sie aufnahmen an Nahrung, aus der verdicklichten Luft auf. Aber wo hinein nahmen sie es auf? Sehen Sie, sie nahmen es auf in dasjenige, was sich in ihnen wieder besonders ausgebildet hat.
Nun, diese Fleischmasse, die da vorhanden war an diesen Schwimmtieren dazumal, an diesen, ich möchte sagen, Gleittieren - denn es war ja nicht ein Gehen, war ja nicht ein Schwimmen -, diese Fleischmasse, die konnten wieder die damaligen Lufttiere nicht brauchen, weil sie ja nicht in der verdicklichten Flüssigkeit schwimmen, sondern in der Luft sich selber tragen sollten. Dieser Umstand, daß sie sich in der Luft selber tragen sollten, der bewirkte da bei diesen Tieren, daß diese Fleischmasse, die sich bei den gleitenden, halb schwimmenden Tieren entwickelte, sich anpaßte den Schwefelverhältnissen der Luft. Der Schwefel vertrocknete diese Fleischmasse und machte sie zu dem, was Sie heute an den Federn sehen. An den Federn ist diese vertrocknete Fleischmasse; es ist ja auch vertrocknetes Gewebe. Aber mit diesem vertrockneten Gewebe konnten diese Tiere wiederum diejenigen Gliedmaßen bilden, die sie brauchten. Es waren nun auch nicht im heutigen Sinne Flügel, aber die trugen sie in dieser Luft; sie waren schon flügel-ähnlich, aber nicht ganz so wie heutige Flügel. Vor allen Dingen waren sie in einem sehr, sehr voneinander verschieden. Sehen Sie, heute ist ja nur etwas noch zurückgeblieben von dem, was dazumal diese merkwürdigen, flügelähnlichen Gebilde hatten: heute ist nur zurückgeblieben das Mausern, wo die Vögel ihre Federn verlieren. Diese Gebilde
also, die noch nicht Federn waren, aber die mehr die vertrockneten Gewebe ausbildeten, mit denen dann diese Tiere sich in der verdicklichten Luft erhielten - diese Gebilde waren eigentlich halb Atmungsorgane, halb Organe zur Aufnahme der Nahrungsmittel. Es wurde dasjenige, was in der Luftumgebung war, aufgenommen. Und so war ein jedes solches Organ, namentlich diejenigen Organe, die nicht zum Fliegen benutzt wurden, die aber auch da waren in ihren Ansätzen, wie der Vogel am ganzen Leib Federn hat. Diese Flügel waren zur Aufnahme der Luft und zum Abscheiden der Luft da. Heute ist davon nur das Mausern zurückgeblieben. Dazumal wurde aber damit genährt, das heißt der Vogel plusterte sein Gewebe auf mit dem, was er hereinsog von der Luft, und dann wiederum gab er das von sich, was er nicht mehr brauchte, so daß ein solcher Vogel schon ein sehr merkwürdiges Gebilde war.
Sehen Sie, in der damaligen Zeit lebten da unten diese furchtbar plumpen Wassertiere - die heutigen Schildkröten sind schon die reinsten Prinzen dagegen; diese Tiere da unten, die waren im flüssigen Element. Da oben waren diese merkwürdigen Tiere. Und während sich die heutigen Vögel da oben in der Luft manchmal unanständig benehmen - was wir ihnen schon übelnehmen, nicht wahr -, haben diese vogelartigen Tiere fortwährend abgeschieden. Und dasjenige, was von ihnen kam, regnete herunter. Besonders in gewissen Zeiten regnete es herunter. Aber die Tiere, die unten waren, die hatten ja noch nicht diese Gewohnheiten, die wir haben; wir sind gleich schrecklich ungehalten, wenn einmal ein Vogel sich etwas unanständig benimmt. So waren diese Tiere, die da unten in dem flüssigen Element waren, nicht; sondern die sogen wiederum auf - in ihren eigenen Körper sogen sie auf dasjenige, was da herunterfiel. Und das war aber zugleich die Befruchtung dazumal. Dadurch konnten diese Tiere, die da entstanden waren, überhaupt nur weiterleben, daß sie das aufnahmen; nur dadurch konnten sie weiterleben. Und wir haben dazumal nicht so ausgesprochen ein Hervorgehen des einen Tieres aus dem anderen gehabt wie jetzt, sondern man möchte sagen, dazumal war es noch so, daß eigentlich diese Tiere lange lebten; sie bildeten sich immer wiederum neu. Es war so ein Weltenmausern, möchte ich sagen; sie verjüngten
sich immer wiederum, diese Tiere da unten. Dagegen die Tiere, die oben waren, die wiederum waren darauf angewiesen, daß zu ihnen dasjenige kam, was die Tiere unten entwickelten, und dadurch wurden diese wiederum befruchtet. So daß die Fortpflanzung dazumal etwas war, was im ganzen Erdenkörper vor sich ging. Die obere Welt befruchtete die untere, die untere Welt befruchtete die obere. Es war überhaupt ein ganzer belebter Körper. Und ich möchte sagen: Dasjenige, was da an solchen Tieren da unten und an Tieren da oben war, war wie die Maden in einem Körper drinnen, wo auch der ganze Körper lebendig ist und die Maden darinnen auch lebendig sind. Es war also ein Leben und die einzelnen Wesen, die drinnen lebten, lebten in einem ganzen lebendigen Körper drinnen.
Später aber ist einmal ein Zustand, ein Ereignis gekommen, das von ganz besonderer Wichtigkeit war. Diese Geschichte hätte nämlich lange fortgehen können; da wäre aber alles nicht so geworden, wie es jetzt auf der Erde ist. Da wäre alles so geblieben, daß plumpe Tiere mit luftfähigen Tieren zusammen einen lebendigen Erdenkörper bewohnt hätten. Aber es ist eines Tages eben etwas Besonderes eingetreten. Sehen Sie, wenn wir diese lebendige Bildung der Erde da nehmen (siehe Zeichnung), so trat das ein, daß sich eines Tages von dieser Erde wirklich, man kann schon sagen, ein Junges bildete, das in den Weltenraum herausging. Diese Sache geschah so, daß da ein kleiner Auswuchs entstand; das verkümmerte da und spaltete sich
#Bild s. 36
zum Schluß ab. Und es entstand statt dem da hier ein Körper draußen im Weltenraum, der das Luftförmige, das da in der Umgebung ist,
innerlich hatte, und außen die dickliche Flüssigkeit hatte. Also ein umgekehrter Körper spaltete sich ab. Während die Mondenerde dabei blieb, ihren innerlichen Kern dickflüssig zu haben, außen dickliche Luft zu haben, spaltete sich ein Körper ab, der außen das Dickliche hat und innen das Dünne. Und in diesem Körper kann man, wenn man nicht mit Vorurteil, sondern mit richtiger Untersuchung an die Sache herangeht, den heutigen Mond erkennen. Heute kann man schon ganz genau wissen, so wie man zum Beispiel das Natrium in der Luft finden kann, aus was die Luft besteht. So kann man ganz genau wissen: Der Mond war einmal in der Erde drinnen! Was da draußen als Mond herumkreist, war in der Erde drinnen und hat sich von ihr abgetrennt, ist hinausgegangen in den Weltenraum.
Und damit ist dann aber eine ganze Veränderung eingetreten sowohl mit der Erde wie mit demjenigen, was hinausgegangen ist. Vor allen Dingen: Die Erde hat da gewisse Substanzen verloren, und jetzt erst konnte sich das Mineralische in der Erde bilden. Wenn die Mondensubstanzen in der Erde drinnen geblieben wären, so hätte sich niemals das Mineralische bilden können, sondern es wäre immer ein Flüssiges und Bewegtes gewesen. Erst der Mondenaustritt hat der Erde den Tod gebracht und damit das Mineralreich, das tot ist. Aber damit sind auch erst die heutigen Pflanzen, die heutigen Tiere und der Mensch in seiner heutigen Gestalt möglich geworden.
Nun können wir also sagen: Es ist aus dem alten Mondenzustand der Erde der heutige Erdenzustand entstanden. Damit ist das Mineral-reich entstanden. Und jetzt haben sich alle Formen ändern müssen. Denn jetzt ist eben gerade dadurch, daß der Mond herausgetreten ist, die Luft weniger schwefelhaltig geworden, hat sich immer mehr und mehr genähert dem heutigen Zustand in der Erde selber. So hat sich auch abgesetzt dasjenige, was in der Flüssigkeit aufgelöst war, und gebirgsartige Einschlüsse gebildet, und das Wasser wurde immer mehr ähnlich unserem heutigen Wasser. Dagegen der Mond, der dasjenige in der Umgebung hat, was wir in der Erde im Inneren haben, der bildete nach außen eine ganz hornartig dickliche Masse; auf die schauen wir hinauf. Die ist nicht so wie unser Mineralreich, sondern die ist so, wie wenn unser Mineralreich hornartig geworden wäre und verglast
wäre, außerordentlich hart, härter als alles Hornartige, was wir auf der Erde haben, aber doch nicht ganz mineralisch, sondern hornartig. Daher diese eigentümliche Gestalt der Mondberge. Diese Mondberge sehen eigentlich ja alle so aus wie Hörner, die angesetzt sind. Sie sind so gebildet, daß man das Organische darinnen, dasjenige, was einmal mit dem Leben zusammenhing, eigentlich an ihnen wahrnehmen kann.
Nun, sehen Sie, es setzte sich also von diesem Zeitpunkt an, wo der Mond hinausging, aus der damaligen dicklichen Flüssigkeit immer mehr und mehr das heutige Mineralreich ab. Da wirkte insbesondere ein Stoff, der in diesen alten Zeiten riesig stark vorhanden war, ein Stoff, der aus Kiesel und Sauerstoff besteht und den man Kieselsäure nennt. Sehen Sie, Sie haben die Vorstellung, eine Säure muß - weil das bei einer heutigen Säure, die man verwendet, eben so ist -, eine Säure muß etwas Flüssiges sein. Aber die Säure, die eine richtige Säure ist und die ich hier meine, die ist etwas ganz Festes! Das ist nämlich der Quarz, den Sie im Hochgebirge finden; denn der Quarz ist Kieselsäure. Und wenn er weißlich und glasartig ist, so ist er sogar reine Kieselsäure; wenn er irgendwelche andere Stoffe enthält, dann bekommen Sie diese Quarze, die violettlich und so weiter sind. Das ist von den Stoffen, die drinnen eingeschlossen sind.
Aber dieser Quarz, der heute so dick ist, daß Sie ihn nicht mit dem Stahlmesser ritzen können, daß Sie sich schon ordentliche Löcher schlagen, wenn Sie sich ihn an den Kopf schlagen, dieser Quarz war dazumal in jenen alten Zeiten ganz aufgelöst - entweder aufgelöst dadrinnen in der dicklichen Flüssigkeit oder in den halbfeinen Partien in der Umgebung, in der verdicklichten Luft aufgelöst. Und man kann schon sagen: Neben dem Schwefel waren riesige Mengen von solchem aufgelöstem Quarz in der verdicklichten Luft, welche die damalige Erde hatte. Sie können eine Vorstellung davon bekommen, wie stark dazumal der Einfluß dieser aufgelösten Kieselsäure gewesen ist, wenn Sie heute betrachten, wie eigentlich die Erde noch immer zusammengesetzt ist bloß da, wo wir leben. Sie können ja natürlich sagen: Da muß viel Sauerstoff da sein, denn den brauchen wir zum Atmen; viel Sauerstoff muß auf der Erde sein. - Es ist auch viel Sauerstoff auf der Erde, achtundzwanzig bis neunundzwanzig Prozent der gesamten Erdenmasse,
die wir haben. Sie müssen dann nur alles nehmen. In der Luft ist der Sauerstoff, in vielen Substanzen, die fest sind auf der Erde, ist der Sauerstoff enthalten; der Sauerstoff ist in den Pflanzen, in den Tieren. Aber wenn man alles zusammennimmt, so sind es achtund-zwanzig Prozent. Aber Kiesel, der im Quarz drinnen mit dem Sauerstoff verbunden Kieselsäure gibt, Kiesel sind achtundvierzig bis neunundvierzig Prozent vorhanden! Denken Sie sich, was das heißt: Die Hälfte von alldem, was uns umgibt und was wir brauchen, fast die Hälfte ist Kiesel! Natürlich, wie alles flüssig war, die Luft fast flüssig war, ehe sie sich verdickte - ja, da spielte dieser Kiesel eine Riesenrolle; der bedeutete sehr viel in diesem ursprünglichen Zustande.
Man respektiert diese Dinge nicht ordentlich, weil man da, wo der Mensch feiner organisiert ist, heute nicht mehr die richtige Vorstellung vom Menschen hat. Heute stellen sich die Menschen grobklotzig vor: Nun ja, wir atmen als Menschen; da atmen wir den Sauerstoff ein, der bildet sich in uns zur Kohlensäure um, wir atmen die Kohlensäure aus. Schön. Gewiß, wir atmen den Sauerstoff ein, wir atmen die Kohlensäure aus. Wir könnten nicht leben, wenn wir nicht diese Atmung hätten. Aber in der Luft, die wir doch einatmen, ist heute noch immer Kiesel enthalten, richtiger Kiesel, und wir atmen immer ganz kleine Mengen von Kiesel auch ein. Genug ist da vorhanden, denn achtundvierzig bis neunundvierzig Prozent Kiesel ist ja in unserer Umgebung. Während wir atmen, geht allerdings nach unten, nach dem Stoffwechsel, der Sauerstoff und verbindet sich mit dem Kohlenstoff; aber er geht zugleich nach aufwärts zu den Sinnen und zu dem Gehirn, zum Nervensystem - überall geht er hin. Da verbindet er sich mit dem Kie-sel und bildet in uns Kieselsäure. So daß wir sagen können: Wenn wir da den Menschen haben (es wird gezeichnet), hier der Mensch seine Lungen hat, und er atmet nun Luft ein, so hat er hier Sauerstoff. Der geht in ihn hinein. Und nach unten verbindet sich der Sauerstoff mit dem Kohlenstoff und bildet Kohlensäure, die man dann wieder aus-atmet; nach oben aber wird der Kiesel mit dem Sauerstoff verbunden in uns, und es geht da in unseren Kopf hinauf Kieselsäure, die da in unserem Kopf drinnen nicht gleich so dick wird wie der Quarz. Das wäre natürlich eine üble Geschichte, wenn da lauter Quarzkristalle
darinnen entstehen würden; da würden Ihnen statt der Haare gleich Quarzkristalle herauswachsen - es könnte ja unter Umständen ganz schön und drollig sein! Aber sehen Sie, so ganz ohne ist das doch nicht, denn die Haare, die Ihnen herauswachsen, haben nämlich sehr viel Kieselsäure in sich; da ist sie nur noch nicht kristallisiert, da ist sie noch in einem flüssigen Zustand. Die Haare sind sehr kieselsäurehaltig. Überhaupt alles, was in den Nerven ist, was in den Sinnen ist, ist kieselsäurehaltig.
Daß das so ist, meine Herren, darauf kommt man ja erst, wenn man die wohltätige Heilwirkung der Kieselsäure kennenlernt. Die Kiesclsäure ist ein ungeheuer wohltätiges Heilmittel. Sie müssen doch bedenken: Der Mensch muß die Nahrungsmittel, die er durch den Mund in seinen Magen aufnimmt, durch alle möglichen Zwischendinge führen, bis sie in den Kopf hinaufkommen, bis sie zum Beispiel ans Auge, ans Ohr herankommen. Das ist ein weiter Weg, den da die Nahrungsmittel nehmen müssen; da brauchen sie Hilfskräfte, daß sie da überhaupt heraufkommen. Es könnte durchaus sein, daß die Menschen diese Hilfskräfte zu wenig haben. Ja, viele Menschen haben zu wenig Hilfskräfte, so daß die Nahrungsmittel nicht ordentlich in den Kopf herauf arbeiten. Dann, sehen Sie, muß man ihnen Kieselsäure eingeben; die befördert dann die Nahrungsmittel hinauf zu den Sinnen und in den Kopf. Sobald man bemerkt, daß der Mensch zwar die Magen- und Darmverdauung ordentlich hat, daß aber diese Verdauung nicht bis zu den Sinnen hingeht, nicht bis in den Kopf, nicht bis in die Haut hineingeht, muß man Kieselsäurepräparate als Heilmittel nehmen. Da sieht man eben, was diese Kieselsäure heute noch für eine ungeheure Rolle im Menschen spielt.
Und diese Kieselsäure wurde ja dazumal, als die Erde in diesem alten Zustande war, noch nicht geatmet, sondern sie wurde aufgenommen, aufgesogen. Namentlich diese vogelartigen Tiere nahmen diese Kieselsäure auf. Neben dem Schwefel nahmen sie diese Kieselsäure auf. Und die Folge davon war, daß diese Tiere eigentlich fast ganz Sinnesorgan wurden. So wie wir unsere Sinnesorgane der Kieselsäure verdanken, so verdankte dazumal überhaupt die Erde ihr vogelartiges Geschlecht dem Wirken der Kieselsäure, die überall war. Und weil die
Kieselsäure an diese anderen Tiere mit den plumpen Gliedmaßen, während sie so hinglitten in der dicklichen Flüssigkeit, weniger herankam, wurden diese Tiere vorzugsweise Magen- und Verdauungstiere. Da oben waren also dazumal furchtbar nervöse Tiere, die alles wahrnehmen konnten, die eine feine, nervöse Empfindung hatten. Diese Urvögel waren ja furchtbar nervös. Dagegen was unten in der dicklichen Flüssigkeit war, das war von einer riesigen Klugheit, aber auch von einem riesigen Phlegmatismus; die spürten gar nichts davon. Das waren bloße Nahrungstiere, waren eigentlich nur ein Bauch mit plumpen Gliedmaßen. Die Vögel oben waren fein organisiert, waren fast ganz Sinnesorgan. Und wirklich Sinnesorgane, die es machten, daß die Erde selber nicht nur wie belebt war, sondern alles empfand durch diese Sinnesorgane, die herumflogen, die die damaligen Vorläufer der Vögel waren.
Ich erzähle Ihnen das, damit Sie sehen, wie ganz anders alles einmal auf der Erde ausgesehen hat. Also alles das, was da aufgelöst war, hat sich dann in dem festen mineralischen Gebirge, in den Felsmassen ab-geschieden, bildete eine Art von Knochengerüst. Damit war aber auch für den Menschen und für die Tiere erst die Möglichkeit gegeben, feste Knochen zu bilden. Denn wenn sich draußen das Knochengerüst der Erde bildete, bildeten sich im Inneren der höheren Tiere und des Menschen die Knochen. Daher war alles dasjenige, was ich Ihnen hier eingezeichnet habe, noch nicht da; es gab noch nicht solche feste Knochen, wie wir sie heute haben, sondern das alles waren biegsame, hornartige, knorpelige Dinge, wie es heute beim Fisch nur noch zurückgeblieben ist. Alle diese Dinge sind schon in einer gewissen Weise zurückgeblieben, sind aber dann verkümmert, weil dazumal in alldem, was ich Ihnen beschrieben habe, die Lebensbedingungen dazu da waren. Heute sind für diese Dinge nicht mehr die Lebensbedingungen da. So daß wir sagen können: In unseren heutigen Vögeln haben wir die für die Luft umgewandelten Nachfolger dieses vogelartigen Geschlechtes, das da oben in der schwefelhaltigen und kieselsäurehaltigen dicklichen Luft war. Und in all demjenigen, was wir heute haben in den Amphibien, in den Kriechtieren, in alldem, was Frösche- und Krötengezücht ist, aber auch in alldem, was Chamäleons, Schlangen und so weiter sind,
haben wir die Nachkommen desjenigen, was dazumal in der dicklichen Flüssigkeit schwamm. Und die höheren Säugetiere und der Mensch in seiner heutigen Gestalt, die kamen ja erst später dazu.
Nun kommt ein scheinbarer Widerspruch heraus, meine Herren. Das letzte Mal sagte ich Ihnen: Der Mensch war zuerst da; aber er war seelisch-geistig nur in der Wärme da. Der Mensch war schon auch bei alldem dabei, was ich Ihnen gezeigt habe, aber er war noch nicht als physisches Wesen da, war in einem ganz feinen Körper da, in dem er sich sowohl in der Luft wie in der dicklichen Flüssigkeit aufhalten konnte. Sichtbarlich war er noch nicht da. Sichtbarlich waren auch die höheren Säugetiere noch nicht da, sondern sichtbarlich waren eben diese plumpen Tiere da und waren diese luftigen, vogelartigen Tiere da. Und das muß man eben unterscheiden, wenn man sagt: Der Mensch war schon da. Er war zuallererst da, wie nicht einmal die Luft da war, aber er war in einem nicht sichtbaren Zustande da und war noch damals, als die Erde so ausgeschaut hat, in einem nicht sichtbaren Zustande da. Erst mußte sich der Mond von der Erde trennen, dann konnte der Mensch auch in sich Mineralisches ablagern, ein mineralisches Knochen-system bilden, konnte in den Muskeln solche Stoffe wie das Myosin und so weiter absondern. Die waren dazumal noch nicht da. Und es entstand der Mensch. Aber er hat eben doch heutzutage in seiner Körperlichkeit durchaus die Erbschaft von diesem Früheren erhalten.
Denn ohne Mondeneinfluß, der nur jetzt von außen ist, nicht mehr innere Erde, entsteht ja der Mensch nicht. Die Fortpflanzung hängt schon mit dem Monde zusammen, nur nicht mehr direkt. Daher können Sie auch sehen, daß das, was mit der Fortpflanzung beim Menschen zusammenhängt, die vierwöchentliche Periode der Frau, in derselben rhythmischen Periode verläuft wie die Mondenphasen, nur fallen sie nicht mehr zusammen, haben sich voneinander emanzipiert. Aber das ist geblieben, daß dieser Mondeneinfluß durchaus tätig ist in der menschlichen Fortpflanzung.
So können wir sagen: Wir haben die Fortpflanzung gefunden zwischen den Wesen der verdicklichten Luft und denen der verdicklichten Flüssigkeit, zwischen dem alten vogelähnlichen Geschlecht und den alten Riesenamphibien. Die befruchteten sich gegenseitig, weil der
Mond noch drinnen war. Sofort, als der Mond draußen war, mußte die Außenbefruchtung eintreten. Denn im Monde liegt eben das Befruchtungsprinzip.
Nun, von diesen Gesichtspunkten aus wollen wir dann am nächsten Samstag, wo wir die Stunde hoffentlich um neun Uhr haben können, weiter fortsetzen. Die Frage von Herrn Dollinger ist eben eine, die ausführlich beantwortet werden muß; wir werden aber schon zurechtkommen, wenn Sie Geduld haben, bis Sie die Gegenwart herausspringen sehen aus demjenigen, was allmählich eigentlich geschieht. Es liegt in der Frage, die eben schwer verständlich ist. Aber ich glaube, man kann die Sache, wenn man sie so anschaut, wie wir es getan haben, schon verstehen.
DRITTER VORTRAG Dornach, 7. Juli 1924
Nun, meine Herren, Sie haben gesehen aus demjenigen, was wir besprochen haben, daß eigentlich in unserer Erde ein Zustand vorliegt, der nur der letzte Rest von vielem anderem ist, das wesentlich anders ausgeschaut hat. Und wenn wir heute den früheren Zustand der Erde mit etwas vergleichen wollen, so können wir ihn eigentlich nur, wie Sie gesehen haben, vergleichen mit demjenigen, was wir in einem Eikeim haben. Wir haben heute in der Erde einen festen Kern aus allerlei Mineralien und Metallen; wir haben ringsherum die Luft und haben in der Luft zwei Stoffe, die uns vor allen Dingen auffallen, weil wir ohne sie nicht leben können: den Sauerstoff und den Stickstoff. So daß wir also sagen können: Wir haben in unserer Erde einen festen Erdenkern mit allen möglichen Stoffen, siebzig bis achtzig Stoffen, und ringsherum die Lufthülle, vorzugsweise drinnen Stickstoff und Sauerstoff (es wird gezeichnet).
Aber das ist ja nur, daß vorzugsweise drinnen sind Stickstoff und Sauerstoff! Immer sind in der Luft auch andere Stoffe enthalten, nur eben in in sehr geringer Menge, unter anderem Kohlenstoff, Wasserstoff, Schwefel. Aber das sind ja auch die Stoffe, die zum Beispiel in dem Weißen im Ei, im Weißen eines Hühnereies enthalten sind: Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff und Schwefel! Die sind auch im Weißen eines Hühnereies enthalten. Der Unterschied ist bloß der, daß in dem Weißen eines Hühnereies, ich möchte sagen, der Schwefel, der Wasserstoff, der Kohlenstoff mehr sich anschmiegen an den Sauerstoff und Stickstoff, während sie in der äußeren Luft viel loser vorhanden sind. Also eigentlich ist doch dasselbe in der Luft vorhanden, was in dem Hühnerei drinnen enthalten ist. In ganz geringer Menge sind auch dieselben Stoffe im Eidotter drinnen vorhanden. So daß wir also sagen können, daß es, wenn es sich verhärtet, verdichtet, zu dem wird, was die Erde ist. Sie sehen also, man muß auf solche Dinge hinschauen, wenn man wissen will, wie es in der Welt einmal ausgesehen hat.
Heute aber macht man die Sache auf eine ganz andere Art, und damit Sie in der Beurteilung desjenigen, was ich Ihnen hier vorbringe, nicht beirrt werden durch dasjenige, was eben allgemein anerkannt ist, möchte ich Ihnen doch einiges von dem sagen, was allgemein anerkannt ist, und was dennoch durchaus übereinstimmt mit demjenigen, was ich sage. Man muß es nur richtig betrachten. Sehen Sie, heute denkt man ja nicht so, wie hier gedacht worden ist in den zwei letzten Stunden, sondern heute denkt man so, daß man sagt: Da haben wir die Erde. Die Erde ist einmal mineralisch. Diese mineralische Erde, die ist bequem zu untersuchen. Zunächst einmal untersuchen wir dasjenige, was obenauf ist, was wir mit unseren Füßen betreten. Dann sehen wir da, wenn wir Steinbrüche machen, wenn wir die Erde aufschließen, um Einschnitte zu machen beim Eisenbahnbau, wie gewisse Schichten vorhanden sind in der Erde. Da ist die oberste Schicht, auf die wir treten. Kommen wir irgendwo in die Tiefe hinein, dann finden wir tieferliegende Schichten. Aber diese Schichten liegen nicht so übereinander, daß man sagen kann, sie haben sich so hübsch übereinander aufgetürmt, immer ist die eine über der anderen -, sondern die Sache ist ja so: Sehen Sie einmal, nehmen Sie an, da haben Sie eine solche Schichte (siehe Zeichnung, rot); die ist nicht eben, diese Schichte, die ist gebogen; eine andere Schichte ist darunter (grün), die ist auch gebogen. Und jetzt kommt darüber diejenige Schichte, welche wir mit den Füßen betreten (weiß). Solange wir, sagen wir, auf dieser Seite
#Bild s. 45
eines Berges Fußgänger bleiben, so lange sehen wir da oben diejenige Schicht, die auch, wenn es gut geht, Ackererde werden kann, wenn wir
die entsprechende Düngungsmethode und so weiter finden. Wenn wir aber eine Eisenbahn bauen, dann kann es sein, daß wir so heraufgehen müssen, daß wir also gewisse Schichten abbauen müssen. Und dann kommen wir dadurch, daß wir einen solchen Einschnitt machen, in die Tiefen der Erde hinein. Und auf eine solche Weise hat man gefunden, daß eben übereinander Schichten sind, nicht ebene, sondern in der verschiedensten Weise durcheinandergeworfene Schichten der Erde.
Aber diese Schichten sind manchmal sehr merkwürdig. Man hat sich gefragt: Wie kann man das Alter der Schichten bestimmen? Welche Schichte ist älter? - Nun ja, das Nächstliegende ist ja das, daß einer sagt: Wenn die Schichten übereinander sind, so ist die unterste die älteste, die darauf folgende ist jünger, und die oben liegende ist die allerjüngste. Aber sehen Sie, so ist die Geschichte nicht überall; manchmal ist es so, aber nicht überall ist es so. Und daß es nicht überall so ist, das kann man auf folgende Weise konstatieren.
Wir sind ja in unseren kultivierten Gegenden gewöhnt, unsere Haustiere, wenn sie sterben, zu verscharren, damit sie für die Menschen nicht schädlich werden. Wäre aber das Menschengeschlecht noch nicht entwickelt, was würde dann mit den Tieren, die da schon da wären, geschehen? Die Tiere würden an irgendeiner Stelle verenden, würden da liegenbleiben. Nun liegt das Tier zunächst da oben. Aber Sie wissen ja, wenn es regnet, wird die Erde aufgespült, und nach einiger Zeit könnte man sehen, wenn da ein Tier verendet wäre, daß dieses Tier, indem es anfängt zu verwesen, in seinen Uberresten, die übrig bleiben, sich vermischt mit der vom Regen herangeschlagenen Erde. Und nach einer Zeit ist das ganze Tier durchzogen mit der vom Regen herangeschwemmten Erde oder von dem Regenwasser, das herunterfließt über einen Abhang; dann geht über das Tier die andere Erde darüber. Nun kann einer kommen hinterher und kann sagen: Donnerwetter, die Erde schaut ja da so geringelt aus, da muß ich mal nachgraben! - Da braucht er nicht viel nachzugraben; er gräbt etwas nach und findet darinnen -sagen wir, wenn die Menschen noch nicht dagewesen wären und eben hinterher der gekommen wäre, der nachgegraben hätte -, da findet er dasjenige, was übrig ist vom Knochengerüste, sagen wir, von einem wilden Pferd. Da kann er sich sagen: Ja, jetzt gehe ich über eine Erdschichte,
die erst später geworden ist; aber die drunter ist eine, die ist gebildet worden zu einer Zeit, wo schon solche wilden Pferde da waren. - Und man kann erkennen, daß das die nächste Schichte ist, daß also der Zeit, in der dieser Mensch lebt, eine vorangegangen ist, worin diese Pferde gelebt haben.
Sehen Sie, so wie es der Mensch hier macht, haben es nun die Geologen mit allen Schichten der Erde gemacht; sie haben sie einfach, seit sie zu erreichen sind in Steinbrüchen, in Eisenbahnaufschließungen und so weiter, abgegraben. Man lernt ja in der Geologie, daß man mit einem Hammer oder auch mit einem anderen Instrument überall Steinbrüche aufsucht, um eben aufzuschließen dasjenige, was im Gebirge durch Abrutschungen bloßgelegt ist oder dergleichen. Da hämmert man überall ein, sägt unter Umständen auch das eine oder andere aus, und da findet man in irgendeiner Schichte sogenannte Versteinerungen. Da kann man sagen: Unter unserem Erdboden sind die Schichten erhalten, die ganz andere Tiere als die heutigen enthalten haben. - Und man kommt dann darauf, wie die Gestalt der Tiere ist, die in alten Zeiten vorhanden waren, wenn man in dieser Weise die Schichten der Erde abgräbt.
Das ist gar nicht so etwas Besonderes, denn, sehen Sie, in welcher Zeit so etwas geschieht, das unterschätzen die Leute eigentlich. Sie finden heute in südlicheren Gegenden Kirchen oder andere Gebäude; die stehen da. Sie kommen durch irgend etwas darauf - Donnerwetter, da unter dieser Kirche, das ist ja etwas, was hart ist, was nicht Erde ist. Sie graben hinein und finden, daß da drunter ein heidnischer Tempel ist! Ja, was ist denn da geschehen? Vor verhältnismäßig kurzer Zeit, da war diese Oberschicht überhaupt nicht da, auf der diese Kirche oder dieses Gebäude steht, sondern das ist erst angetragen, angeschleppt worden vielleicht von Menschen, aber vielleicht auch durch Mithelfen der Naturkräfte, und drunten ist der heidnische Tempel. Das war oben, was jetzt drunten ist. So ist es. Aber in der Erde, da ist Schichte auf Schichte aufgeschichtet worden. Und man muß herausfinden, nicht aus der Art, wie die Schichten liegen, sondern aus der Art und Weise, wie diese Versteinerungen, wie diese versteinerten Tiere liegen - und dazu kommen auch die verschiedenen Pflanzen -, wie diese in die Schichten hereingekommen sind.
Da stellt sich aber folgendes heraus. Sehen Sie, da kann folgendes passieren: Sie finden eine Erdschichte (siehe Zeichnung, gelb); Sie finden eine andere Erdschichte (grün); Sie sind in der Lage durch irgend etwas, hier hineinzugraben (Pfeil). Wenn Sie jetzt bloß auf die Schichtungen
#Bild s. 48
schauen, dann kommt es Ihnen doch vor, wie wenn das, was ich da grün gezeichnet habe, die untere Schichte wäre, und dasjenige, was ich gelb gezeichnet habe, die obere Schichte. Hierher können Sie einfach nicht; da können Sie nicht eingraben, da ist keine Eisenbahn, kein Tunnel, noch irgend etwas anderes, wodurch man hinkommen kann. Da merken Sie: Das Gelbe ist die Oberschichte, das Grüne ist die untere Schichte. Aber Sie dürfen das nicht gleich sagen, sondern Sie müssen erst die Versteinerungen suchen. Nun findet man sehr häufig in dem, was da oben liegt, Versteinerungen, die älter sein müssen. Man findet zum Beispiel da oben merkwürdige Fischskelette, und unten findet man, sagen wir, merkwürdige Säugetierskelette, die jünger sind. Jetzt widersprechen die Versteinerungen der Lage: Oben erscheint das Altere, unten erscheint das Jüngere. Jetzt muß man sich eine Vorstellung machen, woher das kommt. Ja, sehen Sie, das kommt davon her, daß durch irgendein Erdbeben oder eine innere Erschütterung dasjenige, was hier unten war, sich herumgeschmissen hat über das Obere, so daß also dieses entstanden ist, daß, wenn ich hier Ihnen den Stuhl über den Tisch legen würde, wenn das die ursprüngliche Lage wäre der Stuhllehne und hier der Tischplatte -, so würde es geschehen, daß durch einen Erdstoß, der hier erfolgt ist, die Tischplatte sich über die Stuhllehne drüberstülpt.
Sehen Sie, das kann man an dem Verschiedensten wahrnehmen: es hat sich das umgestülpt. Und man kann, wie Sie gleich daraus sehen, auch folgendes noch wissen. Man kann fragen: Wann ist diese Umstülpung geschehen? Diese Umstülpung ist ja erst geschehen, nachdem diese Versteinerungen sich gebildet haben; sonst müßten diese anders drinnen liegen. Also man weiß, daß diese Umstülpung, diese Umschichtung später entstanden ist als diese Tiere gelebt haben.
Auf diese Weise kommt man darauf, die Erdschichten nicht so zu beurteilen, wie sie einfach übereinanderliegen, sondern so zu beurteilen, wie sie sich auch umgeschichtet haben. Und sehen Sie, die Alpen, dieser mächtige Gebirgszug, der sich vom Mittelländischen Meere hin-überzieht bis in die österreichischen Donaugegenden - diesen mächtigen Alpenzug, der das Hauptgebirge der Schweiz ist, den kann man überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht auf solche Dinge eingehen kann. Denn in diesen Alpen ist alles, was schichtweise sich aufgebaut hat, später einmal durcheinandergeschmissen worden. Da liegt oft das Unterste zuoberst und das Oberste zuunterst und man muß erst suchen, wie da die Dinge durcheinandergeschmissen worden sind.
Nun, erst wenn man das berücksichtigt, kommt man darauf, welches die ältesten Schichten sind und welches die jüngsten Schichten sind. Und da sagt natürlich diese heutige, nur aufs Außerliche dieser Forschung bauende Wissenschaft: Diejenigen Schichten sind die ältesten, in denen die allereinfachsten Überreste von Tieren und Pflanzen gefunden werden können. Später werden die Tiere und Pflanzen kompliziert - also finden sich die komplizierteren der Tiere und Pflanzen in den jüngeren Schichten. Wenn man an ältere Schichten herankommt, so findet man Versteinerungen, die davon herrühren, daß sich dasjenige, was die Tiere an Kalk- oder Kieseleinschlüssen gehabt haben, erhalten hat; das andere hat sich ja aufgelöst. Wenn man an jüngere Schichten kommt, hat sich das Skelett erhalten. - Nur bilden sich nämlich, merkwürdigerweise, auch auf andere Art Versteinerungen. Diese anderen Versteinerungen sind unter Umständen sehr interessant.
Sehen Sie, sie bilden sich auch so, diese Versteinerungen: Denken Sie sich, irgendein einfaches älteres Tier sei einmal vorhanden gewesen, ein Tier, das einen Leib hat, meinetwillen vorne Fangarme (weiß) -
ich zeichne es so groß, es wird in den Schichten, die aus dem Geologischen
#Bild s. 50 a
bekannt sind, in der Regel kleiner sein. Nun, dieses Tier verendet, indem es auf diesem Erdreiche liegt. Nehmen wir an, das Erdreich ist so, daß es nicht recht hinein kann in das Tier; dieses Erdreich, das meidet sozusagen irgendeine Säure, die in dem Tier enthalten ist. Dann entsteht etwas sehr Merkwürdiges; dann geht die Erde, in der dieses Tier dadrinnen liegt, überall an das Tier heran und umhüllt das Tier (gelb), und es bildet sich ein Hohlraum von der Form des Tieres.
#Bild s. 50 b
Das ist sehr häufig entstanden, daß sich solche Hohlräume bilden (grün). Um das Tier herum lagert sich die Erde. Aber es ist nichts drinnen, es
#Bild s. 50 c
durchsaugt nicht das Tier, sondern ringsherum, weil das Tier schalig war, bildet sich solch ein Hohlraum. Nun, später wird aber die Schale aufgelöst; und noch später windet sich irgendein Bach da durch; der füllt dann mit seiner Gesteinsmasse das, was ein Hohlraum ist, aus (grün), und da drinnen wird fein modelliert ein Abdruck des Tieres mit einer ganz anderen Materie, mit einem ganz anderen Stoffe. Solche Abdrücke sind ganz besonders interessant, denn da haben wir nicht die Tiere selber, sondern Abgüsse der Tiere.
Nun, sehen Sie, Sie dürfen sich aber auch die Dinge nicht so ganz leicht vorstellen. Von dem heutigen Menschen zum Beispiel mit seiner verhältnismäßig weichen Stofforganisation bleibt außerordentlich wenig vorhanden, und von höheren Tieren ist auch verhältnismäßig wenig vorhanden gewesen. So zum Beispiel gibt es Tiere, von denen nur Abgüsse der Zähne vorhanden geblieben sind; eine Art Abgüsse ur-weltlicher Haifischzähne, die sich auf diese Weise gebildet haben, findet man. Jetzt muß man schon die Fähigkeit haben, sich zu sagen:
Jede Tierform hat ihre eigene Zahnform - der Mensch hat eine andere Zahnform -, und die Zahnform richtet sich immer nach der ganzen Gestalt, dem ganzen Wesen. Jetzt muß man das Talent haben, aus den Zähnen, die man da findet, sich vorstellen zu können, wie das ganze Tier gewesen sein kann. Also so ganz leicht ist die Sache doch nicht.
Aber sehen Sie, man kommt, indem man diese Schichten da studiert, auch darauf, wie eigentlich sich die ganze Sache entwickelte. Und daraus geht einfach hervor, daß es Zeiten gegeben hat, in denen solche Tiere, wie sie heute da sind, nicht da waren, sondern in denen Tiere dagewesen sind, die viel, viel einfacher waren, die so ausgeschaut haben wie unsere ganz niederen Tiere, das Schnecken-, das Muschelgetier und so weiter. Aber Sie müssen überall wissen, was von diesen Tieren übriggeblieben ist. Denken Sie nur einmal, es könnte ja folgendes eintreten.
Nehmen Sie einmal an, ein kleiner Junge, der Krebse nicht mag, stibitze sich einen Krebs von der Mahlzeit seiner Eltern und spiele mit ihm. Er wird nicht erwischt und gräbt ihn ein in den Garten. Nun hat der im Garten den Krebs eingegraben. Über die ganze Sache kommt Erde drüber; es wird vergessen. Den Garten hat ein anderer später;
der gräbt um, wird aufmerksam an einer Stelle: Da findet er komischerweise zwei kleine Dinger, die so wie kleine Kalkschalen ausschauen. Sie wissen, daß es die sogenannten Krebsaugen gibt, die ja nicht Augen sind, sondern kleine Kalkschalen, die im Leibe des Krebses sind. Das sind die einzigen Zeichen, die von seinen Spuren geblieben sind. Jetzt können Sie nicht sagen: Das sind Versteinerungen von irgendeinem Tier -, sondern das sind Versteinerungen nur von einem Teil des Tieres. So kann man in älteren Schichten irgendwelche Gebilde finden, meinetwillen so aussehend, wie eine Schale aussehend, namentlich in den Alpen. Die sehen so ähnlich aus; die gibt es heute nicht mehr, die findet man in älteren Schichten. Man darf nicht annehmen, daß dies die ganzen Tiere gewesen sind, sondern man muß eben annehmen:
Da war eben etwas herum, das hat sich aufgelöst, und nur ein kleines Stück von dem Tier ist geblieben.
Darauf geht schon die heutige Wissenschaft wenig ein. Warum? Ja, weil sie eben nur so sagt: Dieses mächtige Alpenmassiv, das zeigt ja, daß es durcheinandergeschmissen worden ist, das Unterste zuoberst, das Oberste zuunterst; das zeigen die Schichten. - Aber, meine Herren, können Sie sich vorstellen, daß mit den Kräften, die heute auf der Erde vorhanden sind, solch ein Alpenmassiv in der Weise durcheinander-geschmissen werden kann? Das bißchen, was heute geschieht auf der Erde, geschieht ja so, daß vergleichsweise die Erde durchtanzt wird, daß die Erde von einem Fleck ein bißchen auf einen anderen geworfen wird; das ist heute alles, dieses Durchtanztwerden. Würde der Mensch statt zweiundsiebzig Jahre siebenhundertzwanzig Jahre alt, dann würde er erleben, wie er in seinem Greisenalter schon über einen ein wenig höheren Boden geht als vorher. Aber wir leben ja zu kurz. Denken Sie nur, wenn uns eine Eintagsfliege, die nur vom Morgen bis zum Abend lebt, erzählen würde, was sie erlebt, die würde uns erzählen, da sie nur im Sommer lebt: Es gibt überhaupt nur Blüten, die ganze Zeit nur Blüten. - Die würde ja gar keine Ahnung davon haben, was im Winter geschieht und so weiter; sie würde glauben, der nächste Sommer schließe sich an den vorigen an. Wir Menschen sind zwar ein bißchen länger dauernde Eintagsfliegen, aber etwas von Eintagsfliegen haben wir doch schon an uns mit unseren siebzig bis zweiundsiebzig
Jahren! Nun, die Sache ist schon so, daß wir wenig sehen von dem, was vorgeht. Und so muß man sagen: Mit den Kräften, die heute wirksam sind, geschieht zwar mehr, als der Mensch gewöhnlich sieht, aber es geschieht doch verhältnismäßig nur das, daß der Boden ein bißchen aufgeschwemmt wird, daß Flüsse gegen das Meer hinfließen, Flußsand zurücklassen, daß dann an den Ufern der Flußsand weitergeht, daß die Felder eine neue Schichte bekommen. Das ist verhältnismäßig wenig. Hält man sich vor Augen, wie so etwas wie dieses Alpenmassiv durchgerüttelt und durchgeschüttelt worden ist, dann muß man sich klar sein, daß die Kräfte, die heute wirksam sind, früher in einer ganz anderen Weise wirksam waren.
Nun aber müssen wir uns Bilder machen, wie so etwas vor sich gehen kann. Ja, nehmen Sie nur einmal irgendeinen Eikeim, einen Ei-keim von irgendeinem Säugetier. Der schaut anfangs verhältnismäßig sehr einfach aus: ringsherum Eiweißmasse, drinnen ein Kern (es wird gezeichnet). Aber nehmen Sie an, dieser Eikeim wird befruchtet. Sehen Sie, wenn er befruchtet wird, da macht der Kern dann allerlei Sperenzchen; er bildet sich, sehr merkwürdig, zu einer Summe von solchen Spiralen aus, die wie ein Schwanz heraufgehen. So bildet sich der Kern aus. In dem Moment, wo diese Knäuelchen entstehen, entstehen aus der Masse heraus sternförmige Gebilde; da kommt die ganze Masse dadurch, daß Leben in ihr ist, in Gestaltungen hinein. Da geht es schon anders zu als heute auf unserer Erde! Dadrinnen entstehen schon solche Umstülpungen und Überwerfungen, wie wir sie im Alpen-massiv sehen!
Was ist natürlicher, als daß wir sagen: Also war die Erde einmal lebendig, sonst hätten diese Umstülpungen und Überwerfungen gar nicht entstehen können! Die heutige Gestalt der Erde zeigt uns eben, daß sie in der Zeit, in der noch nicht Menschen, in der noch nicht höhere Tiere gelebt haben, selber lebendig war! So daß wir auch aus dieser Erscheinung heraus sagen müssen: Aus der lebendigen Erde ist die heutige tote Erde erst hervorgegangen. - Aber nur in dieser heutigen toten Erde können die Tiere leben! Denn denken Sie einmal, es hätte in der Luft sich nicht abgesondert für sich der Sauerstoff und Stickstoff und hätte sozusagen den Wasserstoff, den Kohlenstoff, den
Schwefel zu einer verhältnismäßigen Tatenlosigkeit verdammt, so müßten wir atmen in so etwas, was ähnlich wäre dem Eiweiß im Hühnerei, denn so war es ringsherum um die Erde.
Nun könnte man sich zum Beispiel denken - denn in der Welt kann ja alles entstehen -, daß sich statt unserer Lunge auch Organe gebildet hätten, durch die man einsaugen könnte solch ein atmosphärisches Ein-weiß. Wir können es ja heute durch den Mund verzehren. Warum sollte nicht etwas mehr gegen den Mund hinüber eine Art Lungenorgane entstanden sein? Auf der Welt kann alles entstehen. Es entsteht auch das, was da noch möglich ist. Also am Menschen liegt es eigentlich, zunächst so, wie er heute ist, eigentlich körperlich nicht. Aber bedenken Sie doch nur, meine Herren: Wir gucken, wenn wir heute in die Luft gucken, in die tote Luft hinein. Die ist abgestorben. Früher war das Eiweiß lebendig. Die Luft ist abgestorben; gerade dadurch, daß der Schwefel, der Wasserstoff, der Kohlenstoff weg ist, ist der Stickstoff und Sauerstoff abgestorben. Wir gucken hinein in die lichterfüllte Luft, die abgestorben ist. Dadurch können unsere Augen auch physikalisch sein, sind auch physikalisch. Wäre in unserer Umgebung alles lebendig, so müßten auch unsere Augen lebendig sein. Wenn sie lebendig wären, könnten wir nichts mit ihnen sehen, und wir wären fortwährend in einer Ohnmacht, geradeso wie wir in Ohnmacht kommen, wenn es in unserem Kopf zu stark zu leben anfängt, wenn wir in unserem Kopf, statt daß wir die regelmäßig ausgebildeten Organe haben, allerlei Gewächse haben, werden wir auch ohnmächtig, zuerst ab und zu und später wird die Anzahl so stark, daß Sie wie tot daliegen. Also so, wie wir ursprünglich waren, hätten wir doch nicht mit Bewußtsein leben können in dieser Erde. Das Menschenwesen konnte erst zum Bewußtsein erwachen, als die Erde allmählich abgestorben war. So daß wir uns als Menschenwesen entwickeln eben auf der abgestorbenen Erde.
So ist es ja auch, meine Herren! So ist es ja nicht nur mit der Natur, sondern auch mit der Kultur. Wenn Sie noch einmal auf das hinschauen, was ich gesagt habe, daß da unten heidnische Tempel sein konnten, oben christliche Kirchen, so verhalten sich diese christlichen Kirchen zu den heidnischen Tempeln geradeso wie die oberen zu den unteren Schichten; nur in dem einen Fall haben wir es mit der Natur,
im anderen Fall mit der Kultur zu tun. Aber man kann auch nicht verstehen, wie das Christliche sich entwickelt, wenn man es nicht betrachtet, wie es sich auf der Grundlage des Heidentums entwickelte. So ist es schon mit der Kultur. Auch da muß man diese Schichten beobachten.
Nun sagte ich Ihnen aber: Der Mensch war eigentlich immer da, nur nicht als solches physisches Wesen, sondern als mehr geistiges Wesen. - Und das wiederum führt uns dazu, den eigentlichen Grund einzusehen, warum der Mensch nicht schon früher sich als physisches Wesen entwickelte. Sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt: Da sind in der Luft heute Stickstoff, Sauerstoff - Kohlenstoff, Wasserstoff und Schwefel weniger. Heute bringen wir selber den Kohlenstoff, den wir in uns haben, bei der Atmung mit dem Sauerstoff, den wir einatmen, zusammen, verbinden den Kohlenstoff mit dem Sauerstoff, stoßen den miteinander verbundenen Kohlenstoff und Sauerstoff, was man Kohlensäure nennt, wieder aus. Wir Menschen leben also so, daß wir Sauerstoff einsaugen durch die Atmung und Kohlensäure ausstoßen. Darin besteht unser Leben. Längst hätten wir als Menschen die Erde, die Erdenluft ganz angefüllt mit Kohlensäure, wenn nicht etwas anderes wäre. Das sind die Pflanzen; die haben einen ebensolchen Hunger, wie wir nach dem Sauerstoff haben, nach dem Kohlenstoff. Die Pflanzen wiederum nehmen gierig die Kohlensäure auf, behalten den Kohlenstoff zurück und geben Sauerstoff wieder her.
Sie sehen, meine Herren, wie wunderbar sich eigentlich das ergänzt! Es ergänzt sich ganz famos. Wir Menschen brauchen aus der Luft den Sauerstoff, den atmen wir ein; wir geben ihm den Kohlenstoff mit, den wir in uns haben, atmen Kohlenstoff und Sauerstoff zusammen aus als Kohlensäure. Die Pflanzen atmen sie ein und atmen den Sauerstoff wieder aus. Und so ist immer wiederum in der Luft Sauerstoff da.
Ja, das ist heute so; aber in der Entwickelung der Menschheit auf Erden war es nicht immer so. Gerade wenn wir die alten Wesen finden, die da gelebt haben, die wir sogar noch in den Versteinerungs-schichten drinnen finden können, dann sagen wir uns: Ja, die können nicht so gewesen sein, wie unsere heutigen Tiere und Pflanzen sind,
namentlich nicht so, wie die Pflanzen heute sind, sondern alle diese Wesen, die ursprünglich da waren als Pflanzen, die müssen viel ähnlicher gewesen sein unseren Schwämmen, den Pilzen und den Algen. Nun besteht aber ein Unterschied zwischen unseren Pilzen und unseren heutigen Pflanzen. Der Unterschied liegt darinnen: Unsere heutigen Pflanzen nehmen den Kohlenstoff auf, bilden sich daraus ihren Leib. Wenn dann solche Pflanzen versinken in der Erde, dann bleibt der Leib als Kohle darinnen. Was wir heute als Kohle ausgraben, sind Pflanzenleiber.
Meine Herren, alles das, was wir untersuchen können in bezug darauf, was für Pflanzen ursprünglich gelebt haben, zeigt uns: Die heutigen Pflanzen, auch diejenigen Pflanzen, die uns einmal unsere Kohlen geliefert haben, die wir heute aus der Erde ausgraben, die bauen sich aus Kohlenstoff auf. Aber viel frühere Pflanzen haben sich nicht aus Kohlenstoff aufgebaut, sondern aus Stickstoff. Geradeso wie sich unsere heutigen Pflanzen aus Kohlenstoff aufbauen, so haben sich diese Pflanzen aus Stickstoff aufgebaut. Wodurch ist denn das möglich geworden? Sehen Sie, das ist dadurch möglich geworden, daß geradeso, wie heute die Kohlensäure ausgeatmet wird von den Tieren und Menschen, in alten Zeiten ausgeatmet wurde eine Verbindung von Kohlenstoff und Stickstoff. Heute atmen wir eine Verbindung von Kohlenstoff und Sauerstoff aus, früher wurde ausgeatmet eine Verbindung von Kohlenstoff und Stickstoff. Aber, meine Herren, das ist die Blau-säure, die für alles, was heute lebt, so furchtbar giftige Blausäure, die Zyansäure! Diese giftige Blausäure, die wurde einmal ausgeatmet, und die verhinderte, daß so etwas, wie es heute lebt, entstehen konnte. Diese Blausäure ist eben eine Verbindung von Stickstoff und Kohlenstoff. Da wird der Kohlenstoff noch nicht angenommen von diesen pilzartigen Pflanzen, sondern da wird der Stickstoff angenommen. Diese alten Pflanzen, die bauten sich aus dem Stickstoff auf. Und die Wesenheiten, von denen ich Ihnen gesprochen habe, diese vogelartigen Gebilde, und diese plumpen Tiere, von denen ich Ihnen das letzte Mal gesprochen habe, die atmeten diese giftige Säure aus, und die Pflanzen, die um sie herum waren, nahmen den Stickstoff und bildeten sich daraus ihren Leib, ihren Pflanzenleib. So daß wir auch da sehen können, daß die
Stoffe, die heute noch da sind, eben in ganz anderer Weise verwendet worden sind in alten Zeiten.
Und das ist es eben, wovon ich einmal aus der Anthroposophie heraus gesprochen habe; ich habe es den Herren, die länger da sind, schon erzählt: 1906 hatte ich Vorträge in Paris zu halten über Erdentwickelung, Menschenentstehung und so weiter, und da mußte ich sagen aus dem ganzen Zusammenhang heraus: Kann man heute noch irgendwo etwas finden, was uns darauf hinweist, daß einmal auch auf der Erde nicht der Kohlenstoff und der Sauerstoff die Rolle gespielt haben, die sie heute spielen, sondern daß da der Stickstoff eine solche Rolle gespielt hat, daß gewissermaßen eine Atmosphäre von Blausäure da war, von Zyansäure?
Nun wissen Sie ja das Folgende: Es gibt alte Leute und kleine Kinder. Da kann einer stehen mit siebzig Jahren und neben ihm ein Kind von zwei Jahren - das eine ist ein Mensch, und der andere ist ein Mensch. Sie stehen eben nebeneinander, und derjenige, der heute siebzig Jahre alt ist, war eben vor achtundsechzig Jahren wie das kleine Kind. Die Dinge, die verschiedenalterig sind, stehen doch im Leben nebeneinander. So wie es aber im Menschenleben ist, ist es eben auch in der Welt. Auch da stehen gewissermaßen ältere Dinge und jüngere nebeneinander. In unserer Erde mit dem, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, was Sie heute noch sehen, ist ein richtiges Greisenhaftes, sogar schon fast Erstorbenes - wenn man nicht das Leben, das wieder neu aufgesprossen ist, nimmt -, ein sogar fast Erstorbenes vorhanden. Aber daneben sind im Weltenall wieder jüngere Gebilde, die erst so werden, wie unser heutiges Leben ist. Und als solche muß man zum Beispiel die Kometen anschauen. Daher kann man wissen, daß die Kometen, weil sie eben jünger sind, auch noch diejenigen Zustände haben müssen, die ihrem Jüngersein entsprechen. So wie das Kind dem Greis gegenüber, so stehen die Kometen der Erde gegenüber: Hat die Erde einmal Blausäure gehabt, so müssen die Kometen jetzt noch Blausäure haben; Zyanverbindungen müßten sie haben! So daß man mit einem heutigen Körper, wenn man lecken würde an dem Kometen, sogleich sterben müßte. Das ist allerdings verdünnte Blausäure, die dadrinnen ist.
Nun, sehen Sie, das habe ich 1906 in Paris gesagt, daß dies aus der
Geisteswissenschaft folgt. Nun ja, zunächst haben diejenigen, die Geisteswissenschaft anerkennen, das angenommen; man kann sich sogar über so etwas verwundern. Dann später, längere Zeit darauf, ist wieder ein Komet erschienen. Da hatte man schon die Instrumente, die nötig sind, und da fand man auch durch die gewöhnliche Naturforschung, daß die Kometen wirklich Zyan haben, Blausäure - was ich damals in Paris gesagt hatte! So werden die Dinge eben bestätigt. Natürlich sagen dann die Leute, weil sie nur dieses hören: Der Steiner hat in Paris gesagt, die Kometen haben Blausäure, nachher ist es gefunden worden - das ist ein Zufall! - So sagen die Leute, weil sie nichts anderes als dieses wissen: Das ist ein Zufall. - Aber ich habe Ihnen jetzt gesagt, warum man in den Kometen Blausäure annehmen muß. Da sehen Sie, es ist kein Zufall, es ist eine wirkliche Wissenschaft, durch die man darauf gekommen ist! Nur eben, mit der sinnlichen Forschung wird das erst später bestätigt. Und so könnten die Leute schon ansehen das, was in der Anthroposophie ist: Alles wird später bestätigt. Sogar häufig wird es heute schon außerhalb der anthroposophischen Bewegung, eben auf eine etwas andere Art, gefunden werden, was aber von der Anthroposophie schon vor vielen Jahren gegeben worden ist.
Ja, es kommen sogar noch andere Sachen vor, meine Herren. Das ist etwas, was heute ganz wissenschaftlich untersucht werden könnte. Ich muß immer sagen: Wenn die Menschen zu einem Stern wirklich hinausfahren könnten, da würden sie sehr erstaunt sein, daß der anders ausschaut, als sie sich ihn aus den heutigen Erdenvorstellungen vorstellen. Da stellt man sich vor, da ist so ein glühendes Gas drinnen. Aber das findet man gar nicht draußen, sondern wo der Stern ist, da ist eigentlich leerer Raum, aber ein leerer Raum, der einen gleich auf-saugt. Saugekräfte sind da! Es saugt einen gleich auf und zersplittert einen. Und wenn man nun mit derselben Forschung so konsequent vorgeht und eine solche unbefangene Denkweise hat, wie wir es hier haben, so kann man auch darauf kommen, mit komplizierten Spektroskopen zu sehen: Da sind nicht Gase, sondern da ist der saugende Raum. - Und ich habe schon vor längerer Zeit gewissen unserer Leute die Aufgabe gegeben, mit dem Spektroskop einmal die Sonne und die Sterne zu untersuchen, um einfach nachzuweisen mit äußeren Erfahrungen,
daß die Sterne Hohlräume sind, nicht glühende Gase. Und das kann man nachweisen. Aber diejenigen Leute, denen ich diese Aufgabe gegeben habe, waren anfangs furchtbar begeistert: Oh, da wird etwas gemacht! - Aber manchmal erlischt diese Begeisterung; sie haben zu lange gewartet - und schon vor anderthalb Jahren kam von Amerika herüber die Nachricht, daß man auf dem Weg ist, die Sterne zu untersuchen, und nach und nach findet, daß die Sterne gar nicht glühende Gase sind, sondern ausgesparte Hohlräume! Es schadet ja auch nichts, wenn das so geschieht. Natürlich, äußerlich wäre es uns nützlicher, wenn wir es machten. Aber es kommt ja nicht darauf an; wenn nur die Wahrheit herauskommt.
Auf der anderen Seite aber könnte gerade durch solche Sachen gesehen werden, wie Anthroposophie eigentlich mit der gewöhnlichen Wissenschaft zusammenarbeiten will. Und so möchte sie auch durchaus zusammenarbeiten mit der gewöhnlichen Wissenschaft, zum Beispiel in bezug auf die Erdschichten. Man nimmt ja durchaus an, was die gewöhnliche Wissenschaft zu sagen hat über das Durcheinander-schmeißen und Durcheinanderwürfeln in den Alpen. Nur kann man nicht mitgehen, wenn man annimmt, das wird so herumgeschmissen mit den Kräften, die heute noch da sind; sondern da waren eben Lebenskräfte da, die nur dieses Lebendige durcheinanderschmeißen können! - Also, Anthroposophie steckt wahrlich in der gewöhnlichen Wissenschaft schon drinnen. Die gewöhnliche Wissenschaft will nur da überall aufhören, wo sie zu faul ist, an diese Dinge wirklich heranzukommen.
Dann am Mittwoch um neun Uhr Fortsetzung.
ÜBER WELT- UND MENSCHENENTSTEHUNG UND DEN GANG DER KULTURENTWICKELUNG DER MENSCHHEIT. ERNÄHRUNGSFRAGEN
VIERTER VORTRAG Dornach, 9. Juli 1924
Vielleicht können wir fortsetzen und beenden - wenn wir so weit kommen -, was wir das letzte Mal angefangen haben, meine Herren.
Ich habe Ihnen also auseinandergesetzt, wie man sich vorzustellen hat, daß nach und nach die Erde sich entwickelt hat und wie der Mensch geistig eigentlich immer da war. Physisch, also dem Körperlichen nach, kommt aber der Mensch erst dann heraus, wie wir gesehen haben, wenn die Erde eigentlich tot geworden ist, wenn die Erde selber ihr Leben verloren hat. Sehen Sie, man hat erst vor verhältnis-mäßig kurzer Zeit die Erde so angesehen, daß man, wie ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe, darinnen die Versteinerungen suchte, um das Alter der Schichten zu bestimmen. Man hat überhaupt solche Vorstellungen, wie sie jetzt sind in der äußeren Wissenschaft, sich verhältnis-mäßig spät gemacht, und wir haben ja gesehen, inwiefern diese Vorstellungen eigentlich falsch sind, nicht eigentlich bestehen können ge-genüber den wirklichen Tatsachen.
Nun müssen Sie aber sich klarmachen: Man findet, wenn man in die Erde so hineinbohrt und hineingräbt, wie ich es Ihnen auseinandergesetzt habe, wenn man so etwas durchsucht wie das Alpenmassiv, die durcheinandergeworfenen Schichten, findet dann, wie Versteinerungen in den Schichten sind; man findet dann durchaus bestimmte Pflanzen, Tiere in jeder einzelnen Schicht. Und diejenigen Tiere, diejenigen Pflanzen, die wir heute zumeist haben, die heute die Erde erfüllen, die sind eigentlich erst spät aufgetreten. Die früheren Pflanzen- und Tierformen waren verschieden von den heutigen Pflanzen- und Tierformen.
Nun sehen Sie, daß die Erde nicht einfach ganz langsam entstanden ist, daß also nicht eine Schichte über der anderen sich aufgeschichtet hat, bis sie langsam entstanden ist, das kann man nicht bloß daran sehen, daß die Alpen so durcheinandergeworfen sind, sondern man kann es zum Beispiel an folgendem sehen: Es gab Tiere, die ähnlich waren unseren Elefanten, nur größer. Unser Elefant ist schon groß
genug, aber das waren noch mächtigere Tiere mit noch dickeren Häuten, also noch stärkere Dickhäuter. Diese Tiere, die lebten einmal. Und daß sie gelebt haben, das kann man daran sehen, daß sie gefunden wurden im nördlichen Sibirien, das ist also im nördlichen Asien, da wo Rußland nach Asien hinübergeht. Aber alle diese merkwürdigen Tiere, diese Mammuttiere, die wurden gefunden als ganze Tiere mit dem frischen Fleisch.
Ja, sehen Sie, Tiere mit noch frischem Fleisch erhält man bekanntlich, wenn man sie zum Beispiel ins Eis gibt. Nun, diese Tiere waren in der Tat im Eis drinnen! Nämlich am Nördlichen Eismeer, wo Sibirien gegen den Nordpol hingeht, da waren diese Tiere und sind heute noch drinnen - frisch, wie wenn sie gestern von Riesenmenschen gefangen worden, ins Eis gegeben, aufgehoben worden wären! Und da muß man sich doch sagen: Diese Tiere leben heute nicht; das sind uralte Tiere. Diese Tiere können auch ganz unmöglich langsam vereist sein; sie sind heute noch da als ganze Tiere. Das kann nur dadurch geschehen sein, daß plötzlich, als diese Tiere dort gelebt haben, eine mächtige Wasserrevolution gekommen ist, die vereist ist gegen den Nordpol und diese Tiere auf einmal aufgenommen hat.
Nun, daraus sehen wir schon, daß es auf der Erde in früheren Zeiten ganz außergewöhnlich zugegangen ist, so zugegangen ist, daß man es mit dem heutigen Zustand nicht vergleichen kann. Und wenn man so etwas wie die Alpen sich anschaut, dann muß man sich auch vorstellen, daß das nicht Millionen von Jahren gedauert haben kann, sondern daß das verhältnismäßig kurz sich abgespielt haben muß. Also muß in der Erde alles gebrodelt haben und gelebt haben - geradeso wie es zugeht in einem Magen, nachdem man eben gegessen hat und dann anfängt zu verdauen. Aber das kann nur im Lebendigen geschehen. Die Erde muß einmal lebendig gewesen sein. Und die Kräfte sind zunächst noch zurückgeblieben, die in der Erde waren. Da gab es große, plumpe Tiere. Unsere mehr schlanken, geschmeidigen Tiere haben sich eben gebildet, nachdem die Erde selber abgestorben war, kein Tier mehr war. Diese großen Elefanten, die Mammuttiere, waren noch sozusagen wie Läuse auf dem alten Körper der Erde, sind nur mit einer einzigen Welle, die vereist ist, zugrunde gegangen.
Daraus können Sie entnehmen, wie sehr das stimmt, was ich gesagt habe in bezug darauf, daß unsere jetzige Erde eigentlich eine Art von Weltenleichnam ist. Und erst als die letzten Zustände eintraten auf dieser Erde, erst da konnte der Mensch entstehen.
Nun, ich will Ihnen noch etwas anführen, woraus Sie sehen können, wie die Erde sich verändert hat, verhältnismäßig noch spät verändert hat. Sehen Sie, wir haben da, wenn wir das so oberflächlich zeichnen, Amerika (es wird gezeichnet). Hier haben wir dann Europa: Norwegen, Schottland, England, Irland, da kommen wir herüber nach Frankreich, Spanien; da geht es dann herüber nach Italien, Deutschland; da ist der Bottnische Meerbusen.
Wenn man heute, sagen wir zum Beispiel von Liverpool nach Amerika fährt, so macht man diese Strecke. Man fährt durch den Atlantischen Ozean. Nun will ich Ihnen etwas sagen: Da herüben - da unten ist dann Afrika -, da herüben sind gewisse Pflanzen und gewisse Tiere, überall - man muß namentlich das kleine Viehzeug nehmen -sind also Pflanzen und Tiere. Wenn man sich heute diese Pflanzen und Tiere anschaut, die auf der einen Seite an den Westküsten von Europa und da unten von Afrika vorkommen, und auf der anderen Seite an der Ostküste von Amerika, dann stellt sich heraus, daß diese Pflanzen und Tiere etwas miteinander verwandt sind. Sie sind etwas verschieden, aber sie sind miteinander verwandt. Nun, warum sind denn diese miteinander verwandt? Sie sind verwandt aus dem Grunde - heute ist die Sache so: da unten ist Meeresboden, da oben ist das atlantische Wasser; hier käme dann Afrika. Sehen Sie, wie die Pflanzen und Tiere da (in Amerika> sind, und wie sie da (in Europa und Afrika) sind, das kann man sich nur erklären, wenn einmal hier überall Land war, der Boden hoch war und die Tiere hier herübergehen konnten, hier überall, und die Pflanzen auch ihren Samen nicht über den Ozean schickten, sondern stückweise ins Land schickten. Wo also heute zwischen Europa und Amerika eine riesige See ist, ein riesiges Meer ist, da war einstmals Land. Der Boden ist gesunken. Überall, wo der Boden sinkt, kommt gleich Wasser. Wenn Sie irgendwo nur bis zu einer gewissen Tiefe graben, die Erde ausgraben, gleich kommt Wasser. Wir müssen also annehmen: Da ist der Boden gesunken.
Merkwürdig ist es zum Beispiel da - da ist Italien, da liegt die Stadt Ravenna. Wenn man von Ravenna gegen das Meer hin geht, dann hat man heute mehr als eine Stunde zu gehen; aber man trifft See-muscheln und Seeschnecken auf dem Grund, wo man gegen das Meer hin geht von Ravenna. Das bezeugt einem wiederum: Da war einstmals Meer. Und Ravenna, das heute eine Stunde vom Meer entfernt ist, lag einstmals ganz an der See, die See grenzte an. Da wiederum hat sich der Boden gehoben, in die Höhe gehoben, und das Wasser ist dadurch abgelaufen. Wenn sich der Boden nun besonders stark hebt, dann verödet der Boden, dann wird es kalt, wie es in den Gebirgen geschieht. Eine solche Gegend, wo es kalt geworden ist - wenn ich hier weiter zeichnen würde, würde da Sibirien sein -, das ist die Gegend von Sibirien. Sibirien zeigt durch alles das, was es an Pflanzenwachstum hat und so weiter, daß es einstmals den Boden tiefer hatte, daß der mächtig in die Höhe gestiegen ist.
Aus alledem sehen Sie, daß Land fortwährend steigt und sinkt an gewissen Punkten der Erde; es steigt auf, sinkt, und man sieht, daß Land und Wasser auf der Erde zu verschiedenen Zeiten in der verschiedensten Weise verteilt ist. Wenn man die Gesteine vom britischen Reich, von England, Schottland und Irland ansieht, sich die Schichten selbst anschaut, dann kommt man darauf, daß dieses England viermal auf und ab gesunken ist im Laufe der Zeit! Wie es oben war, sind gewisse Pflanzen gewachsen, bis es untergegangen ist. Wie es wieder hinaufgegangen ist, da war natürlich alles verödet. Es bedeckte sich mit einer ganz anderen Pflanzen- und Tierwelt, und man kann heute noch sehen:
Viermal ist das auf und ab gegangen.
Also der Boden der Erde ist in einer fortwährenden Bewegung. Und er war in einer viel größeren, riesenhaften Bewegung in alten Zeiten. Wenn heute alles so bewegt wäre, wie es in alten Zeiten war, dann wäre es den Menschen schon recht unheimlich, denn die letzten Nachrichten von mächtigen Erdbewegungen, die allerletzten Nachrichten sind ja eigentlich diejenigen, die nur sagenhaft auf die Menschen gekommen sind als die Sintflut. Aber die Sintflut ist ja eine Kleinigkeit gegen dasjenige, wie es einmal auf der Erde in riesenmäßigen Ausdehnungen zugegangen ist.
Sehen Sie, meine Herren, es entsteht dadurch die Frage: Wie ist überhaupt der Mensch auf diese Erde gekommen? Wie ist der Mensch aufgetreten? - Nun sind ja darüber die allerverschiedensten Ansichten entstanden. Die bequemste Ansicht, die sich die Leute heute gebildet haben, ist diese, daß es einmal affenähnliche Tiere gegeben hat, die haben sich immer mehr und mehr vervollkommnet und sind Menschen geworden. Das ist ja eine Ansicht, welche die Wissenschaft im letzten Jahrhundert vertreten hat. Die Wissenschaft vertritt sie heute nicht mehr; aber die Leute, die eben immer Nachzügler sind von der Wissenschaft, die glauben das natürlich heute noch. Nun, die Sache ist diese: Wie könnte man sich aber nun vorstellen, daß der Mensch auf der Erde als physischer Mensch, wie er heute ist, sich gebildet hat? Ein großer Rummel sozusagen, eine riesige Begeisterung war, als am Ende des 19. Jahrhunderts ein reisender Gelehrter, Dubois, in Ostasien Teile von einem Skelett entdeckt hat in solchen Erdschichten, von denen man bisher geglaubt hat, der Mensch ist da nicht drinnen, kann da noch nicht gewesen sein. Es waren nur Teile von einem Skelett, das man für ein Menschenskelett angesehen hat, nämlich ein Oberschenkel, ein paar Zähne, Stücke vom Schädel. Das hat nun der Dubois gefunden drüben in Asien und hat - solch eine Sache muß natürlich einen anständigen Namen haben - diese Überreste, respektive das Wesen, das menschenaffenähnliche Wesen, das einmal gelebt haben sollte, genannt: Pithecanthropus erectus. Also dieses Wesen soll darstellen, so war man der Ansicht, ein affenartiges Geschlecht, aus dem sich dann die Menschheit allmählich heraus entwickelte. Und jetzt glauben die Menschen in verschiedener Weise, wie sich eigentlich der Mensch entwickelt haben soll. Die einen sagen, da war einmal ein affenartiges Geschlecht; das ist in bestimmte Lebensverhältnisse gekommen, wo es hat anfangen müssen zu arbeiten; so sind umgebildet worden die Füße, die affenartigen Kletterfüße zu richtigen Füßen, die vorderen Kletterfüße zu menschlichen Händen, und so habe sich das eben verwandelt. Aber die anderen sagen wiederum: Nein, das kann nicht so sein; denn wenn dieser Affenmensch in diese so ungünstigen Verhältnisse gekommen wäre, dann wäre er einfach ausgestorben, dann hätte er sich nicht umwandeln können; er muß vielmehr gelebt haben, dieser Affenmensch,
da schon in einer Art paradiesischem Zustand, wo er nicht hat arbeiten müssen, wo er sich hat frei entwickeln können, wo er geschützt war. - Sehen Sie, so weit gehen die Ansichten auseinander! Aber all das hält nicht stand, wenn man die wirkliche Untersuchung der Tatsachen aufgreift, von der wir ja schon gesprochen haben.
Gehen wir noch einmal zurück. Hier war einstmals (es wird gezeichnet) eine große Landfläche, wo heute der Atlantische Ozean ist, durch den man fährt, wenn man von Europa nach Amerika fährt -große Landstrecken. Aber sehen Sie, wenn man wiederum das untersucht, was da hier etwas unter der Erde versteinert ist, was also die Versteinerungen sind, und woraus man sehen kann, wie die früheren Formen, die früheren Arten der Pflanzen und Tiere da waren, dann findet man: Da kann alles nicht so gewesen sein! Da muß die Erde, die da war zwischen dem heutigen Europa und Amerika, noch viel weicher gewesen sein, nicht so festes Gestein wie heute; und die Luft muß noch viel dicker gewesen sein, immer neblig, viel Wasser und andere Stoffe noch enthalten haben. So daß man also da einen viel weicheren Erdboden hatte und eine viel dickere Luft. In solch einer Gegend, wenn es das heute noch auf der Erde geben würde, könnten wir, wenn wir hinkämen, keine Woche leben; da würden wir gleich aussterben. Aber nun müßten ja natürlich, weil das gar nicht so lange her sein kann, zehntausend bis fünfzehntausend Jahre, dazumal schon Menschen gelebt haben. Aber die können auch nicht so gewesen sein wie die heutigen Menschen. Der heutige Mensch hat seinen festen Knochenbau nur deshalb, weil draußen harte Erde ist, harte Mineralien sind. Zu unseren kalkartigen Knochen gehören draußen die kalkarti-gen Berge; mit denen tauschen wir ja fortwährend auch den Kalk aus:
wir trinken ihn mit ihrem Wasser und so weiter. Dahier gab es noch keine so festen Knochengerüste. Da konnten wir Menschen, wenn wir damals lebten, nur solche weichen Knorpeln haben wie heute die Haifische. Und durch Lungen konnte man auch nicht so atmen wie heute. Da mußte man eine Art von Schwimmblasen haben und eine Art von Kiemen; so daß also der Mensch, der da lebte, seiner äußerlichen Gestalt nach halb Mensch und halb Fisch war. Man kommt gar nicht hinüber über die äußerliche Sache, daß der Mensch ganz anders ausgesehen
hat, halb Mensch und halb Fisch war. Besonders wenn wir in Zeiten zurückgehen, die noch früher zurückliegen, da haben wir den Menschen viel, viel weicher. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, ist er wässerig, ist er ganz flüssig. Da bilden sich natürlich keine Versteinerungen davon, sondern da geht er eben auf in der übrigen Flüssigkeit der Erde. So daß man also sieht: So wie wir heute dastehen, sind wir erst geworden. Wir sind ja auch ein kleines Flüssigkeitsklümpchen, wenn wir zuerst im Mutterleib noch sind. Nun, das ist verkümmert, das ist klein; dazumal waren wir große, mächtige flüssige oder weiche gallertartige Wesen. Und je weiter man zurückgeht in der Erdenentwickelung, desto flüssiger wird der Mensch, desto mehr ist er eigentlich bloß weiche, gallertartige Masse. Nicht aus dem heutigen Wasser -aus heutigem Wasser kann man natürlich keinen Menschen machen -, aber aus so etwas wie einer eiweißartigen Substanz läßt sich schon dann der Mensch formen.
Da kommen wir in eine Zeit zurück, wo es weder die heutigen Menschengestalten gegeben hat, noch heutige Elefanten, noch Rhinozerosse, noch Löwen, noch Kühe, noch Ochsen, noch Stiere, keine Känguruhs; alles das hat es noch nicht gegeben. Dagegen hat es, könnte man sagen, fischähnliche Tiere gegeben - nicht so wie die heutigen Fische, schon menschenähnlich -, halb menschenähnliche, halb fisch-ähnliche Tiere, die man ebensogut Menschen nennen könnte. Das hat es also gegeben. All die heutigen Gestalten von Tieren hat es nicht gegeben.
Dann hat sich die Erde allmählich verwandelt in die Gestalt, wie sie heute ist. Der Boden des Atlantischen Ozeans senkte sich hinunter; immer mehr und mehr ging das sumpfige, schleimartige, eiweißhaltige Wasser über in das heutige Wasser, bildete sich allmählich immer mehr um dasjenige, was als solche Fischmenschen vorhanden war. Aber es entstanden die verschiedensten Formen. Die mehr unvollkommenen dieser Fischmenschen wurden Känguruhs, die ein bißchen vollkommeneren wurde Hirsche und Rinder, und diejenigen, die am vollkommensten waren, wurden Affen, oder Menschen. Aber Sie sehen daraus:
Es stammt der Mensch gar nicht in dem Sinne vom Affen ab, sondern der Mensch war da, und alle Säugetiere entstanden eigentlich aus dem
Menschen heraus von denjenigen Menschen formen, in denen der Mensch unvollkommen geblieben ist. So daß man vielmehr sagen kann, der Affe stammt vom Menschen ab, als der Mensch stammt vom Affen ab. Das ist nun schon so, und man muß sich über diese Dinge ganz klar sein.
Sehen Sie, das könnten Sie sich durch das Folgende veranschaulichen. Denken Sie einmal, es ist ein recht gescheiter Mensch; der hat einen kleinen Sohn. Der kleine Sohn hat einen Wasserkopf und bleibt sehr dumm. Man kann sagen: Der gescheite Mensch ist vielleicht fünfundvierzig Jahre alt, der kleine Sohn sieben, acht Jahre alt; der entwickelt sich dumm. Ja, darf da irgendein Mensch sagen: Weil der Kleine ein kleiner, unvollkommener Mensch ist, deshalb stammt der alte Mensch, der vollkommene, gescheite Mensch, von dem kleinen, unvollkommenen ab? Das wäre ja Unsinn! Der kleine Unvollkommene stammt von dem Gescheiten ab! Das wäre eine Verwechslung. Dieselbe Verwechslung hatte man begangen, indem man geglaubt hat, Affen, die zurückgebliebene Menschen sind, seien die Urväter der Menschen. Sie sind eben nur zurückgebliebene Menschen, sind sozusagen die unvollkommenen Vorläufer der Menschen. Man kann schon sehen: Die Wissenschaft war da auf einem Wege, der sie recht stark in den Irrtum hin-einführte, und einfache Menschen konnten sich das ja auch nicht so recht vorstellen. Man braucht nur an die Geschichte zu erinnern, wie ein kleiner Rotzjunge nach Hause gekommen ist - der Schullehrer hatte gerade, weil er angestochen war von der modernen Wissenschaft, erklärt in der Schule: Die Menschen stammen vom Affen ab - und sagte:
Heute habe ich etwas Großartiges gelernt: Die Menschen stammen vom Affen ab! - Da sagte der Vater: Du dummer Junge, bei dir kann das der Fall sein, bei mir aber nicht! - Sehen Sie, das war der naive Mensch gegenüber dem Darwinismus. Die Wissenschaft ist eben manchmal nicht eigentlich so gescheit, wie der naive Mensch es ist! Das muß man sich sagen.
Und so kann man sagen: Alles dasjenige, was an Tieren da draußen in der Welt lebt, das stammt von einem Urwesen ab, das weder Tier noch Mensch war, sondern das dazwischen liegt. Die einen sind unvollkommen geblieben, die anderen sind vollkommener geworden, sind
Menschen geworden. - Da kommen natürlich jetzt die Leute und sagen:
Ja, aber die Menschen waren doch früher viel unvollkommener als sie heute sind! Die Menschen waren doch früher so, daß sie einen Schädel gehabt haben mit einer niederen Stirn, einer solchen Nase (es wird gezeichnet), die Neandertalmenschen, oder die Menschen, die man in Jugoslawien gefunden hat. Man findet sie ja nur selten; man darf nicht glauben, daß da überall die Skelette so herumliegen; es wurden nur immer wenige gefunden. Der heutige Mensch hat in der Regel seine schöne Stirn und so weiter, sieht also anders aus. Nun sagen die Menschen: Ja, da finden wir also diese Urmenschen mit ihrer niederen Stirn; die waren natürlich dumm, denn in der Stirne, da sitzt der Verstand, und erst die Menschen, welche die hohen Stirnen kriegten, hatten den richtigen Verstand. Daher waren die Urmenschen dumm, verständnislos, und die späteren Menschen mit den hohen Stirnen, den vorgesetzten Stirnen, die hatten eben den rechten Verstand.
Ja, sehen Sie, meine Herren, wenn man sich diese atlantischen Menschen angeschaut hätte, diese Menschen, die da gelebt haben, bevor der Boden des Atlantischen Ozeans gesunken ist und ein Meer entstand, da hätte man gefunden: Ja, diese Menschen, die hatten schon eigentlich ein ganz dünnes Häutchen, wenige weiche Knorpel, wie ein Netz, wie als Hülle des Kopfes, im übrigen überall Wasser! Wenn Sie sich heute einen richtigen Wasserkopf anschauen: der hat gar nicht eine zurückliegende Stirn, der hat gerade eine hohe, vorgerückte Stirn, und der ist viel ähnlicher diesem Wasserkopf; den könnten die Atlantier gehabt haben! -Nun denken Sie sich, die Atlantier haben also diesen Kopf gehabt, aber wässerig, so wie wir es heute beim Embryo sehen. Sehen Sie, das wäre die Erde (es wird gezeichnet); jetzt ist das über die Erde gekommen, daß der Boden des Atlantischen Ozeans sich gesenkt hat, daß der Atlantische Ozean entstanden ist, Europa und Asien immer mehr aufgetaucht sind. Denn da hebt sich alles, in Amerika hebt sich es auch, dahier senkt es sich. Die Erde verändert sich. Die Menschen bekamen mehr harte Knochen. So daß da, wenn wir in frühere Zeiten gehen, in die Zeit, wo da (auf dem Gebiete des heutigen Atlantischen Ozeans) noch festes Land war, ganz weiche Knochen dadrinnen waren, Knorpeln. Da schaute das noch so aus (es wird auf die Zeichnung verwiesen);
da war Wasser. Und diese Menschen, die konnten auch mit dem Wasser denken. - Da werden Sie sagen: Donnerwetter, jetzt setzt er uns auch noch das vor, daß die Leute dazumal nicht mit einem festen Hirn, sondern mit einem wässerigen Hirn gedacht hätten! - Ja, meine Herren, Sie denken alle nicht mit dem festen Gehirn! Sie denken nämlich alle mit dem Gehirnwasser, in dem das Gehirn drinnen schwimmt; es ist ein Aberglaube, daß man mit dem festen Gehirn denke. Nicht einmal die Dickschädel, die ganz eigensinnig sind, die gar nichts anderes auffassen können als ihre eigenen Ideen, die sie in ihrer frühen Jugend aufgenommen haben, nicht einmal die denken mit dem festen Gehirn; die denken auch mit dem Gehirnwasser, wenn auch mit den mehr verdichteten Stellen im Gehirnwasser.
Da kam aber die Zeit, wo diese Art von Wasser, diese schleimige, eiweißartige Form von Wasser verschwand. Die Menschen konnten nicht mehr damit denken; die Knochen blieben zurück, und es entstanden diese niedrigen Schädel. Und erst später wuchsen sie wieder aus -in Europa und in Amerika drüben - zu einer hohen Stirn. So daß Sie sagen müssen: Die Atlantier, die alten Atlantier, die hatten in ihrem wäßrigen Kopf gerade eine sehr hohe Stirne, und dann kam, als dies zurückging, zuerst die niedrige Stirn, und die wuchs sich nach und nach wiederum aus zu den höheren Stirnen. Das ist eben eine Zwischenzeit, wo die Menschen so waren wie der Neandertalmensch, oder die, die man in Südfrankreich oder in Südslawien ausgegraben hat. Das ist ein Übergangsmensch, ein Mensch, der gelebt hat, als gerade in den Küstengebieten sich der Boden nach und nach gesenkt hat. Und diese Menschen, wie man sie heute ausgräbt in Südfrankreich, die sind also nicht die früheren Menschen, sondern das ist der spätere Mensch! Es sind Vorfahren, aber schon spätere Menschen.
Und das Interessante ist: In derselben Zeit, in der diese Menschen mit der flachen, niedrigen Stirn gelebt haben müssen, in derselben Zeit findet man Höhlen, in denen Dinge drinnen sind, aus denen man annehmen kann, die Menschen haben dazumal nicht in gebauten Häusern drinnen gelebt, sondern in Erdhöhlen, in die sie sich hineingegraben haben. Aber da mußte erst die Erde hart geworden sein. Also in der Zeit, in der die Erde noch nicht ganz so hart war wie heute, sondern
wenigstens noch etwas weniger hart war, da bohrten sich die Leute noch in die Erde hinein ihre Wohnungen, und die findet man auch heute noch. Aber, was man da findet, das sind merkwürdige Zeichen, merkwürdige Malereien, die verhältnismäßig einfach sind, die aber doch ganz geschickt wiedergeben Tiere, die dazumal gelebt haben. Und man ist eigentlich erstaunt, daß diese Menschen mit der flachen Stirne, mit dem unentwickelten Kopf diese Zeichnungen gemacht ha-haben. Diese Zeichnungen sind zugleich gescheit, und in einer anderen Beziehung wiederum ungeschickt. Wie kann man sich das erklären? Nur dadurch, daß eben einmal die Menschen gelebt haben mit der hohen, noch flüssigen Stirn, und daß diese eine besondere Kunst schon gehabt haben, vielleicht sogar viel mehr gekonnt haben als wir heute. Und das ist dann verkümmert. Und das, was man da findet in den Höhlen, das sind eben die letzten Reste von dem, was die Menschen noch gekonnt haben, was sich noch fortgebildet hat. So daß man darauf kommt: Es haben die Menschen einmal nicht bloß als Tiere gelebt und sich bis zum heutigen Zustand vervollkommnet, sondern bevor das heutige Menschengeschlecht mit seinen festen Knochen auf der Erde da war, war ein anderes Menschengeschlecht mit mehr Knorpeln da, das schon einmal eine höhere Kultur und Zivilisation gehabt hatte. Da wo heute Meer ist, da war einmal schon eine höhere Zivilisation.
Und sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, daß auch die Vögel in alten Zeiten anders waren, als sie heute sind. Die Vögel waren so, daß sie eigentlich einmal ganz aus Luft bestanden haben; das andere haben sie sich erst herumgebildet. Daher sind die Knochen der Vögel alle innerlich mit Luft ausgefüllt. Diese Vögel waren einstmals Tiere, die nur aus Luft bestanden haben, aber aus einer dicken Luft. Und die heutigen Vögel, die haben eben ihre Federn und so weiter gebildet, als unsere heutige Luft entstanden ist. Denken Sie einmal, die heutigen Vögel - sie haben sie ja in Wirklichkeit nicht, aber wir können uns das ja vorstellen -, die hätten Schulen, die hätten eine Kultur; das müßte aber anders ausschauen, als es bei uns jetzt ausschaut! Nehmen wir zum Beispiel an, wir bauen uns Häuser. Darin besteht ein großer Teil unserer Kultur. Die können sich keine Häuser bauen, denn die würden ja herunterfallen; auch können die Vögel keine Bildhauer werden,
denn alles würde herunterfallen; nicht einmal nähen können sie - das gehört auch zu der Kultur -, denn wenn sie die Nadel nur ein bißchen fallen lassen, so würde das auch herunterfallen. Wenn diese Vögel eine Zivilisation und Kultur hätten, wie könnte die denn sein? Die müßte so sein, daß sie oben in der Luft sein könnte. Aber das kann ja nichts Festes hervorbringen, sie könnten keinen Schreibtisch haben, gar nichts; sie könnten sich höchstens Zeichen machen, die gleich wiederum vorbei sind, wenn sie gemacht sind. Wenn der andere dann die Zeichen verstehen würde, nun ja, dann wäre eine Kultur da. Denken Sie sich also, ein Adler wäre ein sehr gescheites Tier, ein Adler könnte eine Statue der Eule machen - nun ja, er müßte sie aber bloß in der Luft machen; es würde nichts mehr da sein, wenn man es sich anschaut. Nun, jetzt käme die Eule; sie wäre besonders eitel, läßt sich eine Eulenstatue vom Adler machen; der würde das sehr schön machen, alles sehr schön; gerade wenn eine kleine Wolke da ist vielleicht, so daß er etwas dickere Luft hat, würde er es machen; aber es würde gleich wiederum verschwinden. Andere Vögel könnten zufliegen, andere Eulen auch, die könnten das bewundern. - Ja, die Vögel haben das heute nicht! Sie können ganz sicher sein: Die Adler bildhauern keine Eule! Aber diejenigen Wesenheiten, die einstmals Mensch waren in ihren weichen Gestalten, ihrem weichen Körper, die hatten eine solche Kultur und Zivilisation! Als zum Beispiel Land da war, wo heute der Atlantische Ozean ist, da konnten die Dinge schon mehr oder weniger fest bleiben, stehenbleiben und so weiter, wenn sie auch immer wieder versanken; aber es war schon dichter. Aber dem ging ein noch dünnerer Zustand voran; da gab es nur eine solche Kultur und Zivilisation, die man in Zeichen machte, die gleich wieder vergingen. So daß man sich vorstellen muß, daß eben diese Menschen alles einmal machten, und daß die Sachen nicht da geblieben sind, sondern daß sie in ganz feiner Materie drinnen waren. Und als sie später anfingen, die Sachen mehr gröber zu machen, da wurde es ungeschickt. Es ist ja auch heute leichter, in weichem Wachs irgend etwas auszubilden als in dem härteren Ton. Und gar als die Menschen nur in einer Art dicken Luft ihre ganze Kultur und Zivilisation hatten, da hatten sie ihre Freude daran, etwas zu machen, wenn das auch gleich wiederum unterging.
Ja, aber jetzt, meine Herren, sind wir schon sehr weit zurückgekommen, haben also Menschen gefunden, die eigentlich ziemlich luftartig sind, nur aus dickerer Luft sind. Wenn Sie sich das so vorstellen, daß da so ein Mensch aus dickerer Luft ist, so nimmt sich das eigentlich aus wie eine Wolke, nur nicht so unregelmäßig geformt wie eine Wolke, sondern er hat stark eben Gesichtartiges, Kopfartiges, Gliedmaßenartiges (Zeichnung) - aber das ist ja schon etwas sehr Geistiges, das ist ja schon fast ein Gespenst! Wenn Ihnen heute so etwas begegnete, meine Herren, nun ja, da würden Sie es für ein Gespenst ansehen, noch dazu für ein ganz kurioses Gespenst! Und es würde ganz fischähnlich und doch wieder menschenähnlich aussehen. So waren wir auch ein-mal! Da sind wir schon bei dem Zustande angekommen, wo der Mensch eigentlich ganz geistig war. Und Sie sehen: Je weiter wir zurückgehen, desto mehr finden wir, daß der Mensch den Stoff als Geistiges beherrscht. nWir können ja nur mit den weichsten Dingen unseres Stoffes noch irgend etwas anfangen, können, wenn wir ein Stück Brot in den Mund nehmen, es beißen, flüssig machen, denn alle Nahrung muß flüssig gemacht werden, wenn sie in den Menschenleib hineingehen soll. Denken Sie sich nur einmal, Sie machen Brot flüssig, es geht in die Speiseröhre, geht in den Magen, breitet sich im Blut aus. Was wird denn eigentlich aus einem Stück Brot? Das ist eine ganz merkwürdige Sache.
Nehmen Sie an, Sie haben da den Menschen vor sich, die menschliche Gestalt: das ist der Magen, die Speiseröhre, da geht es zum Mund herauf (es wird gezeichnet). Jetzt ißt dieser Mensch ein Stück Brot. Da ißt er es hinein, da wird es allmählich flüssig gemacht, der Magen macht es noch flüssiger; jetzt breitet es sich im Blut aus, geht überall hin, wird dünn, ganz dünn, breitet sich da aus.
Da habe ich also ein Stück Brot in der Hand. Ich esse es - wie schaut es denn aus nach einiger Zeit? Nach drei Stunden, wenn es sich ausgebreitet hat im Blut, im ganzen Körper, schaut es so aus: Dieses Stück Brot ist selber ein Mensch geworden! Und so gestalten Sie alles, was Sie mit den Speisen einessen, zum Menschen um; Sie merken es nut nicht. Sie merken nicht, daß eigentlich alles, was Sie in sich aufnehmen, fortwährend den Menschen macht. Sie könnten auch gar nicht ein
Mensch sein, wenn Sie nicht fortwährend den Menschen neu machen würden. Denn wenn Sie heute, am 9. Juli, essen: Das wird noch ein ganz dünner, winzig dünner Mensch; davon bleibt etwas zurück, das andere geht weg. Am nächsten Tag ist es wiederum so; aber dabei wird Ihr Körper ausgetauscht. Er wird ja alle sieben Jahre ausgetauscht.
Nun, meine Herren, wir brauchen aber diesen in sich schon festen Körper, damit wir immer diesen neuen Menschen machen können. Aber diesen festen Körper hatten die früheren Menschen nicht. Die konnten aus ihrer Seele heraus das, was sie aufnahmen, so gestalten, daß es in der damaligen Art menschenähnlich wurde. Sie müssen sich vorstellen, daß sie das alles nicht brauchten, was Muskeln und Knochen sind, sondern daß sie auf seelische Art die Speisen so gestalten konnten, daß sie menschenähnlich waren. So war es aber sicher. Der Mensch beherrschte durch seinen Geist die Materie, den Stoff, bildete seine eigene Gestalt, allerdings viel dünner, aus. Aber so war er da, so eine menschenähnliche, schwebende Wolke. Die ist ja heute noch da, nur brauchen wir heute ein Modell dazu: Es müssen schon Knochen und Muskeln da sein. Und in Wirklichkeit machen wir es, indem wir uns ernähren, heute noch so. So dünn, wie es heute ist, was sich in uns findet, wenn wir essen, so dünn war der Mensch einmal.
Und dann atmet der Mensch die Luft: Jetzt ist sie draußen, gleich nachher ist sie wiederum drinnen. Es breitet sich die Luft durch das Blut überall aus: Es entsteht heute noch der luftige Mensch, sehen Sie, durch den ganzen Menschen durch! Der luftige Mensch entsteht. Wenn ich Ihnen also sage: Einmal war der Mensch luftartig, bevor er sich verdichtet, kristallisiert hat durch seine Knochen -, so sage ich Ihnen da gar nicht etwas, was es nicht heute noch gibt. Jedesmal, wenn Sie einen Atemzug machen, machen Sie noch diesen Luftmenschen. Nur hatte in früheren Zeiten bloß der Luftmensch bestanden, und die festen, dichten, erdigen Bestandteile, die haben sich erst hineingebildet.
Wir kommen also zurück und sehen, daß dasjenige, was wir heute in fester, dichter Materie sehen, einmal durch und durch geistig war. Es ist also ein Unsinn, zu sagen, daß einmal die Erde nur Gas war und daß sich das Gas durch seine eigenen Kräfte zu alledem gebildet hat, was heute Menschen sind, was heute Tiere sind, sondern wir sehen, daß
die Menschen, die Tiere, alles das, was jetzt da ist, eben selber einstmals gasförmig, luftförmig war, sich umgebildet hat. Und so treffen wir eine Gestaltung unserer Erde, die einmal so gewesen sein muß: Sehen Sie, da war dieses Eiland, wo heute Wasser ist, wo wir drüberfahren, da war also Land; dazumal war der Boden von Europa noch tief unten; der hat sich erst später heraufgehoben, an einzelnen Stellen war er oben. Jetzt kommen wir nach Europa. Da haben wir einen Erdboden, der noch tief unten ist, der oben noch mit Sumpfwasser bedeckt ist, kommen nach Asien herüber, wo alles noch mit Sumpfwasser bedeckt ist. Es sind Länder gewesen, da drüben in Amerika, da war auch noch Sumpf. Diejenigen Gegenden, die heute feste Erde sind, die waren noch Meer; was heute Meer ist, war Land. Da darauf lebten Menschen, die ganz anders ausschauten, also dünn waren. Erst als sich die heutigen Länder herauf-hoben aus dem Wasser und die früheren Länder sich senkten, so daß sie Meer wurden, erst da entstand das heutige Menschengeschlecht, entstanden die heutigen Tiere in der Form, wie sie sind. Das hängt zusammen mit dem inneren Leben der Erde.
Nur geht das heute alles subtiler vor sich. Heute heben und senken sich nicht mehr so stark die Länder, aber ein bißchen noch immer. Und wer heute Karten ansieht - sogar in der Schweiz ist es so -, die nur Jahrhunderte alt sind, der sieht, daß es auf solchen Karten noch vorkommt: Da ist ein See, heute liegt irgendein Ort weit weg vom See -aber man erkennt, dieser Ort, der muß, geradeso wie Ravenna einst-mais am Meer gelegen hat, an diesem See gelegen haben. Ja, Seen trocknen aus, werden kleiner, auch heute noch. Nur geht es langsamer vor sich, als es einmal vor sich gegangen ist. Aber damit, daß sich die Flächen, die Landflächen und die Seeböden heben und senken, damit verändert sich auch fortwährend die Menschheit und verändern sich alle Tiere. Die sind in einer fortwährenden Umbildung. Nur geht es eben langsamer vor sich, als es einmal vor sich gegangen ist.
Das ist es, was ich Ihnen heute noch sagen wollte. Und Sie sehen, wie das heutige Menschengeschlecht entstanden ist. Wir werden das nächste Mal einiges Geschichtliche hinzufügen, schauen, wie das Menschengeschlecht einmal da war. In der heutigen Form, da entstand ja erst die Geschichte, da entstanden erst die Menschen, indem sie gedrängt
wurden dazu, daß sie Jäger, Ackerbauer, Hirten und so weiter wurden. Das ist dasjenige, was wir dann noch als ein Stückchen Geschichte anstückeln werden eben an das, was wir jetzt über Weltund Menschenentstehung sagen konnten. - Es war sehr fruchtbar, daß uns Herr Dollinger die Frage gestellt hat. Wir haben sehr ausführlich darüber sprechen können, und wir werden, wie gesagt, das nächste Mal noch ein Stückchen Geschichte dazunehmen.
FÜNFTER VORTRAG Dornach, 12. Juli 1924
Meine Herren! Ich habe Ihnen gesagt, daß wir noch etwas die Geschichte betrachten wollen, die sich anschließt an die Weltbetrachtung, die wir angestellt haben. Sie haben gesehen, wie sich so allmählich das Menschengeschlecht aus der übrigen großen Natur herausgebildet hat. Und erst als die Lebensverhältnisse für die Menschheit eben da waren auf der Erde, als sozusagen die Erde abgestorben war, die Erde nicht mehr ihr eigenes Leben hatte, konnte sich menschliches und auch tierisches Leben so entwickeln auf der Erde, wie ich es Ihnen dargestellt habe.
Und wir haben ja auch gesehen, daß sich das erste menschliche Leben noch ganz anders als das heutige eigentlich da abspielte, wo heute der Atlantische Ozean ist. In der Zeit müssen wir uns vorstellen, daß also die Erde da, wo heute der Atlantische Ozean ist, als fester Boden da war. Ich werde Ihnen also die Sache so ungefähr noch einmal aufzeichnen (es wird gezeichnet): Da kommt man jetzt nach Asien herüber. Das ist das Schwarze Meer. Da unten ist dann Afrika. Da ist dann Rußland, und da kommen wir nach Asien herüber. Da würde dann England, Irland sein. Da drüben ist Amerika. Hier war also überall früher Land, und nur ganz wenig Land hier überall; dahier, in Europa, hatten wir eigentlich damals ein ganz riesiges Meer. Diese Länder, die sind alle im Meer. Und wenn wir da hinüberkommen, so ist Sibirien auch noch Meer; das ist alles noch Meer. Und da unten, wö heute Indien ist - da ist dann Hinterindien -, dahier war es wiederum so, daß es etwas aus dem Meer herausgestiegen ist. Also wir haben eigentlich hier etwas Land; hier haben wir wieder Land. In dem Teil, wo heute die Asiaten, die Vorderasiaten und die Europäer leben, da war eigentlich Meer, und das Land ist erst später daraus emporgestiegen. Und dieses Land, das ging viel weiter, das ging noch bis in den Stillen Ozean hinein, wo heute die vielen Inseln sind; also die Inseln Java, Sumatra und so weiter, das sind Stücke von einem ehemaligen Land, der ganze Inselarchipel. Da also, wo heute der Große Ozean ist, war wiederum viel Land; dazwischen war Meer.
Nun sind also die ersten Bevölkerungen, die wir verfolgen können, hier geblieben, wo etwas das Land sich erhalten hat. Wenn wir in Europa uns umschauen, so können wir eigentlich sagen: In Europa ist die Sache so, da ist vor heute etwa zehn-, zwölf-, fünfzehntausend Jahren erst die Erde soweit fest geworden, der Boden, daß Menschen da wohnen konnten. Vorher waren nur Seetiere da, die aus dem Meere sich herausentwickelten und so weiter. Wollte man dazumal nach den Menschen schauen, so müßte man da hinüber schauen, wo heute der Atlantische Ozean ist. Aber da drüben in Asien, in Ostasien, da waren eben auch schon Menschen in der Zeit vor zehntausend Jahren und so weiter. Diese Menschen, die haben natürlich Nachkommen hinterlassen; und die sind sehr interessant, meine Herren, diese Nachkommen gerade, denn das sind eigentlich diejenigen, die die älteste sogenannte Kultur haben auf der Erde. Das sind Völker, die wir heute als Mongolenvölker bezeichnen, das sind Japaner und Chinesen. Die sind eigentlich deshalb sehr interessant, weil sie Überreste sind sozusagen der ältesten Erdenbevölkerung, von der noch etwas geblieben ist.
Natürlich gibt es ja, wie Sie gesehen haben, eine viel ältere Erden-bevölkerung; die ist aber ganz zugrunde gegangen. Das ist die Bevölkerung, die hier in der alten Atlantis gelebt hat. Von der ist nichts mehr vorhanden. Denn da müßte man, selbst wenn Reste davon vorhanden wären, auf dem Boden des Atlantischen Ozeans graben. Man müßte erst herunterkommen auf den Boden - das ist schwerer als man denkt -, und dann müßte man da graben; dann würde man höchstwahrscheinlich nichts finden, weil die einen weichen Leib gehabt haben, wie ich Ihnen sagte. Und die Kultur, die sie mit den Gebärden gemacht haben, kann man auch nicht aus der Erde ausgraben, weil es nicht geblieben ist! Also das, was da viel älter ist als Japaner und Chinesen, das kann man nicht mit der äußeren Wissenschaft erreichen. Man muß Geisteswissenschaft treiben, wenn man solche Sachen erreichen will.
Aber interessant ist, was von Chinesen und Japanern geblieben ist. Sehen Sie, diese Chinesen und die älteren Japaner - nicht die heutigen; ich will gleich darüber einige Worte sagen -, die Chinesen und Japaner haben eigentlich eine Kultur, die ganz verschieden ist von der
unsrigen. Man würde viel mehr richtig von der Sache denken, wenn nicht die braven Europäer in den letzten Jahrhunderten eben ihre Herrschaft ausgedehnt hätten über diese Gebiete und alles ganz anders gemacht hätten. Das ist ja zum Beispiel bei Japan vollständig gelungen. Wenn Japan auch dem Namen nach sich selber bewahrt - das sind ja ganz Europäer geworden; die haben ja alles von den Europäern nach und nach angenommen, und es ist ihnen nur als Außerlichkeit geblieben, was ihnen von ihrer alten Kultur vorhanden war. Die Chinesen haben sich schon stärker bewahrt; aber jetzt können sie es ja auch nicht mehr. Denn die europäische Herrschaft hat sich zwar dort nicht als Herrschaft festgesetzt, aber dasjenige, was die Europäer denken, das gewinnt in diesen Gegenden die Oberhand. Denn es ist so, daß da alles verlorengeht, was einmal vorhanden war. Das ist ja nicht zu bedauern. Das ist einmal so in der Entwickelung der Menschheit. Aber sagen muß man es.
Nun, wenn wir zunächst, weil es bei denen reiner erscheint, die Chinesen betrachten, so ist das so, daß sie eine Kultur haben, die sich schon deshalb -~ on aller anderen Kultur unterscheidet, weil die Chinesen in ihrer alten Kultur eigentlich gar nicht dasjenige haben, was man Religion nennt. Die chinesische Kultur war noch eine religionslose Kultur.
Sie müssen sich darunter nur etwas vorstellen, meine Herren, unter «religionsloser Kultur». Nicht wahr, wenn man die Kulturen in Betracht zieht, die Religionen haben, so hat man überall, zum Beispiel in diesen altindischen Kulturen, die Verehrung von Wesenheiten, die unsichtbar sind, die aber doch so ähnlich ausschauen wie der Mensch auf der Erde. Das ist die Eigentümlichkeit aller späteren Religionen, daß sie sich die unsichtbaren Wesen so menschenähnlich vorstellen.
Nicht wahr, das tut die Anthroposophie nicht mehr. Die stellt sich die übersinnliche Welt nicht mehr menschenähnlich vor, sondern so wie sie eben ist, und geht auch dazu über, in den Sternen und so weiter den Ausdruck des Übersinnlichen zu sehen. Das Merkwürdige ist, daß etwas Ähnliches die Chinesen schon gehabt haben. Die Chinesen verehren nicht unsichtbare Götter, sondern die Chinesen sagen: Dasjenige, was hier auf der Erde ist, das ist verschieden, je nach dem Klima, je
nach der Bodenbeschaffenheit, in der man ist. - Sehen Sie, China war ja schon in den allerältesten Zeiten ein großes Land, ist ja heute noch größer als Europa! Es ist ein Riesenland, ist immer ein Riesenland gewesen, hat eine ungeheuer große, starke Bevölkerung gehabt. Nicht wahr, daß die Bevölkerung auf der Erde zunimmt, das ist ja nur eine abergläubische Vorstellung der heutigen Wissenschaft, die immer nur rechnet mit dem, womit sie rechnen will. In Wahrheit waren in ältesten Zeiten auch die Riesenbevölkerungen in China und auch drüben in Südamerika und auch in Nordamerika. In ältesten Zeiten ging ja auch dort das Land heraus gegen den Stillen Ozean. Nun, gegen das ist eigentlich unsere Erdenbevölkerung nicht gewachsen.
Also es ist da eine ganz alte Kultur, meine Herren. Diese Kultur kann man heute noch beobachten so, wie sie vor zehntausend, acht-tausend Jahren durchaus vorhanden war. Da hatten sich diese Chinesen gesagt: Ja, da oben, da ist ein anderes Klima, ein anderer Boden als da unten; da ist alles verschieden. Da ist das Pflanzenwachstum verschieden, da mußten die Menschen in verschiedener Weise leben. Aber die Sonne kommt überall hin: Die Sonne scheint da oben, die Sonne scheint da unten, die geht ihren Weg, die geht aus den wärmeren Gegenden zu den kälteren Gegenden und so weiter. - So sagten sich diese Leute: Auf der Erde herrscht Verschiedenheit; die Sonne macht alles gleich. - Und sie sahen daher in der Sonne dasjenige, was alles befruchtet, was alles gleich macht. Deshalb sagten sie: Wenn wir einen Herrscher haben, so muß der auch so sein. Die einzelnen Menschen sind verschieden, aber der muß wie die Sonne die Leute beherrschen. - Deshalb nannten sie ihn den Sohn der Sonne. Der war also verpflichtet, so zu regieren auf Erden, wie die Sonne in der Welt regiert. Die einzelnen Planeten: Venus, Jupiter und so weiter treiben Verschiedenes; die Sonne macht alles gleich als Herrscher über diese Planeten. Und so stellten sich die Chinesen vor, daß derjenige, der der Herrscher ist, der Sohn der Sonne ist. Nicht wahr: Unter «Sohn» verstand man eigentlich im wesent-lichen dasjenige, was zu irgend etwas gehört.
Und nun war das ganze übrige Leben so eingerichtet, daß die Leute sich sagten: Nun ja, der Sohn der Sonne, das ist unser wichtigster Mensch; die anderen sind seine Helfer, so wie die Planeten und so
weiter die Helfer der Sonne sind. - Und sie richteten auf Erden alles so ein, wie es ihnen oben bei den Sternen erschien. Und das alles machten sie, ohne daß sie beteten. Die Chinesen kannten das nicht, was man ein Gebet nennt. Das taten sie, ohne daß sie im Grunde so etwas hatten, was später ein Kultus war. Sie richteten sich dasjenige, was man ihr Reich nennen könnte, so ein, daß es ein Abbild des Himmels war. Man kann das noch nicht Staat nennen; das ist ein Unfug, den die heutigen Menschen treiben. Aber sie richteten sich dasjenige, was auf Erden war, so wie ein Abbild desjenigen ein, was ihnen am Sternenhimmel erschien.
Sehen Sie, dadurch kam etwas heraus, was natürlich ganz anders war als das Spätere; dadurch wurde man Bürger eines Reiches. Man gehörte nicht zu einem Religionsbekenntnis, man fühlte sich nur als zu einem Reich gehörig. Götter hatten die Chinesen ursprünglich schon gar nicht; wenn sie später Götter hatten, so waren die von den Indern übernommen. Ursprünglich hatten sie keine Götter, sondern sie drückten alles das, was sie als Beziehung zu den übersinnlichen Welten hatten, in ihrem Reichswesen aus, in dem sie ihre Einrichtungen hatten. Daher hatten diese Einrichtungen so etwas Familienhaftes. Der Sohn der Sonne war zugleich der Vater der übrigen Chinesen, und die dienten ihm. Wenn es auch ein Reich war, es hatte das Ganze etwas von Familienhaftem.
Das alles ist nur möglich, wenn die Menschen überhaupt noch gar kein solches Denken haben wie die späteren Menschen. Und die Chinesen hatten noch kein solches Denken wie die späteren Menschen. Was wir heute denken, war den Chinesen noch ganz fremd. Wir denken zum Beispiel Tier und denken Mensch; wir denken Vase, wir denken Tisch. So dachten die alten Chinesen nicht, sondern die Chinesen wußten: Es gibt einen Löwen, einen Tiger, einen Hund, einen Bären - aber nicht, daß es ein Tier gibt. Sie wußten: Der Nachbar hat einen eckigen Tisch; der andere hat einen etwas runderen Tisch. Die einzelnen Dinge nannten sie; aber das, was Tisch ist, das kam ihnen gar nicht in den Sinn. Den Tisch als solchen, den kannten sie nicht. Sie wußten: Da ist der eine Mensch mit einem etwas größeren Kopf, mit längeren Beinen, da ist der andere Mensch mit einem etwas kleineren
Kopf, mit kürzeren Beinen und so weiter. Da ist ein kleiner Mensch, da ist ein großer Mensch; aber Mensch im allgemeinen kannten sie nicht. Sie dachten ganz anders. Der heutige Mensch kann sich nicht hineinversetzen in die Art und Weise, wie die Chinesen dachten. Daher brauchten sie auch andere Begriffe. Wenn man so denkt, sehen Sie:
Tisch, Mensch, Tier - was ist dann? Das kann man juristisch ausbilden, denn die Juristerei besteht nur aus solchen Begriffen; aber die Chinesen konnten sich noch keine Juristerei ausdenken. Da war alles so eingerichtet wie in einer Familie. In der Familie sieht man nicht nach im Obligationenrecht, wenn der Sohn oder die Tochter etwas tun wollen. Wenn man heute etwas tun will in der Schweiz, schlägt man das Obligationenrecht, Eherecht und so weiter auf. Da ist dann alles drinnen. Das muß man dann auf das einzelne anwenden.
Insofern die Menschen noch ein bißchen etwas vom Chinesischen in sich haben - es bleibt ja immer ein bißchen was! -, da kennen sie sich noch nicht recht aus im Obligationenrecht; da müssen sie dann zum Advokaten gehen. Sie kennen sich auch noch nicht in allgemeinen Begriffen aus, die Leute. Die Chinesen, die hatten auch keine Juristerei. Sie hatten überhaupt eigentlich alles dasjenige noch nicht, was dann später zum Staatswesen wurde. Sie hatten nur dasjenige, was der einzelne Mensch wiederum im einzelnen sehen konnte.
Nun weiter. Davon ist zum Beispiel die ganze Sprache der Chinesen beeinflußt. Nicht wahr, wenn wir sagen: Tisch - so stellen wir uns darunter unbedingt etwas vor, was eine Platte hat und entweder eins, zwei oder drei Beine und so weiter, aber es muß etwas sein, was eben so wie ein Tisch stehen kann. Und wenn einer kommt und vom Stuhl sagt, das wäre ein Tisch, würden wir ihm sagen: Du bist ein Esel, das ist doch kein Tisch, das ist doch ein Stuhl. - Und wenn gar einer kommen würde und würde zu dem da (Wandtafel) Tisch sagen, da würden wir ihm sagen: Das ist ein doppelter Esel, denn das ist doch eine Tafel und kein Tisch! - Wir müssen eben nach dem, wie wir gerade unsere Sprache haben, jedes Ding mit einem Namen bezeichnen.
Das ist bei den Chinesen nicht der Fall, sondern sagen wir - ich will es nur hypothetisch anführen, es ist nicht genau so, aber Sie bekommen eine Vorstellung davon -, sagen wir, der Chinese hat einen Laut OA,
IOA, TAO meinetwillen, er hat den Laut für Tisch zum Beispiel. Aber dieser selbe Laut, der bedeutet dann noch vieles andere. Also, sagen wir, so ein Laut, der kann bedeuten: Baum, Bach, auch, sagen wir, Kieselstein und so weiter. Dann hat er einen anderen Laut, der kann bedeuten, sagen wir Stern, auch Tafel und zum Beispiel Bank. Ich meine nicht, daß das in der chinesischen Sprache so wirklich ist, aber es ist so aufgebaut. Jetzt weiß der Chinese: er hat zwei Laute, sagen wir zum Beispiel Lao und Bao, und beides bedeutet ganz Verschiedenes, nur Bach bedeuten sie beide; dann setzt er beides zusammen:
Baolao. So baut er seine Sprache auf! Er baut seine Sprache nicht auf Namen auf, die dem einzelnen gegeben sind, sondern er setzt sie so zusammen, wie die verschiedenen Laute Verschiedenes bedeuten. Es kann Baum, aber auch Bach bedeuten. Wenn er dann einen Laut hat, der unter vielem anderem Baum, aber auch Bach bedeutet, so setzt er diesen mit einem anderen zusai:amen; dann weiß der andere, daß er den Bach meint; aber wenn er nur einen Laut ausspricht, dann weiß keiner, was gemeint ist. Und so kompliziert ist es auch mit dem Schreiben. So daß also die Chinesen eine außerordentlich komplizierte Sprache und eine außerordentlich komplizierte Schrift haben.
Ja, aber daraus folgt vieles, meine Herren. Daraus folgt, daß man nicht so leicht wie bei uns lesen und schreiben lernen konnte, nicht einmal sprechen. Bei uns kann man wirklich sagen: Lesen und Schreibe ist kinderleicht, und wir sind sogar alle unglücklich, wenn unsere Kinder nicht lesen und schreiben lernen; es muß eben «kinderleicht» sein. Das ist bei den Chinesen nicht so; da wird man ein alter Bursche, bis man schreiben lernen kann oder die Sprache beherrscht. Daher kann man sich auch vorstellen, daß eigentlich das Volk das alles nicht kann, und daß nur diejenigen, die bis ins höchste Alter lernen, das alles beherrschen. Daher ist in China von selbst den Gebildeten ein geistiger Adel gegeben. Also in China ist dieser geistige Adel durch das, was in der Sprache und Schrift ist, hervorgerufen. Und wiederum ist es nicht so, wie es im Westen der Fall ist, wo der Adel einigermaßen ernannt ist und dann sich forterbt, sondern in China ist es nur möglich, eine solche Rangstellung sich zu erringen durch Bildung, durch Gelehrsamkeit.
Es ist sehr merkwürdig, meine Herren: Wir müssen natürlich, wenn wir äußerlich heute beurteilen wollen, immer betonen: Wir wollen nur ja keine Chinesen werden! - Also Sie müssen das nicht so auffassen, als ob ich sagen wollte, wir wollen Chinesen werden oder China besonders bewundern. Das ist etwas, was natürlich einige Leute einem leicht nachsagen können, und als wir in Wien vor zwei Jahren einen Kongreß hatten, da hat einer von uns davon geredet, daß die Chinesen heute noch verschiedene Einrichtungen haben, die weiser sind als die unsrigen. Flugs haben die Zeitungen geschrieben, wir wollten für Europa die chinesische Kultur haben! - Nicht wahr, das ist also nicht damit gemeint! Nur wird man, wenn man die chinesische Kultur beschreibt, so sprechen, daß man in eine Art, nur in eine Art von Lob hineinkommt, weil sie ja etwas Geistiges hat. Nur ist sie primitiv; sie ist so, daß man sich jetzt nicht mehr darauf einlassen kann. Also Sie müssen deshalb schon nicht glauben, daß ich wünsche, daß man China in Europa einführt! Aber ich will Ihnen doch beschreiben diese älteste Menschheitskultur, wie sie eben wirklich war.
Nun weiter: Das, was ich da sagte, hängt nun überhaupt zusammen mit der ganzen Art und Weise, wie diese Chinesen dachten und fühlten. Die Chinesen nämlich und auch die älteren Japaner beschäftigten sich auch sehr viel, außerordentlich viel mit ihrer Kunst, ihrer Art von Kunst; sie malten zum Beispiel. Ja, wenn wir malen, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn diese Chinesen malen! Sehen Sie, wenn wir malen - ich will das Einfachste machen -, wenn wir zum Beispiel eine Kugel malen (es wird gezeichnet), sagen wir, wenn so das Licht kommt, dann ist diese Kugel hier hell, dahier ist sie dunkel, da ist sie im Schatten, da trifft das Licht vorbei; da ist sie wiederum auf der Lichtseite ein bißchen hell, weil da das zurückgeworfene Licht kommt -, dann sagen wir, das ist Selbstschatten, weil da das zurückgeworfene Licht kommt; und dann müßten wir hier noch extra aufmalen den Schatten, den sie auf den Boden wirft, den Überschatten. Das ist das eine, wie wir malen. Wir müssen Licht und Schatten auf unseren Dingen haben. Wenn wir ein Gesicht malen, dann malen wir hierher Helligkeit, wenn da das Licht kommt; dahier machen wir es dunkel. Ebenso sehen wir vom Menschen, wenn wir richtig malen, einen Schatten, der auf den Boden fällt.
Aber außerdem müssen wir bei unserem Malen noch etwas berücksichtigen. Nehmen wir an, ich stehe da und ich will malen. Da sehe ich da vorne den Herrn Aisenpreis sitzen, und da hinten sehe ich den Herrn Meier und die beiden Herren, die da hinten sind; die muß ich auch malen: Herrn Aisenpreis ganz groß, Herrn Meier und die beiden Herren da hinten ganz klein. So werden sie auch auf der Photographie, wenn ich photographiere, ganz klein.Wenn ich das male, mache ich das so, daß ich die Herren, die auf der vordersten Reihe sitzen, ganz groß male, die nächsten kleiner, die nächsten noch kleiner, und der da ganz hinten sitzt, der hat einen winzig kleinen Kopf, ein winzig kleines Gesicht. Da sehen Sie, man muß nach der Perspektive malen. Das muß man auch bei uns. Wir müssen nach Licht und Schatten malen, wir müssen nach der Perspektive malen. So ist es einmal in unserer Denkweise.
Ja, die Chinesen, meine Herren, die kannten weder Licht noch Schatten beim Malen, noch kannten sie eine Perspektive, weil sie überhaupt nicht so gesehen haben wie wir! Die haben gar nicht geachtet auf Licht und Schatten, auf die Perspektive; denn die haben so gesagt:
Aisenpreis ist doch nicht ein Riese, und Meier ist doch nicht ein kleiner, winziger Zwerg! Die können wir doch nicht so durcheinanderstellen auf einem Bild, daß der eine ein Riese, der andere ein Zwerg wäre; das ist doch eine Lüge! Das ist doch gar nicht wahr! - Die haben sich so hineingedacht in alles und haben so gemalt, wie sie sich hineingedacht haben. Und die Chinesen und Japaner, wenn sie in ihrer Art malen lernen, lernen sie es nicht so, daß sie es von außen anschauen, sondern sich hineindenken in die Dinge; sie malen alles von innen heraus, wie sie sich es denken müssen. Das macht das Wesen der chinesischen und japanischen Malerei aus.
Also Sie sehen: Das Sehenlernen, das tritt erst später in der Menschheit auf. Die Menschen, die da im alten China waren, die haben nur in ihrer Art bildlich gedacht; sie haben nicht allgemeine Begriffe gebildet, wie Tisch und so weiter, aber das, was sie gesehen haben, haben sie innerlich erfaßt. Das ist auch gar nicht wunderbar, meine Herren, denn die Chinesen kamen ja von einer solchen Kultur her, bei der man nicht so gesehen hat. Wir sehen heute so, weil die Luft zwischen uns und dem
Gegenstand ist. Aber diese Luft war ja nicht da in den Gegenden, aus denen die Chinesen herkamen. In den Zeiten, von denen die Chinesen herkamen, da sah man noch nicht so. In älteren Zeiten wäre es ein Unsinn gewesen, von Licht und Schatten zu reden, weil es das noch nicht gab in der Luftdichte. So hat sich das bei den Chinesen erhalten, daß sie Licht und Schatten nicht haben für die Dinge, die sie malen, und nicht haben irgendeine Perspektive. Das kommt erst später auf. Daraus sehen Sie schon, wie die Chinesen ganz anders innerlich denken. Sie denken nicht so wie die späteren Menschen.
Aber all das hinderte die Chinesen gar nicht, daß sie es in bezug auf äußere Geschicklichkeiten sehr weit brachten. Sehen Sie, in der Zeit, als ich noch jung war, jetzt ist es etwas anders geworden, da hat man halt in der Schule gelernt: Das Schießpulver hat Berthold Schwarz erfunden. Und es war so gemeint, als wenn es früher niemals ein Schießpulver gegeben hätte und der Berthold Schwarz aus Schwefel, Kali-salpeter und Kohle einmal, als er seine alchimistischen Versuche gemacht hat, das Schießpulver gefunden hätte. Nun, die Chinesen haben aber schon das Schießpulver vor Jahrtausenden gemacht!
Dann lernte man in der Schule: Gutenberg hat die Buchdrucker-kunst erfunden. - Man lernte da vieles auch richtig, aber es schaut so aus, als ob es früher niemals einen Buchdrucker gegeben hätte. Die Chinesen hatten ihn schon vor Jahrtausenden! Ebenso hatten die Chinesen die Holzschneidekunst, konnten die wunderbarsten Sachen aus Holz herausschneiden. Also die Chinesen haben in diesen Äußerlichkeiten eine hohe Kultur gehabt. Und diese Kultur war wiederum nur der letzte Überrest einer Kultur, die früher noch höher war; denn das sieht man dieser chinesischen Kunst an, daß sie herstammt von etwas, was noch höher war.
Nun, das Eigentümliche aber bei diesen Chinesen, das ist eben das, daß sie gar nicht in Begriffen denken können, sondern nur in Bildern; aber dann versetzen sie sich in das Innere der Gegenstände hinein. Und so können sie auch alle die Gegenstände machen, die durch äußere Erfindungen gemacht werden, wenn es nicht gerade Dampfmaschinen sind oder so etwas. Und so, wie die Chinesen heute, man kann schon sagen, verlottert und unkultiviert sind, so sind sie eigentlich erst geworden,
nachdem sie eigentlich wirklich jahrhundertelang malträtiert worden sind von den Europäern.
Da sehen Sie, meine Herren, daß es eine Kultur hier gab, die eigentlich in gewissem Sinne geistig ist, und die ganz alt ist, die auf zehntausend Jahre vor unsere Zeit schon zurückgeht. Und verhältnismäßig spät, erst in dem Jahrtausend, das vor dem Christentum liegt, da haben solche Leute wie der Laatse> der Konfutse, dasjenige, was diese Chinesen gehabt haben an Kenntnissen, aufgeschrieben. Aber diese Herren haben nichts anderes aufgeschrieben als dasjenige, was sich so ergeben hat im Familienumgang des großen Reichs. Die haben gar nicht das Bewußtsein gehabt, daß sie etwas erfinden als Moral-, Sittlichkeitsregeln und so weiter, sondern dasjenige, was sie vorgefunden haben, wie sich die Chinesen benommen haben, das haben sie aufgeschrieben. Früher hat man es nur ausgesprochen. Also alles war im Grunde genommen anders dazumal. Nun, sehen Sie, das ist dasjenige, was sich gewissermaßen heute noch an den Chinesen beobachten läßt.
An den Japanern läßt sich das kaum mehr beobachten, weil sie sich ganz europäisiert haben und sie alles der europäischen Kultur nachmachen. Daß sie nicht aus ihnen selber gewachsen ist, diese Kultur, das geht daraus hervor, daß sie das, was rein europäisch ist, nicht aus sich selber heraus finden können. Da passierte ja zum Beispiel einmal folgendes: Die Japaner sollten ein Dampfschiff verwenden; sie haben sich eingebildet, das könnten sie schon ganz wunderbar verwenden. Sie haben zum Beispiel abgeguckt, wie man umdreht mit einem Dampf-schiff, was man da für eine Schraube aufmacht und so weiter. Nun, dann haben die Lehrer, die Europäer, das eine Zeitlang mit den Japanern durchgemacht; dann waren die Japaner schon stolz und haben gesagt:
Das können wir jetzt selber machen, wir können selber einen Kapitän stellen. - Nun haben sich die europäischen Lehrer auf dem Lande aufgestellt, und die Japaner sind mit ihrem Dampfschiff aufs hohe Meer hinausgefahren. Nun wollten sie auch das Umdrehen probieren, machten die Schrauben auf, und siehe da, das Schiff drehte um - aber dann wußten sie nicht, wie man wieder zumacht; und nun drehte das Schiff fortwährend, tanzte auf dem Meer herum, und die europäischen Lehrer, die an der Küste standen, mußten in einem Boot auf das Meer
fahren und das Schiff erst wiederum zum Stillstand bringen. - Sie wissen, daß es ein Gedicht von Goethe gibt: «Der Zauberlehrling», wo ein Junge von einem alten Zaubermeister sich die Sprüche abgelauscht hat. Nun hat er gelernt, damit er nicht selber das Wasser holen muß, durch Zauberspruch einen Besen zu verwandeln, daß der das Wasser herbeihole. Nun fängt er an, als der alte Meister einmal weg-ging, sich das Wasser vom Besen bringen zu lassen. Die Worte, die hatte er, daß er den Besen veranlassen konnte, das Wasser zu bringen. Und nun fängt der Besen an, immer Wasser und Wasser zu bringen - aber nun hat der Junge vergessen, wie er ihn wiederum zum Stillstand bringen kann! Nun denken Sie, wenn Sie Wasser hätten im Zimmer und der Besen immer wieder Wasser bringt, bis der Lehrling sogar den Besen zerhackt: da werden sogar zwei Besen daraus, die bringen beide jetzt Wasser! Als alles schon überschwemmt ist und immer mehr Wasser kommt, da ist der alte Meister gekommen, der das Wort sagte, so daß der Besen wieder zum Besen geworden ist.
Nicht wahr, das Gedicht ist neulich hier eurythmisiert worden, machte den Leuten riesigen Spaß. So erging es auch den Japanern: Die hatten auch nicht gewußt, wie die Schraube wieder zurückgedreht werden mußte, und das Schiff da draußen drehte und drehte sich. Da war da draußen so ein richtiger Schiffstanz, bis die auf dem Lande stehenden Lehrer mit dem Boot hinausfahren konnten und dem wieder ab-halfen.
Daraus geht hervor: Europäische Sachen eigentlich erfinden können die Chinesen nicht - das können auch die Japaner nicht-, aber erfinden die eigentlich älteren Sachen, wie Schießpulver, Buchdruck und so weiter, darauf sind diese in viel, viel älteren Zeiten gekommen als die Europäer.
Nun, sehen Sie, der Chinese hat eben großes Interesse für die Umwelt, großes Interesse für die Sterne, wie überhaupt großes Interesse für die Außenwelt.
Ein anderes Volk, das nun auch weit zurückweist auf alte Zeiten, das ist dann das indische. Aber so weit wie das chinesische weist das indische nicht zurück. Das indische Volk hat auch eine alte Kultur. Aber diese alte Kultur, die ist, ich möchte sagen, erst später als die
chinesische aus dem Meer aufgestiegen. Die Leute, die da im späteren Indien waren, die sind mehr vom Norden, als das dann hier vom Wasser frei wurde, heruntergekommen, haben sich dann da niedergelassen.
Nun, diese Inder haben, während die Chinesen sich mehr für das, was außen in der Welt ist, interessierten, in jedes Ding sich hineindenken konnten, mehr in sich hineingebrütet. Die Chinesen haben mehr über die Welt nachgedacht, in ihrer Art, aber eben über die Welt nachgedacht; die Inder dachten mehr über sich nach, über den Menschen selber. Daher entstand eine sehr verinnerlichte Kultur in Indien. In den ältesten Zeiten war nun die indische Kultur auch noch religionsfrei, denn auch in die indische Kultur ist die Religion erst später hereingekommen. Man hat hauptsächlich den Menschen betrachtet, aber man hat den Menschen innerlich betrachtet.
Sehen Sie, das kann ich Ihnen auch wiederum aus dem, wie diese Inder gezeichnet und gemalt haben, am besten erklären. Wenn die Chinesen einen Menschen gesehen haben, haben sie ihn einfach gemalt, indem sie sich in ihn hineingedacht haben, ohne Licht und Schatten, ohne Perspektive. Also wenn ein Chinese schon hätte Herrn Burle malen wollen, so hätte er sich hineingedacht in ihn; er hätte ihn da nicht schwarz gemacht, wie wir es heute machen, und da hell - Licht und Schatten hätte er nicht gemacht; er hätte auch nicht die Hände im Verhältnis, weil wir die Hände immer vorne haben, etwas größer gemacht. Aber wenn der Chinese den Herrn Burle nun gemalt hätte, dann wäre eben der Herr Burle da auf dem Bild.
Bei den Indern war das ganz anders. Denken Sie sich, die Inder hätten gemalt. Da hätten sie angefangen, hätten versucht, den Kopf zu malen - Perspektive hatten sie ja auch nicht. Aber dann wäre ihnen gleich eingefallen: Der Kopf könnte auch anders sein - da hätten sie gleich einen zweiten, einen dritten gemacht, noch anders, und dann wäre ihnen ein vierter und fünfter eingefallen. So hätten sie nach und nach zwanzig, dreißig Köpfe nebeneinander gehabt! So viel ist ihnen eingefallen bei dem einen Kopf. Oder bei einer Pflanze, wenn sie die gemalt hätten: gleich fiel ihnen ein, die könnte auch anders sein - und dann entstanden gleich viele, viele junge Pflanzen, die aus der älteren
hervorwuchsen! So war es bei den ältesten Indern. Die haben diese riesige Phantasie gehabt. Die Chinesen haben gar keine Phantasie gehabt, die machten nur das einzelne, aber sie dachten sich in das einzelne hinein. Die Inder hatten diese riesenhafte Phantasie.
Nun, sehen Sie, meine Herren, das ist ja nicht da; wahrhaftig, wenn man Herrn Burle ansieht, da hat man nur einen Kopf, und wenn man ihn da hinmalt (an die Tafel), kann man auch nur einen Kopf malen. Also man malt nichts, was äußerlich wirklich ist, wenn man da zwanzig, dreißig Köpfe malt; da malt man etwas, was nur im Geiste gedacht ist. Und so wurde die ganze indische Kultur. Die wurde eine ganz innerlich geistige Kultur. Daher, wenn Sie indische geistige Wesen sehen, wie die Leute es sich gedacht haben, dann haben sie diese mit vielen Köpfen, mit vielen Armen gemalt oder so, daß anderes, Tierisches aus dem herausgeht, was also da im Körper ist und so weiter.
Sehen Sie, diese Inder, das sind ganz andere Menschen als die Chinesen. Die Chinesen sind phantasielos, die Inder sind ursprünglich voll Phantasie. Daher waren die Inder auch geeignet, nach und nach ihre Kultur ins Religiöse umzuwandeln. Die Chinesen haben nie ihre Kultur, bis heute nicht, ins Religiöse umgewandelt; in China gibt es keine Religion. Die Europäer, sehen Sie, die alles miteinander verwursteln, die reden von einer chinesischen Religion. Kein Chinese wird das zugeben! Der sagt: Ihr in Europa habt eine Religion, die Inder haben eine Religion; wir haben nicht das, was eurer Religion ähnlich ist -, sagen die Chinesen. Nun, aber das, wie diese Inder veranlagt waren, das war nur möglich dadurch, daß diese Inder eine ganz genaue Kenntnis hatten, was die Chinesen nicht so hatten, von dem menschlichen Körper. Der Chinese konnte sich in alles, was außen ist, sehr gut hineinversetzen. Deshalb malte er auch so, wie ich es Ihnen sagte. Wenn er aber auch andere Dinge wahrnahm, dann konnte er sich gut hinein-versetzen. Sehen Sie, wenn wir auf unserem Tisch Essig stehen haben und Salz und Pfeffer und wollen wissen, wie diese Dinge schmecken, dann müssen wir Pfeffer und Salz und Essig erst auf die Zunge kriegen; dann wissen wir, wie es schmeckt. Das war beim alten Chinesen nicht so: Der schmeckte die Dinge schon, wenn sie draußen waren. Er konnte sich wirklich in sie hineinversetzen. Und mit dem Äußeren war
der Chinese gut vertraut. Daher hatte er auch Ausdrücke, die zeigten, daß er teilnahm an der Außenwelt. Wir haben nicht mehr solche Ausdrücke - höchstens bedeuten sie bei uns etwas Bildliches. Beim Chinesen bedeuteten sie etwas Wirkliches. Wenn ich einen Menschen kennen-lerne, und ich sage: Das ist ein säuerlicher Mensch -, dann werden Sie sich etwas Bildliches vorstellen. Daß er wirklich sauer ist wie Essig, das stellen Sie sich dann nicht vor. Aber beim Chinesen bedeutete das, daß dieser Mensch in ihm hervorgerufen hätte einen säuerlichen Geschmack.
Nun, das war bei den Indern eben nicht so. Die Inder, die konnten sich vielmehr in den eigenen Körper vertiefen. Wenn wir uns in den Körper vertiefen, dann können wir nur unter gewissen Umständen etwas fühlen in unserem Körper. Wenn jedesmal, wenn wir eine Mahlzeit hinter uns haben, diese Mahlzeit im Magen liegen bleibt, der Magen nicht ordentlich verdauen kann, dann fühlen wir Schmerzen in unserem Magen; wenn unsere Leber nicht in Ordnung ist, nicht genügend Galle absondern kann, dann fühlen wir Schmerzen auf der rechten Seite des Körpers, dann werden wir leberkrank. Wenn unsere Lunge zu viel Exsudate, also Absonderungen, von sich gibt, so daß sie mit Schleim ausgefüllt wird, den sie nicht haben soll, so fühlen wir: Die Lunge, die ist nicht richtig in Ordnung, die ist krank. Der heutige Mensch fühlt den Körper nur in denjenigen Organen, wo er krank ist. In diesen älteren Zeiten fühlte der Inder auch die gesunden Organe; er wußte, wie der Magen, wie die Leber sich anfühlt. Wenn der Mensch das heute wissen will, muß er sich einen Leichnam nehmen, muß ihn zerschnei-den; er schaut die einzelnen Organe, wie sie im Inneren sind, an. Kein Mensch wüßte heute, wie eine Leber ausschaut, wenn man sie nicht sezieren würde - außerdem: die Geisteswissenschaft ist in der Lage, sie zu beschreiben! Die Inder, die dachten den Menschen von innen her; sie hätten alle Organe zeichnen können. Nur beim Zeichnen wiederum, wenn Sie einem Inder die Aufgabe gegeben hätten, er soll seine Leber fühlen, und er soll das, was er fühlt, zeichnen, so hätte er gesagt: Leber -das ist eine Leber, das eine andere Leber, das ist wieder eine andere Leber, und er hätte zwanzig bis dreißig Lebern nacheinander aufgezeichnet.
Ja, meine Herren, da wird die Geschichte schon anders. Wenn ich einen fertigen Menschen habe und ihm zwanzig Köpfe mache, dann habe ich ein Phantasiegebilde. Wenn ich aber eine menschliche Leber aufzeichne und dabei zwanzig-, dreißigmal eine Leber mache, dann ist es wirklich so, daß ich eigentlich nicht etwas ganz Phantastisches auf-zeichne, sondern diese zwanzig, dreißig Lebern hätten eigentlich entstehen können! Es hat ja jeder Mensch seine bestimmte Form der Leber, wie er sein Gesicht hat; aber das ist nicht so arg notwendig, sondern sie könnte der Form nach auch anders sein. Und dieses, daß etwas anders sein kann, dieses Geistige an der Sache, das haben die Inder viel besser verstanden als die Späteren. Die haben gesagt: Wenn man ein einzelnes Ding zeichnet, so ist das gar nicht wahr, sondern man muß sich die Dinge geistig vorstellen. - Daher haben die Inder eine hohe geistige Kultur gehabt, haben eigentlich allmählich nicht mehr viel gegeben auf die äußere Welt, sondern haben sich alles geistig vorgestellt.
Aber diese Inder, die hielten darauf, daß man tatsächlich auch in dieser Weise die Sache lernt. Und daher war es wiederum bei ihnen so, daß man, um ein gebildeter Mensch zu werden, lange lernen mußte. Denn nicht wahr, es war nicht so, daß sich auf einmal der Mensch hat in sich vertiefen und alles daher hat wissen können; er mußte dazu erst Anleitung haben. Wenn wir einen Jungen oder ein Mädchen unterrichten, so sind wir verpflichtet, es so zu tun, daß wir es lesen und schreiben lehren und so weiter, also ihm äußerlich etwas beibringen. Das war bei den alten Indern nicht der Fall. Die haben, wenn sie wirklich jemanden etwas lehren wollten, ihn hingesetzt: Er mußte sich innerlich in sich vertiefen, er mußte sogar möglichst die Aufmerksamkeit von der Welt ablenken und auf das Innere richten. Nun aber, wenn einer sitzt und so hinschaut, so sieht er Sie alle da sitzen, und er wird auf die Außenwelt gelenkt. Das hätten die Chinesen gemacht, die lenkten die Aufmerksamkeit auf die Außenwelt. Die Inder taten anderes. Die sagten: Du mußt lernen deine Nasenspitze anzuschauen. - Dann mußte er die Augen so halten, daß er nichts anderes sah als seine Nasenspitze, nichts anderes, stundenlang, und gar nicht mit den Augen wegschaute.
Ja, meine Herren, der Europäer sagt: Das ist etwas Schreckliches, wenn man die Leute anleitet, sie sollen immer auf ihre Nasenspitze
schauen. - Gewiß, für den Europäer hat es etwas Schreckliches; er kann das nicht nachmachen. Aber im alten Indien war es eben Sitte. Derjenige, der etwas lernen sollte, sollte nicht mit den Fingern schreiben, sondern auf seine Nasenspitze sehen. Dadurch aber, daß er dasaß und stundenlang auf seine Nasenspitze sah, wurde er auf das Innere gelenkt, lernte Lunge, Leber und so weiter kennen; da wurde er wirklich auf das Innere gelenkt. Denn die Nasenspitze ist in der ersten Stunde wie in der zweiten; er sieht nichts Besonderes an der Nasenspitze. Aber von der Nasenspitze aus sieht er immer mehr und mehr in sein Inneres; da wird es im Inneren immer heller und heller.
Dazu mußten sie noch das Folgende ausüben. Nicht wahr, man ist gewöhnt, wenn man herumgeht, auf seinen Füßen zu gehen. Ja, meine Herren, dieses Auf-den-Füßen-Gehen, das übt einen Einfluß auf uns aus. Wir fühlen uns dann als aufrechte Menschen, wenn wir auf den Füßen gehen. Auch das wurde abgestellt bei denen, die etwas lernen sollten in Indien. Die mußten, während sie lernten, das eine Bein so haben und sich darauf setzen, das andere so; so daß sie also so saßen und immer auf die Nasenspitze schauten - daß sie sich ganz abgewöhnten zu stehen, sondern daß sie da das Gefühl hatten: sie sind nicht aufrechtstehende Menschen, sondern das ist verkrüppelt, das ist noch wie bei einem Embryo, wie wenn sie im Mutterleib noch wären. - So können Sie ja auch die Buddha-Figuren sehen. So mußten die Inder lernen. Und so schauten sie allmählich in ihr Inneres hinein und lernten das Innere des Menschen kennen, lernten den physischen Leib des Menschen ganz geistig kennen.
Wenn wir in uns hineinschauen, da fühlen wir das armselige Denken und ein bißchen das Fühlen, fast gar nicht mehr das Wollen. Die Inder fühlten eine ganze Welt in dem Menschen. Natürlich können Sie sich vorstellen, daß das ganz andere Menschen waren als die späteren. Und dann entwickelte sich diese ungeheure Phantasie; die haben sie in ihren dichterischen Weisheitsbüchern niedergelegt, später in den Veden oder in der Vedanta-Philosophie, die wir heute noch bewundern; sie haben sie niedergelegt in all den Legenden, die sie über die übersinnlichen Dinge haben, die wir heute noch bewundern.
Sehen Sie, das ist der Gegensatz: Die Inder waren hier, die Chinesen da drüben, und die Chinesen waren ein Volk, welches nüchtern, äußerlich war, gar nicht von innen, vom Inneren lebte. Die Inder waren ein Volk, das ganz nach dem Inneren schaute, aber eigentlich den physischen Körper, der geistig ist, im Inneren anschaute.
Nun, da habe ich Ihnen zunächst etwas von den ältesten Bevölkerungen der Erde gesagt. Meine Herren, ich werde doch noch das nächste Mal fortsetzen, damit wir weiterkommen bis herauf, wo wir jetzt leben, und wir werden also die Geschichte weiter betrachten.
Setzen Sie sich aber doch Fragen zurecht. Es wird Sie jetzt immer mehr und mehr das Einzelne und Besondere interessieren, aber ich werde das nächste Mal immer auch wiederum berücksichtigen, was mir für Fragen gestellt werden, und so allmählich weiterschreiten. -Nur kann ich Ihnen nicht sagen, wann die nächste Stunde sein wird. Ich muß jetzt nach Holland fahren, und werde Ihnen sagen lassen, wann die nächste Stunde dann sein wird, in zehn bis vierzehn Tagen.
SECHSTER VORTRAG Dornach, 31. Juli 1924
Guten Morgen! Nun, meine Herren, hat sich jemand während der langen Zeit eine Frage zurechtgelegt?
Frage: Ich möchte Herrn Doktor einmal fragen über die Nahrungsmittel - über Bohnen, Gelbe Rüben und so weiter, was die für einen Einfluß auf den Körper haben? Über Kartoffeln hat Herr Doktor ja schon gesprochen. Vielleicht können wir über andere Nahrungsmittel noch etwas hören. Manche Vegetarier essen nicht hängende Sachen, wie Bohnen, Erbsen. Wenn man zum Beispiel ein Kornfeld sieht, so gibt das einern auch wieder verschiedene Gedanken über die Brotfrucht, die sehr wahrscheinlich alle Völker der Erde, mit Variationen, haben.
Dr. Steiner: Also es wird gewünscht, daß jetzt etwas gesprochen werden soll über das Verhältnis der Nahrungsmittel zum Menschen. Nun, da ist es notwendig, daß man sich zunächst klarmacht, worauf eigentlich das Ernähren beruht. Man stellt sich zunächst vor, daß die Ernährung darauf beruht, daß der Mensch seine Nahrungsmittel aufnimmt, durch den Mund in den Magen bringt, daß sie sich dann weiter im Körper ablagern, daß er sie wiederum von sich gibt und sich wieder neu ernähren muß und so weiter. So einfach ist aber die Sache nicht, sondern die Dinge sind viel komplizierter. Und man muß, wenn man verstehen will, in welcher Weise eigentlich der Mensch zu den Nahrungsmitteln steht, sich ja erst einmal klarmachen, welcher Art die Nahrungsmittel sind, die der Mensch unbedingt braucht.
Sehen Sie, das erste, was der Mensch braucht, was er unbedingt in sich aufnehmen muß, das ist Eiweiß. Eiweiß also braucht der Mensch unbedingt. Wollen wir uns das einmal aufschreiben, damit wir die Sachen zusammen haben. Also Eiweiß, wie es im Hühnerei zum Beispiel ist; aber nicht nur im Hühnerei, sondern in allen Nahrungsmitteln ist Eiweiß. Eiweiß braucht der Mensch unbedingt. Das zweite, was der Mensch braucht, das sind Fette. Wiederum sind die Fette in allen Nahrungsmitteln drinnen. Es sind auch Fette in den Pflanzen. Das dritte hat einen Namen, der Ihnen weniger geläufig sein wird, den man aber notwendigerweise wissen sollte: Kohlehydrate. Kohlehydrate sind solche
Stoffe, wie sie am allermeisten in der Kartoffel zum Beispiel enthalten sind; aber auch in allen anderen Pflanzen sind viel Kohlehydrate. Kohlehydrate sind dadurch ausgezeichnet, daß sie sich, wenn man sie ißt, durch den Speichel des Mundes und durch den Magensaft so langsam in Stärke verwandeln. Die Stärke ist etwas, was der Mensch durchaus braucht; aber er ißt nicht Stärke, sondern er ißt solche Nahrungsmittel, welche Kohlehydrate enthalten; die verwandeln sich in ihm selber in Stärke. Und dann verwandeln sie sich noch einmal bei der weiteren Verdauung in Zucker. Und den Zucker braucht der Mensch. Also in den Kohlehydraten hat er den Zuckergehalt bei sich.
Aber etwas ist noch notwendig für den Menschen: das sind die Salze, die er aufnimmt. Er nimmt sie zum Teil als Zusatz zu den Speisen auf, zum Teil aber sind Salze in allen Speisen schon enthalten.
Wenn wir das Eiweiß betrachten, dann müssen wir bei Tier und Mensch den großen Unterschied ins Auge fassen gegenüber den Pflanzen. Die Pflanzen enthalten auch Eiweiß; sie essen aber kein Eiweiß. Wenn die Pflanzen aber trotzdem Eiweiß in sich haben, woher haben sie das? Sie haben es aus dem Boden, der Luft, aus dem Leblosen, aus dem Mineralischen; sie können nämlich aus dem Leblosen, aus dem Mineralischen ihr Eiweiß bereiten. Das kann weder das Tier noch der Mensch. Der Mensch kann nicht aus dem Leblosen Eiweiß bereiten - da würde er nur Pflanze sein können -, sondern er muß Eiweiß in sich aufnehmen, wie es wenigstens die Pflanzen oder die Tiere schon zubereitet haben.
Überhaupt braucht der Mensch zu seinem Leben auf der Erde die Pflanzen. Und die Pflanzen - das ist nun das Interessante-, die könnten nicht gedeihen, wenn nicht wiederum der Mensch da wäre! Und da ist es interessant, meine Herren, das müssen Sie nur ins Auge fassen, daß die zwei allerwichtigsten Dinge für das Leben sind: der grüne Pflanzensaft in den grünen Blättern und das Blut auf der anderen Seite. Dieses Grün im Pflanzensaft nennt man Chlorophyll, Blattgrün; also das Chlorophyll ist im grünen Blatt enthalten. Und außerdem ist wichtig das Blut. Nun, da ist etwas höchst Eigentümliches: Sehen Sie, wenn Sie den Menschen betrachten, so atmet der Mensch zunächst - das Atmen ist auch eine Ernährung -, der Mensch nimmt Sauerstoff aus der Luft
auf, er atmet Sauerstoff ein. In seinem ganzen Körper, überall, ist aber Kohlenstoff abgelagert. Wenn Sie in die Erde hineingeraten, wo ein Kohlenlager ist, so kommen Sie auf die schwarze Kohle; wenn Sie einen Bleistift spitzen, so kommen Sie auf den Graphit. Kohle und Graphit, das ist Kohlenstoff. Sie bestehen alle, außer anderen Stoffen, den ganzen Körper hindurch aus Kohlenstoff; der wird gebildet im menschlichen Körper.
Nun können Sie sagen: Ja, da ist eigentlich der Mensch ein recht schwarzer Rapuzzel gerade in bezug auf den Kohlenstoff! Aber Sie können ja auch noch etwas anderes sagen: Sehen Sie, der teuerste Körper der Welt, der Diamant, besteht auch aus Kohlenstoff, nur in einer anderen Gestalt! Also wenn Sie das lieber haben wollen, können Sie auch sagen: Sie bestehen in bezug auf den Kohlenstoff aus lauter Diamanten. Der dunkle Kohlenstoff, der Graphit des Bleistiftes und der Diamant sind derselbe Stoff. Wenn die Kohle, die Sie aus der Erde ausgraben, durch irgendeine Kunst durchsichtig gemacht werden kann, dann ist sie Diamant. Also diese Diamanten haben wir überall abgelagert in uns. Wir sind ein richtiges Kohlenlager. Wenn aber der Sauerstoff durch das Blut mit dem Kohlenstoff zusammenkommt, dann bildet sich Kohlensäure. Kohlensäure kennen Sie auch sehr gut: Sie brauchen nur Selterswasser zu nehmen; da sind die Perlen drinnen - diese sind die Kohlensäure, das ist ein Gas. So daß Sie also sich vorstellen können: Der Mensch atmet Sauerstoff durch die Luft ein, der Sauerstoff breitet sich durch das ganze Blut aus, im Blute nimmt er den Kohlenstoff auf, er atmet die Kohlensäure aus. Ein atmen Sie Sauer-stoff, aus atmen Sie Kohlensäure.
Meine Herren, es wäre in den Vorgängen, die ich Ihnen geschildert habe in der Entwickelung der Erde, längst alles durch Kohlensäure von Menschen und Tieren vergiftet. Denn die Zeit ist ja lang, seit sich alles auf der Erde entwickelt hat. Wie Sie sehen, könnten längst keine Tiere und Menschen mehr auf der Erde leben, wenn nicht die Pflanzen eine ganz andere Eigenschaft hätten: die Pflanzen, die saugen nicht Sauerstoff ein, sondern gerade Kohlensäure, die der Mensch und das Tier ausatmen. So daß also die Pflanzen ebenso gierig sind auf die Kohlensäure wie der Mensch auf den Sauerstoff.
#Bild s. 97
Und wenn Sie nun da die Pflanze haben (siehe Zeichnung>: Wurzel, Stengel, Blätter, Blüte, so saugt also die Pflanze überall Kohlensäure ein; die geht hinein. Und jetzt setzt sich der Kohlenstoff, der da in der Kohlensäure drinnen ist, in der Pflanze nieder, und der Sauerstoff wird wiederum ausgeatmet von den Pflanzen. Da haben ihn die Menschen und die Tiere wieder. Der Mensch gibt Kohlensäure her und tö-tet alles; die Pflanze behält den Kohlenstoff zurück, gibt den Sauerstoff frei und belebt damit alles. Und nichts könnte die Pflanze machen mit der Kohlensäure; wenn nicht der grüne Pflanzensaft, das Chlorophyll, da wäre. Dieser grüne Pflanzensaft, meine Herren, der ist ein Zauberer, der hält den Kohlenstoff in der Pflanze zurück und gibt den Sauerstoff wieder frei. Das Blut verbindet den Sauerstoff mit dem Kohlenstoff; der grüne Pflanzensaft nimmt den Kohlenstoff wiederum aus der Kohlensäure heraus und gibt den Sauerstoff frei.
Denken Sie, was das für eine feine Sache ist in der Natur, daß die Pflanzen, die Menschen und die Tiere sich auf diese Weise ergänzen! Sie ergänzen sich vollständig.
Nun muß man das Folgende sagen. Sehen Sie, der Mensch braucht aber nicht bloß von der Pflanze dasjenige, was sie ihm gibt durch den
Sauerstoff, sondern er braucht die ganze Pflanze; mit Ausnahme der Giftpflanzen und mit Ausnahme solcher Pflanzen, die wenig von diesen Stoffen enthalten, braucht der Mensch alle Pflanzen, indem er sie nicht durch Atmung, sondern durch Ernährung bekommt. Und da ist wiederum ein solcher merkwürdiger Zusammenhang. Sehen Sie, die Pflanze besteht ja aus der Wurzel, wenn es eine einjährige Pflanze ist -vom Baum wollen wir jetzt absehen -, aus der Wurzel, aus dem Kraut und aus der Blüte mit Frucht. Nun, schauen wir uns einmal die Wurzel an. Die Wurzel, die ist ja in der Erde drinnen; sie enthält namentlich viele Salze, weil in der Erde die Salze drinnen sind. Und die Wurzel hängt mit ihren feinen Würzelchen an dieser Erde; da zieht sie fortwährend aus der Erde die Salze heraus. So daß die Wurzel eben dasjenige ist, was mit dem Mineralreich der Erde, mit den Salzen in besonderer Verbindung steht.
Nun, sehen Sie, meine Herren, verwandt mit der ganzen Erde ist der menschliche Kopf - nicht die Füße, sondern gerade der Kopf ist mit der Erde verwandt. Wenn der Mensch anfängt Erdenmensch zu sein im Mutterleibe, hat er ja zunächst fast nur den Kopf. Beim Kopf fängt er an. Der Kopf ist dem ganzen Weltenall, aber auch der Erde nachgebildet. Und der Kopf braucht vorzugsweise Salze. Denn vom Kopf gehen die Kräfte aus, die den menschlichen Körper zum Beispiel auch mit Knochen durchsetzen. Alles dasjenige, was den Menschen fest macht, geht von der Kopfbildung aus. Wenn der Kopf selber noch weich ist, wie im Mutterleib, dann kann er nicht ordentlich Knochen bilden. Indem der Kopf selber zuerst immer härter und härter wird, gibt er die Kräfte an den Leib ab, damit der Mensch und die Tiere die festen Dinge, vorzugsweise die Knochen bilden können. Daraus sehen Sie schon, daß man die Wurzel, die mit der Erde verwandt ist und die Salze enthält - und zum Knochenbilden braucht man Salze, die Knochen bestehen aus kohlensaurem Kalk, phosphorsaurem Kalk; Salze sind das -, daraus sehen Sie, daß man die Wurzel braucht, um den menschlichen Kopf zu versorgen.
Also, meine Herren, wenn man zum Beispiel merkt, sagen wir, daß ein Kind schwach wird im Kopf, woran können Sie das merken? Man kann das manchmal an entsprechenden Zuständen merken: Wenn ein
Kind im Kopf schwach wird, dann kriegt es leicht Würmer im Gedärm. Würmer halten sich im Gedärm auf, wenn die Kopfkräfte zu schwach sind, weil dann der Kopf nicht stark genug in den übrigen Körper herunterwirkt, während die Würmer keine Behausung im Menschen finden, wenn die Kopfkräfte stark in die Gedärme herunter wirken. Daraus können Sie am allerbesten sehen, wie großartig der menschliche Körper eingerichtet ist: Alles hängt in ihm zusammen. Und wenn man ein Kind hat, das Würmer hat, soll man sich sagen, das Kind ist im Kopf schwach; man kann auch sagen - namentlich derjenige, der Pädagoge sein will, muß solche Dinge wissen -, wenn man später im Leben Menschen hat, die kopfschwach sind, so haben sie in der Jugend ihre Würmer gehabt. - Was muß man denn da tun, wenn man das beobachtet? Nun, meine Herren, das einfachste ist, wenn man Gelbe Rüben nimmt, Möhren, und füttert die Kinder eine Zeitlang damit -unter anderem; natürlich darf man sie nicht nur mit Gelben Rüben anfüttern, aber eine Zeitlang. Gelbe Rüben sind ja dasjenige, was vorzugsweise Pflanzenwurzel in der Erde ist. Die haben viel Salze; die sind imstande, da sie die Kräfte der Erde haben, wenn sie aufgenommen werden in den Magen, durch das Blut bis in den Kopf wieder zu wirken. Nur salzreiche Stoffe sind fähig, in den Kopf zu dringen. Salz-reiche Stoffe, wurzelhafte Stoffe machen den Menschen durch den Kopf stark. Das ist dasjenige, sehen Sie, was außerordentlich wichtig ist. Und gerade bei den Gelben Rüben, bei den Möhren, da ist es so, daß die allerobersten Partien des Kopfes stark werden, also dasjenige, was man gerade braucht für den Menschen, damit er innerlich kräftig, steif wird, damit er nicht weichlich wird.
Sehen Sie, wenn Sie die Pflanze von einer Gelben Rübe anschauen, so werden Sie sich sagen: Der Pflanze sehe ich etwas ganz Bestimmtes an, die ist vorzugsweise zu der Wurzel hingewachsen. Es ist ja fast alles Wurzel an der Gelben Rübe. Man interessiert sich nur für die Wurzel, wenn man die Pflanze hat. Das andere, das Kraut, ist nur so obenauf, hat nicht viel Bedeutung. Also diese Gelbe Rübe ist vorzugsweise geeignet, den menschlichen Kopf als ein Nahrungsmittel zu versorgen. Wenn Sie daher manchmal fühlen, Sie haben so eine Kopf-schwäche, eine Leere im Gehirn, können nicht gut denken, dann ist
es auch gut, wenn Sie sich Gelbe Rüben einmal eine Zeitlang in die Nahrung tun. Aber am meisten hilft das natürlich bei Kindern.
Nun, wenn Sie jetzt aber die Kartoffel vergleichen mit der Gelben Rübe - ja sehen Sie, die schaut ganz anders aus als die Gelbe Rübe. Sie wissen ja, die Kartoffel hat Kraut, aber sie hat dann gerade das, was man ißt, diese Knollen; die stecken in der Erde drinnen. Nun kann man, wenn man oberflächlich die Sache betrachtet, sagen: Bei der Kartoffel sind diese Knollen die Wurzeln. Das ist aber nicht wahr; diese Knollen sind keine Wurzeln. Wenn Sie nämlich genauer zuschauen, so werden Sie überall sehen: Da hängen eigentlich erst die Wurzeln daran an den Knollen in der Erde. Die eigentlichen Wurzeln sind kleine Würzelchen, die daranhängen an den Knollen; sie fallen nur leicht ab. Wenn man die Kartoffeln ausnimmt, sind sie schon abgefallen; aber wenn man sie ganz frisch ausnimmt, sind sie überall noch dran. Wenn wir die Knollen nehmen und essen, haben wir schon so etwas wie Stengel oder Kraut, das sich nur scheinbar wie Wurzeln ausbildet; in Wirklichkeit ist das ein Stengel oder ein Kraut; die Blätter sind umgestaltet. Das ist also etwas, was zwischen der Wurzel und dem Kraut drinnen ist. Daher hat die Kartoffel nicht so viel Salze in sich wie zum Beispiel die Rübe, ist nicht so erdenhaft; sie wächst zwar in der Erde, aber sie ist nicht so verwandt mit dem Erdigen. Und die Kartoffel, die hat vorzugsweise Kohlehydrate, nicht so viel Salze, aber Kohlehydrate.
Jetzt müssen Sie sich folgendes sagen: Wenn ich Gelbe Rüben esse, dann kann mein Körper eigentlich ein richtiger Faulenzer sein, denn er braucht nur den Mundsaft, den Speichel zu verwenden bei der Gelben Rübe, um sie aufzuweichen im Speichel; er braucht nur den Magensaft zu verwenden, das Pepsin und so weiter, und die ganze wichtige Sache von der Gelben Rübe geht in den Kopf. Der Mensch braucht die Salze. Diese Salze werden geliefert durch alles das, was Pflanzen-wurzel ist, und im besonderen Maß von einer solchen Wurzel wie der Gelben Rübe.
Nun, wenn der Mensch aber Kartoffeln ißt, gibt er sie auch zunächst in den Mund, in den Magen; da wird aus der Kartoffel erst durch die Anstrengung des Leibes Stärke gebildet. Dann geht es weiter durch den Darm. Damit es bei weitererer Verdauung bis ins Blut geht und auch
in den Kopf kommen kann, muß wiederum eine Anstrengung gemacht werden, daß aus der Stärke Zucker gewonnen wird. Dann erst kann es in den Kopf gehen. Da muß man also eine größere Kraft anwenden. Ja, sehen Sie, meine Herren, wenn ich auf etwas Außerliches eine Kraft anwenden soll, dann werde ich schwach. Das ist ja das Geheimnis des Menschen: Wenn ich Holz hacke, also wenn ich äußerlich eine Kraft an-wende, dann werde ich schwach. Wenn ich aber innerlich eine Kraft in mir ausbilde, daß ich Kohlehydrate in Stärke und Stärke in Zucker verwandle, da werde ich stark. Gerade indem ich das ausführe, daß ich mich selber mit Zucker durchsetze, dadurch daß ich Kartoffeln esse, werde ich stark. Wenn ich äußerlich Kraft anwende, werde ich schwach; wenn ich innerlich Kraft anwende, werde ich stark. Es kommt also nicht darauf an, daß man sich mit Nahrungsmitteln nur ausfüllt, sondern daß die Nahrungsmittel im Körper Kräfte entwickeln.
So daß man also sagen kann: Wurzelnahrung - denn alle Wurzeln sind so, nur nicht in demselben Grade wie die Rübenwurzel, daß sie vorzugsweise auf den Kopf wirken -, Wurzelnahrung, die gibt dem Körper dasjenige, was er für sich braucht. Nahrung, die schon ein bißchen nur nach dem Kraut neigt, Kohlehydrate hat, die gibt dem Körper Kräfte, die er zum Arbeiten braucht, zur Bewegung braucht.
Nun, über die Kartoffel habe ich schon gesprochen; sie macht den Menschen zugleich, indem sie wiederum furchtbar viel Kraftaufwand braucht, wieder schwach, und macht ihn vor allen Dingen so, daß er nicht auf die Dauer Kräfte bekommt. Aber das Prinzip, das ich Ihnen jetzt auseinandergesetzt habe, gilt gerade eben für die Kartoffel.
Aber in demselben Maße wie die Kartoffel im schlechteren Sinne, sind im guten Sinne alle die Saatfrüchte Nahrungsmittel: Weizen oder Roggen und so weiter. Da drinnen sind nun auch die Kohlehydrate, und zwar so, daß der Mensch in der günstigsten Weise Stärke bereitet, Zucker bereitet, sich also eigentlich durch die Kohlehydrate der Feld-früchte so stark machen kann, als es nur möglich ist. - Denken Sie nur einmal, wie stark gerade die Leute auf dem Lande werden dadurch, daß sie einfach viel von ihrem Brot essen, in dem die Feldfrüchte drinnen sind! Sie müssen nur an sich schon gesunde Körper haben; gerade wenn man gröberes Brot verträgt, ist es eigentlich die allergesündeste
Nahrung. Sie müssen gesunde Körper haben; aber dann wird gerade der Körper durch die Stärke- und Zuckerbereitung ganz besonders stark.
Nun entsteht ja eine Frage. Sehen Sie, die Menschen sind ganz von selber, möchte man sagen, darauf gekommen in ihrer Entwickelung, die Feldfrüchte nicht so zu essen wie die Tiere. Das Roß frißt seinen Hafer fast wie er wächst. Die Tiere fressen ihre Körnerfrüchte so, wie sie wachsen. Denn die Vögel müßten schlecht Körnerfrüchte essen können, wenn sie darauf angewiesen wären, daß sie ihnen jemand erst kochte! Die Menschen sind von selber darauf gekommen, sich die Feldfrüchte zu kochen. Meine Herren, was geschieht denn dadurch, daß ich die Feldfrüchte koche? Sehen Sie, dadurch, daß ich die Feld-früchte koche, genieße ich sie nicht kalt, sondern warm. Nun müssen wir, wenn wir die Nahrung innerlich verarbeiten wollen, Wärme aufwenden. Das geht nicht ohne Wärme ab, meine Herren, daß man Kohlehydrate in Stärke und Stärke in Zucker verwandelt; das bedarf eines innerlichen Heizens. Wenn ich nun schon außen heize und die Nahrungsmittel schon warm mache, dann komme ich dem Körper zu Hilfe; dann braucht er die Wärme nicht von sich selber abzugeben. Also erstens werden die Nahrungsmittel dadurch schon in den Feuer-, in den Wärmeprozeß aufgenommen, daß man sie kocht. Das ist das erste. Das zweite ist aber: die Nahrungsmittel werden da ganz verändert! Denken Sie nur, was aus dem Mehl gemacht wird, wenn ich es zu Brot verbacke. Es wird ja ganz anders! Aber durch was wird es anders? Nun, zunächst mahle ich die Früchte. Was heißt mahlen? Ganz klein machen. - Ja, sehen Sie, das, was ich da tue mit den Körner-früchten, daß ich sie mahle, ganz klein mache, das müßte ich ja später in meinem eigenen Leib tun! Alles das, was ich da mache, müßte ich in meinem eigenen Leib tun; durch das, was ich da mache, nehme ich es dem Leib ab. Ebenso wenn ich sie röste. Alle diese Dinge, die ich beim Kochen ausführe, die nehme ich dem Leib ab, so daß ich die Nahrungsmittel dann in einen Zustand bringe, in dem der Körper sie leichter verdaut.
Sie brauchen ja nur zu vergleichen, was für ein Unterschied bestehen würde, wenn der Mensch rohe Kartoffeln essen würde, oder
wenn er sie gekocht ißt. Wenn der Mensch rohe Kartoffeln essen würde, müßte der Magen ungeheuer viel Wärme hergeben, um diese rohe Kartoffel, die fast schon Stärke ist, umzuändern. Wie er sie jetzt umändert, das ist aber nicht hinreichend. Die Kartoffel geht dann in den Darm. Der Darm muß wiederum viel Kraft aufwenden. Dadurch aber bleibt die Kartoffel überhaupt im Darm stecken; die späteren Kräfte sind nicht mehr geeignet, die Kartoffel weiterzuleiten in den übrigen Körper. Ißt man also rohe Kartoffeln, so füllt man sich entweder bloß den Magen an - und der Darm kann schon nicht mehr weiter was damit anfangen -, oder man füllt sich den Darm an; aber weiter geht es nicht. Bereitet man aber die Kartoffel vor, indem man sie kocht oder irgendwie anders zubereitet, hat der Magen nicht mehr so viel damit zu tun, der Darm auch nicht; die Kartoffeln gehen über ins Blut und gehen bis in den Kopf.
Also Sie sehen, man hat dadurch, daß man die Speisen kocht, insbesondere daß man diejenigen Speisen kocht, welche auf die Kohlehydrate berechnet sind, die Möglichkeit, die Ernährung zu unterstützen.
Sie wissen ja, in der neueren Zeit sind allerlei Narrheiten gekommen, besonders in bezug auf die Ernährung. Die Narrheiten sind ja heute eigentlich Mode. Da gibt es «Rohköstler», die wollen überhaupt nichts mehr kochen, die wollen durchaus alles bloß roh essen. - Nun, natürlich, aus was kommt so etwas? Weil die Leute aus der materialistischen Wissenschaft nicht mehr wissen, wie die Sachen sind, und eine geistige Wissenschaft wollen sie nicht kennenlernen. Daher denken sie sich etwas aus. Die ganze Rohköstlerei ist nichts als eine Phantasterei. Eine Zeitlang kann man schon, weil der Körper starke Kräfte aufwenden muß, ich möchte sagen, den Körper aufpeitschen, wenn man bloß Rohkost benützt; aber um so mehr fällt er dann zusammen.
Nun, meine Herren, kommen wir jetzt zu den Fetten überhaupt. Die Pflanzen, fast alle Pflanzen enthalten Fette, Pflanzenfette, die sich die Pflanzen aus den Mineralien bereiten. Ja, sehen Sie, die Fette, die kommen nicht so leicht in den menschlichen Körper hinein wie die Kohlehydrate und die Salze. Die Salze werden eigentlich gar nicht verändert. Wenn Sie sich Ihre Suppe salzen: das Salz, das Sie da rein-schmeißen, das geht fast unverändert in Ihren Kopf als Salz hinauf;
Sie kriegen das in den Kopf hinein. Wenn Sie aber Kartoffeln essen, so kriegen Sie in Ihren Kopf schon nicht mehr Kartoffeln hinein, sondern Zucker; aber die Verwandlung geht so vor sich, wie ich es Ihnen gesagt habe. Bei den Fetten aber, gleichgültig, ob Sie pflanzliche oder tierische Fette essen, da geht die Sache nicht so einfach. Bei den Fetten ist es so: Wenn Sie die Fette essen, dann werden sie durch den Mund-saft, Magensaft, Darmsaft überhaupt fast ganz aufgegessen, und es geht ganz was anderes ins Blut über, und das Tier und der Mensch muß sich durch die Kraft, welche die Fette hervorrufen, im Darm und im Blut erst selber die Fette bilden.
Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen dem Fett und zwischen Zucker oder Salz. Salz und Zucker nimmt der Mensch eigentlich noch aus der Natur auf, nur daß er sich den Zucker aus der Kartoffel oder aus dem Roggen und so weiter verwandelt. Da hat er noch etwas von der Natur drinnen. Bei dem Fett, das der Mensch oder das Tier in sich hat, ist nichts mehr Natur; das hat er sich selber gebildet. Aber er hätte keine Kraft, wenn er sich nicht ernähren würde, und Darm und Blut-ansatz brauchen Fett. So daß man sagen kann: Salze könnte der Mensch nicht selber bilden. Der menschliche Körper würde, wenn er nicht Salze aufnehmen würde, niemals sich von selber Salze bilden. Wenn der Mensch nicht Kohlehydrate aufnehmen würde, wenn er nicht Brot oder so etwa& essen würde, wodurch er Kohlehydrate aufnimmt, würde er nicht Zucker bilden können. Wenn er aber nicht Zucker bilden könnte, würde er ewig ein Schwachmatikus sein. Das verdanken Sie nur dem Zucker, meine Herren: Weil Sie durch und durch voll Süßigkeit sind, haben Sie Kraft. In dem Augenblicke, wo Sie nicht mehr durch und durch voll Süßigkeit wären, würden Sie nicht mehr Kraft haben, würden Sie zusammensinken.
Sehen Sie, das geht bis in die Völker hinein. Wir haben Völker, welche wenig Zucker verzehren und auch wenig Stoffe, die Zucker bereiten. Das sind schwache Völker in bezug auf physische Kräfte. Wir haben Völker, die viel Zucker essen; das sind starke Völker.
Aber so leicht hat es der Mensch mit den Fetten nicht. Wenn der Mensch Fette hat in sich, das Tier auch, so ist das sein eigenes Verdienst, das Verdienst seines Körpers. Die Fette sind ganz sein eigenes
Produkt. So daß also der Mensch das, was er an Fetten in sich aufnimmt von außen durch Pflanzenfette, durch tierische Fette, vernichtet, und in der Überwindung der Fette entwickelt er jetzt die Kraft. Bei der Kartoffel, beim Roggen, beim Weizen, da entwickelt der Mensch seine Kräfte, indem er die Stoffe verwandelt; bei den Fetten, die er ißt, entwickelt er die Kraft, indem er die Stoffe vernichtet. Wenn ich von außen irgend etwas vernichte, werde ich wieder müde und matt. Wenn ich aber im Inneren ein ganz fettes Beefsteak vernichte, werde ich dadurch schwach, aber diese Vernichtung des ganz fetten Beefsteaks oder die Vernichtung von Pflanzenfett, das gibt mir wiederum Kraft, daß ich das eigene Fett entwickeln kann, wenn mein Körper dazu veranlagt ist. So sehen Sie also, daß die Fettnahrung auf ganz andere Art im menschlichen Körper wirkt als die Kohlehydratnahrung.
Nun, meine Herren, der menschliche Körper ist ja recht kompliziert, und man muß schon sagen, das, was ich Ihnen da erzähle, das ist eine große Arbeit; es muß viel geschehen im menschlichen Leib, daß er diese Pflanzenfette vernichten kann. Nehmen wir aber jetzt an, der Mensch genießt Kraut, also von der Pflanze das Krautartige. Ja, das ist schon so: Wo das Krautartige genossen wird, da ist dasjenige da, was der Mensch namentlich an Fetten von der Pflanze bekommt. Wodurch ist denn der Halm so ein hartes Zeug? Weil er die Blätter umbildet, so daß sie zu Kohlehydraten werden. Wenn aber die Blätter grün bleiben - je grüner sie sind, desto mehr geben sie eben fettige Substanz. So daß also der Mensch, wenn er Brot ißt, sagen wir, vom Brot nicht viel Fett aufnimmt in sich. Er nimmt zum Beispiel von dem, was, sagen wir, Brunnenkresse ist - die kleine Pflanze mit den ganz kleinen Blättern -, mehr Fett auf, als wenn er Brot ißt. Es ist daher ein Bedürfnis entstanden, daß man das Brot mit Butter, mit etwas Fett ißt, nicht für sich, oder wie die Landleute mit Speck und so weiter, was ja wiederum Fett ist, da ist dann für zweierlei gesorgt.
Wenn ich Brot esse, so geht das Brot dadurch, daß das Wurzelhafte der Pflanze bis in den Halm hinaufgeht - denn der Halm, der hat die Wurzelkräfte, trotzdem er Halm ist und oben in der Luft wächst, in sich -, bis in den Kopf hinauf. Es kommt nicht darauf an, ob etwas oben in der Luft ist, sondern ob es wurzelhaft ist. Aber das Blatt, das
grüne Blatt ist nicht wurzelhaft. Drunten in der Erde entsteht kein grünes Blatt. Im Herbst, wenn die Sonnenkräfte nicht mehr stark wirken, da kann der Halm ausreifen, gegen den Spätsommer und Herbst zu. Aber die stärksten Triebkräfte der Sonne braucht das Blatt, wenn es reifen soll; das wächst der Sonne zu. So daß wir sagen können: Das Kraut wirkt vorzugsweise auf Lunge und Herz, während also die Wurzel den Kopf stark macht und auch noch die Kartoffel so ist, daß sie eigentlich bis zum Kopfe kommt. Wenn wir das Kraut essen, das vorzugsweise Pflanzenfette uns geben kann, machen wir uns in Herz und Lunge stark, im mittleren Menschen, im Brustmenschen. Das ist, möchte ich sagen, das Geheimnis der menschlichen Ernährung: Will ich auf meinen Kopf wirken, dann bereite ich mir Wurzelnahrung oder Halmnahrung oder so etwas zu; will ich auf Lunge und Herz wirken, mache ich mir Salat und so weiter. Weil aber diese Dinge schon im Darm vernichtet werden und nur die Kräfte wirken, braucht man da nicht so viel zu kochen. Daher werden die Blätter zu Salaten gemacht. Aber alles das, was im Kopfe wirken soll, das kann nicht zu Salaten gemacht werden, das muß verkocht werden. Gekochte Nahrung wirkt vorzugsweise bis in den Kopf. Salatartige Nahrung wirkt vorzugsweise auf Lunge, Herz und so weiter aufbauend, also ernährend hinein, und zwar durch die Fette.
Nun ist es aber so, meine Herren, daß man nicht nur auf den Kopf wirken muß und auf den mittleren, auf den Brustmenschen, sondern der Mensch muß ja auch die Nahrungsorgane selber aufgebaut haben. Er braucht einen Magen, ein Gedärm, er braucht Nieren, die Leber, und er muß also die Nahrungsorgane selber aufgebaut haben. Nun ist das Interessante: Zum Aufbauen der Nahrungsorgane braucht der Mensch als Ernährung gerade das Eiweiß, das Eiweiß in den Pflanzen, und zwar vorzugsweise wie es in den Pflanzen enthalten ist in der Blüte, und namentlich in der Frucht selber. So daß wir sagen können:
Die Wurzel ernährt vorzugsweise den Kopf (siehe Zeichnung, Seite 97); das, was in der Mitte der Pflanze ist, das Kraut, ernährt vorzugsweise die Brust, und das, was in den Früchten ist, den Unterleib.
Schauen wir also auf unsere Saatfelder, so können wir sagen: Gut, daß die da sind, denn davon wird unser Kopf genährt. Schauen wir auf
den Salat, den wir anpflanzen, auf alles dasjenige, was wir in den Blättern essen, was wir nicht zu kochen brauchen, weil es schon in den Därmen verdaut werden kann, weil es nur auf die Kräfte ankommt, dann bekommen wir alles das, was uns unsere Brustorgane erhält. Aber gucken wir hinauf auf die Pflaumen, Apfel, Früchte, die an den Bäumen wachsen - ja sehen Sie, da brauchen wir nicht viel zu kochen, denn die werden schon im ganzen Sommer von der Sonne selber ausgekocht! Also da wird schon die innere Reifung bewirkt; da ist es anders als bei Wurzeln und bei dem, was also nicht von der Sonne ausgereift wird, sondern verdorrt wie Halme und so weiter. Bei den Früchten, da brauchen wir nicht viel zu kochen, sondern nur dann, wenn wir einen schwachen Organismus haben, der im Darm die Früchte nicht vernichten kann, müssen wir kochen, Kompotte machen und dergleichen. Also gerade wenn jemand Darmkrankheiten hat, muß er dafür sorgen, daß er die Früchte in Kompottform bekommt, als Brei, Mus und so weiter. Aber wenn einer ein ganz gesundes Verdauungs-system hat, ein ganz gesundes Darmsystem, dann sind die Früchte gerade dazu da, den Unterleib aufzubauen, und zwar durch das, was sie an Eiweiß in sich haben. Eiweiß in den Pflanzenfrüchten baut Ihnen Ihren Magen auf, baut alles dasjenige auf, was der Mensch im Unterleib als Ernährungsorgane selber hat.
Sehen Sie, was eigentlich für ein Instinkt immer da war! Die Menschen haben natürlich das, was ich Ihnen jetzt auseinandersetze, nicht so mit Begriffen gewußt, aber sie haben es aus dem Instinkt gewußt. Daher haben sie eigentlich immer sich eine gemischte Nahrung zubereitet aus Wurzeln, Kraut und Früchten, haben alle diese Dinge gegessen, und auch auf die Mengen, die man zum einen oder zum anderen braucht, sind sie aus dem Instinkt gekommen.
Nun wissen Sie aber, daß die Menschen nicht bloß Pflanzen essen, sondern auch Tiere, Fleisch von Tieren, Fett von Tieren genießen und so weiter.
Sehen Sie, die Anthroposophie ist nirgends dazu da, fanatisch oder sektenhaft aufzutreten, sondern nur, um zu sagen, wie die Dinge sind. Und man kann nicht sagen, daß der Mensch nur Pflanzen essen soll, oder auch Tierisches essen soll und so weiter, sondern man muß folgendes
sagen: Es gibt einfach Menschen, die können durch alle die Kräfte, die sie in sich durch die Vererbung haben, nicht so viel Kräfte aufbringen, daß sie alle die Arbeit verrichten können, um Pflanzenfette soweit zu vernichten, daß die Kräfte wiederum entstehen im Leib, um eigenes Fett zu erzeugen. Sehen Sie, wer nur Pflanzenfette ißt, ja, meine Herren, das ist ein Mensch, der entweder darauf verzichten muß, ein dicker Kerl zu werden, weil das Pflanzenfett vernichtet wird - und aus der Vernichtung entstehen Kräfte -, oder aber er muß eine furchtbar gute Gesundheit in der Verdauung haben, daß es ihm leicht wird, die Pflanzenfette zu vernichten; dann kriegt er Kräfte, um eigenes Fett anzusetzen. Die meisten Menschen aber sind so, daß sie eigentlich das gar nicht durchführen können, eigenes Fett genügend anzusetzen, wenn sie nur Pflanzenfett vernichten. Wenn die Menschen aber tierisches Fett essen oder Fleisch, wird das nicht ganz vernichtet. Pflanzenfett geht nicht über die Gedärme heraus, wird in den Gedärmen vernichtet; das Fett aber, das im Fleisch enthalten ist, geht wieder in den Menschen über. Und er darf schwächer sein - schwächer, als wenn er sich bloß mit dem Pflanzenfett ernährt. Daher werden wir unterscheiden zwischen solchen Körpern, die nicht gern das Fett haben, Körpern, die nicht gern Speck essen, die insbesondere fette Nahrungsmittel nicht gern mögen; das sind solche Körper, die verhältnismäßig leicht das Fett vernichten und dadurch Fett in sich selber bilden wollen. Die Körper sagen: Was ich an mir trage an Speck, das will ich mir selber machen; meinen eigenen Speck will ich haben. - Wenn aber einer sich die Tafel ganz voll setzt mit fetten Speisen, dann sagt er nicht: Meinen Speck will ich selber machen -, sondern dann sagt er:
Die Welt soll mir meinen Speck geben -, denn das tierische Fett geht in den Leib über. Das ist also eine Erleichterung in der Ernährung.
Wenn das Kind Zucker schleckt, tut es das ja nicht wegen der Ernährung. Es ist schon etwas Nahrhaftes drinnen, wenn die Kinder Zucker schlecken, aber das Kind tut das ja nicht wegen der Ernährung, sondern wegen der Süße. Nun, da wird die Süßigkeit bewußt beim Zuckerschlecken. Wenn der Mensch aber das Fett vom Ochsen, vom Schwein, oder was es halt ist, in sich aufnimmt - ja, meine Herren, da geht das über in seinen Körper. Das befriedigt seine Wollust geradeso,
wie das Zuckerschlecken die Wollust des Kindes befriedigt, nur daß es nicht so befriedigt, aber der Mensch fühlt schon, daß da Wollust drinnen ist. Nun braucht der Mensch natürlich zu seinem inneren Dasein diese innere Wollust. Daher liebt er das Fleisch. Fleisch ißt man also besonders, wenn der Körper das Fleisch liebt.
Aber man darf in dieser Beziehung nicht fanatisch sein. Es gibt Menschen, die können gar nicht bestehen, wenn sie kein Fleisch essen. Es muß daher immer sorgfältig ausprobiert werden, ob sie wirklich ohne Fleisch leben können. Aber wenn einer ohne Fleisch auskommen kann, fühlt er sich dann, wenn er von der Fleischnahrung übergeht zu der vegetarischen Nahrung, stärker als vorher. Sehen Sie, das ist eben die Schwierigkeit: Mancher verträgt gar nicht zu leben ohne Fleisch. Wenn er aber das kann, so fühlt er sich dann stärker, wenn er Vegetarier geworden ist, weil er nicht mehr darauf angewiesen ist, fremdes Fett in sich abzulagern, sondern nur sein eigenes Fett kriegt; in dem fühlt er sich dann stark.
Und ich kann schon sagen: Das weiß ich von mir selber, der ich die Anstrengungen, die ich seit langer Zeit, die ich in den letzten vierundzwanzig Jahren habe durchmachen müssen, daß ich die anders nicht hätte durchmachen können! Dann würde ich nicht ganze Nächte haben fahren können und am nächsten Tag einen Vortrag halten und so weiter. Denn, nicht wahr, es wird einem das, was man sich selber bereiten muß, wenn man Vegetarier ist, abgenommen, wenn man sich durch das Tier zuerst diese Arbeit verrichten läßt. Das ist die Geschichte. Sie dürfen aber nicht glauben, daß ich in irgendeiner Weise für den Vegetarismus agitiere, weil es wirklich immer erst ausprobiert werden muß, ob der betreffende Mensch überhaupt Vegetarier werden kann oder nicht; das ist seine Anlage.
Sehen Sie, meine Herren, besonders wichtig ist das ja beim Eiweiß. Eiweiß kann man auch umgestalten, wenn man in der Lage ist, es so, wie man es aufnimmt als Pflanzeneiweiß, im Gedärm zu vernichten; und dann bekommt man die Kräfte. Aber sobald das Gedärm schwach wird, muß man es schon von außen bereiten, also richtig Eiweiß aufnehmen, was ja dann zum Beispiel tierisches Eiweiß ist, denn die Hühner, die die Eier liefern, sind ja auch Tiere. Nun, das Eiweiß, das ist
etwas, was eigentlich wirklich ganz falsch beurteilt wird, wenn man die Sache nicht geisteswissenschaftlich beurteilt.
Wenn ich Wurzeln esse, so kommen ihre Salze bis in meinen Kopf. Wenn ich Salat esse, so kommen die Kräfte - nicht die Fette selber, aber die Kräfte, die von den Fetten in den Pflanzen sind - in meine Brust, Lunge und Herz. Wenn ich Früchte esse, so kommt das Eiweiß aus den Früchten aber nicht bis in die Brust, sondern bleibt im Gedärm. Und das Eiweiß nun, das man aus dem Tierischen hat, das geht weiter als ins Gedärm, das versorgt den Körper, weil das Eiweiß von den Tieren sich ausbreitet. So könnte man sagen: Wenn der Mensch besonders viel Eiweiß ißt, so muß er ein gut genährter Mensch werden. Das hat dazu geführt, daß im materialistischen Zeitalter die Leute, die Medizin studiert hatten, den Leuten übertriebenen Eiweißgenuß angeraten haben; man hat behauptet, daß hundertzwanzig bis hundertfünfzig Gramm Eiweiß notwendig sind. Unsinn ist das! Heute weiß man, daß nur ein Viertel davon für den Menschen notwendig ist. Und tatsächlich, wenn der Mensch so furchtbar viel Eiweiß ißt, was unnötig ist -ja, sehen Sie, dann kommt es eben so, wie es einmal einem Professor gegangen ist mit seinem Assistenten: Die haben einen Menschen, der unterernährt war, mit Eiweiß auffüttern wollen. Nun setzt man voraus, daß das Eiweiß, wenn es besonders viel ist, umgewandelt wird im Menschen, und daß sich im Urin zeigt, daß er Eiweiß gegessen hat. Nun kamen sie bei diesem Menschen darauf: Der Urin zeigt nicht, daß das Eiweiß im Körper drinnen verarbeitet ist. Sie kamen nicht darauf, daß durch den Darm Eiweiß abging. Der Professor war ganz wild darüber. Und der Assistent sagte mit schlotternden Beinen ängstlich:
Ja, Herr Professor, vielleicht durch den Darm? - Ja, was war geschehen? Die haben den Mann mit Eiweiß überfüttert, aber das hat ihm nichts genützt, denn das Eiweiß ist vom Magen in den Darm gegangen, und dann wiederum hinten heraus. Es ist also gar nicht in den Körper gegangen. Wenn man zuviel Eiweiß füttert, so geht es gar nicht in den Körper, sondern in die Fäkalien. - Aber etwas hat er doch davon, denn bevor es herausgeht, bleibt es im Darm liegen und wird zu Gift und intoxiert den ganzen Körper, vergiftet den Körper! Das hat man von zuviel Eiweiß. Und von dieser Vergiftung entsteht sehr häufig die
Arterienverkalkung, so daß viele Menschen die Arterienverkalkung zu früh kriegen - sie einfach deshalb kriegen, weil sie mit Eiweiß überfüttert werden.
Also es ist schon wichtig, so wie ich es gerade auseinandergesetzt habe, die Ernährungsfrage kennenzulernen. Denn die meisten Menschen sind eigentlich sehr häufig der Ansicht: man wird um so besser ernährt, je mehr man ißt. Das ist nicht richtig, sondern man wird manchmal viel besser ernährt, wenn man weniger ißt, weil man dann sich nicht vergiftet.
Und das ist es: Man muß wissen, wie diese einzelnen Stoffe wirken. Man muß wissen, daß also Salze vorzugsweise auf den Kopf wirken, daß Kohlehydrate, wie sie also in unseren Hauptnahrungsmitteln, in Brot und in den Kartoffeln sind, mehr auf das Lungensystem und auf das Halssystem - Lunge, Hals, Gaumen und so weiter - wirken, daß Fette vorzugsweise wirken auf Herz und Blutgefäße, Arterien und Venen, und daß das Eiweiß vorzugsweise wirkt auf die UnterleibsOrgane. Der Kopf hat überhaupt nichts besonderes vom Eiweiß. Das Eiweiß, das im Kopfe ist - natürlich muß der Kopf auch aus Eiweiß aufgebaut werden, denn er besteht ja aus lebendiger Substanz -, das Eiweiß muß sich der Mensch auch selber bilden. Wenn man ihn also überfüttert, so darf man nicht glauben, daß er dadurch ein besonders gesundes Hirn kriegt, sondern im Gegenteil, er kriegt ein vergiftetes Hirn.
Ich werde vielleicht noch eine Stunde über die Ernährung reden müssen. Es ist dies aber ganz schön, weil solche Fragen ganz fruchtbar sind. Also dann nächsten Samstag um neun Uhr.
Eiweiß: Unterleibsorgane
Fette: Herz und Blutgefäße
Kohlehydrate: Lunge, Hals, Gaumen
Salze: Kopf
SIEBENTER VORTRAG Dornach, 2. August 1924
Ich möchte heute einiges noch beifügen zu dem, was vorigen Donnerstag auf die Frage von Herrn Burle gesagt werden konnte. Ich habe also auseinandergesetzt, wie vier Dinge zur Ernährung für jeden Menschen notwendig sind: Salze; dasjenige, was man Kohlehydrate nennt, was also vorzugsweise in Kartoffeln enthalten ist, was aber auch ganz besonders enthalten ist in den Körnerfrüchten unserer Felder, und auch in den Hülsenfrüchten. Und dann, sagte ich, braucht der Mensch außerdem Fette; und er braucht Eiweiß. Aber ich habe Ihnen auseinandergesetzt, wie ganz verschieden die Ernährung ist beim Menschen in bezug auf Eiweiß zum Beispiel und, sagen wir, Salz. Das Salz nimmt der Mensch in seinen Körper bis zum Kopfe hin so auf, daß es Salz bleibt, daß es sich eigentlich nicht anders verändert, als daß es aufgelöst wird. Aber es behält seine Kräfte als Salz bei bis in den menschlichen Kopf hinein. Dagegen das Eiweiß, also dasjenige, was wir im gewöhnlichen Hühnerei haben, was wir aber auch in den Pflanzen haben, dieses Eiweiß, das wird sogleich im menschlichen Körper, noch im Magen und in den Gedärmen, vernichtet, bleibt nicht Eiweiß. Aber jetzt hat der Mensch die Kraft aufgewendet, dieses Eiweiß zu vernichten, und die Folge davon ist, daß er auch wieder die Kraft bekommt, weil er Eiweiß vernichtet hat, Eiweiß wieder herzustellen; und so macht er sich sein eigenes Eiweiß. Er würde es sich aber nicht machen, wenn er nicht erst anderes Eiweiß zerstören würde.
Stellen Sie sich einmal vor, meine Herren, wie das beim Eiweiß ist. Denken Sie sich einmal, Sie sind ein ganz verständiger Mensch geworden und sind so gescheit, daß Sie sich die Geschicklichkeit zutrauen, eine Uhr zu machen, Sie haben aber nichts gesehen als eine Uhr, wie sie von außen ausschaut - nun, da werden Sie nicht gleich eine Uhr machen können. Aber wenn Sie es riskieren, die Uhr ganz zu zerlegen, ganz auseinanderzunehmen, in ihre einzelnen Stücke zu zerlegen und sich dabei merken, wie die Geschichte zusammengesetzt war, dann lernen Sie aus dem Zerlegen der Uhr, wie Sie sie wiederum zusammensetzen
müssen. So macht es der menschliche Körper mit dem Eiweiß. Er muß das Eiweiß in sich hineinbekommen, er zerlegt es ganz. Das Eiweiß besteht nämlich aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel; das sind die wichtigsten Bestandteile vom Eiweiß. Das Eiweiß wird nun ganz zerlegt; so daß der Mensch in sich nun nicht Eiweiß hat, wenn die Geschichte in die Gedärme kommt, sondern Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel. Sehen Sie, jetzt hat der Mensch das Eiweiß zerlegt, wie man eine Uhr zerlegt. -Sie werden sagen: Ja, aber wenn man einmal eine Uhr zerlegt, so kann man sich das ja merken, um weitere Uhren zu machen; und man braucht ja nur ein einziges Mal Eiweiß essen, und kann dann immer wieder Eiweiß machen. - Das ist aber nicht wahr, weil der Mensch ein Gedächtnis hat als ganzer Mensch; aber der Körper als solcher, hat nicht ein solches Gedächtnis, daß er sich etwas merken kann, sondern der Körper verwendet die Kräfte zum Aufbauen. Also wir müssen immer wieder von neuem Eiweiß essen, damit wir das Eiweiß herstellen können.
Nun ist es so, daß der Mensch etwas sehr, sehr Kompliziertes macht, wenn er selber sich sein Eiweiß fabriziert. Nämlich er zerlegt zuerst das Eiweiß, das er ißt; dadurch bekommt er den Kohlenstoff überall in seinen Körper hinein. Nun wissen Sie: den Sauerstoff ziehen wir aber auch aus der Luft heran. Der vereinigt sich mit dem Kohlenstoff, den wir in uns haben. Diesen Kohlenstoff haben wir im Eiweiß und in den anderen Nahrungsmitteln. Da atmen wir zunächst Kohlenstoff in der Kohlensäure wieder aus. Aber einen Teil behalten wir zurück. Jetzt haben wir in unserem Körper Kohlenstoff und Sauerstoff miteinander drinnen; so daß wir nicht den Sauerstoff beibehalten, den wir gegessen haben mit dem Eiweiß, sondern wir vereinigen mit dem Kohlenstoff den Sauerstoff, den wir eingeatmet haben. Wir bauen also unser Eiweiß in unserem Inneren nicht so auf, wie es sich die Materialisten vorstellen: daß wir recht viel Hühnerei essen, das verteilt sich im ganzen Körper, und nachher haben wir das Hühnerei, das wir gegessen haben, im ganzen Körper ausgebreitet. Das ist nicht wahr. Wir sind schon bewahrt durch die Organisation unseres Körpers, daß, wenn wir Hühnerei essen, wir alle verrückte Hühner würden. Nicht wahr,
wir werden nicht alle verrückte Hühner, weil wir schon in den Gedärmen das Eiweiß vernichten. Statt des Sauerstoffes, den es gehabt hat, nehmen wir den Sauerstoff aus der Luft. Den hat man jetzt da. Sehen Sie, mit dem Sauerstoff atmen wir, weil in der Luft immer auch Stickstoff ist, den Stickstoff ein. Und auch den Stickstoff verwenden wir nicht, den wir mit dem Hühnerei essen, sondern wiederum den Stickstoff, den wir aus der Luft einatmen. Den Wasserstoff, den wir mit dem Hühnerei essen, den verwenden wir schon gar nicht, sondern jenen Wasserstoff, den wir durch die Nase bekommen, und durch die Ohren, gerade durch die Sinne; das machen wir zu unserem eigenen Eiweiß. Und Schwefel - den bekommen wir fortwährend aus der Luft. Also Wasserstoff und Schwefel bekommen wir auch aus der Luft. Von dem Eiweiß, das wir essen, behalten wir überhaupt nur den Kohlenstoff. Das andere verwenden wir so, daß wir das nehmen, was wir aus der Luft bekommen.
Also sehen Sie, so ist es mit dem Eiweiß. Und in einer ganz ähnlichen Weise ist es auch so mit dem Fett. Unser eigenes Eiweiß machen wir uns selber, wir verwenden nur den Kohlenstoff vom fremden Eiweiß; und unser eigenes Fett machen wir uns auch selber. Wir verwenden auch dazu im Grunde genommen nur sehr wenig von dem Stickstoff, den wir aufnehmen durch die Nahrung, für die Fette. Also die Sache ist so, daß wir Eiweiß und Fett auf eigene Weise erzeugen. Nur dasjenige, was wir in den Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Körnerfrüchten aufnehmen, das geht in den Körper über, und zwar dasjenige, was wir mit den Körnerfrüchten und mit den Kartoffeln aufnehmen, nicht vollständig, man möchte sagen, nur bis zu den unteren Partien des Kopfes. Was wir aufnehmen mit den Salzen, das geht in den ganzen Kopf über, und daraus bilden wir uns dann das, was wir für unsere Knochen brauchen.
Sehen Sie, meine Herren, deshalb, weil das so ist, müssen wir dafür sorgen, daß wir namentlich gesundes Pflanzeneiweiß in unseren Körper hineinbringen! Gesundes Pflanzeneiweiß, das ist dasjenige, wovon unser Körper sehr viel hat. Wenn wir Hühnereiweiß in unseren Körper hineinbringen, kann unser Körper schon ziemlich faul sein, ein träger, fauler Körper sein: er wird es leicht zerstören können, weil das
leicht zerstört ist. Das Pflanzeneiweiß, also dasjenige Eiweiß, das wir mit den Früchten der Pflanzen kriegen - in den Pflanzen ist es hauptsächlich drinnen, wie ich Ihnen vorgestern sagte -, das ist für uns ganz besonders wertvoll. Daher ist es für einen Menschen, der sich gesund halten will, wirklich notwendig, daß er in gekochtem oder rohem Zustande Früchte zu seiner Nahrung hinzu hat. Früchte muß er haben. Wenn ein Mensch ganz vermeidet, Früchte zu essen, so ist das so, daß er eigentlich nach und nach übergeht zu einer ganz trägen inneren Verdauung seines Körpers.
Nun sehen Sie, da handelt es sich aber auch darum, daß wir die Pflanzen selber in der richtigen Weise ernähren! Da müssen Sie bedenken, wenn wir die Pflanzen in der richtigen Weise ernähren wollen, daß die Pflanzen etwas Lebendes sind. Die Pflanzen sind keine Mineralien, die Pflanzen sind etwas Lebendes. Und wenn wir eine Pflanze bekommen, so bekommen wir sie ja aus dem Samen, der in den Boden hineingegeben wird. Die Pflanze kann nicht ordentlich gedeihen, wenn sie nicht den Boden selber ein bißchen lebendig kriegt. Und wie macht man ihn lebendig? Man macht den Boden lebendig, indem man ihn ordentlich düngt. Also das ordentliche Düngen, das ist dasjenige, was uns wirklich richtiges Pflanzeneiweiß liefert.
Und da wiederum müssen Sie folgendes bedenken. Sehen Sie, durch lange, lange Zeiten hindurch haben die Menschen gewußt: Richtiger Dünger ist der, der aus den Ställen kommt, aus dem Kuhstall und so weiter, richtiger Dünger ist der, der aus der Wirtschaft selber heraus kommt. Aber in der neueren Zeit, wo alles materialistisch geworden ist, haben die Leute gesagt: Ja, man kann ja die Sache so machen, daß man nachschaut, welche Stoffe in dem Dünger drinnen sind, und dann nehmen wir das aus dem Mineralreich - den mineralischen Dünger.
Ja, sehen Sie, meine Herren, wenn man mineralischen Dünger verwendet, so ist das gerade so, wie wenn man bloß Salze in den Boden bringt; da wird bloß die Wurzel kräftig. Da kriegen wir dann also aus der Pflanze bloß dasjenige heraus, was in den menschlichen Knochenbau geht. Wir kriegen aber aus der Pflanze nicht ein richtiges Eiweiß heraus. Daher leiden die Pflanzen, unsere Feldfrüchte, seit einiger Zeit alle an einem Eiweißmangel. Und der wird immer größer und
größer werden, wenn die Leute nicht wiederum zu ordentlichem Düngen kommen.
Sehen Sie, es haben schon Versammlungen von Landwirten stattgefunden, da haben die Landwirte gesagt - aber sie wußten natürlich nicht, aus welchen Gründen -: Ja, die Früchte, die werden immer schlechter und schlechter! - Und wahr ist es. Wer alt geworden ist, der weiß, daß, als er noch ein junger Kerl war, eigentlich alles besser war, was die Felder hervorgebracht haben. Man kann eben nicht so denken, daß man einfach den Dünger zusammensetzt aus den Stoffen, aus denen der Kuhmist besteht, sondern man muß sich klar sein: Dadurch, daß der Kuhmist nicht aus dem Laboratorium vom Chemiker kommt, sondern aus dem viel, viel wissenschaftlicheren Laboratorium, das in der Kuh drinnen ist - das ist ein viel wissenschaftlicheres Laboratorium -, dadurch kommt es, daß der Kuhdünger eben doch dasjenige ist, was nicht bloß die Wurzeln der Pflanzen stark macht, sondern bis in die Früchte hinauf stark wirkt, dadurch ordentliches Eiweiß in den Pflanzen erzeugt und der Mensch davon ganz kräftig wird.
Wenn man nur immer düngen würde mit mineralischem Dünger, wie man es in der neueren Zeit liebt, oder gar mit Stickstoff, der aus der Luft erzeugt wurde - ja, meine Herren, da werden schon Ihre Kinder, und noch mehr Ihre Kindeskinder ganz bleiche Gesichter haben. Sie werden die Gesichter nicht mehr von den Händen, wenn sie weiß sind, unterscheiden können. Daß der Mensch eine lebhafte Farbe haben kann, eine gesunde Farbe haben kann, hängt eben davon ab, daß die Äcker ordentlich gedüngt werden.
Also Sie sehen, man muß berücksichtigen, wenn man über die Ernährung spricht, wie man überhaupt die Nahrungsmittel gewinnt. Das ist außerordentlich wichtig. Daß der menschliche Körper die Notwendigkeit hat, selber zu begehren dasjenige, was er braucht, das können Sie aus verschiedenen Umständen sehen. Nehmen Sie zum Beispiel nur den Umstand, daß Gefangene, die verurteilt werden zu jahrelanger Strafe - die bekommen gewöhnlich Nahrung, die nicht fettreich genug ist - eine ungeheure Gier nach Fett bekommen, und wenn da irgendwie von einem Licht, das der Gefängniswärter in die Zelle hineinträgt,
etwas heruntertropft und auf dem Boden ist, dann bücken sie sich gleich und lecken dieses Fett auf aus dem Grunde, weil der Körper das so ungeheuer stark spürt, wenn er irgendein Nahrungsmittel, das er braucht, eigentlich stark vermißt. Das kommt nicht zum Ausdruck, wenn man immerfort, Tag für Tag ordentlich essen kann. Da kommt es nie dazu, weil der Körper das nicht entbehrt, was er braucht. Aber wenn etwas dauernd durch Wochen hindurch fehlt in der Nahrung, dann wird der Körper außerordentlich gierig danach. Das ist dasjenige, was im besonderen noch hinzugefügt werden muß.
Nun habe ich Ihnen schon gesagt, daß mit solchem Düngen viel anderes noch zusammenhängt. Sehen Sie, unsere Vorfahren in Europa im 12., 13. Jahrhundert oder noch früher, ja, die haben sich durch manches unterschieden von uns. Das berücksichtigt man gewöhnlich gar nicht! Und unter alledem, wodurch sie sich von uns unterschieden haben, war das, daß sie keine Kartoffeln zu essen bekommen haben. Die Kartoffeln sind erst später eingeführt worden. Die Kartoffelnahrung hat aber einen starken Einfluß ausgeübt auf den Menschen. Sehen Sie, ißt man Körnerfrüchte, so werden dadurch insbesondere Lunge und Herz stark. Das verstärkt Lunge und Herz. Der Mensch wird so, daß er einen gesunden Brustkorb hat, und es geht ihm gut. Er ist nicht so erpicht aufs Denken, als wie aufs Atmen zum Beispiel; er kann auch etwas vertragen beim Atmen. Und da möchte ich Ihnen gleich sagen:
Sie müssen sich nicht vorstellen, daß derjenige kräftig ist beim Atmen, der immer die Fenster aufmachen muß, der immer schreit: Oh, frische Luft! - und so weiter, sondern derjenige ist kräftig im Atmen, der schließlich so stark organisiert ist, daß er jede Luft verträgt. Wie es überhaupt darauf ankommt, daß abgehärtet nicht derjenige ist, der nichts vertragen kann, sondern derjenige, der etwas vertragen kann.
In unserer Zeit redet man viel von Abhärtung. Denken Sie nur, wie man die Kinder abhärtet. Jetzt schon werden die Kinder - namentlich von reichen Leuten, aber die anderen kommen auch schon und machen es nach -, jetzt werden die Kinder so angezogen: Während wir in unserer Jugend als Kinder ordentliche Strümpfe angehabt haben und ganz bedeckt waren, höchstens daß man bloßfüßig gegangen ist, ist es jetzt so, daß die Anzüge nur bis an die Knie höchstens gehen, oder noch weniger
weit. Wenn die Leute wüßten, daß das die größte Gefahr bildet für spätere Blinddarmentzündungen' so würden sie sich besinnen! Aber die Mode, die wirkt ja so tyrannisch, daß solch eine Gesinnung gar nicht aufkommt. Jetzt werden die Kinder so angezogen, daß die Kleidchen nur bis an die Knie oder noch weniger weit gehen, und es wird noch dazu kommen, daß sie später bloß bis an den Bauch gehen werden; das wird auch noch Mode werden. Also da wirkt die Mode außerordentlich stark ein.
Aber dasjenige, worauf es eigentlich ankommt, das merken eben die Leute gar nicht. Es kommt eben durchaus darauf an, daß der Mensch in seiner ganzen Organisation so sich einstellt, daß er nun eben wirklich innerlich alles verarbeiten kann, was er als Nahrungsmittel in sich aufnimmt. Und da meine ich, ist es ganz besonders wichtig, daß man weiß: Der Mensch wird stark, wenn er die Dinge ordentlich verarbeitet, die er in sich aufnimmt. Und er wird nicht abgehärtet dadurch, daß man das macht mit den Kindern, was ich Ihnen erzählt habe. Da werden die Kinder so abgehärtet, daß wenn sie später - schauen Sie sie einmal an - über einen erhitzten Platz gehen sollen, da triefen sie, da können sie nicht weiter. Nicht der ist abgehärtet, der dazu kommt, nichts vertragen zu können, sondern der ist abgehärtet, der alles mögliche vertragen kann. Also, so ist es auch, daß die Leute früher wenig abgehärtet waren; sie hatten eben gesunde Lungen, gesundes Herz und so weiter.
Nun kam die Kartoffelnahrung. Die Kartoffel versorgt weniger Herz und Lunge, die Kartoffel geht in den Kopf hinauf - allerdings, wie ich Ihnen gesagt habe, nur in den Unterkopf' nicht in den Ober-kopf-, aber sie geht in den Unterkopf hinein, wo man besonders kritisch wird, denkt. Daher, sehen Sie, hat es in früheren Zeiten weniger Zeitungsschreiber gegeben. Die Buchdruckerkunst war ja noch nicht da. Bedenken Sie nur, was heute täglich gedacht wird auf der Welt, nur um die Zeitungen zustande zu bringen! Ja, dieses viele Denken, das ja gar nicht notwendig ist - es ist viel zu viel -, dieses viele Denken, das verdanken wir der Kartoffelnahrung! Denn der Mensch, der Kartoffeln ißt, der fühlt sich fortwährend angeregt zu denken. Der kann gar nicht anders, als denken. Dadurch wird seine Lunge und sein Herz
schwach, und die Tuberkulose, die Lungentuberkulose, die nahm erst überhand, als die Kartoffelnahrung eingeführt wurde! Und die schwächsten Leute sind diejenigen in Gegenden, wo fast nichts mehr gebaut wird als Kartoffeln und die Leute von Kartoffeln leben.
Gerade die Geisteswissenschaft - ich habe Ihnen das öfter gesagt -hat Gelegenheit, dieses Materielle kennenzulernen. Die materialistische Wissenschaft weiß nichts von der Ernährung, weiß nicht, was dem Menschen gesund ist. Das ist gerade das Eigentümliche vom Materialismus, daß er nur immer denkt, denkt, denkt, und nichts weiß! Es kommt darauf an: Wenn man eben im Leben richtig stehen will, muß man durchaus etwas wissen. Sehen Sie, das sind so Dinge, die ich Ihnen wegen der Ernährung sagen wollte.
Jetzt können Sie vielleicht, wenn Sie noch irgendwelche Wünsche haben, über einzelnes noch Fragen stellen.
Frage: Herr Doktor hat das vorige Mal etwas von Arterienverkalkung gesprochen. Diese Arterienverkalkung soll ja, wie man allgemein sagt, vom vielen Fleischund Eiergenuß und dergleichen herrühren. Ich kenne eine Person, die hat mit fünfzig Jahren Arterienverkalkung bekommen, ist bis zum siebzigsten Jahre steif geworden, und nun ist die Person fünfundachtzig, sechsundachtzig Jahre alt, ist heute viel rüstiger als in deis Fünfziger-, Sechzigerjahren. Ist die Arterienverkalkung da zurückgegangen? Ist dies möglich, oder was kann da schuld sein? Nebenbei bemerkt, hat diese Person niemals Tabak geraucht, auch wenig Alkohol getrunken, ziemlich solid gelebt. Nur hat er in seinen jüngeren Jahren ziemlich viel Fleisch genossen, mit siebzig Jahren nur noch wenig arbeiten können; heute aber, mit fünfundachtzig, sechsundachtzig Jahren ist er dauernd noch tätig, lebt noch.
Dr. Steiner: Nicht wahr, Sie sagen, das war eine Persönlichkeit, die mit fünfzig Jahren etwa Arterienverkalkung bekommen hat, steif geworden ist, wenig arbeitsfähig war - ich weiß nicht, ob auch das Gedächtnis zurückgegangen ist; das werden Sie nicht bemerkt haben Dieser Zustand ist bis zu den Siebzigerjahren geblieben; dann wurde diese Person wieder rüstig, lebt heute noch. - Nun aber, was hat sie denn heute noch, was an Arterienverkalkung erinnern könnte? Oder ist er so, daß er rüstig und beweglich ist?
Fragesteller sagt: Er ist heute vollständig rüstig und beweglicher als mit fünfund-sechzig Jahren, siebzig Jahren; es ist mein Vater.
Dr. Steiner: Da handelt es sich darum, daß man erst genau feststellen müßte, wie die Arterienverkalkung war. Denn sehen Sie, die Sache ist diese: Meistens tritt die Arterienverkalkung so ein, daß der Mensch im ganzen seine Arterien verkalkt bekommt. Nun, wenn der Mensch im ganzen seine Arterien verkalkt bekommt, dann wird er natürlich unfähig, von der Seele und vom Geiste aus den Körper zu beherrschen; der Körper wird steif. Nun ist jetzt die Sache so: Nehmen wir an, jemand bekommt aber Arterienverkalkung nicht im ganzen Körper, die Arterienverkalkung verschont zum Beispiel das Gehirn; dann ist folgendes der Fall. Sehen Sie, ich kenne ja auch etwas Ihren Gesundheitszustand. Vielleicht darf man von Ihrem Gesundheitszustand
- Ihren Vater kenne ich nicht - etwas auf den Ihres Vaters schließen. Sie leiden zum Beispiel, oder haben gelitten, es wird ja hoffentlich absolut gut werden, etwas an Heuschnupfen. Das bezeugt, daß Sie in sich tragen etwas, was der Körper nur dann ausbilden kann, wenn er für die Sklerose, für die Arterienverkalkung nicht im Kopf, sondern nur außer dem Kopf veranlagt ist. Keiner, der im ganzen Leib von vornherein für die Arterienverkalkung veranlagt ist, kann gut Heuschnupfen bekommen. Denn der Heuschnupfen ist gerade das Gegenteil von Arterienverkalkung. Nun leiden Sie an Heuschnupfen. Das bezeugt, daß Ihr Heuschnupfen - es ist ja nicht gut, wenn man Heuschnupfen hat; wird er kuriert, ist es besser; aber es kommt dabei auf die Anlage an -, also Ihr Heuschnupfen, der ist so etwas wie ein Ventil gegen die Sklerose, gegen die Arterienverkalkung.
Nun, Arterienverkalkung in geringerem Zustande kriegt aber jeder Mensch. Man kann nicht alt werden, ohne Arterienverkalkung zu bekommen. Bekommt man die Arterienverkalkung im ganzen Körper, i so kann man sich nicht mehr helfen; da wird man steif im ganzen Körper. Bekommt man aber die Arterienverkalkung - ausgenommen den übrigen Körper - im Kopf, dann tritt ja das ein, wenn man nur recht alt wird: Da wird der Ätherleib, von dem ich Ihnen gesprochen habe, immer stärker und stärker. Und dann braucht der Ätherleib nicht mehr so stark das Gehirn. Das kann nun alt und steif werden. Der Ätherleib kann aber nun doch anfangen, diese geringfügige Arterienverkalkung, die einen früher alt und steif gemacht hat, so zu beherrschen,
daß man sie geschickt beherrschen kann; die Arterienverkalkung ist dann nicht so stark eingetreten.
Ihr Vater braucht zum Beispiel nicht selber den Heuschnupfen gehabt zu haben, das ist gar nicht notwendig; aber die Anlage dazu kann er gehabt haben. Und die Anlage dazu, sehen Sie, die kann ihm gerade zugute kommen. Man kann sogar dieses sagen, was einem natürlich ein bißchen gegen den Strich gehen wird: Es kann ein Mensch da sein, der kann eine Anlage zum Heuschnupfen haben; er kann in dem Zustand sein, daß er sagt: Gott sei Dank, daß ich diese Anlage habe; der Heuschnupfen kommt zwar bei mir nicht heraus, aber so habe ich immer eine Anlage zur Erweichung meiner Gefäße. Wenn das nun nicht herauskommt, schützt ihn das vor Arterienverkalkung. Wenn nun der betreffende Mensch einen Sohn hat, so kann er gerade das haben, was beim Vater nach innen schießt; das kann er nach außen haben, das hängt beim Sohn mit irgendeiner Erkrankung nach außen zusammen.
Das sind ja überhaupt die Geheimnisse der Vererbung, daß manches bei den Nachkommen krank wird, was bei den Vorfahren gesund war. Man teilt die Krankheiten ein, spricht von Arterienverkalkung, Lungentuberkulose, Leberverhärtung, Magenverstimmung und so weiter. Das kann man nun hübsch im Buch hintereinanderschreiben, kann beschreiben, wie diese Krankheiten sind; man hat aber nicht viel davon, aus dem einfachen Grunde, weil Arterienverkalkung bei jedem Menschen etwas anderes ist. Es sind gar nicht zwei Menschen gleich, die Arterienverkalkung haben; jeder Mensch kriegt die Arterienverkalkung auf andere Weise. Das ist schon so, meine Herren. Sehen Sie, das ist gar kein Wunder.
Es gab einmal zwei Professoren, Dozenten, die wirkten beide an der Berliner Universität. Der eine war siebzig Jahre alt, der andere zweiundneunzig; derjenige, der siebzig Jahre alt war, der war ein ganz berühmter Mensch. Er hat viele Bücher geschrieben, aber er war ein Mensch, der mit seiner Philosophie ganz im Materialismus drinnen gelebt hat, der nur Gedanken gehabt hat, die im Materialismus drinnen-stecken. Solche Gedanken wirken nun auch bei der Arterienverkalkung mit. Und er bekam Arterienverkalkung. Als er siebzig Jahre alt
war, konnte er nicht anders, als sich pensionieren zu lassen. Derjenige, der neunzig Jahre alt war, sein Kollege, war nicht Materialist, war ein Kind geblieben fast sein ganzes Leben hindurch, hat mit ungeheurer Lebhaftigkeit noch doziert. Der hat gesagt: Ja, ich begreife meinen Kollegen nicht, den jungen Knaben! Ich will mich jetzt noch nicht pensionieren lassen; ich fühle mich noch furchtbar jung. - Der andere war abgetakelt, der «Knabe» konnte nicht mehr weiter dozieren. Natürlich war der, als er zweiundneunzig Jahre alt war, auch verkalkt; er hatte ganz verkalkte Arterien, aber er konnte bei der Beweglichkeit seiner Seele mit seinen Arterien noch etwas anfangen. Der andere hatte keine Möglichkeit mehr dazu. -
Nun noch etwas zu der Frage von Herrn Burle über die Gelbe Rübe; Herr Burle sagte:
Der menschliche Körper verlangt durch seinen eigenen Instinkt das, was er braucht. Kinder haben oft eine Gelbe Rübe in der Hand. Kinder und Große zwingt man manchmal zu einer Speise, welche ihnen nicht gut tut. Ich glaube, daß man das nicht machen sollte, wenn jemand einen Speiseabscheu hat. Ich habe einen Knaben, der mag die Kartoffeln nicht essen.
Meine Herren, Sie brauchen ja nur das eine zu bedenken. Wenn nämlich die Tiere keinen Instinkt hätten für dasjenige, was ihnen gut tut und nicht gut tut, so würden sie alle längst krepiert sein; denn die Tiere kommen ja alle auf der Weide auch an Giftpflanzen heran. Wenn sie nicht genau wüßten, Giftpflanzen können sie nicht fressen, so würden sie sie ja fressen. Sie gehen ja immer an den Giftpflanzen vorbei. Aber es ist noch vieles andere. Die Tiere wählen sich ja mit Sorgfalt dasjenige aus, was ihnen gut bekommt. Haben Sie schon jemals Gänse genudelt oder gestopft? Glauben Sie, daß das die Gänse von selber machen würden? Da zwingen ja nur die Menschen die Gänse dazu, so viel zu fressen. Natürlich, bei den Schweinen ist es schon etwas anderes; aber was glauben Sie, was wir für magere Schweine hätten, wenn man sie nicht zwingen würde, so viel zu fressen! Aber bei den Schweinen ist das noch etwas anderes. Sie haben etwas in der Vererbung aufgenommen, weil man schon die Schweinevorfahren gewöhnt hat an alle die Dinge, die fett machen; die wurden schon früher in der Nahrung aufgenommen. Aber die Urschweine, die mußte man
dazu zwingen! Von selber nimmt kein Tier auf, was ihm nicht paßt. -Nun aber, meine Herren, was hat der Materialismus gemacht? Der glaubt doch nicht mehr an solche Instinkte.
Sehen Sie, ich hatte einen Freund, es war ein Jugendfreund; und als wir zusammen waren, da waren wir ganz leidlich vernünftig mit dem Essen - wir haben sehr häufig zusammen gegessen als junge Leute; wir haben uns halt dasjenige geben lassen, was man so ißt und von dem man glaubt, wie man sagt, daß es anschlägt. Nun, wie das Leben es so fügt, wir sind auseinandergekommen, und ich kam später nach Jahren wiederum in die Stadt, wo er war, wurde eingeladen bei ihm zu Mittag: Und siehe da: Er hatte neben seinem Teller ein Waage. Da sagte ich zu ihm: Was machst du denn mit der Waage da? - Ich wußte es natürlich, wollte aber hören, was er sagen würde. Er erwiderte: Das Fleisch, das mir gerade dient, das wäge ich mir zu, daß es richtig ist für mich, und den Salat. - Da wog er sich auf der Waage alles zu, was er auf dem Teller haben soll, weil das die Wissenschaft vorgeschrieben hat. Was hat er aber damit getan? Er hat sich allen Instinkt abgewöhnt, wußte zuletzt überhaupt nicht mehr, was er essen sollte! Sehen Sie, was einst im Buch gestanden hat: an Eiweiß braucht der Mensch hundertzwanzig oder hundertfünfzig Gramm - heute ist es so, daß es heißt: nur fünfzig Gramm -, das hat er brav sich abgewogen. Das war gerade falsch!
Natürlich, meine Herren, wenn der Mensch zuckerkrank ist, dann ist es etwas anderes - das ist ganz selbstverständlich -, denn die Zuckerkrankheit, die Diabetes, die beweist immer, daß der Mensch den Instinkt für die Nahrung eigentlich verloren hat.
Also darum handelt es sich: daß, wenn ein Kind die Anlage hat, nur die geringfügige Anlage hat, Würmer zu bekommen, dann tut es nämlich alles mögliche. Sie können manchmal erstaunt sein darüber, wie ein solches Kind sich gerade ein Feld aufsucht, wo Gelbe Rüben sind, und dann werden Sie es finden, Gelbe Rüben essend. Und wenn das Feld weit weg ist, läuft das Kind hin und sucht sich die Gelben Rüben, weil das Kind, das Anlage hat zu Würmern, unbedingt Gelbe Rüben essen will. Und so ist eigentlich das Allernützlichste, was man tun kann, meine Herren: Achtgeben, wie ein Kind anfängt, das oder
jenes gern zu essen, oder nicht gern zu essen, wenn es entwöhnt ist, wenn es nicht mehr die Milch hat. Sobald das Kind an die äußere Nahrung herankommt, kann man an dem Kinde lernen, was man dem Menschen geben soll. Wenn man erst das Kind zwingt, das zu essen, was man glaubt, daß es essen soll, wird der Instinkt verdorben. Also man soll sich nach dem richten, wonach das Kind Instinkt hat. Natürlich, man muß manches, was gleich zur Unsitte ausschlägt' ja eindämmen, aber da, wo man es eindämmt, muß man beobachten.
Nehmen Sie zum Beispiel ein Kind, von dem Sie bemerken, daß es, trotzdem Sie ihm alles schön geben nach Ihrer Meinung, gar nicht anders kann, wenn es zum ersten Mal zu Tisch kommt, als auf einen Stuhl hinaufzusteigen, sich ein bißchen hinüber über den Tisch zu beugen und ein Stückchen Zucker zu stibitzen! Ja, sehen Sie, solch eine Sache muß man in der richtigen Weise auffassen, denn ein solches Kind, das auf einen Stuhl steigt und sich ein Stückchen Zucker stibitzt, hat ganz gewiß etwas in seiner Leber nicht in Ordnung. Einfach das, daß das Kind sich etwas Zucker stibitzt, das beweist, daß irgend etwas in der Leber nicht in Ordnung ist. Nur Kinder, bei denen etwas in der Leber nicht in Ordnung ist - was sogar dann durch den Zucker kuriert wird -, die stibitzen Zucker; die anderen interessieren sich nicht für den Zucker, die lassen ihn stehen. Natürlich darf das nicht zur Unsitte ausarten, aber man muß für so etwas Verständnis haben. Und man kann da in zweifacher Weise Verständnis haben.
Sehen Sie, wenn ein Kind ganz fest fortwährend nur daran denkt:
Wann guckt der Vater oder die Mutter nicht hin, daß ich den Zucker nehmen kann -, dann stibitzt das Kind später auch andere Sachen. Wenn man aber das Kind befriedigt, weil man ihm gibt, was es braucht, dann wird es kein Dieb. Also es hat auch in moralischer Beziehung eine große Bedeutung, ob man solche Dinge beobachtet oder nicht. Das ist sehr wichtig, meine Herren. Und so muß man die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, so beantworten: Man soll gerade achtgeben' was das Kind will oder verabscheut, und es nicht zu dem zwingen, was es nicht will. Denn wenn es zum Beispiel geschieht, was bei sehr vielen Kindern der Fall ist, daß es kein Fleisch essen will, so ist es so, daß das Kind durch das Fleisch Darmgifte bekommt, und die will es vermeiden. Dieser
Instinkt ist da. Ein Kind, das an einem Tisch sitzt, wo alle anderen Fleisch essen, und es verweigert das Fleisch, das hat gerade die Anlage, Darmgifte zu entwickeln durch das Fleisch. Das muß man alles berücksichtigen.
Daraus sehen Sie, daß die Wissenschaft überhaupt noch viel feiner werden muß. Die Wissenschaft muß noch viel feiner werden; die ist heute viel zu grob! Mit der Waage und allem, was man im Laboratorium treibt, kann man eigentlich nicht bloß Wissenschaft treiben.
Die Ernährung, die Sie jetzt so vorzugsweise interessiert, die ist schon so, daß man richtig verstehen muß, wie diese Ernährung mit dem Geist züsammenhängt. Da führe ich ja oftmals, wenn die Leute um so etwas fragen, oder so etwas wissen wollen, zwei Beispiele an. Denken Sie sich, meine Herren, ein Journalist, der muß ja so viel denken -allerdings unnötig meistens -, aber er muß so viel denken, daß ja der Mensch so viele Gedanken, die logisch sind, gar nicht haben kann. Daher werden Sie finden, daß der Journalist oder überhaupt ein Mensch, der berufsmäßig schreiben soll, den Kaffee liebt, ganz instinktmäßig. Er setzt sich ins Kaffeehaus, trinkt eine Tasse Kaffee nach der anderen und nagt an der Feder, damit etwas herauskommt, das er schreiben kann. Das Federnagen hilft ihm nichts, aber der Kaffee hilft ihm dazu, daß ein Gedanke aus dem anderen hervorgeht, denn es muß sich ja ein Gedanke an den anderen anknüpfen.
Aber sehen Sie, wenn sich einer an den anderen anknüpft, wenn einer aus dem anderen folgt, das ist sehr schädlich bei Diplomaten. Wenn Diplomaten logisch sind, findet man sie langweilig; sie müssen recht unterhaltsam sein. In Gesellschaften, da liebt man es nicht, daß erstens, zweitens, drittens, «und wenn das erst' und zweit' nicht wär', das dritt' und viert' wär nimmermehr» -, wenn einer so logisch ist! Man darf nicht andere Dinge zum Beispiel in einem Finanzartikel behandeln als Journalist. Aber als Diplomat kann man reden von Tanzbars oder sonstigem zugleich, oder nachher von den Staatsfinanzen des Landes X, und nachher von den Schnecken der Frau Soundso, und nachher kann man gleich übergehen und reden von der Fruchtbarkeit der Kolonien; und nachher: wo das beste Pferd steht und so weiter. Da muß ein Gedanke in den anderen überspringen. Ja,
da bekommt man, wenn man in dieser Weise gesellschaftsfähig werden wsll, den Instinkt, viel Tee zu trinken! Der Tee, der zerstreut die Gedanken; da springt man in Gedanken. Und der Kaffee, der setzt einen Gedanken an den anderen an. Wenn ein Gedanke zum anderen überspringen soll, da muß man Tee trinken! Ja, sehen Sie, beim Diplomaten-Tee - man sagt schon «Diplomaten-Tee»! -, da wird eben Tee getrunken! Der Journalist sitzt im Kaffeehaus, trinkt einen Kaffee nach dem anderen aus. Da sehen Sie schon, welchen Einfluß ein Nahrungs- oder Genußmittel auf das ganze Denken hat! Und so ist es natürlich nicht nur mit diesen Dingen; dies sind sozusagen radikale Dinge - Kaffee und Tee. Aber gerade daran sieht man, daß man darauf achten muß, wie diese Dinge stehen. Das ist sehr wichtig, meine Herren.
Wir werden dann den Vortrag am nächsten Mittwoch wiederum um neun Uhr haben.
ACHTER VORTRAG Dornach, 5. August 1924
Nun, meine Herren, es sind mir eine Reihe von Fragen überreicht worden, die ganz interessant zu der heutigen Besprechung gehören können. Jemand aus Ihrem Kreise hat die Frage überreicht:
Woraus ist die Kulturentwicklung des Menschen entstanden?
Ich werde es gleich im Zusammenhang dann betrachten mit der zweiten Frage:
Warum war bei den primitiven Menschen der Glaube an einen Geist so groß?
Nun, sehen Sie, es ist ja zweifellos interessant, sich zu fragen: Wie haben die Menschen in früheren Zeiten gelebt? - Und es gibt ja, wie Sie wissen, auch wenn man die Sache nur oberflächlich betrachtet, zwei Ansichten. Die eine Ansicht geht dahin, daß der Mensch ursprünglich recht vollkommen war und aus seiner Vollkommenheit heruntergefallen ist zu der heutigen Unvollkommenheit. Man braucht sich nicht besonders daran zu stoßen und damit zu beschäftigen, daß die verschiedenen Völker diese ursprüngliche Vollkommenheit sich in verschiedener Weise auslegen. Der eine spricht vom Paradies, der andere von etwas anderem; aber die Ansicht war ja noch bis vor ganz kurzer Zeit vorhanden, daß der Mensch ursprünglich vollkommen war und er sich erst nach und nach zu seiner jetzigen Unvollkommenheit heranbildete. Die andere Ansicht ist diejenige, die Sie ja wahrscheinlich kennengelernt haben als die, welche allein wahr sein soll: daß der Mensch ursprünglich ganz unvollkommen war, so eine Art höheres Tier war, und sich allmählich zu immer größerer Vollkommenheit entwickelt habe. Sie wissen ja, daß man dann versucht, diejenigen Urzustände, die heute noch unter den wilden Völkern sind - sogenannten wilden Völkern -, daß man diese benützt, um sich ein Ansicht darüber zu bilden, wie die Menschen ursprünglich, als sie noch tierähnlich waren, eigentlich haben sein können. Man sagt sich: Wir in Europa und die Leute in Amerika sind hoch zivilisiert; aber in Afrika, in Australien
und so weiter, da leben noch unzivilisierte Völker, die sind auf der ursprünglichen Stufe oder wenigstens auf einer Stufe, die der ursprünglichen sehr nahe stand, stehengeblieben; an denen kann man studieren, wie die ursprüngliche war.
Sehen Sie, meine Herren, die Leute machen sich aber die Vorstellung, die man über die Entwickelung der Menschheit haben muß, dabei viel, viel zu einfach. Denn erstens ist es gar nicht wahr, daß zum Beispiel alle zivilisierten Völker sich vorstellen, daß der Mensch ursprünglich als physisches Wesen vollkommen gewesen wäre. Die Inder haben ganz gewiß nicht die Ansicht, welche die heutigen Materialisten haben, aber sie stellen sich doch vor, daß die Menschen, die in der Urzeit physisch auf der Erde herumgegangen sind, dennoch tierähnlich ausgesehen haben. Und wenn man bei den Indern, bei den indischen Weisen von dem ursprünglichen Menschen auf der Erde redet, so redet man auch von Hanuman, der affenähnlich ausgesehen hat. Nun, sehen Sie, das ist schon einmal nicht wahr, daß auch die Menschen, die eine geistige Weltanschauung haben, sich überall vorstellen, daß der Mensch ursprünglich irgendwie so war, wie sich ungefähr die Leute heute vorstellen, daß der Mensch im Paradiese war - das ist eben doch schon nicht so. Man muß sich vielmehr darüber klar sein, daß der Mensch ja ein Wesen ist, welches in sich trägt Leib, Seele und Geist, und daß Leib, Seele und Geist verschiedene Entwickelungen durchgemacht haben. Natürlich, wenn man gar nicht vom Geist spricht, so kann man auch nicht von der Entwickelung des Geistes sprechen. Aber sobald man darauf kommt, daß eben der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, kann man durchaus davon sprechen: Wie entwickelt sich der Leib? Wie entwickelt sich die Seele? Wie entwickelt sich der Geist? -Soll man sprechen vom Leib des Menschen, dann kommt man schon dazu, sich zu sagen: Der Leib des Menschen, der hat sich allmählich aus niederen Stufen vervollkommnet. Da muß man auch sagen: Dafür sind schon die Zeugnisse, die man hat, ein lebendiger Beweis. - Man findet, wie ich Ihnen ja schon angedeutet habe, in den Schichten der Erde den ursprünglichen Menschen; er zeigt einen Leib, der eben noch sehr tierähnlich ist - nicht so wie irgendein heutiges Tier, aber der eben doch tierähnlich ist, und der sich vervollkommnet haben muß, damit er
die heutige Gestalt hat annehmen können. Es ist also gar keine Rede, daß Geisteswissenschaft, so wie sie hier am Goetheanum getrieben wird, in einen Widerspruch kommt mit der Naturwissenschaft, weil sie einfach die Wahrheiten der Naturwissenschaft aufnimmt.
Dagegen, meine Herren, muß man auch wiederum das feststellen, daß in diesen Zeiten, die eigentlich nur, man könnte sagen um dreitausend oder viertausend Jahre zurückliegen, daß in solchen Zeiten Ansichten entstanden sind, aus denen wir heute nicht nur sehr viel lernen können, sondern die wir bewundern müssen. Wenn wir heute mit einer wirklichen Sachkenntnis die Schriften, die in Indien, in Asien, in Ägypten, selbst in Griechenland entstanden sind, wirklich studieren und verstehen, dann finden wir, daß die Leute damals uns weit voraus waren. Nur haben sie dasjenige, was sie gewußt haben, eben auf eine ganz andere Weise erworben, als es heute erworben wird.
Sehen Sie, heute weiß man von vielen Dingen sehr wenig. Zum Beispiel haben Sie gesehen aus dem, was ich Ihnen über die Ernährung dargestellt habe, wie die Geisteswissenschaft nachhelfen muß, damit man auf die einfachsten Dinge der Ernährung wieder kommt. Das kann nun eben die physische Wissenschaft nicht. Aber gerade wenn man bei alten Medizinern nachliest und ihre Worte richtig versteht, dann kommt man darauf, daß die Leute eigentlich zum Beispiel noch bis Hippokrates in Griechenland im Grunde genommen viel mehr wußten, als die heutigen materialistischen Mediziner wissen. Und man bekommt Respekt, man bekommt Hochachtung vor demjenigen, was einmal vorhanden war an Wissen. Nur, sehen Sie, meine Herren, war die Sache so, daß man das Wissen nicht so ausgedrückt hat wie heute. Man drückt heute das Wissen in Begriffen aus. Die alten Völker haben das Wissen nicht in Begriffen ausgedrückt, sie haben es ausgedrückt in dichterischen Vorstellungen, so daß dasjenige, was da übriggeblieben ist, heute eben vielfach als Dichtung genommen wird. Aber es war für die alten Menschen nicht Dichtung, es war dasjenige, wodurch sie ihr Wissen, ihre Erkenntnis ausgedrückt haben. Und so kommen wir darauf, daß schon, wenn wir dasjenige, was schriftlich vorhanden ist, prüfen und richtig studieren können, dann gar keine Rede davon sein kann, daß ursprünglich die Menschen ganz unvollkommen gewesen
sind an Geist. Diese Menschen, die einmal in tierischen Körpern herumgegangen sind, die waren eben an Geist viel, viel weiser, als wir sind.
Aber auch das muß man wiederum festhalten: Sehen Sie, wenn solch ein ursprünglicher Mensch herumgegangen ist, so hatte er seinen Geist sehr weise ausgebildet. Sein Gesicht war mehr oder weniger - wir würden heute sagen: tierähnlich. Na ja, schön. Aber der heutige Mensch, der drückt in seinem Gesicht schon den Geist aus. In die Materie des Gesichtes ist der Geist schon hineingebaut. Das, meine Herren, ist notwendig, damit der Mensch frei sein kann, ein freies Wesen sein kann. Diese sehr gescheiten Menschen von ehemals, diese sehr gescheiten Menschen der Urzeit, waren zwar weise, aber sie haben die Weisheit so gehabt, wie heute das Tier seine Instinkte hat. Sie haben dumpf, wie im Nebel gelebt. Sie haben geschrieben, ohne daß sie selber irgendwie die Hand geführt hätten; sie haben gesprochen so, daß sie geglaubt haben, nicht sie selber sprechen, sondern eben der Geist spricht in ihnen. Also von einem freien Menschen war in diesen Urzeiten nicht die Rede.
Und das ist dasjenige, was ein wirklicher Fortschritt des Menschen-geschlechtes in der Kulturgeschichte ist: daß der Mensch ein Bewußtsein gekriegt hat, daß er ein freies Wesen ist. Dadurch fühlt er den Geist nicht mehr als etwas, das ihn, wie der Instinkt das Tier, treibt, sondern er fühlt den Geist in sich. Und das ist dasjenige, was die heutigen Menschen unterscheidet von den früheren.
Sehen Sie, wenn wir von diesem Gesichtspunkte aus die heutigen Wilden anschauen, so müssen wir uns vorstellen, daß die Menschen in der Urzeit - die hier in der Frage die primitiven Menschen genannt werden - nicht so waren wie die heutigen Wilden. Und sie werden eine Vorstellung bekommen, wie die heutigen Wilden aus den Menschen der Urzeit geworden sind, wenn ich Ihnen etwa das Folgende sage: Es gibt in gewissen Gegenden Menschen, die tragen sich mit der Idee, daß sie, wenn sie ein Stücklein von irgend jemandem, von einem Kranken, eingraben in die Erde, und dieses so machen, daß sie das Stück Hemdleinen zum Beispiel eingraben im Friedhof, sie damit eine Zauberwirkung bewirken, daß der Kranke gesund werden kann. Ich habe solche Menschen noch kennengelernt. Ich habe sogar einen kennengelernt,
der hat ein Gesuch geschrieben, als der Kaiser Friedrich, der dazumal noch Kronprinz war, krank war - Sie wissen ja die Geschichte -, ein Gesuch an die spätere Kaiserin, daß man ihm einen Hemdzipfel vom Kaiser Friedrich schicken solle; er werde das dann im Friedhof eingraben und dann werde der Kaiser Friedrich gesund werden. Nun, Sie können sich denken, daß dieses Gesuch nicht gerade sehr gut beschieden worden ist! Aber der Mann hat das eben gemacht, weil er geglaubt hat, daß er dadurch den Kaiser Friedrich gesund machen könne. Er hat mir das selbst erzählt. Und er hat mir erzählt, daß es viel gescheiter gewesen wäre, wenn man ihm das Hemdzipferl geschickt hätte, als daß man solchen Unsinn gemacht hätte, den englischen Arzt Mackenzie zu dem Kaiser zu rufen und so weiter. Das wäre alles Unsinn gewesen, man hätte ihm müssen diesen Hemdzipfel schicken.
Sehen Sie, diese Sache verfolgt nun derjenige, der materialistisch denkt, und sagt: Das ist ein Aberglaube, der einmal irgendwo entstanden ist. Irgendeinmal hat ein Mensch sich in den Kopf gesetzt, wenn man auf dem Friedhof einen Hemdzipfel eingräbt und dabei ein gewisses Gebet verrichtet, so wird derjenige, für den man das Gebet verrichtet, gesund.
Aber auf diese Weise ist nie ein Aberglaube entstanden, meine Herren. Ein Aberglaube ist nie auf die Weise entstanden, daß das jemand sich ausgedacht hat, sondern er entsteht auf eine ganz, ganz andere Art. Es war einmal so, daß die Leute ihre Toten ganz stark verehrt haben und sich gesagt haben: Solange der Mensch auf der Erde herum-geht, ist er eben ein sündhafter Mensch, begeht neben dem Guten auch Schlechtes. - Sie haben die Vorstellung gehabt: Der Tote lebt in der Seele und im Geiste fort. Der Tod gleicht alles aus. - Und wenn sie an den Toten denken, dann denken sie an etwas Gutes. Diese Vorstellung haben die Leute gehabt: Wenn sie an einen Toten denken, dann denken sie an etwas Gutes. Und sie haben sich selber besser machen wollen dadurch, daß sie an ihre Toten gedacht haben.
Nun ist es aber bei den Menschen so, daß die Leute die Sache leicht vergessen. Denken Sie nur, wie schnell werden Tote, Abgeschiedene vergessen! Da fanden sich dann andere Leute, die wollten allerlei Merkzeichen an die Leute heranbringen, damit sie an die Toten denken und dadurch selber besser werden sollten.
Sagen wir, es hat jemand die Absicht gehabt, daß in einem Dorf, wenn einer krank ist, sich die Leute des Kranken annehmen. Ja, in den Dörfern war es doch früher so, daß man nicht Krankengeld gekriegt hat - Krankenkassen oder so etwas, das wissen Sie, ist eine neuere Einrichtung -; da mußte einer dem andern aushelfen im Dorfe aus gutem Willen. Er mußte an den Kranken denken. Nun hat sich derjenige, der das Dorf geleitet hat, gesagt: Die Leute werden, weil sie egoistisch sind, nicht an die Kranken denken, wenn sie nicht überhaupt angesport werden, aus sich herauszugehen und zum Beispiel an die Toten zu denken. Und da hat er ihnen gesagt, sie sollen von dem Kranken ein Hemdzipferl nehmen - dadurch werden sie erinnert, daß der Kranke da ist -und das Hemdzipferl eingraben. Dadurch werden sie daran erinnert, daß man sorgen soll für jemanden, indem sie an den Toten denken. Und es ist dasjenige, was äußerliche Handlung ist, eigentlich nur für den Menschen wie eine Gedächtnishilfe eingerichtet worden. Später hat man vergessen, wozu das da war und hat der Sache Zauberwirkung, Aberglaubewirkung zugeschrieben. So ist es mit sehr vielem, was da lebt als Aberglaube; es ist ausgegangen von etwas ganz Vernünftigem. Niemals ist etwas Vollkommenes ausgegangen von etwas Unvollkommenem. Derjenige, der das durchschaut, dem kommt die Behauptung, daß etwas Vollkommenes aus Unvollkommenem entstehen kann, so vor, als wenn man sagt: Du mußt einen Tisch machen, aber den mußt du zuerst möglichst plump und unvollkommen machen, damit er dann vollkommener werden kann. - So ist es doch nicht! Man kriegt niemals aus einem zerschlagenen Tisch einen richtigen. Erst ist der Tisch richtig und dann wird er auch zerschlagen. Und so ist es auch draußen in der Natur und in der Welt überhaupt. Zuerst müssen die vollkommenen Dinge da sein, dann können daraus die unvollkommenen entstehen. Und so ist es beim Menschen: er hat seinen Geist zuerst in einer gewissen Vollkommenheit gehabt, wenn auch noch unfrei - den Körper allerdings unvollkommen. Aber das war ja gerade wiederum das Vollkommene des Körpers, daß er weich war, daß er sich durch den Geist hat formen lassen, daß die Kultur dadurch höhersteigen konnte.
Also sehen Sie, meine Herren, wir dürfen nicht die Ansicht haben, daß ursprünglich die Menschen so waren wie die heutigen Wilden. Die
heutigen Wilden sind so geworden, wie sie heute sind: abergläubisch, zauberisch, aber auch im Äußern schmutzig, aus ursprünglich vollkommeneren Zuständen; und wir haben den Wilden nur das voraus, daß wir von denselben Zuständen ausgegangen sind - nur, die sind heruntergekommen und wir sind eben nicht heruntergekommen. Also ich möchte sagen: Nach zwei Seiten hin hat sich eben die Menschheit entwickelt. Es ist gar nicht wahr, daß die heutigen Wilden darstellen einen Zustand, in dem die Menschheit ursprünglich war. Diese Menschen, die ursprünglich mehr tierisch ausgesehen haben, diese Menschen sind sehr zivilisiert gewesen.
Wenn Sie nun die Frage aufwerfen: Stammen denn aber diese ursprünglichen tierischen Menschen ab von den Affen oder von anderen Tieren? -, da kommen Sie natürlich dann auf folgendes: Sie schauen die heutigen Affen an und sagen sich: Von den Affen stammen die Menschen ab. - Ja, aber als der Mensch in dieser tierischen Form da war, da gab es die heutigen Affen noch gar nicht! Also von den heutigen Affen stammt der Mensch nicht ab. Im Gegenteil! So wie die heutigen Wilden heruntergekommene Menschen der Urzeit sind, so sind die heutigen Affen auch wiederum noch mehr heruntergekommene Wesen. Und wenn wir weiter in der Entwickelung der Erde hinaufgehen, so finden wir eben Menschenwesen, die sich so gebildet haben, wie ich es vor einigen Stunden hier dargestellt habe: aus einem weichen Element heraus, nicht aus dem heutigen Tiere. Aus dem heutigen Affen werden niemals Menschen entstehen. Dagegen könnte es sehr leicht sein, wenn diejenigen Zustände, die heute vielfach auf der Erde herrschen, wo alles auf Gewalt gegründet ist, wo alles auf Macht gegründet ist, wo die Weisheit gar nichts gilt - ja, das könnte sehr leicht sein, daß die Menschen, die heute alles auf Macht gründen wollen, daß die allmählich wiederum eine tierische Körperlichkeit annehmen, und daß zwei große Rassen entstehen: eine, also diejenigen, die für den Frieden, den Geist und die Weisheit sind, und eine andere, die tierische Gestalten wieder annimmt. Und wir könnten schon sagen: Diejenigen Menschen, die heute gar nichts geben auf den wirklichen Menschheitsfortschritt, auf das Geistige, die könnten in der Gefahr stehen, einmal in die Affenhaftigkeit zu verfallen.
Sehen Sie, man erlebt ja heute allerlei sonderbare Sachen. Natürlich ist dasjenige, was in den Zeitungen berichtet wird, meistens nicht wahr, aber manchmal weist es in ganz besonderer Art auf die Denkungsart der Menschen hin. Neulich, auf der holländischen Reise, kauften wir eine illustrierte Zeitung. In dieser illustrierten Zeitung war auf der letzten Seite ein ganz sonderbares Bild: Da war ein Kind, ein kleines Kind, ein Baby, und als Pfleger, als Aufzieher, als Erzieher ein Affe, ein Orang-Utan; der hält das Kind ganz wacker im Arm und sollte also angestellt werden - man berichtete, er wäre angestellt, natürlich irgendwo in Amerika - als Kinderaufzieher!
Nun, die Sache mag ja heute noch nicht wahr sein, aber es zeigt doch, wohin die Sehnsucht mancher Menschen geht: Die möchten die heutigen Affen aufziehen als Kinderwärter. Ja, meine Herren, da können wir ja weit kommen in der Menschheit, wenn die Affen Kinder-wärter werden! Aber Sie wissen ja, die Sehnsucht mancher Menschen geht ja überhaupt noch weiter. Sollte es nur einmal entdeckt werden, daß Affen als Kinderwärter benützt werden können - einen Affen kann man zu manchem abrichten; das Kind wird es zwar zu büßen haben, aber einen Affen kann man zu manchem abrichten; rein äußerlich kann ja unter Umständen ein Affe schon einmal als Kinderwärter abgerichtet werden -, dann werden die Leute eine merkwürdige Sehnsucht bekommen. Dann wird zum Beispiel die soziale Frage auf eine ganz neue Stufe gestellt werden, denn dann werden Sie gleich sehen, wie die Vorschläge kommen, man solle große Affenzüchtereien einrichten und man solle sich die Fabrikarbeiten von Affen machen lassen! Denn die Menschen werden finden, daß die Affen billiger sind als die Menschen, und daher wird das als eine Lösung der sozialen Frage gebracht werden. Wenn es wirklich gelingen wird, die Affen zu Kinderwärtern zu machen - die Broschüren über die Lösung der sozialen Frage durch Aufzucht der Affen, die dann erscheinen, die werden massenhaft sein!
Ja, man kann sich denken, daß das sogar geschehen könnte. Denken Sie doch nur einmal, andere Tiere als die Affen kann man zu so manchem aufziehen; sogar die Hunde kann man zu manchem anlernen. Aber es frägt sich, ob damit die Zivilisation vorwärtskommt oder zurückkommt.
Sie kommt ganz gewiß zurück! Herunter kommt sie. Die Kinder, die eben von Affenwärtern oder -wärterinnen aufgezogen werden, die werden ganz sicher affenartig werden! Dann wird sich das Vollkommene eben in das Unvollkommene verwandeln. So müßten wir eben uns klar sein darüber, daß zwar die Zukunft gewisser Menschen die Affenähnlichkeit sein könnte, aber daß die Vergangenheit des Menschengeschlechtes niemals eine solche war, daß wirklich aus der Affenhaftigkeit sich die Menschheit herausgebildet hat. Denn als die Menschen noch ihre tierische Gestalt, die ganz anders ausgeschaut hat als die heutige Affengestalt, hatten, da gab es eben noch nicht die heutigen Affen. Die sind selber heruntergekommene Wesen, von einer höheren Stufe heruntergekommen.
Wenn wir nun zu diesen primitiven Völkern gehen, die, wenn man so sagen darf, groß an Geist und tierisch an Körper waren, so findet man, daß bei denen der Verstand, die Intelligenz, auf die wir so stolz sind, eben noch nicht ausgebildet war. Denken haben diese alten Menschen nicht gekonnt. Wenn daher heute einer, der sich durch Denken besonders gescheit fühlt, herankommt an die alten Schriften, so sucht er Gedankengründe. Die findet er nicht. Also sagt er: Es ist zwar sehr schön, aber Dichtung. - Ja, meine Herren, wir können aber nicht alles nur nach uns beurteilen! Es ist ganz falsch, wenn wir alles bloß nach uns beurteilen. Diese Menschen in einer früheren Zeit, die haben vor allen Dingen eine ganz starke Phantasie gehabt, eine Phantasie, die wie ein Instinkt gewirkt hat. Wenn wir heute unsere Phantasie brauchen, dann werfen wir uns das oftmals sogar vor, weil wir sagen: Die Phantasie bezieht sich nicht auf etwas Wirkliches. - Für uns heute haben wir damit ganz recht; aber die Menschen der Urzeit, die primitiven Menschen hätten überhaupt nichts anfangen können, wenn sie nicht die Phantasie gehabt hätten.
Nun wird Ihnen das merkwürdig erscheinen, daß die Menschen der Urzeit eine so lebhafte Phantasie gehabt haben, die auf irgend etwas Wirkliches gegangen ist. Aber sehen Sie, auch da hat man wiederum ganz falsche Vorstellungen. Sie werden in Ihren Schulbüchern der Geschichte gelesen haben, was es für eine große Bedeutung in der Entwickelung der Menschheit hatte, als das sogenannte Leinenlumpenpapier
erfunden worden ist. Ja, meine Herren, das Papier, auf dem wir heute alle unsere Sachen drauf schreiben, das aus Lumpen gemacht wird, das besteht ja erst ein paar Jahrhunderte! Früher hat man auf Pergament schreiben müssen, das auf ganz andere Weise entstanden ist. Daß man die Pflanzenfasern, aus denen ursprünglich unsere Kleider gemacht wurden, nachdem die Kleider abgetragen sind, verarbeiten kann zu Papier, das ist eben erst, als das Mittelalter zu Ende war, von den Menschen entdeckt worden. Der Verstand ist über die Menschen spät gekommen. Und das haben die Menschen mit dem Verstand entdeckt, dieses Leinenlumpenpapier. Aber ganz dasselbe, nur nicht gerade so weiß, wie wir unser Papier für die schwarze Tinte haben wollen, das ist ja längst entdeckt gewesen! Derselbe Stoff wie unser heutiges Papier war ja längst entdeckt, und zwar nicht etwa ein paar tausend Jahre vorher, sondern viele, viele tausend Jahre vorher. Aber von wem? Überhaupt nicht von Menschen, sondern von den Wespen! Schauen Sie sich einmal ein solches Wespennest an, das an den Bäumen hängt. Nehmen Sie den Stoff, aus dem es besteht; aber Sie müssen nicht weißes Papier nehmen, nicht das Papier, das man zum Schreiben braucht, denn die Wespen haben sich eben das Schreiben noch nicht angewöhnt, sonst würden sie auch weißes Papier machen, auf dem sie schreiben könnten, sondern solches Papier, wie man es bloß zum Einwickeln braucht. Wir haben zum Einwickeln ja auch graues Papier. Dieses graue Papier, meine Herren, das ist ganz dasselbe wie das, woraus die Wespen ihr Wespennest machen! Die Wespen haben viele, viele tausend Jahre vorher das Papier entdeckt, bevor die Menschen durch den Verstand darauf gekommen sind. Es ist eben der Unterschied: Bei den Tieren wirkte der Instinkt, bei den ursprünglichen Menschen die Phantasie. Die hätten gar nichts machen können, wenn sie nicht aus der Phantasie heraus etwas hätten machen können, denn Verstand hatten sie nicht. So daß man also sagen muß: Diese ursprünglichen Menschen schauten äußerlich mehr tierisch aus als die heutigen Menschen, sie waren aber gewissermaßen besessen von dem Geist; der wirkte in ihnen. Sie besaßen ihn noch nicht durch sich selber, sie waren besessen vom Geist, und ihre Seele hatte große Phantasie. Mit der Phantasie machten sie ihre Werkzeuge, mit der Phantasie
machten sie alles, was sie überhaupt machen konnten, was sie brauchten.
Wir sind auf alle unsere Erfindungen so urchtbar stolz, aber wir sollten auch bedenken, daß wir ja nicht gar so stolz zu sein brauchen, denn es ist vieles von dem, was heute die Größe der Kultur ausmacht, eigentlich entsprungen aus einfachen Gedanken. Sehen Sie, meine Herren, ich will Ihnen etwas sagen: Wenn wir über den Trojanischen Krieg lesen - wissen Sie, wann der stattgefunden hat? Etwa 1200 Jahre vor der Begründung des Christentums. Nun, wenn wir von solchen Kriegen hören, die nicht in Griechenland stattgefunden haben, sondern weit weg von Griechenland, in Asien drüben - ja, daß am nächsten Tag durch ein Telegramm in Griechenland die Leute erfahren haben, wie der Krieg ausgegangen ist, der drüben in Asien war, ja, so ist das nicht gegangen wie heute! Heute schickt einem, wenn man ein Telegramm kriegt, die Post das Telegramm herauf; so kriegt man es. Das ist natürlich in Griechenland nicht so gewesen, denn die Griechen haben keine elektrischen Telegraphen gehabt. Wie haben Sie es denn gemacht? Ja, sehen Sie, dahier war Krieg (es wird gezeichnet), dahier war Meer, da eine Insel, da ein Berg, da wieder Meer; da eine Insel, ein Berg und so weiter bis zu Griechenland herunter - hier Asien, dazwischen Meer, da Griechenland. Es war verabredet, daß wenn der Krieg ausgeht, auf dem Berg drei Feuer angezündet werden. Derjenige, der am nächsten Berg war, der hat zunächst dadurch, daß er hergelaufen ist und drei Feuer angezündet hat, das erste Signal gegeben. Derjenige, der am nächsten Berg war, hat wieder drei Feuer angezündet, wenn er die drei Feuer gesehen hat, der nächste wieder drei, und so ist das herüberge-kommen bis Griechenland in ganz kurzer Zeit. So hat man telegraphiert. Das hat man eben gemacht, das ist eine einfache Art zu telegraphieren. Schnell ist es gegangen; als man noch keinen elektrischen Telegraphen gehabt hat, hat man sich eben mit dieser Art begnügen müssen.
Nun, meine Herren, wie machen wir es denn heute? Sehen Sie, wenn wir telephonieren - gar nicht telegraphieren, sondern telephonieren: in der allereinfachsten Art, die nicht kompliziert ist, will ich es Ihnen zeigen. Wir haben eine Art von Magneten, der allerdings durch Elektrizität erzeugt wird; haben dahier (es wird gezeichnet)
etwas, was man Anker nennt; wenn der Strom geschlossen ist, dann wird das angezogen; wenn der Strom wieder offen ist, geht die Platte weg, und so pendelt diese Platte hier hin und her. Das ist durch einen Draht mit dem nächsten verbunden, das pendelt mit, und dasjenige, was hier mit der Platte erzeugt wird - es ist nur verschlossen dem Telephongehilfen -, das überträgt sich geradeso, wie dazumal die drei Feuer durch Menschen übertragen wurden. Es ist etwas komplizierter, aber der Gedanke ist derselbe geblieben, nur daß man auf diesen Gedanken die Elektrizität angewendet hat.
Sehen Sie, man bekommt eben vor demjenigen, was die alten Menschen ersonnen und eingerichtet haben aus der Phantasie heraus, einen Respekt, wenn man es wirklich kennt. Und wenn man mit diesem Respekt die alten Schriften liest, dann sagt man sich: Auch im rein Geistigen haben diese Menschen Großartiges geleistet; aber alles aus der Phantasie heraus. - Da brauchen Sie nur zu nehmen etwas, wovon, sagen wir, die heutigen Menschen glauben, daß sie es ganz gut wissen. Die heutigen Menschen glauben, daß sie von den alten germanischen Göttern etwas wissen; Wotan zum Beispiel, Loki, die werden in Menschengestalt abgebildet in Büchern - der Wotan mit wallendem Bart, der Loki mit rotem Haar, teuflisch aussehend und so weiter. Und nun glaubt man, daß die alten Menschen, die alten Germanen dieselben Vorstellungen gehabt haben von Wotan und von Loki. Das ist aber nicht wahr, sondern diese alten Menschen haben die Vorstellung gehabt:
Wenn der Wind weht, dann ist da auch Geistiges drinnen - das ist ja auch wahr -, und da weht der Wotan drinnen. Sie haben sich nicht vorgestellt, daß wenn sie in den Wald gehen, ein gewöhnlicher Mensch einem begegne als Wotan, sondern wenn sie von der Begegnung mit dem Wotan geredet haben, dann war es der wehende Wind im Walde. Derjenige, der noch einen Sinn hat für das Wort Wotan, der fühlt das heute noch aus dem Wort heraus. Loki - es war nicht die Vorstellung, daß der irgendwo in der Ecke glotzt, sondern der lebt im Feuer.
Nun aber erzählten die Menschen allerhand von Wotan und Loki. Sagen wir zum Beispiel, sie erzählten von Wotan: Ja, wenn man da hin-überkommt über den Weg, über den Berg hinüber, dann kann man dem Wotan begegnen, und dann wird der Wotan einen entweder stark
machen oder schwach, je nachdem man es verdient. - Sehen Sie, das haben die Leute erzählt, haben es auch verstanden. Die heutigen Menschen sagen: Nun ja, das ist eben ein Aberglaube, eine abergläubische Vorstellung. - Aber so haben es die Leute damals nicht verstanden; sondern die Leute haben gewußt: Wenn sie dorthin gehen an jene Ecke, die schwer zugänglich ist, da begegnen sie nicht einem Menschen, der so ist wie ein anderer leiblicher Mensch, sondern da ist ihnen durch die ganze Konfiguration des Gebirges Gelegenheit gegeben, daß da eine Art Wirbelwind besonders weht, und eine besondere Luft aus irgendeinem Abgrund auf einen zukommt - wenn man das aushält, und auch schon den Weg dahin aushält, so kann man von so etwas gesund werden, oder auch krank werden. Wie man gesund und krank wird, wollten die Leute eben erzählen; sie waren mit der Natur in Einklang und wollten das aus der Phantasie heraus erzählen, nicht durch den Verstand. Der heutige Arzt sagt es durch den Verstand; er sagt: Wenn du Anlagen hast zu Tuberkulose, dann gehe diesen Weg jeden Tag so hoch hinauf, setze dich ein bißchen nieder und gehe wieder herunter; das bekommt dir gut. - So sagt man es mit dem Verstand. Mit der Phantasie sagt man: Der Wotan sitzt da in der Ecke, hält sich da auf; der wird dir nützen, wenn du ihn durch vierzehn Tage zu einer gewissen Zeit besuchst.
So haben die Leute aus der Phantasie heraus das Leben angegriffen. Und sie haben ja auch aus der Phantasie gewirkt. Sehen Sie, meine Herren, Sie alle werden doch schon irgendeinmal auf dem Lande gewesen sein, wo man nicht mit Maschinen drischt, sondern wo man noch mit der Hand drischt. Hören Sie da nur einmal zu, wie man drischt, ganz nach dem Takt, nach dem Rhythmus. Die Leute wissen, wenn sie dreschen müssen durch viele Tage und ganz unregelmäßig dreschen würden, wie es ihnen einfällt hinschlagen würden: man würde zusammenfallen vor Müdigkeit! So kann man nicht dreschen. Wenn man aber im Rhythmus, im Takt drischt, so wird man weniger müde, weil sich das anpaßt dem Rhythmus, den man in sich selber hat in seiner Blutzirkulation, in seinem Atem. Es ist ja etwas anderes, ob Sie mit dem Schlegel schlagen, wenn Sie ausatmen, oder wenn Sie einatmen, oder wenn Sie mit dem Schlegel schlagen, wenn Sie gerade das Einatmen
ins Ausatmen umwandeln sollen. Aber woher kommt das? Daß es vom Verstand nicht kommt, das sehen Sie, denn heute geschieht es nicht mehr; man rottet alles dieses aus. Aber alle Arbeit, die die Leute gemacht haben, war so, zum Beispiel, daß sie im Takt, im Rhythmus getan wurde; aus der Phantasie heraus wurde alle Arbeit getan. Und so hat sich eigentlich alles das, was sich ursprünglich an Kultur entwickelt hat, aus dem Rhythmus heraus entwickelt.
Nun, sehen Sie, ich glaube, daß Sie doch wirklich nicht der Meinung sein können, wenn ich irgendein Holz habe, einen Bogen und Saiten und so weiter, daß da durch irgendwelche zufällige Maßnahmen eine Geige entsteht! Eine Geige entsteht, wenn man Geist anwendet, wenn man das Holz in einer bestimmten Fläche bearbeitet, die Saiten bearbeitet und so weiter. Also man muß schon sagen: Die Art und Weise, wie man ursprünglich Maschinen gemacht hat, konnten die Leute, namentlich weil sie selber noch nicht dachten, niemandem anderem zuschreiben als dem Geist, von dem sie besessen waren, der in ihnen wirkte. Deshalb waren diese ursprünglichen Menschen, die nicht aus dem Verstand, sondern aus der Phantasie arbeiteten, natürlich geneigt, überall von Geist zu sprechen. Wenn einer natürlich heute nach dem Verstand eine Maschine zusammensetzt, da sagt er nicht: Der Geist hat mir geholfen. - Er sagt es mit Recht nicht. Wenn aber der ursprüngliche Mensch, der es nicht gewußt hat, der überhaupt gar nicht daran denken konnte zu denken - wenn der ursprüngliche Mensch etwas zusammensetzte, fühlte er gleich: Der Geist hat mir geholfen.
Daher war es auch so, daß, als die Europäer, diese «besseren» Menschen, zuerst nach Amerika gekommen sind, ja auch noch später, als sie im 19. Jahrhundert in jene Gegenden gekommen sind, wo noch Indianer der alten Zeit gelebt haben, da sprachen diese Indianer - man kriegte das heraus, von was sie sprachen - von dem «Großen Geist», der alles beherrscht. Und so haben es diese primitiven Menschen überhaupt gehalten; sie haben von dem Großen Geist gesprochen, der alles beherrscht. Und diesen «Großen Geist», den haben namentlich diejenigen Menschen verehrt, die in dieser atlantischen Zeit gelebt haben, da, als noch Land war zwischen Europa und Amerika, und die Indianer haben das zurückbehalten. Die Indianer hatten noch keinen Verstand.
Sehen Sie, die Indianer haben allmählich kennengelernt die «bes-seren» Menschen, die über sie gekommen sind, bevor diese sie ausgerottet haben. Das Papier haben sie kennengelernt, auf dem so kleine Zeichen standen. Die haben sie für kleine Teufelchen gehalten und verabscheut, weil das aus dem Verstand entsteht. Der Mensch, der aus der Phantasie heraus tätig ist, der verabscheut das, was aus dem Verstand kommt.
Nicht wahr, der Europäer in seiner materialistischen Zivilisation, der weiß, wie eine Lokomotive entsteht. So wie der Europäer eine Lokomotive nach dem Verstand zusammensetzt, hätten die Griechen noch nicht eine Maschine zusammengesetzt, weil bei den Griechen noch nicht derVerstand da war. Der Verstand kam ja erst im 15., 16. Jahrhun-dert zu den Menschen. Die Griechen hätten es noch aus der Phantasie heraus zusammengesetzt. Da die Griechen nun alles das, was in der Natur sich bildet, den guten Geistern zugeschrieben haben, und alles dasjenige, was nicht Natur ist, was bloß Kunstprodukt ist, den bösen Geistern zuschrieben, so hätten die Griechen gesagt: In der Lokomotive lebt eben ein böser Geist. - Ja, sie hätten es aus der Phantasie heraus erbaut, wären nicht auf etwas anderes gekommen, als daß der Geist eben geholfen hat beim Zusammenbringen.
Aber sehen Sie, meine Herren, so ist es, daß wir dazu kommen, dem ursprünglichen, primitiven Menschen wirklich auch mehr Geist zuzuschreiben, denn die Phantasie ist eben etwas Geistigeres in der Seele des Menschen als der bloße Verstand, den der heutige Mensch so schätzt.
Nun können aber niemals alte Zustände wiederum heraufkommen. Daher muß das so sein, daß wir allerdings fortschreiten, aber daß wir doch nicht denken, daß dasjenige, was bloß Instinkt in dem heutigen Tiere ist, sich zum Geistigen hin hätte entwickeln können. Wir dürfen uns also nicht die primitiven Menschen so vorstellen, daß sie bloßen Instinkt gehabt hätten. Sie wußten, der Geist ist es, der in ihnen wirkt. Und deshalb hatten sie auch diesen Glauben an den Geist.
Das ist ein kleiner Beitrag, wie die Kulturentwickelung in der Menschheit stattfand. So daß wir sagen müßten: Ja, diejenigen haben recht, die sich heute vorstellen, der Mensch ist aus tierischen Gestalten entstanden. - Er ist es ja auch, aber nicht aus solchen tierischen Gestalten,
wie die heutigen es sind, denn die sind später entstanden, als der Mensch schon dagewesen ist. Aber diese tierischen Gestalten, die allmählich immer mehr und mehr zu der heutigen geworden sind in der menschlichen Entwickelung, und diese Fähigkeiten, die dazumal waren, die sind dadurch gekommen, daß allerdings das Geistige zwar nicht verstandesmäßig, aber phantasiemäßig ursprünglich vollkommener war, als es heute ist. Aber dabei müssen wir immer denken: Diese ursprüngliche Vollkommenheit war eben durchaus verbunden damit, daß der Mensch wie besessen war von dem Geiste, nicht frei war. Nur durch den Verstand kann der Mensch frei werden; durch den Intellekt kann er frei werden.
Denken Sie nur einmal über das eine nach: Derjenige, der mit seinem Verstand wirkt, der kann sagen: Nun ja, zu einer bestimmten Zeit werde ich das und das denken. - Das kann ein Dichter, der mit der Phantasie heute noch wirkt, nicht. Sehen Sie, Goethe war ein großer Dichter. Wenn er sich einmal hingesetzt hat, um ein Gedicht zu machen, weil irgend jemand es verlangt hat von ihm, oder weil er selbst gerade Lust gehabt hat, zu dieser Zeit ein Gedicht zu machen, so ist es ein spottschlechtes geworden. Daß das die Leute heute nicht wissen, das kommt bloß davon her, weil die Leute heute nicht mehr gute Gedichte von schlechten unterscheiden können. Aber in Goethes Gedichten stehen ja viele spottschlechte Gedichte. Das heißt, in der Phantasie wirken kann man eben nur, wenn es über einen kommt, und man soll, wenn es über einen kommt, eben das Gedicht niederschreiben. Und sehen Sie, so ist das bei den ursprünglichen Menschen gewesen: Die haben überhaupt nicht können vom freien Willen aus das eine oder andere tun. Dieser freie Wille, der ist das, was sich erst entwickelt hat - aber nicht die Weisheit. Die Weisheit war ursprünglich größer als der freie Wille und muß wiederum groß werden. Das heißt, wir müssen wiederum auch durch den Verstand zum Geist kommen.
Und das, sehen Sie, ist die Aufgabe der Anthroposophie; die will nicht, was heute viele Menschen wollen, primitive Zustände wieder heraufbringen, alte indische Weisheit etwa wiederum unter die Menschen bringen. Das ist ja nur ein Unsinn, wenn man uns das nachsagt, sondern die Anthroposophie legt Wert darauf, zum Geist zu kommen,
aber mit dem vollen Verstand, gerade mit dem vollen Verstand! Und das ist wichtig, das müssen Sie festhalten: Es fällt uns gar nicht ein, irgendwie etwas gegen den Verstand zu wollen, sondern es handelt sich darum, mit dem Verstand vorwärtszukommen. Erst waren die Menschen ohne Verstand mit dem Geist da; dann ist der Geist allmählich heruntergekommen, der Verstand ist groß geworden. Jetzt muß man aus dem Verstand heraus wiederum zum Geist kommen. Den Gang muß die Kultur nehmen. Wenn die Kultur diesen Gang nicht nehmen will - ja, meine Herren, man hat immer gesagt: Der Weltkrieg, so etwas ist überhaupt noch niemals dagewesen. - Es ist auch so: So haben sich die Menschen nie zerfleischt. Aber wenn die Menschen nicht diesen Gang machen, gehen wollen, daß sie den Verstand wiederum zum Geist kriegen, dann werden noch größere Kriege kommen. Immer wildere und wildere Kriege werden dann kommen, und die Menschen werden tatsächlich sich gegenseitig ausrotten, wie die zwei Ratten, die man in ein Rattenhaus gesperrt hat, die sich soweit aufgefressen haben, daß zuletzt nichts mehr da war als die zwei Schwänze. Das ist etwas stark ausgesprochen, aber eigentlich arbeitet die Menschheit darauf hin, daß schließlich gar nichts mehr von der Menschheit da ist. Das ist aber sehr wichtig zu wissen, wie eigentlich der Gang der Menschheit ist!
ERDENLEBEN UND STERNENWIRKEN
NEUNTER VORTRAG Dornach, 9. August 1924
Vielleicht hat noch jemand eine Frage auf dem Herzen? Wir werden ja jetzt einige Zeit nicht zusammenkommen können; aber vielleicht hat noch jemand eine Frage?
Herr Erbsmehl: Ich habe eine ganz verworrene Frage. Ich weiß nicht, wie ich sie formulieren soll. Wenn man Pflanzen sieht, so bemerkt man, daß sie verschiedene Gerüche haben; auch die Menschenrassen haben verschiedene Gerüche. Herr Doktor hat zu uns doch schon gesprochen von der Entwickelung der Menschen vom Urzustande an. Da muß gewirkt haben, daß eine jede Art von Wesen sich dasjenige genommen hat, was ihr gut getan hat. Es haben ja zum Beispiel auch die verschiedenen Rassen verschiedene Gerüche. Da muß doch ein geistiger Zusammenhang sein: Wie die Pflanzen die Gerüche aus der Erde genommen haben, so haben auch die Menschen der verschiedenen Rassen die verschiedenen Gerüche angenommen. Wie hängt das mit der Entwickelung von Urzuständen her zusammen?
Dr. Steiner: Sehen Sie, wir wollen einmal die Frage so stellen, daß sie auf das kommt, worauf Sie vielleicht hinaus wollen. Sie haben zu-nächst also ins Auge gefaßt die verschiedenen Naturprodukte: Pflanzen, Tiere und auch den Menschen, nicht wahr? Es ist das ja auch bei den Mineralien der Fall, daß sie in verschiedener Weise riechen. Der Geruch ist nur eine Sinneswahrnehmung. Es gibt die verschiedensten Sinneswahrnehmungen. Und so kann man sagen: Sie möchten gerne wissen, wie das mit der ganzen Entstehung der Naturwesen zusammenhängt, daß verschiedene Naturwesen in der verschiedensten Weise riechen.
Nun, schauen wir uns zunächst einmal das an, was eigentlich über-haupt den Geruch möglich macht. Was ist eigentlich der Geruch? Da müssen Sie sich zunächst klar sein darüber, daß ja der Mensch, indem er den Geruch wahrnimmt, sei es an einer Sache, sei es an anderen Naturprodukten, eigentlich in einer verschiedenen Lage ist. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, daß zum Beispiel derjenige, der Wein trinkt, sich in einer Umgebung, wo Wein getrunken wird, an dem Geruch wenig stößt; dagegen derjenige, der nicht selber Wein trinkt,
empfindet es gleich unangenehm, wenn er in einer Lokalität ist, wo Wein getrunken wird, oder wo sich überhaupt nur Wein befindet. Ebenso ist es mit anderen Dingen. Da müssen wir zum Beispiel ins Auge fassen, daß es Menschen gibt, insbesondere Frauen, die sind nicht imstande, sich auch nur, ohne Kopfschmerzen zu bekommen, kurze Zeit in einem Zimmer aufzuhalten, in dem ein Hund ist. Also die verschiedenen Wesen sind in verschiedener Weise für Gerüche empfindlich. Das macht es überhaupt schwer, in solchen Dingen von vorneherein gleich das Richtige zu treffen.
Das ist aber nicht nur beim Geruch der Fall. Das ist auch bei anderen Sinnesempfindungen der Fall. Denken Sie nur einmal daran:
Sie strecken Ihre Hand einfach, so wie Sie sind, sagen wir, in ein Wasser von siebenundzwanzig Grad. Dieses Wasser wird Ihnen so vorkommen, daß Sie nicht eine besondere Kälte empfinden. Dagegen, wenn Sie vorher Ihre Hand längere Zeit gewöhnt haben, unterzutauchen in ein Wasser von dreißig Grad, und Sie greifen dann hinein in ein Wasser von siebenundzwanzig Grad, dann kommt Ihnen das Wasser von siebenundzwanzig Grad kälter vor wie früher. - Das läßt sich leicht weiter denken. Denken Sie sich eine rote Fläche. Da kann Ihnen diese rote Fläche sehr rot vorkommen, wenn diese rote Fläche auf einem weißen Untergrund ist. Wenn Sie aber den Untergrund jetzt blau anstreichen, wird Ihnen die rote Fläche nicht mehr so rot vorkommen. So hängt alles in vieler Beziehung davon ab, wie sich der Mensch selber zu diesen Dingen verhält. Das hat gerade dazu geführt, daß man gemeint hat, der Mensch nehme die Dinge überhaupt nicht wahr, sondern nur, wie sie auf ihn wirken. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Wir können also sagen: Wir müssen erst durchdringen zu dem, was eigentlich hinter einer solchen Sache ist. Dennoch kann man ganz genau dem Geruche nach unterscheiden das Veilchen und den Teufelsdreck oder Stinkasant. Das eine, das Veilchen, hat einen Geruch, der uns durchaus sympathisch ist; der andere hat einen Geruch, der nicht sympathisch ist, den wir wegbringen wollen von uns. Und es ist schon richtig, daß in dieser Weise verschiedene Rassen für den einen und den anderen verschiedene Rassengerüche haben. So kann derjenige, der, ich möchte sagen, eine feine Nase hat, einen Japaner
sehr gut dem Geruche nach von einem Europäer unterscheiden. Das ist das eine.
Nun muß uns klar sein, worauf der Geruch beruht. Da kommt es darauf an, daß von dem Körper, der riecht, immer etwas ausgeht, was an unseren Körper in gasförmiger, in luftförmiger Gestalt herankommen kann. Wenn von einem Körper nichts ausgeht, was in gasförmiger, in luftförmiger Gestalt herankommen kann an uns, dann können wir den Körper nicht riechen. Es müssen also immer von dem Körper luftartige Stoffe, gasartige Stoffe ausgehen, damit wir den Körper riechen können. Und diese gasförmigen Stoffe müssen mit unserem Riechorgan, mit der Nase, innerlich in Berührung kommen. Eine Flüssigkeit als solche können wir nicht riechen, können wir nur schmecken. Erst wenn die Flüssigkeit Luft ausströmt, also Gasförmiges ausströmt, können wir sie riechen. Wir riechen unsere Speisen nicht aus dem Grunde, weil sie flüssig sind, sondern aus dem Grunde, weil sie Luft ausströmen, die dann durch unsere Nase in unser Inneres kommt. Nun sehen Sie, es gibt Menschen, die können überhaupt nicht riechen; für die ist also die ganze Welt geruchlos. Erst neulich ist mir ein Mensch entgegengekommen, der außerordentlich leidet daran, daß er nicht riechen kann, denn er hat einen Beruf, wo man riechen müßte und die Gegenstände geradezu nach ihrem Geruche unterscheiden müßte. Es stört ihn in seinem Berufe, daß er nicht riechen kann. Das hängt natürlich davon ab, daß die entsprechenden Riechnerven nicht ordentlich ausgebildet sind.
Nun müssen wir, um an die Frage heranzukommen, uns fragen:
Woher kommt es, daß Körper Gas ausströmen, das man in einer gewissen Weise riechen kann? - Nun, sehen Sie, wenn wir an einen Körper herangehen, so finden wir immer, daß wir die Körper einteilen können in feste Körper, was man in früheren Zeiten erdige Körper genannt hat, und in flüssige Körper, was man in früheren Zeiten wässerige Körper genannt hat. Als Wasser bezeichnete man auch das, was man jetzt nicht mehr als Wasser benennt. In früheren Zeiten hat man alles, was fließt, als Wasser bezeichnet, also auch Quecksilber. Dann sind da noch die luftförmigen oder gasförmigen Körper. Wenn man diese drei Arten von Körpern nimmt - die festen, die flüssigen, die gasförmigen Körper -, so fällt vor allen Dingen eines auf. Wasser ist
gewiß flüssig, aber es gefriert zu Eis; dann ist es ein fester Körper. Irgendein Metall, zum Beispiel Blei, ist fest; wenn Sie es richtig erwärmen, wird es flüssig, wird es so wie Wasser. Es können also diese verschiedenen Stoffe - die festen, flüssigen, gasförmigen -, ineinander übergeführt werden. Man kann heute schon Luft zu einem festen Körper machen, oder wenigstens zu einer Flüssigkeit machen. Und man kann hoffen, daß man es immer weiter und weiter darin bringt. Jeder Körper kann fest, flüssig, gasförmig sein.
Nehmen wir jetzt einen Körper, der riecht, dann ist das ein Körper, der gewissermaßen in sich Gas eingesperrt enthält. Wenn wir einen festen Körper haben für sich, den riechen wir nicht. Wenn wir einen flüssigen Körper für sich haben, den riechen wir auch nicht. Ein Gas können wir riechen, immer riechen. Aber das Veilchen ist ja kein Gaskörper, und dennoch riechen wir es. Wie ist es mit einem Körper bestellt, der scheinbar fest ist, wie das Veilchen, und den wir dennoch riechen? Den müssen wir uns so vorstellen, meine Herren, daß er nicht so ist wie dieses (es wird gezeichnet), sondern daß er solche feste Bestandteile enthält, und daß dazwischen dasjenige ist, was als Gas verdunstet. So daß wir also uns sagen: Das Veilchen enthält Gas, das verdunsten kann. - Dazu ist notwendig, daß das Veilchen eine Anziehung zu gewissen Kräften hat. Wenn Sie also das Veilchen abpflükken, dann ist es so, daß Sie eigentlich nur das Feste vom Veilchen abpflücken. Also Sie pflücken das Feste vom Veilchen ab und schauen dieses Feste an. Nun, in Wirklichkeit besteht das Veilchen nicht bloß in dem, was Sie als Festes abpflücken. Das Wesen des Veilchens, das, was es eigentlich ist, das steckt in diesem Festen drin, und man kann auch sagen: Das wirkliche Veilchen, dasjenige, was duftet, das ist eigentlich ein Gas. Das ist so, daß es drinsteckt im Blatt und so weiter, geradeso wie Sie in Ihren Schuhen oder Stiefeln stecken. Und wie Sie nicht Ihre Stiefel sind, so ist auch dasjenige, was in dem Veilchen duftet, nicht im Festen drin, sondern im Gasförmigen.
Nun aber, meine Herren, wenn Sie in die Welt hinausschauen: Da glauben die Leute, wenn man so in die Welt hinausschaut, da ist es ja leer, und in dem leeren Raume leben die Sterne drinnen und so weiter. -Früher haben die Bauern geglaubt, daß da, wo sie herumgehen, es auch
leer sei. Heute weiß jeder, daß da Luft ist, daß es da nicht leer ist. Ebenso kann man wissen, daß es im Weltenraum draußen nirgends leer ist; entweder ist Materie da, oder es ist Geist da. Sehen Sie, daß es im Weltenraum nirgends leer ist, kann man geradezu beweisen. Das ist interessant, das einmal zu überlegen, daß es nicht leer ist. Ich will das an einem bestimmten Zeichen beweisen, daß es nirgends leer ist. Wir wollen einmal absehen davon, daß sich die Erde um die Sonne dreht, was Kopernikus den Menschen gelehrt hat. Wir wollen die Sache so nehmen, wie sie sich anschaut. Da haben wir hier die Erde, und da geht die Sonne um die Erde herum, geht im Osten auf und im Westen unter. Da ist immer irgendwo die Sonne (es wird gezeichnet). Nun ist da etwas Eigentümliches. In gewissen Gegenden, eigentlich überall, wenn man genau zuschaut, ist nämlich, wenn die Sonne aufgeht und untergeht, aber auch sonst, nicht bloß die Dämmerung da, sondern es ist etwas da, was die Welt immer in Erstaunen versetzt. Es ist etwas da um die Sonne herum, was eine Art von Strahlenlicht bildet. Immer wenn die Sonne angeschaut wird, namentlich aber gegen Morgen und Abend, ist außer der Dämmerung noch dieses erstrahlende Licht da. Es erstrahlt um die Sonne herum ein Licht. Man nennt es das Zodiakallicht. Dieses Zodiakallicht, meine Herren, das macht den Menschen viel Kopfzerbrechen, namentlich denjenigen, die materialistisch denken. Sie denken sich: Die Sonne im leeren Raume kann also leuchten, und wenn sie leuchtet, so sehen wir, daß sie die anderen Körper beleuchtet. Aber woher kommt dieses Licht, das da immer um die Sonne herum ist, dieses Zodiakallicht? - Unglaublich viele Theorien haben die Leute darüber aufgestellt, woher dieses Zodiakallicht kommt. Wenn die Sonne im leeren Raume herumfliegen soll, oder auch nur steht nach der kopernikanischen Lehre, kann doch dort nicht ein Licht sein! Woher kommt dieses Licht? - Es ist furchtbar einfach, zu finden, woher dieses Licht kommt. Sie werden ganz gewiß schon an einem sehr reinen Abend durch die Stadt gegangen sein und da Laternen gesehen haben. Diese Laternen haben feste Grenzen. An einem luftreinen Abend sieht man die Lichter ganz fest begrenzt. Aber gehen Sie jetzt an einem nebligen Abend, dann sehen Sie nicht so feste Grenzen, dann sehen Sie überall eine Art Lichtring herum. Woher kommt der? Weil Nebel da
ist. Im Nebel drin bildet sich dieser Schein von einem Lichtring. Die Sonne geht mit einem Lichtring zu gewissen Zeiten über den Himmel hin, weil der Himmelsraum nicht leer ist, sondern weil er mit einem feinen Nebel überall ausgefüllt ist. Das Zodiakallicht, das ist, was in diesem feinen Nebel als ein Schein vorhanden ist. An alles mögliche haben die Leute da gedacht. Zum Beispiel, daß da allerlei Kometen durchfliegen. Gewiß tun sie das auch. Aber dieses Zodiakallicht, das mit der Sonne geht, das zu gewissen Zeiten stärker ist, manchmal schwach, manchmal gar nicht da ist, das ist, weil die Nebel im Weltenraum sich mehr oder weniger verdichten oder verdünnen. So daß wir sagen können: Eigentlich ist der ganze Weltenraum mit etwas angefüllt. - Aber ich habe Ihnen auch schon gesagt, es ist nicht so, daß man nun glauben kann, daß überall Stoff, Materie ist. Ich habe Ihnen gesagt, die Physiker, die materialistischen Physiker würden sehr erstaunt sein, wenn sie da hinaufkämen und erwarteten, daß die Sonne so ausschaut, wie sie sie heute in der Physik beschreiben. Das ist Unsinn. Wenn die Physiker da hinauffahren könnten, mit irgendeinem günstigen Zug, in die Sonne, die würden erstaunt sein, daß sie dort nichts finden würden, was so wäre wie ein Gas. Einen Hohlraum fänden sie, einen richtigen Hohlraum. Der scheint Licht. Und dasjenige, was sie finden würden, wäre gerade das Geistige. So daß wir nicht sagen können: Überall ist nur Stoff -, sondern wir müssen sagen: Überall ist auch Geistiges, richtiges Geistiges.
Nun, meine Herren, so wirkt nicht bloß der Stoff aus dem Welten-raum auf alles, was auf Erden ist; auch das habe ich schon ausgeführt, es wirkt das Geistige auf alles. Nun, schauen wir uns einmal an, wie im Menschen das Geistige mit dem Physischen zusammenhängt.
Meine Herren, es gibt ja ein naheliegendes Wesen, das noch besser riechen kann als Sie oder ich; das ist der Hund. Die Hunde haben einen viel feineren Geruch als der Mensch. Sie wissen, daß man diesen Geruch heute ausnützt. Es gibt Polizeihunde, die durch ihren Geruch die Menschen, die irgendwie Verbrecher sind, die davongelaufen sind, ausfindig machen. Man läßt den Hund riechen an einer Stelle, wo ein Verbrechen begangen wurde, er geht der Spur nach, er verfolgt die Spur und führt an den Ort, wo der Verbrecher angekommen ist. Der
Hund hat in der Nase sehr feine Geruchsnerven. Das ist sehr interessant, diese feine Geruchsempfindung des Hundes zu studieren. Aber es ist auch sehr interessant, zu studieren, wie die Geruchsnerven des Hundes mit dem übrigen zusammenhängen. Hinter der Nase, im Gehirn, hat der Hund ein sehr interessantes Riechorgan. Die Nase ist nur ein Teil des Riechorganes. Hinter der Nase, im Gehirn, hat der Hund die Hauptmasse seines Riechorganes. Nun können wir vergleichen die Riechorgane des Hundes mit denen des Menschen.
Beim Hunde ist ein deutliches Riechorgan vorhanden, ein Gehirn, das im Grunde zum Riechorgan werden kann. Beim Menschen ist der größte Teil dieses Riechgehirns umgewandelt zum Verstandesgehirn. Was wir hinter der Nase haben, ist ein umgewandeltes Riechorgan. Wir verstehen die Dinge; der Hund versteht sie nicht, er riecht sie. Wir verstehen sie, weil an der Stelle, wo der Hund noch ein richtiges Riechorgan hat, wir ein umgewandeltes Riechorgan haben. Unser Verstandesorgan ist ein umgewandeltes Riechorgan. Wir haben nur einen kleinen Rest als riechendes Gehirn; daher riechen wir schlechter als der Hund. So können Sie voraussetzen: Wenn der Hund durch die Felder geht - das ist furchtbar interessant für den Hund; der riecht so vielerei, daß, wenn er das alles beschreiben könnte, würde er die Welt als Geruch beschreiben. Wenn es einen Schopenhauer unter den Hunden gäbe - der Denkweise nach -, der könnte interessante Bücher schreiben. Schopenhauer hat ja ein Buch geschrieben «Die Welt als Wille und Vorstellung», weil er ein Mensch war und sein Riechorgan zum Vorstellungsorgan geworden war. Der Hund würde ein interessantes Buch schreiben: «Die Welt als Wille und Geruch.» Da würde so vieles drinnenstehen, was der Mensch nicht wissen kann, weil der Mensch das Ding sich vorstellt, und der Hund riecht es. Ich glaube sogar, daß das Buch, das der Hund schriebe, viel interessanter sein würde, wenn der Hund ein Schopenhauer wäre, als das Buch, das Schopenhauer geschrieben hat, «Die Welt als Wille und Vorstellung»!
Sie sehen also, wie es sich ergibt, daß wir in einer riechbaren Welt stehen, und wie andere Wesen, zum Beispiel der Hund, diese Welt in einem viel höheren Sinne als riechbar wahrnehmen.
Da müssen wir nun sagen: Wenn es noch feinere Riechorgane gäbe,
ließe sich, weil die Welt überall angefüllt ist mit Gasigem - was wir am Zodiakallicht sehen -, die ganze Welt in verschiedenster Weise riechen. Denken Sie sich, da würde ein Wesen da sein, das schnüffelte zur Sonne hinauf. Das beschreibt nicht die Schönheit, wie man die Sonne sieht, sondern sein Schnüffeln lehrt es, wie die Sonne riecht. Ein anderes Wesen beschreibt die Mondnacht nicht wie die Dichter:
In der mondbeglänzten Zaubernacht ging das Liebespaar -, in phantasievoller Handlung, sondern ein solches Wesen schriebe: In der mond-riechenden Zaubernacht ging das Liebespaar und lebte in einer Welt von Wohlgerüchen -, oder vielleicht, weil es der Mond ist, gar nicht so starker Wohlgerüche. Dann könnte wiederum ein solches Wesen zum Abendstern hinaufschnüffeln und würde da im Abendstern anderes riechen als in der Sonne. Dann würde es zum Merkur, zur Venus, zum Saturn hinaufschnüffeln; es könnte nicht ein Lichtbild von diesen Sternen bekommen, nicht eine Vorstellung, wie sie das Auge vermittelt, aber es bekäme Sonnengeruch, Mondgeruch, Saturngeruch, Marsgeruch, Venusgeruch. Wenn es solche Wesen gäbe, die richteten sich nach dem, was der Geist hineinschreibt in den Geruch des Weltengases; was der Geist von Venus, Merkur, Sonne, Mond hineinschreibt in das Weltendasein. Diese Wesen richteten sich danach.
Aber weiter, meine Herren: Betrachten wir, wie die Geschichte ist bei den Fischen, sagen wir, die gar nicht riechen. Wir können ganz genau wahrnehmen, wie Fische Farben sich hinneigen, je nachdem sie von der Sonne beschienen werden. Sie geben mit ihrer eigenen Färbung dasjenige Licht wieder, was ihnen von der Sonne zukommt. So daß man sagen kann: Ein Wesen, das so fein riechen würde, würde nicht bloß riechen, sondern es würde sich danach bilden, wie es die Welt riecht.
Sehen Sie, es gibt solche Wesen. Es gibt Wesen, die einfach die Welt riechen können: das sind die Pflanzen. Die Pflanzen riechen den Weltenraum und richten sich danach ein. Was tut das Veilchen? Sehen Sie, es ist eben ganz Nase und eine ungeheuer feine Nase. Und das Veilchen nimmt sehr schön wahr gerade dasjenige, was zum Beispiel ausströmt vom Merkur, und danach bildet es sich seinen Geruchskörper' während der Stinkasant, Teufelsdreck' sehr fein wahrnimmt dasjenige,
was vom Saturn ausströmt: er gestaltet sich danach seinen Gaskörper und stinkt. Und so nimmt ein jedes Wesen in der Pflanzenwelt, wenn es zum Riechen kommt, dasjenige wahr, was aus der Planetenwelt herein zu riechen ist.
Nun diejenigen Pflanzen, die nicht riechen: Warum riechen sie nicht? Sehen Sie, etwas riechen für feine Nasen alle Pflanzen. Mindestens haben sie dasjenige, was man einen erfrischenden Geruch nennen kann. Aber dasjenige, was sie als einen solchen erfrischenden Geruch haben, das wirkt sehr stark auf sie. Das ist gerade das, was von der Sonne kommt. Währenddem eine große Anzahl von Pflanzen nur zugänglich sind für den Sonnengeruch, sind einzelne Pflanzen, wie Veilchen, Stinkasant, zugänglich für Planeteneinflüsse. Die sind die eigentlich wohl- oder übelriechenden Pflanzen. Und man kann, wenn man zum Beispiel ein Veilchen riecht, ganz gut sagen: Oh, dieses Veilchen hat eine feine Nase. Es ist ganz Nase; es nimmt den Weltengeruch des Merkur auf. - Es hält ihn fest, so wie ich das angedeutet habe, daß er zwischen den festen Bestandteilen festgehalten wird, und strömt ihn aus. Dann ist er so dicht, daß wir ihn riechen können. Wenn uns also der Merkur aus dem Veilchen entgegenkommt, riechen wir es. Wenn wir mit unserer ungeheuer groben Nase zum Saturn hinaufschnüffeln, merken wir nichts. Wenn aber der Stinkasant, der eine feine Nase für den Saturn hat, zum Saturn hinaufschnüffelt, riecht er das, was vom Saturn kommt und richtet danach seinen Gasgehalt ein; dann stinkt er. Wenn wir durch eine Allee gehen, wo Roßkastanien sind - Sie kennen diesen Geruch von Roßkastanien oder von Linden-blüten? Das ist ein Geruch, den die Roßkastanien und die Linden deshalb haben, weil sie in ihren Blüten feine Nasen haben für alles, was von der Venus strömt ins Weltendasein. Und so duftet uns aus den Pflanzen in Wirklichkeit der Himmel entgegen.
Nun gehen wir von den Pflanzen zu dem, was Herr Erbsmehl zunächst in seiner Frage angeschlagen hat: zu den Rassen. Die Rassen lebten ursprünglich an verschiedenen Stellen der Erde. Auf der einen Stelle der Erde bildete sich diese, auf der anderen Stelle der Erde eine andere Rasse. Woher kommt das? Wir könnten ganz gut reden davon, wie auf einzelne Teile der Erde besonders starken Einfluß hat der eine
Planet, auf einen anderen Teil der andere Planet. Gehen wir zum Beispiel nach Asien hinüber, dann finden wir, daß auf asiatischen Boden besonders stark wirkt alles, was von der Venus auf die Erde herunterströmt - Venus, der Abendstern. Gehen wir auf amerikanischen Boden, so finden wir, daß alles dasjenige besonders stark wirkt auf den amerikanischen Boden, was herunterströmt aus dem Saturn. Und so finden wir eigentlich zum Beispiel auf Afrika alles dasjenige wirken, was vom Mars herunterströmt. So finden wir, daß auf jedes Stück der Erde eigentlich ein anderer Planet besonders stark wirkt. Das hängt damit zusammen, daß die Planeten verschiedene Stellungen haben am Himmel, je nachdem das Licht auffällt. Es fällt zum Beispiel das Licht von der Venus ganz anders auf als vom Merkur. Das hängt mit den Gebirgsformationen, mit der Steinformation zusammen. So hängen die verschiedenen Rassen auf verschiedenen Teilen der Erde davon ab, daß der eine Teil der Erde besonders stark aufnimmt die Venuseinflüsse, andere Teile die Saturneinflüsse. Danach richtet sich die Pflanzenheit im Menschen.
Der Mensch hat die ganze Natur in sich. Er hat die Steine in sich, er hat die Pflanzen in sich, er hat das Tierische in sich und hat extra das Menschliche in sich. Aber das Pflanzliche im Menschen richtet sich ebenso nach den Planetengerüchen wie das Pflanzliche selber. Bei denjenigen Mineralien, welche noch viel Pflanzliches in sich haben, gibt es auch einen Geruch. Also es hängt, ob etwas riecht oder nicht, davon ab, daß es die Weltengerüche wahrnimmt.
Das ist sehr wichtig, daß Sie solche Sachen auch auffassen. Denn man redet heute davon, daß die Pflanzen geradeso wahrnehmen können, daß sie eine Seele haben wie der Mensch. Das ist natürlich ein Unsinn. Ich habe schon einmal davon gesprochen. Es gibt Pflanzen, von denen man glaubt, daß sie Empfindung haben, wie zum Beispiel die Venusfliegenfalle. Wenn ein Insekt in den Bereich der Venusfliegenfalle kommt, schließt sich die Falle, und das Insekt ist gefangen. Ebenso könnte man von einer Mausefalle sagen, sie habe eine Seele, denn wenn die Maus in den Bereich der Mausefalle kommt, schließt sich die Mausefalle und die Maus ist eingeschlossen. Solche Äußerlichkeiten darf man nicht zur Erkenntnis gebrauchen; man muß eindringen
in das Wesen der Sache. Dann kann man sagen - wenn man zu gleicher Zeit weiß, wie die Pflanzengerüche dasjenige wiedergeben, was in der Welt draußen ist: Die Pflanzen sind eigentlich feine Geruchsorgane der Erde. - Und die menschliche Nase, meine Herren, die ist im Grunde genommen eine grobe Pflanze. Sie wächst auch so wie eine Blüte aus dem Menschen heraus, aber sie ist gröber geworden -eine grobe Blüte, die aus dem Menschen herauswächst. Sie nimmt nicht mehr so fein wahr, wie wahrgenommen wird von der Pflanze im Weltenraum. Das sind schon die Bilder; die sind sehr wirklich. So ist es eben.
So können wir sagen: Wir finden eigentlich, wenn wir in der Pflanzenwelt dahingehen, die Erde überall bedeckt mit lauter Nasen; das sind die Pflanzen. Unserer merkwürdigen Nase sehen wir gar nicht mehr an, daß sie eigentlich von der Pflanze abstammt. Und manche Pflanzenblüten schauen wirklich so aus wie eine Menschennase. Schauen Sie so eine Pflanze an, die so ausschaut wie eine Menschennase. Es gibt solche Pflanzen: Man sagt, sie seien Rachenblütler, Lippenblütler, aber sie schauen so aus wie eine Nase. Sie finden sie überall am Wege wachsen.
Auf diese Weise kommt man hinein in die wirkliche Erkenntnis der Welt. Und dann, wenn man in dieser Weise die Sache verfolgt, dann erst findet man, wie sich der Mensch eigentlich verhält zu der ganzen übrigen Welt. Sehen Sie, man kann sagen: Dieser arme Mensch, nun hat er seine Nase zum Riechen, aber er riecht nicht mehr ordentlich; sie ist zu grob geworden. Sehen Sie, die Blüten der Pflanzen, die können die ganze Welt riechen. Die Blätter der Pflanzen lassen sich vergleichen mit der menschlichen Zunge. Sie können die Welt schmecken. Die Wurzel der Pflanzen, die läßt sich vergleichen mit demjenigen, was da guckt, schaut: Es ist ein Auge, aber ein schlechtes Auge. - Da steht der arme Mensch. Er hat alles in sich, was draußen die Wesen der Natur haben, aber es ist schwach und matt geworden.
Aber, meine Herren, wir begegnen auch ganz merkwürdigen Menschen. Wenn wir so gut riechen würden, wie durch die Pflanzen gerochen wird, wenn Sie so gut schmecken würden, wie durch die Pflanzenblätter geschmeckt wird - wir würden uns nicht auskennen; denn
von allen Seiten duftete und schmeckte es! Wir brauchten nicht irgend etwas zu essen, um Geschmack zu empfinden; von allen Seiten her würde uns der Geschmack zulaufen. Das ist beim Menschen nicht der Fall; er hat alles dies nicht mehr. Dafür hat er aber seinen Verstand. Nehmen Sie ein Tier, das ein besonders starkes Riechgehirn ausgebildet hat hinter der Nase (es wird gezeichnet). Beim Menschen ist dieses Riechgehirn verkümmert. Seine Nase ist grob geworden. Da ist nur ein kleines Stückchen. Dafür hat er aber sein Verstandesgehirn. Ebenso aber, meine Herren, ist es auch mit dem Geschmacksorgan des Menschen. Es gibt Tiere - die meisten Tiere sogar haben ein mächtig entwickeltes Geschmacksgehirn' können furchtbar gut ein Nahrungsmittel von dem anderen unterscheiden. Wissen Sie, so wie die Tiere genießen, davon haben wir gar keinen Begriff. Wir würden turmhoch springen, wenn uns all die Dinge, die wir essen, so geschmackvoll wären, wie den Tieren die Sachen geschmackvoll sind. Von der Art und Weise, wie der Hund vom Zucker beglückt ist, hat unser bißchen Zukkergeschmack gar keine Ahnung. Es kommt dies daher, daß bei den meisten Tieren ein mächtiges Geschmacksgehirn vorhanden ist. Beim Menschen ist auch davon nur ein kleiner Rest vorhanden. Dafür aber hat er wieder die Fähigkeit, Ideen zu bilden, mit dem umgewandelten Geschmacksgehirn Ideen zu bilden. Und auf diese Weise, sehen Sie, wird der Mensch das edelste Wesen auf der Erde, daß bei ihm von den Sinnesempfindungen im Gehirn immer nur ein Stückchen vorhanden ist; das andere ist umgewandelt zum Denken, zum Fühlen. Dadurch wird der Mensch das höchste Wesen. So können wir sagen: Da ist im menschlichen Gehirn mächtig umgewandelt Schmecken und Riechen, und nur Stückchen sind vorhanden vom Geschmacksgehirn und Geruchsgehirn. Beim Tier ist das nicht vorhanden, dagegen ist das mächtig ausgebildet (es wird auf die Zeichnung verwiesen). Das kann man schon an den äußeren Formen erkennen. Wenn der Mensch ein so mächtig ausgebildetes Geruchsgehirn hätte wie der Hund, dann hätte er keine Stirn. Die Stirn ginge zurück, weil das Geruchsgehirn nach hinten sich ausbilden würde. Aber indem es sich umwandelt, stülpt sich die Stirn auf. Weil der Hund die Nase nach vorne streckt, geht das Gehirn nach hinten. Wer darauf sich einschult, kann schon sagen,
welche Tierformen besonders gute Geruchsempfindungen haben. Er braucht nur darauf zu sehen, daß das Gehirn nach hinten geht und die Nase mächtig ausgebildet ist, dann weiß er, das Tier hat eine gute Geruchsempfindung.
Dann nehmen Sie die Pflanze. Deren Nase setzt sich bis zur Wurzel fort in die Erde hinunter. Da ist alles Nase. Nur kommt an die Nase, entgegen dem, wie es beim Menschen ist, der Geschmack heran, die Welt der Geschmäcke. Und dieses, sehen Sie, zeigt uns, daß der Mensch gerade dadurch vollkommen ist, daß er diese Dinge, die die Tiere und Pflanzen haben, unvollkommen hat, daß sie umgestaltet sind. So daß man sagen kann: Wodurch ist der Mensch vollkommener als die übrigen Naturwesen? Weil er dasjenige, was bei den anderen Wesen vollkommen ist, in Unvollkommenheit hat. - Das können Sie leicht einsehen. Schauen Sie sich einmal ein Hühnchen an. Es schlüpft aus dem Ei heraus - flugs kann es, was es überhaupt braucht. Es kann schon sein Futter suchen, kann schon scharren. Bedenken Sie, wie sich dagegen der Mensch anschickt! Das Tier kann alles. Warum? Weil seine äußeren Gehirnorgane noch nicht zu Denkorganen umgewandelt sind. Beim Menschen müssen erst, wenn er geboren ist, vom Gehirn aus diese stumpfen Reste von den Sinnesorganen erobert werden. Und deshalb muß das Kind lernen, während das Tier nicht zu lernen braucht, sondern alles von vorneherein kann. So ist es beim Menschen. Wir können alles ganz genau sehen: Menschen, die ganz einseitig nur ihr Gehirn ausgebildet haben, die können furchtbar fein denken, sind aber furchtbar ungeschickte Kerle. Beim Menschen kommt es darauf an, daß er nicht gar zu viel Gehirnmasse umgewandelt hat. Wenn er gar zu viel umgewandelt hat, kann er ein guter Dichter werden, aber er wird kein guter Mechaniker werden. Er wird in der äußeren Welt nicht geschickt sein. Heute, meine Herren, ist es so - das hängt zusammen mit dem, was ich neulich besprochen habe -, daß durch die reichliche Kartoffelnahrung bei vielen Menschen furchtbar viel umgewandelt wird von ihrem ganzen Gehirn. Daher werden die Menschen gescheit, aber ungeschickt. Heute sind die Menschen so ungeschickt: Das, was sie nicht lange gelernt haben, das können sie nicht - solche Dinge, die man doch eigentlich nur flüchtig lernt. Es gibt Menschen: wenn ihnen
ein Hosenknopf abreißt, können sie ihn nicht annähen. Sie können furchtbar gute Bücher schreiben, aber Hosenknöpfe können sie nicht annähen. Das rührt davon her, daß diejenigen Nerven, die Empfindungsnerven sind in den feineren Organen, fast ganz in Gehirnnerven umgewandelt sind.
Ich habe einmal einen kennengelernt, der hatte eine heillose Angst vor der Zukunft, weil er sagte: In alten Zeiten war der Mensch mehr feinsinnig, weil tatsächlich noch nicht so viel Gehirn umgewandelt war. Worin besteht die Entwickelung der Menschheit? Sie besteht darin, daß vieles, was früher den Sinnen angehört hat, was zur Feinsinnigkeit geführt hat, heute in das Gescheitheitsgehirn umgewandelt ist. -Dieser Mann hatte eine heillose Angst, daß das so weitergehen würde, daß immer mehr von dem Sinnengehirn in das Gedankengehirn umgewandelt werde, so daß die Leute zuletzt ganz ungeschickt werden, daß die Augen verkrüppeln und so weiter. In früheren Zeiten sind die Leute mit guten Augen durchs Leben gegangen; jetzt brauchen sie schon Brillen! Die Leute riechen nicht mehr so gut. Die Hände werden ungeschickt. Aber was ungeschickt wird, das verkümmert. Er hatte Angst, daß alles sich in Gehirn umwandle, und daß der Mensch, der erst so ist (es wird gezeichnet) - hier ist der Rumpf mit den Gliedern, oben trägt er den Kopf -, nun hat er gemeint: Nach und nach kommt es dahin, daß alles verkümmert; der Kopf wird immer größer und größer, die Beine werden immer kleiner. - Aber der Mensch hat das im völligen Ernst gemeint, er hat das furchtbar tragisch gefunden. Die Menschen werden sich zuletzt nur mehr wie Kopfkugeln durch die Welt rollen. Was soll da werden? - Aber es ist ein ganz richtiger Gedanke. Denn wenn der Mensch nicht wiederum zurückkommt zu dem, was einmal durch die Phantasie ergriffen worden ist, wenn der Mensch nicht wiederum zum Geiste kommt, dann wird er eine solche Kugel. Daher ist es so, daß tatsächlich die Beschäftigung mit der Geisteswissenschaft den Menschen nicht nur gescheit werden läßt - er wird nicht mehr gescheit als durch andere Theorien, wenn er sie nur als Theorie annimmt; er wird nicht gescheiter, er wird eher dümmer -, aber wenn er die Geisteswissenschaft richtig auffaßt, so wie sie aufgefaßt werden soll, dann geht das bis in die Finger! Die steif gewordenen Finger werden
wieder geschickter, weil wiederum die Außenwelt zu ihrer Geltung kommt. Sie vergeistigen sie nur, aber Sie werden dadurch nicht ungeschickter. Also auf solche Dinge muß man schon hinschauen. Man sieht geradezu: Als die Menschen Mythen, Sagen, Mythologien ausgebildet haben - worum ich neulich gefragt worden bin -, war noch nicht so viel von dem, was in den Sinnen ist, in Gehirn umgewandelt. Nun sehen Sie, da waren, wenn die Menschen eben träumten - die alten Leute haben mehr geträumt, weil noch nicht so viel in Gehirn umgewandelt war -, wenn sie träumten, da waren Bilder vor ihnen. Wir haben heute ganz leere Gedanken. Und wenn Sie die Erzählungen hören von Wotan, Loki' von den alten griechischen Göttern, von Zeus, Aphrodite und so weiter, so rühren diese Erzählungen auch davon her, daß der Mensch noch nicht so viel von der heute so geschätzten Gescheitheit hatte. Die Menschen werden gescheiter, ja, aber man lernt die Welt nicht dadurch kennen, daß man mit Gescheitheit lernt, sondern dadurch, daß man sie anschauen lernt. Das können Sie an einem Vergleich erkennen.
Denken Sie sich einen Erwachsenen, der hat ein Kind vor sich. Er kann sich bloß etwas einbilden auf seine Gescheitheit; dann findet er das Kind nur dumm. Wenn er aber einen Sinn hat für das, was im Kinde naturhaft herauskommt, dann schätzt er das für mehr als seine eigene Gescheitheit. So kann man dasjenige, was in der Natur da ist, nicht durch Gescheitheit fassen, sondern dadurch, daß man eingehen kann auf die Geheimnisse der Natur. Unsere Gescheitheit haben wir für uns selber, nicht zur Erkenntnis. Ein gescheiter Mensch braucht noch nicht besonders weise zu sein. Gescheite Menschen können nicht dumm sein, natürlich, aber sie können unweise sein, nichts wissen von der Welt. Gescheitheit kann man auf alles mögliche anwenden:
um Pflanzen einzuteilen, um Mineralien einzuteilen, um chemische Verbindungen zusammenzusetzen und zu bestimmen, man kann Domino und Schach spielen, kann an der Börse spielen. Dieselbe Gescheitheit ist es, die die Leute betrügt an der Börse, wie die Gescheitheit, die die Menschen haben, wenn sie Chemie studieren. Es kommt nur darauf an, daß man anderes wahrnimmt, wenn man Chemie treibt, anderes, wenn man an der Börse spielt. Die Gescheitheit ist in beiden
da. Auf dasjenige, was man anschaut, kommt es an. Es darf nicht zu viel in Gehirn umgewandelt werden. Wenn man zum Beispiel einen großen Börsenspekulanten sezieren würde, würde man ein ausgezeichnetes, ein ganz glänzendes Gehirn finden. In dieser Richtung ist manches gelöst worden, da man gerade da durch die Anatomie vieles herausgebracht hat. Niemals aber hat sich Erkenntnis im Gehirn nachweisen lassen, wohl aber die Gescheitheit.
So habe ich versucht, diese Frage auszugestalten. Vielleicht sind Sie nicht ganz unzufrieden mit der Beantwortung. Nun, sobald ich zurückkomme' wollen wir uns wieder zusammenfinden. Ich hoffe, daß Sie damit ein bißchen ausreichen können. Es tut mir leid, daß ich nicht hier Vorträge halten kann und in England. So weit sind wir noch nicht. Wenn wir einmal so weit sein werden, dann brauchen wir keine Pause mehr zu machen. Aber vorläufig müssen wir eine Pause machen. Daher auf Wiedersehen, meine Herren.
ZEHNTER VORTRAG Dornach, 9. September 1924
Guten Morgen, meine Herren! Vielleicht ist eine Möglichkeit, daß Sie noch weitere Fragen haben?
Schriftliche Frage: Mars steht in Erdnähe. Welchen Einfluß hat das auf die Erde? Was weiß man überhaupt vorn Mars?
Dr. Steiner: Nun, sehen Sie, in der letzten Zeit war ja immer wieder und wieder die Rede, daß der Mars in Erdnähe stehe, und die Zeitungen haben in der allerunnützesten Weise, in der törichtesten Weise eigentlich von dieser Erdnähe des Mars gesprochen. Denn wir müssen durchaus auf diese äußeren Verhältnisse in der Planetenkonstellation, die mit entsprechenden Stellungen von der Erde und so weiter zusammenhängen, nicht den allergrößten Wert legen, weil diese Einflüsse, die von daher kommen, eigentlich keine besonders großen sind. Es ist überhaupt merkwürdig, daß in der letzten Zeit so viel von der An-näherung des Mars an die Erde die Rede war, weil ja jeder Planet, zum Beispiel auch der Mond, sich fortwährend der Erde nähert, und die Planeten sind schon in einem Zustande, der damit endigen wird, daß sie sich alle wiederum mit der Erde vereinigen werden, ein Körper mit ihr werden.
Allerdings, wenn man sich das so vorstellt, wie sich zumeist heute die Menschen die Planeten vorstellen, daß sie ebensolche feste Körper wie die Erde seien, dann könnte man schon erwarten, wenn sie mit der Erde zusammenkommen werden, daß sie alle lebenden Wesen auf der Erde überall anschlagen! Aber das wird nicht der Fall sein, denn die Planeten haben nicht dieselbe Festigkeit wie die Erde selber. Wenn der Mars zum Beispiel wirklich herunterkommen würde und sich mit der Erde vereinigen würde, dann würde er selber nicht das feste Land verheeren können, sondern er würde nur die Erde überschwemmen können. Denn der Mars besteht, soweit man dieses untersuchen kann -man kann ja diese Dinge eigentlich niemals mit bloß physischen Instrumenten untersuchen, sondern man muß da schon die Geisteswissenschaft,
das geistige Schauen zu Hilfe nehmen -, wenn man sich also einläßt darauf, den Mars wirklich kennenzulernen, so besteht er vor allem aus einer mehr oder weniger flüssigen Masse, nicht so flüssig wie unser Wasser, aber, sagen wir, wie Gelee und solche Dinge. Also in dieser Weise ist er flüssig. Er hat allerdings auch feste Bestandteile, aber diese sind auch nicht so wie die auf unserer Erde, sondern sie sind so, wie etwa die Geweihe oder Hörner bei Tieren sind. Sie bilden sich heraus aus unserer Erdenmasse, und bilden sich auch wiederum zurück. So daß wir natürlich beim Mars eine ganz andere Beschaffenheit annehmen müssen, als diejenige unserer Erde ist.
Sehen Sie, man spricht fortwährend von Marskanälen, von Kanälen, die auf dem Mars sein sollen. Aber warum spricht man von Kanälen? Man sieht ja nichts anderes auf dem Mars als solche Linien (es wird gezeichnet); die spricht man als Kanäle an. Das ist richtig -und auch nicht richtig. Denn weil der Mars nicht in dem Sinne fest ist wie die Erde, kann man da natürlich nicht von solchen Kanälen sprechen, wie sie auf der Erde sind; aber man kann davon sprechen, daß so etwas Ahnliches auf dem Mars ist, wie unsere Passatwinde sind. Sie wissen ja, daß von der heißen Gegend der Erde, von Afrika, von der mittleren Erde, fortwährend die warme Luft nach dem kalten Nordpol geht, und vom kalten Nordpol die Luft wiederum zurückströmt nach dem mittleren Gebiet der Erde. So daß man, wenn man von außen die Sache ansehen würde, man auch solche Linien sehen würde; aber das sind Linien der Passatwinde, der Luftströmungen der Passatwinde. So ähnlich ist es auch beim Mars. Nur, beim Mars lebt alles viel mehr als auf der Erde. Die Erde ist in viel stärkerem Sinne ein erstorbener Planet als der Mars, auf dem mehr oder weniger noch die Dinge leben. Und da will ich Sie auf einiges aufmerksam machen, was Sie dazu bringen kann, einzusehen, wie es eigentlich mit dem Verhältnis von Mars zur Erde ist.
Wenn wir ausgehen von dem, was unser allerwichtigster Himmels-körper ist, von der Sonne, so wissen wir ja: die Sonne, die unterhält auf der Erde sehr vieles. Nehmen Sie nur einmal die gewöhnliche Tages-sonne an. Sie können in der Nacht die Pflanzen ansehen: die ziehen ihre Blüten ein, weil sie nicht von der Sonne beschienen werden. Bei
Tag öffnen sie sich wiederum, weil sie von der Sonne beschienen werden. Und so gibt es sehr, sehr vieles, was durchaus zusammenhängt mit der Verbreitung von Sonnenlicht über einen bestimmten Teil der Erde oder mit der Verbreitung von Finsternis über einen bestimmten Teil, also vom Nichtvorhandensein der Sonne. Aber während eines Jahres ist das ja deutlich. Sie können sich nicht denken, daß auf unserer Erde irgendwie im Frühling überhaupt Pflanzen wachsen würden, wenn nicht die Sonne in einer gewissen Weise ihre Macht bekäme. Und weil die Sonne im Herbst wiederum an Macht verliert, welken die Pflanzen ab, alles Leben erstirbt, der Schnee fällt auf die Erde. Also das Leben auf der Erde hängt mit der Sonne zusammen. Überhaupt, wir könnten gar nicht in der Luft, die da ist, atmen, wenn sie nicht da wäre, wenn nicht die Sonnenstrahlen uns die Luft geeignet machen würden. Also die Sonne ist schon unser wichtigster Himmelskörper. Aber denken Sie einmal, wie anders die Geschichte wäre, wenn die Sonne nicht in vierundzwanzig Stunden sozusagen scheinbar um die Erde herumginge, sondern in der doppelten Zeit! Dann würde alles Leben langsamer sein. Es hängt also von der Umdrehung der Sonne um die Erde - eigentlich ist es umgekehrt, aber es scheint doch so - alles Leben auf der Erde ab.
Und wiederum, weniger bedeutend schon ist dem Menschen der Einfluß des Mondes, aber der ist ja trotzdem da. Und wenn Sie bedenken, daß sich nach dem Monde richten Ebbe und Flut, daß die dieselben Zeiten haben wie der Mondumlauf, so werden Sie sehen, mit welcher Kraft der Mond auf die Erde wirkt. Und dann können Sie ja auch sehen, wie die Umlaufszeit des Mondes um die Erde eine gewisse Bedeutung hat, wenn man untersuchen würde, wie auf der Erde die Pflanzen, wenn sie schon von der Sonne beschienen sind, sich entwikkeln. So würde man schon den Einfluß des Mondes finden. Also der Mond und die Sonne haben den allergrößten Einfluß auf die Erde. Und wir können diesen Einfluß erkennen aus der Umlaufszeit, aus der Zeit, in der der Mond wiederum voll wird, Neumond wird und so weiter. Wir können es bei der Sonne erkennen, je nachdem sie auf-und untergeht, oder im Frühling ihre Kraft bekommt, im Herbst ihre Kraft verliert.
Nun will ich Ihnen etwas sagen. Sie alle kennen die Erscheinung, daß es in der Erde die sogenannten Engerlinge gibt. Das sind kleine wurmartige Tiere, die uns namentlich schädlich sind, weil sie uns die Kartoffeln zerfressen. Aber sehen Sie, diese Engerlinge, die drohen unseren Kartoffeln nicht immer, sondern es gibt Jahre, wo unsere Kartoffeln ungeschoren bleiben von diesem Ungeziefer, und es gibt Jahre, in denen man sich gar nicht retten kann, wo furchtbar immer die Engerlinge da sind. Was sind denn eigentlich diese Engerlinge?
Sehen Sie, man kann das ja nachrechnen. Wenn ein Jahr dagewesen ist, Wo diese Engerlinge uns die Kartoffeln zerfressen haben, und man wartet jetzt, bis das vierte Jahr darauf kommt - im ersten Jahr entstand nichts, im zweiten Jahr entstand nichts, im dritten Jahr entstand nichts; sehen Sie, meine Herren, in diesem vierten Jahr ist wiederum die Maikäferplage da. Da gibt es dann entsprechend viele Maikäfer, weil erst nach vier Jahren die Maikäfer herauskommen aus den Engerlingen, die vor vier Jahren da waren. So daß ungefähr die vierjährige Periode liegt zwischen dem Erscheinen der Engerlinge, die einfach, wie jedes Insekt, zuerst die Madenform, dann die Puppenform haben und so weiter, nach und nach entwickeln sie dann die Form des vollkommenen Insektes, so daß also die Engerlinge vier Jahre brauchen zu ihrer Entwickelung bis zum Maikäfer. Natürlich sind immer Maikäfer da; wenn im nächsten Jahr wenig Engerlinge da sind, sind im vierten Jahr auch wenig Maikäfer da. Es hängt eben so zusammen, daß die Masse der Maikäfer zusammenhängt mit den Engerlingen, die vor vier Jahren da waren.
Nun, wenn man diese Zeit nimmt, so sieht man ganz genau, daß das zusammenhängt mit der Umlaufzeit des Mars. Da sehen Sie also innerhalb der Fortpflanzung von gewissen Insekten, wie der Mars einen Einfluß auf das Leben der Erde hat. Das ist nur etwas versteckt. Bei der Sonne ist der Einfluß offenbar, beim Mond schon nicht mehr ganz offenbar, beim Mars versteckt. Alles dasjenige, was Zwischenzeiten braucht, zwischen den Jahren der Erde - also so wie die Engerlinge und Maikäfer, das hängt ab vom Mars. So daß man also da schon eine solche Wirkung sieht, die in der Tat bedeutsam ist.
Es könnte ja jemand sagen: Ich glaube dir das nicht. - Nun, meine Herren, wir können nicht alle Versuche allein machen, aber wer es nicht glaubt, der soll nur einmal das Folgende machen. Der soll irgendwo solche Engerlinge nehmen, die er in einem Jahr, wo es viele Engerlinge gibt, gewonnen hat, soll sie künstlich züchten irgendwo in einem Behälter, und in einem Jahr wird er sehen: die meisten Engerlinge kriechen nicht aus, werden keine Maikäfer. Natürlich macht man solche Dinge nicht, weil man an die Dinge nicht glaubt.
Nun kommt man auf dasjenige, um was es sich eigentlich handelt. Wenn man dabei auf die Sonne schaut, so hat sie den allerstärksten Einfluß. Aber die Sonne hat ihren hauptsächlichsten Einfluß auf alles dasjenige in der Erde, was tot ist und jedes Jahr ins Leben gerufen werden muß, während der Mond nur auf das Leben seinen Einfluß hat, nicht mehr auf das Tote. Der Mars hat zum Beispiel seinen Einfluß nur auf dasjenige, was im feineren Leben, in der Empfindung ist, und die anderen Planeten haben auf das Seelische und das Geistige und so weiter ihren Einfluß. So daß eigentlich die Sonne derjenige Himmelskörper ist, der am stärksten bis in die Mineralien hinein auf die Erde wirkt, denn in den Mineralien kann der Mond nichts machen, der Mars noch weniger. Kein Wesen würde auf der Erde kriechen und leben können als Tier, wenn nicht der Mond da wäre. Es könnten auf der Erde nur Pflanzen da sein, keine solchen Wesen. Viele solche Tiere könnten nicht eine Zwischenzeit an Jahren haben von der Larve bis zum Insekt, wenn nicht der Mars da ware.
Und sehen Sie, eigentlich hängen alle Dinge so zusammen. Wir können uns zum Beispiel fragen: Wann sind wir denn ganz voll ausgewachsen, wenn wir uns als Menschen entwickeln? Wann hören wir denn auf, eine irgendwie zunehmende Entwickelung zu haben? Ja, sichtbarlich schon sehr früh, vielleicht schon mit zwanzig, einundzwanzig Jahren; doch setzt sich noch immer etwas an. Manche Menschen wachsen sogar nicht mehr, aber innerlich setzt sich immer noch etwas an. Bis gegen das dreißigste Jahr hin nehmen wir eigentlich zu, dann fangen wir erst an abzunehmen. Wenn wir wiederum mit dem Weltenall vergleichen, kriegen wir da die Umlaufs-zeit des Saturn heraus.
Also auf die feineren Verhältnisse des Wachstums und Lebens haben wiederum die Planeten ihren Einfluß. So daß wir sagen können:
Wenn sich, wie alle Planeten, der Mars der Erde nähert, so müssen wir auf diese äußere Annäherung nicht den allergrößten Wert legen, sondern es ist viel wichtiger, wie mit den feineren Verhältnissen des Lebens die Dinge im Weltall zusammenhängen.
Nun müssen Sie ja bedenken, daß der Mars ganz anders beschaffen ist als die Erde. Ich sagte Ihnen: In dem Sinne, wie die Erde heute Festes hat, hat der Mars nichts Festes. Aber, meine Herren, ich habe Ihnen ja beschrieben vor einiger Zeit, daß die Erde auch einmal in einem sölchen Zustand war, daß sich das Mineralische, das Feste erst herausgebildet hat, daß da riesige Tiere gelebt haben, die aber noch keine festen Knochen hatten. Wenn wir heute den Mars nehmen, so ist der Mars in einem ähnlichen Zustand, wie die Erde früher war, hat also auch diejenigen Lebewesen, diejenigen Tiere, die die Erde dazumal hatte, und die Menschen sind auf dem Mars so, wie sie auf der Erde dazumal waren: noch ohne Knochen, wie ich es Ihnen beschrieben habe an einem früheren Erdenzustande. - Das kann man wissen. Nur kann man es nicht wissen auf diejenige Weise, wie es die heutige Naturwissenschaft gewöhnt ist; aber man kann diese Dinge wissen. So daß man sagen kann: Willst du dir vorstellen, wie der Mars heute ist, so stelle dir vor, wie die Erde in einem früheren Zeitalter war; dann hast du das Aussehen des Mars.
Sehen Sie, heute haben wir Passatströmungen von Süden nach Norden, von Norden nach Süden. Einstmals waren diese Luftströmungen viel dicker; es waren flüssige, wäßrige Luftströmungen. So ist heute der Mars. Das sind solche noch lebendigere, noch viel wäßrigere, nicht luftförmige Strömungen auf dem Mars.
Der Jupiter zum Beispiel ist ja fast ganz luftförmig, nur wiederum etwas dichter als die Luft der Erde. Der Jupiter stellt, wenn wir ihn heute anschauen, einen Zustand dar, welchem die Erde erst zustrebt, wie die Erde erst in der Zukunft sein wird.
Und so sehen wir überall im Planetensystem gewisse Zustände, die die Erde auch durchmacht. Wenn wir die Planeten so verstehen, dann verstehen wir sie richtig.
Hat vielleicht jemand jetzt in bezug auf diese Frage noch etwas zu fragen, oder möchte noch etwas wissen? Vielleicht Herr Burle selber?
Herr Burle: Ich bin ziemlich befriedigt darüber.
Weitere Frage: Herr Doktor führte in einem der letzten Vorträge an, daß die Blumen in ihren Düften mit den Planeten zusammenhängen. Ist es mit den Farben der Blumen und mit dem farbigen Gestein auch so?
Dr. Steiner: Nun, ich will nur ganz kurz wiederholen, was ich gesagt habe. Es war auch auf eine Frage. Ich sagte: Die Blumen, und auch andere Stoffe der Erde duften, haben also dasjenige, was auf das Geruchsorgan des Menschen einen entsprechenden Einfluß ausübt. Ich habe Ihnen damals gezeigt, daß das zusammenhängt mit den Planeten, daß gewissermaßen die Pflanzen, und so ähnlich auch gewisse andere Stoffe, große Nasen sind, oder überhaupt Nasen sind, daß sie also wahrnehmen dasjenige, was als Wirkungen aus den Planeten kommt. Sehen Sie, auf das feinere Leben - da kommen wir wieder darauf, daß wir auf das feinere Leben übergehen müssen - haben die Planeten einen Einfluß; und wir können schon sagen: Die Pflanzen entstehen eigentlich aus dem Weltenduft heraus, der nur so dünn und fein ist, daß wir ihn mit unseren groben Nasen nicht riechen. Aber ich habe Sie dazumal aufmerksam gemacht darauf, wie man noch ganz anders riechen kann - ich meine nicht von sich aus, sondern etwas beriechen kann anders als der Mensch. Da brauchen Sie sich ja nur an die Polizeihunde zu erinnern. Die Polizeihunde, die macht man in entsprechender Weise darauf aufmerksam, daß da irgendwie ein Mensch war, der etwas gestohlen hat; dann nimmt der Polizeihund den Duft auf, und er führt einen auf die Spur, und man kommt schon manchmal, wenn er die Spur verfolgt, wohin der Dieb gegangen ist, an den Dieb heran. In dieser Weise werden ja die Polizeihunde verwendet. Zu allerlei ganz interessanten Dingen kommt man, wenn man verfolgt, wie diejenigen Düfte, die dem Menschen gar nicht wahrnehmbar sind, vom Hunde wahrgenommen werden.
Ja, aber, meine Herren, die Menschen haben nicht immer geahnt, daß die Hunde solche feine Nasen haben, sonst hätten sie schon längst die Hunde in Polizeidienste genommen. Man ist erst verhältnismäßig
spät darauf gekommen. Und so ahnen die Menschen heute noch nicht, was die Pflanzen für ungeheuer feine Nasen haben. Die ganze Pflanze ist eine Nase, nimmt den Duft auf, und wenn sie gerade so gestaltet ist, daß sie, wie ein Echo den Ton zurückgibt, so den Duft wiederum zurückgibt, den sie aufnimmt, so wird sie eben eine riechende Pflanze. So daß wir sagen können: Vom Planetensystem hängen die Düfte der Blumen, der Pflanzen überhaupt, und auch andere Düfte auf der Erde schon ab.
Nun ist die Frage gestellt worden, wie das bei den Farben ist. Bei den Farben ist es so: Wenn die Pflanze sich gestaltet aus dem Welten-duft heraus, so ist sie ja wiederum gerade, wie ich es beschrieben habe, das Jahr hindurch der Sonne ausgesetzt. Und während die Gestalt der Pflanze aus dem Weltenduft heraus von den Planeten gebildet wird, wird die Farbe der Pflanze von der Sonne, auch etwas unter dem Einfluß des Mondes, gebildet. Also nicht von derselben Quelle her kommt der Duft und die Farbe. Der Duft kommt von den Planeten, die Farbe kommt von Sonne und Mond. Nicht wahr, es muß ja nicht alles von demselben kommen; geradeso wie der Mensch einen Vater und eine Mutter hat, so hat die Pflanze ihre Düfte von den Planeten, ihre Farben von Sonne und Mond.
Daß die Farben zusammenhängen mit Sonne und Mond, das können Sie aus folgendem entnehmen. Nehmen Sie Pflanzen, die ganz schöne grüne Blätter haben, setzen Sie sie in den Keller: sie werden nicht nur blaß, sondern sie schauen ganz weiß aus, werden ganz farblos, weil sie die Sonne nicht mehr beschien. Ihre Gestalt, ihre Form behalten sie, weil der Weltenduft überall hineingeht, aber die Farbe behalten sie nicht, weil die Sonne nicht hereinscheint. So also sehen sie, daß die Farben durchaus kommen von der Sonne, und, wie ge-sagt - das ist etwas schwerer durchschaubar -, auch vom Monde. Da müßten erst wiederum Versuche gemacht werden, könnten auch Versuche gemacht werden; indem man die Pflanze dem Mondenlicht so und so aussetzt, würde man schon darauf kommen.
Vielleicht hat dazu jemand noch etwas zu sagen?
Herr Burle: Ich möchte die Frage erweitern: Wie ist es mit der Farbe der Gesteine?
Dr. Steiner: Bei den Gesteinen ist es nun so: Nicht wahr, wenn Sie sich vorstellen, daß jeden Tag die Sonne einen bestimmten Einfluß hat auf die Pflanzen, und auch während des Jahres einen Einfluß hat auf die Pflanzen, dann bekommen Sie eine Ansicht darüber, daß die jährlichen Sonnenwirkungen anders sind als die täglichen Sonnenwirkungen. Die täglichen Sonnenwirkungen können nicht viel ändern an den Farben der Pflanzen, aber die jährlichen Sonnenwirkungen, die machen den Eindruck auf die Farben der Pflanzen.
Aber es gibt ja nicht bloß tägliche oder jährliche Wirkungen der Sonne, sondern es gibt noch ganz andere Wirkungen der Sonne. Von denen habe ich vor längerer Zeit auch schon zu Ihnen gesprochen, will es Ihnen aber jetzt noch einmal zeigen.
Denken Sie sich einfach - scheinbar - die Erde hier (es wird gezeichnet). Die Sonne geht an einem bestimmten Punkte auf am Himmel, und nehmen wir an, wir prüfen den Aufgang der Sonne am 21. März, im Frühling, dann bekommen wir einen bestimmten Punkt am Himmel, wo die Sonne aufgeht. Sehen Sie, wenn wir heute hinschauen, wo die Sonne am 21. März aufgeht, da finden wir hinter dem Aufgang der Sonne das Sternbild der Fische. Das ist ein bestimmtes Sternbild. In diesem Sternbild der Fische geht die Sonne schon seit mehreren hundert Jahren auf, aber nicht immer an derselben Stelle, sondern dieser Punkt im Frühling, wo die Sonne am 21. März aufgeht, der rückt im Sternbild der Fische immer weiter und weiter. Sehen Sie, vor einem Jahr ist die Sonne ein Stückchen weiter zurück aufgegangen, noch weiter zurück wiederum vor einem Jahr. Also nicht immer geht die Sonne am selben Punkt auf. Da ist das Sternbild der Fische (es wird gezeichnet); so geht es durch die Jahrhunderte, ja noch länger: wir finden den Frühlingspunkt immer im Sternbild der Fische. Aber so war es nicht immer. Wenn wir zurückgehen würden ins Jahr 1200 -jetzt haben wir 1924 -, wenn wir da zurückgehen würden, so würden wir finden: die Sonne ist gar nicht aufgegangen im Sternbild der Fische, sondern im Sternbild des Widders. Und wiederum lange Zeit hat man den Frühlingspunkt im Sternbild des Widders gefunden. Vorher noch, sagen wir zum Beispiel in der alten ägyptischen Zeit, da ist die Sonne nicht aufgegangen im Sternbild des Widders, sondern im Sternbild des
Stieres, und noch früher im Sternbild der Zwillinge und so weiter. So daß wir sagen können: Die Sonne rückt immer vor mit ihrem Frühlingspunkt.
Ja, meine Herren, das weist ja darauf hin, daß sich die Sonne selber verschiebt im Weltenall! Die Sonne verschiebt sich - man müßte auch sagen: scheinbar, denn es ist die Erde, die sich verschiebt, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Und wenn wir den Zeitraum nehmen von 25915 Jahren, so geht der Frühlingspunkt der Sonne ganz rund herum. So daß wir in diesem Jahr 1924 den Frühlingspunkt an einem bestimmten Punkt des Himmels sehen - wir haben heute 1924; vor 25915 Jahren schrieb man 23991 Jahre vor Christi Geburt: da ging die Sonne im selben Punkte auf! Einen ganzen Umkreis hat sie gemacht in der Zeit. Sie sehen, das ist sehr merkwürdig: Die Sonne geht scheinbar herum in einem Tag, die Sonne geht herum in einem Jahr, und die Sonne geht herum in 25915 Jahren. Wir haben einen Sonnentag, ein Sonnenjahr, und wir haben ein Weltenjahr, das große Weltenjahr, das 25915 Jahre dauert.
Das ist überhaupt sehr interessant. Sehen Sie sich einmal diese Zahl 25915 an - eine höchst interessante Zahl! Denn wenn Sie den menschlichen Atemzug nehmen und bedenken, daß der Mensch etwa 18 Atem-züge in der Minute hat - rechnen wir uns einmal aus, wie viele er im Tag hat: wenn er in der Minute 18 Atemzüge hat, so hat er in einer Stunde 60 mal 18 = 1080 Atemzüge. Wie viele hat er in 24 Stunden, also im ganzen Tag? Vierundzwanzigmal mehr, also 25920 Atemzüge -was ungefähr dasselbe ist, wie diese Zahl 25915! Der Mensch atmet in einem Tage so oft, als die Sonne Jahre braucht, um im Weltenall einmal herumzulaufen. Es ist sehr merkwürdig, daß in der Welt alles übereinstimmt!
Warum sage ich Ihnen das alles, meine Herren? Ja, sehen Sie, um einer Pflanze Farbe zu geben, braucht die Sonne ein Jahr; um einem Stein Farbe zu geben, braucht die Sonne 25915 Jahre! Das ist eben ein viel härterer Kerl, der Stein. Um einer Pflanze eine Farbe zu verleihen, geht die Sonne einmal im Jahr herum. Sie geht in ihrem Aufgangspunkt herum, steht im Frühlingspunkt tief, geht hinauf, wieder hinunter: das ist ein richtiger Umlauf innerhalb eines Jahres. Aber in
25915 Jahren ist wieder ein Umlauf da. Durch diese letzte Bewegung kriegt es die Sonne erst fertig, dem Stein die Farbe zu geben. Aber es ist immer die Sonne, die die Farbe gibt. Daraus sehen Sie auch zugleich, wie weit das Mineralreich vom Pflanzenreich absteht. Wenn die Sonne nicht jedes Jahr in der Weise herumginge, wie es eben der Fall ist, sondern wenn die Sonne nur Tagesumläufe hätte und nur den großen Umlauf von 25915 Jahren, so gäbe es keine Pflanzen, und Sie müßten statt Kohl Kieselsteine essen! Es müßte nur erst der menschliche Magen dazu eingerichtet sein.
Frage: Haben die Berg- und Alpenkräuter größeren Heilwert als die Taikräuter? Wenn das bei den ersteren der Fall ist, woher kommt dann der größere Heilwert?
Dr. Steiner: Sehen Sie, es ist schon der Fall, daß die Berg- und Alpenkräuter den größeren Heilwert haben als die Talkräuter, namentlich als die Kräuter, die wir in unseren gewöhnlichen Gärten oder auf dem Feld angepflanzt haben. Es ist ja auch gut, daß es so ist, denn würden im Tal unten ebenso die Pflanzen wachsen wie auf den Bergen, so würde ja jedes Nahrungsmittel zugleich ein Heilmittel sein. Das geht ja doch nicht an. Nun aber ist es schon der Fall, daß der hauptsächlichste Heilwert der Pflanzen darauf beruht, daß die Pflanzen, die Heilkräuter sind, auf den Bergen wachsen. Warum? Ja, da müssen Sie einmal vergleichen den Boden, aus dem die Bergpflanzen wachsen, mit dem Boden, aus dem die Talkräuter wachsen.
Sehen Sie, die Sache ist ja schon von großem Unterschied in bezug auf Wald und künstliche Gartenzucht. Nehmen Sie nur die Erdbeere:
Wenn Sie Walderdbeeren haben, sind sie klein, aber sie sind sehr aromatisch; wenn Sie Gartenerdbeeren haben, sind sie nicht so geruchvoll, so prickelnd, aber sie können riesig werden; es gibt ja gar eigroße Gartenerdbeeren. Nun, worauf beruht denn das? Das beruht darauf, daß, wenn wir im Tal unten den Boden nehmen, der Boden nicht mehr so durchsetzt ist von dem, was so vom Gestein abbröckelt. Am Berg oben finden Sie ja das eigentliche harte Gestein, das eigentliche Mineral. Unten im Tal finden Sie eigentlich dasjenige, was schon vielfach durch-schwemmt ist, was schon vielfach von den Flüssen abgetragen ist, was also ganz zerklüftet und zerstäubt ist. Am Berg oben ist natürlich auch
dieses Zerklüftete und Zerstäubte als Boden, aber immer auch von ganz kleinen Bröselchen, Körnchen durchsetzt, namentlich, sagen wir, von Quarz, Feldspat und so weiter. Da ist überall gerade dasjenige darunter, was wir ja auch wiederum zur Heilung benutzen. Wirklich Großes, Bedeutendes erreichen wir, wenn wir zum Beispiel das, was der Quarz, der Kiesel enthält, zerreiben und Heilmittel daraus machen. Da wenden wir direkt diese Mineralien als Heilmittel an.
Wenn der Erdboden unten im Tal ist, ist nichts mehr drinnen von diesem Gestein; wenn er oben auf dem Berge ist, da bröckeln diese Gesteine doch immer ab, verwittern, bröckeln ab. Da nimmt die Pflanze in ihre Säfte die ganz kleinen Teile von diesen Steinen auf, und das macht sie zu Heilpflanzen.
Sehen Sie, es ist ja interessant: Die Kunst der sogenannten Homöopathen, die nicht in allem Recht haben, aber in vielem Recht haben, beruht ja darauf, daß man Stoffe nimmt, sie ganz fein zerkleinert und immer feiner und feiner zerreibt, so daß man dadurch das Heilmittel bekommt. Wenn man die groben Stoffe nimmt, so kriegt man ja gar nicht das Heilmittel. Aber die Pflanzen, meine Herren, sind ja die kostbarsten Homöopathen, denn die nehmen ganz kleine, winzige Teilchen auf von all diesen Gesteinen, die man sonst zerreibt, wenn man die Heilmittel macht! Wir können also direkt, weil das ja von der Natur viel besser gemacht wird, die Pflanzen nehmen und mit den Pflanzen heilen. Aber es ist deshalb durchaus richtig, daß auf den Bergen, auf den Alpen die Pflanzen, die Kräuter viel mehr Heilwert haben als unten im Tal. Sie sehen ja auch, daß sogar das ganze Aussehen bei Pflanzen sich ändert. Ich habe es Ihnen eben bei der Erdbeere gesagt:
Wenn die Erdbeere viel aufnimmt von einem gewissen Gestein, so wird sie eine Walderdbeere. Die Walderdbeere, wo gedeiht sie denn besonders? Die Walderdbeere gedeiht ganz besonders da, wo Gesteine sind, die ein bißchen Eisen enthalten. Dieses Eisen geht in den Erdboden herein; das geht in die Erdbeere hinein und von dem hat die Erdbeere ihren aromatischen Geruch. Daher bekommen gewisse Leute, die in ihrem Blute sehr empfindlich sind, einen Ausschlag, wenn sie Erdbeeren essen. Der Ausschlag rührt davon her, daß das Blut im gewöhnlichen Zustand schon genug Eisen hat; es bekommt zu viel
Eisen, wenn sie Erdbeeren essen: sie bekommen einen Ausschlag. Daher kann man auch wiederum sagen: Während beim gewöhnlichen Blut manche Leute Ausschlag bekommen, ist beim eisenarmen Blut das Erdbeerenessen sehr gut. Auf diese Weise kommt man natürlich allmählich auf den Heilwert hinaus. Nun, in den Gartenanlagen, wo die Riesen-erdbeeren gedeihen, da ist in der Regel der Boden so, daß kein Eisen drinnen enthalten ist; da pflanzen sich die Erdbeeren in der Regel nur durch sich selber fort, nehmen nicht diesen Antrieb vom Eisen auf. Die Menschen sind nur in dieser Beziehung etwas kurzsichtig; sie verfolgen die Dinge nicht lang genug. Man kann ja wirklich dadurch, daß man in eisenarmem Boden Erdbeeren züchtet, Riesenerdbeeren haben, gerade weil die Pflanzen sich nicht zusammenziehen, nicht fest werden. Denken Sie, wenn die Erdbeere darauf angewiesen ist, das bißchen Eisen, das da ist, anzuziehen, dann muß sie ja, wie man sagt, einen Riesenradius entwickeln! Das ist aber eine Eigenschaft der Erdbeere.
Sehen Sie, da wäre der Erdboden (es wird gezeichnet), dann sind da ganz winzige Spuren von Eisen in der Erde. Da wächst die Erdbeere, die zieht von weither diese Eisenspuren heran; die Wurzel der Erdbeerpflanze, die hat eine große Kraft, zieht von weither die Spuren des Eisens heran. Nehmen Sie jetzt die Erdbeere vom Wald. Setzen Sie diese Erdbeere in den Garten, so ist da ja kein Eisen, aber diese Riesenkraft, die hat sich die Erdbeere angewöhnt, die hat sie einmal. Daher zieht sie alles, was sie nur anziehen kann, von weither auch in der Gartenkultur heran, nährt sich also außerordentlich gut. Eisen kriegt sie nicht, aber sie zieht alles andere an, weil sie gut dazu veranlagt ist. Daher wird sie riesengroß.
Aber ich sagte: Die Menschen sind kurzsichtig; sie beobachten die Dinge nicht so, wie man sie eigentlich beobachten sollte, und deshalb sehen die Menschen nicht, daß sie in der Gartenkultur zwar viele Jahre hindurch Riesenerdbeeren pflanzen können, daß das aber nur eine Zeitlang geht. Dann erstirbt die Fruchtbarkeit, dann muß man neuerdings wieder nachhelfen mit denjenigen Pflanzen, denjenigen Erdbeeren, die man sich vom Walde holt. Es läßt sich eben einfach in bezug auf Fruchtbarkeit und so weiter nicht alles künstlich machen, sondern man muß
diejenigen Dinge kennen, die durchaus mit der Erde und mit der Natur zusammenhängen.
Sie können das am besten sehen bei der Rose. Wenn Sie hinausgehen und Sie sehen draußen in der freien Natur die Rose, so ist das die Wilde Rose, die sogenannte Hundsrose, Rosa canina - Sie kennen ja diese Wilde Rose -, die hat fünf Blätter, ziemlich blasse Blumenblätter (es wird gezeichnet). Worauf beruht das, daß diese Hundsrose eine solche Form hat, daß sie fünf Blätter aufbringt und dann gleich die Früchte entwickelt? Diese rötliche Frucht - Sie kennen sie -, die Hagebutte, sie entwickelt sich aus der Hundsrose. Nun, das beruht darauf, daß der Boden, wo die Hundsrose wild wächst, in sich ein gewisses Öl hat, wie überhaupt der Erdboden verschiedene Ölsorten in seinem Gestein und so weiter hat. Wir gewinnen ja auch die Öle aus der Erde oder aus den Pflanzen, die es schon von der Erde aufgenommen haben. Nun, meine Herren, die Rose muß, wenn sie draußen wild wächst, riesig weit herum mit ihrer Wurzel wirken, damit sie das bißchen Öl zusammenkriegt aus den Mineralien, um eben Rose werden zu können. Woher rührt denn das, daß die Rose so weit ausgreifen muß, so weithin die Kraft ihrer Wurzeln, die Anziehungskraft ihrer Wurzeln erstrecken muß? Sehen Sie, das rührt davon her, daß der Boden draußen, wo die Rose wild wächst, sehr wenig Humus hat. Aber der Humus ist öliger als der wilde Boden draußen.
Nun hat die Rose eine Riesenkraft, das Öl überall heranzuziehen. Wenn es nahe ist wie beim Humusboden, dann hat sie es gut, die Rose, dann zieht sie viel Öl an, und sie entwickelt sich so, daß sie jetzt nicht nur fünf Blätter entwickelt, sondern eine ganze Masse, eine gefüllte Rose wird unseres Gartens. Nur entwickelt sie wiederum nicht eine eigentliche Frucht, weil dazu das andere gehört, was draußen ist im Boden, im Gestein. Wir können also die Rose, die Hundsrose, zur Zierpflanze machen, wenn wir sie in einen humusreicheren Boden, wo sie sich leicht ihre Öle verschaffen kann, aus denen sie ihre Blüte macht, versetzen können. Dann, meine Herren, ist es das Umgekehrte: Die Erdbeere, die findet dasjenige, was sie draußen in der Wildnis hat, in der Gartenkultur schlecht. Die Rose findet das, was sie draußen in der Wildnis wenig hat, gerade in der Gartenkultur sehr stark. Daher wird
sie üppig in der Blüte, aber sie bleibt immer zurück in der Fruchtbildung. Sehen Sie, wenn man weiß, wie ein Erdboden beschaffen ist, kann
man ihm ansehen, was auf diesem Erdboden wächst. Das ist natürlich wiederum von ungeheurer Wichtigkeit für die Zucht von Pflanzen, namentlich zum Beispiel für die Zucht landwirtschaftlicher Pflanzen, denn da muß man eben durch die Düngungen und durch die Zusätze, die man zum Dünger macht und so weiter, eben den Boden so herstellen, daß dasjenige wächst, was wachsen soll. Und die Kenntnis des Bodens, das ist das ungeheuer Wichtige zum Beispiel für den Landwirt. Das hat man ja vollständig vergessen, daß das so wichtig ist. Aus dem Instinkt heraus treiben die einfachen Landwirte die richtige Mistdüngung. Aber wo die Landwirtschaft heute im Großen getrieben wird, da wird darauf nicht mehr so viel Rücksicht genommen. Die Folge davon ist, daß fast alle unsere Nahrungsmittel im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, viel schlechter geworden sind, wie sie waren, als wir, die wir jetzt ältere Leute geworden sind, kleine Buben waren.
Es hat vor kurzer Zeit, in diesem Jahre, eine interessante landwirtschaftliche Versammlung gegeben, wo die Landwirte ganz besorgt waren: Was soll aus den Pflanzen, aus den Nahrungsmitteln werden, wenn das so weitergeht? - Ja, meine Herren, es wird auch so weitergehen! Die Nahrungsmittel werden nach einem Jahrhundert ganz unbrauchbar sein, wenn nicht wiederum eine gewisse Kenntnis des Bodens Platz greift.
Damit haben wir ja schon durch die anthroposophische Geisteswissenschaft in der Landwirtschaft angefangen. Ich habe einen landwirtschaftlichen Kurs in der Nähe von Breslau gehalten. Danach hat sich eine Vereinigung gebildet, die die Sache in die Hand nimmt. Auch wir haben hier etwas gemacht, haben uns schon in manchem am Realisieren beteiligt. Wir haben erst angefangen damit, aber die Dinge werden in Angriff genommen. So wird schon Anthroposophie allmählich auch ins praktische Leben eingreifen.
Wir müssen noch etwas nachholen; wir haben dann die nächste Stunde am nächsten Freitag, meine Herren.
ELFTER VORTRAG Dornach, 13. September 1924
Nun, meine Herren, vielleicht ist Ihnen noch etwas auf der Seele, was Sie heute gern beantwortet haben wollen?
Frage: Ob die Erdnähe des Mars mit dem Wetter zusammenhängt, weil so ein schlechter Sommer gewesen ist, wie man es sich kaum denken kann - Oder über-haupt die Planeteneinflüsse da hereinspielen?
Dr. Steiner: Nun, nicht wahr, die Witterungsverhältnisse, wie sie sich im Laufe der Jahre, überhaupt in letzter Zeit als wenig regelmäßig erwiesen haben, sie haben schon etwas zu tun mit den Himmelsverhältnissen, aber nicht eigentlich direkt mit dem Mars, sondern wenn wir diese Unregelmäßigkeiten beobachten, so müssen wir vor allen Dingen auf eine Erscheinung sehr stark Rücksicht nehmen, die ja auch wenig berücksichtigt wird sonst, aber von der doch immerhin gesprochen wird: das ist die Erscheinung der Sonnenflecken. Die Sonnen-flecken sind Erscheinungen, welche in Abständen von zehn, elf, zwölf Jahren immer wiederum in einer bestimmten Veränderung auftreten. Man sieht, wenn man die Fläche der Sonne beobachtet, dunkle Flecken auftreten. Diese dunklen Flecken beeinträchtigen natürlich die Ausstrahlungen der Sonne, denn, wo es dunkel ist, strahlt sie nicht aus. So daß Sie sich denken können, daß wenn einmal in einem Jahre mehr solche Sonnenflecken vorhanden sind, dann in einem solchen Jahre eine geringere Ausstrahlung stattfindet. Und bei der sehr großen Bedeutung - von der ich Ihnen gesprochen habe -, die die Sonne schon einmal für die Erde hat, ist das schon wichtig.
Und diese Erscheinung der Sonnenflecken ist ja auch noch in einer anderen Richtung sehr bemerkenswert. Es muß durchaus zugegeben werden, daß im Laufe der Jahrhunderte die Zahl der Sonnenflecken sich vermehrte. Sie erscheinen also durchaus nicht jedes Jahr in der gleichen Menge. Das rührt davon her, daß die Stellung der Himmels-körper eine andere ist. Wenn sich die Himmelskörper drehen, so wird die Stellung eine andere; dadurch wird der Anblick, den ein Himmelskörper
bietet, immer anders. Wenn also an einer bestimmten Stelle die Sonnenflecken sind, so erscheinen sie nicht jedes Jahr an derselben Stelle, sondern je nachdem sich die Sonne dreht; sie erscheinen dann im Laufe der Jahre wiederum an derselben Stelle. Aber im Laufe der Jahrhunderte haben sie sich wesentlich vermehrt, und es ist so, daß diese Vermehrung der Sonnenflecken schon für die Auffassung desjenigen, was eigentlich im Verhältnis der Erde zur Sonne vorgeht, etwas bedeutet.
Wenn wir Jahrtausende zurückgehen, so sind sozusagen noch gar keine Sonnenflecken da. Die Sonnenflecken sind entstanden, vermehrten sich und werden sich immer weiter vermehren. Daher ist die Sache so, daß die Sonne einmal überhaupt weniger strahlen wird und zuletzt, wenn sie ganz schwarz geworden ist, verfallen sein wird, gar kein Licht mehr ausstrahlen wird. So daß wir also tatsächlich damit zu rechnen haben, daß da wirklich in verhältnismäßig langer Zeit die Quelle von Licht und Leben, die von der Sonne ausgeht, physisch für die Erde erlischt. Wir können also auch aus der Erscheinung der Sonnenflecken - was ja auch sonst, nicht wahr, klar ist - von einem Erdenende sprechen. Dann wird alles dasjenige, was geistig ist an der Erde, andere Formen annehmen, wie ich Ihnen schon erzählt habe, daß es andere Formen gegeben hat in älteren Zeiten. Aber geradeso wie ein Mensch alt wird und auch sich verändert, so wird die Sonne mit dem ganzen Planetensystem alt und verändert sich.
Mars selber hat eigentlich nicht mit diesen Erscheinungen - das sagte ich schon das letzte Mal - einen starken Zusammenhang, sondern mit solchen mehr lebendigen, dem Leben angehörenden Erscheinungen wie dem Ablauf des Erscheinens der Engerlinge und Maikäfer alle vier Jahre. Da müssen Sie auch die Sache natürlich nicht mißverstehen. Mit dem, was man in der Astronomie ausrechnet als Umlaufszeit des Mars, dürfen Sie das nicht ohne weiteres vergleichen, weil die Stellung in Betracht kommt. Dieselbe Stellung, die der Mars zur Erde und zur Sonne hat, die kommt alle vier Jahre so zustande, daß die Engerlinge, die also vier Jahre leben, bis sie Maikäfer werden, auch damit zusammenhängen. Aber wenn Sie zwei Marsumläufe nehmen -die also vier Jahre drei Monate sind -, dann bekommen Sie heraus
die Zeit, die da liegt zwischen den Maikäfern und den Engerlingen, und umgekehrt zwischen den Engerlingen und Maikäfern. So daß Sie also bei diesen kleineren Himmelskörpern auch an die feineren Erscheinungen auf der Erde denken müssen, währenddem bei der Sonne und dem Mond durchaus an die gröberen, also an die Witterungserscheinungen und dergleichen zu denken ist.
Aber so etwas wie die Sonnenflecken hängt zum Beispiel dann auch wiederum damit zusammen, ob ein gutes oder schlechtes Weinjahr ist, was aber auch wiederum mit den Kometenerscheinungen und dergleichen zusammenhängt. Wirklich richtig studieren kann man dasjenige, was auf der Erde vorgeht, eben nur dann, wenn man es im Zusammenhang mit den Himmelserscheinungen beobachtet.
Es kommen jetzt natürlich noch andere Fragen in Betracht, wenn wir ins Auge fassen wollen, warum abnorme Witterungserscheinungen eintreten. Denn dasjenige, was wir Witterungserscheinungen nennen und was uns als Menschen so naheliegt, weil davon Gesundheit und alles mögliche abhängt, das hängt natürlich von sehr vielen Verhältnissen ab. Da müssen Sie bedenken: Wenn wir zurückgehen in der Entwickelung der Erde, so kommen wir zu einer Zeit zurück, die etwa sechstausend Jahre oder so etwas zurückliegt, sechstausend bis zehntausend Jahre zurückliegt. Ja, wenn Sie in der Zeit unsere Gegenden betrachten, sechs- bis zehntausend Jahre zurückliegend, da würden Sie natürlich nicht so, wie es heute ist, da draußen die Berge haben. Sie würden überhaupt nicht die Schweizer Berge besteigen können, weil sie so, wie Sie heute leben, überhaupt nicht vorhanden wären! Sie könnten nicht hier leben, könnten auch nicht in den anderen Län-dern Europas leben, denn dazumal waren diese Gegenden im wesentlichen von Eis bedeckt, vereist. Es war die sogenannte Eiszeit. Diese Erscheinung der Eiszeit, die hat bewirkt, daß der größte Teil der früher schon in Europa vorhandenen Bevölkerung entweder physisch zugrunde gegangen ist, oder andere Gegenden aufsuchen mußte. Diese Eiszeit, die wird sich wiederholen, in einer gewissen Weise anders gestaltet, und zwar wiederum so in fünf-, sechs-, siebentausend Jahren; sie wird nicht genau auf derselben Stelle der Erde sein, wie sie dazumal war, aber es wird wiederum eine Eiszeit geben.
Sehen Sie, man darf sich eben durchaus nicht vorstellen, daß sich alles so glatt entwickelt, sondern solche Unterbrechungen wie durch die Eiszeit, die finden schon statt! Und wenn man verstehen will, wie die Erde sich eigentlich entwickelt, so muß man eben sich sagen: Es finden fortdauernd solche Unterbrechungen der glatten Entwickelung statt. Nun, woher kommt denn so etwas? So etwas kommt davon her, daß die Erdoberfläche sich ja fortwährend hebt und senkt. Ja, wenn Sie auf den Berg hinaufgehen, der ja gar nicht einmal so besonders hoch zu liegen braucht, so finden Sie schon heute auch noch eine Eiszeit; es bleibt etwas Schnee und Eis oben. Nun ist es so, daß wenn der Berg heute so hoch ist, so ist hier Schnee und Eis. Wenn aber im Laufe der Zeit sich die Oberfläche der Erde so hebt, daß sie gerade so hoch ist als der Berg, so ist da erst recht Schnee und Eis. Auf der Oberfläche der Erde liegt dann Eis und Schnee. Und das findet statt, meine Herren. Es findet statt, daß sich die Oberfläche der Erde hebt und senkt. Und die Erde vor sechstausend Jahren war hoch in der Fläche, wo wir jetzt sind. Jetzt ist sie heruntergesunken, ist schon wieder im Aufsteigen, denn der tiefste Punkt war etwa im Jahr 1250. Das war der tiefste Punkt. Da war es hier in den Gegenden von einer Temperatur, die außerordentlich wohlig war, viel wärmer war, als die heutige ist. Nun ist es schon wiederum auf dem Rückgang und bewegt sich langsam hinauf, so daß nach fünf- bis sechstausend Jahren wiederum eine Art von Eiszeit da sein wird.
Daraus können Sie schon wissen, daß, wenn man von zehn zu zehn Jahren die Witterung beobachtet, sie nicht gleich bleibt; sie verändert sich fortwährend.
Nun aber wiederum, das ist eines, was die Witterung beeinflußt. Aber, meine Herren, bedenken Sie einmal, wenn, sagen wir, in einem bestimmten Jahre bei dieser Höhe der Erdenoberfläche über der Erde eine bestimmte Temperatur wäre, so daß das Wetter dadurch von der Wärmeseite aus so gelegen wäre, so ist ja noch etwas anderes bei der Erde der Fall. Sehen Sie, bei der Erde ist es so: Wenn ich hier die Erde auf-zeichne (es wird gezeichnet), so ist die Erde hier, wie man sagt, durch den Aquator warm. Oben und unten auf den Polen ist die Erde kalt. In der Mitte ist die Erde warm. Wenn die Leute nach Afrika oder
Indien reisen, so reisen sie in die Hitze hinein. Oben, auf dem Nordpol - und so ist es auch auf dem Südpol - reist man in die Kälte hinein. Sie haben ja die Polarfahrtenbeschreibungen gelesen.
Sie brauchen bloß zu beachten, wie es mit der Wärme- und Kälteverteilung in einem Zimmer ist, das wir anfangen einzuheizen: Wenn Sie anfangen ein Zimmer einzuheizen, so werden Sie bemerken, daß es anfangs nicht gleich warm wird; es dauert eine gewisse Zeit, bis das Zimmer warm wird. Wenn Sie aber eine Leiter nehmen würden und heraufsteigen würden, so würden Sie finden, daß es unten noch ganz kalt sein kann, und oben am Plafond ist es schon warm. Wovon rührt das her? Das rührt davon her, daß die Wärme, die warme Luft, jeder luftförmige, gasförmige erwärmte Körper hinaufsteigt, leichter wird. Alles, was kalte Luft ist, das hält sich unten, weil das schwerer ist; alle warme Luft steigt nach oben, weil sie leichter ist. Nun ist fortwährend die warme Luft hier in dieser Gegend (es wird gezeichnet) und die kalte Luft hier. Diese Wärme steigt fortwährend in die Höhe, so daß hier in der Mitte der Erde fortwährend die warme Luft aufsteigen will. Wenn sie aber oben ist, weht sie hinauf gegen den Nordpol, und es entstehen solche Winde, die von der Mitte der Erde nach dem Nordpol gehen, und die stellen dar hinaufgehende warme Luft. Die kalte Luft aber wiederum, die will sich erwärmen, geht in die leere Stelle, in die Mitte hinein: kalte Luft strömt herunter; so daß fortwährend vom Nordpol nach der Mitte der Erde kalte Luft strömt, und vom Aquator, von der Mitte der Erde nach dem Nordpol, warme Luft strömt. Man nennt das ja die Passatwinde, die sich in solchen Gegenden, wie die unsrigen sind, verfangen, nicht so bemerkbar sind, aber in anderen Gegenden eben durchaus bemerkbar sind.
Aber das ist nicht nur der Fall für die Luft, sondern auch das Meerwasser zeigt solche Strömungen von der Mitte der Erde nach dern Nordpol und wieder herunter. Das verteilt sich natürlich in der mannigfaltigsten Weise, aber es ist eben da.
Nun denken Sie einmal, wenn nun gerade eine Strömung, eine elektrische Strömung - elektrische Strömungen sind immer vorhanden im Weltenall, denn nicht nur wir bringen drahtlose elektrische Wellen auf der Erde zustande; da ahmen wir ja nur das nach, was im Weltenall
in irgendeiner Weise auch vorhanden ist -, wenn gerade eine solche Strömung da ist, sagen wir, in der Schweiz ist: In der Schweiz hat es eine bestimmte Kälte; geht aber eine solche Strömung so her, daß die Wärme hergetragen wird, so wird es etwas wärmer. Und so wird die Wärme durch Weltenströmungen wiederum verteilt. Das beeinflußt die Witterung.
Nun, denken Sie sich aber, daß wiederum solche Strömungen, elektrisch-magnetische Strömungen im Weltenall abhängig sind von den Sonnenflecken. Wenn die Sonne gerade hier ihre Flecken hat (es wird gezeichnet), so sind da die Strömungen - die Folge davon ist das Wetter. Es sind das ja ganz bedeutsame Einflüsse. Und so ist es einfach so, daß wir sagen können: In bezug auf die Verteilung der Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter, da ist eine gewisse Regelmäßigkeit im Weltenall. Das können wir im Kalender einteilen. Der Frühling beginnt zu einer bestimmten Zeit und so weiter. Das richtet sich nach den groben Verhältnissen unter den Himmelskörpern. Aber da sind auch wenige Einflüsse. Es sind ja nicht so viel Sterne da, die Einfluß haben; die meisten sind ja weit und haben nur auf das Allergeistigste auf der Welt einen Einfluß. Aber nun mit Bezug auf die Witterungsverhältnisse, meine Herren, da ist es so. Denken Sie sich einmal, Sie haben eine Scheibe, darauf sind Farben, Sie drehen die Scheibe; da können Sie, wenn Sie langsam drehen, noch alle Farben - sagen wir, es sind vier Farben darauf: rot, gelb, grün, blau - gut unterscheiden. Sie können schneller drehen: Es wird Ihnen schon schwerer, aber Sie können doch noch unterscheiden. Drehen Sie aber ganz schnell, dann schwimmt alles durcheinander; da können Sie nichts mehr unterscheiden. Aber es ist auch so, daß man sagen kann: Bei groben Erscheinungen wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, da kann man noch übersehen, von was es abhängt. Aber da sind so viele Dinge, von denen die Witterung abhängt, daß man sie nicht mehr überdenken kann, so daß man die Sache im Kalender in bezug auf die Witterung nicht mehr einschreiben kann, wie: Frühling, Sommer und so weiter - da wird es kompliziert, weil es sich eben verwirrt.
Aber auch da sind alte Volksanschauungen vorhanden. Man muß alte Volksanschauungen nicht so ohne weiteres abweisen; die beruhen
darauf, daß sich die Leute, als die Verhältnisse noch einfacher waren, wirklich viel mehr für die Sachen interessiert haben. Heute, wo wir uns höchstens vierundzwanzig Stunden lang für eine Sache so recht interessieren, weil nach vierundzwanzig Stunden wieder eine neue Zeitung kommt, und wir durch die neue Zeitung ein anderes Interesse kriegen, heute vergessen wir ja alles, was geschieht. Es ist ja so! Und außerdem, wie sind unsere Lebensverhältnisse kompliziert geworden; es ist ja alles schauderbar kompliziert. So war es nicht einmal bei unseren Großvätern, geschweige denn bei unseren Ururgroßvätern. Die saßen schon so in der Stube und hinterm Ofen, saßen zusammen und erzählten sich, erzählten sich aber auch von alten Zeiten und wußten, wie in alten Zeiten manchmal die Witterung war, weil sie sie zusammenhängend wußten mit den Gestirnen, und dadurch haben sie gesehen, wahrgenommen, daß doch eine gewisse Regelmäßigkeit in der Witterung liegt. Und sehen Sie, es gab ja unter diesen Urgroßvätern auch sogenannte «verflixte Kerle», wissen Sie - ich meine mit einem «verflixten Kerl» einen, der nicht ganz dumm ist, sondern der auch ein bißchen gescheiter ist als die anderen, der so etwas Gescheites hat -, es gab solche verflixten Kerle mit einer gewissen Gescheitheit. Ja, meine Herren, wenn man diesen verflixten Kerlen zuhören würde, dann würde man sie ganz interessant reden hören! Wollen wir einmal hören, wie so ein recht alt gewordener, verflixter Kerl zu seinem Ururenkel oder Urenkel gesagt hätte. Der hätte gesagt: Ja, sieh einmal, wenn du den Mond beobachtest - du weißt ja, der Mond, der hat auf die Witterung Einfluß. - Das haben die Leute also einfach gesehen. Sie wußten ganz gut, das Regenwasser ist besser zum Wäschewaschen als das gewöhnliche Wasser, das man aus dem Brunnen herholt. Deshalb haben sie die Eimer aufgestellt. Das hat meine Mutter auch noch gemacht: Eimer aufgestellt, Regenwasser gesammelt und zum Waschen das Regenwasser verwendet! Es ist eben ein anderes Wasser, das Regenwasser, hat eine gewisse Lebendigkeit in sich, nimmt auch die Waschbläue und anderes, was man braucht als Zusatz beim Waschen, viel mehr auf als das gewöhnliche Wasser. Und gar nicht so schlecht wäre, wenn wir das auch täten, denn mit dem harten Wasser waschen, das hat schon etwas Zerstörerisches für vieles, was Sie anziehen.
Also, meine Herren, das hat man früher gewußt; darüber hat man erst durch die Wissenschaft im 19. Jahrhundert andere Ansichten bekommen. Ich habe Ihnen einmal erzählt - ein Teil der Herren weiß es schon - von den zwei Professoren an der Leipziger Universität; der eine hieß Schleiden, der andere hieß Fechner. Fechner behauptete, weil er das beobachtet hatte, statistische Aufzeichnungen gemacht hatte:
Der Mond hat auf die Erde Einfluß, auf das Wetter der Erde Einfluß. Schleiden war der ganz Gescheite; der sagte: Das ist eine Dummheit, ein Aberglaube; das gibt es nicht. - Nun, wenn Professoren streiten, so kommt nicht viel dabei heraus; wenn andere Leute sich streiten, kommt meistens auch nicht viel dabei heraus! Aber nun waren die zwei Professoren verheiratet, und es gab auch eine Frau Professor Schleiden und eine Frau Professor Fechner. Und es war noch in jener Zeit, in der man in Leipzig das Regenwasser noch gesammelt hat zum Waschen der Wäsche. Da hat der Fechner zu seiner Frau gesagt: Nun ja, gut, wenn mein Kollege, der Schleiden, sagt, daß man bei Neumond ebensoviel Regenwasser kriegt wie bei Vollmond, da soll die Frau Professor Schleiden bei Neumond ihre Eimer herausstellen und Wasser sammeln, und du sammelst bei Vollmond, wo ich sage, daß du mehr Wasser kriegst! - Nun das hat die Frau Professor Schleiden gehört, diesen Vorschlag, und hat gesagt: Nein, da wird nichts draus, ich will meine Eimer bei Vollmond herausstellen, und die Frau Professor Fechner soll ihre Eimer bei Neumond herausstellen! - Sehen Sie, die Frauen haben anders entschieden, weil die das Wasser brauchten! Die Professoren können ruhig über das Wasser herumstreiten, aber die Frauen brauchen das Wasser.
Das wußte auch dieser Urgroßvater noch und wußte, daß der Urenkel das auch weiß, und sagte: Sieh einmal das an, der Mond beeinflußt das Wasser. Aber schau dir einmal an, wie das ist mit dem Mond:
Alle achtzehn, neunzehn Jahre wiederholt sich für den Mond alles, was es nur gibt für ihn.Wir haben zum Beispiel in einem bestimmten Jahr, an einem bestimmten Tag Sonnen- und an einem bestimmten Tag Mondenfinsternisse. Das wiederholt sich im Lauf von achtzehn, neunzehn Jahren regelmäßig. So ist der Kreislauf. Und so wiederholen sich alle Erscheinungen nach der Stellung der Sterne im Weltenall. Warum
könnte nicht auch - so sagte er - sich alles in der Witterung wiederholen, da es doch vom Mond abhängt? Es muß also nach achtzehn, neunzehn Jahren eine Ähnlichkeit in der Witterung mit derjenigen vor achtzehn, neunzehn Jahren sein.
Und wiederum, sehen Sie, wenn alles sich wiederholt, so schauten diese Leute dann auf andere Wiederholungen, und verzeichneten im Kalender gewisse Witterungen in früheren Jahren, vor achtzehn, neunzehn Jahren, und erwarteten, daß ähnliche Witterungen kommen wiederum nach achtzehn, neunzehn Jahren. Man hat also nur den Kalender den Hundertjährigen Kalender genannt, weil hundert so eine Zahl ist, die man leicht behalten kann; aber es waren andere Zahlen eingeschrieben, nach denen man die Witterung vorausgesagt hat. - Nur natürlich, so ganz zu stimmen braucht ja das nicht, weil wiederum die Verhältnisse kompliziert sind; aber im praktischen Leben hat das doch den Leuten Dienste getan, denn sie haben sich danach gerichtet und haben dadurch in der Tat bessere Fruchtbarkeitsverhältnisse für die Erde bekommen. So daß man sagen kann: Aus solchen Beobachtungen heraus kann man schon für die Fruchtbarkeitsverhältnisse wiederum etwas tun. - Aber diese Witterungsverhältnisse haben eben durchaus wiederum eine Abhängigkeit von Sonne und Mond, denn diese Wiederholungen der Mondesstellungen, die beziehen sich eben auf Sonne und Mond.
Für andere Sterne in ihren Verhältnissen sind andere Wiederholungen da. Eine interessante Wiederholung ist ja diejenige, die sich auf die Venus bezieht, auf den Morgen- und Abendstern. Nicht wahr, wenn da die Sonne ist und da die Erde (es wird gezeichnet), so ist zwischen Sonne und Erde die Venus, die sich bewegt. Wenn die Venus da steht, so sieht man so heraus; wenn die Venus da steht, sieht man so heraus; wenn die Venus aber da steht, bedeckt die Venus die Sonne. Es ist von der Venus, die natürlich nur viel kleiner ausschaut wie der Mond, wenn sie auch größer ist, die Sonnenscheibe ein Stückchen bedeckt. Man nennt das einen Venusdurchgang. Diese Venusdurchgänge sind deshalb sehr interessant, weil sie eigentlich nur ungefähr alle hundert Jahre einmal stattfinden, und weil, wenn so die Venus vor der Sonne vorbeigeht, also vor der Sonne durchgeht, man da sehr wichtige Sachen
beobachten kann. Man kann beobachten, wie sich ringsherum der Lichtschein der Sonne ausnimmt, wenn die Venus davorsteht. Das verursacht große Veränderungen. Das ist sehr interessant. Diese Venus-durchgänge, die werden beschrieben; und da sie nur ungefähr alle hundert Jahre stattfinden, kann man sagen: sie gehören zu demjenigen, wo die Wissenschaft sagen müßte, sie glaube auch andere Sachen als die, die sie gesehen habe. Denn wenn die Wissenschafter sagen, sie glauben nur diejenigen Dinge, die sie gesehen haben, so könnte niemals ein Astronom, der im Jahre 1890 geboren ist und heute vorträgt, über einen Venusdurchgang sprechen, denn den kann er in der Zeit gar nicht wahrgenommen haben, und vermutlich wird er früher sterben, bevor der nächste Venusdurchgang ist, der eben wahrscheinlich im Jahre 2004 stattfinden wird. Da muß auch der Wissenschafter glauben, was er nicht sieht! Das kann er nicht wahrnehmen.
Aber wiederum haben wir da, weil ja die Venus jetzt die Sonne beeinflußt, weil sie das Licht abhält, einen Einfluß auf die Witterungsverhältnisse - einen Einfluß, der ungefähr nur alle hundert Jahre stattfindet. Diese Venusdurchgänge, die hat man gerade in alten Zeiten außerordentlich interessant gefunden.
Und da ist etwas sehr Merkwürdiges. Sehen Sie, meine Herren, wenn Sie den Mond anschauen: Sie finden den Mond auf dem Himmel stehen, wenn Vollmond ist, als eine Scheibe, sonst als einen Kipfel, eine Halb-scheibe und so weiter - da glänzt er in seinem Licht. Dann gibt es aber Neumond. Wenn Sie aber ein bißchen geübte Augen haben - ich weiß nicht, ob Sie das wissen -, können Sie auch den Neumond sehen; namentlich können Sie das Stückchen Mond sehen, wenn dahier zunehmender Mond ist. So kann man schon, wenn man genauer hinschaut, auch das andere vom Mond sehen, so schwarz-bläulich. Und wie gesagt, wenn man geübte Augen hat, kann man auch bei Neumond eine so schwarz-bläuliche Scheibe noch sehen; man gibt nur nicht acht darauf, man kann sie aber sehen. Ja, woher kommt das, daß das überhaupt sichtbar wird beim Mond? Das kommt davon her, weil dieses Stück Mond, das sonst finster ist, noch von der Erde etwas beleuchtet wird. Der Mond ist ja ungefähr fünfzigtausend Meilen von der Erde entfernt, wird nicht eben von der Erde
beleuchtet; aber dieses kleine Licht, das von der Erde auf den Mond hinstrahlt, macht uns dieses Stück Mond sichtbar. Aber bis zur Venus strahlt gar kein Licht von der Erde. Die Venus ist angewiesen auf das Sonnenlicht; es strahlt kein Licht auf sie von der Erde. Nun ist die Venus der Morgen- und Abendstern. Der ist ja auch so, daß er sich so verändert wie der Mond, nur nicht in derselben Zeit. Es gibt Zeiten, in denen die Venus so ausschaut (es wird gezeichnet), so, und wieder so, dann wiederum so. Die Venus hat auch diese Veränderung, man sieht das nur nicht; die Venus ist weit weg, und man sieht eben nur einen glänzenden Stern. Man muß sie abblenden und muß sie dann mit dem Fernrohr anschauen, dann sieht man, daß die Venus auch sich in dieser Weise verändert wie der Mond. Da aber, bei der Venus, ist es so, daß nun, trotzdem sie von der Erde nicht mehr beleuchtet werden kann, dieses Stück außerdem in einem matten, bläulichen Licht noch immer sichtbar ist. Das Sonnenlicht, das sieht man an der Venus-phase, wie man sagt, an dern «Kipfel» oben - nicht der ganzen Venus, aber da, wo die Venus nicht von der Sonne beschienen ist, da sieht man ein bläuliches Licht.
Nun, meine Herren, es gibt zum Beispiel gewisse Steine, die Bologneser Leuchtsteine, die eine Bariumverbindung - Barium ist ein metallischer Stoff - enthalten. Wenn Sie diese Steine eine Zeitlang beleuchten, also Licht auffallen lassen, dann das Zimmer verfinstern, dann sehen Sie, wie der Stein noch ein bläuliches Licht zurückwirft. Man sagt, der Stein, nachdem er beleuchtet ist, phosphoresziert. Er hat das Licht gewissermaßen auch bekommen, etwas gefressen von dem Licht, und jetzt speit er es wiederum von sich, wenn es finster ist. Er tut das natürlich auch, wenn es hell ist; er nimmt immer etwas auf, gibt immer etwas zurück. Weil er nicht viel aufnehmen kann, so ist es natürlich auch wenig, was er zurückgibt, man sieht es daher nicht, wenn es hell ist, geradeso wie man ein schwaches Kerzenlicht nicht wahrnimmt, wenn Sonnenlicht da ist; aber wenn man das Zimmer verfinstert, dann phosphoresziert der Stein, dann sieht man das Licht, das von ihm ausgeht.
Nun, sehen Sie, meine Herren, wenn Sie dieses Licht am Stein beobachten, so ist es Ihnen ja erklärlich, woher das Licht der Venus
kommt. Die Venus wird auf der anderen Seite, wenn sie hier nicht be-schienen wird, von der Sonne beschienen, sie frißt also gleichsam das Sonnenlicht auf, und wenn Sie sie dann anschauen in der finsteren Nacht, wo sie nicht beschienen ist, da speit sie es aus, phosphoresziert. In der Zeit, als der Mensch alles besser gesehen hat als jetzt - die Menschen haben ja alles besser gesehen, bessere Augen gehabt in früheren Zeiten -, hat er das auch gesehen. Sie wissen, die Brillen sind ja erst im 16. Jahrhundert aufgekommen; sie wären sicher früher aufgekommen, wenn der Mensch sie gebraucht hätte! Die Erfindungen und Entdeckungen kommen immer dann, wenn die Menschen sie brauchen. Die Menschen haben schon bessere Augen gehabt, und sie haben dieses Phosphoreszieren der Venus gesehen. Aber außerdem haben sie die Veränderung, die bewirkt wird, wenn die phosphoreszierende Venus da in die Sonne hereinkommt, auch wahrgenommen. Und daraus haben sie in ganz alten Zeiten den Schluß gezogen, daß, weil da das Sonnenlicht einen Einfluß von der Venus hat, dieser selbe Einfluß nach ungefähr hundert Jahren wieder da ist; dann wird da auch eine ähnliche Witterung sein. So daß in einer solchen Gegend, wo man den Venusdurchgang sehen wird - Sie wissen ja, Sonnenfinsternisse sieht man auch nicht in allen Gegenden, sondern nur in gewissen Gegenden -, wieder eine ähnliche Witterung sein wird in hundert Jahren. Sehen Sie, daraus bildeten sie dann in gewissen Jahren einen Hundertjährigen Kalender. Dann haben die Leute, die nichts mehr verstanden haben von der Sache, in jedem Jahr einen Hundertjährigen Kalender gemacht. Dann finden sie in jedem Jahr: der Hundertjährige Kalender sagt das. Das stimmt nicht! Das geht dann nach der Lebensregel: Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich's Wetter oder's bleibt, wie's ist. - Aber darauf beruht die Sache überhaupt, daß ursprünglich ganz richtige Dinge da waren: Die Leute haben gesehen, wenn die Venus durch die Sonne durchgeht, dann bewirkt das eine Witterung, die sich dann irgendwo wiederholt nach ungefähr hundert Jahren.
Und weil das so ist bei der Witterung, daß das das ganze Jahr sich gegenseitig beeinflußt, so ist das nicht nur während der Tage, während derer die Venus durchgeht, sondern es ist ausgedehnt durch längere Zeit. Und so sehen Sie: nach dem, was ich Ihnen schon gesagt habe,
müßte man eigentlich ja nachdenken darüber, wenn man die Gesetzmäßigkeit der Witterung wissen wollte für irgendeine Woche oder einen Tag: Vor wieviel Jahren war ein Venusdurchgang? Wie steht jetzt der Mond? Vor wieviel Jahren war eine Sonnenfinsternis, dieselbe wie jetzt? - Das sind aber nur wenige Dinge, die ich Ihnen gesagt habe. Man muß wissen: Wie werden durch den Magnetismus oder die Elektrizität die Passatwinde vertragen? Alle diese Fragen müßte man beantworten, wenn man die Regelmäßigkeit der Witterung bestimmen wollte. Ja, meine Herren, das ist etwas, wo man eben ins Unendliche hineinkommt! Daher wird man es aufgeben, darüber irgendwie etwas Bestimmtes zu sagen, welche Witterung unbedingt eintreten müßte. So regelmäßig alle Erscheinungen sind, die die Astronomie behandelt - Astronomie ist die Lehre, welche den Himmelseinfluß der Sterne behandelt -, so wenig eigentlich ist die Wissenschaft bestimmt, die die gegenseitigen Verhältnisse der Einflüsse auf die Witterung behandelt, die sogenannte Meteorologie. In der Meteorologie, da werden Sie finden, wenn Sie heute ein Buch in die Hand nehmen, das etwas von Meteorologie enthält: Donnerwetter, da kann ich gar nichts daraus lernen, denn eigentlich behauptet jeder etwas anderes. - Das ist bei der Astronomie nicht der Fall.
Damit habe ich Ihnen wohl einen Uberblick gegeben über das, wie man über die Gesetzmäßigkeit von Wind und Wetter und so weiter sprechen kann. Dazu kommt noch dieses, daß auf die Witterung ungeheuer starken Einfluß haben die Kräfte, die in der Atmosphäre selber entstehen. Sie brauchen nur an den Sommer zu denken, an den heißen Sommer, wo die Blitze aus den Wolken kommen und die Donner rollen: da haben Sie wiederum Einflüsse auf die Witterung ausgedrückt, die aus der unmittelbaren Erdennähe herkommen. Uber diese Geschichte hat ja die heutige Wissenschaft eine merkwürdige Ansicht. Sie sagt: Ja, das ist die Elektrizität, die da bewirkt, daß der Blitz aus der Wolke schlägt. - Nun, Sie wissen ja vielleicht, daß man in der Schule anfängt, die Elektrizität zu erklären, indem man eine Glas-stange nimmt und mit einem Tuchlappen reibt, der etwas mit Amalgam geschmiert ist. Man kann dann finden, daß die Glasstange kleine Papierschnitzel anzieht und so weiter; man kann soweit reiben, daß
dann auch Funken entstehen und so weiter. Man macht solche Versuche in der Schule mit der Elektrizität. Aber, meine Herren, es ist notwendig, wenn man solche Versuche mit der Elektrizität macht, daß man alles sorgfältig abwischt, denn die Gegenstände, die elektrisch werden sollen, die dürfen gar nicht irgendwie feucht oder naß sein, müssen ganz trocken sein, warm-trocken sein, sonst kriegt man nichts heraus aus dem Glas oder Siegellack. Daraus würden Sie wissen können: Die Elektrizität wird vertrieben durch Wasser und Flüssigkeit. Das weiß jeder, wissen natürlich auch die Gelehrten, denn die machen es ja. Trotzdem behaupten sie, daß der Blitz aus den Wolken herauskommt, und die sind doch ganz gewiß naß!
Soll denn wirklich der Blitz aus den Wolken herauskommen, dann müßte man ja zuerst die Wolken mit einem riesigen Handtuch abreiben und alles trocken machen, wenn der Blitz aus den Wolken kommen soll! Aber man sagt es so einfach: Man reibe eine Siegellackstange, dann kommt Elektrizität heraus: die Wolken reiben sich auch aneinander, es kommt Elektrizität heraus. Wenn aber die Siegellackstange ein bißchen naß ist, kommt keine Elektrizität heraus. Nun soll aus den Wolken, die ja nur naß sind, Elektrizität kommen! Daraus sehen Sie aber, was für Dinge Sie eigentlich heute lernen, die ganz innerlich unsinnig sind. Die Sache ist eben diese, sehen Sie: Wenn Sie Luft haben, können Sie die warm machen, sie wird dann immer heißer und heißer. Nun denken Sie sich einmal, Sie haben Luft eingeschlossen in einem Kessel. Man kann sagen: Diese Luft wird dichter, denn je heißer und heißer Sie sie machen, desto mehr drückt sie auf die Kesselwände, immer mehr und mehr drückt sie auf die Kesselwände. Je heißer Sie sie machen, desto mehr kommt es an den Punkt, wo unter Umständen, wenn die Kesselwände nicht dick genug sind, die heiße Luft die Kesselwände auseinandersprengt. Warum zerspringt denn solch ein Ball meistens, den die Kinder zum Spielen haben? Weil die Luft heraus-geht. Ja nun, meine Herren, daraus können Sie sehen, daß die Luft, wenn sie warm wird, durch das Heißerwerden die Tendenz bekommt, die Kraft bekommt, auseinanderzugehen. So bleibt die Geschichte in der Nähe der Erde. In der Nähe der Erde bekommt die Luft so eine Kraft, auseinanderzugehen. Geht man aber in recht hohe Schichten hinauf
und wird in recht hohen Schichten die Luft durch irgend etwas sehr, sehr warm - was zum Beispiel auch durch irgendwelche Einflüsse im Winter geschehen kann, wenn sie zuerst irgendwo sehr stark zusammengedrückt wird -, dann kriegt sie furchtbare Hitze in sich. Nicht wahr, wenn Sie einen Kessel haben und dadrinnen Luft (es wird gezeichnet), dann drückt es nach allen Seiten. Wenn Sie aber hier eine warme Luftschicht haben, und hier weht, durch irgend etwas bewirkt, ein Wind vorbei, so daß er die Luft hier wegfängt - hier ist irgendwie eine dickere Luft, weil es sich zusammenschoppt -, dann kann es nicht hier hinaus, sondern geht hier herüber: die wärmende Hitze der Blitze strömt nach der Seite, wo es am leichtesten ist. Die Blitze, das ist die Hitze, die die Luft in sich selber erzeugt und die dahin geht, wo gewissermaßen dadurch, daß die Luft dort am dünnsten ist, eine Art Loch ist in der umgebenden Luft. Man muß sagen: Der Blitz entsteht nicht durch Elektrizität, sondern der Blitz entsteht dadurch, daß die Luft ihre eigene Hitze ausleert.
Aber nun dadurch, daß diese furchtbar starke Bewegung geschieht, dadurch werden wiederum die immerfort in der Luft, namentlich in der warmen Luft vorhandenen elektrischen Strömungen erregt. Der Blitz erregt erst die Elektrizität. Er ist noch keine Elektrizität.
Und wiederum sehen Sie da, daß überall in der Luft eine andere innere Wärmeverteilung ist. Das beeinflußt wiederum die Witterung. Das sind Witterungseinflüsse, die von der Nähe der Erde kommen, die in der Nähe der Erde selber sich abspielen.
Aus alledem sehen Sie, wie viele Dinge da sind, die die Witterung beeinflussen, und wie heute - wie Sie sehen, hat man ja über den Blitz ganz verdrehte Ansichten, wie ich Ihnen gesagt habe - über alle diese Einflüsse eben noch durchaus keine richtigen Ansichten da sind. In dieser Beziehung muß wirklich, weil die Geisteswissenschaft, die Anthroposophie, eine größere Übersicht erreicht, das Denken überhaupt beweglicher macht, ein Umschwung eintreten.
Denn, sehen Sie - natürlich kann man das nicht im heutigen Seziersaal nachweisen -, wenn man eben mit den Mitteln der Geisteswissenschaft forscht, so findet man, daß die Gehirne der Menschen in den letzten Jahrhunderten furchtbar viel steifer geworden sind, als
sie vorher waren, furchtbar viel steifer. Denn man findet zum Beispiel, sagen wir, die alten Ägypter haben ganz bestimmte Dinge gedacht, die ihnen gerade so sicher waren wie uns unsere Dinge. Aber der Mensch kann sie heute, wenn er richtig Obacht gibt, im Winter weniger verstehen als im Sommer. Man gibt nur nicht acht auf solche Dinge; man gibt wirklich nicht acht auf solche Dinge. Und würde man in manchen Dingen sich recht richten können nach dem, was eigentlich gesetzmäßig in der Welt drinnen ist, dann würde man sich anders einrichten. Man würde zum Beispiel selbst in der Schule - was in gewissem Sinne schon in der Waldorfschule beobachtet wird - in den Winter andere Gegenstände verlegen als in den Sommer. Nicht nur, daß man da Botanik nimmt, weil ja die Pflanzen da sind, sondern manches, was leichter zu verstehen ist, sollte man in den Winter verlegen, manches was schwerer zu verstehen ist, sollte man in den Frühling und Herbst verlegen, weil das Verstehen schon auch von diesen Dingen abhängig ist. Das kommt davon her, weil wir härtere Gehirne gekriegt haben und die früheren Menschen weichere Gehirne gehabt haben. Was wir nur im Sommer denken können, haben die Ägypter im ganzen Jahre denken können. - Ja, alle diese Dinge gibt es. Auf alle diese Dinge kommt man, wenn man eben Jahreszusammenhänge, Witterungszusammenhänge und so weiter beobachtet.
Ist vielleicht jemandem noch etwas nicht klar? Sind Sie befriedigt über die Sache? Ich habe es natürlich etwas ausführlicher beantwortet. Nicht wahr, die Welt ist ein Ganzes, ein Wesen, und man kommt dann natürlich, wenn man eines erklären will, in die andere Sache selbstverständlich hinein, weil alles voneinander abhängt.
Frage: Herr Burle sagt, er möchte etwas darüber fragen, ob daran etwas sei - seine Kollegen werden wahrscheinlich lachen, er habe vor zwei, drei Jahren schon einmal davon gesprochen -, daß man sagt, wenn man Kaffee hat, und tut Zucker in den Kaffee, der sich dann auflöst so, daß es schön in der Mitte bleibt:
Es wird schönes Wetter - oder umgekehrt, wenn er sich schlecht auflöst, zerfließt:
Es wird schlechtes Wetter - und so ähnlich?
Dr. Steiner: Ja, nicht wahr, dieses Experiment habe ich in der Weise noch nicht gemacht. Ich weiß es also nicht, ob da etwas dahintersteckt oder nicht. Aber es könnte schon sein, daß es etwas zu bedeuten
hat, wenn sich der Zucker gleichmäßig oder weniger gleichmäßig auflöst - wenn es überhaupt etwas zu bedeuten hat. Aber nehmer wir an, es hätte etwas zu bedeuten; ich will unter dieser Voraussetzung: Es hat etwas zu bedeuten - hypothetisch reden.
Nehmen wir aber etwas anderes an, das etwas an sich hat, denn das habe ich genügend beobachtet: Das ist die Ergründung des nächsten kommenden Wetters durch die Laubfrösche, die grünen Laubfrösche. Das habe ich genügend gemacht: Kleine Leitern gemacht und den Laubfrosch beobachtet, ob er herauf oder herunter geht. Da finden Sie, daß der Laubfrosch in der Tat eine sehr feine Empfindung dafür hat, was da für Wetter kommt. Das braucht Sie nicht zu verwundern, denn in gewissen Gegenden kommt manchmal folgendes vor: Die Menschen müssen beobachten, wie plötzlich die Tiere in den Ställen unruhig werden, fort wollen; und diejenigen, die fort können, die freigebundenen Tiere, machen sich schnell davon. Die Menschen bleiben zurück: es kommt ein Erdbeben! Die Tiere haben das voraus gewußt, daß sich schon früher etwas in der Natur vollzieht. Es verändert sich alles in der Natur schon vorher. Die Menschen nehmen das durch ihre Nasen und anderen groben Sinne nicht wahr; die Tiere nehmen es wahr. Ich habe das schon einmal ausgeführt. So hat natürlich auch der Laubfrosch eine bestimmte Witterung für dasjenige, was da kommt. Man nennt das sogar «Witterung», was man da riecht, weil es sich auf das Zukünftige bezieht.
Nun sehen Sie, im Menschen sind auch recht viele Dinge, von denen er gar nichts weiß. Ja, meine Herren, das ist schon so: Im Menschen sind recht viele Dinge, von denen man nichts weiß! Man beobachtet es einfach nicht. Wenn es ein schöner Sommertag ist, dann sind wir unter Umständen, wenn wir aufgestanden sind und zum Fenster hin-ausschauen, ganz anders aufgelegt, als wenn es furchtbar wettert. Wir beobachten nicht, daß das bis in unsere Fingerspitzen hineingeht. Und das, was die Tiere können, können wir schon auch; wir bringen es uns nur nicht zum Bewußtsein.
Also denken Sie einmal, Herr Burle, wenn die Sache so wäre, daß Sie, nicht irgendwo anders, aber in dem Feingefühl Ihrer Fingerspitzen, wovon Sie nichts wissen, wittern, so wie der Laubfrosch, die kommende
Witterung, dann tun Sie instinktiv an dem Tage, wo Sie durch eine günstige Witterung besser aufgelegt sind, den Zucker mit einer größeren Kraft in den Kaffee hinein - am anderen Tag weniger. Also es braucht nicht abzuhängen vom Kaffee und Zucker, sondern von Ihrer Kraft, mit der Sie ihn hineinwerfen. Aber diese Kraft, die ich jetzt meine, die ist ja nicht diese, daß Sie stark oder schwach bewußt hineinwerfen, sondern die ist in Ihren Fingerspitzen. In Ihren Fingerspitzen liegt das eben so, daß Sie, wenn günstige Witterung kommt, anderes in Ihren Fingerspitzen haben, als an einem anderen Tag, wo trübes Wetter kommt. Das hängt nicht ab von der Kraft, wie stark oder schwach Sie hineinwerfen, sondern von dem, wie in Ihren Fingerspitzen miterlebt wird die Witterung. Davon hängt es ab, nicht von dem, wie Sie mit Ihrem Bewußtsein hineinwerfen, sondern wie Sie in Ihren Finger-spitzen das haben! Das ist ja eine etwas andere Kraft, eine andere Bewegung.
Denn, sehen Sie, nehmen Sie einmal die Sache so: Da sitzt eine Gesellschaft, sie setzt sich um einen Tisch herum; man macht zunächst irgend etwas Sentimentales, singt ein heiliges Lied, bringt die Gesellschaft in Stimmung. Dann fangen - es ist eine feine, nicht eine grobewendung -, dann fangen dadrinnen Schwingungen an. Womöglich kommt dann Musik. Weiter schwingt es; dann fangen die Leute an und geben um den Tisch alle diese feinen Erzitterungen an den Tisch weiter. Das summiert sich und der Tisch fängt an zu tanzen. Es ist die spiritistische Sitzung zustandegekommen durch diese kleinen, durch Musik und Gesang erregten Bewegungen. So verursacht schon auch die Witterung feinere Bewegungen. Von diesen feineren Bewegungen kann das wieder beeinflußt sein, was da stattfindet - ich sage es nur hypothetisch; ich kann nicht sagen, daß das absolut stimmt. Aber wahrscheinlicher ist es, daß da dasjenige, was der Mensch selber ahnt über die Witterung, sich ausdrückt, als daß das auf den Zucker einen besonderen Eindruck gemacht hat, was eben nicht gerade sehr wahrscheinlich ist; ich sage es ja selbst nur als eine Hypothese. Aber derjenige, der auf dem Standpunkt der Geisteswissenschaft steht, der muß unbedingt eine solche Erscheinung solange abweisen, bis er den striktesten Beweis hat. Sehen Sie, wenn ich Ihnen leichten Herzens erzählen
würde über die Dinge, die ich Ihnen hier erzähle, so brauchten Sie mir eigentlich gar nichts zu glauben. Nur dadurch können Sie mir glauben, daß Sie wissen: Solange die Dinge nicht bewiesen sind, werden sie nicht in der Geisteswissenschaft aufgenommen. So kann ich die Geschichte mit dem Kaffee auch dann nur in die Geisteswissenschaft aufnehmen, wenn sie wirklich bewiesen ist. Vorher kann man nur sagen, daß man zum Beispiel etwas weiß von den feinen Wellen-schwingungen der Nerven, die ja auch die Ursache sind, daß die Tiere die Wirkung vorauswissen - auch der Laubfrosch, denn der kommt in Erzitterung; und wenn er in Erzitterung kommt, dann werden Sie auch sehen, wie die Blätter, auf denen er sitzt, anfangen zu zittern. Und so kann das auch - ich sage nicht, daß es so ist, aber es könnte - viel wahrscheinlicher davon abhängen, daß der Kaffee anders zu erzittern anfängt, wenn schlechte Witterung kommt, als wenn bessere Witterung kommt, je nachdem.
Das nächste Mal dann am nächsten Mittwoch. Aber ich denke schon, daß ich dann regelmäßig wieder die Stunden einhalten kann.
ZWÖLFTER VORTRAG Dornach, 18. September 1924
Nun, meine Herren, vielleicht hat heute einer von Ihnen eine Frage?
Frage: Warum kommt der Blitz nicht gerade, sondern im Zickzack? Müßte er nicht in einer geraden Linie kommen?
Dr. Steiner: Also der Herr redet folgendes: er findet, daß der Blitz, wenn er sich aus der Luft herauslöst - wie ich es das letzte Mal beschrieben habe -, dann in Form einer geraden Linie kommen müßte. Aber nun kommt der Blitz zickzackförmig. Und das muß man auch erklären, das kann man auch erklären.
Fassen wir noch einmal auf, wie ich neulich erklärt habe, daß der Blitz eigentlich entsteht. Ich sagte Ihnen: Der Blitz ist eigentlich dasjenige, was herauskommt aus der übererwärmten Luft, aus dem über-erwärmten Weltenall, also aus dem übererwärmten Weltengas. Es kann, sagte ich, keine Rede davon sein, daß der Blitz etwa durch Reibung der Wolken entsteht, weil die Wolken selbstverständlich naß sind, und wenn man die kleinen Blitze mit den Apparaten in der Stube erzeugen will, muß man alles erst trocken abwischen. Also man muß gerade vermeiden alles Wäßrige. Es darf also nicht angenommen werden, daß der Blitz eine wirkliche elektrische Erscheinung ist, die aus dem Reiben eines Trockenen kommen würde. Man weiß, wenn man Glas oder Siegellack reibt, so entsteht Elektrizität, und so denkt man, wenn sich die Wolken reiben, nun ja, da entsteht halt auch Elektrizität. So ist es nicht, sondern infolge des inneren Überhitztseins des Weltengases kommt diese Wärme, die in dem Weltengase lebt, so heraus, wie ich es Ihnen gesagt habe. Dadurch, daß nach irgendeiner Seite hin die Luft weniger drückt, geht nach dieser Seite hin die Strahlung der überhitzten Kraft, und es kommt der Blitz zustande. Nun stellen wir uns also vor, wir haben das irgendwo, und infolge der viel überhitzten, also nicht Wolken, sondern Weltengase (es wird gezeichnet), strahlt der Blitz heraus. Und es ist ganz richtig: er müßte jetzt geradlinig strahlen.
Aber sehen Sie, die Sache ist diese. Sie müssen sich vorstellen: Wenn
irgendwo eine solche Ansammlung von Hitze ist, so ist sie gewöhnlich nicht allein, sondern es sind in der Nähe ebensolche Hitzeansammlungen. Und zwar stellt sich heraus, daß gerade, wenn, sagen wir, hier die Erde ist und man guckt da hinauf, und da ist ein Anfang eines Blitzes, wo solch eine Wärmeansammlung ist, so sind in der Nähe auch solche Wärmeansammlungen; und wir haben es damit zu tun, daß wir nicht an einer einzelnen Stelle diese Wärmeansammlungen haben. Sie können sich ja denken, daß diese Wärmeansammlungen mit der Sonne, die da einstrahlt, zusammenhängen. Nun sind auf dem ganzen Wege solche Wärmeansammlungen, und während der Blitz da herausstrahlt fängt er in seinem Lauf diese anderen Wärmeausstrahlungen ab. Dadurch strahlt das so herüber, und so weiter (es wird gezeichnet). Er nimmt alle anderen Ausstrahlungen mit, und dadurch bekommt der Blitz scheinbar diese Zickzackform; in Wirklichkeit geht er ganz unregelmäßig. Und je weiter er herunterkommt, desto gradliniger geht er ja. Da sind dann nicht mehr diese Wärmeansammlungen; die sind mehr oben. So daß also der Zickzackblitz dadurch entsteht, daß er nicht nur von einem Orte ausgeht, sondern von da, wo stärkste Wärme-anhäufungen sind, ausgeht zwar und die anderen dann mitschleppt auf seinem Wege. Das ist geradeso, wie wenn Sie jetzt da einen Bekannten treffen und nehmen ihn mit; die zwei nehmen wieder einen mit, und so weiter. Das ist die Geschichte.
Nun, meine Herren, vielleicht hat jemand noch eine andere Frage?
Frage: Kann man etwas darüber hören, wie die Vulkane, die feuerspeienden Berge entstehen?
Dr. Steiner: Das ist eine Frage, die nicht in so ganz kurzer Zeit zu beantworten ist. Ich will Sie dazu führen, daß Sie eine Antwort auf die Frage kriegen. Denn, sehen Sie, Sie können zwar heute, wenn Sie in den Büchern lesen, überall allerlei Ansichten finden, wie feuerspeiende Berge entstehen; aber wenn Sie wieder in Büchern lesen, die etwas weiter in der Zeit zurückliegen, älter sind, finden Sie andere Ansichten darüber, in älterer Zeit wieder andere. Und so haben sich die Ansichten, weil man niemals eingegangen ist auf die wirkliche Erdenentstehung, im Laufe der Zeit geändert. Und im Grunde genommen kann
sich kein Mensch eine rechte Vorstellung davon machen, wie diese feuerspeienden Berge entstehen.
Sehen Sie, meine Herren, da muß man sehr weit zurückgehen, wenn man das verstehen will, denn man kann nicht so ohne weiteres begreifen, wie es denn eigentlich kommt, daß an gewissen Stellen der Erde feuerflüssige Massen herauskommen. Und man wird sich nur eine Vorstellung davon machen können, wenn man wirklich nicht glaubt, daß ursprünglich die Erde ein Gasball war, der immer fester und fester geworden ist. Daß im Inneren Feuer sei und daß dieses Feuer durch irgendwelche Ursachen da oder dort einmal herauskomme, das ist eine bequeme Vorstellung. Auf die Weise bekommt man über die Sache eigentlich nichts heraus.
Aber ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Das ist jetzt lange her, mehr als vierzig Jahre; da machten wir im geologischen Kabinett des längst verstorbenen Geologen Hochstetter einen bestimmVersuch. Man erzeugte eine Substanz, die etwas Schwefel enthielt, noch einige andere Substanzen, und die behandelte man nicht so, daß man sie zusammenkittete, sondern man behandelte sie so, sehen Sie: Man hatte hier ein Stückchen von dieser Substanz, hier ein Stückchen von dieser, hier von dieser und so weiter, und man spritzte diese Substanz immer nach einem bestimmten Punkte hin. Auf diese Weise entstand hier eine kleine Kugel mit allerlei Bergen, die kurioserweise sehr ähnlich war demjenigen, was man durchs Fernrohr als Mond sieht. Also es ist tatsächlich dazumal dieses Experiment gemacht worden im geologischen Kabinett von Hochstetter in Wien, daß man einen kleinen Mond erzeugen konnte. Dasjenige, was man gewöhnlich mit dem Fernrohr als Mondoberfläche sieht, das war ganz wunderschön herausgekommen, und die Geschichte schaute aus wie ein kleiner Mond. Man konnte sich also zuerst die Vorstellung bilden, daß solch ein Welten-körper gar nicht so entsteht, daß er anfangs als Gas da ist, sondern daß er eigentlich aus dem Weltenraum zusammengespritzt wird. Und anders können wir auch unsere Erde nicht erklären als dadurch, daß sie aus dem Weltenraum zusammengespritzt ist.
Nun will ich Ihnen im Zusammenhang damit etwas erklären, was heute wenig besprochen wird, was aber doch richtig ist. Nicht wahr,
Sie hören überall beschreiben, daß die Erde eine Kugel sei und sie sich als Kugel gebildet hätte. Ja, aber eigentlich ist es nicht wahr, daß die Erde eine Kugel ist. Ich will Ihnen jetzt einmal erklären, wie die Erde eigentlich in Wirklichkeit ist. Das ist nur eine Phantasie, daß die Erde eine Kugel ist. Stellen wir uns einmal die Gestalt, die eigentlich die Erde hat, ganz regelmäßig vor, da kommen wir auf einen Körper, den man in der Wissenschaft Tetraeder nennt. Ich will ihn aufzeichnen, kann es natürlich nur aus der Perspektive machen. Ein Tetraeder schaut so aus:
#Bild s. 197
Sehen Sie, da sind ein, zwei, drei Dreiecke, und das, was vorne ist, ist das vierte Dreieck. Das steht auf einem Dreieck. Können Sie sich das vorstellen? Ein Dreieck ist unten, und da dran sind drei andere Dreiecke, und das bildet solch eine kleine Pyramide. Also wir stellen uns solch ein Tetraeder vor, und wir müssen uns klar darüber sein, daß vier Dreiecke zusammengestoßen sind. Auf einem Dreieck müssen wir das Tetraeder aufstellen, und die drei anderen Dreiecke ragen pyramidenförmig in die Höhe. Das ist ein ganz regelmäßiger Körper.
Nun denken Sie sich aber: ich buchte die Flächen dieser Dreiecke etwas aus, so wird die Geschichte ein bißchen anders. Da wird die Geschichte so: Da steht sie jetzt darauf, und das ist rund, aber doch noch frei. Aber die Seiten vom Dreieck, die früher gerade Linien waren, sind rund. Können Sie sich das vorstellen? Da entsteht ein solcher Körper, der eigentlich ein rund gewordenes Tetraeder ist! Und sehen Sie, ein solches rund gewordenes Tetraeder ist unsere Erde. Das ist etwas, was man bis zu dem Grad feststellen kann, daß man sogar die
#Bild s. 198
Kanten dieses Erdentetraeders finden kann. Sehen Sie, das ist so: Nehmen Sie einmal die Erde so gezeichnet, wie man sie oftmals zeichnet, wie wenn sie auf einer Fläche wäre; dann haben wir hier Nordamerika, hier Südamerika, dazwischen Mittelamerika; hier herüben haben wir Afrika, hier haben wir Europa. Und da ist zuerst Kleinasien, Meer, Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, also Europa. Dahier hinauf, so herüber ist dann Skandinavien, da ist England, und dahier, da drüben, ist dann Asien. Also wir haben hier Asien, hier Afrika, hier Europa, und wir haben hier Amerika.
Nun, hier ist der Südpol. Namentlich um den Südpol herum sind viele Vulkane, vulkanische Gebirge. Da ist der Nordpol. Und die Sache ist jetzt so: Wir können richtig eine Linie verfolgen, die geht von der Mitte Amerikas, von hier, wo der Vulkan Colima ist, herunter durch die Berge, die die Anden heißen, bis zum Südpol hin. Sie ist abgerundet, diese Kante der Erde. Dann geht es weiter: Vom Südpol geht es hier herüber, hier an Afrika vorbei, und geht bis zu den vulkanischen Bergen vom Kaukasus. Dann geht dieselbe Linie hier herüber, geht just an der Schweiz vorbei, geht an den Rhein hier hinüber, und geht bis hierher.
Sehen Sie, wenn Sie diese Linie verfolgen, die wie ein Dreieck aussieht - die schaut ähnlich aus wie ein Dreieck -, das können Sie vergleichen mit diesem Dreieck hier. Also, was ich dort jetzt gezeichnet habe, das können Sie vergleichen mit diesem Dreieck hier. So daß, wenn Sie dieses Stück Erde nehmen, das die Grundfläche von einem Tetraeder ist.
Denken Sie sich einmal die Grundfläche von einem Tetraeder! Jetzt: Wie kommen wir zu dieser Spitze da? Nun ja, da muß man da durchgehen nach der anderen Seite der Erde. Das kann ich aber da
#Bild s. 199
nicht aufzeichnen, ich müßte alles rund machen. Würde ich das rund machen, so käme ich eben auf der Spitze gerade da hinaus auf Japan. Also wenn ich das Tetraeder einzeichne, so haben wir hier Mittelamerika, hier haben wir den Südpol, hier haben wir den Kaukasus, und da drüben, was man nicht sieht, da wäre Japan.
Und wenn wir so die Erde vorstellen, so haben wir sie so als eine ausgebuchtete Pyramide im Weltenall dastehen, die ihre Spitze nach Japan hinüberschickt und die hier ihre Grundfläche hat; dadrinnen
liegt Afrika, Südamerika, der ganze südliche Ozean, das ganze südliche Meer in der Grundfläche. So steht die Erde kurioserweise darinnen im Weltenraum als ein solches ausgebuchtetes Tetraeder, als eine Art Pyramide. Das ist immerhin eigentlich die Formanlage der Erde, meine Herren!
Und nun zeigt sich, daß, wenn man diese Linien nimmt, die ich Ihnen da aufgezeichnet habe, diese Linien, die das Tetraeder bilden, und wenn man sie verfolgt, so sind die meisten feuerspeienden Berge längs dieser Linien liegend. Von denen haben Sie ja immer gehört, von diesen furchtbaren feuerspeienden Bergen drüben in Südamerika, die da in Chile und so weiter liegen, diese furchtbaren speienden Berge um den Südpol herum. Sie haben die mächtigen feuerspeienden Berge im Kaukasus. Wenn Sie da herübergehen, können Sie sagen: Bei uns sind ja nicht so viele, aber wir können überall nachweisen, daß diese feuerspeienden Berge einmal da waren, aber erloschen sind. Zum Beispiel, sehen Sie, wenn man auf der Strecke fährt, die vom Norden von Schlesien nach Breslau geht, da sieht man einen merkwürdig alleinstehenden Berg; vor dem fürchten sich die Leute heute. Wenn man ihn aber untersucht nach seinem Gestein, so ist dieser merkwürdige Berg, der da steht, eben ein erloschener feuerspeiender Berg. Ebenso haben wir in vielen Gegenden Deutschlands erloschene feuerspeiende Berge.
Und gehen wir jetzt weiter. Wir haben uns ja nur die Grundfläche aufgezeichnet. Wir haben ja da überall Linien, die nach Japan hinübergehen. Ja, sehen Sie, längs aller dieser Linien könnten wir immer auf der Erdoberfläche feuerspeiende Berge finden! So daß man sagen kann, wenn einer herginge und die allerwichtigsten feuerspeienden Berge aufzeichnete, aber aufzeichnete nicht auf einer Fläche, sondern aufzeichnete so, daß sie einen Körper bilden, der kriegte diese Gestalt der Erde heraus. Die feuerspeienden Berge sind kurioserweise dasjenige, was uns die Linien angibt, welche die Erde erscheinen lassen als ein Tetraeder.
Wenn Sie nun daran denken, daß die Erde nicht so entstanden ist, als ob da ein Gasball gewesen wäre, der sich verdichtet hat, wie man sagt - das ist eine bequeme Vorstellung -, sondern wenn Sie sie durch Anschmeißen von allen Seiten erklären, dann müßten Sie sie aber,
#Bild s. 201 a
wenn die Erde ein Tetraeder ist, ein so regelmäßiger Körper ist, so erklären, als ob eigentlich ein großer Meistergeometer, der die Sache kennt, die Erde zusammengeschoben hätte von außen nach den Linien, die wir heute noch bemerken. Denken Sie sich, meine Herren, ich mache dieses Tetraeder; ich mache es so, daß ich zunächst dieses Dreieck hier hereinschmeiße aus der Weltenperipherie, dann dieses Dreieck hier, dann dieses, dann dasjenige, was da obenauf liegt. Ich mache also
#Bild s. 201 b
das Tetraeder, wie es die kleinen Buben machen: sie schneiden sich vier Dreiecke aus und kitten sie von außen zusammen, und das pappen sie zusammen zu dem Tetraeder. So ist aber auch die Erde entstanden; sie ist von außen nach Dreiecken zusammengeschmissen worden. Nun, schauen Sie sich die kleinen Buben an, wenn sie diese Dreiecke zusammenpappen. Da müssen sie ja ganz besonders überall, wo sie sie zusammenkitten, eben Kitt anbringen, Kleister. Die Erde ist an den Stellen, die ich Ihnen da gezeigt habe: Südamerika, dann hinüber nach dem Kaukasus, da hier herüber durch die Alpen und so weiter - da ist die Erde ursprünglich zusammengekittet worden! Aber wenn man die Gebirge untersucht, so findet man, daß sie überall dort schlecht zusammengekittet
worden ist, möchte man sagen; es paßt nicht ganz gut aneinander. Wir können, namentlich wenn wir die Gebirge verfolgen, die da herübergehen vom Kaukasus durch unsere Karpathen und Alpen, wir können überall verfolgen, wie die Gebirge in ihrer Form, in ihrer Gestalt zeigen: das ist noch nicht ganz zusammengewachsen. So daß die Erde eigentlich aus vier zusammengefügten Stücken besteht, die aus dem Weltenraum zusammengeschmissen worden sind - vier Stücke, die dann ein Tetraeder bilden. Und da, wo die Kanten sind, da sind gewissermaßen noch undichte Stellen. An diesen undichten Stellen kann das eintreten, daß die Weltenhitze, die von der Sonne ausgeht, mehr hinein kann in die Erde als an den anderen Stellen.
Wenn nun das Unterirdische der Erde dadurch, daß da die Sonne mehr hinein kann mit ihrer Kraft, mehr erhitzt wird, so werden sie -wie es immer ist, wenn man die Dinge verbrennt; Sie können ja sogar Metalle verbrennen -, so werden sie weich. Sie schaffen sich dann wiederum nach den Stellen hin, die da nicht ordentlich zusammengekittet sind, einen Ausgang. Und da entstehen durch Sonnenwirkung mit der im Weltenraum zusammengekitteten Erde diese regelmäßigen Vulkane, die regelmäßigen feuerspeienden Berge.
Aber, meine Herren, es gibt ja auch an anderen Stellen Vulkane. Gewiß, zum Beispiel der Ätna, der Vesuv, die liegen nicht an diesen Kanten; die liegen zum Beispiel da, wo nicht eine solche Kante durchgeht. Ja, gerade diese Vulkane, die nicht an diesen Hauptlinien liegen, diese feuerspeienden Berge, die sind besonders lehrreich, denn aus denen kann man entnehmen, wodurch die Ausbrüche entstehen.
Sehen Sie, man kann immer nachweisen, daß, wenn so etwas wie Feuerspeien auf der Erde entsteht, das zusammenhängt mit Sternkonstellationen zur Sonne, Sternenverhältnissen zur Sonne. Niemals entsteht ein feuerspeiender Ausbruch anders, als daß die Sonne in irgendeiner Weise stark scheinen kann auf die betreffende Stelle, weil sie nicht zugedeckt ist durch andere Sterne. Ist sie nicht durch andere Sterne zugedeckt, wie es meistens der Fall ist, dann kommt regelmäßig der Sonnenschein. Es ist überall Sternenlicht; man sieht die Sterne nur bei Tag nicht. Sie dürfen nicht glauben, daß jetzt da oben, auch bei Tag, die Sterne nicht stünden. In Jena, wo man Zeit hatte, solche
Sachen zu machen, in dieser alten Stadt Jena, wo so viele deutsche Philosophen Lehrer waren, wo auch der Haeckel gelebt hat, da gibt es einen tiefen Keller, und über diesem Keller ist ein Turm, der oben offen ist. Wenn Sie hinuntergehen in diesen Keller und gucken durch diesen Turm heraus bei Tag, so ist da alles darinnen finster, aber Sie sehen oben den schönsten Sternenhimmel, bei Tag, wenn es draußen hell, klar ist, den schönsten Sternenhimmel.
Also überall da sind Sterne. Wenn aber die Sterne gerade so stehen, daß die Sonne mit aller Kraft ihre Wärme entwickeln kann, wenn sie sich nicht vor die Sonne stellen, dann leuchten eben auf einen besonderen Punkt ganz die Sonnen-, die Wärmekräfte. Das sind eben solche Stellen, wo später, nachdem die Erde dann schon zusammengekittet war, nun die Vulkane entstehen, die feuerspeienden Berge. Die sind später entstanden. Dagegen sind diejenigen, die an den Kanten des Tetraeders liegen, die ursprünglich feuerspeienden Berge.
Nun, sehen Sie, in dieser Beziehung, da kann man sagen, findet manchmal auch einer, der nicht gerade im gewöhnlichen Wissenschaftsleben drinnensteht, ganz gute Wege. Sie haben ja vielleicht einmal gehört, wenigstens die älteren Herren von Ihnen haben ja vielleicht einmal davon gehört, daß es einen Falb gegeben hat, der weder Astronom war noch Geologe noch Geograph, auch nicht Naturforscher, aber ein davongelaufener Geistlicher; er hat sich davongemacht, ist davongelaufen! Er war ein davongelaufener Geistlicher, dieser Falb, und hat sich besonders darauf verlegt, solche Dinge zu untersuchen, wie es da steht mit den Sternenverhältnissen, ob die wirklich auf die Erde wirken. Und da ist er zu der Ansicht gekommen, daß erstens solche Stern-konstellationen mit den feuerspeienden Bergen zusammenhängen, daß immer dann, wenn in einer gewissen Weise die Sache so steht, daß Sterne die Sonnenwirkungen unterstützen, ein feuerspeiender Berg zustande kommt. Aber er behauptete noch mehr: Er behauptete, daß da auch Überschwemmungen zustande kommen, weil das das Wasser an-zieht: unten die erhitzte Masse, oben das Wasser.
Aber er behauptete noch mehr: Er sagte, in Bergwerken leiden die Bergleute am allermeisten unter den sogenannten schlagenden Wettern. Da entzündet sich die Luft in den Bergwerken von selber. Woher
kann das kommen? - sagte er sich. Das kann nur davon herkommen, sagte er, daß wiederum solche selben Wirkungen da sind, wo die Stern-wirkung zu Hilfe kommt der Sonnenwirkung, und dadurch, daß die Sternwirkung die Sonnenwirkung nicht auslöscht, die Sonnenwirkung sehr stark wird, ins Bergwerk scheint, dadurch die Luft im Bergwerk entzündet. Deshalb sagte Falb: Wenn man die Bergwerksverhältnisse kennt, muß man angeben können, wann schlagende Wetter im Jahr zu erwarten sind. Und dann machte er einen Kalender und gab an nach den Sternenverhältnissen, wann irgendwo schlagende Wetter entstehen müssen. Das waren seine sogenannten kritischen Tage, und er verzeichnete in seinem Kalender diese kritischen Tage.
Dieser Kalender ist ja immer wieder gedruckt worden; da stehen die Falbschen kritischen Tage drinnen. Nun, was hatte man zu erwarten, wenn das im Kalender stand? Entweder einen Ausbruch eines feuerspeienden Berges oder irgendwo ein Erdbeben - Erdbeben ist eine unterirdische Welle, unterirdische Überhitzung - oder eine Überschwemmung oder aber schlagende Wetter. Nun, meine Herren, da erlebte ich sogar einmal eine nette Geschichte. Sehen Sie, der Falb war ja ganz gescheit, solche Dinge hat er durchschaut; aber er war sehr eitel, furchtbar eitel. Gelehrsamkeit schützt ja nicht vor Eitelkeit, wie Sie wissen.Und da ist das Folgende geschehen. Ich war bei einem Vortrag, den der Falb gehalten hat - es ist jetzt auch schon vierzig Jahre oder so etwas her -, Falb geht mit großer Grandezza, mit großem Wohlbehagen auf das Rednerpult und fängt seinen Vortrag an und sagt: Ja, gerade heute, da stehen die Sterne so, daß man erwarten könnte, daß mächtige schlagende Wetter eintreten können. - Also das sagte er im Vortrag. In dem Momente öffnet sich die Tür, und ein Zeitungsbote von der «Neuen Freien Presse» kommt herein und bringt ein Telegramm. Der Falb stand oben mit seinem ganzen langen Patriarchenbart; der Diener kam herein von der «Neuen Freien Presse», brachte das Telegramm. Der Falb sagt: Es scheint etwas Wichtiges zu sein, weil man es mir grade zum Vortrag herschickt -, nimmt sein Messer heraus und schneidet das Telegramm auf. «Es haben sich heute furchtbare schlagende Wetter ereignet», wurde darin gemeldet! Nun können Sie sich das Publikum denken: Falb hatte eben gesagt: Schlagende
Wetter könnten heute kommen - und der Zeitungsbote bringt das Telegramm! Na, sehen Sie - sagte er -, so werden einem die Beweise auf den Tisch gelegt! - Das waren seine Worte.
Die ganze Geschichte ist ja doch ein bißchen stark schauspielerisch gewesen; denn der Falb wußte ganz gut: schlagende Wetter werden schon kommen. Das war richtig. Aber er ist vorher zu der Redaktion der «Neuen Freien Presse» gegangen und hat dort hinterlassen: Wenn ein solches Telegramm eintrifft, so schickt es mir bitte gleich in den Vortragssaal!
Aber das ist auch ein Stückchen von denen, die in gelinderem Maße von schlechten Rednern und so weiter sehr gern benützt werden, und ich erzähle dieses Stückchen auch deshalb ganz gern, damit daraus hervorgeht, wie das Publikum doch ein bißchen vorsichtig sein soll und nicht alles einfach hinnehmen soll. Das Publikum, das der Falb dazumal hatte, rauschte von seidenen Kleidern und Smokings, denn es war das ein sehr vornehmes Publikum. Aber Sie hätten nur sehen sollen, wie das Publikum durch diese Äußerung Falbs überzeugt war! Niemals, und wenn der Falb noch so viel geredet hätte von seiner Ansicht, wäre das Publikum so überzeugt worden, als dadurch, daß der Pressebote gekommen ist mit dem Telegramm. Die Leute lassen sich immer viel lieber durch Äußerlichkeiten überzeugen als durch dasjenige, was man innerlich zum Beweis eben sagen kann.
Denn man kann sagen: Die Erde ist an gewissen Stellen, nämlich an der Stelle der Kanten dieses Tetraeders, eigentlich noch nicht ganz zusammengekittet, ist der Weltenwärme ausgesetzt, der Sonnenwärme, der Sternenwärme; und die Folge davon ist, daß auch Linien mit Vulkanen auftreten, mit feuerspeienden Bergen, daß aber auch an anderen Stellen feuerspeiende Ausbrüche stattfinden können.
Ja, nun aber, weist das denn darauf hin, daß die Erde unbedingt in ihrem Inneren feuerflüssig sein muß? Das ist etwas, was immer behauptet wird. Aber es gibt eigentlich keinen anderen Beweis dafür, als daß, wenn man Schächte hineingräbt in die Erde und immer tiefer und tiefer geht, es dann immer wärmer und wärmer wird. Aber man kann ja nicht sehr tief hineinkommen. Mit diesem Wärmerwerden ist es ja auch so, daß, je weiter man hinuntergeht im Erdinnern, auch der
Druck immer mehr und mehr wächst. Und dasjenige, was durch die Wärme auseinandergezogen wird, so daß es flüssig werden könnte, wird durch den Druck im Inneren wieder zusammengedrückt. Wenn die Erde wirklich innen feuerflüssig wäre, dann könnte etwas anderes nicht stimmen. Man kann nämlich ausrechnen, wie schwer die Erde wäre. Es ist natürlich eine Hypothese, denn man kann die Erde nicht wiegen, sie schwebt ja frei im Weltenraum. Aber wenn man sie wiegen könnte - man müßte sie auf einer anderen, riesigen Erde wieder wiegen; es muß ja etwas da sein, was anzieht, Schwere entwickelt, wenn Gewicht sein soll -, aber wenn das wäre, daß man die Erde wiegen könnte - man kann das nämlich ausrechnen, wieviel sie wiegen würde, nach der Art und Weise, wie sie andere Körper anzieht; es gibt eine solche Rechnung -, da findet man, daß die Erde viel, viel schwerer ist, als sie sein würde, wenn sie innerlich flüssig wäre, feuerflüssig wäre. Deshalb hat sich Goethe schon mit aller Energie dagegen gewendet, daß das richtig sein soll, daß die Erde innerlich feuerflüssig ist.
Wenn man nun wirklich kennt, wie die Erde beschaffen ist, daß sie eigentlich ein nicht ganz zusammengekittetes Tetraeder ist, dann braucht man gar nicht die Erde im Inneren immerfort feuerflüssig sein zu lassen und es ihr zu gewissen Zeiten, ich weiß nicht woher, aus welcher Laune, wie ein hysterischer Mensch, der Launen hat, einfallen zu lassen, sie will Feuer speien! Wenn die Erde im Inneren flüssig wäre, so müßte man sich ja vorstellen, die Erde wäre eigentlich ein bißchen wahnsinnig - so wie ein Mensch, der wahnsinnig ist, und ab und zu zu toben anfängt; man weiß nicht, wann die Augenblicke kommen. Aber das ist ja bei der Erde nicht der Fall! Sie können ja immer nachweisen, woher die Wärme kommt: daß sie von außen hereinkommt, und daß erst in diesem Momente, gar nicht so tief in der Erde, so starke Erwärmung eintritt, daß sich die einen Ausgang schafft.
Also dasjenige, was da feurig wird, wenn der Vesuv ausbricht, oder irgendein anderer Vulkan ausbricht, entsteht erst in dem Moment in der Weltenwitterung, wo es feurig wird. Sehen Sie, es braucht immer einige Zeit, bis diese Wirkung entsteht. Da muß schon dieses Sternenverhältnis einige Zeit auf die Erde wirken. Aber auch das folgt ja aus gewissen
Tatsachen, die ich hier schon in einem ganz anderen Zusammenhange vor Ihnen erzählt habe. Nehmen Sie an: Hier ist ein Stück Erde: da kommen die Sonnenstrahlen mächtig. Da drunter entsteht dasjenige, was sich später durch Feuerspeien oder irgendein Erdbeben einen Ausweg sucht (es wird gezeichnet).
Ja, dasjenige, was ich zuerst gezeichnet habe, was da heruntergeht als mächtige Wärme, das spüren die Menschen nicht, weil sie nicht achtgeben. Höchstens gehen einige herum an dem Ort, wo noch gar nichts zu spüren ist von Vulkanausbrüchen, wo aber schon in der Luft diese Sonnenwirkungen sind, und haben stark Bauchweh gekriegt; andere haben Kopfschmerzen, Migräne, andere wiederum finden, daß ihr Herz unruhig wird. Aber das alles nehmen die Menschen hin, dämmerig, geben nicht acht darauf. Und die Tiere - wie ich Ihnen schon in anderem Zusammenhange sagte -, die Tiere, die feinere Nasen haben, feinere Organe haben in dieser Beziehung, die nehmen das wahr und reißen aus. Die Menschen wissen nicht, trotzdem sie Bauchweh haben und Kopfschmerzen, warum die Tiere denn so unruhig werden und ausreißen. Aber nach einigen Tagen kommt das Erdbeben oder der Vulkanausbruch. Die Tiere sind davongelaufen, weil sie schon die Vorbereitungen dazu gespürt haben; die Menschen sind so grob organisiert in dieser Beziehung, daß sie die Geschichte erst sehen, wenn die Bescherung da ist. Schon daraus können Sie sehen, daß lange Zeit vorher etwas vorgeht, bevor die Geschichte eintritt. Und das, was vorgeht, ist eben das Hereinstrahlen eines Stückes Weltenwärme.
Sie können jetzt aber immer noch fragen: Ja, aber diese Welten-wärme, die erhitzt ja nur den Erdboden. Und der kann dann an einer solchen Stelle, wo er gerade Substanzen enthält, die leichter entzündlich sind, in eine Entzündung kommen. Wie kommt es dann, daß das alles gleich herausspritzt? - Da will ich Ihnen auch etwas sagen: Wenn man nach Italien, namentlich zwischen Rom und Neapel geht, in die Nähe von Neapel geht, namentlich auf die Inseln, die Halbinseln, die sich da und dort ansetzen an Italien, dann zeigen die Führer immer ganz gerne das Folgende den Besuchern: Sie nehmen ein Stück Papier, zünden es an, halten es so - in dem Augenblick beginnt es von der Erde heraus zu rauchen! Es raucht. Warum? Weil die Luft warm
wird durch das Anzünden, und dadurch wird das leichter, dehnt sich aus. Was unten angesammelt ist an durch die Sonnenhitze bewirkter Erwärmung aus der Erde, strömt schon als Rauch heraus. Man kann dieses sehr Interessante sehen: Man zündet ein Stück Papier an - flugs raucht die Erde an der Stelle. Nun denken Sie sich das ins Riesenhafte vergrößert - die Sonne erwärmt ja nicht bloß unten den Erdboden, sondern auch oben die Luft - und Sie haben den Vesuv. Und wenn er sich einmal gebildet hat, nun, dann ist das halt der Anfang dazu, dann geht es immer weiter an Stellen, die dazu besonders günstig sind.
Sehen Sie, es ist schon interessant, auch das einmal zu wissen, daß gerade diese Dinge, die eigentlich unregelmäßig geschehen auf der Erde, herrühren vom ganzen Weltenraum.
Nun sagte ich Ihnen, dazumal, als wir im geologischen Kabinett diese Substanzen anschmissen, schweflige Substanzen, da kriegte man etwas, was richtig aussieht wie ein kleiner Mond. Und wenn man also den heutigen Mond, dem ja das ganz ähnlich sieht, anschaut, so kriegt man beim Mond auch die Ansicht, daß er aus dem Weltenraum zusammengeschmissen ist! Das ist das eine, was man kriegt. Das andere aber stellt sich heraus gerade durch geisteswissenschaftliche Forschung, daß der Mond eigentlich in der Hauptsache von der Erde in den Weltenraum hinausgeschmissen worden ist. Was kriegt man denn da heraus? - Sehen Sie, das ist dazumal auch gemacht worden. Zunächst hat man einmal aus Substanzen solch einen Weltenkörper zusammengeschmissen. Dann hat man auch in die Mitte herein eine Substanz genommen und angeschmissen von außen, und siehe da, da wurde es erst recht mondähnlich. Und was hat man da? Nun, man hat den ganzen Vorgang. Die Hauptmasse des Mondes ist von der Erde ausgeschmissen worden; weil die da war, ist von allen Seiten aus der Welt leichter Stoff angeschmissen worden, der ja immer im Weltenall enthalten ist - in den Meteorsteinen fällt er ja herunter, wird aber immer angeschmissen. Und so hat man die Entstehung des Mondes. Diese Dinge gehören alle zusammen.
Sehen Sie, die Entwickelung der Wissenschaft ist ja manchmal merkwürdig. In Heilbronn steht heute ein Denkmal, das allerdings ziemlich scheußlich ist als Kunstwerk, aber es steht halt eben da; das
stellt dar Julius Robert Mayer. Wenn Sie heute irgendwo in der Wissenschaft den Namen Julius Robert Mayer hören, dann erfahren Sie, wie er dadurch, daß er die Natur der Wärmewirkungen aufgesucht hat in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, ein bahnbrechendes Genie war. Julius Robert Mayer ist in Heilbronn geboren, war in Heilbronn Arzt, ging da herum in Heilbronn und wurde dazumal nicht besonders beachtet. Die Wissenschafter der damaligen Zeit nahmen keine Notiz von ihm. Und es ist ihm ja so gegangen, daß er, trotzdem er heute als genialer Bahnbrecher der Wissenschaft, als genialer Bahnbrecher der Physik überall geschildert wird, dazumal, als er sein Arztexamen machte in Tübingen, durchgefallen ist - wie Sie überhaupt auf die merkwürdige Tatsache kommen würden, daß die meisten, die nachher Genies geworden sind, bei ihren Examina durchgefallen sind. So ist es auch mit Julius Robert Mayer gewesen. Mit Ach und Krach konnte er die Geschichte noch machen und wurde Arzt. Aber beachtet hat ihn niemand während seines Lebens. Im Gegenteil:
er ist so begeistert geworden von seiner Entdeckung, daß er überall davon geredet hat. Da hat man von ihm gesagt: er hat Ideenflucht -und hat ihn ins Irrenhaus gesetzt. Also die Gegenwart hat ihn damals ins Irrenhaus gesperrt, die Nachwelt hält ihn für ein großes Genie und hat ihm ein Denkmal gesetzt in seiner Vaterstadt.
Nun aber, dieser Julius Robert Mayer war es auch, der aus seinem Denken und Forschen heraus die Idee aufgestellt hat: Wodurch kommt es, daß die Sonne, die uns ja so viel Wärme gibt, nicht kalt wird? Sie wird nicht so kalt, wie sie werden müßte, nachdem sie immer Wärme abgibt - so sagte sich Julius Robert Mayer. Und deshalb, meinte er, müßten fortwährend Kometen, riesig viele Kometen fortwährend in die Sonne hereinfliegen, vom Weltenraum angeschmissen werden. Es sind sehr dünne Körper, aber sie fliegen da herein. - Es ist wahr, daß sie hereinfliegen! Die Sonne sieht ja ganz anders aus, als sich die Physiker heute vorstellen. Wenn sie hinaufkommen würden, würden sie sehr erstaunt sein: sie würden nicht ein feuriges Gas da finden, sondern etwas finden, was jede Erdenmaterie gleich verschwinden läßt, weil es sie aufsaugt. Die Sonne ist ein Raum, der aufsaugt. Aber das, was da wie eine Saugkugel ist, ist nicht eine volle Gaskugel, sondern
wie eine Perle im Weltenall, wo alles nicht drinnen ist, was man drinnen sucht. Das saugt auch diese Kometenmasse fortwährend heran. Die feinen ätherischen Bildungen des Weltenalls, die fast geistig sind, die saugt sie heran und nährt sich mit diesen Äthermassen, mit diesen Kometenmassen. Und wir sehen an der Sonne daher heute noch dieses Anschmeißen. Wir müßten doch dadurch auf etwas aufmerksam werden, was wichtig ist, meine Herren.
Sehen Sie, wenn man so darauf kommt, daß die Erde solch ein Tetraeder eigentlich ist - und derjenige, der einmal diese Körper hat studieren müssen, wieviel Kanten und Winkel und Ecken sie haben, der weiß, daß man da etwas Geometrie studieren muß, um solche Körper zu verstehen, um solche Körper vorzustellen -, dann sieht man:
Solche Körper kommen ja nicht so einfach zustande. Die Buben machen es sehr gern, Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder, Hexaeder, Dodekaeder, diese fünf regelmäßigen Körper: sie setzen sie aus Flächen zusammen und kitten die Flächen dann - aber man braucht dazu Geometrie. Nun wird geradeso aus dem Weltenall heraus die Erde gebildet mit Kenntnissen der Geometrie, wenn man sie so anschaut, nicht durch Zahlen gebildet, sondern mit Kenntnissen, denn es ist regelmäßig! Sie können also daraus entnehmen, daß eigentlich in der Welt Geometrie drinnen ist, daß alles aus der Geometrie wirkt. Und das ist richtig. Man kommt schon immer durch wirkliche Wissenschaft, wie ich immer sage, darauf, daß Gedanken ausgebreitet sind in der Welt, Gedanken überall wirken, und daß eigentlich die Menschen diese Gedanken nur dann nicht finden, wenn sie, ja, selber keine Gedanken haben!
Nicht wahr, es ist schon ganz lobenswert, wenn man ein freidenkender Mensch ist; aber es ist doch etwas Verräterisches, daß in der neueren Zeit, im 19. Jahrhundert, der Ausdruck «Freigeist» aufgekommen ist. Freies Denken, das ist sehr gut; aber dieser Ausdruck «Freigeist», den haben viele doch in ihrer Eitelkeit sehr mißbraucht. Und am freigeistigsten haben sich dann diejenigen gefühlt, die die wenigsten Gedanken hatten, die nur das nachgesagt haben, was die anderen sagten. Da gab es einen Engländer, der einen netten Ausspruch getan hat; der sagte: Die Freigeisterei besteht ja nicht darinnen, daß die Leute Geist haben, sondern daß sie frei sind vom Geist. - Ein
englischer Ausspruch, den die anderen viel nachzitiert haben: Was ist ein Freigeist? Ein Freigeist ist derjenige, der frei ist vom Geist! -Ja, man muß schon in der Wissenschaft danach streben, nicht solche Freigeistigkeit zu entwickeln, denn dann wird nichts entstehen. Längst hätte man die Sache durchschauen können, was die Erde eigentlich für eine Form hat, daß sie nicht ein runder, ein ganz runder Kohlkopf ist, sondern daß sie eigentlich etwas hat von einem Tetraeder!
Die Erdenerkenntnis hängt wiederum zusammen mit Menschenerkenntnis. Der Mensch bildet das Weltenall in seiner eigenen Form nach. In seinem Kopfe bildet der Mensch das Weltenall ab. Daher ist der Kopf nach oben rund nach dem runden Weltenall. Da unten aber, wo die Kiefer ansetzen, da sind ganz merkwürdige Bildungen: die kommen von der dreieckigen Erde. Da finden Sie überall Dreiecke; die kommen von unten herauf, von der dreieckigen Erde. Und die Menschen bilden zusammen das runde Weltenall ab. Darum haben sie einen mehr oder weniger runden Kopf nach oben, und da unten erstrecken sich die Kräfte der Erde. Und suchen Sie nur einmal: Sie werden bei Menschen und Tieren da überall das Dreieck nachgebildet finden irgendwie in der Kieferbildung, denn die kommt von der Erde, die wirkt von der Erde aufwärts und prägt ihm die Dreiecke ein, und die Welt wirkt von oben herunter und bildet die runde Form. Das ist sehr interessant.
Das ist dasjenige, was man wissen kann, wenn man die wirkliche Wissenschaft durchschaut. Wenn man frei ist von Geist, da redet man allerlei Zeug. Und in unserer Zeit wird ja allerlei Zeug geredet; das kann nicht kommen zu einer Ansicht, wie die Dinge eigentlich in Wirklichkeit sind.
Nun, meine Herren, wollen wir am nächsten Samstag davon weiter reden.
DREIZEHNTER VORTRAG Dornach, 20. September 1924
Guten Morgen, meine Herren! Ist jemandem eine interessante Frage eingefallen?
Frage in bezug auf Anthroposophie: Was sie eigentlich ist und will, was für eine Aufgabe sie in der Welt eigentlich habe und so weiter.
Dr. Steiner: Die Frage, die gestellt worden ist, ist diese: Der Herr möchte gern wissen, was eigentlich Anthroposophie ist und was sie für die Menschheit im allgemeinen, und ich könnte auch sagen, für die Arbeiterschaft oder die Arbeiterklasse, bedeutet.
Natürlich ist es schwer, in ganz kurzen Worten diese Dinge zu besprechen. Ich möchte bemerken, daß diejenigen Herren, die schon länger da sind, doch wohl sich immer mehr und mehr überzeugt haben, daß so etwas wie Anthroposophie in die Entwickelung der Menschheit hineinkommen muß. Diejenigen, die nun noch weniger lange da sind, werden natürlich Mühe haben und solch eine Sache erst nach und nach verstehen.
Sehen Sie, da muß man ja vor allen Dingen zuerst darauf aufmerksam machen, wie wenig eigentlich die Menschen geneigt sind, dann, wenn etwas Neues in die Welt kommt, dieses Neue anzunehmen. Man könnte ja da die allermerkwürdigsten Beispiele anführen, wie neue wissenschaftliche Entdeckungen in der Welt aufgenommen worden sind. Man braucht nur daran zu erinnern, daß ja heute alles im Grunde genommen beherrscht wird von der Entdeckung der Dampfgewalt, der Dampfmaschinen. Denken Sie sich nur, was heute die Welt wäre, wenn es keine Dampfmaschinen gäbe in ihren verschiedensten Formen! Als die Dampfmaschine zuallererst aufgekommen ist, da fuhr ein ganz ganz kleines Dampfboot den Fluß hinauf: Die Bauern haben es kaputt gemacht, weil sie gesagt haben, so etwas ließen sie sich nicht gefallen; das tauge nichts für die Menschen! Nun, nicht immer waren es die Bauern, die so etwas kaputt gemacht haben. Als zuerst über die Meteorsteine in der gelehrten Körperschaft von Paris berichtet worden
ist, haben die Leute denjenigen, der berichtet hat, für einen Narren erklärt.
Von Julius Robert Mayer, der heute eine große Berühmtheit ist und als großer Gelehrter angesehen wird, habe ich Ihnen neulich erzählt; ich habe Ihnen gesagt, daß er eine gewisse Zeit seines Lebens ins Irren-haus gesperrt worden ist.
Und wie ist es mit den Eisenbahnen gegangen? Ja, wissen Sie, mit den Eisenbahnen, da ist es ganz besonders merkwürdig gegangen. Sie wissen ja, es ist noch nicht so lange her, daß die Menschen Eisenbahnen haben; es ist erst im 19.Jahrhundert gewesen. Früher mußten die Leute mit der Postkutsche fahren. Nun ja, sehen Sie, als die erste Eisenbahn von Berlin nach Potsdam gebaut werden sollte, da sagte der Direktor der Postkutschen, er lasse jede Woche zwei Postkutschen von Berlin nach Potsdam fahren, und da sitze niemand drinnen - er sehe nicht ein, wozu Eisenbahnen in der Welt gut seien! Der Mann dachte eben nicht daran, daß, wenn Eisenbahnen da sind, dann mehr Leute fahren werden als mit der Postkutsche.
Aber noch interessanter benahm sich ein Ärzte-Kollegium, in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als man die erste Eisenbahn baute von Fürth nach Nürnberg. Da erklärten die gelehrten Herren, daß man keine Eisenbahn bauen solle, weil die Leute drinnen sehr leicht krank, nervös werden könnten von der schnellen Fahrerei; aber nachdem sich das die Leute nun einmal nicht nehmen ließen, Eisenbahnen zu bauen - Sie können heute noch diese schönen Dokumente lesen -, sollten hohe Bretterwände links und rechts der Bahnlinie errichtet werden, damit die Bauern, wenn die Eisenbahnen vorbeifahren, nicht Gehirnerschütterung kriegen! - Nun, sehen Sie, so ist die Sache gegangen. Die Eisenbahnen sind doch gebaut worden, haben ihren großen Aufschwung genommen, gegen all diejenigen, die sich dagegen gewendet haben. So wird auch Anthroposophie ihren Weg durch die Welt machen, weil sie eben einfach kommen muß, weil nichts in der Welt wirklich verstanden werden kann, wenn nicht die Dinge vom Geiste aus verstanden werden, wenn man nicht die geistigen Grundlagen von allem wirklich erkennt.
Sehen Sie, Anthroposophie ist entstanden nicht gegen die Naturwissenschaft,
sondern weil die Naturwissenschaft da ist, ist Anthroposophie entstanden und mußte entstehen aus den Gründen, weil die Naturwissenschaft mit ihren vollkommenen Instrumenten, mit ihren ganz ausgebildeten Experimenten eine große Menge von Tatsachen gefunden hat, die eigentlich, so wie sie die Naturwissenschaft findet, nicht wirklich verstanden werden können. Sie können nicht verstanden werden. Sie können erst verstanden werden, wenn man überall hinter den Dingen wahrnimmt, daß das Geistige da ist, daß ein Geistiges in allem wirklich drinnen ist.
Nehmen Sie nur einmal eine ganz gewöhnliche praktische Frage. Ich will ganz von einer praktischen Frage ausgehen. Nehmen Sie, sagen wir, das Kartoffelessen. Ich will von etwas ganz Gewöhnlichem ausgehen : vom Kartoffelessen. Sehen Sie, es gab ja Zeiten, wo es in Europa keine Kartoffeln gab; die Kartoffeln sind ja erst von auswärtigen Ländern in Europa eingeführt worden. Man schreibt solch einem Menschen, der Drake heißt, die Einführung der Kartoffel zu. Aber das ist nicht wahr; sie sind auf andere Weise eingeführt worden. In Offenburg draußen hat der Drake deshalb doch ein Denkmal! Und ich war einmal neugierig, warum der Drake in Offenburg das Denkmal habe -es war während des Krieges, wir mußten dort Station machen -, ich war neugierig und schaute im Konversationslexikon nach und richtig steht im Konversationslexikon: Dem Drake ist in Offenburg ein Denkmal errichtet worden, weil er angeblich die Kartoffel in Europa eingeführt habe! - Sehen Sie, so kommen Bücher, so kommt Geschichte-schreiben zustande.
Also nun die Kartoffel! Wenn heute irgend jemand sagen würde, ein Naturwissenschafter oder ein Mediziner solle sagen, wie eigentlich die Kartoffel wirkt, wenn sie gegessen wird - was tut er? Sie wissen ja, die Kartoffel ist allmählich ein Nahrungsmittel geworden, und es ist außerordentlich schwer, in manchen Gegenden die Leute davon abzubringen, daß sie sich fast ausschließlich von Kartoffeln nähren. Nun, was tut der heutige Naturforscher, wenn er die Kartoffel auf ihren Nährwert prüft? Ja, er untersucht, was da in der Kartoffel an Stoffen drinnen ist. Das kann man ja natürlich im Laboratorium untersuchen, was in der Kartoffel an Stoffen drinnen ist. Man findet da Kohlehydrate,
die also bestehen aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, die in einer bestimmten Weise angeordnet sind. Man kommt noch dazu, einzusehen, daß sich im menschlichen Körper diese Stoffe umwandeln, daß sie zuletzt zu einer Art von Zucker werden, aber man kommt nicht weiter damit. Man kann auch nicht weiterkommen. Denn, sehen Sie, wenn man irgendeinem Tier, das man mit Milch füttern will, Milch gibt, so kann es unter Umständen ganz gut gedeihen. Wenn man aber die Milch in ihre chemischen Bestandteile zerlegt und untersucht, aus was sie besteht, und nun statt der Milch dem Tiere diese chemischen Bestandteile gibt, krepiert das Tier dabei, kann sich nicht ernähren. Worauf beruht das? Das beruht darauf, daß noch etwas anderes in den chemischen Bestandteilen in der Milch wirkt. Und so wirkt auch in der Kartoffel noch etwas anderes als die bloßen chemischen Bestandteile. Das ist das Geistige dabei. Und überall, in allem in der Natur wirkt das Geistige.
Und wir sehen, wenn man jetzt mit der Geisteswissenschaft - Anthroposophie ist ja nur ein Name -, wenn man also wirklich mit der Geisteswissenschaft kommt und die Art und Weise untersucht, wie die Kartoffel den Menschen ernährt, da kommt man darauf, daß die Kartoffel etwas ist, was in den Verdauungsorganen nicht ganz verdaut wird. Die Kartoffel wird nicht ganz in den Verdauungsorganen verdaut, sondern geht durch die Lymphdrüsen, durch das Blut so in den Kopf hinauf, daß der Kopf noch gerade bei der Kartoffel als ein Verdauungsorgan dienen muß. Der Kopf wird gewissermaßen, wenn man recht viel Kartoffeln ißt, zum Magen; er verdaut mit.
Ein solches Nahrungsmittel wie die Kartoffel unterscheidet sich dadurch ganz beträchtlich von gesundem Brot zum Beispiel. Wenn man gesundes Brot ißt, dann verdaut man alles dasjenige, was stofflich ist vom Korn, vom Roggen, vom Weizen, auf gesunde Weise im Verdauungskanal. Und die Folge davon ist, daß in den Kopf hinein nur das Geistige vom Korn, Roggen, Weizen und so weiter kommt, was da hineingehört.
Diese Dinge kann man durch keine bloße Naturwissenschaft wissen, sondern diese Dinge kann man nur wissen, wenn man die Dinge wirklich auf ihren geistigen Gehalt untersucht hat. So kommt man darauf,
wie in der neueren Zeit die Menschen ruiniert worden sind durch das Kartoffelessen. Also man sieht ein, daß in den letzten Jahrhunderten zu der allgemein geschwächten Gesundheit der Menschen ganz besonders beigetragen hat der Kartoffelgenuß. Das ist ein ganz grobes Beispiel, wie man geistig forschen kann in all dem, was die Naturwissenschaft in so ausgezeichneter Weise schafft, wenn man sie als Grundlage nimmt.
Nun aber will ich Ihnen etwas anderes noch sagen: Von demselben Standpunkt aus kann man jede Substanz, die in der Welt vorkommt, auf ihren geistigen Gehalt prüfen. Dadurch kriegt man erst Heilmittel heraus für Krankheiten. Und so liefert die Geisteswissenschaft eine ganz besondere Grundlage für das Medizinische.
Wir haben in der Geisteswissenschaft nur eine Fortsetzung der Naturwissenschaft, durchaus nicht irgend etwas, was der Naturwissenschaft widerspricht. Und außerdem haben wir in der Geisteswissenschaft etwas, das auf wissenschaftliche Weise den Geist erforscht, also die Leute nicht darauf verweist, daß sie irgend etwas glauben sollen, was die Menschen sagen. Die Glaubensbekenntnisse, die werden dadurch ersetzt durch etwas wirklich Wissenschaftliches.
Nun will ich Ihnen noch etwas anderes sagen. Sehen Sie, die Wissenschaft kommt überall bis zu einem gewissen Grad dazu, die Sachen zu erkennen. Und die Menschheit muß natürlich nicht teilnehmen an allen kleinen wissenschaftlichen Dingen, aber die Hauptsachen über die Welt müßte eigentlich jeder Mensch wissen.
Ich will Ihnen nun etwas erzählen, woraus Sie ersehen können, wie großartig und wichtig es ist, in der Welt auch den Geist zu erkennen, wie er wirklich wirkt. Sehen Sie, es war 1773, da wurde plötzlich in Paris das Gerücht verbreitet, ein Gelehrter würde einen Vortrag halten in einer gelehrten Gesellschaft; in dem Vortrag würde er beweisen, daß ein Komet mit der Erde zusammenstoßen und daß der Untergang der Erde kommen werde. Das war dazumal etwas, was man glaubte, daß es ganz wissenschaftlich bewiesen werden könnte. Und es ist also da im 18.Jahrhundert - der Aberglaube war noch groß - eine riesige Angst durch ganz Paris gegangen. Wenn man heute die Dinge verfolgt, die dazumal in Paris geschehen sind, so findet man,
daß eine ganz große Anzahl von Fehlgeburten geschehen ist. Die Frauen haben vor lauter Schrecken früher geboren. Die Leute, die irgendwie schwere Krankheiten gehabt haben, sind gestorben, als das bekanntgeworden ist. Es war eine riesige Aufregung in ganz Paris, weil bekanntgeworden ist, daß da ein Gelehrter einen Vortrag halten solle darüber, daß da ein Komet mit der Erde zusammenstoßen und die Erde zugrunde gehen werde.
Ja, meine Herren, die Polizei, die ja, wie Sie wissen, immer auf ihrem Posten ist, die hat natürlich den Vortrag außerdem noch verboten. Und so haben die Leute nicht einmal erfahren, was der Gelehrte nun eigentlich sagen wollte. Aber die Bescherung war da! Sehen Sie einmal, jetzt können Sie fragen: Hat der Gelehrte - der hat ja wirklich den Vortrag halten wollen - nun recht oder hat er nicht recht gehabt?
Nun, die Geschichte ist doch nicht so ganz einfach. Denn seitdem der Kopernikus das neue Weltsystem aufgestellt hat, rechnet man ja alles, und die Rechnung hat dazumal ja wirklich folgendes ergeben. Man stellt sich vor, die Sonne ist im Mittelpunkt des Weltsystems; da kommen Merkur, Venus, Mond, Erde, Mars her (es wird gezeichnet>, die Planetoiden; da kommt Jupiter, da der Saturn. Und jetzt die Kometen, die machen solche Bahnen (es wird gezeichnet). Da kommt der Komet heran. Nun bedenken Sie: Da geht die Erde herum; man kann ausrechnen, wann die Erde da steht und wann der Komet herankommt -plumps, stoßen sie zusammen nach der Rechnung! - Ja, meine Herren, zusammengestoßen sind die dazumal auch wirklich; aber der Komet war eben so klein, daß er sich in der Luft aufgelöst hat - nicht gerade in Paris, aber an einer anderen Stelle. Die Rechnung hat also durchaus gestimmt, aber es war kein besonderer Grund zur Angst da.
Aber sehen Sie einmal dieses an: Im Jahre 1832, da ist die Geschichte schon sengeriger geworden, denn da konnte man wieder ausrechnen, daß ein Komet mit der Erdbahn sich kreuzt und ganz nahe an der Erde vorübergeht. Und der ist nicht so ein kleiner Knirps gewesen, wie der andere war, sondern der wirkte schon etwas verderblicher. Aber es war nun die Rechnung dazumal noch ziemlich glücklich verlaufen, denn man kriegte heraus, daß, wenn der Komet da vorbeikommt bei
der Erde, er dann noch immer dreizehn Millionen Meilen von ihr entfernt bleibe; das ist ja immerhin ein Stückchen, nicht wahr! Also da brauchte man sich nicht zu fürchten, daß er die Erde durchstößt, kaputt macht. Aber die Leute fürchteten dazumal doch auch schon recht viel, denn die Weltenkörper ziehen sich gegenseitig an und man mußte abwarten, ob nicht der Komet irgendwie große Meereskonvulsionen hervorrufen werde durch seine Schwerkraft und so weiter. Es ist ja dann nichts Besonderes geschehen - eine allgemeine Unruhe in der Natur, aber nichts Besonderes. Er war eben noch dreizehn Millionen Meilen entfernt; die Sonne, die ist dreizehn mal soweit entfernt, so daß also die Erde dazumal keinen Schaden genommen hat.
Als ich ein kleiner Bub war, 1872 - ich war dazumal mit meinen Eltern auf einem kleinen Bahnhof -, da kriegten wir überallhin Schriften: Die Welt geht unter -, denn da sollte der Komet wieder kommen. Gewisse Kometen kommen ja immer wiederum; er sollte also wieder kommen. Jetzt sollte er schon näher sein; also die Geschichte wurde schon gefährlich in der Richtung. Der Komet war auch schon 1845/46 und 1852 wieder gekommen, aber dieser merkwürdige Himmelskörper, dieser Komet, der trat jetzt auf entzweigespalten! Während er vorher so war, immer so gekommen ist, kam er jetzt so (es wird gezeichnet). Und jeder war um soviel dünner, weil er sich eben abgespalten hat. Und was war 1872 zu sehen? Ja, 1872 war zu sehen, daß so etwas wie ein Lichtregen von Sternschnuppen herunterfiel, besonders viele Sternschnuppen herunterfielen! Der Komet war schon nähergekommen, aber er hat sich zerspalten und hat außerdem Materie abgegeben, dünne Materie, die heruntergeregnet ist wie ein Lichtregen. Das war damals zu sehen. Einige Leute haben etwas gesehen - das heißt, sehen konnte es jeder, denn nicht wahr, wenn in der Nacht mächtige Sternschnuppenfälle geschehen, so sieht man etwas aus dem Himmel kommen. Aber einige, die es gesehen haben, haben geglaubt, der Jüngste Tag wäre gekommen! Es ist doch wiederum ein großer Schreck entstanden. Aber die Sternschnuppen haben sich eben in der Atmosphäre, in der Luft aufgelöst.
Und denken Sie sich dieses Merkwürdige: Wäre der Komet beisammengeblieben, so wäre es uns 1872 doch recht schlecht gegangen
mit der Erde! Aber wie gesagt, auf unserem Bahnhof kriegten wir lauter Schriften: Die Welt geht unter! -, die Astronomen hätten ausgerechnet, nach der Naturwissenschaft ganz richtig: die Welt geht unter. Und wie viele Leute dazumal reichliche Beichtgelder zahlten, damit sie rasch von ihren Sünden freigesprochen wurden, das geht nicht weiter aufzuschreiben, denn das tritt immer ein, meine Herren. Auch in Paris dazumal, 1773, oh, da haben die Beichtväter viel Geld eingenommen, denn die Leute wollten rasch von ihren Sünden befreit werden.
Nun aber erschien dazumal eine etwas gescheitere Schrift von einem Astronomen Littrow. Aber dieser Astronom hat doch etwas ganz Besonderes berechnet, was sehr bemerkenswert ist. Er hat berechnet: Im Jahre 1832 war der Komet, der dann später auseinandergegangen ist, von der Erde noch dreizehn Millionen Meilen entfernt; aber er kommt eben immer näher. Er war früher ganz weit weg; jedesmal, wenn er kommt, rückt er näher, ist er der Erde näher. Und nun hat Littrow ganz richtig ausgerechnet, woran die Geschichte liegt.
Sehen Sie, die Gefahr, die die Leute ausgerechnet haben, daß dieser Komet mit der Erde zusammenstößt, die war damals 1872 im September. Hätte der Komet den Punkt dazumal schon erreicht gehabt, den er für dieses Jahr [1872] erst am 27. November erreicht hat, dann wäre die Geschichte noch immer nicht bei einem Kometenregen geblieben, sondern wäre trotzdem sehr schlimm geworden. Also diese Dinge gibt es schon. - Aber er hat ausgerechnet, warum die Geschichte doch so steht, daß 1933 - also wir haben jetzt 1924-, wenn der Komet so geblieben wäre, wie er im 18.Jahrhundert war, unbedingt ein Zusammenstoß erfolgen müsse, und die Erde müßte dabei kaputtgehen! - Die Rechnung stimmte auf das Haar. Nur konnten sich dazumal die Leute schon sagen: Der Komet hat es gnädig gemacht. Denn während er fähig geworden wäre, 1933 die Erde so durchzuschlagen, daß alle Meere vom Äquator heraufgeströmt wären nach dem Nordpol und die ganze Erde zugrundegegangen wäre - das konnte man ausrechnen -, hat er sich entzweigeteilt, und hat außerdem seine Materie, die ihm zu schwer geworden ist, als auseinandergestreute Meteorsteine abgegeben, die dann nicht mehr schädlich werden konnten.
Also sehen Sie, wir leben schon in einer Zeit, von der wir sagen können: Wäre der Komet nicht gnädig gewesen, so säßen wir heute alle nicht mehr da! Es ist schon so. Und zuletzt ist es so gekommen, daß er überhaupt nicht mehr als Komet erscheint, sondern immer an den Tagen, wo er erscheinen soll, kommt noch immer der Meteorregen. Er wirft seine gesamte Materie langsam im Laufe der Jahrhunderte aus und wird sehr bald überhaupt nicht mehr sichtbar sein; er wird nicht mehr kommen, weil er seine Materie langsam an den Weltenraum und etwas auch an die Erde abgegeben hat.
Da will ich Ihnen aber die andere Seite der Sache zeigen. Sehen Sie einmal, wenn man die menschliche Entwickelung verfolgt, dann ist es so, daß ja die geistigen Fähigkeiten der Menschen immer andere werden. Wer es nicht glaubt, versteht eben die ganze geistige Entwickelung der Menschheit nicht. Denn, nicht wahr, alle unsere Entdeckungen hätten ja viel früher gemacht werden müssen, wenn die Menschen dieselben geistigen Fähigkeiten gehabt hätten! Sie haben nicht geringere geistige Fähigkeiten gehabt, aber etwas andere in alten Zeiten. Das habe ich Ihnen ja in der verschiedensten Weise schon auseinandergesetzt, auch auf Fragen, die gestellt worden sind nach dieser Richtung.
Wenn man aber jetzt zurückgeht, so ist das ja nicht der einzige Komet, der in dieser Weise so gnädig durch den Weltenraum geht, daß er sich im rechten Moment spaltet und ganz auflöst, sondern es gibt eine ganze Anzahl anderer Kometen, die das taten. An die Kometen hat sich immer der Aberglaube angeschlossen. Anthroposophie betrachtet die ganze Sache absolut wissenschaftlich.
Aber wenn wir uns so weiterentwickeln würden, wie wir uns heute entwickelt haben, das wäre ja nicht auszudenken. Ach, die Menschheit ist ja so furchtbar gescheit! Vergleichen Sie nur einmal einen Menschen mit seiner Gescheitheit, mit dem, was er in der Schule gelernt hat, mit einem Menschen im 12., 13.Jahrhundert, der nicht schreiben konnte! Sie müssen nur bedenken: Wir haben ein sehr schönes Gedicht von Wolfram von Eschenbach, der war ein Adliger des 13. Jahrhunderts; er hat das Gedicht verfaßt - aber er hat nicht schreiben können; er hat sich müssen einen Pater kommen lassen, dem er es diktiert hat: das ist der «Parzival», nach dem Wagner seinen «Parsifal» umgedichtet und
komponiert hat! Also Sie sehen, die Leute haben dazumal andere Fähigkeiten gehabt. Wir brauchen gar nicht weiter zurückzugehen als bis ins 12. bis 13. Jahrhundert: Dazumal konnte ein Adliger nicht schreiben; lesen konnte der Wolfram von Eschenbach, aber schreiben konnte er nicht.
Nun, sehen Sie, diese Fähigkeiten, die kommen ja nicht von selber, die entwickeln sich ja. Und wenn wir so fortfahren würden, wie wir jetzt es tun, daß wir jeden vollpfropfen zwischen dem sechsten und zwölften, vierzehnten Lebensjahr mit allen möglichen Wissenschaften -was ja gut ist auf der einen Seite -, dann würden wir Menschen aber alle nach und nach das werden, was früher gar nicht da war, und was jetzt so häufig da ist, wie man sagt: nervös. Nervöse Menschen würden wir werden. Und da kommt etwas, was Ihnen klarmachen wird, daß die Herren Ärzte, die dazumal in den vierziger Jahren so dumm waren, daß sie geglaubt haben, die Menschen würden gar nicht leben können, wenn es Eisenbahnen gibt, daß diese Herren Ärzte vom Standpunkt ihrer Wissenschaft aus doch nicht so ganz dumm waren! Denn, was sie dazumal haben wissen können, das geht alles darauf hin, daß sie sagen mußten: Wenn der Mensch in der Eisenbahn fährt, so wird er einfach nach und nach ganz arbeitsunfähig; das Gedächtnis verliert er, die Nerven werden aufgeregt, zappelig wird er. - Das konnten sie sich nach ihrer damaligen Wissenschaft sagen. Es war ganz richtig, absolut richtig, was sie sich sagten; aber sie bedachten eines nicht. Ein bißchen nervöser sind ja auch die Menschen geworden. Wenn Sie nur vergleichen, wie Sie heute, wenn Sie von der Arbeit kommen, anders sind, als die Leute aus den dreißiger, vierziger Jahren, die sich abends die Schlaf-mützen aufgesetzt haben und so furchtbar gemütliche Leute waren, ganz ohne alle Nerven! Die Welt ist schon anders geworden in dieser Beziehung; aber doch nicht so stark, als es sich die Herren Ärzte von Nürnberg dazumal vorstellten. Nun ist es aber so: Die Nürnberger hängen keinen, wenn sie ihn nicht erst haben; und so ist es bei den Nürnbergern dazumal auch gewesen: sie haben keine Wissenschaft betrieben, die sie nicht erst hatten. Nun aber, was konnten diese Herren Ärzte dazumal nicht wissen? Sie konnte nicht wissen, daß, während sie das alles lernen, dieser Komet sich allmählich auflöst. Was tut denn
der? Ja, meine Herren, diesen feinen Meteorregen, den haben wir ja von diesem Kometen! Statt daß er einmal mit der Erde zusammenstößt und der Menschheit den Schädel einschlägt, statt dessen gibt er langsam seine Materie ab. Die ist in der Erde drinnen, diese Materie, Stück für Stück. Alle paar Jahre lieferte der Komet etwas für die Erde. Und diejenigen Leute, die von der Wissenschaft leben wollen und nicht zugeben wollen, daß da die Erde etwas aus dem Weltenraum einfach frißt, die sind so dumm wie diejenigen, die behaupten, wenn einer ein Stück Brot ißt, so ist es nicht in ihm drinnen. Es ist natürlich in der Erde drinnen, was wir vom Kometen haben. Aber die Menschen übersehen das immer. Die Wissenschaft nimmt davon keine Notiz. Wo haben wir denn das, was der Komet abgegeben hat? Das geht in die Luft über; von der Luft geht es über ins Wasser, wenn das Wasser hinauf und wieder heruntergeht; vom Wasser geht es über in die Wurzeln der Pflanzen, von den Wurzeln der Pflanzen in dasjenige, was wir auf den Tisch tragen. Und von dem geht es in unseren eigenen Leib, und wir essen mit dasjenige, was uns der Komet gegeben hat seit Jahrhunderten. Das hat sich aber längst vergeistigt. Und statt daß 1933 der Komet der Erde den Garaus macht, hat er sich längst in die Erde als eine Erdennahrung hineinbegeben und nimmt von den Menschen weg -durch das, daß er ein Heilmittel ist, ein Weltheilmittel - die Nervosität.
Sehen Sie, da haben Sie ein Stück Geschichte: Die Kometen erscheinen draußen am Himmel, und nach einiger Zeit kommen sie zu uns vergeistigt aus der Erde heraus. Solche Sachen greifen doch jetzt schon ein ins Menschenleben. Jetzt kann man nicht mehr so die Geschichte darstellen, wie man sie wörtlich darstellt, wenn man ein Philister sein will, sondern jetzt muß man Rücksicht darauf nehmen, was in der Welt vorgeht im Geistigen. Das kann man nur, wenn man die Welt geistig durchdringt, mit Anthroposophie durchschaut. Da können Sie ja sagen: Nun ja, schön, diese Dinge, die werden schon vor sich gehen. Gerade der Komet lehrt uns, daß wir Menschen dumm bleiben können; wir brauchen uns nicht darum zu bekümmern. Denn wenn auch die Leute dann aufgeklärt sein wollen, praktisch sind sie dann furchtbar schicksalsgläubig, denken sich: In der Welt wird schon alles ordentlich zugehen. - Ja, aber es gibt die Möglichkeit, so etwas zu wissen, sich zu
beschäftigen mit einer solchen Wissenschaft, oder sich nicht damit zu beschäftigen.
Nun, meine Herren, da ist eines gekommen: Sie wissen, ich habe durch Jahre hindurch gerade unter Arbeitern Vorträge gehalten. In diesen Vorträgen, die ich gehalten habe, habe ich oftmals aufmerksam gemacht auf einen großartigen Vortrag von Lassalle, der geheißen hat «Die Wissenschaft und die Arbeiter». Ich weiß nicht, ob heute die Sache noch viel bekannt ist; aber ich bin ja mittlerweile sehr alt geworden, und ich habe die Entstehung der Arbeiterbewegung gesehen. Von meinem Elternhaus konnte ich zum Fenster hinausschauen: Da sind die ersten Leute, die dazumal noch die großen Hüte getragen ha-ben - demokratische Hüte -, da sind die ersten Sozialdemokraten vorbeigezogen im Anfang der siebziger Jahre, hinaus in den Wald, um da ihre Versammlungen abzuhalten. Also ich habe die ganze Entstehung der Dinge durchaus immer mitgemacht, Stück für Stück. Und dazumal verehrten die Leute noch sehr Lassalle. Man fand überall, wo Arbeiterversammlungen waren, Lassalles Büste. Heute sind die Dinge mehr oder weniger vergessen worden, denn es ist ja fünfzig Jahre her. Dazumal war ich acht, zehn oder elf Jahre alt, aber ich bekümmerte mich schon um die Sache. Nun hat Lassalle diesen Vortrag gehalten - dazumal war es acht, neun Jahre her, daß er diesen Vortrag gehalten hatte: «Die Wissenschaft und die Arbeiter». Und in diesem Vortrag hat er darauf aufmerksam gemacht, daß die ganze Arbeiterfrage abhängt von der Wissenschaft, daß die Arbeiter zuerst eine soziale Anschauung aus der Wissenschaft heraus gebildet haben, was all den anderen Menschen nicht eingefallen ist. Das war in einer gewissen Weise außerordentlich wichtig.
Aber nun denken Sie einmal, was ist denn geworden seit jener Zeit? Ich frage Sie: Sind Sie zufrieden? Können Sie zufrieden sein mit der Art und Weise, wie sich die Arbeiterfrage entwickelt hat? Haben Sie nicht furchtbar viel zu klagen überall über die Art und Weise, wie die Arbeiter tyrannisiert werden von ihren Gewerkschaften und so weiter? Das spürt man; das spürt der Arbeiter. Aber was er nicht spürt, das ist das, woher das gekommen ist. Woher ist es gekommen? Es ist davon gekommen, daß ganz richtig ist, daß die Lösung der Arbeiterfrage
nicht gefunden werden kann ohne Wissenschaft. Früher hat man die Frage durch Religion und so weiter gelöst. Jetzt müssen diese Fragen mit Wissenschaft gelöst werden. Aber dazu muß man erst ein wirklich wissenschaftliches Denken haben! Und das hatte niemand, weil man nur immer auf die Materie ging, weil die ganze Wissenschaft Materialismus war. Niemals wird irgend etwas gelöst werden in der sozialen Frage, bevor die Wissenschaft nicht wiederum geistig wird.
Geistig kann sie nur werden, wenn sie sich herbeiläßt, in allem -sei es in der Kartoffel, sei es in dem Kometen - das Geistige zu suchen. Denn die Dinge suchen, wie sie zusammenhängen, lernt man nur durch geistige Erkenntnisse. Und so lernt man auch nur durch geistige Erkenntnisse die sozialen Zusammenhänge kennen. Die muß man wirklich erkennen; dann wird man finden, daß die Dinge ja sehr, sehr gut gemeint waren, die zum Beispiel durch den Marxismus heraufgekommen sind, aber sie beruhten auf einer irrtümlichen Wissenschaft. Und das will ich Ihnen jetzt auch noch zeigen, inwiefern diese Dinge auf einer irrtümlichen Wissenschaft beruhen. Und das kann nicht gedeihen, was auf einer irrtümlichen Wissenschaft beruht.
Sehen Sie, es ist ungemein scharfsinnig, ungemein gescheit, wie der Marx berechnet, und man kann gar nichts einwenden, weil er eben in der rein materialistischen Wissenschaft drinnensteckt. Alles klappt gerade so, wie es bei dem Astronomen 1773 geklappt hat, daß die Erde sich mit dem Kometen begegnet. Aber der Komet, das war ein anderer, als der spätere, war eben längst so dünn geworden, daß er der Erde nichts mehr getan hat! Und das, was Marx berechnet, beruht auf einer ebenso ausgezeichneten, aber ebenso nicht vollkommenen Wissenschaft.
Nehmen Sie an eines, was er berechnet hat. Er hat gesagt: Wenn der Mensch arbeitet, verbraucht er innerlich Kräfte. - Gewiß, wir geben die Kräfte an die Arbeit ab, werden abends müde, und haben also während des Tages eine bestimmte Anzahl von Kräften abgegeben. Jetzt braucht der Arbeiter selbstverständlich dasjenige, was ihm diese Kraft wieder ersetzt. Man kann also das ausrechnen; die Rechnung klappt, stimmt vollkommen. Es ist absolut richtig; man kann es ausrechnen, wieviel Arbeitslohn da sein muß, damit der Arbeiter seine
Kräfte ersetzen kann. Ja, kriegt man aber auf diesem Wege, auf dem Marx sucht, wirklich den richtigen Arbeitslohn und so weiter heraus? Das ist die Frage, ob man ihn da herauskriegt! Daß er bis jetzt noch nicht sehr starken Eindruck gemacht hat, das zeigt sich ja; aber man kann ihn gar nicht auf diesem Wege herauskriegen, weil die Wissenschaft zwar ausgezeichnet, aber falsch ist.
Denken Sie nur einmal: Einer ist da, der arbeitet den ganzen Tag nichts. Entweder geht er spazieren, oder er kann selbst von einem Stuhl auf den anderen sich setzen, wenn er ein Rentier ist. Der verbraucht ebenso seine Kräfte vom Morgen bis zum Abend, ganz genau so! Ich habe einmal gesehen in Arbeiterkonzerten, daß die Leute, die Arbeiter waren, viel weniger müde waren als die Rentiers, die gar nichts getan haben. Die gähnten fortwährend; die anderen waren sehr fidel.
Ja, sehen Sie, da steckt ein Fehler in der Rechnung. Es sind gar nicht dieselben Kräfte, die wir innerlich in unserem Organismus verbrauchen, die wir äußerlich an die Arbeit abgeben! Das ist gar nicht wahr. Und deshalb kann man auf diesen naturwissenschaftlichen Grundlagen die ganze Rechnung nicht aufbauen. Man muß die Sache in ganz anderer Weise machen; man muß die Sache auf Menschenwürde und Menschenrecht und so weiter begründen. Und so ist es in sehr vielen Dingen. Und die Folge davon ist, daß aus der Wissenschaft, wie sie bisher war, auch in sozialer Beziehung eine furchtbare Verwirrung hergegangen ist und ein Nichtwissen.
Mit Geisteswissenschaft können Sie jetzt sagen, wieviel wert die Kartoffeln sind für die Nahrung, wieviel wert der Kohl für die Nahrung ist, wieviel wert das Salz ist und so weiter. Und dann kriegen Sie heraus, was der Mensch haben muß, damit er gesund gedeihen kann. Das kriegen Sie erst durch Geisteswissenschaft heraus. Da müssen Sie zuerst aufbauen auf einem solchen Wissen, das aus Geisteswissenschaft kommt. Dann können Sie übergehen zu der Betrachtiing des sozialen Lebens. Dann wird die Arbeiterfrage ganz andere Gestalt annehmen, und die Sache wird endlich auf eine gesundere Basis kommen, gerade dadurch, daß man alles geistig ansieht.
Und so, sehen Sie, verstehen die Menschen heute überhaupt gar nicht, wie die Dinge in der Welt zusammenhängen, glauben immer,
alles geht so fort, wie es ist; aber es ist eben nicht so! Es muß fortwährend der Mensch verstehen, wie die Dinge in der Welt sich ändern. Und das größte Unglück, könnte man sagen, das ist, daß die Menschheit früher abergläubisch war und jetzt wissenschaftlich. Aber Stück für Stück hat sich in die Wissenschaft überall der Aberglaube hinein-geschlichen, und heute haben wir eben einfach eine Naturwissenschaft mit Aberglauben. Die Leute glauben, wenn der Magen voll ist mit Kartoffeln, dann habe man etwas davon. Man verdirbt sich dadurch die Gesundheit des Kopfes, weil der Kopf da Verdauungsorgan werden muß!
Und so sind alle Fragen eben so zu behandeln, daß man dabei das Geistige nicht vernachlässigt, wie es durch lange Zeiten geschehen ist, sondern daß man das Geistige überall hineinbringt. Und so haben die Leute geredet in den sechziger, siebziger Jahren: Wissenschaft muß unter die Arbeiter kommen. - Aber richtige Wissenschaft, die dazumal gar nicht vorhanden war, und die man jetzt sucht eben als Geisteswissenschaft, die nur äußerlich den Namen Anthroposophie hat. Es will einfach diese Anthroposophie nicht - wie man es bisher gemacht hat - das Pferd beim Schwanz aufzäumen, bei der Materie, sondern beim Kopf, wie es richtig ist: beim Geiste; dann wird man die Dinge finden, wie es richtig ist, und wird auch wiederum zu den richtigen Erziehungsmethoden kommen, wird eine Pädagogik haben, in der man die Kinder richtig erzieht. Davon hängt auch ungeheuer viel ab. Und man wird in einer rechtmäßigen Weise ins soziale Leben hineinkommen.
In einer Stunde kann ich natürlich nur andeuten, wie es ist; aber dazu waren alle die Vorträge veranstaltet, um aus den Fragen angedeutet zu bekommen, was die Herren wissen wollten. Vielleicht werde ich in der nächsten Stunde noch eine Ergänzung dazu sagen - heute konnte ich nur die Grundlage geben -, damit das noch immer besser verstanden werden kann. Aber einiges über das, was Sie gerade mit Ihrer Frage wollten, haben Sie wohl schon daraus entnehmen können: Was eigentlich Geisteswissenschaft will.
Also am nächsten Mittwoch dann weiter.
VIERZEHNTER VORTRAG Dornach, 24. September 1924
Guten Morgen, meine Herren! Nun will ich heute noch einige Worte hinzufügen zu dem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Und dann findet sich vielleicht die Möglichkeit, daß der eine oder der andere etwas zu fragen hat.
Sehen Sie, eigentlich kann man die Frage, die gestellt worden ist, nur dann richtig verstehen und beantworten, wenn man ein bißchen zurückblickt in der ganzen Entwickelung der Menschheit. Es ist ja eigentlich ein wissenschaftliches Märchen, daß die Menschen ursprünglich tierähnlich waren, tierähnlichen Verstand und so weiter gehabt haben. Denn dem widerspricht die Tatsache, daß eben aus den ältesten Zeiten, die man geschichtlich verfolgen kann, Dinge da sind, wenn auch in dichterischer Gestalt, die von einer großen Vollkommenheit der Menschen sprechen, die damals, in Urzuständen der Erde, gelebt haben. Die Menschen waren dazumal auch durchaus nicht in dem Sinne ungleich in der Welt, daß sie diese Ungleichheit so gefühlt hätten wie heute, sondern es war die Zeit, in der das besonders Ungleiche der Menschheit hervorgetreten ist, immer der Zeitraum, in dem die Menschen mehr oder weniger das richtige Wissen verloren hatten.
Nehmen Sie nur einmal die Tatsache, daß gewiß im alten Ägypten zu einer gewissen Zeit das in reichlichem Maße vorhanden war, was man Sklaverei nennt. Aber die Sklaverei war nicht immer da, sondern sie hat sich herausgebildet aus den früheren Zuständen dann, als die Menschen das richtige Wissen von der Welt, die richtige Wissenschaft verloren hatten, nicht mehr wußten, was das eigentlich bedeutet. Und so müssen Sie sich ja auch bei einem vernünftigen Denken sagen: Woher ist es denn gekommen, daß eine so lebhafte Arbeiterbewegung zum Beispiel entstehen mußte?
Natürlich mußte sie entstehen, weil allmählich die Verhältnisse das notwendig machten, weil allmählich die Menschen fühlten: So kann es nicht weitergehen -, und sagen wollten, in welcher Weise die Sache sich verbessern sollte. Aber nicht wahr, die eine Seite der Sache, daß die Arbeiterfrage
so brennend geworden ist, das ist ja der Umstand, daß die Industrie und alle Erfindungen und Entdeckungen die Gestalt angenommen haben, die sie nun eben einmal heute haben. Als es noch nicht diese ausgebreitete Industrie gab, war die drückende Lebensnot eben nicht da. Nun aber, woher kommt denn das, daß mit der Industrie die drückende Lebensnot entstehen muß?
Man kann natürlich nicht sagen - das wird im Grunde genommen auch wieder jeder vernünftige Mensch zugeben -, daß diejenigen Menschen, die nicht in Not leben, die also wenigere sind, und die also, sagen wir, die Kapitalisten, wie man sie gewöhnlich nennt, sind -, man kann nicht sagen, daß die aus reiner Freude an der Not diese Not bewirken; denn natürlich wäre es ihnen lieber, wenn alle Menschen zufrieden wären. Das muß man ja natürlich auch bemerken.
Aber dann entsteht die andere Frage, diese: Woher kommt das, daß die wenigen, die zu irgendwelchen führenden Stellungen kommen, eigentlich nicht den Sinn dafür haben, irgendwie zu sorgen dafür, daß die Sache in irgendeiner Weise so kommt, daß die Menschen im weitesten Umkreise zufrieden sein können?
Sehen Sie, meine Herren, Sie müssen ja auch das sehen: Es sind natürlich, auch wenn man sagt, der Arbeiter verdient nicht solche Massen, da auch eigentlich nur die wenigen, die führende Stellungen in den Gewerkschaften haben, von denen dann die anderen abhängen. Es kommt immer darauf hinaus, auf ganz selbstverständliche Art, daß immer einige wenige es sind. So wie sich die Dinge entwickelt haben, können Sie ja schon ganz klar sehen - das spüren die Arbeitermassen -, daß diese wenigen auch nicht wissen, wie man es machen soll. Das hat sich besonders in der letzten Zeit sehr klar herausgestellt, daß diese wenigen auch nicht wissen, wie man es machen soll. So kann man nur sagen: Da fehlt etwas. - Natürlich fehlt etwas. Dasjenige, was fehlt, das ist eben nach der Ansicht der anthroposophischen Geisteswissenschaft das Wissen von der geistigen Welt. Und das könnte sich Ihnen bestätigen, wenn Sie eben klar sind darüber, daß man nicht so sagen kann: Jetzt sind die Menschen aufgeklärt, und anfangs gab es auf der Erde nur ganz Dumme. - Das ist ja die heutige, so allgemeine Ansicht. Aber das ist gar nicht wahr. Als die Menschheit im Anfang auf der Erde
war, entwickelten die Menschen ein starkes Wissen nicht nur von dem, was auf der Erde ist, sondern auch von dem, was Sternenhimmel ist. Wenn heute das in den Aberglauben hineingekommen ist - ich habe Ihnen das ja schon öfter ausgeführt -, so ist das eben aus dem Grunde, weil man in späterer Zeit nicht mehr geforscht hat; dann sind die Sachen mißverstanden worden. Aber ursprünglich gab es ein ausgebreitetes Wissen von den Sternen. Heute hat man von den Sternen nur ein Wissen, das rechnet, aber das nicht eingehen kann auf das Geistige in den Sternen. Geradeso, sehen Sie, wie wenn jemand auf dem Mars lebte und von der Erde nur so viel wüßte, wie wir mit dem gewöhnlichen Bewußtsein, mit der gewöhnlichen Wissenschaft vom Mars wissen - wie einer, der glaubte, da ist keine Seele auf der Erde, während doch fünfzehn- bis zwanzighundert Millionen Seelen auf der Erde sind! Geradeso verhalten sich die Menschen in bezug auf die Sternenwelt. Ja, die Sternenwelt ist überall voller Seelen, ist überall beseelt - nur, die Seelen sind verschieden.
Nun können Sie ja natürlich sagen: Man kann aber nicht hinaufschauen, und man kann daher nicht wissen, wie es ausschaut auf den Sternen. - Das ist eben der große Irrtum. Sehen Sie, warum kann der Mensch, wenn er da steht, dort das Klavier sehen? Weil sein Auge dazu eingerichtet ist. Das Auge ist auch nicht dort beim Klavier. Und wenn der Mensch blind ist, wenn sein Auge nicht sieht, so kann er eben das Klavier nicht sehen. Geradeso kann der Mensch - und das zeigt eben die Geisteswissenschaft, die Anthroposophie -, wenn er nicht bloß so sich entwickelt, wie man sich von der Kindheit auf durch die heutige Erziehung entwickelt, sondern wenn er sich weiterentwickelt, tatsächlich wahrnehmen das Geistige in den Sternen. Und es ist ursprünglich in der Menschheit wahrgenommen worden! Und dann rechnet man nicht mehr bloß mit den Sternen, sondern man weiß, daß dieser Stern auf den Menschen den einen Einfluß hat, jener Stern den anderen Einfluß hat. Wenn man schon nachweisen kann, daß der Mars seinen Einfluß, wie ich Ihnen gezeigt habe, auf Engerlinge und Maikäfer hat, so kann man eben auch nachweisen, daß die Sterne alle einen Einfluß auf das menschliche Geistesleben haben. Das haben sie. Aber dieses Sternenwissen, das ist eben ganz und gar untergegangen. Und was ist
an die Stelle getreten? Nun, während früher die Menschen gewußt haben, wenn sie zum Mond hinaufgeschaut haben: Vom Mond kommen die Kräfte aller Fortpflanzung auf der Erde, es würde kein Wesen Nachkommen haben, wenn nicht der Mond die Fortpflanzungskräfte herschickte; es würde kein Wesen wachsen, wenn nicht von der Sonne die Wachstumskräfte kämen; es würde kein Mensch denken können, wenn nicht vom Saturn die Denkkräfte kämen - während man das wußte, weiß man heute gar nichts, als wie schnell der Saturn sich bewegt, wie schnell der Mond sich bewegt, ob der Mond ein paar erloschene feuerspeiende Berge hat oder nicht, aber weiter gar nichts. Man will nichts weiter wissen. Man rechnet bloß aus dasjenige, was man von den Sternen wissen will.
Nun ist die Industrie heraufgekommen. Gehen wir jetzt von der Sternenwelt zu der Menschenwelt. In der Zeit, in der man nur rechnen konnte an den Sternen, hat man angefangen, da die Industrie heraufgekommen ist, auch in der Industrie nur zu rechnen, hat nichts getan als gerechnet. Und weil man bloß berechnete, weil man nichts anderes getan hat als berechnen, hat man den Menschen ganz vergessen, der sich nicht errechnen läßt, hat ihn selber wie ein Glied an der Maschine behandelt. Und so ist der ganze Zustand gekommen, der heute da ist. Und niemals werden die Menschen auf der Erde bloß errechnen können, wie die Zustände sein sollen, sondern sie werden nur wissen, wie die Zustände sein sollen auf der Erde, wenn man noch etwas anderes weiß. Das ist die Sache. Und da muß man sagen: Ja, mit dem Wissen des Menschen ist es wirklich gerade in unserer aufgeklärten Zeit furchtbar abwärtsgegangen. - Da ist es so, wie ich Ihnen hier schon einmal erzählt habe, daß man bei einer Versammlung von Landwirten vor kurzem durchaus darauf gekommen ist, wie alle Produkte seit Jahrzehnten schlechter geworden sind für die ganze Menschheit. Ja, das beruht eben darauf, daß man, mit Ausnahme der Bauern, die noch etwas instinktiv sich bewahrt haben von früherem Wissen, eigentlich nichts mehr weiß über die Art und Weise, wie man einen Acker behandeln muß. Aber wodurch erlangt man ein Wissen, wie man einen Acker behandeln muß?
Ja, meine Herren, dadurch nicht, daß man bloß auf der Erde rechnet,
daß man bloß weiß vom Mond, er macht in achtundzwanzig Tagen einen Rundgang, sondern dadurch, daß man die Kräfte kennt, wie der Mond auch in der Fortpflanzung des Getreidewesens und so weiter wirkt. Aber dieses Wissen ist ganz vergessen worden, und hat man schon das Wissen nicht von den Sternen und ihrer Wirkung auf alles dasjenige, was auf unseren Feldern vor sich geht, so hat man noch weniger das Wissen von demjenigen, was in der Menschenwelt ist. Und so sind lauter Rechnungsgeschichten aus der Sozialwissenschaft geworden, lauter Rechnungsgeschichten! Kapital, Arbeitszeit, Lohn sind lauter Zahlen, die man ausrechnet. Aber mit alldem, was man ausrechnet, kommt man dem menschlichen Leben nicht bei, kommt man überhaupt gar keinem Leben bei. Und das ist der Fluch der neueren Zeit, daß alles bloß ausgerechnet werden soll. Und lernen, wie man nicht bloß zu rechnen hat, sondern wie man die Dinge zu behandeln hat, so wie sie sind, das kann man nur, wenn man es zuerst an der Sternenwissenschaft lernt. Heute ist es so, daß der Mensch schon von vornherein, wenn er von der Sternenwissenschaft hört, sich sagt: Das ist doch eine Trottelei; das wissen wir doch längst, daß die Sterne keinen Einfluß haben. - Aber es ist eine Trottelei, zu sagen, daß die Sterne keinen Einfluß haben! Denn, was ist denn gekommen, als die Leute gesagt haben, sie glauben an keinen Sterneneinfluß auf alles, was auf der Erde ist? Das ist gekommen, daß sie nichts mehr gewußt haben; das ist das Konkrete! Und sagen wir also zum Beispiel Kapital - das läßt sich ausdrücken in Zahlen, läßt sich berechnen. Aber, was wird damit festgestellt, wenn man es berechnet? Wenn man dasjenige, was Kapital ist, bloß berechnen will, dann ist das ganz einerlei, wer dieses Kapital besitzt. Denn es ist eben doch so: Ob es ein einzelner besitzt, ob es alle zusammen besitzen - wenn das Kapital bloß als Rechnungszahl arbeitet, kommen dieselben Verhältnisse heraus. Erst dann, wenn man wieder eine Art und Weise findet, in das Leben so einzugreifen, daß man auf den Menschen losgehen kann, dann wird auch eine soziale Wissenschaft zustande kommen, die nicht nichts machen kann, wie es bei der heutigen Wissenschaft der Fall ist, sondern die wirklich etwas machen kann. Und deshalb möchte ich zu der Beantwortung der Frage, wie ich sie neulich gab, eben noch das hinzufügen, daß ich Ihnen sage: Man
soll nur sehen, wie das wird, was durch die Anthroposophie herauskommt. - Natürlich ist das heute noch im Anfange. Natürlich sieht es in vieler Beziehung ganz ähnlich, ganz gleich aus wie die andere Wissenschaft. Aber es wird sich allmählich entwickeln zu einem vollkommenen Wissen vom Menschen, wie sich zum Beispiel auf den Gebieten der Erziehung und Pädagogik die Schule schon entwickelt hat. Und dann wird gerade diese anthroposophische Wissenschaft erst fähig sein, zu wissen, um was es sich in der sozialen Frage handelt, und wird dann eingreifen. Heute können Sie nur dasjenige sehen, daß eben das gegenwärtige Wissen, wenn es noch soweit kommt, tatsächlich nicht eingreifen kann, sondern überall steckenbleibt.
Das ist dasjenige, was ich noch hinzufügen wollte. Sind Sie jetzt etwas befriedigt soweit? (Ja, Ja!) Es könnte ja noch vieles hinzugefügt werden; aber es wird sich ja bei anderen Gelegenheiten noch mancher Gesichtspunkt ergeben.
Nun, hat sich vielleicht noch einer eine Frage ausgedacht?
Frage: Oh man etwas darüber wissen könne, woher der Mensch stammt, von wo der Mensch herkommt?
Dr. Steiner: Nun, meine Herren, das ist eine Frage, über die ja sehr viele von denen, die jetzt hier sind, schon vieles von mir gehört haben; aber die Herren, die jetzt neu gekommen sind, haben natürlich ein Interesse daran, daß solche Fragen behandelt werden. Und diejenigen, die es schon gehört haben, werden ja auch ganz gern die Sache neuerdings hören.
Wenn man den Menschen betrachtet, wie er auf der Erde heute herumgeht, so sieht man ja zunächst vom Menschen den Leib. Man merkt allerdings, daß er denkt, empfindet, fühlt. Wenn man einen Stuhl anschaut, so kann man noch so lange warten - er fängt nicht an herumzugehen, weil er nicht wollen kann. Man merkt: Der Mensch, der will. Aber im allgemeinen kann man sagen: Man sieht eigentlich nur den Leib.
Nun aber, wenn man diesen Leib in Betracht zieht, dann kann man sehr leicht zu der Ansicht kommen - und hier in der Anthroposophie werden nicht Ansichten einfach leichtsinnig vertreten, sondern
es werden alle Meinungen, die aufkommen können, wirklich berücksichtigt -, man kann sehr leicht zu der Meinung kommen: Dieser Leib ist alles am Menschen. Ja, wenn man das glaubt, so kann man viele Beweise dafür finden. Man kann zum Beispiel sagen: Ja, wenn man dem Menschen das eine oder das andere Gift beibringt, das nicht gleich zum Tode führt, so verliert mancher dadurch das Gedächtnis. - Das sieht so aus, als wenn der Leib eine Maschine wäre und alles nur beruhen würde auf dem Gang der Maschine. Wenn der Mensch, sagen wir, die Blutadern zersprungen hat im Gehirn, das Blut herausgeht und auf die Nerven drückt, kann er unter Umständen nicht nur das Gedächtnis, sondern den ganzen Verstand verlieren. Man kann also sagen: Vom Leib, vom Körper hängt alles ab. - Aber sehen Sie, das ist schließlich eine Art zu denken, die doch eigentlich nicht Stich hält, wenn man sie wirklich gründlich ausdenkt; sie hält nicht Stich. Denn man könnte zum Beispiel dann sagen: Ja, der Mensch denkt mit seinem Gehirn. - Aber was geht da eigentlich im Gehirn vor, während der Mensch denkt?
Nun, sehen Sie, es ist gar nicht richtig, wenn man wirklich erforschen kann den menschlichen Leib, daß der Mensch, wenn er denkt, irgend etwas im Gehirn vorgehen hat, sondern im Gegenteil: im Gehirn wird immer etwas zerstört, wenn der Mensch denkt. Die Stoffe werden abgebaut im Gehirn. Es ist immer ein klein wenig Tod da. Und der Tod, der dann eintritt auf einmal, das ist, daß der ganze Körper abgebaut wird. Aber das, was dann auf einmal geschieht mit dem menschlichen Körper, wenn der Mensch stirbt, das geht gleicherweise immer im menschlichen Körper vor sich. Und nicht nur, daß der Mensch durch seine Absonderungsorgane, im Urin und in den Fäkalien absondert und im Schweiß, sondern der Mensch sondert ja auch sonst ab. Denken Sie nur einmal, was Sie alle für Köpfe hätten, wenn Sie sich nie Ihr Haar schneiden ließen! Der Mensch sondert da etwas ab. Denken Sie, was Sie für Krallen hätten, wenn Sie sich nie die Nägel schneiden würden! Aber das ist nicht nur da der Fall, sondern fortwährend schuppt die Haut ab -. das merkt man nur nicht -, schuppt ab und fliegt weg. Dasjenige also, was der Mensch an Stoff an sich hat, das stößt er fortwährend aus. Das ist beim Urin und bei den Fäkalien nicht so bedeutsam, weil da zum großen Teil das drinnen ist,
was man einfach ißt, ohne daß es in den Körper geht. Aber bei dem, was sich aus dem Nagel absondert, das geht durch den ganzen Körper durch.
Nun aber will ich Ihnen folgendes sagen: Nehmen Sie an, Sie nehmen eine Schere und schneiden sich einen Nagel. Was Sie da wegschneiden, haben Sie ungefähr vor sieben bis acht Jahren gegessen, da haben Sie es zu sich genommen. Das ist hineingegangen in Blut und Nerven und so weiter, ist durch den ganzen Körper gegangen. Danach hat es sieben, acht Jahre gebraucht; jetzt schneiden Sie es ab. Und dieses Abgeschuppte, das heute weggeht, ist wiederum dasselbe, was Sie vor sieben, acht Jahren gegessen haben. Ja, aber, meine Herren, denken Sie doch einmal, wenn Sie den heutigen Körper anschauen, in dem Sie da sitzen - wenn Sie vor sieben, acht Jahren da gesessen hätten, das wäre doch ein ganz anderer Körper! Denn alles dasjenige, was Sie dazumal hatten, ist abgeschuppt, ist mit den Nägeln abgeschnitten, mit den Haaren abgeschnitten, mit dem Schweiß herausgegangen. Das ist weg und der ganze Körper, mit Ausnahme von wenigem, dem Knochenbau und so weiter, ist in sieben bis acht Jahren erneuert.
Nun fragt man sich: Kommt das Denken davon, daß der Körper fortwährend aufbaut, oder davon, daß der Körper abbaut? Das ist wichtig! Denken Sie einmal, wenn Sie irgend etwas im Körper haben, wodurch zuviel aufgebaut wird - ich will also sagen, wenn Sie einmal ein Gläschen zuviel trinken, oder nicht nur ein Gläschen, das können ja die meisten vertragen, oder wenn Sie halt, je nach dem Maße, was Sie trinken können, zuviel trinken. Meine Herren, was geschieht dann? Dann kommt das Blut in sehr rasche Tätigkeit. Da wird furchtbar rasch aufgebaut. Und jetzt ist es so: Wenn einer fortwährend aufbaut, kriegt er Ohnmacht, wird er bewußtlos. Wer zuviel sein Blut in Wal-lungen bringt, zuviel aufbaut, wird bewußtlos. Vom Aufbau kommt das Denken nicht, sondern das Denken kommt von diesem kleinen, teilweisen Abbau im Gehirn - es wird immer ganz wenig abgebaut im Gehirn. So daß Sie sagen können, wenn Sie sich das irgendwie aufzeichnen: Da wird aufgebaut - es wird aber auch immer abgebaut, zerstört! Würde nicht zerstört im menschlichen Körper, würde der Mensch gar nicht denken, gar nicht empfinden können. So daß also das Denken
in Wirklichkeit nicht von unserem aufbauenden Körper herrührt, sondern gerade dadurch, daß wir ihn fortwährend ein bißchen töten. Deshalb müssen wir ja schlafen, weil im Schlaf das Denken nicht tätig ist. Da wird rasch dasjenige wiederum gutgemacht, was fortwährend durch das Denken abgebaut wird. So daß gerade Schlafen und Wachen uns richtig darüber belehrt, daß während des Denkens fortwährend ein wenig Tod da ist im Körper.
Ja aber, denken Sie sich einmal das Bild, nicht vom menschlichen Körper, sondern vom menschlichen Anzug; wenn Sie den ganz ausziehen, haben Sie sich ja selber, wie Sie sind; Sie sind zwar nicht mehr salonfähig, aber Sie sind doch noch da und können einen anderen Anzug anziehen. So macht es der Mensch sein ganzes Erdenleben durch! Er zieht alle sieben bis acht Jahre einen neuen Leib an und legt den anderen ab. Bei den Tieren ist das vorgebildet; da sieht man das ganz deutlich, wie sie jedes Jahr die Haut ablegen. Würde man die Häute, die die Schlange jedes Jahr ablegt, zusammennehmen und untersuchen, so würde man finden: Nach einer bestimmten Anzahl von Jahren legt sie den ganzen Körper ab, nicht nur die ganze Schlangenhaut. Wir machen das nur nicht so bemerklich! Und die Vögel? Die mausern. Was tun sie, wenn sie mausern? Sie legen einen Teil von ihrem Körper ab, und nach einigen Jahren haben sie außer den Federn den ganzen Körper abgelegt. Ja, was bleibt denn da? Es muß doch etwas bleiben. Sie sitzen doch heute da, obwohl Sie von dem Körper, den Sie vor acht bis neun Jahren gehabt haben, nichts mehr an sich haben; Sie sitzen doch da! Sie haben sich einen neuen Körper angeschafft. Nun, meine Herren, die Seele sitzt da - das Geistige und das Seelische sitzen da, und das arbeitet fortwährend am Körper, baut sich den Körper auf. Und wenn Sie da irgendwo hingehen und Sie finden, da ist ein großer Haufen Steine, so werden Sie vermuten, da wird ein Haus gebaut. Sie werden doch gar nicht voraussetzen, daß jetzt die Steine da draußen alle anfangen Füße zu bekommen und sich selber übereinander-legen, und das Haus eritsteht! Ebensowenig fügen sich die Stoffe selber zum Körper zusammen. Den Leib, den wir in den ersten sieben bis acht Jahren haben - das kann man so erklären -, den haben wir von Vater und Mutter; aber er wird ganz abgeworfen, und nach sieben
bis acht Jahren bekommen wir einen neuen Leib. Den bekommen wir nicht von Vater und Mutter, den müssen wir uns selber aufbauen. Woher kommt der? Nun, der Leib, den wir haben in den ersten Lebensjahren, der kommt von Mutter und Vater. Wären die nicht da, so hätten wir ihn nicht. Dasjenige aber, was später aufbaut, das kommt aus der geistigen Welt. Denn was später aufbaut, nicht der Stoff, aber das Tätige, das, was aufbaut, das Wesen, das kommt aus der geistigen Welt. So daß wir sagen können: Wenn der Mensch geboren wird, so ist dasjenige, was er Körperliches hat für die ersten sieben bis acht Lebensjahre, von Mutter und Vater; aber das Seelische, das Geistige kommt aus der geistigen Welt. Und jetzt macht der Mensch das durch, daß er sich alle sieben oder acht Jahre seinen Körper austauscht, aber das Geistige behält. Und dann wird eben nach einiger Zeit der Körper verbraucht, und dasjenige, was zuerst hineingegangen ist als Geistig-Seelisches, geht wiederum in die geistige Welt zurück. So daß der Mensch vom Geistigen kommt und wiederum in die geistige Welt zurückgeht.
Sehen Sie, das ist wiederum etwas, was ganz und gar vergessen worden ist - aber auch nur aus dem Grunde, weil die Menschen heute gedankenlos geworden sind und nicht eigentlich in Wirklichkeit die Dinge durchschauen. Wenn man sieht, wie der Körper immer und immer wieder erneuert wird, dann kommt man eben darauf, daß die Kraft der Erneuerung durch das Seelische drinnen ist.
Nun, meine Herren, was essen Sie? Wollen wir einmal das, was der Mensch in den verschiedenen Speisen ißt, wollen wir das einmal auf die einfachsten Stoffe zurückführen, so ißt der Mensch erstens Eiweiß. Nicht nur in Eiern, sondern in den verschiedensten Stoffen, die er ißt, auch in Pflanzen, ist Eiweiß. Er ißt Fette und er ißt das, was man Kohlehydrate nennt, zum Beispiel die Kartoffel, und er ißt Salze. Alles übrige sind zusammengesetzte Stoffe; diese ißt er, nimmt sie in sich herein. Das sind Stoffe, die man von der Erde hat, die ganz von der Erde abhängig sind. Was wir also mit dem Mund aufnehmen, das ist ganz von der Erde abhängig. Aber wir nehmen ja nicht bloß Substanzen durch den Mund auf, sondern wir atmen. Wir nehmen Stoffe aus der Luft auf durch den Atmungsprozeß. Nun, das beschreibt man
einfach so, daß man gewöhnlich sagt: Der Mensch atmet Sauerstoff ein, atmet Kohlensäure aus - als wenn der Mensch nur eben einatme, ausatme, einatme, ausatme! Das aber ist nicht wahr; sondern in dem, was wir einatmen, sind ganz fein verteilte Nahrungsstoffe enthalten. Und wir leben nicht nur von dem, was wir essen, sondern von den fein verteilten Nahrungsstoffen, die in der Luft sind und die wir einatmen. Und wenn wir bloß essen würden, dann würden wir unseren Körper sehr oft auswechseln müssen; denn das, was wir essen, das wandelt sich sehr schnell im Körper um. Bedenken Sie doch nur einmal, was der Mensch für Beschwerden hat, wenn er dasjenige, was er absondern soll, nicht loskriegt nach vierundzwanzig Stunden zum Beispiel! Dasjenige, was mit dem Essen aufgenommen und abgesondert wird, das macht schnellen Prozeß; da würden wir uns nicht sieben bis acht Jahre Zeit zu lassen brauchen, wenn wir bloß von dem lebten. Aber weil wir ganz fein verteilte Nahrung aus der Luft aufnehmen und das langsam geht, verteilt sich die Auswechslung auf sieben bis acht Jahre.
Und sehen Sie, meine Herreii, das ist sehr wichtig, daß man weiß:
Der Mensch nimmt mit der Luft Nahrungsmittel auf. Denn wenn man jetzt richtig zu Werke geht mit der Wissenschaft, dann findet man:
Diejenige Nahrung, die der Mensch durchs Essen bekommt, die verwendet er zum Beispiel dazu, daß sein Kopf immerfort erneuert wird. Aber diejenige Nahrung, die der Mensch braucht, um, sagen wir zum Beispiel Nägel zu bekommen, die bekommt er nämlich gar nicht aus der Nahrung, die er ißt, sondern die bekommt er aus der Nahrung, die er vom Luftraum aufnimmt. Und so kriegen wir Nahrung durchs Essen und kriegen Nahrung, indem wir diese Nahrung vom Luftraum bei der Atmung aufnehmen.
Ja nun, die Sache ist aber so, daß wir dann, wenn wir die Nahrung aufnehmen durch die Atmung, aus dem Weltenraum zugleich das Seelische aufnehmen, nicht bloß den Stoff; sondern da ist der Stoff so fein verteilt, daß überall das Seelische drinnen lebt. So daß wir sagen können:
Der Mensch nimmt das Körperliche auf durch die Nahrung; das Seelische nimmt er fortwährend auf, lebt mit dem Seelischen durch die Atmung. Aber es ist nicht so, daß wir mit jedem Atemzug ein Stück
Seele hereinkriegen und mit jedem Ausatmungszug wieder ein Stück Seele ausatmen - da würden wir ja das Seelische immerfort auch aus-rangieren -, sondern es ist so, daß wir mit dem ersten Atemzug das Seelische hereinnehmen und das Seelische dann in uns das Atmen bewirkt, und mit dem letzten Atemzug geben wir das Seelische frei, und dadurch kann dieses Seelische wiederum in die geistige Welt zurückgehen.
Sehen Sie, jetzt kann man rechnen, wenn man die Sache so betrachtet. Wollen wir uns einmal das Folgende vor Augen halten, was Sie, vielleicht die meisten Herren, schon kennen, aber was Sie vielleicht doch etwas überraschen wird. Wenn Sie untersuchen, wieviel Atem-züge der Mensch in der Minute hat, so sind es 18. Rechnen wir einmal aus, wieviel der Mensch im Tage hat. In der Minute 18, so mussen wir mit 60 multiplizieren, das gibt 1080 Atemzüge in der Stunde. Jetzt in 24 Stunden 24 mal so viel: 25920 Atemzüge hat der Mensch im Tag.
Jetzt wollen wir einmal ausrechnen - ungefähr können wir das -, wieviel Tage der Mensch auf der Erde lebt. Nehmen wir an, damit die Rechnung einfach ist, das Jahr habe 360 Tage und nehmen wir weiter an, der Mensch würde 72 Jahre alt werden - würden wir mit 365 rechnen, so müßte ich ein anderes Alter nehmen -, nehmen wir das patriarchalische Alter an; also 72 Jahre mal 360 Tage, das sind 25920 Tage. 25 920 Tage lebt der Mensch; das ist dieselbe Zahl, die wir erhielten von den Atemzügen des Menschen an einem Tage! So daß man sagen kann: Der Mensch lebt soviel Tage in seinem Leben, als er atmet in einem Tage.
Ja, wenn der Mensch nun bei jedem Atemzug sterben würde - da es Eintagsfliegen gibt, so könnte es ja auch Einachtzehntelminutenwe-sen geben, es kommt ja nicht auf die Zeit an -, wenn der Mensch bei jedem Atemzug sterben würde, so könnte man sagen: Er atmet die Seele ein mit jedem Atemzug und atmet sie wieder aus. Aber er bleibt ja vorhanden. Und er bleibt vorhanden 25920 Tage.
Nun, jetzt rechnen wir einmal diese 72 Jahre als einen einzigen Atemzug! So wie ich vorhin gesagt habe: Der Mensch atmet seine Seele ein beim ersten Atemzug, atmet sie beim letzten Atemzug aus -nehmen wir an, er wird 72 Jahre alt im Durchschnitt, so können wir
sagen: Ein solches Einatmen der Seele, Ausatmen der Seele, das dauert 72 Jahre. Nun, meine Herren, nehmen wir an, das wäre ein Tag in der Welt. Dann müßten wir wiederum mit 360 multiplizieren und bekommen ein Weltenjahr: wieder 25920 - 72 mal 360! Wenn wir das Menschenleben als einen Weltentag annehmen, so bekommen wir das Weltenjahr: 25 920 Jahre.
Aber diese Zahl hat noch eine ganz andere Bedeutung. Diese Zahl hat diese Bedeutung: Wenn Sie jetzt achtgeben, wo am 21. März die Sonne, wenn der Frühling anfängt, aufgeht, da geht die Sonne just im Sternbild der Fische auf. Aber sie geht nur einmal genau dort auf; das verschiebt sich fortwährend. Und vor ungefähr fünfhundert Jahren ist die Sonne im Frühling nicht im Sternbild der Fische aufgegangen, sondern im Sternbild des Widders, noch früher im Sternbild des Stiers, und noch früher im Sternbild der Zwillinge, so daß die Sonne einen regelrechten Rundgang macht. Sehen Sie, wenn man die scheinbare Sonnenbahn aufzeichnet, so geht sie jetzt in den Fischen auf, vorher ist sie aufgegangen im Widder, noch vorher im Stier und so weiter; sie geht den ganzen Tierkreis herum, kommt wieder auf die Fische zurück. Und es wird einmal ein Punkt eintreten, wo die Sonne genau wieder in demselben Frühlingspunkt aufgeht. Es muß schon immer wieder dagewesen sein eine Zeit, wo die Sonne da aufgegangen ist, denn sie geht rundherum. Wie lange braucht sie dazu? Das kann man auch ausrechnen. Damit die Sonne ganz herumgeht, der Frühlingspunkt wieder an seinen alten Punkt zurückkommt, dauert das wiederum 25 920 Jahre.
Sehen Sie, wir atmen; atmen wir 25 920 mal, haben wir einen Tag vollendet. Unsere Seele ist geblieben, die Atemzüge wechseln. Haben wir 25 920 Tage vollendet, so haben wir ebenso oft gewacht wie geschlafen. Was haben wir da getan? Im Schlaf liegen wir da, denken nicht, bewegen uns nicht, sind untätig. Im Schlaf wird unser GeistigSeelisches in die geistige Welt für einige Stunden hinausbefördert. Im Aufwachen kriegen wir es wieder herein. Geradeso wie man den Atem heraus- und hereingehen läßt, achtzehnmal in der Minute, so lassen wir im Tag einmal die Seele heraus, nehmen sie wieder herein. Sehen Sie, das sind bloß größere Atemzüge, Schlafen und Wachen. So daß wir
sagen können: Das ganz kleine Atmen, das machen wir in einem Achtzehntel von einer Minute; das größere Atmen, das machen wir, wenn wir schlafen undwachen. Aber das größteAtmen:Wir atmen unser ganzes Geistig-Seelisches ein, wenn wir geboren werden, atmen es aus, wenn wir sterben. Aber was bleibt, das ist auch nur der große Atemzug. Denn wir gehen dann mit den 25920 Jahren, die die Sonne vollendet, rundherum, wieder zu der Sternenwelt empor. In demselben Momente, wo man also das Seelische betritt, meine Herren, muß man von der Erde weggehen zu der Sternenwelt.
Und sehen Sie, das sind die ersten Grundlagen, durch die man die Frage beantworten kann, die der Herr gestellt hat. Denken Sie sich einmal, was da für eine Regelmäßigkeit ist im Weltenall, wenn man die Zahl 25920 immer wieder herauskriegt! Im menschlichen Atem lebt der Sonnengang. Das ist ungeheuer wichtig.
Damit habe ich angefangen die Frage zu beantworten.
Am nächsten Samstag wollen wir fortsetzen um neun Uhr; da will ich weiter die Frage beantworten.
HINWEISE
Zu dieser Ausgabe
Textgrundlagen: Die Vorträge wurden von der Berufsstenographin Helene Finckh (1883-1960) mitstenographiert und in Klartext übertragen.
Der 1. Auflage von 1969 liegt eine vollständige Neuübertragung des ursprünglichen Stenogramms zugrunde. Textabweichungen gegenüber früheren Ausgaben sind hierauf zurückzuführen. Die 2. Auflage von 1977 ist im wesentlichen ein Nachdruck der Auflage von 1969.
Hinweise zum Text
Werke Rudolf Steiners innerhalb der Gesamtausgabe (GA) werden in den Hinweisen mit der Bibliographie-Nummer angegeben.
zu Seite
14 man macht ihnen auch einen kleinen Versuch vor: Den sog. Plateauschen Versuch, entwickelt von dem Physiker J.A. F. Plateau, 1801-1883.
28 am nächsten Mittwoch: Dieser für Mittwoch angesagte Vortrag fand erst ani Donnerstag, den 3. Juli, statt.
43 am nächsten Samstag: Wurde erst am Montag, den 7. Juli, gehalten.
57 1906 hatte ich Vorträge in Paris zu halten: Paris, 25. Mai-16. Juni1906, «Esquisse d'une cosmogonie psychologique» (Referate von Edouard Schuré), Paris 1928; 2. Aufl. unter dem Titel «L'Esotérisme chrétien/Esquisse d'une cosmogonie psychologique», Paris 1957; vorgesehen in Bibl.-Nr. 94.
64 Eugen Duhois, 1858-1940, holländischer Militärarzt. Vgl. seine Publikation:
«Pithecanthropus erectus, eine menschenähnliche Ubergangsform auf Java«, Batavia 1894.
83 als wir in Wien vor zwei Jahren einen Kongreß hatten: Der West-Ost-Kongreß vom 1.-12. Juni 1922. Siehe den Vortragszyklus «Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit«, Gesamtausgabe Dornach 1950, Bibl.-Nr. 83.
85 Berthold Schwarz, ein Franziskanermönch aus Freiburg, lebte um 1300.
Johann Gutenberg, um 1394-1468.
86 Laotse, chinesischer Weiser aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.
Konlutse, 531-478 v.Chr., chinesischer Philosoph.
121 Es gab einmal zwei Professoren: Gemeint sind der Philosoph Karl Ludwig Michelet, 1801-1893 und der Theologe und Philosoph Eduard Zeller, 1814- 1908. Vgl. dazu auch die Vortragszyklen «Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik«, Gesamtausgabe Dornach 1968, Bibl.-Nr. 293, S. 103 und «Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation/Pädagogischer Jugendkurs«, Gesamtausgabe Dornach 1964, Bibl.Nr. 217, S. 139.
126 am nächsten Mittwoch: Wurde am Donnerstag, den 5. August, gehalten.
129 Hippokrates von Kos, um 460-um 377, griechischer Arzt, Begründer der klassischen Medizin.
131 Kaiser Friedrich III., 1831-1888, litt an einem Kehlkopfleiden. Wer das Gesuch geschrieben hat, ist unbekannt.
148 Nikolaus Kopernikus, 1473-1543, Astronom.
150 Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Philosoph.
153 Venus fliegen falle: Dionaea muscipula, eine zu den Sonnentaugewächsen (Droseraceae) gehörende «insektenfressende« Pflanze, die an sumpfigen Stellen im wärmeren Nordamerika wächst. Vgl. hierzu Charles Darwin, «Insektenfressende Pflanzen«, übersetzt v. J. Victor Carus, in «Ch. Darwins gesammelte Werke«, 8. Band, Stuttgart 1876, S. 259 ff.
157 Ich habe einmal einen kennengelernt: Hermann Rollett, 1819-1904; österr. Schriftsteller. Vgl. hierzu auch «Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation/Pädagogischer Jugendkurs«, Gesamtausgabe Dornach, 1964, Bibl.-Nr. 217, S. 163.
174 Ich habe einen landwirtschaftlichen Kurs in der Nähe von Breslau gehalten:
In Koberwitz vom 7. bis 16. Juni 1924; siehe «Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft«, Gesamtausgabe Dornach 1963, Bibl.-Nr.327.
am nächsten Freitag: Wurde auf Samstag, den 13. September, verschoben.
176 zwei Marsumläufe: Die synodische Umlaufzeit, also die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Konjunktionen, oder Oppositionen zur Sonne, kann beim Mars um ca. 50 Tage schwanken; sie variiert zwischen 2 Jahren 34 Tagen und 2 Jahren 80 Tagen - der durchschnittliche Wert beträgt 2 Jahre 50 Tage, also fast 2 Jahre 2 Monate.
182 Matthias Jakob Schleiden, 1804-1881, Naturforscher.
Gustav Theodor Fechner, 1801-1887, Naturforscher, Begründer der Psychophysik. - Siehe seine Schrift «Professor Schleiden und der Mond», Leipzig 1856; II. Teil, Kap. VI, S. 153.
184 Venusdurchgänge: Der den Venuidurchgängen zugrundeliegende gemeinsame Rhythmus ist eine Periode von 243 Jahren und 2 Tagen, innerhalb welcher die Intervalle zwischen den einzelnen Durchgängen 8, 121 1/2, 8 und 105 1/2 Jahre betragen. Der letzte Venuidurchgang fand am 6. Dezember 1882 statt. Nach astronomischen Berechnungen erfolgt der nächste Durchgang am 7. Juni 2004.
193 am nächsten Mittwoch: Wurde auf Donnerstag, den 18. September, verlegt.
196 Ferdinand Hochstetter, 1829-1884, Geograph und Geologe.
198 der Vulkan Colima: Tätiger Vulkan in Mexiko.
203 Ernst Haeck ei, 1834-1919.
über diesem Keller ist ein Turm: Gemeint ist das sog. «Weigelsche Haus«, das 1647 erbaut und 1898 beim Durchbruch der Weigelstraße abgebrochen wurde. Es zählte zu den »Sieben Wundern» Jenas. Dieses Haus war sieben Stockwerke hoch und enthielt u. a. eine um eine Spindel angelegte Treppe, durch die man am Tage die Sterne am Himmel sehen konnte.
204 Rudolf Falb, 1838-1903. Schrieb u. a. «Grundzüge der Theorie der Erdbeben und Vulkanausbrüche», Graz 1870; «Gedanken und Studien über den Vulkanismus», Graz 1875; »Kritische Tage, Sintflut und Eiszeit«, Wien 1895; «Kalender der kritischen Tage», Wien 1892ff.
206 hat sich Goethe... dagegen gewendet, ... daß die Erde innerlich feuer flüssig ist: Goethe hat sich wiederholt mit Unmut gegen den damals besonders durch Leopold von Buch und dessen Schüler und Gleichgesinnte hochkommenden Vulkanismus gewendet, dem seiner Meinung nach eine leitende Idee fehlte, die durch das Labyrinth der Einzeltatsachen hätte hindurchführen können. Vgl.
z. B. den Brief Goethes an Nees von Esenbeck vom 13. Juni 1823 (SophienAusgabe Bd. 37, Brief 64).
209 Julius Robert Mayer, 1814-1878, Siehe «Beiträge zur Dynamik des Himmels», Heilbronn 1848.
213 sagte der Direktor der Postkutschen: Karl Ferdinand Friedrich von Nagler,
1770-1846, preußischer Staatsmann. 1823-46 Generalpostmeister; begründete das moderne Postwesen.
ein Ärztekollegium: Vgl. R. Hagen «Die erste deutsche Eisenbahn« 1885, S. 45.
214 Sir Francis Drake, 1540-1596, berühmter engl. Seefahrer.
216 ein Gelehrter würde einen Vortrag halten: J. J. L. Lalande, 1732-1807, franz. Astronom.
217 daß ein Komet mit der Erdbahn sich kreuzt: Der sog. Bielasche Komet.
219 eine Schrift von einem Astronomen Littrow: Joseph Johann Littrow, 1781-1840, «Über den gefürchteten Kometen des Jahres 1832 und über Kometen überhaupt«, Wien 1832.
220 Wolfram von Eschenbach, um 1170-1220. «Parzival«, vollendet um 1210.
Richard Wagner, 1813-1883. «Parsifal«, ein Bühnenweihfestspiel; erschien als Dichtung 1877, während die Komposition erst 1882 abgeschlossen wurde.
223 ich habe durch Jahre hindurch ... unter Arbeitern Vorträge gehalten: Von 1899-1904 unterrichtete Dr. Steiner an der Arbeiterbildungsschule in Berlin. Siehe »Mein Lebensgang», Kap. XXVIII; Gesamtausgabe Dornach 1962, Bibl.-Nr.28.
Ferdinand Lassalle, 1825-1864, Begründer der Sozialdelnokratie in Deutschland. Der genaue Titel der angeführten Rede lautet: «Die Wissenschaft und die Arbeiter. Eine Verteidigungsrede vor dem Berliner Kriminalgericht gegen die Anklage, die besitzlosen Klassen zum Haß und zur Verachtung gegen die Besitzenden öffentlich angereizt zu haben (16. Januar 1863)«, Zürich 1863.
240 Am nächsten Samstag wollen wir fortsetzen: Der hier angekündigte Vortrag konnte nicht mehr gehalten werden. Der Vortrag vom 24. September 1924 ist der letzte, den Rudolf Steiner vor den Arbeitern vor seiner Erkrankung gehalten hat.
Literatur
- Rudolf Steiner: Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken, GA 354 (2000), ISBN 3-7274-3540-2 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |







