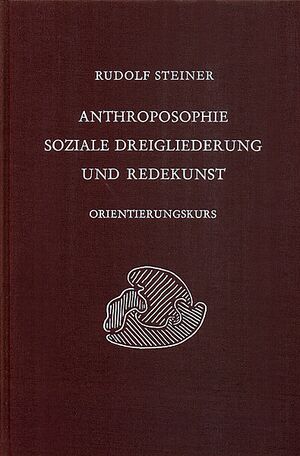Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 339
RUDOLF STEINER
VORTRÄGE
VORTRÄGE ÜBER DAS SOZIALE LEBEN UND
DIE DREIGLIEDERUNG DES SOZIALEN ORGANISMUS
Anthroposophie,
soziale Dreigliederung
und Redekunst
Orientierungskurs
für die öffentliche Wirksamkeit
mit besonderem Hinblick
auf die Schweiz
Sechs Vorträge, gehalten in Dornach
vom 11. bis 16. Oktober 1921
GA 339
1984
Inhaltsverzeichnis
ERSTER VORTRAG Dornach, 11. Oktober 1921
Ich habe die Meinung, daß es sich bei diesem Kursus handelt um eine Besprechung dessen, was notwendig ist, um dann wirklich für die Bewegung für Anthroposophie und Dreigliederung, insofern sie heute in Betracht kommt, einzutreten. Der Kursus wird also nicht so eingerichtet sein, daß er etwa ein Rednerkursus oder dergleichen im allgemeinen sein sollte, sondern als eine Art Orientierungskursus für die Persönlichkeiten, die es sich zur Aufgabe machen, eben in der angedeuteten Richtung zu wirken.
Persönlichkeiten, welche einfach wie eine Art von Mitteilung entgegennehmen, was von Anthroposophie kommen kann, werden nicht viel haben können von diesem Kursus. Wir brauchen ja in der Gegenwart durchaus Wirksamkeit innerhalb unserer Bewegung. Diese Wirksamkeit, sie scheint schwer zu entfachen zu sein. Es scheint sich die Einsicht schwer zu verbreiten, daß diese Wirksamkeit in unserer Gegenwart wirklich notwendig ist.
Es wird sich daher hier nicht um einen formalen Redekursus handeln, sondern gerade um dasjenige, was für jemanden notwendig ist, der eine ganz bestimmte, eben die angedeutete Aufgabe erfüllen möchte. Von einem Herumreden im allgemeinen sollte überhaupt auf dem Boden der anthroposophischen Bewegung nicht Gebrauch gemacht werden. Das ist ja gerade das Kennzeichen unserer gegenwärtigen Kultur und Zivilisation, daß im allgemeinen über die Dinge herumgeredet wird, daß konkrete Aufgaben wenig erfaßt werden, daß man auch vorzugsweise Interesse für ein Herumreden im allgemeinen hat.
Ich werde daher in diesem Kursus auch nicht die Dinge zu behandeln haben, die ich inhaltlich auseinandersetzen werde, wie sie einer Information dienen können, sondern ich werde versuchen, sie so zu behandeln - und das muß ja in einem solchen orientierenden Kursus der Fall sein, weil er eben Unterlage für eine bestimmte Aufgabe sein soll -, wie sie dann eingehen können in die mündliche Rede. Und ich werde
diese mündliche Rede so behandeln, daß Rücksicht darauf genommen wird, daß derjenige, welcher sich eine solche mündliche Rede zur Aufgabe stellt, nicht etwa innerhalb eines Rahmens wirkt, wo schon Interesse vorhanden ist, sondern wirkt in ein, zwei oder drei Vorträgen, durch die er erst das Interesse wecken soll.
Also in diesem ganz konkreten Sinne möchte ich diesen Kursus gestalten. Und schon die allgemeinen Gesichtspunkte, die ich heute besprechen werde, sollen durchaus in diesem ganz konkreten Sinne gemeint sein, so daß man Unzutreffendes sagen würde, wenn man das, was ich heute oder in den nächsten Tagen sagen werde - wie es heute beliebt ist -, als abstrakte Sätze hinstellen würde. Von den Formalien werde ich heute zu sprechen haben.
Jedesmal, wenn man sich die Aufgabe stellt, in der mündlichen Rede etwas an seine Mitmenschen heranzubringen, wird sich ja selbstverständlich eine Wechselwirkung abspielen zwischen dem Menschen, der etwas mitzuteilen, für etwas zu wirken, zu etwas zu befeuern hat, und zwischen den Menschen, die ihm zuhören. Ein Wechselspiel der Seelenkräfte findet statt. Und auf dieses Wechselspiel der Seelenkräfte wollen wir zunächst unsere Aufmerksamkeit lenken.
Diese Seelenkräfte leben ja in Denken, Fühlen und Wollen, und niemals ist beim Menschen nur eine einzige Seelenkraft für sich in abstrakter Form tätig, sondern in jede einzelne Seelenkraft spielen die anderen Seelenkräfte hinein, so daß, wenn wir denken, in unserem Denken immer auch das Fühlen und das Wollen wirkt, ebenso in unserem Fühlen das Denken und das Wollen und im Wollen wiederum das Denken und das Fühlen. Dennoch aber kann man das seelische Leben -auch in seiner Wechselwirkung zwischen den Menschen - nicht anders betrachten, als indem man dieses Tendieren auf der einen Seite nach dem Denken und auf der anderen Seite nach dem Wollen ins Auge faßt. Und da mussen wir im Sinne unsere Aufgabe von heute nun sagen: Was wir denken, das interessiert keinen Menschen; und wer glaubt, daß seine Gedanken, insofern sie Gedanken sind, irgendeinen Menschen interessieren, der wird sich eine rednerische Aufgabe nicht stellen können. - Wir werden über diese Dinge dann noch genauer zu sprechen haben. - Und das Wollen, zu dem wir etwa eine Versammlung
oder vielleicht auch nur einen einzelnen anderen Menschen befeuern wollen, das Wollen also, das wir etwa in unsere Rede hineinlegen wollen, das ärgert die Menschen, das weisen sie instinktiv zurück.
Man hat es zunächst mit dem Wirken verschiedener Instinkte zu tun, wenn man rednerisch an die Menschen herantritt. Das Denken, das man selber in sich entfaltet, interessiert die Menschen nicht, das Wollen ärgert sie. Wenn also jemand etwa aufgefordert würde, dieses oder jenes zu wollen, so würden wir zunächst sein Argernis hervorrufen, und wenn wir unsere schönsten und genialsten Gedanken wie Monologe vor den Menschen entrollen würden, so würden sie gehen. Das muß Grundsatz für den Redner sein.
Ich sage nicht, daß das so ist, wenn wir etwa eine allgemeine Unter-haltung unter Menschen oder einen Kaffeeklatsch oder dergleichen charakterisieren. Denn ich rede nicht darüber, wie diese Dinge zu charakterisieren sind, sondern ich rede von dem, was uns beseelen soll, was in uns leben soll als richtiger Antrieb für das Reden, wenn das Reden gerade in der Richtung, wie ich es hier meine, einen Zweck haben soll. Was man sich als Maxime vorsetzt: Unsere Gedanken interessieren kein Publikum, unser Wollen ärgert jedes Publikum - das braucht nicht eine Charakteristik zu sein.
Nun müssen wir ja berücksichtigen: Wenn jemand redet, so redet er meistens nicht aus der Wesenheit des Redens allein heraus, sondern er redet aus allerlei Situationen heraus. Er redet vielleicht aus irgend-einer Angelegenheit heraus, die schon wochenlang an dem Orte, wo er redet, besprochen oder beschrieben wird. Er begegnet natürlich einem ganz anderen Interesse, als wenn er einen ersten Satz zu sagen hat, der etwas berührt, was seine Zuhörer bisher nicht im geringsten beschäftigt hat. Wenn jemand hier im Goetheanum redet, ist es natürlich etwas ganz anderes, als wenn er in einem Wirtshaus in Buchs redet. Ich meine jetzt sogar, davon absehen zu können, daß man vielleicht im Goetheanum vor Leuten redet, die sich schon längere Zeit mit dem Stoff befaßt haben, die etwas darüber gelesen oder gehört haben, während das vielleicht in Buchs nicht der Fall ist. Ich meine die ganze Umgebung:
Die Tatsache, daß man in einen Bau kommt wie das Goetheanum,
macht es möglich, in ganz anderer Weise sich an das Publikum zu wenden, als wenn man in einem Wirtshaus in Buchs spricht. Und so sind unzählige Umstände, aus denen heraus man redet, die immer berücksichtigt werden müssen.
Das aber begründet insbesondere in unserer Zeit die Notwendigkeit, an dem, was nicht sein soll, ein wenig sich zu orientieren über das, was sein soll. Nehmen wir den extremsten Fall: Ein richtiger Durchschnittsprofessor habe eine Rede zu halten. Er hat es zunächst mit seinen Gedanken über den Gegenstand zu tun; und wenn er ein richtiger Durchschnittsprofessor ist, hat er es zu tun auch mit der Überzeugung, daß diese Gedanken, die er denkt, überhaupt die allerbesten der Welt sind über den betreffenden Gegenstand. Alles übrige interessiert ihn zunächst nicht. Er schreibt sich diese Gedanken auf. Und selbstverständlich, wenn er diese Gedanken zu Papier bringt, sind sie gut zu Papier gebracht. Dann steckt er sich dieses Manuskript in seine linke Seitentasche, geht hin, gleichgültig ob ins Goetheanum oder ins Wirtshaus zu Buchs, findet irgendein Rednerpult, das in entsprechender Weise in richtiger Entfernung von den Augen aufgestellt ist, legt das Manuskript darauf und liest ab. Ich sage nicht, daß es jeder so macht, aber es ist ein häufig vorkommender und für unsere Gegenwart doch charakteristischer Fall, und er weist uns auf das Grauen, das man heute haben kann für das Reden. Es ist der Fall, vor dem man am allermeisten Abscheu haben sollte.
Und da ich gesagt habe, daß unsere Gedanken eigentlich niemanden interessieren, unser Wollen eigentlich jeden ärgert, dann scheint es auf das Fühlen anzukommen, es scheint also eine besonders bedeutsame Ausbildung des Fühlens zugrunde liegen zu müssen für das Reden. Also werden schon solche Gefühle, wenn auch vielleicht von einer entfernten, so doch in einem gewissen Sinne fundamentalen Bedeutung sein: daß wir uns den richtigen Abscheu angeeignet haben vor diesem extremen Fall. Ich habe einmal in einer größeren Versammlung einen Vortrag des berühmten Helmholtz gehört, der allerdings in dieser Weise gehalten worden ist: das Manuskript aus der linken Seitentasche her-ausgezogen - abgelesen! Nachher kam ein Journalist zu mir und sagte: Warum ist eigentlich dieser Vortrag nicht gedruckt worden und ein
Exemplar jedem, der da war, in die Hand gedrückt worden? - und Helmholtz wäre dann herumgegangen und hätte jedem die Hand gereicht! - Diese Handreichung wäre vielleicht den Zuhörern wertvoller gewesen als das schreckliche Sitzen auf den harten Stühlen, zu dem sie verurteilt waren, um in einer längeren Zeit, als sie es selber hätten lesen können, sich irgend etwas vorlesen zu lassen. Die meisten hätten ja wohl, wenn sie es hätten verstehen wollen, überdies sehr lange dazu gebraucht; aber denen hat auch das kurze Anhören nichts geholfen.
Man muß schon über alle diese konkreten Dinge durchaus nachdenken, wenn man verstehen will, wie in Wahrheit und Ehrlichkeit die Kunst des Redens angestrebt werden kann.
Auf dem Philosophenkongreß in Bologna wurde die bedeutsamste Rede so gehalten, daß sie in drei Sprachen in je drei Exemplaren auf jedem Stuhl lag. Man mußte sie erst in die Hand nehmen, um sich darauf setzen zu können, auf den leeren Stuhl. Und dann wurde aus diesem Gedruckten die Rede, die etwas länger als eine Stunde dauerte, vorgelesen. Durch einen solchen Vorgang ist selbst die schönste Rede eben keine Rede mehr, denn das Verstehen im Lesen ist etwas wesentlich anderes als das Verstehen im Hören. Und diese Dinge müssen durchaus berücksichtigt werden, wenn man sich in lebensvoller Weise in solche Aufgaben hineinfinden will.
Gewiß, auch ein Roman kann uns so rühren, daß wir Tränen vergießen an bestimmten Stellen. Ich meine selbstverständlich ein guter Roman, aber er kann das nur an bestimmten Stellen, kann es nicht vom Anfang bis zum Ende. Aber was liegt denn da eigentlich vor beim Lesen, daß wir hingenommen werden vom Gelesenen? Wenn wir von dem Gelesenen hingenommen werden, haben wir eine gewisse Arbeit zu verrichten, die sehr stark mit dem Inneren unserer Menschenwesenheit zusammenhängt. Denn derjenige, der nicht lesen kann, kann diese Arbeit gar nicht verrichten. Es wird eine innere Arbeit verrichtet, wenn wir lesen. Diese Arbeit, die wir da verrichten, die besteht ja darin, daß wir, indem wir den Blick auf einzelne Buchstaben lenken, wirklich das, was wir gelernt haben im Zusammenfassen der Buchstaben, ausführen, um aus diesem Ansehen und Zusammenfassen und Überdenken einen Sinn herauszubekommen. Das ist ein Vorgang, welcher
in unserem Atherleib vor sich geht, im Aufnehmen, und noch stark den physischen Leib in Anspruch nimmt, in der Wahrnehmung.
Das alles fällt aber beim bloßen Zuhören einfach weg. Beim bloßen Zuhören findet diese ganze Tätigkeit nicht statt. Aber diese ganze Tätigkeit ist in einer bestimmten Weise doch verbunden mit dem Aufnehmen einer Sache. Der Mensch bedarf ihrer, wenn er eine Sache aufnehmen will. Er braucht ein Mittun seines Atherleibes und teilweise sogar seines physischen Leibes. Nicht bloß im Sinnesorgan, also im Ohr, sondern er braucht im Zuhören ein so reges Seelenleben, daß sich dieses Seelenleben nicht im Astralleib erschöpft, sondern den Atherleib in Schwingungen bringt, und dieser Atherleib dann noch den physischen Leib mit in Schwingungen bringt. Dasjenige nämlich, was sich beim Lesen an Aktivität vollziehen muß, das muß sich auch beim Anhören einer Rede entwickeln, aber, ich möchte sagen, in einer ganz anderen Form, weil es ja so nicht da sein kann, wie es beim Lesen ist. Und was da beim Lesen aufgewendet wird, das ist umgewandeltes Gefühl, in den Atherleib und in den physischen Leib hinuntergedrängtes Fühlen, das Kraft wird. Als Gefühl, als Gefühisinhalt müssen wir es selbst bei der abstraktesten Rede in der Lage sein, aufzubringen.
Es ist wirklich so, daß unsere Gedanken als solche keinen Menschen interessieren, unsere Willensimpulse jeden ärgern und allein unsere Gefühle dasjenige ausmachen, wovon der Eindruck, die Wirkung -im berechtigten Sinne natürlich - einer Rede abhängt.
Es entsteht daher als wichtigste Frage diese: Wie werden wir in unserer Rede etwas haben können, was in genügend starker Weise -ohne aufdringlich zu sein, weil wir ja sonst hypnotisieren oder suggerieren würden - eine solche Gefühlstingierung, eine solche Gefühlsdurchsetzung wird hervorbringen können?
Es kann nicht abstrakte Regeln geben, durch die man lernt, wie man mit Gefühl sprechen kann. Denn jemand, der sich in allerlei Anleitungen solche Regeln aufgesucht hat, nach denen man mit Gefühl sprechen kann, eindrucksvoll sprechen kann, dem wird man schon irgend etwas davon anmerken, daß seine Rede ihm ganz gewiß nicht aus dem Herzen kommt, daß sie ganz anderswo herstammt als aus dem Herzen. Und eigentlich müßte jede Rede durchaus aus dem Herzen
kommen. Auch die abstrakteste Rede müßte aus dem Herzen kommen, und sie kann es. Und gerade das ist es, was wir besprechen müssen: wie auch die abstrakteste Rede durchaus aus dem Herzen kommen kann.
Wir müssen uns nur klar sein darüber, was eigentlich im Gemüte des Zuhörers rege ist, wenn er uns zuhört. Nicht, wenn er uns zuhört und wenn wir ihm irgend etwas sagen, was er begierig ist zu hören, sondern wenn wir ihm zumuten, daß er uns als Redner anhören soll. Denn eigentlich ist es ja immer eine Art Attacke auf unsere Mitmenschen, wenn wir mit einer Rede auf sie losgehen. Und auch das ist etwas, dessen wir uns durchaus bewußt sein müssen, daß es eine Attacke ist auf die Zuhörer, wenn wir mit einer Rede auf sie losgehen.
Alles das, was ich sage - ich muß das immer wieder in Parenthese hinzufügen -, gilt als Maxime für Redner, nicht als Charakteristik des sozialen Verkehrs oder sonst für etwas; es gilt als Maxime für Redner. Wenn ich in bezug auf den sozialen Verkehr sprechen würde, so könnte ich natürlich nicht dieselben Sätze prägen. Da würde ich Torheiten sagen. Denn wenn man im Konkreten spricht, so kann ein solcher Satz wie: Unsere Gedanken interessieren keinen Menschen - entweder etwas sehr Kluges sein oder aber eine große Dummheit. Alles, was wir sagen, kann eine Dummheit sein im ganzen menschlichen Zusammenhang oder eine Klugheit; es kommt nur darauf an, in welcher Art es sich in den Zusammenhang hineinstellt. Daher sind für einen Redner ganz andere Dinge notwendig als Anleitungen zur formalen Redekunst.
Es handelt sich also darum, zu erkennen: Was ist denn eigentlich in dem Zuhörer wirksam? Im Zuhörer ist wirksam Sympathie und Antipathie. Die machen sich, mehr oder weniger unbewußt, durchaus geltend, wenn wir ihn mit einer Rede attackieren. Sympathie oder Antipathie! Aber mit unseren Gedanken hat er sicherlich zunächst keine Sympathie. Auch nicht mit unseren Willensimpulsen, mit dem, was wir von ihm gewissermaßen wollen, mit dem, wozu wir ihn ermahnen wollen. Für Sympathie oder Antipathie zu dem, was wir sagen, muß man ein gewisses Verständnis haben, wenn man irgendwie an die Redekunst herantreten will. Sympathie und Antipathie haben eigentlich weder mit dem Denken noch mit dem Willen etwas zu tun,
sondern wirken hier in der physischen Welt lediglich für die Gefühle, für das Gefühlsmäßige. Und ein bewußtes Verständnis beim Zuhörer für Sympathie und Antipathie wirkt so, als ob wir uns den Weg zu ihm versperren würden - es muß durchaus dieses Verständnis für Sympathie und Antipathie etwas sein, das namentlich während der Rede durchaus nicht zum Bewußtsein des Zuhörers kommt. Und ein Hinarbeiten auf die Sympathie und Antipathie wirkt so, wie wenn wir jeden Schritt so machen würden, daß der Boden, auf den wir auftreten, dabei der andere Fuß ist, als ob wir immer mit dem einen Fuß auf den anderen treten würden. So ungefähr wirkt es in der Rede, wenn wir die Sympathie oder Antipathie abfangen wollen. Wir müssen das feinste Verständnis haben für Sympathie und Antipathie des Zuhörers, aber es darf uns während der Rede nicht das geringste an seiner Sympathie oder Antipathie liegen! Wir müssen alles das, was in Sympathie und Antipathie hineinwirkt, wenn ich so sagen darf, auf Umwegen, in der Vorbereitung, in die Rede hineinbringen.
Geradesowenig wie es Anleitungen abstrakter Art fürs Malen geben kann oder fürs Bildhauern, ebensowenig kann es Regeln abstrakter Art fürs Reden geben. Aber ebenso wie man die Kunst des Malens anregen kann, so auch die Kunst der Rede. Und es handelt sich nur darum, daß man die Dinge, die in dieser Richtung vorgebracht werden können, völlig ernst nimmt.
Nehmen wir zunächst, um von einem Beispiel auszugehen, den Lehrer, der zu Kindern spricht. Von der Genialität und Weisheit des Lehrers hängt eigentlich für das Sprechen im Unterrichten das allerwenigste ab. Das allerallerwenigste hängt dafür, ob wir gut Mathematik oder Geographie lehren können, davon ab, ob wir selbst ein guter Mathematiker oder ein guter Geograph sind. Wir können ein ausgezeichneter Geograph, aber ein schlechter Lehrer der Geographie sein und so weiter. Es hängt die Güte beim Lehren, das ja doch zum größten Teil auch im Sprechen besteht, davon ab, was man einmal über die Dinge, die man vorzubringen hat, gefühlt, empfunden hat, und was für Empfindungen wieder angeregt werden dadurch, daß man das Kind vor sich hat. Deshalb läuft zum Beispiel die Pädagogik der Waldorfschule auf Menschenkenntnis hinaus, das heißt auf Kindeskenntnis;
nicht auf eine Kindeskenntnis, die durch abstrakte Psychologie vermittelt ist, sondern die auf einem vollmenschlichen Begreifen des Kindes beruht, so weit, daß man es durch das bis zum unmittelbaren liebevollen Hingeben verdichtete Gefühl dazu bringt, das Kind nachzuempfinden. Dann ergibt sich aus dieser Nachempfindung, die man gegenüber dem Kinde hat, und aus dem, was man selber einmal gefühlt und empfunden hat an dem, was man vorzubringen hat, aus alledem ergibt sich ganz instinktiv die Art, wie man zu sprechen oder auch zu hantieren hat.
Es nützt zum Beispiel gar nichts, ein blödes Kind so zu unterrichten, daß man die Weisheit der Welt, die man selber hat, anwendet. Weisheit hilft einem bei einem blöden Kinde nur, wenn man sie gestern gehabt und zur Vorbereitung gebraucht hat. In dem Augenblick, wo man das blöde Kind unterrichtet, muß man die Genialität haben, selber so blöde zu sein wie das Kind, und nur die Geistesgegenwart haben, sich zu erinnern an die Art, wie man gestern weise war bei der Vorbereitung. Man muß mit dem blöden Kind blöde, mit dem nichtsnutzigen Kinde -im Gemüt wenigstens - nichtsnutzig, mit dem braven Kind brav sein können und so weiter. Man muß wirklich als Lehrer - ich hoffe, daß dieses Wort nicht allzustarke Antipathien erweckt, weil es zu stark nach Gedanken oder Willen gerichtet ist -, man muß wirklich eine Art Chamäleon sein, wenn man richtig jinterrichten will.
Es gefiel mir daher zum Beispiel ganz gut, was manche Waldorflehrer zur Erhöhung der Disziplin aus ihrer Genialität heraus gefunden haben. So fängt einer der Lehrer, wenn sich die Kinder, während er Jean Paul tradiert, Briefchen schreiben, die sie sich reichen, er fängt nicht an mit Ermahnungen und dergleichen, sondern er geht hin, schaut sich die Sache in aller Geduld an und macht dann eine Unterrichtsparenthese: er fügt in den Unterricht ein ganz kleines Kapitel über das Postwesen ein! Das wirkt viel besser als alle Ermahnungen. Das Briefe-schreiben während der Stunde hört dann auf in der Klasse. Das beruht natürlich auf einem ganz konkreten Ergreifen des Augenblickes. Aber diese Geistesgegenwart muß man selbstverständlich haben. Man muß wissen, daß Sympathien und Antipathien, die man erregen will, tiefer sitzen, als man gewöhnlich meint.
Und so ist es außerordentlich wichtig, daß der Lehrer - in der Vorbereitung vor allen Dingen, wenn er irgendein Kapitel in der Klasse zu behandeln hat - sich völlig gegenwärtig macht, wie er selber an dieses Kapitel herangetreten ist, als er in demselben Lebensalter war, wie seine Kinder sind, wie er da gefühlt hat. Nicht, um jetzt wiederum pedantisch zu werden und sich am nächsten Tag, wenn er es behandelt, so zu arten, daß er nun etwa wieder so fühlt! Nein, es ist schon genügend, wenn in der Vorbereitung dieses Gefühl heraufgeholt wird, wenn es in der Vorbereitung durchgemacht wird. Und dann handelt es sich darum, daß man nun eben am nächsten Tage mit der eben geschilderten Menschenkenntnis wirkt.
Also auch da handelt es sich darum, daß wir selbst in uns die Möglichkeit finden, aus dem Gefühl heraus den Redestoff, der ja, wie gesagt, ein Teil des Unterrichtsstoffes ist, zu gestalten.
Wie die Dinge wirken können, machen wir uns am besten gegenwärtig, wenn wir auch noch das Folgende ins Seelenauge fassen: Wenn also etwas Gefühlsmäßiges wirken muß in dem, was unsere Rede durchpulst, so können wir natürlich nicht gedankenlos sprechen, obwohl die Gedanken eigentlich unsere Zuhörer nicht interessieren, und wir können auch nicht willenlos sprechen, obschon das Wollen sie ärgert; wir werden sogar sehr häufig so sprechen wollen, daß es in die Willens-impulse der Menschen hineingeht, daß infolge unserer Rede unsere Mitmenschen etwas tun. Aber wir dürfen jedenfalls die Rede nicht so einrichten, daß wir durch unseren Gedankeninhalt den Zuhörern langweilig und durch den Willensanstoß, den wir geben wollen, ihnen antipathisch werden.
Daher wird es sich darum handeln, daß wir das Denken über die Rede abmachen, ganz abmachen, möglichst lange, bevor wir sie halten, daß wir also das Denkerische ganz und gar zunächst mit uns selbst abgemacht haben. Das hat nichts damit zu tun, ob wir dann geläufig reden, ob wir holperig reden. Das letztere hängt, wie wir sehen werden, von ganz anderen Umständen ab. Aber das, was gewissermaßen unbewußt in der Rede wirken muß, das hängt damit zusammen, daß wir den Gedankeninhalt viel, viel früher mit uns selbst abgemacht haben. Den Gedankenmonolog, der möglichst lebhaft sein soll, den müssen
wir vorher abgemacht haben, jenen Gedankenmonolog, der sich so gestaltet, daß wir uns selber während dieser Vorbereitung in Rede und Gegenrede bewegen, daß wir möglichst alle Einwände vorausnehmen. Denn allein dadurch, daß wir in dieser Weise unsere Rede vorher in Gedanken erleben, nehmen wir unserer Rede den Stachel, den sie sonst unter allen Umständen für die Zuhörerschaft hat. Wir müssen gewissermaßen unsere Rede dadurch versüßen, daß wir das Saure der Gedankenfolge, des logischen Ausbaues, vorher durchgemacht haben, aber möglichst so durchgemacht haben, daß wir uns den wortwörtlichen Inhalt der Rede nicht formulieren, daß wir keine Ahnung davon haben - ich muß natürlich in Maximen reden, die Dinge können ja natürlich nicht in dieser Extremheit hingenommen werden -, daß wir keine Ahnung davon haben, wenn wir zu reden beginnen, wie wir uns die Sätze formulieren werden. Die Gedankeninhalte aber müssen abgemacht sein. Die wortwörtliche Formulierung gar für die ganze Rede zu haben, ist etwas, was schließlich niemals zu einer wirklich guten Rede führen kann. Denn das kommt schon sehr nahe dem Aufgeschriebenhaben, und wir brauchen uns da bloß vorzustellen, daß statt unser ein Phonograph dastünde, der die Sache von selbst von sich gäbe; dann ist der Unterschied noch kleiner zwischen dem Aufgeschriebenhaben und der Maschine, die das von sich gibt. Aber wenn wir eine Rede vorher formuliert haben, so daß sie so ausgearbeitet ist, daß sie wortwörtlich von uns gesprochen werden kann, so unterscheiden wir uns ja nicht sehr stark von einer Maschine, der wir das eingekurbelt haben und die wir dann abkurbeln. Da ist schon gar nicht viel Unterschied zwischen dem Anhören einer Rede, die wortwörtlich so gesprochen wird, wie sie schon wortwörtlich ausgearbeitet wurde, und dem Lesen, außer dem, daß einen beim Lesen nicht der Redner fortwährend stört, während einen beim Anhören einer also eingelernten Rede, die man wortwörtlich spricht, der Redner ja fortwährend stört. Die Gedankenvorbereitung also wird dadurch in der richtigen Weise gepflogen, daß sie ganz bis zum absoluten Einigwerden mit sich selbst, aber in Gedanken, dem Halten der Rede vorangeht. Fertig muß man sein mit dem, was man vorbringen will.
Allerdings, einige Ausnahmen sind da für gewöhnliche Reden, die
man vor einer sonst unbekannten Zuhörerschaft hält. Wenn man nämlich vor einer solchen Zuhörerschaft gleich damit beginnt, daß man dasjenige, was man so in Gedanken gewissermaßen meditativ ausgearbeitet hat, vom ersten Satz an nun auch unter der unmittelbaren, wenn ich mich so ausdrücken darf, Inspiration vorbringt, dann tut man doch wiederum den Zuhörern nicht etwas recht Gutes. Im Beginne einer Rede nämlich muß man schon etwas seine Persönlichkeit wirksam machen; im Beginne der Rede darf man nicht gleich seine Persönlichkeit ganz auslöschen, weil, ich möchte sagen, erst das Vibrierende des Gefühls angeregt werden muß.
Man braucht es nun ja nicht gleich so zu machen wie zum Beispiel der einstmals in gewissen Kreisen sehr berühmte Professor der deutschen Literaturgeschichte Michael Bernays, der, als er einmal nach Weimar kam, um dort eine Rede über Goethes Geschichte der Farbenlehre zu halten, die ersten Sätze so gestalten wollte, daß allerdings das Gefühl der Zuhörer in sehr, sehr intensiver Weise in Anspruch genommen wurde; allerdings anders, als er wollte. Er kam nach Weimar schon ein paar Tage früher. Weimar ist eine kleine Stadt; da kann man bei den Leuten herumgehen, die zum Teil dann im Saal sein werden, und kann Stimmung machen für seine Rede. Diejenigen, die es so unmittelbar hören, die sagen es dann den anderen, und es ist eigentlich dann der ganze Saal «gestimmt», wenn man die Rede hält. Da ging denn nun wirklich der Professor Michael Bernays ein paar Tage lang in Weimar herum und sagte: Ach, ich habe mich nicht vorbereiten können auf diese Rede; der Genius wird mir im rechten Augenblick schon das Richtige eingeben. Ich werde warten, was der Genius mir eingibt. -Nun hatte er diese Rede im Weimarer «Erholungssaal» zu halten. Es war ein heißer Sommertag. Die Fenster mußten aufgemacht werden, und unmittelbar vor den Fenstern dieses «Erholungssaales» war ein Hühnerhof. Michael Bernays stellte sich hin und wartete, bis der Genius anfing, ihm etwas einzugeben. Denn das wußte ja ganz Weimar: Der Genius muß kommen und muß Michael Bernays seine Rede eingeben. Und siehe da, in diesem Momente, als Bernays auf den Genius wartete, fing draußen der Hahn an: Kikeriki! - Jeder Mensch wußte: Jetzt hat der Genius gesprochen für Michael Bernays! - Die Gefühle
waren stark angeregt, allerdings in anderer Weise, als er es gewollt hatte. Aber es war eine gewisse Stimmung schon im Saal.
Ich sage das nicht, um Ihnen eine nette Anekdote zu erzählen, sondern weil ich darauf aufmerksam machen muß: Der Hauptteil der Rede soll schon so gestaltet sein, daß er in Gedanken meditativ gut durchgearbeitet ist und nachher frei formuliert wird. Aber der Anfang ist ja eigentlich sogar dazu da, daß man sich ein bißchen lächerlich macht, denn das stimmt die Zuhörer so, daß sie einem dann lieber zuhören. Wenn man sich nicht ein ganz klein wenig lächerlich macht -allerdings so, daß die Sache nicht stark bemerkt wird, daß sie nur im Unterbewußten abläuft -, dann kann man doch nicht in der richtigen Weise fesseln, wenn man irgendwo eine einzelne Rede zu halten hat. Es darf natürlich nicht stark aufgetragen sein, aber es wirkt schon genügend im Unterbewußten.
Was man eigentlich für jede einzelne Rede haben sollte, ist dies, daß man den ersten, zweiten, dritten, vierten, höchstens noch den fünften Satz wörtlich formuliert hat. Dann geht man zu dem über, was in der Weise angeordnet, orientiert ist, wie ich das eben angedeutet habe. Und den Schluß sollte man wiederum wörtlich formuliert haben. Denn am Schluß sollte man eigentlich immer, wenn man ein richtiger Redner ist, etwas Lampenfieber haben, sollte man immer so eine geheime Angst haben davor, daß man seinen letzten Satz nicht findet. Das ist nötig zur Färbung der Rede. Man braucht das, um die Herzen der Zuhörer zu fesseln am Schlusse, daß man etwas ängstlich ist, den letzten Satz zu finden. Damit man also, nachdem man nun schwitzend seine Rede absolviert hat, dieser Angst in der richtigen Weise entgegenkommt, füge man zu aller übrigen Vorbereitung dieses hinzu, daß man sich merkt die genaue Formulierung auch der letzten ein, zwei, drei, vier, höchstens fünf Sätze. Also einen Rahmen müßte eigentlich eine Rede haben: Formulierung der ersten und der letzten Sätze, und dazwischen müßte die Rede frei sein. Wie gesagt, als Maxime sage ich das.
Nun werden vielleicht manche von Ihnen sagen: Ja, aber wenn nun einer eben nicht so reden kann? - Man wird deshalb nicht gleich sagen müssen, die Sache sei so schlimm, daß er nun überhaupt nicht reden solle. Es ist ja ganz natürlich, daß man ein bißchen besser oder ein
bißchen schlechter reden kann, so daß man sich nicht abhalten lassen soll vom Reden, wenn man nicht alle Bedingungen erfüllen kann. Aber man sollte sich bestreben, diese Bedingungen zu erfüllen, indem man solche Maximen zu seinen Lebensmaximen macht, wie wir sie hier entwickeln können. Und dann gibt es ja ein sehr gutes Mittel, um wenigstens ein erträglicher Redner zu werden, wenn man auch ganz und gar zuerst kein Redner ist, selbst wenn man das Gegenteil eines Redners ist. Ich kann Ihnen versichern, wenn er sich fünfzigmal blamiert hat, das einundfünfzigste Mal wird es gehen, gerade deshalb, weil er sich fünfzigmal blamiert hat. Und derjenige, bei dem fünfzig nicht genug sind, der kann ja hundertmal auf sich laden, aber einmal geht es, wenn man Blamagen nicht scheut. Natürlich, niemals wird die letzte Rede vor dem Tode gut sein, wenn man vorher Blamagen gescheut hat. Aber mindestens die letzte Rede vor dem Tode wird gut sein, wenn man sich vorher x-mal im Reden blamiert hat. Das ist auch etwas, woran man eigentlich immer denken sollte. Und man wird sich zum Redner ganz zweifellos heranbilden. Denn man hat ja nichts nötig zum Redner, als daß einem die Leute zuhören, und daß man ihnen gewissermaßen nicht allzu nahe tritt, daß man wirklich vermeidet, was den Menschen zu nahe tritt.
So wie man gewohnt ist, im sozialen Leben zu reden, wenn man mit einem anderen Menschen spricht, so wird man in der öffentlichen oder überhaupt in der vor Zuhörern gehaltenen Rede nicht sprechen können. Höchstens wird man zuweilen solche Sätze, wie man sie auch im gewöhnlichen Leben spricht, einfügen können. Denn es ist gut, wenn man sich dessen bewußt ist, daß dasjenige, was man im gewöhnlichen Leben als Formulierung der Rede hat, für die Rede vor einem Zuhörer-kreis in der Regel etwas zu fein oder etwas zu grob ist. Ganz stimmt es in der Regel nicht. Die Art, wie man im gewöhnlichen Leben seine Worte formuliert, wenn man einen anderen Menschen anredet, die variiert, die pendelt ja immer zwischen etwas Grobsein und etwas Unwahrsein oder Nichthöflichsein. Beides muß in der vor Zuhörern gehaltenen Rede durchaus vermieden und nur in Parenthese gewissermaßen angewendet werden. Der Zuhörer hat dann das geheime Gefühl: Während der sonst so redet, wie man eben in einer Rede redet,
apostrophiert er einen da plötzlich; er redet wie im Dialog. Da hat er im Sinne, uns entweder ein bißchen zu verletzen oder aber uns süßlich zu kommen.
Wir müssen aber auch das Willenselement in der richtigen Weise in die Rede hineinbringen. Und das kann wiederum nur durch die Vorbereitung geschehen, aber durch diejenige Vorbereitung, die im Durchdenken der Sache den eigenen Enthusiasmus anwendet, gewissermaßen mit der Sache lebt. Was meine ich damit eigentlich? Sehen Sie, zunächst ist man fertig mit dem Gedankeninhalt. Man hat sich ihn zu eigen gemacht. Jetzt würde der nächste Teil der Vorbereitung der sein: Man hört sich gewissermaßen im Vortragen dieses Gedankeninhaltes innerlich selber zu. Man fängt an, seinen Gedanken zuzuhören. Sie brauchen nicht wortwörtlich formuliert zu sein, wie ich schon sagte, aber man fängt an, ihnen zuzuhören. Das ist es, was das Willenselement in die richtige Lage bringt, dieses sich selbst innerlich Anhören. Denn dadurch, daß wir uns innerlich anhören, entwickeln wir an den richtigen Stellen Enthusiasmus oder Abscheu, Sympathie oder Antipathie, wie es sich anknüpfen muß an das, was wir da tradieren. Was wir so erleben, in dieser willensmäßigen Weise, das geht auch in unseren Willen hinein und erscheint, wenn wir reden, in der Variation der Töne. Ob wir intensiv oder schwächer reden, ob wir heller oder dunkler betonen, das haben wir lediglich von dem Durchfühlen und dem Durchwollen unseres eigenen Gedankeninhaltes in der meditativen Vorbereitung. Und was wir im Denken haben, das müssen wir allmählich dazu überleiten, ein Bild zu bekommen von der Gestaltung unserer Rede. Dann ist auch das Denken in der Rede drinnen, aber nicht in den Worten, sondern zwischen den Worten, wie die Worte gestaltet, die Sätze gestaltet, die Disposition gestaltet werden. Je mehr wir in der Lage sind, über das Wie unseres Vortrags zu denken, desto stärker wirken wir auf den Willen der anderen. Das nehmen die Menschen nämlich hin, was wir in die Formulierung und in die Komposition der Rede hineinlegen.
Wenn wir ihnen kommen und sagen: Jeder von euch ist im Grunde genommen ein schlechter Kerl, der nicht morgen alles tut, um die Dreigliederung zu verwirklichen - das ärgert die Leute. Wenn wir aber die Vernunft der Dreigliederung in einer solchen Rede vorbringen, die
naturgemäß komponiert ist, die innerlich gegliedert ist, so daß sie vielleicht selbst sogar eine Art intimer Dreigliederung ist, namentlich aber, wenn sie so gestaltet ist, daß wir selber in uns von der Notwendigkeit der Dreigliederung überzeugt sind, mit allem Gefühl und mit allen Willensimpulsen überzeugt sind, dann wirkt das auf die Menschen, dann wirkt es auf den Willen der Menschen.
Was wir an Gedankenentfaltung angewendet haben, um unsere Rede zu einem Kunstwerk zu machen, das wirkt auf den Willen der Menschen unbemerkt in der Rede; was aus unserem eigenen Willen hervorgeht, was wir selber wollen, was uns begeistert, was uns hinreißt, das wirkt viel mehr auf das Denken der Zuhörer; das regt in ihnen viel leichter die Gedanken an. Daher wird ein für seine Sache begeisterter Redner leicht verstanden. Ein künstlerisch bildender Redner wird leichter den Willen der Zuhörer anregen können. Aber der oberste Grundsatz, die oberste Maxime muß denn doch diese sein: daß wir keine Rede anders halten, als gut vorbereitet.
Ja, aber wenn wir nun gezwungen sind, eine Rede aus dem sogenannten Stegreif zu halten, wenn wir zum Beispiel angeredet werden und gleich darauf zu antworten haben, da können wir doch nicht erst die Zeit zurückgehen lassen zum vorhergehenden Tage, um da den Gegentoast zu meditieren und ihn in Erinnerung bringen, wie ich das jetzt eben angedeutet habe; das geht doch nicht! - Und doch geht es! Es geht nämlich in der Weise, daß wir gerade in einem solchen Moment absolut wahr sind. Oder wir werden in dieser Weise attackiert, daß uns ein Mensch so schrecklich grob kommt, daß wir ihm gleich darauf antworten müssen - dann ist das schon ein starkes Gefühlsfaktum. Also das Gefühl wird schon in einer entsprechenden Weise angeregt. Da ist ein Ersatz da für das, was wir sonst brauchen, um in Begeisterung und so weiter zu beleben, was wir uns erst in Gedanken vorstellen. Dann aber, wenn wir in einem solchen Momente nichts anderes sagen als dasjenige, was wir als ganzer Mensch in jedem Augenblicke sagen können, wenn wir in dieser Weise attackiert werden, dann sind wir doch in einer ähnlichen Weise vorbereitet.
Gerade bei solchen Dingen handelt es sich eben um den Gesamt-entschluß, nur, nur, nur wahr zu sein. Es sind dann ja auch in der
Regel alle Bedingungen des Verstehens da, wenn die Attacke nicht gerade darin besteht, daß wir in einer Diskussion herausgefordert werden. Darüber will ich dann noch sprechen. Denn es handelt sich dann eigentlich darum, überhaupt nicht eigentliche Reden zu halten, sondern etwas ganz anderes zu tun, was für uns wohl, wenn wir diesen Kursus mit Recht absolvieren wollen, ganz besonders wichtig sein wird. Denn wir werden ja, um in dem Sinne zu wirken, wie ich es heute im Anfang angedeutet habe, nicht bloß Reden zu halten haben, sondern auch in der Diskussion unseren Mann - selbstverständlich auch unsere Dame - zu stellen haben. Und darüber muß also durchaus auch gesprochen werden, und sogar sehr viel gesprochen werden.
Nun bitte ich Sie vor allen Dingen, das, was ich heute gesagt habe, von dem Gesichtspunkte aus ins Auge zu fassen, daß es vielleicht ein bißchen darauf hinweist, wie schwierig man es hat mit dem Aneignen der Redekunst. Aber ganz besonders schwierig hat man es, wenn nicht nur geredet, sondern sogar über das Reden geredet werden soll. Denken Sie sich, wenn man das Malen malen, das Bildhauern bildhauern sollte! Also, die Aufgabe ist nicht ganz leicht. Aber wir werden versuchen, sie doch in irgendeiner Weise in den nächsten Tagen zu absolvieren.
ZWEITER VORTRAG Dornach, 12. Oktober 1921
Wenn wir heute darangehen, zu sprechen über Anthroposophie und die Dreigliederungsbewegung mit ihren verschiedenen Konsequenzen - die ja aus Anthroposophie heraus entspringt und im Grunde aus ihr heraus gedacht werden muß -, dann müssen wir uns vor allen Dingen vor die Seele halten, daß es schwer ist, verstanden zu werden. Und ohne diese Empfindung, daß es schwer ist, verstanden zu werden, werden wir wohl kaum in einer uns befriedigenden Art zurechtkommen können als Redner für anthroposophisch Geisteswissenschaftliches und alles, was damit zusammenhängt. Denn wenn sachgemäß über Anthroposophie gesprochen werden soll, muß eigentlich durchaus anders gesprochen werden, als man nach den Traditionen des Sprechens gewohnt ist, über Dinge überhaupt zu sprechen. Man hat sich ja vielfach gewöhnt, auch über anthroposophische Dinge so zu sprechen, wie man eben gewohnt worden ist zu sprechen, namentlich in der Zeit des Materialismus. Aber dadurch verbaut man eher das Verständnis für Anthroposophie, als daß man zu ihr den Zugang eröffnete.
Wir werden uns zunächst einmal nur das Inhaltliche, das Stoffliche gewissermaßen ganz klarmachen müssen, das uns mit Anthroposophie und ihren Konsequenzen entgegentritt. Und ich werde es ja hier in diesen Vorträgen, wie ich schon gestern sagte, durchaus zu tun haben mit einem Anwenden des Rednerischen gerade nur in anthroposophischen und dazugehörigen Dingen, so daß, was ich zu sagen habe, eben nur dafür gilt.
Wir müssen uns nun klarmachen, daß zunächst für, sagen wir, die Hauptsache der Dreigliederung das Gefühl ja erst rege gemacht werden muß in unserer gegenwärtigen Menschheit. Es muß im Grunde genommen vorausgesetzt werden, daß ein gegenwärtiges Publikum zunächst mit dem Begriff der Dreigliederung nichts rechtes anzufangen weiß, und unser Sprechen muß langsam dazu führen, dem Publikum erst eine Empfindung von dieser Dreigliederung beizubringen.
Man ist ja gewohnt worden in der Zeit, in welcher der Materialismus geherrscht hat, rednerisch die Dinge der Außenwelt in beschreibender Art vorzubringen. Da hatte man in der Außenwelt selber eine Art von Anleitung. Und außerdem war das Objekt der Außenwelt, ich möchte sagen, zu feststehend, als daß man nicht geglaubt hätte, wie man rede über die Dinge der Außenwelt, das sei schließlich gleichgültig, wenn man nur den Menschen zur Anschauung dieser Außenwelt eine Anleitung auf den Weg gebe. Nun, und schließlich ist es ja auch so: Wenn man irgendwo, sagen wir, einen populären Experimentalvortrag hält und dabei den Leuten vorführt, wie dieser oder jener Stoff in der Retorte reagiert, dann sehen sie, wie dieser Stoff in der Retorte reagiert, und ob man da nun so oder so redet - ein bißchen besser, ein bißchen weniger gut, ein bißchen sachgemäßer, ein bißchen unsachgemäßer -, macht ja schließlich nichts aus. Und nach und nach ist es schon ein wenig so geworden, daß solche Vorträge und solche Reden besucht werden, damit man dasjenige sieht, was experimentiert wird, und was da noch gesprochen wird, das nimmt man eben wie eine Art mehr oder weniger angenehmen oder unangenehmen Nebengeräusches mit. Man muß diese Dinge etwas radikal aussprechen, damit man gerade in die richtige Richtung weist, in der sich die Zivilisation in bezug auf diese Dinge bewegt. Und wenn es sich dann um dasjenige handelt, was man in den Leuten für das Tun, für das Wollen anregen will, da meint man, man müsse vor die Leute eben Ideale hinstellen, da müßten sie sich gewöhnen, Ideale aufzufassen, und da gleitet man dann nach und nach immer mehr ins Utopistische hinüber, wenn es sich um so etwas handelt wie zum Beispiel die Dinge der Dreigliederung des sozialen Organismus.
So ist es ja auch in vieler Beziehung gekommen: Viele Menschen, die heute über die Dreigliederung reden, rufen durchaus die Meinung hervor - durch die Art, wie sie reden -, daß es sich um irgendeine Utopie handle, um irgend etwas, was man anstreben solle. Und da man immer die Meinung hat, dasjenige, was angestrebt werden soll, das müsse meistens erst kommen können in fünfzig, in hundert Jahren -oder manche dehnen die Zeit noch länger aus -, so gestattet man sich dann auch, ganz unbewußt, über die Dinge so zu reden, als wenn sie
eben erst in hundert oder fünfzig Jahren reif wären, heranzukommen. Man gleitet sehr bald von der Wirklichkeit ab und redet dann darüber: Wie wird ein Krämerladen eingerichtet sein beim dreigliedrigen sozialen Organismus? Wie wird das Verhältnis des einzelnen Menschen zur Nähmaschine sein im dreigliedrigen sozialen Organismus? - und so weiter. Diese Fragen werden ja wirklich in Fülle gestellt gegenüber einer Bestrebung, wie die zur Dreigliederung des sozialen Organismus eine ist. Gegenüber einer solchen Bestrebung, die mit allen ihren Wurzeln aus der Wirklichkeit herauskommt, sollte man durchaus nicht in dieser Weise utopistisch reden. Denn mindestens dieses Gefühl sollte man immer hervorrufen, daß ja die Dreigliederung des sozialen Organismus nichts ist, was man machen kann, machen kann in dem Sinne, wie man in irgendeinem Parlamente von der Art, wie zum Beispiel die Weimarische Nationalversammlung eines war, Staatsverfassungen macht. Die macht man! Aber in demselben Sinne kann man nicht sprechen vom Machen des dreigliedrigen sozialen Organismus.
Ebensowenig kann man davon sprechen, daß man organisieren soll, damit die Dreigliederung herauskäme. Was ein Organismus ist, das organisiert man eben nicht; das wächst. Es ist ja gerade das Wesen des Organismus, daß man ihn nicht zu organisieren hat, daß er sich selbst organisiert. Was man organisieren kann, ist kein Organismus. Mit diesen Empfindungen müssen wir von vornherein an die Dinge herangehen, sonst werden wir nicht die Möglichkeit des sachgemäßen Ausdrucks finden können.
Die Dreigliederung ist etwas, das ja einfach aus dem natürlichen Zusammenleben der Menschen folgt. Man kann dieses natürliche Zusammenleben der Menschen fälschen, indem man, wie es zum Beispiel in der neueren Geschichte der Fall gewesen ist, die Eigentümlichkeiten des einen Gliedes, des rechtlich-staatlichen Gliedes, auf die beiden anderen ausdehnt. Dann werden einfach diese beiden anderen Glieder korrumpiert, weil sie nicht gedeihen können, so wie jemand nicht gedeihen kann, wenn man ihm ein ungeeignetes Gewand anzieht, das ihm zu schwer ist oder dergleichen.
Im natürlichen Zusammenhang der Menschen lebt die Dreigliederung des sozialen Organismus, lebt das selbständige Geistesleben, lebt
das Rechts- oder Staatsleben, das auf die Mündigkeit der Menschen gestellt ist, lebt auch das nur aus sich heraus sich gestaltende Wirtschaftsleben. Man kann dem Geistesleben und kann dem Wirtschaftsleben Zwangsjacken anlegen, obwohl man es nicht nötig hat; aber dann macht sich fortwährend ihr Eigenleben geltend, und was wir dann im Außeren erleben, ist eben das Sich-geltend-Machen des Eigen-lebens. Es ist also notwendig, aus der Natur des Menschen und aus der Natur des sozialen Zusammenlebens die Selbstverständlichkeit der Dreigliederung des sozialen Organismus zu zeigen. Sehen wir doch, wie in Europa das Geistesleben durchaus selbständig und frei war bis zum 13., 14. Jahrhundert, wo man das, was freies, selbständiges Geistesleben war, zuerst in die Universitäten hineingeschoben hat. Sie finden gerade in dieser Zeit die Begründung der Universitäten, und die Universitäten schlüpften dann nach und nach wiederum in das Staatsleben hinein. So daß man sagen kann: Etwa vom 13. bis zum 16., 17. Jahrhundert schlüpfen die Universitäten in das Staatsleben hinein, und mit den Universitäten, ohne daß es ja eigentlich die Leute bemerkt haben, auch die übrigen Unterrichts- und Erziehungsanstalten. Sie sind ihnen einfach nachgefolgt. Das haben wir auf der einen Seite.
Und auf der anderen Seite haben wir ungefähr bis zu demselben Zeitalter das freie wirtschaftliche Walten, das seinen eigentlichen mitteleuropäischen Ausdruck gefunden hat in den freien wirtschaftlichen Dorfgemeinschaften. Und wie das freie Geistesleben hineingeschlüpft ist in die Universitäten, die zuerst lokalisiert sind und die dann unter-schlüpfen unter den Staat, so bekommt dasjenige, was wirtschaftliche Organisation ist, zuerst eine gewisse Verwaltung im rechtlichen Sinn, indem die Städte immer mehr und mehr auftauchen und die Städte nun dieses wirtschaftliche Leben zunächst organisieren, während es früher gewachsen ist, als die Dorfgemeinden tonangebend waren. Und dann sehen wir, wie nun auch immer wieder melir und mehr dasjenige, was in den Städten zentralisiert war, unterkriecht in die größeren Territorien der Staaten. Wir sehen also, wie die Tendenz der neueren Zeit darauf hinausgeht, auf der einen Seite das Geistesleben, auf der anderen Seite das Wirtschaftsleben unterkriechen zu lassen in die Staaten, die immer mehr und mehr den Charakter der nach römischem
Rechte konstituierten Gebiete annehmen. Das war eigentlich die Entwickelung in der neueren Zeit.
Und an dem Punkte der geschichtlichen Entwickelung sind wir angelangt, wo es so nicht mehr weitergeht, wo sich wiederum ein Herz und ein Sinn entwickeln muß für freies Geistesleben, weil einfach der Geist nicht fortschreitet, wenn er in der Zwangsjacke ist, weil er nur scheinbar fortschreitet, in Wahrheit aber dennoch zurückbleibt, niemals wirkliche Geburten, sondern höchstens Renaissancen feiern kann. Und ebenso ist es mit dem Wirtschaftsleben. Wir stehen eben heute einfach in dem Zeitalter, wo wir die Bewegung, die sich gerade in der zivilisierten Welt Europas mit ihrem amerikanischen Anhange entwikkelt hat, unbedingt rückgängig machen müssen, wo die entgegengesetzte Richtung einsetzen muß. Denn dasjenige, was eine Zeitlang sich fortentwickelt hat, muß an einem Punkt ankommen, wo etwas Neues einsetzen muß. Sonst kommt man in die Gefahr, es ebenso zu machen, wie man es machen würde, wenn eine Pflanze wachsen sollte und man sagen würde, man läßt sie nicht zum Keimen kommen, sondern sie soll weiter wachsen, sie soll immer weiter, weiter blühen. Nicht wahr, so würde sie wachsen: eine Blüte hervorbringen; jetzt keinen Keim, sondern wieder eine Blüte, wieder eine Blüte und so fort. Es ist also durchaus notwendig, daß man sich in diese Dinge ganz innerlich hineinfindet, und daß man ein Gefühl entwickelt für den historischen Wendepunkt, auf dem wir heute stehen.
Aber geradeso wie in einem Organismus jede Einzelheit notwendig so geformt ist, wie sie eben geformt ist, so ist in der Welt, in der wir leben und an der wir mitgestalten, alles so zu formen, wie es im Sinne des Ganzen an seinem Orte geformt werden muß. Sie können sich nicht denken, wenn Sie real denken, daß Ihr Ohrläppchen auch nur im allergeringsten anders geformt wäre, als es eben ist in Gemäßheit Ihres ganzen Organismus. Wäre Ihr Ohrläppchen nur ein bißchen anders geformt, dann müßten Sie auch eine ganz andere Nase, Sie müßten andere Fingerspitzen haben und so weiter. Und so muß auch die Rede, in die sich etwas ergießt, was wirklich neue Formen annimmt, durchaus - so wie das Ohrläppchen im Sinne des ganzen Menschen geformt ist - im Sinne der ganzen Sache gehalten sein.
Sie kann nicht gehalten sein in der Art, die man lernen kann etwa von der Predigtrede. Denn die Predigtrede, wie wir sie heute noch immer haben, beruht auf der Tradition, die eigentlich zurückgeht bis in den alten Orient; und sie beruht ja auf einer besonderen Stellung, welche der ganze Mensch im alten Orient zu der Sprache hatte. Diese Eigentümlichkeit ist dann fortgesetzt worden, so daß sie lebte in einer gewissen freien Weise in Griechenland, lebte in Rom und heute ihr letztes Auffiackern am deutlichsten zeigt in dem besonderen Verhältnis, das der Franzose zu seiner Sprache hat. Nicht als ob ich damit sagen wollte, daß jeder Franzose predigt, wenn er spricht, aber ein ähnliches Verhältnis, wie es sich aus dem orientalischen Verhältnis zur Sprache entwickeln mußte, lebt durchaus noch in der französischen Handhabung der Sprache weiter fort, nur eben durchaus in abschüssiger Bewegung.
Dieses Element, zu dem wir da hinschauen können in bezug auf das Sprachliche, das ist zum Ausdrucke gekommen, als man das Reden noch etwa so lernte, wie man es dann später, aber schon im Verfalls-stadium, lernen konnte von den Professoren, die eigentlich durchaus wie Mumien aus alten Zeiten weiterlebten, und die den Titel trugen «Professor für Eloquenz». Es war in früheren Zeiten fast an jeder Universität, an jeder Schule, auch an den Seminarien und so weiter, solch ein Professor für Eloquenz, für Rhetorik. Der berühmte Curtius in Berlin führte eigentlich offiziell noch den Titel «Professor für Eloquenz». Aber die Geschichte ist ihm zu dumm geworden und er hat nicht Eloquenz vorgetragen, sondern hat sich als Professor für Eloquenz nur dadurch gezeigt, daß er vom Professorenkollegium immer ausgeschickt worden ist bei festlichen Gelegenheiten, weil das immer die Aufgabe des Professors für Eloquenz war. Da hat es sich Curtius allerdings sehr angelegen sein lassen, seine Aufgabe für solche festlichen Gelegenheiten dadurch zu lösen, daß er die alten Regeln der Eloquenz möglichst wenig berücksichtigt hat. Im übrigen war es ihm zu dumm, Professor der Eloquenz zu sein in Zeiten, in die eben Professoren der Eloquenz nicht mehr hineinpassen, und er hat Kunstgeschichte, griechische Kunstgeschichte vorgetragen. Aber im Universitätsverzeichnis war er angeführt als «Professor der Eloquenz». Das weist uns zurück
auf ein Element, das im Reden in den alten Zeiten durchaus vorhanden war.
Nun, wenn wir etwas, was ganz besonders charakteristisch ist, die Ausbildung des Redens für die mitteleuropäischen Sprachen, also für das Deutsche etwa, nehmen, so hat ja alles, was man im ursprünglichen Sinne mit dem Wort Eloquenz bezeichnen kann, nicht den allergeringsten Sinn. Denn in diese Sprachen ist schon etwas eingeflossen, was durchaus anders ist als dasjenige, was dem Reden in den Zeiten eigen war, wo man die Eloquenz ernst nehmen mußte. Für die griechische, für die lateinische Sprache gibt es Eloquenz. Für die deutsche Sprache ist eine Eloquenz etwas ganz Unmögliches, wenn man innerlich auf das Wesenhafte sieht.
Nun leben wir aber heute durchaus in einem Übergange. Das kann auch nicht fortgebraucht werden, was etwa das Redeelement der deutschen Sprache war. Es muß durchaus versucht werden, aus diesem Redeelement herauszukommen und in ein anderes Redeelement hin-einzukommen. Und das ist mit die Aufgabe, die in einem gewissen Sinne zu lösen hat, wer über Anthroposophie oder Dreigliederung heute fruchtbar reden soll. Denn erst, wenn eine größere Anzahl von Menschen so zu reden vermag, werden Anthroposophie und Dreigliederung in der Öffentlichkeit auch in einzelnen Vorträgen richtig verstanden werden, während nicht wenige sind, die nur ein Pseudoverständnis und Pseudobekenntnisse entwickeln.
Wenn wir zurückblicken auf das besondere Element, das in bezug auf das Reden in den Zeiten vorhanden war, aus denen sich erhalten hat die Handhabung der Eloquenz, so müssen wir sagen: Da war es so, daß die Sprache wie herauswuchs aus dem Menschen, in ganz naiver Weise, wie seine Finger wachsen, wie seine zweiten Zähne wachsen. Im Nachahmungsprozeß ergab sich das Sprechen, ergab sich die Sprache mit ihrer ganzen Organisation. Und man kam erst nach der Sprache zu dem Gebrauch des Denkens.
Und nun war es so, daß der Mensch, wenn er zu anderen Menschen unter irgendeiner Aufgabe sprach, darauf zu sehen hatte, daß das innere Erlebnis, das Gedankenerlebnis gewissermaßen einschnappte in die Sprache. Die Satzfügung war da. Sie war in einer gewissen Weise
elastisch und dehnbar. Und innerlicher als die Sprache war das Gedankenelement. Man erlebte das Gedankenelement als etwas Innerlicheres als die Sprache und ließ es dann einschnappen in die Sprache, so daß es hineinpaßte, geradeso wie man in den Marmor hineinpaßt, was man als die Idee irgendeiner Statue oder dergleichen hat. Es war durchaus ein künstlerisches Bearbeiten der Sprache. Es hatte sogar die Art und Weise, wie man auch im Prosaischen zu sprechen hatte, etwas Ähnliches mit dem, wie man sich im Poetischen auszudrücken hatte. Rhetorik, Eloquenz hatten Regeln, die gar nicht unähnlich waren den Regeln des poetischen Ausdruckes. Ich möchte hier, damit ich nicht mißverstanden werde, einfügen, daß die Entwickelung der Sprache nicht etwa die Poesie ausschließt. Was ich jetzt sage, sage ich für ältere Arten des Ausdruckes, und ich bitte, das nicht so aufzufassen, als wenn ich behaupten wollte, heute könne es überhaupt nicht mehr Poesie geben. Wir haben nur nötig, die Sprache in der Poesie anders zu behandeln. Aber das gehört ja nicht hierher; das möchte ich nur in Parenthese einfügen, damit ich nicht mißverstanden werde.
Und wenn wir nun fragen: Wie hatte man also in dieser Zeit zu sprechen, in welcher der Gedanke, der Empfindungsgehalt in die Sprache einschnappte? - Man hatte schön zu sprechen! Das war die erste Aufgabe: schön zu sprechen. Schön sprechen kann man daher eigentlich auch nur lernen, indem man sich vertieft in die alte Art zu sprechen. Schön zu sprechen hatte man. Und das schöne Sprechen ist durchaus eine Gabe, welche der Menschheit aus dem Oriente zukommt. Man möchte sagen: Schön zu sprechen hatte man bis dahin, daß man eigentlich als Ideal des Sprechens angesehen hat das Singen, das Singen der Sprache. Und nur eine Form dieses Schönsprechens ist das Predigen, wobei manches abgestreift ist von dem Schönsprechen. Denn das volle Schönsprechen ist das kultische Sprechen. Gießt sich das kultische Sprechen in die Predigt aus, so ist schon manches abgestreift. Aber immerhin ist die Predigt eine Tochter des Schönsprechens im Kultus.
Die zweite Form, die dann insbesondere ja in der deutschen Sprache und in ähnlichen Sprachen zum Ausdruck gekommen ist, ist diese, die eigentlich gar nicht bedingt ist, so daß man gar nicht mehr recht unterscheiden
kann zwischen dem Worte und dem Begreifen, dem Worte und dem Gedankenerlebnis; das Wort ist abstrakt geworden, so daß es selbst wie eine Art Gedanke sich ausnimmt. Es ist das Element, wo abgestreift ist das Verständnis für die Sprache selbst. Es kann nicht mehr einschnappen, weil man das Einschnappende und dasjenige, in das eingeschnappt werden soll, schon von vornherein wie Eines empfindet.
Wer ist sich denn heute im Deutschen zum Beispiel klar, wenn er aufschreibt «Begriff», daß dies das substantivierte Begreifen ist, das Be-greifen, das Greifen mit einer Vorsilbe ist also, das Greifen an etwas ausführen, daß «Begriff» also nichts anderes ist als das substantivierte gegenständliche Anschauen? In einer Zeit ist der Begriff «Begriff» gebildet worden, als man noch eine lebendige Empfindung hatte von dem Ätherleibe, der die Dinge angreift. So daß man dazumal wirklich den Begriff des Begriffes bilden konnte, weil das Angreifen mit dem physischen Leibe eben nur ein Bild ist von dem Angreifen mit dem Ätherleibe.
Aber, um in dem Worte Begriff das Begreifen zu hören, dazu gehört ja, daß man die Sprache als einen eigenen Organismus empfindet. In dem Elemente des Sprechens, von dem ich jetzt berichte, da schwimmt ja Sprache und Begriff immer durcheinander, da ist gar nicht jene scharfe Trennung, die einst im Oriente vorhanden war, wo die Sprache ein Organismus ist, mehr äußerlich ist, und das, was sich ausspricht, innerlich lebt. Und einschnappen mußte beim Reden das innerlich Lebende in die sprachliche Form, und zwar so einschnappen, daß das innerlich Lebende der Inhalt ist, und das, worin es ein-schnappte, die äußere Form. Und dieses Einschnappen mußte im Sinne des Schönen geschehen, so daß man also ein wirklicher Sprachkünstler ist, wenn man reden will.
Das ist nicht mehr der Fall, wenn man zum Beispiel keine Empfindung mehr dafür hat, zu unterscheiden zwischen Gehen und Laufen in bezug auf das Sprachliche als solches. Gehen: zwei e, man wandelt dahin, ohne daß man sich dabei anstrengt; e ist immer der Empfindungsausdruck für die geringe Teilnahme, die man hat an der eigenen Tätigkeit. Wenn man ein au im Worte hat, da ist diese Teilnahme gesteigert.
Beim Laufen kommt es auch zum Schnaufen, wo derselbe Vokal drinnen ist. Da kommt das Innere in Aufruhr. Da muß ein Laut da sein, der diese Modifikation des Inneren andeutet. Aber das alles ist ja heute nicht mehr da; die Sprache ist abstrakt geworden. Sie ist wie die dahinfließenden Gedanken selber für das ganze mittlere und namentlich auch für das westliche Gebiet der Zivilisation.
In jedem einzelnen Worte ist es möglich, ein Bild, eine Imagination zu schauen, und in diesem Bilde kann man so leben wie in etwas relativ Objektivem. Derjenige, der noch in älteren Zeiten der Sprache gegenübergestanden hat, der wird ebensowenig in die Lage gekommen sein, die Sprache als etwas zu betrachten, das nicht objektiv mit ihm verbunden gewesen wäre und in das das Subjektive sich hineinergossen hätte, wie er niemals aus dem Auge verloren hat, daß sein Rock etwas Objektives ist und nicht mit seinem Leibe als eine andere Haut zusammengewachsen ist.
Die zweite Stufe der Sprache dagegen nimmt ja überhaupt den ganzen Organismus der Sprache wie eine andere Haut der Seele, während die Sprache vorher viel loser, ich möchte sagen, wie ein Kleid da war. Ich spreche jetzt von der Stufe der Sprache, bei der nicht mehr in erster Linie in Betracht kommt, schön zu sprechen, sondern richtig zu sprechen, bei der es sich nicht um Rhetorik und Eloquenz, sondern um Logik handelte, in der die Grammatik selber so weit logisch wurde, daß man ja einfach - und zwar kommt das seit Aristoteles' Zeiten langsam herauf - aus den grammatikalischen Formen die logischen entwickelte, von den grammatikalischen die logischen abstrahierte. Es ist ja alles da zusammengeschwommen: Gedanke und Wort. Der Satz ist dasjenige, woran man das Urteil entwickelt. Aber das Urteil ist ja eigentlich in dem Satze so gelegen, daß man es nicht mehr innerlich selbständig erlebt. Richtigsprechen, das ist die Signatur geworden.
Nun aber sehen wir heute schon ein neues Element des Sprechens heraufkommen, nur überall am falschen Ort angewendet, auf ein ganz falsches Gebiet übertragen. Das Schönsprechen verdankt die Menschheit dem Orient. Das Richtigsprechen liegt im mittleren Gebiet der Zivilisation. Und nach dem Westen müssen wir hinschauen, wenn wir das dritte Element suchen.
Aber in diesem Westen kommt es zunächst ganz korrumpiert herauf. Wie kommt es herauf? Nun, zunächst ist die Sprache abstrakt geworden. Was Wortorganismus ist, das ist fast schon Gedankenorganismus. Und im Westen hat sich das allmählich so gesteigert, daß man es dort vielleicht sogar für spaßhaft ansehen würde, solche Dinge noch zu erörtern. Aber es ist schon, auf einem ganz falschen Gebiete, der Fortschritt durchaus vorhanden.
Sehen Sie, in Amerika hat sich aufgetan gerade im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine philosophische Richtung, welche «Pragmatismus» genannt wird. In England hat man sie dann «Humanismus» genannt. James ist der Vertreter in Amerika, Schiller der Vertreter in England. Es sind dann Persönlichkeiten da, die nun schon daran sind, diese Dinge etwas zu erweitern. So gebührt das Verdienst, gerade diesen Begriff des Humanismus in einem sehr schönen Sinne erweitert zu haben, dem neulich hier anwesend gewesenen Professor Mackenzie.
Worauf laufen diese Bestrebungen denn hinaus? Ich meine jetzt den amerikanischen Pragmatismus und den englischen Humanismus. Sie gehen hervor aus einer vollständigen Skepsis gegenüber der Erkenntnis: Wahrheit ist etwas, was es eigentlich gar nicht gibt! Wenn wir zwei Behauptungen aufstellen, so stellen wir sie eigentlich aus dem Grunde auf, um im Leben Richtpunkte zu haben. Von einem «Atom» zu sprechen - man kann nicht irgendeinen besonderen Wahrheitsgrund dafür aufbringen; aber es ist nützlich, in der Chemie die Atomtheorie zugrunde zu legen; also stellen wir den Begriff des Atoms auf. Er ist brauchbar, er ist nützlich. Es gibt keine andere Wahrheit als eine solche, die in nützlichen, für das Leben brauchbaren Begriffen lebt. «Gott», ob es ihn gibt oder nicht, darauf kommt es nicht an. Wahrheit, das ist so irgend etwas, was uns nichts angeht. Doch es läßt sich nicht gut leben, wenn man nicht den Begriff «Gott» aufstellt; es läßt sich wirklich gut leben, wenn man so lebt, als ob es einen Gott gäbe. Also stellen wir ihn auf, weil es ein für das Leben brauchbarer, nützlicher Begriff ist. Ob die Erde im Sinne der Kant-Laplaceschen Theorie begonnen hat und im Sinne der mechanischen Wärmetheorie enden wird, vom Wahrheits-standpunkt aus weiß kein Mensch etwas darüber - ich referiere jetzt bloß -, aber es ist nützlich für unser Denken, sich den Anfang der Erde
und das Ende der Erde so vorzustellen. Das ist die pragmatistische Lehre von James und auch im wesentlichen die humanistische Lehre von Schiller. Schließlich weiß man auch gar nicht, ob der Mensch nun wirklich, wenn man vom Wahrheitsstandpunkt ausgeht, eine Seele hat. Darüber kann man diskutieren bis ans Ende der Welt, ob es eine Seele gibt oder nicht, aber nützlich ist es, wenn man all das, was der Mensch da im Leben ausführt, begreifen will, eine Seele anzunehmen.
Natürlich, es verbreitet sich alles das, was da an einem Orte heute in unserer Zivilisation auftritt, wiederum über die anderen Orte. Und für solche Dinge, die instinktiv im Westen aufgetreten sind, mußte der Deutsche etwas finden, was nun mehr begrifflich ist, was sich leichter begrifflich durchschauen läßt. Und daraus entstand die Philosophie des «Als Ob»: Ob es ein Atom gibt oder nicht, darauf kommt es nicht an; wir betrachten die Erscheinungen so, «als ob» es ein Atom gäbe. Ob das Gute sich realisieren kann oder nicht, darüber kann man nicht entscheiden; wir betrachten das Leben so, «als ob» das Gute sich realisieren könnte. Ob es einen Gott gibt oder nicht, darüber könnte man ja bis ans Ende der Welt streiten; wir betrachten aber das Leben so, daß wir handeln, «als ob» es einen Gott gäbe. Da haben Sie die «Als Ob»-Philosophie.
Man beachtet diese Dinge wenig, weil man sich denkt: Nun ja, da sitzt in Amerika der James mit seinen Schülern, da sitzt Schiller in England mit seinen Schülern; da ist der Vaihinger, der die Philosophie des «Als Ob» geschrieben hat: das sind so ein paar Käuze, die leben 50 in einer Art Wolkenkuckucksheim, und was geht das die anderen Menschen an!
Wer aber das Ohr dafür hat, der hört heute die «Als Ob»-Philosophie schon überall anklingen: Fast alle Menschen reden im Sinne der «Als Ob»-Philosophie. Die Philosophen sind nur ganz spaßige Kerle. Die plauschen immer das aus, was die anderen Menschen unbewußt machen. Wenn man unbefangen genug dazu ist, so hört man heute nur selten einen Menschen, der seine Worte noch anders gebraucht, im Zusammenhang mit seinem Herzen und mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Menschen, der anders spricht, als wie wenn die Sache so wäre, wie er sie ausdrückt. Man hat nur gewöhnlich nicht das Ohr
dafür, im Klang und in der Farbentönung des Sprechens zu hören, daß dieses «Als Ob» drinnen lebt, daß im Grunde genommen die Menschen schon über die ganze Zivilisation hin von diesem «Als Ob» ergriffen sind.
Aber so, wie sonst die Dinge am Ende in Korruption kommen, zeigt sich da etwas korrumpiert am Anfange, was nun gerade in einem höheren Sinne entwickelt werden muß für die Handhabung der Rede in Anthroposophie, in Dreigliederung und so weiter. So ernst, so wichtig sind diese Dinge, daß wir über sie eigentlich extra reden sollten. Denn es wird sich darum handeln, daß wir die Trivialität «Wir gebrauchen Begriffe, weil sie nützlich sind für das Leben», daß wir diese Trivialität einer materialistischen Utilitätstheorie ins Ethische hinaufheben und vielleicht durch das Ethische ins Religiöse. Denn die Aufgabe steht vor uns, wenn wir wirken wollen im Sinne von Anthroposophie und von Dreigliederung, daß wir hinzulernen zu dem, was wir aus der Geschichte uns aneignen können - zu dem Schönsprechen, zu dem Richtigsprechen -, das Gutsprechen, daß wir ein Ohr erhalten für das Gutsprechen.
Ich habe bis jetzt wenig bemerkt, daß es aufgefallen ist, wenn ich im Verlaufe meiner Vorträge hingewiesen habe - ich habe es sehr häufig getan - auf dieses in diesem Sinne Gutsprechen, indem ich immer gesagt habe, es komme heute nicht allein darauf an, daß dasjenige, was man sagt, im logisch-abstrakten Sinne richtig ist, sondern es komme darauf an, daß in einem gewissen Zusammenhang etwas gesagt wird, oder auch unterlassen wird zu sagen, nicht gesagt wird in diesem Zusammenhange; daß man ein Gefühl dafür entwickelt, daß etwas nicht nur richtig sein soll, sondern daß es in seinem Zusammenhang drinnen gerechtfertigt ist, daß es gut sein kann in einem gewissen Zusammen-hange, oder schlecht sein kann in einem gewissen Zusammenhange. Wir müssen lernen, über die Rhetorik, über die Logik hinaus eine wirkliche Ethik des Sprechens. Wir müssen wissen, wie wir uns in einem gewissen Zusammenhange Dinge erlauben dürfen, die in einem anderen Zusammenhange gar nicht gestattet waren.
Da darf ich jetzt ein naheliegendes Beispiel gebrauchen, das vielleicht schon einigen von Ihnen, die letzthin bei den Vorträgen anwesend
waren, hat auffallen können: Ich habe in einem gewissen Zusammenhang davon gesprochen, daß Goethe eigentlich in Wirklichkeit gar nicht geboren ist. Ich habe davon gesprochen, daß Goethe lange Zeit sich bemüht hat, malerisch sich auszudrücken, zu zeichnen, aber daß daraus nichts geworden ist, daß das dann übergeflossen ist in seine Dichtungen, und daß wiederum in den Dichtungen, wie zum Beispiel in «Iphigenie» oder besonders in der «Natürlichen Tochter» ja gar nicht im schwärmerischen Sinne Dichtungen vorliegen. «Marmorglatt und marmorkalt», haben die Leute diese Dichtungen Goethes genannt, weil sie fast bildhauerisch sind, weil sie plastisch sind. Goethe hatte lauter Fähigkeiten, die eigentlich gar nicht bis zur Menschwerdung gediehen sind; er ist gar nicht wirklich geboren. - Sehen Sie, in jenem Zusammenhang, in dem ich das ausgesprochen habe letzthin, konnte man es ganz gewiß sagen. Aber denken Sie sich, wenn das einer als eine These für sich im absoluten Sinne vertreten würde! Es wäre nicht nur unlogisch; es wäre selbstverständlich ganz verrückt.
Aus dem Lebenszusammenhang heraus sprechen ist etwas anderes, als die Adäquatheit oder Richtigkeit eines Wortzusammenhanges finden für den Gedanken- und Empfindungszusammenhang. Heraus entstehen lassen aus einem lebendigen Zusammenhange an einer bestimmten Stelle ein Diktum oder dergleichen, das ist dasjenige, was hinüberführt von der Schönheit, von der Richtigkeit zu dem Ethos der Sprache, wobei man empfindet, wenn man einen Satz ausspricht, ob man ihn aussprechen darf oder nicht aussprechen darf in dem ganzen Zusammen-hange. Da gibt es wiederum, aber jetzt ein verinnerlichtes Zusammenwachsen, jetzt nicht mit der Sprache, sondern mit der Rede. Das ist es, was ich das Gutsprechen oder Schlechtsprechen nennen möchte; die dritte Form. Neben dem Schön- und Häßlichsprechen, neben dem Richtig- oder Unrichtigsprechen kommt das Gut- oder Schlechtsprechen in dem Sinne, wie ich das jetzt dargestellt habe.
Es ist heute noch vielfach die Ansicht verbreitet, es gäbe Sätze, die man formt und die man dann bei jeder Gelegenheit sprechen könne, weil sie absolut gelten. Solche Sätze gibt es nämlich in Wirklichkeit für unser Leben in der Gegenwart nicht mehr, sondern jeder Satz, der in einem gewissen Zusammenhang möglich ist, ist für einen anderen
Zusammenhang heute schon unmöglich. Das heißt, wir sind in eine Epoche der Menschheitsentwickelung eingetreten, wo wir nötig haben, auf diese Vielseitigkeit des Erlebens unser Augenmerk zu lenken.
Der Orientale, der mit seinem ganzen Denken in einem kleinen Territorium lebte, auch noch der Grieche, der mit seinem Geistesleben, mit seinem Rechtsleben, mit seinem Wirtschaftsleben auf einem kleinen Territorium lebte, der goß auch in seine Sprache etwas hinein, was so aussieht, wie ein sprachliches Kunstwerk aussehen muß. Wie ist es denn bei einem Kunstwerk? So ist es, daß in einem einzelnen geschlossenen Objekte eigentlich ein Unendliches erscheint auf einem bestimmten Gebiete. So ist sogar, wenn auch einseitig, das Schöne definiert worden von Haeckel, von Darwin und anderen: Es ist die Erscheinung der Idee in einem abgeschlossenen Formgebilde. Es ist das erste, wogegen ich mich wenden mußte in meinem Wiener Vortrag «Goethe als Vater einer neuen Ästhetik», daß das Schöne «die Erscheinung der Idee in der äußeren Form» sei, indem ich zeigte, daß man gerade das Umgekehrte meinen müsse: daß das Schöne entsteht, wenn man der Form den Schein des Unendlichen gibt.
Und so ist es mit der Sprache, die gewissermaßen auch als begrenztes Territorium auftritt, als Territorium, welches die mögliche Bedeutung in Grenzen einschließt: wenn in diese Sprache einschnappen muß dasjenige, was eigentlich an innerem Seelen- und Geistesleben unendlich ist. Da muß es in schöner Form zum Ausdrucke kommen.
Beim Richtigsprechen, da muß es adäquat sein, da muß der Satz zum Urteil, der Begriff zum Wort passen. Dazu waren die Römer genötigt, ganz besonders als ihr Territorium immer größer und größer wurde: da formte sich ihre Sprache um aus dem Schönen ins Logische, daher dann die Sitte beibehalten worden ist, gerade in der lateinischen Sprache den Leuten Logik beizubringen. Sie haben es ja auch daran ganz gut gelernt.
Aber nun sind wir wiederum über dieses Stadium hinaus. Nun ist es notwendig, daß wir die Sprache empfinden lernen mit Ethos, daß wir gewissermaßen eine Art Moralität des Sprechens in unsere Rede hinein gewinnen, indem wir wissen, wir haben uns in einem gewissen Zusammenhange etwas zu gestatten oder etwas zu versagen. Da
schnappt die Sache nicht ein in der Weise, wie ich es früher geschildert habe, sondern da verwenden wir, indem wir das Wort gebrauchen, dieses Wort, um zu charakterisieren. Da hört alles Definieren auf; da wird das Wort verwendet, um zu charakterisieren. Da wird das Wort so gehandhabt, daß man eigentlich jedes Wort als etwas Ungenügendes empfindet, jeden Satz als etwas Ungenügendes empfindet, und den Drang hat, dasjenige, was man hinstellen will vor die Menschheit, von den verschiedensten Seiten her zu charakterisieren, gewissermaßen um die Sache herumzugehen und sie von den verschiedensten Seiten zu charakterisieren. Ich habe oft betont, daß das die Darstellungsweise der Anthroposophie sein muß. Ich habe es oft betont, daß man ja nicht glauben solle, man könne das adäquate Wort, den adäquaten Satz finden, sondern man kann sich nur so verhalten wie der Photograph, der, um einen Baum zu zeigen, wenigstens vier Aspekte nimmt. Also heraufgehoben werden muß eine Anschauung, die sich in einer abstrakten, trivialen Philosophie als «Pragmatismus» und «Humanismus» auslebt, heraufgehoben muß sie werden ins Gebiet des Ethischen. Und dann muß sie sich zuerst ausleben im Ethos der Sprache: Wir müssen gut sprechen lernen. Das heißt, wir müssen für das Sprechen etwas erleben von alldem, was wir sonst erleben in bezug auf die Ethik, die Sittenlehre.
Und im Grunde genommen ist ja die Sache in der neueren Zeit recht anschaulich geworden. Da haben wir im Sprechen der Theosophen eine einfach schon durch die Sprache bedingte Altertümlichkeit, nämlich altertümlich in bezug auf die letzten Jahrhunderte materialistischer Färbung: «physischer Leib» - nun, er ist dick; « Ätherleib» - er ist dünner, nebelhaft; «astralischer Leib» - wiederum dünner, aber eben doch nur dünner; «Ich» - noch dünner. Nun kommen ja immerfort und immerfort neue Glieder der menschlichen Wesenheit: das wird immer dünner. Man weiß zuletzt schon gar nicht mehr, wie man zu dieser Dünnheit noch kommen kann, aber jedenfalls wird es nur immer dünner und dünner. Man kommt aus dem Materialismus nicht heraus. Das ist ja auch das Kennzeichen dieser theosophischen Literatur. Und das ist immer das Kennzeichen, was da auftritt, wenn über diese Dinge gesprochen werden soll, von dem theoretischen Sprechen bis zu dem,
was ich einmal innerhalb der Theosophischen Gesellschaft in Paris erlebt habe, ich glaube, es war 1906. Da wollte eine Dame, die eine richtige kernfeste Theosophin war, ausdrücken, wie gut ihr einzelne Reden gefallen haben, die in dem Saal, wo wir waren, gesprochen worden sind; und da sagte sie: Es sind so gute Vibrationen da! - Und man merkte ihr an: eigentlich war dieses gemeint wie etwas, das man schnüffelt. Also die Düfte, die da zurückgeblieben waren von den Reden und die man so etwas erschnüffeln konnte, die waren eigentlich gemeint.
Wir müssen lernen, die Sprache loszureißen von der Adäquatheit. Denn sie kann adäquat sein nur dem Materiellen. Wollen wir sie für das Spirituelle verwenden im Sinne der heutigen Entwickelungsepoche der Menschheit, dann müssen wir sie freibekommen. Dann muß Freiheit in das Handhaben der Sprache hineinkommen. Und wenn man diese Dinge nicht abstrakt, sondern lebensvoll nimmt, so ist das erste, wo hineinkommen muß Philosophie der Freiheit in das Sprechen, in die Handhabung der Sprache. Denn das hat man nötig, sonst wird man nicht den Übergang finden zum Beispiel zu der Charakteristik des freien Geisteslebens.
Sehen Sie, für freies Geistesleben, das heißt Geistesleben, das aus seinen eigenen Gesetzen heraus da ist, es ist noch nicht sehr viel Verständnis in der gegenwärtigen Menschheit dafür vorhanden. Denn meistens versteht man unter freiem Geistesleben ein Gebilde, in dem Menschen leben, von denen jeder nach seinem eigenen Kikeriki kräht, wo jeder Hahn - verzeihen Sie das etwas merkwürdige Bild - auf seinem eigenen Misthaufen kräht, und wo dann die unglaublichsten Zusammenklänge aus diesem Krähen zustandekommen. In Wirklichkeit kommt beim freien Geistesleben nämlich durchaus Harmonie zustande, weil der Geist lebt, nicht die einzelnen Egoisten, weil der Geist wirklich über die einzelnen Egoisten hinüber ein eigenes Leben führen kann.
Es ist zum Beispiel - man muß diese Dinge schon heute sagen - für unsere Waldorfschule in Stuttgart durchaus ein Waldorfschulgeist da, der unabhängig ist von der Lehrerschaft, in den die Lehrerschaft sich hineinlebt, und in dem es immer mehr und mehr klar wird, daß unter
Umständen der eine fähiger oder unfähiger sein kann - der Geist aber hat ein eigenes Leben.
Es ist eine Abstraktion, von der sich heute noch die Menschen eine Vorstellung machen, wenn sie von «freiem Geist» sprechen. Das ist ja gar keine Wirklichkeit. Der freie Geist ist etwas, was wirklich lebt unter den Menschen, man muß ihn nur zum Dasein kommen lassen, und was wirkt unter den Menschen, man muß ihn nur zum Dasein kommen lassen.
Was ich heute zu Ihnen gesprochen habe, habe ich im Grunde auch nur gesprochen, um das, was wir hier profitieren sollen, von prinzipiellen Empfindungen ausgehen zu lassen, also von der Empfindung des Ernstes der Sache. Ich kann natürlich nicht meinen, daß jetzt alle gleich hinausgehen und so, wie die Alten schön gesprochen haben, die Mittleren richtig, nun alle gut sprechen werden! Aber Sie können deshalb auch nicht einwenden: Was helfen uns denn dann unsere ganzen Vorträge, wenn wir ja doch nicht gleich gut sprechen können? - Sondern es handelt sich darum, daß wir wirklich die Empfindung bekommen von dem Ernst der Lage, in die wir uns dadurch hineinleben sollen, daß wir wissen: Was da gewollt wird, ist etwas in sich so organisch Ganzes, daß sich selbst in der Sprache nach und nach ausdrücken muß eine Notwendigkeit der Form, wie sich in dem Ohrläppchen eine Notwendigkeit der Form ausdrückt, wie das nicht anders sein kann, je nachdem der ganze Mensch ist.
So werde ich versuchen, dann noch näher zusammenzubringen, was nun bei uns Inhalt von Anthroposophie und Dreigliederung ist, mit der Art, wie es an die Menschen herangebracht werden soll. Und ich werde aus dem Prinzipiellen in das Konkrete und in dasjenige, was dem Praktizieren zugrunde liegen soll, immer mehr und mehr hereinkommen.
DRITTER VORTRAG Dornach, 13. Oktober 1921
Es wird sich, zu den Aufgaben, die man sich auf einem bestimmten Gebiete als Redner stellen kann, darum handeln, den Stoff, den man zu behandeln hat, in der entsprechenden Weise zunächst selber zu durchdringen. Es gibt eine zweifache Durchdringung des Stoffes, in-sofern die Mitteilung über diesen Stoff durch das Reden in Betracht kommt. Das erste ist, sich den Stoff für eine entsprechende Rede anzueignen so, daß man ihn gliedern kann, daß man gewissermaßen in die Lage versetzt ist, der Rede eine Komposition zu geben. Ohne Komposition kann eine Rede eigentlich nicht verstanden werden. Es kann dem Zuhörer an einer nichtkomponierten Rede das eine oder das andere gefallen; aber in Wirklichkeit aufgenommen wird eine nichtkomponierte Rede nicht. Insofern die Vorbereitung in Betracht kommt, muß es sich daher darum handeln, daß man einsieht: Jede Rede muß unbedingt schlecht werden in bezug auf die Aufnahme durch die Zuhörer, welche nur so entstanden ist, daß man einfach eine Ausführung nach der anderen, einen Satz nach dem anderen sich vorgestellt hat und eines nach dem anderen in der Vorbereitung gewissermaßen durchgenommen hat. Ist man nicht in der Lage, wenigstens in irgendeinem Stadium der Vorbereitung die ganze Rede als ein Ganzes zu überschauen, dann kann man eigentlich nicht auf Verstandenwerden rechnen. Hervorgehenlassen die ganze Rede gewissermaßen aus einem umfassenden Gedanken, den man gliedert, und Entstehenlassen der Komposition dadurch, daß man von einem solchen einheitlichen, das Ganze der Rede umfassenden Gedanken ausgeht, das ist das erste.
Das andere ist das Zu-Rate-Ziehen aller Erfahrungen, die man für das Gebiet der Rede aus dem unmittelbaren Leben heraus haben kann, also möglichst in die Erinnerung rufen alles dasjenige, was man in der betreffenden Sache unmittelbar erlebt hat, und versuchen, nachdem man eine Art Komposition der Rede vor sich hat, die Erfahrungen in diese Komposition da oder dort hineinfließen zu lassen.
Das wird im allgemeinen die Skizze zum Vorbereiten sein. Man hat also dann in der Vorbereitung das Ganze der Rede vor sich wie in einem Tableau. Und so genau hat man dieses Tableau vor sich, daß man, wie es ja naturgemäß sein wird, die einzelnen Erfahrungen, an die man sich erinnert, in beliebiger Weise dahin oder dorthin unterbringen kann, wie wenn man auf dem Papier aufgeschrieben hätte:
a, b, c, d, und man nun eine Erfahrung hätte; man weiß, sie gehört unter d, eine andere unter f, eine andere gehört unter a, so daß man also gewissermaßen von der Folge der Gedanken, wie sie nachher vorgebracht werden sollen, in bezug auf dieses Aufsammeln der Erfahrungen unabhängig ist. Ob man so etwas macht, indem man es zu Papier bringt, oder ob man es in freier Verarbeitung ohne Zuhilfenahme des Papiers macht, davon wird ja nur abhängen, daß derjenige, der auf das Papier angewiesen ist, eben schlechter reden wird, und derjenige, der auf das Papier nicht angewiesen ist, etwas besser reden wird. Aber man kann natürlich durchaus beides machen.
Nun handelt es sich aber darum, daß man noch ein Drittes absolviert, und das ist, nachdem man auf der einen Seite das Ganze hat -ich sage niemals: das Gerippe hat - und auf der anderen Seite die einzelnen Erfahrungen, hat man nötig, die Ideen, die sich ergeben, so weit auszuarbeiten, daß diese Dinge bis zur vollständigsten eigenen inneren Befriedigung vor der Seele stehen können.
Nehmen wir also als Beispiel an, wir wollten eine Rede halten über Dreigliederung. Hier werden wir uns sagen: Nach einer Einleitung, über die werden wir noch sprechen, und vor einem Schlusse, über den wir auch noch sprechen, ist eigentlich die Komposition einer solohen Rede durch die Sache selbst gegeben. Der einheitliche Gedanke ist durch die Sache selbst gegeben. Ich sage das bei diesem Beispiel. Wenn man ordentlich geistig lebt, so gilt das eigentlich für jeden einzelnen Fall, es gilt für alles gleich. Aber nehmen wir dieses uns naheliegende Beispiel der Dreigliederung des sozialen Organismus, über die wir reden wollen. Da ist von vornherein das gegeben, daß uns die Behandlung unseres Themas drei Glieder ergibt. Wir werden zu behandeln haben das Wesen des geistigen Lebens, das Wesen des rechtlich-staatlichen Lebens und das Wesen des wirtschaftlichen Lebens.
Nun wird es sich allerdings darum handeln, daß wir durch eine entsprechende Einleitung - über die wir, wie gesagt, noch reden werden - eine Empfindung davon hervorrufen bei den Zuhörern, daß es überhaupt einen Sinn hat, über diese Dinge, über eine Wandlung in diesen Dingen, in der Gegenwart zu sprechen. Dann aber wird es sich darum handeln, nicht gleich etwa von Erklärungen auszugehen, was zu verstehen ist unter einem freien Geistesleben, unter einem auf Gleichheit begründeten rechtlich-staatlichen Leben, unter einem auf Assoziationen begründeten Wirtschaftsleben, sondern man wird hinführen müssen zu diesen Dingen. Und da wird man hinführen müssen dadurch, daß man anknüpft an dasjenige, was zunächst in allerhervorragendstem Maße über die drei Glieder des sozialen Organismus in der Gegenwart vorhanden ist, was also am intensivsten durch den Menschen der Gegenwart bemerkt werden kann. Nur dadurch wird man ja an Bekanntes anknüpfen.
Nehmen wir an, wir hätten ein Publikum, und ein solches Publikum kann uns ja am angenehmsten und am sympathischsten sein, das zusammengemischt wäre aus bürgerlicher Bevölkerung, aus proletarischer Bevölkerung - diese wiederum mit allen möglichen Nuancen -, und wenn dann natürlich auch ein paar Adelige dabei sind, schweizerische Adelige sogar, so schadet das natürlich durchaus nichts. Nehmen wir also an, wir hätten so ein aus allen Gesellschaftsklassen durcheinandergewürfeltes Publikum. Ich betone das aus dem Grunde, weil man eigentlich als Redner dieses immer erfühlen soll, zu wem man zu sprechen hat, bevor man an das Sprechen herangeht. Man sollte sich schon lebendig in die Situation nach dieser Richtung hineinversetzen.
Nun, was wird man sich selber zunächst sagen müssen über dasjenige, woran man bei dem heutigen Publikum anknüpfen kann in bezug auf den dreigliedrigen sozialen Organismus? Man wird sich sagen:
An Begriffe des Bourgeoispublikums läßt sich zunächst außerordentlich schwer anknüpfen, weil sich die Bourgeoisie über soziale Verhältnisse in der neueren Zeit außerordentlich wenig Vorstellungen gemacht hat, weil sie gewissermaßen gedankenlos in bezug auf das soziale Leben dahinvegetiert hat. Es würde immer einen akademischen Eindruck machen, wenn man aus dem Gedankenkreis eines bürgerlichen Publikums
heute reden wollte über diese Dinge. Andererseits aber wird man sich doch darüber klar sein können, daß über alle drei Gebiete des sozialen Organismus innerhalb der proletarischen Bevölkerung außerordentlich ausgeprägte Begriffe vorhanden sind, auch ausgeprägte Empfindungen, und auch ein ausgeprägtes soziales Wollen. Und es bedeutet das gerade die Signatur unserer heutigen Zeit, daß eben innerhalb der proletarischen Bevölkerung diese ausgebildeten Begriffe da sind.
Diese Begriffe sind dann aber allerdings von uns mit großer Vorsicht zu behandeln, denn wir werden sehr leicht das Vorurteil hervorrufen, daß wir nach der proletarischen Richtung hin parteiisch sein wollen. Dieses Vorurteil sollen wir durch die ganze Art und Weise unseres Auftretens eigentlich bekämpfen. Wir werden ja allerdings sehen, daß wir uns, wenn wir von proletarischen Begriffen ausgehen, zunächst schweren Mißverständnissen aussetzen. Diese Mißverständnisse haben sich ja in der Tat fortwährend ergeben in der Zeit, als noch in Mitteleuropa gewirkt werden konnte, so vom April 1919 ab, für die Dreigliederung des sozialen Organismus. Eine bürgerliche Bevölkerung hört nur das, was sie durch Jahrzehnte aus dem agitatorischen Auftreten des Proletariats empfunden hat, heraus aus bestimmten Begriffen. Wie man die Sache selbst meint, das wird zunächst fast gar nicht aufgefaßt.
Man muß sich klar sein darüber, daß das Wirken in der Welt über-haupt im Sinne, möchte ich sagen, der Weltenordnung erfaßt werden muß. Die Weltenordnung ist so - Sie brauchen nur bei den Fischen im Meer nachzusehen -, daß sehr, sehr viele Fischkeime abgelegt werden und nur wenige zu Fischen werden. Das muß so sein. Aber mit dieser Naturtendenz müssen Sie auch an die Aufgaben herangehen, welche von Ihnen als Redner zu lösen sind: Wenn sich auch nur ganz wenige, und diese wenig angeregt, zunächst finden bei der ersten Rede, dann ist eigentlich schon ein Maximum desjenigen erreicht, was erreicht werden kann. Es handelt sich ja bei Dingen, für die man so drinnensteht im Leben wie etwa für die Dreigliederung des sozialen Organismus, darum, daß dann dasjenige, was auf rednerischem Wege geleistet werden kann, eben niemals fallengelassen werden darf, sondern
aufgefangen werden muß und auf irgendeine Weise fortgebildet werden muß, sei es durch weitere Reden, sei es in irgendeiner anderen Weise. Man kann sagen: Keine Rede ist eigentlich vergeblich, welche aus dieser Gesinnung heraus gehalten wird und an die sich eben dann das Nötige anschließt.
Aber man muß sich völlig klar darüber sein, daß man auch bei einer proletarischen Bevölkerung eigentlich, wenn man gerade aus dem heraus spricht, was sie heute denkt im Sinne ihrer Theorien, wie sie seit Jahrzehnten bestehen, daß man auch da durchaus mißverstanden wird. Man kann sich nicht etwa die Frage stellen: Wie macht man es nun, damit man nicht mißverstanden wird? - Man muß es nur richtig machen! Aber darum kann es sich gar nicht handeln, sich etwa die Frage vorzulegen: Wie macht man es denn, damit man nicht mißverstanden wird? - Sie ist nicht schwer zu lösen, die Frage: Wie macht man es, damit man nicht mißverstanden wird? - Man sagt den Leuten, was sie ohnedies schon gedacht haben! Man tradiert ihnen irgendwie Marxismus oder so etwas. Dann wird man natürlich verstanden.
Aber es liegt ja kein Interesse vor, in dieser Weise verstanden zu werden. Sonst wird man ja sehr bald die folgende Erfahrung machen -über diese Erfahrung muß man sich völlig klar sein -: Redet man heute zu einer Proletarierversammlung so, daß sie wenigstens die Terminologie verstehen kann - und das muß man anstreben -, dann wird man, insbesondere in der Diskussion, bemerken, daß diejenigen, die diskutieren, nichts verstanden haben. Die anderen lernt man meistens nicht kennen, weil sie sich nicht an den Diskussionen beteiligen. Die nichts verstanden haben, beteiligen sich gewöhnlich nach solchen Reden an den Diskussionen. Und bei denen wird man eben etwas bemerken, was in der folgenden Linie liegt. Unzählige Reden habe ich selber gehalten über die Dreigliederung des sozialen Organismus vor, wie man es in Deutschland nennt, «Mehrheits-Sozialdemokraten », unabhängigen «Sozialdemokraten», Kommunisten und so weiter. Nun, man wird da bemerken: Wenn sich nun jemand in der Diskussion hinstellt und glaubt, reden zu können, so ist es ja meistens so, daß er einem antwortet, als ob man eigentlich gar nicht geredet hätte, sondern als ob irgend jemand geredet hätte so, wie man ungefähr als sozialdemokratischer
Agitator vor dreißig Jahren in Volksversammlungen geredet hätte. Man fühlt sich plötzlich ganz verwandelt. Man sagt sich ungefähr: Ja, sollte dir denn das Malheur passiert sein, daß du besessen warst in diesem Momente von dem alten Bebel? Denn so wird dir ja eigentlich entgegengetreten! Die Betreffenden hören selbst physisch nichts anderes, als was sie gewohnt sind, seit Jahrzehnten zu hören. Selbst physisch hören sie sonst nichts - nicht etwa bloß seelisch -, selbst physisch hören sie nur, was sie lange gewohnt sind. Und dann sagen sie: Ja, eigentlich hat uns der Vortragende gar nichts Neues gesagt! - Denn sie haben, weil man genötigt war, die Terminologie zu gebrauchen, sofort schon im Ohr - nicht erst in der Seele - den ganzen Zusammenhang der Terminologie übersetzt in das, was sie seit langem gewohnt gewesen sind. Und dann reden sie weiter fort im Sinne dessen, was sie seit langem gewohnt gewesen sind.
So ungefähr verliefen unzählige Diskussionen. Höchstens, daß manchmal eine neue Nuance dadurch in die Sache hineinkam, daß die Kommunisten nun von ihrem neu errungenen Standpunkte aus auftraten und nun etwa erklärten: Vor allen Dingen sei es notwendig, daß man die politische Macht habe! Es sei ja ganz natürlich - ich rede aus der Erfahrung heraus und gebe Beispiele, die durchaus vorgekommen sind -, daß man zuerst die politische Macht habe! Und wenn - so sagte zum Beispiel einmal einer -, wenn er die politische Macht hätte, sagen wir zum Beispiel - so meinte er - als Polizeiminister, so würde er ja auch nicht als Standesbeamten sich selber anstellen, denn er sei ein Schuhflicker, und er könne sehr gut einsehen, daß ein Schuhflicker von den Verpflichtungen eines Standesbeamten nichts wisse. Er würde durchaus nicht, wenn er Polizeiminister wäre, da er ein Schuhflicker sei, sich selber als Standesbeamten anstellen! - Er merkte nicht, daß er eigentlich implicite sagte: Zum Polizeiminister gerade angestellt zu werden, fühle er sich ganz gut berufen, aber zum Standesbeamten durchaus nicht! Das war für die Diskussion eine Art neuer Nuance. Die Nuancen waren ja ungefähr immer in diesem Stil gehalten.
Nun, trotzdem aber müssen wir uns klar sein, daß, weil wir eben verstanden werden sollen, aus der Seele der Leute heraus geredet werden muß. Das Unterbewußte geht dennoch nämlich, wenn aus der
Seele heraus geredet wird, in einem gewissen Sinne mit. Insbesondere, wenn im übrigen die Rede so angeordnet worden ist, wie ich es schon angedeutet habe und wie ich es im weiteren auseinandersetzen werde. Aber wir müssen dann über dasjenige, was in Betracht kommt, wirklich aus der Erfahrung, das heißt in diesem Falle, aus den Erfahrungen des proletarischen Empfindens heraus formulierbare Begriffe haben.
Nehmen wir einmal das geistige Glied des dreigliedrigen sozialen Organismus. In bezug auf dieses geistige Glied hat der Proletarier seit dem Heraufkommen des Marxismus sich sehr deutliche Begriffe herausgebildet, nämlich den Begriff der Ideologie. Er sagt: Geistesleben, das hat für sich gar keine Wirklichkeit. Religion, Rechtsbegriffe, Sittenbegriffe und so weiter, Kunst, Wissenschaft selber, das ist nichts für sich. Für sich existieren eigentlich nur wirtschaftliche Prozesse. Man kann verfolgen in der weltgeschichtlichen Entwickelung, wie das wahrhaft Wirkliche in der Art und Weise besteht, wie die eine Schichte der Bevölkerung zu der anderen steht im Wirtschaftsleben. Darnach, wie die eine Schichte der Bevölkerung zu der anderen steht im Wirtschaftsleben, darnach müssen sich ganz von selbst, wie eine Art Rauch, der daraus hervorsteigt, die Begriffe, die Empfindungen in Religion, Wissenschaft, Kunst, Sitte, Recht und so weiter bilden. Das sind keine Wirklichkeiten, Recht, Sitte, Religion, Kunst, sondern eine Ideologie. -Diesen Ausdruck «Ideologie», mit dem Gefühl, wie ich es eben jetzt charakterisiert habe, ihn konnte man hören seit Jahrzehnten in allen sozialdemokratischen oder sonstigen proletarischen Versammlungen. Und es war geradezu ein besonders ausgebildetes Erziehungsmittel, den Menschen zum Verständnis zu bringen: Die bürgerliche Bevölkerung spricht von der Wahrheit an sich, von dem Werte der Wissenschaft, von dem Werte der Religion, von dem Werte der Sittlichkeit, der Kunst -, aber das ist ja alles nichts in Wirklichkeit für sich, sondern das alles sind die Schaumbilder, die aufsteigen aus dem wirtschaftlichen Prozesse. Einer der Führer der proletarischen Welt, Franz Mehring, hat diese Sache ja bis zum besonderen Radikalismus getrieben in einem Buche «Die Lessing-Legende».
Da war erschienen ein allerdings nicht sehr bedeutendes Buch eines Bourgeoisprofessors, des Erich Schmidt, über Lessing. Es ist deshalb
nicht sehr bedeutend, weil darin nicht eigentlich Lessing behandelt wird, sondern eine Statue aus Papiermaché, welche fälschlich «Lessing» genannt wird, und an die Erich Schmidt die Bemerkungen und Erzählungen und Mitteilungen anknüpft, deren er eben durch seine besondere Begabung oder Unbegabung fähig war. Man hat es gar nicht mit einem Menschen zu tun in diesem Buche, sondern mit einer Statue aus Papiermaché, genannt «Lessing». Daß dieser Bourgeoisprofessor keine besonders klaren Vorstellungen hatte über den lebendigen Lessing, sondern nur über einen Papiermaché-Lessing, das ging mir schon hervor, als das Buch «Lessing» von Erich Schmidt noch gar nicht geschrieben war, als ich Erich Schmidt reden hörte in Wien in einer Rede in der Wiener Akademie der Wissenschaften, wo er so die ersten Anfänge der ersten Kapitel dieses Lessing-Buches zusammengefaßt vorgebracht hatte als eine Rede. Ich war dazumal eigentümlich berührt von dieser Rede, die so recht zeigte, wie man eben, wenn man sonst in eine gewisse soziale Position hineingestellt ist und reden darf, also selbst vor einer erlauchten Akademie der Wissenschaften, eigentlich inhaltlich gar nichts zu sagen braucht. Denn bei den wichtigsten Stellen, wo Erich Schmidt damals etwas vorbrachte, was charakteristisch sein sollte für die Persönlichkeit, die er besprach, da sagte er immer, indem er irgend etwas heraushob aus Lessings Arbeitsweise und aus Lessings Schreibweise: Das ist echt Lessingsch! - Und dieses Wort: Das ist echt Lessingsch! -, das hörte man, ich glaube, fünfzigmal während dieser Akademierede.
Nun, wenn man es zu tun hat mit dem Ernst Müller aus Neu-Babelsberg und man ihn zu charakterisieren hat, so wird man mit genau demselben Inhalt sagen können, wenn man erzählt seine besondere Art, wie er, sagen wir, seinen Misthaufen in Ordnung bringt: Das ist echt Müllersch! - Man wird etwas gesagt haben, das ein ganz gleich schweres Gewicht hat.
Man hatte es also zu tun mit etwas außerordentlich Unbedeutendem. Aber ein richtiger sozialdemokratischer Schriftsteller, wie Franz Mehring war, der schrieb dies Unbedeutende des Erich Schmidtschen Lessing-Buches dem Umstande zu, daß eben Erich Schmidt ein Bourgeoisprofessor war, und er sagte: Das ist eben ein Bourgeoisprodukt. -
Und jetzt stellte er sein proletarisches Produkt dagegen. «Die LessingLegende» nannte er dieses Buch. Da wird nun untersucht, in welchen wirtschaftlichen Verhältnissen Lessings Voreltern gelebt haben, was sie getrieben haben, wie dann Lessing selber in der Jugend ins Wirtschaftsleben hineingestellt worden ist, wie er Journalist werden mußte, wie er Geld pumpen mußte - das ist ja auch ein wirtschaftlicher Zusammenhang - und so weiter. Kurz, es wird gezeigt, wie Lessings «Laokoon»-Auffassung, wie Lessings «Hamburgische Dramaturgie», wie Lessings «Minna von Barnhelm» so sein mußten, wie sie eben sind, dadurch, daß Lessing aus diesen bestimmten wirtschaftlichen Verhältnissen herausgewachsen ist.
Nach dem Muster dieses Buches «Die Lessing-Legende» des Partei-gelehrten Mehring hat dann einmal ein Schüler meiner Arbeiterbildungsschule - ich habe ja jahrelang eine Arbeiterbildungsschule versorgt, auch in der Redelehre - in einer Proberede bewiesen, daß die Kantsche Philosophie eben einfach aus den wirtschaftlichen Verhältnissen hervorgegangen ist, aus denen Kant sich entwickelt hat. Und ähnliche Dinge begegneten einem da immer und können einem wohl auch noch heute begegnen, obwohl sie heute mehr oder weniger schon zur Phrase geworden sind. Aber es war durchaus so. Und das hat bedeutet, daß über das geistige Leben der moderne Proletarier überhaupt die Anschauung hatte: Alles, was im geistigen Leben vorhanden ist, ist Ideologie.
In bezug auf das staatlich-rechtliche Leben, da läßt der Proletarier nur gelten, was sich wiederum innerhalb der wirtschaftlichen Verhältnisse als Beziehung von Mensch zu Mensch herausstellt. Das sind aber für ihn die Klassen. Die herrschende Klasse beherrscht die anderen Klassen. Und derjenige, der innerhalb der Klasse steht, entwickelt dann das Klassenbewußtsein. So daß eigentlich dasjenige, was der moderne Proletarier von dem staatlich-rechtlichen Leben begreift, die Klasse ist, und was ihm nahegeht, das Klassenbewußtsein ist.
Das dritte Glied des sozialen Organismus ist das wirtschaftliche. Auch da sind innerhalb des Proletariats streng umrissene Begriffe, und der Mittelpunktsbegriff, der immer wiederum gefunden wird, ebenso wie die Begriffe Ideologie und Klassenbewußtsein, das ist der Begriff
des Mehrwertes. Der Proletarier begreift: Wenn gewirtschaftet wird, so kommt im wirtschaftlichen Produkt ein bestimmter Wert zum Vorschein; von diesem Werte bekommt er als Lohn einen bestimmten Teil, das andere geht fort für irgend etwas anderes. Das bezeichnet er als «Mehrwert» und beschäftigt sich nun mit diesem Mehrwert, von dem er das Gefühl hat, daß er ihm von dem Werte seiner Arbeitsprodukte genommen werde.
Man kann, indem man die Dinge so durchdenkt, sehen, wie in der Tat innerhalb derjenigen Bevölkerungsklasse, die sich als die aktive, als die eigentlich aggressive in der neueren Zeit heraufgebildet hat, deutlich umrissene Begriffe für die drei Gebiete des dreigliedrigen sozialen Organismus vorhanden sind. Das soziale Leben offenbart sich in dreifacher Weise - würde etwa ein richtiger proletarischer Theoretiker sagen -, es offenbart sich erstens durch seine Wirklichkeit, durch die wertproduzierende Wirtschaft. Diese wertproduzierende Wirtschaft liefert aus dem wirtschaftlichen Leben selbst den Mehrwert. Durch die Machtverhältnisse, die sich herausbilden, werden im wirtschaftlichen Leben als in der einzigen Wirklichkeit die sozial tätigen Menschen in Klassen zerspalten, so daß sie, wenn sie über ihren Menschenwert nachdenken, zu dem Klassenbewußtsein, nicht zu dem Menschenbewußtsein kommen. Und dann entwickelt sich als dasjenige, was man für den Sonntag gern hat, was man braucht - aber auch so zwischendurch -, damit die Maschinen richtig ausgedacht werden, damit man auch ab und zu in freien Stunden, nicht wahr, Erfindungen machen kann und so weiter, dann entwickelt sich die Ideologie, die sich aber ergibt als ein Rauchprodukt aus der eigentlichen Wirklichkeit, aus dem wirtschaftlichen Leben.
Ich karikiere ganz gewiß nicht, sondern ich schildere, was in Millionen, nicht etwa in Tausenden, sondern in Millionen von Köpfen lebte in den Jahrzehnten, die dem Kriege vorausgegangen sind, und was sich auch durch den Krieg fortsetzte. Der Proletarier hat also schon einen Begriff von der Dreigliederung des sozialen Organismus in sich, und man kann da anknüpfen.
Man kann noch in weiterem Sinne anknüpfen. Man kann anknüpfen daran, daß sich in der neueren Zeit im Grunde genommen das wirtschaftliche
Leben, weil es ja seine eigene Notwendigkeit in sich trägt, besonders entwickelt hat, und daß die anderen Lebenselemente, das geistige Leben und das staatlich-rechtliche Leben, zurückgeblieben sind. Im wirtschaftlichen Leben konnten die Menschen nicht zurückbleiben. Sie mußten erst zum Weltverkehr, dann zur Weltwirtschaft im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts übergehen. Da liegt eine innere Notwendigkeit. Das macht sich in gewissem Sinne von selbst, bis man es ruiniert, wie es durch den Krieg geschehen ist. Aber weil die anderen Dinge nicht nachgekommen sind, weil sich in den anderen Dingen ein abstrakter Intellektualismus entwickelt hat, wurde die Empfindung vom Wirtschaftsleben in hervorragendem Maße einflußreich, wirkte in erster Linie durch ihren Charakter suggestiv auf alle Bevölkerung. Und was da suggestiv wirkte, das hat sich nicht etwa nur in den Vorstellungen festgelegt, sondern das ist zu Einrichtungen geworden. Der Intellektualismus hat allmählich das soziale Leben ganz ergriffen.
Dem Intellektualismus ist eigen die Abstraktion, das Abstrakte. Man hat im Leben, sagen wir, Butter; man hat im Leben, sagen wir, eine Raffaelsche Madonna; man hat im Leben, sagen wir, eine Zahnbürste; man hat im Leben, sagen wir, ein philosophisches Werk; man hat im Leben, sagen wir, einen Pudertigel für Frauen und so weiter. Im Leben gibt es ja viel, nicht wahr. Ich könnte ja diese Reihe lange fortsetzen. Aber Sie werden nicht bestreiten, daß diese Dinge sehr, sehr verschieden voneinander sind, und daß, wenn man sich Begriffe machen will von all diesen Dingen, diese Begriffe, diese Vorstellungen sehr, sehr verschieden voneinander werden. Aber im neueren sozialen Leben entwickelte sich doch etwas, was außerordentlich bedeutsam wurde für alle Lebensverhältnisse, und was gar nicht so sehr differenziert ist. Denn, sagen wir, Butter von einer gewissen Menge kostet zwei Franken; eine Raffaelsche Madonna kostet zwei Millionen Franken; eine Zahnbürste kostet vielleicht jetzt bloß zweieinhalb Franken; ein philosophisches Werk - es wird vielleicht am billigsten sein -, das kostet, sagen wir, im Einzelexemplar vielleicht, wenn es dünn ist, siebzig Rappen; ein Pudertigel, wenn er besonders gut ist, zehn Franken.
Jetzt haben wir die ganze Sache auf gleich gebracht! Jetzt brauchen wir bloß das, was ja auch wiederum auf ein Feld gehört, die Zahlen,
verschieden zu nehmen. Aber wir haben eine Abstraktion, den Geld-preis, über alles ausgebreitet.
Das hat sich ganz besonders eingelebt in die Denkweise der Menschen, wenn sich die Menschen das auch nicht immer gestehen. Gewiß, derjenige, der ein Dichter ist, hält sich selbstverständlich für den Mittelpunkt der Welt, der beurteilt sich dann nicht so; ebensowenig derjenige, der ein Philosoph ist und so weiter. Oder erst gar der, der ein Maler ist! Aber die Welt beurteilt diese Sachen heute alle in diesem Stil in der sozialen Bewertung der Menschen. Und da kommt es schon zuletzt heraus, daß, sagen wir, ein Dichter für einen Verleger - von dem Zeitraume an, wo er angefangen hat, seinen Roman zu schreiben, bis zu der Zeit, wo er ihn beendet hat -, wenn der Verleger edel ist, dieser Dichter zehntausend Franken wert ist. Das ist also der Preis eines Dichters für eine gewisse Zeit, nicht wahr. Wir haben ihn auch auf die gleichwertige Abstraktion gebracht.
2.- Fr. Butter
2 000 000.- Fr. Raffaelsche Madonna
2.50 Fr. Zahnbürste
-.70 Fr. Philosophisches Werk
10.- Fr. Pudertigel
10 000.- Fr. Dichter
3.- Fr. Tägliche Arbeitskraft
Nun ich könnte auch da mancherlei Beispiele anführen; aber ich habe schon gesagt: Die Bourgeoisie dachte ja über diese Dinge nicht sehr tief nach. Der Dichter hält sich natürlich in seinem Oberstübchen - ich meine jetzt dasjenige, das in einer Etage weit oben gelegen ist - für etwas ganz Besonderes, aber im sozialen Leben, da war er halt eben zehntausend Franken wert. Aber er achtete es nicht, wenn er nicht gerade dem Proletariat angehörte. Er achtete das nicht. Aber der Proletarier achtete das. Der zog nämlich aus alledem die Konsequenz: Du hast nicht Butter, du hast nicht Puder, du hast kein philosophisches Werk , aber du hast deine Arbeitskraft; die bietest du dem Fabrikanten an, und die ist für den Fabrikanten, sagen wir, täglich drei Franken wert: Tägliche Arbeitskraft.
Daß ich hierher geschrieben habe «Dichter», das müssen Sie mir verzeihen aus dem Grunde, weil man die Erfahrung machen konnte, daß der Dichter eben noch um ein Stückchen schlechter behandelt worden ist im Laufe der letzten Jahrzehnte als der Proletarier mit seiner täglichen Arbeitskraft. Denn der letztere konnte sich noch besser wehren als der Dichter, und die zehntausend Franken für den Dichter waren in der Regel nicht mehr wert als die drei Franken Arbeitslohn für die proletarische Arbeitskraft, mit Ausnahme von einzelnen natürlich, wie es ja selbstverständlich war, daß solche Dichter wie zum Beispiel - ich weiß nicht, ob sich viele noch an sie erinnern - die selige Marlitt, die ja ganz großartig verdient hat mit dem «Geheimnis der alten Mamsell», was ein Roman ist, über den die beste Kritik wohl die wäre, wie einmal einer gesagt hat: 0 Buch, wärest du doch das Geheimnis der alten Mamsell geblieben!
Nun, der Arbeiter dachte nach über das, was er dadurch geworden ist, daß er in die Abstraktion der Preise hineingestellt worden ist, respektive seine Arbeitskraft da hineingestellt worden ist. Und was ist denn etwas im Wirtschaftsleben dadurch, daß es einen Preis hat? Es ist eine Ware. Als Ware im wirtschaftlichen Leben muß alles gelten, wofür eben ein Preis bezahlt werden kann. Ich sagte, das Leben der Bourgeoisie verläuft mit einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber solchen Sachen. Aus dem Proletariat aber kamen diese Begriffe herauf, und dadurch entstand der Begriff: Wir selber sind mit unserer Arbeitskraft zu einer Ware geworden.
Das ist etwas, was nun mit den drei anderen Begriffen zusammengewirkt hat. Und wer eigentlich das moderne Leben richtig versteht, der weiß, wenn er die vier Begriffe Ideologie, Klassenbewußtsein, Mehrwert, Arbeitskraft als Ware richtig versteht, so daß er sich mit diesen vier Begriffen erfahrungsgemäß hineinstellen kann in das Leben, daß er mit diesen vier Begriffen zunächst die Bewußtseinsrealität trifft, die gerade bei der aktiven Bevölkerung, bei derjenigen Bevölkerung, die bewußt eine Umwandelung der sozialen Verhältnisse will, vorhanden ist. Und so hat man denn die Aufgabe, darüber nachzudenken, wie man diese vier Begriffe zu behandeln hat.
Wenn man nun eine Zuhörerschaft hat gemischt aus Proletariern
und bourgeoiser Bevölkerung, da wird man nötig haben, so zu sprechen, daß man zunächst bemerklich macht, wie der Proletarier notwendigerweise zu diesen Dingen kommen mußte, wie der Proletarier durch das moderne Leben nichts hat kennen lernen können als die Vorgänge des Wirtschaftslebens. So ist es ja geworden, sagen wir seit der Mitte des 15. Jahrhunderts. Da fängt es langsam an. Denn gehen wir zurück hinter diese Mitte des 15. Jahrhunderts, so sehen wir, wie im Wesen der Mensch noch zusammenhängt mit seinem Produkte. Wer einen Schlüssel macht, legt seine Seele in diesen Schlüssel hinein. Wer einen Schuh macht, legt seine Seele in den Schuh hinein. Und ich bin ganz gewiß, daß bei den Menschen, bei denen sich diese Dinge in gesunder Weise fortentwickelt haben, keine Verachtung irgendeiner solchen Sache vorhanden war. Ich bin völlig davon überzeugt - nicht nur subjektiv überzeugt, sondern solche Dinge kann man schon beweisen, wenn es darauf ankommt -: lakob Böhme hat ganz gewiß ebensogerne seine Stiefel gemacht wie seine philosophischen Werke, seine mystischen Werke geschrieben, oder Hans Sachs zum Beispiel. Diese Dinge - daß das eine verachtet wird, was materiell ist, das andere überschätzt wird, was geistig ist -, die sind auch erst mit dem Intellektualismus und seinen Abstraktionen auf allen Gebieten heraufgekommen. Es ist eben dieses eingetreten, daß der Mensch durch das moderne wirtschaftliche Leben, in das die Technik sich hineinergossen hat, von seinem Produkte getrennt worden ist, so daß ihn keine wirkliche Liebe mehr mit dem Produzieren verbinden kann. Es werden die Leute, die noch für gewisse Berufszweige mit dem Produzieren Liebe entwickeln, immer seltener und seltener. Nur bei den sogenannten geistigen Berufszweigen ist diese Liebe noch vorhanden. Daher das Unnatürliche in der sozialen Verteilung und selbst Gliederung in der neueren Zeit. Man muß schon nach dem Osten hinübergehen - heute wird es vielleicht auch nicht mehr möglich sein, aber vor Jahrzehnten war es so-, um da noch Berufsfreude zu finden. Ich muß gestehen, ich war tief entzückt, geradezu ergriffen, als ich vor Jahrzehnten in Budapest einen Haarschneider, den ich in Anspruch nahm zum Haarschneiden, kennenlernte, und der immer herumtanzte um mich und, nachdem er wiederum etwas mit der Schere heruntergekriegt hatte, sagte, indem er den Spiegel nahm: Ein
wunderbarer Schnitt, den ich da mache! Ein wunderbarer Schnitt, den ich da mache! - Bitte, suchen Sie sich heute in der eigentlichen Zivilisation noch solchen begeisterungsfähigen Haarschneider!
Was also eingetreten ist, ist die Trennung des Menschen von seinem Produkte. Es ist ihm gleichgültig geworden. Er wird an die Maschine hingestellt. Was interessiert ihn diese Maschine! Sie interessiert ja höchstens - nicht einmal mehr den Konstrukteur, sondern höchstens den Erfinder, und das Interesse, das der Erfinder daran hat, ist meistens kein wirklich soziales. Denn das soziale Interesse fängt erst dann an, wenn man den möglichen Wert für die Rendite herausfinden kann, nun ja, wenn man also die Geschichte auf den Preis reduziert hat.
Dasjenige aber, was vorzugsweise der moderne Proletarier kennengelernt hat, das ist das Wirtschaftsleben. In das ist er hineingestellt. Soll er an das geistige Leben herangehen, so hängt ihm das nirgends mit seinem unmittelbaren seelischen Leben zusammen. Es bewegt nicht die Seele. Er nimmt es als etwas Fremdes auf, als Ideologie. Es liegt im modernen geschichtlichen Prozeß, daß sich diese Ideologie entwickelt hat.
Gelingt es Ihnen aber erst, eine Empfindung in dem Proletarier hervorzurufen, daß das so ist, dann haben Sie den Anfang dessen erreicht, was Sie erreichen sollen. Denn der Proletarier hört Sie heute zunächst mit dem Gefühl an: Es liegt ja in einer absoluten Naturnotwendigkeit, daß alle Kunst, alle Wissenschaft, alle Religion, alles Ideologie ist. Weit, weit entfernt liegt es ihm, daran zu denken, daß er mit dieser Anschauung ja eben gerade nur das Produkt der neuzeitlichen Entwickelung geworden ist. Es ist sehr schwer, ihm das begreiflich zu machen. Merkt er es, dann kehrt er mit seiner ganzen Denkweise um, dann wird es ihm schrecklich, daß alles nur eine Ideologie sein soll, dann wird er sich des ganz Illusionären dieser Anschauung bewußt. Er ist sozusagen derjenige, der am besten dazu vorbereitet ist, über die Tatsache, daß alles zur Ideologie geworden ist, Ekel zu empfinden; aber Sie müssen bis zur Empfindung kommen. Die Gedanken, die Sie darüber entwickeln oder bei sich selber entwickelt haben, die interessieren den Zuhörer nicht. Sie bringen ihn in der Weise, wie ich es geschildert habe, zum Fühlen der Sache. Denn es handelt sich darum, daß
man die Sache für die Proletarier auf diese Weise, indem man einzelnen seiner Sätze diese Färbung gibt, zurechtrückt.
Für die Bourgeoisie muß man die Sache wieder anders zurecht-rücken, denn, was für die Proletarier sehr gut ist, das ist für die Bourgeosie auf diesem Gebiete sehr schlecht. Und es handelt sich nicht darum, daß man bloß richtig redet, sondern bei der heutigen Mannigfaltigkeit des Lebens handelt es sich darum, daß man gut redet, in dem gestrigen Sinne, und daß man auch, soweit es geht, für den Bourgeois redet. Diesem Bourgeois muß man nun klarmachen, daß er ja dadurch, daß er gegenüber dem, was heraufgezogen ist, gleichgültig war, die Sache hat kommen machen. Durch seine Betätigung oder vielmehr Nichtbetätigung ist die Sache so geworden, daß sie für den Proletarier Ideologie geworden ist. Dem Bourgeois muß man dann begreiflich machen: Religion war einmal etwas, was den ganzen Menschen mit innerer Glut erfüllte, aus dem alles hervorgegangen ist, was der Mensch im Grunde genommen in der äußeren Welt auszuführen hat. Sitte war dasjenige, was den Menschen für das soziale Leben heilig war. Kunst war etwas, wodurch sich der Mensch hinweghalf über die Härten und Schweren des physischen Lebens und so weiter. Aber wie ist im Verlaufe der letzten Jahrhunderte der Wert dieser geistigen Güter hinuntergesunken! So wie der Bourgeois sie hält, so kann sie der Arbeiter nicht mehr anders denn als Ideologie empfinden.
Nehmen wir einmal den Fall an, der Arbeiter käme aus irgendeinem Grunde ins Kontor des Unternehmers. Er hat so seine Ansichten über den ganzen Gang des Unternehmens. Nehmen wir an, der Buchhalter, zu dem er gerufen worden ist, oder der Unternehmer selbst ist eben hinausgegangen. Da liegt ein großes Buch, in das vieles eingetragen ist. Über die Art und Weise, wie diese Zahlen dadrinnen sprechen, hat der Arbeiter so seine Ansichten. Die hat er sich ja eben entwickelt. Nun, weil der Buchhalter oder der Unternehmer gerade draußen ist und er um eine halbe Minute zu früh gekommen ist, da blättert er um und schlägt die erste Seite auf. Da steht: «Mit Gott!» Da wird er aufmerksam, daß nun wahrhaftig dieses religiöse Element, daß da auf der ersten Seite «Mit Gott!» steht, nun wirklich die reine Ideologie ist, denn daß nun wirklich nicht viel «mit Gott» ist, was auf den folgenden
Seiten des Buches steht, davon ist der Arbeiter ganz überzeugt. Das liegt ganz in dem Stile, wie er sich die Weltverhältnisse überhaupt denkt: So viel ist von dem wahr, was die Leute Religion, Sitte und so weiter nennen, wie in diesem Buche von dem wahr ist, was auf der ersten Seite steht: «Mit Gott». Ich weiß nicht, ob in der Schweiz in diesen Büchern auch auf der ersten Seite steht «Mit Gott!»; aber es ist sehr verbreitet, daß man sein Kassabuch, Journal und so weiter «Mit Gott» hat.
Es handelt sich also darum, daß man dem Bourgeois klarmacht: Er ist der Veranlasser, daß beim Proletariat die Auffassung entstanden ist von der Ideologie.
Dann hat jeder seinen Teil. Dann ist man so weit, daß man nun auseinandersetzen kann, wie das geistige Leben wiederum Realität gewinnen muß, weil es ja zur Ideologie wirklich geworden ist. Wenn man vom Geiste nur Ideen hat, nicht den Zusammenhang mit dem wirklichen geistigen Sein und Wesen, dann ist es eben eine Ideologie. So bekommt man von da aus die Brücke zu dem Gebiet, auf dem man eine Vorstellung hervorrufen kann von der Realität des geistigen Lebens. Und dann wird es einem möglich, darauf hinzuweisen, wie das geistige Leben eben eine in sich geschlossene Realität, nicht ein Produkt des wirtschaftlichen Lebens, nicht eine bloße Ideologie ist, sondern ein in sich selbst gegründetes Reales ist. Ein Empfinden muß man dafür hervorrufen, daß das geistige Leben ein in sich begründetes Reales ist. Ein in sich begründetes Reales ist etwas anderes als ein in sich bloß abstrakt Begründetes, denn das abstrakt Begründete muß von woanders aus begründet sein.
Der Proletarier sagt: Die Ideologie ist von dem wirtschaftlichen Leben aus begründet. - Insofern aber der Mensch sich in seinem geistigen Leben nur abstrakten Ideen hingibt, ist das eben auch durchaus etwas Rauchartiges, etwas Illusionäres. Erst wenn man durch dieses Rauchartige, durch dieses Illusionäre, durch die Idee zu der Realität des Geisteslebens durchdringt, wie es durch Anthroposophie geschieht, erst dann kann wiederum das geistige Leben als ein reales empfunden werden. Wenn das geistige Leben nur eine Ideologie ist, so strömen eben diese Ideen herauf aus dem wirtschaftlichen Leben. Da muß man sie
organisieren, da muß man ihnen eine künstliche Wirksamkeit und Organisation verschaffen. Das hat ja auch der Staat getan. In dem Zeitalter, wo das geistige Leben in Ideologie verdunstete, hat der Staat es in die Hand genommen, um der Sache wenigstens die Realität, die man nicht in der geistigen Welt selber erlebt hat, zu geben.
So muß man versuchen, begreiflich zu machen, wie dasjenige, was der Staat unberechtigterweise dem geistigen Leben gegeben hat, da es Ideologie geworden ist, Realität hat. Es muß ja doch eine Realität haben. Wenn man eben keine eigenen Beine hat und doch gehen will, muß man sich künstliche machen lassen. Es muß ja etwas, um zu existieren, Realität haben. Aber das geistige Leben soll seine eigene Realität haben. Das muß man empfinden, daß das geistige Leben seine eigene Realität haben muß.
Zunächst werden Sie allerdings paradox wirken, sowohl bei der bürgerlichen wie bei der proletarischen Bevölkerung. Und Sie müssen ein Bewußtsein davon hervorrufen, daß Sie paradox wirken. Das können Sie dadurch, daß Sie eben gerade bei den Leuten, die Ihnen zuhören, eine Vorstellung davon hervorrufen, daß Sie schon ebenso denken, wie der Proletarier, indem Sie aus seiner Sprache heraus reden, wie der Bürgerliche, indem Sie aus seiner Sprache heraus reden. Dann aber, nachdem Sie solches entwickelt haben, was mit Hilfe jener Erinnerung, die man an Erfahrungen im Leben haben kann, möglich ist, nachdem Sie so etwas in der Vorbereitung durchgemacht haben, kommen Sie dazu, zu den Menschen so zu sprechen, daß nach und nach ein Verständnis für die Dinge hervorgerufen werden kann, für die es eben hervorgerufen werden muß.
Reden kann man nicht durch eine äußerliche Anleitung lernen. Reden muß man gewissermaßen dadurch lernen, daß man das hinter dem Reden liegende Denken und das vor dem Reden liegende Erfahren zu dem Reden in ein richtiges Verhältnis zu bringen versteht.
Nun habe ich eben heute versucht, Ihnen zu zeigen, wie der Stoff zunächst behandelt werden muß. Ich habe an Bekanntes angeknüpft, um Ihnen zu zeigen, wie der Stoff nicht aus irgendeiner Theorie heraus geschöpft werden darf, wie er aus dem Leben heraus gefaßt werden muß, wie er zubereitet werden muß, um ihn dann rednerisch zu behandein.
Was ich heute gesprochen habe, das sollte eigentlich jeder in seiner Art nun selber machen als Vorbereitung für das Reden. Dadurch, daß man solche Vorbereitung macht, wird die Rede eindringlich. Dadurch, daß man denkerische Vorbereitungen macht - Vorbereitungen zur Gliederung der Rede, wie ich im Anfange der heutigen Ausführungen gesagt habe: von einem Gedanken, der dann gestaltet wird zur Komposition -, dadurch wird die Rede übersichtlich, so daß der Zu-hörer sie auch als Einheit bekommen kann. Durch das, was der Redner mitbringt an Denken, soll er nicht in seine eigenen Gedanken hinein-wirken. Denn wenn er seine eigenen Gedanken gibt, sind sie, wie ich schon gesagt habe, so, daß sie keinen einzelnen Menschen interessieren. Erst dadurch, daß man sein eigenes Denken verwendet, um die Rede zu gliedern, dadurch wird sie übersichtlich, und durch das Übersichtliche verständlich.
Durch die Erfahrungen, die der Redner überall zusammensuchen soll - die schlechtesten Erfahrungen sind noch immer besser als gar keine! - wird die Rede eindringlich. Wenn Sie zum Beispiel irgend jemandem erzählen, was Ihnen passiert ist, meinetwillen als Sie durch ein Dorf gingen, wo Ihnen beinahe einer eine Ohrfeige gegeben hat, so ist es noch immer besser, wenn Sie aus einer solchen Erfahrung heraus das Leben beurteilen, als wenn Sie bloß theoretisieren. Heraus aus der Erfahrung die Dinge holen, durch die die Rede Blut bekommt, denn durch das Denken hat sie nur Nerven. Blut bekommt sie durch die Erfahrung, und durch dieses Blut, das aus der Erfahrung kommt, wird die Rede eindringlich. Zum Verstande der Zuhörer reden Sie durch die Komposition, zum Herzen der Zuhörer reden Sie durch Ihre Erfahrung. Das ist es, was man wie eine goldene Regel betrachten soll. Nun, wir können Schritt für Schritt vorwärtsgehen. Ich wollte zunächst heute mehr im groben zeigen, wie man den Stoff allmählich umwandeln kann zu dem, was er dann in der Rede zu sein hat. Dann morgen um drei Uhr wieder Fortsetzung.
VIERTER VORTRAG Dornach, 14. Oktober 1921
Gestern versuchte ich zu entwickeln, wie man den ersten Teil eines Dreigliederungsvortrags vor einem gewissen Publikum behandeln könnte, und ich machte darauf aufmerksam, daß es namentlich notwendig ist, eine Empfindung hervorzurufen für den besonderen Charakter des auf sich selbst gestellten Geisteslebens. Im zweiten Teil wird es sich darum handeln, überhaupt einer gegenwärtigen Menschheit erst begreiflich zu machen, daß es so etwas geben kann wie einen demokratisch-politischen Zusammenhang, der Gleichheit anzustreben hat. Denn eigentlich - und das muß man bedenken, namentlich wenn man sich für einen solchen Vortrag vorbereitet - ist das der Fall, daß der gegenwärtige Mensch gar keine Empfindung hat für ein solches Staatsgebilde, das auf das Recht als auf sein eigentliches Fundament aufgebaut ist. Und dieser Teil, der politisch-staatliche Teil des Vortrags, er wird ganz besonders schwierig zu behandeln sein innerhalb der schweizerischen Verhältnisse. Und es wird sich ganz besonders darum handeln, daß die Redner, welche innerhalb der schweizerischen Verhältnisse die Dreigliederung des sozialen Organismus vertreten wollen, gerade von den also bedingten schweizerischen Verhältnissen ausgehen, und besonders darum, daß sie bei dem mittleren, dem rechtlich-staatlichen Teil, Rücksicht darauf nehmen, wie man aus den schweizerischen Verhältnissen heraus zu reden hat. Denn die Sache liegt ja im allgemeinen so: Durch die Verhältnisse der neueren Menschheitsentwickelung ist das eigentliche Staatsleben als solches, das sich eigentlich im Rechtsstaat ausleben sollte, im wesentlichen verschwunden, und was sich im Staate auslebt, ist eigentlich ein chaotisches Zusammensein der geistigen Elemente des menschlichen Daseins und der wirtschaftlichen Elemente. Man könnte sagen: In den modernen Staaten haben sich allmählich die geistigen Elemente und die wirtschaftlichen Elemente durcheinandergeschweißt, und das eigentliche Staatsleben ist zwischendurch eben heruntergefallen, eigentlich verschwunden.
Dies ist besonders innerhalb der schweizerischen Verhältnisse bemerkbar.
Da haben wir es überall zu tun mit einer in ihren eigentlichen Ausgestaltungen unmöglichen, scheinbaren Demokratisierung des geistigen Lebens und mit einer Demokratisierung des Wirtschaftslebens, und damit, daß die Leute glauben, dieses scheinbar demokratisierte Gemisch von Geistesleben und Wirtschaftsleben, das wäre eine Demokratie. Und da sie sich ihre Vorstellung von Demokratie gebildet haben aus dieser Mischung heraus, da sie also eine vollständige Schein-vorstellung von Demokratie haben, so ist es so schwierig gerade zu den Schweizern von wirklicher Demokratie zu sprechen. Eigentlich verstehen gerade von wirklicher Demokratie die Schweizer am allerallerwenigsten.
Man denkt in der Schweiz darüber nach, wie man die Schulen demokratisieren soll. Das ist ungefähr so, als wenn man darüber nachdenken und aus wirklichen, wahren Begriffen heraus eine Vorstellung davon bekommen sollte, wie man einen Stiefel zu einer guten Kopfbedeckung macht. Und in ähnlicher Weise werden hier die staatlichen sogenannten demokratischen Begriffe behandelt. Es nützt ja nichts, über diese Dinge, ich möchte sagen, leisetreterisch zu sprechen, um, wenn man hauptsächlich vor Schweizern spricht, höflich zu sprechen; denn dann würden wir uns doch nicht verstehen können. In der Höflichkeit über solche Dinge kann man sich ja niemals ordentlich verstehen. Nun, gerade deshalb ist es notwendig, den Begriff des Rechts und der Gleichheit der Menschen vor einer solchen Bevölkerung zu erörtern, wie es die schweizerische ist.
Man muß sich da durchaus angewöhnen, wenn man rednerisch aktiv sein will, auf jedem Boden anders zu sprechen. Wenn man, wie es der Fall war vom April 1919 ab, in Deutschland über die Dreigliederung sprach, sprach man unter ganz anderen Verhältnissen als etwa hier in der Schweiz, und auch unter so ganz anderen Verhältnissen, als in England oder in Amerika von der Dreigliederung gesprochen werden kann. Gerade in jenem Frühling, im April 1919, unmittelbar nach der deutschen Revolution, waren in Deutschland alle, sowohl proletarische wie bürgerliche Kreise, die einen natürlich mehr revolutionär, die anderen resignierend, davon überzeugt, daß irgend etwas Neues kommen müsse. Und in diese Empfindung hinein, daß irgend
etwas Neues kommen müsse, sprach man ja eigentlich. Man sprach doch damals zu verhältnismäßig vorbereiteten Leuten, und man konnte natürlich damals auch in Deutschland ganz anders sprechen, als man etwa heute sprechen kann. Zwischen heute und dem Frühling 1919 liegt ja auch in Deutschland eine Welt. Heute kann man höchstens hoffen, in Deutschland mit irgend etwas, was an Dreigliederung an-klingt, eine Vorstellung davon hervorzurufen, wie das geistige Leben als solches selbständig gestaltet werden kann und eigentlich gerade unter solchen Verhältnissen, wie sie in Deutschland sind, heute gestaltet werden müßte, wie unter gewissen Verhältnissen auch das inner-staatlich-rechtliche Leben gestaltet werden könnte. Aber man kann natürlich heute in Deutschland nicht von einer völlig im Sinne der Dreigliederung gelegenen Gestaltung des Wirtschaftslebens sprechen, denn das Wirtschaftsleben in Deutschland ist ja tatsächlich etwas, was unter Zwangsmaßregeln, unter Druck und so weiter steht, was sich nicht frei bewegen kann, was keine Gedanken haben kann über seine eigene freie Beweglichkeit. Es ist dies zum Beispiel ganz auffällig in der ganz verschiedenen Art des Lebens, sagen wir, des «Futurum» und des «Kommenden Tages». Der «Kommende Tag» steht mitten drin, so wie wenn er in einer Zwangsjacke wäre, und hat die Aufgabe, unter solchen Verhältnissen zu arbeiten; das «Futurum», wie es sich hier in der Schweiz entwickelt, muß eben mit schweizerischen Verhältnissen arbeiten, über die wir ja gleich noch etwas mehr werden zu sprechen haben. Es ist also durchaus eine Rede verschieden zu gestalten, ob sie hier in der Schweiz, ob sie in Deutschland, ob sie zu dieser oder jener Zeit gehalten wird.
In England, in Amerika müßte man natürlich wieder ganz anders sprechen. Es ist ja, was zunächst von hier aus in bezug auf England und Amerika gemacht werden kann, doch nur eine Art Surrogat, denn schon zum Beispiel «Die Kernpunkte der sozialen Frage»: es ist gut, wenn sie übersetzt werden, gut, wenn sie überall verbreitet werden; aber, was ich von Anfang an gesagt habe, das wirklich Richtige, das letztlich Richtige wäre, wenn für Amerika und auch für England die «Kernpunkte» ganz anders geschrieben würden als für Mitteleuropa und auch für die Schweiz. Für Mitteleuropa und die Schweiz können
sie schon ganz wörtlich und satzgemäß lauten, wie sie sind, aber für England und Amerika müßten sie eigentlich ganz anders verfaßt werden, denn da spricht man zu Menschen, die ja zunächst das Gegenteil von dem haben, was in Deutschland zum Beispiel im April 1919 vorhanden war. In Deutschland war die Meinung vorhanden, etwas Neues müsse kommen, und man müsse nur zunächst wissen, was dieses Neue sei. Man hatte nicht die Kraft, es zu verstehen, aber man hatte zunächst das Gefühl, man musse wissen, was irgend etwas vernünftiges Neues sein könnte. Davon ist natürlich im ganzen Gebiete von England und Amerika auch nicht einmal die allergeringste Empfindung vorhanden. Da ist nur die Empfindung vorhanden: Wie kann man das Alte festlegen, retten? Was muß man tun, damit das Alte nur ja recht fest bleibt? Denn das Alte ist ja gut! An dem Alten ist ja nicht zu rütteln. - Ich weiß selbstverständlich, daß da, wenn man so etwas ausspricht, erwidert werden kann: Ja, aber es sind doch so viele progressistische Bewegungen in den westlichen Gebieten! - Diese progressistischen Bewegungen sind aber alle, ganz gleichgültig, ob sie auch dem Inhalte nach neu seien, der Führung nach durchaus reaktionär, konservativ. Da muß also die Empfindung davon erst hervorgerufen werden, daß es so nicht weitergeht, wie es bisher gegangen ist.
An einzelnen Fragen kann das durchaus bemerkt werden. Nehmen wir eine furchtbare, schreckliche, ich möchte sagen, die schrecklichste Frage, die hat heraufkommen können vom rein menschlichen Standpunkte aus, nehmen wir die Frage der Verhungerung Rußlands. Innerhalb Deutschlands - wenn auch die Anschauungen noch so chaotisch sind, wenn auch aus Agitationsgründen gegen das gehandelt wird, was vernünftig wäre, und aus menschlichen Gründen wiederum in selbstverständlicher Weise dem Mitleid gehuldigt wird, gegen welches Walten des Mitleids natürlich gar nicht gesprochen werden soll -, innerhalb Deutschlands kommt man endlich, wenigstens in einzelnen Kreisen, mehr oder weniger darauf, daß es ja ein Unsinn ist für den ganzen Gang der Menschheitsentwickelung, in Form von Unterstützungen für die Verhungerung Rußlands etwas zu tun, durch Schenkungen gewissermaßen von westlicher Seite. Man kommt darauf, daß das ganz gewiß vom menschlichen Standpunkte aus sogar gefordert wird, daß
aber, was nach dieser Richtung getan wird, so selbstverständlich ist, daß man nur ja nicht sagen soll, es habe irgend etwas mit den Aufgaben zu tun, die heute die Verhungerung Rußlands stellt. Im Westen werden höchstens einige Theoretiker - aber dann auch nur auf dem Boden des Theoretischen - zu einer solchen Anschauung kommen. Es ist also natürlich, daß man im Westen erst eine Empfindung davon hervorrufen muß, daß die Welt eine Neugestaltung braucht.
Die Schweiz hat so dagestanden während der furchtbarsten Katastrophe der neueren Zeit, daß sie eigentlich nur theoretisierend - nämlich durch die journalistische Theorie - daran teilgenommen hat, und durch das, was von außen eben in die geistigen und die wirtschaftlichen Verhältnisse hereingewirkt hat. Die schweizerische Bevölkerung hat deshalb gar nicht eine eigentliche Empfindung, weder davon, daß etwas Neues kommen müsse, noch davon daß das Alte bleiben müsse. Wenn heute der Schweizer, je nach der einen oder anderen Partei-richtung davon spricht, daß ein Neues kommen müsse oder das Alte bleiben müsse, so hat man immer das Gefühl: Er erzählt einem nur, was er gehört hat, gehört hat auf der einen Seite von Mitteleuropa, gehört hat von England und dem Westen auf der anderen Seite. Er erzählt einem nur, was zu seinen beiden Ohren hineingegangen ist, und nicht, was er eigentlich erlebt hat. Und daher erscheint es einem auch als so schweizerisch, wenn diejenigen Menschen, die sich nicht gern nach rechts oder nicht gern nach links engagieren - und das sind ja maßgebende Schweizer heute sehr häufig -, daß diese Menschen sagen: Ja, wenn das geschieht, dann geschieht es eben so, wenn das andere geschieht, geschieht es eben so! Wenn ein Neues kommt, dann verläuft die Sache halt so, wenn das Alte bleibt, dann verläuft die Sache so! - Es wird gewissermaßen ausgeknobelt, was man in die eine oder andere Waagschale noch zu legen hat.
Es ist so: Wenn man versucht, jemanden in der Schweiz zu erwärmen für das, was der Welt heute bitter notwendig ist, so gerät man in Verzweiflung, weil es ihn eigentlich gar nicht angreift, weil es gleich zurückprallt, weil er eigentlich in Wirklichkeit mit dem Herzen gar nicht dabei ist. Es ist ihm zu sehr zuwider, als daß es für ihn interessant sein könnte, und er hat zu wenig Erfahrung über diese Dinge, als
daß es ihm irgendwie sympathisch sein könnte. Er möchte Ruhe haben. Aber er möchte doch auch wiederum Schweizer sein. Das heißt: Wenn da alle möglichen Fortschrittsgeschichten mit «Freiheit» und «Demokratie» über die Grenze herübertönen, so kann man doch, weil man sich durch viele Jahrhunderte hindurch immerfort demokratisch genannt hat, wiederum nicht sagen, man wolle die Demokratie nicht! Kurz, man hat wirklich das Gefühl, als ob in der Schweiz die Menschen einen sehr gut ausgebauten Kanal hätten zwischen dem rechten und dem linken Ohr, so daß alles, was auf der einen Seite hineingeht, auf der anderen Seite wiederum herausgeht, ohne daß es zu Verstand und Herzen gekommen ist.
Daher wird man wenigstens an den Punkten eben angreifen müssen, wo gezeigt werden kann, daß ja solch ein Staatswesen wie die Schweiz wirklich etwas ganz Besonderes ist. Und es ist etwas ganz Besonderes. Denn erstens ist die Schweiz - was schon während des Krieges bemerkbar war, wenn man es nur sehen wollte - etwas wie ein Schwerpunkt der Welt. Und gerade ihr Unengagiertsein gegenüber den verschiedenen Weltverhältnissen könnte sie benützen, um ein freies Urteilen und auch ein freies Handeln gegenüber ringsherum zu bekommen. Die Welt wartet ja nur darauf, daß die Schweizer das auch in ihren Köpfen bemerken, was sie in ihrer Tasche bemerken. In ihrer Tasche bemerken sie, daß der Franken vom Auf- und Absteigen der Valuta, von der Korrumpierung der Valuta, eigentlich nicht betroffen worden ist. Daß ja die ganze Welt sich um den Schweizer Franken bewegt, das bemerken die Schweizer. Daß das auch in geistiger Beziehung der Fall ist, das bemerken die Schweizer eben nicht. Aber so, wie sie den unbeweglichen Franken, der gewissermaßen der Regulator geworden ist der Valuta der ganzen Welt, wie sie den zu würdigen verstehen, so sollten sie auch ihre durch die Weltverhältnisse wirklich unabhängige Stellung, durch die die Schweiz tatsächlich eine Art Hypomochlion sein könnte für die Weltverhältnisse - dies sollten die Schweizer verstehen. Daher ist es notwendig, daß man ihnen dies eben begreiflich macht.
Es ist schon fast so, wie man es in ähnlicher Art einmal hat über Österreich sagen müssen. Leute, die etwas von den Dingen verstanden
in Österreich, die haben oftmals darüber nachgedacht, warum denn dieses Österreich, das ja nur zentrifugale Tendenzen hatte, bestehen blieb, warum es nicht auseinandersplitterte. Ich habe in den achtziger, neunziger Jahren nie etwas anderes gesagt als: Was in Österreich selber geschieht, das hat zunächst noch gar keine Bedeutung für das Zusammenhalten oder Auseinandersplittern, sondern nur, was ringsherum geschieht. Weil die anderen - Deutschland, Rußland, Italien, Türkei und diejenigen, die an der Türkei interessiert sind, Frankreich und auch die Schweiz selber -, weil diese ringsherum liegenden Staatsgebilde Österreich nicht zerfallen lassen, sondern mitten drinnen zusammenhalten, weil keiner dem anderen ein Stück davon gönnte! Jeder sorgte dafür, daß der andere ja nichts bekomme: dadurch blieb Österreich beisammen. Es wurde von außen zusammengehalten. Das konnte man sehr genau sehen, wenn man einen Sinn hatte für solche Verhältnisse. Und erst als dieses gegenseitige Beschauen der umliegenden Mächte im Weltkrieg durch den Nebel der Kanonen getrübt wurde, erst da zerfiel Österreich, selbstverständlich. Das Bild besagt im Grunde genommen alles.
Nun, bei der Schweiz ist es ähnlich, aber doch wiederum anders. Ringsherum sind alle möglichen Interessen, aber diese Interessen haben einen kleinen Fleck da übriggelassen, wo sie sich nicht begegnen. Und heute, wo man Weltwirtschaftsleben, Weltgeistesleben hat, da ist die Sache so, daß ja dieser kleine Fleck allerdings dadurch aufrechterhalten wird, daß er nun etwas ganz Besonderes ist. Was ist er denn eigentlich? Er ist etwas, was innerhalb seiner Grenzen durch rein politische Verhältnisse zusammengehalten wird. Das geht Ihnen aus der schweizerischen Geschichte hervor;Die schweizerische Geschichte ist eine scheinbar ganz politische, so wie das schweizerische Denken ein scheinbar ganz demokratisches ist. Aber auch mit der Politik verhält es sich so für die Schweiz, wie ich es vorhin für die Demokratie auseinandergesetzt habe: Es ist eine Politik, die eigentlich keine ist, die auf einem kleinen Fleck Erde das Geistesleben und das Wirtschaftsleben verwaltet, aber eigentlich in Wirklichkeit gar nicht Politik treibt. Vergleichen Sie, was in der Schweiz und was anderwärts Politik ist! Es muß manchmal das eine oder andere politisch gemacht werden, weil man mit den anderen
Ländern in Korrespondenz treten muß. Aber wirkliche schweizerische Politik - man müßte eben die Dinge auf den Kopf stellen, wenn man eine wirkliche schweizerische Politik finden wollte. Die gibt es eigentlich nicht. Auch daraus ist eben ersichtlich, daß hier ein Landgebilde geschaffen worden ist, auf dem im politischen Sinne das Geistesleben, im politischen Sinne das Wirtschaftsleben verwaltet wird, in dem aber eigentlich gar nicht eine wirkliche Empfindung, ein wirkliches Erleben von dem Rechtsdasein vorhanden ist.
Daher handelt es sich darum, daß man hier ganz besonders tief ein-schärft, daß das Recht etwas ist, was man nicht definieren kann, so wie man Rot oder Blau nicht definieren kann, daß das Recht etwas ist, was in seiner Selbständigkeit erlebt werden muß, und was erlebt werden muß, wenn sich als Mensch bewußt wird jeder mündig gewordene Mensch. Es wird sich also darum handeln, zu versuchen, für schweizerische Mittel gerade dieses menschliche Empfindungs- und Gefühlsverhältnis im Rechtsleben herauszuarbeiten, daß im einzelnen Menschen die Gleichheit leben müsse, wenn Rechtsleben da sein soll. Gerade die Schweiz ist nämlich dazu berufen, und ich möchte sagen:
Die Engel der ganzen Welt schauen auf die Schweiz, ob hier das Richtige geschieht -, gerade die Schweiz ist dazu berufen, da sie, ich möchte sagen, völlig jungfräulich ist in bezug auf den Rechtsstaat, nur einen geistigen, nur einen Wirtschaftsstaat hat, einen Rechtsstaat zu schaffen unter Freigebung des geistigen und des Wirtschaftslebens.
An den schweizerischen Bergen hat sich für die Herzen der Menschen eigentlich gebrochen das römische Recht, das in ganz anderer Weise in Frankreich und in Deutschland und anderen europäischen Ländern eingezogen ist. Es ist nur in das Außerliche hineingegangen, nicht aber in das Empfinden der Menschen. Es ist also jungfräulicher Rechtsboden, auf dem alles geschaffen werden kann. Wenn nur die Menschen zur wirklichen Besinnung kommen, was es für ein unendliches Glück ist, hier zwischen den Bergen zu leben und einen eigenen Willen haben zu können, unabhängig von der ganzen Welt, die sich um dieses kleine Ländchen dreht. Hier können, gerade wegen dieser Weltverhältnisse, die Rechtselemente bloß aus dem Menschen herausgearbeitet werden.
Also ich deute Ihnen an, wie man die besondere Lokalität, die besondere Örtlichkeit in das Vorbereiten hineinbringen muß für solch einen Vortrag, wie man tatsächlich mit sich selber völlig eins sein muß, was das Wesen des Schweizertums ist. Ich kann es natürlich hier nur skizzieren; aber jeder, der in der Schweiz reden will, müßte eigentlich sich bemühen, ganz zu verstehen, welch besonderer Art dieses Schweizertum ist.
Nicht wahr, Sie können sagen: Wir sind ja Schweizer - so wie die Engländer sagen können: Wir sind ja Engländer -, und du willst uns jetzt sagen, wie der Schweizer das Schweizertum kennenlernen soll, und was der Engländer alles nicht hat von solcher Empfindung und so weiter. - Gewiß, das kann man sagen. Aber diejenigen, die heute zu den Gebildeten gehören, haben ja nirgends eine wirklich erlebte Bildung, nirgends eine Bildung, die heraus ist aus dem Unmittelbaren des Er-lebens. Daher muß gerade gegenüber dem Rechte auch sehr hingewiesen werden auf dieses unmittelbare Erleben.
Da kommen wir zu der Betrachtung, wie die Menschen allmählich unter der neueren Zivilisation in gegenseitige Verhältnisse, in soziale Verhältnisse hineingekommen sind auf dem Gebiete, wo sich eigentlich das Recht entwickeln sollte. Von Mensch zu Mensch sollte sich das Recht entwickeln. Und alles also, alles Parlamentarisieren ist eigentlich im Grunde genommen nur ein Surrogat für das, was sich von Mensch zu Mensch abspielen müßte in einem wirklich richtigen Rechts-gebiete.
Da hat man dann Gelegenheit, wenn man nun nachdenkt über das Rechtsgebiet, wiederum einzugehen - aber jetzt in einer realeren Weise einzugehen - auf dasjenige, was die Begriffe des Proletariats sind und die Empfindungen der Bourgeoisie. Man kann aber jetzt in einer reale-ren Weise dasjenige, was das Proletariat an Begriffen entwickelt hat, herüberführen in das Empfinden der Bourgeoisie. Ich sage: Begriffe des Proletariats, Empfindungen der Bourgeoisie. Die Erklärung dafür finden Sie in meinen «Kernpunkten der sozialen Frage».
Das Proletariat hat aus den vier Begriffen, die ich gestern hier entwickelt habe, durchaus eben das Gefühl des Klassenbewußtseins entwickelt; es muß erobern, was im Besitze der Bourgeoisie ist, den Staat.
Inwieweit der Staat nun ein wirklicher Rechtsstaat ist oder nicht, das ist natürlich dem Proletariat auch nicht klargeworden. Aber was als Rechtsstaat sich entwickelt hat, davon ist die Schweiz am allerwenigsten berührt, daher sie am leichtesten ohne Vorurteile einen wirklichen Rechtsstaat begreifen könnte. Was sich als ein wirklicher Rechtsstaat entwickelt hat, das lebt ja nur zwischen den Äußerungen des eigentlichen Seelenlebens der Menschen fast in der ganzen Welt heute, nur eben nicht in der Schweiz! Überall sonst in der Welt lebt eigentlich dasjenige, was Rechtsstaat ist, ein, ich möchte sagen, Unter-der-Hand-Dasein, währenddem dasjenige, was wirklich von Mensch zu Mensch erlebt wird, auf etwas ganz anderem beruht, und zwar auf etwas ganz durch und durch Bürgerlichem. Was der Mensch im öffentlichen Leben eigentlich sucht, was er hineinträgt in das ganze öffentliche Leben, wodurch ihm eine Verdunkelung des eigentlichen Rechtslebens geschieht, das kann man nur erfassen, wenn man ein wenig die konkreten Beziehungen ins Auge faßt.
Sehen Sie, das Geistesleben ist allmählich aufgesogen worden vom Staatsleben. Das Geistesleben aber ist, wenn man ihm gegenübersteht als einem Elemente, das auf sich selbst gebaut ist, ein sehr strenges Element, ein Element, demgegenüber man fortwährend seine Freiheit bewahren muß, das deshalb nicht anders als auch in der Freiheit organisiert werden darf. Lassen Sie einmal eine Generation ihr Geistesleben freier entfalten und dann dieses Geistesleben organisieren, wie sie es will: es ist die reinste Sklaverei für die nächstfolgende Generation. Das Geistesleben muß wirklich, nicht etwa bloß der Theorie nach, sondern dem Leben nach, frei sein. Die Menschen, die darinnenstehen, müssen die Freiheit erleben. Das Geistesleben wird zur großen Tyrannei, wenn es überhaupt auf der Erde sich ausbreitet, denn ohne daß eine Organisation eintritt, kann es sich nicht ausbreiten, und wenn eine Organisation eintritt, wird sogleich die Organisation zur Tyrannin. Daher muß fortwährend in Freiheit, in lebendiger Freiheit gekämpft werden gegen die Tyrannis, zu der das Geistesleben selber neigt.
Dieses Geistesleben ist nun im Laufe der neueren Jahrhunderte aufgesogen worden vom Staatsleben. Das heißt: Wenn man das Staats-leben der Toga entkleidet, die es noch immer sehr stark anhat in der
Erinnerung an die alte Römerzeit, obwohl schon sogar die Richter anfangen, den Talar abzulegen, aber im ganzen kann man doch sagen, daß das Staatsleben die Toga noch anhat; aber wenn man absieht von dieser Toga, wenn man auf das sieht, was darunter ist: dann ist es eigentlich überall das verzwangte Geistesleben, das im Staate und im sozialen Leben des Staates vorhanden ist. Es ist das verzwangte Geistesleben! Verzwangt, aber nicht wissend, daß es verzwangt ist, daher nicht nach Freiheit strebend, aber immerhin doch gegen die Verzwangtheit fortwährend ankämpfend. Und vieles in der neuesten Zeit ist gerade aus diesem Ankämpfen gegen die Verzwangtheit des Geisteslebens hervorgegangen. Unser ganzes öffentliches Geistesleben steht eigentlich unter dem Zeichen dieser Verzwangtheit des Geisteslebens, und wir können nicht gesunde Verhältnisse gewinnen, wenn wir uns nicht einen Sinn aneignen für die Beobachtung dieser Verzwangtheit des Geisteslebens. Man muß ein Gefühl dafür haben, wie einem diese Verzwangtheit des Geisteslebens entgegenkommt im Alltag.
Ich wurde einmal von einer Anzahl Berliner Damen, die in einem Institute von mir Vorträge angehört hatten, dann eingeladen, einen Vortrag zu halten bei einer der Damen in ihrem Privatappartement, und die ganze Veranstaltung war eigentlich dazu da, daß die Damen entgegenarbeiten wollten einer gewissen dazumal recht gutmütigen Stimmung bei ihren Männern. Nicht wahr, diese Damen kamen so etwa um zwölf Uhr in das Unterrichtsinstitut, wo ich die Vorträge hielt. Und die Männer, wenn wiederum solch ein Tag kam - ich glaube, es war einmal in der Woche -, sagten dann: Na ja, da geht Ihr halt in eure verrückte Anstalt heute wieder hin; da wird die Suppe wieder schlecht sein, oder es wird etwas anderes nicht in Ordnung sein! - Und da wollten denn diese Damen, daß ich einen Vortrag hielte über Goethes «Faust» - das wurde als Thema ausgesucht -, und dazu wurden auch die Männer eingeladen. Nun hielt ich eben einen Vortrag über Goethes «Faust» vor den Damen und Herren. Ja, die Herren waren nachher etwas verdutzt und sie sagten: «Ja, aber Goethes ist halt eine Wissenschaft; Kunst ist ja Goethes nicht. Kunst, das ist Blumenthal» - ich zitiere wörtlich -, «da braucht man sich nicht anzustrengen. Wenn man sich schon im wirtschaftlichen Beruf so anstrengt,
will man sich doch im Leben nicht auch noch anstrengen!» Sehen Sie, was eingezogen ist als Ersatz des Enthusiasmus für die Freiheit im Geistesleben, das tritt uns im staatlichen Leben entgegen als bloßes leichtes Unterhaltungsbedürfnis.
Ich habe einmal auf dem Lande gesehen, wo man so etwas noch gut sehen konnte, wie diese alten herumziehenden Schauspieler, die immer, in Deutschland nannte man es den Dummen August, also den Bajazzo bei sich hatten, wie diese manchmal ganz feine Sachen darstellten. Da sah ich, wie der Clown, der nun seine Clownkunststücke eine ganze Zeit hindurch gemacht und die Leute unterhalten hatte, weil er nun daranging, etwas für ihn sehr Ernstes darzustellen, das Clownkostüm abwarf und nun in schwarzen Beinkleidern und schwarzem Frack dastand. Mir dreht sich dieses Bild immer um: Ich sehe dann zuerst den Mann in schwarzen Beinkleidern und schwarzem Frack, und hinterher sehe ich den Mann mit dem Clownkostüm. Mir kommt es so vor wie schwarzes Beinkleid und Frack, wenn ich irgendwo in einem Schaufenster ein Buch von Einstein über die Relativitätstheorie sehe; und dann habe ich den Clown vor mir, wenn ich daneben ein Buch von Moszkowski über die Relativitätstheorie vor mir habe. Denn tatsächlich, im äußeren Leben ist ja manches Maja: Aber man könnte sich gar nicht denken, daß innerlich die ganze Denkerpedanterie anders auftreten könnte als in schwarzem Beinkleid und in wohlgeschnittenem Frack, will sagen, in der Relativitätstheorie. Und wiederum: Es ist unangenehm, sich so strengen Gedankengängen, so konsequenten Gedankengängen zu fügen, die schon wirklich so geschnitten sind wie ein gutsitzender Frack; das muß den Leuten auch anders entgegentreten. Da macht sich denn der als Philosophenclown feuilletonistisch ganz besonders begabte Alexander Moszkowski daran und schreibt ein dickes Buch. Aus dem lernen nun alle Leute in Feuilletonform, im Clownkostüm, was im Frack geboren worden ist! Sehen Sie, man kann gar nicht anders heute, als die Dinge herüber zu übersetzen in dasjenige, wobei man sich nicht anzustrengen braucht, wobei man auch keinen großen Enthusiasmus zu entfalten braucht.
Gegen diese allgemeine Stimmung muß nämlich empfindungsgemäß angekämpft werden, wenn man über Rechtsbegriffe sprechen
will, denn da tritt der Mensch mit seinem ganzen inneren Werte als ein Gleicher den anderen Menschen gegenüber. Und dasjenige, was die Rechtsbegriffe nicht heraufkommen läßt, das ist das, ja, ich möchte sagen, Alexander-Moszkowskimäßige! Man muß überall die Dinge beim Konkreten aufsuchen.
Ich sage natürlich durchaus nicht, daß man nun nötig hat, wenn man über Rechtsbegriffe spricht, von Frack und Clownkostüm zu sprechen, aber ich möchte zeigen, wie man die Begriffe für diese Dinge elastisch bekommen muß, wie man wirklich auf das eine hinweisen muß, wenn man auf das andere hinweist; auch wie man disponieren können muß, zuerst in sich selber, um dann die nötige Geläufigkeit zu haben, vor den Menschen zu sprechen.
Und auch noch aus einem anderen Grunde muß der heutige Redner so etwas wissen. Er ist ja zumeist dazu verurteilt, wenn er für etwas Zukunftswürdiges zu sprechen hat, abends zu sprechen. Das heißt, er hat diejenige Zeit auszufüllen, in der eigentlich die Leute im Konzert-saal oder im Theater sein möchten. Er muß sich also durchaus klar sein darüber, daß er zu einem Publikum spricht, das besser an seinem Platze wäre, der Zeitverfassung nach, wenn es im Konzertsaal oder im Theater wäre, oder noch woanders, aber nicht eigentlich an seinem Platz ist da unten, wo es zuhören soll, wenn oben ein Redner von zukunftswürdigen Dingen spricht. Man muß sich klar sein, was man eigentlich tut, bis in die Einzelheiten hinein.
Was tut man denn eigentlich, wenn man vor einem solchen Publikum spricht, vor dem zu sprechen man heute zumeist verurteilt ist? Man verdirbt ja diesem Publikum eigentlich in ganz wörtlichem Sinne den Magen! Eine ernste Rede hat nämlich die Eigentümlichkeit, daß sie dem Pepsin feindlich ist, daß sie das Pepsin, den Magensaft nicht zur Wirksamkeit kommen läßt. Eine ernste Rede macht den Magen sauer. Und nur wenn man selber in der ganzen Stimmung ist, eine ernste Rede so vorzubringen, daß man, weigstens innerlich, sie nüt dem nötigen Humor vorbringt, dann hilft man dem Magensaft wieder. Man muß mit einer gewissen inneren Leichtigkeit eine Rede vorbringen, mit einer gewissen Modulation, mit einer gewissen Begeisterung, dann hilft man dem Magensaft. Und dann gleicht man das wiederum aus, was
man dem Magen zufügt in der Zeit, in der wir heute zumeist zu reden haben. Daher ist es wirklich eher als für die Dreigliederung des sozialen Organismus für die Magenspezialisten gearbeitet, wenn Menschen in aller Schwere, mit allem inneren Herauspressen, in pedantischer Form über die Dreigliederung zu den Menschen sprechen. Das muß mit Leichtigkeit, mit Selbstverständlichkeit geschehen, sonst arbeitet man nicht für die Dreigliederung, sondern für die Magenspezialisten. Es gibt nur noch keine Statistik darüber, wie viele Leute, nachdem sie pedantische Vorträge angehört haben, zu den Magenspezialisten gehen müssen! Wenn man einmal eine Statistik über diese Dinge hätte, würde man nämlich erstaunt sein darüber, welcher Prozentsatz in den Patientenkreisen der Magenspezialisten eifrige Vortragszuhörer der heutigen Zeit abgeben.
Ich muß schon auf diese Dinge auch aufmerksam machen, denn es naht sich die Zeit, wo man kennen muß, wie eigentlich der Mensch lebt: wie Ernst auf seinen Magen, wie Humor auf seinen Magensaft wirkt, wie zum Beispiel, sagen wir, der Wein eine Art Zyniker ist, der die ganze menschliche Organisation nicht ernst nimmt, sondern mit ihr spielt. Und so könnte man, wenn man nicht mit den Wischiwaschi-begriffen der heutigen Wissenschaft, sondern mit menschlichen Begriffen an die menschliche Organisation heranginge, durchaus einsehen, was nun auch für eine organische Wirkung, fast chemische Wirkung, jedes Wort und jeder Wortzusammenhang beim Menschen hervorruft.
Solche Dinge zu wissen, erleichtert einem auch das Reden. Während man sonst eine Mauer vor sich hat gegenüber dem Publikum, hört diese Mauer auf zu sein, wenn man gewissermaßen bei einer pedantischen Rede immer durchsieht, wie der Magensaft träufelt und endlich sauer wird im Magen, die Magenwände angreift. Man hat schon zuweilen Gelegenheit, das zu sehen. In Hörsälen der Universitäten ja weniger; da helfen sich die Studenten dadurch, daß sie nicht zuhören.
Sie sehen aber daraus, was ich so sage, wieviel beim Reden von der Stimmung abhängt, wieviel mehr Bedeutung das Vorbereiten der Stimmung, das In-die-Hand-Nehmen der Stimmung hat also das wort-wörtliche Vorbereiten. Wer oftmals sich für die Stimmung vorbereitet
hat, der hat dann gar nicht mehr nötig, sich für das Wortwörtliche so vorzubereiten, daß er sich im entsprechenden Moment durch das zu gute wortwörtliche Vorbereiten eben zum Verderber des Magensaftes gerade macht.
Sehen Sie, zu einem - wenn ich mich jetzt so ausdrücken darf -richtig geschulten Redner gehört verschiedenes; und ich möchte es gerade an dieser Stelle vorbringen, weil das Auseinandersetzen der Rechtsbegriffe gerade vieles fordert, was man nach dieser Richtung charakterisieren muß. Ich möchte es gerade jetzt vorbringen, bevor ich dann wohl morgen zu der Hineinverwebung der Wirtschaftselemente in das Reden sprechen möchte.
Ein Anthroposoph brachte einmal in den Architektenhaussaal in Berlin den Ihnen ja vielleicht auch schon bekannten Max Dessoir mit an einem Abend, wo ich dort einen Vortrag zu halten hatte. Dieser damalige Freund des Max Dessoir sagte hinterher: Ach, der Dessoir ging doch nicht mit! - Ich fragte ihn, wie ihm der Vortrag gefallen habe; da sagte er: Ja, wissen Sie, ich bin selbst ein Redner; und derjenige, der selbst ein Redner ist, der kann nicht richtig zuhören, der hat kein Urteil über das, was der andere redet! - Nun, ich hatte nicht nötig, mir über Dessoir ein Urteil zu bilden nach dieser Aussage, denn dazu hatte ich andere Urteilsbildungsgelegenheiten, würde mir auch kein Urteil gebildet haben nach dieser Aussage: denn ich konnte gar nicht wissen, ob es wirklich wahr ist, oder ob der Dessoir, wie sonst, auch diesmal gelogen hat. Nun aber, nehmen wir an, es wäre wahr gewesen: Wofür wäre das ein Beweis? Dafür, daß jedenfalls derjenige, der solche Ansicht hat, niemals ein richtiger Redner werden kann. Denn niemals kann derjenige ein richtiger Redner werden, der gerne redet, und der sich selbst gerne hört, und der auf sein eigenes Reden besonders viel gibt. Ein richtiger Redner muß eigentlich immer eine gewisse Über-windung durchmachen, wenn er reden soll, und er muß diese Überwindung deutlich fühlen. Er muß vor allen Dingen selbst den schlechtesten fremden Redner lieber hören wollen, als daß er selber sprechen will.
Ich weiß sehr genau, was ich mit dieser Sache sage, und weiß sehr genau, wie schwer es manchem von Ihnen ist, das gerade mir zu glauben,
aber es ist so. Ich gebe zwar zu, daß es andere Vergnügungen gibt in der Welt, als schlechten Rednern zuzuhören. Aber es darf jedenfalls zu diesen anderen größeren Vergnügungen nicht das gehören, selber zu sprechen. Man muß sogar einen gewissen Drang haben, andere zu hören. Man muß gerne anderen zuhören, denn durch das Zuhören wird man eigentlich ein Redner, nicht durch die Liebe zum eigenen Reden. Durch das eigene Reden bekommt man eine gewisse Geläufigkeit; das muß aber instinktiv verlaufen. Was einen zum Redner macht, das ist eigentlich das Zuhören, das Entwickeln eines Ohres für die besonderen Eigentümlichkeiten der anderen Redner, und selbst wenn sie schlechte Redner sind. Daher werde ich jedem, der mich frägt, wie er sich am besten vorbereite, nach einer gewissen Richtung hin ein guter Redner zu werden, antworten: Er höre, aber insbesondere er lese -ich habe den Unterschied zwischen Hören und Lesen auseinandergesetzt - er höre und lese - man kann das ja auch; denn der Unfug besteht einmal, daß die Reden gedruckt werden - die Reden von anderen! Man wird nur auf diese Art jenes starke Gefühl bekommen der Abneigung gegen das eigene Reden. Und diese Abneigung gegen das eigene Reden ist es eigentlich, die es einem ermöglicht, eben entsprechend wirklich zu reden. Das ist außerordentlich wichtig. Und bei den Menschen, die es doch nicht zustande kriegen das eigene Reden mit Antipathie zu betrachten, bei denen ist es gut, wenn sie wenigstens das Lampenfieber sich bewahren, denn ohne Lampenfieber und mit Sympathie für das eigene Reden sich hinstellen und reden, das ist eigentlich etwas, das man unterlassen sollte, denn es wirkt unter allen Umständen nicht gut in der Welt. Es wirkt zur Sklerotisierung der Rede, zur Verknöcherung, zur Verkapselung der Rede und gehört dann eben zu dem, was den Leuten die Predigt verdirbt.
Sehen Sie, ich würde Ihnen wahrhaftig nicht im Sinne der Aufgabe dieses Kurses über das Reden sprechen, wenn ich aus irgendeiner alten Rhetorik oder aus nachgebildeten alten rhetorischen Reden heraus Ihnen hier Redegesetze aufzählen würde, sondern ich will Ihnen aus voller Erfahrung heraus ans Herz legen, was man eigentlich immer im Herzen haben soll, wenn man durch Reden auf seine Mitmenschen wirken will.
Gewiß, einigermaßen ändern sich die Dinge, wenn man zur Wechselrede gezwungen ist, wenn also, ich möchte sagen, ein gewisses Rechtsverhältnis auftritt zwischen Mensch und Mensch in der Diskussion. Aber in der Diskussion, an der man gerade das Rechtsverhältnis am schönsten lernen könnte, macht sich heute fast gar nicht dieses Hineinprojizieren der allgemeinen Rechtsbegriffe in das Verhältnis, das zwischen Mensch und Mensch in der Diskussion, im Wortverhältnis, im Satzverhältnis besteht, geltend. Da handelt es sich wirklich darum, daß man dann bei der Diskussion nicht verliebt ist in seine eigene Art, zu denken, in seine Art, zu empfinden, sondern daß man in der Diskussion eigentlich antipathisch empfindet, was man selber zu etwas sagen möchte und das man heraufholt. Dann kann man das nämlich, wenn man seine eigene Meinung, auch seinen eigenen Ärger oder die eigene Aufgeregtheit zurückzudämmen versteht und hinüberkriechen kann in den anderen. So wird das fruchtbar auch in der Debatte, wo etwas zurückgewiesen werden muß. Man kann natürlich nicht dasselbe sagen, was der andere sagt, aber man kann von dem anderen das nehmen, was man gerade zu einer wirksamen Debatte braucht.
Ein ganz eklatantes Beispiel ist das Folgende. Es ist erzählt in der letzten Nummer der «Dreigliederung»; ich habe es vor mehr als zwanzig Jahren erlebt. Der Abgeordnete Rickert hielt im deutschen Reichstag eine Rede, in der er Bismarck vorwarf, daß er die Richtung seiner Politik ändere. Er wies darauf hin, wie Bismarck eine Zeitlang mit den Liberalen gegangen ist, sich nachher nach den Konservativen gewendet hat, und hielt eine sehr wirksame Rede, die er zusammenfaßte in das Bild, daß die Bismarcksche Politik darauf hinausliefe, den Mantel nach dem Winde zu drehen. Nun, Sie können sich denken, wie das in der Empfindung eines Auditoriums, noch dazu einer Schwatzanstalt -nun, der deutsche Ausdruck ist nicht gut, wenn man ihn braucht, aber für Parlament ist die richtige deutsche Übersetzung schon Schwatzanstalt -, innerlich, empfindungsgemäß wirkt, wenn solch ein Bild gebraucht wird. Bismarck aber stellte sich hin und hielt nun dem Abgeordneten Rickert die Dinge entgegen - zunächst mit einer gewissen Überlegenheit-, die er zu sagen hatte; und dann kroch er in den Abgeordneten Rickert hinein, wie er das in ähnlichen Fällen immer tat,
und sagte: Der Abgeordnete Rickert hat mir vorgeworfen, daß ich den Mantel nach dem Winde drehe. Aber Politik treiben ist so etwas, wie auf der See fahren. Ich möchte wissen, wie man eigentlich richtig steuern sollte, wenn man sich nicht nach dem Winde drehen will! Ein richtiger Seefahrer muß sich, wie ein richtiger Politiker, beim Steuern selbstverständlich nach dem Winde richten, wenn er nicht etwa selbst Wind machen will!
Sie sehen: Das Bild ist aufgegriffen, so gewendet, daß es nun tatsächlich den Pfeil auf den Schützen zurückschlägt. Es handelt sich in der Debatte darum, die Dinge aufzunehmen, aus dem Redner selber heraus die Dinge zu holen. Wenn es sich um ein leichteres Bild handelt, ist ja die Sache begreiflich. Aber man wird das auch ganz im Seriösen tun können: aufsuchen bei dem Gegner, was aus dem Gegner heraus selber die Sache zerfasert! In der Regel wird es nicht viel nützen, wenn man seine eigenen Gründe den Gründen des Gegners einfach entgegen-setzt.
Bei der Debatte sollte man eigentlich in folgender Stimmung sein können: Man sollte in dem Augenblick, wo die Debatte losgehen soll, eigentlich alles, was man bisher gewußt hat, ausschalten können, das alles ins Unbewußte hinunterdrängen, und eigentlich nur wissen, was der Redner, dem man zu erwidern hat, eben gesagt hat, und dann redlich sein Zurechtrückungstalent über das, was der Redner gesagt hat, walten lassen. Das Zurechtrückungstalent walten lassen! In der Debatte handelt es sich darum, unmittelbar aufzunehmen, was der Redner sagt, und nicht einfach das, was man schon vor längerer Zeit gewußt hat, eben einfach entgegenzustellen. Wenn man das, was man schon vor längerer Zeit gewußt hat, einfach entgegenstellt, wie es bei den meisten Debatten geht, so geht die Debatte eigentlich wirklich ergebnislos aus, tatsächlich ergebnislos. Man kann ja eigentlich nie jemanden in einer Diskussion widerlegen. Man muß sich dessen nur bewußt sein, daß man nie jemanden in einer Debatte widerlegen kann, sondern man kann nur zeigen, daß ein Redner entweder sich selbst oder der Wirklichkeit widerspricht. Man kann nur eingehen auf das, was er gesagt hat. Und das wird gerade, wenn es als Grundsatz entwickelt wird, für Debatten, für Diskussionen von einer außerordentlichen
Wichtigkeit sein. Wenn einer in der Debatte nur das sagen will, was er schon gewußt hat, dann wird es sicher gar keine Bedeutung haben, daß er es nach dem Redner vorbringt.
Mir trat das einmal ganz besonders instruktiv, möchte ich sagen, vor Augen. Ich wurde in Holland auf meiner letzten Reise eingeladen, auch in der Philosophischen Gesellschaft der Amsterdamer Universität einen Vortrag zu halten über Anthroposophie. Da war schon der Vorsitzende selbstverständlich anderer Meinung als ich. Es war gar kein Zweifel, daß er, wenn er in die Debatte eingriff, etwas ganz anderes sagen werde als ich. Aber es war ebenso klar, daß schließlich das, was er sagte, nichts ausmachte in bezug auf meine Rede, und daß meine Rede auch keinen besonderen Einfluß haben würde auf dasjenige, was er sagen würde, aus dem, was er ja ohnedies wußte. Daher fand ich, daß er es ganz gescheit gemacht hat: Er brachte, was er zunächst vorzubringen hatte, nicht etwa hinterher in der Debatte, sondern schon vorher vor! Er hätte auch das, was er nachher in der Debatte noch angefügt hat an seine vorausgehenden Worte, schon am Anfang auch gleich vorher vorbringen können, es würde an der Sache gar nichts geändert haben.
Über solche Dinge muß man sich nur keinen Illusionen hingeben. Vor allen Dingen kommt es darauf an, daß gerade ein Redner sich recht, recht stark in menschliche Verhältnisse hineinfindet. Aber über menschliche Verhältnisse darf man sich, wenn die Dinge wirken sollen, keinen Illusionen hingeben. Vor allen Dingen - das möchte ich Ihnen heute noch sagen, weil das eine gewisse Grundlage für die nächsten Vorträge abgeben wird -, vor allen Dingen soll man sich keiner Illusion darüber hingeben, daß Reden doch wirken.
Ich muß immer innerlich furchtbar in eine humoristische Stimmung kommen, wenn gutmeinende Zeitgenossen immer wieder und wieder sagen: Auf Worte kommt es nicht an, auf Taten kommt es an! -Ich habe an den ungeeignetsten Stellen, sowohl in Zwiegesprächen wie auch von verschiedenen Podien herab, immer wieder deklamieren hören: Auf Worte kommt es nicht an; auf Taten kommt es an! - Bei dem, was in der Welt an Taten geschieht, kommt alles auf die Worte an! Es geschehen nämlich für den, der die Sache durchschaut, gar keine
Taten, die nicht vorher durch die Worte von irgend jemandem vorbereitet sind.
Aber Sie werden verstehen, daß die Vorbereitung etwas recht Subtiles ist. Denn, wenn es wahr ist, und es ist wahr, daß man eigentlich dadurch, daß man pedantisch theoretisch, prinzipiell marxistisch redet, den Leuten den Magensaft verdirbt, wobei der Magensaft den übrigen Organismus infiziert, dann können Sie sich denken, wie die Taten draußen, die sehr stark vom Magensaft abhängen, wie er sich dann in den übrigen Organismus ergießt, wenn er zerstreut wird - wie die Taten draußen Folgen solcher schlechten Reden sind. Und wie auf der anderen Seite wiederum, wenn die Leute nur als Spaßmacher auftreten, fortwährend Magensaft produziert wird, der dann eigentlich als Essig wirkt, und der Essig ist ein furchtbarer Hypochonder. Aber die Leute werden weiter unterhalten, indem das, was heute in die Öffentlichkeit fließt, ein fortwährendes Getriebe von Spaßmacherei ist. Die Spaßmacherei von gestern ist noch gar nicht verdaut, wenn die Spaßmacherei von heute auftritt. Da verschlägt sich der Magensaft von gestern und wird etwas Essighaftes. Der Mensch wird ja heute schon wiederum unterhalten. Er kann ganz lustig sein. Aber so, wie er sich in das öffentliche Leben hineinstellt, so ist es eigentlich der hypochondrische Essig, der da wirkt. Und diesen hypochondrischen Essig, den kann man dann finden!
Ja, in den Wirtshäusern sind es die marxistischen Redner, die den Leuten den Magen verderben, und wenn die Leute dann den «Vorwärts» lesen, so ist dies dasjenige, woran der verdorbene Magen wieder zurechtgerückt werden muß. Das ist schon ein ganz realer Prozeß.
Man muß wissen, wie sich in die Welt der Taten die Welt der Reden hineinstellt. Der unwahrste Ausspruch - weil aus einer falschen Sentimentalität, und alles, was aus einer falschen Sentimentalität kommt, ist nämlich unwahr -, der unwahrste Ausspruch gegenüber dem Reden ist der: «Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich auch endlich Taten sehn!» Das kann ganz gewiß stehen an einer Stelle eines Dramas, und dort, wo es steht, steht es schon zu Recht. Aber wenn es da herausgerissen und als ein allgemeines Diktum hingestellt wird, dann mag es richtig sein, aber gut ist es ganz sicher nicht. Und wir sollen
lernen, nicht etwa bloß schön, nicht etwa bloß richtig, sondern auch gut zu reden, sonst bringen wir die enschen in den Abgrund hinein, können jedenfalls nichts Zukunftswürdiges mit den Leuten besprechen.
Also morgen um drei Uhr.
FÜNFTER VORTRAG Dornach, 15. Oktober 1921
Versucht habe ich zu charakterisieren, wie man etwa einen Dreigliederungsvortrag aus einem Gedanken heraus formen und dann auch einteilen kann. In dem, was ich sagte, war ja enthalten sowohl das Allgemeine, was man vorbringen kann über den gesamten sozialen Organismus, wie auch Hinweise darauf, was in den ersten zwei Gliedern vorkommen kann, nämlich bei der Besprechung des geistigen Lebens und bei der Besprechung des rechtlich-staatlichen Organismus. Sie werden daraus gesehen haben, wie man, inhaltlich sich vorbereitend für einen solchen Vortrag, vorgehen kann.
Nun, man kann sich aber auch, indem man sich in die Gedanken und Empfindungen hineinlebt, auf das Wie vorbereiten, und wir werden uns vielleicht am besten verstehen, wenn ich sage, daß die Vor-bereitung auf das Wie so sein soll, daß wir uns bemühen, schon zu empfinden und dann auch zu sprechen dasjenige, was sich bezieht auf das geistige Leben, in einer mehr lyrischen Sprache - ohne daß wir selbstverständlich ins Singen oder dergleichen oder ins Rezitieren verfallen -, in einer lyrischen Sprache, in ruhiger Begeisterung, so daß man verrät durch die Art und Weise, wie man die Dinge vorbringt, daß alles, was man über das Geistesleben zu sagen hat, aus einem selbst heraus kommt. Man soll durchaus die Vorstellung hervorrufen, daß man begeistert ist für das, was man verlangt für den geistigen Teil des sozialen Organismus. Natürlich darf es nicht falsch-mystische, sentimentale Begeisterung, nicht gemachte Begeisterung sein. Das erreichen wir, wenn wir uns eben zuerst bloß in der Vorstellung, im inneren Erleben bis auf den Ton hin vorbereiten darauf, wie etwa so etwas gesagt werden könnte. Ich sage ausdrücklich: wie etwa so etwas gesagt werden könnte - aus dem Grunde, weil wir uns niemals wortwörtlich binden sollen, sondern was wir vorbereiten, ist gewissermaßen eine bloß in Gedanken sich abspielende Rede, und wir sind durchaus darauf gefaßt, das, was wir dann sagen, wiederum in anderer Formulierung zu sagen.
Wenn wir aber reden über Rechtsverhältnisse, da sollten wir schon
den Versuch machen, dramatisch zu sprechen. Das heißt: Wenn wir sprechen über die Gleichheit der Menschen, diese durch Beispiele erörternd, sollten wir versuchen, uns möglichst hineinzudenken in den anderen Menschen. Wir sollten etwa die Vorstellung vor unsere Seele rufen, wie derjenige, der eine Arbeit sucht, das Recht für diese Arbeit geltend macht im Sinne der «Kernpunkte der sozialen Frage». Und wir sollten dann gewissermaßen, indem wir auf der einen Seite bemerklich machen, daß wir aus dem anderen heraus reden, aus seiner rechtlichen Forderung, wir sollten dann bemerklich machen, wie wir durch eine leise Änderung der Stimmlage dazu übergehen, wie man aus allgemein menschlichen Gründen heraus solch eine Forderung erfüllen müsse. Also dramatisches Sprechen, sehr stark moduliertes dramatisches Sprechen, das die Empfindung bei den Zuhörern hervorruft, man könne sich in die Seele von anderen Menschen hineindenken, das wird dasjenige sein, was wir verwenden sollten beim Sprechen über Rechtsverhältnisse.
Und beim Sprechen über wirtschaftliche Verhältnisse, da handelt es sich ja hauptsächlich darum, daß wir durchaus aus den Erfahrungen heraus sprechen. Man sollte überhaupt, wenn man im Sinne der Drei-gliederung des sozialen Organismus über wirtschaftliche Verhältnisse spricht, gar nicht den Glauben aufkommen lassen, daß es so etwas wie eine theoretische Nationalökonomie auch nur geben könnte. Man soll vielmehr das Hauptsächlichste darauf beschränken, Fälle aus dem wirtschaftlichen Leben selber zu beschreiben, seien es Fälle, die man nachbeschreibt, oder seien es Fälle, die man sich zusammenstellt, wie sie etwa sein sollten oder sein könnten. Aber bei den letzteren Fällen -wie sie etwa sein sollten oder sein könnten - soll man niemals außer acht lassen, aus der wirtschaftlichen Erfahrung heraus zu sprechen. Man soll eigentlich, wenn man über das wirtschaftliche Leben spricht, episch sprechen. Gerade wenn man das vorbringt, was in den «Kern-punkten der sozialen Frage» steht, soll man so sprechen, wie wenn man eigentlich über das wirtschaftliche Leben gar keine Vormeinungen hätte, gar nicht meinte, das soll so sein oder das soll anders sein, sondern wie wenn man sich alles, alles von den Tatsachen sagen ließe.
Man kann ja eine gewisse Empfindung hervorrufen, daß es zum
Beispiel richtig ist, Kapitalverwaltungen übergehen zu lassen von demjenigen, der nicht mehr selbst daran beteiligt ist, an jemanden, der wiederum beteiligt sein kann. Man kann aber über so etwas auch nur sprechen, wenn man es vor die Menschen hinstellt an der Hand von Beschreibungen dessen, was geschieht, wenn bloße Blutserbverhältnisse sind, und dessen, was geschehen kann, wenn ein solches Übergehen stattfindet, wie es in den «Kernpunkten der sozialen Frage» beschrieben ist. Man kann nur dadurch, daß man dieses recht lebendig, wie wenn man die Wirklichkeit abschriebe, vor die Menschen hinstellt, so sprechen, daß das Sprechen im wirtschaftlichen Leben wirklich drin-nensteht. Und gerade dadurch wird man auch den Assoziationsgedan ken begreiflich, plausibel machen. Man wird plausibel machen, daß der einzelne Mensch eigentlich gar nichts weiß über das Wirtschaftsleben, daß er im Grunde genommen ganz darauf angewisen ist, wenn er zu einem Urteil über das kommen will, was im Wirtschaftsleben zu geschehen hat, sich mit anderen zu verständigen, so daß eigentlich immer nur aus Menschengruppen ein wirkliches wirtschaftliches Urteil hervorgehen kann und man also angewiesen ist auf die Assoziationen.
Man wird dann vielleicht auf Verständnis stoßen, wenn man darauf aufmerksam macht, daß ja vieles von dem, was heute besteht, eigentlich aus alten instinktiven Assoziationen hervorgegangen ist. Bedenken sie nur einmal, wie der heutige abstrakte Markt Dinge zusammen-bringt, deren Zusammenkommen und wiederum Weiterverteiltwerden an den Konsumenten gar nicht überschaut werden kann. Aber wie ist man denn überhaupt zu diesem Marktverhältnis gekommen? Im Grunde genommen aus der instinktiven Assoziation heraus, indem eine Anzahl von Dörfern in solch einer Entfernung, daß man hin- und zurückgehen kann im Tage, um einen größeren Ort herum waren und da die Leute ihre Produkte austauschten. Das nannte man nicht eine Assoziation. Man sprach überhaupt kein Wort aus; aber in Wirklichkeit war es eine instinktive Assoziation. Diejenigen Leute, welche hier sich zum Markt vereinigten, waren assoziiert mit all denen, die in den Dörfern herum wohnten. Sie konnten rechnen auf einen bestimmten Absatz, der sich erfahrungsgemäß ergab. Daher konnten sie nach dem Konsum die Produktion regeln in ganz lebendigen Zusammenhängen.
In solchen primitiven Wirtschaften waren durchaus assoziative Verhältnisse, die sich nur nicht als solche aussprachen, vorhanden.
Das alles ist mit der Vergrößerung der wirtschaftlichen Territorien unüberschaubar geworden, und insbesondere dann sinnlos geworden gegenüber der Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft, zu der es ja erst gekommen ist im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, die hat ja alles ins Abstrakte, das heißt, im wirtschaftlichen Leben auf den bloßen Geld- oder Geldeswertumsatz reduziert, bis sich eben dieses Reduzieren ad absurdum geführt hat.
Nicht wahr, als Japan mit China Krieg geführt und Japan den Krieg gewonnen hatte, da konnte man sehr einfach die Kriegsentschädigung zahlen, indem einfach der chinesische Minister dem japanischen Gesandten einen Check übergab, den der japanische Gesandte dann in Japan auf eine Bank geben konnte. Das ist ein tatsächlicher Vorgang. Da waren eben Werte darinnen in diesem Check, der Geld und Geldes-wert eben ist. Es waren Werte darinnen. Wenn Sie sich vorstellen, daß das dazumal alles von dem einen Territorium in das andere hätte übergeführt werden sollen, es wäre unter den neuzeitlichen Verhältnissen eben schwer gegangen. Aber so konnte man durch die ganze Art und Weise, wie Japan und China in die ganze Weltwirtschaft hineingestellt waren, das machen. Aber das hat sich ja selbst ad absurdum geführt. In dem Handel zwischen Deutschland und Frankreich hat sich das nicht mehr als möglich erwiesen. Ich meine also, man kann aus den wirtschaftlichen Zusammenhängen heraus am besten die Dinge erörtern, und dann die Notwendigkeit des assoziativen Prinzips darlegen.
Dann wird man sich diesen Stoff gerade mit Bezug auf das Wirtschaftsleben auch in einer gewissen Weise wiederum zu gliedern haben, und wird dann überzugehen haben zu einigen Schlußsätzen, von denen ich schon gesagt habe, daß sie wiederum wortwörtlich verfaßt werden sollen oder wenigstens nahezu wörtlich.
Wie wird sich denn also eigentlich die Vorbereitung für eine Rede ausnehmen? Nun, man suche möglichst in die Situation oder in dasjenige, worauf die Zuhörerschaft vorbereitet ist, hineinzukommen dadurch, daß man die ersten Sätze so gestaltet, wie man es eben für notwendig
hält. Man wird größere Mühe haben bei ganz unvorbereiteten Zuhörern, kleinere Mühe, wenn man zu einem Kreis spricht, den man schon in der Sache drinnenstehend findet, wenigstens in den entsprechenden Empfindungen, von den Forderungen, die man erhebt. Dann wird man den übrigen Teil der Rede weder aufschreiben, noch wird man bloße Schlagworte hinschreiben. Die Erfahrung zeigt, daß die wörtliche Ausarbeitung ebensowenig zu einer guten Rede führt wie das bloße Aufschreiben von Schlagworten. Das Aufschreiben aus dem Grunde nicht, weil es einen bindet und dadurch leicht Verlegenheit bringt, wenn das Gedächtnis holpert, was gerade dann am leichtesten der Fall ist, wenn die Rede wortwörtlich aufgeschrieben ist. Schlagworte verleiten sehr leicht dazu, die ganze Vorbereitung zu abstrakt zu gestalten. Dagegen ist dasjenige, was man am besten aufschreibt und auch als Manuskript mitbringt, wenn man nötig hat, sich an so etwas zu halten, eine Reihe richtig formulierter Sätze als Schlagsätze, die nicht den Anspruch darauf machen, daß man sie auch so sagt als einen Bestandteil der Rede, sondern die dastehen: erstens, zweitens, drittens, viertens und so weiter, die gewissermaßen Extrakte geben, so daß aus einem Satz vielleicht zehn oder acht oder zwölf werden. Aber man schreibe sich solche Sätze auf. Man schreibe sich also nicht etwa auf «Geistesleben als selbständig», sondern «Das Geistesleben kann nur gedeihen, wenn es frei aus sich heraus selbständig wirkt». Also Schlag-sätze. Sie werden dann, wenn Sie so etwas tun, selbst die Erfahrung machen, daß man durch solche Schlagsätze am allerbesten in verhältnismäßig kurzer Zeit in eine gewisse Möglichkeit des freien Sprechens, das eben nur die Leiter der Schlagsätze hat, hineinkommt.
Für den Schluß ist es oftmals sehr gut, wenn man in einer gewissen Weise, wenigstens leise, zum Anfang wiederum zurückführt, wenn also der Schluß in einer gewissen Weise etwas hat, was als Motiv schon im Anfang enthalten war.
Und dann geben einem solche Schlagsätze leicht die Möglichkeit, nun wirklich sich so vorzubereiten, wie vorhin angedeutet wurde, indem man sich auf seinem Blättchen diese Schlagsätze aufgeschrieben hat. Also, sagen wir, man überlegt sich: Was du für das geistige Leben zu sagen hast, muß in dir eine Art lyrischen Charakter haben; was du
für das Rechtsleben zu sagen hast, muß in dir eine Art dramatischen Charakter haben; das für das Wirtschaftsleben muß in dir einen erzählend-epischen Charakter, einen ruhig erzählend-epischen Charakter haben. - Dann wird in der Tat schon instinktiv ein wenig die Sucht hervorgehen und auch die Kunst hervorgehen, in der Formulierung der Schlagsätze so etwas auszubilden, wie ich es angedeutet habe. Es wird die Vorbereitung ganz gefühlsmäßig so erfolgen, daß in der Tat die Art, wie man redet, hineinwächst in das, was man inhaltlich zu sagen hat.
Dazu ist aber allerdings notwendig, daß man nun gewissermaßen das, was Sprachbeherrschung sein soll, bis, ich möchte sagen, zum Instinkt gebracht hat, daß man also tatsächlich die Sprachorgane so fühlt, wie man etwa den Hammer fühlen würde, wenn man irgend etwas mit dem Hammer machen wollte. Das kann man dann erreichen, wenn man ein wenig Sprachturnen übt.
Nicht wahr, wenn man Turnen übt, so sind das auch nicht Bewegungen, welche dann im wirklichen Leben ausgeübt werden, aber es sind Bewegungen, die einen geschmeidig, geschickt machen. Und so soll man auch die Sprachorgane geschmeidig, biegsam machen. So aber, daß dieses Geschineidig-, Biegsammachen mit dem inneren Seelenleben zusammenhängt, so daß man fühlen lernt den Laut im Sagen. Ich habe in dem seminaristischen Kursus, den ich den Waldorflehrern in Stuttgart vor jetzt mehr als zwei Jahren gehalten habe, eine Reihe von solchen Sprachübungen zusammengestellt, die ich Ihnen hier auch mitteilen möchte. Sie sind nun so, daß sie zumeist durch ihren Inhalt nicht davon abhalten, rein in das Sprachelement sich hineinzuleben, sondern daß sie lediglich darauf ausgehen, ein Sprachturnen zu üben. Wenn man diese Sätze versucht, immer wieder und wiederum sich laut zu sagen, aber so zu sagen, daß man immer probiert: Wie machst du es am besten mit der Zunge, wie am besten mit den Lippen, daß du gerade diese Lautfolge herausbringst? -, dann macht man sich unabhängig von dem Sprechen selber, und dann kann man um so mehr auf das seelische Vorbereiten für das Sprechen Wert legen.
Ich werde Ihnen also eine Reihe von solchen, für das Inhaltliche oftmals sinnlosen Sätzen vorlesen, die aber dazu bestimmt sind, die
Sprachorgane geschmeidig zum Reden zu gestalten.
Daß er dir log, uns darf es nicht loben
ist das Einfachste. Ein schon etwas Komplizierteres:
Nimm nicht Nonnen in nimmermüde Mühlen
Und man soll immer mehr versuchen, angemessen der Lautfolge die Sprachorgane zu geschmeidigen, zu biegen, zu hohlen, zu erhabenen. Ein anderes Beispiel:
Rate mir mehrere Rätsel nur richtig
Es genügt natürlich nicht, einmal oder zehnmal so etwas zu sagen, sondern immer wieder und wiederum. Denn wenn die Sprachorgane auch schon biegsam sind, sie können noch immer biegsamer werden.
Ein Beispiel, von dem ich glaube, daß es ganz besonders nützlich ist, ist das Folgende:
Redlich ratsam
Rüstet rühmlich
Riesig rächend
Ruhig rollend
Reuige Rosse
Dabei hat man auch zugleich die Gelegenheit, in den Zwischenpausen den Atem in Ordnung zu bringen, worauf man sehen muß, und was insbesondere durch solch eine Übung sehr gut gemacht werden kann.
In einer ähnlichen Weise - es haben nicht alle Buchstaben, nicht alle Laute den gleichen Wert für dieses Turnen - kommen sie vorwärts, wenn Sie zum Beispiel das Folgende haben:
Protzig preist
Bäder brünstig
Polternd putzig
Bieder bastelnd
Puder patzend
Bergig brüstend
Wenn es Ihnen gelingt, nach und nach sich hineinzufinden in diese Lautfolge, so haben Sie viel davon.
Hat man solche Übungen gemacht, dann kann man auch versuchen, diejenigen Übungen zu machen, die dann notwendig darauf hinauslaufen, schon Stimmung hineinzubringen in das Sprechen der Laute. Ich habe ein Beispiel, wie das Lauten in die Stimmung hinein sich ergießen kann, versucht, in dem Folgenden zu geben:
Erfüllung geht
Durch Hoffnung
Geht durch Sehnen
Durch Wollen
und jetzt kommt es mehr ins Lauten hinein, wodurch gerade hier die Stimmung im Laut selber festgehalten wird:
Wollen weht
Im Webenden
Weht im Bebenden
Webt bebend
Webend bindend
Im Finden
Findend windend
Kündend
Sie werden immer sehen, wenn Sie gerade diese Übungen machen, wie Sie in der Lage sind, ohne daß Sie der Atem stört, den Atem zu regulieren, wenn Sie sich einfach an das Lauten halten. Man hat in der neueren Zeit allerlei mehr oder weniger pfiffige Methoden für das Atmen und für alles mögliche, was die Begleittatsachen sind des Sprechens und Singens, ausgedacht. Allein das alles sind eigentlich Nichtsnutzigkeiten, denn Sprechen soll mit allem, was dazugehört, auch mit dem Atmen, durchaus im Sprechen selbst gelernt werden. Das heißt, man soll lernen so zu sprechen, daß in den Notwendigkeiten, die die Lautfolge, die Wortzusammenhänge ergeben, auch der Atem sich wie selbstverständlich mitreguliert. Man soll also nur im Sprechen auch das Atmen beim Sprechen lernen. Es sollen also die Sprechübungen so
sein, daß man, wenn man sie richtig fühlt dem Lauten nach, nicht dem Inhalte, sondern dem Lauten nach, genötigt ist, durch dieses Richtigfühlen des Lautens auch den Atem richtig zu gestalten.
Auf das Inhaltliche wiederum der Stimmung geht schon dasjenige, was nun der folgende Spruch ist. Er hat vier Zeilen. Diese vier Zeilen sind so angeordnet, daß sie gewissermaßen ein Aufstieg sind. Jede Zeile erregt eine Erwartung. Und die fünfte Zeile ist der Abschluß und bringt Erfüllung. Nun soll man sich bemühen, diese Sprechbewegung, die ich eben charakterisiert habe, wirklich auszuführen. Der Spruch heißt
In den unermeßlich weiten Räumen,
In den endenlosen Zeiten,
In der Menschenseele Tiefen,
In der Weltenoffenbarung:
Suche des großen Rätsels Lösung
Da haben Sie die fünfte Zeile als die Erfüllung jener stufenweisen Erwartung, die in den vier ersten Zeilen angeschlagen ist.
Nun kann man auch versuchen, schon, ich möchte sagen, die Stimmung der Situation in das Lauten, in die Sprechart, in das Wie des Sprechens hineinzubringen. Und dazu habe ich folgende Übung geformt. Man stelle sich vor einen recht großen grünen Frosch, der vor einem sitzt mit offenem Mund. Also einen riesigen Frosch stelle man sich vor mit offenem Mund, dem man gegenübersteht. Und nun stelle man sich vor, was man für Affekte haben kann gegenüber diesem Frosch. In dem Affekt wird Humor drinnen sein, manches andere drinnen sein; das rufe man recht lebhaft in der Seele hervor. Dann spreche man diesen Frosch so an:
Lalle Lieder lieblich
Lipplicher Laffe
Lappiger lumpiger
Laichiger Lurch
Stellen Sie sich einmal vor: einen Acker, darüber gehe ein Pferd. Auf den Inhalt kommt es nicht an. Sie müssen sich natürlich jetzt vorstellen,
daß die Pferde pfeifen! Nun sprechen Sie die Tatsache, die Sie hier haben, folgendermaßen aus:
Pfiffig pfeifen
Pfäffische Pferde
Pflegend Pflüge
Pferchend Pfirsiche
und dann variieren Sie das, indem Sie so sprechen:
Pfiffig pfeifen aus Näpfen
Pfäffische Pferde schlüpfend
Pflegend Pflüge hüpfend
Pferchend Pfirsiche knüpfend
Und dann - aber bitte, lernen Sie es auswendig, so daß Sie recht geläufig die eine und die andere Form hintereinander sagen können -noch eine dritte Form. Lernen Sie alle drei auswendig, und versuchen Sie, sie so geläufig zu sprechen, daß Sie niemals die eine Form im Aussprechen der anderen beirrt. Darauf kommt es hier an. Als dritte Form nehmen Sie:
Kopfpfiffig pfeifen aus Näpfen
Napfpfäffische Pferde schlüpfend
Wipfend pflegend Pflüge hüpfend
Tipfend pferchend Pfirsiche knüpfend
Also das hintereinander, so daß man auswendig die drei Formen kann, so daß Sie niemals das eine in dem anderen stört.
Ein Ähnliches können Sie dann etwa mit den folgenden zwei Sprüchen machen:
Ketzer petzten jetzt kläglich
Letztlich leicht skeptisch
und nun die andere Form:
Ketzerkrächzer petzten jetzt kläglich
Letztlich plötzlich leicht skeptisch
Wiederum auswendig lernen und hintereinander sprechen!
Man kann die Sprache geschmeidig kriegen, wenn man etwa das Folgende übt:
Nur renn nimmer reuig
Gierig grinsend
Knoten knipsend
Pfänder knüpfend
Man muß sich gewöhnen, diese Lautfolge zu sagen: Nur renn ... Sie werden schon sehen, was Sie für Ihre Zunge, Ihre Sprachorgane haben, wenn Sie solche Übungen machen.
Nun eine etwas länger dauernde, eine solche Übung, wodurch dieses Geschmeidigwerden im Sprechen hervorgerufen werden kann - ich glaube, es haben ja hinterher schon Schauspieler gefunden, daß sie auf diese Weise am besten ihre Sprache geschmeidig machen -:
Zuwider zwingen zwar
Zweizweckige Zwacker zu wenig
Zwanzig Zwerge
Die sehnige Krebse
Sicher suchend schmausen
Daß schmatzende Schmachter
Schmiegsam schnellstens
Schnurrig schnalzen
Dann: Man braucht zuweilen Geistesgegenwart im unmittelbaren Sprechen. Man kann sie sich durch folgendes etwa ausbilden:
Klipp plapp plick glick
Klingt Klapperrichtig
Knatternd trappend
Rossegetrippel
Dann: zum weiteren Geistesgegenwärtigsein im Sprechen die folgenden zwei Beispiele, die zusammengestellt werden können:
Schlinge Schlange geschwinde
Gewundene Fundewecken weg
Da ist auch das «Wecken weg» drinnen. Dann aber dasselbe Motiv als Lautmotiv so:
Gewundene Fundewecken
Geschwinde schlinge Schlange weg
Dann zu dem Kräftigmachen der Sprache, daß man die Sprache so hat, daß man auch einmal einem eins in der Diskussion herunterhauen kann - so etwas ist schon in der Sprache nötig! -, das folgende Beispiel:
Marsch schmachtender
Klappriger Racker
Krackle plappernd linkisch
Flink von vorne fort
Dann wären für jemanden, der etwas stottert, die folgenden zwei Beispiele noch anzuführen:
Nimm mir nimmer
Was sich wässerig
Mit Teilen mitteilt
Es ist für jeden Stotterer gerade dieses Beispiel gut. Man kann es auch in der folgenden Weise dann sagen beim Stottern:
Nimmer nimm mir
Wässerige Wickel
Was sich schlecht mitteilt
Mit Teilen deiner Rede
Es kommt natürlich darauf an, daß sich der Stotterer Mühe gibt.
Man soll durchaus nicht glauben, daß man das, was ich Redeturnen nennen möchte, nur an für den Verstand sinnvollen Sätzen üben kann oder auch nur üben soll. Denn an den für den Verstand sinnvollen Sätzen überwiegt zunächst unbewußt-instinktiv zu stark die Aufmerksanikeit für den Sinn, als daß wir richtig rechneten mit dem Lauten, mit dem Sagen. Und es ist schon notwendig, daß wir, wenn wir reden wollen, auch darauf Rücksicht nehmen, daß wir das Reden in einem gewissen Sinne losbringen von uns selber, wirklich losbringen
von uns selber. Geradeso wie man die Schrift losbringen kann von sich selber, so kann man ja auch das Reden losbringen von sich selber.
Es gibt zweierlei Arten, zu schreiben bei einem Menschen. Die eine Art besteht darinnen, daß der Mensch egoistisch schreibt, daß er gewissermaßen die Buchstabenformen in seinen Gliedern hat und sie aus den Gliedern herausfließen läßt. Auf ein solches Schreiben hat man insbesondere eine Zeitlang - wahrscheinlich ist es auch jetzt noch der Fall - dann viel gesehen, wenn man für kaufmännisch Anzustellende oder ähnliche Leute Schreibunterricht gegeben hat. Ich habe zum Beispiel einmal beobachtet, wie ein solcher Schreibunterricht für kaufmännische Angestellte so erteilt worden ist, daß die Betreffenden jeden Buchstaben aus einer Art Kurve heraus entwickeln mußten. Sie mußten Schwingen lernen mit der Hand, dann das Schwingen zu Papier bringen, so daß alles in der Hand, in den Gliedern ist, und man eigentlich mit nichts anderem als mit der Hand dabei ist beim Schreiben. Eine andere Art, zu schreiben, ist die nichtegoistische, die selbstlose Art des Schreibens. Sie besteht darin, daß man eigentlich nicht mit der Hand, sondern mit dem Auge schreibt, also immer hinschaut und im Grunde genommen den Buchstaben zeichnet, so daß das im geringen Maße in Betracht kommt, was in der Gliederung der Hand liegt, daß man eigentlich ebenso verfährt wie beim Zeichnen, wo man also nicht eine Handschrift hat, deren Sklave man ist, sondern wo man nach und nach Mühe hat, selbst seinen Namen noch ebenso zu schreiben, wie man ihn sonst geschrieben hat. Den meisten Menschen ist es ja so furchtbar leicht, ihren Namen so zu schreiben, wie man ihn sonst geschrieben hat. Er kommt ihnen aus der Hand. Aber die Menschen, die etwas Künstlerisches in die Schrift hineinlegen, die schreiben mit dem Auge. Sie verfolgen die Strichführung mit dem Auge. Da sondert sich in der Tat die Schrift ab vom Menschen. Da kann dann der Mensch - obwohl es nicht wünschenswert ist in einer gewissen Beziehung, das zu praktizieren - Schriften nachahmen, in verschiedener Weise Schriften variieren. Ich sage nicht, daß man das besonders praktizieren soll, aber ich sage, daß es als ein Extrem herauskommt, wenn man die Schrift malt. Das ist das selbstlosere Schreiben. Das Schreiben heraus aus den Gliedern dagegen ist das selbstische, das egoistische.
Auch die Sprache ist bei den meisten Menschen egoistisch. Sie kommt einfach aus den Sprachorganen heraus. Sie können sich aber allmählich angewöhnen, Ihre Sprache so zu empfinden, als wenn sie eigentlich um Sie herumhauchte, als wenn die Worte um Sie herumflögen. Sie können wirklich eine Art Empfindung von Ihren Worten haben. Da sondert sich das Sprechen vom Menschen ab. Es wird objektiv. Der Mensch hört sich ganz instinktiv selber sprechen. Es wird gleichsam im Sprechen sein Kopf größer, und man fühlt um sich herum das Weben der Laute und der Worte. Man lernt allmählich hinhören auf die Laute, auf die Worte. Und das kann man eben gerade durch solche Übungen erreichen. Dadurch aber wird dann in der Tat nicht bloß hineingebrüllt in einen Raum - ich meine mit Brüllen jetzt nicht bloß laut schreien; man kann auch lispelnd brüllen, wenn man nur für sich selber eigentlich redet, so wie es aus den Sprachorganen herauskommt-, sondern man lebt im Sprechen wirklich mit dem Raum. Man fühlt gewissermaßen im Raume die Resonanz. Das ist bei gewissen Sprach-theorien - Sprachlehr- oder Sprachlerntheorien, wenn Sie wollen - in der neueren Zeit zum stammelnden Unfug geworden, indem man die Leute mit Körperresonanzen sprechen läßt, Bauchresonanzen, Nasen-resonanzen und so weiter. Alle diese inneren Resonanzen sind aber eine Untugend. Eine wirkliche Resonanz kann nur eine erlebte sein. Die fühlt man aber dann nicht etwa in dem Anstoßen des Lautes ans Innere der Nase, sondern die fühlt man erst vor der Nase, außen. So daß tatsächlich die Sprache etwas bekommt vom Vollen. Voll werden soll überhaupt die Sprache des Redners. Der Redner soll möglichst wenig verschlucken.
Glauben Sie nicht, daß dies für den Redner unbedeutend ist, sondern es ist höchst bedeutend für den Redner. Denn ob wir in der richtigen Weise etwas an die Menschen heranbringen, das hängt durchaus davon ab, wie wir in der Lage sind, uns zur Sprache selbst zu verhalten. Man braucht ja nicht gleich soweit zu gehen wie ein mir einst befreundeter Schauspieler, der niemals Freundrl sagte, sondern immer Freunderl, weil er sich in jede Silbe hineinlegen wollte. Das tat er bis zum Extrem. Aber man soll schon die instinktive Begabung entwickeln, nicht Silben, nicht Silbenformen, nicht Silbengestaltungen zu verschlucken.
Das kann man, wenn man versucht, in rhythmische Sprache sich so hineinzufinden, daß man sie sich vorsagt mit einem Hineinlegen in die ganze Lautgestaltung:
Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. . .
Also: sich hineinlegen nicht nur in den Laut als solchen, sondern auch in die Lautgestaltung, in dieses Runden und Eckigen des Lautes.
Wenn jemand glaubt, er könne ein Redner werden, ohne auf dieses Wert zu legen, so lebt er in demselben Irrtum wie eine Menschenseele, die zwischen Tod und neuer Geburt an dem Punkte angekommen ist, auf die Erde herunterzusteigen und die sich nicht verleiblichen will, weil sie nicht eingehen will auf Gestaltungen des Magens, der Lunge, der Niere und so weiter. Es handelt sich durchaus darum, daß zum Reden alles herangezogen werden muß, was die Rede tatsächlich fertig gestaltet.
Man soll also auf den Organismus der Sprache und ihren Genius immerhin Wert legen. Man soll nicht vergessen, daß dieses Wertlegen auf den Organismus der Sprache, auf den Genius der Sprache bild-schöpferisch ist. Wer sich nicht innerlich hörend mit der Sprache beschäftigt, dem kommen nicht Bilder, dem kommen nicht Gedanken, der bleibt ungelenk im Denken, und er wird ein Abstraktling im Sprechen, wenn nicht gar ein Pedant. Gerade an dem Erleben des Lautlichen, des Bildhaften in der Sprachformung selbst liegt etwas, was herauslockt aus unserer Seele auch die Gedanken, die wir brauchen, um sie vor die Zuhörer hinzutragen. Es liegt eben in dem Erleben des Wortes etwas Schöpferisches mit Bezug auf den inneren Menschen. Das sollte niemals außer acht gelassen werden. Das ist außerordentlich wichtig. Es sollte uns überhaupt durchaus die Empfindung beherrschen, wie das Wort, die Wortfolge, die Wortgestaltung, die Satz-gestaltung, wie diese zusammenhängen mit unserer ganzen Organisation. Geradeso wie man aus der Physiognomie den Menschen gewissermaßen erraten kann, so kann man natürlich erst recht - ich meine jetzt nicht aus dem, was er uns sagt, sondern aus dem Wie der Sprache -den ganzen Menschen erfühlen aus dem Wie der Sprache.
Aber dieses Wie der Sprache kommt aus dem ganzen Menschen heraus. Und es handelt sich durchaus auch darum, daß wir, in leichter Weise natürlich, nicht indem wir uns so behandeln wie einen Patienten, sondern in leichter Weise, auch den physischen Leib ins Auge fassen. Es ist zum Beispiel für jemanden, der durch Erziehung oder vielleicht sogar durch Vererbung dazu veranlagt ist, pedantisch zu sprechen, gut, wenn er versucht, durch anregenden Tee, den er ab und zu zu sich nimmt, sich die Pedanterie abzugewöhnen. Diese Dinge müssen, wie gesagt, vorsichtig gemacht werden. Für den einen ist dieser Tee, für den anderen ein anderer Tee gut. Der gewöhnliche Tee, der ist ja, wie ich öfter erwähnt habe, eine sehr gute Diplomatenkost: weil die Diplomaten geistreich sein müssen, das heißt, unzusammenhängend eins hinter dem anderen plappern müssen, und das darf nur ja nicht pedantisch sein, sondern das muß die Leichtigkeit des Übergangs von einem Satz zum anderen aufweisen. Daher ist schon der Tee das Diplomaten-getränk. Der Kaffee aber, der macht logisch. Daher schreiben Journalisten ihre Artikel, weil sie gewöhnlich von Natur aus nicht sehr logisch sind, sehr häufig in Kaffeehäusern. Jetzt, seit der Schreibmaschinenzeit, sind ja die Dinge etwas anders; aber früher konnte man in ganzen Trupps Journalisten in Kaffeehäusern antreffen, an der Schreib-feder knuspernd und Kaffee trinkend, damit ein Gedanke nun wirklich auch an den anderen sich anreihen konnte. Also, wenn man findet, daß man zuviel von dem Teeartigen hat, dann ist der Kaffee etwas, das ausgleichend wirken kann. Aber wie gesagt, das alles ist eben nicht ganz arzneimäßig gemeint, aber doch in der Richtung liegend. Und wenn zum Beispiel jemand veranlagt ist, irgendwelche störenden Laute in die Rede hineinzumischen - sagen wir, wenn jemand «he» sagt nach jeder dritten Silbe oder dergleichen, dann rate ich ihm, etwas schwachen Sennesblättertee zweimal in der Woche abends zu trinken, und er wird sehen, was das für eine günstige Wirkung ausübt.
Es ist schon so: Da die Dinge, die in der Rede, in der Sprache zum Ausdruck kommen, aus dem ganzen Menschen kommen müssen, darf da durchaus nicht die Diät vernachlässigt werden. Es ist das nicht bloß im groben der Fall. Natürlich hört man es der Rede an, wenn sie von einem Menschen kommt, der endlose Mengen Bier durch seine
Kehle hat strömen lassen, oder dergleichen. Das ist im groben der Fall. Wer ein Ohr hat für das Sprechen, der weiß ganz gut, ob irgendein Sprecher ein Teetrinker oder ein Kaffeetrinker ist, ob er an Obstipationen oder am Gegenteil leidet. In der Sprache drückt sich alles mit einer absoluten Sicherheit aus, und auf all das muß durchaus Rücksicht genommen werden. Man wird allmählich instinktiv sich auf diese Dinge einlassen, wenn man so, wie ich es sagte, die Sprache in der Umgebung fühlt.
Allerdings, die verschiedenen Sprachen neigen in verschiedener Art, in verschiedenem Grade dazu, so in der Umgebung gehört zu werden. Eine Sprache wie die lateinische, die eignet sich besonders dazu, gehört zu werden. Das Italienische auch. Ich meine jetzt, vom Sprecher selbst als objektiv gehört zu werden. Wenig eignet sich zum Beispiel die englische Sprache dazu, weil diese als Sprache sehr ähnlich ist dem Schreiben, das aus den Gliedern heraus fließt. Je abstrakter die Sprachen werden, desto weniger eignen sie sich dazu, innerlich gehört zu werden, objektiv zu werden. Wie tönt noch in älteren Zeiten das deutsche
Nibelungenlied:
Uns ist in alten maeren wunders vil geseit
von heleden lobebaeren, von grôzer arebeit;
von freude unt hôchgezîten, von weinen unde klagen,
von küener recken strîten müget ir nu wunder hoeren sagen.
Ez wuohs in Buregonden ein vil edel magedin,
daz in allen landen niht schoeners mohte sin,
Kriemhilt geheizen; diu wart ein schoene wîp,
Dar umbe muosen dëgene vil verliesen dën líp.
Das hört sich, indem man spricht! An solchen Dingen muß man lernen, die Sprache zu empfinden. Natürlich, es werden die Sprachen im Laufe ihrer Entwickelung abstrakt. Man muß dann mehr von innen heraus das Konkrete hineinbringen, das Sinnenfällige hineinbringen. Abstrakt nebeneinandergestellt, was ist für ein Unterschied:
Uns ist in alten maeren wunders vil geseit
und
Uns wird in alten Märchen Wunderbares viel erzählt
und so weiter!
Es kann aber natürlich, wenn man sich an das Hören gewöhnt, dieses auch in die neuere Sprache hineingebracht werden, und da kann viel in der Sprache darauf hingewirkt werden, daß die Sprache wirklich etwas wird, was einen eigenen Genius hat. Aber es gehören eben solche Übungen dazu, um aufeinander einschnappen zu machen das Hören im Geiste und das Sprechen aus dem Geiste. Und da will ich denn noch einmal die eine Formel anführen:
Erfüllung geht
Durch Hoffnung
Geht durch Sehnen
Durch Wollen
Wollen weht
Im Webenden
Weht im Bebenden
Webt bebend
Webend bindend
Im Finden
Findend windend
Kündend.
Nur eben dadurch, daß man den einen Laut in verschiedene Zusammenhänge hineinstellt, kommt man zum Empfinden des Lautes, zur Metamorphose des Lautes und zum Anschauen des Wortes, zum Schauen des Wortes.
Wenn sich dann so etwas, wie ich es heute dargestellt habe im Dispositionenmachen durch Schlagsätze, als unsere innerlich seelische Vorbereitung mit dem vereinigt, was wir in dieser Weise aus der Sprache heraus gewinnen, dann geht es eben zu dem Reden hin.
Eines braucht man noch zu dem Reden außer all den Dingen, die ich schon erwähnt habe: Verantwortlichkeit! Das heißt, man soll fühlen, daß man kein Recht hat, alle seine Sprachungezogenheiten auskramen
zu dürfen vor einem Publikum. Man soll fühlen lernen, daß man zum öffentlichen Auftreten Spracherziehung, ein Herausgehen aus sich selbst und ein Plastizieren in bezug auf die Sprache eben schon nötig hat. Verantwortlichkeit gegenüber der Sprache! Es ist ja bequem, dabei stehenzubleiben, zu sprechen, wie man eben spricht, und zu verschlucken, wieviel man gewohnt ist, zu verschlucken, zu quetschen und biegen und brechen und drücken und dehnen die Worte, wie es einem bequem ist. Aber man darf eben bei diesem Quetschen und Drücken und Dehnen und Ecken und Ähnlichem nicht stehenbleiben, sondern muß versuchen, auch in diesem Formalen seinem Reden zu Hilfe zu kommen. Man wird eben einfach, wenn man in dieser Weise seinem Reden zu Hilfe kommt, auch dazu geführt, mit einem gewissen Respekt vor dem Publikum zu sprechen, mit einer gewissen Scheu an das Sprechen heranzugehen, mit Respekt vor dem Publikum zu sprechen. Und das ist durchaus nötig. Das kann man, wenn man das Seelische auf der einen Seite ausarbeitet, und das mehr Physische, das ich heute im zweiten Teil der Auseinandersetzung gegeben habe, auf der anderen Seite. Auch wenn man nur Gelegenheitsreden zu halten hat, so kommen durchaus derlei Dinge stark in Betracht.
Sagen wir zum Beispiel, man hat den Bau, das Goetheanum, zu erörtern. Dann sollte man im Grunde genommen, weil man natürlich nicht zu jeder Erörterung eine Extravorbereitung machen kann, sich wenigstens zweimal in der Woche zu der entsprechenden Rede entsprechend vorbereiten, wie ich es auseinandergesetzt habe. Man sollte eigentlich nur aus dem Stegreif reden, wenn man gewissermaßen das Vorbereiten als eine ständige Übung übt.
Dann wird man auch finden, wie sich, ich möchte sagen, das Formale mit dem Inhaltlichen verbindet. Und gerade über diesen Punkt werden wir dann morgen nochmals zu sprechen haben: über die Verbindung der formalen Praxis mit der seelischen Praxis.
Der Kurs ist ja leider kurz; man kann kaum über die Einleitung hinauskommen. Aber ich würde es unverantwortlich finden, gerade dasjenige nicht gesagt zu haben, was ich im Verlaufe dieser Vorträge gesagt habe.
SECHSTER VORTRAG Dornach, 16. Oktober 1921
Da wir heute unsere letzte Stunde haben müssen, wird es sich darum handeln, daß wir einige Ergänzungen und Erweiterungen zu dem Gesagten vorbringen, und Sie müssen das schon so hinnehmen, wie wenn eben einiges zuletzt gewissermaßen im Ramschausverkauf noch vorgebracht würde.
Zunächst möchte ich vor allen Dingen bemerken, daß man immer berücksichtigen muß, daß der Redner in einer wesentlich anderen Lage ist als derjenige, der irgend etwas Schriftliches von sich gibt gegenüber dem Leser. Der Redner hat Rücksicht darauf zu nehmen, daß er eben nicht einen Leser vor sich hat, sondern einen Zuhörer. Der Zuhörer ist nicht in der Lage, wenn er irgend etwas nicht verstanden hat, zurückzukehren und den Satz noch einmal zu lesen. Dazu ist ja der Leser in der Lage, und darauf hat man Rücksicht zu nehmen. Man wird das dadurch erreichen, daß man in der Rede sich bemüht, in Wiederholung manches vorzubringen, was man für ganz besonders wichtig, ja für unerläßlich hält, um mit dem Ganzen mitzukommen. Man wird natürlich darauf sehen müssen, daß solche Wiederholungen in Variierungen gegeben werden, daß man also besonders wichtige Dinge in verschiedenen Wendungen vorbringt, und daß durch die Verschiedenheit der Wendungen der Zuhörer zu gleicher Zeit, wenn er leichte Auffassungsgabe hat, doch nicht ermüdet werde. Man wird also darauf zu sehen haben, daß gewissermaßen verschiedene Wendungen für ein und dieselbe Sache eine Art künstlerischen Charakter tragen.
Das Künstlerische der Rede ist überhaupt etwas, das durchaus berücksichtigt werden muß, und zwar vielleicht gerade um so mehr, je mehr man es zu tun hat mit etwas, das auf Logik, auf Lebenserfahrung, auf andere Verständniskräfte Rücksicht nehmen muß. Vielleicht muß man um so mehr künstlerisch in der Rede verfahren durch solche Wiederholung, durch die Komposition und noch durch manches andere, was heute zu erwähnen sein wird, je mehr man durch ein straffes Anspannen des Denkens an das Verständnis appellieren muß. Man muß nur
bedenken, daß das Künstlerische eben ein Mittel des Verständnisses abgibt. Wiederholungen an sich zum Beispiel, sie wirken ja so, daß sie gewissermaßen eine Art Erleichterung für den Zuhörer bilden. Man gibt dem Zuhörer Gelegenheit, wenn er Wiederholungen in verschiedenen Wendungen hört, gewissermaßen nicht straff sich zu halten an die eine Wendung oder an die andere Wendung, sondern an dasjenige, was dazwischen liegt. Dadurch wird er im Auffassen befreit und er hat dann dieses Gefühl der Befreiung, und das ist etwas, was außerordentlich zum Verständnis beiträgt.
Aber auch andere Mittel des künstlerischen Aufbaues nicht nur, sondern der künstlerischen Durchführung sollen angewendet werden. Nehmen wir zum Beispiel dies, daß der Redner von Zeit zu Zeit, indem er die nötige Einkleidung dafür sucht, Fragen anbringt, so daß er also eigentlich zwischen den gewöhnlichen Erörterungen in einer Frage zu seinen Zuhörern spricht. Was heißt es eigentlich, zu seinen Zuhörern in einer Frage zu sprechen? Ja, Fragen, die der Zuhörer sich anhört, die wirken eigentlich hauptsächlich auf die Einatmung des Zuhörers. Der Zuhörer lebt ja während des Zuhörens in Einatmung-Aus-atmung, Einatmung-Ausatmung. Das ist nicht bloß für das Sprechen von Bedeutung, das ist durchaus auch von Bedeutung für das Zuhören. Bringt einer nun als Redner eine Frage vor, dann kann das Ausatmen gewissermaßen unbeschäftigt bleiben. Das Einatmen ist dasjenige, was sich auf das Zuhören verlegt beim Anhören einer Frage. Das widerspricht nicht dem, daß der Redner etwa gerade, wenn der Hörer aus-atmet, seine Frage vorbringt. Es wird nämlich nicht nur gerade zugehört, sondern auch schief, so daß das eigentliche Hören eines Wortes oder eines Satzes, der hineinfällt in eine Ausatmung, wenn er eine Frage ist, eigentlich erst recht perzipiert, aufgenommen wird bei der nachfolgenden Einatmung. Kurz, das Einatmen überhaupt hat etwas Wesentliches zu tun mit dem Anhören des in Frageform Vorgebrachten. Dadurch aber, daß das Einatmen engagiert wird durch das Aufwerfen einer Frage, wird der ganze Prozeß des Zuhörens verinnerlicht. Er geht gewissermaßen tiefer in der Seele vor sich, als wenn man nur einfach einer Erörterung zuhört.
Wenn man einer Erörterung zuhört, dann hat man eigentlich immer
die Tendenz, weder mit der Einatmung noch mit der Ausatmung sich zu engagieren. Die Erörterung möchte eigentlich möglichst wenig tief gehen, aber eigentlich auch nicht die Sinnesorgane viel beschäftigen.
Das Erörtern logischer Dinge durch die mündliche Rede ist überhaupt eine mißliche Sache. Wer daher so reden will, daß er etwa bloß in Schlußfolgerungen spricht, der wird dadurch ein gutes Mittel in der Hand haben, um seine Zuhörer einzuschläfern. Denn dieses logische Entwickeln, das hat den Nachteil, daß es das Verständnis vom Gehörorgan wegschafft, man hört nicht ordentlich dem Logischen zu, und auf der anderen Seite, daß es wiederum das Atmen nicht eigentlich gestaltet, nicht in variierte Wellen versetzt. Der Atem bleibt eigentlich am neutralsten, wenn man logische Erörterungen anhört; daher schläft man dabei ein. Es ist das ein ganz organischer Prozeß. Logische Erörterungen wollen unpersönlich sein; aber das rächt sich.
Daher wird man, wenn man sich zum Redner entwickeln will, darauf Rücksicht nehmen müssen, daß man womöglich, trotzdem man logisch bleibt, nicht bloß in logischen Formeln spricht, sondern eben in Redefiguren. Und zu den Redefiguren gehört eben die Frage. Zu den Redefiguren gehört es auch, daß man zuweilen das Gegenteil von dem sagt, was man - es ist ein extremer Fall - eigentlich sagen will, trotzdem der Zuhörer natürlich sehr gut weiß, daß er das Gegenteil zu verstehen habe, indem man den Satz eben so einkleidet, daß man das Gegenteil sagen darf. Wenn also, sagen wir, jemand einfach erörtert und auch im Erörterungston sagen würde: Der Kully ist dumm -, so wäre das unter Umständen keine sehr gute Redewendung. Dagegen könnte es eine gute Redewendung sein, wenn jemand sagt: Ich glaube nicht, daß jemand hier sitzt, der die Meinung hat: der Kully ist gescheit! - Da haben Sie den Satz ausgesprochen, von dem das Gegenteil die Wahrheit ist. Aber Sie haben natürlich auch etwas dazu getan, um nicht den Satz der geraden Erörterung, sondern das Gegenteil aussprechen zu dürfen. Also in dieser Weise vorzugehen, aber auch das mit innerer Empfindung zu tun, wird der Rede ganz besonders gut auf die Beine helfen können.
Ich habe eben gesagt: Es wird der Rede ganz besonders gut auf die Beine helfen können. - So etwas ist ein Bild. Der Philister kann sagen,
eine Rede habe doch keine Beine. Aber eine Rede hat eben doch Beine! Man braucht nur zum Beispiel sich zu erinnern, daß Goethe im hohen Alter, als er manchmal schon in der Müdigkeit sprechen mußte, gern sprach herumgehend im Zimmer. Die Rede ist im Grunde genommen der Ausdruck für den ganzen Menschen, sie hat also doch Beine! Und den Zuhörer zu frappieren durch so etwas, was er vielleicht bisher nicht gewahr geworden ist, aber was aufzufassen er gegen seine Gewohnheit genötigt ist, das ist wiederum für die Rede außerordentlich wichtig.
Zur Gefühlslogik für die Rede gehört auch, daß man nicht immer in demselben Tone spricht. Immer in demselben Ton fortsprechen, das wissen Sie ja, schläfert auch ein. Denn jede Erhöhung des Tons ist eigentlich ein ganz leiser Alpdruck, so daß der Zuhörer durch jede Erhöhung des Tons innerlich etwas aufgerüttelt wird. Jede Senkung des Tons im Verhältnis zur Höhe ist eigentlich eine leise Ohnmacht, so daß der Zuhörer genötigt ist, dagegen anzukämpfen. Man veranlaßt also durch Modulieren der Rede den Zuhörer, mitzuarbeiten, und das ist für den Redner schon außerordentlich wichtig.
Besonders bedeutsam aber ist es auch, zuweilen gewissermaßen an das Ohr des Zuhörers zu appellieren. Wenn er gar zu sehr in sich versunken zuhört, dann geht er manchmal mit gewissen Passagen der Rede nicht mit. Er fängt an, für sich nachzudenken. Das ist für den Redner ein großes Unglück, wenn die Zuhörer anfangen, für sich nachzudenken. Dann hören sie etwas nicht, fangen nach einiger Zeit wieder an zu hören und kommen eben nicht mit. Daher muß man die Zuhörer zuweilen beim Ohr nehmen, und das geschieht dadurch, daß man in seinen Redewendungen ungewohnte Satzfolgen und Wortfolgen anwendet. Die Frage gibt ja an sich schon eine andere Stellung von Subjekt und Prädikat, als man gewohnt ist, aber man sollte auch die Änderung der Wortfolge in der verschiedensten Weise handhaben. Man sollte darauf achten, daß manche Sätze so gesprochen werden, daß das Verbum am Beginne des Satzes steht, oder aber, daß man einen Satz mit irgendeinem anderen Redeteil beginnt, von dem man sonst nicht gewohnt ist, daß er im Beginne steht. Da kommt etwas Ungewohntes, da paßt er wieder auf, und das Merkwürdige ist, er paßt dann nicht bloß auf diesen Satz auf, sondern auch noch auf den nächstfolgenden.
Und wenn man es mit ganz besonders zahmen Zuhörern zu tun hat, passen sie dann sogar noch auf den zweitnächsten auf, wenn man seine Redeteilgliederung etwas verschränkt. Man muß als Redner diese innere Gesetzmäßigkeit durchaus beachten. Man lernt eigentlich diese Dinge am besten, wenn man einmal im Zuhören die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, wie wirklich gute Redner solche Dinge gebrauchen. Solche Dinge sind es auch, die im wesentlichen zum Bildlichen der Rede führen.
Fürs Reden könnte man in dieser Beziehung, in formaler Beziehung, sehr viel von den Jesuiten lernen. Die werden sehr gut geschult. Sie gebrauchen erstens gut das Komponieren der Rede, indem sie auf Steigerungen und auf Gefälle hin wirken, aber sie gebrauchen vor allen Dingen das Bild. Und ich muß immer wieder auf eine ausgezeichnete Jesuitenrede hinweisen, die ich einmal in Wien anhören konnte, wo mich jemand in die Jesuitenkirche führte, und gerade einer der berühmtesten Jesuitenpatres predigte. Er predigte über die österliche Beichte, und ich will Ihnen den wesentlichen Teil seiner Predigt hier mitteilen. Er sagte: Liebe Christen! Da gibt es von Gott Abtrünnige, die behaupten, die österliche Beichte sei vom Papst, vom römischen Papst eingesetzt. Sie stamme also nicht von Gott, sondern sie stamme vom römischen Papst. Liebe Christen, wer das glaubt, der könnte etwas lernen, wenn ich ihm das Folgende sage: Stellt euch vor, meine lieben Christen, hier stehe eine Kanone. An der Kanone stehe ein Kanonier. Der Kanonier hat die Zündschnur in der Hand. Die Kanone ist geladen. Hinten steht der Offizier und kommandiert. Wenn der Offizier kommandiert: Feuer! - zieht der Kanonier die Zündschnur. Die Kanone geht los. Wird jetzt ein einziger von euch sagen:
Dieser Kanonier, der auf den Befehl seines Vorgesetzten gehört hat, er habe das Pulver erfunden? Niemand von euch, liebe Christen, wird das sagen! Seht ihr, ein solcher Kanonier war der römische Papst, der auf Befehl von oben wartete, bis er die österliche Beichte befahl. Daher wird niemand sagen - geradesowenig wie: Der Kanonier habe das Pulver erfunden -, der römische Papst habe die österliche Beichte erfunden, die er nur ausführen läßt auf das Kommando von oben. -Alle von den Zuhörern waren niedergeschmettert, überzeugt!
Selbstverständlich kannte der Mann die Situation und die Verfassung der Gemüter, aber das ist ja auch etwas, was als eine unerläßliche Vorbedingung für ein gutes Reden in dieser Betrachtung hier schon charakterisiert worden ist. Er sagte etwas, was als Bild ganz eigentlich aus dem Gedankengang hinwegfällt und dennoch den Zuhörer den Gedankengang vollziehen läßt, ohne daß der Zuhörer das Gefühl hat, der Mann rede subjektiv. Ich habe Ihnen auch das Diktum von Bismarck vorgebracht über das Steuern nach dem Winde bei den Politikern, ein Bild, das sogar entnommen ist dem anderen, mit dem er debattierte, das aber wiederum frei macht von der Strenge des erörterten Gedankenganges.
Solche Dinge, wenn sie richtig empfunden werden, sind diejenigen künstlerischen Mittel, die durchaus das ersetzen werden, was eben in einer Rede nicht sein darf: bloße Logik. Logik ist für die Gedanken, ist nicht für das Reden, ich meine jetzt für die Form der Rede, die Ausdrucksweise. Natürlich darf nicht Unlogik drinnen sein. Aber es darf nicht eine Rede so kombiniert werden, wie man eben einen Gedankengang kombiniert. Sie werden auch finden, daß irgend etwas ganz spitzig und gut angebracht sein kann in der Debatte und dennoch eigentlich nicht dauernd zu wirken braucht. Dauernd wirkt, was in die Rede als Bild eingreift, namentlich dann, wenn es als Bild ziemlich fern steht dem, was es bedeutet, und wenn derjenige, der das Bild handhabt, selbst frei geworden ist von dem sklavischen Anlehnen an den reinen Gedankensinn.
So etwas führt dann dazu, zu erkennen, inwiefern eine Rede durch Humor gehoben werden kann. Die tiefernste Rede kann durch einen Humor, der, sagen wir, zum Beispiel Pfeile hat, gehoben werden. Es ist eben so: Wenn wir zwangsmäßig, wie ich gesagt habe, Willen hinein-gießen wollen in die Zuhörer, dann ärgern sie sich. Daher sollen wir das Willenshafte darauf verwenden, daß die Rede selber Bilder kriegt, die innerlich gewissermaßen Realitäten sind. Die Rede selbst soll Realität sein. Es wird Ihnen vielleicht faßbar sein, was ich sagen will, wenn ich Ihnen von zwei Debatten sage. Die zweite wird nicht eine reine Debatte sein, aber etwas, was gerade in der charakterisierenden Rede für die Bildverwendung instruktiv sein kann.
Sehen Sie, eine ganz subjektive Färbung bekommen oftmals gerade diejenigen Debattereden, die leicht witzig sein wollen. Das deutsche Parlament hatte ja eine Zeitlang in dem Abgeordneten Meyer einen solchen witzigen Debattenredner. Zum Beispiel war es einmal, daß die berühmte oder berüchtigte «Lex Heinze» in diesem deutschen Parlament vertreten wurde. Ich glaube, der Mann, der die Verteidigungsrede hielt, war gerade Minister und sprach immer als Verteidiger, als Angehöriger der Konservativen Partei von «das Lex Heinze». Er sagte immer: Das Lex Heinze. Nun, nicht wahr, so etwas kann passieren. Aber es gehörte zu den Eigentümlichkeiten der Liberalen Partei, welcher der Spaßmacher, der Abgeordnete Meyer angehörte, sich gerade auf solche Dinge zu verlegen, und so ließ er sich denn hinterher in der Debatte zum Worte melden und sagte etwa folgendes: Der Herr Minister hat die Lex Heinze verteidigt und immer gesagt «Das Lex Heinze». Ich wußte gar nicht, wovon er eigentlich redet, ich ging überall herum und fragte, was das Lex ist. Niemand konnte mir Auskunft geben. Ich nahm Wörterbücher, suchte nach, fand nichts. Ich wollte schon hierher kommen, um den Herrn Minister zu fragen, da fiel mir zuletzt noch ein, die letzte Minute dazu zu benützen, auch eine lateinische Grammatik nachzuschlagen, und siehe da, da fand ich, da steht der Satz drinnen: Was man nicht deklinieren kann, das sieht man als ein Neutrum an!
Gewiß, für das augenblickliche Lachen ist es ein guter, derber Witz, aber er hat doch keine Pfeile, er braucht nicht tief zu zünden, weil bei so etwas sich doch in leiser Weise im Unterbewußtsein wiederum das Mitleid für den Betroffenen bei den Zuhörern geltend macht. Das ist also eine zu subjektive Art; sie kommt mehr aus der Spottlust als aus der Sache selbst.
Dagegen habe ich immer als ein vortreffliches Bild dieses gefunden:
Der spätere preußische König Friedrich Wilhelm IV. war als Kronprinz ein sehr geistreicher Mann. Sein Vater, der König Friedrich Wilhelm III., hatte einen ihm besonders lieben Minister, von Klewiz hieß er. Der Kronprinz konnte den von Klewiz nicht leiden. Einmal, beim Hofball, redete der Kronprinz den Klewiz an und sagte: Exzellenz, ich möchte Ihnen heute einmal ein Rätsel aufgeben:
Das erste ist eine Frucht auf dem Felde;
das zweite ist so etwas: wenn man es vernimmt,
bekommt man etwas wie einen leichten Schock;
und das Ganze ist eine Landplage!
Von Klewiz wurde rot bis weit über die Ohren, verbeugte sich und reichte nach diesem Hofball den Abschied ein. Der König ließ ihn kommen und sagte: Was fällt Ihnen denn ein! Ich kann Sie nicht entbehren, mein lieber Klewiz! - Ja, aber Königliche Hoheit, der Kronprinz haben mir gestern am Hofball etwas gesagt, demgegenüber ich nicht weiter im Amte bleiben kann. - Aber das ist ja nicht möglich! Seine Liebden, der Kronprinz wird doch so etwas nicht sagen, das kann ich nicht glauben. - Ja, es ist doch so, Majestät. - Was hat denn Seine Liebden, der Kronprinz gesagt? - Er hat zu mir gesagt:
Das erste ist eine Frucht auf dem Felde;
das zweite ist etwas: wenn man es vernimmt,
bekommt man so etwas wie einen leichten Schock;
das Ganze ist eine Landplage!
Es ist ja kein Zweifel, daß Königliche Hoheit der Kronprinz mich gemeint haben. - Ja, eine merkwürdige Sache, mein lieber Klewiz. Aber wir wollen doch den Kronprinzen kommen lassen und hören, wie sich die Sache verhält.
Der Kronprinz wird gerufen. - Euer Liebden sollen gestern Abend einen schwer beleidigenden Ausspruch gesagt haben gegenüber meinem unentbehrlichen Minister, Exzellenz von Klewiz. - Der Kronprinz sagte: Majestät, ich wüßte mich nicht zu erinnern. Wenn es etwas Erhebliches gewesen wäre, würde ich mich zu erinnern wissen. - Es schien doch etwas Erhebliches gewesen zu sein. - Ja, ja, ja, ich erinnere mich:
Ich habe zu Seiner Exzellenz gesagt, ich wolle ihm ein Rätsel aufgeben:
Die erste Silbe, das sei eine Frucht auf dem Felde;
die zweite Silbe bedeutet etwas, wenn man es vernimmt,
bekommt man so etwas wie einen leisen Schock;
das Ganze ist eine Landplage.
Ich denke, daß ich doch nicht dadurch Seine Exzellenz so sehr beleidigt
habe, daß Seine Exzellenz das Rätsel nicht lösen konnte. Ich erinnere mich, Exzellenz konnte einfach das Rätsel nicht lösen! - Der König sagte: Ja, was ist des Rätsels Lösung? - Nun ja:
Die erste Silbe, eine Frucht auf dem Felde ist: Heu
die zweite Silbe, wo man so einen leichten
Schock bekommt, ist: Schreck;
das Ganze ist: Heuschreck; -
das ist ja eine Landplage, Majestät.
Nun, warum sage ich das? Ich sage das aus dem Grunde, weil niemand, der so etwas erzählt, der auch seine Redewendungen in solch eine Form gießt, nötig hat, die Sache ganz zu Ende zu führen, denn kein Mensch erwartet, wenn man es erzählt, daß man das Tableau weiter erörtert, sondern jeder kann sich die entsprechende bildliche Vorstellung machen. Und es ist gut, zuweilen in der Rede zu bewerkstelligen, daß etwas übrig bleibt für den Zuhörer. Das bleibt nicht übrig, wenn jemand spottet, da geht der Bruch Null für Null auf.
Es handelt sich also darum, daß man die Anschaulichkeit auch dadurch hebt, daß der Zuhörer wirklich die Empfindung bekommt, er darf auch etwas tun, er darf weiterdenken. Dann aber hat man natürlich nötig, die nötigen Redepausen eintreten zu lassen. Diese Rede-pausen müssen durchaus auch da sein.
Nun, nach dieser Richtung hin wäre wirklich außerordentlich viel zu sagen über die Form, über die Gestaltung einer Rede. Denn gewöhnlich glaubt man, daß die Menschen bloß mit den Ohren zuhören, wogegen schon das spricht, daß manche, wenn sie etwas ganz besonders auffassen wollen, den Mund aufsperren beim Zuhören. Sie würden das nicht tun, wenn man bloß mit den Ohren zuhören würde. Man hört nämlich viel mehr mit den Sprachorganen zu, als gewöhnlich gerneint wird. Man schnappt gewissermaßen in die Rede des Redners immer ein gerade mit seinem Sprachorgan, und der ätherische Leib redet eigentlich immer mit, macht sogar immer Eurythmie mit, wenn zugehört wird, und zwar Bewegungen, die durchaus den eurythmischen Bewegungen entsprechen. Nur kennt sie der Mensch meistens nicht, wenn er nicht Eurythmie gelernt hat.
Es ist so, daß alles, was gehört wird von den unlebendigen Körpern, mehr von außen mit dem Ohr gehört wird, daß aber die Rede des Menschen eigentlich so gehört wird, daß beachtet wird, was von innen an das Ohr anschlägt. Das ist eine Tatsache, die, wie man sagen kann, die wenigsten Menschen wissen. Die wenigsten Menschen wissen, welch großer Unterschied besteht, sagen wir zwischen dem Anhören eines Glockengeläutes oder einer Symphonie, und dem Zuhören der menschlichen Rede. Bei der menschlichen Rede wird eben eigentlich das Innere am Sprechen gehört. Das andere ist viel mehr Begleiterscheinung, als es dies ist beim Anhören von irgend etwas Unorganischem. Deshalb mußte alles das gesagt werden, was ich sagte über das eigene Zuhören, damit man tatsächlich die Rede so formuliert, wie man sie kritisieren würde, wenn man sie hörte. Ich meine, daß das Formulieren aus derselben Kraft, aus demselben Impuls heraus kommt wie die Kritik, wenn man sie hört.
Es wird schon von einiger Wichtigkeit sein, daß die Persönlichkeiten, welche sich zur Aufgabe machen, etwas gerade für die Drei-gliederung des sozialen Organismus oder Ahnliches zu wirken, Rücksicht darauf nehmen, daß in einer gewissen Weise auch künstlerisch an das Publikum herangebracht werde, was man sagen will. Denn im Grunde spricht man heute - ich habe das schon angedeutet - doch zu ziemlich tauben Ohren, wenn man vor einem gewöhnlichen Publikum über die Dreigliederung des sozialen Organismus spricht. Und man wird schon müssen, ich möchte sagen, von einer gewissen Seite ganz in der Sache drinnen stehen, namentlich mit Gefühl und Empfindungen in der Sache drinnen stehen, wenn man so wirken will, daß es Aussicht auf Erfolg haben soll. Nicht als ob es nötig wäre, gewissermaßen die Geheimnisse des Erfolges zu studieren - das ist gewiß nicht nötig -und sich anzupassen in einer kleinlichen Weise an das, was der Zuhörer gern hört. Das ist ganz gewiß nicht dasjenige, was angestrebt werden darf. Aber angestrebt werden muß ein wirkliches Drinnenstehen in den Zeiterscheinungen. Und sehen Sie, ein solches Drinnen-stehen in den Zeiterscheinungen, ein Erregen des wirklich tieferen Interesses für die Zeiterscheinungen kann heute doch nur hervorgerufen werden durch Anthroposophie. Aus diesen und aus anderen Gründen
muß derjenige, der wirksam über Dreigliederung sprechen will, schon absolut wenigstens innerlich durchdrungen sein davon, daß notwendig ist für das Verständnis der Dreigliederung von seiten der Welt, auch die Anthroposophie an die Welt heranzubringen.
Gewiß, seit im Sinne der Dreigliederung gewirkt wird, ist ja die Sache so, daß auf der einen Seite diejenigen Menschen stehen, von denen man sagt, sie interessieren sich für Dreigliederung, wollen aber von Anthroposophie nichts wissen, und auf der anderen Seite diejenigen, die sich für Anthroposophie interessieren, und dann nichts von der Dreigliederung wissen wollen. Wenn man aber mit dieser Tatsache zu stark bei sich selbst rechnet, dann erreicht man doch nichts für die Dauer; für den Augenblick mag etwas erreicht werden, für die Dauer aber erreicht man doch nichts.
Insbesondere wird man wenig mit so etwas, was man für eine Taktik halten könnte, gerade in der Schweiz erreichen können, mit aus den Gründen, die ich ja schon mit Bezug gerade auf die Schweiz angegeben habe. Es wird sich schon darum handeln, daß wenigstens im Untergrunde des Redenden stark die Uberzeugung vorhanden sein muß, daß man ohne anthroposophische Grundlage der Dreigliederung nicht richtig auf die Beine helfen kann. Man kann natürlich das benutzen, daß manche Menschen die Dreigliederung entgegennehmen und die Anthroposophie abweisen; aber man sollte durchaus wissen -und wenn man es weiß, wird man schon die nötigen Wendungen in seine Rede hineinbringen -, daß ohne die Verbreitung wenigstens der elementarsten Dinge der Anthroposophie nichts dreigegliedert werden kann.
Was soll man denn eigentlich dreigliedern? Denken Sie sich nur einmal, in einem solchen Territorium, in dem, sagen wir, ein Staat auf der einen Seite ganz in seiner Hand hat das Schulwesen, auf der anderen Seite das Wirtschaftsleben, so daß zwischendurchgefallen ist das Rechtsleben - ja, denken Sie nur einmal, es könnte das Unwahrscheinliche eintreten, daß da nun dreigegliedert würde! Es würde ja auf dem Gebiet des Schulwesens, das nun selbständig wäre, wahrscheinlich in kürzester Zeit zu der Wahl eines Schulmonarchen und Schulministers geschritten werden, und das freie Geistesleben würde in kürzester Zeit in einen Staat verwandelt!
Solche Dinge lassen sich nicht formal nehmen, sie müssen in dem ganzen Lebendigen der Menschen ruhen. Es muß doch erst etwas da sein als freies Geistesleben, in dem die Menschen drinnenstehen, wenn man das Geistesleben auf sich selbst in dem sozialen Organismus stellen will. Nur dann, wenn das Geistesleben auch im anthroposophischen Sinne gehandhabt wird, wie zum Beispiel in der Freien Waldorfschule in Stuttgart, kann davon geredet sein, daß man da etwas hat, was ein kleiner Keim ist für ein freies Geistesleben. Aber in der Freien Waldorfschule hat man weder einen Rektor, noch hat man Lehrpläne, noch hat man irgend etwas anderes dieser Art, sondern das Leben ist da, und es ist durchaus Rücksicht genommen auf dasjenige, was man eben bedenken muß gegenüber dem Leben.
Ich bin ganz überzeugt davon, daß über ein ideales freies Schulwesen sich jeweilig drei, sieben, zwölf, dreizehn oder fünfzehn Menschen, die sich zusammensetzen, die allerallerschönsten Gedanken machen können, und ein Programm aufstellen können: Erstens, zweitens, drittens - viele Punkte. Dieses Programm könnte so sein, daß man sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen könnte. Die Leute, die dieses Pro-gramm ausdenken, brauchten nicht einmal besonders gescheit zu sein, könnten zum Beispiel durchaus Durchschnittsparlamentarier sein, brauchten nicht einmal solche zu sein, könnten Wirtshauspolitiker sein unter Umständen, und die könnten dreißig, vierzig Punkte herausfinden, die die höchsten Ideale erfüllen für ein tadelloses Schulwesen - aber anfangen kann man damit nichts! Es ist ganz unnötig, Paragraphen und Statuten in dieser Weise zu formen, wenn man damit nichts anfangen kann. Man kann nur etwas anfangen mit einem zusammengestellten Lehrerkollegium, wenn man gar nicht nach Statuten rechnet, sondern nach dem, was man halt eben hat, und daraus in aller Lebendigkeit das Beste macht.
Freies Geistesleben muß eben ein wirkliches Geistesleben sein. Wenn die Menschen heute von Geistesleben reden, reden sie gar nicht vom Geiste, reden sie von Ideen; sie reden ja nur immer von Ideen.
Also wenn schon Anthroposophie dazu da ist, in den Menschen wiederum die Empfindung von einem realen Geistesleben hervorzurufen, so kann sie nicht entbehrt werden, wenn man überhaupt die
Forderung der Dreigliederung des sozialen Organismus aufstellt. Also muß im Grunde genommen in einem gehen: Förderung der Anthroposophie, Förderung der Dreigliederung des sozialen Organismus.
Man sieht ja auch heute, wie wenig die Leute Empfindung haben für ein freies Geistesleben, daran, daß da oder dort Forderungen auftreten für ein vom Staate emanzipiertes Wirtschaftsleben. Man denke sich einmal im Konkreten aus, was nun das für ein soziales Gebilde wäre, bei dem auf der einen Seite der Rechtsstaat ist, der aber die ganze Schulverfassung in sich hat, aus dem also eigentlich alles das hervorgehen soll, was an Weisheiten dann in den Wirtschaftszusammenhän-gen entwickelt wird, und auf der anderen Seite ein emanzipiertes Wirtschaftsleben! Wer im wahren Sinne für die Dreigliederung des sozialen Organismus ist, dem sollte es nur nie einfallen, etwa zu sagen: Da ist ja schon ein Stück von der Dreigliederung des sozialen Organismus, nämlich die Zweigliederung. - Viel besser ist der chaotische Einheitsstaat als eine irgendwie geartete Zweigliederung. Denn das ist das Wesen der Dreigliederung, daß sie eben eine Dreigliederung ist und nicht eine Zweigliederung.
Nun sagte ich: Man hätte zum Beispiel in Deutschland nach der Revolution, weil jeder etwas Neues erwartete, durchaus in verhältnismäßig kurzer Zeit einen Weg finden können für die Dreigliederung des sozialen Organismus; aber aus den Gründen, die Sie ja kennen, ist das eben nicht geworden. In der Schweiz war zunächst überhaupt eine solche äußere Veranlassung gar nicht da, absolut nicht da, kaum daß etwa die Diskrepanzen zwischen den drei schweizerischen Nationalitäten eine Empfindung von der Notwendigkeit der Dreigliederung hervorrufen. Aber diese sind ja im Grunde genommen so sehr wenig tief-gehend, trotzdem viel in ihrem Sinne geschrieben wird, daß auch dadurch keine gründliche Empfindung für die Dreigliederung des sozialen Organismus - ich meine jetzt natürlich nicht in drei Nationen, sondern in die drei in den «Kernpunkten» angeführten Glieder - hervorgerufen werden könnte. Deshalb wird es für die Schweiz schon notwendig sein, daß man immer bestrebt ist, den Horizont der Betrachtung zu erweitern, daß man die Schweiz eben so betrachtet, wie ich es vor ein paar Tagen getan habe: als eine Art Drehungsmittelpunkt für
die ganze Welt. Und diese Empfindung sollte man bei den Schweizern hervorrufen.
Ich war immer der Meinung, daß während der furchtbaren Welt-katastrophe das Wirksamste schon 1915 zur Erreichung des Friedens, wenn es scharf und tüchtig angefaßt worden wäre, von der Schweiz aus hätte geschehen können, so sonderbar es klingt. Aber das ist vorerst notwendig, daß eben der Blick des Schweizers auf den großen Welthorizont hingelenkt werde.
Dazu wird für den, der im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus reden will, vor allen Dingen notwendig sein - ja, sollte ich im Alltäglichen sprechen, so möchte ich sagen: die Wochenschrift «Das Goetheanum» nicht nur zu lesen, sondern auch zu studieren. Und wenn ich es nun ins Allgemeine wende, so würde ich sagen: Sich be-kümmern um alles, was auf dem großen Welthorizont heute vorgeht, ein Herz und einen Sinn haben dafür, daß, sagen wir, der Minister für Südafrika, Smuts, einen Teil der heutigen Weltwende damit ausgedrückt hat, daß er sagte: Die Weltinteressen wenden sich ab von der Nordsee und dem Atlantischen Ozean und bekommen ihren neuen Ausstrahlurigspunkt im Stillen Ozean. - Was nun eben so ein süd-afrikanischer Minister vom heutigen Schnitt denken kann, weist alles darauf hin, wo Niedergangskräfte, namentlich in bezug auf den europäischen Kontinent, zu suchen sind. Ich sage: Was ein Minister von solchem Schnitt sagen kann. Er kann ja nur vom wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus sprechen, weil nur der ihm naheliegt, weil er ja nur den versteht. Und wenn sich das realisiert, was solche Leute heute denken können, dann wird in der Tat Europa eine Art halbbarbarisches Bauernland. Die Tendenz geht durchaus dahin.
Man muß das in seiner Empfindung haben, sonst wird man heute wirklich nicht mit dem Duktus der Wahrheit seine Rede formen können. Man mag noch so viel politisieren, man wird ohne innere Wahrheit sprechen, und daher auch unwirksam sprechen, wenn man im Hintergrunde die Empfindung hat: Na, es ist immer gegangen; wenn es einmal eine Weile talab gegangen ist, ging es wiederum bergauf; so wird es auch jetzt nicht so gefährlich sein! - Es ist nicht so! Nur der kann empfinden, welches die richtigen Aufgangskräfte sind, der ganz
durchdrungen ist davon, wie in dem Angedeuteten für Europa eben nur Niedergangskräfte entfesselt werden. Es muß eben einfach die Empfindung heute leben bei dem richtigen Dreigliederer: In alldem, was sich heute als Weltgestaltung herausgebildet hat, lebt für Europa die Abenddämmerung. - Daher muß man frei werden von dem, was sich da herausgestaltet und muß aus ursprünglichen Quellen heraus, vor allen Dingen aus geistigen Quellen heraus, die Wüste wieder beleben, zu der Europa gemacht werden soll vom Westen und auch vom Osten. Es ist durchaus so, daß man hinzuhorchen hat auf so etwas, wie heute die «altbewährten Staatsmänner» reden, wie es zum Beispiel jetzt wiederum in Genf gehört worden ist. Wenn da ein Staatsmann etwa den Traum hinstellt von einem «Weltgerichtshof», in dem die Staatsmänner dann zum Heil der Völker ihre Weisheit loslassen, so sollte man immer das Gefühl haben und auch nicht zurückschrecken, dieses Gefühl hervorzurufen: daß diese Staatsmänner, die hier allein gemeint sind, den heutigen Zustand herbeigeführt haben und daß sie ihn verstärken werden, wenn es in ihrem Sinne weitergeht.
Aber die Menschen sind gerade heute insbesondere gedanken- und seelenmüde. Sie möchten eigentlich vermeiden, zu ursprünglichen Gedanken und Empfindungen zu kommen. Sie möchten immer nur fort-pflegen, was eben altbewährt ist. Sie möchten irgendwo unterkriechen. Sie wenden sich nicht zur Anthroposophie, weil es da nötig ist, daß man die Seele in Regsamkeit bringt, sondern sie wenden sich heute, insbesondere die Intellektuellen, in großen Scharen zur römisch-katholischen Kirche, weil da keine Anstrengung nötig ist. Da tut es der Pfarrer oder der Bischof, daß er die Seele durch den Tod hindurch-führt. Man denke doch nur, wie tief es eigentlich heute in den Menschen sitzt: Eltern haben einen Sohn, sie haben ihn gern; daher wollen sie seinen Lebensweg sichern. Da ist der Staat, da muß er unterkommen, denn da ist er ganz sicher untergebracht, da braucht er nicht selber den Lebenskampf zu führen. Da arbeitet er, so lange er kann; dann wird er pensioniert; also noch über seine Arbeit hinaus ist er gesichert. Wie soll man da diesen Staat nicht lieben, wenn er einem die Kinder versorgt!
Und auch die ringende Seele haben die Leute nicht besonders gern.
Die Seele soll von der Kirche so versorgt werden bis zum Tode hin, wie die Arbeit durch den Staat. Und wie der Staat den äußeren physischen Menschen pensioniert durch seine Macht, so soll die Kirche auch die Seele pensionieren, wenn der Mensch stirbt; sie soll für die Seele sorgen, soll ihr Pensionsgeld geben nach dem Tode. Das ist etwas, was so tief in den heutigen Menschen sitzt, was so sehr in jedem einzelnen sitzt. Aus Höflichkeit will ich nur sagen, daß es nicht etwa bloß für die Söhne gilt, sondern für die Töchter auch, denn die heiraten doch wiederum diejenigen am liebsten, nicht wahr, welche in dieser Weise versorgt sind. Also, dahinein sind schon die Menschen versessen: Nicht auf sich selbst bauen, sondern irgendwo eine mystische Macht haben, auf die gebaut werden kann. Der Staat ist ja auch, wie er heute besteht, eine mystische Macht. Oder ist nicht vieles dunkel in dem Staate? Ich denke, viel mehr ist da dunkel als selbst bei dem schlechtesten Mystiker.
Alle diese Dinge müssen eben als Empfindungen in uns sitzen, wenn wir uns solche Aufgaben stellen, wie Sie sie sich stellen wollen, und wie die sind, die eigentlich zum Abhalten dieses Kursus geführt haben. Ich kann zum Schlusse nur sagen: Ich mußte mich bei diesem Kursus mehr auf das Formale der Redekunst beschränken. Aber das Wesentliche ist doch dasjenige, was in Ihren Herzen sitzt an Enthusiasmus, an Hingegebensein an die Notwendigkeit jener Wirksamkeit, die vom Goetheanum in Dornach ausgehen kann. Und in demselben Maße, in dem diese Überzeugungskraft in wirklicher Wahrheit innerlich in Ihnen wächst, in demselben Maße wird sie auch nicht bloß in Ihnen überzeugende Kraft, sondern sie wird auch überzeugende Kraft für andere werden können. Denn, was braucht man? Wir brauchen heute nicht etwa bloß eine Lehre. Die kann noch so gut sein, aber sie kann in den Bibliotheken verschimmeln, sie kann in Worten von Wüstenpredigern da oder dort figurieren, wenn nicht dafür gesorgt wird, daß möglichst bald der Impuls der Dreigliederung mit allem, was dazugehört, in eine möglichst große Anzahl von Köpfen hineinkommt. In eine möglichst große Anzahl von Köpfen muß das hinein, was mit der Dreigliederung des sozialen Organismus zusammenhängt, denn dadurch nur läßt sich doch etwas erzielen, daß der eigentliche Nerv dieser Dreigliederungsbewegung in möglichst vielen Köpfen sitzt. Dann
wird dasjenige, was zur Verwirklichung führen soll, ja ganz von selber kommen.
Aber wir müssen eben versuchen, ins Große hineinzuwirken. Es ist durchaus, man möchte sagen, fast notwendig, daß so etwas wie die Wochenzeitung «Goetheanum» so intensiv wie möglich gerade in der Schweiz verbreitet wird. Das ist natürlich nur eines unter Mannigfaltigem. Denn solch eine Wochenschrift wird ja nicht immer nur in derselben Form wiederholen, was schon im Anfange gesagt wurde, und was ja jeder natürlich sich immer und immer wieder aneignen soll; aber es wird eine solche Wochenschrift genötigt sein, sich auch in die Zeit-bewegung hineinzustellen und in den verschiedensten Gebieten anzuwenden und auszugestalten, was im Sinne der Dreigliederung wirkt. Mitzuerleben, was so durch das «Goetheanum» fließt, das wird insbesondere notwendig sein für diejenigen, welche wirken wollen, so wie Sie es wollen, im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus.
Aber vor allen Dingen: Was wir brauchen, das ist Energie, Mut und Einsicht und Interesse für die großen Weltbegebenheiten! Nicht sich abkapseln von der Welt, nicht sich in enge Interessen hineinspinnen, sondern sich für alles, was heute auf der ganzen Erde vorgeht, interessieren. Das beflügelt auch unsere Worte, das wird uns zu einem richtigen Mitarbeiter machen auf dem Felde, das wir ja gesucht haben.
In diesem Sinne, meine lieben Freunde, möchte ich zu Ihnen gesprochen haben, und in diesem Sinne habe ich namentlich dasjenige zu dem in dieser Woche Gesprochenen noch heute, gewissermaßen als Ramschergänzung, hinzugefügt, was ich glaubte, hinzufügen zu müssen, da ja doch in einer solch kurzen Zeit nur außerordentlich Weniges gegeben werden kann.
Wenn Sie nun an Ihre Arbeit gehen, dann können Sie sicher sein, daß die Gedanken dessen, der in diesen acht Tagen zu Ihnen gesprochen hat, Sie begleiten werden. Und in einem solchen Zusammenwirken mag auch etwas liegen von einer Erkraftung des Impulses, der uns beseelen soll, wenn wir im richtigen Sinne, insbesondere in der Schweiz, wirken wollen.
Damit rufe ich Ihnen zu ein schönes «Glück auf», trotzdem ich Sie nicht in die Tiefen eines finsteren Schachtes hinunterschicken möchte,
sondern gerade dorthin, wo es hell ist, wo es luftig werden kann für die Entwickelung der Menschheit und dahin, wo Ihnen diese Helligkeit, diese Luftigkeit eine besondere Befriedigung gewähren kann, weil Sie es ja selbst sein müssen, die dieses Licht, diese frische Luft in einen Teil der Welt hineinbringen.
HINWEISE
Wie aus dem Rundbrief des «Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Orga-nismus» vom 1. Oktober 1921 hervorgeht, wurde Rudolf Steiner gebeten, diesen «Orientierungskurs» für Mitarbeiter der anthroposophischen und Dreigliederungsbewegung in der Schweiz zu halten. Es nahmen etwa 50 Zuhörer daran teil. Veranlassung dazu war ein entsprechender Kurs in Stuttgart im Februar gleichen Jahres, der in Buchform veröffentlicht ist unter dem Titel: «Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? - Ein Kursus für Redner« (Dornach 1968).
zu Seite
9 Dreigliederung: Siehe Rudolf Steiner: «Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft», erschienen 1919; Bibl.-Nr. 23, Gesamtausgabe Dornach 1961. «Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915-1921«, Bibl.-Nr. 24, Gesamtausgabe Dornach 1961.
12 Hermann von Helmholtz, 1821-1894, Physiologe und Physiker.
13 Philosophenkongreß in Bologna: 4. Internationaler Philosophie-Kongreß 1911. Rudolf Steiner hielt dort am 8. April 1911 den Vortrag «Die psychologischen Grundlagen und die erkenntnistheoretische Stellung der Theosophie«, abgedruckt in «Philosophie und Anthroposophie«, Gesammelte Aufsätze l904-l918, Gesamtausgabe Dornach 1965, Bibl.-Nr. 35.
16 die Pädagogik der Waldorfschule: Die «Freie Waldorfschule» wurde durch Rudolf Steiner im Herbst 1919 in Stuttgart als «Einheitliche Volks- und höhere Schule» begründet. Seither entstanden zahlreiche weitere Waldorf- oder Rudolf Steiner-Schulen in vielen Ländern der Erde. Siehe Rudolf Steiner: «Die pädagogische Grundlage und Zielsetzung der Waldorfichule», Dornach 1970, sowse die grundlegenden pädagogischen Vortragskurse: «Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Padagogsk«, Bibl. Nr. 293, «Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches», Bibl.-Nr. 294; «Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge«, Bibl.-Nr. 295, alle innerhalb der Gesamtausgabe erschienen.
17 Jean Paul Friedrich Richter, 1763-1825
20 Michael Bernays, 1834-1897.
Johann Wo lf gang Goethe, 1749-1832.
31 Ernst Curtius, 1814-1896, Archäologe und Geschichtsschreiber.
35 Aristoteles, 384-322 v. Chr.
36 William James, 1842-1910, amerikanischer Philosoph.
F. C. S. Schiller, 1864-1937. Vertreter des Pragmatismus in England, mit dem er den Humanismus verband.
36 Professor Mackenzie: J. S. Mackenzie, geb. 1860. Professor in Cardiff. »Lectures on Humanism«, London 1907.
37 Hans Vaihinger, 1852-1933, Philosoph. «Die Philosophie des Als ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus», 1911.
39 daß Goethe in Wirklichkeit gar nicht geboren ist: Siehe den Vortrag vom 8. Oktober 1921, im Bande «Anthroposophie als Kosmosophie», Gesamtausgabe Dornach 1971, Bibl.-Nr. 207.
40 Ernst Haeckel, 1834-1919, Zoologe.
Charles Darwin, 1809-1882, englischer Naturforscher.
«Goethe als Vater einer neuen Ästhetik», Vortrag vom 9. November 1888 in Wien. In «Methodische Grundlagen der Anthroposophie«, Gesammelte Aufsätze 1884-1901, Gesamtausgabe Dornach 1961, Bibl.-Nr. 30, und als Einzel-ausgabe.
47 als noch in Mitteleuropa gewirkt werden konnte: Im Jahre 1919 trat Rudolf Steiner vor allem in Baden-Württemberg in zahlreichen öffentlichen Vorträgen für den Gedanken der Dreigliederung des sozialen Organismus ein. Siehe Rudolf Steiner: «Neugestaltung des sozialen Organismus», Bibl.-Nr. 330, Gesamtausgabe Dornach 1963; »Gedankenfreiheit und soziale Kräfte», Bibl.-Nr. 333, Gesamtausgabe Dornach 1971. Siehe auch: «Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung» Heft 24/25 und 27/28: Rudolf Steiners öffentliches Wirken für die Dreigliederung des sozialen Organismus. Eine Chronik 1917-1919, zusammengestellt durch H. Wiesberger.
49 August Bebel, 1840-1913. Gründete 1869 mit Wilhelm Liebknecht die Sozialdemokratische Partei.
50 Franz Mehring, 1846-1919, sozialistischer Schriftsteller und Politiker. Begründer der marxistischen Literaturbetrachtung. «Die Lessing-Legende», 1893.
Erich Schmidt, 1853-1913, Literaturhistoriker. «Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften», 2 Bände, 1884-92.
Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781.
52 Arheiterbildungsschule: In den Jahren 1899-1904 unterrichtete Rudolf Steiner an der von Wilhelm Liebknecht begründeten Arheiterbildungsschule in Berlin. Siehe Rudolf Steiner: «Mein Lebensgang», Bibl.-Nr. 28, Gesamtausgabe Dorn-ach 1962, Kap. XXVIII. Siehe auch J. Mücke/A. A. Rudolph: «Erinnerungen an Rudolf Steiner und seine Wirksamkeit an der Arbeiterbildungsschule in Berlin 1899-1904», Basel 1955.
Immanuel Kant, 1724-1804.
56 F. Marlitt (Pseudonym für Eugenie John), 1825-1887, Unterhaltungsschrift stellerin.
57 Jakob Böhme, 1575-1624, Mystiker und Schuster in Görlitz.
57 Hans Sachs, 1494-1576, Meistersinger, Dichter und Schuhmacher in Nürnberg.
65 «Futurum» A.G., Ökonomische Gesellschaft zur Förderung wirtschaftlicher
und geistiger Werte, Dornach 1920-1924.
«Der Kommende Tag», Aktiengesellschaft zur Förderung wirtschaftlicher und
geistiger Werte in Stuttgart, 1920-1925.
Assoziative Unternehmen im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus.
«Die Kernpunkte der sozialen Frage»: Siehe Hinweis zu S. 9.
73 Oskar Blumenthal, 1852-1917, Lustspielautor, z. B. «Im weißen Rößl».
74 Albert Einstein, 1879-1955, Physiker.
Alexander Moszkowski, 1851-1934. «Einstein. Einblicke in seine Gedankenwelt», Hamburg und Berlin 1921.
77 Max Dessoir, 1867-1947, Philosoph.
79 in der letzten Nummer der «Drei gliederung»: »Dreigliederung des sozialen Organismus», Stuttgart 1919/20 ff.
Heinrich Rickert, 1833-1902, Politiker. Otto, Fürst von Bismarck, 1815-1898.
81 Vortrag in der Philosophischen Gesellschaft der Amsterdamer Universität: Am
1. März 1921 über «Philosophie und Anthroposophie«. Vorgesehen in Bibl.-Nr75 der Gesamtausgabe.
82 «Der Worte sind genug gewechselt»: «Faust», Vorspiel auf dem Theater.
89 in dem seminaristischen Kursus: «Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge.» Gesamtausgabe Dornach 1969, Bibl.-Nr. 295. Siehe auch Rudolf Steiner/Marie Steiner-von Sivers: «Methodik und Wesen der Sprach-gestaltung», Bibl.-Nr. 280, Gesamtausgabe Dornach 1964, und «Die Kunst der Rezitation und Deklamation», Bibl.-Nr. 281, Gesamtausgabe Dornach 1967.
98 Und es wallet.. .: Aus Schillers «Taucher».
102 das Goetheanum: Das in Holz erbaute erste Goetheanum in Dornach, welches in der Silvesternacht 1922 durch Brand zerstört wurde. Siehe Rudolf Steiner:
»Der Baugedanke des Goetheanum», ein Lichtbildervortrag mit 104 Abb., Bibl.-Nr. 290, Stuttgart 1958.
105 Maximilian Kully, 1878-1936, Pfarrer in Arlesheim.
109 «Lex Heinze»: Name eines Nachtragsgesetzes vom 25. Juni 1900 zum Deutschen Strafgesetzbuch. Siehe hierzu Rudolf Steiner: »Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887-1901», Bibl.-Nr. 31, Gesamtausgabe Dorn-ach 1966, S. 651ff.
Friedrich Wilhelm IV., 1795-1861, König von Preußen seit 1840. Friedrich Wilhelm III., 1770-1840.
109 von Klewiz: Wilhelm Anton von Klewiz, 1760-1838, von 1817-1824 preußischer Finanzminister.
111 Eurythmie: Die durch Rudolf Steiner inaugurierte neue Bewegungskunst. Siehe Rudolf Steiner: «Eurythmie, die Offenbarung der sprechenden Seele», Bibl.Nr. 277, Gesamtausgabe Dornach 1971; «Eurythmie als sichtbarer Gesang», Bibl.-Nr. 278, Gesamtausgabe Dornach 1956; «Eurythmie als sichtbare Sprache«, Bibl.-Nr. 279, Gesamtausgabe Dornach 1968.
114 in der «Freien Waldorfschule»: Siehe Hinweis zu S. 16.
116 «Das Goetheanum»: Die erste Nummer der Wochenschrift erschien im August
1921. Siehe Rudolf Steiner: «Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart», Gesammelte Aufsätze aus der Wochenschrift »Das Goetheanum» 1921-1925, Bibl.-Nr. 36, Gesamtausgabe Dornach 1961. Jan Smuts, 1870-1950, südafrikanischer Politiker. 1919-1924 und 1939-1948 Premierminister der Südafrikanischen Union.
Literatur
- Rudolf Steiner: Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst. Orientierungskurs für die öffentliche Wirksamkeit mit besonderem Hinblick auf die Schweiz., GA 339 (1984), ISBN 3-7274-3390-6 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |