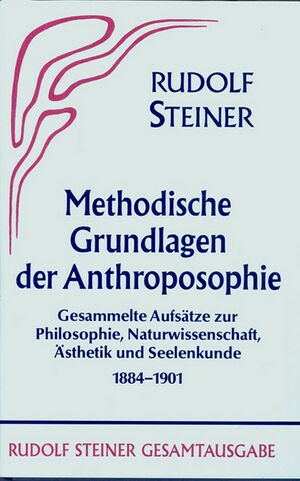Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 30
RUDOLF STEINER
SCHRIFTEN
GESAMMELTE AUFSÄTZE
METHODISCHE GRUNDLAGEN
DER ANTHROPOSOPHIE
1884-1901
ZUR PHILOSOPHIE, NATURWISSENSCHAFT,
ÄSTHETIK UND SEELENKUNDE
GA 30
1989
ZUR EINFÜHRUNG
Aus einem am 5. Juni 1920 in Dornach gehaltenen Vortrag
Wer wahr Sehen will und meine Schriften verfolgt, die ich im Anschlusse an Goethes Naturwissenschaftliche Werke vorn Beginne der achtziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts an geschrieben habe, der wird finden, daß dort zunächst der Geistesweg seiner Methode nach überall schon angedeutet ist, der dann, was selbstverständlich ist, im Laufe der Zeit - es sind jetzt vier Jahrzehnte seitdem verflossen - weiter ausgebaut worden ist. Man kann dasjenige, was jetzt Anthroposophie genannt wird, unterscheiden nach zwei Richtungen hin. Das eine ist die Art des Vorstellens, die Art des Suchens, des Forschens. Das andere ist das Inhaltliche, sind die Ergebnisse dieser Forschung, soweit sie bis heute haben ausgebildet werden können. Es wäre selbstverständlich kein gutes Zeugnis für dasjenige, was als anthroposophische Geisteswissenschaft unternommen worden ist, wenn man nach vier Jahrzehnten sagen müßte, es sei im Laufe der langen Zeit nichts erarbeitet worden, sondern man wiederholte heute nur immer dieselben Sachen, von denen in den Veröffentlichungen der achtziger Jahre gesprochen worden ist.
Aber wer die Richtung des Denkens, die Richtung des Forschens oder, wenn ich mich gelehrter ausdrücken will, die Methode ins Auge faßt, die hier in Betracht kommt, der wird finden, daß alles in Betracht Kommende in den achtziger Jahren bereits als Vorstufe ausgesprochen worden ist, ich möchte sagen, daß der Grundnerv desjenigen, was hier Geisteswissenschaft genannt wird, damals schon angedeutet worden ist. Selbstverständlich war es, daß diese Geistesforschung, die in den achtziger Jahren von mir angedeutet worden ist, sich zunächst auseinandersetzen mußte mit demjenigen, was für die Höhen der modernen Geistesentwickelung den besonderen Ton angab. Und das war die naturwissenschaftliche Weltanschauung. Nichts anderes hatte ich im Auge als eine Auseinandersetzung zunächst mit der naturwissenschaftlichen
Weltanschauung, die selbstverständlich notwendig machte auch eine Auseinandersetzung mit der damaligen zeitgenössischen Philosophie. Wer anderes glaubt, der mißversteht den Inhalt desjenigen, was ich bis in die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts geschrieben habe. Er wird dort wenig finden von Berücksichtigung irgendwelcher religiöser Bekenntnisse und dergleichen, er wird aber immer wieder die Bemühung finden, die herrschende natur-wissenschaftliche Richtung zu durchgeistigen.
Nun war ja selbstverständlich, daß mit gewissen tonangebenden Faktoren des naturwissenschaftlichen Denkens der damaligen Zeit zunächst eine Auseinandersetzung gepflogen werden mußte. Aber wie ist diese Auseinandersetzung gepflogen worden? Ich möchte, soweit es irgend geht, nur durch Tatsachen dasjenige heute darstellen, was meiner Meinung nach in Betracht kommt. Zunächst handelte es sich darum, daß gerade in dem Beginne der achtziger Jahre dasjenige gewissermaßen als tonangebend innerhalb gewisser naturwissenschaftlich denkender Kreise vorgefunden wurde, was man den Darwinismus, Haeckelismus, den darwinistischen Haeckelismus nennen könnte. Haeckel war dazumal ein Faktor, mit dem zu rechnen war. Er hatte im Beginne der neunziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts seine damals überall in den Kreisen der Bildung Aufsehen erregende Rede gehalten und drucken lassen: Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft.
Wie ich mich in solche Bewegungen hineingestellt habe, das mag aus folgendem ersichtlich sein. Ich hielt in Wien - da war zunächst das Podium, welches mir zugänglich war, bevor ich nach Weimar ging - eine Rede, welche im eminentesten Sinne die von mir unternommene Richtigstellung desjenigen ist, was dazumal Haeckelismus genannt werden konnte. Ich setzte einen geistigen Monismus dem materialistischen Monismus entgegen. Als ich dann wenige Wochen, nachdem ich diese Rede gehalten hatte, nach Weimar kam, war gerade über weite Gebiete der gebildeten Welt jene Bewegung in Ausbreitung, welche man dazumal die Bewegung für ethische Kultur genannt hat. Diese Bewegung strebte im wesentlichen an, Ethik von Weltanschauung getrennt zu behandeln, sittliche Anschauung als etwas unter den Menschen
zu verbreiten, welches ohne religiöse oder sonstige Weltanschauung bestehen sollte. Gegen eine solche Anschauung lehnte ich mich auf, weil mir eine bodenlose Ethik unmöglich schien. Ich kann heute nur referieren; die Beweise wird man finden, wenn man meine Schriften historisch der Reihe nach vornimmt. Die heute zu erwähnenden Aufsätze werde ich demnächst der Reihe nach, der Jahrzahl nach, gesammelt wieder erscheinen lassen, damit jeder sehen kann, wie die Dinge sind. Ich lehnte mich auf, weil ich nicht annehmen durfte nach meinen Erkenntnissen, daß die Ethik, die Sittenlehre etwas anderes sein könne als dasjenige, was sich auf der Grundlage einer Weltanschauung begründet. Das betreffende Thema behandelte ich dazumal in einer der ersten Nummern der eben in die Welt tretenden «Zukunft». Damals war es, wo sich Haeckel - ich war nun schon, nachdem ich diesen Aufsatz geschrieben hatte, längere Zeit in Weimar und an Haeckel vorbeigegangen, hatte mich um Haeckel, der in Jena in unmittelbarer Nachbarschaft war, nicht gekümmert - nach diesem Aufsatz über ethische Kultur an mich wandte. Ich antwortete ihm dazu-mal mit Übersendung meines Wiener Vortrages im Abdduck, dessen Inhalt im wesentlichen darin bestand, dem materialistischen Monismus einen geistigen Monismus entgegenzusetzen. Niemals ist von mir der Versuch unternommen worden, mich irgendeiner zeitgenössischen Richtung irgendwie anzubieten. Und wenn von einer Näherung gegenüber dem Haeckelismus gesprochen werden kann, so war es so, daß Haeckel sich zuerst an mich wandte, und es war außerdem selbstverständlich, daß eine Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft stattfand.
Wer lesen kann, der wird aus alledem, was in meinen «Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten Jahrhundert» steht, die Ernst Haeckel aus einem gewissen verehrenden Gefühle für diese mutvolle, bei allen Schattenseiten groß angelegte Persönlichkeit gewidmet sind, sehen können, daß zu nichts anderem zugestimmt ist als zu dem, wozu man zustimmen kann wegen der naturwissenschaftlichen Bedeutung der Haeckelschen Ergebnisse. Niemals kann aus jenem Buch herausgelesen werden, daß meine Zustimmung Haeckel gegenüber philosophisch oder im Sinne der
höchsten Weltanschauungsfragen war. Im Gegenteil, ich darf hier ein persönliches Erlebnis anführen. Ich saß einmal in Leipzig zusammen mit Haeckel und sagte ihm, es wäre ja eigentlich doch schade, daß er bei so vielen Leuten dasjenige hervorriefe, was er eigendich gar nicht wolle, nämlich die Meinung, daß er den Geist ganz ableugne. Da sagte er: Tue ich denn das? Ich möchte nur einmal die Leute hinführen vor eine Retorte und ihnen zeigen, wenn in der Retorte das und jenes vorgeht, wie da alles in Bewegung kommt. - Man sah, daß Haeckel sich unter Geschehnissen des Geistes nichts anderes vorstellte als Geschehnisse der Bewegung, aber in seiner Naivität konnte er nicht anders. Er sah die Materie in Regsamkeit kommen und nannte das «geistig> sich offenbaren. Er war gegenüber alledem, was man Geist und dergleichen nennt, im Grunde genommen naiv. Das gibt ein Urteil über dasjenige, was in den neunziger Jahren bis zu der kleinen Schrift «Haeckel und seine Gegner> hin von mir geschrieben worden ist. Jeder, der wirklich lesen kann, wird gegenüber dieser Schrift finden müssen, wie ich an entscheidender Stelle dasjenige einfüge, was eine naturwissenschaftliche Grundlegung niemals bieten kann. Es wird jeder sehen, daß ich in den neunziger Jahren nichts anderes suchte als eine Auseinandersetzung zwischen dem, was ich der allgemeinen Richtung nach in den achtziger Jahren in meinen Goethe-Schriften angedeutet hatte, was ich dann in der 1897 erschienenen Schrift weiter ausgebaut habe, und der naturwissenschaftlichen Richtung der Zeit.
Nichts anderes als eine gradlinige Fortsetzung alles dessen, um was es sich damals handelte, ist dann gegeben in der fast gleichzeitig mit den «Welt- und Lebensanschauungen> geschriebenen Schrift «Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung>. Es lag einfach im gradlinigen Fortgange einer ernstgemeinten Forschung, daß eingemündet werden mußte gerade aus den naturwissenschaftlichen Voraussetzungen heraus in dasjenige, was nun mit dieser Schrift in Angriff genommen wurde. Ich glaube, man kann nicht stärker und deutlicher diese Orientierung betonen, als es in der Vorrede zu dieser Schrift geschehen ist.
I
GOETHE ALS VATER EINER NEUEN ÄSTHETIK
Zur zweiten Auflage
Dieser Vortrag, der hiermit in zweiter Auflage erscheint, ist vor mehr als zwanzig Jahren im Wiener Goethe-Verein gehalten worden. Anläßlich dieser Neuausgabe einer meiner früheren Schriften darf vielleicht das Folgende gesagt werden. Es ist vorgekommen, daß man Änderungen meiner Anschauungen während meiner schriftstellerischen Laufbahn gefunden hat. Wo gibt es ein Recht hierzu, wenn eine mehr als zwanzig Jahre alte Schrift von mir heute so erscheinen kann, daß auch nicht ein einziger Satz geändert zu werden braucht? Und wenn man insbesondere in meinem geisteswissenschaftlichen (anthroposophischen) Wirken einen Umschwung in meinen Ideen hat finden wollen, so kann dem erwidert werden, daß mir jetzt beim Durchlesen dieses Vortrags die in ihm entwickelten Ideen als ein gesunder Unterbau der Anthroposophie erscheinen. Ja, sogar erscheint es mir, daß gerade anthroposophische Vorstellungsart zum Verständnisse dieser Ideen berufen ist. Bei anderer Ideenrichtung wird man das Wichtigste, was gesagt ist, kaum wirklich ins Bewußtsein aufnehmen. Was damals vor zwanzig Jahren hinter meiner Ideenwelt stand, ist seit jener Zeit von mir nach den verschiedensten Richtungen ausgearbeitet worden; das ist die vorliegende Tatsache, nicht eine Änderung der Weltanschauung.
Ein paar Anmerkungen, die zur Verdeutlichung am Schlusse angehängt werden, hätten ebensogut vor zwanzig Jahren geschrieben werden können. Nun könnte noch die Frage aufgeworfen werden, ob denn das im Vortrage Gesagte auch heute noch in bezug auf die Ästhetik gilt. Denn in den letzten zwei Jahrzehnten ist doch auch manches auf diesem Felde gearbeitet worden. Da scheint mir, daß es gegenwärtig sogar noch mehr gilt als vor zwanzig Jahren. Mit Bezug auf die Entwickelung der Ästhetik
darf der groteske Satz gewagr werden: die Gedanken dieses Vortrags sind seit ihrem ersten Erscheinen noch wahrer geworden, obgleich sie sich gar nicht geändert haben.
Basel, 15. September 1909.
Die Zahl der Schriften und Abhandlungen, die in unserer Zeit erscheinen mit der Aufgabe, das Verhältnis Goethes zu den verschiedensten Zweigen der modernen Wissenschaften und des modernen Geisteslebens überhaupt zu bestimmen, ist eine erdrückende. Die bloße Anführung der Titel würde wohl ein stattliches Bändchen füllen. Dieser Erscheinung liegt die Tatsache zu-grunde, daß wir uns immer mehr bewußt werden, wir stehen in Goethe einem Kulturfaktor gegenüber, mit dem sich alles, was an dem geistigen Leben der Gegenwart teilnehmen will, notwendig auseinandersetzen muß. Ein Vorübergehen bedeutete in diesem Falle ein Verzichten auf die Grundlage unserer Kultur, ein Herumtammeln in der Tiefe ohne den Willen, sich zu erheben bis zur lichten Höhe, von der alles Licht uneerer Bildung ausgeht. Nur wer es vermag, sich in irgendeinem Punkte an Goethe und seine Zeit anzuschließen, der kann zur Klarheit darüber kommen, welchen Weg unsere Kultur einschlägt, der kann sich der Ziele bewußt werden, welche die moderne Menschheit zu wandeln hat; wer diese Beziehung zu dem größten Geiste der neuen Zeit nicht findet, wird einfach mitgezogen von seinen Mitmenschen und geführt wie ein Blinder. Alle Dinge erscheinen uns in einem neuen Zusammenhange, wenn wir sie mit dem Blick betrachten, der sich an diesem Kulturquell geschärft hat.
So erfreulich aber das erwähnte Bestreben der Zeitgenossen ist, irgendwo an Goethe anzuknüpfen, so kann doch keineswegs zu-gestanden werden, daß die Art, in der es geschieht, eine durchwegs glückliche ist. Nur zu oft fehlt es an der gerade hier so notwendigen Unbefangenheit, die sich erst in die volle Tiefe des Goetheschen Genius versenkt, bevor sie sich auf den kritischen Stuhl setzt. Man hält Goethe in vielen Dingen nur deswegen für
überholt, weil man seine ganze Bedeutung nicht erkennt. Man glaubt weit über Goethe hinaus zu sein, während das Richtige meist darinnen läge, daß wir seine umfassenden Prinzipien, seine großartige Art, die Dinge anzuschauen, auf unsere jetzt vollkommeneren wissenschaftlichen Hilfsmittel und Tatsachen anwenden sollten. Bei Goethe kommt es gar niemals darauf an, ob das Ergebnis seiner Forschungen mit dem der heutigen Wissenschaft mehr oder weniger übereinstimmt, sondern stets nur darauf, wie er die Sache angefaßt hat. Die Ergebnisse tragen den Stempel seiner Zeit, das ist, sie gehen so weit, als wissenschaftliche Behelfe und die Erfahrung seiner Zeit reichten; seine Art zu denken, seine Art, die Probleme zu stellen, aber ist eine bleibende Errungen-schaft, der man das größte Unrecht antut, wenn man sie von oben herab behandelt. Aber unsere Zeit hat das Eigentümliche, daß ihr die produktive Geisteskraft des Gesies fast bedeutungslos erscheint. Wie sollte es auch anders sein in einer Zeit, in der jedes Hinausgehen über die physische Erfahrung in der Wissenschaft wie in der Kunst verpönt ist. Zum bloßen sinnlichen Beobachten braucht man weiter nichts als gesunde Sinne, und Genie ist dazu ein recht entbehrliches Ding.
Aber der wahre Fortschritt in den Wissenschaften wie in der Kunst ist niemals durch solches Beobachten oder sklavisches Nachahmen der Natur bewirkt worden. Gehen doch Tausende und aber Tausende an einer Beobachtung vorüber, dann kommt einer und macht an derselben Beobachtung die Entdeckung eines gtoßartigen wissenschaftlichen Gesetzes. Eine schwankende Kirchen-lampe hat wohl mancher vor Galilei gesehen; doch dieser geniale Kopf mußte kommen, um an ihr die für die Physik so bedeutungsvollen Gesetze der Pendelbewegung zu finden. «Wär' nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken», ruft Goethe aus; er will damit sagen, daß nur der in die Tiefen der Natur zu blicken vermag, der die notwendige Veranlagung dazu hat und die produktive Kraft, im Tatsächlichen mehr zu sehen als die bloßen äußeren Tatsachen. Das will man nicht einsehen. Man sollte die gewaltigen Errungenschaften, die wir dem Genie Goethes verdanken, nicht verwechseln mit den Mängeln, die seinen Forschungen
infolge des damaligen beschränkten Standes der Erfahrungen anhaften. Goethe selbst hat das Verhältnis seiner wissenschaftlichen Resultate zum Fortschritte der Forschung in einem trefflichen Bilde charakterisiert; er bezeichnet die letzteren als Steine, mit denen er sich auf dem Brette vielleicht zu weit vorgewagt, aus denen man aber den Plan des Spielers erkennen solle. Beherzigt man diese Worte, dann erwächst uns auf dem Gebiete der Goethe-Forschung folgende hohe Aufgabe: sie muß überall auf die Tendenzen, die Goethe hatte, zurückgehen. Was er selbst als Ergebnisse gibt, mag nur als Beispiel gelten, wie er seine großen Aufgaben mit beschränkten Mitteln zu lösen versuchte. Wir müssen sie in seinem Geiste, aber mit unseren größeren Mitteln und auf Grund unserer reicheren Erfahrungen zu lösen suchen. Auf diesem Wege werden alle Zweige der Forschung, denen Goethe seine Aufmerksamkeit zugewendet, befruchtet werden können und, was mehr ist: sie werden ein einheitliches Gepräge tragen, durchaus Glieder einer einheitlichen großen Weltanschauung sein. Die bloße philologische und kritische Forschung, der ihre Berechtigung abzusprechen ja eine Torheit wäre, muß von dieser Seite her ihre Ergänzung finden. Wir müssen uns der Gedanken- und Ideenfülle, die in Goethe liegt, bemächtigen und von ihr ausgehend wissenschaftlich weiterarbeiten.
Hier soll es meine Aufgabe sein, zu zeigen, inwiefern die entwickelten Grundsätze auf eine der jüngsten und zugleich am meisten umstrittenen Wissenschaften, auf die Ästhetik, Anwendung finden. Die Ästhetik, das ist die Wissenschaft, die sich mit der Kunst und ihren Schöpfungen beschäftigt, ist kaum hundert Jahre alt. Mit vollem Bewußtsein, damit ein neues wissenschaftliches Gebiet zu eröffnen, ist erst Alexander Gottlieb Baumgarten im Jahre 1750 hervorgetreten. In dieselbe Zeit fallen die Bemühungen Winckelmanns und Lessings, über prinzipielle Fragen der Kunst zu einem gründlichen Urteile zu kommen. Alles, was vorher auf diesem Felde versucht worden ist, kann nicht einmal als elementarster Ansatz zu dieser Wissenschaft bezeichnet werden. Selbst der große Aristoteles, dieser geistige Riese, der auf alle Zweige der Wissenschaft einen so maßgebenden Einfluß geübt hat, ist für
die Ästhetik ganz unfruchtbar geblieben. Er hat die bildenden Künste ganz aus dem Kreise seiner Betrachtung ausgeschlossen, woraus hervorgeht, daß er den Begriff der Kunst überhaupt nicht gehabt hat, und außerdem kennt er kein anderes Prinzip als das der Nachahmung der Natur, was uns wieder zeigt, daß er die Aufgabe des Menschengeistes bei seinen Kunstschöpfungen nie begriffen hat.
Die Tatsache, daß die Wissenschaft des Schönen so spät erst entstanden ist, ist nun kein Zufall. Sie war früher gar nicht möglich, einfach weil die Vorbedingungen dazu fehlten. Welche sind nun diese? Das Bedürfnis nach der Kunst ist so alt wie die Menschheit, jenes nach dem Erfassen ihrer Aufgabe konnte erst sehr spät auftreten. Der griechische Geist, der vermöge seiner glücklichen Organisation aus der unmittelbar uns umgebenden Wirklichkeit seine Befriedigung schöpfte, brachte eine Kunstepoche hervor, die ein Höchstes bedeutet; aber er tat es in ursprünglicher Naivität, ohne das Bedürfnis, sich in der Kunst eine Welt zu erschaffen, die eine Befriedigung bieten soll, die uns von keiner anderen Seite werden kann. Der Grieche fand in der Wirklichkeit alles, was er suchte; allem, wonach sein Herz verlangte, wonach sein Geist dürstete, kam die Natur reichlich entgegen. Nie sollte es bei ihm dazu kommen, daß in seinem Herzen die Sehnsucht entstände nach einem Etwas, das wir vergebens in der uns umgebenden Welt suchen. Der Grieche ist nicht herausgewachsen aus der Natur, deshalb sind alle seine Bedürfnisse durch sie zu befriedigen. In ungetrennter Einheit mit seinem ganzen Sein mit der Natur verwachsen, schafft sie in ihm und weiß dann ganz gut, was sie ihm anerschaffen darf, um es auch wieder befriedigen zu können. So bildete denn bei diesem naiven Volke die Kunst nur eine Fortsetzung des Lebens und Treibens innerhalb der Natur, war unmittelbar aus ihr herausgewachsen. Sie befriedigte dieselben Bedürfnisse wie ihre Mutter, nur im höheren Maße. Daher kommt es, daß Aristoteles kein höheres Kunstprinzip kannte als die Naturnachahmung. Man brauchte nicht mehr als die Natur zu erreichen, weil man in der Natur schon den Quell aller Befriedigung hatte. Was uns nur leer und bedeutungslos erscheinen müßte, die bloße
Naturnachahmung, war hier völlig ausreichend. Wir haben verlernt, in der bloßen Natur das Höchste zu sehen, wonach unser Geist verlangt; deswegen könnte uns der bloße Realismus, der uns die jenes Höheren bare Wirklichkeit bietet, nimmer befriedigen. Diese Zeit mußte kommen. Sie war eine Notwendigkeit für die sich zu immer höheren Stufen der Vollkommenheit fort-entwickelnde Menschheit. Der Mensch konnte sich nur so lange ganz innerhalb der Natur halten, solange er sich dessen nicht bewußt war. Mit dem Augenblicke, da er sein eigenes Selbst in voller Klarheit erkannte, mit dem Augenblicke, als er einsah, daß in seinem Innem ein jener Außenwelt mindestens ebenbürtiges Reich lebt, da mußte er sich losmachen vou den Fesseln der Natur.
Jetzt konnte er sich ihr nicht mehr ganz ergeben, auf daß sie mit ihm schalte und walte, daß sie seine Bedürfnisse erzeuge und wieder befriedige. Jetzt mußte er ihr gegenübertreten, und damit hatte er sich faktisch von ihr losgelöst, hatte sich in seinem Innern eine neue Welt erschaffen, und aus dieser fließt jetzt seine Sehnsucht, aus dieser kommen seine Wünsche. Ob diese Wünsche, jetzt abseits von der Mutter Natur erzeugt, von dieser auch befriedigt werden können, bleibt natürlich dem Zufall überlassen. Jedenfalls trennt den Menschen jetzt eine scharfe Kluft von der Wirklichkeit, und er muß die Harmonie erst herstellen, die früher in ursprüngllcher Vollkommenheit da war. Damit sind die Konflikte des Ideals mit der Wirklichkeit, des Gewollten mit dem Erreichten, kurz alles dessen gegeben, was eine Menschenseele in ein wahres geistiges Labyrinth führt. Die Natur steht uns da gegen-über seelenlos, bar alles dessen, was uns unser Inneres als ein Göttliches ankündigt. Die nächste Folge ist das Abwenden von allem, was Natur ist, die Flucht vor dem unmittelbar Wirklichen. Dies ist das gerade Gegenteil des Griechentums. So wie das letztere alles in der Natur gefunden hat, so findet diese Weltanschauung gar nichts in ihr. Und in diesem Lichte muß uns das christliche Mittelalter erscheinen. Sowenig das Griechennam das Wesen der Kunst zu erkennen vermochte, weil sie deren Hinausgehen über die Natur, das Erzeugen einer höheren Natur gegenüber der unmittelbaren, nicht begreifen konnte, ebensowenig konnte es die christliche
Wissenschaft des Mittelalters zu einer Kunsterkenntnis bringen, weil ja die Kunst doch nur mit den Mitteln der Natur arbeiten konnte und die Gelehrsamkeit es nicht fassen konnte, wie man innerhalb der gottlosen Wirklichkeit Werke schaffen kann, die den nach Göttlichem strebenden Geist befriedigen können. Auch hier tat die Hilflosigkeit der Wissenschaft der Kunstentwickelung keinen Abbruch. Während die erstere nicht wußte, was sie darüber denken solle, entstanden die herrlichsten Werke christlicher Kunst. Die Philosophie, die in jener Zeit der Theologie die Schleppe nachtrug, wußte der Kunst ebensowenig einen Platz in dem Kulturfortschrirte einzuräumen, wie es der große Idealist der Griechen, der «göttliche Plato>, vermochte. Plato erklärte ja die bildende Kunst und die Dramatik einfach für schädlich. Von einer selbständigen Aufgabe der Kunst hat er so wenig einen Begriff, daß er der Musik gegenüber nur deshalb Gnade für Recht walten läßt, weil sie die Tapferkeit im Kriege befördert.
In der Zeit, in der Geist und Natur so innig verbunden waren, konnte die Kunstwissenschaft nicht entstehen, sie konnte es aber auch nicht in jener, in der sie sich als unversöhnte Gegensätze gegenüberstanden. Zur Entstehung der Ästhetik war jene Zeit notwendig, in der der Mensch frei und unabhängig von den Fesseln der Natur den Geist in seiner ungetrübten Klarheit erblickte, in der aber auch schon wieder ein Zusamrnenfließen mit der Natur möglich ist. Daß der Mensch sich über den Standpunkt des Griechentums erhebt, hat seinen guten Grund. Denn in der Summe von Zufälligkeiten, aus denen die Welt zusanznengesetzt ist, in die wir uns versetzt fühlen, können wir nimmer das Göttliche, das Notwendige finden. Wir sehen ja nichts um uns als Tatsachen, die ebensogut auch anders sein könnten; wir sehen nichts als Individuen, und unser Geist strebt nach dem Gattungsmäßigen, Urbildlichen; wir sehen nichts als Endliches, Vergängliches, und unser Geist strebt nach dem Unendlichen, Unvergänglichen, Ewigen. Wenn also der der Natur entfremdete Menschengeist zur Natur zurückkehren sollte, so mußte dies zu etwas anderem sein als zu jener Summe von Zufälligkeiten. Und diese Rückkehr bedeutet Goethe: Rückkehr zur Natur, aber Rückkehr mit dem vollen
Reichtum des entwickelten Geistes, mit der Bildungshöhe der neuen Zeit.
Goethes Anschauungen entspricht die grundsätzliche Trennung von Natur und Geist nicht; er will in der Welt nur ein großes Ganzes erblicken, eine einheitliche Entwickelungskette von Wesen, innerhalb welcher der Mensch ein Glied, wenn auch das höchste, bildet. «Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen -unvermögend, aus ihr herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen.» (Siehe Goethes Werke. Naturwissenschaftliche Schriften, 2. Bd. Hg. von Rudolf Steiner in Kürschners Deutsche Nat.-Lit., S. 5f.) Und lin Buche über Winckelmann: Hierinnen liegt das echt Goethesche weite Hinausgehen über die unmittelbare Natur, ohne sich auch nur im geringsten von dem zu entfernen, was das Wesen der Natur ausmacht. Fremd ist ihm, was er selbst bei vielen besonders begabten Menschen findet: Goethe flieht die Wirklichkeit nicht, um sich eine abstrakte Gedankenwelt zu schaffen, die nichts mit jener gemein hat; nein, er vertieft sich in dieselbe, urn in ihrem ewigen Wandel, in ihrem Werden und Bewegen, ihre unwandelbaren Gesetze zu finden, er stellt sich dem Individuum gegenüber, um in ihm das Urbild zu erschauen. So erstand in seinem Geiste die Urpflanze, so das Urtier, die ja nichts anderes sind als die Ideen des Tieres und der Pflanze. Das sind keine leeren Allgemeinbegriffe, die einer grauen Theorie angehören, das sind die wesentlichen Grundlagen der Organismen
mit einem reichen, konkreten Inhalt, lebensvoll und anschaulich. Anschaulich freilich nicht für die äußeren Sinne, sondern nur für jenes höhere Anschauungsvermögen, das Goethe in dem Aufsatze über «Anschauende Urteilskraft» bespricht. Die Ideen im Goetheschen Sinne sind ebenso objektiv wie die Farben und Gestalten der Dinge, aber sie sind nur für den wahrnehmbar, dessen Fassungsvermögen dazu eingerichtet ist, so wie Farben und Formen nur für den Sehenden und nicht für den Blinden da sind. Wenn wir dem Objektiven eben nicht mit einem empfänglichen Geiste entgegenkommen, enthüllt es sich nicht vor uns. Ohne das instinktive Vermögen, Ideen wahrzunehmen, bleiben uns diese immer ein verschlossenes Feld. Tiefer als jeder andere hat hier Schiller in das Gefüge des Goetheschen Genius geschaut.
Am 23. August 1794 klärte er Goethe über das Wesen, das seinem Geist zugrunde liegt, mit folgenden Worten auf: «Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen; in der AlIheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf. Von der einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu der mehr verwickelten auf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, daß Sie ihn der Natur gleichsam nacherschaffen, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudringen.> In diesem Nacherschaffen liegt ein Schlüssel zum Verständnis der Weltanschauung Goethes. Wollen wir wirklich zu den Urbildern der Dinge, zu dem Unwandelbaren im ewigen Wechsel aufsteigen, dann dürfen wir nicht das Fertiggewordene betrachten, denn dieses entspricht nicht mehr ganz der Idee, die sich in ihm ausspricht, wir müssen auf das Werden zurückgehen, wir müssen die Natur im Schaffen belauschen. Das ist der Sinn der Goetheschen Worte in dem Aufsatze «Anschauende Urteilskraft>: «Wenn wir ja im Sittlichen durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen, so dürfte es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte
ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen.> (Goethes Werke, wie oben. 1. Bd. d. Naturw. Schr.. S. 115.> Die Goetheschen Urbilder sind also nicht leere Schemen, sondern sie sind die treibenden Kräfte hinter den Erscheinungen.
Das ist die in der Natur, der sich Goethe bemächtigen will. Wir sehen dasaus, daß in keinem Falle die Wirklichkeit, wie sie vor unseren Sinnen ausgebreitet daliegt, etwas ist, bei dem der auf höherer Kulturstufe angelangte Mensch stehenbleiben kann. Nur indem der Menschengeist diese Wirklichkeit überschreitet, die Schale zerbricht und zum Kerne vordringt, wird ihm offenbar, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Nimmermehr können wir am einzelnen Naturgeschehen, nur am Naturgesetze, nimmermehr. am einzelnen Individuum, nur an der Allgemeinheit Befriedigung finden. Bei Goethe kommt diese Tatsache in der denkbar vollkommensten Form vor. Was auch bei ibm stehenbleibt, ist die Tatsache, daß für den modernen Geist die Wirklichkeit, das einzelne Individuum keine Befriedigung bietet, weil wir nicht schon in ihm, sondern erst, wenn wir über dasselbe hinausgehen, das finden, in dem wir das Höchste erkennen, das wir als Göttliches verehren, das wir in der Wissenschaft als Idee ansprechen. Während die bloße Erfahrung zur Versöhnung der Gegensätze nicht kommen kann, weil sie wohl die Wirklichkeit, aber noch nicht die Idee hat, kann die Wissenschaft zu dieser Aussöhnung nicht kommen, weil sie wohl die Idee, aber die Wirklichkeit nicht mehr hat. Zwischen beiden bedarf der Mensch eines neuen Reiches; eines Reiches, in dem das Einzelne schon und nicht erst das Ganze die Idee darstellt, eines Reiches, in dem das Individuum schon so auftritt, daß ihm der Charakter der Allgemeinheit und Notwendigkeit innewohnt. Eine solche Welt ist aber in der Wirklichkeit nicht vorhmden, eine solche Welt muß sich der Mensch erst selbst erschaffen, und diese Welt ist die Welt der Kunst: ein notwendiges drittes Reich neben dem der Sinne und dem der Vernunft.
Und die Kunst als dieses dritte Reich zu begreifen, hat die Ästhetik als ihre Aufgabe anzusehen. Das Göttliche, dessen die
Naturdinge entbehren, muß ihnen der Mensch selbst einpflanzen, und hierinnen liegt eine hohe Aufgabe, die den Künstlern erwächst. Sie haben sozusagen das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Diese, man darf es wohl so nennen, religiöse Sendung der Kunst spricht Goethe - im Buch über Winckehnann - in folgenden herrlichen Worten aus: «Indem der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Vollkommenheiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft und sich endlich bis zur Produktion des Kunstwerkes erhebt, das neben seinen übrigen Taten und Werken einen glänzenden Platz einnimmt. Ist es einmal hervorgebracht, steht es in seiner idealen Wirklichkeit vor der Welt, so bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor; denn indem es aus den gesamten Kräften sich geistig entwickelt, so nimmt es alles Herrliche, Verehrungs- und Liebenswürdige in sich auf und erhebt, indem es die menschliche Gestalt beseelt, den Menschen über sich selbst, schließt seinen Lebens- und Tatenkreis ab und vergöttert ihn für die Gegenwart, in der das Vergangene und Künftige begriffen ist. Von solchen Gefühlen wurden die ergtiffen, die den olympischen Jupiter erblickten, wie wir aus den Beschreibungen, Nachrichten und Zeugnissen der Alten uns entwickeln können. Der Gott war zum Menschen geworden, um den Menschen zum Gott zu erheben. Man erblickte die höchste Würde und ward für die höchste Schönheit begeistert.>
Damit war der Kunst ihre hohe Bedeutung für den Kulturfortschritt der Menschheit zuerkannt. Und es ist bezeichnend für das gewaltige Ethos des deutschen Volkes, daß ibm zuerst diese Erkenntnis aufging, bezeichnend, daß seit einem Jahrhundert alle deutschen Philosophen danach ringen, die würdigste wissenschaftliche Form für die eigentamliche Art zu finden, wie im Kunst-werke Geistiges und Natürliches, Ideales und Reales miteinander verschmelzen. Nichts anderes ist ja die Aufgabe der Ästhetik, als diese Durchdringung in ihrem Wesen zu begreifen und in den einzelnen Formen, in denen sie sich in den verschiedenen Kunstgebieten
darlebt, durchzuarbeiten. Das Problem, zuerst in der von uns angedeuteten Weise angeregt und damit alle ästhetischen Hauptfragen eigentlich in Fluß gebracht zu haben, ist das Verdienst der im Jahre 1790 erschienenen «Kritik der Urteilskraft> Kants, deren Auseinandersetzungen Goethe sogleich sympathisch berührten. Bei allem Ernst der Arbeit aber, der auf die Sache verwandt wurde, müssen wir doch heute gestehen, daß wir eine allseitig befriedigende Lösung der ästhetischen Aufgaben nicht haben. Der Altmeister unserer Ästhetik, der scharfe Denker und Kritiker Friedrich Theodor Vischer, hat bis zu seinem Lebensende an der von ihm ausgesprochenen Überzeugung festgehalten: «Ästhetik liegt noch in den Anfängen.» Damit hat er eingestanden, daß alle Bestrebungen auf diesem Gebiete, seine eigene fütifbändige Ästhetik mit inbegriffen, mehr oder weniger Irrwege bezeichnen. Und so ist es auch Dies ist - wenn ich hier meine Überzeugung aussprechen darf - nur auf den Umstand zurückzuführen, weil man Goethes fruchtbare Keime auf diesem Gebiete unberücksichtigt gelassen hat, weil man ihn nicht für wissenschaftlich voll nahm. Hätte man das getan, dann hätte man einfach die Ideen Schillers ausgebaut, die ihm in der Anschauung des Goetheschen Genius aufgegangen sind und die er in den «Briefen über ästhetische Erziehung> niedergelegt hat. Auch diese Briefe werden vielfach von den systematisierenden Ästhetikern nicht für genug wissenschaftlich genommen, und doch gehören sie zu dem Bedeutendsten, was die Ästhetik überhaupt hervorgebracht hat. Schiller geht von Kant aus. Dieser Philosoph hat die Natur des Schönen in mehrfacher Hinsicht bestimmt. Zuerst untersucht er den Grund des Vergnügens, das wir an den schönen Werken der Kunst empfinden. Diese Lustempfindung findet er ganz verschieden von jeder anderen. Vergleichen wir sie mit der Lust, die wir empfinden, wenn wir es mit einem Gegenstande zu tun haben, dem wir etwas uns Nutzenbringendes verdanken. Diese Lust ist eine ganz andere. Diese Lust hängt innig mit dem Begehren nach dem Dasein dieses Gegenstandes zusarumen. Die Lust am Nützlichen verschwindet, wenn das Nützliche selbst nicht mehr ist. Das ist bei der Lust, die wir dem Schönen gegenüber empfinden, anders. Diese Lust hat mit
dem Besitze, mit der Existenz des Gegenstandes nichts zu tun. Sie haftet demnach gar nicht am Objekte, sondern nur an der Vorstellung von demselben. Während beim Zweckmäßigen, Nützlichen sogleich das Bedürfnis entsteht, die Vorstellung in Realität umzusetzen, sind wir beim Schönen mit dem bloßen Bilde zufrieden. Deshalb nennt Kant das Wohlgefallen am Schönen ein von jedem realen Interesse unbeeinflußtes, ein «interesseloses Wohlgefallen». Es wäre aber die Ansichr ganz falsch, daß damit von dem Schönen die Zweckmäßigkeit ausgeschlossen wird; das geschieht nur mit dem äußeren Zwecke. Und daraus fließt die zweite Erklärung des
Schönen: «Es ist ein in sich zweckmäßig Geformtes aber ohne einem äußeren Zwecke zu dienen.» Nehmen wir ein anderes Ding der Natur oder ein Produkt der menschlichen Technik wahr, dann kommt unser Verstand und fragt nach Nutzen und Zweck Und er ist nicht früher befriedigt, bis seine Frage nach dem «Wozu» beantwortet ist. Beim Schönen liegt das Wozu in dem Dinge selbst, und der Verstand braucht nicht über dasselbe hinauszugehen. Hier setzt nun Schiller an Und er tut dies indem er die Idee der Freiheit in die Gedaukenreihe hineinverwebt in einer Weise, die der Menschennatur die hochste Ehre macht Zunachst stellt Schiller zwei unablassig sich geltend machende Triebe des Menschen einander gegenuber Der erste ist der sogenannte Stoff trieb oder das Bedurfnis, unsere Sinne der einstromenden Außen welt offenzuhalten Da dringt ein reicher Inhalt auf uns em aber ohne daß wir selbst auf seine Natur einen bestimmenden Einfluß nehmen könnten. Mit unbedingter Notwendigkeit geschieht hier alles. Was wir wahrnehmen, wird von außen bestimmt; wir sind hier unfrei, unterworfen, wir müssen einfach dem Gebote der Naturnotwendigkeit gehorchen. Der zweite ist der Formtrieb. Das ist nichts anderes als die Vernunft, die in das wirre Chaos des Wahrnebmungsinhaltes Ordnung und Gesetz bringt. Durch ihre Arbeit kommt System in die Erfahrung. Aber auch hier sind wir nicht frei, findet Schiller. Denn bei dieser ihrer Arbeit ist die Vernunft den unabänderlichen Gesetzen der Logik unterworfen. Wie dort unter der Macht der Naturnotwendigkeit, so stehen wir hier unter jener der Vernunftnotwendigkeit. Gegenüber beiden sucht
die Freiheit eine Zufluchtstätte. Schiller weist ihr das Gebiet der Kunst an, indem er die Analogie der Kunst mit dem Spiel des Kindes hervorhebt. Worinnen liegt das Wesen des Spieles? Es werden Dinge der Wirklichkeit genommen und in ihren Verhältnissen in beliebiger Weise verändert. Dabei ist bei dieser Umformung der Realität nicht ein Gesetz der logischen Notwendigkeit maßgebend, wie wenn wir zum Beispiel eine Maschine bauen, wo wir uns strenge den Gesetzen der Vernunft unterwerfen müssen, sondern es wird einzig und allein einem subjektiven Bedürfnis gedient. Der Spielende bringt die Dinge in einen Zusammenhang, der ihm Freude macht; er legt sich keinerlei Zwang auf. Die Naturnotwendigkeit achtet er nicht, denn er überwindet ihren Zwang, indem er die ihm überlieferten Dinge ganz nach Willkür verwendet; aber auch von der Vernunftnotwendigkeit fühlt er sich nicht abhängig, denn die Ordnung, die er in die Dinge bringt, ist seine Erfindung. So prägt der Spielende der Wirklichkeit seine Subjektivität ein, und dieser letzteren hinwiederum verleiht er objektive Geltung. Das gesonderte Wirken der beiden Triebe hat aufgehört; sie sind in eins zusammengeflossen und damit frei geworden: Das Natürliche ist ein Geistiges, das Geistige ein Natürliches. Schiller nun, der Dichter der Freiheit, sieht so in der Kunst nur ein freies Spiel des Menschen auf höherer Stufe und ruft begeistert aus: «Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, ... und er spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist.> Den der Kunst zugrunde liegenden Trieb nennt Schiller den Spieltrieb. Dieser erzeugt im Künstler Werke, die schon in ihrem sinnlichen Dasein unsere Vernunft befriedigen und deren Vernunftinhalt zugleich als sinnliches Dasein gegenwärtig ist. Und das Wesen des Menschen wirkt auf dieser Stufe so, daß seine Natur zugleich geistig und sein Geist zugleich natürlich wirkt. Die Natur wird zum Geiste erhoben, der Geist versenkt sich in die Natur. Jene wird dadurch geadelt, dieser aus seiner unanschaulichen Höhe in die sichtbare Welt gerückt. Die Werke, die dadurch entstehen, sind nun freilich deshalb nicht völlig naturwahr, weil in der Wirklichkeit sich nirgends Geist und Natur decken; wenn wir daher die Werke der Kunst mit jenen der Natur zusammenstellen, so erscheinen
sie uns als bloßer Schein. Aber sie müssen Schein sein, weil sie sonst nicht wahrhafte Kunstwerke wären. Mit dem Begriffe des Scheines in diesem Zusammenhange steht Schiller als Ästhetiker einzig da, unübertroffen, unerreicht. Hier hätte man weiter bauen sollen und die zunächst nur einseitige Lösung des Schönheitsproblemes durch die Anlehnung an Goethes Kunst-betrachtung weiterführen sollen. Statt dessen tritt Schelling mit einer vollständig vetfehlten Grundansicht auf den Plan und inauguriert einen Irrtusn, aus dem die deutsche Ästhetik nicht wieder herausgekommen ist. Wie die ganze moderne Philosophie findet auch Schelling die Aufgabe des höchsten menschlichen Strebens in dem Erfassen der ewigen Urbilder der Dinge. Der Geist schreitet hinweg über die wirkliche Welt und erhebt sich zu den Höhen, wo das Göttliche thront. Dort geht ihm alle Wahrheit und Schönheit auf. Nur was ewig ist, ist wahr und ist auch schön. Die eigentliche Schönheit kann also nach Schelling nur der schauen, der sich zur höchsten Wahrheit erhebt, denn sie sind ja nur eines und dasselbe. Alle sinnliche Schönheit ist ja nur ein schwacher Abglanz jener unendlichen Schönheit, die wir nie mit den Sinnen wahrnehmen können. Wir sehen, worauf das hinauskomint: Das Kunstwerk ist nicht um seiner selbst willen und durch das, was es ist, schön, sondern weil es die Idee der Schönheit abbilder. Es ist dann nur eine Konsequenz dieser Ansicht, daß der Inhalt der Kunst derselbe ist wie jener der Wissenschaft, weil sie ja beide die ewige Wahrheit, die zugleich Schönheit ist, zugrunde legen. Für Schelling ist Kunst nur die objektiv gewordene Wissenschaft. Worauf es nun hier ankommt, das ist, woran sich unser Wohlgefallen am Kunstwerke knüpft. Das ist hier nur die ausgedrückte Idee. Das sinnliche Bild ist nur Ausdrucksmittel, die Form, in der sich ein übersinnlicher Inhalt ausspricht. Und hierin folgen alle Ästhetiker der idealistischen Richtung Schellings. Ich kann nämlich nicht übereinstimmen mit dem, was der neueste Geschichtsschreiber und Systematiker der Ästhetik, Eduard von Hartmann, findet, daß Hegel wesentlich über Schelling in diesem Punkte hinausgekommen ist. Ich sage in diesem Punkte, denn es gibt vieles andere, wo er ihn turmhoch überragt. Hegel sagt ja auch: «Das Schöne ist das sinnliche
Scheinen der Idee.» Damit gibt auch er zu, daß er in der ausgedrückten Idee das sieht, worauf es in der Kunst ankommt. Noch deutlicher wird dies aus folgenden Worten: «Die harte Rinde der Natur und der gewöhnlichen Welt machen es dem Geiste saurer, zur Idee durchzudringen, als die Werke der Kunst.» Nun, darinnen ist doch ganz klar gesagt, daß das Ziel der Kunst dasselbe ist wie das der Wissenschaft, nämlich zur Idee vorzudringen.
Die Kunst suche nur zu veranschaulichen, was die Wissenschaft unmittelbar in der Gedankenform zum Ausdrucke bringt. Friedrich Theodor Vischer nennt die Schönheit «die Erscheinung der Idee» und setzt damit gleichfalls den Inhalt der Kunst mit der Wahrheit identisch. Man mag dagegen einwenden, was man will; wer in der ausgedrückten Idee das Wesen des Schönen sieht, kann es nimmermehr von der Wahrheit trennen. Was dann die Kunst neben der Wissenschaft noch für eine selbständige Aufgabe haben soll, ist nicht einzusehen. Was sie uns bietet, erfahren wir auf dem Wege des Denkens ja in reinerer, ungetrübterer Gestalt, nicht erst verhüllt durch einen sinnlichen Schleier. Nur durch Sophisterei kommt man vom Standpunkte dieser Ästhetik über die eigentliche korupromittierende Konsequenz hinweg, daß in den bildenden Künsten die Allegorie und in der Dichtkunst die didaktische Poesie die höchsten Kunstformen seien. Die selbständige Bedeutung der Kunst kann diese Ästhetik nicht begreifen. Sie hat sich daher auch als unfruchtbar erwiesen. Man darf aber nicht zu weit gehen und deswegen alles Streben nach einer widerspruchslosen Ästhetik aufgeben. Und es gehen in dieser Richtung zu weit jene, die alle Ästhetik in Kunstgeschichte auflösen wollen. Diese Wissenschaft kann denn, ohne sich auf authentische Prinzipien zu stützen, nichts anderes sein als ein Sammelplatz für Notizensarnmlungen über die Künstler und ihre Werke, an die sich mehr oder weniger geistreiche Bemerkungen schließen, die aber, ganz der Willkür des subjektiven Raisonnements entstammend, ohne Wert sind. Von der anderen Seite ist man der Ästhetik zu Leibe gegangen, indem man ihr eine Art Physiologie des Geschmacks gegenüberstellt. Man will die einfachsten, elementarsten Fälle, in denen wir eine Lust-empfindung haben, untersuchen und dann zu immer komplizierteren
Fällen aufsteigen, um so der «Ästhetik von oben» eine «Ästhetik von unten» entgegenzusetzen. Diesen Weg hat Fechner in seiner «Vorschule der Ästhetik eingeschlagen. Es ist eigentlich unbegteiflich, daß ein solches Werk bei einem Volke, das einen Kant gehabt hat, Anhänger finden kann. Die Ästhetik soll von der Untersuchung der Lustempfindung ausgehen; als ob jede Lust-empfindung schon eine ästhetische wäre und als ob wir die ästhetische Natur einer Lustempfindung von der einer anderen durch irgend etwas anderes unterscheiden könnten als durch den Gegen-stand, durch den sie hervorgebracht wird. Wir wissen nur, daß eine Lust eine ästhetische Empfindung ist, wenn wir den Gegenstand als einen schönen erkennen, denn psychologisch als Lust unterscheidet sich die ästhetische in nichts von einer andern. Es handelt sich immer um die Erkenntnis des Objektes. Wodurch wird ein Gegenstand schön? Das ist die Grundfrage aller Ästhetik.
Viel besser als die «Ästhetiker von unten» kommen wir der Sache bei, wenn wir uns an Goethe anlehnen. Merck bezeichnet einmal Goethes Schaffen mit den Worten: «Dein Bestreben, deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichts wie dummes Zeug.» Damit ist ungefähr dasselbe gesagt wie mit Goethes Worten im zweiten Teil des «Faust»: «Das Was bedenke, mehr bedenke Wie.» Es ist deutlich gesagt, worauf es in der Kunst ankommt. Nicht auf ein Verkörpern eines Übersinnlichen, sondern um ein Umgestalten des Sinnlich Tatsachlichen Das Wirkliche soll nicht zum Aus dtucksmittel herabsinken nein es soll in seiner vollen Seibstandig keit bestehen bleiben nur soll es eine neue Gestalt bekommen eine Gestalt in der es uns befriedigt Indem wir irgendein Einzel wesen aus dem Kreise seiner Umgebung herausheben und es in dieser gesonderten Stellung vor unser Auge stellen, wird uns daran sogleich vieles unbegteiflich erscheinen. Wir können es mit dem Begriffe, mit der Idee, die wir ibm notwendig zugtunde legen müssen, nicht in Einklang bringen. Seine Bildung in der Wirklichkeit ist eben nicht nur die Folge seiner eigenen Gesetzlichkeit, sondern es ist die angrenzende Wirklichkeit unmittelbar mitbestimmend.
Hätte das Ding sich unabhängig und frei, unbeeinflußt von anderen Dingen entwickeln können, dann nur lebte es seine eigene Idee dar. Diese dem Dinge zugrunde liegende, aber in der Wirklichkeit in freier Entfaltung gestörte Idee muß der Künstler ergreifen und sie zur Entwickelung bringen. Er muß in dem Objekte den Punkt finden, aus dem sich ein Gegenstand in seiner vollkommensten Gestalt entwickeln läßt, in der er sich aber in der Natur selbst nicht entwickeln kann. Die Natur bleibt eben in jedem Einzelding hinter ihrer Absicht zurück; neben dieser Pflanze schafft sie eine zweite> dritte und so fort; keine bringt die volle Idee zu konkretem Leben; die eine diese, die andere jene Seite, soweit es die Umstände gestatten. Der Künstler muß aber auf das zurückgehen, was ihrn als die Tendenz der Natur erscheint. Und das meint Goethe, wenn er sein &haffen mit den Worten ausspricht:
«Ich raste nicht, bis ich einen prägnanten Punkt finde, von dem sich vieles ableiten läßt.» Beim Künstler muß das ganze Äußere seines Werkes das ganze Innere zum Ausdruck bringen; beim Naturprodukt bleibt jenes hinter diesem zurück, und der forschende Menschengeist muß es erst erkennen. So sind die Gesetze, nach denen der Künstler verfährt, nichts anderes als die ewigen Gesetze der Natur, aber rein, unbeeinflußt von jeder Hemmung. Nicht was ist, liegt also den &höpfungen der Kunst zugrunde, sondern was sein könnte, nicht das Wirkliche, sondern das Mögliche. Der Künstler schafft nach denselben Prinzipien, nach denen die Natur schafft; aber er behandelt nach diesen Prinzipien die Individuen, während, um mit einem Goetheschen Worte zu reden, die Natur sich nichts aus den Individuen macht. «Sie baut immer und zerstört immer», weil sie nicht mit dem Einzelnen, sondern mit dem Ganzen das Vollkommene erreichen will. Der Inhalt eines Kunstwerkes ist irgendein sinnenfällig wirklicher - dies ist das Was; in der Gestalt, die ihm der Künstler gibt, geht Sein Bestreben dahin, die Natur in ihren eigenen Tendenzen zu übertreffen, das, was mit ihren Mitteln und Gesetzen möglich ist, in höherem Maße zu erreichen, als sie es selbst imstande ist.
Der Gegenstand, den der Künstler vor uns stellt, ist vollkommener, als er in seinem Naturdasein ist; aber er trägt doch keine
andere Vollkommenheit als seine eigene an sich. In diesem Hinausgehen des Gegenstandes über sich selbst, aber doch nur auf Grundlage dessen, was in ihm schon verborgen ist, liegt das Schöne. Das Schöne ist also kein Unnatürliches; und Goethe kann mit Recht sagen: «Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben>, oder an einem anderen Orte: «Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst.» In demselben Sinne, in dem man sagen kann, das Schöne sei ein Unreales, Unwahres, es sei bloßer Schein, denn was es darstellt, finde sich in dieser Vollkommenheit nirgends in der Natur, kann man auch sagen: das Schöne sei wahrer als die Natur, indem es das darstellt, was die Natur sein will und nur nicht sein kann. Über diese Frage der Realität in der Kunst sagt Goethe: «Der Dichter» - und wir können seine Worte ganz gut auf die gesamte Kunst ausdehnen - «der Dichter ist angewiesen auf Darstellung. Das Höchste derselben ist, wenn sie mit der Wirklichkeit wert-eifert, das heißt wenn ihre Schilderungen durch den Geist dergestalt lebendig sind, daß sie als gegenwärtig für jedermann gelten können.> Goethe findet: «Es ist in der Natur nichts schön, was nicht naturgesetzlich als wahr motiviert wäre.» (Gespräche mit Eckermann III, 82.) Und die andere Seite des Scheines, das Übertreffen des Wesens durch sich selbst, finden wir als Goethes Ansicht ausgesprochen in «Sprüche in Prosa» (Goethes Werke, wie oben. 4. Bd. d. Naturw. Schr. 2. Abtlg., S. 495): «In den Blüten tritt das vegetabilische Gesetz in seine höchste Erscheinung, und die Rose wäre nur wieder der Gipfel dieser Erscheinung ... Die Frucht kann nie schön sein, denn da tritt das vegetabilische Gesetz in sich (ins bloße Gesetz) zurück.» Nun, da haben wir es doch ganz deutlich, wo sich die Idee ausbildet und auslebt, da tritt das Schöne ein, wo wir in der äußeren Erscheinung unmittelbar das Gesetz wahrnehmen; wo hingegen, wie in der Frucht, die äußere Erscheinung formlos und plump erscheint, weil sie von dem der Pflanzenbildung zugrunde liegenden Gesetz nichts verrät, da hört das Naturding auf, schön zu sein. Deshalb heißt es in demselben
Spruch weiter: Fragen wir uns jetzt einmal nach dem Grund des Vergnügens an Gegenständen der Kunst. Vor allem müssen wir uns klar sein darüber, daß die Lust, welche an den Objekten des Schönen befriedigt wird, in nichts nachsteht der rein intellektuellen Lust, die wir am rein Geistigen haben. Es bedeutet immer einen entschiedenen Verfall der Kunst, wenn ihre Aufgabe in dem bloßen Amüsement, in der Befriedigung einer niederen Lust gesucht wird. Es wird also der Grund des Vergnügens an Gegenständen der Kunst kein anderer sein als jener, der uns gegenüber der Ideenwelt überhaupt jene freudige Erhebung empfinden läßt, die den ganzen Menschen über sich selbst hinaushebt. Was gibt uns nun eine solche Befriedigung an der Ideenwelt? Nichts anderes als die innere himmlische Ruhe und Vollkommenheit, die sie in sich birgt. Kein Widerspruch, kein Mißton regt sich in der in unserem eigenen Innern aufsteigenden Gedankenwelt, weil sie ein Unendliches in sich ist. Alles, was dieses Bild zu einem vollkommenen macht, liegt in ibm selbst. Diese der Ideenwelt eingeborene Vollkommenheit, das ist der Grund unserer Erhebung, wenn wir ihr gegenüberstehen. Soll uns das Schöne eine ähnliche Erhebung bieten, dann muß es nach dem Muster der Idee aufgebaut sein. Und dies ist etwas ganz anderes, als was die deutschen idealisierenden Ästhetiker
wollen. Das ist nicht die «Idee in Form der sinnlichen Erscheinung», das ist das gerade Umgekehrte, das ist eine «sinnliche Erscheinung in der Form der Idee». Der Inhalt des Schönen, der demselben zugrunde liegende Stoff ist also immer ein Reales, ein unmittelbar Wirkliches, und die Form seines Auftretens ist die ideelle. Wir sehen, es ist gerade das Umgekehrte von dem richtig, was die deutsche Ästhetik sagt; diese hat die Dinge einfach auf den Kopf gestellt. Das Schöne ist nicht das Göttliche in einem sinnlich-wirklichen Gewande; nein, es ist das Sinnlich-Wirkliche in einem göttlichen Gewande. Der Künsder bringt das Göttliche nicht dadurch auf die Erde, daß er es in die Welt einfließen läßt, sondern dadurch, daß er die Welt in die Sphäre der Göttlichkeit erhebt. Das Schöne ist Schein, weil es eine Wirklichkeit vor unsere Sinne zaubert, die sich als solche wie eine Idealwelt darstellt. Das Was bedenke, mehr bedenke Wie, denn in dem Wie liegt es, worauf es ankommt. Das Was bleibt ein Sinnliches, aber das Wie des Auftretens wird ein Ideelles. Wo diese ideelle Erscheinungsform am Sinnlichen am besten erscheint, da erscheint auch die Würde der Kunst am höchsten. Goethe sagt darüber: «Die Würde der Kunst erscheint bei der Musik vielleicht am eminentesten, weil sie keinen Stoff hat, der abgerechnet werden müßte. Sie ist ganz Form und Gehalt und erhöht und veredelt alles, was sie ausdrückt.» Die Ästhetik nun, die von der Definition ausgeht: «das Schöne ist ein sinnliches Wirkliche, das so erscheint, als wäre es Idee>, diese besteht noch nicht. Sie muß geschaffen werden. Sie kann schlechterdings bezeichnet werden als die «Ästhetik der Goetheschen Weltanschauung». Und das ist die Ästhetik der Zukunft. Auch einer der neuesten Bearbeiter der Ästhetik, Eduard von Hartmann, der in seiner «Philosophie des Schönen» ein ganz ausgezeichnetes Werk geschaffen hat, huldigt dem alten Irrtum, daß der Inhalt des Schönen die Idee sei. Er sagt ganz richtig, der Grundbegriff, wovon alle Schönheitswissenschaft auszugehen hat, sei der Begriff des ästhetischen Scheine& Ja, aber ist denn das Erscheinen der Idealwelt als solcher je als Schein zu betrachten! Die Idee ist doch die höchste Wahrheit; wenn sie erscheint, so erscheint sie eben als Wahrheit und nicht als Schein. Ein wirklicher
Schein aber ist es, wenn das Naturliche, Individuelle in einem ewigen, unvergänglichen Gewande, ausgestattet mit dem Charakter der Idee, erscheint; denn dieses kommt ihr eben in Wirklichkeit nicht zu.
In diesem Sinne genommen, erscheint uns der Künstler als der Fortsetzer des Weltgeistes; jener setzt die Schöpfung da fort, wo dieser sie aus den Händen gibt. Er erscheint uns in inniger Verbruderung mit dem Weltengeiste und die Kunst als die freie Fort-Setzung des Naturprozesses. Damit erhebt sich der Künstler über das gemeine wirkliche Leben, und er erhebt uns, die wir uns in seine Werke vertiefen, mit ihm. Er schafft nicht für die endliche Welt, er wächst über sie hinaus. Goethe läßt diese seine Ansicht in seiner Dichtung «Künstlers Apotheose» von der Muse dem Künstler mit den Worten zurufen:
«So wirkt mit Macht der edle Mann
Jahrhunderte auf seinesgleichen:
Denn was ein guter Mensch erreichen kann,
Ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen.
Drum lebt er auch nach seinem Tode fort
Und ist so wirksam, als er lebte;
Die gute Tat, das schöne Wort,
Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte.
So lebst auch du (der Künstler) durch ungemeßne Zeit;
Genieße der Unsterblichkeit!»
Dieses Gedicht bringt überhaupt Goethes Gedanken über diese, ich möchte sagen, kosmische Sendung des Künstlers vortrefflich zum Ausdruck.
Wer hat wie Goethe die Kunst in solcher Tiefe erfaßt, wer wußte ihr. eine solche Würde zu geben! Wenn er sagt: «Die hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. Alles Willkürliche, Eingebildete fällt zusammen: da ist die Notwendigkeit, da ist Gott», so spricht dies wohl genugsam für die volle Tiefe seiner Ansichten. Eine Ästhetik in seinem Geiste kann gewiß nicht schlecht sein. Und das wird wohl auch noch für
manch anderes Kapitel unserer modernen Wissenschaften gelten. Als Walther von Goethe, des Dichters letzter Nachkomme, am 15. April 1885 starb und die Schätze des Goethehauses der Nation zugänglich wurden, da mochte wohl mancher achselzuckend auf den Eifer der Gelehrten blicken, der sich auch der kleinsten Überbleibsel aus dem Nachlasse Goethes annahm und ihn wie eine teure Reliquie behandelte, die man im Hinblicke auf die Forschung keineswegs geringschätzend ansehen dürfe. Aber das Genie Goethes ist ein unerschöpfliches, das nicht mit einem Blick zu überschauen ist, dem wir uns nur von verschiedenen Seiten immer mehr annähern können. Und dazu muß uns alles willkommen sein. Auch was im einzelnen wertlos erscheint, gewinnt Bedeutung, wenn wir es im Zusammenhange mit der umfassenden Weltanschauung des Dichters betrachten. Nur wenn wir den vollen Reichtuln der Lebensäußerungen durchlaufen, in denen sich dieser universelle Geist ausgelebt hat, tritt uns sein Wesen, tritt uns seine Tendenz, aus der bei ihm alles entspringt und die einen Höhepunkt der Menschheit bezeichnet, vor die Seele. Erst wenn diese Tendenz Gemeingut aller geistig Strebenden wird, wenn der Glaube ein allgemeiner sein wird, daß wir die Weltansicht Goethes nicht nur verstehen sollen, sondern daß wir in ihr, sie in uns leben muß, erst dann hat Goethe seine Sendung erfüllt. Diese Weltansicht muß für alle Glieder des deutschen Volkes und weit über dieses hinaus das Zeichen sein, in dem sie sich als in einem gemeinsamen Streben begegnen und erkennen.
EINIGE BEMERKUNGEN
Zu Seite 26. Es ist hier von der Ästhetik als einer selbständigen Wissenschaft die Rede. Man kann natürlich Ausführungen über die Künste bei leitenden Geistern früherer Zeiten durchaus finden. Ein Geschichtsschreiber der Ästhetik könnte aber alles dieses nur so behandeln, wie man sachgemäß alles philosophische Streben der Menschheit vor dem wirklichen Beginn der Philosophie in Griechenland mit Thales behandelt.
Zu Seiten 28 und 29. Es könnte auffallen, daß in diesen Ausführungen gesagt wird: das mittelalterliche Denken finde «gar nichts» in der Natur. Man könnte dagegen halten die großen Denker und Mystiker des Mittelalters. Nun beruht aber ein solcher Einwand auf einem völligen Mißverständnis. Es ist hier nicht gesagt, daß mittelalterliches Danken nicht imstande gewesen wäre, sich Begriffe zu bilden von der Bedeutung der Wahrnehmung und so weiter, sondern lediglich, daß der Menschengeist in jener Zeit dem Geistigen als solchem, in seiner ureigenen Gestalt, zugewendet war und keine Neigung verspürte, mit den Einzeltatsachen der Natur sich auseinanderzusetzen.
Zu Seite 37. Mit der «verfehlten Grundansicht» Schellings ist keineswegs gemeint das Erheben des Geistes «zu den Höhen, wo das Göttliche thront», sondern die Anwendung, die Schelling davon auf die Betrachtung der Kunst macht. Es soll das besonders hervorgehoben werden, damit das hier gegen Schelling Gesagte nicht mit den Kritiken verwechselt werde, die vielfach gegenwärtig im Umlauf sind gegen diesen Philosophen und gegen den philosophischen Idealismus überhaupt. Man kann Schelling sehr hoch stellen, wie es der Verfasser dieser Abhandlung tut, und dennoch gegen Einzelheiten in seinen Leistungen viel einzuwenden haben.
Zu Seiten 40 und 41. Es wird die sinnliche Wirklichkeit in der Kunst verklärt dadurch, daß sie so erscheint, als wenn sie Geist wäre. Insofern ist das Kunstschaffen nicht eine Nachahmung von irgend etwas schon Vorhandenem, sondern eine aus der menschlichen Seele entsprungene Fortsetzung des Weltprozesses. Die bloße Nachahmung des Natürlichen schafft ebensowenig ein Neues wie die Verbildllchung des schon vorhandenen Geistes. Als einen wirklich starken Künstler kann man nicht den empfinden, welcher auf den Beobachter den Eindruck von treuer Wiedergabe eines Wirklichen macht, sondern denjenigen, welcher zum Mitgehen mit ihm zwingt, wenn er schöpferisch den Weltprozeß in seinen Werken fortführt.
EINHEITLICHE NATURANSCHAUUNG UND ERKENNTNISGRENZEN
Die Ansichten über den Wert und die Fruchtbarkeit der Philosophie haben innerhalb unserer Nation in der jüngsten Zeit eine tiefgehende Veränderung erfahren Während zu Anfang des Jahrhunderts Fichte, Schelling und Hegel mit kühnem Denkermute an der Lösung der Welträtsel arbeiteten und das menschliche Erkenntnisvermögen fähig hielten, in die tiefsten Geheimnisse des Daseins einzudringen, vermeidet man es heute, auf die zentralen Probleme der Wissenschaften einzugehen, denn man ist überzeugt, daß die Feantwortung der letzten und höchsten Fragen dem menschlichen Geiste unmöglich ist. Das Vertrauen in das Denken ist uns verlorengegangen. Die Mutlosigkeit auf philosophischem Gebiete wird immer allgemeiner. Wir können das an der Wandlung sehen, die ein bedeutender und verdienstvoller Philosoph der Gegenwart seit seinem in die Mitte der siebziger Jahre fallenden ersten Auftreten durchgemacht hat. Ich meine Johannes Volkelt. In scharfen Worten tadelte dieser Gelehrte 1875 in der Einleitung zu seinem Buche über «Die Traum-Phantasie» die Halbheit und Kraftlosigkeit des Denkens seiner Zeitgenossen, das nicht in die Tiefen der Gegenstände eindringen will, sondern zaghaft und unsicher an der Oberfläche derselben herumtastet. Und als er im Jahre 1883 bei Übernahme der Philosophie-Professur in Basel seine Antrittsrede hielt, da hatte diese Zaghaftigkeit ihn selbst bis zu dem Grade ergriffen, daß er es als notwendige Forderung beim philosophischen Denken proklaralerte, auf eindeutige, allseitig befriedigende Lösungen der letzten Fragen zu verzichten und sich mit der Auffindung der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten sowie der Mittel und Wege, die zum Ziele führen könnten, zu begnügen. Das heißt aber doch die Unsicherheit zu einer charakteristischen Eigenschaft aller in die Tiefen gehenden Forschung erklären. Ein deutlicher Beweis für die Entmutigung auf philosophischem Gebiete ist die Entstehung einer Unzhhl von Schriften über Erkenntnistheorie. Niemand wagt es heute, sein Erkenntnisvermögen bei Erforschung des Weltgeschehens anzuwenden,
bevor er ängstlich geprüft hat, ob das Instrument zu einem solchen Beginnen auch tauglich sei. Der Philosoph Lotze hat diese wissenschaftliche Tätigkeit mit den Worten verspottet: das ewige Messerwetzen sei bereits langweilig geworden. - Diesen Spott verdient die Erkenntnistheorie allerdings nicht, denn ihr konttnt es zu, die große Frage zu lösen: Inwieferne ist der Mensch imstande, sich durch sein Wissen in den Besitz der Weltgeheimnisse zu setzen? - Haben wir darauf eine Antwort gefunden, so ist damit ein wichtiger Teil des großen Lebensproblems gelöst: In welchem Verhältnisse stehen wir zur Welt? - Unmöglich können wir uns der Aufgabe entziehen, zu einer solch wichtigen Arbeit unsere Werkzeuge zu prüfen und zu schärfen. Nicht der Betrieb der erkenntnistheoretischen Forschung ist das Beklagenswerte, wohl aber erscheint uns ein betrübendes Bild, wenn wir auf die Ergebnisse dieser Forschung in den letzten Jahrzehnten blikken. Das «Wetzen der Messer» hat nichts genützt, sie sind stumpf geblieben. Die Erkenntnistheoretiker sind fast ausnahmslos zu der Ansicht gekommen, daß die Zaghaftigkeit im Gebiete der Philosophie mit Notwendigkeit aus dem Wesen unseres Erkenntnisvermögens folge; sie glauben, daß letzteres wegen der ihm gesetzten unüberschreitbaren Grenzen bis zum Grund der Dinge überhaupt nicht dringen könne. Eine Anzahl Philosophen behaupten, die Erkenntniskritik führe zur Überzeugung, daß es eine Philosophie neben den einzelnen Erfahrungswissenschaften nicht geben könne und daß alles philosophische Denken nur die Aufgabe habe, der empirischen Einzelforschung eine methodische Grundlegung zu liefern. Wir haben akademische Lehrer der Philosophie, die ihre eigentliche Sendung darin erblicken, das Vorurteil zu zerstören, daß es eine Philosophie gebe.
Diese Ansicht schädigt das gesamte wissenschaftliche Leben der Gegenwart. Die Philosophen, denen selbst jeder Halt innerhalb ihres Gebietes fehlt, vermögen auch auf die einzelnen Spezial-wissenschaften nicht mehr jenen Einfluß auszuüben, der zur Vertiefung der Forschung wünschenswert wäre. Wir haben in jüngster Zeit an einem charakteristischen Beispiele gesehen, daß die Vertreter der Einzelforschung alle Fühlung mit der Philosophie
verloren haben. Sie zogen aus der Richtung der Kantianer, die sie mit Recht als unfruchtbar für wahre Wissenschaft bezeichnen, den falschen Schluß daß die Philosophie als solche überflüssig sei. Daher sehen sie die Beschäftigung mit derselben nicht mehr als ein notwendiges Bedurfnis des Gelehrten an Die Folge davon ist, daß sie alles Verstandnls fur eine tiefere Auffassung der Welt vetlieten und gar nicht ahnen daß ein im echten Sinne philosophischer Blick sie uberschaut und ihre Probleme viel grundlicher zu fassen weiß als sie selbst es konnen Im Jahre 1869 erschien Eduard von Hartrmanns «Philosophie des Unbewußten». Der Verfasser versuchte in einem Kapitel des Buches, sich mit dem Darwinismus philosophisch auseinanderzusetzen. Er fand , daß die damals herrschende Auffassung desselben einem folgerechten Denken gegenüber nicht standhalten könne und suchte sie zu vertiefen. Die Folge davon war daß er von seiten der Naturforscher des Dilettantismus beschul'digt und auf die denkbar schärfste Art verurteilt wurde In zahlreichen Aufsätzen und Schriften wurde ihm Einsichtslosigkeit in natutwiss-ens-chaftlichen Dingen vorgeworfen. Unter den gegnerischen Schriften befand sich auch die eines Anonymus. Das darin Gesagte wurde von angesehenen Naturforschern als- das Beste und Sachgemäßeste bezeichnet, was gegen Hartmanns Ansichten vorgebracht werden könne. Die Fachgelehrten hielten den Philosophen für vollständig widerlegt. Der berühmte Zoologe Dr. Oskar Schmidt sagte, die Schrift des Anonymus habe «alle, welche nicht auf das Unbewußte eingeschworen sind , in ihrer Überzeugung vollkommen bestätigt, daß der Darwinismus» - un Schmidt meint die von den Naturforschern vertretene Auffassung desselben - «im Rechte sei». Und der auch von mir als der größte deutsche Naturforscher der Gegenwart verehrte Ernst Haeckel schrieb: «Diese ausgezeichnete Schrift sagt im wesentlichen alles, was- ich selbst über die Philosophie des Unbewußten den Lesern der Schöpfungsgeschichte hätte sagen können...»
Als später eine zweite Auflage der Schrift erschien, stand auf dem Titeiblatte als Name des Verfassers Eduard von Hartmann. Der Philosoph hatte zeigen wollen, daß es ihm durchaus nicht unmöglich ist, sich in den naturwissenschaftlichen Gedanketikreis
einzuleben und in der Sprache der Naturforscher zu reden, wenn er will. Hartmann hat damit den Beweis-geliefert, daß es- nicht den Philosophen an Verständnis- für die Naturwissenschaft, sondern umgekehrt den Vertretern der letztern an Einsicht in die Philosophie fehlt.
Nicht besser steht es mit der Literaturgeschichte. Die Anhänger Scherers, welche gegenwärtig dieses- Feld beherrschen, zeigen in ihren Schriften, daß ihnen jegliche philosophische Bildung fehlt. Scherer selbst stand der Philosophie fremd und ablehnend gegenüber. Mit einer solchen Gesinnung kann man aber die deutschen Klassiker unmöglich verstehen, denn deren Schöpfungen sind ganz von dem philosophischen Geiste ihrer Zeit durchsetzt und nur aus-diesem heraus verständlich.
Wollen wir diese Tatsachen mit wenigen Worten zusammenfassen, so müssen wir sagen: der Glaube an die Philosophie hat in den weitesten Kreisen eine tiefe Erschütterung erfahren.
Nach meiner Überzeugung, für die ich sogleich einige Beweise bringen werde, ist die hiermit gekennzeichnete Strömung eine der traurigsten wissenschaftlichen Verirrungen. Bevor ich aber meine eigene Ansicht zum Ausdrucke bringe, sei es- mir gestattet, anzugeben, worin der Grund des- Irrtums zu suchen ist.
Unsere philosophische Wissenschaft steht unter dem mächtigen Einflusse des- Kantianismus. Dieser Einfluß ist heute bedeutender als- er zu irgendeiner Zeit gewesen ist. Im Jahre 1865 hat Otto Liebmann in seiner Schrift «Kant und die Epigonen> die Forderung erhoben: wir müssen in der Philosophie zu Kant zurückkehren. - In der Erfüllung dieser Forderung sieht er das- Heil seiner Wissenschaft. Er hat damit nur der Ansicht der überwiegenden Mehrheit der Philosophen unserer Zeit Ausdruck gegeben. Und auch die Naturforscher, insofern sich dieselben um philosophische Begriffe noch bekümmern, sehen in der Kantschen Lehre die einzig mögliche Form der Zentralwissenschaft. Von Philosophen und Naturforschem aus-gehend, ist diese Meinung auch in die weiteren Kreise der Gebildeten gedrungen, die ein Interesse für Philosophie haben. Damit hat die Kantsche Anschauungsweis-e die Bedeutung einer treibenden Kraft in unserem wissenschaftlichen
Denken erlangt. Ohne je eine Zeile von Kant gelesen Oder einen Satz aus seiner Lehre gehört zu haben, sehen die meisten unserer Zeitgenossen das Weltgeschehen in seiner Art an. Seit einem Jahrhundert wird immer wieder und wieder das stolz klingende Wort ausgesprochen: Kant habe die denkende Menschheit von den Fesseln des philosophischen Dogmatismus befreit, welcher leere Behauptungen über das Wesen der Dinge aufstellte, ohne eine kritische Untersuchung darüber anzustellen, ob der menschliche Geist auch fähig sei, über dieses Wesen etwas schlechthin Gültiges- auszumachen. - Für viele, welche dies- Wort aus-sprechen, ist aber an die Stelle des- alten Dogmas nur ein neues getreten, nämlich das- von der unumstößlichen Wahrheit der Kantschen Grundanschauungen. Diese lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen: Ein Ding kann von uns- nur wahrgenommen werden, wenn es auf uns einen Eindruck macht, eine Wirkung aus-übt. Dann ist es- aber immer nur diese Wirkung, die wir wahrnehmen, niemals- das «Ding an sich». Von dem letzteren können wir uns keinerlei Begriff machen. Die Wirkungen der Dinge auf uns- sind nun unsere Vorstellungen. Was uns- von der Welt bekannt ist, sind also nicht die Dinge, sondern unsere Vorstellungen von den Dingen. Die uns- gegebene Welt ist nicht eine Welt des-Seins-, sondern eine Vorstellungs- oder Erscheinungswelt. Die Geserze, nach denen die Einzelheiten dieser Vorstellungswelt verknüpft sind, können dann natürlich auch nicht die Gesetze der «Dinge an sich» sein, sondern jene unseres subjektiven Orgarnismus. Was für uns Erscheinung werden soll, muß sich den Gesetzen unseres- Subjektes fügen. Die Dinge können uns- nur so erscheinen, wie es unserer Natur gemäß ist. Der Welt, die uns er-scheint - und diese allein kennen wir -, schreiben wir selbst die Gesetze vor.
Was Kant mit diesen Anschauungen für die Philosophie gewonnen zu haben glaubte, wird klar, wenn man einen Blick auf die wissenschaftlichen Strömungen wirft, aus denen er heraus-gewachsen ist und denen er sich gegenüberstellt. Vor der Kantschen Reform waren die Lehren der Leibniz-Wolffschen Schule in Deutschland die alleinherrschenden. Die Anhänger dieser Richtung
wollten auf dem Wege des rein begrifflichen Denkens zu den Grundwahrheiten über das Wesen der Dinge kommen. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse galten als die klaren und notwendigen gegenüber den durch sinnliche Erfahrung gewonnenen, die man für verworren und zufällig ansah. Nur durch reine Begriffe glaubte man auch zu wissenschaftlichen Einsichten in den tieferen Zusammenhang der Weltereignisse, in die Natur der Seele und Gottes, also zu den sogenannten absoluten Wahrheiten, zu gelangen. Auch Kant war in seiner vorkritischen Zeit ein Anhänger dieser Schule. Seine ersten Schriften sind ganz in ihrem Sinne gehalten. Ein Umschwung in seinen Anschauungen trat ein, als er mit den Ausführungen des englischen Philosophen Hume bekannt wurde. Dieser suchte den Nachweis zu führen, daß es andere als Erfahrungserkenntnisse nicht gibt. Wir nehmen den Sonnenstrahl wahr, und hierauf bemerken wir, daß der Stein, auf den ersterer fällt, sich erwärmt hat. Dies nehmen wir immer wieder und wieder wahr und gewöhnen uns daran. Deshalb setzen wir voraus, daß sich der Zusaztunenhang zwischen Sonnenstrahl und Erwärmung des Steines auch in aller Zukunft in derselben Weise geltend machen wird. Eine sichere und notwendige Erkenntnis ist damit aber keineswegs gewonnen. Nichts verbürgt uns, daß ein Geschehen, das wir gewohnt sind, in einer bestimmten Weise zu sehen, nicht bei nächster Gelegenheit ganz anders ablaufe. Alle Sätze in unseren Wissenschaften sind nur durch Gewohnheit festgesetzte Ausdrücke für oft bemerkte Zusammenhänge der Dinge. Daher kann es auch über jene Objekte, um die sich die Philosophen bemühen, kein Wissen geben. Es fehlt uns hier die Erfahrung, welche die einzige Quelle unserer Erkenntnis ist. Über diese Dinge muß der Mensch sich mit dem bloßen Glauben begnügen. Will sich die Wissenschaft damit beschäftigen, so artet sie in ein leeres Spiel mit Begriffen ohne Inhalt aus. -Diese Sätze gelten, im Sinne Humes, nicht nur von den letzten psychologischen und theologischen Erkenntnissen, sondern schon von den einfachsten Naturgesetzen, zum Beispiel von dem Satze, daß jede Wirkung eine Ursache haben müsse. Auch dieses Urteil ist nur aus der Erfahrung gewonnen und durch Gewohnheit festgelegt.
Als unbedingt gültig und notwendig läßt Hume nur jene Sätze gelten, bei denen das Prädikat im Grunde schon im Subjekte eingeschlossen ist, wie das nach seiner Ansicht bei den mathematischen Urteilen der Fall ist.
Kant wurde durch die Bekanntschaft mit Humes Anschauung in seiner bisherigen Überzeugung erschüttert. Daß wirklich alle unsere Erkenntnisse mit Hilfe der Erfahrung gewonnen werden, daran zweifelte er bald nicht mehr. Aber gewisse wissenschaftliche Lehrsätze schienen ihsn doch einen solchen Charakter von Notwendigkeit zu haben, daß er an ein bloß gewohnheitsmäßiges Festhalten an denselben nicht glauben wollte. Kant konnte sich weder entschließen, den Radikalismus Humes mitzumachen, noch vermochte er bei den Bekennern der Leibniz-Wolffschen Wissenschaft zu bleiben. Jener schien ihm alles Wissen zu vernichten, in dieser fand er keinen wirklichen Inhalt. Richtig angesehen, stellt sich der Kantsche Kritizismus als ein Kompromiß zwischen Leibniz-Wolff einerseits und Hume andererseits heraus. Und die Kantsche Grundfrage lautet mit Rücksicht darauf: Wie können wir zu Urteilen kommen, die im Sinne von Leibniz und Wolff notwendig gultig sind, wenn wir zugleich zugeben, daß wir nur durch die Erfahrung zu einem wirklichen Inhalte unseres Wissens gelangen? Aus der in dieser Frage liegenden Tendenz läßt sich die Gestalt der Kantschen Philosophie begreifen. Hatte Kant einmal zugegeben, daß wir unsere Erkenntnisse aus der Erfahrung gewinnen, so mußte er der letzteren eine solche Gestalt geben, daß sie die Möglichkeit von allgemein- und notwendig-gültigen Urteilen nicht ausschloß. Das erreichte er dadurch, daß er unseren Wahrnehmungs- und Verstandesorganismus zu einer Macht erhob, der die Erfahrung miterzeugt. Unter dieser Voraussetzung konnte er sagen: Was auch immer aus der Erfahrung von uns aufgenommen wird, es muß sich den Gesetzen fügen, nach denen unsere Sinnlichkeit und unser Verstand allein auffassen können. Was sich diesen Gesetzen nicht fügt, das kann für uns nie ein Gegenstand der Wahrnehmung werden. Was uns erscheint, das hängt also von den Dingen außer uns ab, wie uns die letzteren erscheinen, das ist von der Natur unseres Organismus bedingt. Die Gesetze, unter
denen sich derselbe etwas vorstellen kann, sind somit die allgemeinsten Naturgesetze. In diesen liegt auch das Notwendige und Allgemeingültige des Weltlaufes. Wir sehen im Kantschen Sinne die Gegenstände nicht deshalb in räumlicher Anordnung, weil die Räumlichkeit eine ihnen zukommende Eigenschaft ist, sondern weil der Raum eine Form ist, unter welcher unser Sinn die Dinge wahrzunehmen befähigt ist; zwei Ereignisse verknüpfen wir nicht deshalb nach dem Begriffe der Ursächlichkeit, weil dies- einen Grund in der Wesenheit derselben hat, sondern weil unser Verstand so organisiert ist, daß er zwei in aufeinanderfolgenden Zeitmomenten wahrgenommene Prozesse diesem Begriff gemäß verknüpfen muß. So schreiben unsere Sinnlichkeit und unser Verstand der Erfahrungs-welt die Gesetze vor. Und von diesen Gesetzen, die wir selbst in die Erscheinungen legen, können wir unsnarürlich auch notwendig gültige Begriffe machen.
Klar ist es aber auch, daß diese Begriffe einen Inhalt nur von außen, von der Erfahrung erhalten können. An sich sind sie leer und bedeutungslos. Wir wissen durch sie zwar, wie uns ein Gegenstand erscheinen muß, wenn er uns- überhaupt gegeben wird. Daß er uns- aber gegeben wird, daß er in unseren Gesichtskreis- eintritt, das hängt von der Erfahmng ab. Wie die Dinge an sich, abgesehen von unserer Erfahrung, sind, darüber können wir durch unsere Begriffe also nichts- aus-machen.
Auf diese Weise hat Kant ein Gebiet gerettet, auf dem es Begriffe von notwendiger Geltung gibt; aber er hat zugleich die Möglichkeit abgeschnitten, mit Hilfe dieser Begriffe über die eigentliche, absolute Wes-enheit der Dinge etwas aus-zumachen. Kant hat, um die Notwendigkeit unserer Begriffe zu retten, deren absolute Anwendbarkeit geopfert. Um der letzteren willen wurde aber die erstere in der Vor-Kantschen Philosophie geschätzt. Kants- Vorgänger wollten aus der Gesamtheit unseres- Wissens-einen zentralen Kern bloßlegen, der seiner Natur nach auf alles, also auch auf die absoluten Wesenheiten der Dinge, auf das- «Innere der Natur> anwendbar ist. Das- Ergebnis- der Kantschen Philosophie ist aber, daß dieses- Innere, dieses «Ansich der Objekte» niemals- in den Bereich unserer Erkenntnis- treten, nie ein Gegenstand
unseres Wissens werden kann. Wir müssen uns mit der subjektiven Erscheinungswelt begnügen, welche in uns- entsteht, wenn die Außenwelt auf uns einwirkt. Kant setzt also unserem Erkenntnisvermögen unübersteigliche Schranken. Von dem «Ansich der Dinge» können wir nichts wissen. Ein nasnhafter Philosoph der Gegenwart hat dieser Ansicht folgenden präzisen Ausdruck gegeben: «Solange das Kunststück, um die Ecke zu schauen, das heißt ohne Vorstellung vorzustellen, nicht erfunden ist, wird es bei der stolzen Selbstbescheidung Kants sein Bewenden haben, daß vom Seienden dessen Daß, niemals aber dessen Was erkennbar ist» - das heißt: wir wissen, daß etwas da ist, welches- die subjektive Erscheinung des Dinges- in uns- bewirkt, was aber hinter der letzteren eigentlich steckt, bleibt uns- verborgen.
Wir haben gesehen, daß Kant diese Ansicht angenommen hat, um von jeder der zwei entgegengesetzten philosophischen Lehren, von denen er ausging, möglichst viel zu retten. Aus- dieser Tendenz heraus- entwickelte sich eine gekünstelte Auffassung unseres-Erkennens, die wir nur rnit dem zu vergleichen brauchen, was die unmittelbare und unbefangene Beobachtung ergibt, um die ganze Haltlosigkeit des- Kantschen Gedankengebäudes einzusehen. Kant denkt sich unsere Erfahmngserkenntnis aus- zwei Faktoren zustande gekommen: aus den Eindrücken, welche die Dinge außer uns auf unsere Sinnlichkeit machen, und aus den Formen, in denen unsere Sinnlichkeit und unser Verstand diese Eindrücke anordnen. Die ersteren sind subjektiv, denn ich nehme nicht das Ding wahr, sondern nur die Art und Weise, wie meine Sinnlichkeit davon affiziert wird. Mein Organismus erleidet eine Veränderung, wenn von außen etwas einwirkt. Diese Veränderung, also ein Zustand meines Selbst, meine Empfindung ist es, was rult gegeben ist. Im Akte des Auffassens- nun ordnet unsere Sinnlichkeit diese Empfindungen räumlich und zeitlich, der Verstand wieder das Räumliche und Zeitliche nach Begriffen. Auch diese Gliederung der Empfindungen, der zweite Faktor unseres Erkennens, ist somit ganz und gar subjektiv. - Diese Theorie ist weiter nichts-als- eine willkürliche Gedankenkonstruktion, die vor der Beobachtung nicht standhalten kann. Legen wir uns einmal zuerst die
Frage vor: Tritt irgendwo für uns eine einzelne Empfindung auf, einzeln für sich und abgesondert von anderen Elementen der Erfahrung? - Blicken wir auf den Inhalt der uns gegebenen Welt. Er ist eine kontinuierliche Ganzheit. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf irgendeinen Punkt unseres Erfahrungsgebietes richten, so finden wir, daß sich ringsherum anderes anschließt. Ein Abgesondertes, für sich allein Bestehendes gibt es hier nirgends. Eine Empfindung schließt sich an die andere. Wir können sie nur künstlich herausheben aus unserer Erfahrung; in Wahrheit ist sie mit dem Ganzen der uns gegebenen Wirklichkeit verbunden. Hier liegt ein Fehler, den Kant gemacht hat. Er hatte eine ganz falsche Vorstellung von der Beschaffenheit unserer Erfahrung. Die letztere besteht nicht, wie er glaubt, aus unendlich vielen Mosaiksteinchen, aus denen wir durch rein subjektive Vorgänge ein Ganzes machen, sondern sie ist uns als eine Einheit gegeben: eine Wahrnehmung geht in die andere ohne bestimmte Grenze üben Wollen wir eine Einzelheit für sich abgesondert betrachten, dann müssen wir sie erst künstlich aus dein Zusammenhange herausheben, in dem sie sich befindet. Nirgends ist uns zum Beispiel die Einzel-empfindung des Rot als solche gegeben; allseitig ist sie von anderen Qualitäten umgeben, zu denen sie gehört und ohne die sie nicht bestehen könnte. Wir müssen von allem übrigen absehen und unsere Aufmerksamkeit auf die eine Wahrnehmung richten, wenn wir sie in ihrer Vereinzelung betrachten wollen. Dieses Herausheben eines Dinges aus seinem Zusammenhange ist für uns eine Notwendigkeit, wenn wir die Welt überhaupt betrachten wollen. Wir sind so organisiert, daß wir die Welt nicht als Ganzes, als eine einzige Wahrnehmung auffassen können. Das Rechts und Links, das Oben und Unten, das Rot neben dem Grün in meinem Gesichtsfelde sind in Wirklichkeit in ununterbrochener Verbindung und gegenseitiger Zusammengehörigkeit. Wir können den Blick aber nur nach einer Richtung wenden und das in der Natur Verbundene nur getrennt wahrnehmen. Unser Auge kann immer nur einzelne Farben aus einem vielgliedrigen Farbenganzen wahrnehmen, unser Verstand einzelne Begriffsglieder aus einem in sich zusammenhängenden Ideengebäude. Die Absonderung
einer Einzelempfindung aus dem Weltzusammenhange ist somit ein subjektiver Akt, bedingt durch die eigentüinllche Einrichtung unseres Geistes. Wir müssen die einheitliche Welt in Einzelempfindungen auflösen, wenn wir sie betrachten wollen.
Wir müssen uns aber darüber klar sein, daß diese unendliche Vielheit und Vereinzelung in Wahrheit gar nicht besteht, daß sie ohne alle objektive Bedeutung für die Wirklichkeit selbst ist. Wir schaffen ein zunächst von der Wirklichkeit abweichendes Bild derselben, weil uns die Organe fehlen, sie in ihrer ureigenen Gestalt in einem Akte aufzufassen. Aber das Trennen ist nur der eine Teil unseres Erkenntnisprozesses. Wir sind beständig damit beschäftigt, jede Einzelwahmehmung, die an uns herantritt, einer Gesamt-vorstellung einzuverleiben, die wir uns von der Welt machen.
Die sich hier notwendig anschließende Frage ist nun die: Nach welchen Gesetzen verknüpfen wir das im Wahrnehmungsakte Getrennte? - Die Trennung ist eine Folge unserer Organisation; sie hat mit der Sache selbst nichts zu tun. Deshalb kann auch der Inhalt einer Einzelwahrnehmung durch den Umstand nicht verändert werden, daß sie für uns zunächst aus dem Zusammenhange gerissen erscheint, in den sie gehört. Da aber dieser Inhalt durch den Zusammenhang bedingt ist, so erscheint er in seiner Absonderung zunächst ganz unverständlich. Daß an einer bestimmten Stelle des Raumes gerade die Wahrnehmung des Rot auftrete, ist von den mannigfaltigsten Uaaständen bewirkt. Wenn ich nun das Rot wahrnehme, ohne gleichzeitig auf diese Umstände meine Aufmerksamkeit zu richten, so bleibt es mir unverständlich, woher das Rot kommt. Erst wenn ich andere Wahrnehmungen, und zwar die jener Umstände gemacht habe, an die sich jene Wahrnehmung des Rot notwendig anschließt, dann verstehe ich die Sache. Jede Wahrnehmung weist mich also über sich selbst hinaus, weil sie aus sich selbst nicht zu erklären ist. Ich verbinde deswegen die durch meine Organisation aus dem Weltganzen abgesonderten Einzelheiten gemäß ihrer eigenen Natur zu einem Ganzen. In diesem zweiten Akte wird somit das wiederhergestellt, was in dem ersten zerstört wurde, die Einheit des Objektiven tritt wieder in ihr Recht gegenüber der subjektiv bedingten Vielheit.
Der Grund, warum wir uns der objektiven Gestalt der Welt nur auf dem gekennzeichneten Umwege bemächtigen können, liegt in der Doppelnatur des Menschen. Als vernünftiges Wesen ist er sehr wohl imstande, sich den Kosmos als eine Einheit vorzustellen, in der jedes- Einzelne als- Glied des- Ganzen erscheint; als sinnliches Wesen jedoch ist er an Ort und Zeit gebunden, er kann nur einzelne der unendlich vielen Glieder des- Kosmos- wahrnehmen. Die Erfahrung kann daher nur eine durch die Beschränktheit unserer Individualität bedingte Gestalt der Wirklichkeit liefern, aus welcher die Vernunft erst das- Objektive gewinnen muß. Die sinnenfällige Anschauung entfernt uns also von der Wirklichkeit, die vernünftige Betrachtung führt uns darauf wieder zurück. Ein Wesen, dessen Sinnlichkeit in einem Akte die Welt anschauen könnte, bedürfte der Vernunft nicht. Ihm lieferte eine einzelne Wahrnehmung, was wir nur durch das Zusammenfassen unendlich vieler erreichen können.
Die eben angestellte Untersuchung unseres- Erkenntnisvermögens führt uns zu der Ansicht, daß die Vernunft das Organ der Objektivität ist oder daß sie uns die eigentliche Gestalt der Wirklichkeit liefert. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen darch den Umstand, daß die Vernunft scheinbar ganz innerhalb unserer Subjektivität liegt. Wir haben gesehen, daß in Wahrheit ihre Tätigkeit dazu bestimmt ist, gerade den subjektiven Charakter, den unsere Erfahrung durch die sinnliche Wahrnehmung erhält, aufzuheben. Durch diese Tätigkeit stellen die Wahanehmungsinhalte selbst in unserem Geiste den objektiven Zusammenhang wieder her, aus- dem sie unsere Sinne gerissen haben.
Wir sind nun an dem Punkte, wo wir das Irrtumliche der Kantschen Auffassung durchschauen können. Was eine Folge unserer Organisation ist: das Auftreten der Wirklichkeit als- unendlich viele getrennte Einzelheiten, das faßt Kant als- objektiven Tatbestand auf; und die Verbindung, die sich wieder herstellt, weil sie der objektiven Wahrheit entspricht, die ist ihm eine Folge unserer subjektiven Organisation. Gerade das Umgekehrte von dem ist wahr, was Kant behauptet hat. Ursache und Wirkung zum Beispiel sind ein zusalaanengehöriges Ganzes. Ich nehme sie getrennt
wahr und verbinde sie in der Weise, wie sie selbst zueinander streben. Kant hat sich durch Hume in den Irrtum hineintreiben lassen. Letzterer sagt: Wenn wir zwei Ereignisse immer und immer wieder in der Weise wahrnehmen, daß das eine auf das- andere folgt, so gewöhnen wir uns- an dieses Zusammensein, erwarten es auch in künftigen Fällen und bezeichnen das eine als Ursache, das andere als Wirkung. - Das widerspricht den Tatsachen. Wir bringen zwei Ereignisse nur dann in eine ursächliche verbindung, wenn eine solche aus- ihrem Inhalte folgt. Diese Verbindung ist nicht weniger gegeben als- der Inhalt der Ereignisse selbst.
Von diesem Gesichtspunkte aus- betrachtet, findet die alltäglichste sowohl wie die höchste wissenschaftliche Denkarbeit ihre Erklärung. Könnten wir die ganze Welt mit einem Blick ums-pannen, dann wäre diese Arbeit nicht notwendig. Ein Ding erklären, verständlich machen heißt nichts- anderes-, als- es wieder in den Zusammenhang hineinsetzen, aus dem es- unsere Organisation herausgerissen hat. Ein Ding, das an sich vom Weltganzen abgetrennt ist, gibt es nicht. Alle Sonderung hat bloß eine subjektive Geltung für uns. Für uns legt sich das Weltganze auseinander in:
Oben und Unten, Vor und Nach, Ursache und Wirkung, Gegenstand und Vorstellung, Stoff und Kraft, Objekt und Subjekt und so weiter. Alle diese Gegensätze sind aber nur möglich, wenn uns das Ganze, an dem sie auftreten, als Wirklichkeit gegenübertritt. Wo das nicht der Fall ist, können wir auch nlcht von Gegensätzen sprechen. Ein unmöglicher Gegensatz ist der, den Kant als bezeichnet. Dieser letztere Begriff ist ganz bedeutungslos. Wir haben nicht die geringste Veranlassung, ihn zu bilden. Er hätte nur für ein Bewußtsein Berechtigung, das- außer der Welt, die uns gegeben ist, noch eine zweite kennt und welches- beobachten kann, wie diese Welt auf unseren Organismus- einwirkt und das- von Kant als Erscheinung Bezeichnete zur Folge hat. Ein solches Bewußtsein könnte dann sagen:
Die Welt der Menschen ist nur eine subjektive Erscheinung jener zweiten, mir bekannten Welt. Die Menschen selbst aber können nur Gegensätze innerhalb der ihnen gegebenen Welt anerkennen.
Die Sumsne alles Gegebenen zu etwas anderem in Gegensatz bringen ist sinnlos. Das Kantsche «Ding an sich» folgt nicht aus dem Charakter der uns- gegebenen Welt. Es ist hinzuerfunden.
Solange wir mit solchen willkürlichen Annahmen, wie das «Ding an sich» eine is-t, nicht brechen, können wir niemals- zu einer befriedigenden Weltanschauung kommen. Unerklärlich ist uns etwas nur, solange wir das- nicht kennen, was- notwendig damit zusammenhängt. Dies haben wir aber innerhalb, nicht außerhalb unserer Welt zu suchen.
Die Rätselhaftigkeit eines- Dinges- besteht nur, solange wir es- in seiner Besonderheit betrachten. Diese ist aber von uns- hervor-gebracht und kann auch von uns wieder aufgehoben werden. Eine Wissenschaft, welche die Natur des- menschlichen Erkenntnis-prozess-es versteht, kann nur so verfahren, daß sie alles-, was sie zur Erklärung einer Erscheinung braucht, auch innerhalb der uns- gegebenen Welt sucht. Eine solche Wissenschaft kann als- Monis-musoder einheitliche Naturauffassung bezeichnet werden. Ihr steht der Dualismus oder die Zweiweltentheorie gegenüber, welche zwei voneinander absolut verschiedene Welten annimmt und die Er-klärungsprinzipien für die eine in der andern enthalten glaubt.
Diese letztere Lehre beruht auf einer falschen Auslegung der Tatsachen unseres- Erkenntnisprozesses. Der Dualist trennt die Summe alles- Seins- in zwei Gebiete, von denen jedes- seine eigenen Gesetze hat und die einander äußerlich gegenüberstehen. Er vergißt, daß jede Trennung, jede Absonderung der einzelnen Seins gebiete nur eine subjektive Geltung hat. Was- eine Folge seiner Organisation ist, das- hält er für eine außer ihm liegende, objektive Naturtatsache.
Ein solcher Dualismus- ist auch der Kantianismus. Erscheinung und An sich der Dinge sind nicht Gegensätze innerhalb der gegebenen Welt, sondern die eine Seite, das- An sich, liegt außerhalb des- Gegebenen. - Solange wir das- letztere in Teile trennen - mögen dieselben noch so klein sein im Verhältnis- zum Universum -, folgen wir einfach einem Gesetze unserer Persönlichkeit; betrachten wir aber alles- Gegebene, alle Erscheinungen als- den einen Teil und stellen ihm dann einen zweiten entgegen, dann philosophieren
wir ins- Blaue hinein. Wir haben es dann mlt einern bloßen Spiel mit Begriffen zu tun. Wir konstruieren einen Gegensatz, können aber für das- zweite Glied keinen Inhalt gewinnen, denn ein solcher kann nur aus dem Gegebenen geschöpft werden. Jede Att des Seins-, die außerhalb des- letzteren angenommen wird, ist in das Gebiet der unberechtigten Hypothesen zu verweisen. In diese Kategorie gehört das Kantsche «Ding an sich» und nicht weniger die Vorstellung, welche ein großer Teil der modernen Physiker von der Materie und deren atomistischer Zusammen-setzung hat. Wenn mir irgendeine Sinnes-empfindung gegeben ist, zum Beispiel Farbe- oder Wärmeempfindung, dann kann ich innerhalb dieser Empfindung qualitative und quantitative Sonderungen vornehmen; ich kann die räumliche Gliederung und den zeitlichen Verlauf, die ich wahrnehme, nlit mathematischen Formeln ums-pannen, ich kann die Erscheinungen getnäß ihrer Natur als Ursache und Wirkung ansehen und so weiter: ich muß aber mit diesem meinem Denkprozesse innerhalb dessen bleiben, was mir gegeben ist. Wenn wir eine sorgfältige Selbstkritik an uns üben, so finden wir auch, daß alle unsere abstrakten Anschauungen und Begriffe nur einseitige Bilder der gegebenen Wirklichkeit sind und nur als- solche Sinn und Bedeutung haben. Wir können uns- einen allseitig geschlossenen Raum vorstellen, in dem sich eine Menge elastischer Kugeln nach allen Richtungen bewegt, die sich gegenseitig stoßen, an die Wände an- und von diesen abprallen; aber wir müssen uns- darüber klar sein, daß dies eine einseitige Vorstellung ist, die einen Sinn erst gewinnt, wenn wir uns-das rein mathematische Bild mit einem sinnenfällig wirklichen Inhalt erfüllt denken. Wenn wir aber glauben, einen wahrgenommenen Inhalt ursächlich durch einen unwahrnehmbaren Seins-prozeß, der dem geschilderten mathematischen Gebilde entspricht und der außerhalb unserer gegebenen Welt sich abspielt, erklären zu können, so fehlt uns jede Selbstkritik. Den beschriebenen Fehler macht die moderne mechanische Wärmetheorie. Ganz dasselbe kann in bezug auf die moderne Farbentheorie gesagt werden. Auch sie verlegt etwas, was nur ein einseitiges Bild der Sinnenwelt ist, hinter diese als Ursache derselben. Die ganze Wellentheorie des
Lichtes- ist nur ein mathematisches Bild, das die räumlich-zeitlichen Verhältnisse dieses- bestimmten Erscheinungsgebietes- einseitig dar-stellt. Die Undulationstheorie rnacht dieses Bild zu einer realen Wirklichkeit, die nicht mehr wahrgenommen werden kann, sondern die vielmehr die Ursache dessen ist, was wir wahrnehmen.
Es ist nun gar nicht zu verwundern, daß es dem dualistischen Denker nicht gelingt, den Zusammenhang Itwischen den beiden von ihm angenommenen Weltprinzipien begreiflich zu machen. Das eine ist ihm erfahmngsmäßig gegeben, das- andere von ihm hinzugedacht. Er kann also auch folgerichtig alles, was- das- eine enthält, nur durch Erfahrung, was in dem andern enthalten ist, nur durch Denken gewinnen. Da aber aller Erfahrungsinhalt nur eine Wirkung des hinzugedachten wahren Seins- ist, so kann in der unserer Beobachtung zugänglichen Welt nie die Ursache selbst gefunden werden. Ebensowenig ist das- Umgekehrte möglich: ausder gedachten Ursache die erfahrungsmäßig gegebene Wirklichkeit abzuleiten. Dies letztere deshalb nicht, weil nach unseren bisherigen Auseinandersetzungen alle solchen erdachten Ursachen nur einseitige Bilder der vollen Wirklichkeit sind. Wenn wir ein solches Bild überblicken, so können wir mittels eines- bloßen Gedankenprozesses nie das- darinnen finden, was nur in der beobachteten Wirklichkeit damit verbunden ist. Aus- diesen Gründen wird derjenige, welcher zwei Welten annimmt, die durch sich selbst getrennt sind, niemals zu einer befriedigenden Erklärung ihrer Wechselbeziehung kommen können.
Und hierinnen liegt die Veranlassung zur Annahme von Erkenntnis-grenzen. Der Anhänger der monistischen Weltanschauung weiß, daß die Ursachen zu den ihm gegebenen Wirkungen im Bereiche seiner Welt liegen müssen. Mögen die ersteren von den letzteren räumlich oder zeitlich noch so weit entfernt liegen:
sie mussen sich im Bereiche der Erfahrung finden. Der Umstand, daß von zwei Dingen, die einander gegenseitig erklären, ihm augenblicklich nur das eine gegeben ist, erscheint ihm nur als-eine Folge seiner Individualität, nicht als etwas- im Objekte selbst Begründetes-. Der Bekenner einer dualistischen Ansicht glaubt die Erklärung für ein Bekanntes- in einem willkürlich hinzugedachten
Unbekannten annehmen zu müssen. Da er dieses letztere unberechtigterweise mit solchen Eigenschaften ausstattet, daß es sich in unserer ganzen Welt nicht finden kann, so statuiert er hier eine Grenze des Erkennens. Unsere Auseinandersetzungetl haben den Beweis- geliefert, daß alle Dinge, zu denen unser Erkenntnisvermögen angeblich nicht gelangen kann, erst zu der Wirklichkeit künstlich hinzugedacht werden müssen. Wir erkennen nur dasjenige nicht, was wir erst unerkennbar gemacht haben. Kant gebietet unserem Erkennen Halt vor dem Geschöpfe seiner Phantasie, vor dem «Ding an sich», und Du Bois--Reymond stellt fest, daß die unwahrnehmbaren Atome der Materie durch ihre Lage und Bewegung Empfindung und Gefühl erzeugen, um dann zu dem Schlusse zu kommen: wir können niemals- zu einer befriedigenden Erklärung darüber gelangen, wie Materie und Bewegung Empfindung und Gefühl erzeugen, denn «es- ist eben durchaus-und für immer unbegreiflich, daß es- einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammenwirken Bewußtsein entstehen könne>. - Diese ganze Schlußfolgerung fällt in nichts- zusammen, wenn man erwägt, daß die sich bewegenden und in bestimmter Weise gelagerten Atome eine Abstraktion sind, der ein absolutes, von dem wahrnehmbaren Geschehen abgesondertes- Dasein gar nicht zugeschrieben werden darf.
Eine wissenschaftliche Zergliederung unserer Erkenntnistätigkeit führt, wie wir gesehen haben, zu der Überzeugung, daß die Fragen, die wir an die Natur zu stellen haben, eine Folge des eigentümlichen Verhältnisses sind, in dem wir zur Welt stehen. Wir sind beschränkte Individualitäten und können deshalb die Welt nur stückweise wahrnehmen. Jedes Stück, an und für sich betrachtet, ist ein Rätsel oder, anders- ausgedrückt, eine Frage für unser Erkennen. Je mehr der Einzelheiten wir aber kennenlernen, desto klarer wird uns die Welt. Eine Wahrnehmung erklärt die andere. Fragen, welche die Welt an uns stellt und die mit den Mitteln, die sie uns bietet, nicht zu beantworten wären, gibt es
nicht. Für den Monismus existieren demnach keine prinzipiellen Erkenntnisgrenzen. Es kann zu irgendeiner Zeit dies oder jenes unaufgeklärt sein, weil wir zeitlich oder räumlich noch nicht in der Lage waren, die Dinge aufzufinden, welche dabei im Spiele sind. Aber was heute noch nicht gefunden ist, kann es morgen werden. Die hierdurch bedingten Grenzen sind nur zufällige, die mit dem Fortschreiten der Erfahrung und des Denkens verschwinden. In solchen Fällen tritt dann die Hypothesenbildung in ihr Recht ein. Hypothesen dürfen nicht über etwas aufgestellt werden, das unserer Erkenntnis prinzipiell unzugänglich sein soll. Die atomistische Hypothese ist eine völlig unbegründete. Eine Hypothese kann nur eine Annahme über einen Tatbestand sein, der uns aus zufälligen Gründen nicht zugänglich ist, der aber seinem Wesen nach der uns gegebenen Welt angehört. Berechtigt ist zum Beispiel eine Hypothese über einen bestimmten Zustand unserer Erde in einer längst verflossenen Periode. Zwar kann dieser Zustand nie Objekt der Erfahrung werden, weil mittlerweile ganz andere Bedingungen eingetreten sind. Wenn aber ein wahrnehmendes Individuum zu der vorausgesetzten Zeit dagewesen wäre, dann härte es den Zustand wahrgenommen. Unberechtigt dagegen ist die Hypothese, daß alle Empfindungsqualitäten nur quantitativen Vorgängen ihre Entstehung verdanken, weil qualitätslose Vorgänge nicht wahrgenommen werden können.
Der Monismus oder die einheitliche Naturerklärung geht aus einer kritischen Selbstbetrachtung des Menschen hervon Diese Betrachtung führt uns zur Ablehnung aller außerhalh der Welt gelegenen erklärenden Ursachen derselben. Wir können diese Auffassung aber auch auf das praktische Verhältnis des Menschen zur Welt ausdehnen. Das menschliche Handeln ist ja nur ein spezieller Fall des allgemeinen Weltgeschehens. Seine Erklärungsprinzipien dürfen daher gleichfalls nur innerhalh der uns gegebenen Welt gesucht werden. Der Dualismus, der die Grundkräfte der uns vorliegenden Wirklichkeit in einem uns unzugänglichen Reiche sucht, versetzt dahin auch die Gebote und Normen unseres Handelns. Auch Kant ist in diesem Irrtume befangen. Er hält das Sittengesetz für ein Gebot, das von einer uns fremden Welt dem
Menschen auferlegt ist, für einen kategorischen Imperativ, dem er sich zu fügen hat, auch dann, wenn seine eigene Natur Neigungen entfaltet, die einer solchen aus einem Jenseits in unser Diesseits hereintönenden Stimme sich widersetzen. Man braucht sich nur an Kants bekannte Apostrophe an die Pflkht zu erinnern, um das erhärtet zu finden: Einem solchen von außen der menschlichen Natur aufgedrungenen Imperativ setzt der Monismus die aus der Menschenseele selbst geborenen sittlichen Motive entgegen. Es ist eine Täuschung, wenn man glaubt, der Mensch könne nach anderen als selbstgemachten Geboten handeln. Die jeweiligen Neigungen und Kulturbedürfnisse erzeugen gewisse Maximen, die wir als unsere sittlichen Grundsätze bezeichnen. Da gewisse Zeitalter oder Völker ähnliche Neigungen und Bestrebungen haben, so werden die Menschen, die denseiben angehören, auch ähnliche Grundsätze aufstellen, um sie zu befriedigen. Jedenfalls aber sind solche Grundsätze, die dann als ethische Motive wirken, durchaus nicht von außen eingepflanzt, sondern aus den Bedürfnissen heraus geboren, also innerhalb der Wirklichkeit erzeugt, in der wir leben. Der Moralkodex eines Zeitalters oder Volkes ist einfach der Ausdruck dafür, wie man innerhalb derselben den herrschenden Kulturzielen am besten sich zu nähern glaubt. So wie die Naturwirkungen aus Ursachen entspringen, die innerhalb der gegebenen Natur liegen, so sind unsere sittlichen Handlungen die Ergebnisse von Motiven, die innerhalb unseres Kulturprozesses liegen. Der Monismus sucht also den Grund unserer Handlungen im strengsten Sinne des Wortes innerhalb der menschlichen Natur. Er macht dadurch den Menschen aber auch zu seinem eigenen Gesetzgeber. Der Dualismus fordert Unterwerfung unter die von irgendwoher geholten sittlichen Gebote; der Monismus weist den Menschen auf sich selbst, auf seine autonome Wesenheit. Er macht ihn zum Herrn seiner selbst Erst vom Standpunkte des Monismus aus können wir den Menschen als
wahrhaft freies Wesen im ethischen Sinne auffassen. Nicht von einem andern Wesen stammende Pflichten sind ihm auferlegt, sondern sein Handeln richtet sich einfach nach den Grundsätzen, von denen jeder findet, daß sie ihn zu den Zielen führen, die von ihm als erstrebenswert angesehen werden. Eine dem Boden des Monismus entsprungene sittliche Anschauung ist die Feindin alles blinden Autoritätsglaubens. Der autonome Mensch folgt eben nicht der Richtschnur, von der er bloß glauben soll, daß sie ihn zum Ziele führe, sondern er muß einsehen, daß sie ihn dahin führe, und das Ziel selbst muß ihm individuell als ein erwünschtes erscheinen. Hier ist auch der Grundgedanke des modernen Staates zu suchen, der auf die Volksvertretung gestützt ist. Der autonome Mensch will nach Gesetzen regiert werden, die er sich selbst gegeben hat. Wären die sittlichen Maximen ein für allemal fest bestimmt, dann brauchten sie einfach kodifiziert zu werden, und die Regierung hätte sie zu vollstrecken. Zur Regierung wäre die Kenntnis des allgemein-menschlichen Moralkodex hinreichend. Wenn dann immer der Weiseste, der den Inhalt dieses heiligen Buches am besten kennt, an der Spitze des Staates stünde, so wäre das Ideal einer menschlichen Verfassung erreicht. In dieser Weise etwa hat sich Plato die Sache gedacht. Der Weiseste hätte zu befehlen und die anderen zu gehorchen. Die Volksvertretung hat nur einen Sinn unter der Voraussetzung, daß die Gesetze der Ausfluß der Kulturbedürfnisse einer Zeit sind, und diese letzteren wurzeln wieder in den Bestrebungen und Wünschen der einzelnen Individualität. Durch die Volksvertretung soll erreicht werden, daß das Individuum nach Gesetzen regiert wird, von denen es sich sagen kann, daß sie seinen eigenen Neigungen und Zielen entsprechen. Der Staatswille soll auf diese Weise in die möglichste Kongruenz gebracht werden mit dem Individualwillen. Mit Hilfe der Volksvertretung gibt der autonome Mensch sich selbst seine Gesetze. Durch die moderne Staatsverfassung soll also dasjenige zur Geltung kommen, was im Gebiete des Sittlichen allein Wirklichkeit hat, nämiich die Individualität, im Gegensatze zu dem Staate, der sich auf Autorität und Gehorsam stützt und der keinen Sinn hat, wenn man nicht den abstrakten sittlichen Normen eine
objektive Realität zusprechen wollte. Ich will nicht behaupten, daß wir gegenwärtig diesen von mir gekennzeichneten Idealstaat überall als wünschenswert hinstellen dürfen. Dazu sind die Neigungen der Menschen, die zu unseren Volksgemeinschaften gehören, zu ungleiche. Ein großer Teil des Volkes wird von zu niedrigen Bedürfnissen beherrscht, als daß wir wünschen sollten, der Staatswille solle der Ausdruck solcher Bedürfnisse sein. Aber die Menschheit ist in fortwährender Entwickelung begriffen, und eine vernünftige Volkspädagogik wird den allgemeinen Bildungsstand so zu heben versuchen, daß jeder Mensch fähig sein kann, sein eigener Herr zu sein. In dieser Richtung muß sich unsere Kultur-entwickelung bewegen. Nicht durch Bevormundungsgesetze, welche die Menschen davor bewahren, zum Spielballe ihrer blinden Triebe zu werden, fördern wir die Kultur, sondern dadurch, daß wir die Menschen dazu bringen, nur in den höheren Neigungen ein erstrebenswertes Ziel zu suchen. Dann können wir sie auch ohne Gefahr ihre eigenen Gesetzgeber werden lassen. In der Erweiterung der Erkenntnis liegt also allein die Aufgabe der Kultur. Wenn dagegen in unserer Zeit sich Vereinigungen bilden, welche die Sittlichkeit für unabhängig von der Erkenntnis erklären wollen, wie etwa die , so ist das ein verhängnisvoller Irrtum. Diese Gesellschaft will die Menschen dazu veranlassen, den allgemein-menschlichen sittlichen Normen gemäß zu leben. Ja, sie will auch einen Kodex solcher Normen zu einem integrierenden Bestandteil unseres Unterrichtes machen. Damit komme ich auf ein Gebiet, welches bis jetzt noch am wenigsten von den Lehren des Monismus berührt worden ist. Ich meine die Pädagogik. Was ihr am meisten obliegt: die freie Entfaltung der Individualität, der einzigen Realität auf dem Gebiete der Kultur, das wird bisher am meisten vernachlässigt, und der angehende Mensch dafür in ein Netz von Normen und Geboten eingespannt, die er in seinem künftigen Leben befolgen soll. Daß jeder, auch der Geringste, etwas in sich hat, einen individuellen Fonds, der ihn befähigt, Dinge zu leisten, die nur er allein in einer ganz bestimmten Weise leisten kann: das wird dabei vergessen. Dafür spannt man ihn auf die Folter allgemeiner Begriffssysteme,
legt ihm das Gängelband konventioneller Vorurteile an und untergräbt seine Individualität. Für den wahren Erzieher gibt es keine allgemeinen Erziehungsnormen, wie sie etwa die Herbartsche Schule aufstellen will. Für den echten Pädagogen ist jeder Mensch ein Neues, noch nie Dagewesenes, ein Studien-objekt, aus dessen Natur er die ganz individuellen Prinzipien entnimmt, nach denen er in diesem Falle erziehen soll. Die Forderung des Monismus ist die: statt den angehenden Pädagogen allgemeine methodische Grundsätze einzupflanzen, sie zu Psychologen zu bilden, welche imstande sind, die Individualitäten zu begreifen, die sie erziehen sollen. So ist der Monismus geeignet, auf allen Gebieten des Erkennens und Lebens unserem größten Ziele zu dienen: der Entwickelung des Menschen zur Freiheit, was gleichbedeutend ist mit der Pflege des Individuellen in der Menschennatur. Daß unsere Zeit empfänglich ist für solche Lehren, das glaube ich aus dem Umstande entnehmen zu können, daß ein junges Geschlecht dem Manne begeistert zugejubelt hat, der die monistischen Lehren zum ersten Male in populärer Art, wenn auch aus einer kranken Seele gespiegelt, auf das Gebiet der Ethik übertragen hat: ich meine Friedrich Nietzsche. Der Enthusiasmus, den er gefunden hat, ist ein Beweis dafür, daß es unter unseren Zeitgenossen nicht wenige gibt, welche es müde sind, sittlichen Chimären nachzulaufen, und die die Sittlichkeit da suchen, wo sie allein wirklich lebt: in der Menschenseele. Der Monismus als Wissenschaft ist die Grundlage für ein wahrhaft freies Handeln, und unsere Entwickelung kann nur den Gang nehmen: durch den Monismus zur Freiheitsphilosophie!
GOETHES NATURANSCHAUUNG
gemäß den neuesten Veröffentlichungen des Goethe-Archivs
Einmal schon gab eine Geburtstagsfeier Goethes Veranlassung, daß hier in Frankfurt ein Mann das offene Bekenntnis ablegte: er sehe in Deutschlands größtem Dichter auch einen Geist, der als einer der ersten in Betracht kommt, wenn von den Pfadfindern auf dem Gebiete der Naturerkenntnis die Rede ist. Arthur Schopenhauer schrieb in das Goethe-Albumn, mit dem man den 28. August 1849 begrüßte, einen Beitrag, der von kräftigen Zornesworten über die Gegner von Goethes Farbenlehre so voll war wie die Seele des Philosophen von begeisterter Anerkennung für Goethe den Naturforscher. , und das ist - nach seiner Ansicht - . In der ängstlichen Vermeidung alles Subjektiven und Persönlichen gehen aber die Physiker unserer Zeit noch viel weiter als diejenigen, die Goethe mit diesen Worten treffen wollte. Das Ideal unserer Zeitgenossen in dieser Beziehung ist, alle Erscheinungen auf möglichst wenige unlebendige
Grundkräfte zurückzuführen, die nach rein mathematischen und mechanischen Gesetzen wirken. Goethes Sinn war auf anderes gerichtet.> Was in der übrigen Natur nur verborgen ist, erscheint seiner Ansicht nach iln Menschen in seiner ureigenen Gestalt. Der Menschengeist ist für Goethe die höchste Form des Naturprozesses, das Organ, das sich die Natur anerschaffen hat, um durch es ihr Geheimnis offen an den Tag treten zu lassen.> Alle Kräfte, die die Welt durchzittern, dringen in die Menschenseele ein, um da zu sagen, was sie ihrem Wesen nach sind.> Eine von dem Menschen abgesonderte Natur konnte sich Goethe nicht denken. Eine tote, geistlose Materie war seinem Vorstellen un-möglich. Eine Naturerklärung mit Prinzipien, aus denen nicht auch der Mensch seinem Dasein und Wesen nach begreiflich ist, lehnte er ab.>
Ebenso begreiflich wie die Gegnerschaft der Physiker ist die Zustimmung, welche Goethes Naturauffassung bei einigen der hervorragendsten Erforscher der Lebenserscheinungen, besonders bei dem geistvollsten Naturforscher der Gegenwart, Ernst Haeckel, gefunden hat. Haeckel, der den Darwinschen Ideen über die Entstehung der Organismen eine der deutschen Gründlichkeit angemessene Vervollkommnung hat angedeihen lassen, legt sogar den größten Wert darauf, daß der Einklang seiner Grundüberzeugungen mit den Goetheschen erkannt werde. Für Haeckel ist die Frage Darwins nach dein Ursprunge der organischen Formen sogleich zu der höchsten Aufgabe geworden, die sich die Wis-senschaft vom organischen Leben überhaupt stellen kann, zu der vom Ursprunge des Menschen. Und er ist genötigt gewesen, an Stelle der toten Materie der Physiker solche Naturprinzipien anzunehmen, mit denen man vor den Menschen nicht Halt zu machen braucht. Haeckel hat in seiner vor kurzem (1892) erschienenen Schrift , welche nach meiner Überzeugung die bedeutsamste Kundgebung der neuesten Naturphilosophie ist, ausdrücklich betont, daß er sich einen «immateriellen lebendigen Geist» ebensowenig denken könne wie eine «tote geistlose Materie».> Und ganz übereinstimmend damit sind Goethes Worte, daß «die
Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existiert und wirksam sein kann>.
Gegenüber dem hartnäckigen Widerstande der Physiker finden wir hier eine Naturauffassung, die Goethes Ideen mit Stolz für sich in Anspruch nimmt.
Für denjenigen, der sich die volle Würdigung des Goetheschen Genies auf einem bestimmten Gebiete zur Aufgabe macht, entsteht nun die Frage: Wird diejenige Richtung der modernen Natur-wissenschaft, welche wir soeben gekennzeichnet haben, Goethe vollkommen gerecht? Wem es nur urn diese Naturwissenschaft zu tun ist, der fragt natürlich einfach: inwiefern stimmt Goethe mit mir überein? Er betrachtet Goethe als einen Vorläufer seiner eigenen Richtung in bezug auf jene Anschauungen, die dieser mit ihm gemein hat. Sein Maßstab ist die gegenwärtige Naturanschauung Goethe wird nach ihr beurteilt. Diesen Beurteilern gegenüber sei mein Standpunkt in den folgenden Auseinandersetzungen: Wie hätte sich Goethe zu denjenigen Naturforschern verhalten, die heute sich in ihrer Art anerkennend für ihn aussprechen? Wäre er des Glaubens gewesen, daß sie Ideen ans Tageslicht gebracht haben, die er nur vorausgeahnt, oder hätte er vielmehr gemeint, daß die Gestalt, die sie der Naturwissenschaft gegeben haben, seinen Anfängen nur unvollkommen entspricht? Wie wir diese Frage beantworten und wie wir uns selbst dann zu Goethes Weltanschauung stellen, davon wird es abhängen, ob wir in Goethe, dem Naturforscher, bloß eine mehr oder weniger interessante Erscheinung der Wissenschaftsgeschichte sehen oder ob wir auch auf naturwissenschaftlichem Gebiete seine Schöpfungen für unsere Erkenntnis noch fruchtbar machen und ihn, um mit einer Wendung Herman Grimms zu sprechen, in den Dienst der Zeit stellen wollen.
Es handelt sich darum, aus der Betrachtungs- und Denkart Goethes selbst, nicht aus der äußerlichen Vergleichung mit wissenschaftlichen Ideen der Gegenwart, in den Geist seiner Naturanschauung einzudringen. Wenn wir Goethe recht verstehen wollen, so kommen die einzelnen Leistungen, in denen sein reicher Geist die wissenschaftlichen Gedanken niedergelegt hat, weniger
in Betracht als die Absichten und Ziele, aus denen sie hervorgegangen sind. Hervorragende Männer können in einer zweifachen Weise für die Menschheit epochemachend werden. Entweder sie finden für bereits gestellte Fragen die Lösung, oder sie finden neue Probleme in Erscheinnngen, an denen ihre Vorgänger achtlos vorübergegangen sind. In der letzteren Art wirkte zum Beispiel Galilei auf die Entwickelung der Wissenschaft ein.> Unzählige Menschen vor ihm hatten einen schwingenden Körper gesehen, ohne daran etwas Auffälliges zu bemerken; für seinen Blick enthüllte sich in dieser Erscheinung die große Aufgabe, die Gesetze der Pendelbewegung kennenzulernen, und er schuf in diesem Gebiete der Mechanik ganz neue wissenschaftliche Grundlagen. In Geistern solcher Art leben eben Bedürfnisse, die ihre Vorgänger noch nicht gekannt haben, zum ersten Male auf. Und das Bedürfnis öffnet die Augen für eine Entdeckung.
Frühzeitig erwachte in Goethe ein solches Bedürfnis. Sein Forschertrieb entzündete sich zunächst an der Mannigfaltigkeit des organischen Lebens. Mit anderem Blick als seine wissenschaftlichen Zeitgenossen sah er die Fülle der Gestalten des Tier- und Pflanzenreiches. Sie glaubten genug getan zu haben, wenn sie die Unterschiede der einzelnen Formen genau beobachteten, die Eigentümlichkeiten jeder besonderen Art und Gattung feststellten und auf Grund dieser Arbeit eine äußerliche Ordnung, ein System der Lebewesen schufen. Linné, der Botaniker, namentlich war ein Meister in dieser Kunst des Klassifizierens. Goethe lernte die Schriften dieses Mannes, wie wir aus dem Briefwechsel mit Frau von Stein wissen, im Jahre 1782 kennen. Was für Linné das Wichtigste war, die Merkmale genau festzustellen, welche eine Form von der anderen unterscheide, kam für Goethe zunächst gar nicht in Betracht. Für ihn entstand die Frage: was lebt in der unendlichen Fülle der Pflanzenwelt, das diese Mannigfaltigkeit zu einem einheitlichen Naturreich verbindet? Er wollte erst begreifen, was eine Pflanze überhaupt ist, dann hoffte er auch zu verstehen, warum sich die Pflanzennatur in so unendlich vielen Formen auslebt. Von seinem Verhältnis zu Linné sagt er später selbst: «Das, was er mit Gewalt auseinanderzuhalten suchte, mußte nach dem
innersten Bedürfnis meines Wesens zur Vereinigung anstreben.» Daß Goethe hier auf dem rechten Wege war, ein Naturgesetz zu finden, lehrt eine einfache Betrachtung darüber, wie sich Naturgesetze in den Erscheinungen aussprechen. Jede Naturerscheinung geht aus einer Reihe sie bedingender Umstände hervor. Nehmen wir etwas ganz Einfaches. Wenn ich einen Stein in waagerechter Richtung werfe, so wird er in einer gewissen Entfernung von mir auf die Erde fallen. Er hat im Raume während seines Hinfliegens eine ganz bestimmte Linie beschrieben. Diese Linie ist von drei Bedingungen abhängig: von der Kraft, mit der ich den Stein stoße, von der Anziehung, die die Erde auf ihn ausübt, und von dem Widerstand, den ihm die Luft entgegensetzt. Ich kann mir die Bewegung des Steines erklären, wenn ich die Gesetze kenne, nach denen die drei Bedingungen auf ihn einwirken. Daß Erscheinungen der leblosen Natur auf diese Weise erklärt werden müssen, das heißt dadurch, daß man ihre Ursachen und deren Wirkungsgesetze sucht, hat bei Goethes Auftreten niemand bezweifelt, der für die Geschichte der Wissenschaften in Betracht kommt. Anders aber stand es um die Erscheinungen des Lebens. Man sah Gattungen und Arten vor sich und innerhalb ihrer jedes Wesen mit einer solchen Einrichtung, mit solchen Organen ausgerüstet, wie sie seinen Lebensbedürfnissen entsprechen. Eine derartige Gesetzmäßigkeit hielt man nur für möglich, wenn die organischen Formen nach einem wohlüberlegten Schöpfungsplan gestaltet sind, demgemäß jedes Organ gerade die Bildung erhalten hat, die es haben muß, wenn es seinen vorbedachten Zweck erfüllen soll. Während man also die Erscheinungen der leblosen Natur aus Ursachen zu erklären suchte, die innerhalb der Welt liegen, glaubte man für die Organismen außerweltliche Erklärungsprinzipien annehmen zu müssen. Den Versuch, die Erscheinungen des Lebens ebenfalls auf Ursachen zurückzuführen, die innerhalb der uns beobachtbaren Welt liegen, hat man vor Goethe nicht versucht, ja der berühmte Philosoph Immanuel Kant hat noch 1790 jeden solchen Versuch «ein Abenteuer der Vernunft» genannt. Man dachte sich einfach jede der Linnéschen Arten nach einem bestimmten vorgedachten Plan geschaffen und meinte eine Erscheinung
erklärt zu haben, wenn man den Zweck erkannte, dem sie dienen soll. Eine solche Anschauungsweise konnte Goethe nicht befriedigen. Der Gedanke eines Gottes, der außerhalb der Welt ein abgesondertes Dasein fährt und seine Schöpfung nach äußerlich aufgedrängten Gesetzen lenkte, war ihm fremd. Sein ganzes Leben hindurch beherrschte ihn der Gedanke:
«Was wär' ein Gott, der nur von außen stieße,
Im Kreis das All am Finger laufen ließe?
Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
So daß, was in ihm lebt und webt und ist,
Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.>
Was mußte Goethe, dieser Gesinnung gemäß, in der Wissenschaft der organischen Natur suchen? Erstens ein Gesetz, welches erklärt, was die Pflanze zur Pflanze, das Tier zum Tiere macht, zweitens ein anderes, das begreiflich macht, warum das Gemeinsame, allen Pflanzen und Tieren zugrunde Liegende in einer solchen Mannigfaltigkeit von Formen erscheint. Das Grundwesen, das sich in jeder Pflanze ausspricht, die Tierheit, die in allen Tieren zu finden ist, die suchte er zunächst. Die künstlichen Scheidewände zwischen den einzelnen Gattungen und Arten mußten niedergerissen, es mußte gezeigt werden, daß alle Pflanzen nur Modifikationen einer Urpflanze, alle Tiere eines Urtieres sind. Daß wir die Urform erkennen können, die allen Organismen zugrunde liegt, und daß wir die gesetzmäßigen Ursachen innerhalb unserer Erscheinungswelt zu finden imstande sind, welche bewirken, daß diese Urform einmal als Lilie, das andere Mal als Eiche erscheint, hatte Kant für unmöglich erklärt. Goethe unternahm «das Abenteuer der Vernunft und hat damit eine wissenschaftliche Tat ersten Ranges vollbracht. Goethe ging also darauf aus: sich eine Vorstellung von jener Urform zu machen und die Gesetze und Bedingungen zu suchen, welche das Auftreten in den mannigfachen Gestalten erklären. Beiden Forderungen muß aber, seiner Meinung nach, die Wissenschaft gerecht werden. Wer keinen Begriff von der Urform hat, der kann zwar die Tatsachen
angeben, unter deren Einfluß sich eine organische Form in die andere verwandelt hat, er kann aber niemals zu einer wirklichen Erklärung gelangen. Deshalb betrachtete es Goethe als seine erste Aufgabe, die Urpflanze und das Urtier oder, wie er es auch nannte, den Typus der Pflanzen und der Tiere zu finden.
Was versteht Goethe unter diesem Typus? Er hat sich darüber klar und unzweideutig ausgesprochen. Er sagt, er fühlte die Notwendigkeit: «einen Typus aufzustellen, an welchem alle Säugetiere nach Übereinstimmung und Verschledenheit zu prüfen wären, und wie ich früher die Urpflanze aufgesucht, so trachtete ich nunmehr das Urtier zu finden, das heißt denn doch zuletzt:
den Begriff, die Idee des Tieres. Und ein anderes Mal mit noch größerer Deutlichkeit: «Hat man aber die Idee von diesem Typus gefaßt, so wird man recht einsehen, wie unmöglich es sei, eine einzelne Gattung als Kanon aufzustellen. Das Einzelne kann kein Muster des Ganzen sein, und so dürfen wir das Muster für alle nicht im Einzelnen suchen. Die Klassen, Gattungen, Arten und Individuen verhalten sich wie die Fälle zum Gesetz: sie sind darin enthalten, aber sie enthalten und geben es nicht. Hätte man also Goethe gefragt, ob er in einer bestimmten Tier- oder Pflanzenform, die zu irgendeiner Zeit existiert hat, seine Urform, seinen Typus verwirklicht sehe, so hätte er ohne Zweifel mit einem kräftigen Nein geantwortet. Er hätte gesagt: So wie der Haushund, so ist auch der einfachste tierische Organismus nur ein Spezialfall dessen, was ich unter Typus verstehe. Den Typus findet man überhaupt nicht in der Außenwelt verwirklicht, sondern er geht uns als Idee in unserem Innern auf, wenn wir das Gemeinsame der Lebewesen betrachten. Sowenig der Physiker einen einzelnen Fall, eine zufällige Erscheinung zum Ausgangspunkte seiner Untersuchungen macht, sowenig darf der Zoologe oder Botaniker einen einzelnen Organismus als Urorganümus ansprechen.
Und hier ist der Punkt, an dein es klar werden muß, daß der neuere Darwinismus weit hinter Goethes Grundgedanken zurück-bleibt. Diese wissenschaftliche Strömung findet, daß es zwei Ursachen gibt, unter deren Einfluß eine organische Form sich in eine andere umformen kann: die Anpassung und den Kampf ums
Dasein. Unter Anpassung versteht rnnn die Tatsache, daß ein Organismus infolge von Einwirkungen der Außenwelt eine Veränderung in seiner Lebenstärigkeit und in seinen Gestaltverhält-nissen annimmt. Er erhält dadurch Eigentümlichkeiten, die seine Voreltern nicht hatten. Auf diesem Wege kann sich also eine Umformung bestehender organischer Formen vollziehen. Das Gesetz vom Kampf ums Dasein beruht auf folgenden Erwägungen. Das organische Leben bringt viel mehr Keime hervor, als auf der Erde Platz zu ihrer Ernährung und Entwickelung finden. Nicht alle können zur vollen Reife kommen. Jeder entstehende Organismus sucht aus seiner Umgebung die Mittel zu seiner Existenz. Es ist unausbleiblich, daß bei der Fülle der Keime ein Kampf entsteht zwischen den einzelnen Wesen. Und da nur eine begrenzte Zahl den Lebensunterhalt finden kann, so ist es natürlich, daß diese aus denen besteht, die sich im Kampf als die stärkeren erweisen. Diese werden als Sieger hervorgehen. Welche sind aber die Stärkeren? Ohne Zweifel diejenigen mit einer Einrichtung, die sich als zweckmäßig erweist, um die Mittel zum Leben zu beschaffen. Die Wesen mi? unzweckmäßiger Organisation müssen unterliegen und aussterben. Deswegen, sagt der Darwinismus, kann es nur zweckmäßige Organisationen geben.> Die anderen sind einfach im Karnpf ums Dasein zugrunde gegangen. Der Darwinismus erklärt mit Zugrundelegung dieser beiden Prinzipien den Ursprung der Arten so, daß sich die Organismen unter dem Einfluß der Außenwelt durch Anpassung umwandeln, die hierdurch gewonnenen neuen Eigentümlichkeiten auf ihre Nachkommen verpflanzen und von den auf diese Weise umgewandelten Formen immer diejenigen sich erhalten, welche in dem Umwandlungsprozesse die zweckentsprechendste Gestalt angenommen haben.
Gegen diese beiden Prinzipien hätte Goethe zweifellos nichts einzuwenden. Wir können nachweisen, daß er beide bereits gekannt hat. Für ausreichend aber, um die Gestalten des organischen Lebens zu erklären, hat er sie nicht gehalten. Sie waren ihm äußere Bedingungen, unter deren Einfluß das, was er Typus nannte, besondere Formen annimmt und sich in der mannigfaltigsten Weise verwandeln kann. Bevor sich etwas umwandelt, muß es
aber erst vorhanden sein. Anpassung und Kampf ums Dasein setzen das Organische voraus, das sie beeinflussen. Die notwendige Voraussetzung sucht Goethe erst zu gewinnen. Seine 1790 veröffentlichte Schrift «Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären> verfolgt den Gedanken, eine ideale Pflanzengestalt zu finden, welche allen pflanzlichen Wesen als deren Urbild zugrunde liegt. Später versuchte er dasselbe auch für die Tierwelt.
Wie Kopernikus die Gesetze für die Bewegungen der Glieder unseres Sonnensystems, so suchte Goethe die, wonach sich ein lebendiger Organismus gestaltet. Ich will auf die Einzelheiten nicht eingehen, will vielmehr gerne zugeben, daß sie sehr der Verbesserung bedürfen.> Einen entscheidenden Schritt bedeutet Goethes Unternehmen aber doch in genau derselben Weise wie des Kopernikus Erklärung des Sonnensystems, die ja auch durch Kepler eine wesentliche Verbesserung erfahren hat.
Ich habe mich bereits im Jahre 1883 (in meiner Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften in Kürschners Nat. Lit., 1. Bd.) bemüht, zu zeigen, daß die neuere Naturwissenschaft nur eine Seite der Goetheschen Anschauung zur Ausgestaltung gebracht hat.* Das Studium der äußeren Bedingungen für die Artverwandlung ist in vollem Gange. Haeckel hat in genialer Weise die Verwandtschaftsgrade der Formen der Tierwelt festzustellen gesucht. Für die Erkenntnis der inneren Bildungsgesetze des Organismus ist so gut wie nichts geschehen. Ja, es gibt Forscher, die solche Gesetze für bloße Phantasiegebilde halten. Sie glauben alles Nötige getan zu haben, wenn sie zeigen, wie sich die komplizierteren Lebewesen allmählich aus Elementarorganismen aufgebaut haben. Und diese elementaren organischen Wesenheiten will man durch bloße gesetzmäßige Verbindung unorganischer Stoffe in derselben Art erklären, wie man das Entstehen einer chemischen Verbindung erklärt. So hätte man denn glücklich das Kunstsrück vollbracht, das Leben dadurch zu erklären, daß man es vernichtet
- - -
* Meine der Kürschnerischen Ausgabe einverleibten «Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften» versuchen die wissenschaftliche Bedeutung dieser Schriften und deren Verhältnis zum gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaft ausführlich darzustellen.
oder, besser gesagt, als nicht vorhanden denkt. Mit einer solchen Betrachtungsweise wäre Goethe nie einverstanden gewesen.> Er suchte Naturgesetze für das Lebendige, aber nichts lag ihm ferner als der Versuch, die Gesetze des Leblosen auf das Belebte einfach zu übertragen.>
Bis zur Eröffnung des Goethe-Archivs hätte manche meiner Behauptungen vielleicht angefochten werden können, obwohl ich glaube, daß für denjenigen, der Goethes wissenschaftliche Schriften im Zusammenhange liest, kein Zweifel besteht über die Art, wie ihr Verfasser gedacht hat. Aber diese Schriften bilden kein geschlossenes Ganzes. Sie stellen nicht eine allseitig ausgeführte Naturansicht dar, sondern nur Fragruente einer solchen. Sie haben Lücken, die sich derjenige, der eine Vorstellung von Goethes Ideenwelt gewinnen will, hypothetisch ausfüllen muß. Der handschriftliche Nachlaß Goethes, der sich im Weimarischen Goethe-Archiv befindet, macht es nun möglich, zahlreiche und wichtige dieser Lücken auszufüllen. Mir hat er durchwegs die erfreuliche Gewißheit gebracht, daß die Vorstellungen, die ich mir schon früher von Goethes wissenschaftlichem Denken gemacht hatte und die ich eben charakterisiert habe, vollständig richtig sind. Ich hatte nicht nötig, meine Begriffe zu modifizieren, wohl aber kann ich heute manches, was ich vor Eröffnung des Archivs nur hypothetisch zu vertreten in der Lage war, mit Goethes eigenen Worten belegen.*
Wir lesen zum Beispiel in einem Aufsatz, der im sechsten Bande von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften in der Weimarer Ausgabe veröffentlicht ist: Die Metamorphose der Pflanzen «zeigt uns die Gesetze, wonach die Pflanzen gebildet werden. Sie macht uns auf ein doppeltes Gesetz aufmerksam: 1. auf das Gesetz der
- - -
* Ein vollständiges, systematisch geordnetes Ganzes von Goethes morphologischen und allgemein naturwissenschaftlichen Ideen werden die Bände 612 (6, 7, 8, 9 sind bereits veröffentlicht) der zweiten Abteilung der Weimatischen Goethe-Ausgabe bilden, Die Gliederung des Stoffes ist in Übereinstimmung mit dem Redaktor der Bände, Prof. Suphan, und unter dessen fortwährender tätiger Anteilnahme von mir und (für den 8. Band) von Prof. Bardeleben in Jena, als Herausgeber dieser Schriften, besorgt.
inneren Natur, wodurch die Pflanzen konstituiert werden, 2. auf das Gesetz der äußeren Umstände, wodurch die Pflanzen modifiziert werden.»
Besonders interessant ist es aber, daß wir den Gedankengang Schritt für Schritt verfolgen können, durch den Goethe dieses Gesetz der inneren Natur, wonach die Pflanzen gebildet werden, zu erkennen suchte. Diese Gedanken entwickeln sich in Goethe während seiner italienischen Reise.> Die Notizblätter, auf denen er seine Beobachtungen notiert hat, sind uns erhalten. Die Weimarische Ausgabe hat sie dem siebenten Bande der naturwissenschaftlichen Schriften einverleibt. Sie sind ein Muster dafür, wie ein Forscher mit philosophischem Blick die Geheimnisse der Natur zu ergründen sucht. Mit demselben tiefen Ernst, mit dem er in Italien seinen künstlerischen Interessen obliegt, ist er bestrebt, die Gesetze des pflanzlichen Lebens zu erkennen. Diese Blätter liefern den vollen Beweis, daß ein langes Bemühen hinter Goethe lag, als er um die Mitte des Jahres 1787 die Hypothese von der Urpflanze zur entschiedenen wissenschaftlichen Überzeugung erhob.
Noch mehr Zeit und Arbeit verwandte der Dichter darauf, seine Ideen auch auf das Tierreich und den Menschen anzuwenden. Bereits im Jahre 1781 beginnt das ernste Studium der Anatomie in Jena. Auf diesem Gebiete fand Goethe eine wissenschaftliche Anschauung vor, gegen die sich seine ganze Natur sträubte. Man glaubte in einer geringfügigen Kleinigkeit einen Unterschied des Menschen von den Tieren in bezug auf den anatomischen Bau gefunden zu haben. Die Tiere haben zwischen den beiden symmetrischen Hälften des Oberkieferknochens noch einen kleinen Knochen (Zwischenknochen), der die oberen Schneidezähne enthält. Bei dem Menschen, glaubte man, sei ein solcher nicht vorhanden. Diese Ansicht mußte Goethe sofort als ein Irrtum erscheinen. Wo eine solche Übereinstimmung des Baues wie beim Skelett des Menschen und dem der höhern Tiere besteht, da muß eine tiefere Naturgesetzlichkeit zugrunde liegen, da ist ein solcher Unterschied im einzelnen nicht möglich. Im Jahre 1784 gelang es Goethe, den Nachweis zu führen, daß der Zwischenknochen auch beim Menschen vorhanden ist, und damit war das letzte Hindernis hinweggeräumt,
das im Wege stand, wenn es sich daruzn handelte, allen tierischen Organisationen bis herauf zum Menschen einen einheitlichen Typus zugrunde zu legen. &hon 1790 ging Goethe daran, seinem Versuch über die Metamorphose der Pflanzen einen 501-chen «Über die Gestalt der Tiere» nachfolgen zu lassen, der leider Fragment geblieben ist. Es befindet sich irn achten Bande der naturwissenschaftlichen Schriften der Weimarischen Ausgabe. Goethe ging dann nochmals im Jahre 1795 daran, diese Absicht auszuführen, allein auch diesmal kam er nicht zu Ende. Wir können seine Intentionen im einzelnen aus den beiden Fragmenten wohl erkennen; die Ausführung der gewaltigen Idee hätte mehr Zeit in Anspruch genomtnen, als dem Dichter bei seinen vielseitigen Interessen zur Verfügung stand. Eine Einzelentdeckung schließt sich aber diesen Bestrebungen noch an, die uns klar erkennen läßt, worauf sie zielten. Wie Goethe nämlich alle Pflanzen auf die Urpflanze, alle Tiere auf das Urtier zurückzuführen suchte, so ging sein Streben auch dahin, die einzelnen Teile eines und desselben Organismus aus einem Grundbestandteil zu erklären, der die Fähigkeit hat, sich in vielfältiger Weise umzubilden. Er dachte sich, alle Organe lassen sich auf eine Grundform zurückführen, die nur verschiedene Gestalten annimmt. Ein tierisches und ein pflanzliches Individuum sah er als aus vielen Einzelheiten bestehend an. Diese Einzelheiten sind der Anlage nach gleich, in der Erscheinung aber gleich oder ähnlich, ungleich und unähnlich. Je unvollkommener das Geschöpf ist, desto mehr sind die Teile einander gleich und desto mehr gleichen sie dem Ganzen. Je vollkommener das Geschöpf wird, desto unähnlicher werden die Teile einander. Goethes Streben ging deshalb dahin, Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Teilen eines Organismus zu suchen. Dies brachte ihn beim tierischen Skelett auf einen Gedanken von weittragender Bedeutung, auf den der sogenannten Wirbelnatur der Schädel-knochen. Wir haben es hier mit der Ansicht zu tun, daß die Knochen, die das Gehirn umschließen, die gleiche Grundform haben mit denen, welche das Rückgrat zusammensetzen. Goethe vermutete das wohl bald nach dem Beginn seiner anatomischen Untersuchungen. Zur vollen Gewißheit wurde es für ihn im Jahre 1790.
Damals fand er auf den Dünen des Lido in Venedig einen Schafschädel, der so glücklich auseinandergefallen war, daß Goethe in den Stücken deutlich die einzelnen Wirbelkörper zu erkennen glaubte. Auch hier hat man wieder behauptet, daß es sich bei Goethe viel mehr um einen glücklichen Einfall als um ein wirkliches wissenschaftliches Ergebnis handle. Allein mir scheint, daß gerade die neuesten Arbeiten auf diesem Gebiete den vollen Beweis liefern, daß der von Goethe betretene Weg der rechte war. Der hervorragende Anatom Carl Gegenbaur hat im Jahre 1872 untersuchungen veröffentlicht über das Kopfskelett der Selachier oder Urfische, welche zeigen, daß der Schädel der umgebildete Endteil des Rückgrats und das Gehirn das umgebildete Endglied des Rückenmarks ist. Man muß sich nun vorstellen, daß die knöcherne Schädelkapsel der höheren Tiere aus umgebildeten Wirbelkörpern besteht, die aber im Laufe der Entwickelung höherer Tierformen aus niederen allmählich eine solche Gestalt angenonrtnen haben und die so miteinander verwachsen sind, daß sie zur Umschiießung des Gehirns geeignet erscheinen. Deshalb kann man die Wirbeltheorie des Schädels nur im Zusammenhang mit der vergleichenden Anatomie des Gehirns studieren. Daß Goethe diese Sache bereits 1790 von diesem Gesichtspunkte aus betrachtete, das zeigt eine Eintragung in sein Tagebuch, die vor kurzem im Goethe-Archiv gefunden worden ist: «Das Hirn selbst ist nur ein großes Hauptganglion. Die Organisation des Gehirns wird in jedem Ganglion wiederholt, so daß jedes Ganglion als ein kleines subordiniertes Gehirn anzusehen ist.
Aus alledem geht hervor, daß Goethes wissenschafdiche Methode jeder Kritik gewachsen ist und daß er im Verfolge seiner naturphilosophischen Ideen eine Reihe von Einzelentdeckungen machte, welche auch die heutige Wissenschaft, wenn auch in verhesserter Gestalt, für wichtige Bestandteile der Naturerkenntnis halten muß. Goethes Bedeutung liegt aber nicht in diesen Einzelentdeckungen, sondern darin, daß er durch seine Art, die Dinge anzusehen, zu ganz neuen leitenden Gesichtspunkten der Naturerkenntnis kam. Darüber war er sich selbst vollständig klar. Am 18. August des Jahres 1787 schrieb er von Italien aus an Knebel:
was ich bei Neapel, in Sizilien von Pflanzen und Fischen gesehen habe, würde ich, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, seht versucht sein, eine Reise nach Indien zu machen, nicht um Neues zu entdecken, sondern um das Entdeckte nach meiner Art anzusehen. In diesen Worten ist die Ansicht ausgesprochen, die Goethe vom wissenschaftlichen Erkennen hatte. Nicht die treue, nüchterne Beobachtung allein kann zum Ziele führen.> Erst wenn wir den entsprechenden Gesichtspunkt finden, um die Dinge zu betrachten, werden sie uns verständlich. Goethe hat durch seine Anschauungsweise die große Scheidewand zwischen lebloser und belebter Natur vernichtet, ja er hat die Lehre von den Organismen erst zum Range einer Wissenschaft erhoben. Worin das Wesen dieser Anschauungsweise besteht, hat Schiller mit bedeutungsvollen Worten in einem Briefe an Goethe vom 23. August 1793 ausgesprochen:
«Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie vorgezeichnet haben, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige in der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen; in der Allheit ihrer Erscheinungsatten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf. Von der einfachen Organisation steigen Sie Schritt vor Schritt zu der mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäu-des zu erbauen.> Dadurch, daß Sie ihn der Natur gleichsam nach-erschaffen, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudringen.»
Aus dieser Geistesrichtung mußte sich eine Naturanschauung entwickeln, die von rohem Materialismus und nebuloser Mystik gleich weit entfernt ist. Für sie war es selbstverständlich, daß man das Besondere nur erkennt durch Erfahrung, das Allgemeine, die großen gesetzlichen Naturzusammenhänge nur durch Aufsteigen von der Beobachtung zur Idee. Nur wo beide zusammenwirken: Idee und Erfahrung, sieht Goethe den Geist der wahren Naturforschung. Treffend spricht er das mit den Worten aus: «Durch die Pendelschläge wird die Zeit, durch die Wechselbewegung
von Idee zu Erfahrung die sittliche und wissenschaftliche Welt regiert (Goethes Werke, II. Abteilung, 6. Band, S. 354). Nur in der Idee glaubte Goethe dem Geheimnis des Lebens nahekommen zu können. In der organischen Welt fand er Ursachen wirksam, die nur zum Teil für die Sinne wahrnehmbar sind. Den anderen Teil suchte er zu erkennen, indem er die Gesetzmäßigkeit der Natur im Bilde nachzuschaffen unternahm. In der sinnfälligen Wirklichkeit äußert sich das Leben zwar, aber es besteht nicht in ihr. Deshalb kann es durch sinnliche Erfahmng auch nicht gefunden werden. Die höheren Geisteskräfte müssen dafür eintreten. Es ist heute beliebt, neben der nüchternen Beobachtung nur dem Verstande ein Recht zuzuerkennen, in der Wissenschaft mitzusprechen. Goethe glaubte, nur mit Aufwendung aller Geisteskräfte in den Besitz der Wahrheit kommen zu können. Deshalb wurde er nicht müde, sich zu den verschiedensten Arten des wissenschaftlichen Betriebes in ein Verhältnis zu setzen. In den wissenschaftlichen Instituten der Jenaer Hochschule sucht er sich die sachlichen Kenntnisse für seine Ideen zu erwerben; bei ihren berühmten philosophischen Lehrern und bei Schiller sucht er Aufschluß über die philosophische Berechtigung seiner Gedankenrichtung. Goethe war im eigentlichen Sinne des Wortes nicht Philosoph; aber seine Art, die Dinge zu betrachten, war eine philosophische. Er hat keine philosophischen Begriffe entwickelt, aber seine naturwissenschaftlichen Ideen sind von philosophischem Geiste getragen. Goethe konnte seiner Natur nach weder einseitig Philosoph noch einseitig Beobachter sein. Beide Seiten wirkten in ihm in der höheren Einheit, dem philosophischen Beobachter, harmonisch ineinander, sowie Kunst und Wissenschaft sich wieder vereinigt in der umfassenden Persönlichkeit Goethes, der uns nicht bloß in diesem oder jenem Zweig seines Schaffens, sondern in seiner Ganzheit als weltgeschichtliche Erscheinung interessiert. In Goethes Geist wirkten Wissenschaft und Kunst zusammen. Wir sehen das am besten, wenn er angesichts der griechischen Kunstwerke in Italien schreibt, er glaube, daß die Griechen bei ihren Schöpfungen nach denselben Gesetzen verfuhren wie die Natur selbst, und er dazu bemerkt, daß er glaube, diesen auf der Spur zu sein. Das
schrieb er in einer Zeit, in der er dem Gedanken der Urpflanze nachging. Es kann also kein Zweifel darüber sein, daß Goethe sich das Schaffen des Künstlers von denselben Grundmaximen geleitet denkt, nach denen auch die Natur bei ihren Produktionen verfährt. Und weil er in der Natur dieselben Grundwesenheiten vermutete, die ihn als Künstler bei seiner eigenen Tätigkeit lenkten, deshalb trieb es ihn nach einer wissenschaftlichen Erkenntnis von ihnen. Goethe bekannte sich zu einer streng einheitlichen oder monistischen Weltansicht. Einheitliche Grundmächte sieht er walten von dem einfachsten Vorgang der leblosen Natur bis hinauf zur Phantasie des Menschen, der die Werke der Kunst entspringen.
Rudolf Virchow betont in der bemerkenswerten Rede, welche er am 3. August dieses Jahres zur Geburtstagsfeier des Stifters der Berliner Universität gehalten hat, daß die philosophische Zeit der deutschen Wissenschaft, in der Fichte, Schelling und Hegel tonangebend waren, seit Hegels Tode definitiv abgetan sei und daß wir seither im Zeitalter der Naturwissenschaften leben. Virchowrühint von diesem Zeitalter, daß es immer mehr und mehr begriff, daß die Naturwissenschaft nur in der Beschäftigung mit der Natur selbst: in Museen, Sainmlungen, Laboratorien und Instituten, erfaßt werden könne und daß aus den Studierzimmern der Philosophen kein Aufschluß über die Naturvorgänge zu gewinnen sei. Es wird hiermit ein weitverbreitetes Vorurteil unserer Zeit ausgesprochen. Gerade der Bekenner einer streng naturwissenschaftlichen Weltanschauung müßte sich sagen, daß, was zur äußeren Natur gehört und was wir allein in wissenschaftlichen Instituten unterbringen können, nur der eine Teil der Natur ist und daß der andere, gewiß nicht weniger wesentliche Teil zwar nicht im Studierzimmer, wohl aber in dem Geiste des Philosophen zu suchen ist. So dachte Goethe, und sein Denken ist deshalb naturwissenschaftlicher als das der neueren Naturwissenschaft. Diese läßt den menschlichen Erkenntnisdrang vollständig unbefriedigt, wenn es sich um Höheres handelt, als was der sinnfälligen Beobachtung zugänglich ist. Kein Wunder ist es daher, daß Virchow gleichzeitig zu klagen hat über die schlimmsten Einbrüche des Mystizismus in das Gebiet der Wissenschaft vom Leben. Was die Wissenschaft
versagt, das sucht ein tieferes Bedürfnis eben in allerlei geheimnisvollen Naturkräften, nämlich die Erklärung der einmal vorhandenen Tatsachen. Und daß das Zeitalter der Naturwissenschaft bisher außerstande war, das Wesen des Lebens und das des menschlichen Geistes zu erklären, das gesteht auch Virchow zu.
Wer aber kann hoffen, den Gedanken mit den Augen zu sehen, das Leben mit dem Mikroskop wahrnehmen zu können? Hier ist allein mit jener zweiten Richtung etwas zu erreichen, durch die Goethe zu den Urorganismen zu kommen suchte. Die Fragen, welche die moderne Naturwissenschaft nicht beantworten kann, sind genau jene, deren Lösung Goethe in einer Weise unternimmt, von der man heute nichts wissen will. Hier eröffnet sich ein Feld, wo Goethes wissenschaftliche Arbeiten in den Dienst der Zeit gestellt werden können. Sie werden sich tüchtig gerade da erweisen, wo die gegenwärtige Methode sich ohnmächtig zeigt. Nicht allein daruin handelt es sich, Goethe gerecht zu werden und seinen Forschungen in der Geschichte den richtigen Ort anzuweisen, sondern daruin, seine Geistesart mit unseren vollkommeneren Mitteln weiter zu pflegen.
Ihm selbst kam es in erster Linie darauf an, daß die Welt erkenne, was seine Naturanschauung im allgemeinen zu bedeuten habe, und erst in zweiter darauf, was er mit Hilfe dieser Anschauung mit den Mitteln seiner Zeit im besondern zu leisten vermochte.
Das naturwissenschaftliche Zeitalter hat das Band zwischen Erfahrung und Philosophie zerrissen. Die Philosophie ist das Stiefkind dieses Zeitalters geworden. Schon aber erhebt sich vielfach das Bedürfnis nach einer philosophischen Vertiefung unseres Wissens. Auf mancherlei Irrwegen sucht vorläufig noch dieses Bedürfnis sich zu befriedigen. Die Überschätzung des Hypnotismus, des Spiritismus und Mystizismus gehören dazu. Auch der rohe Materialismus ist ein Versuch, den Weg zu einer philosophischen Gesamtauffassung der Dinge zu finden. Dem naturwissenschaftlichen Zeitalter ein wenig Philosophie einzuflößen ist für viele heute ein wünschenswertes Ziel. Möge man sich zur rechten Zeit daran erinnern, daß es einen Weg von der Naturwissenschaft zur Philosophie gibt und daß dieser in Goethes Schriften vorgezeichnet ist.
GOETHES GEHEIME OFFENBARUNG
Zu seinem hundertfünfzigsten Geburtstage: 28. August 1899
Als Johann Gottlieb Fichte das Werk an Goethe gelangen ließ, in dern kühne Denkerkraft und höchster ethischer Ernst einen unvergleichlichen Ausdruck fanden, die «Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre», legte er einen Brief bei, der die Worte enthielt: «Ich betrachte Sie, und habe Sie immer betrachtet als den Repräsentanten der reinsten Geistigkeit des Gefühls auf der gegenwärtig errungenen Stufe der Humanität. An Sie wendet mit Recht sich die Philosophie: Ihr Gefühl ist derselben Probierstein. Diese Sätze sind 1794 geschrieben. Wie der große Philosoph hätten damals die Träger der verschiedensten geistigen Strömungen an Goethe schreiben können. Der Dichter und Denker Goethe stand in dieser Zeit auf der Höhe seines Lebens. Was der Biograph sagt, der am liebevollsten in diese Persönlichkeit sich versenkt und uns darum das intimste Bild von ihr liefert, Albert Bielschowski, das empfanden in den neunziger Jahren schon Goethes Zeitgenossen:
«Goethe hatte von allem Menschlichen eine Dosis empfangen und war darum der . Seine Gestalt hatte ein großartig typisches Gepräge. Sie war ein potenziertes Abbild der Menschheit an sich. Demgemäß hatten auch alle, die ihm nähertraten, den Eindruck, als ob sie noch nie einen so ganzen Menschen gesehen hätten.»
So war Goethes Verhältnis zur geistigen Umwelt beschaffen, als er vor hundert Jahren in sein fünfzigstes Lebensjahr eintrat. Als ein Vollendeter stand er da. Das Studium der Antike hatte seinem künstlerischen Schaffen den Grad von Vollkommenheit gegeben, der durch das innerste Wesen seiner Persönlichkeit gefordert war und über den hinaus es für ihn keinen Fortschritt mehr gab; seine Einsicht in das Wirken der Natur war zum Abschlusse gekommen. Fortan blieb ihm nur die Ausführung der Natur-Ideen, die sich in seinem Geiste festgesetzt hatten. Der «menschlichste aller Menschen» wirkte damals als völlig Reifer auf die Mitlebenden.
In vielsagenden Worten sprach das Schiller in dem Briefe aus, den er am 23. August 1794 an Goethe richtete: «Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen; in der Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf ... Wären Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren worden, und hätte schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine idealisierende Kunst Sie umgeben, so wäre Ihr Weg unendlich verkürzt, vielleicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in die erste Anschauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Notwendigen aufgenommen, und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Stil bei Ihnen entwickelt. Nun da Sie ein Deutscher geboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl, als entweder selbst zum nordischen Künstler zu werden, oder Ihrer Imagination das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhilfe der Denkkraft zu ersetzen, und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären.» Goethe antwortete am 27.: «Zu meinem Geburtstag, der mir diese Woche erscheint, hätte mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie, mit freundschaftlicher Hand, die Summe meiner Existenz ziehen und mich durch Ihre Teilnahme zu einem emsigern und lebhafteren Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern.»
Man darf diesen Satz erweitern und sagen: Goethe hätte in der Zeit seiner Reife kein bedeutungsvolleres Geschenk werden können als Schillers hingebungsvolle Freundschaft. Der philosophische Sinn des letzteren führte Goethes reine Geistigkeit des Gefühls in neue geistige Regionen.
Die schöne Gemeinsamkeit der beiden Geister, die sich ausbildete, charakterisiert Schiller in einem Brief an Körner: «Ein
jeder konnte dem andern etwas geben, was ihm fehlte, und etwas dafür empfangen. Goethe fühlt jetzt ein Bedürfnis, sich an mich anzuschließen, um den Weg, den er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusetzen.>
Schiller war um die Zeit, in der seine Freundschaft mit Goethe begann, mit den Ideen beschäftigt, die in seinen «Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen» ihren Ausdruck gefunden haben. Er arbeitete diese ursprünglich für den Herzog von Augustenburg geschriebenen Briefe für die «Horen» 1794 um. Was Goethe und Schiller damals mündlich verhandelten und was sie sich schrieben, schloß sich immer wieder der Gedankenrichtung nach an den Ideenkreis dieser Briefe an. Schillers Nachsinnen betraf die Frage: Welcher Zustand der Seelenkräfre entspricht im höchsten Sinne des Wortes einem menschenwürdigen Dasein? «Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt der Anlage und Bestimmung nach einen reinen, idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzustimmen die große Aufgabe seines Daseins ist», heißt es im vierten Briefe. Eine Brücke soll geschlagen werden von dem Menschen der alltägigen Wirklichkeit zu dem idealischen Menschen. Zwei Triebe sind vorhanden, die den Menschen von der idealischen Vollkommenheir zurückhalten, wenn sie in einseitiger Weise zur Entwickelung kommen: der sinnliche und der vernünftige Trieb. Hat der sinnliche Trieb die Oberhand, so unrerliegt der Mensch seinen Instinkten und Leidenschaften. Sein Tun ist die Folge einer niederen Nötigung. Überwiegt der vernünftige Trieb, so ist der Mensch bestrebt, Instinkte und Leidenschaften zu unterdrücken und einer rein geistigen Tugendhaftigkeit nachzustreben. In beiden Fällen ist der Mensch einem Zwange unterworfen. Im ersteren zwingt seine sinnliche Natur die geistige, im zweiten seine geistige die sinnliche Natur zur Unterwerfung. Weder das eine noch das andere kann ein wahrhaft menschenwürdiges Dasein begründen. Dieses setzt vielmehr eine vollkommene Harmonie beider Grundtriebe voraus. Die Sinnlichkeit soll nicht unterdrückt, sondern veredelt werden; die Instinkte und Leidenschaften sollen auf eine so hohe Stufe gehoben werden, daß sie in
der Richtung wirken, die auch die Vernunft, die höchste Moralität vorschreibt. Und die moralische Vernunft soll nicht wie eine höhere Gesetzgebung in dem Menschen walten, der man sich widerwillig unterwirft, sondern man soll ihre Gebote empfinden wie ein zwangloses Bedürfnis. «Wenn wir jemand mir Leidenschaft umfassen, der unserer Verachtung würdig ist, so empfinden wir peinlich die Nötigung der Natur. Wenn wir gegen einen andern feindlich gesinnt sind, der uns Achtung abnötigt, so empfinden wir peinlich die Nötigung der Vernunft. Sobald er aber zugleich unsere Neigung interessiert und unsere Achtung sich erworben, so verschwindet sowohl der Zwang der Empfindung als der Zwang der Vernunft, und wir fangen an, ihn zu lieben» (14. Brief). Ein Mensch, der weder von Seite der Sinnlichkeit noch von Seite der Vernunft eine Nötigung erfährt, der aus Leidenschaft im Sinne der reinsten Moral handelt, ist eine freie Persönlichkeit. Und eine Gesellschaft von Menschen, in denen der natürliche Trieb des Einzelnen so veredelt ist, daß er nicht durch die Machrsprüche der Gesamtheit gezügelt zu werden braucht, um ein harmonisches Zusammenleben möglich zu machen, ist der Idealzusrand, dem der Macht- und Zwangsstaat zustreben muß. Äußere Freiheit im Zusammenleben setzt innere Freiheit der einzelnen Persönlichkeiten voraus. In dieser Art suchte Schiller das Problem der Freiheit des menschlichen Zusammenlebens zu lösen, das damals alle Gemüter bewegte und das in der Französischen Revolution nach einer gewaltsamen Lösung strebte. «Freiheit zu geben durch Freiheit ist das Grundgesetz» eines menschenwürdigen Reiches (27. Brief).
Goethe fand sich durch diese Ideen tief befriedigt. Er schreibt über die «ästhetischen Briefe» am 26. Oktober 1794 an Schiller:
«Das mir übersandte Manuskript habe ich sogleich mir großem Vergnügen gelesen; ich schlürfte es auf einen Zug hinunter. Wie uns ein köstlicher, unserer Natur analoger Trunk willig hinunter-schleicht und auf der Zunge schon durch gute Stimmung des Nervensystems seine heilsame Wirkung zeigt, so waren mir diese Briefe angenehm und wohltärig; und wie sollte es anders sein, da ich das, was ich für Recht seit langer Zeit erkannte, was ich teils
lebte, teils zu leben wünschte, auf eine so zusammenhängende und edle Weise vorgetragen fand.»
So ist der Vorsrellungskreis beschaffen, der bei Goethe durch Schiller angeregt wurde. Aus ihm heraus ist nun eine Dichtung des ersteren erwachsen, welche wegen ihres geheimnisvollen Charakrers die mannigfaltigsten Auslegungen erfahren hat, die aber vollständig klar und durchsichtig nur wird, wenn man sie aus dem geschilderten Vorsrellungskreis heraus begreift: Das Rätsel-märchen, mit dem Goethe seine in den «Horen» erschienene Erzählung «Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten» schloß und das im Jahre 1795 in den «Horen» erschien. Was Schiller in den «Ästhetischen Briefen» in philosophischer Form aussprach, das stellte Goethe in einer lebensvollen, mir reichem poetischem Gehalt erfüllten Märchendichtung dar. Der menschenwürdige Zustand, den der Mensch erreicht, wenn er in den vollen Besitz der Freiheit gelangt ist, erscheint in diesem Märchen symbolisiert durch die Vermählung eines Jünglings mir der schönen Lilie, der Repräsenrantin des Freiheirsreiches, des idealischen Menschen, den der Mensch des Alltags als sein Ziel in sich trägt.
Die größte Zahl der bisher unrernommenen Auslegungsversuche findet man verzeichnet in dem Buche «Goethes Märchen-dichtungen» von Friedrich Meyer von Waldeck (Heidelberg 1879, Carl Winrersche Universirärsbuchhandlung). Ich habe gefunden, daß diese Auslegungsversuche hübsche Anregungen geben und in vieler Beziehung das Richtige treffen, daß jedoch keiner völlig befriedigend ist. Ich habe nun die Wurzeln der Erklärung in dem Boden gesucht, aus dem auch Schillers « Ästhetische Briefe» erwachsen sind. Trotzdem in mehreren mündlichen Vorträgen das erste Mal am 27. November 1891 im Wiener Goethe -Verein meine Auslegung auf viele Zuhörer überzeugend gewirkt hat, zögerte ich bisher noch, sie dem Druck zu übergeben. Auch meinem 1897 erschienenen Buche «Goethes Weltanschauung» habe ich sie noch nicht eingefügt. Ich hatte das Bedürfnis, die Überzeugung von ihrer Richtigkeit in mir durch längere Zeit reifen zu lassen. Sie hat sich bis heute nur befestigt. Das Folgende kann sich nicht an den Gang der Märchenhandlung halten, sondern muß so ein-
gerichtet werden, daß sich der Sinn der Dichtung am bequemsten enthüllt.*
*
Eine Person, die für die Entwickelung der Vorgänge im «Märchen» eine hervorragende Rolle spielt, ist der «Alte mir der Lampe». Als er mit seiner Lampe in die Felsklüfre kommt, wird er gefragt, welches das wichtigste der Geheimnisse sei, die er wisse. Er antwortet: «Das offenbare.» Und auf die Frage, ob er dieses Geheimnis nicht verraten wolle, sagt er: wenn er das vierte wisse. Dieses vierte aber kennt die Schlange, und sie sagt es dem Alten ins Ohr. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieses Geheimnis sich auf den Zustand bezieht, nach dem sich alle im Märchen vorkommenden Personen sehnen. Dieser Zustand wird uns am Schluß der Dichtung geschildert. Man muß annehmen, daß der Alte dieses Geheimnis kennt; denn er ist ja die einzige Person, die immer über den Verhältnissen steht, die alles lenkt und leitet. Was kann also die Schlange dem Alten sagen? Sie ist das wichtigste Wesen in dern ganzen Prozesse. Dadurch, daß sie sich aufopfert, wird erreicht, was alle zuletzt befriedigt. Daß sie sich aufopfern muß, um diese Befriedigung herbeizuführen, weiß der Alte offenbar. Was er nicht weiß, ist nur, wann sie dazu bereit sein wird. Denn das hängt von ihr ab. Sie muß aus sich heraus zu der Erkenntnis kommen, daß ihre Opferung zum all. gemeinen Heile notwendig ist. Daß sie zu dieser Opferung bereit ist, das ist das wichtigste Geheimnis, und das sagt sie dem Alten ins Ohr. Und nun kann dieser das große Wort aussprechen: «Es ist an der Zeit! »
Das gewünschte Ziel wird herbeigeführt durch die Wieder. belebung des Jünglings, durch seine Vereinigung mir der schönen Lilie und durch den Umstand, daß beide Reiche, das diesseits und
- - -
* Bei meinen Vorträgen bin ich oft von Zuhörern darauf angesprochen worden, ob das .Märchen. in den Goethe-Ausgaben stehe. Ich bemerke deshalb ausdrücklich, daß es in jeder Goethe-Ausgabe enthalten ist und daß es den Schluß der Erzählungen .Unterhalrungen deutscher Ausgewanderten. bildet.
das jenseits des Flusses, durch die herrliche Brücke verbunden werden, die aus dem geopferten Leibe der Schlange sich bildet. Wenn auch die Schlange die Urheberin des glücklichen Zustandes ist, so könnte sie allein dem Jünglinge doch nicht die Gaben verleihen, durch die er das neubegründete Reich beherrscht. Sie empfängt er von den drei Königen. Von dem ehernen König erhält er das Schwert mit dem Auftrag: «Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! » Der silberne gibt ihm das Szepter, indem er den Satz spricht: «Weide die Schafe! » Der goldene drückt ihm den Eichenkranz aufs Haupt mit den Worten: «Erkenne das Höchste! »Die drei Könige sind die Symbole für die drei Grundkräfte der menschlichen Seele, und in den Worten, die sie sprechen, liegt angedeutet, wie sich in dem vollkommenen Menschen diese drei Grundkräfte ausleben sollen. Das Schwert bezeichnet den Willen, die physische Stärke und Gewalt. Der Mensch soll es nicht in der Rechten halten, wo es die Bereitschaft zu Streit und Krieg bedeutete, sondern in der Linken zum Schutz und zur Abwehr des Schlechten. Die Rechte soll frei sein für die Taten edler Menschlichkeit. Die Übergabe des Szeprers wird begleitet von den Worten: «Weide die Schafe! » Sie erinnern an Christi Worte: «Weide meine Lämmer, weide meine Schafe! » Dieser König ist also das Sinnbild der Frömmigkeit, des edlen Herzens. Der goldene König teilt dem Jüngling mit dem Eichenkranze die Gabe der Erkenntnis mir. Der Wille, der sich in der Macht, in der Gewalt auslebt, die Frömmigkeit und die Weisheit in ihrer vollkommensten Gestalt werden dem Jüngling, dem Repräsentanten des menschen-würdigen Daseins, verliehen. Diese drei Seelenkräfre werden durch die drei Könige versinnbildlicht. Als daher der Alte die Worte spricht: «Drei sind, die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt», da erheben sich die drei Könige, ein jeder bei Nennung der Seelenkraft, deren Symbol er ist. Eine Unklarheit scheint darin zu liegen, daß der silberne König als der Herrscher im Reiche des Scheins hingestellt wird, während er nach seinen Worten die Frömmigkeit zu bedeuten hat. Dieser Widerspruch löst sich sofort, wenn man die nahe Beziehung bedenkt, in die Goethe die ästhetischen Empfindungen die der
schöne Schein künstlerischer Werke erzeugt und die religiösen bringt. Denken wir nur an Sätze von ihm wie diesen: «Es gibt nur zwei wahre Religionen: die eine, die das Heilige, das in und um uns wohnt, ganz formlos, die andere, die es in der schönsten Form anerkennt und anbeter.» Goethe sieht in der Kunst nur eine andere Form der Religion. Als ihm die Schönheit der griechischen Kunstwerke aufgegangen war, da sprach er den Satz aus: «Da ist die Notwendigkeit, da ist Gott.»
Von der Bedeutung der Könige aus können wir auf anderes im Märchen schließen. Der König der Weisheit ist aus Gold. Wo uns sonst im Märchen das Gold begegnet, werden wir also in ihm das Symbol der Weisheit, der Erkenntnis zu erblicken haben. Es ist bei den Irrlichtern und bei der Schlange der Fall. Die ersteren wissen sich dieses Metall überall auf leichte Weise anzueignen, um es dann verschwenderisch, hochmütig von sich zu werfen. Die Schlange kommt schwer zu demselben, nimmt es aber organisch in sich auf, verarbeitet es in ihrem Leibe und durchdringt sich ganz damit. Wir haben zweifellos in den Irrlichrern eine bildliche Darstellung von Persönlichkeiten vor uns, die sich ihre Weisheit von allen Seiten zusammenlesen und sie dann stolz und auch leichtfertig von sich geben, ohne sich hinreichend mir ihr durchdrungen zu haben. Unproduktive Geister stellen die Irrlichter dar, die unverdautes Wissen verbreiten. Fallen ihre Worte auf fruchtbaren Boden, so können sie das Allerbeste bewirken. Ein Mensch kann Lehren, denen er selbst durchaus kein tiefes Verständnis entgegenbringt, einem anderen mitteilen, und dieser andere kann einen tiefen Sinn darin erkennen. Die Schlange stellt das solide menschliche Streben dar, das ehrliche Hinschreiten auf der Bahn der Erkenntnis. Für sie wird das von den Irrlichtern verschleuderte Gold kosrbares Gut, das sie in sich bewahrt. Für Goethe hatte der Gedanke, daß jemand die in sich aufgenommene Weisheit als Lehrer von sich gibt, etwas Unbehagliches. Das Lehren führt nach seiner Meinung leicht dazu, die Wissenschaft sich anzueignen, um sie wieder ausgeben zu können. Er preist sich deshalb glücklich, daß er sich der Forschung widmen kann, ohne zu-gleich einen Lehrstuhl einnehmen zu müssen. Nur wer in der
letzteren Lage ist, wird von Ausnahmen natürlich abgesehen sich wahrhaft selbstlos in die Dinge vertiefen und der wahren Humanität dienen. Wer die Weisheit um des Lehrens willen erwirbt, der wird leicht zum falschen Propheten oder Sophisten. An diese erinnern die Irrlichrer. Aber nur die selbstlose Erkenntnis, die in den Dingen ganz aufgeht und die in der Schlange verbildlicht wird, kann zu der Einsicht kommen, daß das Höchste nur durch die selbstlose Hingabe erreicht werden kann. Der Mensch, der seine Allragspersönlichkeir absterben läßt, um den idealischen Menschen in sich zu erwecken, erreicht dieses Höchste. Was ein Mystiker wie Jakob Böhme mir den Worten ausgesprochen hat:
der Tod ist die Wurzel alles Lebens, das hat Goethe mit der sich opfernden Schlange zum Ausdruck gebracht. Wer nicht loskommen kann von seinem kleinen Ich, wer nicht imstande ist, das höhere Ich in sich auszubilden, der kann nach Goethes Ansicht nicht zur Vollkommenheit gelangen. Der Mensch muß als einzelner absterben, um als höhere Persönlichkeit wieder aufzuleben. Das neue Leben ist dann erst das menschenwürdigste, dasselbe, das, nach Schillers Weise zu sprechen, weder von der Vernunft noch von der Sinnlichkeit eine Nötigung empfindet. Im «Diwan» lesen wir Goethes schönes Wort: «Und so lang du das nicht hast, dieses:
Srirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.» Und einer der «Sprüche in Prosa» heißt: «Man muß seine Existenz aufgeben, um zu existieren.» Die Schlange gibt ihre Existenz auf, um die Brücke zu bilden zur Verbindung der beiden Reiche, dem der Sinnlichkeit und dem der Geistigkeit. Der Tempel mir seinem bunten Gewimmel ist das höhere Leben der Schlange, das sie durch den Tod ihrer niederen Natur erkauft hat. Ihre Worte, sie wolle sich freiwillig aufopfern, um nicht aufgeopfert zu werden, sind nur ein anderer Ausdruck für Jakob Böhmes Satz: «Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt»; das heißt, wer dahinlebt, ohne die niedere Natur in sich abzutöten, der stirbt zuletzt, ohne eine Ahnung zu haben von dem idealischen Menschen in sich.
Der Jüngling wird durch ein unbezwingliches Verlangen nach dem Reich der schönen Lilie gedrängt. Man vergegenwärtige sich
die Kennzeichen dieses Reiches. Die Menschen können, trotzdem sie die tiefste Sehnsucht nach dem Gebiet der Lilie haben, doch nur zu bestimmten Zeiten in dasselbe gelangen. Zur Mittagszeit, wenn die Schlange eine Brücke über den Fluß bildet; dann abends und morgens, wenn der Schatten des Riesen sich über den Fluß breitet. Jemand, der sich der Beherrscherin dieses Reiches, der schönen Lilie, nähert, ohne dazu die innere Eignung zu besitzen, kann sein Leben in der schwersten Weise schädigen. Ferner hat die Lilie selbst Verlangen nach dem anderen Reiche. Endlich kann der Fährmann jeden herüber-, niemand aber hinüberbringen. Was bedeutet demnach das Reich der schönen Lilie? Goethe sagt «Sprüche ,in Prosa» : «Alles, was unsern Geist befreit, ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu geben, ist verderblich.» Die Herrschaft über sich selbst hat nur der Mensch, der sich rückhalt-los seinen Neigungen überlassen darf, weil diese aus sich selbst nur im moralischen Sinne wirken. «Pflicht, wo man liebt, was man sich selbst befiehlt», ist ein Spruch Goethes. Wer sich der Freiheit bemächtigt, ohne die Herrschaft über sich selbst zu haben, dem geht es wie dem Jüngling, der durch die Berührung mit der Lilie gelähmt worden ist. Das Reich des einseitig wirkenden Vernunfrrriebes, der rein geistigen Moralität, ist das der Lilie. Dasjenige der einseitig wirkenden Sinnlichkeit ist an der anderen Seite des Flusses. Bei dem noch unvollkommenen Menschen ist der Einklang zwischen sinnlichem Trieb und Vernunfttrieb im allgemei. nen nicht hergestellt. Nur in gewissen Augenbkicken handelt er aus Leidenschaft so, daß dies Handeln von selbst auch moralisch ist. Das wird dadurch symbolisiert, daß die Schlange nur in gewissen Augenblicken, in der Mittagszeit, eine Brücke über den Fluß bilden kann. Daß die Lilie Sehnsucht nach dem andern Reiche hat, drückt aus, daß der Vernunfttrieb sein Wesen nur erfüllt, wenn er nicht wie ein strenger Gesetzgeber jenseits der Begierden und Instinkte wirkt und diese zügelt, sondern wenn er diese durchdringt, sich mir ihnen verbindet. Der Fährmann kann jeden herüber-, niemand aber hinüberbringen. Die Menschen stammen, ohne daß sie selbst etwas dazu getan haben, aus dem Reiche der Vernunft, sie kommen aber nicht ohne ihr Zutun aus dem Reiche
der Leidenschaften wieder in ihr eigentliches Heimatland zurück. Außer in den Augenblicken, in denen der Mensch durch den Ausgleich von Vernunft und Sinnlichkeit den Idealzusrand des Lebens erreicht, sucht er in denselben auch noch durch Gewalt zu gelangen, durch Willkür, die in den politischen Revolutionen zum Ausdruck kommen. Für diese Art der Verbindung beider Reiche bringt Goethe den Riesen und seinen Schatten. In Revolutionen lebt sich der Drang nach dem Idealzustand dumpf aus, wie in der Dämmerung der Schatten des Riesen sich über den Fluß legt. Daß diese Deutung des Riesen richtig ist, dafür gibt es auch ein historisches Zeugnis. Am 16. Oktober 1795 schreibt Schiller an Goethe, der sich auf einer Reise befindet, die bis nach Frankfurt a. M. sich ausdehnen sollte: «Es ist mir in der Tat lieb, Sie noch fern von den Händeln am Main zu wissen. Der Schatten des Riesen könnte Sie leicht etwas unsanft anfassen.» Was die Willkür, der gesetzlose Verlauf geschichtlicher Ereignisse im Gefolge hat, ist also mir dem Schatten des Riesen gemeint.
Zwischen die Vernunft und die Sinnlichkeit stellen sich, so daß der noch unvollkommene Mensch abgehalten wird, durch seine Leidenschaften die Moralität zu zerstören: Sitte, alles, was gesellschaftliche Ordnung der Gegenwart ist. Diese Ordnung findet ihr Sinnbild in dem Flusse. Im dritten der «Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen» sagt Schiller vom Staate: «Der Zwang der Bedürfnisse warf den Menschen hinein, ehe er in seiner Freiheit diesen Stand wählen konnte; die Not richtete denselben nach bloßen Naturgesetzen ein, ehe er es nach Vernunft-gesetzen konnte.» Der Fluß trennt die beiden Reiche, bis die Schlange sich opfert. Der Fährmann will von jedem Wanderer mir Früchten der Erde belohnt sein; Staat und Gesellschaft legen dem Menschen reale Pflichten auf; sie können das phrasenhafte Geschwätz falscher Propheten und bloß mit Worten bezahlender Volksbegkücker sowenig brauchen wie der Fährmann die Gold-stücke der Irrlichrer. Die Alte bekennt sich dem Flusse als Schuldnerin und haftet ihm mir ihrem Leibe; ihre Gestalt schwindet, da sie Schuldnerin ist. So bekennt sich das Individuum dem Staate als Schuldner; es geht im Staate auf, gibt diesem einen Teil seines
Selbstes hin. Solange der Mensch nicht auf solcher Höhe steht, daß er frei aus sich heraus moralisch handelt, muß er verzichten, einen Teil seines Selbst von sich aus zu bestimmen; er muß sich dem Staate verschreiben.
Die Lampe des Alten hat die Eigenschaft, nur da zu leuchten, wo schon ein anderes Licht vorhanden ist. Wir müssen an den von Goethe wiederholten Spruch eines alten Mysrikers denken: «Wär nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt nicht in uns des Gottes eigne Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? » So wie die Lampe im Dunkeln nicht leuchtet, so leuchtet das Licht der Wahrheit, der Erkenntnis auch denen nicht, die ihm nicht die geeigneten Organe, das innere Licht, entgegenbringen. Dieses Licht der Weisheit ist es aber, das den Menschen an sein Ziel führt. Es bringt ihn dahin, den Einklang seiner Triebe herzustellen. Dieses Licht läßt ihn die Gesetze der Dinge erkennen. Was für ihn tote Masse ist, verwandelt sich durch die Erkenntnis in ein lebendiges Ding, das für unsern Geist durchsichtig ist. Anders steht die Welt vor dem, der sie erkannt hat, als vor dem, der ohne Erkenntnis dahinlebt. Die Verwandlung, die alle Dinge für unseren Geist erfahren, wenn sie von dem Lichte der Erkenntnis beleuchtet werden, wird symbolisiert durch die Verwandlung, welche die Dinge durch das Licht der Lampe erfahren. Steine verwandelt dieses Licht in Gold, Holz in Silber und rote Tiere in Edelsteine.
Durch die Opferung der Schlange hört das Reich des vierten Königs auf, der Gold, Silber und Erz chaotisch in sich trug. Das harmonische Zusammenwirken der drei Metalle, aus denen die drei anderen Könige bestehen, beginnt. Durch die Erweckung des idealischen Menschen hören die Seelenkräfre auf, chaotisch, einseitig durcheinanderzuwirken, sie erreichen eine vollkommene Harmonie. Die Irrlichter lecken das Gold des vierten Königs auf. Ist der menschenwürdige Zustand erreicht, so haben die unproduktiven Geister das Geschäft, die Vergangenheit, in der noch das Unvollkommene herrschte, wissenschaftlich, als Geschichte, zu verarbeiten. Auf das Wesen der Irrlichter wirft auch die Gestalt des Mopses Licht. Sie werfen ihm ihr Gold hin, und er stirbt vom
Genuß desselben. So geht der zugrunde, dem falsche Propheten und Sophisten ihre für ihn unverdaulichen Lehren beibringen.
Auf dem Flusse wird der Tempel errichtet, in dem sich die Vermählung des Jünglings mir der schönen Lilie vollzieht. Aus dem Zwangssraare wird die freie Gesellschaft herauswachsen, in der jeder sich seinen Neigungen überlassen kann, weil sie nur in dem Sinne wirken, daß edles Zusammenleben der Menschen möglich ist. Dann wird der Mensch nicht mehr nur in Augenblicken den befriedigenden Zustand erleben, er wird ihn nicht mehr durch revolutionäre Gewalt zu erringen suchen, er wird für ihn in jedem Augenblicke gegenwärtig sein. Am Schluß des Märchens findet man das poetische Bild für diese Wahrheit: «Die Brücke ist gebaut; alles Volk geht fortwährend herüber und hinüber, bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.»
Gibt man diesen Grundstock der Auslegung zu, dann erklärt sich wie von selbst jeder Vorgang, jede Person des Märchens. Man nehme zum Beispiel den Habicht. Er fängt den Strahl der Sonne auf, um ihn auf die Erde zu reflektieren, bevor es der Sonne selbst noch möglich ist, direkt ihr Licht auf dieselbe zu senden. So kann auch der menschliche Spürsinn die Ereignisse einer nicht zu fernen Zukunft. vorausberechnen. In den Dienerinnen der schönen Lilie kann man Repräsentanten jener glücklich veranlagten menschlichen Wesen sehen, denen durch ihre Natur der Einklang von Sinnlichkeit und Vernunft geschenkt ist. Sie werden in das neue Reich hinüberleben, ohne von dem Übergang etwas zu merken, wie die Dienerinnen während des Momentes der Umwandlung schlummern. Daß das Symbol der rohen Gewalt, der Riese, zuletzt als Stundenzeiger eine Rolle spielt, möchte ich dahin deuten, daß auch die Unvernunft im Weltgetriebe ihren Platz ausfüllen kann, wenn sie nicht zu Verrichtungen verwendet wird, die dem freien Menschengeiste ziemen, sondern innerhalb strenger Natur-regelmäßigkeit zur Entfaltung ihrer Kraft gebracht ist.
Durch Schiller wurde also Goethe angeregt, in seiner Weise, poetisch, sein ethisches Glaubensbekenntnis auszusprechen, wie es Schiller selbst in den «ästhetischen Briefen» auf andere Art getan
hat. Auf die Gespräche, die in der in Betracht kommenden Zeit über diese Ideen stattgefunden haben, deutet Schiller in dem Briefe, mir dem er den Empfang des Manuskripres anzeigt: «Das ist bunt und lustig genug, und ich finde die Idee, deren Sie einmal erwähnten: , recht artig ausgeführt.»
DER INDIVIDUALISMUS [Egoismus] IN DER PHILOSOPHIE
Wäre der Mensch bloß Geschöpf der Natur und nicht zugleich Schaffender, so stände er nicht fragend vor den Erscheinungen der Welt und suchte auch nicht ihr Wesen und ihre Gesetze zu ergründen. Er befriedigte seinen Nahrungs- und Fortpflanzungstrieb gemäß den seinem Organismus eingeborenen Gesetzen und ließe im übrigen die Ereignisse der Welt laufen, wie sie eben laufen. Er käme gar nicht darauf, an die Natur eine Frage zu stellen. Zufrieden und glücklich wandelte er durchs Leben wie die Rose, von der Angelus Silesius sagt:
«Die Ros' ist ohn warumb, sie blühet, weil sie blühet,
sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sihet.»
So kann die Rose sein. Was sie ist, ist sie, weil die Natur sie dazu gemacht hat. So kann aber der Mensch nicht sein. In ihm liegt der Trieb, zu der vorhandenen Welt noch eine aus üifli entsprungene hinzuzufügen. Er will mit seinen Mitmenschen nicht in dem zufälligen Nebeneinander leben, in das ihn die Natur gestellt hat, er sucht das Zusararnenleben mit andern nach Maß-gabe seines vernünftigen Denkens zu regeln. Die Gestalt, in welche die Natur den Mann und das Weib eingebildet, genügt ihm nicht; er schafft die idealen Figuren der griechischen Plastik. Dem natürlichen Gang der Ereignisse im täglichen Leben fügt er den seiner Phantasie entsprungenen in der Tragödie und Komödie hinzu. In der Architektur und Musik entspringen aus seinem Geiste Schöpfungen, die kaum noch an irgend etwas von der
Natur Geschaffenes erinnern. In seinen Wissenschaften entwirft er begriffliche Bilder, durch die das Chaos der Welterscheinungen, das täglich vor unsern Sinnen vorüberzieht, als harmonisch geregeltes Ganzes, als in sich gegliederter Organismus erscheint. In der Welt seiner eigenen Taten schafft er ein besonderes Reich, das des historischen Geschehens, das wesentlich anderer Art ist als der Tatsachenverlauf der Natur.
Daß alles, was er schafft, nur eine Fortsetzung des Wirkens der Natur ist, das fühlt der Mensch. Daß er berufen ist, zu dem, was die Natur aus sich selbst vermag, ein Höheres hinzuzufügen, das weiß er auch. Er ist sich dessen bewußt, daß er aus sich eine andere, höhere Natur zu der äußeren hinzugebärt.
So steht der Mensch zwischen zwei Welten: derjenigen, die von außen auf ihn eindringt, und derjenigen, die er aus sich hervorbringt. Diese beiden Welten in Einklang zu bringen, ist er bemüht. Denn sein ganzes Wesen ist auf Harmonie gerichtet. Er möchte leben wie die Rose, die nicht fragt nach dem Warum und Weil, sondern die blühet, weil sie blühet. Schiller fordert das von dem Menschen mit den Worten:
«Suchst Du das Höchste, das Größte?
Die Pflanze kann es Dich lehren.
Was sie willenlos ist, sei Du es wollend - das ist's!>
Die Pflanze kann es sein. Denn aus ihr entspringt kein neues Reich, und die bange Sehnsucht kann daher in ihr auch nicht entstehen: wie bringe ich die beiden Reiche miteinander in Einklang?
Das, was in ihm selbst liegt, mit dem, was die Natur aus sich erzeugt, in Harmonie zu bringen, das ist das Ziel, dem der Mensch durch alle Zeiten der Geschichte zustrebt. Die Tatsache, daß er fruchtbar ist, wird zum Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der Natur, die den Inhalt seines geistigen Strebens ausmacht.
Es gibt zwei Wege für diese Auseinandersetzung. Entweder läßt der Mensch die äußere Natur über seine innere Herr werden, oder er unterwirft sich diese äußere Natur. In dem ersteren Fall sucht er sein eigenes Wollen und Sein dem äußeren Gang der Ereignisse unterzuordnen. In dem zweiten nimmt er Ziel und
Richtung seines Wollens und Seins aus sich selbst und sucht mit den Ereignissen der Natur, die doch ihren eigenen Gang gehen, auf irgendeine Weise fertigzuwerden.
Ich möchte zuerst von dem ersten Fall sprechen. Daß der Mensch über das Reich der Natur hinaus noch ein anderes, in seinem Sinne höheres erschafft, ist seinem Wesen gemäß. Er kann nicht anders. Welche Empfindungen und Gefühle er diesem seinem Eeiche gegenüber hat, davon hängt es ab, wie er sich zu der Außenwelt stellt. Er kann nun seinem eigenen Reiche gegenüber dieselben Empfindungen haben wie den Tatsachen der Natur gegenüber. Dann läßt er die Geschöpfe seines Geistes an sich herankommen, wie er ein Ereignis der Außenwelt, zum Beispiel Wind und Wetter, an sich herankommen läßt. Er vernimmt keinen Artunterschied zwischen dem, was in der Außenwelt, und dem, was in seiner Seele vorgeht. Er ist deshalb der Ansicht, daß sie nur ein Reich sind, das von einer Art von Gesetzen beherrscht wird. Nur fühlt er, daß die Geschöpfe des Geistes höherer Art sind. Deshalb stellt er sie über die Geschöpfe der bloßen Natur. Er versetzt also seine eigenen Geschöpfe in die Außenwelt und läßt von ihnen die Natur beherrscht sein. Er kennt somit nur Außenwelt. Denn seine eigene innere Welt verlegt er nach außen. Kein Wunder, daß ihm auch sein eigenes Selbst zum untergeordneten Gliede dieser Außenwelt wird.
Die eine Art der Auseinandersetzung des Menschen mit der Außenwelt besteht demnach darin, daß er sein Inneres als ein Äußeres ansieht und dieses nach außen versetzte Innere zugleich als den Herrscher und Gesetzgeber über die Natur und sich selbst setzt.
Ich habe hiermit den Standpunkt des religiösen Menschen charakterisiert. Eine göttliche Weltordnung ist ein Geschöpf des menschlichen Geistes. Nur ist sich der Mensch nicht klar darüber, daß der Inhalt dieser Weltordnung aus seinem eigenen Geiste entsprungen ist. Er verlegt ihn daher nach außen und ordnet sich seinem eigenen Erzeugnis unter.
Der handelnde Mensch kann sich nicht dabei beruhigen, sein Handeln einfach gelten zu lassen. Die Blume blühet, weil sie blühet. Sie fragt nicht nach dem Warum und Weil. Der Mensch
nimmt Stellung zu seinem Tun. Ein Gefühl knüpft sich an dieses Tun. Er ist entweder befriedigt oder nicht befriedigt von einer seiner Handlungen. Er unterscheidet das Tun nach seinem Werte. Das eine Tun betrachtet er als ein solches, das ihm gefällt, das andere als ein solches, das ihm mißfällt. In deln Augenblicke, in dem er so empfindet, ist für ihn die Harmonie der Welt gestört. Er ist der Ansicht, daß das wohlgefällige Tun andere Folgen nach sich ziehen muß als dasjenige, das sein Mißfallen hervorruft. Wenn er sich nun nicht klar darüber ist, daß er aus sich heraus zu den Handlungen das Werturteil hinzugefügt hat, so glaubt er, diese Wertbestimmung hänge den Handlungen durch eine äußere Macht an. Er ist der Ansicht, daß eine solche äußere Macht die Geschehnisse dieser Welt unterscheide in solche, die gefallen und daher gut sind, und in solche, die mißfallen, also schlecht, böse sind. Ein Mensch, der in dieser Weise empfindet, macht keinen Unterschied zwischen den Tatsachen der Natur und den Handlungen des Menschen. Er beurteilt beide von demselben Gesichtspunkte aus. Das ganze Weltall ist ihm ein Reich, und die Gesetze, die dies Reich regieren, entsprechen ganz denen, die der menschliche Geist aus sich selbst hervorbringt.
In dieser Art der Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt tritt ein ursprünglicher Zug der menschlichen Natur zutage. Der Mensch mag sich noch so unklar über sein Verhältnis zur Welt sein: er sucht doch in sich den Maßstab, mit dem er alle Dinge messen kann. Aus einer Art unbewußten Souveränitätsgefühles heraus entscheidet er über den absoluten Wert alles Geschehens. Man kann forschen, wie man will: Menschen, die sich von Göttern regiert glauben, gibt es ohne Zahl; solche, die nicht selbständig, über den Kopf der Götter hinweg ein Urteil fällen, was diesen Göttern gefallen kann oder mißfallen, gibt es nicht. Zum Herren der Welt vermag der religiöse Mensch sich nicht aufzuwerfen; wohl aber bestimmt er die Neigungen der Weltherrscher aus eigener Machtvollkommenheit.
Man braucht die religiös empfindenden Naturen nur zu betrachten, und man wird meine Behauptungen bestätigt finden. Wo hat es je Verkündiger von Göttern gegeben, die nicht zugleich ganz
genau festgestellt hätten, was diesen Göttern gefällt und was ihnen zuwider ist. Jede Religion hat ihre Weisheit über das Weltall, und jede behauptet auch, daß diese Weisheit von einem Gotte oder mehreren Göttern stamme.
Will man den Standpunkt des religiösen Menschen charakterisieren, so muß man sagen: er versucht die Welt von sich aus zu beurteilen, aber er hat nicht den Mut, auch sich selbst die Verantwortung für dieses Urteil zuzuschreiben, deshalb erfindet er sich Wesen in der Außenwelt, denen er diese Verantwortung aufbürdet.
Durch diese Betrachtungen scheint mir die Frage beantwortet zu sein: was ist Religion? Der Inhalt der Religion entspringt aus dem menschlichen Geiste. Aber dieser Geist will sich diesen Ursprung nicht eingestehen. Der Mensch unterwirft sich seinen eigenen Gesetzen, aber er betrachtet diese Gesetze als fremde. Er setzt sich zum Herrscher über sich selbst ein. Jede Religion setzt das menschliche Ich zum Regenten der Welt ein. Ihr Wesen besteht eben darinnen, daß sie sich dieser Tatsache nicht bewußt ist. Sie betrachtet als Offenbarung von außen, was sie sich selber offenbart.
Der Mensch wünscht, daß er in der Welt oben an erster Stelle stehe. Aber er wagt es nicht, sich als den Gipfel der Schöpfung hinzustellen. Deshalb erfindet er sich Götter nach seinem Bilde und läßt von ihnen die Welt regieren. Indem er so denkt, denkt er religiös.
*
Das religiöse Denken wird von dem philosophischen Denken abgelöst. In den Zeiten und bei den Menschen, wo diese Ablösung geschieht, enthüllt sich uns die Menschennatur auf eine ganz besondere Weise.
Für die Entwickelung des abendländischen Denkens ist besonders interessant der Übergang des mythologischen Denkens der Griechen zu dem philosophischen. Drei Denker möchte ich zu-nächst aus der Zeit dieses Übergangs hervorheben: Aaalaimarder, Thales und Parmenides. Sie stellen drei Stufen dar, die von der Religion zur Philosophie führen.
Die erste Stufe auf diesem Wege ist dadurch gekennzeichnet, daß die göttlichen Wesen nicht mehr anerkannt werden, aus denen der aus dem menschlichen Ich entnommene Inhalt stanunen soll. Trotzdem wird aber - aus Gewohnheit - noch daran festgehalten, daß dieser Inhalt aus der Außenwelt stammt. Auf dieser Stufe steht Anaximander. Er redet nicht mehr von Göttern wie seine griechischen Vorfahren. Das höcliste, die Welt regierende Prinzip ist ihm nicht ein Wesen, das nach dem Bilde des Menschen vorgestellt wird. Es ist ein unpersönliches Wesen, das Apeiron, das Unbestimmte. Es entwickelt alles in der Natur Vorkommende aus sich, aber nicht in der Art, wie ein Mensch schafft, sondern aus Naturnotwendigkeit. Aber diese Naturnotwendigkeit denkt sich Anaximander noch immer analog einem Handeln, das nach menschlichen Vernunftgrundsätzen verläuft. Er stellt sich sozusagen eine moralische Naturgesetzlichkeit vor, ein höchstes Wesen, das die Welt wie ein menschlicher Sittenrichter behandelt, ohne ein solcher zu sein. Nach Anaximander geschieht alles in der Welt so notwendig, wie der Magnet das Eisen anzieht, aber es geschieht nach moralischen, das heißt menschlichen Gesetzen. Nur von diesem Gesichtspunkte aus konnte er sagen: «Woraus die Dinge entstehen, in dasselbe müssen sie auch vergehen, wie es der Billigkeit gemäß ist, denn sie müssen Buße und Vergeltung tun, um der Ungerechtigkeit willen, wie es der Ordnung der Zeit entspricht.>
Dies ist die Stufe, auf der ein Denker anfängt, philosophisch zu urteilen. Er läßt die Götter fallen. Er schreibt also das, was aus dem Menschen kommt, nicht mehr den Göttern zu. Aber er tut nichts weiter, als daß er die Eigenschaften, die vorher göttlichen, also persönlichen Wesen beigelegt worden sind, auf ein unpersönliches überträgt.
In ganz freier Weise tritt Thales der Welt gegenüber. Wenn er auch um ein paar Jahre älter ist als Anaximander, er ist philosophisch viel reifer. Seine Denkungsweise ist gar nicht mehr religiös.
Innerhalb des abendländischen Denkens ist erst Thales ein Mann, der sich in der zweiten oben genannten Art mit der Welt
auseinandersetzt. Hegel hat es so oft betont, daß das Denken die Eigenschaft ist, die den Menschen vom Tiere unterscheidet. Thales ist die erste abendländische Persönlichkeit, die es wagte, dem Denken seine Souveränitätsstellung anzuweisen. Er kümmerte sich nicht mehr darum, ob Götter die Welt nach der Ordnung der Gedanken eingerichtet haben oder ob ein Apeiron die Welt nach Maßgabe des Denkens lenkt. Er wußte nur, daß er dachte, und nahm an, daß er deswegen, weil er dachte, auch ein Recht habe, sich die Welt nach Maßgabe seines Denkens zurechtzulegen. Man unterschätze diesen Standpunkt des Thales nicht! Er war eine ungeheure Rücksichtslosigkeit gegenüber allen religiösen Vorurteilen. Denn er war die Erklärung der Absolutheit des menschlichen Denkens. Die religiösen Menschen sagen: die Welt ist so eingerichtet, wie wir sie uns denken, denn Gott ist. Und da sie sich Gott nach dem Ebenbilde des Menschen denken, ist es selbstverständlich, daß die Ordnung der Welt der Ordnung des menschlichen Kopfes entspricht. Thales ist das alles ganz gleichgültig. Er denkt über die Welt. Und kraft seines Denkens schreibt er sich ein Urteil über die Welt zu. Er hat bereits ein Gefühl davon, daß das Denken nur eine menschliche Handlung ist, und dennoch geht er daran, mit Hilfe dieses bloß menschlichen Denkens die Welt zu erklären. Das Erkennen selbst tritt mit Thales in ein ganz neues Stadium seiner Entwickelung. Es hört auf, seine Rechtfertigung aus dem Umstande zu ziehen, daß es nur nachzeichnet, was die Götter vorgezeichnet haben. Es entnimmt aus sich selbst das Recht, über die Gesetzmäßigkeit der Welt zu entscheiden. Es kommt zunächst gar nicht darauf an, ob Thales das Wasser oder irgend etwas anderes zum Prinzip der Welt gemacht hat, sondern darauf, daß er sich gesagt hat: was Prinzip ist, das will ich durch mein Denken entscheiden. Er hat es als selbstverständlich angenommen, daß das Denken in solchen Dingen die Macht hat. Und darin liegt seine Größe.
Man vergegenwärtige sich nur einmal, was damit getan ist. Nichts Geringeres ist damit geschehen als dies, daß dem Menschen die geistige Macht über die Welterscheinungen gegeben ist. Wer auf sein Denken vertraut, der sagt sich: mögen die Wogen
des Geschehens noch so stürmisch brausen, möge die Welt ein Chaos scheinen: ich bin lllhig, denn all dies tolle Getriebe beunruhigt mich nicht, weil ich es begreife.
Diese göttliche Ruhe des Denkers, der sich selbst versteht, hat Heraklit nicht begriffen. Er war der Ansicht, daß alle Dinge in ewigem Flusse seien. Daß das Werden das Wesen der Dinge sei. Wenn ich in einen Fluß hineinsteige, so ist er nicht mehr derselbe wie in dem Momente, in dem ich mir vorgenommen, hineinzusteigen. Aber Heraklit übersieht nur eins. Was der Fluß mit sich fortträgt, das bewahrt das Denken, und es findet, daß im nächsten Momente ein Wesentliches von dem wieder vor die Sinne tritt, was schon vorher da war.
So wie Thales mit seinem festen Glauben an die Macht des menschlichen Denkens, so ist auch Heraklit eine typische Erscheinung im Reiche derjenigen Persönlichkeiten, die sich mit den bedeutsamsten Fragen des Daseins auseinandersetzen. Er fühlt nicht in sich die Kraft, durch das Denken den ewigen Fluß des sinnlichen Werdens zu bezwingen. Heraklit sieht in die Welt, und sie zerfließt ihm in nicht festzuhaltende Augenblickserscheinungen. Hätte Heraklit recht, dann zerflatterte alles in der Welt, und im allgemeinen Chaos mußte auch die menschliche Persönlichkeit sich auflösen. Ich wäre heute nicht derselbe, der ich gestern war, und morgen wäre ich ein anderer als heute. Der Mensch stünde in jedem Augenblicke vor völlig Neuem und hätte keine Macht. Denn von den Erfahrungen, die er sich bis zu einem bestimmten Tage gesammelt hat, wäre es fraglich, ob sie ihm eine Richtschnur an die Hand geben zur Behandlung des völlig Neuen, das ihm ein junger Tag bringt.
In schroffen Gegensatz zu Heraklit stellt sich deshalb Parmenides. Mit all der Einseitigkeit, die nur einer kühnen Philosophennatur möglich ist, verwarf er jegliches Zeugnis der sinnlichen Wahrnehmung. Denn eben diese in jedem Augenblick sich ändernde Sinnenwelt verführt zu der Ansicht des Heraklit Dafür sprach er als den Quell aller Wahrheit einzig und allein die Offenbarungen an, die aus dem innersten Kern der menschlichen Persönlichkeit hervordringen, die Offenbarungen des Denkens. Nicht was vor
den Sinnen vorüberfließt, ist das wirkliche Wesen der Dinge -nach seiner Ansicht, sondern die Gedanken, die Ideen, welche das Denken in diesem Strome gewahr wird und festhält!
Wie so vieles, was als Gegenschlag auf eine Einseitigkeit erfolgt, so wurde auch die Denkweise des Parmenides verhängnisvoll. Sie verdarb das europäische Denken auf Jahrhunderte hinaus. Sie untergrub das Vertrauen in die Sinneswahrnehmung. Während nämlich ein unbefangener, naiver Blick auf die Sinnenwelt aus dieser selbst den Gedankeninhalt schöpft, der den menschlichen Erkenntnistrieb befriedigt, glaubte die im Sinne des Parmenides sich fortentwickelnde philosophische Bewegung die rechte Wahrheit nur aus dem reinen, abstrakten Denken schöpfen zu sollen.
Die Gedanken, die wir in lebendigem Verkehr mit der Sinnenwelt gewinnen, haben einen individuellen Charakter, sie haben die Wärme von etwas Erlebtem in sich. Wir exponieren unsere Person, indem wir Ideen aus der Welt herauslösen. Wir fühlen uns als Überwinder der Sinnenwelt, wenn wir sie in die Gedankenwelt einfangen. Das abstrakte, reine Denken hat etwas Unpersönliches, Kaltes. Wir fühlen immer einen Zwang, wenn wir die Ideen aus dem reinen Denken herausspinnen. Unser Selbstgefühl kann durch ein solches Denken nicht gehoben werden. Denn wir müssen uns der Gedankennotwendigkeit einfach unterwerfen.
Parmenides hat nicht berücksichtigt, daß das Denken eine Tätigkeit der menschlichen Persönlichkeit ist. Er hat es unpersönlich, als ewigen Seinsinhalt, genommen. Das Gedachte ist das Seiende, hat er gesagt. .
Er hat dadurch an die Stelle der alten Götter einen neuen gesetzt. Während die ältere, religiöse Vorstellungsweise den ganzen, fühlenden, wollenden und denkenden Menschen als Gott an die Spitze der Welt gesetzt hatte, nahm Parmenides eine einzelne menschliche Tätigkeit, einen Teil aus der Persönlichkeit heraus und machte daraus ein göttliches Wesen.
Auf dem Gebiete der Anschauungen über das sittliche Leben des Menschen wird Parmenides durch Sokrates ergänzt. Der Satz :
die Tugend ist lehrhar, den dieser ausgesprochen hat, ist die ethische Konsequenz der Aschanung des Parmenldes, daß das Denken gleich dem Sein ist. Ist dies letztere eine Wahrheit, so kann das menschliche Handeln nur dann darauf Anspruch machen, sich zu einem wertvollen Seienden erhoben zu haben, wenn es aus dem Denken fließt. Aus dem abstraltten, logischen Denken, dem sich der Mensch einfach zu fügen, das heißt das er sich als Lernender anzueignen hat.
Es ist klar: ein gemeinsamer Zug ist in der griechischen Gedankenentwickelung zu verfolgen. Der Mensch hat das Bestreben, das, was ihm angehört, was aus seinem eigenen Wesen entspringt, in die Außenwelt zu versetzen und auf diese Weise sich seinem eigenen Wesen unterzuordnen. Zunächst nimmt er sich in seiner ganzen vollen Breite und setzt seine Ebenbilder als Götter über sich; dann nimmt er eine einzelne menschliche Tätigkeit, das Denken, und setzt es als Notwendigkeit über sich, der er sich zu fügen hat. Das ist das Merkwürdige in der Entwickelung des Menschen, daß er seine Kräfte entfaltet, daß er für das Dasein und die Entfaltung dieser Kräfte in der Welt kämpft, daß er diese Kräfte aber lange nicht als seine eigenen anzuerkennen vermag.
*
Diese große Täuschung des Menschen über sich selbst hat einer der größten Philosophen aller Zeiten in ein kühnes, wunderbares System gebracht. Dieser Philosoph ist Plato. Die ideale Welt, der Umkreis der Vorstellungen, die im Menschengeiste aufgehen, während der Blick auf die Vielheit der äußeren Dinge gerichtet ist, wird für Plato zu einer höheren Welt des Seins, von der jene Vielheit nur ein Abbild ist. «Die Dinge dieser Welt, welche unsere Sinne wahrnehmen, haben gar kein wahres Sein: sie werden immer, sind aber nie. Sie haben nur ein relatives Sein, sind insgesamt nur in und durch ihr Verhältnis zueinander; man kann daher ihr ganzes Dasein ebensowohl ein Nichtsein nennen. Sie sind folglich auch nicht Objekte einer eigentlichen Erkenntnis. Denn nur von dem, was an und für sich und immer auf gleiche
Weise ist, kann es eine solche geben; sie hingegen sind nur das Objekt eines durch Empfindung veranlaßten Dafürhaltens. S(> lange wir auf ihre Wahrnehmung beschränkt sind, gleichen wir Menschen, die in einet finsteren Höhle so festgebunden säßen, daß sie auch den Kopf nicht drehen könnten und nichts sähen als beim Lichte eines hinter ihnen brennenden Feuers an der Wand ihnen gegenüber die Schattenbilder wirklicher Dinge, welche zwischen ihnen und dem Feuer vorübergeführt würden, und auch sogar voneinander und jeder von sich selbst eben nur die Schatten an jener Wand. Ihre Weisheit aber wäre, die aus Erfahrung erlernte Reihenfolge jener Schatten vorherzusagen.> Der Baum, den ich sehe, betaste und dessen Blütenduft ich atme, ist also der Schatten der Idee des Baumes. Und diese Idee ist das wahrhaft Wirkliche. Die Idee aber ist das, was in meinem Geiste aufleuchtet, wenn ich den Baum betrachte. Was ich mit den Sinnen wahrnehme, wird dadurch zum Abbild dessen gemacht, was mein Geist durch die Wahrnehmung ausbildet.
Alles, was Plato als Ideenwelt jenseits der Dinge vorbanden glaubt, ist menschliche Innenwelt. Der Inhalt des menschlichen Geistes aus dem Menschen herausgerissen und als eine Welt für sich vorgestellt, als höhere, wahre, jenseitige Welt: das ist platonische Philosophie.
Ich gebe Ralph Waldo Emerson recht, wenn er sagt: «Unter allen weltlichen Büchern hat nur Plato ein Recht auf das fanatische Lob, das Omar dem Koran erteilte, als er den Ausspruch tat:
Seine Sentenzen enthalten die Bildung der Nationen; sie sind der Eckstein aller Schulen, der Brunnenkopf aller Literaturen. Sie sind ein Lehrbuch und Kompendium der Logik, Arithmetik, Ästhetik, der Poesie und Sprachwissenschaft, der Rhetorik, Ontologie, der Ethik oder praktischen Weisheit. Niemals hat sich das Denken und Forschen eines Mannes über ein so ungeheures Gebiet erstreckt. Aus Plato kommen alle Dinge, die noch heute geschrieben und unter denkenden Menschen besprochen werden.> Den letzteren Satz möchte ich etwas genauer in folgender Form aussprechen. Wie Plato über das Verhältnis
des menschlichen Geistes zur Welt empfunden hat, so empfindet auch heute die überwiegende Mehrheit der Menschen. Sie empfindet, daß der Inhalt des menschlichen Geistes, das menschliche Fühlen, Wollen und Denken auf der Stufenleiter der Erscheinungen oben zu stehen kommt, aber sie weiß mit diesem geistigen Inhalt nur etwas anzufangen, wenn er außerhalb des Menschen als göttliches oder irgendein anderes höheres Wesen:
notwendige Naturordnung, moralische Weltordnung - und wie der Mensch sonst das, was er selbst hervorbringt, genannt hat -vorhanden gedacht wird.
*
Es ist erklärlich, daß der Mensch so denkt. Die Eindrücke der Sinne dringen von außen auf ihn ein. Er sieht die Farben, hört die Töne. Seine Empfindungen, seine Gedanken entstehen in ihm, während er die Farben sieht, die Töne hört. Seiner eigenen Natur entstammen diese. Er fragt sich: wie komme ich dazu, aus Eigenem etwas zu dem hinzuzufügen, was die Welt mir überliefert. Es erscheint ihm ganz willkürlich, aus sich heraus etwas zur Ergänzung der Außenwelt zu holen.
In dem Augenblicke aber, in dem er sich sagt: das, was ich da fühle und denke, das bringe ich nicht aus Eigenem zur Welt hinzu, das hat ein anderes, höheres Wesen in sie gelegt, und ich hole es nur aus ihr heraus: in diesem Augenblicke ist er beruhigt. Man braucht dem Menschen nur zu sagen: du hast deine Meinungen und Gedanken nicht aus dir selbst, sondern ein Gott hat sie dir geoffenbart: dann ist er versöhnt mit sich selbst. Und streift er den Glauben an Gott ab, dann setzt er an seine Stelle: die naturliche Ordnung der Dinge, die ewigen Gesetze. Daß er diesen Gott, diese ewigen Gesetze nirgends in der Welt draußen finden kann, daß er sie vielinehr erst zu der Welt hinzuerschaffen muß, wenn sie dasein sollen: das will er sich zunächst nicht eingestehen. Es wird ihm schwer, sich zu sagen: die Welt außer mir ist ungöttlich; ich aber nehme mir, kraft meines Wesens, das Recht, das Göttliche in sie hineinzuschauen.
Was gehen die schwingende Kirchenlampe die Pendelgesetze an, die im Geiste Galileis erstanden sind, als er sie betrachtete? Aber der Mensch selbst kann nicht existieren, ohne einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Außenwelt und der Welt seines Innern. Sein geistiges Leben ist ein fortwährendes Hineinarbeiten des Geistes in die Sinnenwelt. Durch seine eigene Arbeit vollzieht sich im Laufe des geschichtlichen Lebens die Durchdringung von Natur und Geist. Die griechischen Denker wollten nichts anderes, als daß der Mensch in ein Verhältnls bereits hineingeboren sei, das erst durch ihn selbst werden kann. Sie wollten nicht, daß der Mensch erst die Ehe vollziehe zwischen Geist und Natur; sie wollten, daß er diese Ehe als vollzogen bereits antreffe und sie nur als fertige Tatsache betrachte.
Aristoteles sah das Widerspruchsvolle, das darinnen liegt, die im Menschengeiste von den Dingen entstehenden Ideen in eine übersinnliche, jenseitige Welt zu versetzen. Aber auch er erkannte nicht, daß die Dinge erst ihre ideelle Seite erhalten, wenn der Mensch sich ihnen entgegenstellt und sie zu ihnen hinzu erschafft. Er nahm vielmehr an, daß dieses Ideelle als Entelechie in den Dingen als ihr eigentliches Prinzip selbst wirksam sei. Die natürliche Folge dieser seiner Grundansicht war, daß Aristoteles das sittliche Handeln des Menschen aus seiner ursprünglichen ethischen Naturanlage ableitete. Die physischen Triebe veredeln sich im Laufe der menschlichen Entwickelung und erscheinen dann als vernünftig geleitetes Wollen. In diesem vernünftigen Wollen besteht die Tugend.
In dieser Unmittelbarkeit genommen, scheint es, als ob Aristoteles auf dem Standpunkt stände, daß wenigstens das sittliche Handeln seinen Quell in der Eigenpersönlichkeit des Menschen habe. Daß der Mensch selbst sich aus seinem Wesen heraus Richtung und Ziel seines Tuns gebe und sich dieselben nicht von außen vor-schreiben lasse. Aber auch Aristoteles wagt es nicht, bei diesem sich selbst seine Bestimmung vorzeichnenden Menschen stehenrableiben. Was in dem Menschen als einzelnes vernünftiges Tun auftritt, sei doch nur eine Ausprägung einer außer ihm existierenden allgemeinen Weltvernunft. Die letztere verwirkliche sich in
dem Einzelmenschen, aber sie habe über ihn hinaus ihr selbständiges, höheres Dasein.
Auch Aristoteles drängt aus dem Menschen hinaus, was er nur im Menschen vorfindet. Dasjenige, was im Inneren des Menschen angetroffen wird, als selbständiges, für sich bestehendes Wesen zu denken und von diesem Wesen die Dinge der Welt abzuleiten, ist die Tendenz des griechischen Denkens von Thales bis Aristoteles.
*
Es muß sich an der Erkenntnis des Menschen rächen, wenn dieser die Vermittlung des Geistes mit der Natur, die er selbst vollziehen soll, durch äußere Mächte vollzogen denkt. Er sollte sich in sein Inneres versenken und da den Anknüpfungspunkt der Sinnenwelt an die ideelle suchen. Blickt er statt dessen in die Außenwelt, um diesen Punkt zu finden, so wird er, weil er ihn da nicht finden kann, einmal notwendig zu dem Zweifel an aller Versöhnung der beiden Mächte kommen müssen. Dieses Stadium des Zweifels stellt uns die auf Aristoteles folgende Periode des griechischen Denkens dar. Es kündigt sich an bei den Stoikern und Epikureern und erreicht seinen Höhepunkt bei den Skeptikern.
Die Stoiker und Epikureer fühlen instinktiv, daß man das Wesen der Dinge auf dem von ihren Vorgängern eingeschlagenen Wege nicht finden kann. Sie verlassen diesen Weg, ohne sich viel um einen neuen zu kümmern. Den älteren Philosophen war die Welt als Gesamtheit die Hauptsache. Sie wollten die Gesetze der Welt erforschen und glaubten, aus der Welterkenntnis müsse sich die Menschenerkenntnis von selbst ergeben, denn ihnen war der Mensch ein Glied des Weltganzen wie die andern Dinge. Die Stoiker und Epikureer machten den Menschen zur Hauptsache ihres Nachdenkens. Sie wollten seinem Leben den ihm entsprechenden Inhalt geben. Sie dachten nach, wie der Mensch leben solle. Alles übrige war ihnen nur ein Mittel zu diesem Zwecke. Alle Philosophie gilt den Stoikern nur insofern als etwas Wertvolles, als durch sie der Mensch erkennen könne, wie er zu leben
habe. Als das richtige Leben des Menschen betrachteten sie dasjenige, welches der Natur gemäß ist. Um das Naturgemäße in seinem Handeln zu verwirklichen, muß man dieses Naturgemäße erst erkannt haben.
In der stoischen Lehre liegt ein wichtiges Zugeständnis an die menschliche Persönlichkeit. Dasjenige, daß sie sich Zweck und Ziel sein darf und daß alles andere, selbst die Erkenntnis, nur um dieser Persönlichkeit willen da ist.
Noch weiter in dieser Richtung gingen die Epikureer. Ihr Streben erschöpfte sich darin, das Leben so zu gestalten, daß der Mensch sich in demselben so zufrieden wie möglich fühle oder daß es ihm die möglichst große Lust gewähre. So sehr stand ihnen das Leben im Vordergrunde, daß sie die Erkenntnis nur zu dem Zwecke trieben, damit der Mensch von abergläubischer Furcht und von dem Unbehagen befreit werde, die ihn befallen, wenn er die Natur nicht durchschaut.
Durch die Anschauungen der Stoiker und Epikureer zieht ein höheres menschliches Selbstgefühl als durch diejenigen der älteren griechischen Denker.
In einer feineren, geistigeren Weise erscheint diese Anschauung bei den Skeptikern. Sie sagten sich: wenn der Mensch sich über die Dinge Ideen macht, so kann er sie nur aus sich heraus machen. Und nur aus sich heraus kann er die Überzeugung schöpfen, daß einem Dinge eine Idee entspreche. Sie sahen in der Außenwelt nichts, was einen Grund abgehe zu einer Verknüpfung von Ding und Idee. Und was vor ihnen von solchen Gründen gesagt worden war, betrachteten sie als Täuschung und bekämpften es.
Der Grundzug der skeptischen Ansicht ist Bescheidenheit. Ihre Anhänger wagten nicht zu leugnen, daß es in der Außenwelt eine Verknüpfung von Idee und Ding gebe; sie leugneten bloß, daß der Mensch eine solche erkennen könne. Deshalb machten sie zwar den Menschen zum Quell seines Erkennens, aber sie sahen dieses Erkennen nicht als den Ausdruck der wahren Weisheit an.
Im Grunde stellt der Skeptizismus die Binkerotterltlinng des menschlichen Erkennens dar. Der Mensch unterliegt dem selbst-geschaffenen Vorurteil, daß die Wahrheit außen fertig vorhanden
sei, durch die gewonnene Überzeugung, daß seine Wahrheit nur eine innere, also überhaupt nicht die rechte sein könne.
Mit rückhaltlosem Vertrauen in die Kraft des menschlichen Geistes hat Thales begonnen, über die Welt nachzudenken. Ein Zweifel daran, daß dasjenige, was das Nachsinnen als Grund der Welt ansehen muß, nicht in Wirklichkeit dieser Grund sein könne, lag seinem naiven Glauben an die Erkenntnisfähigkeit des Menschen ganz ferne. Bei den Skeptikern ist an die Stelle dieses Glaubens ein vollständiges Verzichtleisten auf wirkliche Wahrheit getreten.
*
Zwischen den beiden Extremen, der naiven Vertrauensseligkeit in die menschliche Erkenntnisfahigkeit und der absoluten Vertrauenslosigkeit, liegt der Entwicltelungsgang des griechischen Denkens. Man kann diesen Entwickelungsgang begreifen, wenn man beachtet, wie sich die Vorstellungen über die Ursachen der Welt gewandelt haben. Was sich die ältesten griechischen Philosophen als solche Ursachen dachten, hatte sinnliche Eigenschaften. Da-durch hatte man ein Recht, diese Ursachen in die Außenwelt zu versetzen. Das Ur-Wasser des Thales gehört wie jeder andere Gegenstand der Sinnenwelt der äußeren Wirklichkeit an. Ganz anders wurde die Sache, als Parmenides im Denken das wahre Sein zu erkennen glaubte. Denn dieses Denken ist seinem wahren Dasein nach nur im menschlichen Innern wahrzunehmen. Durch Parmenides erst entstand die große Frage: wie verhält sich das gedankliche, geistige Sein zu dem äußeren, das die Sinne wahrnehmen. Man hatte sich nun gewöhnt, das Verhältnis des höchsten Seins zu demjenigen, das uns täglich umgibt, so vorzustellen, wie sich Thales das seines sinnlichen Urdings zu den uns umgebenden Dingen gedacht hat. Es ist durchaus möglich, sich das Hervorgehen aller Dinge aus dem Wasser, das Thales als Urquell alles Seins hinstellt, analog gewissen sinnenfälligen Prozessen vorzustellen, die sich täglich vor unsern Augen abspielen. Und der Trieb, sich das Verhältnis der uns umgebenden Welt im Sinne einer solchen Analogie vorzustellen, blieb auch noch vorhanden,
als durch Parmenides und seine Nachfolger das reine Denken und sein Inhalt, die Ideenwelt, zum Urquell alles Seins gemacht worden sind. Die Menschen waren wohl reif, einzusehen, daß die geistige Welt höher steht als die sinnliche, daß sich der tiefste Welt-gehalt im Innern des Menschen offenbart, aber sie waren nicht sogleich auch reif, sich das Verhältnis zwischen sinnlicher und ideeller Welt auch ideell vorzustellen. Sie stellten es sich sinnlich, als ein tatsächliches Hervorgehen vor. Hätten sie es sich geistig gedacht, so hätten sie ruhig zugestehen können, daß der Inhalt der Ideenwelt nur im Innern des Menschen vorhanden ist. Denn dann brauchte das Höhere dem Abgeleiteten nicht zeitlich voranzugehen. Ein Sinnending kann einen geistigen Inhalt offenbaren, aber dieser Inhalt kann im Momente der Offenbarung erst aus dem Sinnendinge heraus geboren werden. Er ist ein späteres Entwickelungsprodukt als die Sinnenwelt. Stellt man sich das Verhältnis aber als ein Hervorgehen vor, so muß dasjenige, woraus das andere hervorgeht, diesem letzteren auch in der Zeit vorangehen. Auf diese Weise wurde das Kind, die geistige Welt der Sinnenwelt, zur Mutter der letzteren gemacht. Dies ist der psychologische Grund, warum der Mensch seine Welt hinausversetzt in die äußere Wirklichkeit und von dem, was sein Eigentum und Produkt ist, behauptet: es habe ein für sich bestehendes, objektives Dasein, und er habe sich ihm unterzuordnen, beziehungsweise er könne sich nur in dessen Besitz setzen durch Offenbarung oder auf eine andere Weise, durch die die einmal fettige Wahrheit ihren Einzug in sein Inneres halte.
Diese Deutung, die der Mensch seinem Streben nach Wahrheit, seinem Erkennen gibt, entspricht einem tiefen Hange seiner Natur. Goethe hat diesen Hang in seinen «Sprüchen in Prosa> mit folgenden Worten gekennzeichnet: «Der Mensch begreift niemals, wie anthropomorphisch er ist.> Und: «Fall und Stoß. Dadurch die Bewegung der Weltkörper erklären zu wollen, ist eigentlich ein versteckter Anthropomorphismus, es ist des Wanderers Gang über Feld. Der aufgehobene Fuß sinkt nieder, der zurückgebliebene strebt vorwätts und fällt; und immer so fort, vom Ausgehen bis zum Ankommen.> Alle Erklärung der Natur besteht eben darinnen,
daß Erfahrungen, die der Mensch an sich selbst macht, in den Gegenstand hineingedeutet werden. Selbst die einfachsten Erscheinungen werden auf diese Weise erklärt. Wenn wir den Stoß zweier Körper erklären, so geschieht das dadurch, daß wir uns vorstellen, der eine Körper übe auf den anderen eine ähnliche Wirkung aus wie wir selbst, wenn wir einen Körper stoßen. So wie wir es hier mit etwas Untergeordnetem machen, so macht es der religiöse Mensch mit seiner Gottesvorstellung. Er deutet menschliche Denk- und Handlungsweise in die Natur hinein; und auch die angeführten Philosophen von Parmenides bis Aristoteles deuteten menschliche Denkvorgänge in die Natur hinein.
Das hiermit angedeutete Bedürfnis des Menschen hat Max Stirner im Sinne, wenn er sagt: Wesen treibt, das ist eben der geheimnisvolle Spuk, den Wir höchstes Wesen nennen. Und diesem Spuk auf den Grund zu kommen, ihn zu begreifen> in ihm die Wirklichkeit zu entdecken (das zu beweisen), - diese Aufgabe setzten sich Jahrtausende die Menschen; mit der gräßlichen Unmöglichkeit, der endlosen Danaidenarbeit, den Spuk in einen Nicht-Spuk, das Unwirkliche in ein Wirkliches> den Geist in eine ganze und leibhaftige Person zu verwandeln, - damit qualten sie sich ab. Hinter der daseienden Welt suchten sie das , das Wesen, sie suchten hinter dem Ding das Unding. »
*
Einen glänzenden Beweis dafür, wie der menschliche Geist geneigt ist, sein eigenes Wesen und deshalb sein Verhältnis zur Welt zu verkennen, bietet die letzte Phase der griechischen Philosophie: der Neuplatonismus. Diese Lehre, deren wichtigster Vertreter Plotin ist, hat mit der Tendenz gebrochen, den Inhalt des menschlichen Geistes in ein Reich außerhalb der lebendigen Wirklichkeit zu verlegen, in welcher der Mensch selbst steht. In der eigenen Seele sucht der Neuplatoniker den Ort, an dem der höchste Gegenstand des Erkennens zu finden ist. Durch jene Steigerung der Erkenntniskräfte, die man als Ekstase bezeichnet, sucht er in
sich selbst das Wesen der Welterscheinungen anzuschauen. Die Erhöhung der inneren Wahrnehmungskräfte soll den Geist auf eine Stufe des Lebens heben, auf der er unmittelbar die Offenbarung dieses Wesens empfindet. Eine Art von Mystik ist diese Lehre. Es liegt ihr das Wahre zugrunde, das sich in jeder Mystik findet. Die Versenkung in das eigene Innere liefert die tiefste menschliche Weisheit. Aber zu dieser Versenkung muß sich der Mensch erst erziehen. Er muß sich gewöhnen, eine Wirklichkeit zu schauen, die frei von alledem ist, was uns die Sinne überliefern. Menschen, die ihre Erkenntniskräfte bis zu dieser Höhe gebracht haben, sprechen von einem inneren Licht, das ihnen aufgegangen ist. Jakob Böhme, der christliche Mystiker 4es siebzehnten Jahrhunderts, betrachtete sich als einen solch innerlich Erleuchteten. Er sieht in sich das Reich, das er als das höchste dem Menschen erkennbare bezeichnen muß. Er sagt: «Im menschlichen Gemüte liegt die Signatur ganz künstlich zugerichtet, nach dem Wesen aller Wesen.»
Das Anschauen der menschlichen Innenwelt setzt der Neu-platonismus an die Stelle der Spekulation über eine jenseitige Außenwelt. Dabei tritt die höchst charakteristische Erscheinung auf, daß der Neuplatoniker sein eigenes Inneres für ein Fremdes ansieht. Bis zur Erkenntnis des Ortes, an dem das letzte Glied der Welt zu suchen ist, hat man es gebracht; was an diesem Orte sich vorfindet, hat man falsch gedeutet. Der Neuplatoniker beschreibt deshalb die inneren Erlebnisse seiner Ekstase, wie Plato die Wesen seiner übersinnlichen Welt beschreibt.
Bezeichnend ist, daß der Neuplatonismus gerade dasjenige aus dem Wesen der Innenwelt ausschließt, was den eigentlichen Kern derselben ausmacht. Der Zustand der Ekstase soll nur dann eintreten, wenn das Selbstbewußtsein schweigt. Es war deshalb nur natürlich, daß der Geist im Neuplatonismus sich selbst, seine eigene Wesenheit nicht in ihrem wahren Lichte schauen konnte.
In dieser Anschauung haben die Ideengänge, die den Inhalt der griechischen Philosophie ausmachen, ihren Abschluß gefunden. Sie stellen sich dar als Sehnsucht des Menschen, sein eigenes Wesen als Fremdes zu erkennen, zu schauen, anzubeten.
Nach der naturgemäßen Entwickelung hätte innerhalb der abendländischen Geistesentwickelung auf den Neuplatonismus die Entdeckung des Egoismus folgen müssen. Das heißt, der Mensch hätte das als fremd angesehene Wesen als sein eigenes erkennen müssen. Er hätte sich sagen müssen: das Höchste, was es in der dem Menschen gegebenen Welt gibt, ist das individuelle Ich, dessen Wesen in dem Inneren der Persöniichkeit zur Erscheinung kommt.
*
Dieser natürliche Gang der abendländischen Geistesentwickelung wurde aufgehalten durch die Ausbreitung der christlichen Lehre. Das Christentum bietet dasjenige, was die griechische Philosophie in der Sprache des Weltweisen zum Ausdruck bringt, in volkstümlichen, sozusagen mit Händen zu greifenden Vorstellungen dar. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie tief eingewurzelt in der Menschennatur der Drang ist, sich der eigenen Wesenheit zu entäußern, so erscheint es begreiflich, daß diese Lehre eine so unvergleichliche Macht über die Gemüter gewonnen hat. Um diesen Drang auf philosophischem Wege zu befriedigen: dazu gehört eine hohe Entwickelungsstufe des Geistes. Ihn in der Form des christlichen Glaubens zu befriedigen, reicht das naivste Gemüt aus. Nicht einen feingeistigen Inhalt wie Platos Ideenwelt, nicht ein dem erst zu entfachenden inneren Lichte entströmendes Erleben stellt das Christentum als höchste Weltwesenheit dar, sondern Vorgänge mit den Artributen sinnlich-greifbarer Wirklichkeit. Ja es geht so weit, das höchste Wesen in einem einzelnen historischen Menschen zu verehren Mit solchen greifbaren Vorstellungen konnte der philosophische Geist Griechenlands nicht dienen. Solche Vorstellungen lagen hinter ihm in der Mythologie des Volkes. Hamann, Herders Vorläufer auf dem Gebiete der Religionswissenschaft, bemerkt einmal: Ein Philosoph für Kinder sei Plato nie gewesen. Die Kindesgeister aber sind es, für die «der heilige Geist den Ehrgeiz gehabt hat, ein Schriftsteller zu werden» .
Und diese kindliche Form der menschlichen Selbstentfremdung ist für Jahrhunderte von dem denkbar größten Einflusse gewesen für die philosophische Gedankenentwickelung. Wie ein Nebel
lagert sich die christliche Lehre vor das Licht, von dem die Erkenntnis des eigenen Wesens hätte ausgehen sollen. Die Kirchenväter der ersten christlichen Jahrhunderte suchen durch allerlei philosophische Begriffe den volkstümlichen Vorstellungen eine Form zu geben, in der sie auch einem gebildeteren Bewußtsein annehmbar scheinen konnten. Und die späteren Kirchenlehrer, deren bedeutendster Vertreter der heilige Augustin ist, setzten diese Bestrebungen in demselben Geiste fort. Der Inhalt des christlichen Glaubens wirkte so faszinierend, daß von einem Zweifel an seiner Wahrheit nicht die Rede sein konnte, sondern nur von einem Heraufheben derselben in ein mehr geistiges, ideelleres Gebiet. Die Philosophie der Kirchenlehrer ist Umsetzung des christlichen Glaubensinhaltes in ein Ideengebäude. Der allgemeine Charakter dieses Ideengebäudes konnte aus diesem Grunde kein anderer sein als der des Christentums: Hinausversetzung der menschlichen Wesenheit in die Welt, Selbstentäußerung. So ist es gekommen, daß Augustin wieder an den richtigen Ort kommt, wo das Welt-wesen zu finden ist, und daß er an diesem Orte wieder ein Fremdes findet. In dem eigenen Sein des Menschen sucht er den Quell aller Wahrheit, die inneren Erlebnisse der Seele erklärt er für das Fündament der Erkenntnis. Aber die christliche Glaubenslehre hat an den Ort, an dem er suchte, den außermenschlichen Inhalt gelegt. Deshalb fand er an dem rechten Orte die unrechten Wesenheiten.
Es folgt nun eine jahrhundertelange Anstrengung des menschlichen Denkens, die keinen andern Zweck hatte, als mit Aufwendung aller Kraft des menschlichen Geistes den Beweis zu erbringen, daß der Inhalt dieses Geistes nicht in diesem Geiste, sondern an dem Orte zu suchen sei, wohin ihn der christliche Glaube versetzt hat. Die Gedankenbewegung, die aus dieser Anstrengung hervorwuchs, wird als Scholastik bezeichnet. In diesem Zusammenhange können all die Spitzfindigkeiten der Scholastiker nicht interessieren. Denn eine Entwickelung nach der Richtung hin, in der die Erkenntnis des persönlichen Ich liegt, bedeutet diese Ideenbewegung nicht im geringsten.
*
Wie dicht die Nebeiwolke war, welche das Christentum vor die menschliche Selbsterkenntnis geschoben hat, wird am offenbarsten durch die Tatsache, daß der abendländische Geist nun überhaupt unfähig wurde, rein aus sich heraus auch nur einen Schritt auf dem Wege zu dieser Selbsterkenntnis zu machen. Er bedurfte eines zwingenden Anstoßes von außen. Er konnte auf dem Grunde der Seele nicht finden, was er so lange in der Außenwelt gesucht hatte. Es wurde ihm aber der Beweis erbracht: diese Außenwelt kann gar nicht so geartet sein, daß er das Wesen, das er suchte, in ihr finden konnte. Dies geschah durch das Auffilühen der Naturwissenschaften im sechzehnten Jahrhundert. Solange der Mensch von der Beschaffenheit der natürlichen Vorgänge nur unvollkommene Vorstellungen hatte, war in der Außenwelt Raum für göttliche Wesenheiten und für das Wirken eines persönlichen, göttlichen Willens. Als aber Kopernikus und Kepler ein natürliches Bild der Welt entwarfen, war für ein christliches kein Platz mehr vorhanden. Und als Galilei die Fundamente zu einer Erklärung der natürlichen Vorgänge durch Naturgesetze legte, mußte der Glaube an die göttlichen Gesetze ins Wanken kommen.
Nun mußte man das Wesen, das der Mensch als das höchste anerkennt und das ihm aus der Außenwelt herausgedrängt wurde, auf einem neuen Wege suchen.
Die philosophischen Folgerungen der durch Kopernikus, Kepler und Galilei gegebenen Voraussetzungen zog Baco von Verulam. Sein Verdienst um die abendländische Weltanschauung ist im Grunde nur ein negatives. Er hat in kräftiger Weise dazu aufgefordert, den Blick frei und unbefangen auf die Wirklichkeit, auf das Leben zu richten. So banal diese Forderung erscheint: es ist doch nicht zu leugnen, daß die abendländische Gedankenentwickelung jahrhundertelang schwer gegen sie gesündigt hat. Unter die wirklichen Dinge gehört auch das eigene Ich des Menschen. Und sieht es nicht fast aus, als wenn es in der Naturanlage des Menschen läge, dieses Ich nicht unbefangen betrachten zu können? Nur die Ausbildung eines vollkommen unbefangenen, unmittelbar auf das Wirkliche gerichteten Sinnes kann zur Selbsterkenntnis
führen. Der Weg der Naturerkenntnis ist auch der Weg der Ich-Erkenntnis.
*
Es traten nun in der abendländischen Gedankenentwickelung zwei Strömungen auf, die auf verschiedenen Wegen den durch die Naturwissenschaften notwendig gemachten neuen Erkenntnis-zielen zustrebten. Die eine geht auf Jakob Böhme, die andere auf René Descartes zurück.
Jakob Böhme und Descartes standen nicht mehr im Banne der Scholastik. Jener hat eingesehen, daß es im Weltenraume nirgends einen Platz für den Himmel gibt; deshalb wird er Mystiker. Er sucht den Himmel im Innern des Menschern Dieser hat erkannt, daß das Haften der Scholastiker an der christlichen Lehre nur eine Sache der durch Jahrhunderte erzeugten Gewöhnung an diese Vorstellungen ist. Deshalb hielt er es für notwendig, zunächst an diesen gewohnten Vorstellungen zu zweifeln und eine Erkenntnisart zu suchen, durch die der Mensch zu einem solchen Wissen kommen kann, dessen Sicherheit er nicht aus Gewohnheit behauptet, sondern die ihm durch die eigenen Geisteskräfte in jedem Augenblick verbürgt werden kann.
Es sind also starke Ansätze, welche, sowohl bei Böhme wie bei Descartes, das menschliche Ich macht, sich selbst zu erkennen. Dennoch sind beide in ihren weiteren Ausführungen von den alten Vorurteilen überwältigt worden. Es wurde schon angedeutet, daß Jakob Böhme eine gewisse geistige Verwandtschaft mit den Neuplatonikern hat. Seine Erkenntnis ist Einkehr in das eigene Innere. Was ihm aber in diesem Innern entgegentritt, ist nicht das Ich des Menschen, sondern doch wieder nur der Christengott. Er wird gewahr, daß im eigenen Gemüte dasjenige sitzt, wonach der erkenntnisbedürftige Mensch begehrt. Erfüllung der heißesten menschlichen Sehnsuchten strömt ihm von da aus entgegen. Das führt ihn aber nicht zu der Ansicht, daß das Ich durch Steigerung seiner Erkenntniskräfte imstande ist, seine Ansprüche aus sich selbst heraus auch zu befriedigen. Es bringt ihn vielmehr zu der Meinung, auf dem Erkenntniswege in das Gemüt den Gott wahrhaft
gefunden zu haben, den das Christentum nur auf einem falschen Wege gesucht habe. Statt Selbsterkenntnis sucht Jakob Böhme Vereinigung mit Gott, statt Leben mit den Schätzen des eigenen Innern sucht er ein Leben in Gott.
Es ist einleuchtend, daß von der menschlichen Selbsterkenntnis oder Selbstverkennung auch abhängen wird, wie der Mensch über sein Handeln, über sein sittliches Leben denkt. Das Gebiet des Sittlichen baut sich ja gleichsam als höheres Stockwerk über den rein natürlichen Vorgängen auf. Der christliche Glaube, der schon diese natürlichen Vorgänge als Ausfluß des göttlichen Willens ansieht, wird in dem Sittlichen um so mehr diesen Willen suchen. In der christlichen Sittenlehre zeigt sich fast noch klarer als sonst irgendwo das Schiefe dieser Weltanschauung. Welch ungeheure Sophistik auch die Theologie auf diesem Gebiete aufgewendet hat: es bleiben hier Fragen bestehen, die vom Standpunkte des Christentums aus in weithin deutlichen Zügen das Widerspruchsvolle zeigen. Wenn ein solches Urwesen wie der Christengott angenommen wird, so bleibt es unverständlich, wie das Gebiet des Handelns in zwei Reiche zerfallen kann: in das des Guten und das des Bösen. Denn alle Handlungen müßten aus dem Urwesen fließen und folglich die gleichartigen Züge ihres Ursprungs tragen. Sie müßten eben göttlich sein. Ebensowenig ist auf diesem Boden die menschliche Verantwortlichkeit zu erklären. Der Mensch wird ja von dem göttlichen Willen gelenkt. Er kann sich diesem also nur überlassen, er kann nur durch sich geschehen lassen, was Gott vollbringt.
Genau dasselbe, was auf dem Gebiete der Erkenntnislehre eingetreten ist, hat sich auch innerhalb der Anschauungen über die Sittlichkeit vollzogen. Der Mensch kam seinem Hange entgegen, das eigene Selbst aus sich herauszureißen und als ein Fremdes hinzustellen. Und so wie auf dem Erkenntnisgebiete dem als außer-menschlich angesehenen Urwesen kein anderer Inhalt gegeben werden konnte als der aus dem eigenen Innern geschöpfte, so konnten in diesem Wesen auch keine sittlichen Absichten und Antriebe zum Handeln gefunden werden als die eigenen der menschlichen Seele. Wovon der Mensch in seinem tiefsten Innern
überzeugt war, daß es geschehen soll, das betrachtete er als das vom Welturwesen Gewollte. Auf diese Weise hatte man auf ethischem Gebiete eine Zweiheit geschaffen. Man stellte dem Selbst, das man in sich hatte und aus dem heraus man handeln mußte, den eigenen Inhalt als das Sittlich-Bestimmende gegenüber. Und dadurch konnten sittliche Forderungen entstehen. Das Selbst des Menschen durfte nicht sich, es mußte einem Fremden folgen. Der Selbstentfremdung auf dem Erkenntnisgebiet entspricht auf dem moralischen Felde die Selbstlosigkeit der Handlungen. Diejenigen Handlungen sind gut, bei denen das Ich dem Fremden folgt, diejenigen dagegen böse, bei denen es sich selbst folgt. In der Selbst-sucht sieht das Christentum den Quell des Bösen. Nie hätte das geschehen können, wenn man eingesehen hätte, daß das gesamte Sittliche seinen Inhalt nur aus dem eigenen Selbst schöpfen kann. Man kann die ganze Summe der christlichen Sittenlehre in dem Satze zusammenfassen: Gesteht sich der Mensch ein, daß er nur den Geboten seines eigenen Wesens folgen kann, und handelt er darnach, so ist er böse; verbirgt sich ihm diese Wahrheit und setzt er - oder läßt setzen - die eigenen Gebote als fremde über sich, um ihnen gemäß zu handeln, so ist er gut.
Vielleicht am vollkommensten durchgeführt ist die Morallehre der Selbstlosigkeit in einem Buche aus dem vierzehnten Jahrhundert: «Die deutsche Theologie». Der Verfasser des Buches ist uns unbekannt. Er hat die Selbstentäußerung so weit getrieben, dafür zu sorgen, daß sein Name nicht auf die Nachwelt komme. In dein Buche heißt es: «Das ist kein wahres Wesen und hat kein Wesen, anders denn in dem Vollkommenen, sondern es ist ein Zufall oder ein Glanz und ein Schein, der kein Wesen ist oder kein Wesen hat, anders als in dem Feuer, wo der Glanz ausfließt, oder in der Sonne, oder in dem Lichte. Die Schrift spricht und der Glaube und die Wahrheit: Sünde sei nichts anderes, denn daß sich die Kreatur abkehrt von dem unwandelbaren Gute und kehret sich zu dem wandelbaren, das ist: daß sie sich kehrt von dem Vollkommenen zu dem Geteilten und Unvollkommenen und allermeist zu sich selber. Nun merke. Wenn sich die Kreatur etwas Gutes annimmt, als Wesens, Lebens, Wissens, Erkennens, Vermögens
und kürzlich alles dessc, was man gut nennen soll, und meint, daß sie das sei oder daß es das Ihre sei oder ihr zugehöre oder daß es von ihr sei: so oft und viel dahei geschieht, so kehrt sie sich ab. Was tat der Teufel anders oder was war sein Fall und Abkehren anders, als daß er sich annahm, er wäre auch etwas und etwas wäre sein und ihm gehörte auch etwas zu? Dies Annehmen und sein Ich und sein Mich, sein Mir und sein Mein, das war sein Abkehren und sein Fall. Also ist es noch. - Denn alles das, was man für gut hält oder gut nennen soll, das gehört niemand zu, denn allein dem ewigen, wahren Gut, das Gott allein ist, und wer sich dessen annimmt, der tut Unrecht und wider Gott.»
Mit der Wendung, die Jakob Böhme dem Verhältnisse des Menschen zu Gott gegeben hat, hängt auch eine Änderung der Anschauungen über das Sittliche gegenüber den alten christlichen Vorstellungen zusammen. Gott wirkt als Veranlasser des Guten zwar noch immer als Höheres in dem menschlichen Selbst, aber er wirkt eben in diesem Selbst, nicht von außen auf dasselbe. Es entsteht dadurch eine Verinnerlichung des sittlichen Handelns. Das übrige Christentum hat nur eine äußere Befolgung des göttlichen Willens verlangt. Bei Jakob Böhme treten die früher getrennten Wesenheiten, das wirkliche Persönliche und das zum Gott gemachte, in einen lebendigen Zusammenhang. Dadurch wird nun wohi der Quell des Sittlichen in das menschliche Innere verlegt, aber das ethische Prinzip der Selbstlosigkeit erscheint noch stärker betont. Wird Gott als äußere Macht angesehen, so ist das menschliche Selbst das eigentlich Handelnde. Es handelt entweder im Sinne Gottes oder diesem entgegen. Wird aber Gott in das menschliche Innere verlegt, so handelt der Mensch nicht mehr selber, sondern Gott in ihm. Gott lebt sich unmittelbar in dem menschlichen Leben dar. Der Mensch verzichtet darauf, ein eigenes Leben zu haben, er macht sich zu einem Gliede des göttlichen Lebens. Er fühlt sich in Gott, Gott in sich, er wächst mit dem Urwesen zusammen, er wird ein Organ desselben.
In dieser deutschen Mystik hat der Mensch also seine Teilnahme am göttlichen Leben mit der vollständigsten Auslöschung seiner Persönlichkeit, seines Ich erkauft. Den Verlust des Persönlichen
fühlten Jakob Böhme und die Mystiker, die seiner Anschauung waren, nicht. Im Gegenteil: sie empfanden etwas besonders Erhebendes bei dem Gedanken, daß sie des göttlichen Lebens unmittelbar teilhaftig seien, daß sie Glieder am göttlichen Organismus seien. Der Organismus kann ja nicht bestehen, ohne seine Glieder. Der Mystiker fühlte sich deshalb als ein Notwendiges innerhalb des Weltganzen, als ein Wesen, das Gott unentbehrlich ist. - Angelus Silesius, der in demselben Geiste wie Jakob Böhme empfindende Mystiker, spricht das in einem schönen Satze aus:
«Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben,
Wird´ ich zu nicht, er muß von Not den Geist aufgeben.»
Und noch charakteristischer in einem andern:
«Gott mag nicht ohne mich ein einzigs Wünnlein machen,
Erhalt' ich's nicht mit ihm, so muß es stracks zerkrachen.»
Das menschliche Ich macht hier in kräftigster Weise sein Recht geltend gegenüber seinem in die Außenwelt versetzten Bilde. Dem vermeintlichen Urwesen wird zwar auch hier nicht gesagt, daß es die von dem Menschen sich gegenüber gestellte eigene menschliche Wesenheit ist, aber die letztere wird zum Erhalter des göttlichen Urgrundes gemacht.
Eine starke Empfindung davon, daß der Mensch sich durch seine Gedankenentwickelung in ein schiefes Verhältnis zur Welt gebracht hat, hatte Descartes. Deshalb setzte er zunächst allem, was aus dieser Gedankenentwickelung hervorgegangen war, den Zweifel entgegen. Nur wenn man an allem zweifelt, was die Jahrhunderte als Wahrheiten entwickelt haben, kann man - nach seiner Meinung - die notwendige Unbefangenheit gewinnen für einen neuen Ausgangspunkt. Es lag in der Natur der Sache, daß Descartes durch diesen seinen Zweifel auf das menschliche Ich geführt wurde. Denn je mehr der Mensch alles übrige als ein noch zu Suchendes hinstellt, ein desto intensiveres Gefühl muß er von seiner eigenen suchenden Persönlichkeit erhalten. Er kann sich sagen: vielleicht irre ich auf den Wegen des Daseins; um so deutlicher nur wird er auf sich selbst, den Irrenden, gewiesen.
Das Damit ist wenigstens nach einer Richtung hin die absolut zentrale Stellung des Ich im Weltganzen anerkannt, nach der Richtung der Methode des Erkennens. Der Mensch richter das Wie seiner Welterkenntnis nach dem Wie seiner Selbsterkenntnis ein und fragt nicht mehr nach einem äußeren Wesen, um dieses Wie zu rechtfertigen. Nicht wie ein Gott das Erkennen vorschreibt, will der Mensch denken, sondern wie er es sich selbst einrichtet. Hinsichtlich des Wie zieht der Mensch die Kraft seiner Weisheit nunmehr aus sich selbst.
In bezug auf das Was tat Descartes nicht den gleichen Schritt. Er ging daran, Vorstellungen über die Welt zu gewinnen, und durchsuchte - dem eben angeführten Erkenntnisprinzip gemäß -das eigene Innere nach solchen Vorstellungen. Da fand er die Gottesvorstellung. Sie war natürlich nichts weiter als die Vorstellung des menschlichen Ich. Das erkannte Descartes nicht. Er wurde dadurch getäuscht, daß die Jdee von Gott als dem aller-vollkommensten Wesen sein Denken in eine ganz falsche Bahn brachte. Die eine Eigenschaft, die der allergrößten Vollkommenheit, überstrahlte für ihn alle übrigen des zentralen Wesens. Er sagte sich: die Vorstellung eines allervollkommensten Wesens kann der Mensch, der selbst unvollkommen ist, nicht aus sich selbst schöpfen, also kann sie ihm nur von außen, von dem aller-vollkommensten Wesen selbst kommen. Somit existiert dieses allervollkommenste Wesen. Hätte Descartes den wahren Inhalt der Gottesvorstellung untersucht, so hätte er gefunden, daß dieser vollkommen gleich der Ich-Vorstellung und die Vollkommenheit
nur eine im Gedanken vollzogene Steigerung dieses Inhalts ist. Der wesentliche Inhalt einer Elfenbeinkugel wird dadurch nicht geändert, daß ich sie mir unendlich groß denke. Ebensowenig wird aus der Ich-Vorstellung durch eine solche Steigerung etwas anderes.
Der von Descartes geführte Beweis des Daseins Gottes ist also wieder nichts als eine Umschreibung des menschlichen Bedürfnisses, das eigene Ich als außermenschliches Wesen zum Weltengrunde zu machen. Hier zeigt es sich aber gerade mit voller Deutlichkeit, daß der Mensch für dies außermenschliche Urwesen keinen eigenen Inhalt gewinnen, sondern ihm nur denjenigen seiner Ich-Vorstellung in unwesentlich geänderter Form leihen kann.
*
Mit Spinoza ist auf dem Wege, der zur Eroberung der Ich-Vorstellung führen muß, kein Schritt vorwärts, sondern einer zurück getan worden. Denn Spinoza hat kein Gefühl von der einzigartigen Stellung des menschlichen Ich. Für ihn erschöpft sich der Strom der Weltvorgänge in einem System von natürlichen Notwendigkeiten, wie er sich für die christlichen Philosophen in einem System von göttlichen Willensakten erschöpft. Hier wie dort ist das menschliche Ich nur ein Glied in diesem System. Für den Christen ist der Mensch in der Hand Gottes, für Spinoza in derjenigen des natürlichen Weltgeschehens. Der Christengott hat bei Spinoza einen anderen Charakter erhalten. Der in der Zeit des Aufblühens naturwissenschaftlicher Einsichten herangewachsene Philosoph kann keinen Gott anerkennen, der nach Willkür die Welt lenkt, sondern nur ein Urwesen, das existiert, weil seine Existenz durch es selbst eine Notwendigkeit ist, und das den Weltenlauf nach den unabänderlichen Gesetzen leitet, die aus seiner eigenen absolut notwendigen Wesenheit fließen. Daß der Mensch das Bild, unter dem er sich diese Notwendigkeit vorstellt, seinem eigenen Inhalte entnimmt, davon hat Spinoza kein Bewußtsein. Aus diesem Grunde wird auch das sittliche Ideal Spinozas ein unpersönliches, unindividuelles. Nach seinen Voraussetzungen
kann er ja nicht in der Vervollkommnung des Ich, in der Steigerung der eigenen Kräfte des Menschen ein Ideal erblicken, sondern in der Durchdringung des Ich mit dem göttlichen Weltinhalte, mit der höchsten Erkenntnis des objektiven Gottes. Sich an diesen Gott zu verlieren, soll Ziel des menschlichen Strebens sein.
Der Weg, den Descartes eingeschlagen hatte: vom Ich aus zur Welterkenntnis vorzudringen, wird nunmehr von den Philosophen der Neuzeit fortgesetzt. Die christlich-theologische Methode, die kein Vertrauen in die Kraft des menschlichen Ichs als Erkenntnisorgan hatte, war wenigstens überwunden. Das eine wurde anerkannt, daß das Ich selbst das höchste Wesen finden müsse. Von da bis zu dem anderen Punkte, bis zu der Einsicht, daß der im Ich liegende Inhalt auch das höchste Wesen ist, ist freilich ein weiter Weg.
Weniger tiefsinnig als Descartes gingen die englischen Philosophen Locke und Hume an die Untersuchung der Wege, die das menschliche Ich einschlägt, um zu einer Aufklärung über sich und die Welt zu kommen. Beiden ging vor allen Dingen eines ab: der gesunde, freie Blick in das menschliche Innere. Sie konnten daher auch keine Vorstellung von dem großen Unterschied bekommen, der besteht zwischen der Erkenntnis äußerer Dinge und derjenigen des menschlichen Ich. Alles, was sie sagen, bezieht sich nur auf die Erwerbung äußerer Erkenntnisse. Locke übersieht vollständig, daß der Mensch, indem er sich über die äußeren Dinge aufklärt, über diese ein Licht verbreitet, das seinem eigenen Innern entströmt. Er glaubt daher, daß alle Erkenntnisse aus der Erfahsung stammen. Aber was ist Erfahrung? Galilei sieht eine schwingende Kirchenlampe. Sie führt ihn dazu, die Gesetze zu finden, nach denen ein Körper schwingt. Er hat zweierlei erfahren: erstens durch seine Sinne äußere Vorgänge. Zweitens aus sich heraus die Vorstellung eines Gesetzes, das über diese Vorgänge aufklärt, sie begreiflich macht. Man kann nun narürlich das eine wie das andere Erfahrung nennen. Aber dann verkennt man eben den Unterschied, der zwischen den beiden Teilen des Erkenntnisvorganges besteht. Ein Wesen, das nicht aus dem
Inhalt seines Wesens heraus schöpfen könnte, würde ewig vor der schwingenden Kirchenlampe stehen: die sinnliche Wahrnehmung würde sich nie durch ein begriffliches Gesetz ergänzen. Icccke und alle, die so denken wie er, lassen sich durch etwas täuschen - nämlich durch die Art, wie die Erkenntnisinhalte an uns herankommen. Sie steigen eben einfach auf dem Horizonte unseres Bewußtseins auf. Dieses Aufsteigen bildet die Erfahrung. Aber anerkannt werden muß, daß der Inhalt der Erfahrungsgesetze von dem Ich an den Erfahrungen entwickelt wird. Bei Hume zeigt sich zweierlei. Einmal, daß dieser Mann, wie schon erwähnt, die Natur des Ich nicht erkennt und deshalb gerade so wie Locke den Inhalt der Gesetze aus der Erfahrung ableitet. Und dann, daß dieser Inhalt durch Loslösung von dem Ich völlig sich ins Ungewisse verliert, frei in der Luft ohne Halt und Grundlage hängt. Hume erkennt, daß die äußere Erfahrung nur unzusammenhängende Vorgänge überliefert; sie bietet mit diesen Vorgängen zusammen nicht zugleich die Gesetze, nach denen sie verknüpft sind. Da von dem Wesen des Ich Hume nichts weiß, kann er aus ihm auch nicht die Berechtigung zu solcher Verknüpfung ableiten. Er leitet sie daher aus dem vagsten Ursprung her, der sich denken läßt, aus der Gewöhnung. Der Mensch sieht, daß auf einen gewissen Vorgang immer ein anderer folgt; auf den Fall des Steines folgt die Aushöhlung des Bodens, auf den er fällt. Folglich gewöhnt sich der Mensch daran, solche Vorgänge in einer Verknüpfung zu denken. Alle Erkenntnis verliert ihre Bedeutung, wenn man von solchen Voraussetzungen ausgeht. Die Verbindung der Vorgänge und ihrer Gesetze gewinnt etwas rein Zufälliges.
*
Einen Mann, dem das schöpferische Wesen des Ich voll zum Bewußtsein gekommen ist, sehen wir in George Berkeley. Er hatte eine deutliche Vorstellung von der eigenen Tätigkeit des Ich beim Zustandekommen aller Erkenntnis. Wenn ich einen Gegenstand sehe, sagte er sich, so bin ich tätig. Ich schaffe mir meine Wahrnehmung. Der Gegenstand einer Wahrnehmung
bliebe immer jenseits meines Bewußtseins, er wäre für mich nicht da, wenn ich sein totes Dasein nicht fortwährend durch meine Tätigkeit belebte. Nur diese meine belebende Tätigkeit nehme ich wahr, nicht das, was ihr objektiv als toter Gegenstand vorangeht. Wohin ich in meiner Bewußtseinssphäre blicke: über-all sehe ich mich selbst als Tätiges, als Schaffendes. In Berkeleys Denken gewinnt das Ich ein universelles Leben. Was weiß ich von einem Sein der Dinge, wenn ich dieses Sein nicht vorstelle?
Aus schaffenden Geistern, die aus sich heraus eine Welt bilden, besteht für Berkeley die Welt. Aber auf dieser Stufe der Erkenntnis trat auch bei ihm das alte Vorurteil wieder auf. Er läßt das Ich sich zwar seine Welt schaffen, aber er gibt ihm nicht zugleich die Kraft, aus sich selbst zu schaffen. Es muß doch wieder eine Gottesvorstellung herhalten. Das schaffende Prinzip im Ich ist Gott, auch bei ihm.
Dieser Philosoph aber zeigt uns eines. Wer sich wirklich in das Wesen des schnffenden Ichs versenkt, der kommt aus demselben nicht wieder heraus zu einem äußeren Wesen, es sei denn auf gewaltsame Weise. Und gewaltsam geht Berkeley vor. Er führt ohne zwingende Notwendigkeit das Schaffen des Ich auf Gott zurück. Frühere Philosophen entleerten das Ich seines Inhaltes, und dadurch hatten sie für ihren Gott einen solchen. Berkeley tut das nicht. Deshalb vermag er nichts anderes, als neben die schöpferischen Geister noch einen besonderen zu setzen, der im Grunde mit ihnen völlig gleichartig, das heißt also doch wohl unnötig ist.
Noch auffälliger wird das bei dem deutschen Philosophen Leibniz. Auch er hatte Einblick in die schöpferische Tätigkeit des Ich. Er überblickte den Umfang dieser Tätigkeit ganz deutlich und sah ihre innere Geschlossenheit, ihr Beruhen auf sich selbst. Eine Welt für sich, eine Monale wurde ihm deshalb das Ich. Und alles, was Dasein hat, kann es nur dadurch haben, daß es sich selbst einen geschlossenen Inhalt gibt. Nur Monaden, das heißt aus sich und in sich schaffende Wesen existieren. Abgetrennte Welten für sich, die auf nichts außer ihnen angewiesen sind. Welten bestehen, keine Welt. Jeder Mensch ist eine Welt, eine
Monade für sich. Wenn nun diese Welten doch miteinander übereinstimmen, wenn sie voneinander wissen und die Inhalte ihres Wissens sich denken, so kann das nur davon herrühren, daß eine vorherbestimmte Übereinstimmung (prästabilierte Harmonie> besteht. Die Welt ist eben so eingerichtet, daß die eine Monade aus sich schafft, was der Tätigkeit in der andern entspricht Zur Herbeiführung dieser Übereinstimmung braucht Leibniz narürlich wieder den alten Gott Er hat erkannt, daß das Ich in seinem Innern tätig, schöpferisch ist, daß es sich selbst seinen Inhalt gibt; daß es selbst auch diesen Inhalt zu dem anderen Weltinhalt in Beziehung setzt, ist ihm verborgen geblieben. Dadurch ist er von der Gottesvorstellung nicht losgekommen. Von den zwei Forderungen, die in dem Goetheschen Satze liegen: «Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß' ich's Wahrheit», hat er nur die eine eingesehen.
Ein ganz bestimmtes Gepräge zeigt diese europäische Gedankenentwickelung. Das Beste, was der Mensch erkennen kann, muß er aus sich schöpfen. Er übt in der Tat Selbsterkenntnis. Aber er schreckt immer wieder vor dem Gedanken zurück, das Selbstgeschaffene auch als solches anzuerkennen. Er fühlt sich zu schwach, um die Welt zu tragen. Deshalb lädt er diese Bürde einem andern auf. Und die Ziele, die er sich selbst steckt, würden für ihn von ihrem Gewichte verlieren, wenn er sich ihren Ursprung eingesründe, deshalb belastet er sie mit Kräften, die er von außerhalb zu nehmen glaubt. Der Mensch verherrlicht sein Kind, ohne doch die Vaterschaft zugestehen zu wollen.
*
Trotz der entgegengesetzten Strömungen ist die menschliche Selbsterkenntnis stetig fortgeschritten. Auf dem Punkte, wo sie anfing, für allen Jenseitsglauben recht bedenklich zu werden, traf sie Kant. Die Einsicht in die Natur des menschlichen Erkennens hat die Überzeugungskraft aller Beweise erschüttert, die ersonnen worden sind, um einen solchen Glauben zu stützen. Man hat allmählich eine Vorstellung von wirklichen Erkenntnissen bekommen und durchschaute deshalb das Gekünstelte, Gequälte der
Scheinideen, welche über die außerweltlichen Mächte Aufklärung geben sollten. Ein frommer, gläubiger Mann wie Kant konnte befürchten, daß die Fortentwickelung auf dieser Bahn zur Auflösung alles Glaubens führen werde. Seinem tiefen religiösen Sinn mußte das als ein bevorstehendes großes Unglück für die Menschheit erscheinen. Aus der Angst vor der Zerstörung der religiösen Vorstellungen heraus entstand für ihn das Bedürfnis, einmal gründlich zu untersuchen: wie es mit dem Verhältnisse des menschlichen Erkennens zu den Gegenständen des Glaubens stehe. Wie ist Erkennen möglich, und auf was kann es sich erstrecken? Das ist die Frage, die Kant sich stellte, wohl vom Anfang an in der Hoffnung, aus seiner Antwort eine der festesten Stützen für den Glauben gewinnen zu können.
Zweierlei nahm Kant von seinen Vorgängern auf. Erstens, daß es unhezweifelbare Erkenntnisse gebe. Die Wahrheiten der reinen Matheinatik und die allgemeinen Lehren der Logik und Physik erschienen ihm als solche. Zweitens stützte er sich auf Hume mit der Behauptung, daß aus der Erfahrung keine unbedingt sicheren Wahrheiten kommen können. Die Erfahrung lehrt nur, daß wir gewisse Zusammenhänge soundso oft beobachtet haben, ob diese Zusammenhänge auch notwendige seien, darüber kann durch Erfahrung nichts ausgemacht werden. Wenn es, wie unzweifelhaft, notwendige Wahrheiten gibt und sie nicht aus der Erfahrung stammen können: woher stammen sie denn? Sie müssen in der menschlichen Seele vor der Erfahrung vorhanden sein. Nun kommt es darauf an, zu unterscheiden, was von den Erkenntnissen aus der Erfahrung stammt und was dieser Erkenntnisquelle nicht entnommen werden kann. Die Erfahrung geschieht dadurch, daß ich Eindrücke erhalte. Diese Eindrücke sind durch die Empfindungen gegeben. Der Inhalt dieser Empfindungen kann uns auf keine andere Weise als durch Erfahrung gegeben werden. Aber diese Empfindungen, wie Licht, Farbe, Klang, Wärme, Härte und so weiter, beten ein chaotisches Durcheinander, wenn sie nicht in gewisse Zusanimenhänge gebracht würden. In diesen Zusammenhängen bilden die Empfindungsinhalte erst die Gegen-stände der Erfahrung. Ein Gegenstand setzt sich aus einer bestimmt
geordneten Gruppe von Empfindungsinhalten zusammen. Die Empfindungsinhalte in Gruppen zu ordnen, das vollzieht nach Kants Meinung die menschliche Seele. In ihr sind gewisse Prinzipien vorhanden, durch welche die Mannigfaltigkeit der Empfindungen in gegenständliche Einheiten gebracht werden. Solche Prinzipien sind der Raum, die Zeit und Verknüpfungs-weisen, wie zum Beispiel die nach Ursache und Wirkung. Die Empfindungsinhalte sind mir gegeben, nicht aber ihre räuriliche Aneinanderreihung oder zeitliche Folge. Diese beiden bringt erst der Mensch hinzu. Ebenso ist ein Empfindungsinhalt gegeben und ein anderer, nicht aber das, daß der eine die Ursache des an-dern ist. Dazu macht sie erst der Verstand. So liegen in der menschlichen Seele die Verknüpfungsweisen der Empfindungsinhalte ein für allemal bereit. Können wir also nur durch Erfahrung uns in den Besitz von limpfindungsinhalten setzen, so können wir doch vor aller Erfahrung Gesetze darüber aufstellen, wie diese Empfindungsinhalte verknüpft sein werden. Denn diese Gesetze sind die in unserer eigenen Seele gegebenen. - Wir haben also notwendige Erkenntnisse. Aber diese beziehen sich nicht auf einen Inhalt, sondern nur auf die Verknüpfungsweise von Inhalten. Nimmermehr werden wir daher nach Kants Meinung aus den eigenen Gesetzen der menschlichen Seele inhaltvolle Erkenntnisse herausschöpfen. Der Inhalt muß durch die Erfahrung kommen. Nun können die Gegenstände des Jenseitsglaubens aber nie Gegenstand einer Erfahrung werden. Sie können daher auch nicht durch unsere notwendigen Erkenntnisse erreicht werden. Wir haben ein Erfahrungswissen und ein anderes notwendiges erfahrungsfreies Wissen darüber, wie die Inhalte der Erfahrung verknüpft sein können. Aber wir haben kein Wissen, das über die Erfahrung hinausgeht. Die uns umgebende Welt der Gegenstände ist, wie sie nach den in unserer Seele bereitliegenden Verknüpfungsgesetzen sein muß. Wie sie, abgesehen von diesen Gesetzen, «an sich> ist, wissen wir nicht. Die Welt, auf die sich unser Wissen bezieht, ist kein solches , sondern eine Erscheinung für uns.
Natürliche Einwände gegen diese Kantschen Ausführungen
drängen sich dem Unbefangenen auf. Der prinzipielle Unterschied zwischen den Einzelheiten (Empfindungsinhalten) und der Verknüpfungsweise dieser Einzelheiten besteht in bezug auf die Erkenntnis nicht in der Weise, wie Kant es annimmt. Wenn auch das eine von außen sich uns darbietet, das andere aus unserem Innern herauskommt, so bilden beide Elemente der Erkenntnis doch eine ungetrennte Einheit. Nur der abstrahierende Verstand kann Licht, Wärme, Härte und so weiter von räumlicher Anordnung, ursächlichem Zusammenhang und so weiter abtrennen. In Wirklichkeit dokumentieren sie an jedem einzelnen Gegenstande ihre notwendige Zusammengehörigkeit. Auch die Bezeichnung des einen Elementes als Inhalt gegenüber dem andern als bloß verknüpfenden Prinzips ist schief. In Wahrheit ist die Erkenntnis, daß etwas eine Ursache von einem andern ist, eine ebenso inhaltliche wie die, daß es gelb ist. Wenn sich der Gegenstand aus zwei Elementen zusammensetzt, von denen das eine von außen, das andere von innen gegeben ist, so folgt daraus, daß für das Erkennen auf zwei Wegen vermittelt wird, was der Sache nach zusammengehört. Nicht aber, daß man es mit zwei voneinander verschiedenen, künstlich zusammengekoppelten Sachen zu tun hat. -Nur durch eine gewaltsame Trennung von Zusammengehörigem kann also Kant seine Ansicht stützen. Am auffälligsten ist die Zusammengehörigkeit der beiden Elemente bei der Erkenntnis des menschlichen Ich. Hier kommt nicht das eine von außen, das andere von innen, sondern beide gehen aus dem Innern hervor. Und beide sind hler nicht nur ein Inhalt, sondern auch ein völlig gleichgearteter Inhalt.
Worauf es Kant ankam, was als Herzenswunsch seine Gedanken mehr lenkte als ein unbefangenes Beobachten der wirklichen Wesenheiten, war die Rettung der auf das Jenseits bezüglichen Lehren. Was das Wissen im Laufe einer langen Zeit als Stütze dieser Lehren zustande gebracht hatte, war morsch geworden. Kant glaubte nun gezeigt zu haben, daß ein solcher Beweis der Erkenntnis überhaupt nicht zukomme, weil sie auf die Erfahrung angewiesen ist und die Dinge des Jenseitsglaubens nicht Gegenstand einer Erfahrung werden können. Kant meinte damit ein
freies Feld geschaffen zu haben, auf dem ihm die Erkenntnis nicht störend in die Wege tritt, wenn er auf demselben den Jenseitsglauben aufbaut. Und er verlangt, daß als Stütze des sittlichen Lebens an die Dinge des Jenseits geglaubt werde. Aus dem Reiche, aus dem uns kein Wissen kommt, tönt zu uns die Despotenstimme des kategorischen Imperativs, der von uns verlangt, daß wir das Gute tun sollen. Und zur Aufrichtung des moralischen Reiches brauchten wir eben alles das, worüber das Wissen nichts sagen kann. Kant glaubte erreicht zu haben, was er wollte: «Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.>
*
Der große Philosoph der abendländischen Gedankenentwickelung, der in unmittelbarer Weise auf eine Erkenntnis des menschlichen Selbstbewußtseins ausging, ist Johann Gottlieb Fichte. Für ihn ist es bezeichnend, daß er ohne alle Voraussetzung mit völliger Unbefangenheit an diese Erkenntnis herangeht. Er hat das klare, scharfe Bewußtsein davon, daß nirgends in der Welt ein Wesen zu entdecken ist, von dem das Ich abgeleitet werden könnte. Es kann deshalb nur aus sich selbst abgeleitet werden. Nirgends ist eine Kraft zu entdecken, aus der das Sein des Ich fließt. Alles, was das Ich braucht, kann es nur aus sich selbst gewinnen. Nicht bloß gewinnt es durch Selbstbeobachtung Aufschluß über sein eigenes Wesen, es setzt erst durch eine unbedingte, voraussetzungslose Handlung dieses Wesen in sich hinein. «Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: das Ich ist, und setzt sein Sein, vermöge seines bloßen Seins. Es ist zugleich das Handelnde und das Produkt seiner Handlung; das Tätige, und das, was durch die Tätigkeit hervorgebracht wird; Handlung und Tat sind ein und dasselbe; und daher ist das:
Ich bin, Ausdruck einer Tathandlung.> Völlig unbeirrt durch den Umstand, daß frühere Philosophen das Wesen, das er da beschreibt, außer den Menschen versetzt haben, naiv betrachtet Fichte das Ich. Deshalb wird das Ich ihm naturgemäß zurn höchsten Wesen. «Dasjenige, dessen Sein (Wesen) bloß darin besteht, daß es sich
selbst als seiend setzt, ist das Ich, als absolutes Subjekt. So wie es sich setzt, ist es, und so wie es ist, setzt es sich: und das Ich ist demnach für das Ich schlechthin und notwendig. Was für sich selbst nicht ist, ist kein .... . Man hört wohl die Frage aufwerfen: was war ich wohl, ehe ich zum Selbstbewußtsein kam? Die natürliche Antwort darauf ist: ich war gar nicht; denn ich war nicht Ich . . . Sich selbst setzen und Sein sind, vom Ich gebraucht, völlig gleich.» Die vollständige, lichte Klarheit über das eigene Ich, die rücksichtslose Aufhellung des persönlichen, menschlichen Wesens tritt damit an den Anfang des menschlichen Denkens. Die Folge davon muß sein, daß von hier aus der Mensch an die Eroberung der Welt geht. Die zweite der oben genannten Goetheschen Forderungen: Erkenntnis meines Verhältnisses zur Welt, schließt sich an die erste: Erkenntnis des Verhältnisses, das das Ich zu sich selbst hat. Von diesen beiden Verhältnissen wird diese auf Selbsterkenntnis gebaute Philosophie sprechen. Nicht von der Herleitung der Welt aus einem Urwesen. Man kann nun fragen:
soll denn der Mensch sein eigenes Wesen an die Stelle des Urwesens setzen, in das er den Weltursprung verlegt? Kann sich denn gar der Mensch selbst zum Ausgangspunkte der Welt machen? Demgegenüber muß betont werden, daß diese Frage nach dem Weltursprung aus einer niederen Sphäre stammt. Im Verlauf der Vorgänge, die uns von der Wirklichkeit gegeben sind, suchen wir zu den Ereignissen die Ursachen, zu den Ursachen wieder andere Ursachen und so weiter. Wir dehnen nun den Begriff der Verursachung aus. Wir suchen nach einer letzten Ursache der ganzen Welt. Und auf diese Weise verschmilzt für uns der Begriff des ersten, absoluten, durch sich selbst notwendigen Urwesens mit der Idee der Weltursache. Doch ist das eine bloße Begriffskonstruktion. Wenn der Mensch solche Begriffskonstruktionen aufstellt, brauchen sie nicht auch eine Berechtigung zu haben. Der Begriff des fliegenden Drachen hat auch keine. Fichte geht von dem Ich als Urwesen aus, und er gelangt zu Ideen, die das Verhältnis dieses Urwesens zur übrigen Welt unbefangen, aber nicht unter dem Bilde von Ursache und Wirkung darstellen. Von dem Ich aus sucht nun Fichte die Ideen zum Begreifen der übrigen
Welt zu gewinnen. Wer sich über die Natur dessen, was man Wissen oder Erkenntnis nennen kann, nicht täuschen will, kann nicht anders verfahren. Alles, was der Mensch über das Wesen der Dinge sagen kann, ist den Erlebnissen seines Innern entlehnt. «Der Mensch begreift niemals, wie anthropomorphisch er ist» (Goethe). In der Erklärung einfachster Erscheinungen, zum Beispiel in derjenigen des Stoßes zweier Körper, liegt ein Anthropomorphismus. Das Urteil: der eine Körper stößt den andern, ist bereits anthropomorphistisch. Denn man muß, wenn man über das hinauskommen will, was die Sinne über den Vorgang aussagen, das Erlebnis auf ihn übertragen, das unser Körper hat, wenn er einen Körper der Außenwelt in Bewegung setzt. Wir übertragen unser Erlebnis des Stoßens auf den Vorgang der Außenwelt und sprechen auch da von Stoß, wo wir eine Kugel heranrollen und in der Folge eine zweite weiterrollen sehen. Denn nur die Bewegungen der beiden Kugeln können wir beobachten, den Stoß denken wir im Sinne der eigenen Erlebnisse hinzu. Alle physikalischen Erklärungen sind Anthropomorphismen, Vermenschlichungen der Natur. Daraus folgt natürlich aber nicht, was so oft daraus gefolgert wird, diß diese Erklärungen keine objektive Bedeutung für die Dinge haben. Ein Teil des objektiven, in den Dingen liegenden Gehalts kommt eben erst zum Vorschein, wenn wir über sie das Licht verbreiten, das wir in unserm eigenen Innern wahrnehmen.
Wer im Sinne Fichtes das Wesen des Ich ganz auf sich selbst stellt, kann auch die Quellen des sittlichen Handelns nur in dem Ich allein finden. Nicht mit einem andern Wesen kann das Ich die Übereinstimmung suchen, sondern nur mit sich selbst. Es läßt sich seine Bestimmung nicht vorschreiben, sondern gibt sich selbst eine solche. Handle nach dem Grundsatze, daß du dein Handeln als das möglichst wertvolle ansehen kannst. So etwa müßte man den obersten Satz der Fichteschen Sittenlehre aussprechen. «Der wesentliche Charakter des Ich, wodurch es sich von allem, was außer ihm ist, unterscheidet, besteht in einer Tendenz zur Selbsttätigkeit ,,in der Selbsttätigkeit willen; und diese Tendenz ist es, was gedacht wird, wenn das Ich an und für sich, ohne alle Beziehung auf etwas außer ihm gedacht wird.> Eine Handlung steht
also auf einer um so höheren Stufe der sittlichen Wertschätzung, je reiner sie aus der Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung des Ich fließt.
Fichte hat in seinem späteren Leben sein auf sich gestelltes, absolutes Ich wieder in den äußeren Gott zurückverwandelt und dadurch der aus der menschlichen Schwäche stammenden Selbst-entäußerung die wahre Selbsterkenntnis, zu der er so wichtige Schritte getan, zum Opfer gebracht. Für den Fortschritt dieser Selbsterkenntnis sind daher die letzten Schriften Fichtes ohne Be-deutung.
Wichtig aber für diesen Fortschritt sind die philosophischen Schriften Schillers. Hat Fichte die auf sich gebaute Selbständigkeit des Ich als allgemeine philosophische Wahrheit ausgesprochen, so war es Schiller mehr um die Beantwortung der Frage zu tun: wie das besondere Ich der einzelnen menschlichen Individualität diese Selbsttätigkeit im besten Sinne in sich ausleben könne. - Kant hatte ausdrücklich die Unterdrückung der Lust als Voraussetzung des sittlichen Handelns gefordert. Nicht, was dem Menschen B& friedigung gewährt, soll er vollbringen, sondern dasjenige, was der kategorische Imperativ von ihm fordert. Eine Handlung ist nach seiner Ansicht um so moralischer, je mehr sie mit Niederschlagung aller Lustgefühle aus bloßer Achtung vor dem strengen Sittengesetz vollzogen ist. In dieser Forderung scheint für Schiller etwas zu liegen, was die menschliche Würde herabsetzt. Ist denn der Mensch in seinem Lustverlangen wirklich ein so niedriges Wesen, daß er diese seine niedere Natur erst ausschalten muß, wenn er tugendhaft sein will? Schiller tadelt eine solche Herab-würdigung des Menschen in der Xenie:
«Gerne dien ich den Freunden, doch tu ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.»
Nein, sagt Schiller, die menschlichen Instinkte sind einer solchen Veredlung fähig, daß es Lust macht, das Gute zu tun. Das strenge Sollen verwandelt sich bei dem veredelten Menschen in ein freies Wollen. Und höher steht der Mensch auf der moralischen Weltleiter, der aus Lust das Sittliche vollbringt, als derjenige, der seinem
Wesen erst Gewalt antun muß, um dem kategorischen Imperativ zu gehorchen.
Schiller hat diese seine Ansicht in seinen «Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechtes» ausgeführt. Ihm schwebt die Vorstellung einer freien Individualität vor, die sich ihren egoistischen Trieben ruhig überlassen darf, weil diese Triebe dasjenige aus sich selbst wollen, was von der unfreien, unedlen Persönlichkeit nur vollbracht werden kann, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse unterdrückt. Der Mensch, so führt Schiller aus, kann in zweifacher Hinsicht unfrei sein: erstens, wenn er nur seinen blinden, untergeordneten Instinkten zu folgen fähig ist. Dann handelt er aus Notdurft. Die Triebe zwingen ihn; er ist nicht frei. Zweitens aber handelt auch der Mensch unfrei, der nur seiner Vernunft folgt. Denn die Vernunft stellt die Prinzipien des Handelns nach logischen Regeln auf. Ein bloß der Vernunft folgender Mensch handelt unfrei, weil er sich der logischen Notwendigkeit unterwirft. Frei aus sich selbst heraus handelt nur derjenige, bei dem das Vernünftige so mit seiner Individualität verwachsen ist, ihm so in Fleisch und Blut übergegangen ist, daß er mit größter Lust vollbringt, was der minder sittlich Hochstehende nur durch die äußerste Selbstentäußerung und durch den stärksten Zwang vollziehen kann.
Den Weg, den Fichte genommen hat, wollte Friedrich Joseph Schelling weiter fortsetzen. Von der unbefangenen Erkenntnis des Ich, die sein Vorgänger erlangt, ging dieser Denker aus. Das Ich war als Wesen erkannt, das sein Dasein aus sich selbst schöpft. Die nächste Aufgabe war, zu diesem auf sich selbst gebauten Ich die Natur in ein Verhältnis zu bringen. Es ist klar: Sollte das Ich nicht wieder das eigentliche höhere Wesen der Dinge in die Außenwelt verlegen, so mußte gezeigt werden, daß es aus sich selbst auch dasjenige schafft, was wir die Gesetze der Natur nennen. Der Bau der Natur mußte also draußen im Raume das materielle System dessen sein, was das Ich in seinem Innern auf geistige Weise erschafft. «Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Hier also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muß sich
das Problem, wie eine Natur außer uns möglich sei, auflösen.» «Die äußere Welt liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr die Geschichte unseres Geistes wieder zu finden.»
Schelling beleuchtet also scharf den Vorgang, den die Philosophen so lange falsch gedeutet haben. Er zeigt, daß aus einem Wesen heraus das erklärende Licht auf alle Weltvorgänge fallen muß, daß das Ich ein Wesen in allem Geschehen erkennen kann, aber er stellt dieses Wesen nicht mehr als ein außer dem Ich liegendes hin, er sieht es in dem Ich selbst. Das Ich fühlt sich endlich stark genug, den Inhalt der Welterscheinungen aus sich heraus zu beleben. In welcher Weise Schelling die Natur als eine materielle Ausgestaltung des Ich im einzelnen dargestellt hat, braucht hier nicht ausgeführt zu werden. Darauf kommt es in dieser Darstellung an, zu zeigen, in welcher Weise sich das Ich den Machtbereich wieder zurückerobert, den es im Verlauf der abendländischen Gedankenentwickelung an ein selbstgezeugtes Geschöpf abgetreten hat. Deswegen können in diesem Zusammenhange auch die übrigen Schöpfungen Schellings nicht berücksichtigt werden. Sie bringen höchstens noch Einzelheiten zu der berührten Frage bei. - Gleich wie Fichte kommt auch Schelling von der klaren Selbsterkenntnis wieder ab und sucht die aus dem Selbst fließenden Dinge dann aus anderen Wesenheiten abzuleiten. Die späteren Lehren der beiden Denker sind Rückfälle in Anschauungen, die sie in einem früheren Lebensalter vollkommen überwunden hatten.
*
Ein weiterer kühner Versuch, die ganze Welt auf Grund des im Ich liegenden Inhalts zu erklären, ist die Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels. Was Fichte mit allerdings unvergleichlichen Worten charakterisiert hat, das Wesen des menschlichen Ich: Hegel suchte seinen ganzen Inhalt allseitig zu durchforschen und darzustellen. Denn auch er sieht dieses Wesen als das eigentliche Urding, als das «An-sich der Dinge» an. Nur macht Hegel ein Eigentümliches. Er entkleidet das Ich alles Individuellen, Persönlichen. Trotzdem es ein echtes, wahres Ich ist, was Hegel den
welterscheinungen zugrunde legt, wirkt es unpersönlich, unindividuell, fern dern intimen, vertrauten Ich, fast wie ein Gott. In solch unnahbarer, streng abstrakter Form legt Hegel das An-sich der Welt, seinem Inhalte nach, in seiner Logik auseinander. Das persönlichste Denken wird hier auf die unpersönlichste Art dargestellt. Die Natur ist nun nach Hegel nichts anderes als der in Raum und Zeit auseinandergelegte Inhalt des Ich. Dieser ideelle Inhalt in seinem Anderssein. «Die Natur ist der sich entfremdete Geist.» Im individuellen Menschengeiste wird Hegels Aufstellung nach das unpersönliche Ich persönlich. Im Selbstbewußtsein ist das Ichwesen nicht nur an sich, es ist auch für sich; der Geist entdeckt, daß der höchste Weltinhalt sein eigener Inhalt ist. -Weil Hegel das Wesen des Ich zunächst unpersönlich zu fassen sucht, bezeichnet er es auch nicht als Ich, sondern als Idee. Hegels Idee ist aber nichts anderes als der von allem persönlichen Charakter freigemachte Inhalt des menschlichen Ich. Dieses Abstrahieren von allem Persönlichen zeigt sich am kräftigsten in Hegels Ansichten über das geistige, das sittliche Leben. Nicht das einzelne persönliche, individuelle Ich des Menschen darf sich seine Bestimmung vorsetzen, sondern das von diesem abstrahierte große, objektive, unpersönliche Welt-Ich, die allgemeine Welt-Vernunft, die Welt-Idee. Dieser aus seinetn eigenen Wesen geholten Abstraktion hat sich das individuelle Ich zu fügen. In den rechtlichen, staatlichen, sittlichen Institutionen, in dem geschichtlichen Prozesse hat die Weltidee den objektiven Geist niedergelegt. Diesem objektiven Geiste gegenüber ist der Einzelne minderwertig, zufällig. Hegel wird nicht müde, immer wieder und wieder zu betonen, daß das zufällige Einzel-Ich sich den allgemeinen Ordnungen, dern geschichtlichen Verlauf der geistigen Entwickelung eingliedern müsse. Es ist die Despotie des Geistes über die Träger dieses Geistes, was Hegel verlangt.
Es ist ein merkwürdiger letzter Rest des alten Gottes- und Jenseitsglaubens, der hler bei Hegel noch auftritt. Alle die Attribute, womit das zum äußeren Weltenherrscher gewordene menschliche Ich einst ausgestattet worden ist, sind fallengelassen, und lediglich das der logischen Allgemeinheit ist geblieben. Die Hegelsche
Weltidee ist das menschliche Ich, und Hegels Lehre erkennt das ausdrücklich an, denn auf der Spitze der Kultur gelangt der Mensch nach dieser lehre dazu, seine volle Identität mit diesem Welt-Ich zu fühlen. In Kunst, Religion und Philosophie sucht der Mensch das Allgemeinste seinem besonderen Sein einzuverleiben, der Einzelgeist durchdringt sich mit der allgemeinen Welt-vernunft. Den Verlauf der Weltgeschichte schildert Hegel folgendermaßen: «Werfen wir einen Blick auf das Schicksal der welthistorischen Individuen, so haben sie das Glück gehabt, die Geschäftsführer eines Zweckes zu sein, der eine Stufe in dern Fortschreiten des allgemeinen Geistes war. Indem sich die Vernunft dieser Werkzeuge bedient, können wir es eine List derselben nennen, denn sie läßt sie mit aller Wut der Leidenschaft ihre eigenen Zwecke vollführen und erhält sich nicht nur unbeschädigt, sondern bringt sich selbst hervor. Das Partikulare ist meistens zu gering gegen das Allgemeine: die Individuen werden geopfert und preisgegeben. Die Weltgeschichte stellt sich somit als der Kampf der Individuen dar, und in dem Felde dieser Besonderheit geht es ganz natürlich zu. Wie in der tierischen Natur die Erhaltung des Lebens Zweck und Instinkt des Einzelnen ist, wie aber doch hier die Vernunft, das Allgemeine, vorherrscht und die Einzelnen fallen, so geht es auch in der geistigen Welt zu. Die Leidenschaften zerstören sich gegenseitig; die Vernunft allein wacht, verfolgt ihren Zweck und macht sich geltend.> Die höchste Entwickelungsstufe der Menschenbildung stellt sich aber auch für Hegel nicht dar in dieser Opferung des partikularen Individuums zugunsten der allgemeinen Weltvernunft, sondern in der vollständigen Durchdringung beider. In der Kunst, Religion und Philosophie wirkt das Individuum so, daß sein Wirken zugleich Inhalt der allgemeinen Weltvernunft ist. - Bei Hegel ist durch das Moment der Allgemeinheit, das er in das Welt-Ich legte, auch die Unterordnung des menschlichen Sonder-Ichs unter dieses Welt-Ich noch geblieben.
Dieser Unterordnung suchte Ludwig Feuerbach dadurch ein Ende zu machen, daß er mit kräftigen Worten aussprach, wie der Mensch das Wesen seines Ich in die Außenwelt versetzt. um sich
ihm dann als einem Gotte erkennend, gehorchend, verehrend gegenüberzustellen. «Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen, die Religion ist die feierliche Enthüllung der verborgenen Schätze des Menschen, das Ein-geständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner Liebesbekenntnisse.» Aber auch Feuerbach hat die Idee dieses Ich von dem Momente der Allgemeinheit noch nicht gereinigt. Ihm ist das allgemeine Menschen-Ich ein höheres als das individuelle Einzel-Ich. Und obwohl er als Denker dieses allgemeine Ich nicht gleich Hegel zu einem an sich seienden Welt-wesen vergegenständlicht, so stellt er doch in sittlicher Beziehung dern menschlichen Einzeiwesen den allgemeinen Begriff des gattungsmaßigen Menschen gegenüber und fordert, daß der Einzelne sich über die Schranken seiner Individualität erheben soll.
*
Erst Max Stirner hat in seinem 1844 erschienenen Buche «Der Einzige und sein Eigentum> in radikaler Weise von dem Ich gefordert, es sollte endlich einsehen, daß es alle Wesen, die es im Laufe der Zeit über sich gesetzt hat, aus seinem eigenen Leibe geschnitten und als Götzen in die Außenwelt versetzt hat. Jeder Gott, jede allgemeine Weltvernunft ist ein Ebenbild des Ich und hat keine anderen Eigenschaften als das menschliche Ich. Und auch der Begriff des allgemeinen Ich ist aus dem ganz individuellen Ich jedes Einzelnen herausgeschält.
Stirner fordert den Menschen auf, alles Allgemeine von sich abzuwerfen und sich zu gestehen, daß er ein Einzelner ist. «Du bist zwar mehr als Jude, mehr als Christ usw., aber Du bist auch mehr als Mensch. Das sind alles Ideen, Du aber bist leibhaftig. Meinst Du denn, jemals werden zu können?» «Ich bin Mensch! Ich brauche den Menschen nicht erst in Mir leer-zustellen, denn er gehört mir schon wie alle meine Eigenschaften.» «Nur Ich bin nicht Abstraktion allein, Ich bin Alles in Allem; . . . Ich bin kein bloßer Gedanke, aber Ich bin zugleich voller Gedanken, eine Gedankenwelt. Hegel verurteilt das Eigene, das
Meinige . . . Das ist dasjenige Denken, welches vergißt, daß es mein Denken ist, daß Ich denke, und daß es nur durch Mich ist. Als Ich aber verschlinge Ich das Meinige wieder, bin Herr desselben, es ist nur meine Meinung, die Ich in jedem Augenblicke ändern, das heißt vernichten, in Mich zurücknehmen und aufzehren kann.» «Mein eigen ist der Gedanke erst dann, wenn Ich zwar ihn, er aber niemals Mich unterjochen kann, nie Mich fanatisiert, zum Werkzeug seiner Realisation macht.» Alle über das Ich gestellten Wesen zerschellen zuletzt an der Erkenntnis, daß sie nur durch das Ich in die Welt gebracht worden sind. «Für mein Denken ist nämlich der Anfang nicht ein Gedanke, sondern Ich, und darum bin Ich auch sein Ziel, wie denn sein ganzer Verlauf nur ein Verlauf meines Selbstgenusses ist.»
Das einzelne Ich im Sinne Stirners soll man nicht durch einen Üedanken, eine Idee definieren wollen. Denn Ideen sind etwas Allgemeines; und durch eine solche Definition würde somit der Einzelne - wenigstens logisch - sofort wieder einem Allgemeinen untergeordnet. Alle übrigen Dinge der Welt kann man durch Ideen definieren, das eigene Ich aber müssen wir als Einzelnes in uns erleben. Alles, was über den Einzelnen in Gedanken ausgesprochen wird, kann seinen Inhalt nicht in sich aufnehmen; es kann nur auf denselben hindeuten. Man sagt: sehe hin in dich; da ist etwas, für das jeder Begriff, jede Idee zu arm ist, um es in seinem leibhaftigen Reichtum zu umspannen, das aus sich heraus die Ideen hervorbringt, selbst aber einen unerschöpflichen Brunnen in sich hat, dessen Inhalt unendlich umfangreicher ist als alles, was es hervorbringt. In einer von Stirner verfaßten Entgegnung sagt dieser: «Der Einzige ist ein Wort, und bei einem Worte müßte man sich doch etwas denken können, ein Wort mußte doch einen Gedankeninhalt haben. Aber der Einzige ist ein gedankenloses Wort, es hat keinen Gedankeninhalt. Was ist aber dann sein Inhalt, wenn der Gedanke es nicht ist? Einer, der nicht zum zweiten Male da sein, folglich auch nicht ausgedrückt werden kann, denn könnte er ausgedrückt, wirklich und ganz ausgedrückt werden, so wäre er zum zweiten Male da, wäre im ... . Erst dann, wenn Nichts von Dir ausgesagt
und Du nur genannt wirst, wirst Du anerkannt als Du. Solange Etwas von Dir ausgesagt wird, wirst Du nur als dieses Etwas (Mensch, Geist, Christ usf.) anerkannt.» Das einzelne Ich ist also dasjenige, das alles, was es ist, nur durch sich selber ist, das den Inhalt seines Daseins aus sich selbst holt und ihn fortwährend aus sich heraus erweitert. - Dieses einzelne Ich kann keine ethische Verbindlichkeit anerkennen, die es sich nicht selbst auferlegt. «Ob, was Ich denke und tue, christlich sei, was kemmert's Mich? Ob es menschlich, liberal, human, ob unmenschlich, illiberal, inhuman, was frag' Ich darnach? Wenn es nur bezweckt, was Ich will, wenn Ich nur Mich darin befriedige, dann belegt es mit Prädikaten wie Ihr wollt: es gilt Mir gleich...» «Auch Ich wehre Mich vielleicht schon im nächsten Augenblicke gegen meine vorigen Gedanken, auch Ich ändere wohl plötzlich meine Handlungsweise; aber nicht darum, weil sie der Christlichkeit nicht entspricht, nicht darum, weil sie gegen die ewigen Menschenrechte läuft, nicht darum, weil sie der Idee der Menschheit, Menschlichkeit und Humanität ins Gesicht schlägt, sondern - weil Ich nicht mehr ganz dabei bin, weil sie Mir keinen vollen Genuß mehr bereitet, weil Ich an dem früheren Gedanken zweifle oder in der eben geübten Handlungsweise Mir nicht mehr gefalle.> Charakteristisch ist, wie sich Stirner von diesem seinem Gesichtspunkte aus über die Liebe ausspricht. «Ich liebe die Menschen auch, nicht bloß einzelne, sondern jeden. Aber Ich liebe sie mit dem Bewußtsein des Egoismus; Ich liebe sie, weil die Liebe Mich glücklich macht, Ich liebe, weil Mir das Lieben natürlich ist, weil Mir's gefällt. Ich kenne kein ...» Diesem souveränen Individuum gegenüber sind alle staatlichen, gesellschaftlichen, kirchlichen Organisationen eine Fessel. Denn alle Organisationen setzen voraus, daß das Individuum so oder so sein müsse, damit es sich in die Gemeinschaft eingliedern lasse. Aber das Individuum will sich nicht von der Gemeinschaft bestimmen lassen, wie es sein soll; es will sich selbst so oder so machen. Worauf es Stimer ankommt, hat J. H. Mackay in seinem Buche «Max Stirner, sein Leben und sein Werk» ausgesprochen, auf die «Vernichtung jener fremden Mächte, die das Ich in den verschiedensten Formen zu unterdrücken
und zu vernichten suchen, in erster Linie; und der Darlegung der Beziehungen unseres Verkehrs untereinander, wie sie sich aus dem Widerstreit und der Harmonie unserer Interessen ergeben, in zweiter». Sich selbst genügen kann der Einzelne nicht in einer organisierten Gemeinschaft, sondern nur in dern freien Verkehr oder Verein. Dieser kennt keine als Macht über den Einzelnen gesetzte gesellschaftliche Struktur. In ihm geschieht alles durch den Einzelnen. Es ist in ihm nichts festgelegt. Was geschieht, ist immer auf den Willen des Einzelnen zurückzuführen. Einen Gesamtwillen repräsentiert niemand und nichts. Stirner will nicht, daß die Gesellschaft für den Einzelnen sorgt, seine Rechte schützt, sein Wohl fördert und so weiter. Wenn von den Menschen die Organisation genommen ist, dann regelt sich ihr Verkehr von selbst. «Ich will lieber auf den Eigennutz der Menschen angewiesen sein, als auf ihre , ihre Barmherzigkeit, Erbarmen usw. Jener fordert Gegenseitigkeit (wie Du Mir, so Ich Dir), tut nichts , und läßt sich gewinnen und - erkaufen.» Lasset dem Verkehr seine völlige Freiheit, und er schafft unbeschränkt jene Gegenseitigkeit, die ihr durch eine Gemeinschaft doch nur beschränkt herstellen könnt. «Den Verein hält weder ein natürliches noch ein geistiges Band zusammen, und er ist kein natürlicher, kein geistiger Bund. Nicht Ein Blut, nicht Ein Glaube (das heißt Geist) bringt ihn zustande. In einem natürlichen Bunde - wie einer Familie, einem Stamme, einer Nation, ja der Menschheit - haben die Einzelnen nur den Wert von Exemplaren derselben Art oder Gattung; in einem geistigen Bunde - wie einer Gemeinde, einer Kirche - bedeutet der Einzelne nur ein Glied desselbigen Geistes; was Du in beiden Fällen als Einziger bist, das muß - unterdrückt werden. Als Einzigen kannst Du Dich bloß im Vereine behaupten, weil der Verein nicht Dich besitzt, sondern Du ihn besitzest oder Dir zunutze machest.»
Der Weg, auf dem Stirner zu seiner Anschauung des Einzelnen gelangt ist, kann als universale Kritik aller das Ich unterdrückenden allgemeinen Mächte bezeichnet werden. Die Kirchen, die politischen Systeme (der politische Liberalismus, der soziale Liberalismus,
der humane Liberalismus), die Philosophien, sie alle haben solche allgemeine Mächte über den Einzelnen gesetzt. Der politische Liberalismus fixiert den «guten Bürger», der soziale Liberalismus den an Gemeinbesitz mit allen andern gleichen Arbeiter, der humane Liberalismus den «Menschen als Menschen». Indem er alle diese Mächte zerstört, richtet Stirner auf den Trimmern die Souveränität des Einzelnen auf. «Was soll nicht alles Meine Sache sein! Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit; ferner die Sache Meines Volkes, Meines Fürsten, Meines Vaterlandes; endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur Meine Sache soll niemals Meine Sache sein. - Sehen Wir denn zu, wie diejenigen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache Wir arbeiten, Uns hingeben und begeistern sollen. Ihr wißt von Gott viel Gründliches zu ver-künden und habt jahrtausendelang und ihr ins Herz geschaut, so daß Ihr Uns wohl sagen könnt, wie Gott die , der wir zu dienen berufen sind, selber betreibt. Und ihr verhehlt es auch nicht, das Treiben des Herrn. Was ist nun seine Sache? Hat er, wie es Uns zugemutet wird, eine fremde Sache, hat er die Sache der Wahrheit, der Liebe zur seinigen gemacht? Euch empört dies Mißverständnis und ihr belehrt uns, daß Gottes Sache allerdings die Sache der Wahrheit und Liebe sei, daß aber diese Sache keine ihm fremde genannt werden könne, weil Gott ja selbst die Wahrheit und Liebe sei; Euch empört die Annahme, daß Gott Uns armen Würmern gleichen könnte, indem er eine fremde Sache als eigene beförderte. Er sorgt nur für seine Sache, aber weil er alles in allem ist, darum ist auch alles seine Sache; Wir aber, Wir sind nicht alles in allem, und unsere Sache ist gar klein und verächtlich; darum müssen wir einer . - Nun, ist es klar, Gott bekümmert sich nur ums Seine, beschäftigt sich nur mit sich, denkt nur an sich und hat sich im Auge; wehe allem, was ihm nicht wohlgefällig ist. Er dient keinem Höhern und befriedigt nur sich. Seine Sache ist
eine - rein egoistische Sache. Wie steht es mit der Menschheit, deren Sache Wir zur unsrigen machen sollen? Ist ihre Sache etwa die eines andern und dient die Menschheit einer höhern Sache? Nein, die Menschheit sieht nur auf sich, die Menschheit will nur die Menschheit fördern, die Menschheit ist sich selber ihre Sache. Damit sie sich entwickle, läßt sie Völker und Individuen in ihrem Dienste sich abquälen, und wenn diese geleistet haben, was die Menschheit braucht, dann werden sie von ihr aus Dankbarkeit auf den Mist der Geschichte geworfen. Ist die Sache der Menschheit nicht eine - rein egoistische Sache?» Aus einer solchen Kritik alles dessen, was der Mensch zu seiner Sache machen soll, ergibt sich für Stirner: «Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf Nichts gestellt als auf sich. Stelle Ich denn meine Sache gleichfalls auf Mich, der Ich so gut wie Gott das Nichts von allem andern, der Ich mein Alles, der Ich der Einzige bin.»
*
Dies ist Stirners Weg. Man kann auch einen andern gehen, um zur Natur des Ich zu gelangen. Man kann es bei seiner Erkenntnistätigkeit beobachten. Man richte seinen Blick auf einen Erkenntnisvorgang. Durch denkende Betrachtung der Vorgänge sucht das Ich gewahr zu werden, was eigentlich diesen Vorgängen zum Grunde liegt. Was will man durch diese denkende Betrachtung erreichen? Zur Beantwortung dieser Frage muß man beobachten: was würden wir ohne diese Betrachtung von den Vorgängen besitzen, und was erlangen wir durch dieselbe? - Ich muß mich hier auf eine dürftige Skizze dieser grundlegenden Weltanschauungsfragen beschränken und kann nur auf die weiteren Ausführungen in meinen Schriften «Wahrheit und Wissenschaft» und «Philosophie der Freiheit» verweisen.
Man betrachte einen beliebigen Vorgang. Ich werfe einen Stein in horizontaler Richtung von mir. Er bewegt sich in einer krummen Linie und fällt nach einiger Zeit zu Boden. Ich sehe den Stein in aufeinanderfolgenden Zeitpunkten an verschiedenen Orten, nachdem es mich erst eine gewisse Anstrengung gekostet hat,
ihn wegzuwerfen. Durch meine denkende Betrachtung gewinne ich folgendes. Der Stein steht während seiner Bewegung unter mehreren Einflüssen. Wenn er nur unter der Folge des Stoßes, den ich ihm beim Wegwerfen erteilt habe, stände, würde er ewig fortfliegen, und zwar in gerader Richtung, ohne die Geschwindigkeit zu ändern. Nun aber übt die Erde einen Einfluß auf ihn aus, den man als Anziehungskraft bezeichnet. Hätte ich ihn, ohne ihn wegzustoßen, einfach losgelassen, wäre er senkrecht zur Erde gefallen, und dabei hätte seine Geschwindigkeit fortwährend zugenommen. Aus der Wechselwirkung dieser beiden Einflüsse entsteht das, was wirklich geschieht. Das alles sind Gedankenerwägungen, die ich zu dem hinzubringe, was sich mir ohne denkende Betrachtung bieten würde.
Auf diese Weise haben wir in jedem Erkenntnisprozeß ein Element, das sich uns auch ohne denkende Betrachtung darstellen würde, und ein anderes, das wir nur durch diese gewinnen können. - Wenn wir dann beide gewonnen haben, ist es uns klar, daß sie zusammengehören. Ein Vorgang verläuft im Sinne der Gesetze, die ich durch mein Denken über ihn gewinne. Daß für mich beide Elemente getrennt sind und durch meinen Erkenntnis-vorgang ineinander gefügt werden, ist meine Sache. Der Vorgang kümmert sich um diese Trennung und Zusammenfügung nicht. Daraus folgt aber, daß das Erkennen überhaupt meine Sache ist. Etwas, das ich lediglich um meiner selbst willen vollbringe.
Nun kommt aber noch etwas anderes hinzu. Die Dinge und Vorgänge würden mir aus sich selbst nie das geben, was ich durch meine denkende Betrachtung über sie gewinne. Aus sich selbst geben sie mir eben das, was ich ohne diese Betrachtung besitze. Es ist innerhalb dieser Ausführungen schon gesagt worden, daß ich dasjenige aus mir selbst nehme, was ich in den Dingen als deren tiefstes Wesen sehe. Die Gedanken, die ich mir über die Dinge mache, produziere ich aus meinem Innern heraus. Sie gehören, wie gezeigt worden ist, trotzdem zu den Dingen. Das Wesen der Dinge kommt mir also nicht aus ihnen, sondern aus mir zu. Mein Inhalt ist ihr Wesen. Ich käme gar nicht dazu, zu fragen,
was das Wesen der Dinge ist, wenn ich nicht in mir etwas vorfän de, was ich als dieses Wesen der Dinge bezeichne, als das-jenige, was zu ihnen gehört, was sie mir aber nicht aus sich geben, sondern was ich nur aus mir nehmen kann. - Im Erkenntnisprozeß entnehme ich aus mir das Wesen der Dinge. Ich habe also das Wesen der Welt in mir. Folglich habe ich auch mein eigenes Wesen in mir. Bei den andern Dingen erscheint mir zweierlei: ein Vorgang ohne das Wesen und das Wesen durch mich. Bei mir selbst sind Vorgang und Wesen identisch. Das Wesen der ganzen übrigen Welt schöpfte ich aus mir, und mein eigenes Wesen schöpfe ich auch aus mir.
Mein Handeln ist nun ein Teil des allgemeinen Weltgeschehens. Es hat somit ebenso sein Wesen in mir wie alles andere Geschehen. Für das menschliche Handeln die Gesetze suchen heißt somit, sie aus dem Inhalte des Ich schöpfen. Wie der Gott-gläubige die Gesetze seines Handelns aus dem Willen seines Gottes ableitet, so kann derjenige, der eingesehen hat, daß im Ich das Wesen aller Dinge liegt, die Gesetze des Handelns auch nur im Ich finden. Hat das Ich sein Handeln dem Wesen nach wirklich durchdrungen, dann fühlt es sich als den Beherrscher desselben. Solange wir an ein uns fremdes Weltwesen glauben, stehen uns auch die Gesetze unseres Handelns fremd gegenüber. Sie beherrschen uns; was wir vollbringen, steht unter dem Zwange, den sie auf uns ausüben. Sind sie aus solcher fremden Wesenheit in das ureigene Tun unseres Ich verwandelt, dann hört dieser Zwang auf. Das Zwingende ist unser eigenes Wesen geworden. Die Gesetzmäßigkeit herrscht nicht mehr über uns, sondern in uns über das von unserem Ich ausgehende Geschehen. Die Verwirklichung eines Vorganges vermöge einer außer dem Verwirklicher stehenden Gesetzmäßigkeit ist ein Akt der Unfreiheit, jene durch den Verwirklicher selbst ein Akt der Freiheit. Die Gesetze seines Handelns sich aus sich geben, heißt als freier Einzelner handeln. Die Betrachtung des Erkenntnisprozesses zeigt dem Menschen, daß er die Gesetze seines Handelns nur in sich finden kann.
*
Das Ich denkend begreifen heißt die Grundlage schaffen, um alles, was aus dem Ich kommt, allein auch auf das Ich zu begründen. Das Ich, das sich selbst versteht, kann sich von nichts als von sich selbst abhängig machen. Und es kann niemandem verantwortlich sein als sich. Es erscheint nach diesen Ausführungen fast überflüssig, zu sagen, daß mit dem Ich nur das leibhaftige, reale Ich des Einzelnen und nicht ein allgemeines, von diesem abgezogenes gemeint sein kann. Denn ein solches kann ja nur aus dem realen durch Abstraktion gewonnen sein. Es ist somit abhängig von dem wirklich Einzelnen. (Dieselbe Ideenrichtung und Lebensanschauung, aus der meine oben genannten Schriften entsprungen sind, vertreten auch Benj. R. Tucker und J. H. Mackay. Vergleiche des ersteren «Instead of a Book» und des letzteren Kulturgemälde «Die Anarchisten».)
Im vorigen und dem größten Teile unseres Jahrhunderts war das Denken bemüht, dern Ich seine Stellung im Weltganzen zu erobern. Geister, welche dieser Tendenz bereits fremd gegenüberstehen, sind Arthur Schopenhauer und Eduard von Hartmann, der noch rüstig unter uns Wirkende. Beide haben nicht mehr das volle Wesen unseres Ich, das wir in unserem Bewußtsein vorfinden, als Urweltwesen in die Außenwelt verlegt. Schopenhauer hat einen Teil dieses Ich, den Willen als Welewesen angesehen, und Hartmann sieht das Unbewußte als solches an. Beiden gemeinsam ist dies Streben, das Ich dem von ihnen angenommenen allgemeinen Weltwesen unterzuordnen. Dagegen ist als letzter der strengen Individualisten noch Friedrich Nietzsche von Schopenhauer ausgehend zu Anschauungen gelangt, welche durchaus auf dem Wege der absoluten Würdigung des einzelnen Ich führen. Seiner Meinung nach besteht die echte Kultur darinnen, den Einzelnen zu pflegen, damit er die Kraft habe, aus sich heraus alles das zu entwickeln, was in ihm gelegen ist. Bisher war es nur ein Zufall, wenn ein Einzelner sich voll aus sich heraus hat entwickeln können. «Dieser höherwertigere Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als ein Glücksfall, als eine Ausnahme, niemals als gewollt. Vielmehr ist er gerade am besten gefürchtet worden, er war bisher beinahe das Furchtbare; - und aus der Furcht heraus
wurde der umgekehrte Typus gewollt, gezüchtet, erreicht: das Haustier, das Herdentier, das kranke Tier Mensch, - der Christ . . .» . Seinen Typus Mensch als Ideal hat Nietzsche poetisch verklärt in seinem Zarathustra. Er nennt ihn den Übermenschen. Dieser ist der von allen Normen befreite Mensch, der nicht mehr Ebenbild Gottes, Gott wohigefälliges Wesen, guter Bürger und so weiter, sondern er selber und nichts weiter sein will - der reine und absolute Egoist.
HAECKEL UND SEINE GEGNER
Vorrede *
Von meiner vor fünf Jahren veröffentlichten «Philosophie der Freiheit> habe ich die Überzeugung, daß sie das Bild einer Weltanschauung gibt, die mit den gewaltigen Ergebnissen der Naturwissenschaften unserer Zeit in vollem Einklang steht. Ich bin mir bewußt, daß ich diesen Einklang nicht absichtlich herbeigeführt habe. Mein Weg war ganz unabhängig von dem, welchen die Naturwissenschaft einschlägt.
Aus dieser Unabhängigkeit meiner Vorstellungsart von dem herrschenden Wissensgebiet unserer Tage und aus der gleichzeitigen völligen Übereinstimmung mit demselben glaube ich die Berechtigung herleiten zu dürfen, die Stellung des monumentalsten Vertreters der naturwissenschaftlichen Denkweise, Ernst Haeckels, innerhalb des Geisteskampfes unserer Zeit darzustellen.
Das Bedürfnis, sich mit der Naturwissenschaft auseinanderzusetzen, wird zweifellos heute von vielen empfunden. Es kann am besten dadurch befriedigt werden, daß man sich in die Ideen desjenigen
- - -
* Außer dieser Vorrede wurde die Schrift mir Anmerkungen (S. 196-200) versehen.
Naturforschers vertieft, der am rückhaltlosesten die Konsequenzen der naturwissenschaftlichen Voraussetzungen gezogen hat. Ich möchte mich mit diesem Schriftchen an diejenigen wenden, die mit mir in dieser Beziehung ein gleiches Bedürfnis empfinden.
Berlin, im Januar 1900.
I
Der Empfindung, welche der Mensch hat, wenn er seine Stellung innerhalb der Welt betrachtet, hat Goethe einen herrlichen Ausdruck in seinem Buche über Winckelmann gegeben: «Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt: dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern.> Aus dieser Empfindung heraus entspringt die bedeutungsvollste Frage, die sich der Mensch stellen kann: Wie ist sein eigenes Werden und Wesen mit demjenigen des ganzen Weltalls verknüpft? Schiller hat den Weg, durch den Goethe zur Erkenntnis der menschlichen Natur kommen wollte, trefflich in einem Briefe an diesen am 23. August 1794 bezeichnet. «Von der einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu den mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen.» Dieser Weg Goethes ist nun auch der, welchen die Naturwissenschaft seit vier Jahrzehnten einschlägt, um die «Frage aller Fragen für die Menschheit» zu lösen. Huxley sieht sie darin, die Stellung zu bestimmen, welche «der Mensch in der Natur einnimmt, und seine Beziehungen zu der Gesamtheit der Dinge». Es ist das große Verdienst Charles Darwins, dem Nachdenken über diese Frage einen neuen naturwissenschaftlichen
Boden geschaffen zu haben. Die Tatsachen, die er 1859 in seinem Werke «Über die Entstehung der Arten» mitteilte, und die Grundsätze, die er entwickelte, boten der Naturforschung die Möglichkeit, auf ihre Weise zu zeigen, wie begründet Goethes Überzeugung war, daß die Natur «nach tausendfältigen Tieren ein Wesen bildet, das sie alle enthält: den Menschen». Heute blicken wir auf vierzig Jahre wissenschaftlicher Entwickelung zurück, die unter dem Einflüsse der Ideenrichtung Darwins stehen. Mit Recht konnte Ernst Haeckel in seiner Schrift «Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung des Menschen», die einen von ihm auf dem vierten internationalen Zoologen-Kongreß in Cambridge am 26. August 1898 gehaltenen Vortrag wiedergibt, sagen: «Vierzig Jahre Darwinismus! Welcher ungeheure Fortschritt unserer Naturerkenntnis! Und welcher Umschwung unserer wichtigsten Anschauungen, nicht allein in den nächstbetroffenen Gebieten der gesamten Biologie, sondern auch in demjenigen der Anthropologie und ebenso aller sogenannten Geisteswissenschaften! » Goethe hat aus seiner tiefen Naturerkenntnis heraus diesen Umschwung vorausgesehen und seine Bedeutung für den Fortgang der menschlichen Geisteskultur in vollem Umfange erkannt. Wir sehen das besonders deutlich aus einem Gespräche, das er am 2. August 1830 mit Soret gehabt hat. Damals gelangten die Nachrichten von der begonnenen Julirevolution nach Weimar und versetzten alles in Aufregung. Soret wurde, als er Goethe besuchte, mit den Worten empfangen: «Nun, was denken Sie von dieser großen Begebenheit? Der Vulkan ist zum Ausbruch gekommen; alles steht in Flammen, und es ist nicht ferner eine Verhandlung bei geschlossenen Türen! » Soret konnte natürlich nur glauben, Goethe spreche von der Julirevolution, und erwiderte, daß bei den bekannten Zuständen nichts anderes zu erwarten war, als daß man mit der Vertreibung der königlichen Familie endigen würde. Goethe aber hatte etwas ganz anderes im Sinne. «Ich rede gar nicht von jenen Leuten; es handelt sich bei mir um ganz andere Dinge. Ich rede von dem in der Akademie zum öffentlichen Ausbruch gekommenen, für die Wissenschaft so höchst bedeutenden Streit zwischen Cuvier und Geoffroy de Saint-Hilaire! » Der Streit
betraf die Frage, ob jede der Spezies, in denen die organische Natur sich auslebt, einen besonderen Bauplan für sich habe oder ob ihnen allen ein solcher gemeinsam sei. Goethe hatte für sich diese Frage bereits mehr als vierzig Jahre früher entschieden. Sein eifriges Studium der Pflanzen- und Tierwelt hatte ihn zum Gegner der Linnéschen Ansicht gemacht, daß wir «Spezies so viele zählen, als verschiedene Formen im Prinzip geschaffen worden sind». Wer eine solche Meinung hat, kann sich nur bemühen zu erforschen, welches die Organisationspläne der einzelnen Spezies sind. Er wird diese einzelnen Formen vor allem sorgfältig zu unterscheiden suchen. Goethe schlug einen anderen Weg ein. «Das, was Linné mit Gewalt auseinanderzuhalten suchte, mußte, nach dem innersten Bedürfnis meines Wesens, zur Vereinigung anstreben.» Es bildete sich in ihm die Meinung aus, die er 1796 in den «Vorträgen über die drei ersten Kapitel des Entwurfs einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie» in dem Satze zusammengefaßt hat: «Dies also hätten wir gewonnen, ungescheuet behaupten zu dürfen, daß alle vollkommnern organischen Naturen, worunter wir Fische, Amphibien, Vögel, Säugetiere und an der Spitze der letzten den Menschen sehen, alle nach einem Urbilde geformt seien, das nur in seinen sehr beständigen Teilen mehr oder weniger hin- und herweicht und sich noch täglich durch Fortpflanzung aus- und umbildet.» Das Urbild, auf das sich alle mannigfaltigen Pflanzenformen zurückführen lassen, hat Goethe schon 1790 in seinem «Versuch, die Metasnorphose der Pflanzen zu erklären» dargestellt. Diese Betrachtungsweise, durch die Goethe die Gesetze der lebendigen Natur zu erkennen bestrebt war, ist ganz gleich derjenigen, die er in seinem 1793 geschriebenen Aufsatz «Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt» für die leblose Welt fordert: «In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer Verbindung mit dem Ganzen stehe, und wenn uns die Erfahrungen nur isoliert erscheinen, wenn wir die Versuche nur als isolierte Fakta anzusehen haben, so wird dadurch nicht gesagt, daß sie isoliert seien; es ist nur die Frage: Wie finden wir die Verbindung dieser Phänomene, dieser Begebenheiten?» Auch die Spezies erscheinen uns nur isoliert.
Goethe sucht ihre Verbindung. Daraus geht klar hervor, daß Goethes Streben darauf gerichtet ist, bei Betrachtung der Lebe-wesen dieselbe Erklärungsart anzuwenden, die bei der leblosen Natur zum Ziele führt. Wie weit er mit solchen Vorstellungen seiner Zeit vorauseilte, wird ersichtlich, wenn man bedenkt, daß zur selben Zeit, als Goethe seine Metamorphosenschrift veröffentlichte, Kant in seiner «Kritik der Urteilskraft» die Unnuöglichkeit einer Erklärung des Lebendigen nach denselben Prinzipien, die für das Leblose gelten, wissenschaftlich dartun wollte. Er behauptet: «Es ist nämiich ganz gewiß, daß wir die organisierten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend kennenlernen, viel weniger uns erklären können; und zwar so gewiß, daß man dreist sagen kann, es ist für den Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen oder zu hoffen, daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalnas nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde; sondern man muß diese Einsicht den Menschen schlechthin absprechen.» Haeckel weist diesen Gedanken mit den Worten zurück: «Nun ist aber dieser unmögliche Newton siebzig Jahre später in Darwin wirklich erschienen und... und hat die Aufgabe tatsächlich gelöst, die Kant für absolut unlösbar hielt! »Daß der durch den Darwinismus bewirkte Umschwung in den naturwissenschaftlichen Anschauungen eintreten müsse, wußte Goethe, denn er entspricht seiner eigenen Vorstellungsart. In der Ansicht, die Geoffroy de Saint-Hilaire gegen Cuvier verteidigte, daß alle organischen Formen einen «allgemeinen, nur hier und da modifizierten Plan» in sich tragen, erkannte er die eigene wieder. Deshalb konnte er zu Soret sagen: «Jetzt ist nun auch Geoffroy de Saint-Hilaire entschieden auf unserer Seite und mit ihm alle seine bedeutenden Schüler und Anhänger Frankreichs. Dieses Ereignis ist für mich von ganz unglaublichem Wert, und ich juble mit Recht über den endlich erlebten allgemeinen Sieg einer Sache, der ich mein Leben gewidmet habe und die ganz vorzüglich auch die meinige ist.» Von noch viel größerem Werte für Goethes Naturanschauung sind nun die Entdeckungen Darwins. Die Naturanschauung
Goethes verhält sich zum Darwinismus in ähnlicher Weise wie die Einsichten Kopernikus' und Keplers in den Bau und die Bewegungen des Planetensysterus zu der Auffindung des Gesetzes der allgemeinen Anziehung aller Himmeiskörper durch Newton. Dieses Gesetz zeigt die naturwissenschaftlichen Ursachen auf, warum sich die Planeten in der Weise bewegen, wie es Kopernikus und Kepler beschrieben haben. Und Darwin hat die natürlichen Ursachen gefunden, warum das von Goethe angenommene gemeinsame Urbild aller organischen Wesen in den mannigfaltigen Spezies zur Erscheinung kommt.
Der Zweifel an der Anschauung, daß jeder einzelnen organischen Spezies ein besonderer Organisationsplan zugrunde liege, der für alle Zeiten unveränderlich sei, setzte sich in Darwin fest auf einer Reise, die er im Sommer 1831 als Naturforscher auf dem Schiffe «Beagle» nach Südamerika und Australien antrat. Wie seine Gedanken reiften, davon erhalten wir eine Vorstellung, wenn wir Mitteilungen von ihm lesen wie diese: «Als ich während der Fahrt des den Galapagos-Archipel, der im Stillen Ozean ungefähr fünfhundert englische Meilen von der Küste von Südamerika entfernt liegt, besuchte, sah ich mich von eigentümlichen Arten von Vögeln, Reptilien und Pflanzen umgeben, welche sonst nirgends in der Welt existieren. Doch trugen sie fast alle ein amerikanisches Gepräge an sich. Im Gesang der Spottdrossel, in dem harschen Geschrei des Aasgeiers, in den großen leuchterähnlichen Opuntien nahm ich deutlich die Nachbarschaft mit Amerika wahr; und doch waren diese Inseln durch so viele Meilen Ozean vom Festlande getrennt und wichen in ihrer geologischen Konstitution und in ihrem Klima weit von ihm ab. Noch überraschender war die Tatsache, daß die meisten Bewohner jeder einzelnen Insel dieses kleinen Archipels spezifisch verschieden waren, wenn auch unter-einander nahe verwandt... Ich habe mich damals oft gefragt, wie diese vielen eigentümlichen Pflanzen und Tiere entstanden sind. Die einfachste Antwort schien zu sein, daß die Bewohner der verschiedenen Inseln voneinander abstammten und im Verlauf ihrer Abstammung Modifikationen erlitten hätten und daß alle Bewohner des Archipels von denen des nächsten Festlandes, nämlich
Amerika, von welchem die Kolonisation natürlich herrühren würde, abstammten. Es blieb mir aber lange ein unerklärliches Problem: wie der notwendige Modifikationsgrad erreicht worden sein könnte.» Über dieses Wie Märten Darwin die zahlreichen Züchtungsversuche auf, die er nach seiner Heimkehr mit Tauben, Hühnern, Hunden, Kaninchen und Kuirurgewächsen machte. Aus ihnen ersah er, in welch hohem Grade in den organischen Formen die Möglichkeit liegt, sich im Verlaufe ihrer Fortpflanzung fortwährend zu verändern. Man ist in der Lage, durch Herstellung künstlicher Bedingungen aus einer gewissen Form nach wenigen Generationen neue Arten zu erhalten, die viel mehr voneinander abweichen als solche in der freien Natur, deren Verschiedenheit man für so groß hält, daß man jeder einen besonderen Organisationsplan zugrunde legen möchte. Diese Veränderlichkeit der Arten benutzt bekanntlich der Züchter, um solche Formen von Kulturorganismen zur Entwickelung zu bringen, die gewissen Ab-sichten entsprechen. Er sucht die Bedingungen herzustellen, welche die Veränderung nach einer Richtung hinlenken, die ihm entspricht. Will er eine Schafsorte mit besonders feiner Wolle züchten, so sucht er innerhalb seiner Schafherde diejenigen Individuen aus, welche die feinste Wolle haben. Diese läßt er sich fortpflanzen. Von ihren Nachkommen wählt er zur weiteren Fortpflanzung wieder diejenigen aus, welche die feinste Wolle haben. Wird das durch eine Reihe von Generationen hindurch fortgesetzt, so erlangt man eine Schafspezies, welche in der Bildung der Wolle erheblich von ihren Vorfahren abweicht. Dasselbe kann man mit andern Eigenschaften der Lebewesen machen. Aus diesen Tatsachen geht zweierlei hervor: daß die organischen Formen die Neigung haben, sich zu verändern, und daß sie die angenommenen Veränderungen auf ihre Nachkommen vererben. Durch die erste Eigenschaft der Lebewesen ist der Züchter imstande, bei seiner Spezies gewisse Merkmale auszubilden, die seinen Zwecken entsprechen; durch die zweite übertragen sich diese neuen Merkmale von einer Generation auf die andere.
Der Gedanke liegt nun nahe, daß sich die Formen auch in der freien Natur fortwährend ändern. Und die große Veränderungsfähigkeit
der Kulturorganismen zwingt nicht dazu, anzunehmen, daß diese Eigenschaft der organischen Formen innerhalb gewisser Grenzen eingeschlossen ist. Wir können vielmehr voraussetzen, daß sich im Laufe großer Zeiträume eine gewisse Form in eine ganz andere verwandelt, die in ihrer Bildung in der denkbar größten Weise von der ersten abweicht. Die natürlichste Folgerung ist dann die, daß die organischen Spezies nicht unabhängig jede nach einem besonderen Bauplan nebeneinander entstanden sind, sondern daß sich im Laufe der Zeit die einen aus den andern entwickeln. Eine Unterstützung erfährt dieser Gedanke durch die Er-kenntnisse, zu denen Lyell in der Entwickelungsgeschichte der Erde gelangt ist und die er zuerst 1830 in seinen «Grundsätzen der Geologie» (Principles of geology) veröffentlicht hat. Durch sie wurden jene älteren geologischen Ansichten, wonach sich die Bildung der Erde in einer Reihe gewaltsamer Katastrophen vollzogen haben soll, beseitigt. Durch diese Katastrophenlehre sollten die Ergebnisse erklärt werden, zu denen die Untersuchung der festen Erdkruste geführt hat. Die verschiedenen Schichten der Erdrinde und die in ihnen enthaltenen versteinerten organischen Wesen sind ja die Überbleibsel dessen, was sich im Zeitenlaufe auf der Erdoberfläche zugetragen hat. Die Anhänger der gewaltsamen Umwälzungslehre glaubten, daß sich die Entwickelung der Erde in aufeinanderfolgenden, genau voneinander unterschiedenen Perioden vollzogen habe. Am Ende einer solchen Periode trat eine Katastrophe ein. Alles Lebendige wurde zerstört und seine Reste in einer Erdschicht aufbewahrt. Über dem Zerstörten erhob sich eine vollständig neue Welt, die wieder geschaffen werden mußte. An die Stelle dieser Katastrophenlehre setzte Lyell die Ansicht, daß sich die Erdrinde im Laufe sehr langer Zeiträume allmählich durch dieselben Vorgänge gebildet habe, die sich noch heute jeden Tag auf der Oberfläche der Erde abspielen. Die Tätigkeit der Flüsse, welche Schlamm von einer Stelle ab- und der anderen zuführen, die Wirkungen der Gletscher, die das Gestein abschleifen und Blöcke fortschieben, und ähnliche Vorgänge sind es gewesen, die in ihrer stetigen, langsamen Wirksamkeit der Erdoberfläche die heutige Gestalt gegeben haben. Diese Anschauung zieht die
andere notwendig nach sich, daß auch die heutigen Tier- und Pflanzenformen sich allmählich aus denjenigen entwickelt haben, deren Reste uns in den Versteinerungen erhalten sind. Nun ergibt sich aus den Vorgängen der künstlichen Züchtung, daß wirklich eine Form in eine andere sich verwandeln kann. Es entsteht nur die Frage, wodurch werden in der Natur selbst die Bedingungen zu dieser Umwandlung geschaffen, die der Züchter auf künstlichem Wege herbeiführt?
Bei der künstlichen Züchtung wählt die menschliche Intelligenz die Bedingungen so, daß die neuentstehenden Formen dem Zwecke angepaßt sind, den der Züchter verfolgt. Nun sind aber auch die in der Natur lebenden organischen Formen im allgemeinen den Bedingungen zweckmäßig angepaßt, unter denen sie leben. Jeder Blick in die Natur kann über die Wahrheit dieser Tatsache belehren. Die Tier- und Pflanzenspezies sind so eingerichtet, daß sie in den Verhältnissen, in denen sie leben, sich erhalten und fortpflanzen können.
Diese zweckmäßige Einrichtung ist es eben, welche das Vorurteil hervorgerufen hat, daß die organischen Formen sich nicht auf dieselbe Weise erklären lassen wie die Tatsachen der leblosen Natur. Kant führt in der «Kritik der Urteilskraft» aus: «Die Analogie der Formen, sofern sie bei aller Verschiedenheit einem gemeinschaftlichen Urbilde gemäß erzeugt zu sein scheinen, verstärkt die Vermutung einer wirklichen Verwandtschaft derselben in der Erzeugung von einer gemeinschaftlichen Urmutter durch stufenweise Annäherung einer Tiergattung zur andern ... Hier steht nun dem Archäologen der Natur frei, aus den übriggebliebenen Spuren ihrer ältesten Revolutionen, nach allem ihm bekannten und gemutmaßten Mechanismus derselben, jene große Familie von Geschöpfen (denn so müßte man sie sich vorstellen, wenn die genannte durchgängig zusammenhängende Verwandtschaft einen Grund haben soll) entspringen zu lassen... Allein er muß gleichwohl zu dem Ende dieser allgemeinen Mutter eine auf alle diese Geschöpfe zweckmäßig gestellte Organisation beilegen, widrigenfalls die Zweck form der Produkte des Tier- und Pflanzenreichs ihrer Möglichkeit nach gar nicht zu denken ist.»
Will man die organischen Formen in derselben Art erklären, wie die Naturwissenschaft es mit den unorganischen Erscheinungen macht, so muß gezeigt werden, daß die zweckmäßige Einrichtung der Organismen ohne einen absichtlich in sie gelegten Zweck gerade so naturnotwendig entsteht, wie eine elastische Kugel gesetzmäßig dahinrollt, wenn sie von einer andern gestoßen wird. Diese Forderung hat Darwin durch seine Lehre von der natürlichen Zuchtwahl erfüllt. Gemäß ihrer durch die künstliche Züchtung erwiesenen Verwandiungsfahigkeit müssen sich die organischen Formen auch in der Natur umbilden. Ist nichts vorhanden, was von vorneherein die Verwandlung so einrichtet, daß nur zweckmäßige Formen entstehen, so werden wahllos unzweckmäßige oder mehr oder weniger zweckmäßige entstehen. Nun ist die Natur ungeheuer verschwenderisch in der Hervorbringung ihrer Keime. Auf unserer Erde werden so viele Keime erzeugt, daß sich in kurzer Zeit eine große Anzahl Welten füllen könnten, wenn sie alle zur Entwickelung kämen. Dieser großen Zahl von Keimen steht nur ein verhältnismäßig geringes Maß von Nahrung und Raum gegenüber. Die Folge davon ist ein allgemeiner Kampf ums Dasein unter den organischen Wesen. Nur die Tüchtigen werden sich erhalten und fortpflanzen können; die Untüchtigen müssen zugrunde gehen. Die Tüchtigsten werden aber eben die sein, die den Lebensbedingungen am zweckmäßigsten angepaßt sind. Der durchaus absichtslose und naturnotwendige Kampf ums Dasein bewirkt somit dasselbe, was die Intelligenz des Züchters mit den Kulturorganismen vollbringt: er schafft zweckmäßige organische Formen. Dies ist in großen Umrissen der Sinn der von Darwin aufgestellten Lehre von der natürlichen Zuchtwahl im Kampf ums Dasein oder der Selektionstheorie. Durch sie war erreicht, was Kant für unmöglich gehalten hat: die Zweckform der Produkte des Tier- und Pflanzenreichs ihrer Möglichkeit nach zu denken, ohne der allgemeinen Mutter eine auf alle diese Geschöpfe zweckmäßig gestellte Organisation beizulegen.
Wie Newton durch seine Lehre von der allgemeinen Anziehung der Himmelskörper zeigte, warum diese in den von Kopernikus und Kepler festgestellten Bahnen sich bewegen, so konnte man
nunmehr mit Hilfe der Selektionstheorie erklären, wie sich in der Natur die Entwickelung des Lebendigen vollzieht, deren Gang Goethe in «Zur Morphologie» mit den Worten bezeichnet hat:
«So viel aber können wir sagen, daß die aus einer kaum zu sondernden Verwandtschaft als Pflanzen und Tiere nach und nach hervortretenden Geschöpfe nach zwei entgegengesetzten Seiten sich vervollkommnen, so daß die Pflanze sich zuletzt im Baum dauernd und starr, das Tier im Menschen zur höchsten Beweglichkeit und Freiheit sich verherrlicht.» Goethe hat von seinem Ver-fahren gesagt: «Ich raste nicht, bis ich einen prägnanten Punkt finde, von dem sich vieles ableiten läßt, oder vielmehr der vieles freiwillig aus sich hervorbringt und mir entgegenträgt.» Für Ernst Haeckel wurde die Selektionstheorie der Punkt, aus dem er eine ganze naturwissenschaftliche Weltanschauung ableitete.
Auch Jean Lamarck hat bereits im Anfange unseres Jahrhunderts die Ansicht vertreten, daß zu einer gewissen Zeit in der Erdentwickelung sich aus den mechanischen, physikalischen und chemischen Prozessen heraus durch Urzeugung ein einfachstes Organisches entwickelt habe. Diese einfachsten Organismen haben dann vollkommenere erzeugt und diese wieder höher organisierte bis herauf zum Menschen. «Man könnte daher diesen Teil der Entwicklungstheorie, welcher die gemeinsame Abstammung aller Tier- und Pflanzenarten von einfachsten gemeinsamen Stamm-formen behauptet, seinem verdientesten Begründer zu Ehren mit vollem Rechte Lamarckismus nennen.> Haeckel hat im großen Stile eine Erklärung des Lamarckismus durch den Darwinismus gegeben.
Den Schlüssel zu dieser Erklärung fand Haeckel dadurch, daß er in der individuellen Entwickelung der höheren Organismen -in ihrer Ontogenie - die Zeugnisse dafür suchte, daß sie wirklich von niederen Lebewesen abstammen. Wenn man die Formentwikkelung eines höheren Organismus vom ersten Keime bis zum ausgebildeten Zustande verfolgt, so stellen die verschiedenen Stufen Gestalten dar, welche den Formen niederer Organismen entsprechen. Im Beginne seiner individuellen Existenz ist der Mensch und jedes andere Tier eine einfache Zelle. Diese teilt sich, und aus
ihr entsteht eine aus vielen Zellen bestehende Keimblase. Aus ihr entwickelt sich der sogenannte Becherkeim, die zweischichtige Gastrula, die die Gestalt eines becherförmigen oder krugförmigen Körpers hat. Nun bleiben die niederen Pflanzentiere (Spongien, Polypen und so weiter) während ihres ganzen Lebens auf einer Entwickelungsstufe stehen, welche diesem Becherkeim gleicht. Haeckel sagt darüber: «Diese Tatsache ist von außerordentlicher Bedeutung. Denn wir sehen, daß der Mensch, und überhaupt jedes Wirbeltier, rasch vorübergehend ein zweiblättriges Bildungsstadium durchläuft, welches bei jenen niedersten Pflanzentieren zeitlebens erhalten bleibt.» (Anthropogenie 5.175.) Ein solcher Parallelismus zwischen den Entwickelungsstadien der höheren Organismen und den ausgebildeten niederen Formen läßt sich durch die ganze individuelle Entwickelungsgeschichte hindurch verfolgen. Haeckel kleidet diese Tatsache in die Worte: «Die kurze Ontogenese oder die Entwicklung des Individuums ist eine schnelle und zusammengezogene Wiederholung, eine gedrängte Rekapitulation der langen Phylogenese oder der Entwicklung der Art.> Dieser Satz drückt das sogenannte biogenetische Grundgesetz aus. Wodurch kommen nun die höheren Organismen im Lauf ihrer Entwickelung zu Formen, die den niederen gleichen? Die naturgemäße Erklärung ist die, daß sich jene aus diesen entwickelt haben, daß also jeder Organismus in seiner individuellen Entwickelung uns die Gestalten aufeinanderfolgend zeigt, die ihm als Erbstück von seinen niederen Vorfahren geblieben sind.
Der einfachste Organismus, der sich dereinst auf der Erde gebildet hat, verwandelt sich im Laufe der Fortpflanzung in neue Formen. Von diesen bleiben die bestangepaßten im Kampf ums Dasein übrig und vererben ihre Eigenschaften auf ihre Nachkommen. Alle Gestaltungen und Eigenschaften, die ein Organismus gegenwärtig zeigt, sind in großen Zeiträumen durch Anpassung und Vererbung entstanden. Die Vererbung und die Anpassung sind also die Ursachen der organischen Formenwelt.
Haeckel hat also dadurch, daß er das Verhältnis der individuellen Entwickelungsgeschichte (Ontogenie) zur Stammesgeschichte (Phylogenie) suchte, die naturwissenschaftliche Erklärung der mannigfaltigen
organischen Formen gegeben. Er hat als Naturphilosoph die menschliche Erkenntnisforderung erfüllt, die Schiller aus der Beobachtung des Goetheschen Geistes gewonnen hat: er ist aufgestiegen von der einfachen Organisation, Schritt vor Schritt, zu der mehr verwickelten, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Natur-gebäudes zu erbauen. Seine Ansicht hat er in mehreren großangelegten Werken niedergelegt, in seiner «Generellen Morphologie der Organismen» (1866), in der «Natürlichen Schöpfungsgeschichte» (1868), in der «Anthropogenie» (1874), in der er «den ersten und bis jetzt einzigen Versuch unternommen hat, den zoologischen Stammbaum des Menschen im einzelnen kritisch zu begründen und die ganze tierische Ahnenreihe unseres Geschlechts... eingehend zu erörtern». Zu diesen Werken ist in den letzten Jahren (1894-1896) noch seine dreibändige «Systematische Phylogenie» getreten.
Es ist bezeichnend für die tiefe philosophische Natur Haeckels, daß er nach dem Erscheinen von Darwins «Entstehung der Arten» (1859) sogleich die volle Tragweite der darin aufgestellten Grundsätze für die gesamte Weltanschauung des Menschen erkannte; und es spricht für seinen philosophischen Enthusiasmus, daß er mit Kühnheit unermüdlich alle die Vorurteile bekämpfte, die sich gegen die Aufnahme der neuen Wahrheit in das Glaubensbekenntnis des modernen Geistes erhoben. Die Notwendigkeit, daß alles moderne wissenschaftliche Denken mit dem Darwinismus zu rechnen hat, setzte Haeckel in der fünfzigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte am 18. September 1877 in dem Vortrage über «Die heutige Entwicklungslehre im Verhältnisse zur Gesamtwissenschaft» auseinander. Ein umfassendes «Glaubensbekenntnis eines Naturforschers» trug er am 9. Oktober 1892 in Altenburg beim 75jährigen Jubiläum der naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes vor. (Gedruckt ist diese Rede unter dem Titel «Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft», Bonn 1892.) Was sich aus der reformierten Entwickelungslehre und aus unserem gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Wissen für die Beantwortung der «Frage aller Fragen» ergibt, hat
er in großen Linien kürzlich in dem oben erwähnten Vortrage <Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung des Menschen» entwickelt. Hier behandelt Haeckel neuerdings die KonSequenz, die sich für jeden logisch Denkenden ohne weiteres aus dem Darwinismus ergibt, daß der Mensch sich aus niederen Wirbeltieren, und zwar zunächst aus echten Affen, entwickelt hat. Dieser notwendige Folgeschluß ist es aber auch gewesen, welcher alle alten Vorurteile der Theologen, Philosophen und aller, die in deren Bann stehen, zum Kampf gegen die Entwickelungstheorie aufgerufen hat. Zweifelsohne hätte man sich ein Hervorgehen der einzelnen Tier- und Pflanzenformen auseinander gefallen lassen, wenn dessen Annahme nur nicht zugleich auch die Anerkennung der tierischen Abstammung des Menschen nach sich gezogen hätte. «Es bleibt», wie Haeckel in seiner «Natürlichen Schöpfungsgeschichte» betonte, «eine lehrteiche Tatsache, daß diese Anerkennung keineswegs» - nach dem Erscheinen des ersten Darwinschen Werkes - «allgemein war, daß vielmehr zahlreiche Kritiker des ersten Darwinschen Buches (und darunter sehr berühmte Namen) sich vollkommen mit dem Darwinismus einverstanden erklärten, aber jede Anwendung desselben auf den Menschen gänzlich von der Hand wiesen.» Mit einem gewissen Schein von Recht berief man sich dabei auf Darwins Buch selbst, in dem von dieser Anwendung kein Wort steht. Haeckel wurde deswegen, weil er rücksichtslos diese unabweisliche Konsequenz zog, der Vorwurf gemacht, daß er «darwinistischer als Darwin selbst sei». Das ging freilich nur bis zum Jahre 1871, in dem Darwins Werk erschien «Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zucht-wahl». Hier vertritt dieser selbst mit großer Kühnheit und Klarheit diese Folgerung.
Man erkannte richtig, daß mit dieser Folgerung eine Vorstellung fallen muß, die zu den geschätztesten in der Sammlung älterer menschlicher Vorurteile gehört: diejenige, daß die «Seele des Menschen» ein besonderes Wesen für sich sein soll, das einen ganz anderen «höheren Ursprung» habe als alle anderen Naturdinge. Die Abstammungslehre muß natürlich zu der Ansicht führen, daß die seelischen Tätigkeiten des Menschen nur eine besondere Form
derjenigen physiologischen Funktionen sind, die sich bei dessen Wirbeltier-Ahnen finden, und daß diese Tätigkeiten sich mit eben derselben Notwendigkeit aus den Geistestätigkeiten der Tiere entwickelt haben, wie sich das Gehirn des Menschen, welches die materielle Bedingung des Geistes ist, aus dem Wirbeltiergehirn entwickelt hat.
Nicht nur die Menschen mit alten, durch die verschiedenen Kirchenreligionen gtoßgezogenen Glaubensvorstellungen sträubten sich gegen das neue Bekenntnis, sondern auch alle diejenigen, die sich zwar scheinbar von diesen Glaubensvorstellungen freigemacht haben, deren Geist aber doch noch immer im Sinne dieser Vorstellungen denkt. In dem Folgenden soll der Nachweis geführt werden, daß zu der letzteren Art von Geistern eine Reihe von Philosophen und naturwissenschaftlich hochstehenden Gelehrten gehört, die Haeckel bekämpft haben und noch immer Gegner der von ihm vertretenen Ansichten sind. Zu ihnen gesellen sich dann die, welchen überhaupt die Fähigkeit abgeht, aus einer Reihe vorliegender Tatsachen die notwendigen logischen Folgerungen zu ziehen. Welches die Einwände sind, gegen die Haeckel seinen Kampf zu führen hatte, möchte ich hier zur Darstellung bringen.
II
Auf die Verwandtschaft des Menschen mit den höheren Wirbeltieren wirft die Wahrheit ein helles Licht, die Huxley 1863 in seinen «Zeugnissen für die Stellung des Menschen in der Natur» ausgesprochen hat: «Die kritische Vergleichung aller Organe und ihrer Modifikationen innerhalb der Affen-Reihe führt uns zu einem und demselben Resultate: Die anatomischen Verschiedenheiten, welche den Menschen vom Gorilla und Schimpansen scheiden, sind nicht so groß als die Unterschiede, welche diese Menschenaffen von den niedrigeren Affen trennen.» Mit Hilfe dieser Tatsache ist es möglich, die tierische Ahnenreihe des Menschen im Sinne der Darwinschen Abstammungslehre festzustellen. Der Mensch hat mit den Ostaffen zusammen gemeinsame Stammeltern
in einer ausgestorbenen Affenart. Durch entsprechende Benutzung der Erkenntnisse, welche vergleichende Anatomie und Physiologie, individuelle Entwickelungsgeschichte und Paläontologie liefern, hat Haeckel die in der Zeit weiter vorausliegenden tierischen Vorfahren des Menschen, über die Halbaffen, Beuteltiere, Urfische bis hinauf zu den Urdarmtieren und den nur aus einer Zelle bestehenden Urtieren verfolgt. Er hat ein volles Recht zu dem Ausspruche: Sind die Erscheinungen der individuellen Entwickelung des Menschen etwa weniger wunderbar als die paläonto-logische Entwickelung aus niederen Organismen? Warum soll der Mensch sich nicht im Laufe großer Zeiträume aus einzelligen Urformen entwickelt haben, da jedes Individuum dieselbe Entwickelung von der Zelle zum ausgebildeten Organismus durchläuft?
Es wird dem menschlichen Geist aber auch nicht leicht, sich über die Entwickelung des Einzelorganismus vom Keim bis zum ausgebildeten Zustand naturgemäße Vorstellungen zu bilden. Wir sehen das an den Gedanken, die sich ein Naturforscher wie Albrecht von Haller und ein Philosoph wie Leibniz über diese Entwickelung gebildet haben. Haller vertrat die Ansicht, daß der Keim eines Organismus bereits alle Teile, die während der Entwickelung auftreten, im kleinen, aber vollkommen fertig vorgebildet enthalte. Entwickelung soll also nicht Bildung eines Neuen an dem Vorhandenen sein, sondern Auswickelung eines schon Dagewesenen und wegen seiner Kleinheit nur dem Auge Verborgenen. Wäre diese Ansicht richtig, dann müßten aber auch in dem ersten Keim einer tierischen oder pflanzlichen Form alle folgenden Generationen bereits ineinander eingeschachtelt gelegen haben. Haller hat diese Folgerung auch gezogen. Er nahm an, daß in dem ersten Menschenkeim der Urmutter Eva das ganze Menschengeschlecht im kleinen bereits vorhanden gewesen ist. Und auch Leibniz kann sich die Entstehung der Menschen nur als Auswickelung von bereits Existierendem denken: «So sollte ich meinen, daß die Seelen, welche eines Tages menschliche Seelen sein werden, im Samen wie jene von anderen Spezies dagewesen sind, daß sie in den Voreltern bis auf Adam, also seit dem Anfang der Dinge, immer in der Form organisierter Körper existiert haben.»
Der menschliche Verstand hat einen Hang sich vorzustellen, daß etwas Entstehendes schon in irgendeiner Form vor der Entstehung vorhanden gewesen ist. Der ganze Organismus soll schon im Keim verborgen sein; die einzelnen organischen Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten sollen als Gedanken eines Schöpfers vor ihrer tatsächlichen Entstehung vorhanden sein. Nun fordert aber die Idee der Entwickelung, daß wir uns die Entstehung eines Neuen, Späteren aus einem bereits Vorhandenen, Früheren vorstellen. Wir sollen das Gewordene aus dem Werden begreifen. Das können wir nicht, wenn wir alles Gewordene als ein immer Dagewesenes ansehen.
Wie groß die Vorurteile sind, die der Entwickelungsidee entgegengebracht werden, das zeigte sich deutlich an der Aufnahme, die Caspar Friedrich Wolffs 1759 erschienene «Theoria generationis» bei den zu Hallers Ansichten sich bekennenden Naturforschern fand. In dieser Schrift wurde gezeigt, daß im menschlichen Ei noch nicht eine Spur von der Form des ausgebildeten Organismus vorhanden ist, sondern daß dessen Entwickelung in einer Kette von Neubildungen besteht. Wolff verteidigte die Idee einer wirklichen Entwickelung, der Epigenesis, eines Werdens von noch nicht Vorhandenem, gegenüber der Ansicht von der scheinbaren Entwickelung, der Einschachtelung und Auswickelung. Haeckel sagt von Wolffs Schrift, sie «gehört trotz ihres geringen Umfanges und ihrer schwerfälligen Sprache zu den wertvollsten Schriften im ganzen Gebiete der biologischen Literatur...» Trotzdem hatte diese merkwürdige Schrift zunächst gar keinen Erfolg. Obgleich die naturwissenschaftlichen Studien infolge der von Linné gegebenen Anregung zu jener Zeit mächtig emporblühten, obgleich Botaniker und Zoologen bald nicht mehr nach Dutzenden, sondern nach Hunderten zählten, bekümmerte sich doch niemand um Wolffs Theorie der Generation. Die wenigen aber, die sie gelesen hatten, hielten sie für grundfalsch, so besonders Haller. Obgleich Wolff durch die exaktesten Beobachtungen die Wahrheit der Epigenesis bewies und die in der Luft schwebenden Hypothesen der Präformationstheorie widerlegte, blieb dennoch der «exakte» Physiologe Haller der eifrigste Anhänger der letzteren
und verwarf die richtige Lehre von Wolff mit seinem diktatorischen Machtspruche: «Es gibt kein Werden» (N'llla est epigenesis!). Mit solcher Macht widersetzte sich das Denken einer Ansicht, von der Haeckel (in seiner «Anthropogenie») findet: Wie tief eingewurzelt das Vorurteil gegen die Idee der Entwickelung ist, darüber können uns die Einwände, die unsere philosophischen Zeitgenossen gegen sie machen, jeden Augenblick belehren. Otto Liebmann, der wiederholt, in seiner «Analysis der Wirklichkeit» und in «Gedanken und Tatsachen», die naturwissenschaftlichen Grundansichten einer Kritik unterworfen hat, äußert sich über den Entwickelungsgedanken in einer merkwürdigen Weise. Er kann die Berechtigung der Vorstellung, daß höhere Organismen aus niederen hervorgehen, angesichts der Tatsachen nicht leugnen. Deshalb versucht er die Tragweite dieser Vorstellung als eine für das höhere Erklärungsbedürfnis möglichst geringe hinzustellen. «Angenommen, die Deszendenzlehre... wäre fertig; der große Stammbaum der organischen Naturwesen... läge offen vor uns aufgerollt; und zwar nicht als Hypothese, sondem als historisch konstatiertes Faktum,... was hätten wir dann? Eine Ahnengalerie, wie man sie auf fürstlichen Schlössern auch findet; nur nicht als Fragment, sondern in abgeschlossener Totalität.» Es soll also für die wirkliche Erklärung nichts Erhebllches getan sein, wenn man zeigt, wie das Spätere als Neubildung aus dem Früheren hervorgeht. Es ist nun interessant, zu sehen, wie Lieb-manns Voraussetzungen ihn doch wieder zu der Annahme hinführen, das auf dem Wege der Entwickelung Entstehende sei schon vor seiner Entstehung vorhanden. In dem vor kurzem erschienenen zweiten Heft seiner «Gedanken und Tatsachen» behauptet er:
der Zeit ablaufender, zeitlich in die Länge gezogener Prozeß. In dem zeitlosen Weitwesen hingegen, welches nicht entsteht und nicht vergeht, sondern ein für alle Male ist, sich im Strome des Geschehens unabänderlich erhält, und für welches keine Zukunft, keine Vergangenheit, sondern nur eine ewige Gegenwart existiert, fällt dieses Vorher und Nachher, dieses Früher und Später gänzlich hinweg... Das, was sich für uns in der Linie der Zeit als langsamer oder schneller ablaufende Sukzession einer Reihe von Entwicklungsphasen entrollt, ist im allgegenwärtigen, permanenten Weitwesen ein feststehendes, unentstandenes und unvergängliches Gesetz.» Der Zusammenhang solcher philosophischen Vorstellungen mit den Auffassungen der verschiedenen Religionslehren über die Schöpfung ist leicht einzusehen. Daß in der Natur zweckmäßig eingerichtete Wesen entstehen, ohne eine zugrunde liegende Tätigkeit oder Kraft, welche die Zweckmäßigkeit in die Wesen hineiniegt, wollen weder die Religionsiehren noch solche philosophische Denker wie Liebmann zugeben. Die naturgemäße Anschauung verfolgt den Gang des Geschehens und sieht Wesen entstehen, welche die Eigenschaft der Zweckmäßigkeit haben, ohne daß der Zweck selbst mitbestimmend bei ihrer Entstehung gewesen ist. Die Zweckmäßigkeit ist mit ihnen geworden, aber der Zweck hat bei diesem Werden nicht mitgewirkt. Die religiöse Vorstellungsart greift zu dem Schöpfer, der nach dem vorgefaßten Plane die Geschöpfe zweckmäßig geschaffen hat; Liebmann wendet sich an ein zeitloses Weltwesen, aber er läßt das Zweckmäßige doch durch den Zweck hervorgebracht sein. «Das Ziel oder der Zweck ist hier nicht später und auch nicht früher als das Mittel, sondern er fordert es vermöge einer zeitlosen Notwendigkeit. »Liebmann ist ein gutes Beispiel für die Philosophen, die sich scheinbar von Glaubensvorstellungen freigemacht haben, die aber doch ganz im Sinne solcher Vorstellungen denken. Sie wollen ihre Gedanken rein aus vernünftigen Erwägungen heraus bestimmen lassen; die Richtung gibt ihnen aber doch ein eingeimpftes theologisches Vorurteil.
Ein vernunftgemäßes Nachdenken muß daher Haeckel beipflichten, wenn er sagt: «Entweder haben sich die Organismen
natürlich entwickelt, und dann müssen sie alle von einfachsten, gemeinsamen Stammformen abstammen - oder das ist nicht der Fall, die einzelnen Arten der Organismen sind unabhängig voneinander entstanden, und dann können sie nur auf übernatürlichem Wege durch ein Wunder erschaffen sein. Natürliche Entwicklung oder übernatürliche Schöpfung der Arten -, zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist zu wählen, ein Drittes gibt es nicht!» Was von Philosophen oder Naturforschern gegenüber der natürlichen Entwickelungslehre als solches Drittes vorgebracht wird, erweist sich bei genauerer Betrachtung nur als ein seinen Ursprung mehr oder weniger verschleiernder oder verleugnender Schöpfungsglaube.
Wenn wir die Frage nach der Entstehung der Arten in ihrer wichtigsten Form aüfwerfen, in der nach dem Ursprung des Menschen, so gibt es nur zwei Antworten. Entweder ist ein vernunftbegabtes Bewußtsein vor seinem tatsächlichen Auftreten in der Welt in keiner Weise vorhanden, sondern es entsteht als Ergebnis des im Gehirn konzentrierten Nervensystems, oder eine alles beherrschende Weltvernunft existiert vor allen übrigen Wesen und gestaltet den Stoff so, daß im Menschen ihr Abbild zur Erscheinung kommt. Haeckel stellt (in «Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft») das Werden des Menschengeistes in folgender Weise dar: «Wie unser menschlicher Körper sich langsam und stufenweise aus einer langen Reihe von Wirbeltierahnen herangebildet hat, so gilt dasselbe auch von unserer Seele; als Funktion unseres Gehirns hat sie sich stufenweise in Wechselwirkung mit diesem ihrem Organ entwickelt. Was wir kurzweg nennen, ist ja nur die Summe unseres Empfindens, Wollens und Denkens, die Summe von physiologischen Funktionen, deren Elementarorgane die mikroskopischen Ganglienzellen unseres Gehirns bilden. Wie der bewunderungswürdige Bau dieses letzteren, unseres menschlichen Seelenorgans, sich im Laufe von Jahrmillionen alimählich aus den Gehimformen höherer und niederer Wirbeltiere emporgebildet hat, zeigt uns die vergleichende Anatomie und Ontogenie; wie Hand in Hand damit auch die Seele selbst - als Funktion des Gehirns - sich entwickelt hat, das lehrt uns die vergleichende Psychologie. Die letztere zeigt uns auch, wie
eine niedere Form der Seelentängkeit schon bei den niedersten Tieren vorhanden ist, bei den einzelligen Urtieren, Infusorien und Rhizopoden. Jeder Naturforscher, der gleich mir lange Jahre hindurch die Lebenstätigkeit dieser einzelligen Protisten beobachtet hat, ist positiv überzeugt, daß auch sie eine Seele besitzen; auch diese besteht aus einer Summe von Empfindungen, Vorstellungen und Willenstätigkeiten; das Empfinden, Denken und Wollen unserer menschlichen Seele ist nur stufenweise davon ver-schieden.» Die Gesamtheit menschlicher Seelentätigkeiten, die in dem einheitlichen Selbstbewußtsein ihren höchsten Ausdruck findet, entspricht dem komplizierten Bau des menschlichen Gehirnes ebenso wie das einfache Empfinden und Wollen der Organisation des Urtieres. Die Fortschritte der Physiologie, die wir Forschern wie Goltz, Munk, Wernicke, Edinger, Paul Flechsig und anderen verdanken, geben uns heute die Möglichkeit, einzelne Seelenäußerungen bestimmten Teilen des Gehirnes als deren besondere Funktionen zuzuweisen. Wir sehen in vier Gebieten der grauen Rindenzone des Hirnmantels die Vermittler von vier Arten des Empfindens: die Körperfühlsphäre im Scheitellappen, die Riechsphäre im Stirnlappen, die Sehsphäre im Hinterhauptlappen, die Hörsphäre im Schläfenlappen. Das die Empfindungen verbindende und ordnende Denken hat seine Werkzeuge zwischen diesen vier «Sinnesherden». Haeckel knüpft an die Erörterung dieser neueren physiologischen Ergebnisse die Bemerkung: «Die vier Denkherde, durch eigentümliche und höchst verwickelte Nervenstruktur vor den zwischeniiegenden Sinnesherden ausgezeichnet, sind die wahren , die einzigen realen Werkzeuge unseres Geisteslebens» (Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung des Menschen).
Haeckel fordert von den Psychologen, daß sie solche Ergebnisse bei ihren Ausführungen über das Wesen der Seele berücksichtigen und nicht eine Scheinwissenschaft aufoauen, die sich zusammensetzt aus phantastischer Metaphysik, einseitiger, sogenannter innerer Beobachtung der Seelenvorgänge, unkritischer Vergleichung, mißverstandenen Wahrnehmungen und unvollständigen Erfahrungen aus spekulativen Verirrungen und religiösen Dogmen. Man findet dem Vorwurf gegenüber, der durch diese Ansicht der veralteten
Seelenkunde gemacht wird, bei Philosophen und auch bei einzelnen Naturforschern die Behauptung, daß in den materiellen Vorgängen des Gehirnes doch nicht das eingeschlossen sein könne, was wir als Geist zusammenfassen; die stofflichen Vorgänge in den Sinnes- und Denksphären seien doch keine Vorstellungen, Empfindungen ünd Gedanken, sondern nur materielle Erscheinungen. Das Wesen der Gedanken und Empfindungen könnten wir nicht durch äußere Beobachtung, sondern nur durch innere Erfahrung, durch rein geistige Selbstbeobachtung kennenlernen. Gustav Bunge zum Beispiel führt in einem Vortrage «Vitalismus und Mechanismus» (Seite 12) aus: «In der Aktivität - da steckt das Rätsel des Lebens darin. Den Begriff der Aktivität aber haben wir nicht aus der Sinneswahrnehmung geschöpft, sondern aus der Selbst-beobachtung, aus der Beobachtung des Willens, wie er in unser Bewußtsein tritt, wie er dem inneren Sinn sich offenbart.» Manche Denker sehen das Kennzeichen eines philosophischen Kopfes in der Fähigkeit, sich zu der Einsicht zu erheben, daß es eine Umkehrung des richtigen Verhältnisses der Dinge ist, die geistigen Vorgänge aus materiellen begreifen zu wollen.
Solche Einwände deuten auf ein Mißverständnis der von Haeckel vertretenen Weltanschauung hin. Wer wirklich von dem Sinn dieser Weltanschauung durchdrungen ist, wird die Gesetze des geistigen Lebens niemals auf einem anderen Wege als durch innere Erfahrung, durch Selbstbeobachtung zu erforschen suchen. Die Gegner der naturwissenschaftlichen Denkungsart reden gerade so, als wenn deren Anhänger die Wahrheiten der Logik, Ethik, Ästhetik und so weiter nicht durch Beobachtung der Geisteserscheinungen als solcher, sondern aus den Ergebnissen der Gehirnanatomie gewinnen wollten. Das von solchen Gegnern selbstgeschaffene Zerrbild naturwissenschaftlicher Weltanschauung nennen sie dann Materialismus und werden nicht müde, immer von neuem zu wiederholen, daß diese Ansicht unfruchtbar sein muß, weil sie die geistige Seite des Daseins ignoriere oder wenigstens auf Kosten der materiellen herabsetze. Otto Liebmann, der hier noch einmal angeführt werden mag, weil seine antinarurwissenschaftlichen Vorstellungen typisch für die Denkweise gewisser Philosophen und
Laien sind, bemerkt: «für wahr halte und behaupte, den anderen Satz für falsch halte und bestreite, oder weshalb ich diese Zeilen hier gerade jetzt aufs Papier schreiben muß, während ich in dem subjektiven Glauben befangen bin, es geschehe dies deshalb, weil ich sie wegen ihrer von mir angenommenen Wahrheit niederschreiben will» (Gedanken und Tatsachen). Kein naturwissenschaftlicher Denker wird je der Meinung sein, daß darüber, was im logischen Sinne wahr oder falsch ist, die körperlich-organischen Gründe Aufschluß geben können. Die geistigen Zusammenhänge können nur aus dem geistigen Leben heraus erkannt werden. Was logisch berechtigt ist, darüber wird immer die Logik, was künstlerisch vollkommen ist, darüber wird das ästhetische Urteil entscheiden. Ein anderes aber ist die Frage: Wie entsteht das logische Denken, wie das ästhetische Urteil als Funktion des Gehirnes? Über diese Frage allein spricht sich die vergleichende Physiologie und Gehirnanatomie aus. Und diese zeigen, daß das vernünftige Bewußtsein nicht für sich abgesondert existiert und das menschliche Gehirn nur benutzt, um sich durch dasselbe zu äußern, wie der Klavierspieler auf dem Klavier spielt, sondern daß unsere Geisteskräfte ebenso Funktionen der Form-Elemente unseres Gehirns sind, wie «jede Kraft die Funktion eines materiellen Körpers ist» (Haeckel, Anthropogenie).
Das Wesen des Monismus besteht in der Annahme, daß alle Weltvorgänge, von den einfachsten mechanischen an bis herauf zu den höchsten menschlichen Geistesschöpfungen, in gleichem Sinne sich naturgemäß entwickeln und daß alles, was zur Erklärung der Erscheinungen herangezogen wird, innerhalb der Welt selbst zu suchen ist. Dieser Anschauung steht der Dualismus gegenüber, der die reine Naturgesetzlichkeit nicht für ausreichend hält, um die Erscheinungen zu erklären, sondern zu einer über den Erscheinungen waltenden, vernünftigen Wesenheit seine Zuflucht nimmt. Diesen Dualismus muß die Naturwissenschaft, wie gezeigt worden ist, verwerfen.
Es wird nun von seiten der Philosophie geltend gemacht, daß die Mittel der Naturwissenschaft nicht ausreichen, um eine Weltanschauung zu begründen. Von ihrem Standpunkte aus hätte die Naturwissenschaft ganz recht, wenn sie den ganzen Weltprozeß als eine Kette von Ursachen und Wirkungen im Sinne einer rein mechanischen Gesetzmäßigkeit erklärt; aber hinter dieser Gesetz-mäßigkeit stecke doch die eigentliche Ursache, die allgemeine weltvernunft, die sich der mechanischen Mittel nur bedient, um höhere, zweckmäßige Zusammenhänge zu verwirklichen. So sagt zum Beispiel der in den Bahnen Eduard von Hartmanns wandelnde Arthur Drews: «Auch das menschliche Kunstwerk kommt auf mechanische Weise zustande, wenn man nämlich nur die äußerliche Aufeinanderfolge der einzelnen Momente dabei im Auge hat, ohne darauf zu reflektieren, daß hinter diesem allem doch nur der Gedanke des Künstlers steckt; dennoch würde man denjenigen mit Recht für einen Narren halten, der etwa behaupten wollte, das Kunstwerk sei rein mechanisch entstanden..., was sich auf jenem niedrigeren, mit der bloßen Anschauung der Wirkung sich begnügenden Standpunkte, der also den ganzen Prozeß gleichsam nur von hinten betrachtet, als gesetzmäßige Wirkung einer Ursache darstellt, dasselbe erweist sich, von vorne gesehen, allemal als beabsichtigter Zweck des angewandten Mittels> (Die deutsche Spekulation seit Kant). Und Eduard von Hartmann selbst sagt von dem Kampf ums Dasein, der es ermöglicht, die Lebewesen naturgemäß zu erklären: «Der Kampf ums Dasein und mit ihm die ganze natürliche Zuchtwahl ist nur ein Handlanger der Idee> der die niederen Dienste bei der Verwirklichung jener, nämlich das Be-hauen und Anpassen der vom Baumeister nach ihrem Platz im gtoßen Bauwerk bemessenen und typisch vorherbestimmten Steine, verrichten muß. Diese Auslese im Kampf ums Dasein für das im wesentlichen zureichende Erklärungsprinzip der Entwickelung des organischen Reiches ausgeben, wäre nicht anders, als wenn ein Tagelöhner, der beim Zurichten der Steine beim Kölner Dombau mitgewirkt, sich für den Baumeister dieses Kunstwerkes erklären wollte» (Philosophie des Unbewußten).
Wären diese Vorstellungen berechtigt, so käme es der Philosophie
zu, den Künstler hinter dem Kunstwerke zu suchen. Philosophen haben in der Tat die verschiedensten dualistischen Erklärungsweisen der Welterscheinungen versucht. Sie haben in Gedanken gewisse Wesenheiten konstruiert, die hinter den Erscheinungen schweben sollen, wie der Künstlergeist hinter dem Kunstwerke waltet.
Alle naturwissenschaftlichen Betrachtungen könnten dem Menschen die Überzeugung nicht nehmen, daß die wahrnehmbaren Erscheinungen von außerweltlichen Wesen gelenkt werden, wenn er innerhalb seines Geistes selbst etwas fände, was auf solche Wesen hindeutet. Was vermöchten Anatomie und Physiologie mit ihrer Erklärung, daß die Seelentätigkeiten Funktionen des Gehirnes sind, wenn die Beobachtung dieser Tätigkeiten etwas lieferte, was als höherer Erklärungsgrund anzusehen ist? Wenn der Philosoph uns zu zeigen vermöchte, daß sich in der menschlichen Vernunft eine allgemeine Weltvernunft offenbart, dann könnten eine solche Erkenntnis alle naturwissenschaftlichen Ergebnisse nicht widerlegen.
Nun wird aber die dualistische Weltanschauung durch nichts besser widerlegt als durch die Betrachtung des menschlichen Geistes. Wenn ich einen äußeren Vorgang, zum Beispiel die Bewegung einer elastischen Kugel, die durch eine andere gestoßen worden ist, erklären will, so kann ich nicht bei der bloßen Beobachtung stehen bleiben, sondern ich muß das Gesetz suchen, das Bewegungsrichtung und Schnelligkeit der einen Kugel durch Richtung und Schnelligkeit der anderen bestimmt. Ein solches Gesetz kann mir nicht die bloße Beobachtung, sondern nur die gedankliche Verknüpfung der Vorgänge liefern. Der Mensch entnimmt also aus seinem Geiste die Mittel, um das zu erklären, was sich ihm durch die Beobachtung darbietet. Er muß über die Beobachtung hinausgehen, wenn er sie begreifen will. Beobachtung und Denken sind die beiden Quellen unserer Erkenntnisse über die Dinge. Das gilt für alle Dinge und Vorgänge, nur nicht für das denkende Bewußtsein selbst. Ihm können wir durch keine Erklärung etwas hinzufügen, was nicht schon in der Beobachtung liegt. Es liefert uns die Gesetze für alles andere, es liefert uns zugleich auch seine eigenen. Wenn wir die Richtigkeit eines Naturgesetzes
dartun wollen, so vollbringen wir dies dadurch, daß wir Beobachtungen, Wahrnehmungen unterscheiden, ordnen, Schlüsse ziehen, also uns Begriffe und Ideen über die Erfahrungen mit Hilfe des Denkens bilden. Über die Richtigkeit des Denkens entscheidet nur das Denken selbst. So ist es das Denken, das uns bei allem Weltgeschehen über die bloße Beobachtung, nicht aber über sich selbst hinausführt.
Diese Tatsache ist unvereinbar mit der dualistischen Weltanschauung. Was die Anhänger dieser Weltanschauung so oft betonen, daß die Äußerungen des denkenden Bewußtseins uns durch den inneren Sinn der Selbstbeobachtung zugänglich sind, während wir das physische, das chemische Geschehen nur begreifen, wenn wir die Tatsachen der Beobachtung durch logische, mathematische Kombination und so weiter, also durch die Ergebnisse der geistes-wissenschaftlichen Gebiete, in die entsprechenden Zusammenhänge bringen: das dürften sie vielmehr niemals zugeben. Denn man ziehe nur einmal die richtige Folgerung aus der Erkenntnis, daß Beobachtung in Selbstbeobachtung umschlägt, wenn wir aus natur-wissenschaftlichem in geisteswissenschaftliches Gebiet heraufgehen. Läge den Naturerscheinungen eine allgemeine Weltvernunft oder ein anderes geistiges Urwesen zugrunde (zum Beispiel Schopenhauers Wille oder Hartmanns unbewußter Geist), so müßte auch der denkende Menschengeist von diesem Weltwesen geschaffen sein. Eine Übereinstimmung der Begriffe und Ideen, die sich dieser Geist von den Erscheinungen bildet, mit der eigenen Gesetzrnäßigkeit dieser Erscheinungen wäre nur möglich, wenn der ideelle Weltkünstler in der menschlichen Seele die Gesetze erzeugte, nach denen er vorher die ganze Welt geschaffen hat. Dann aber könnte der Mensch seine eigene geistige Tätigkeit nicht durch Selbst-beobachtung, sondern durch Beobachtung des Urwesens erkennen, von dem er gebildet ist. Es gäbe eben keine Selbstbeobachtung, sondern nur Beobachtung der Absichten und Zwecke des Urwesens. Mathematik und Logik zurn Beispiel dürften nicht dadurch ausgebildet werden, daß der Mensch die innere, eigene Natur geistiger Zusammenhänge sucht, sondern daß er diese geisteswissenschaftlichen Wahrheiten aus den Absichten und Zwecken der ewigen
Weltvernunft ableitet. Wäre die menschliche Vernunft nur Abbild einer ewigen, dann könnte sie ihre Gesetzmäßigkeit nimmermehr durch Selbstbeobachrung gewinnen, sondern sie müßte sie aus der ewigen Vernunft heraus erklären. Wo immer aber eine solche Erklärung versucht worden ist, ist stets einfach die menschliche Vernunft in die Welt hinaus versetzt worden. Wenn der Mystiker durch Versenken in sein Inneres sich zur Anschauung Gottes zu erheben glaubt, so sieht er in Wirklichkeit nur seinen eigenen Geist, den er zum Gott macht, und wenn Eduard von Hartmann von Ideen spricht, die sich der Naturgesetze als Handlanger bedienen, um den Weltenbau zu bilden, so sind diese Ideen nur seine eigenen, durch die er sich die Welt erklärt. Weil Beobachtung der Geistesäußerungen Selbstbeobachtung ist, deshalb spricht sich im Geiste das eigene Selbst und nicht eine äußere Vernunft aus.
Im vollen Einklange mit der Tatsache der Selbstbeobachtung steht aber die monistische Entwickelungslehre. Hat sich die menschliche Seele langsam und stufenweise mit den Seelenorganen aus niederen Zuständen entwickelt, so ist es selbstverständlich, daß wir ihr Entstehen von unten her naturwissenschaftlich erklären, daß wir aber die innere Wesenheit dessen, was sich zuletzt aus dem komplizierten Bau des menschlichen Gehirns ergibt, nur durch die Betrachtung dieser Wesenheit selbst gewinnen können. Wäre Geist in einer der menschlichen Form ähnlichen immer vorhanden gewesen und hätte sich zuletzt nur im Menschen sein Gegenbild geschaffen, so müßten wir den Menschengeist aus dem Allgeist ableiten können; ist aber der Menschengeist im Laufe der naturlichen Entwickelung als Neubildung entstanden, dann begreifen wir sein Herkommen, wenn wir seine Ahnenreihe verfolgen; wir lernen die Stufe, zu der er zuletzt gekommen ist, kennen, wenn wir ihn selbst betrachten.
Eine sich selbst verstehende und auf unbefangene Betrachtung des menschlichen Geistes gerichtete Philosophie liefert also einen weiteren Beweis für die Richtigkeit der monistischen Weltanschauung. Sie ist dagegen ganz unverträglich mit einer dualistischen Naturwissenschaft. (Die weitere Ausführung und ausführliche Begründung einer monistischen Philosophie, deren Grundgedanken
ich hier nur andeuten konnte, habe ich in meiner Wer die monistische Weltanschauung recht versteht, für den verlieren auch alle Einwendungen, die ihr von der Ethik gemacht werden, alle Bedeutung. Haeckel hat wiederholt auf das Unberechtigte solcher Einwendungen hingewiesen und auch darauf auf-merksam gemacht, wie die Behauptung, daß der naturwissenschaft-liche Monismus zum sittlichen Materialismus führen müsse, entweder auf einer vollkommenen Verkennung des ersteren beruht, oder aber auf eine bloße Verdächtigung desselben hinausläuft.
Der Monismus sieht natürlich das menschliche Handeln nur als einen Teil des allgemeinen Weltgeschehens an. Er macht es ebenso-wenig abhängig von einer sogenannten höheren moralischen Weltordnung, wie er das Naturgeschehen von einer übernatürlichen Ordnung abhängig sein läßt. «Die mechanische oder monistische Philosophie behauptet, daß überall in den Erscheinungen des menschlichen Lebens, wie in denen der übrigen Natur, feste und unabänderliche Gesetze walten, daß überall ein notwendiger ursächlicher Zusammenhang, ein Kausalnexus der Erscheinungen be-steht und daß demgemäß die ganze uns erkennbare Welt ein einheitliches Ganzes, ein , bildet. Sie behauptet ferner, daß alle Erscheinungen nur durch mechanische Ursachen, nicht durch vorbedachte zwecktätige Ursachen hervorgebracht werden. Einen im gewöhnlichen Sinne gibt es nicht. Vielmehr erscheinen im Lichte der monistischen Weltanschauung auch diejenigen Erscheinungen, die wir als die freiesten und unabhängig-sten zu betrachten uns gewöhnt haben, die Äußerungen des menschlichen Willens, gerade so festen Gesetzen unterworfen wie jede andere Naturerscheinung» (Haeckel, Anthropogenie). Die monistische Philosophie zeigt die Erscheinung des freien Willens erst im rechten Lichte. Als Ausschnitt des allgemeinen Weltgeschehens steht der menschliche Wille unter denselben Gesetzen wie alle anderen natürlichen Dinge und Vorgänge. Er ist naturgesetzlich bedingt. Indem aber die monistische Ansicht leugnet, daß in dem Naturgeschehen höhere, zwecktätige Ursachen vorhanden sind, erklärt sie zugleich auch den Willen unabhängig von einer solchen
höheren Weltordnung. Der natürliche Entwickelungsprozeß fülatt die Naturvorgänge herauf bis zum menschlichen Selbstbewußtsein. Auf dieser Stufe überläßt er den Menschen sich selbst, dieser kann nunmehr die Antriebe seiner Handlungen aus seinem eigenen Geiste holen. Waltete eine allgemeine Weltvernunft, so könnte der Mensch auch seine Ziele nicht aus sich, sondern nur aus dieser ewigen Vernunft holen. Im Sinne des Monismus ist hiernach das Handeln des Menschen durch ursächliche Momente bestimmt; im ethischen Sinne ist es nicht bestimmt, weil die ganze Natur nicht ethisch, sondern naturgesetzlich bestimmt ist. Die Vorstufen des sittlichen Handelns sind bereits bei niederen Organismen vorhanden. «Wenn auch später beim Menschen die moralischen Fundamente sich viel höher entwickelten, so liegt doch ihre älteste, prähistorische Quelle, wie Darwin gezeigt hat, in den sozialen Instinkten der Tiere» (Haeckel, Monismus). Das sittliche Handeln des Menschen ist ein Entwickelungsprodukt. Der sittliche Instinkt der Tiere vervollkommnet sich wie alles andere in der Natur durch Vererbung und Anpassung, bis der Mensch aus seinem eigenen Geiste heraus sich sittliche Zwecke und Ziele setzt. Nicht als vorherbestimmt durch eine übernatürliche Weltordnung, sondern als Neubildung innerhalb des Naturprozesses erscheinen die sittlichen Ziele. In sittlicher Beziehung «zweckvoll ist nur dasjenige, was der Mensch erst dazu gemacht hat, denn nur durch Verwirklichung einer Idee entsteht Zweckmäßiges. Wirksam im realistischen Sinne wird die Idee aber nur im Menschen... Auf die Frage: Was hat der Mensch für eine Aufgabe im Leben, kann der Monismus nur antworten: die, die er sich selbst setzt. Meine Sendung in der Welt ist keine (ethisch) vorherbestimmte, sondern sie ist jeweilig die, die ich mir erwähle. Ich trete nicht mit gebundener Marschroute meinen Lebensweg an» (vergleiche meine «Philosophie der Freiheit», XI: Weltzweck und Lebenszweck). Der Dualismus fordert Unterwerfung unter die von irgendwoher geholten sittlichen Gebote. Der Monismus weist den Menschen auf sich selbst. Dieser empfängt von keinem äußeren Weltwesen sittliche Maßstäbe, sondern nur aus seiner eigenen Wesenheit heraus. Die Fähigkeit, sich selbst ethische Zwecke zu schaffen, kann man moralische Phantasie
nennen. Der Mensch erhebt durch sie die ethischen Instinkte seiner niederen Vorfahren zum moralischen Handeln, wie er durch die künstlerische Phantasie die Gestalten und Vorgänge der Natur in seinen Kunstwerken auf einer höheren Stufe widerspiegelt.
Die philosophischen Erwägungen, die sich aus dem Vorhandensein der Selbstbeobachtung ergeben, sind somit keine Widerlegung, sondern eine wichtige Ergänzung der aus der vergleichenden Anatomie und Physiologie genommenen Beweismittel der monistischen Weltanschauung.
III
Eine absonderliche Stellung der monistischen Weltanschauung gegenüber nimmt der berühmte Pathologe Rudolf Virchow ein. Nachdem Haeckel auf der fünfzigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte seinen Vortrag über «Die heutige Entwicklungslehre im Verhältnisse zur Gesamtwissenschaft» gehalten, in dem er geistvoll die Bedeutung der monistischen Weltanschauung für unsere geistige Kultur und auch für das Unterrichtswesen dargelegt hatte, trat vier Tage später Virchow in derselben Versammlung als sein Gegner mit der Rede auf: «Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat.» Zunächst schien es, als ob Virchow den Monismus nur aus der Schule verbannt wissen wollte, weil nach seiner Ansicht die neue Lehre bloß eine Hypothese sei und nicht eine durch sichere Beweise belegte Tatsache darstelle. Merkwürdig erscheint es allerdings, wenn ein moderner Naturforscher die Entwickelungslehre angeblich aus Mangel an unumstößlichen Beweisen aus dem Unterrichte verbannen will und zugleich dem Dogma der Kirche das Wort redet. Sagt doch Virchow (auf Seite 29 der genannten Rede): «Jeder Versuch, unsere Probleme zu Lehrsätzen umzubilden, unsere Vermutungen als die Grundlagen des Unterrichts einzuführen, der Versuch insbesondere, die Kirche einfach zu depossedieren und ihr Dogma ohne weiteres durch eine Deszendenz-Religion zu ersetzen, ja, meine
Herren, dieser Versuch maß scheitern, und er wird in seinem Scheitern zugleich die höchsten Gefahren für die Stellung der Wissenschaft überhaupt mit sich führen!» Man muß da doch die jedem vernünftigen Denken gegenüber bedeutungslose Frage aufwerfen: Gibt es denn für die kirchlichen Dogmen sicherere Beweise als für die «Deszendenz-Religion»? Aus der ganzen Art, wie Virchow damals gesprochen hat, ergibt sich aber, daß es sich ihm weniger um die Abwendung der Gefahren, die der Monismus dem Unterricht bringen könnte, handelt, als vielmehr um seine prinzipielle Gegnerschaft zu dieser Weltanschauung überhaupt. Das hat er durch sein ganzes seitheriges Verhalten bewiesen. Er hat jede ihm passend erscheinende Gelegenheit ergriffen, um die natürliche Entwickelungsgeschichte zu bekämpfen und seinen Lieblingssatz zu wiederholen: «Es ist ganz gewiß, daß der Mensch nicht vom Affen abstammt.» Beim fünfundzwanzigjährigen Stiftungsfest der «Deutschen Anthropologischen Gesellschaft», am 24. August 1894, kleidete er sogar diesen Satz in die wenig geschmackvollen Worte: «Auf dem Wege der Spekulation ist man zu der Affentheorie gekommen; man hätte ebensogut ... zu einer Elefantentheorie oder einer Schaftheorie kommen können.» Dieser Ausspruch hat natürlich gegenüber den Ergebnissen der vergleichenden Zoologie nicht den geringsten Sinn. «Kein Zoologe» — bemerkt Haeckel — «wird es für möglich halten, daß der Mensch vom Elefanten oder vom Schafe abstammen könne. Denn gerade diese beiden Säugetiere gehören zu den Spezialisiertesten Zweigen der Huftiere, einer Ordnung der Säugetiere, die mit derjenigen der Affen oder Primaten in gar keinem direkten Zusammenhänge steht (ausgenommen die gemeinsame Abstammung von einer ursprünglichen Stammesform der ganzen Klasse).» — So schwer es dem verdienstvollen Naturforscher gegenüber wird: man kann derlei Aussprüche nur als leere Redensarten bezeichnen. Virchow befolgt bei seiner Bekämpfung der Deszendenztheorie eine ganz eigentümliche Taktik. Er fordert unumstößliche Beweise für diese Theorie. Sobald aber die Naturwissenschaft irgend etwas findet, was die Kette der Beweise um ein neues Glied zu bereichern in der Lage ist, dann sucht er dessen Beweiskraft in jeder Weise zu
entkräften. Die Deszendenztheorie sieht in den berühmten Schädeln von Neanderthal, von Spy und so weiter vereinzelte paläonto-logische Überreste von ausgestorbenen niederen Menschen-Rassen, welche zwischen dem affenartigen Vorfahren des Menschen (Pithecanthropus) und den niederen Menschen-Rassen der Gegenwart ein Übergangsglied bilden. Virchow erklärt diese Schädel für abnorme, krankhafte Bildungen, für pathologische Produkte. Er bildete sogar diese Behauptung dahin aus, daß alle Abweichungen von den einmal feststehenden organischen Urformen solche pathologische Gebilde seien. Wenn wir also durch künstliche Züchtung aus wildem Obst Tafelobst hervorbringen, so haben wir nur ein krankes Naturobjekt erzeugt. Man kann den Virchowschen aller Entwickelungstheorie feindlichen Satz: «Der Plan der Organisation ist innerhalb der Spezies unveränderlich, Art läßt nicht von Art» nicht bequemer beweisen, als wenn man das, was vor unseren Augen zeigt, wie Art von Art läßt, nicht als gesundes, naturgemäßes Entwickelungsprodukt, sondern als krankes Gebilde erklärt. Ganz entsprechend diesem Verhalten Virchows zur Abstammungslehre waren auch seine Behauptungen über die Knochen-reste des Menschenaffen (Pithecanthropus erectus), die Eugen Dubois 1894 in Java gefunden hat. Allerdings waren diese Überreste, ein Schädeldach, ein Oberschenkel und einige Zähne, unvollständig. Über sie entspann sich auf dem Zoologen-Kongreß in Leiden [1895] eine Debatte, die höchst interessant war. Von zwölf Zoologen waren drei der Ansicht, daß die Reste von einem Affen, drei, daß sie von einem Menschen stammen, sechs vertraten die Meinung, daß man es mit einer ausgestorbenen Übergangsform zwischen Mensch und Affe zu tun habe. Dubois hat in einleuchtender Weise das Verhältnis dieses Mittelgliedes zwischen Mensch und Affe einerseits zu den niederen Rassen des Menschengeschlechts, anderseits zu den bekannten Menschenaffen dargelegt. Virchow erklärte, daß der Schädel und der Oberschenkel nicht zusammengehören, sondern daß der erstere von einem Affen, der letztere von einem Menschen herrühre. Diese Behauptung wurde von sachkundigen Paläontologen widerlegt, die auf Grund des gewissenhaften Fundberichtes sich dahin aussprachen, daß
nicht der geringste Zweifel bestehen könne über die Herkunft der Knochenreste von einem und demselben Individuum. Daß der Oberschenkel nur von einem Menschen herrühren könne, suchte Virchow durch eine Knochenwucherung an demselben zu beweisen, die von einer nur durch sorgsame menschliche Pflege zur Heilung gebrachten Krankheit herrühren müsse. Dagegen zeigte der Paläontologe Marsh, daß ähnliche Knochenauswüchse auch bei wilden Affen vorkommen. Eine dritte Behauptung Virchows, daß die tiefe Einschnürung zwischen dem Oberrand der Augenhöhlen und dem niederen Schädeldach des Pithecanthropus für dessen Affennatur spreche, konnte der Paläontologe Nehaing damit zurückweisen, daß sich dieselbe Bildung an einem Menschenschädel von Santos in Brasilien findet.
Virchows Kampf gegen die Entwickelungslehre erscheint in der Tat rätselhaft, wenn man bedenkt, daß dieser Forscher im Beginne seiner wissenschaftlichen Laufbahn, vor der Veröffentlichung von Darwins «Entstehung der Arten» [1859], die Lehre von den mechanischen Grundlagen aller Lebenstätigkeit vertrat. In Würzburg, wo Virchow von 1848-1856 lehrte, saß Haeckel fehlen, so kann demgegenüber nur geltend gemacht werden, daß zur Anerkennung der Entwickelungslehre allerdings die Kenntnis der Tatsachen nicht ausreicht, sondern daß dazu - wie Haeckel sagt - auch «ein philosophisches Verständnis» derselben gehört. Es «entsteht nur durch die innigste Wechselwirkung und gegenseitige Durchdringung von Erfahrung und Philosophie das unerschütterliche Gebäude der wahren monistischen Wissenschaft» (Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte). Gefährlicher als all die Schäden, die eine «Deszendenz-Religion» in unreifen Köpfen anrichten kann, ist jedenfalls Virchows seit Jahrzehnten unter dem Beifall der theologischen und anderer
Reaktionäre geführter Kampf gegen die Abstammungslehte. Eine sachliche Auseinandersetzung mit Virchow wird dadurch erschwert, daß er im Grunde bei der bloßen Verneinung stehenbleibt und sachliche Einwände gegen die Entwickelungslehre im allgemeinen nicht vorbringt.
Andere naturwissenschaftliche Gegner Haeckels machen es uns leichter, über sie zur Klarheit zu gelangen, weil sie die Gründe für ihre Gegnerschaft angeben und wir daher die Fehler in ihren Folgerungen einsehen können. Zu ihnen sind Wilhelm His und Alexander Goette zu zählen.
His trat im Jahre 1868 mit seinen «Untersuchungen über die erste Aniage des Wirbeltierleibes» auf. Sein Kampf richtet sich vor allen Dingen gegen die Lehre, daß die Formentwickelung eines höheren Organismus vom ersten Keim bis zum ausgebildeten Zustande ihre Erklärung durch die Stammesentwickelung finde. Nicht dadurch sollen wir diese Entwickelung erklären, daß wir sie als Resultat der durch Vererbung und Anpassung vermittelten Entwickelung der Generationen hinstellen, von denen der Einzelorganismus abstammt, sondern wir sollen, ohne Rücksicht auf vergleichende Anatomie und Stammesgeschichte, in dem Einzel-organismus selbst die mechanischen Ursachen seines Werdens suchen. His geht davon aus, daß der als gleichartige Fläche gedachte Keim an verschiedenen Stellen ungleich wächst, und behauptet, daß infolge dieses ungleichen Wachstums im Laufe der Entwickelung der komplizierte Bau des Organismus hervorgehe. Er sagt: man nehme eine einfache Platte und stelle sich vor, daß sie an verschiedenen Stellen einen verschiedenen Antrieb zur Vergrößerung besitze. Dann wird man aus rein mathematischen und mechanischen Gesetzen den Zustand entwickeln können, in dem sich das Gebilde nach einiger Zeit befinden muß. Seine aufeinanderfolgenden Formen werden genau den Entwickelungsstadien entsprechen, die der Einzelorganismus vom Keim bis zum vollkommenen Zustande durchläuft. So brauchen wir also nicht über die Betrachtung des Einzelorganismus hinauszugehen, um seine Entwickelung zu begreifen, sondern wir können diese aus dem mechanischen Wachstumsgesetz selbst ableiten. «Alle Formung,
bestehe sie in Blätterspaltung, in Faltenbildung ocler in vollständiger Abgilederung, geht als eine Folge aus jenem Grundgesetz hervor.» Die beiden Gliedmaßenpaare bringt das Wachstumsgesetz auf folgende Weise zustande: «Ihre Anlage wird, den vier Ecken eines Briefes ährilich, durch die Kreuzung von vier den Körper umgrenzenden Falten bestimmt.» His weist die Zuhilfenahme der Stammesgeschichte mit der Begründung ab: «Hat die Entwicklungsgeschichte für eine gegebene Form die Aufgabe physiologischer Ableitung durchgreifend erfüllt, dann darf sie mit Recht von sich sagen, daß sie diese Form als Einzelform erklärt habe.» In Wirklichkeit ist aber mit einer solchen Erklärung gar nichts getan. Denn es fragt sich doch: warum wirken an verschiedenen Stellen des Keimes verschiedene Wachstumskräfte. Sie werden von His einfach als vorhanden angenommen. Die Erklärung kann nur darin gesehen werden, daß die Wachstumsverhältnisse der einzelnen Teile des Keimes von den Ahnentieren durch Vererbung übertragen sind, daß somit der Einzelorganismus die aufeinanderfolgenden Stufen seiner Entwickelung durchläuft, weil die Veränderungen, die seine Vorfahren in großen Zeiträumen erfahren haben, als Ursache seines individuellen Werdens nachwirken.
Zu welchen Konsequenzen die Anschauung von His führt, zeigt sich am besten an seiner «Höhlenlappen-Theorie». Durch sie sollen die sogenannten «rudimentären Organe» des Organismus erklärt werden. Es sind dies Teile, die am Organismus vorhanden sind, ohne daß sie für das Leben desselben irgendwelche Bedeutung haben. So hat der Mensch am inneren Winkel seines Auges eine Hautfalte, die für die Verrichtungen seines Sehorgans ohne jeden Zweck ist. Er hat auch die Muskeln, welche denen entsprechen, durch die gewisse Tiere ihre Ohren willkürlich bewegen können. Dennoch können die meisten Menschen ihre Ohren nicht bewegen. Manche Tiere besitzen Augen, die von einer Haut bedeckt sind, also nicht zum Sehen dienen können. His erklärt diese Organe als solche, denen «bis jetzt keine physiologische Rolle sich hat zuteilen lassen, ... den Abfällen vergleichbar, welche beim Zuschneiden eines Kleides auch bei der sparsamsten
verwendung des Stoffes sich nicht völlig vermeiden lassen>. Die Entwickelungstheorie gibt für sie die einzig mögliche Erklärung. Sie sind von den Voreltern ererbt. Bei diesen hatten sie ihren guten Zweck. Tiere, die heute unter der Erde leben und nicht sehende Augen haben, stammen von solchen Ahnen ab, die im Lichte lebten und Augen brauchten. Im Laufe vieler Generationen haben sich die Lebensverhältnisse eines solchen organischen Stammes geändert. Die Lebewesen haben sich den neuen Verhältnissen angepaßt, in denen ihnen die Schorgane entbehrlich sind. Aber diese sind als Erbstücke aus einer früheren Entwickelungsstufe geblieben, nur sind sie im Laufe der Zeit verkümmert, weil sie nicht gebraucht wurden. Diese rudimentären Organe sind eines der stärksten Beweismittel für die narürliche Entwickelungs-theorie. Wenn beim Aufbau einer organischen Form irgendwelche zwecksetzende Absichten geherrscht hätten: woher kämen diese unzweckmäßigen Teile? Es gibt für sie keine andere mögliche Erklämng, als daß sie im Laufe vieler Generationen allmählich außer Gebrauch gekommen sind.
Auch Alexander Goette ist der Ansicht, daß man die Entwickelungsstadien des Einzelorganisraus nicht auf dem Umwege durch die Stammesgeschichte zu erklären brauche. Er leitet die Gestaltung des Organismus von einem «Formgesetze» ab, das zu den physischen und chemischen Prozessen des Stoffes hinzutreten muß, um das Lebewesen zu bilden. Er suchte diesen Standpunkt ausführlich in seiner «Entwicklungsgeschichte der Unke» zu vertreten. «Das Wesen der Entwicklung besteht in der vollständigen, aber ganz allmählichen Einführung eines neuen, von außen bedingten Momentes, eben des Formgesetzes, in die Existenz gewisser Naturkörper.» Da das Formgesetz von außen zu den mechanischen und physikalischen Eigenschaften des Stoffes hinzutreten und nicht sich aus diesen Eigenschaften entwickeln soll, so kann es nichts anderes als eine stoffreie Idee sein, und wir haben in ihm nichts gegeben, was sich im wesentlichen von den Schöpfungsgedanken unterscheidet, die nach der dualistischen Weltanschauung den organischen Formen zugrunde liegen. Es soll ein außer der organisierten Materie existierendes und deren Entwickelung
verursachendes Motiv sein. Das heißt, es bedient sich der stofflichen Gesetze ebenso als Handlanger wie die Idee Eduard von Hartmanns. Goette muß dieses «Formgesetz» herbelmfen, weil er der Meinung ist, daß «die individuelle Entwicklungsgeschichte der Organismen> allein deren gesamte Gestaltung begründet und erklärt. Wer leugnet, daß die wahren Ursachen der Entwickelung des Einzelwesens ein historisch es Ergebnis der Vorfahrenentwickelung sind, der wird notwendig zu solchen außer dem Stoffe liegenden ideellen Ursachen greifen müssen.
Ein gewichtiges Zeugnis gegen solche Versuche, ideelle Gestaltungskräfte in die individuelle Enrwickelungsgeschichte einzuführen, bieten die Leistungen solcher Naturforscher, welche die Gestaltungen höherer Lebewesen wirklich unter der Voraussetzung erklärt haben, daß diese Gestaltungen die erbliche Wiederholung von zaldäosen stammesgeschichtlichen Veränderungen sind, die sich während langer Zeiträume abgespielt haben. Ein schlagendes Beispiel in dieser Hinsicht ist die schon von Goethe und Oken vorgeahnte, aber erst von Carl Gegenbaur auf Grund der Deszendenztheorie in das rechte Licht gerückte «Wirbeltheorie der Schädelknochen». Er führte den Nachweis, daß der Schädel der höheren Wirbeltiere und auch des Menschen durch allmähliche Umbildung eines Urschädeis entstanden ist, dessen Form noch heute die Urfische oder Selachier in ihrer Kopfbildung bewahren. Gestützt auf solche Ergebnisse bemerkt daher Gegenbaur mit Recht: «An der vergleichenden Anatomie wird die Deszendenztheorie zugleich einen Prüfstein finden. Bisher besteht keine vergleichend-anatomische Erfahrung, die ihr widerspräche; vielmehr führen uns alle darauf hin. So wird jene Theorie das von der Wissenschaft zurückempfangen, was sie ihrer Methode gegeben hat: Klarheit und Sicherheit» (vergleiche die Einleitung zu Gegenbaurs: «Vergleichende Anatomie»). Die Deszendenztheorie hat die Wissenschaft darauf hingewiesen, die wirklichen Ursachen der individuellen Entwickelung des Einzelorganismus bei dessen Vorfahren zu suchen, und die Naturwissenschaft ersetzt auf diesem Wege alle ideellen Entwickelungs gesetze, die von irgendwo außerhalb an den organischen Stoff herantreten sollen, durch die tatsächlichen Vorgange
der Stammesgeschichte, die im Einzeiwesen ak Gestaltungskräfte fortwirken.
Immer mehr nähert sich unter dem Einfluß der Deszendenztheorie die Naturwissenschaft dem großen Ziele, das einer der größten Naturforscher des Jahrhunderts, Karl Ernst von Baer, mit den Worten vorgezeichnet hat: «Ein Grundgedanke ist es, der durch alle Formen und Stufen der tierischen Entwicklung geht und alle einzelnen Verhältnisse beherrscht. Derselbe Grund-gedanke ist es, der lm Weltraum die verteilte Masse in Sphären sammelte und diese zu Sonnensystemen verband; derselbe, der den verwitterten Staub an der Oberfläche des Planeten in lebendige Formen hervorwachsen ließ. Dieser Gedanke ist aber nichts als das Leben selbst, und die Worte und Silben, in welchen er sich ausspricht, sind die verschiedenen Formen des Lebendigen.» Ein anderer Ausspruch Baers gibt dieselbe Vorstellung in anderer
Form: «Noch manchem wird ein Preis zuteil werden. Die Palme aber wird der Glückliche erringen, dem es vorbehalten ist, die bildenden Kräfte des tierischen Körpers auf die allgemeinen Kräfte oder Lebensverrichtungen des Weltganzen zurückzuführen.»
Es sind dieselben allgemeinen Naturkräfte, die den auf einer schiefen Ebene befindlichen Stein hinabrollen und die auch durch die Entwickelung aus einer organischen Form die andere entstehen lassen. Die Eigenschaften, die sich eine Form durch Generationen hindurch auf dem Wege der Anpassung erwirbt, die vererbt sie auf ihre Nachkommen. Was ein Lebewesen gegenwärtig von innen heraus aus seiner Keimesanlage entfaltet, das hat sich bei seinen Ahnen äußerlich im mechanischen Kampf mit den übrigen Naturkräften entwickelt. Um diese Ansicht festzuhalten, dazu ist allerdings notwendig, daß man annimmt, die in diesem äußeren Kampfe erworbenen Gestaltungen können sich wirklich vererben. Deshalb wird durch die namentlich von August Weismann verfochtene Meinung, daß sich erworbene Eigenschaften nicht vererben, die ganze Entwickelungslehre in Frage gestellt. Er ist der Ansicht, daß keine äußere Veränderung, die sich mit einem Organismus vollzogen hat, auf die Nachkommen übertragen werden kann, sondern daß sich nur dasjenige vererbt, was durch eine
ursprüngliche Anlage des Keimes vorausbestimmt war. In den Keimen der Organismen sollen unzählige Entwickelungsmöglichkeiten liegen. Demnach können sich die organischen Formen im Laufe ihrer Fortpflanzung verändern. Eine neue Form entsteht, wenn in der Nachkommenschaft andere Entwickelungsmöglichkeiten zur Entfaltung kommen als bei den Vorfahren. Von den auf diese Weise immer neu entstehenden Formen werden sich diejenigen erhalten, die den Kampf ums Dasein am besten bestehen können. Formen, die diesem Kampfe nicht gewachsen sind, werden untergehen. Wenn sich aus einer Entwickelungsmöglichkeit eine Form bildet, die im Konkurrenzstreit besonders tüchtig ist, so wird diese Form sich fortpflanzen, wenn das nicht der Fall ist, muß sie untergehen. Man sieht, hier werden die äußerlich auf den Organismus wirkenden Ursachen ganz aus-geschaltet. Die Gründe, warum sich die Formen verändern, liegen im Keime. Und der Kampf ums Dasein wählt von den aus den verschiedensten Keirnanlagen hervorgehenden Gestalten diejenigen aus, die am tauglichsten sind. Die Eigenschaft eines Organismus führt uns nicht hinauf zu einer Veränderung, die mit seinem Vorfahren vor sich gegangen ist, als zu deren Ursache, sondern zu einer Anlage im Keime dieses Vorfahren. Da also von außen nichts an dem Aufbau der organischen Formen bewirkt werden kann, so müssen im Keime der Urform, von der ein Stamm seine Entwickelung begonnen hat, schon die Anlagen für die folgenden Generationen liegen. Wir stehen wieder vor einer Einschachtelungslehre. Weismann denkt sich den fortschreitenden Prozeß, durch den die Keime die Entwickelung besorgen, als einen stofflichen Vorgang. Wenn ein Organismus entsteht, so wird von der Keimmasse, aus der er sich entwickelt, ein Teil lediglich dazu verwendet, einen neuen Keim behufs weiterer Fortpflanzung zu bilden. In der Keimmasse eines Nachkommen ist also ein Teil derjenigen der Eltern vorhanden, in der Keimmasse der Eltern ein Teil derjenigen der Großelrern und so fort bis hinauf zu der Urform. Durch alle sich auseinander entwickelnden Organismen erhält sich also eine ursprünglich vorhandene Keimsubstanz. Dies ist Weismanns Theorie von der Kontinuität und Unsterblichkeit
des Keimplasmas. Er glaubt sich zu dieser Anschauung gedrängt, weil ihm zahkeiche Tatsachen der Annahme einer Vererbung erworbener Eigenschaften zu widersprechen scheinen. Als eine besonders bemerkenswerte führt er das Vorhandensein der zur Fortpflanzung unfähigen Arbeiter bei den staatenbildenden Insekten, den Bienen, Ameisen und Termiten, an. Diese Arbeiter entwickeln sich nicht aus besonderen Eiern, sondern aus denselben, aus denen auch die fruchtbaren Individuen ihren Ursprung nehmen. Werden weibliche Larven dieser Tiere sehr reichlich und nahrhaft gefüttert, so legen sie Eier, aus denen Königinnen oder Männchen hervorgehen. Ist die Fütterung weniger ausgiebig, so bilden sich unfruchtbare Arbeiter. Es liegt nun nahe, die Ursache der Unfruchtbarkeit einfach in der minderwertigen Ernährung zu suchen. Diese Ansicht vertritt unter anderen Herbert Spencer, der englische Denker, der auf der Grundlage der natürlichen Entwickelungsgeschichte eine philosophische Weltanschauung aufgebaut hat. Weismann hält diese Ansicht nicht für richtig. Denn bei der Arbeitsbiene bleiben die Fortpflanzungsorgane nicht etwa nur in ihrer Entwickelung zurück, sondern sie werden rudimentär, sie haben einen großen Teil der für die Fortpflanzung notwendigen Teile nicht. Nun könne man aber bei anderen Insekten nachweisen, daß schlechte Ernährung durchaus keine solche Organ-verkümmerung nach sich zieht. Die Fliegen sind den Bienen verwandte Insekten. Weismann hat die von einem Weibchen der Schmeißfliege gelegten Eier in zwei Partien getrennt aufgezogen und die einen reichlich, die anderen spärlich gefüttert. Die letzteren wuchsen langsam und blieben auffallend klein. Aber sie pflanzten sich fort. Daraus geht hervor, daß bei den Fliegen schlechte Ernährung nicht das Unfruchtbarwerden bewirkt. Dann kann aber auch bei dem Ur-Insekt, der gemeinsamen Stammform, die man im Sinne der Entwickelungslehre für die verwandten Arten der Bienen und Fliegen annehmen muß, die Eigentümlichkeit noch nicht bestanden haben, durch schwache Ernährung unfruchtbar zu werden. Sondern es muß diese Unfruchtbarkeit eine erworbene Eigenschaft der Biene sein. Zugleich kann aber auch von einer Vererbung dieser Eigenschaft nicht die Rede sein, denn
die Arbeiterinnen, die sie erworben haben, pflanzen sich nicht fort, können demnach auch nichts vererben. Es muß also im Bienenkeim selbst die Ursache dafür gesucht werden, daß sich einmal Königinnen, das andere Mal Arbeiter entwickeln. Der äußere Einfluß der schwachen Fütterung kann nichts bewirken, weil er sich nicht vererbt. Er kann nur als Reiz wirken, der die vorgebildete Keimanlage zur Entfaltung bringt. Durch Verallgemeinerung dieser und ähnlicher Ergebnisse kommt Weismann zu dem Schluß: «Die äußere Einwirkung ist niemals die wirkliche Ursache der Verschiedenheit, sondern sie spielt nur die Rolle des Reizes, der darüber entscheidet, welche der vorhandenen Anlagen zur Entwicklung gelangen soll. Die wirkliche Ursache aber liegt immer in vorgebildeten Veränderungen der Anlagen des Körpers selbst, und diese — da sie stets zweckmäßige sind — können in ihrer Entstehung nur auf Selektionsprozesse bezogen werden», auf die Auswahl der Tüchtigsten im Kampf ums Dasein. Der Kampf ums Dasein (die Selektion) «allein ist das leitende und führende Prinzip bei der Entwicklung der Organismenwelt». Derselben Ansicht wie Weismann von der Nichtvererbung erworbener Eigenschaften und der Allmacht der Selektion huldigen auch die englischen Forscher Francis Galton und Alfred Russell Wallace.
Die Tatsachen, welche diese Forscher vorbringen, bedürfen gewiß der Aufklärung. Sie können eine solche aber nicht in der von Weismann angegebenen Richtung erfahren, wenn man nicht die ganze monistische Entwickelungslehre preisgeben will. Zu einem solchen Schritte können aber am wenigsten die Einwände gegen die Vererbung erworbener Eigenschaften zwingen. Denn man braucht nur die Entwickelung der Instinkte bei den höheren Tieren zu betrachten, um sich davon zu überzeugen, daß eine solche Vererbung stattfindet. Blicken wir zum Beispiel auf die Entwickelung unserer Haustiere. Manche von ihnen haben sich infolge des Zusammenlebens mit den Menschen geistige Fähigkeiten angeeignet, von denen bei ihren wilden Vorfahren nicht die Rede sein kann. Diese Fähigkeiten können doch gewiß nicht aus einer inneren Anlage stammen. Denn der menschliche Einfluß, die Erziehung, tritt als ein völlig Äußeres an diese Tiere
heran. Wie sollte eine innere Anlage gerade einer bestimmten willkürlichen Einwirkung des Menschen entgegenkommen? Und dennoch wird die Dressur zum Instinkt, und dieser vererbt sich auf die Nachkommen. Ein solches Beispiel ist unwiderleglich. Von seiner Art können unzählige gefunden werden. Die Tatsache der Vererbung von erworbenen Eigenschaften besteht also, und es ist zu hoffen, daß weitere Forschungen die ihr scheinbar widersprechenden Erfahrungen Weismanns und seiner Anhänger mit dem Monismus in Einklang bringen werden.
Weismann ist im Grunde doch nur auf halbem Wege zum Dualismus stehengeblieben. Seine inneren Entwickelungs-Ursachen haben nur einen Sinn, wenn sie als ideelle gefaßt werden. Denn wären sie stoffliche Vorgänge im Keimplasma, so wäre nicht einzusehen, warum diese stofflichen Vorgänge und nicht die des äußeren Geschehens im Prozeß der Vererbung fortwirken sollten. Konsequenter als Weismann ist ein anderer Naturforscher der Gegenwart, nämlich J. Reinke, der mit seinem vor kurzem erschienenen Buch: «Die Welt als Tat; Umrisse einer Weltansicht auf naturwissenschaftlicher Grundlage» den Sprung ins dualistische Lager ohne Rückhalt gemacht hat. Er erklärt, daß aus den physischen und chemischen Kräften der organischen Substanzen niemals sich ein Lebewesen aufbauen könne. «Das Leben besteht nicht in chemischen Eigenschaften einer besonderen Verbindung oder einer Mehrzahl von Verbindungen. Wie aus den Eigenschaften von Messing und Glas sich noch nicht die Möglichkeit der Entstehung des Mikroskops ergibt, so wenig folgt aus den Eigenschaften der Eiweißstoffe, Kohlehydrate, Fette, des Lecithins, Cholesterins und so weiter die Mögllchkeit der Entstehung einer Zelle» (S. 178 des genannten Werkes). Es müssen neben den stofflichen Kräften noch geistige oder Kräfte zweiter Hand vorhanden sein, welche den ersteren ihre Richtung geben, ihr Zusammenwirken so regeln, daß sich der Organismus ergibt. Diese Kräfte zweiter Hand nennt Reinke Dominanten. «In der Verbindung der Dominanten mit den Energien» - den Leistungen der physikalischen und chemischen Kräfte - «enthüllt sich uns eine Durchgeistigung der Natur; in dieser Auffassung gipfelt mein naturwissenschaftliches
Glaubensbekenntnis» (S. 455). Es ist nun nur folgerichtig, daß Reinke auch eine allgemeine Weltvernunft annimmt, welche ursprünglich die nur chemischen und physikalischen Kräfte in den Zusammenhang gebracht hat, in dem sie in den organischen Wesen tätig sind.
Dem Vorwurf, daß durch eine solche von außen auf die stofflichen Kräfte wirkende Vernunft die im Reich des Unorganischen geltende Gesetzmäßigkeit für die organische Welt außer Kraft gesetzt wird, sucht Reinke dadurch zu entgehen, daß er sagt: Die allgemeine Weltvernunft ebenso wie die Dominanten bedienen sich der mechanischen Kräfte, sie verwirklichen ihre Schöpfungen nur mit Hilfe dieser Kräfte. Das Verhalten der Weltvernunft stimmt mit dem eines Mechanikers überein, der auch die Naturkräfte arbeiten läßt, nachdem er ihnen die Richtung angewiesen hat. Mit diesem Ausapruche wird aber wieder im Sinne Eduard von Hartmanns die Art der Gesetzmäßigkeit, die sich in den mechanischen Tatsachen ausspricht, zum Handlanger einer höheren, geistigen erklärt.
Goethes Formgesetz, Weismanns innere Entwickelungsursachen, Reinkes Dominanten sind eben im Grunde doch nichts anderes als Abkömmlinge der Gedanken des planmäßig bauenden Weltschöpfers. Sobald man die klare und einfache Erklärungsweise der monistischen Weltansicht verläßt, verfällt man unbedingt mehr oder weniger in mystisch-religiöse Vorstellungen, und von solchen gilt Haeckels Satz, daß «es dann besser ist, die mysteriöse Schöpfung der einzelnen Arten anzunehmen».
Neben denjenigen Gegnern des Monismus, welche der Ansicht sind, daß die Betrachtung der Welterscheinungen zu geistigen Wesenheiten hinführe, die unahhängig von den stofflichen Erscheinungen sind, gibt es noch andere, die das Gebiet einer über der natürlichen schwebenden übernatürlichen Weltordnung dadurch retten wollen, daß sie dem menschlichen Erkenntnisvermögen überhaupt die Fähigkeit absprechen, die letzten Gründe des Weltgeschehens zu begreifen. Die Vorstellungen dieser Gegner haben ihren beredtesten Anwalt in Du Bois-Reymond gefunden. Seine auf der fünfundvierzigsten Versammlung deutscher Naturforscher
und Ärzte (1872) gehaltene berühmte «Ignorabimus-Rede» ist der Ausdruck ihres Glaubensbekenntnisses. Du BoisReymond bezeichnet in dieser Rede als das höchste Ziel des Natur-forschers die Erklärung aller Weltvorgänge, also auch des menschlichen Denkens und Empfindens, durch mechanische Prozesse. Gelingt es uns dereinst zu sagen, wie die Teile unseres Gehlrnes liegen und sich bewegen, wenn wir einen bestimmten Gedanken oder eine Empfindung haben, so ist das Ziel der Naturerklärung erreicht. Weiter können wir nicht kommen. Damit haben wir aber nach Du Bois-Reymonds Ansicht nicht begriffen, worin das Wesen unseres Geistes besteht. «Es scheint zwar bei oberflächlicher Betrachtung, als könnten durch die Kenntnis der materiellen Vorgänge im Gehirn gewisse geistige Vorgänge und Anlagen uns verständlich werden. Ich rechne dahin das Gedächtnis, den Fluß und die Assoziation der Vorstellungen, die Folgen der Übung, die spezifischen Talente und dergleichen mehr. Das geringste Nachdenken lehrt, daß dies Täuschung ist. Nur über gewisse innere Bedingungen des Geisteslebens, welche mit den äußeren durch die Sinneseindrücke gesetzten etwa gleichbedeutend sind, würden wir unterrichtet sein, nicht über das Zustandekommen des Geisteslebens durch diese Bedingungen. - Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen: ‹Ich fühle Schmerz, fühle Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot›, und der ebenso unmittelbar daraus fließenden Gewißheit: ‹Also bin ich!›? Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden.» (S. 35 f.) Wer aber heißt Du Bois-Reymond erst aus der Materie den Geist auszutreiben, um nachher konstatieren zu können, daß er nicht in ihr ist! Die einfache Anziehung und Abstoßung des kleinsten Stoffteilchens ist Kraft, also eine von dem Stoff ausgehende geistige Ursache. Aus den einfachsten Kräften
sehen wir in einer Stufenfolge von Entwickelungen sich den komplizierten Menschengeist aufbauen. Wir begreifen ihn aus diesem seinem Werden. «Das Problem von der Entstehung und dem Wesen des Bewußtseins ist nur ein spezieller Fall von dem generellen Hauptproblem: vom Zusasntiienhang von Materie und Kraft.» (Haeckel, Freie Wissenschaft und freie Lehre. S.80.) Die Frage ist eben gar nicht: wie entsteht der Geist aus der geistlosen Materie, sondern: wie entwickelt sich der kompliziertere Geist aus den einfachsten geistigen Leistungen des Stoffes: aus der Anziehung und Abstoßung? In der Vorrede, die Du Bois-Reymond zu dem Abdruck seiner «Ignorabimus-Rede» geschrieben hat, empfiehlt er denjenigen, die nicht zufrieden sind mit seiner Erklärung von der Unerkennbarkeit der tiefsten Gründe des Seins, daß sie es doch mit den Glaubensvorstellungen der übernatürlichen Weltanschauung versuchen mögen. «Mögen sie es doch mit dem einzigen anderen Ausweg versuchen, dem des Supranaturalismus. Nur daß, wo Supranaturalismus anfängt, Wissenschaft aufhört.» Aber ein solches Bekenntnis, wie das Du Bois-Reymonds, wird immer dem Supranaturalismus Tür und Tor öffnen. Denn, wo man dem menschlichen Geiste sein Wissen begrenzt, wird er seinen Glauben an Nicht-mehr-Wißbares beginnen lassen.
Es gibt nur eine Rettung aus dem Glauben an eine übernatürliche Weltordnung, und das ist die monistische Erkenntnis, daß alle Erkläruuigsgründe für die Welterscheinungen auch innerhalb des Gebietes dieser Erscheinungen liegen. Diese Erkenntnis kann nur eine Philosophie liefern, die im innigsten Einklange mit der modernen Entwickelungslehre steht.
ANMERKUNGEN
I. Goethe und Kant (S. 156, Z. 6/7 ff. v. o.). Den Gegensatz, der zwischen Gnethes und Kants Weltanschauung besteht, habe ich in den Einleitungen zu meiner Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften (in Kürschner «Deutsche National-Literatur») und in meinem Buche «Goethes Weltanschauung» (‹Die Metamorphose der Welterscheinungen›) charakterisiert.
Er zeigt sich auch in der Stellung der beiden Persönijelskeiten zur Erklärung der organischen Natur. Goethe sucht diese Erklärung auf dem Wege, den auch die moderne Naturwissenschaft betreten hat. Kant hält eine solche Erklärung für unmöglich. Nur wer sich in das Wesen von Goethes Weltansicht vertieft, kann ein richtiges Urteil über ihre Stellung zur Kantschen Philosophie gewinnen. Die Selbstzeugnisse Goethes sind nicht maß-gebend, da dieser sich nie in ein genaueres Studium Kants eingelassen hat. »Der Eingang ) war es, der mir gefiel, ins Labyrinth selbst konnt ich mich nicht wagen: bald hinderte mich die Dichtungsgabe, bald der Menschenverstand, und ich fühlte naich nirgend gebessert. « Ihm gefielen einzelne Stellen in Kants «Kritik der Urteilskraft', weil er ihren Sinn so umdeutete, daß er seiner eigenen Weltanschauung entsprach. Es ist daher nur zu begreiflich, daß seine Gespräche mit Kantianern sich wunderlich ausnahmen. «Sie hörten mich wohl, konnten mir aber nichts erwidern, noch irgend förderlich sein. Mehr als einnaal begegnete es mir, daß einer oder der andere mit lächelnder Verwunderung zugestand: es sei freilich ein Analogon Kantischer Vorstellungsart, aber ein seltsames.« Karl Vorländer hat in seinem Aufsatz «Goethes Verhältnis zu Kant in seiner historischen Entwkklung« (Kantstudien I, II) dieses Verhältnis nach dem Wortlaut von Goethes Selbstzeugnissen beurteilt und mir vorgeworfen, daß meine Auffassung «mit klaren Selbstzeugnissen Goethes in Widerspruch« stehe und mindestens «stark einseitig« sei. Ich hatte diesen Einwand unerwidert gelassen, weil ich aus den Ausführungen des Herrn Karl Vorländer sah, daß sie von einem Manne herrühren, dem es ganz unmöglich ist, eine ihm fremde Denkweise zu verstehen; allein, es schien mir doch nötig, eine daran geknüpfte Bemerkung nicht ohne Antwort zu lassen. Herr Vorländer gehört nämlich zu denjenigen Menschen, die ihre Meinung für absolut richtig, also aus der höchstmöglichen Einsicht herrührend, ansehen und jede andere zu einem Produkte der Unwissenheit stempeln. Weil ich anders über Kant denke als er, gibt er mir den weisen Rat, gewisse Partien in Kants Werken zu studieren. Eine solche Art der Kritik fremder Meinungen kann nicht stark genug zurückgewiesen werden. Wer gibt jemandem das Recht, mich wegen einer von der seinigen abweichenden Anschauung nicht zu lcritisieren, sondern zu schulmeistern? Ich habe daher Herrn Karl Vorländer im 4. Bande meiner Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften meine Meinung über diese Schulmeisterei gesagt. Darauf hat er im III. Band der «Kantstudien' mein Buch «Goethes Weltanschauung» in einer Weise besprochen, die nicht nur das vorher wider mich Geleistete der Form nach überbietet, sondern die auch voller objektiver Unwahrheiten ist. So spricht er von einer »isolierten und verbitterten Opposition«, in der ich mich gegen die gesamte moderne Philosophie (exklusive natürlich Nietzsche) und Naturwissenschaft befinde. Das sind gleich drei objektive Unwahrheiten. Wer meine Schriften - und wer über mich urteilt wie Herr Vorlander, sollte sie doch lesen -, wird ersehen, daß ich zwar an einzelnen Anschauungen der
modernen Naturwissenschaft sachliche Kritik übe und andere philosophisch zu vertiefen suche, daß aber von einer verbitterten Opposition zu reden geradezu absurd ist. In meiner «Philosophie der Freiheit» habe ich meine Überzeugung dahin ausgesprochen, daß in meinen Anschauungen der philosophische Abschluß des Gebäudes gegeben sei, das «Darwin und Haeckel für die Naturwissenschaft errichtet haben» (XII. ). Daß ich es bin, der den Grundmangel in Nietzsches Ideenwelt scharf betont hat, weiß zwar der Franzose Henri Lichtenberger, der in seinem Buche «La philosophie de Nietziche» sagt: «R. Steiner est l'auteur de Wahrheit und Wissenschaft et Die Philosophie der Freiheit; dans ce dernier ouvrage ii compléte la théorie de Nietziche sur un point important.» Fr betont, daß ich gezeigt habe, daß gerade Nietzsches «Übermensch « das nicht ist, was er sein sollte. Der deutsche Philosoph Karl Vorländer hat entweder meine Schriften nicht gelesen und urteilt dennoch über mich, oder er hat das getan und schreibt die obigen und ähnliche objektive Unwahrheiten hin. Ich überlasse es dem urteilsfähigen Publikum, zu entscheiden, ob sein Beitrag, der würdig befunden wurde, in eine ernste philosophische Zeitschrift aufgenommen zu werden, ein Beweis für seine gänzliche Urteilslosigkeit oder ein bedenklicher Beitrag zur deutschen Gelehrten-Moral ist.
II. Biogenetisches Grundgesetz (S. 162, Z. 2 ff. v. u.). Haeckel hat die allgemeine Geltung und weittragende Bedeutung des biogenetischen Grundgesetzes in einer Reihe von Arbeiten nachgewiesen. Die wichtigsten Aufschlüsse und Beweise findet man in seiner «Biologie der Kalkschwämme» (1872) und in seinen «Studien zur Gasträa-Theorie» (l873-84). Seitdem haben diese Lehre andere Zoologen ausgebaut und bestätigt. In seiner neuesten Schrift »Die Welträtsel» (1899) kann Haeckel von ihr sagen (S. 72):» Obgleich dieselbe anfangs fast allgemein abgelehnt und während eines Dezenniums von zahlreichen Autoritäten heftig bekämpft wurde, ist sie doch gegenwärtig (seit etwa fünfzehn Jahren) von allen sachkundigen Fachgenossen angenommen.»
III. Haeckels neueste Schrift (S. 163, Z. 3 ff. v. u.). In seinem kürzlich erschienenen Buche »Die Welträtsel, Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie» (Bonn, Emil Strauß, 1899) hat Haeckel rückhaltlos die «weitere Ausführung, Begründung und Ergänzung der Überzeugungen» gegeben, die er in den oben angeführten Schriften bereits ein Menschenalter hindurch vertreten hat. Demjenigen, der die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit in sich aufgenommen hat, muß dieses Werk als eines der bedeutendsten Manifeste vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts erscheinen. Es enthält in reifer Form eine vollständige Auseinandersetzung der modernen Naturwissenschaft mit dem philosophischen Denken aus dem Geiste des genialsten, weitblickendsten Naturforschers unserer Zeit heraus.
IV. Zweckmäßigkeit und Zweck (S. 170, Z. 18 ff. v.u.). Fs wird von denjenigen, die gerne gläubig an dem Vorhandensein von Zwecken in der Na-tut festhalten möchten, immer wieder betont, daß Darwins Anschauungen den Zweckgedanken doch nicht beseitigten, sondern ihn erst recht benutzen, indem sie zeigen, wie die Verkettung von Ursachen und Wirkungen durch sich selbst norwendig zur Entstehung des Zweckmäßigen führen müsse. Es kommt aber nicht darauf an, ob man das Vorhandensein von zweckmäßigen Bildungen in der Natur zugibt oder nicht, sondern ob man annimmt oder ablehnt, daß der Zweck, das Ziel als Ursache bei Entstehung dieser Bildungen mitwirkt. Wer diese Annahme macht, der vertritt die Teleologie oder Zweckmäßigkeitslehre. Wer dagegen sagt: der Zweck ist in keiner Weise bei der Entstehung der organischen Welt tätig; die Lebewesen entstehen nach notwendigen Gesetzen wie die unorganischen Erscheinungen, und die Zweckmäßigkeit ist nur da, weil das Unzweckktiäßige sich nicht erhalten kann; sie ist nicht der Grund der Vorgänge, sondern deren Folge: der bekennt sich zum Darwinismus. Das beachtet nicht, wer wie Otto Liebmann behauptet: «Einer der größten Teleologen der Gegenwart ist Charles Darwin» (Gedanken und Tatsachen, i. Heft, S. 113). Nein, er ist der größte Antiteleologe, weil er solchen Geistern wie Liebmann, wenn sie ihn verstünden, zeigen würde, daß das Zweckgemäße erklärt werden kann, ohne daß man die Tätigkeit von wirkenden Zwecken voraussetzt.
V. Denkorgane (S. 172, Z. 9 ff. v. o.). In neuester Zeit ist es Paul Flechsig gelungen, nachzuweisen, daß in einem Teile der Denkorgane des Menschen sich verwickelte Strukturen finden, die bei den übrigen Säugetieren nicht vorhanden sind. Sie vermitteln offenbar diejenigen geistigen Tätigkeiten, durch die der Mensch sich vom Tiere unterscheidet.
VI. Menschliche und tierische Seelenkunde (S. 179, Z. 11 ff. v. o.). Das Verdienst, gezeigt zu haben, daß kein wirklicher Gegensatz zwischen Tier-und Menschenseele besteht, sondern daß in einer naturgemäßen Entwickelungsreihe sich die Geistestätigkeiten des Menschen an die der Tiere als eine höhere Form derselben anschließen, gebührt George John Romanes, der in einem umfassenden Werke: »Die geistige Entwicklung im Tierreich» (I. Band, Leipzig 1885) und »Die geistige Entwicklung beim Menschen. Ursprung der menschlichen Fähigkeiten» (2. Band, Leipzig 1893) gezeigt hat, «daß die psychologische Schranke zwischen Tier und Mensch überwunden ist».
VII. Virchow und Darwin (S. 181ff.). Am 3. Oktober 1898 hielt Virchow die zweite der «Huxley Lectures» in der Charing Cross Hospital Medical School zu London, in der er sagte: »Ich darf annehmen, daß mir ein solcher Auftrag nicht erteilt worden wäre, wenn die Auftraggeber nicht gewußt
hätten, wie tief das Gefühl der Verehrung für Huxley in meiner Seele ist wenn sie nicht gesehen hätten, wie ich von den ersten bahnbrechenden Publikationen des verstorbenen Meisters an seine Leistungen anerkannt und wie sehr ich die Freundschaft geschätzt habe, die er mir persönlich zuteil werden ließ.« Nun bedeuten gerade diese bahnbrechenden Publikationen Huxleys den ersten großen Schritt zur Ausbildung der Theorie von der Affenabstammung des Menschen, die Virchow bekämpft und über die er auch in dem Huxley-Vortrag «Die neueren Fortschritte in der Wissenschaft« nichts zu sagen weiß als einige gegenüber dem heutigen Stande der Frage ganz bedeutungslose Worte, wie: »Man mag über die Entstehung des Men-scheu denken, wie man will, die Überzeugung von der prinzipiellen Übereinstimmung der menschlichen und der tierischen Organisation ist gegenwärtig allgemein angenommen ... und so weiter.»
VIII. Unzweckmäßige Organe (S. 187, Z. 12 ff. v. o.). Über diese Organe sagt Haeckel in seinem Buche »Die Welträtsel», S.306: »Alle höheren Tiere und Pflanzen, überhaupt alle diejenigen Organismen, deren Körper nicht ganz einfach gebaut, sondern aus mehreren, zweckmäßig zusammen-wirkenden Organen zusammengesetzt ist, lassen bei aufmerksamer Untersuchung eine Anzahl von nutzlosen oder unwirksamen, ja zum Teil sogar gefährlichen und schädlichen Einrichtungen erkennen ... Die Erklärung dieser zwecklosen Einrichtungen finden wir sehr einfach durch die Deszendenztheorie. Sie zeigt, daß diese rudimentären Organe verkümmert sind, und zwar durch Nichtgebrauch ... Der blinde Kampf ums Dasein zwischen den Organen bedingt ebenso ihren historischen Untergang, wie er ursprünglich ihre Entstehung und Ausbildung verursachte.»
IX. Andere Gegner Haeckels (S. 189 ff.). Hier konnte nur von solchen Einwänden gegen Haeckels Lehre gesprochen werden, die gewissermaßen typisch sind und die ihren Grund in veralteten, aber noch immer einflußreichen Gedankenkreisen haben. Die zahlreichen «Widerlegungen» Haekkels, die sich nur als Abarten der verzeichneten Haupteinwände darstellen, mußten ebenso unberücksichtigt bleiben wie diejenigen, die Haeckel selbst am besten in seinem Buche über »Die Welträtsel» abgetan hat, indem er den wackern Kämpfern sagt: «Erwerbet Euch durch fünfjähriges fleißiges Studium der Naturwissenschaft und besonders der Anthropologie (speziell der Anatomie und Physiologie des Gehirns!) diejenigen unentbehrlichen empirischen Vorkenntnisse der fundamentalen Tatsachen, die Euch noch gänzlich fehlen.» (i. Aufl., S.444.)
X. Erkenntnisgrenzen (S. 194, Z. 10 ff. v. u.). Auf welchem Mißverständnis die Annahme von Erkenntnisgrenzen beruht, habe ich nachgewiesen in meiner «Philosophie der Freiheit».
GOETHE-STUDIEN
Grund-Ideen
Zum vollen Verständnis des Goerheschen Innenlebens, seiner Welt- und Lebensbetrachtung gelangt man nicht durch bloßes äußerliches Kommentieren seiner Werke. Man muß vielmehr auf den philosophischen Kern seines ganzen Wesens zurückgehen. Goethe war kein Philosoph im wissenschaftlichen Fachsinne, aber er war eine philosophische Natur.
Ich möchte diese Natur hier mit einigen Gedanken festhalten, um dann einmal Goethes Stellung zum Christentum zu kennzeichnen. In unserer reaktionären Gegenwart scheint es mir nicht unberechtigt zu sein, über das Verhältnis dieses führenden Geistes zu religiösen Fragen nachzudenken.
Der Mensch ist nicht zufrieden mit dem, was die Natur freiwillig seinem beobachtenden Geiste darbietet. Er fühlt, daß sie, um die Mannigfaltigkeit ihrer Schöpfungen hervorzubringen, Triebkräfte braucht, die er selbst durch Beobachtung und Denken gewinnen muß. In dem menschlichen Geiste selbst liegt das Mittel, die Triebkräfte der Natur zu enthüllen. Aus dem Menschengeiste steigen die Ideen auf, die Aufklärung darüber bringen, wie die Natur ihre &höpfungen zustande bringt. Wie die Erscheinungen der Außenwelt zusamenhängen, im Innern des Menschen wird es offenbar. Was der menschliche Geist an Naturgesetzen erdenkt: es ist nicht zur Nätur hinzuerfanden, es ist die eigene Wesenheit der Natur; und der Geist ist nur der Schauplatz, auf dem die Natur die Geheimnisse ihres Wirkens sichtbar werden läßt. Was wir an den Dingen beobachten, das ist nur ein Teil der Dinge. Was in unserem Geiste emporquillt, wenn er sich den Dingen gegenüberstellt, das ist der andere Teil. Dieselben Dinge sind es, die von außen zu uns sprechen und die in uns sprechen. Erst wenn wir die Sprache der Außenwelt mit der unseres Innern zusammenhalten, haben wir die volle Wirklichkeit.
Der Geist sieht das, was die Erfahrung enthält, in zusammenhängender
Gestalt. Er sucht Gesetze, wo die Natur nur Tatsachen bietet.
Philosoph und Künstler haben das gleiche Ziel. Sie suchen das Vollkommene zu gestalten, das ihr Geist erschaut, wenn sie die Natur auf sich wirken lassen. Aber es stehen ihhen verschiedene Mittel zu Gebote, um dies Ziel zu erreichen. In dem Philosophen leuchtet ein Gedanke, eine Idee auf, wenn er einem Naturprozeß gegenübersteht. Diese spricht er aus. In dem Künstler entsteht ein Bild dieses Prozesses, das diesen vollkommener zeigt, als er sich in der Außenwelt beobachten läßt. Philosoph und Künstler bilden die Beobachtung auf verschiedenen Wegen weiter. Der Künstler braucht die Triebkräfte der Natur in der Form nicht zu kennen, in der sie sich dem Philosophen enthüllen. Wenn er ein Ding oder einen Vorgang wahrnimmt, so entsteht unmittelbar ein Bild in seinem Geiste, in dem die Gesetze der Natur in vollkommenerer Form ausgeprägt sind als in dem entsprechenden Dinge oder Vorgange der Außenwelt. Diese Gesetze in Form des Gedankens brauchen nicht in seinen Geist einzutreten. Erkenntnis und Kunst sind aber doch innerlich verwandt. Sie zeigen die Gesetze der Natur, die in dieser als Tatsachen herrschen.
Wenn nun in dem Geiste eines echten Künstlers außer vollkommenen Bildern der Dinge auch noch die Triebkräfte der Natur in Form von Gedanken sich aussprechen, so tritt der gemeinsame Quell von Philosophie und Kunst uns besonders deutlich vor Augen. Goethe ist ein solcher Künstler. Er offenbart uns die gleichen Geheimnisse in der Form seiner Kunstwerke und in der Form des Gedankens. Was er in seinen Dichtungen gestaltet, das spricht er in seinen natur- und kunstwissenschaftlichen Aufsätzen und in seinen «Sprüchen in Prosa» in Form des Gedankens aus. Die tiefe Befriedigung, die von diesen Aufsätzen und Sprüchen ausgeht, hat darin ihren Grund, daß man den Einklang von Kunst und Erkenntnis in einer Persönlichkeit verwirklicht sieht. Das Gefühl hat etwas Erhebendes, das bei jedem Goetheschen Gedanken auftritt: hier spricht jemand, der zugleich das Vollkommene, das er in Ideen ausdrückt, im Bilde schauen kann. Die Kraft eines solchen Gedankens wird verstärkt durch dieses Gefühl.
Was aus den höchsten Bedürfnissen einer Persönlichkeit stammt, muß innerlich zusammengehören. Goethes Weisheitsiehren antworten auf die Frage: was für eine Philosophie ist der echten Kunst gemäß?
*
Was aus dem menschlichen Geiste entspringt, wenn dieser sich beobachtend und denkend der Außenwelt gegenüberstellt, ist die Wahrheit. Der Mensch kann keine andere Erkenntnis verlangen als eine solche, die er selbst hervorbringt. Wer hinter den Dingen noch etwas sucht, das deren eigentliches Wesen bedeuten soll, der hat sich nicht zum Bewußtsein gebracht, daß alle Fragen nach dem Wesen der Dinge nur aus einem menschlichen Bedürfnisse entspringen: das, was man wahrnimmt, auch mit dem Gedanken zu durchdringen. Die Dinge sprechen zu uns, und unser Inneres spricht, wenn wir die Dinge beobachten. Diese zwei Sprachen stammen aus demselben Urwesen, und der Mensch ist berufen, deren gegenseitiges Verständnis zu bewirken. Darin besteht das, was man Erkenntnis nennt. Und dies und nichts anderes sucht der, der die Bedürfnisse der menschlichen Natur versteht. Wer zu diesem Verständnisse nicht gelangt, dem bleiben die Dinge der Außenwelt fremdartig. Er hört aus seinem Innern das Wesen der Dinge nicht zu sich sprechen. Deshalb vermutet er, daß dieses Wesen hinter den Dingen verborgen sei. Er glaubt an eine Außenwelt noch hinter der Wahrnehmungswelt. Aber die Dinge sind uns nur so lange fremd, solange wir sie bloß beobachten. Für den Menschen besteht nur so lange der Gegensatz von objektiver äußerer Wahrnehmung und subjektiver. innerer Gedankenwelt, als er die Zusantnengehörigkeit dieser Welten nicht erkennt. Die menschliche Innenwelt gehört als ein Glied zum Weltprozeß wie jeder andere Vorgang.
Diese Gedanken werden nicht widerlegt durch die Tatsache, daß verschiedene Menschen sich verschiedene Vorstellungen von den Dingen machen. Auch nicht dadurch, daß die Organisationen der Menschen verschieden sind, so daß man nicht weiß, ob eine und dieselbe Farbe von verschiedenen Menschen in der ganz
gleichen Weise gesehen wir& Denn nicht darauf kommt es an, ob sich die Menschen über eine und dieselbe Sache genau das gleiche Urteil bilden, sondern darauf, ob die Sprache, die das Innere des Menschen spricht, eben die Sprache ist, die das Wesen der Dinge ausdrückt. Die einzelnen Urteile sind nach der Organisation des Menschen und nach dem Standpunkte, von dem aus er die Dinge betrachtet, verschieden; aber alle Urteile entspringen dem gleichen Elemente und führen in das Wesen der Dinge. Dieses kann in verschiedenen Gedankennuancen zum Ausdruck kommen; aber es bleibt deshalb doch das Wesen der Dinge.
Der Mensch ist das Organ, durch das die Natur ihre Geheimnisse enthüllt. In der subjektiven Persönlichkeit erscheint der tiefste Gehalt der Welt. «Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt: dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern> (Goethe, Winckelmann: Antikes). Die moderne Naturwissenschaft spricht denselben Gedanken durch ihre Mittel und mit ihren Methoden aus. (Goethe, Sprüche in Prosa.)
*
Wenn ein Ding durch das Organ des menschlichen Geistes seine Wesenheit ausspricht, so kommt die volle Wirklichkeit nur durch den Zusammenfluß von Beobachtung und Denken zu-stande. Weder durch einseitiges Beobachten noch durch einseitiges Denken erkennt der Mensch die Wirklichkeit. Diese ist
nicht als etwas Fertiges in der objektiven Welt vorhanden, sondern wird erst durch den menschlichen Geist in Verbindung mit den Dingen hervorgebracht. Wer ausschließlich die Erfahrung anpreist, dem muß man mit Goethe erwidem, «daß die Erfahrung nur die Hälfte der Erfahrung ist>. «Alles Faktische ist schon Theorie» (Sprüche in Prosa), das heißt, es offenbart sich im menschlichen Geiste ein Gesetzliches, wenn er ein Faktisches betrachtet. Diese Weltauffassung, die in den Ideen die Wesenheit der Dinge erkennt und die Erkenntnis auffaßt als ein Einleben in das Wesen der Dinge, ist nicht Mystik. Sie hat aber mit der Mystik das gemein, daß sie die objektive Wahrheit nicht als etwas in der Außenwelt Vorhandenes betrachtet, sondern als etwas, das sich im Innern des Menschen wirklich ergreifen läßt. Die entgegengesetzte Weltanschauung versetzt die Gründe der Dinge hinter die Erscheinungen, in ein der menschlichen Erfahrung jenseitiges Gebiet. Sie kann nun entweder sich einem blinden Glauben an diese Gründe hingeben, der von einer positiven Offenbarungsteligion seinen Inhalt enthält, oder Verstandes-Hypothesen und Theorien darüber aufstellen, wie dieses jenseitige Gebiet der Wirklichkeit beschaffen ist. Der Mystiker wie auch der Bekenner der Goetheschen Weltanschauung lehnen sowohl den Glauben an ein Jenseitiges wie auch die Hypothesen über ein solches ab und halten sich an das wirkliche Geistige, das sich in dem Menschen selbst ausspricht. Goethe schreibt an Jacobi: «Gott hat dich mit der Metaphysik gestraft und dir einen Pfahl ins Fleisch gesetzt, mich dagegen mit der Physik gesegnet... Ich halte mich fest und fester an die Gottesverehrung des Atheisten (Spinoza) und überlasse euch alles, was ihr Religion heißt und heißen müßt. Du hältst aufs Glauben an Gott, ich aufs Scnauen.> Was Goethe schauen will, ist die in seiner Ideenwelt sich ausdrückende Wesenheit der Dinge. Auch der Mystiker will durch Versenkung in das eigene Innere die Wesenheit der Dinge erkennen; aber er lehnt gerade die in sich klare und durchsichtige Ideenwelt ab als untauglich zur Erlangung einer höheren Erkenntnis. Er glaubt, nicht sein Ideenvermögen, sondern andere Kräfte seines Inneren entwickeln zu müssen, um die Urgründe der Dinge zu schauen.
Gewöhnlich sind es unklare Empfindungen und Gefühle, in denen der Mystiker das Wesen der Dinge zu ergreifen glaubt. Aber Gefühle und Empfindungen gehören nur zum subjektiven Wesen des Menschen. In ihnen spricht sich nichts über die Dinge aus. Allein in den Ideen der Naturgesetzmäßigkeit sprechen die Dinge selbst. Die Mystik ist eine oberflächliche Weltanschauung, trotzdem die Mystiker den Vernunftmenschen gegenüber sich viel auf ihre zugute tun. Sie wissen nichts über die Natur der Gefühle, sonst würden sie sie nicht für Aussprüche des Wesens der Welt halten; und sie wissen nichts von der Natur der Ideen, sonst würden sie diese nicht für flach und rationalistisch halten. Sie ahnen nicht, was Menschen, die wirklich Ideen haben, in diesen erleben. Aber für viele sind Ideen eben bloße Worte. Sie können die unendliche Fülle ihres Inhaltes sich nicht aneignen. Kein Wunder, daß sie ihre eigenen ideenlosen Worthülsen als leer empfinden.
*
Wer den wesentlichen Inhalt der objektiven Welt in dem eigenen Innern sucht, der kann auch das Wesentliche der sittlichen Weltordnung nur in die menschliche Natur selbst verlegen. Wer eine jenseitige Wirklichkeit hinter der menschlichen vorhanden glaubt, der muß in ihr auch den Quell des Sittlichen suchen. Denn das Sittliche im höheren Sinne kann nur aus dem Wesen der Dinge kommen. Der Jenseitsgläubige nimmt deshalb sittliche Gebote an, denen sich der Mensch zu unterwerfen hat Diese Gebote gelangen zu ihm entweder auf dem Wege einer Offenbarung, oder sie treten als solche in sein Bewußtsein ein, wie es beim kategorischen Imperativ Kants der Fall ist. Wie dieser aus dem jenseitigen «An sich» der Dinge in unser Bewußtsein kommt, darüber wird nichts gesagt. Er ist einfach da, und man hat sich ihm zu unterwerfen.
Goethe läßt das Sittliche aus der Naturwelt des Menschen entstehen. Nicht objektive Normen und auch nicht die bloße Trieb-welt lenken das sittliche Handeln, sondern die zu sittlichen Ideen gewordenen natürlichen Triebe des tierischen Lebens, durch die
sich der Mensch selbst die Richtung gibt. Ihnen folgt er, weil er sie liebt, wie man ein Kind liebt. Er will ihre Verwirklichung und setzt sich für sie ein, weil sie ein Teil seines eigenen Wesens sind. Die Idee ist die Richtschnur; und die Liebe ist die treibende Kraft in der Goetheschen Ethik. Ihm ist (Sprüche in Prosa).
Ein Handeln im Sinne der Goetheschen Ethik ist zwar natur-gemäß bedingt, aber ethisch frei. Denn der Mensch ist von nichts abhängig als von seinen eigenen Ideen. Und er ist niemandem verantwortlich als sich selbst. Ich habe bereits in meiner den billigen Einwand entkräftet, daß die Folge einer sittlichen Weltordnung, in der jeder nur sich selbst gehorcht, die allgemeine Unordnung und Disharmonie des menschlichen Handelns sein müßte. Wer diesen Einwand macht, der übersieht, daß die Menschen gleichartige Wesen sind und daß sie deshalb niemals sittliche Ideen produzieren werden, die durch ihre wesentliche Verschiedenheit einen unharmonischen Zusammenklang bewirken werden.
Moral und Christentum
Die Stellung unserer erkennenden Persönlichkeit zum objektiven Welewesen gibt uns auch unsere ethische Physiognomie. Was bedeutet für uns der Besitz von Erkenntnis und Wissenschaft?
In unserem Wissen lebt sich der innerste Kern der Welt aus. Die gesetzmäßige Harmonie, von der das Weltall beherrscht wird, kommt in der menschlichen Erkenntnis zur Erscheinung.
Es gehört somit zum Berufe des Menschen, die Grundgesetze der Welt, die sonst zwar alles Dasein beherrschen, aber nie selbst zum Dasein kommen würden, in das Gebiet der erscheinenden Wirklichkeit zu versetzen. Das ist das Wesen des Wissens, daß es aus der objektiven Realität die ihr zugrunde liegende wesen-hafte Gesetzmäßigkeit herauslöst. Unser Erkennen ist - bildiich gesprochen - ein stetiges Hineinleben in den Weltengrund.
Eine solche Überzeugung muß auch Licht auf unsere praktische Lebensauffassung werfen.
Unsere Lebensführung ist ihrem ganzen Charakter nach bestimmt durch unsere sittlichen Ideale. Diese sind die Ideen, die wir von unseren Aufgaben im Leben haben, oder mit anderen Worten, die wir uns von dem machen, was wir durch unser Handeln vollbringen sollen.
Unser Handeln ist ein Teil des allgemeinen Weltgeschehens. Es steht somit auch unter der allgemeinen Gesetzmäßigkeit dieses Geschehens.
Wenn nun irgendwo im Universum ein Geschehen auftritt, so ist an demselben ein zweifaches zu unterscheiden: der äußere Verlauf desselben in Raum und Zeit und die innere Gesetzmäßigkeit davon.
Die Erkenntnis dieser Gesetzmäßigkeit für das menschliche Handeln ist nur ein besonderer Fall des Erkennens. Die von uns über die Natur der Erkenntnis abgeleiteten Anschauungen müssen also auch hier anwendbar sein. Sich als handelnde Persönlichkeit erkennen, heißt somit: für sein Handeln die entsprechenden Gesetze, das heißt die sittlichen Begriffe und Ideale als Wissen zu besitzen. Wenn wir diese Gesetzmäßigkeit erkannt haben, dann ist unser Handeln auch unser Werk. Die Gesetzmäßigkeit ist dann nicht als etwas gegeben, was außerhalb des Objektes liegt, an dem das Geschehen erscheint, sondern als der Inhalt des in lebendigem Tun begriffenen Objektes selbst. Das Objekt ist in diesem Falle unser eigenes Ich. Hat dies letztere sein Handeln dem Wesen nach wirklich erkennend durchdrungen, dann fühlt es sich zugleich als den Beherrscher desselben. Solange ein solches nicht stattfindet> stehen die Gesetze des Handelns uns als etwas Fremdes gegenüber; sie beherrschen uns; was wir vollbringen, steht unter dem Zwange, den sie auf uns ausüben. Sind sie aus solcher fremden Wesenheit in das ureigene Tun unseres Ich verwandelt, dann hört dieser. Zwang auf. Was die Zweckmäßigkeits-Ideen der Teleologie für die Wissenschaft der Lebewesen, ist der kategorische Imperativ für das menschliche Handeln. Die Zweckmäßigkeits-Ideen hindern das Forschen nach rein natürlichen Gesetzen
der organischen Wesen; der kategorische Imperativ hindert das Ausleben der rein natürlichen moralischen Antriebe. Das Zwingende ist unser eigenes Wesen geworden. Die Gesetzmäßigkeit herrscht nicht mehr über uns, sondern in uns über das von unserem Ich ausgehende Geschehen. Die Verwirklichung eines Geschehens vermöge einer außer dem Verwirklicher stehenden Gesetzmäßigkeit ist ein Akt der Unfreiheit, jene durch den Verwirklicher selbst ein solcher der Freiheit. Die Gesetze seines Handelns erkennen, heißt, sich seiner Freiheit bewußt sein. Der Erkenntnisprozeß ist, nach unseren Ausführungen, der Entwickelungsprozeß zur Freiheit.
Wie wenig Verständnis für die ethischen Anschauungen Goethes sowohl wie für eine Ethik der Freiheit und des Individualismus im allgemeinen in der Gegenwart vorhanden ist, zeigt folgender Umstand. Ich habe im Jahre 1892 in einem Aufsatz der «Zukunft» (Nr.5) mich für eine antiteleologische monistische Auffassung der Moral ausgesprochen. Auf diesen Aufsatz hat Herr Ferdinand Tönnies in Kiel in einer Broschüre «Ethische Kultur und ihr Geleite. Nietzsche-Narren in Zukunft und Gegenwart» (Berlin 1893) geantwortet. Er hat nichts vorgebracht als die Hauptsätze der in philosophische Formeln gebrachten Philistermoral. Von mir aber sagt er, daß ich «auf dem Wege zum Hades keinen schlimmeren Hermes» hätte finden können als Friedrich Nietzsche. Wahruaft komisch wirkt es auf mich, daß Herr Tönnies, um mich zu verurteilen, einige von Goethes «Sprüchen in Prosa» vorbringt. Er ahnt nicht, daß, wenn es für mich einen Hermes gegeben hat, es nicht Nietasche, sondern Goethe war. Ich habe die Beziehungen der Ethik der Freiheit zur Ethik Goethes bereits in der Einleitung zum 34. Bande meiner Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Werken dargelegt. Ich hätte die wertlose Broschüre Tönnies' nicht erwähnt, wenn sie nicht symptomatisch wäre für das in manchen Kreisen herrschende Mißverständnis der Weltanschauung Goethes.
Nicht alles menschliche Handeln trägt diesen freien Charakter. In vielen Fällen besitzen wir die Gesetze für unser Handeln nicht als Wissen. Dieser Teil unseres Handelns ist der unfreie Teil
unseres Wirkens. Ihm gegenüber steht derjenige, wo wir uns in diese Gesetze vollkommen einleben. Das ist das freie Gebiet. Sofern unser Leben ihm angehört, ist es allein als sittliches zu bezeichnen. Die Verwandiung des ersten Gebietes in ein solches mit dem Charakter des zweiten ist die Aufgabe jeder individuellen Entwickelung, wie auch jener der ganzen Menschheit.
Das wichtigste Problem alles menschlichen Denkens ist das: den Menschen als auf sich selbst gegründete, freie Persönlichkeit zu begreifen.
*
Goethes Anschauungen entspricht die grundsätzliche Trennung von Natur und Geist nicht; er will in der Welt nur ein großes Ganzes erblicken, eine einheitliche Entwickelungskette von Wesen, innerhalb welcher der Mensch ein Glied, wenn auch das höchste, bildet. «Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen -unvermögend, aus ihr herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewamt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen.» Damit vergleiche man den schon erwahnten Ausspruch: «Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt: dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern.» Hierin liegt das echt Goethesche weite Hinausgehen über die unmittelbare Natur, ohne sich auch nur im geringsten von dem zu entfernen, was das Wesen der Natur ausmacht. Fremd ist ihm, was er selbst bei vielen besonders begabten Menschen findet: «Die Eigenheit, eine Art von Scheu vor dem wirklichen Leben zu empfinden, sich in sich selbst zurückzuziehen, in sich selbst eine eigene Welt zu erschaffen und auf diese Weise das Vortrefflichste nach innen bezüglich zu leisten.» (Winckelmann: Eintritt.) Goethe flieht die Wirklichkeit nicht, um sich eine abstrakte Gedankenwelt zu schaffen, die nichts
mit jener gemein hat; nein, er vertieft sich in dieselbe, um in ihrem ewigen Wandel, in ihrem Werden und Bewegen, ihre unwandelbaren Gesetze zu finden, er stellt sich dem Individuum gegenüber, um in ihm das Urbild zu erschauen. So erstand in seinem Geiste die Urpflanze, so das Urtiem, die ja nichts anderes sind als die Ideen des Tieres und der Pflanze. Das sind keine leeren Allgemeinheitsbegriffe, die einer grauen Theorie angehören, das sind die wesentlichen Grundlagen der Organismen mit einem reichen, konkreten Inhalt, lebensvoll und anschaulich. Anschaulich für jenes höhere Anschauungsvermögen, das Goethe in dem Aufsatze über «Anschauende Urteilskraft» bespricht. Die Ideen im Goetheschen Sinne sind ebenso objektiv wie die Farben und Gestalten dem Dinge, aber sie sind nur für den wahrnehmbar, dessen Fassungsvermögen dazu eingerichtet ist, so wie Farben und Formen nur für den Sehenden und nicht für den Blinden da sind. Wenn wir dem Objektiven eben nicht mit einem empfänglichen Geiste entgegenkommen, enthüllt es sich nicht vom uns. Ohne das instinktive Vermögen, Ideen wahrzunehmen, bleiben uns diese lmmer ein verschlossenes Feld. Tiefer als jeder andere hat hier Schiller in das Gefüge des Goetheschen Genius geschaut.
Am 23. August 1794 klärt er Goethe über das Wesen, das seinem Geiste zugrunde liegt, mit folgenden Worten auf: «Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen; in der AlIheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgt'ind für das Individuum auf. Von der einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu der mehr verwikkelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Natumgebäudes zu erbauen. Dadurch, daß Sie ihn der Natur gleichsam nacherschaffen, suchen Sie in seine vemborgene Technik einzudringen.> In diesem Nacherschaffen liegt ein Schlüssel zum Verständnis der Weltanschauung Goethes. Wollen wir wirklich zu dem Gesetz-mäßigen im ewigen Wechsel aufsteigen, dann dürfen wir nicht das fertig Gewordene betrachten, wir müssen die Natur im Schaffen belauschen. Das ist der Sinn der Goetheschen Worte in dem Aufsatz «Anschauende Urteilskraft»: «Wenn wir ja im Sittlichen
durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen, so dürfte es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch ... auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen.» Die Goetheschen Urbilder sind also nicht leere Schemen, sondern sie sind die treibenden Kräfte der Erscheinungen.
Das ist die in der Natur, der sich Goethe bemächtigen will. Wir sehen daraus, daß in keinem Falle die Wirklichkeit, wie sie vor unseren Sinnen ausgebreitet daliegt, etwas ist, bei dem der auf höherer Kulturstufe angelangte Mensch stehenbleiben kann. Nur indem der Menschengeist diese Wirklichkeit denkend durchdringt, wird ihm offenbar, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Nimmermehr können wir am einzelnen Naturgeschehen, nur am Naturgesetze, nimmermehr am einzelnen Individuum, nur an der Allgemeinheit Befriedigung finden. Bei Goethe kommt diese Tatsache in der denkbar vollkommensten Form vor. Was auch bei ihm stehenbleibt, ist die Tatsache, daß für den modernen Geist die Wirklichkeit, die bloße Erfahrung durch das Denken zur Versöhnung mit den Bedürfnissen des erkennenden Menschengeistes kommt.
*
Mit Goethes Stellung zur Natur hängt seine Religion auf das Innigste zusammen. Man möchte sagen, seine Naturbegriffe waren so hohe, daß sie ihn durch sich selbst in religiöse Stimmung versetzten. Er kennt das Bedürfnis nicht: die Dinge unter Abstreifung eines jeglichen Heiligen zu sich herabzuziehen, das so viele haben. Er hat aber dem Wirklichen, Diesseitigen gegenüber das Bedürfnis, in ihm ein Verehrungswürdiges zu suchen, demgegenüber er in religiöse Stimmung gerät. Den Dingen selbst sucht er eine Seite abzugewinnen, wodurch sie ihm heilig werden. Karl Julius Schröer hat in Goethes Verhalten in der Liebe diese ans Religiöse grenzende Stimmung gezeigt (vgl. dessen geistvolle
Schrift , Heilbronn 1884). Alles Frivole, Leichtfertige wird abgestreift, und die Liebe wird für Goethe ein Frommsein. Dieser Grundzug seines Wesens ist am schönsten in seinen Worten ausgesprochen:
Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wir heißen's: fromm sein! »
Diese Seite seiner Natur ist nun unzertrennlich mit einer andern in Verbindung. Er sucht an dieses Höhere nie unmittelbar heranzutreten; er sucht sich ihm immer durch die Natur zu nähern. (Dichtung und Wahrheit, I. Teil, 1. Buch), einen Altar errichtet, so entspringt dieser Kuftus schon entschieden aus dem Glauben, daß wir das Höchste, zu dem wir gelangen können, durch treues Pflegen des Verkehrs mit der Natur gewinnen. So ist denn Goethe die Betrachtungsweise angeboren, die wir erkenntnistheoretisch gerechtfertigt haben. Er tritt an die Wirklichkeit heran in der Überzeugung, daß alles nur eine Manifestation der Idee ist, die wir erst gewinnen, wenn wir die Sinneserfahrung in geistiges Anschauen der ewigen, ursachlichen Notwendigkeit hinaufheben. Diese Überzeugung lag in ihm; und er betrachtete von Jugend auf die Welt auf Grund dieser Voraussetzung. Kein Philosoph konnte ihm diese Überzeugung geben. Nicht das ist es also, was Goethe bei den Philosophen suchte. Es war etwas anderes. Wenn seine Weise, die Dinge zu betrachten, auch tief in seinem Wesen lag,
so brauchte er doch eine Sprache, sie auszudrücken. Sein Wesen wirkte philosophisch, das heißt so, daß es sich nur in philosophischen Formeln aussprechen, nur von philosophischen Voraussetzungen aus rechtfertigen läßt. Um nun das, was er war, auch sich deutlich zum Bewußtsein zu bringen, um das, was bei ihm lebendiges Tun war, auch zu wissen, sah er sich bei den Philosophen um. Er suchte bei ihnen eine Erklärung und Rechtfertigung seines Wesens. Das ist sein Verhältnis zu den Philosophen. Zu diesem Zwecke studierte er in der Jugend Spinoza und ließ sich später mit den philosophischen Zeitgenossen in wissenschaftliche Verhandlungen ein. Schon in seinen Jünglingsjahren schienen dem Dichter am meisten Spinoza und Giordano Bruno sein eigenes Wesen auszusprechen. Es ist merkwürdig, daß er beide Denker zuerst aus gegnerischen Schriften kennenlernte und trotz dieses Umstandes erkannte, wie ihre Lehren zu seiner Natur stehen. Besonders an seinem Verhältnis zu Giordano Brunos Lehren sehen wir das Gesagte erhärtet. Er lernt ihn aus Bayles Wörterbuch, wo Bruno heftig angegriffen wird, kennen. Und er erhält von ihm einen so tiefen Eindruck, daß wir in jenen Teilen des «Faust», die der Konzeption nach aus der Zeit um 1770 stammen, wo er Bayle las, sprachliche Anklänge an Sätze von Bruno finden (s. GoetheJahrbuch, VII. Band, 1886). In den «Tag- und Jahresheften» erzählt der Dichter, daß er sich wieder 1812 mit Giordano Bruno beschäftigt habe. Auch diesmal ist der Eindruck ein gewaltiger, und in vielen der nach diesem Jahre entstandenen Gedichte erkennen wir Anklänge an den Philosophen von Nola. Das alles ist aber nicht so zu nehmen, als ob Goethe von Bruno irgend etwas entlehnt oder gelernt hätte, er fand bei ihm nur die Formel, das, was längst in seiner Natur lag, auszusprechen. Er fand, daß er sein eigenes Innere am klarsten darlege, wenn er es mit den Worten dieses Denkers tat. Bruno betrachtet die universelle Weltseele als die Erzeugerin und Lenkerin des Weltalls. Er nennt sie den innern Künstler, der die Materie formt und von innen heraus gestaltet. Sie ist die Ursache von allem Bestehenden; und es gibt kein Wesen, an dessen Sein sie nicht liebevoll Anteil nähme. «Das Ding sei noch so klein und winzig, es hat in sich einen Teil von
geistiger Substanz» (s. Giordano Bruno, «Von der Ursache etc.», herausgegeben von Adolf Lasson, Heidelberg 1882). Das war ja auch Goethes Ansicht, daß wir ein Ding erst zu beurteilen wissen, wenn wir sehen, wie es von der ewigen Harmonie der Naturgesetze - und nichts anderes als diese ist ihm die Weltseele - an seinen Ort gestellt worden, wie es gerade zu dem geworden ist, als was es uns gegenübertritt. Wenn wir mit den Sinnen wahrnehmen, so genügt das nicht; denn die Sinne sagen uns nicht, wie ein Ding mit der allgemeinen Weltidee zusammenhängt, was es für das große Ganze zu bedeuten hat. Da müssen wir so schauen, daß uns unsere Vernunft einen ideellen Untergrund schafft, auf dem uns dann das erscheint, was uns die Sinne überliefern; wir müssen, wie es Goethe ausdrückt, mit den Augen des Geistes schauen. Auch um diese Überzeugung auszusprechen, fand er bei Bruno eine Formel: «Denn wie wir nicht mit einem und demselben Sinn Farben und Töne erkennen, so sehen wir auch nicht mit einem und demselben Auge das Substrat der Künste und das Substrat der Natur», weil wir «mit den sinnlichen Augen jenes und mit dem Auge der Vernunft dieses sehen» (s. Lassen, S. 77). Und mit Spinoza ist es nicht anders. Spinozas Lehre beruht ja darauf, daß die Gottheit in der Welt aufgegangen ist. Das menschliche Wissen kann also nur bezwecken, sich in die Welt zu vertiefen, um Gott zu erkennen. Jeder andere Weg, zu Gott zu gelangen, muß für einen konsequent im Sinne des Spinozismus denkenden Menschen unmöglich erscheinen.
Der Gedanke eines Gottes, der außerhalb der Welt ein abgesondertes Dasein führt und seine Schöpfung nach äußerlich auf-gedrängten Gesetzen lenkte, war ihm fremd. Sein ganzes Leben hindurch beherrschte ihn der Gedanke:
«Was wär' ein Gott, der nur von außen stieße,
Im Kreis das All am Finger laufen ließe?
Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
So daß, was in ihm lebt und webt und ist,
Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.»
Was mußte Goethe, dieser Gesinnung gemäß, in der Wissen-schaft der organischen Natur suchen? Erstens ein Gesetz, welches erklärt, was die Pflanze zur Pflanze, das Tier zum Tiere macht, zweitens ein anderes, das begreiflich macht, warum das Gemeinsame, allen Pflanzen und Tieren zugrunde Liegende, in einer solchen Mannigfaltigkeit von Formen erscheint. Das Grundwesen, das sich in jeder Pflanze ausspricht, die Tierheit, die in allen Tieren zu finden ist, die suchte er zunächst. Die künstlichen &heidewände zwischen den einzelnen Gattungen und Arten mußten niedergerissen, es mußte gezeigt werden, daß alle Pflanzen nur Modifikationen einer Urpflanze, alle Tiere eines Urtieres sind.
Ernst Haeckel, der den Darwinschen Ideen über die Entstehung der Organismen eine der deutschen Gründlichkeit angemessene Vervollkommnung hat angedeihen lassen, legt den größten Wert darauf, daß der Einklang seiner Grundüberzeugungen mit den Goetheschen erkannt werde. Auch bei Haeckel wird die Natur-anschauung zur Grundlage der Religion. Die Naturerkenntnis teilt sich dem Gefühl mit und lebt sich als religiöse Stimmung aus. Für Haeckel ist die Frage Darwins nach dem Ursprunge der organischen Formen sogleich zu der höchsten Aufgabe geworden, die sich die Wissenschaft vom organischen Leben überhaupt stellen kann, zu der vom Ursprunge des Menschen. Und er ist genötigt gewesen, an Stelle der toten Materie der Physiker solche Natur-prinzipien anzunehmen, mit denen man vor dem Menschen nicht haltzumachen braucht. Haeckel hat in seiner Schrift: «Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft», und in seinen «Welträtseln», die vor kurzem erschienen sind und welche nach meiner Überzeugung die bedeutsamste Kundgebung der neuesten Naturphilosophie sind, ausdrücklich betont, daß er sich einen «immateriellen lebendigen Geist» ebensowenig denken könne wie eine
*
Es gehört zu den interessantesten Tatsachen der deutschen Geistesgeschichte, wie Schiller unter dem Einflusse Goethes aus dessen Weltanschauung eine Ethik formt. Diese Ethik entspringt aus einer künstlerisch-freiheitlichen Auffassung der Natur. Aber diese Briefe werden vielfach von den systematisierenden Philosophen nicht für genug wissenschaftlich genommen, und doch gehören sie zu dem Bedeutendsten, was die Ästhetik und Ethik überhaupt hervorgebracht haben. Schiller geht von Kant aus. Dieser Philosoph hat die Natur des Schönen in mehrfacher Hinsicht bestimmt. Zuerst untersucht er den Grund des Vergnügens, das wir an den schönen Werken der Kunst empfinden. Diese Lustempfindung findet er ganz verschieden von jeder anderen. Vergleichen wir sie mit der Lust, die wir empfinden, wenn wir es mit einem Gegenstande zu tun haben, dem wir etwas uns Nutzenbringendes verdanken. Diese Lust ist eine ganz andere. Sie hängt innig mit dem Begehren nach dem Dasein dieses Gegenstandes zusammen. Die Lust am Nützlichen verschwindet, wenn das Nützliche selbst nicht mehr ist. Das ist bei der Lust, die wir dem Schönen gegenüber empfinden, anders. Diese Lust hat mit dem Besitze, mit der Existenz des Gegenstandes nichts zu tun. Sie haftet demnach gar nicht am Objekte, sondern nur an der Vorstellung von demselben. Während beim Zweckmäßigen, Nützlichen sogleich das Bedürfnis entsteht, die Vorstellung in Realität umzusetzen, sind wir beim Schönen mit dem bloßen Bilde zufrieden. Deshalb nennt Kant das Wohlgefallen am Schönen ein von jedem realen Interesse unbeeinflußtes, ein «interesseloses Wohlgefallen». Es wäre aber die Ansicht ganz falsch, daß damit von dem Schönen die Zweckmäßigkeit ausgeschlossen sei. Das geschieht nur mit dem äußeren Zwecke. Und daraus fließt die zweite Erklärung des Schönen: «Es ist ein in sich zweckmäßig Geformtes, aber ohne einem äußeren Zwecke zu dienen.» Nehmen wir ein anderes Ding der Natur oder ein Produkt der menschlichen Technik wahr, dann kommt unser Verstand und fragt nach Nutzen und Zweck. Und er ist nicht eher befriedigt, bis seine Frage nach dem Wozu beantwortet ist. Beim Schönen liegt das Wozu in dem Dinge selbst; und der Verstand braucht nicht über dasselbe hinauszugehen. Hier setzt
nun Schiller an. Und er tut dies, indem er die Idee der Freiheit in die Gedankenreihe hineinverweht, in einer Weise, die der Menschennatur die höchste Ehre macht. Zunächst stellt Schiller zwei unablässig sich geltend machende Triebe des Menschen einander gegenüber. Der erste ist der sogenannte Stofftrieb oder das Bedürfnis, unsere Sinne der einströmenden Außenwelt offenzuhalten. Da dringt ein reicher Inhalt auf uns ein, aber ohne daß wir selbst auf seine Natur einen bestimmenden Einfluß nehmen könnten. Mit unbedingter Notwendigkeit geschieht hier alles. Was wir wahrnehmen, wird von außen bestimmt; wir sind hier unfrei, unterworfen, wir müssen einfach dem Gebote der Naturnotwendigkeit gehorchen. Der zweite ist der Formtrieb. Das ist nichts anderes als die Vernunft, die in das wirre Chaos des Wahrnehmungsinhaltes Ordnung und Gesetz bringt. Durch ihre Arbeit kommt System in die Erfahrung. Aber auch hier sind wir nicht frei, findet Schiller. Denn bei dieser ihrer Arbeit ist die Vernunft den unabänderlichen Gesetzen der Logik unterworfen. Wie dort unter der Macht der Naturnotwendigkeit, so stehen wir hier unter derjenigen der Vernunftnotwendigkeit. Gegenüber beiden sucht die Freiheit eine Zufluchtstätte. Schiller weist ihr das Gebiet der Kunst an, indem er die Analogie der Kunst mit dem Spiel des Kindes hervorhebt. Worin liegt das Wesen des Spieles? Es werden Dinge der Wirklichkeit genommen und in ihren Verhältnissen in beliebiger Weise verändert. Dabei ist bei dieser Umformung der Realität nicht ein Gesetz der logischen Notwendigkeit maßgebend, wie wenn wir zum Beispiel eine Maschine bauen, wo wir uns strenge den Gesetzen der Vernunft unterwerfen müssen, sondern es wird einzig und allein einem subjektiven Bedürfnis gedient. Der Spielende bringt die Dinge in einen Zusammenhang, der ihm Freude macht, er legt sich keinerlei Zwang auf. Die Naturnotwendigkeit achtet er nicht, denn er überwindet ihren Zwang, indem er die ihm überlieferten Dinge ganz nach Willkür verwendet; aber auch von der Vernunftnotwendigkeit fühlt er sich nicht abhängig, denn die Ordnung, die er in die Dinge bringt, ist seine Erfindung. So prägt der Spielende der Wirklichkeit seine Subjektivität ein; und dieser letzteren hinwiederum verleiht er
objektive Geltung. Das gesonderte Wirken der beiden Triebe hat aufgehört; sie sind in Eins zusammengeflossen und damit frei geworden: das Natürliche ist ein Geistiges, das Geistige ein Natürliches. Schiller nun, der Dichter der Freiheit, sieht so in der Kunst nur ein freies Spiel des Menschen auf höherer Stufe und ruft begeistert aus: «Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, ... und er spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist.» Den der Kunst zugrunde liegenden Trieb nennt Schiller den Spieltrieb. Dieser erzeugt im Künstler Werke, die schon in ihrem sinnlichen Dasein unsere Vernunft befriedigen und deren Vernunftinhalt zugleich als sinnliches Dasein gegenwärtig ist. Und das Wesen des Menschen wirkt auf dieser Stufe so, daß seine Natur zugleich geistig und sein Geist zugleich natürlich wirkt. Die Natur wird zum Geist erhoben, der Geist versenkt sich in die Natur. Jene wird dadurch geadelt, dieser aus seiner unanschaulichen Höhe in die sichtbare Welt gerückt.
*
In Schillers «Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen» - in diesem Evangelium der von den Schranken sowohl des Naturzwanges wie der logischen Vernunftnotwendigkeit befreiten Menschlichkeit - lesen wir die ethische und religiöse Physiognomie Goethes. Man darf diese Briefe als die aus allseitiger persönlicher Beobachtung geschöpfte Goethe-Psychologie bezeichnen. «Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt.> So schreibt Schiller an Goethe am 23. August 1794. Wodurch Goethe zur Harmonie seiner Geisteskräfte gelangt ist, das konnte Schiller am besten beobachten. Unter dem Eindruck dieser Beobachtangen entstehen die genannten Briefe. Wir dürfen sagen, daß Goethe zu dem «ganzen Menschen, der spielend die Vollkommenheit erreicht», Modell gesessen hat. Nun schreibt Schiller in dem Briefe, der die angeführten Worte enthält: «Wären Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren worden, und hätte schon von der
Wiege an eine auserlesene Natur und eine idealisierende Kunst Sie umgeben, so wäre Ihr Weg unendlich verkürzt, vielleicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in die erste Anschauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Notwendigen aufgenommen, und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Stil in Ihnen entwickelt. Nun, da Sie ein Deutscher geboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl, als entweder selbst zum nordischen Künstler zu werden oder Ihrer Imagination das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhilfe der Denkkraft zu ersetzen, um so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären.» Da von Goethe solches gilt, begreift man es, daß er die innigste Befriedigung seines Wesens empfand, als er vor den griechischen Kunstwerken, auf seiner italienischen Reise, sich sagen konnte, er fühle, daß die Griechen bei Produktion ihrer Kunstwerke nach denselben Gesetzen verfuhren, nach denen die Natur selbst verfährt und denen er auf der Spur ist. Und daß er in diesen Kunstwerken das findet, was er die «höhere Natur» in der Natur nannte. Er sagt sich diesen Geschöpfen menschlichen Geistes gegenüber: «Da ist die Notwendigkeit, da ist Gott.»
Naturdienst ist Goethes Gottesdienst. Er kann Gottes Spuren nirgends anders finden als da, wo Natur im Schaffen waltet. Er vermag daher auch über sein Verhältnis zum Christentum nicht anders zu sprechen, als indem er seine in der Naturanschauung aufgehende Denkweise scharf mitbetont. «Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, Christo anbetende Ehrfurcht zu erweisen, so sage ich: Durchaus! Ich beuge mich vor ihm, als der göttlichen Offenbarung des höchsten Prinzips der Sittlichkeit. Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, die Sonne zu verehren, so sage ich abermals: Durchaus! Denn sie ist gleichfalls eine Offenbarung des Höchsten, und zwar die mächtigste, die uns Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in ihr das Licht und die zeugende Kraft Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind, und alle Pflanzen und Tiere mit uns. Fragt man mich aber, ob ich geneigt sei, mich vor einem Daumenknochen des Apostels Petri
oder Pauli zu bücken, so sage ich: Verschont mich und bleibt mir mit euren Absurditäten vom Leibe.»
Über Goethes Stellung zum Christentum ist schon alles mögliche gesagt worden. Von der Behauptung des Kirchenhistorikers Nippold, der von ihm meint, er habe entschieden die «christliche Gottesidee» gewahrt, bis zu derjenigen des Jesuitenpaters Alexander Baumgartner, der von Goethes «frech antichristlichem Geist» spricht, ist ein weiter Weg. Es wird kaum eine Station auf diesem Wege geben, auf der sich nicht irgendein Betrachter von Goethes religiösen Anschauungen niedergelassen hat. Und Aussprüche Goethes, durch die sich die eine oder die andere Behauptung stützen läßt, werden den Herren immer zur Verfügung stehen. Aber man sollte, wenn man solche Aussprüche Goethes anzieht, immer das eine bedenken, was Goethe von sich gesagt hat. «Ich für mich kann, bei den mannigfaltigen Richtungen meines Wesens, nicht an einer Denkweise genug haben; als Dichter und Künstler bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Natur-forscher, und eins so entschieden als das andre. Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit, als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt.» Kann man sich, da Goethe solches selbst gesagt hat, noch wundern, wenn uns von der einen Seite gesagt wird: Goethe sei Bekenner eines persönlichen Gottes? Ein Goethe-Interpret braucht nur den folgenden Ausspruch Goethes zu zitieren, und er hat Goethe den Gläubigen der Persönlichkeit Gottes konstruiert: «Nun gewann Blumenbach das Höchste und Letzte des Ausdrucks, er anthropomorphosierte das Wort des Rätsels und nannte das, wovon die Rede war, einen nisus formativus, einen Trieb, eine heftige Tätigkeit, wodurch die Bildung - der Lebewesen - bewirkt werden sollte ... Dieses Ungeheure personifiziert tritt uns als ein Gott entgegen, als Schöpfer und Erhalter, welchen anzubeten, zu verehren und zu preisen wir auf alle Weise aufgefordert sind.»
Gefielen mir Taschenspielerkunststücke des Geistes, so würde ich nacheinander die Beweise erbringen können, daß Goethe Polytheist, Theist, Atheist, Christ und - was weiß ich - noch alles gewesen ist. Doch mir scheint: es kommt nicht darauf an, Goethe
nach einem einzelnen Ausspruche zu interpretieren, sondern nach dem ganzen Geist seiner Weltanschauung. Mit diesem Geiste hat er sein ganzes Gefühlsleben durchdrungen; in diesem Geiste ist er verfahren, als er die Gesetze der Natur zu erforschen trachtete und auf diesem Gebiete zu wichtigen Entdeckungen gekommen ist; aus diesem Geiste heraus hat er sein ganzes Verhalten gegenüber der Kunst eingerichtet. In der Kunst hat er eine «Manifestation geheimer Naturgesetze» gesehen; und die Natur war ihm die Offenbarung des einzigen Gottes, den er suchte. In diesem Sinne ist ein Wort aufzufassen, wie dieses: «Dies ist ein schönes, löbliches Wort; aber Gott anerkennen, wo und wie er sich offenbare, das ist eigentlich die Seligkeit auf Erden» (Sprüche in Prosa). Und bedeutsam ist auch dies: «Das Wahre, mit dem Göttlichen identisch, läßt sich niemals von uns direkt erkennen, wir schauen es nur im Abglanz, im Beispiel, Symbol, in einzelnen und verwandten Erscheinungen; wir werden es gewahr als unbegreifliches Leben und können dem Wunsch nicht entsagen, es dennoch zu begreifen.» Aber Goethe gehörte nicht zu denen, die in dem Wahren, dem Göttlichen das Große, jenseitige Unbekannte sehen. Er nennt das Wesen der Dinge nicht deshalb unbegreiflich, weil die menschliche Erkenntnis nicht bis zu diesem Wesen hinanreicht, sondern weil es im Grunde absurd ist, von einem Wesen an sich zu sprechen. «Eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten.» Man spricht wohl ganz in Goethes Sinn, wenn man hinzufügt: Vergebens bemühen wir uns, das Wesen Gottes zu schildern; man stelle dagegen die Erscheinungen der Natur und ihre Gesetze zusammen, und ein Bild Gottes wird uns entgegentreten.
Von diesen Gesichtspunkten aus habe ich in meinem Buche «Goethes Weltanschauung» dessen Vorstellungsart geschildert. Ich habe die Ausgangspunkte, die eine solche Betrachtung zu nehmen
hat, mit den Worten bezeichnet: «Will man Goethes Weltanschauung verstehen, so darf man sich nicht damit begnügen, hinzuhorchen, was er selbst in einzelnen Aussprüchen über sie sagt. In kristallklaren Sätzen den Kern seines Wesens auszusprechen, lag nicht in seiner Natur ... Er ist immer ängstlich, wenn es sich darum handelt, zwischen zwei Ansichten zu entscheiden. Er will sich die Unbefangenheit nicht dadurch rauben, daß er seinen Gedanken eine scharfe Richtung gibt... Wenn man dennoch die Einheit seiner Anschauungen überschauen will, so muß man weniger auf seine Worte hören als auf seine Lebensführung sehen. Man muß sein Verhältnis zu den Dingen belauschen, wenn er ihrem Wesen nachforscht, und dabei das ergänzen, was er selbst nicht sagt. Man muß auf das Innerste seiner Persönlichkeit eingehen, das sich zum größten Teile hinter seinen Äußerungen verbirgt. Was er sagt, mag sich oft widersprechen; was er lebt, gehört immer einem widerspruchslosen Ganzen an.»
Wenn man sich in Goethes Persönlichkeit vertieft, dann kann man erst seine Aussprüche in dem rechten Sinne bewerten. Am notwendigsten wird solches, wenn von seinem Verhältnis zum Christentum die Rede ist. Da, wo ihm das Christentum mit allen seinen Schattenseiten entgegentritt, wie zum Beispiel in der Person Lavaters, da spricht er sich unverhohlen aus. Er schreibt an diesen (9. August 1782): «Du hältst das Evangelium, wie es steht, für die göttlichste Wahrheit; mich würde eine vernehmliche Stimme vom Himmel nicht überzeugen, daß das Wasser brennt und das Feuer löscht, daß ein Weib ohne Mann gebiert und daß ein Toter aufersteht; vielmehr halte ich dieses für Lästerungen gegen den großen Gott und seine Offenbarung in der Natur ... In meinem Glauben ist es mir so heftig Ernst, wie dir in dem deinen.» Und wenn er sich für das Christentum ausspricht, dann deutet er dieses in seinem Sinne um. Nichts ist für diese seine Art umzudeuten bezeichnender als der Satz, in dem er den als Atheisten verschrienen Spinoza zum Christen macht. «Spinoza beweist nicht das Dasein Gottes, das Dasein ist Gott. Und wenn ihn andere deshalb Atheum schelten, so möchte ich ihn theissimum, ja christianissimum nennen und preisen.» Man darf dabei nur nicht vergessen,
daß er sich selbst «wohl keinen Widerchristen oder Un-christen, aber einen entschiedenen Nichtchristen» nennt
Und wenn er sich vor sich selbst in entschiedener Weise die volle Wahrheit vergegenwärtigen will, dann tut er es mit solchen Distichen, wie sie sich in dem Tagebuch von der schlesischen Reise (1790) finden, die es sind, welche dem Jesuitenpater Baumganner solches Entsetzen vor dem «frechen antichristlichen Geist» einjagten:
«Zum Erdulden ist's gut, ein Christ zu sein, nicht zu wanken:
Und so machte sich auch diese Lehre zuerst.»
«Was vom Christentum gilt, gilt von den Stoikern, freien
Menschen geziemet es nicht, Christ oder Stoiker sein.»
Eine scharfe Illustration erhalten diese Verse, wenn man sie zusammenstellt mit den religiösen Empfindungen, die Goethe in sich selbst fand:
«Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen,
Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare,»
oder:
«Im Innern ist ein Universum auch,
Daher der Völker löblicher Gebrauch,
Daß jeglicher das Beste, was er kennt,
Er Gott, ja seinen Gott benennt,
Ihm Himmel und Erden übergibt,
Ihn fürchtet und womöglich liebt.»
II
GOETHES RECHT IN DER NATURWISSENSCHAFT
Eine Rettung
«Goethe hat im geistigen Leben Deutschlands gewirkt wie eine gewaltige Naturerscheinung im Physischen gewirkt hätte.»
«... Der Vergleich läßt sich ziehen, daß Goethe auf die geistige Atmosphäre Deutschlands gewirkt habe etwa wie ein tellurisches Ereignis, das unsere klimatische Wärme um soundsoviel Grade erhöhte. Geschähe dergleichen, so würde eine andere Vegetation, ein anderer Betrieb der Landwirtschaft und damit eine neue Grundlage unserer gesamten Existenz eintreten.»
«Goethe hat unsere Sprache und Literatur geschaffen.»
Diese Sätze Herman Grimms (siehe dessen «Goethe-Vorlesungen») drücken dasjenige aus, was in bezug auf Goethe mit jedem Tag mehr die Überzeugung der gebildeten Welt wird. Goethe hat unserer Epoche ihr Gepräge aufgedrückt. Dasjenige, was sie von anderen Epochen in der geistigen Entwickelung der Menschheit unterscheidet, ist zum weitaus größten Teile auf Goethe zurückzuführen.
In diesem Bilde hingebungsvollster Verehrung des großen Genius sehen wir aber noch immer einen dunklen Punkt, der mit der übrigen Helle desselben in störender Disharmonie steht. Er betrifft die naturwissenschaftlichen Schriften Goethes.
Wohl ist man auch hier - den physikalischen Teil der Farbenlehre ausgenommen, der heute noch als ein ungeheurer Irrtum gilt - von der absoluten Zurückweisung abgekommen. Man ist heute vielfach der Ansicht, daß Goethes Naturanschauung auf Ideen ruhe, die auch die moderne Naturwissenschaft beherrschen. Vergleicht man aber die Anerkennung dieser Richtung Goetheschen Geistes mit der, die ihm auf anderen Gebieten gezollt wird, so findet man, daß sie auf einer ganz anderen Basis ruht. Unsere Dichtung, unsere ästhetische Weltanschauung, ja, unser Stil sind das, was sie heute sind, durch Goethe geworden. Er ist der Schöpfer
einer völlig neuen Zeitströmung; seine wissenschaftliche Richtung aber wird nur als Prophetie einer neuen Epoche angesehen, die letztere selbst ist durch andere geschaffen worden.
Der Grund dieser Tatsache wird darin gesucht, daß Goethe die Prinzipien gefehlt hatten, welche die moderne Naturanschauung zur wissenschaftlichen Überzeugung gemacht haben. Weil ihm diese Prinzipien fehlten, sind seine Leistungen ohne Einfluß auf die Gestaltung der neueren Wissenschaft geblieben. Diese wäre heute das, was sie ist, auch wenn Goethe ihr seine Tätigkeit niemals zugewendet hätte. Dasjenige, was in anderen Gebieten geistigen Lebens die Grundlage der Anerkennung ist, die Schaffung einer neuen Ära, wird auf dem Gebiete der Wissenschaft Goethe nicht zugestanden.
Unter diesen Voraussetzungen schwindet aber der Wert von Goethes wissenschaftlicher Tätigkeit in ein vollständiges Nichts zusammen. Denn, das muß man sich doch wohl gestehen, daß eine wissenschaftliche Anschauung nicht den geringsten Wert hat, wenn ihr die Prinzipien fehlen, auf denen sie als auf einer festen Grundlage ruhen könnte. Sie ist dann weiter nichts als eine Aneinanderreihung willkürlicher Annahmen, deren Macht, zu überzeugen, dahingestellt bleiben muß. Fehlen Goethes naturwissenschaftlichen Ansichten die Prinzipien, dann sind sie nicht zu halten, möge in ihnen noch so viel Zukunftvorahnendes liegen. Wissenschaft hat sich nicht auf zufällige Einfälle, sondern auf Grundsätze zu stützen.
Bevor man aber diese Annahme macht, sieht man sich zu der Frage gedrängt: Wie ist die in sich unvollendete wissenschaftliche Ansicht Goethes bei dem harmonischen Zusammenwirken aller seiner geistigen Kräfte möglich, in dem doch heute überall eine Vorbedingung seiner Sendung gesehen wird? Diese Frage ist eigentlich noch nie mit aller Schärfe gestellt und noch weniger der Versuch zu ihrer Beantwortung gemacht worden. Wer sie eingehend erwägt, gelangt zu einer Ansicht über die Goethesche naturwissenschaftliche Anschauung, die von der heute allgemein geltenden weit verschieden ist. In diesem Zusammenhange darf vielleicht hingewiesen werden auf die soeben erschienene Ausgabe
der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes* in Spemanns «Deutsche National-Literatur», in denen der Versuch gemacht wird, Goethe aus sich selbst heraus zu erklären und seine Rechte nachzuweisen. Professor Dr. K. J. Schröer hat in der Vorrede zu dieser Ausgabe die Bedeutung eines solchen Umschwunges in der Ansicht über Goethes wissenschaftliche Arbeiten für die Erkenntnis und Würdigung Goetheschen Wesens niedergelegt. Hier kann ich mich wohl nur in aller Kürze über einen Hauptgesichtspunkt aussprechen.
Wer von Wissenschaft nichts weiter verlangt, als daß sie eine möglichst treue Photographie der Wirklichkeit liefere, der wird allerdings über Goethes wissenschaftliche Methode nicht ins reine kommen können. Allein man muß bedenken, daß die unmittelbar gegebene Wirklichkeit Momente enthält, die den Forderungen eines vernünftigen Zusammenhanges der Dinge nicht genügen. Diese Momente lassen sich nicht auf Prinzipien zurückführen, sie entspringen aus der in der Wirklichkeit enthaltenen Zufälligkeit. Das ist auch der Grund, warum die Wirklichkeit unseren Geist so wenig befriedigt, warum ideale Naturen so oft mit ihr in Konflikt geraten. Goethe empfand das Unbefriedigende dieser Konflikte mehr als irgend jemand. Gar oft spricht er über den Zufall, der das zerstört, was sich aus einem Wesen mit innerer Notwendigkeit entwickelt. Die Wirklichkeit der Zufälligkeit ganz zu entkleiden und allein auf den ihr zugrunde liegenden vernünftigen Kern loszugehen, ist seine künstlerische, ist aber auch seine wissenschaftliche Sendung. «Das wirkliche Leben verliert oft dergestalt seinen Glanz, daß man es manchmal mit dem Firnis der Fiktion wieder auffrischen muß> (, II, 9. Buch), sagt Goethe und deutet dadurch seine poetische Sendung an.** Dabei geht er aber auch nie in der Dichtung über das dem Menschen Gegebene hinaus, so daß Merck zu ihm sagen konnte: «Dein Bestreben, deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen
- - -
* «Goethes naturwissenschaftliche Schriften», herausgegehen von Rudolf Steiner, mit einem Vorworte von K. J. Schröer.
* * K. J. Schröer: Ausgabe von Goethes Dramen, Band I, Spemanns ,«Deutsche National-Literatur».
eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichts wie dummes Zeug» (, IV, 18. Buch). Nichts liegt Goethe ferner als das willkürliche Erschaffen leerer Hirngespinste, die nicht in der Wirklichkeit wurzeln. Nur sucht er den allein für den Geist erreichbaren Kern dieser Wirklichkeit, das innere Wesen derselben, das wir voraussetzen müssen, wenn sie uns erklärlich sein soll.
Dieses Wesen zu fassen, dazu gehört Produktivität des Geistes. Es ist noch mehr hierzu nötig als die Beobachtung der Zufälligkeit einzelner Fälle. Die Gesetze gehören der Wirklichkeit an, aber wir können sie aus ihr nicht entlehnen, wir müssen sie an der Hand der Erfahrung schaffen. Allen Bahnbrechern auf dem Gebiete der engeren Wissenschaft war dieses schöpferische Vermögen des Geistes eigen. Die Erscheinungen der Pendelbewegung und des Falles waren erst begreiflich, als Galilei die Gesetze dieser Erscheinungen geschaffen hatte. Wie Galilei die Mechanik durch seine Gesetze begründet hat, so Goethe die Wissenschaft des Organischen. Das ist sein wahres Verhältnis zur Wissenschaft. Goethes Organik ist ebenso ein Reflex der Erscheinungen der organischen Welt, wie die theoretische Mechanik der Reflex der mechanischen Naturerscheinungen ist. Die organische Wissenschaft kann ins Unendliche neue Tatsachen entdecken, selbst ihre wissenschaftliche Grundlage erweitern, der Wendepunkt, an dem sie sich von einer unwissenschaftlichen zu einer wissenschaftlichen Methode erhoben hat, ist bei Goethe zu suchen.
Kein anderer als dieser Geist beherrscht aber auch das physikalische Kapitel, dem Goethes Bestrebungen zugewandt waren: die Farbenlehre. Nur von dieser Seite kommt man diesem merkwürdigen Werke näher. Der Kampf gegen Newton war nur im Anfang die Hauptsache für Goethe, war nur Ausgangspunkt, nicht Ziel seiner optischen Arbeiten. Das Ziel war kein anderes als das, die reiche Mannigfaltigkeit der Farbenwelt auf ein systematisches Ganzes zurückzuführen, so daß uns aus diesem Ganzen jedes Farben-phänomen ebenso verständlich wird, wie es irgendein Zusammenhang von Raumgrößen aus dem System der Mathematik wird. Der
Jahrhunderte überdauernde, wohlgegliederte, sich selbst tragende Bau der Mathematik stand Goethe bei dem Aufbau der Farbenlehre als Ideal vor Augen. Wenn man dieses hohe Ziel übersieht und den Streit mit Newton in den Vordergrund rückt, erweckt man von vornherein nur Mißverständnisse. Denn es gewinnt die Sache dann den Anschein, als ob Goethe gegen eine von Newton gefundene Tatsache gekämpft hätte, während doch sein Streben nichts anderes im Auge hatte, als eine sich selbst mißverstehende Methode, eine hypothetische Erklärung einer Tatsache zu korrigieren. Daß so betrachtet der in Rede stehende Gegensatz eine ganz andere Bedeutung gewinnt als die, die man ihm gewöhnlich beilegt, wurde wiederholt von geistvollen Denkern wie Joh. Müller, Karl Rosenkranz anerkannt. Newtons Behauptungen tragen eigentlich den Charakter des Aphoristischen an sich. Sie dehnen sich bloß über einen Teil der Farbenlehre, über die bei der Brechung des Lichtes entstehenden Farben aus. Sie modifizieren sich sogleich von selbst, wenn man sie in das System einfügt, das die Totalität der Farbenerscheinungen behandelt. Was hier schwer einzusehen ist, ist eigentlich nur, daß nicht Behauptung gegen Behauptung steht, sondern ein Ganzes gegen ein einzelnes Kapitel. In einer Harmonie hat man nicht bloß das Ganze aus seinen Teilen mechanisch zusammenzufügen, sondern es werden auch die Teile durch die Natur des Ganzen bestimmt.
Wer Goethes Naturanschauung nähertritt, findet, daß sie mit allen übrigen Zweigen seines Schaffens eines Ursprunges ist. Man kann sagen: bei seiner Geistesrichtung war nur diese Anschauung möglich, und hinwiederum: seine poetische Sendung setzte eine solche Naturanschauung voraus, wie er sie hatte. Die Prinzipien Goethescher Naturanschauung liegen da, wo die Grundlagen seiner Kunst liegen.
Nur wer diese Zusammenhänge verkennt, kann Goethes Naturlehre eine prinzipienlose nennen. Sie hat aber den Schlüssel zu ihrem Verständnis in Goethes Wesen und trägt die Garantie ihrer Wahrheit in sich selbst. Nicht durch später gefundene Gesetze, durch die in ihr selbst liegende Kraft muß es ihr gelingen, dem Wissenschafts-Bedürfnis der Menschheit zu genügen. Ob dies
wirklich einmal der Fall sein und ob es ihr doch einmal gegönnt sein wird, auf die Entwickelung des menschlichen Geistes einen fruchtbareren Einfluß auszuüben, als dies bisher der Fall war, bleibt natürlich der Zukunft anheimgestellt.
EIN FREIER BLICK IN DIE GEGENWART
Es war im Beginne dieses Jahrhunderts, als inmitten des deutschen Volkes ein mächtiges Geistessareben entstand und durch die Kraft des menschlichen Denkens in die tiefsten Geheimnisse des Weltenbaues einzudringen suchte. Es bildete sich eine ursprüngliche Wissenschaft heraus, die sich von jeder praktischen Betäti-gung emanzipierte und in den höchsten Sphären des Idealismus schwebend nur die Bedürfnisse des Geistes befriedigen wollte. Es war der tiefernste, von sittlichem Hochsinn durchtränkte deutsche Zug, der dieses Streben beseelte.
Wenn wir die deutsche Poesie aus jener Zeit ins Auge fassen, so müssen wir sagen, auch sie ist erfüllt von jenem Zaubersaft, der den deutschen Denkern aus dem Streben nach der innigsten Verbrüderung mit dem Weltgeiste erquoll. Das Forschen wie das künstlerische Schaffen, beide hatten in dieser Hinsicht einen religiösen Zug, weil sie die erste Grundbedingung der Religion erfüllten, den Menschen hinwegzuheben aus dem Alltäglichen und Gewöhniichen in eine höhere, rein geistige Region.
Es war ein Brechen mit alten Traditionen, aber es war ein Brechen anderer Art als das fast gleichzeitige der Französischen Revolution. Die Deutschen bäumten sich gegen das Althergebrachte, gegen die überlebten Formen der Religion, Kunst und Wissen-schaft auf, weil sich eine neue Welt in ihrem Innern erschloß, weil das Echte, die innere Wahrheit, den Schein verdrängte. Bei den Franzosen war es denn doch nichts anderes als der klügelnde Verstand, die Leerheit der Aufklärer, denen das Alte nicht genügte, und gerade deshalb schlägt die Liberalität der Franzosen so leicht in Frivolität um.
Diese Kulturhöhe, auf der die Deutschen einst standen, erscheint uns heute nur mehr als ein Gewesenes, wir Jüngern blicken mit Wehmut auf jene bessere Zeit zurück; scheint uns ja doch fast nichts anderes als die wenig tröstliche Aufgabe geblieben zu sein, die Totengräber und Denkmalsetzer jener großen Geister zu sein, die die gewaltige Epoche herbeiführten.
Was bringen wir zustande, was sich mit jenen Leistungen auch nur im entferntesten messen könnte? Die Kraft, Ursprüngliches zu schaffen, scheint längst dahingeschwunden zu sein und unsere ganze Kunst darin zu bestehen, Biographien unserer großen Ahnen und Kommentare ihrer Werke zu schaffen. Wo ist die deutsche Kraft, die einst Lessing, Schiller, Goethe, Fichte, Schelling, Hegel, Jean Paul zeugte?
Es könnte fast scheinen, als ob der mächtige gerinanische Riese inmitten Europas schliefe. Aber bei schärferem Zusehen weicht das düstere Bild einem noch immer höchst erfreulichen, und wir gewinnen die Überzeugung, daß wir doch auch an der Gegenwart durchaus nicht zu verzweifeln brauchen, sondern in vieler Hinsicht ihrer froh sein können.
Wenn wir das Geistesleben Europas ins Auge fassen, so gleicht es einem System von Fäden, die vielfach verschlungen sind, wir mögen aber welchen immer dieser Fäden verfolgen, so kommen wir doch aucb heute nach Deutschland als dem Kreuzungspunkte, in dem sich alle treffen. Das wissenschaftliche, künstlerische und wirtschaftlich-soziale Leben Europas ist ein Zusammenrang von Kräften, die sämtlich in Deutschland ihr Zentrum haben.
Wenn wir die Wahrheit dieses Satzes erweisen wollen, so brauchen wir uns bloß an zweierlei Interessen zu halten, das eine beherrscht das wissenschaftliche, das andere das wirtschaftlich-soziale Streben der Gegenwart.
Mit dem ersten Punkte meinen wir den Darwinismus, die naturwissenschaftliche Lehre, daß alle jetzt lebenden Tierformen nur Abkömmlinge einiger oder einer einzigen Grundform sind, die sich im I,aufe sehr langer Zeiträume vervollkommnet hat, und daß der Mensch nur die vollkommenste, entwickeltste Tierform ist, daß seine Ahnen nirgends anders zu suchen sind als da, wo auch die
der andern Säugetiere zu finden sind. Diese Lehre ist englischen Ursprungs. Aber so, wie sie aus dem Haupte des Engländers Darwin um die Mitte unseres Jahrhunderts hervorging, war sie eine verschwonunene, in sich unklare Ansicht; es waren weder die sittlichen Konsequenzen gezogen, noch war der notwendige allseitige wissenschaftliche Ausbau vorhanden. In der Mitte war eine Anzahl von Beobachtungen, Erfahrungen und zweifellosen Wahrheiten, Anfang und Ende war aber vollständig in Nebel gehüllt.
Da bemächtigten sich am Anfange der sechziger Jahre deutsche Gelehrte dieser Ansicht; wie ein Blitz schlug deutscher Tiefsinn, deutsche Gründlichkeit und tiefer sittlicher Ernst in das verworrene Gewebe ein. Das Ganze wurde bis in seine letzten Konsequenzen mit Einsetzung aller Kraft des Geistes durchgedacht und durchgeführt, und unter der Pflege deutscher Forscher entstand bald ein wissenschaftlicher Bau, festgefügt und begründet in allen seinen Teilen. Was der Engländer Darwin angedeutet, hat der Deutsche Haeckel in wunderbarer, monumentaler Weise vollendet. Was letzterer geschaffen, ist ein vollendetes Gebäude des Geistes, bis in alle Details mit bewunderungswertem Scharfsinn ausgeführt. In England hatte man ein geheimnisvolles Dokument der Natur gefunden, es war aber ein dichter Schleier darüber, da katn ein Deutscher und riß den Schleier hinweg, und jetzt erst wußte die Welt, was auf dem geheimnisvollen Schriftstück gestanden. Aber dabei blieb es nicht. Der sittliche Hochsinn der Deutschen mußte auch die notwendigen Konsequenzen der neuen Lehre in bezug auf die Moral und das öffentliche Leben erwägen. Und zahlreich sind die Schriften deutscher Forscher, die mit mehr eder weniger Glück entweder die Harmonie des Darwinismus mit einer reinen Moral oder die Gefährdung der letzteren durch den ersteren zeigen wollen. Man erinnerte sich hierbei auch an den Glanzpunkt der deutschen Kultur, an den deutschen Idealismus und an den größten Vertreter desselben: an Goethe. Man hatte das Bedürfnis, die Ideen dieses gtoßen Genius mit den neuen Lehren in Einklang zu bringen. Und es ist nicht gering anzuschlagen, daß der Deutsche so durchdrungen ist von jener idealen Welt, daß
ihm jede Disharmonie neuer Anschauungen mit dieser Welt pein-,ich ist. Das Streben der deutschen Gelehrten, die Resultate der modernen Weltanschauung mit dem Goetheanismus in Einklang zu bringen, ist die Reaktion des deutschen Gewissens auf die wissenschaftliche Mederichtung, der Wille des Deutschen, daß nur ideales im Leben Eingang finden darf, endlich der Glaube, daß der Idealismus wahr sein muß.
Eine spezifisch deutsche Erscheinung ist es, daß sich der Pessimismus in seiner tiefsten Gestalt als eine Folge des Darwinismus einstellt. Nicht gering ist die Zahl der innigen, durchaus guten und hochbegabten Seelen, die die neue Lehre zur Verzweiflung an Welt und Leben bringt. Man muß ein so tiefes Gemüt haben, wie es der Deutsche hat, man muß so ferne jeder Art von Frivolität und Leichtsinn sein, wie er, man muß sein Streben nach dem Göttlichen besitzen, und man wird bei vollem Durchdenken der Nichtigkeit des Menschen und seines Geschlechtes, wie sie folgt, wenn man den Darwinismus in seinem vollen Umfange gelten läßt, dem Pessimismus nicht leicht entkommen. Es erregt das eine Gedankenrelhe, die sich wohl noch lange fortsetzen ließe, indes, soviel haben wir gesehen: die gewaltigste Kraft, welche die wissenschaftliche Welt heute bewegt, weist uns nach Deutschland. Der Westen hat ein Problem aufgeworfen, Deutschland sucht es zu lösen. Und wenn einst Erlösung kommen sollte aus dem Banne der ungeheuren Einseitigkeit der modernen Weltansicht, sie kann nur aus Deutschland kommen. Die Kraft des deutschen Geistes wird es sein, die zeigen wird, was am Darwinismus wahr ist, und welche zugleich zeigen wird, daß er über ein gewisses Maß hinaus angewendet innerlich unwahr, flach und seicht ist; sie wird ihn überwinden, indem sie sein Machtgebiet beschränken, indem sie ihn verstehen wird.
Die zweite Erscheinung, auf die wir hinweisen wollen, ist das Streben der europäischen Völker, jene Form des Staates zu finden, in dem die sittliche Würde und die Freiheit jedes einzelnen Staatsbürgers am vollsten zur Geltung kommt. Wieder war es der Westen, Frankreich und England, wo sich dieses Streben zuerst geltend machte. Es sollte an Stelle von Willkür Vernunftnotwendigkeit,
von Vorrecht Gleichberechtigung, von Unfreiheit Freiheit treten. Aber es ist wohl nicht zu gewagt, wenn man behauptet, die ersten wirklich lebeasfähigen Keime, an die Stelle des Staates, in dem Zufall und subjektive Willkür herrschen, jenen zu setzen, in dem die Vernunft die oberste Regentschaft führt, werden soeben in Deutschland gelegt Der Staat hat dafür zu sorgen, daß das Glück des Einzelnen nicht von Zufall oder Willkür abhängt, sondern daß das nach den Grundsätzen der Vernunft aufgebaute Ganze die Wohlfahrt des Individuums soweit sichert, daß letzteres in physischer und geistiger Richtung sich frei entwickeln kann. Nicht der Staat kann die Menschen frei machen, das kann nur die Erziehung; wohl aber hat der Staat dafür zu sorgen, daß jeder den Boden findet, auf dem seine Freiheit gedeihen kann. Daß zu einer Entwickelung in dieser Hinsicht von den Stufen des Thrones, den einst Friedrich der Große eingenommen, heute das Losungswort gegeben, daß in Deutschland die Führung des Staates einem Manne obliegt, der tief durchdrungen ist von jener Mission des Staates, wird die Geschichte einst als eines der größten ihrer politischen Fakten verzeichnen.
Und nun noch eines: Es gibt Deutsche, die an der großen Arbeit, die das deutsche Volk heute in sozialer Beziehung voll-bringt, nicht teilzunehmen berufen sind. Wir sprechen hier ja zu einer großen Zahl solcher Deutscher. Aber wir möchten es nicht als ein Unglück bezeichnen, daß es so ist. Denn vielleicht fällt heute gerade diesen Deutschen nicht der unbedeutendste Teil der gemeinsamen Kulturarbeit unseres Volkes zu. Wir akzeptieren mit ungeheuchelter Resignation die heutigen Verhältnisse und machen den Umstand geltend, daß es im hohen Grade wünschenswert ist, daß es so ist. Man darf nicht vergessen, daß über den großen wirtschaftlichen Problemen der Gegenwart dem deutschen Volke im Reiche heute vielfach der ideale Schwung für höhere geistige Angelegenheiten abhmden gekommen ist; man darf nicht außer acht lassen, daß selbst die deutsche Jugend, einst die bewährte Hüterin des deutschen Idealismus, den letzteren über sozial-reformatorischen Gedanken vergißt, und wir werden einsehen, daß das deutsche Wesen in seiner schönsten Entfaltung gerade bei
solchen Deutschen eine Zufluchtsstätte braucht, die außerhalb des deutschen Vaterlandes leben.
Hiermit eröffnet sich eine schöne Perspektive für diese letzteren deutschen Volksstämme. Wir wissen ein Volk, das es von jeher mit diesem Grundsatze gehalten hat, das deshalb allen deutschen Stämmen ebenbürtig - sehr vielen um sehr vieles voraus ist in Kultur und Bildung: die Sachsen in Siebenbürgen! Möge dieses Journal dazu beitragen, daß diese Kultur und Bildung noch immerfort wachse, möge es ihm gelingen, in dem angedeuteten Sinne zu einem deutschen Volke in einem nichtdeutschen Lande zu sprechen.
DIE NATUR UND UNSERE IDEALE
Sendschreiben an die Dichterin des «Hermann»: M. E. delle Grazie
Hochverehrte Dichterin!
Sie haben in Ihrem so gedankenreichen philosophischen Gedichte der Grundstimmung Ausdruck gegeben, die sich in dem modernen Menschen geltend macht, wenn er die dermalige Natur- und Geistesauffassung auf sich wirken läßt und dabei jene Tiefe des Empfindens besitzt, die ihn die Disharmonie erkennen läßt, die zwischen jener Auffassung und den Idealen unseres Geistes und Herzens besteht. Jawohl, sie sind vorüber, jene Zeiten, da der leichtfertige, flache Optimismus, der in dem Glauben an unsere Gotteskindschaft besteht, den Menschen über jenen Zwiespalt der Natur und des Geistes hinwegführte. Sie sind vorüber, die Zeiten, in denen man oberflächlich genug war, leichten Herzens hinwegzusehen über die tausend Wunden, aus denen die Welt allerorten blutet. Unsere Ideale sind nicht mehr flach genug, um von dieser oft so schalen, so leeren Wirklichkeit befriedigt zu werden.
Dennoch kann ich nicht glauben, daß es keine Erhebung aus dem tiefen Pessimismus gibt, der aus dieser Erkenntnis hervor-geht. Diese Erhebung wird mir, wenn ich auf die Welt unseres Innern schaue, wenn ich an die Wesenheit unserer idealen Welt näher herantrete. Sie ist eine in sich abgeschlossene, in sich vollkommene Welt, die nichts gewinnen, nichts verlieren kann durch die Vergänglichkeit der Außendinge. Sind unsere Ideale, wenn sie wirklich lebendige Individualitäten sind, nicht Wesenheiten für sich, unabhängig von der Gunst oder Ungunst der Natur? Mag immerhin die liebliche Rose vom unbarmherzigen Windstoße zer-blättert werden, sie hat ihre Sendung erfüllt, denn sie hat hundert menschliche Augen erfreut; mag es der mörderischen Natur morgen gefallen, den ganzen Sternenhimmel zu vernichten: durch Jahrtausende haben Menschen verehrungsvoll zu ihm emporgeschaut, und damit ist es genug. Nicht das Zeitensein, nein das innere Wesen der Dinge macht sie vollkommen. Die Ideale unseres Geistes sind eine Welt für sich, die sich auch für sich ausleben muß und die nichts gewinnen kann durch die Mitwirkung einer gütigen Natur.
Welch erbarmungswürdiges Geschöpf wäre der Mensch, wenn er nicht innerhalb seiner eigenen Idealwelt Befriedigung gewinnen könnte, sondern dazu erst der Mitwirkung der Natur bedürfte? Wo bliebe die göttliche Freiheit, wenn die Natur uns, gleich unmündigen Kindern, am Gängelbande führend, hegte und pflegte? Nein, sie muß uns alles versagen, damit, wenn uns Glück wird, dieses ganz das Erzeugnis unseres freien Selbstes ist! Zerstöre die Natur täglich, was wir bilden, auf daß wir uns täglich aufs neue des Schaffens freuen können! Wir wollen nichts der Natur, uns selbst alles verdanken!
Diese Freiheit, könnte man sagen, ist doch nur ein Traum. Indem wir uns frei dünken, gehorchen wir der ehernen Notwendigkeit der Natur. Die erhabensten Gedanken, die wir fassen, sind ja nur das Ergebnis der in uns blind waltenden Natur.
Oh, wir sollten doch endlich zugeben, daß ein Wesen, das sich selbst erkennt, nicht unfrei sein kannl Indem wir die ewige Gesetzlichkeit der Natur erforschen, lösen wir jene Substanz aus ihr
los, die ihren Außerungen zugrunde liegt. Wir sehen das Gewebe der Gesetze über den Dingen walten, und das bewirkt die Notwendigkeit. Wir besitzen in unserem Erkennen die Macht, die Gesetzlichkeit der Naturdinge aus ihnen loszulösen und sollten darnach die willenlosen Sklaven dieser Gesetze sein? Die Natur-dinge sind unfrei, weil sie die Gesetze nicht erkennen, weil sie, ohne von ihnen zu wissen, durch sie beherrscht werden. Wer ,, sollte sie uns aufdrängen, da wir sie geistig durchdringen? Ein erkennendes Wesen kann nicht unfrei sein. Es bildet die Gesetzlichkeit zuerst in Ideale um und gibt sich diese selbst zum Gesetze. Wir sollten endlich zugeben, daß der Gott, den eine abgelebte Menschheit in den Wolken wähnte, in unserem Herzen, in unserem Geiste wohnt. Er hat sich in voller Selbstentäußerung ganz in die Menschheit ausgegossen. Er hat für sich nichts zu wollen übrig behalten, denn er wollte ein Geschlecht, das frei über sich selbst waltet. Er ist in der Welt aufgegangen. Der Menschen Wille ist sein Wille, der Menschen Ziele seine Ziele. Indem er den Menschen seine ganze Wesenheit eingepflanzt hat, hat er seine eigene Existenz aufgegeben. Es gibt einen «Gort in der Geschichte» nicht; er hat aufgehört zu sein um der Freiheit der Menschen willen, um der Göttlichkeit der Welt willen. Wir haben die höchste Potenz des Daseins in uns aufgenommen. Deswegen kann uns keine äußere Macht, können uns nur unsere eigenen Schöpfungen Befriedigung geben. Alles Wehklagen über ein Da-sein, das uns nicht befriedigt, über diese harte Welt, muß schwinden gegenüber dem Gedanken, daß uns keine Macht der Welt befriedigen könnte, wenn wir ihr nicht zuerst selbst jene Zauber-kraft verleihen, durch die sie uns erhebt und erfreut. Brächte ein außerweltlicher Gott uns alle Himmelsfreuden, und wir sollten sie so hinnehmen, wie er sie ohne unser Zutun bereitete, wir müßten sie zurückweisen, denn sie wären die Freuden der Unfreiheit.
Wir haben keinen Anspruch darauf, daß uns von Mächten Befriedigung werde, die außer uns sind. Der Glaube versprach uns eine Aussöhnung mit den Übeln dieser Welt, wie eine solche ein außerweltlicher Gott herbeiführen sollte. Dieser Glaube ist im Verschwinden begriffen, er wird einst gar nicht mehr sein. Es
wird aber die Zeit kommen, wo die Menschheit nicht mehr auf Erlösung von außen hoffen wird, weil sie erkennen wird, daß sie sich selbst ihre Scligkeit bereiten muß, wie sie sich selbst so tiefe Wunden geschlagen hat: Die Menschheit ist die Lenkerin ihres eigenen Geschickes. Von dieeer Erkenntnis können uns selbst die Errungenschaften der modernen Naturwissenschaft nicht abbringen, denn sie sind die Erkenntnisse, die wir durch Auffassung der Außenseite der Dinge erlangen, während die Erkenntnis unserer Idealwelt auf dem Eindringen in die innere Tiefe der Sache beruht.
Da Sie, verehrte Dichterin, mit Ihrem Gedichte die Kreise der Philosophie so hart bedrängt haben, werden Sie wohl nicht abgeneigt sein, die Antwort dieser letzten zu hören; und damit bin ich in vorzüglicher Hochachtung ergebenst
Rudolf Steiner
DAS ANSEHEN DER DEUTSCHEN PHILOSOPHIE EINST UND JETZT
Als Rosenkranz 1844 seine Hegel-Biographie vollendet hatte, schrieb er in der Vorrede die bedeutungsvollen Worte: «Scheint es nicht, als seien wir heutigen Tages nur die Totengräber und Denknutlsetzer für die Philosophen, welche die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts gebar, um in der ersten des jetzigen zu sterben? Kant fing 1804 dies Sterben der deutschen Philosophen an. Sehen wir einen Nachwuchs für diese Ernte des Todes? Sind wir fähig, in die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts ebenfalls eine heilige Denkerschar hinüberzusenden? » Es sind nun vier Jahrzehnte dahingegangen, seit der geist- und gemütvolle Hegelianer diese Frage gestellt. Blicken wir um uns! Was erteilt uns unsere Zeit für eine Antwort? Jetzt müssen sie ja Männer geworden sein, von denen Rosenkranz fragte: «Leben unter unseren Jünglingen die, welchen platonischer Enthusiasmus und aristotelische Arbeitsseligkeit das Gemüt zu unsterblicher Anstrengung für die Spekulation begeistert?>
Eine ziemlich oberflächliche Kenntnis des Geisteslebens unserer Zeit genügt, um einzusehen, daß die Antwort auf obige Frage eine wenig erfreuliche sein wird. Das Häuflein Philosophen, das heute für Spekulation schwärmt, ist klein, sehr klein, groß aber die Schar jener, die achselzuckend auf das ganze philosophische Zeitalter des deutschen Volkes herabschauen. Es scheint fast, als ob wir mit den deutschen Philosophen die deutsche Philosophie begraben hätten.
Was bedeutet dem Deutschen die Philosophie am Beginne unseres Jahrhunderts, was heute? Damals war sie die Losung des Tages; der Philosoph konnte auf die Teilnahme jedes gebildeten Deutschen rechnen, seinen Worten lauschte nicht nur eine begeisterte Zuhörerschar in den Hörsälen, sie drangen überallhin, wo überhaupt geistige Interessen vorhanden waren. Heute lesen die Philosophie-Professoren - vor leeren Bänken. Philosophische Fragen waren für eine Zeitlang Tagesfragen, sie wurden behandelt, wie man heute politische, nationale oder wirtschaftliche Fragen behandelt. Eine Weltanschauung zu haben, erschien als Not-wendigkeit für jeden denkenden Menschen. Die Philosophie schien dazu ausersehen, allen anderen Wissenschaften die Fackel voranzutragen, ihnen Richtung und Ziel zu bestimmen. Die volle Energie des menschlichen Denkens erwachte, und mit der Energie vereinte sich das vollste Vertrauen in die Menschen-Vernunft. Im Herzen erwachte das tiefste Bedürfnis, in die Geheimnisse des Welträtsels einzudringen, und der Geist hielt sich zugleich für fähig, gesrützt auf seine eigene Kraft - ohne Offenbarung, ohne Erfahrung -, diesem Bestreben Genüge zu tun. Wie anders liegen die Dinge heute! Das Vertrauen in unser Denken ist uns völlig verlorengegangen. Man betrachtet es einzig und allein als Werkzeug der Beobachtung, der Erfahrung, wie man es einst nur als Werkzeug für die Auslegung der von der Kirche aufgestellten Dogmen gehalten hat. Man verzichtet überhaupt auf die Lösung der großen Rätselfragen, die Natur und Leben an uns stellen. Aristotelische Arbeitsseligkeit haben wir; platonischer Enthusiasmus fehlt uns aber. Wir verschwenden unendliche Mühe auf die Detail-forschung, die ohne große leitende Gesichtspünkte denn doch
keinen Wert hat. Man vergißt dabei nur, daß wir auf dem besten Wege zu einem Standpunkte sind, den wir für längst überwunden halten: auf dem Wege zum blinden Dogmenglauben.
Die Abweisung des souveränen Denkens, verbunden mit dem Pochen auf die Aussprüche der Erfahrung, ist für eine tiefere Auffassung ganz dasselbe wie der blinde Offenbarungsglaube einer abgetanen Theologie: Der Theologie werden Wahrheiten überliefert, die sie hinnehmen muß, ohne nach den Gründen fragen zu dürfen, ohne vermöge des eigenen Denkens daraufkommen zu können, warum das wahr ist, was sie für wahr halten muß. Sie vernimmt die Botschaft und muß ihr Glauben entgegenbringen. Das Denken hat nichts zu tun, als die fertige Wahrheit in eine für den Menschen geeignete Form zu bringen. Nicht anders ist es mit der bloßen Erfahrungs-Wissenschaft. Nach ihrer Ansicht gilt nichts für wahr, als was die Tatsachen verkünden. Man soll beobachten, ordnen, sammeln, sich aber ja alles Nachdenkens über die innern Triebfedern der Ereignisse, denen wir gegenübertreten, enthalten. Auch die Erfahiungswahrheiten werden uns ja von außen her fertig übermittelt. Die Kirche forderte vom Denken Unterwerfung unter die Offenbarung, die Erfahrungswissenschaft fordert Unterwerfung unter die zufälligen Aussprüche der Tatsachenwelt.
Und auf dem Gebiete der praktischen Philosophie, wohin sind wir gelangt? Der rote Faden, der sich durch das Denken aller Geister der klassischen Periode durchzieht, ist die Anerkennung des freien Willens des Menschen als höchster Macht seines Geistes. Diese Anerkennung wird zuweilen sehr leicht genommen. Wenige wissen, daß sie in ihrer vollen Tiefe erfaßt geradezu die Keime zu einer religiösen Ansicht der Zukunft bildet. Wer dem Menschen den freien Willen im höchsten Sinne des Wortes zuerkennt, muß jeden inner- oder außerweltlichen Einfluß auf die Taten seines Geistes leugnen. Er muß ihn völlig auf sich selbst, seine eigene Persöulichkeit verweisen. Keine «göttlichen Gebote», kein «Du sollst>, wie es die Religionen haben, kann er für das sittliche Leben des Menschen gelten lassen. Ziel und Zweck seines Daseins muß der Mensch aus sich selbst schöpfen.
Seine Bestimmung ist nicht die, die ihm ein «ewiger Ratschluß»
Gottes zuweist, sondern die er sich selbst gibt. Er erkennt über sich keinen Gebieter. Diese Ansicht erhöht das Bewußtsein der menschlichen Würde unendlich. Um sie zu hegen, braucht man aber jenes Vertrauen in die eigene Vernunft, das wir nicht mehr oder wenigstens nicht in dem Maße mehr haben wie zur Zeit der klassischen Epoche unserer Philosophie. Diese Ansicht muß es eben aufgeben, Trost in der Religion oder in dem Bewußtsein der Gotteskindschaft überhaupt zu finden, sie muß Trost in der eigenen Brust des Menschen suchen. Sie muß es aufgeben, ein gottgefälliges Leben zu führen, und einzig und allein die eigene Vernunft als Führerin anerkennen. Mit dieser Ansicht fühlt sich der Mensch erst völlig frei. Es war ein ungeheurer Schritt nach vorwärts in der Erziehung des Menschengeschlechtes, als die deutschen Philosophen diese Wahrheit in allen Formen verkündeten. Wer erkennt sie heute als solche an? Wir glauben nicht mehr, daß wir fähig sind, uns Ziel und Zweck unseres Lebens selbst vorzusetzen. Wir wähnen uns am Gängelband einer ehernen Naturnotwendigkeit, so wie sich eine abgelebte Menschheit am Gängelband göttlicher Weisheit wähnte. Wer dazu noch das Gefühl von der erbärmlichen Lage hat, in der wir sein würden, wenn diese Ansicht die wahre wäre, der wird eben Pessimist. Und so gilt heute der Pessimismus als die Gesinnung vornehmer Geister. Unsere glaubensstarken Ahnen waren nur deshalb nicht Pessimisten, weil sie glaubten, daß der Schöpfer allgütig und allweise sei und zuletzt doch alles zum besten wende. Von der blinden Naturnotwendigkeit kann eine solche Annahme nun freilich nicht gelten.
Nur ein freies philosophisches Denken, das des höchsten Aufschwunges fähig ist, kann über diese Ansicht erheben. Und ein solches war das Denken unserer klassischen Epoche.
Unsere deutsche Philosophie ist nicht die Tat eines Einzelnen, sie ist die Tat des deutschen Volkes. Das deutsche Volk brachte sein Bestes, sein Herzblut an die Oberfläche, und das nennen wir deutsche Philosophie. Die Männer, die um die Wende des Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des unsrigen auftraten, sie verkünden eine Botschaft, die tief aus der Volksseele entsprungen.
Und nicht nur die Philosophen, auch die Dichter verkündeten dieselbe Botschaft. Denn die Epoche unserer klassischen Literatur bedeutet keinen einseitigen Aufschwung der Dichtung, sondern eine Vertiefung des ganzen deutschen Wesens. Der Grund-Charakter aller Schöpfungen unserer größten Zeit ist ein philosophischer. Unsere größten Dichter mußten sich mit den philosophischen Anschauungen der Zeit auseinandersetzen. Schiller schätzte sich glücklich, in der Zeit zu leben, in der Kant die größten Welt-probleme in Fluß gebracht, und es gibt philosophische Wahrheiten, die bis heute keiner tiefer erfaßt hat als Schiller.
Fragen wir nach dem Grunde dieser Erscheinung, so müssen wir ihn eben in der Tiefe und Eigentutnlichkeit des deutschen Wesens suchen. Man erfaßt dieses Wesen am besten, wenn man es mit dem alten Griechenrum zusammenhält. Der Kulturhistoriker der Zukunft wird ja gewiß dem deutschen Geiste dieselbe Bedeutung für die Bildung der Neuzeit beilegen, wie es der heutige mit dem Griechentum in bezug auf die Bildung des Altertums tut. Der griechische Geist war nach außen gerichtet, er drängte zur Gestaltung der Sinnenwelt, um im einzelnen Kunstwerke eine kleine Welt wiederzugeben. Was in der Natur auf eine Vielheit von Wesen verteilt, das suchte der griechische Künstler seinem Gebilde einzuprägen, so daß man sagen möchte, der Grieche suchte in einern einzigen Kunstwerke alle Gesetzmäßigkeit der Natur zu vereinigen. Als Goethe in Italien diesen Grundcharakter griechischer Meisterwerke erkannte, sagte er, daß die Griechen bei ihrem Schaffen nach eben denselben Gesetzen verfuhren, nach denen die Natur schafft und denen er auf der Spur sei. Hierinnen spricht sich gleich der Gegensatz und die Ähnlichkeit von deutschem und griechischem Geist aus. Der Grieche sucht der Materie den Schöpfungsgedanken einzuprägen, der Deutsche sucht ihn denkend zu erfassen und als Ideenwelt, auf die er sich zurückzieht, auszugestalten. Plastischer Sinn ist bei den Griechen, plastischer Geist bei den Deutschen zu Hause. Wiederholt wurde es ausgesprochen, was der Deutsche mit seiner Philosophie will. Er will die Ordnung, nach welcher die uns umgebende Welt zusammengefügt ist, im Geiste nachschaffen.
In diesem kühnen Sinne hat erst der Deutsche die Philosophie erfaßt. Alle andere Weltweisheit ist bloß Vorahnung, Vorverkündigung dessen, was im deutschen Geiste zu einer welthistorischen Erscheinung wurde. Die Philosophie wurde im deutschen Volke von einer gelehrten Sache zu einer Angelegenheit der Menschheit. In diesem Bewußtsein konnte Hegel, als er am 22. Oktober 1818 seine Antrittsrede hielt, die Worte sagen: «Diese Wissenschaft hat sich zu den Deutschen geflüchtet und lebt allein in ihnen fort. Uns ist die Bewahrung dieses heiligen Lichtes anvertraut, und es ist unser Beruf, es zu pflegen und zu nähren und dafür zu sorgen, daß das Höchste, was der Mensch besitzen kann, das Selbstbewußtsein seines Wesens, nicht erlösche und untergehe.» Hiermit erklärt sich auch die Tatsache, warum ein Philosoph es sein mußte, der den Deutschen am besten ihr eigenes Wesen im Spiegel der Idee zeigte. Der Grundzug deutschen Wesens ist eben ein philosophischer und deshalb am tiefsten für philosophisches Nachdenken erfaßbar. Die «Reden an die deutsche Nation», die Fichte in Berlin, umringt von den Heeren des Feindes, gehalten hat, sie sind ein Schatz des deutschen Volkes.
Wenn augenblicklich die philosophische Zeitströmung in unserem Volke zurückgedrängt ist, so dürfen wir freilich nicht ungerecht sein. Wir sind eben heute zu sehr von politischen und wirtschaftlichen sowie von nationalen Interessen in Anspruch genommen. Aber unbewußt wirkt ja auch in den sozialen Reformen im Reiche der Geist der deutschen Philosophie fort. Wir brauchen uns nur an die Idee des «geschlossenen Handelsstaates» zu erinnern, die Fichte vertrat. Wir geben uns dem Glauben hin, daß in nicht zu ferner Zeit unser Volk seine Gegenwart völlig mit seiner Vergangenheit wieder verknüpfen wird. Es muß, weil es sich selbst verleugnete, wenn es seine Philosophen verleugnet. Unsere westlichen Nachbarn haben uns wegen unseres Idealismus verspottet. Wir konnten den Spott ertragen, denn den Idealismus weiß nur zu schätzen, wer ihn hat. Heute stehen die Dinge ohnehin anders. Während französischer Chauvinismus am liebsten die Waffen gegen unser Volk kehrte, vertieft sich heute französische Gelehrsamkeit in deutsche Gedankenschöpfungen, und die Engländer
wetteifern mit den Franzosen. Verknüpfung von Gegenwart mit Vergangenheit: in diesem Zeichen werden wir siegen, und unsere besten Siege werden doch die des Geistes sein.
JOHANNES VOLKELT. Ein deutscher Denker der Gegenwart
Ohne gegen die gerechte Würdigung vergangener Kulturabschnitte und gegen die immer zunehmende Vertiefung in das Studium Schillers, Goethes, Herders und so weiter im geringsten etwas einwenden zu wollen - wir anerkennen vielmehr völlig die Notwendigkeit davon -, können wir uns doch der Einsicht nicht verschließen, daß uns der gute Wille meist fehlt, über Größen der Gegenwart zu einem Urteile zu kommen. Es gehört freilich weniger Mut dazu, immer und immer wieder seine Bewunderung über Goethe und Schiller auszusprechen, wobei man nirgends in der gebildeten Welt auf Widerspruch stoßen kann, als sich für einen Lebenden einzusetzen und hier einmal ein rücksichtsloses Wort zu sprechen.
Da wir glauben, daß vorzugsweise eine Zeitung dazu berufen ist, der Gegenwart zu dienen, so sei es uns hier gestattet, unser Urteil über eine der sympathischsten deutschen Denkergestalten, über Johannes Volkelt, zu verzeichnen.
Wir wollen von einer Tatsache ausgehen, die vielen, die in den siebziger Jahren in Wien studiert haben, noch in lebhafter Erinnerung sein wird. Am 10. März 1875 hielt im «Leseverein der deutschen Studenten Wiens» Johannes Volkelt, ein damals 27 jähriger
Gelehrter, einen Vortrag, der geradezu als der bedeutsamste Beitrag zur Kulturgeschichte der Gegenwart angesehen werden muß. In jedem Satze zeigt Volkelt, wie tief er in die Geschichte seiner Zeit eingedrungen ist. Es liegt in diesem Vortrage ein erstaunlicher Reichtum an Geist, und zwar an echt deutschem Geist.
Es ist das freilich nicht jene leichte, französierende Geistreichtuerei, welche die Herren Ludwig Speidel, Eduard Hanslick, Hugo Wittmann oder gar Oppenheim und Spitzer entfalten, die angeblich über irgendeinen bedeutenden Gegenstand sprechen, in Wahrheit aber ihr Publikum mit schalen Witzeleien und gedankenleeren Phrasen unterhalten. Nein, Volkelts Rede war in dem Sinne geistreich, daß sie im rechten Augenblicke das rechte Wort findet, das echte, kernige, deutsche Wort, das uns auch immer unterhält, weil es uns geistig erhebt.
Volkelt mißt in diesem Vortrage unsere Zeit an dem hohen, tief aus dem Wesen des deutschen Volkes geholten Sittlichkeitsbegriff Kants. Kant macht die Sittlichkeit einer Handlung einzig und allein von der Gesinnung abhängig, aus der sie hervor-gegangen ist. Eine Handlung, die allen bestehenden Gesetzen entspricht, die der Mit- und Nachwelt von unabsehbarem Nutzen ist, ist doch nicht sittlich, wenn sie nicht aus der guten Gesinnung ihres Urhebers fließt. Wenn zwei dasselbe tun, der eine aus Egoismus, der andere aus Pflicht, so handelt der erste unsittlich, der zweite sittlich. Volkelt fragt nun: Wie stellt sich unsere Zeit zu diesen Anschauungen des Königsberger Weisen. Er kommt zu einer traurigen Antwort. Es scheint die Ansicht fast allgemein geworden zu sein: mit der moralischen Gesinnung kommt man nicht weiter, man baut mit ihr keine Eisenbahnen, man gründet mit ihr keine industriellen Unternehmungen. Man glatibt, der Moral genug getan zu haben, wenn man mit dem Strafgesetz in keinen Konflikt gerät. Im Herzen gut sein, das hält man für ein Vorurteil, das man den Kindern in der Schule wohl vormachen muß, womit sich aber im Leben nichts anfangen läßt. Es gibt heute Kreise, die Lebensformen angenommen haben, die in ihrer Wurzel unsittlich sind. «Mir scheint», sagt Volkelt, «daß kaum ein Ausdruck das sittliche Leben unserer Zeit so treffend charakterisiert
als das Wort ‹bequem›. Kühle Laxheit, vornehme Bequemlichkeit gehört zum guten Tone.»
Es gab eine Zeit, wo der Mensch das Geringste, das er zu seinem Unterhalte brauchte, der Natur abringen mußte. Harte Arbeit, einen Kampf im wahrsten Sinne des Wortes mußte er führen, um sein Dasein zu fristen. Heute ist das anders geworden. Das Bezwingen der Natur ist uns leicht. Wir haben Maschinen und Werkzeuge, die das verrichten, was unsere Vorfahren mit eigener Hand tun mußten. Wir erkennen natürlich wie jeder vernünftige Mensch darinnen einen Fortschritt. Wir verkennen aber auch nicht, daß gerade dieser Fortschritt Hand in Hand geht mit einem Verfall der Charaktere, Tüchtigkeit der Gesittung. Die Mühe und Arbeit, die ehedem der Mensch verrichten mußte, um der Natur seinen Lebensunterhalt abzuringen, waren für ihn eine hohe Schule der Sittlichkeit. Heute brauchen wir nur die Hand zu rühren, und der ganze gesellschaftliche Apparat funktioniert, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das hat zur Folge, daß sich die letzteren bis zur Übertriebenheit steigern, daß der Mensch die Lust verliert, den geraden und harten Weg der Pflicht zu gehen, und dafür lieber den leichten der Bequemlichkeit wandelt. Daraus geht eine Lähmung der persönlichen Charakterfestigkeit, der Arbeitstüchtigkeit hervor.
Ein großer Teil unserer Gesellschaft leidet an Matklosigkeit und Knochenerweichung in geistiger Beziehung.
«Wir leben in einer Zeit allgemeiner Auspolsterung», sagt Volkelt treffend, und fügt hinzu: «Wie sehr ich recht habe, erfahren Sie, wenn Sie sich in Ihrem eingerichteten Zimmer umsehen, wenn Sie einen Gang durch die Straßen tun, wenn Sie eine Reise unternehmen. Selbst die fernsten Gebirgstäler sind vor Eisenbahnen und dem modernen Hotelwesen nicht mehr sicher. Sie erfahren es, so oft Sie sich in einem Wirtshaus von den glatt gekänunten Kellnern, diesen poesielosen Maschinen, bedienen lassen; so oft Sie auf spiegelblankem Salonboden in Frack und Handschnhen sich zu bewegen haben. Sie erfahren es bei jedem Rechtshandel, in den Sie etwa geraten, bei dem einfachsten Geschäfte, das Sie abwickeln sollen. Selbst der Krieg trägt heutzutage den unpersönlichen, prompten Maschinencharakter.» Das ist
eben die Zeit, in der es wenige gibt, die ein ideales Ziel im Auge haben und, ohne Seitenblicke nach rechts oder links, rücksichtslos auf dasselbe zusteuern; nein, wo nur jeder sich dem blinden Treiben der Welt überläßt und, mit Glück und Leben ein frivoles Spiel treibend, sich aus der gesellschaftlichen Maschine so viel herauszuschlagen bemüht ist, als eben geht. Überall wird das Bequeme jenem vorgezogen, zu dem ein Einsetzen der ganzen Persöniichkeit gehört. Wer liest heute ein systematisches Buch, das Denkerfleiß in jahrelanger Arbeit zustande gebracht. Nein, man liebt es, aus «elegant» geschriebenen Feuilletons oder aus «populären>, das ist seichten Vorträgen Notiz von den zeitbewegenden Fragen zu nehmen. Jenes ist eben mühsam und erfordert strammes Denken, dieses ist bequem. Im Theater wird das leichteste, gemeinste, ja blödsinnigste Zeug dem Publikum geboten. Es nippt mit Behagen daran, denn der Genuß eines Höheren erfordert auch geistige Anstrengung. Das politische Parteileben liefert überall nur Halbheit, Opportunität zutage. Fast niemand findet sich, der ein aufrichtiges, rücksichtsloses «Das will ich! » vernehmen läßt.
Die Festigkeit des Charakters ist in dem taumelhaften Genuß-leben untergegangen. Allen denen nun, die von dem bösen Geist unserer Zeit angefressen sind, empfiehlt Volkelt das Lesen der Kantschen Schriften. Denn sie sind eine Schule für den Charakter-schwachen. Besonders aber richtet Volkelt seine Mahnung an die Journalisten. Dieser Stand ist es ja gerade, der die Würde des Menschen in der eigenen Person am meisten erniedrigt, wenn er sich zum willenlosen Werkzeug seiner Geldgeber hergibt. Der Journalist macht seine Person zur Sache, indem er sich verkauft.
Da ist es nun merkwürdig, daß Volkelt schon 1875 angesichts des Ausganges des Prozesses Ofenheim die Schäden des Wiener Preßwesens ungeschminkt dargelegt hat. Er hat sich ein Beispiel aus der Reihe jener Blätter herausgewählt, die von Moral und Gesinnung nichts wissen wollen, wenn es sich um Unternehmungen im großen Stile handelt, für die allein ausschlaggebend ist, ob bei einem Dinge sich mehr oder weniger gewinnen läßt. Unbeschadet des Umstandes, daß man viel aufs Spiel setzt, wenn man sich Mächtige zum Feinde macht, wählte unser Denker das «anges-
sehenste» Blatt Wiens, die «Neue Freie Presse», zum Gegenstände des Angriffes. Er hatte recht, denn obwohl diese Zeitung nur von der Phrase lebt, imponiert sie doch noch vielen. Man muß ihr zunächst die Maske herabnehmen. Die anderen Blätter dieses Charakters lohnen nicht einmal diese Mühe. Volkelt sagt: «Man hätte sich nach dem freisprechenden Urteile der Geschworenen — im Prozesse Ofenheim — mit sittlicher Trauer eingestehen sollen: Unser Strafgesetz ist leider so unvollkommen, daß es die Unsittlichkeit jener Leute nicht in seinen Schlingen fangen kann. Was geschah aber statt dessen? Am nächsten Morgen erschien in der <Neuen Freien Presso ein Leitartikel, der den Brechreiz jedes einfach und gesund denkenden Menschen erregen muß. Hielte man sich in den industriellen Unternehmungen nicht an den Ofenheimschen Geist, so verfiele man in eine «Epoche stumpfer, mutloser Resignation». Dieses Blatt geht in seiner forcierten, sich wie künstlich aufstachelnden Begeisterung so weit, daß es die Freisprechung als die höchste Leistung für das «Gewissen», für die «Ethik» ansieht. Dieselbe Zusammenwerfung von juristischem Recht und Sittlichkeit findet sich in einem nächsten Leitartikel. Um ihr Schoßkind Ofenheim als sittlich völlig rehabilitiert darzustellen, sucht die «Neue Freie Presse» die Sittlichkeit überhaupt fortzuescamotieren. Sie hat die Stirne, zu erklären, daß es für die Sittlichkeit überhaupt «kein irdisches Tribunal» gebe.
Ich frage: lebt nicht im Volke, lebt nicht in jedes Menschen Brust eine Richterstimme, die ihr sittliches Schuldig und Unschuldig eindringlich verkündet? Die «Neue Freie Presse», welche die von Recht und Gesetz verschiedene Sittlichkeit als «wesenloses Abstractum» bezeichnet und uns glauben machen will, daß es in jedes Menschen Brust so dürr und paragraphenmäßig aussieht wie in der ihrer Anhänger, möge sich vom alten Kant belehren lassen, daß ein dem Gesetzesparagraphen entsprechendes Handeln zwar «legal», aber noch nicht «sittlich» ist. Doch wahrscheinlich weiß das die «Neue Freie Presse» selbst. Nur das bedrängende Gefühl, für etwas sittlich Hohles einmal eingetreten zu sein, konnte ihr den Satz eingeben: «Haben Recht und Gesetz gesprochen, so ist auch der Sittlichkeit Genüge geschehen.» Während sie sich sonst mit einem
gewissen idealen Schwunge zu umkleiden liebte, legt sie nun eine sittliche Stumpfheit und moralische Blöße an den Tag. Alle sittlich Entrüsteten sind in ihren Augen Heuchler, Sykophanten, gesinnungslose Leute.»
Das waren kräftige Worte. Volkelt hatte ausgesprochen, was Hunderten die Brust bewegte. Wer seine Worte vernahm, der mußte in Volkelt den deutschen Mann erkennen und aus vollem Herzen ihm zustimmen. Und als energischer, ganzer deutscher Mann hat er sich bisher erwiesen. Er führt ein Denkerleben im deutschen Sinne und ringt nach Lösung der höchsten Weltprobleme. Seine Werke tragen durchaus jenen Zug, der ihnen von seiner harmonisch wirkenden, unbeugsamen Persönlichkeit aufgedrückt ist.
Gemüt und Denken ist in diesem Manne in gleichem Maße vorhanden. Wer sich davon überzeugen will, der lese sein Buch: «Traumphantasie.»
So wie die Astronomie aus der Astrologie, die Chemie aus der Alchemie sich entwickelt hat, so wird sich eine Wissenschaft der Traumwelt aus der Traumdeuterei entwickeln. Der Mensch will immer zuerst die Gebiete der Wirklichkeit für seine persönlichen Wünsche ausbeuten und wird sie erst später mit dem selbstlosen Forschen der Wissenschaft durchdringen. Volkelt hat in seinem Buche uns in formgewandter Weise alles zusammengestellt, was wir heute an Elementen zu einer künftigen Traumwissenschaft haben. Wer das Buch durchgeht, wird alsbald bemerken, daß dieses intime Gebiet, diese Märchenwelt nur von einem Deutschen so vorteilhaft behandelt werden konnte.
Volkelts Schriften: «Das Unbewußte und der Pessimismus», «Individualismus und Pantheismus», «Der Symbol-Begriff in der neuesten Asthetik», zeigen uns überall den hochbegabten, gründlichen Denker, der endlich in seinen letzten Schriften: «Kants Erkenntnistheorie> und «Erfahrung und Denken», auf seiner vollen Höhe erscheint.
Volkelt ist ein origineller Forscher, der in seiner Weise auf Kant weiterbaut. Kant machte gegenüber dem wissenschaftlichen «Herumtappen im Finstern» geltend, man müsse erst unser Erkenntnisverrnögen
selbst prüfen, um zu sehen, ob dieses Instrument auch geeignet sei, außerordentliche Dinge wie Gott, Seele und dergleichen zu begreifen. Und er glaubte bewiesen zu haben, daß wir nichts verstehen können als die Erfahrung, die vor unseren Sinnen ausgebreitet ist. Alles Überirdische bleibe ungewiß. Auch Volkelt ist der Ansicht, daß wir eine sichere Kenntnis nur von dem haben, was unseren Augen und Ohren und so weiter gegeben ist. Jedoch glaubte er durch folgerichtiges Schließen auch von den hinter dieser Sinnenwelt liegenden tätigen Ursachen ein Wissen zu gewinnen, nur ttage dieses keinen anderen als den Wahrscheinlichkeitscharakter. Er will den «behutsamen Kritizismus», den er von Kant übernommen, mit einem «hochstrebenden Idealismus» vereinen. Wohl ist die neueste Phase seines Denkens nicht ganz frei von der heute allgemein herrschenden Mut- und Energielosigkeit des Denkens, aber seine gesunde Natur und sein deutscher Sinn wird ihn hoffentlich nicht in den Irrtum verfallen lassen, daß unser Forschen ein vergebliches Ringen sei. Wir hoffen es zu erleben, daß auch aus seiner Philosophie das wieder verschwindet, was er heute als notwendig ansieht: «Ein Vorwärtsgehen, das doch wieder teilweise zurückweicht, ein Nachgehen, das doch wieder bis zu einem gewissen Grade zugreift. » Wir verlangen, daß auch der Philosoph von Huttens Geist beseelt sei und ein kräftiges und entschlossenes Wir hätten gewünscht, daß dieser deutsche Denker, der in Österreich geboren ist, auch hier eine angemessene Stätte seines Wirkens gefunden hätte. Sein kühner freier Sinn hat ihn in seinem engeren Vaterlande unmöglich gemacht. Wahrlich, er wäre hier der akademischen Bürgerschaft ein Vorbild geworden in der Hoch-haltung unserer idealen Güter und in dem Hasse gegen alles Schlechte und Halbe. Nicht überall aber liebt man freies, rückhaltloses Auftreten, und so mußte Volkelt wandern. Er fand zuerst an der Universitat in Jena, dann in Basel, wo er heute lebt, eine Wirkensstätte.
Weder der künftige Geschichteschreiber der Philosophie noch der Kulturhistoriker wird dem Namen Volkelts einen Ehrenplatz verweigern können.
DIE GEISTIGE SIGNATUR DER GEGENWART
Achselzuckend gedenkt unser heutiges Geschlecht jener Zeit, in der ein philosophischer Zug durch das ganze deutsche Geistesleben ging. Die gewaltige Zeitströmung, die am Ende des vorigen und am Anfang dieses Jahrhunderts die Geister ergriff und kühn sich die denkbar höchsten Aufgaben stellte, gilt gegenwärtig als eine bedauerliche Verirrung. Wer es wagt, zu widersprechen, wenn von den «Plaintastereien Fichtes», von den «wesenlosen Gedanken und Wortspielen» Hegels die Rede ist, wird einfach als Dilettant hingestellt, «der von dem Geiste der heutigen Naturforschung ebensowenig wie von der Gediegenheit und Strenge der philosophischen Methode eine Ahnung hat». Höchstens Kant und Schopenhauer finden Gnade bei unseren Zeitgenossen. Bei dem ersteren gelingt es nämlich, die etwas spärlichen philosophischen Brocken, die sich die moderne Forschung zugrunde legt, scheinbar aus seinen Lehren abzuleiten; der letztere hat neben seinen streng wissenschaftlichen Leistungen auch Arbeiten in leichtem Stil und über Dinge geschrieben, die auch dem Menschen mit dem bescheidensten geistigen Horizonte nicht zu entlegen zu sein brauchen. Für jenes Streben nach den höchsten Spitzen der Gedankenwelt aber, für jenen Schwung des Geistes, der auf wissenschaftlichem Gebiete unserer klassischen Kunstepoche parallel ging, fehlt jetzt der Sinn und das Verständnis. Das Bedenkliche dieser Erscheinung tritt erst hervor, wenn man in Erwägung zieht, daß ein dauerndes Abwenden von jener Geistesrichtung für die Deutschen ein Verlieren ihres Selbsts, ein Bruch mit dem Volksgeiste wäre. Denn jenes Streben entsprang einem tiefen Bedürfnisse des deutschen Wesens. Es fällt uns nicht ein, die mannigfachen Irrtumer und Einseitigkeiten, die Fichte, Hegel, Schelling, Oken und andere auf ihren kühnen Unternehmungen im Reich des Idealismus begangen haben, leugnen zu wollen, aber die Tendenz, von der sie beseelt waren, sollte in ihrer Großartigkeit nicht verkannt werden. Sie ist so recht dem Volke der Denker angemessen. Nicht der lebendige Sinn für die unmittelbare Wirklichkeit, für die Außenseite der Natur, der die Griechen zu ihren herrlichen, unvergänglichen Schöpfungen befähigte,
eignet dem Deutschen, dafür aber ein unablässiges Drängen des Geistes nach dem Grunde der Dinge, nach den scheinbar verborgenen, tieferen Ursachen der uns umgebenden Natur. Lebte sich der griechische Geist in einer wunderbaren Welt von Formen und Gestalten aus, so mußte der auf sich selbst zurückgezogene Deutsche, der weniger mit der Natur, dafür aber mehr mit seinem Herzen, mit seinem eigenen Innern Umgang pflegt, auch seine Eroberun-gen auf dem Gebiete der reinen Gedankenwelt suchen. Und darum war es deutsche Art, wie sich Fichte und seine Nachfolger der Welt und dem Lehen gegenüberstellten. Darum fanden ihre Lehren so begeisterte Aufnahme, darum wurde eine Zeitlang das ganze Leben der Nation davon ergriffen. Darum aber auch dürfen wir mit dieser Richtung des Geistes nicht brechen. Überwindung der Fehler, aber naturgemäße Entwickelung auf dem Grunde, der damals gelegt wurde, muß unsere Losung werden. Nicht was diese Geister fanden oder zu finden glaubten, aber wie sie sich den Aufgaben der Forschung gegenüberstellten, das ist das bleibend Wertvolle. Man hatte das Bedürfnis, in die tiefsten Geheimnisse des Welträtsels einzudringen, ohne Offenbarung, ohne auf den Zufall beschränkte Erfahrung, rein durch die dem eigenen Denken innewohnende Kraft, und man hatte die Überzeugung, daß das menschliche Denken jenes Aufschwunges fähig sei, der dazu notwendig ist. Wie anders liegen die Dinge heute? Man hat alles Vertrauen in das Denken verloren. Man betrachtet als einziges Werkzeug der Forschung die Beobachtung, die Erfahrung. Was nicht handgreiflich ist, das hält man für unsicher. Daß unser Denken, ohne am Gängelbande der Sinne zu hängen, rein auf sich selbst gestützt, tiefer in das Weltengetriebe blicken kann, als alle äußere Beobachtung es vermag, dafür hat man kein Verständnis. Man verzichtet überhaupt auf jegliche Lösung der großen Rätselfragen der Schöpfung und verschwendet unendliche Mühe auf die Detailforschung, die ohne große, leitende Gesichtspunkte denn doch keinen Wert hat. Man vergißt dabei nur, daß man sich mit dieser Ansicht einem Standpunkte nähert, den man längst überwunden zu haben glaubt. Die Abweisung alles Denkens und das Pochen auf die Erfahrung ist nämlich, tiefer erfaßt, ganz dasselbe
wie der blinde Offenbaaungsglaube der Religionen. Denn worauf beruht der letztere? Doch nur darauf, daß uns Wahrheiten fertig überliefert werden, die wir hinnehmen müssen, ohne daß wir die Gründe in unserem eigenen Denken abwägen sollen. Wir vernehmen die Botschaft, doch ist uns die Einsicht in die Gründe verwehrt. Nicht anders ist es beim blinden Erfahrungsglauben. Man soll bloß die Tatsachen sammeln, ordnen und so weiter, ohne auf die inneren Gründe einzugehen, so behaupten die Natur-forscher, so die strengen Philologen. Auch hier sollen wir die fertigen Wahrheiten ohne Einsicht in die hinter den Erscheinungen tätigen Kräfte einfach hinnehmen. Glaube, was Gott ge-offenbart hat, und forsche nicht nach den Gründen, so spricht die Theologie; registriere, was vor deinen Augen sich abspielt, aber denke nicht nach, was für Ursachen dahinter walten, denn das ist vergebens, so spricht die neueste Philosophie. Und erst auf dem Gebiete der Ethik, wohin sind wir da gelangt! Der rote Faden, der sich durch das Denken aller Geister der klassischen Periode unserer Wissenschaft hindurchzieht, ist die Anerkennung des freien Willens als der höchsten Macht des menschlichen Geistes. Diese Anerkennung ist das, was, recht erfaßt, uns den Menschen allein in seiner Würde erscheinen läßt. Die Religionen, die von uns Unterwerfung unter die Gebote verlangen, die uns eine äußere Macht gibt, und in dieser Unterwerfung allein das Sittliche sehen, setzen diese Würde herab. Es ist dem auf der höchsten Stufe organischer Entwickelung stehenden Wesen nicht angemessen, daß es sich willenlos in die Bahnen fügt, die ihm von einem anderen vorgezeichnet sind, es muß sich Richtung und Ziel seines Wirkens selbst vorschreiben. Nicht Geboten, sondern der eigenen Einsicht gehorchen, keine Macht der Welt anerkennen, die uns vorzuschreiben hätte, was sittlich ist, das ist die Freiheit in ihrer wahren Gestalt. Diese Auffassung macht uns zu Selbst-Herren unseres Schicksales. Von dieser Auffassung getragen sind Fichtes bedeutungsvolle Worte: «Brecht alle herab auf mich, und du Erde und du Himmel, vermischt euch in wildem Tumulte, und ihr Elemente alle, - schäumet und tobet und zerreibet im wilden Kampfe das letzte Sonnenstäubchen des Körpers, den ich mein
nenne: - mein Wille allein mit seinem festen Plane soll kühn und kalt über den Trünamern des Weltalls schweben; denn ich habe meine Bestimmung ergriffen, und die ist dauernder als ihr; sie ist ewig, und ich bin ewig wie sie.» Was der deutschen idealistischen Philosophie zugrunde lag: Bruch mit dem Dogma auf dem Gebiete des Denkens, Bruch mit dem Gebote auf jenem des Handelns, das muß das unverrückbare Ziel der weiteren Entwickelung sein. Der Mensch muß skh Glück und Befriedigung aus sich selbst schaffen und nicht von außen an sich herankommen lassenn Rein dem Unvermögen, sich auf ein energisches Selbst zu stützen und von da aus kräftig zu wirken, entspringt der Pessimismus und was sonst noch an Thulichen Zeitkrankheiten auftritt. Man weiß sich keine bestimmten Lebensaufgaben zu stellen, denen man gewachsen wäre, man träumt sich in unbestimmte, unklare Ideale hinein und klagt dann, wenn man nicht erteicht, wovon man eigentlich keine Vorstellung hat. Man frage einen der Pessimisten unserer Tage, was er denn eigentlich wolle und woran er verzweifelt? Er weiß es nicht. Man glaube nicht, daß ich hiermit etwa Eduard von Hartmanns Pessimismus tteffen will, der mit dem gewöhnlichen Gejammer über das Elend des Lebens nichts gemein hat. (Wie hoch ich Hartmanns Weltanschauung steile, ersehe man aus der Einleitung zum zweiten Bande meiner Ausgabe von Goethes wissenschaftlichen Schriften. Kürschners Deutsche National-Literatur.)
Bei allen Fortschritten, die wir auf den verschiedensten Gebieten der Kultur zu verzeichnen haben, können wir uns doch nicht entschlagen, daß die Signatur unseres Zeitalters viel, sehr viel zu wünschen übrig läßt. Unsere Fortschritte sind zumeist nur solche in die Breite und nicht in die Tiefe. Für den Gehalt eines Zeitalters sind aber nur die Fortschritte in die Tiefe maßgebend. Es mag sein, daß die Fülle der Tatsachen, die von allen Seiten auf uns eingedrungen sind, es begreiflich erscheinen läßt, daß wir über dem Blick ins Weite den in die Tiefe augenblicklich verloren haben, wir möchten nur wünschen, daß der abgerissene Faden fortschreitender Entwickelung bald wieder angeknüpft und die neuen Tatsachen von der einmal gewonnenen geistigen Höhe aus erfaßt werden.
GOETHE ALS ÄSTHETIKER
Die Zahl der gegenwärtig erscheinenden Schriften und Abhandlungen, die sich zur Aufgabe machen, das Verhältnis Goethes zu den einzelnen Zweigen der modernen Wissenschaften und zu den verschiedenen Äußerungen unseres Geisteslebens überhaupt zu untersuchen, ist eine erdrückende. Hierinnen spricht sich die erfreuliche Tatsache aus, daß immer weitere Kreise von dem Bewußtsein ergriffen werden: wir stehen in Goethe einem Kultur-faktor gegenüber, mit dem sich alles auseinandersetzen muß, was an dem geistigen Leben der Gegenwart teilnehmen will. Wer den Funkt nicht findet, wo er sein eigenes Streben an diesen größten Geist der neueren Zeit anzuknüpfen vermag, der kann sich nur führen lassen von der übrigen Menschheit wie ein Blinder; bewußt, mit voller Klarheit den Zielen zusteuern, welche die Kulturentwickelung der Zeit einschlägt, kann er nicht. Aber gerade die Wissenschaft wird Goethe nicht überall gerecht. Es fehlt an der hier mehr als irgendwo notwendigen Unbefangenheit, um sich erst in die volle Tiefe des Goetheschen Genius zu versenken, bevor man sich auf den kritischen Stuhl setzt. Man glaubt, weit über Goethe hinaus zu sein, weil die einzelnen Ergebnisse seiner Forschung von denen der heutigen Wissenschaft; die eben mit vollkommeneren Hilfsmitteln und einer reicheren Erfahrig arbeitet, überholt sind. Aber wir sollten über diese Einzelheiten hinaus den Blick auf seine umfassenden Prinzipien, auf seine großartige Weise, die Dinge anzuschauen, richten. Wir sollten uns seine Art zu denken, seine Art, die Probleme zu stellen, an-eignen, um dann mit unseren reicheren Mitteln und unserer ausgebreiteteren Erfahrung in seinem Geiste weiterbauen zu können. Goethe selbst hat das Verhältnis seiner wissenschaftlichen Resultate zum Fortschritte der Forschung in einem trefflichen Bilde veranschaulicht. Er bezeichnet sie als Steine, mit denen er sich auf dem Schachbrette vielleicht zu weit vorgewagt habe, aus denen man aber den Plan des Spielers erkennen sollte. Dieser Plan, mit dem er den Wissenschaften, denen er sich gewidmet hat, neue, großartige Impulse gegeben hat, ist eine bleibende Errungenschaft,
der man das größte Unrecht antut, wenn mm sie von oben herab behandelt. Aber unsere Zeit hat das Eigentümliche, daß ihr die produktive Kraft des Genies fast bedeutungslos erscheint. Wie sollte es auch anders sein in einer Zeit, in der jedes Hinausgehen über die tatsächliche Erfahrung in der Wissenschaft von so vielen verpönt ist! Zum bloßen Beobachten braucht man nichts als gesunde Sinne, und Genie ist dazu ein recht entbehrliches Ding.
Aber der wahre Fortschritt in den Wissenschaften wie in der Kunst ist niemals durch bloßes Beobachten oder sklavisches Nachahmen der Natur bewirkt worden. Gehen doch Tausende und aber Tausende an einer Tatsache vorüber, dann kommt einer und macht an derselben die Entdeckung eines großartigen wissenschaftlichen Gesetzes. Eine schwankende Kircheulampe hat wohl mancher vor Galilei beobachtet, doch diesem genialen Kopfe war es vorbehalten, daran die für die Physik so bedeutungsvollen Pendelgesetze zu entdecken. «Wär' nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken!> ruft Goethe aus, und er will damit sagen, daß nur der in die Tiefen der Natur zu blicken vermag, der die hiezu nötigen Anlagen hat und die produktive Kraft, im Tatsächlichen mehr zu sehen als die bloßen Tatsachen.
Von diesen Grundsätzen ausgehend, muß die bloß philologische und kritische Goethe-Forschung, der ihre Berechtigung abzusprechen ja eine Torheit wäre, ihre Ergänzung finden. Wir müssen auf die Tendenzen, die Goethe hatte, zurückgehen, und von den Gesichtspunkten aus, die er gezeigt hat, wissenschaftlich weiterarbeiten. Wir sollen nicht bloß über seinen Geist, sondern in seinem Geiste forschen.
Hier soll gezeigt werden, wie eine der jüngsten und am meisten umstrittenen Wissenschaften, die Ästhetik, im Sinne der Goetheschen Weltanschauung aufgebaut werden muß. Diese Wissenschaft ist kaum über ein Jahrhundert alt. Mit dem bestimmten Bewußtsein, damit ein neues wissenschaftliches Gebiet zu eröffnen, trat 1750 Alexander Gottlieb Baumgarten mit seiner «Aesthetica» hervor. Was vorher über diesen Zweig des Denkens geschrieben worden ist, kann nicht einmal als elementarer Ansatz zu einer Kunstwissenschaft bezeichnet werden. Weder die griechischen
noch die mittelalterlichen Philosophen wußten wissenschaftlich mit der Kunst etwas anzufangen. Der griechische Geist fand alles, was er suchte, innerhalb der Natur, es gab für ihn keine Sehnsucht, die von dieser guten Mutter nicht befriedigt worden wäre. Er verlangte nichts über die Natur hinaus, daher brauchte ihm auch die Kunst nichts darüber zu bieten; sie mußte dieselben Bedürfnisse wie die Natur, nur in höherem Maße, befriedigen. Man fand alles, was man suchte, in der Natur, deshalb brauchte man in der Kunst nichts als die Natur zu erreichen. Aristoteles kennt deswegen kein anderes Kunstprinzip als die Naturnachahmung. Plato, der große Idealist der Griechen, erklärte die bildende Kunst und die Dramatik einfach für schädlich. Von einer selbständigen Aufgabe der Kunst hat er so wenig einen Be-griff, daß er der Musik gegenüber nur deshalb Gnade für Recht ergehen läßt, weil sie die Tapferkeit im Kriege befördert. - Da-bei konnte es nur so lange bleiben, als der Mensch nicht wußte, daß in seinem Innern eine der äußeren Natur mindestens ebenbürtige Welt lebt. In dem Augenblicke aber, in dem er diese selbständige Welt gewahr wurde, mußte er sich losmachen von den Fesseln der Natur, er mußte ihr gegenüberstehen als ein freies Wesen, dem nicht mehr sie seine Wünsche und Bedürfnisse an-erschafft. Ob jetzt diese neue Sehnsucht, die nicht innerhalb der bloßen Natur erzeugt, auch noch durch die letztere befriedigt werden kann, bleibt fraglich. Damit sind die Konflikte des Ideals mit der Wirklichkeit, des Gewollten mit dem Erreichten, kurz alles dessen gegeben, was eine Menschenseele in ein wahres geistiges Labyrinth führt. Die Natur steht uns gegenüber da seelenlos, bar alles dessen, was uns unser Inneres als ein Göttliches ankündigt. Die nächste Folge wird ein Abwenden von aller Wirklichkeit sein, die Flucht vor dem unmittelbar Natürlichen. Diese Flucht zeigt uns die Weltanschauung des christlichen Mittelalters, sie ist das gerade Gegenteil des Griechentums. So wie letzteres aller in der Natur gefunden hat, so findet diese Auffassung gar nichts mehr in ihn Auch jetzt war eine Kunstwissenschaft nicht möglich. Die Kunst kann ja doch nur mit den Mitteln der Natur arbeiten, und die christliche Gelehrsamkeit konnte es nicht fassen,
wie man innerhalb der gottlosen Wirklichkeit Werke schaffen kann, die den nach Göttlichem strebenden Geist befriedigen können. Aber die Hilflosigkeit der Wissenschaft tat nie der Kunstenrwickelung Abbruch. Während die erstere nicht wußte, was sie darüber denken solle, entstanden die herrlichsten Werke christlicher Kunst.
Zur Entstehung der Ästhetik war eine Zeit notwendig, in der der Geist, zwar frei und unabhängig von den Banden der Natur, sein Inneres, die Idealwelt, in voller Klarheit erblickt, und die Idee ihm Bedürfnis geworden ist, in der aber auch schon wieder ein Zusammengehen mit der Natur möglich ist. Dieses Zusammengehen kann sich nun freilich nicht auf die Summe von Zufälligkeiten beziehen, aus denen die Welt zusammengesetzt ist, die uns als Sinnenwelt gegeben ist, und von der der Grieche noch vollkommen befriedigt war. Hier finden wir ja nichts als Tatsachen, die ebensogut auch anders sein könnten, und wir suchen das Notwendige, von dem wir begreifen, warum es so sein muß; wir sehen nichts als Individuen, und unser Geist strebt nach dem Gattungsmäßigen, Urbildlichen; wir sehen nichts als Endliches, Vergängliches, und unser Geist strebt nach dem Unendlichen, Unvergänglichen, Ewigen. Wenn der der Natur entfremdete Menschengeist wieder zur Natur zurückkehren sollte, so mußte es zu etwas anderem sein als zu jener S'amme von Zufälligkeiten. Und diese Rückkehr bedeutet Goethe: Rückkehr zur Natur, aber Rückkehr mit dem vollen Reichtum des entwickelten Geistes, mit der Bildungshöhe der neuen Zeit. Goethes Anschauung entspricht die grundsätzliche Trennung von Natur und Geist nicht; er will in der Welt ein großes Ganzes erblicken, eine einheitliche Entwickelungskette von Wesen, innerbalb welcher der Mensch ein Glied, wenn auch das höchste, bildet. Es handelt sich um ein Hinausgehen über die unmittelbare, sinnenfällige Natur, ohne sich im geringsten von dem zu entfernen, was das Wesen der Natur ausmacht. Er tritt pietätvoll auf die Wirklichkeit zu, weil er an ihren idealen Gehalt glaubt. Die Natur von einem einheitlichen Entwickelungszentrum aus als ein schaffendes Ganzes zu überblicken und das Hervorgehen des Einzelnen aus dem Ganzen im
Geiste nachzuschaffen, das ist die Aufgabe. Nicht auf das fertig gewordene Einzelne, sondern auf das Naturgesetz, nicht auf das Individuum, sondern auf die Idee, den Typus, der uns jenes erst begreiflich macht, kommt es an. Bei Goethe kommt diese Tatsache in der denkbar vollkommensten Forrn zum Ausdrucke. Was wir aber gerade an seinem Verhalten der Natur gegenüber lernen können, das ist die unumstößliche Wahrheit, daß für den modernen Geist die unmittelbare Natur keine Befriedigung bietet, weil wir nicht schon in ihr, wie sie als Erfahrungswelt ausgebreitet vor unseren Sinnen liegt, sondern erst dann das Höchste, die Idee, das Göttliche erkennen, wenn wir über sie hinausgehen. In der von aller Wirklichkeit losgelösten, rein ideellen Form ist nun die Kants. Die hierinnen ausgesprochenen Ideen in Verbindung mit der großartigen Ausgestaltung, die sie durch Schiller (in den «Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen») erfahren haben, sind der Grundstein der Ästhetik. Kant findet, daß nur dann das Wohlgefallen an einem Objekte ein rein ästhetisches ist,
wenn es unbeeinflußt ist von dem Interesse am realen Dasein desselben, so daß die reine Lust am Schönen nicht durch die Einmischung des Begehrungsvermögens, das nur nach Zweck und Nutzen fragt und die Welt darnach beurteilt, getrübt wird. Schiller findet nun, daß die geistige Tätigkeit, die sich im Schaffen und Genießen des Schönen auslebt, sich darinnen kennzeichnet, daß sie weder durch eine Naturnotwendigkeit gebunden ist, an die wir uns zu halten haben, wenn wir einfach die Erfahmngswelt auf unsere Sinne einwirken lassen, noch daß sie einer logischen Notwendigkeit untersteht, die sofort in Betracht kommt, wenn wir zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung oder technischer Verwertung der Naturkräfte (zum Beispiel beim Bau einer Maschine) an die Wirklichkeit herantreten. Der Künstler gehorcht nun weder einseitig der Naturnotwendigkeit noch der Vernunftnotwendigkeit. Er gestaltet die Dinge der Außenwelt so um, daß sie erscheinen, als ob ihnen schon der Geist eingeboren wäre, und den Geist behandelt er so, als ob er unmittelbar natürlich wirkte.
Dadurch entsteht der ästhetische Schein, in dem sowohl die Natur- wie die Vernunftnotwendigkeit aufgehoben ist; jene, weil sie nicht ohne Geist, und diese, weil sie aus ihrer ideellen Höhe herabgestiegen ist und wie Natur wirkt. Die Werke, die dadurch entstehen, sind nun freilich nicht naturwahr im gewöhnlichen Sinne des Wortes, weil ja in der Natur sich Idee und Wirklichkeit nirgends decken, aber sie müssen Schein sein, wenn sie wahr-hafte Kunstwerke sein sollen. Mit dem Begriffe des Scheines in diesem Zusammenhange steht Schiller als Ästhetiker einzig da, unübertroffen, ja unerreicht. Hier hätte die Ästhetik anknüpfen und von da aus weiterbauen sollen. Statt dessen tritt Schelling mit einer vollständig verfehlten Grundansicht auf den Plan und leitet die Ästhetik damit auf einen Irrweg, so daß sie sich nie wieder zurechtgefunden hat. Der Nestor unserer Schönheitswissenschaft, Friedrich Theodor Vischer, hat bis an sein Lebensende, trotzdem er selbst eine fünibändige Ästhetik geschrieben, an der Überzeu-gung festgehalten: Ästhetik liegt noch in den Anfängen. Wie alle moderne Philosophie, so findet auch Schelling die Aufgabe des höchsten menschlichen Strebens in dem Erfassen der ewigen Urbilder
der Dinge. In ihnen sei alle Wahrheit und Schönheit enthalten. Die wahre Schönheit sei also etwas Übersinnliches und das Kunstwerk, das ja das Schöne im Sinnlichen erreichen will, nur ein Abglanz jenes ewigen Urbildes. Das Kunstwerk ist nach Schelling nicht um seiner selbst willen schön, sondern darum, weil es die Idee der Schönheit abbildet. Die Kunst hat da keine andere Aufgabe, als die Wahrheit, wie sie auch in der Wissenschaft enthalten ist, objektiv zu verkörpern, zu veranschaulichen. Worauf es da ankommt, woran sich unser Wohlgefallen am Kunstwerke knüpft, das ist die ausgedrückte Idee. Das sinnliche Bild ist nur Ausdrucksmittel für einen übersinnlichen Inhalt. Und hierinnen folgen alle Ästhetiker der idealisierenden Richtung Schellings. Weder Hegel und Schopenhauer, noch ihre Nachfolger sind in diesem Punkte weitergekommen.* Wenn Hegel sagt: - - -
* Auch die Ausführungen Eduard von Hanmanns über Hegel in seiner groß angelegten, geistvollen Ästhetik können mich in dieser Üherzengnng nicht erschüttern, und die im Text angeführten Zitate sprechen durchaus für mich.
poetische Gestalt zu geben, während die anderen nur das sogenannte Imaginative zu verkörpern suchen, was dummes Zeug gebe. Damit ist ein Kunstprinzip angedeutet, das Goethe im zweiten Teil des «Faust> mit den Worten ausspricht: Es ist damit klar gesagt, woran in der Kunst alles liegt. Nicht um das Verkörpern eines Übersinnlichen, sondern um das Umgestalten des Sinnlichen, des Tatsächlichen handelt es sich. Das Wirkliche soll nicht zum Ausdrucksmittel herabsinken, nein, es soll in seiner Selbständigkeit bestehen bleiben, nur soll es eine neue Gestalt bekommen, eine Gestalt, in der es unser Bedürfnis nach dem Notwendigen, Urbildlichen befriedigt. Nicht die Idee in dem Sinnlichen soll der Grund unseres Vergnügens, unserer Erhebung am Kunstwerke sein, sondern der Umstand, daß hier ein Wirkliches, ein Individuelles so erscheint wie die Idee. In der Natur treten uns die Gegenstände eben nie so entgegen, wie sie ihrer Idee entsprechen, sondern gehemmt, beeinflußt von allen Seiten von Kräften, die mit dem Keime im Innern derselben nichts zu tun haben. Das Äußere deckt sich nicht mit dem Innern, die Natur erreicht nicht, was sie gewollt. Der Künstler beseitigt nun alle diese Gründe der Unvollkommenheit und stellt das Einzel-ding so vor unser Auge, wie wenn es Idee wäre. Der Künstler schafft Objekte, die vollkommener sind, als sie ihrem Naturdasein nach sein können, aber es ist doch nur die eigene Vollkommenheit der Wesen, die er anschaulich macht, zur Darstellung bringt. In diesem Hinausgehen eines Gegenstandes über sich selbst, aber doch nur auf Grund dessen, was schon in ihm verborgen ist, liegt das Schöne. Goethe kann mit Recht sagen: «Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben», und «Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehllche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegetin, der Kunst>. Das Schöne soll nicht eine Idee verkörpern, sondern einem Wirklichen eine solche Gestalt verleihen, daß es vollkommen und göttlich wie eine Idee vor unsere Sinne tritt.
Das Schöne ist Schein, weil es eine Wirklichkeit vor unsere Sinne zaubert, die sich als solche wie die Ideenwelt selbst darstellt.
Das Was bleibt ein sinnliches, aber das Wie des Auftretens wird ein ideelles. Eine Welt der ideellen Vollkommenheit liefert uns die Wissenschaft; diese können wir aber bloß denken; eine Welt mit dem Charakter derselben Vollkommenheit ausgestattet, die aber anschaulich ist, tritt uns in dem Schönen gegenüber. Eduard von Hartmann, der neueste Bearbeiter der Ästhetik, der in seiner ein sehr verdienstliches Werk geschaffen hat, sagt ganz richtig, der Grundbegriff, von dem alle Schönheitsbetrachtung auszugehen hat, sei der Begriff des ästbetischen Scheines. Aber die Ideenwelt als solche kann niemals als Schein betrachtet werden, gleichviel, in welcher Form sie erscheint. Ein wirklicher Schein aber ist es, wenn das Natürliche, Individuelle in einer ewigen, unvergänglichen Form, ausgestattet mit den Charakteren der Idee erscheint, denn eine solche Form kommt dem Natürlichen als solchem nicht zu. Die Ästhetik nun, die von dieser Ansicht ausgeht, besteht dermalen noch nicht. Sie kann schlechterdings bezeichnet werden als «Ästhetik der Goetheschen Weltanschauung»; und sie ist die Ästhetik der Zukunft.
ÜBER DEN GEWINN UNSERER ANSCHAUUNGEN VON GOETHES NATURWISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN DURCH DIE PUBLIKATIONEN DES GOETHE-ARCHIVS
Die Fragen, die sich dem Betrachter von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften aufdrängen, waren nach dem bisher vor-liegenden Materiale nicht leicht zu beantworten. Der Grund hiervon ist darinnen zu suchen, daß wir es nur auf dem Gebiete der Farbenlehre mit einem völlig ausgearbeiteten, nach allen Seiten hin abgeschlossenen Werke des Dichters aus dem Kreise der Naturwissenschaft
zu tun haben. Aus den anderen Teilen derselben liegen nur mehr oder weniger ausgeführte Aufsätze vor, die zu den verschiedensten Problemen Stellung nehmen, von denen aber nicht zu leugnen ist, daß sie scheinbar schwer zu vermittelnde Widersprüche darbieten, wenn es sich darum handelt, eine allseitig umfassende Anschauung von Goethes Bedeutung auf diesem Gebiete zu gewinnen. Die wichtigsten Punkte, die hierbei in Betracht kommen, wurden daher von den sich an der Sache beteiligenden Forschern in der denkbar verschiedensten Weise aufgefaßt. War Goethe Deszendenztheoretiker? Nahm er eine wirkliche Umwandlung der Arten an, und welchen Ursachen schrieb er sie zu? Dachte er bei seinem «Typus» an ein sinnenfällig-reales Wesen oder an eine Idee? Das sind Fragen, über die wir in den letzten Jahrzehnten von verschiedenen Seiten einander völlig widersprechende Antworten hören konnten. Von der Behauptung, daß Goethe bei seinem «Typus» nur an einen abstrakten Begriff im platonischen Sinne gedacht habe, bis zu jener, daß er als ein echter Vorgänger Darwins anzusehen sei, fanden alle Zwischenstufen ihre Vertreter. Während ihn die einen verlästerten als einen Menschen, der über die Natur bloß phantasiert habe, stimmten die andern sein Lob an, weil er zuerst jene Richtung in der Naturwissenschaft eingeschlagen habe, die heute als die allein zurn Ziele führende angesehen wird.
Man muß gestehen, daß die Verteidiger aller dieser Ansichten für ihre jeweiligen Ausführungen Belegstellen aus Goethes Werken genugsam aufzubringen wußten. Dabei darf freilich nicht übersehen werden, daß in jedem Falle nur das gerade Passende ausgewählt und andere Stellen, die zu einer gegenteiligen Meinung berechtigen, einfach verschwiegen wurden. Wir sind weit davon entfernt, daraus irgend jemandem einen Vorwurf zu machen, haben vielmehr die Überzeugung, daß das bisher Vorliegende eine widerspruchsfreie Auffassung der Sache äußerst schwierig machte, wenn wir auch die Unmöglichkeit einer solchen nicht zugeben können.
Für alle jene, die ein Interesse an dieser Seite Goetheschen Schaffens haben, mußte nach diesem Stande der Dinge in dem
Augenblicke, als die Schätze des Goethe-Archivs zugänglich wurden, die Frage entstehen: bieten die hinterlassenen Papiere des Dichters hier eine Ergänzung? Der Schreiber dieser Zeilen findet nun bei einem eingehenden Studium derselben, daß uns aus ihhen gerade in bezug auf die oben angegebenen Gesichtspunkte die überraschendsten Aufschlüsse werden, die ganz geeignet sind, eine volle Befriedigung in dieser Richtung herbeizuführen.
Die hohe Besitzerin des Archivs, die Frau Großherzogin von Sachsen, hat mir gnädigst gestattet, die vorhandenen Materialien zum Behufe einer vorläufigen orientierenden Arbeit auf diesem Gebiete zu benützen, und so ist denn dieser Aufsatz entstanden, zu dem die notwendigen Beweismittel unter fortwährender liebe-voller Mithilfe des Direktors des Goethe- und Schiller-Archivs, Prof. Suphan, aus den Schätzen des Archivs ausgewählt wurden.
Wir wollen hier von der Farbenlehre und den geologischen und meteorologischen Schriften vorläufig absehen und uns auf die morphologischen Arbeiten beschränken, die ja für die angedeuteten Probleme die allerwichtigsten sind. Zweck unserer Ausführungen soll sein, in allgemeinen Umrissen zu zeigen, was wir von der Publikation der noch ungedruckten Aufsätze und Fragmente Goethes auf diesem Gebiete für die Klarstellung von des Dichters Bedeutung im Bereiche der Wissenschaft des Organischen zu erwarten haben. Wir werden so viel wie möglich vermeiden, auf zeitgenössische Ansichten über diese Dinge einzugehen, und uns jeder Polemik enthalten. Für diesmal möge es genügen, die Ansichten Goethes, ohne alle Seitenblicke auf andere, rein an sich selbst darzustellen.
Vor allen übrigen Dingen müssen wir aber einen Irrturn zurückweisen, der tief eingewurzelt ist und mit dem Goethe schon bei seinen Lebzeiten vielfach zu kämpfen hatte. Derselbe gipfelt in der Annalune, daß der Dichter zu seinen wissenschaftlichen Ergebnissen nicht durch methodische, folgerichtige Gedankenarbeit, sondern «im flüchtigen Vorübergehen», durch einen «glücklichen Einfall» gekommen sei. Goethe hat die «Geschichte seiner botanischen Studien» hauptsächlich aus dem Grunde ausführlich beschrieben, weil er «anschaulich machen» wollte, wie er «Gelegenheit
gefunden, einen großen Teil seines Lebens mit Neigung und Leidenschaft auf Naturstudien zu verwenden».*
Man kann sich keine bessere Illustration dieses letzten Satzes denken als die im Archive aufbewahrten Blätter, die uns einen Einblick gewähren in den Gang von Goethes botanischen Arbeiten wahrend seiner italienischen Reise. Wir sehen aus denselben, wie er sich durch unzählige Beobachtungen und durch gewissenhafte an den Naturobjekten angestellte Überlegungen zur endlichen Klarheit durchringt. Das sind Aufzeichnungen, die durchaus auf das Gegenteil von zufälligen Einfällen oder einem flüchtigen Vorübereilen deuten, sondern vielmehr auf sorgfältiges und bedächtiges schrittweises Hinstreben zu den vorgezeichneten Zielen. Unermüdiich ist Goethe damit beschäftigt, Pflanzenexemplare ausfindig zu machen, die in irgendeiner Weise geeignet sind, in die Gesetze des Wachstums und der Fortpflanzung hineinzuleiten. Besonders Charakteristisches wird gezeichnet, um im lebendigen Nachbilden die Geheimnisse der Naturwirksamkeit zu entdecken. Wir finden mit großer Vorsicht Beobachtungen notiert, die über die Bedeutung der einzelnen Organe, über den Einfluß des Klimas und der Umgebung der Pflanzen gemacht worden sind. Glaubte Goethe irgendeinem Gesetze auf der Spur zu sein, so stellte er es vorerst in hypothetischer Form auf, um es so als Leitfaden bei weiteren Beobachtungen zu gebrauchen. Es soll auf diese Weise entweder befestigt oder widerlegt werden. Solchen Hypothesen teilt er eine ganz besondere Aufgabe bei der wissenschaftlichen Forschung zu. Wir entnehmen darüber einer ungedruckten Auf-zeichnung folgendes:
Diese Worte bezeichnen seine wissenschaftliche Gesinnung, die sich wohl davor hütet, eine flüchtige Bemerkung für ein Naturgesetz hinzunehmen.
- - -
* Siehe den Schluß des Aufsatzes: «Geschichte meines botanischen Stu-diums», in Kürschners «Deutsche National-Literatur», Goethes Werke, Band XXXIII, S. 84.
Die Blätter, auf denen Goethe seine naturwissenschaftlichen Notizen während der italienischen Reise rnachte, gehörten kleinen Heftchen an, die aber auseinandergerissen vorgefunden wurden, gleich andern Papieren mit Aufzeichnungen aus derselben Zeit, zum Beispiel solchen zur «Nausikaa». Die letzteren wurden von Prof. Suphan immer zu dem jeweiligen Zwecke geordnet; ein gleiches ist nun auch mit den zur Naturwissenschaft gehörigen geschehen.
Goethe blieb mit seinen Beobachtungen oft ziemlich lange im Dunkeln, und er wollte das, um eine möglichst breite Basis für seinen theoretischen Aufbau zu gewinnen. Er studiert die Vorgänge der Keimung, der Befruchtung, beobachtet die verschiedenen Formen der Organe und deren Verwandlungen. Wir können Sätze, die später integrierende Teile seiner Metamorphosenlehre geworden sind, hier in diesen Papieren in ihrer ersten Gestalt, wie er sie gleichsam an den Naturvorgängen unmittelbar abliest, sehen, zum Beispiel: «Die Pflanze muß eine Menge wäßriger Feuchtigkeit haben, damit die Öle, die Salze sich darinnen verbinden können. Die Blätter müssen diese Feuchtigkeit abziehen, vielleicht modifizieren.» Oder:
«Was das Erdreich der Wurzel ist, wird nachher die Pflanze den feinern Gefäßen, die sich in die Höhe entwickeln und aus der Pflanze die feinern Säfte aussaugen.»
«Aloe ... werden die Blätter durch die Luft ausgedehnt und verdrängen die Zwischenräume ... unter der Erde sind die Blätter klein, die Zwischenräume größer.»
Nachdem Goethe sich auf diese Weise durch eine Reihe von Beobachtungen durchgearbeitet hat, drängt sich ihm seine spätere Anschauung als Hypothese auf. Wir finden auf einem Blatte die Notiz: «Hypothese. Alles ist Blatt und durch diese Einfachlaeit wird die größte Mannigfaltigkeit möglich.»
Diese Hypothese verfolgt er nun weiter. Wo ihn ein Erfahrungsfall über irgend etwas im unklaren läßt, da notiert er ihn gewissenhaft, um an einem günstigeren sich den nötigen Aufschluß zu holen. Solchen unklar gebliebenen und für zukünftige Beobachtungen aufgesparten Fragen begegnen wir sehr häufig.
Jedenfalls liefern diese Blätter den Beweis, daß eine lange Gedankenarbeit und eine nicht kleine Summe von Erfahrungen hinter Goethe lagen, als er endlich Mitte 1787 die Hypothese von der Urpflanze zur entschiedenen Überzeugung erhob. Wie er die-selbe nun weiter verfolgte, die eingeschlagene Betrachtungsart auch auf die ührigen Organismen ausdehnte und 1790 den ersten Versuch in dieser Richtung veröffentlichte, habe ich in der Ein-leitung zu meiner Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften (Goethes Werke, in Kürschners «Deutsche National-Literatur>, Band XXXIII) ausführlich dargestellt.
Hier wollen wir uns sogleich zu der Frage wenden: was versteht Goethe unter «Urpflanze»? Er schreibt am 17. April 1787 in Palermo über dieselbe die Worte nieder: «Eine solche muß es doch geben; woran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet wären.»* Dieser Satz liefert den Beweis, daß unter der Urpflanze jenes Etwas zu verstehen ist, welches dem menschlichen Geiste als das Gleiche in allen den für die sinnen-fällige Anschauung verschiedenen Pflanzenformen entgegentritt. Wir wären nicht imstande zu erkennen, daß alle diese Formen zusammengehören, daß sie ein Naturreich bilden, wenn wir die «Urpflanze> nicht erfassen könnten.
Wenn wir uns dies vergegenwärtigen, so können wir uns auch sogleich einen Begriff davon machen, was sich Goethe unter Erfahrung dachte. Er wollte nicht nur das sorgfältig beobachten, was der Sinneswahrnehmung erreichbar ist, sondern er strebte zugleich nach einem geistigen Inhalte, der ihm gestattete, die Objekte derselben ihrer Wesenheit nach zu bestimmen. Diesen geistigen Inhalt nun, wodurch ilun ein Ding heraustrat aus der Dumpfheit des Sinnendaseins, aus der Unbestinuntheit der äußeren Anschauung und zu einem bestimmten wurde (Tier, Pflanze, Mineral), nannte er Idee. Nichts anderes kann man aus den oben angeführten Worten herauslesen, und wir sind außerdem noch imstande, unsere Behauptung durch folgenden bisher ungedruckten Ausspruch
- - -
* Siehe Italienische Reise (Kürschners ,Deutsche National-Literatur»), Gcethes Werke, Band XXI, 1. Abteilung, S. 336.
zu erhärten: «Durch die Pendeischläge wird die Zeit, durch die Wechselbewegung von Idee zu Erfahrung die sittliche und die wissenschaftliche Welt regiert.»
Was sollte Goethe mit diesen Worten meinen, wenn nicht dieses, daß die Wissenschaft sich mit der Erfahrung nicht begnügen kann, sondern über diese hinaus zur Idee fortschreiten muß? Die Idee soll ja bestimmen, was das Erfahrungsobjekt ist; sie kann also nicht mit demselben identisch sein. Daß nun Goethe dem Geiste eine wesentlich tätige Rolle bei Hervorbringung der Ideen zuschrieb, geht aus folgender interessanten Einteilung der Wissensarten hervor:
«Um uns in diesen verschiedenen Arten* einigerrnaßen zu orientieren, wollen wir sie einteilen in: Nutzende, Wissende, Anschauende und Umfassende.
1. Die Nutzenden, Nutzensuchenden, Fordernden sind die ersten, die das Feld der Wissenschaft gleichsam umreißen, das Praktische ergreifen. Das Bewußtsein durch Erfahrung gibt ihnen Sicherheit, das Bedürfnis eine gewisse Breite.
2. Die Wißbegierigen bedürfen eines ruhigen, uneigennützigen Blickes, einer neugierigen Unruhe, eines klaren Verstandes und stehen immer irn Verhältnis mit jenen; sie verarbeiten auch nur im wissenschaftlichen Sinne dasjenige, was sie vorfinden.
3. Die Anschauenden verhalten sich schon produktiv, und das Wissen, indem es sich selbst steigert, fordert, ohne es zu bemerken, das Anschauen und geht dahin über, und so sehr sich auch die Wissenden vor der Imagination kreuzigen und segnen, so müssen sie doch, ehe sie sichs versehen, die produktive Einbildungs-kraft zu Hilfe rufen.
4. Die Umfassenden, die man in einem stolzern Sinne die Er-schaffenden nennen könnte, verhalten sich im höchsten Grade prc> duktiv; indem sie nämlich von Ideen ausgehen, sprechen sie die Einheit des Ganzen schon aus, und es ist gewissermaßen nach-her die Sacbe der Natur, sich in diese Idee zu fügen.»
- - -
* der Menschen nach den Arten ihres Wissens und ihres Verhaltens zur Außenwelt.
Was auf der obersten Stufe des Erkennens eigentlich erst in die Rätsel der Natur hineiiiäären soll, das muß der Geist schaflcnd den Dingen der Sinneswalrrnehnaung entgegenbringen. Ohne diese produktive Kraft bleibt unsere Erkenntnis auf einer der unteren Stufen stehen.*
Goethe stellt sich somit unter der Urpflanze eine Wesenheit vor, die in unserem Geist nicht gegenwärtig werden kann, wenn sich derselbe bloß passiv der Außenwelt gegenüber verhält. Was aber nur durch den menschlichen Geist in die Erscheinung treten kann, muß deshalb noch nicht notwendig aus dem Geiste stammen. Hier liegt nämlich eine irrtünliche Auffassung sehr nahe. Es ist für die Mehrzahl der Menschen unmöglich, sich vorzustellen, daß etwas, zu dessen Erscheinung durchaus subjektive Bedingungen notwendig sind, doch eine objektive Bedeutung und Wesenheit haben kann. Und gerade von dieser letzteren Art ist die «Urpflanze». Sie ist das objektiv in allen Pflanzen enthaltene Wesent liche derselben; wenn sie aber erscheinendes Dasein gewinnen soll, so muß sie der Geist des Menschen frei konstruieren.
Aber im Grunde ist diese Auffassung nur eine Fortbildung der Ansicht, welche die moderne Naturwissenschaft auch auf dem Gebiete der Sinnesempfindung vertritt. Ohne die Konstitution und Wirksamkeit des Auges gäbe es keine Farbenempfindung, ohne die des Ohres keinen Ton. Dennoch wird niemand behaupten wollen, daß nicht Farbe und Ton ihre durchaus objektive Bedeutung und Wesenheit haben. Wie man sich das nun näher vorstellen will: ob man als Anhänger der Undulationshypothese Schwingungen der Körperteile und des Athers beziehungsweise der Luft als die objektive Wesenheit von Farbe und Ton ansieht, oder ob man einer anderen Ansicht zuneigt, ist hier ohne Belang.
- - -
* Wenn auch die obigen Zeilen nicht aus der Zeit stammen, in der Goethe anfing Naturwissenschaft zu treiben, sondern wahrscheinlich aus dem Ende der neunziger Jahre, so können wir sie doch mit Recht an dieser Stelle anführen. Denn sie wurden eben in jener Epoche niedergeschrieben, wo der Dichter sich bereits seiner Forschung gegenüber reflektierend verhielt, wo er sein eigener Ausleger wurde. Sie sind also gerade dazu ge-eignet, zu zeigen, wie Goethe sein Verhalten der Natur gegenüber aufgefaßt wissen» will.
Wir legen nur Wert darauf, daß, trotzdem der moderne Physiologe überzeugt ist, daß die Sinnesempfindung nur durch die Tätigkeit des entsprechenden Sinnesorgans ins erscheinende, für uns wahrnehmbare Dasein treten kann, er keinen Augenblick behaupten wird, Farbe, Ton, Wärme und so weiter seien lediglich subjektiv, seien ohne entsprechendes Korrelat im Reich des Objektiven. Aber Goethes Gedanke des organischen Typus ist nur die konsequente Ausdehnung dieser Auffassung von der subjektiven Erzeugung des Erscheinungsdaseins auf ein Gebiet, in dem die bloße Sinneswahrnehmung nicht mehr ausreicht, um zu Erkenntnissen zu gelangen.
Die Sache bietet auf diesem Gebiete nur deshalb dem Verständnisse Schwierigkeiten, weil auf jener Stufe des menschlichen Auffassungsvermögens, auf der Ideen hervorgebracht werden, bereits das Bewußtsein beginnt. Wir wissen nun, daß wir eine tätige Rolle beim Ergreifen der Ideen spielen, während die Tätigkeit des Organismus da, wo derselbe die Sinnesempfindung vermittelt, eine völlig unbewußte ist. Dieser Umstand ist aber für die Sache selbst ganz ohne Belang. So wie Farbe, Ton, Wärme und so weiter in rerum natura eine objektive Bedeutung haben, trotzdem sie ohne die subjektive Tätigkeit unserer Sinneswerkzeuge nicht eine Bedeutung für uns gewinnen können, so haben die Ideen einen objektiven Wert, obwohl sie nicht ohne die eigene Tätigkeit des Geistes in denselben eintreten können.
Es ist eben durchaus notwendig, daß alles, was in unserem Bewußtsein auftreten soll, erst durch unseren physischen oder psychischen Organismus hindurchgeht.
Dies vorausgesetzt, erkennen wir, daß im Sinne der Goetheschen Denkart ein fortwährendes Abwechseln zwischen detn Zufluß des durch die Sinne gelieferten Materiales und des frei von der Vernunft erschaffenen Typischen und ein Durchdringen dieser beiden Produkte im Geiste des Forschers stattfinden muß, wenn eine befriedigende Lösung der Probleme der Naturwissenschaft möglich sein soll. Dieses Abwechseln vergleicht Goethe mit einer Systole und Diastole des Geistes, deren fortwährendes Übergehen ineinander er bei jedem wahren Naturforscher voraussetzt. Er sagt: «Es
müsse in dem Geiste des wahreti Naturforschers sich itumerfort wechselweise wie eine sich im Gleichgewicht bewegende Systole und Diastole ereignen.»
Das bis jetzt Gesagte liefert uns nun auch die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob es der Auffassung Goethes gemäß ist, die Urpflanze oder das Urtier mit irgendeiner zu einer bestiramten Zeit vorgekommenen oder noch vorkommenden sinnlich-realen organischen Form zu identifizieren. Darauf kann nur mit einem entschiedenen «Nein> geantwortet werden. Die «Urpflanze» ist in jeder Pflanze enthalten, kann durch die konstruktive Kraft des Geistes aus der Pflanzenwelt gewonnen werden; aber keine einzelne individuelle Form darf als typisch angesprochen werden.
Nun ist aber gerade die «Urpflanze» (oder auch das «Urtier») dasjenige, was jede einzelne Form zu dem macht, was sie ist; sie ist das Wesentliche. Das müssen wir festhalten, wenn wir in Goethes Absichten vollständig eindringen wollen.
Das Gesetzniäßige des Organischen darf nicht auf demselben Gebiete gesucht werden wie das des Unorganischen. In der Wissenschaft der unorganischen Natur habe ich meine Aufgabe vollkommen erfüllt, wenn es mir gelungen ist, das, was ich mit den Sinnen wahrnehme, nach seinem ursächlichen Zusammenhange zu erklären. Im Organischen muß ich solche Tatsachen der Erklärung unterwerfen, die für die Sinne nicht mehr wahrzunehmen sind. Wer an einem Lebewesen nur das betrachten und zur Erklärung herbeiziehen wollte, was er an demselben mit den Sinnen wahr-nimmt, der genügte vor dem Forum Goethescher Wissenschaftlichkeit nicht.
Man hat vielfach behauptet, das Organische sei nur dann zu erklären, wenn man die Gesetze des Anorganischen einfach in das Reich des Belehren herübernehme. Die Versuche, eine Wissenschaft der Lebewesen auf diese Weise zu begründen, sind auch heute noch auf der Tagesordnung. Es war aber Goethes großer Gedankenflug, der ihn erkennen ließ, daß man auch dann an der Möglichkeit einer Erklärung des Organischen nicht zu zweifeln brauche, wenn sich die anorganischen Naturgesetze hierzu als unzulänglich
erweisen sollten. Soll denn unsere Fähigkeit zu erklären nur so weit reichen, als wir die Gesetze des Anorganischen an-wenden können? Was Goethe wollte, war nichts anderes, als: alle dunklen und unklaren Vorstellungen wie Lebenskraft, Bildungs-trieb und so weiter aus der Wissenschaft verbannen und für sie Naturgesetze auffinden. Aber er wollte für die Organik Gesetze suchen, wie man sie für die Mechanik, Physik, Chemie gefunden hat, nicht einfach die in diesen andern Gebieten vorhandenen her-übernehmen. Der zerstört das Reich des Organischen, der es einfach in das des Unorganischen aufgehen läßt. Goethe wollte eine selbständige Organik, die ihre eigenen Axiome und ihre eigene Methode hat. Dieser Gedanke setzte sich immer mehr bei ihm fest, und «Morphologie» wurde ihm allmählich der Inbegriff alles dessen, was zu einer befriedigenden Erklärung der Lebenserscheinungen aufgebracht werden muß. So lange man nicht alle Bewegungserscheinungen aus Naturgesetzen ableiten konnte, gab es keine Mechanik; so lange man die einzelnen Orte, welche die Himmelskörper einnehmen, nicht durch gesetzliche Linien zusarrirnenzufassen imstande war, gab es keine Astronomie; so lange man die Lebensäußerungen nicht in Form von Prinzipien aufzufassen in der Lage ist, gibt es keine Organik, sagte sich Goethe. Eine Wissenschaft, die das Organische in seinem Zentrum erfaßt und die Gesetze seiner verschiedenen Gestaltungen bloßlegt, schwebte ihm vor. Nicht die Formen der Organe allein, nicht den Stoffwechsel und seine Gesetze für sich, nicht die anatomischen Tatsachen für sich wollte er erfassen; nein, er strebte nach einer Totalauffassung des Lebens, aus der sich alle jene Teilerscheinungen ableiten lassen. Er will eine Wissenschaft, zu der sich Naturgeschichte, Narurlehre, Anatomie, Chemie, Zoonomie, Physiologie nur wie vorbereitende Stufen verhalten. Eine jede von diesen genannten Wissenschaften behandelt ja nur eine Seite des Naturkörpers; aber alle zusammen, bloß als Summe gedacht, erschöpfen das Leben doch auch nicht. Denn dieses ist wesentlich mehr als die Summe seiner Einzelerscheinungen. Wer mit Hilfe der genannten Einzelwissenschaften alle Seiten des organischen Seins begriffen hat, dem fehlt noch immer die lebendige Einheit. Diese zu erfassen
ist nach Goethes Ansicht die Aufgabe der Morphologie im weiteren Sinne.
Die Naturgeschichte hat die Aufgabe, die «Kenntnis der organischen Naturen nach ihrem Habitus und nach dem Unterschied ihrer Gestairverhälmisse» zu vermitteln; der Natur/ehre obliegt die «Kenntnis der materiellen Naturen überhaupt als Kräfte lind in ihren Ortsverhältnissen»; die Anatomie sucht die «Kenntnis der organischen Naturen nach ihren inneren und äußeren Teilen, ohne aufs lebendige Ganze Rücksicht zu nehmen»; die Chemie strebt nach «Kenntnis der Teile eines organischen Körpers, insofern er aufhört, organisch zu sein, oder insofern seine Organisation nur als Stoff-hervorbringend und als Stoff-zusammengesetzt angesehen wird»; von der Zoonomie wird verlangt: die «Betrachtung des Ganzen, insofern es lebt und diesem Leben eine besondere physische Kraft untergelegt wird», von der Physiologie die «Betrachtung des Ganzen, insofern es lebt und wirkt», von der Morphologie im engern Sinne «Betrachtung der Gestalt sowohl in ihren Teilen als im Ganzen, ihren Übereinstimmungen und Abweichungen ohne alle andere Rüchsichten». Die Morphologie im weitem und im Goetheschen Sinne aber will: «Betrachtung des organischen Ganzen durch Vergegenwärtigung aller dieser Rücksichten und Verknüpfung derselben durch die Kraft des Geistes.»*
Goethe ist sich dabei voll bewußt, daß er die Idee einer «neuen Wissenschaft» nach «Ansicht und Methode» aufstellt. Nicht neu ist sie allerdings dem Inhalte nach, «denn derselbe ist bekannt». Das heißt aber nichts anderes, als er ist, rein tatsächlich genommen, derselbe, der in den vorher charakterisierten Hilfswissenschaften dargelegt wir& Neu aber ist die Art, wie dieser Inhalt in den Dienst einer Gesamterfassung der organischen Welt gestellt wird.
Das ist wieder wichtig für die Bestimmung des Goetheschen «Typus». Denn der Typus, das Gesetzliche im Organischen, ist ja der Gegenstand seiner Morphologie im weitern Sinne. Was die sieben Hilfswissenschaften zu leisten haben, das liegt im Bereich
- - -
* Diese Sätze sind einem erhaltenen Manuskript entlehnt, das in großen Zügen die Idee einer solchen Morphologie skizziert und offenbar einer solchen als Einleitung dienen sollte.
des Sinnlich-Erreichbaren. Ja, eben deswegen, weil sie in dem Gebiete des Sinnlich-Erreichbaren bleiben, können sie nicht über die Erkenntnis von einzelnen Seiten des Organischen hinauskommen.
So sehen wir uns denn durchaus gezwungen anzuerkennen, daß Goethe der organischen Welt eine Gesetzmäßigkeit zuschrieb, die sich mit derjenigen nicht deckt, welche wir an den Erscheinungen der unorganischen Natur beobachten. Wir können uns dieselbe nur durch eine freie Konstruktion des Geistes vergegenwärtigen, da sie sich mit dem, was wir am Organismus sinnenfällig wahrnehruen, nicht deckt.
Nun fragt es sich: wie verhält sich Goethe unter solchen Voraussetzungen zu der Mannigfaltigkeit der organischen Arten?
Diese Frage kann nicht beantwortet werden, ohne vorher das Verhältnis des Typus sondern eine Mehrheit.»* Und zwar eine Mehrheit von äußerlich voneinander durchaus verschiedenen Einzelheiten. Wie ist das nun möglich? Wie kann das Verschiedene doch eine Einheit sein? Oder im Speziellen: wie kann ein und dasselbe Organ einmal als Stengelblatt, dann wieder als Blumenblatt oder als Staubgefäß erscheinen? Wer die Einheit im Sinne eines abstrakten Begriffes, eines Schemas oder dergleichen faßt, kann das freilich nicht begreifen. Aber das ist sie im Goetheschen Sinne nicht. Da ist sie eine Gesetzmäßigkeit, die als solche die Form, in der sie sich für die Sinnenwelt äußert, noch vollständig unbestimmt läßt. Eben weil der eigentliche Kern, der tiefere Gehalt dieser Gesetzlichkeit nicht in dem aufgeht, was sinnenfällig wird, kann er sich in verschiedenen sinnlichen Formen äußern und doch immer derselbe bleiben. Es ist vielmehr der organischen Gesetzlichkeit bei ihrem Auftreten als äußere Erscheinung ein unendliches Feld geöffnet, wie das möglich ist. Da aber die Stoffe und Kräfte der unorganischen Natur in den Dienst dieser Gesetzmäßigkeit treten müssen, wenn überhaupt reale Organismen entstehen sollen, so folgt von
- - -
* Siehe: Goethes naturwissenschaftliche Schriften (Kürschners *Dentsche National-Literatur»), Goethes Werke, Band XXXIII, S. 97.
selbst, daß nur jene Fortnen möglich sind, die den in jenen Stoffen und Kräften liegenden Bedingungen nicht widersprechen. Und in-soferne sind die Kräfte und Stoffe der unorganischen Natur negative Bedingungen des organischen lebens. Dieses bringt sich durch sie und in ihren Formen zur Geltung, so gut sie es zulassen. Damit ist aber schon die Notwendigkeit einer unendlichen Mannigfaltigkeit organischer Fonnen gegeben. Denn diese Äußerlichkeit des Daseins ist nichts, was in einern eindeutigen Zusammenhange mir der inneren Gesetzlichkeit stände Ja, man wird von diesem Standpunkte aus sogar die Frage aufwerfen können: wie kommt es, daß es überhaupt Arten gibt, daß nicht jegliches Individuum von jeglichem anderen verschieden ist? Darauf wollen wir noch zurückkommen. Jedenfalls steht fest, daß die charakterisierte Anschauung Goethes von konstanten Formen des Organischen nicht sprechen kann, weil das, was einer Form die Bestimmtheit gibt, nicht aus dem fließt, was sie zur organischen Form macht Nur derjenige kann eine Konstanz der Form annehmen, der in dieser Form ein Wesentliches sieht.
Was aber einer Sache nicht wesentlich ist, das braucht sie auch nicht unbedingt beizubehalten. Und damit ist die Möglichkeit der Umwandlung bestehender Formen abgeleitet. Mehr aber konnte vom Standpunkte Goethes aus nicht gegeben werden als eine Ableitung dieser Möglichkeit. Die empirischen Beobachtungen dazu hat Darwin geliefert. Das ist ja immer die Beziehung zwischen Theorie und Erfahrung, daß die letztere zeigt, was ist und geschieht, und die erstere die Möglichkeit darlegt, inwieferne solches sein und geschehen kann.
Jedenfalls kann auf Grund des im Goethe-Archiv vorhandenen Materiales an kein anderes als an dieses Verhältnis Goethes zu Darwin gedacht werden.
Wer nun aber die organischen Formen für wandelbar ansieht, an den tritt die Aufgabe heran: die zu einer Zeit tatsächlich bestehenden zu erkiären, das heißt die Ursachen anzugehen, warum sich unter den von ihm vorausgesetzten Verhältnissen doch bestimmte Formen entwickeln und ferner jene: den Zusammenhang dieser bestehenden Formen untereinander darzulegen.
Dies war Goethe vollständig klar, und wir ersehen aus den hinterlassenen Papieren, daß er bei der beabsichtigten Weiterführung seiner morphologischen Arbeiten daran dachte, seine Anschauungen nach dieser Richtung hin auszugestalten. So enthält ein Schema zu einer «Physiologie der Pflanzen> folgendes: «Die Metamorphose der Pflanzen, der Grund einer Physiologie derselben. Sie zeigt uns die Gesetze, wonach die Pflanzen gebildet werden.
Sie macht uns auf ein doppeltes Gesetz aufmerksam:
1. Auf das Gesetz der innern Natur, wodurch die Pflanzen konstituiert werden.
2. Auf das Gesetz der äußern Umstände, wodurch die Pflanzen modifiziert werden.
Die botanische Wissenschaft macht uns die mannigfaltige Bildung der Pflanze und ihrer Teile bekannt, und von der andern Seite sucht sie die Gesetze dieser Bildung auf.
Wenn nun die Bemühungen, die große Menge der Pflanzen in ein System zu ordnen, nur dann den höchsten Grad des Beifalls verdienen, wenn sie notwendig sind, die unveränderlichsten Teile von den mehr oder weniger zufälligen und veränderlichen abzusondern und dadurch die nächste Verwandtschaft der verschiedenen Geschlechter immer mehr und mehr ins Licht setzen: so sind die Bemühungen gewiß auch lobenswert, welche das Gesetz zu erkennen trachten, wonach jene Bildungen hervorgebracht werden; und wenn es gleich scheint, daß die menschliche Natur weder die unendiiche Mannigfaltigkeit der Organisation fassn, noch das Gesetz, wonach sie wirkt, deutlich begreifen kann, so ist's doch schön, alle Kräfte aufzubieten und von beiden Seiten, sowohl durch Erfahrung als durch Nachdenken, dieses Feld zu erweitern.>
Jede bestimmte Pflanzen- und Tierform ist nach Goethes Auffassungsweise also aus zwei Faktoren zu erklären: aus dem Gesetz der innern Natur und aus dem Gesetz der Umstände. Da nun aber diese Umstände an einem bestimmten Orte und in einer bestimmten Zeit eben gegebene sind, die sich innerhalb gewisser Grenzen nicht verändern, so ist es auch erklärlich, daß die organischen Formen innerhalb dieser Grenzen konstante bleiben. Denn
diejenigen Formen, die unter jenen Umständen möglich sind, finden eben in den einmal entstandenen Wesen ihren Ausdruck. Neue Formen können nur durch eine Veränderung dieser Umstände bewirkt werden. Dann aber haben diese neuen Umstände nicht allein sich dem Gesetze des Inneren der organischen Natur zu fügen, sondern auch mit den schon entstandenen Formen zu rechnen, denen sie gegenübertreten. Denn was in der Natur einmal entstanden ist, erweist sich fortan in dem Tatsachenzusammenhange als mitwirkende Ursache. Daraus ergibt sich aber, daß den einmal entstandenen Formen eine gewisse Kraft, sich zu erhalten, innewohnen wird. Gewisse einmal angenommene Merkmale werden noch in den fernsten Nachkommen bemerkbar sein, wenn sie auch aus den Lebensverhältnissen dieser Wesen durchaus sich nicht erklären lassen. Es ist dies eine Tatsache, für die man in neuerer Zeit das Wort Vererbung gebraucht. Wir haben gesehen, daß in der Goetheschen Anschauungsweise ein begrifflich strenges Korrelat für das mit diesem Worte Verbundene gefunden werden kann.
Ein besonderes Licht wirft auf diese Auffassung aber noch die Art, wie Goethe sich die Fortpflanzung der Organismen mit ihren übrigen Entwickelungsprinzipien im Zusammenhange dachte. Er stellte sich nämlich vor, daß mit dem, was wir als Individuum an-nehmen, die innere Entwickelungsfähigkeit eines organischen Wesens noch nicht abgeschlossen ist, sondern daß die Fortpflanzung einfach nur die Fortsetzung und ein spezieller Fall dieser Entwickelungsfähigkeit ist. Das, was sich auf einer niederen Stufe als Wachstum äußert, ist auf einer höheren Stufe Fortpflanzung. Goethe hatte schon die Ansicht> daß die Zeugung nur ein Wachstum des Organismus über das Individuum hinaus sei.
Auch das läßt sich aus seinen eigenen Aufzeichnungen nachweisen: «Wir haben gesehen, daß sich die Pflanzen auf verschiedene Art fortpflanzen, welche Arten nur Modifikationen einer einzigen Art anzusehen sind. Die Fortpflanzung wie die Fortsetzung, welche durch die Entwickelung eines Organs aus dem andern geschieht, hat uns hauptsächlich in der Metamorphose beschäftigt. Wir haben gesehen, daß diese Organe, welche selbst von äußerer
Gleichheit bis zur größten Unähnlichkeit sich verändern, innerlich eine virtuelle Gleichheit haben...»
«Wir haben gesehen, daß diese sprossende Fortsetzung bei den vollkommenen Pflanzen nicht ins Unendliche fortgehen kann, sondern daß sie stufenweise zum Gipfel führt und gleichsam am entgegengesetzten Ende seiner Kraft eine andere Art der Fortpflanzung, durch Samen, hervorbringt.»
Hier sieht also Goethe die Fortsetzung von Glied zu Glied bei einer und derselben Pflanze und die Fortpflanzung durch Samen nur als zwei verschiedene Arten einer und derselben Tätigkeit an.
«An allen Körpern, die wir lebendig nennen, bemerken wir die Kraft ihresgleichen hervorzubringen», sagt Goethe; diese Kraft schließt aber gewissermaßen ihren Kreis auch während des Wachstums eines Individuums mehrmals ab, denn: Goethe will den «Beweis» erbringen, daß «von Knoten zu Knoten der ganze Kreis der Pflanze im wesentlichen geendigt sei»; wenn wir dann «diese Kraft geteilt gewahr werden, bezeichnen wir sie unter dem Namen der beiden Geschlechter». Von dieser Anschauung ausgehend, skizziert er den Gang seines Vortrages über Wachstum und Fortpflanzung folgendermaßen: «Bei Betrachtung der Pflanze wird ein lebendiger Punkt angenommen, der ewig seinesgleichen hervorbringt.
Und zwar tut er es bei den geringsten Pflanzen durch Wiederholung eben desselbigen.
Ferner bei den vollkommenern durch progressive Ausbildung und Umbildung des Grundorgans in immer vollkommenere und wirksamere Organe, um zuletzt den höchsten Punkt organischer Tätigkeit hervorzubringen, Individuen durch Zeugung und Geburt aus dem organischen Ganzen abzusondern und abzulösen.
Höchste Ansicht organischer Einheit.»
Auch daraus erhellt, daß Goethe in der Fortpflanzung kein wesentlich neues Element der Pflanzenentwickelung, sondern nur eine höhere Modifikation des Wachsens sieht.
Die angeführte Stelle ist aber noch in anderer Beziehung bemerkenswert. Goethe spricht darinnen von einem «organischen Ganzen», aus dem sich die einzelnen Individuen absondern und
ablösen. Dieses zu verstehen, nennt er die «h&hste Ansicht organischet Einheit>.
Damit ist die Summe alles organischen Lebens als einheitliche Totalitas bezeichnet, und alle Einzeiwesen sind dann nur als Glieder dieser Einheit zu bezeichnen. Wir haben es somit mit einer durch gängigen Verwandtschaft aller Lebewesen im wahrsten Sinne des Wortes zu tun. Und zwar mit einer tatsächlichen Verwandt-schaft, nicht einer bloß ideellen. Die «organische Ganzheit» ist eine einheidiche, die in sich die Kraft hat, ihresgleichen in immerwährender äußerer Veränderung hervorzubringen; die Mannigfaltigkeit der Formen entsteht, indem sie diese Hervorbringungsfähigkeit nicht nur über Individuen, sondern auch über Gattungen und Arten hinaus fortsetzt.
Es ist nur im genauen Sinne der Goetheschen Ausführungen, wenn man sagt: die Kraft, durch welche die verschiedenen Pflanzenfamilien entstehen, ist genau dieselbe wie jene, durch welche ein Stengelblatt sich in ein Blumenblatt verwandelt. Und zwar ist diese Kraft durchaus als reale Einheit und das Hervorgehen der einen Art aus der andern durchaus im realen Sinne vorzustellen
Die organischen Arten und Gattungen sind auf eine wahrhafte Deszendenz unter fortwährender Veränderung der Formen zurück-zuführen. Goethes Anschauung ist eine Deszendenztheorie mit einer tiefen theoretischen Grundlage.
Man darf nun aber keineswegs denken, daß die folgenden Entwickelungsformen in den früheren schon angedeutet liegen. Denn, was sich durch alle Formen hindurchzieht, ist eben die ideelle organische Gesetzlichkeit, bei der von jenen Formen gar nicht gesprochen werden kann. Gerade weil das Wesen des Organischen mit der Art, wie es in Formen auftritt, nichts zu tun hat, kann es sich in denselben realisieren, ohne sie aus sich heraus zu wickeln. Die organische Wesenheit bildet die Form nicht aus sich heraus, sondern sich in dieselbe hinein. Deswegen kann diesen Formen keinerlei Präexistenz, auch nicht der Anlage nach, zukommen. Goethe war deshalb ein Gegner jener Einschachtelungslehre, welche annahm, daß die ganze Mannigfaltigkeit des Organischen schon im Keime, aber verborgen, enthalten sei.
Entwickelung besteht eben darinnen, daß sich eine Einheit fortbildet und daß die Formen, die sie dabei annimmt, als etwas ganz Neues an ihr auftreten. Dies rührt daher, weil diese Formen nicht dem einheitlichen Entwickelungsprinzipe angehören, sondern dem Mittel, dessen sich dasselbe bedient, um sich zu manifestieren. Die Entwickelungsformen müssen alle ideell aus der Einheit erklärbar sein, wenn sie auch nicht reell aus derselben hervorgehen. Daß Goethe nur an dieses ideelle Enthaltensein dachte, beweist zum Beispiel die Behaupning, daß «diese verschiedenen Teile aus einem idealen Urkörper entsprungen und nach und nach in verschiedenen Stufen ausgebildet gedacht werden...»
Das nächste, was sich nach den obigen Sätzen uns aufdrängen muß, ist, zu erfahren, in welcher Weise die beiden Faktoren: inneres Bildungsprinzip und äußere Bedingungen an dem Zustandekommen einer organischen Form beteiligt sind. Denn nur wenn der rechtmäßige Anteil von beiden Seiten gegeben ist, kann man von einer tatsächlichen Erklärung einer solchen Form sprechen.
Zweifellos muß man die äußeren Bedingungen zuerst einmal ihrer realen Wirklichkeit nach durch Erfahrung kennen. Goethe zählt unter diesen Bedingungen auf: Temperatur eines Landes, Menge des Sonnenlichtes, Beschaffenheit der Luft der Umgebung und anderes mehr. Die Beobachtung zeigt uns, daß sich unter dem Einflusse einer gewissen Tatsachenreihe eine bestimmte Form bildet. Goethe sagt, daß der Typus eine gewisse «Einschränkung» erfährt. Haben wir aber auf diese Weise erkannt, daß unter gewissen äußeren Einflüssen irgendeine Form entsteht, dann stehen wir erst vor dem Problem: dieselbe zu erklären, zu sagen, wie sie entstehen konnte. Und da müssen wir die Idee des Typus als Erklärungsprinzip zugrunde legen. Wir müssen aus der allgemeinen
- - -
* Die Mannigfaltigkeit der Organe und Organismen.
Form des Typus diese besondere vorliegende abzuleiten imstande sein. Wenn wir nicht zu sagen vermögen: wie der spezielle Fall mit dem allgemeinen des Typus zusaramenhängt, wenn wir nicht in der Lage sind zu sagen: durch diese oder jene Wirkungsform hat sich der Typus gerade in der individuellen Weise ausgebildet, dann ist das Wissen der äußern Bedingungen wertlos.
Diese Bedingungen geben die Gelegenheitsursache ab, daß das Organische in bestimmter Weise erscheint; die Kenntnis der innern Gesetzlichkeit gibt die Erklärung, wie gerade diese bestimmte Wirklichkeitsform entstehen konnte. Goethe sagt darübet in nicht mißzuverstehender Weise, die Form eines Organismus sei durch «Wechselwirkung der lebendigen Teile nur aus sich selbst zu erklären». Und als Methode der Erklärung empfiehlt er in bestimmtester Weise sehr oft: sich in Kenntnis der äußern Um-stände zu setzen und dann nach den innern Bedingungen zu fragen, die als Gestaltungsprinzip unter dem Einflusse derselben auftreten.
Eine Erklärung, welche nur die äußeren Einflüsse als causa der organischen Verwandlungen gelten lassen wollte, würde Goethe also entschieden zurückweisen müssen.
Wir haben uns darauf beschränkt, Goethes Ansicht einfach hinzustellen. Wie sich dieselbe zum Darwinismus in seiner gegenwärtigen Form verhält: darüber sich ein Urteil zu bilden, überlassen wir diesmal dem leser.* Wir wollen nur zum Schlusse noch ein Wort über die Methode sagen, durch die Goethe zu seinen Resultaten gelangt. Goethes naturwissenschaftliche Ansichten beinhen auf idealistischen Forschungsresultaten, die auf einer empirischen Basis ruhen.** Der Typus ist ein solches idealistisches Forschungsresultat. Wir wissen aus jenem vielangeführten Gespräch
- - -
* Ausgeführt, freilich damals ohne die Materialien des Geethe-Arcbivs zu kennen, haben wir dieses Verhältnis in den Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften (Kürschners »Deutsche National-Literatur»), Goethes Werke, Band XXXIII und XXXIV.
* * Die nähere Bestimmung und der Beweis dieses Satzes sind zu er-sehen aus Goethes Werken (Kürschners «Deutsche National-Literatur»), Band XXXIV, S. XXXVII ff.
mit Schiller, daß Goethe den empirischen Charakter dieses «Typus» entschieden betonte.* Er wurde ärgerlich, als Schiller ihn eine «Idee» nannte. Es war das in jener Zeit, wo ihm die ideelle Natur desselben selbst noch nicht recht klar war. Er war sich damals nur bewußt, daß er zu seiner «Urpflanze« durch sorgfältige Beobachtung gekommen war. Daß er aber gerade auf diese Weise zu einer «Idee» gelangt ist, das erkannte er noch nicht. Er hielt noch an der Ansicht der einseitigen Empiriker fest, welche glauben, das Beobachtbare erschöpfe sich in den Gegenständen der äußeren Sinneswahrnehmung. Aber gerade Schillers Bemerkung veranlaßte ihn, über diesen Punkt weiter nachzudenken. Er sagte sich: «Wenn er das für eine Idee hielt, was ich als Erfahrung aussprach, so mußte doch zwischen beiden irgend etwas Vermitteln-des, Bezügliches obwalten! Der erste Schritt war getan.» ** Nämlich der erste Schritt, um durch weiteres Nachdenken zu einer befriedigenden Lösung der Frage zu kommen: wie sind die Ideen des Typus (Urpflanze, Urtier) festzuhalten, wenn nian streng auf dem Boden der Beobachtung, der Erfahrungswissenschaft stehenbleiben will? Wie ist der Einklang zwischen der Methode und dem Grund-charakter des Resultates herzustellen? Durch gewöhnliches Beobachten der Dinge kommen wir doch nur zur Kenntnis von bloßen individuellen Einzelheiten und zu keinen Typen. Welche Modifikation hat das Beobachten zu erleiden? Goethe mußte zu einer «Theorie der Beobachtung» getrieben werden. Es sollte festgestellt werden: wie muß man beobachten, um wissenschaftlich verwertbare Resultate im obigen Sinne zu erhalten? In dieser Untersuchung hatte Goethe nur einen Vorgänger, dessen Denkweise aber der seinigen ziemlich fremd war: Francis Bacon. Dieser hat gezeigt, wie man den Erscheinungen der Natur gegenübertreten müsse, um nicht zufällige, wertlose Tatsachen zu erhalten, wie sie sich der gewöhnlichen naiven Anschauung darbieten, sondern Resultate mit dem Charakter der Notwendigkeit und Naturgesetzlichkeit. Goethe versuchte dasselbe auf seinem Wege. Bisher ist
- - -
* Siehe den Aufsatz: »Glückliches Ereignis» (Kürschners «Deutsche National-Literatur»), Goethes Werke, Band XXXIII, S. 108-113.
** Siehe »Glückliches Ereignis», a. a. O., S. 112.
als Frucht dieses Nachdenkens nur der Aufsatz: bekannt.* Nun erfahren wir aber aus einem Briefe Goethes an Schiller vom 17. Januar 1798**, daß der erstere seinem Schreiben einen Aufsatz beilegt, der die Prinzipien seiner naturwissenschaftlichen Forschungsweise enthält. Ich vermutete aus Schillers Antwort vom 19. Januar 1798, daß dieser Aufsatz wichtige Aufschlüsse über die Frage enthalten müsse, wie sich Goethe den Grundbau der Naturwissenschaft gedacht habe, und versuchte dann in der Einleitung meines zweiten Bandes von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften*** denselben nach Schillers Ausführungen zu rekonstruieren. Zu meiner besonderen Befriedigung fand sich nun dieser Aufsatz genau in der von mir vorher konstruierten Form im Goethe-Archiv vor. Er gibt tatsächlich über die Grundansichten Goethes über die naturwissenschaft-liche Methodik und über die Bedeutung und den Wert verschiedengearteter Beobachtungen eingehende Aufschlüsse. Der Forscher müsse sich erheben vom gemeinen Empirismus durch das Zwischenglied des abstrakten Rationalismus zum rationellen Empirismus. Der gemeine Empirismus bleibt bei dem unmittelbaren Tatbestand der Erfahrung stehen; er kommt nicht zu einer Schätzung des Wertes der Einzelheiten für eine Auffassung der Gesetzlichkeit. Er registriert die Phänomene nach ihrem Verlaufe, ohne zu wissen, welche von den Bedingungen, die dabei in Betracht kommen, notwendig und welche zufällig sind. Er liefert daher kaum mehr als eine Beschreibung der Erscheinungswelt. Er weiß immer nur, was vorhanden sein muß, damit eine Erscheinung eintrete, aber er weiß nicht, was wesentlich ist. Daher kann er die Phänomene nicht als eine notwendige Folge ihrer Bedingungen darstellen. Das nächste ist, daß der Mensch über diesen Standpunkt hinausgeht, indem er an den Verstand appelliert und so auf dem Wege des Denkens sich über die Bedingungen klar werden will.
- - -
* Siehe Goethes Werke (Kürschners »Dmtscbe National-Literatur»), Band XXXIV, S. 10-2 1.
** Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, 2. Band, S. 10ff.
* * * Goethes Werke (Kürschners » De,»tsche National-Literatur»), Band XXXIV, S. XXXIX ff.
Dieser Standpunkt ist wesentlich jener der Hypothesenbildung. Der Rationalist sucht die Ursachen der Erscheinungen nicht; er ersinnt sie; er lebt in dem Glauben, daß man durch Nachdenken über eine Erscheinung herausfinden könne, warum sie erfolgt. Da-mit kommt er natürlich ins Leere. Denn unser Verstand ist ein bloß formales Vermögen. Er hat keinen Inhalt außer jenem, den er sich durch Beobachtung erwirbt. Wer unter Voraussetzung dieser Erkenntnis doch nach einem notwendigen Wissen strebt, der kann dem Verstande dabei nur eine vermittelnde Rolle zuer-kennen. Er muß ihm das Vermögen zugestehen, daß er die Ursachen der Erscheinungen erkennt, wenn er sie findet; nicht aber jenes, daß er sie selbst ersinnen könne. Auf diesem Standpunkte steht der rationelle Empiriker. Es ist Goethes eigener Standpunkt. «Begriffe ohne Anchauungen> sind leer, sagt er mit Kant; aber er setzt hinzu: sie sind notwendig, um den Wert der einzelnen Anschauungen für das Ganze einer Weltanschauung zu bestimmen. Wenn nun der Verstand in dieser Absicht an die Natur herantritt und diejenigen Tatsachenelemente zusammenstellt, welche einer inneren Notwendigkeit nach zusammengehören, so erhebt er sich von der Betrachtung des gemeinen Phänomens zum rationellen Versuch, was unmittelbar ein Ausdruck der objektiven Natur-gesetzlichkeit ist. Goethes Empirismus entnimmt alles, was er zur Erklärung der Erscheinungen heranzieht, aus der Erfahrung; nur die Art, wie er es entnimmt, ist durch seine Anschauung bestimmt. Jetzt begreifen wir vollständiger, wie er die oben mitgeteilten Worte über seine beabsichtigte Morphologie sprechen konnte, daß sie die Idee einer «neuen Wissenschaft» enthalte «nicht dem Inhalt>, sondern «der Ansicht und Methode> nach.*
Der in Rede stehende Aufsatz ist also die methodologiscbe Rechtfertigung von Goethes Forschungsweise. Er ergänzt in dieser Beziehung alles, was Goethe über Naturwissenschaft geschrieben hat, denn er sagt uns, wie wir es aufzufassen haben.
- - -
* Vgl. Goethes Brief an Hegel vom 7. Oktober 1820 (Fr. Strehifre, Goethes Briefe, Erster Teil, S. 240): »Es ist hier die Rede nicht von einer durehzusetzenden Meinung, sondern von einer mitzuteilenden Methode, deren sich ein jeder als eines Werkzeugs nach seiner Art bedienen möge.»
Mit diesen Ausführungen wollten wir vorläufig auf die erfreuliche Tatsache hingewiesen haben, daß durch das Material des Archives die wissenschaftliche Ansicht Goethes nach zwei Seiten hin in ein helleres Licht gerückt wird: erstens werden die bisher bemerkbaren Lücken in seinen Schriften ausgefüllt, und zweitens wird die Art seines Forschens und sein ganzes Verhalten zur Natur neu beleuchtet.
Die Frage: was suchte Goethe in der Natur und Naturwissenschaft, ohne deren Beantwortung das Verständnis der ganzen Persönlichkeit des Menschen doch nicht möglich ist, wird nach der Publikation der «naturwissenschaftlichen Abteilung» in der Weimarer Goethe-Ausgabe in einer ganz anderen Form beantwortet werden müssen, als dies bisher häufig geschah.
EDUARD VON HARTMANN
Seine Lehre und seine Bedeutung
Dem Philosophen obliegt es, nach einem oft wiederholten Aussprache, den Kulturgehalt seiner Zeit in der Form des reinen Gedankens auszusprechen. Wie der Künstler anstrebt, dasjenige, was in der Tiefe des Volks- und Zeitbewußtseins an Ideen, Gefühlen und sonstigem Lebensinhalt waltet, in sinnlich-anschaulicher Form zum Ausdrucke zu bringen, so sucht der Philosoph die Gesamtheit alles dessen, was seine Zeit und sein Volk beherrscht und belebt, in begrifflicher, denkender Weise darzustellen. Kuno Fischer sagt in seinem geistreichen Werke «Geschichte der neueren Philosophie»: «Wenn wir ein Kultursystem eder ein Zeitalter mit einer Bildsäule vergleichen wollen, so bildet darin die Philosophie das sinnende Auge, welches nach innen schaut.» Ohne diesen lebendigen Bezug zum Zeitalter, ohne den Drang, das, was sich im Leben unter hin- und herwogenden Kämpfen und in der Unruhe des Tages abspielt, in ruhiger Klarheit denkend zu durchdringen,
um so wieder befruchtend auf dasselbe zurückauwirken, kann der Philosoph dem Schicksale nicht entgehen, auf seiner einsamen Höhe ein wertloses Dasein zu führen.
Wenige der namhaften Philosophen haben ihre Aufgabe in der eben gekennzeichneten Weise so trefflich angefaßt wie unser großer Zeitgenosse Eduard von Hartmann. Während wir ihn auf der einen Seite mit den tiefsten Geheimnissen des Weltbaues und den Rätseln des Lebens ringen sehen, verschmäht er es auf der andern nicht, sich mit den schwebenden Fragen des Tages, mit den Bestrebungen der Parteien und den Interessen des Staates gründlich auseinanderzusetzen. Die sozialpolitischen Strömungen der Gegenwart, die Irrtürner der liberalen Parteigänger, die militärischen und kirchenpolitischen Fragen, die Schul- und Studienreform, die nationalen und demokratischen Ideen nehmen sein Interesse nicht weniger in Anspruch als die modernen Kunstbestrebungen, die Frauenfrage und das literarische Getriebe unserer Zeit Ja, auch in verfänglichen Dingen, wie in bezug auf Spiritismus, Hypnotismus und Semnambulismus, hat er ein offenes, rückhaltloses Wort gesprochen; und als die Polenfrage in Deutschland auf die Tagesordnung kam, war er der erste, der für jene Lösung sich schriftstellerisch einsetzte, die später Bismarck als die richtige vertreten hat Und dabei ist es nicht etwa eine einmal zurechtgelegte Schablone, mit der er wie so viele Philosophen in den Streit der Meinungen sich mischt, sondern es sind immer die in den Dingen liegenden und aus einem gründlichen Studium der Tatsachen hervorgehenden Gründe, die ihn leiten. Wie Hartmann aus dem vollen eines schier unermeßlichen Wissens schöpft, über welche Summe von Kenntnissen er verfügt, das zu beurteilen, dazu muß man einmal das Glück gehabt haben, ihm persönlich gegenüber getreten zu sein. Daß aber diese Art des Wirkens nur eine Konsequenz seiner wissenschaftlichen Überzeugung ist, das wollen wir im Verlaufe dieses Aufsatzes zeigen.
Die Folge dieser in der Geschichte des Geisteslebens seltenen Erscheinung ist nun aber auch eine ganz unglaubliche Wirkung derselben. E. v. Hartmann steht heute im neunundvierzigsten Lebensjahre, auf dem Gipfel der Schaffenskraft und Schaffensfreudigkeit,
vieles noch versprechend (sein erstes Auftreten fällt in das Jahr 1868), und schon besitzen wir eine Literatur über ihn, die unübersehbar ist. Anders spiegelt sich die Bedeutung eines Menschen im Bewußtsein der Zeitgenossen, anders in dem der Nachwelt. Die ersteren können kaurn den rechten Maßstab der Beurteilung finden. Der künftige Geschichtsschreiber des geistigen Lebens in Deutschland in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wird Hartmann ein großes Kapitel widinen müssen. Wir wollen zuerst die geschichtliche Stellung des Hartmannschen Ideen-kreises kennzeichnen und dann auf die einzelnen Hauptgebietc seiner Tätigkeit eingehen.
In den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts war die deutsche Philosophie an einem bedenklichen Punkte ihrer Entwickelung angelangt. Die Zuversicht, mit welcher die Schüler Hegels nach dem Tode des Meisters (1830) auftraten, war einer vollständigen Entmutigung auf dem Gebiete dieser Wissenschaft gewichen. Von Hegel ausgehend, harte man gehofft, ein Netz von unbedingt gewissen Erkenntnissen über alle Zweige des Wissens auszubreiten, aber die Hegelianer waren bald nicht mehr imstande, sich mit der Fülle des sich nach und nach häufenden Materials von tatsächlichen Ergebnissen der Forschung auseinanderzusetzen. Sie gaben Stück für Stück von ihrem Lehrgebäude auf, suchten da und dort zu bessern und die überkommene Lehre der neuen Lage der Erfahrungswissenschaften anzupassen. Die meisten aber suchten sich vollständig von dem Glauben ihrer Jugend loszumachen und betrachteten, wie zum Beispiel der Ästhetiker Vischer, ihre Hegelsche Periode nur als Zeit der Schulung ihres philosophischen Denkens. Auf den Kathedern herrschte vollständige Zerfahrenheit und Ratlosigkeit. Während die eine Gruppe von Berufs-philosophen vorläufig jede Aussicht auf Erfolg im Ausbaue einer Weltansicht aufgab und sich bloß der Bearbeitung von Spezial-fragen zuwendete, verlegte sich eine andere auf eine ziemlich unfruchtbare Fortbildung der in antediluvianischen Vorurteilen steckengebliebenen Herbartschen Denkweise. Die Vertreter der Erfahmngswissenschaften aber sahen mit Verachtung auf alle Philosophie herab, die nach ihrer Ansicht nur mit wertlosen Phantasiegebilden
sich zu tun mache. Die große Masse der Gebildeten endlich befriedigte ihr philosophisches Bedürfnis aus der Weltauf-fassung eines bis dahin fast unbeachtet gebliebenen und für ein ernstes, gründliches Betreiben der Wissenschaft tatsächlich beinahe unbrauchbaren Denkers: Schopenhauers. Die schlimmen Erfahrungen, die Schopenhauer mit seinem Erstlingswerke, dem einzigen von ihm, das für die Wissenschaft größere Bedeutung hat: «Über die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde», bei den Fachgelehrten gemacht hatte, führte ihn zu immer bedenklicheren Abwegen. Er machte nunmehr aus persöniichen Ansichten und subjektiven Erfahrungen philosophische Lehrsätze und opferte in «Parerga und Paralipomena» die Wahrheit vollständig einem geistreichelnden, das Publikum bestechenden Stile aufl Seine Ausführungen wurden deshalb mit Gier ergriffen, weil man sich auf leichte Weise aus seinen Schriften, die in entsprechender Form nichts als philosophische Trivialitäten boten, mit den zum Tages-gebrauche nötigen Phrasen versehen konnte.
Das war die Lage der Philosophie, als Hartmann auf den Plan trat (1868). Er tat es gleich mit dem unerläßlichen Selbstvertrauen in die Waffen seines Denkens und im Vollbesitze der zu seiner Zeit vorhandenen Erkenntnisse der Einzelwissenschaften. Er erkannte, daß von Hegel weder alles anzunehmen noch alles zu verwerfen sei. Er schälte den bleibenden Kern der Hegelschen Weltanschauung aus ihrer schädlichen Hülle heraus und fing an, ihn weiter zu bilden. Er trennte vollständig die Methode von den Ergebnissen der Hegelschen Philosophie und erklärte: das Gute bei Hegel sei ohne, ja gegen seine Methode gefunden, und das, was die letztere allein geliefert, sei von zweifelhaftem Werte. Die Methode bedurfte nach seiner Ansicht einer gründlichen Reforrn. Und hier war es, wo er den Bund mit der Naturwissenschaft einging. Die Forderung, wissenschaftliche Ergebnisse nur auf dern Wege der Beobachtung zu suchen, welche die Naturforscher immer energischer erhoben, wurde auch die seinige auf philosophischem Gebiete. «Metaphysische Resultate nach naturwissenschaftlich-induktiver Methode» wurde das Motto seines im Jahr 1869 in Berlin erschienenen Hauptwerkes «Philosophie des Unbewußten».
Aber er vertrat die Anschauung, daß auch Hegel zu seinen wirklich wertvollen Ergebnissen durch eben dieselbe Methode gekommen war, ja daß man zu positiven wissenschaftlichen Sätzen überhaupt nur auf diese Weise gelangen kann. Hartmanns strenge Konsequenz behütete ihn jedoch, von dieser Methode aus zu den einseitigen Anschauungen zu kommen, welche die Naturwissenschaften der Zeit kennzeichnen. Wie kann man behaupten, daß die Beobachtung nichts liefere, als was die Sinne wahrnehmen, was Augen sehen, Ohren hören und so weiter, fragte er sich? Ist das Denken nicht ein über alle Sinne hinausgehendes Auffassungsorgan? Sollte sich die Wirklichkeit in dem Rohstofflichen erschöpfen? Öffnet eure Sinne der Wirklichkeit, aber tut das nicht minder mit eurem vernünftigen Denken, so rief er den Natur-forschern zu, dann werdet ihr finden, daß es eine höhere Wirklichkeit gibt, als die ihr für die allein wahre haltet!
Hegel war von keinem geringeren Durste nach Wirklichkeit beseelt als ein moderner Naturforscher, aber sein auf Höheres gerichteter Sinn offenbarte ihm auch eine höhere Wirklichkeit. In dieser Lage befand sich auch ein E. v. Hartmann. Er ging von der Ansicht aus, daß sich nicht alles, was uns in der Welt entgegentritt, aus Ursachen erklären lasse, die wir mit den Sinnen wahrnehmen. Schon wenn wir einen Stein zur Erde fallen sehen, schreiben wir die Ursache der Anziehungskraft der Erde zu, die wir aber nicht mehr wahrnehmen, sondern nur im Denken erfassen können. Und erst, wenn wir einen Organismus in seiner Entwickelung vom Ei bis zu seiner Vollendung verfolgen! Wer wollte da sein Erklärungsbedürfnis befriedigen, ohne zu der Auffassung seine Zuflucht zu nehmen, daß hier Kräfte walten, die wir uns nur im Gedanken vergegenwärtigen können. Es wird uns bei einet solchen Betrachtung des Organismus klar, daß wir eine einheitliche gedankliche Grundlage voraussetzen müssen, wenn wir unset Erkenntnisbedürfnis befriedigen wollen. Wir müssen im Denken und aus dem Denken etwas zu der Wahrnehmung hinzufügen. wenn wir die Sache verstehen wollen. Was wir da hinzufügen kann natürlich nur ein Gedanke, eine Idee sein. Wie wir aber in unserem Denken eine Idee brauchen, um die Vorstellung zum
Beispiel eines Organismus zustande zu bringen, so muß es auch etwas Analoges in dem Dinge selbst geben, das dasselbe in seiner Wirklichkeit zustande bringt. Das Analogon in der Wirklichkeit nun, das der Idee in unserem Bewußtsein entspricht, nennt Hartmann die unbewußte Idee.
Dieser Begriff der Idee ist aber gar nicht so sehr verschieden von dem, was Hegel die Idee nennt. Hartmann behauptet nichts anderes als das: was draußen in der Welt als Ursache der Dinge und Prozesse wirkt, komme innerhalb unseres Bewußtseins in Form der Idee zum Ausdrucke. Somit muß er den Inhalt unserer Ideenwelt für dasjenige halten, was uns den Schleier des Daseins lüftet, soweit das letztere für uns überhaupt möglich ist. Und Hegel sagt: ergreife die Welt der Ideen in deinem Bewußtsein, so hast du den objektiven Inhalt der Welt ergriffen. Soweit bestünde nun eine vollständige Übereinstimmung der beiden Denker. Während aber Hegel einfach die Welt der Ideen in unserem Innern aufsucht und dabei den inneren logischen Charakter derselben als maßgebend hinnimmt, sagt Hartmann: die Idee als logische, bloß wie sie in uns, in Gedanken, ist, könnte höchstens wieder Idee in logischer Weise bedingen, nicht aber Dinge der Wirklichkeit hervorbringen. Dazu muß ein Zweites, eine Kraft, etwas schlechterdings Uniogisches kommen. Erkennen kann ich von diesem zweiten Elemente der höchsten Wirklichkeit natürlich wieder nur den Repräsentanten, den es mir in mein Bewußtsein hereinsendet. Wenn ich mich aber frage, welches ist die Kraft in mir, die das tatsächlich vollzieht, zur Wirklichkeit macht, was die Logik bedingt, so finde ich meinen Willen. Etwas diesem Analoges muß auch in der Außenwelt walten, um den sonst machtlosen Ideen Wirklichkeit, gesättigtes Dasein zu verleihen. Dieses Analogon nennt Hartmann den unbewußten Willen. Unbewußte Idee und unbewußter Wille zusammen aber bilden den unbewußten Geist oder das Unbewußte.
Man muß dabei beachten, daß Hartmann durchaus nicht etwa behauptet, die unbewußte Idee oder der unbewußte Wille seien in der Außenwelt gerade in derselben Oualität vorhanden wie ihre bewußten Repräsentanten in unserem Geiste. Er hält vieimehr
daran fest, daß wir über die Qualität dessen, was der Idee und dem Willen im Objektiven entspricht, nichts wissen, sondern daß für uns nur das eine feststeht, daß solche Analoga existieren.*
Durch die letztere Annalame, durch den unbewußten Willen, geht nun Hartmann wesentlich über Hegel hinaus. Mußte dieser nach seiner Grundannahme die logische Bestimmtheit für das allein bei der Idee in Betracht Kommende halten, überhaupt in logischen Gesetzen die höchsten Weltgesetze sehen, so behauptet Hartmann: alles, was wir in der Welt gewahr werden, ist: durch den Willen realisiertes Ideelles. Da der Wille nun natürlich eine Kraft ist, die von den Gesetzen der Logik nichts weiß, so sind die Weltgesetze auch nicht die logischen. Wenn ich also bloß in mich hineinblicke und meine Ideenwelt betrachte in ihren logischen Zusammenhängen, so komme ich zu keinem Ziele. Ich muß hinaussehen und durch Beobachtung erforschen, was det Wille für Geschöpfe aus dem ewigen Quell des Seins herausspritzt. Was ich da beobachte, was ich zuletzt als Resultat gewinne, ist Idee, aber aus der Wirklichkeit entlehnte Idee.
Den Naturforschern warf Hartmann vor, daß sie einfach nicht die Fähigkeit hätten, die Ideen zu beobachten, und deshalb bei der bloßen Sinneswahrnehmung stehenblieben. Den Philosophen aber fertigten die Naturforscher damit ab, daß sie seine «Philosophie des Unbewußten» für das Werk eines Phantasten erklärten, der über naturwissenschaftliche Fragen in ganz dilettantenbafter Weise mitsprechen wolle. Bald nach der «Philosophie des Unbewußten» erschienen eine Reihe von Gegenschaiften vom naturwissenschaftlichen Srandpunkte, unter denen sich auch die eines Anonymus befand. Die Naturforscher erklärten dieselbe für ein sehr verdienstliches Büchlein, das mit echter Sachkenntnis die leichtfertigen Ausführungen Hartmanns vom Srandpunkte wahrer Erfahrungswissenschaft widerlege. Das Schriftchen erlebte eine zweite
- - -
* Hartmann bezeichnet die Beziehung eines im Bewußtsein vorhandenen Etwas auf ein jenseits desselben Bestehendes, uns Unbekanntes, als transzendental. Deshalb nennt er seine Weltansicht, die eine solche Realität annimmt und den Bewußtseinsinhalt auf sie bezieht, transzendentalen Realismus.
Auflage; der Verfasser setzte aber jetzt seinen vollen Namen auf das Titelblatt. Es war - Eduard von Hartmann. Der Philosoph hatte sich den Spaß gemacht, einmal den Gegnern grtmdiich zu zeigen, daß man sie schon verstehen kann, wenn man sich nur hinunter auf ihren Standpunkt stellen will. Es war ihm trefflich gelungen, zu zeigen, wer deshalb widerspricht, weil er den Gegner nicht versteht.
Der Erfolg der «Philosophie des Unbewußten» war der denkbar größte. Bis heute sind zehn Auflagen erschienen, und in alle europäischen Kultursprachen sind Übersetzungen besorgt. Hartmann, ermutigt dadurch, widmete sich mir aller Kraft dem Ausbau seiner Weltanschauung. Er suchte nicht nur die sich immer mehrenden Erfahrungen der Naturwissenschaft von dem Gesichtspunkte seiner Philosophie zu beleuchten*, sondern auch die Konsequenzen für Ethik, Religionswissenschaft und Ästhetik zu ziehen.
Die ethischen Anschauungen Hartmanns finden wir hauptsächlich in seinem Buche: «Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins». Aus seinen Grundansichten auf dem Gebiete der Ethik folgt auch sein Standpunkt in der Politik und in den kulturellen Tagesfragen.
Die unbewußte Idee wird durch den unbewußten Willen verwirklicht. Dies ist das Wesen des Weltprozesses. Und der historische Entwickelungsprozeß ist nur ein Teil dieses Prozesses. Aber als solcher ist er wieder ein Ganzes, und die einzelnen Kultur-systeme und sittlichen Anschauungen der Völker und Zeitalter sind nur seine Teile. Wer das erkennt, kann den Zweck seines Daseins nicht in einer einzelnen Handlung suchen, sondern nur in dem Werte, den sein besonderes Dasein für den Kulturprozeß der ganzen Menschheit und mittelbar dadurch für den ganzen Weltlauf hat. Nur in der selbstlosen Hingabe an die Ganzheit, in dem Aufgehen in der Menschheit, kann der Einzelne sein Heil finden. Als Ergänzung gleichsam zu dieser Erkenntnis sucht Hartmann den empirischen Nachweis zu liefern, daß keine Lust in der
- - -
* Eben (1891) ist ein Ergänzungsband zur ersten bis neunten Auflage der «Philosophie des Unbewußten» (Leipzig, Wilhelm Friedrich) erschienen, der sich mit den neuesten Ergebnissen der Naturlehre auseinandersetzt.
Welt uns ein uneingeschränktes Gefühl des Glückes gewähren kann. Wo immer wfr hinblicken mögen: weun wir uns an Einzelnes, Vorübergehendes hängen, so wird die Entbehmng größer sein als die Befriedigung. Wir müssen uns mit dieser Überzeugung durchdringen und dann um so freudiger der oben gekennzeichneten idealen Lebensaufgabe widmen. Wenn man diese ethische Auffassung Pessimismus nennen will, dann mag man es immerhin tun. Nur hüte man sich davor, diese Harsmannsche Ansicht mit dem Pessimismus Schopenhauers zu verwechseln.
Der letztere ist der Überzeugung, daß der Wille in seiner Vernunftlosigkeit das einzige Weltprinzip und die Idee gar keine objektive Bedeutung habe, sondern lediglich ein «Hirnprodukt> sei. Deshalb findet er die Welt vernunftlos und schlecht. Eine Realisierung durch den vemunftlosen Willen könne überhaupt nur ein wertloses Dasein erzeugen. Es gäbe nichts Lebenswertes in der Welt. Da wir in einer solchen Welt nichts erreichen können, so sei für den Menschen das Nichthandeln dem Handeln vorzuziehen. Schopenhauers Ethik endigt, wie man sieht, mit der Empfehlung der vollständigen Tatenlosigkeit.
Man vergleiche damit die Ethik Hartmanns, so wird man sehen, daß sie zu einem ganz entgegengesetzten Resultat führt, daß sie gerade in dem selbstlosen hingebungsvollen Handeln die Befriedigung sucht, die uns das selbstsüchtige Genießen nimmermehr bieten könnte. Daß man dennoch beide Weltanschauungen, trotz wiederholten Protestes von Seite E. v. Hartmanns, immerfort zusamtnenwirft, beweist, welche Gewalt Schiagworte selbst über das gebildete Publikum haben.
Woher aber sollen wir die Grundsätze für unser jeweiliges Handeln nehmen, fragt Hartmann. Wir wirken am zweckmäßigsten, wenn wir an dem Orte, an den uns die Geschichte gesteilt hat, unsere Aufgabe am richtigsten erfassen. Was heute gut ist, war es nicht im Mittelalter und wird es nicht nach Jahrhunderten sein. Was ein Mensch zu tun hat, muß sich daraus ergeben, was sein Vorgänger getan hat. Hier muß er den Faden anknüpfen und weiter entwickeln. Nur wer aus der Vergangenheit, aus der historischen Entwickelung, seine Aufgaben für die Gegenwart kennt,
der schafft Gutes. Nicht mit abstrakten, schablonenhaften Begriffen dürfen wir auf den Sohauplatz des Handelns treten, sondern ausgerüstet mit Erkenntnis von den wahren Bedürfnissen der tatsächlichen Wirklichkeit.
Weil die liberalen Parteien mit Außerachtlassung dieser Bedürfnisse, von außen her, aus der Theorie, die Welt regieren wollen, deshalb ist Hartmann ein Gegner derselben. Er will Parteigrundsätze, die aus dem Studium der Wirklichkeit folgen. Er ist konservativ in dem Sinne, daß er überall die Reformbestrebungen an Vorhandenes angeknüpft wissen will, aber durchaus nicht in der Weise vieler Konservativer, die der Entwickelung allerlei Hemmschuhe anlegen oder ihr am liebsten gar Stillstand gebieten möchten. Hartmann will den Fottschritt, aber nicht, wie ihn der Schablonenliberalismus auffaßt, sondern als fortwährende Annäherung zu den großen Kulturzielen der Menschheit. Jede Kulturepoche ist ihm nur die Vorbereitung der folgenden. Kein Kulturzweig ist von dieser Entwickelung ausgeschlossen.
Wie sich auch die religiösen Bedürfnisse diesem allgemeinen Gesetze unterworfen zeigen, hat Hartmann in seinen beiden Werken: «Die Selbstzersetzung des Christentums und die Religion der Zukunft» und «Das religiöse Bewußtsein der Menschheit im Stufengang seiner Entwicklung» ausgeführt. Wir stehen in der Zeit, in welcher allerorten die alten religiösen Formen morsch geworden sind und neuen Platz machen müssen. Das Christentum ist keine absolute Religion, sondern nur eine Phase in der religiösen Entwickelung der Menschheit, und schon sind Anzeichen genug vorhanden, von welcher neuen Anschauung es abgelöst werden wird.
Es wäre ein arges Vorurteil, wenn man glauben wollte, die philosophischen Erörterungen Hartmanns seien wertlos für das praktische Leben. Ich will nur auf einiges hinweisen, das geeignet ist, solches zu entkräften. Hartmann hat theoretisch das DeutschÖsterreichische Bündnis und die gegenwärtige Konstellation der europäischen Staaten, lange bevor sie sich wirklich vollzogen haben, gefordert. Die Parteibildungen, wie wir sie in Deutschland in der zweiten Hälfte des verflossenen Dezenniums haben entstehen
sehen, stellte Hartmann vorher als eine Notwendigkeit hin. Die Polenfrage haben wir bereits erwähnt. Dabei darf man nun durchaus nicht vergessen, daß unser Philosoph weit davon entfernt ist, zu behaupten, daß das von ihm in dieser Weise als notwendig Bezeichnete auch das Beste sei. Das Beste zu verlangen, ist überhaupt nach seiner Ansicht eine leere Forderung; man muß zusehen, was nach den in den Menschen und in der Zeit wirkenden Motiven entstehen kann und dazu seine Hand bieten. Hartmann ist im eminentesten Sinne Realpolitiker.
Seit einiger Zeit ist man in Deutsch-Österreich auf Hartmann nicht gut zu sprechen, weil er 1885 in einem Aufsatze von einem «Rückgange des Deutschtums in den österreichischen Ländern» gesprochen hat. Wollte man den Inhalt dieses Aufsatzes genau prüfen, so würde man wahrscheinlich zu einem anderen Urteile kommen. Denn abgesehen von einigen Bemerkungen, welche die Lage unserer Stammesgenossen trauriger hinstellen, als sie in Wirklichkeit ist, und die auf Rechnung des Umstandes zu setzen sind, daß Hartmann seine Kenntnisse doch zum Teil aus den die Sache verfälschenden Zeitungsberichten und Broschüren haben muß, wird man in jenem Aufsatze nur die Ansichten vertreten finden, die heute die nationalsten österreichischen Politiker auf ihre Fahne geschrieben haben. Hartmann legte den Deutschen in Österreich dar, daß sie unter das Maß von Einfluß, das ihnen gebührt, herabsinken müssen, wenn sie fortfahren, über liberalen Parteiprogrammen die tatsächlichen Aufgaben ihrer Nation und des Reiches aus den Augen zu verlieren. Sie haben, nach seiner Ansicht, sich auf die Volkskraft und ihre höhere Bildung zu stützen, um so das zu erreichen, was sie nimmermehr durch Paktieren mit «unreifen Natiönchen» und durch liberale Phrasen erreichen können, nämlich «das Staatsruder West-Österreichs» zu lenken. Hartmann wegen dieses Aufsatzes auch nur im geringsten einer deutschfeindlichen Gesinnung zu zeihen, geht nicht an, wenn man bedenkt, wie tief seine ganze Weltanschauung im Deutschtum wurzelt und wie er dieses Deutschtum ehrt, wenn er zum Beispiel sagt, beim Ausbruch des Deutsch- Französischen Krieges «hat es sich so recht gezeigt, daß Deutschland im wesentlichen wohl für
immer darauf wird verzichten müssen, von anderem als deutschem Blute verstanden zu werden>.
Welche Bedeutung Harunatins Auffassung der politischen Situation hat, wird man erst so recht würdigen können, wenn sich eine seiner Hauptideen: «Vollständige Trennung aller politischen Parteien von wirtschaftlichen und religiös-kirchlichen» verwirklicht haben und wenn der von ihm 1881 geforderte mitteleuropäische Zollverein möglich werden wird. Man wird dann sehen, daß Hartmanns Ansichten nichts sind als die in Begriffe gebrachten sittlichen, politischen, religiösen, wirtschaftlichen usw. Kräfte der Gegenwart. Er sucht ihnen abzulauschen, nach welcher Richtung sie hinstreben, und nach dieser Richtung sucht er den praktischen Reformen den Weg vorzuzeichnen.
In der letzten Zeit schenkte uns Hartmann eine zweibändige «Ästhetik». Der erste Band sucht die Entwickelung der deutschen Kunstgeschichte seit Kant geschichtlich darzustellen; der zweite ist bestrebt, ein eigenes selbständiges Gebäude der «Wissenschaft des Schönen» aufzubauen. Im ersten Teile bewundern wir die Allseitigkeit, die auf jede Erscheinung eingeht und nicht nur eine geschichtliche Entwickelung der Grundansichten der einzelnen Ästhetiker bringt, sondern auch eine Darstellung des Fortganges der einzelnen ästhetischen Grundbegriffe, wie: schön, häßlich, komisch, erhaben, ansnutig und so weiter. Daß in dem Buche der oft mißverstandene Deutinger und der vollständig verschollene, aber hochbedeutende Trahndorff ihre gerechte Würdigung finden, gehört nicht zu seinen geringsten Verdiensten. Wer sich eingehend unterrichten will, wie sich die Ansichten über Kunst von Kant herauf bis auf unsere Tage entwickelt haben, der muß zu diesem Buche greifen.
In der «Wissenschaft des Schönen» sucht Hartmann, seinem Prinzipe getreu, jenes Gebiet im tatsächlich Vorhandenen zu suchen, worinnen das Schöne, das von der Kunst Geschaffene, seinen Sitz hat. Er verwirft den abstrakten Idealismus der Schellingianer, die das Schöne nicht im Kunstobjekte selbst, sondern in einer abstrakten Sphäre suchen und behaupten, jedes einzelne Schöne sei nur ein Abglanz der niemals in seiner Vollkommenheit erscheinenden
überirdischen Idee des Schönen. Diesem «abstrakten Idealismus» setzt Hartmann seinen entgegen, der den Grund und die Wurzel in dem ästhetischen Objekte selbst sucht, kurz, der auch hier die beobachtende, betrachtende, nicht die konstruierende Methode anwendet. Was ist eigentlich das Objekt, worinnen sich das «Schöne» verwirklicht? so fragt Hartmann. Weder bloß das reale Werk, das wir vor uns haben, wie die Realisten wollen, noch bloß die Harmonie der Gefähle und Empfindungen, die es in uns erzeugt, wie die Idealisten wollen, sind der Sitz des Schönen, sondern der Schein der Realität, zu dessen Hervorbringung dem Künstler das reale Produkt nur als Mittel dient. Wer nicht davon abzusehen imstande ist, welche realen Wirkungen von dem Kunstprodukte auf ihn ausgeübt werden, und nur sich dem Eindrucke des von aller Wirklichkeit abgelösten Nur wer es vermag, sich gänzlich von der realen Bedeutung des Objektes, das vor ihm steht, zu emanzipieren und sich nur dem Genusse dessen hingibt, was es scheinen will, der ist in ästhetischer Betrachtung begriffen. Und nun zeigt uns Hartmann ebensowohl, wie der von der Realität abgelöste Schein sich in einzelnen Formen des künstlerischen Schaffens ausspricht, im sinnlich Angenehmen, in den mathematischen Verhältnissen, in den organischen Bildungen und so weiter,
wie er uns ferner darstellt, in welcher Weise die einzelnen Künste mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln den «ästhetischen Schein> hervorrufen können. Wir haben selbst in diesen Blättern einen Aufsatz veröffentlicht, der von den Grundanschauungen ausgeht, die sich mit den Hartmannschen nicht vollständig decken. Besonders glauben wir, daß die Ästhetik nicht versäumen soll, zu sagen, was denn eigentlich im «ästhetischen Schein» dasjenige ist, das auf uns wirkt. Es ist ebenso gewiß, daß derjenige, welcher in seiner ästhetischen Betrachtung «durch zufällige Kenntnisse über das Privatleben des Schauspielers Schultze und der Tänzerin Müller in der Beurteilung ihrer mimischen Kunstleisrungen» beeinflußt wird, nicht zum wahren Kunstgenuß kommt, wie es wahr ist, daß ich auch bei der reinen Betrachtung des Scheines ästhetisch unberührt bleiben muß, wenn ich keine Empfindung dafür habe, was gerade durch den ästhetischen Schein zu mir spricht. Gewiß, der Künstler kann auf mich nur durch den Schein wirken, aber nicht der Charakter der Scheinhaftigkeit macht die Natur des Kunstwerkes aus, sondern der Inhalt im Schein, das, was der Künstler im Scheine verkörpert. Wer nur für den Schein Sinn hat und keinen für das im Scheine Ausgesprochene, der bleibt der Kunst gegenüber doch unempfindlich. Der Schein ist bloß deshalb notwendig, weil uns die Kunst etwas zu sagen hat, was uns von der unmittelbaren Wirklichkeit nicht gesagt werden kann. Er ist ein notwendiger Behelf der Kunst, eine Folge des künstlerischen Schaffens, aber er macht das letztere nicht aus. Das sind jedoch prinzipielle Einwände, und wir wären ungerecht, wenn wir denselben nicht entgegensetzten, daß wir selten ein Buch mit solcher Befriedigung, mit so großem Nutzen gelesen haben wie Hartmanns Ästhetik. Jeder kann daraus lernen durch die gründliche Kenntnis der Technik in den einzelnen Künsten, die den Verfasser auszeichnet, durch die Ausblicke auf das Leben, die von Hartmanns Genialität und dem großen Stil zeugen, mit denen er die Summe aller Kulturäußerungen auffaßt, und schiießlich durch den feinen Geschmack, von dern alle seine Kunsturteile getragen sind.
Wir sind selten so erfreut, wie wenn wir die Ankündigung eines neuen Werkes Hartmanns lesen, denn dann wissen wir stets, daß
ein großer Schatz unserem Geiste zugeführt wird. Und wir wünschen der Zeit Glück zu allem, was von Hartmann noch ausgehen wird, denn, wie wir schon erwähnt, er steht in der Vollkraft seines Schaffens. Er hat sein System fast ausgebaut. Wir wissen nicht auf welches Gebiet sich seine Tätigkeit nun werfen wird. Das aber wissen wir: den Charakter des Großen und Bedeutenden wird alles haben, was wir noch von ihm zu erwarten haben.
GEDANKEN ZU DEM HANDSCHRIFTLICHEN NACHLASSE GOETHES
Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des Genies, daß es in großen Zügen den Plan der Kulturentwickelung entwirft, dessen Ausbau in den Einzelheiten der nachfolgenden Generation obliegt. Es müssen oft lange Zeiträume vergehen, ehe die Welt auf Umwegen zum vollen Verständnisse dessen gelangt, was ein Einzelner auf der Höhe seinet Geisteskultur geschaffen. Und immer, wenn ein Same, den ein führender Genius der Bildung eingepflanzt hat, reif ist, als Frucht bei der Nachwelt aufzugehn, dann kehrt die letztere zu jenem Führer zurück, um sich wieder einmal mit ihm auseinanderzusetzen.
Als solche Auseinandersetzungen sind die zahlreichen Kundgebungen aufzufassen, die fortwährend aus allen Teilen des gebildeten Europas in bezug auf Goethe zutage treten. Man fühlt immer besser, daß man von Goethe um so mehr zu lernen hat, je weiter man es selbst in der Bildung gebracht hat. Der Zweig der Kultur, der dies in den letzten Jahrzehnten am anschaulichsten bewiesen hat, ist wohl die Naturwissenschaft. Zahlreiche Forscher, die zu irgendeiner Wahrheit gelangt waren, fühlten förmlich ihr Gewissen erleichtert, wenn sie einen Anhaltspunkt dafür fanden, daß Goethe über die von ihnen aufgeworfene Frage eine der ihrigen ähnliche Ansicht gehabt. Das Kapitel «Goethe und die Naturwissenschaft» ist seit langem auf der Tagesordnung und bliebe es ohne
Zweifel auch dann noch für unabsehbare Zeiten, wenn nicht der außerordentliche Umstand eingetreten wäre, daß die Publikationen des Goethe-Archives unsere Kenntnisse in diesem Felde nun wesentlich bereichern. Da dieses letztere aber in hohem Maße der Fall ist, so wird die Erörterung der einschlägigen Fragen in der nächsten Zeit überhaupt in ein neues Stadium treten.
Der Verfasser dieser Zeilen hat bereits vor einiger Zeit die verehrten Leser der Goethe-Chronik auf die zu erwartende Bereicherung unserer Goethe-Kenntnisse nach dieser Richtung hin aufmerksam gemacht. Seine vor einigen Monaten im Goethe-Archive wieder aufgenommenen Studien haben ihn nun nicht nur in dieser Überzeugung bestärkt, sondern seine Erfahrungen auf diesem Gebiete um manches wertvolle Stück vermehrt. Die hohe Besitzerin der Goethe-Schätze, die Frau Großherzogin Sophie von Sachsen, hat ihm nun gnädigst gestattet, im Einvernehmen mit dem Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs, Prof. Suphan, die Ergebnisse seiner Forschung zur vorläufigen Orientierung des Publikums zu verwerten, welcher Umstand denn auch diesen Aufsatz möglich macht.
Die Maxime, auf welche sich die gegenwärtige Naturwissenschaft besonders viel zugute tut, ist die, daß sie alle ihre Resultate auf dem Wege der Beobachtung gewinnen will. Nichts soll als wahr gelten, was nicht der Erfahrung, der Empirie seinen Ur-sprung verdankt. Es ist hier nicht der Ort, auf die umfassende Prüfung der Richtigkeit des damit gekennzeichneten Standpunktes einzugehen. Auf eines aber müssen wir die Aufmerksamkeit unserer Leser lenken, weil es für die Beurteilung der naturwissenschaftlichen Denkweise Goethes von grundsätzlicher Wichtigkeit ist. Wir meinen die präzise Beantwortung der Frage: was ist denn eigentlich Beobachtung? Was ist Erfahrung? - Wenn ich irgendeinen Satz der Wissenschaft als Erfaurungsresultat hinstelle, so habe ich doch damit nicht ein objektives Kennzeichen dieses Satzes, sondern einzig und allein die Art und Weise angegeben, auf die der Forscher zu demselben gekommen ist. Ich habe nichts über die Sache selbst, sondern nur etwas über das Verhältnis des beobachtenden Menschen zu den Dingen bestimmt. Wer mir die strenge Einhaltung des Grundsatzes der Erfahrung anempfiehlt,
der sagt mir nichts weiter, als wie ich mich verhalten soll, um zu richtigen Ergebnissen zu gelangen. Die Natur dieser Ergebnisse selbst muß er völlig unbestimmt lassen. Denn in seiner Forderung liegt es ja, daß ich mir eben von den Dingen selbst über diese ihre Natur Aufschluß hole, daß ich mein Auffassungsvermögen frei der Einwirkung der Welt öffne und die Objekte an mich heran-kommen lasse. Dann sollen sie selbst mir das enthüllen, was an ihnen für mich erkennbar ist.
Es wird diesem Grundsätze sofort widersprochen, wenn man. ausgehend von der Forderung strenger Erfahrungswissenschaft, behauptet: weil die Welt nur durch Erfahrung erkennbar ist, deshalb muß sie diese oder jene Eigenschaften haben. Wer durch das Prinzip der Erfahrung sich zum Materialismus, Atomismus und so weiter drängen läßt, der überschreitet die Grenzen, die er sich selbst gezogen hat.
Zu denjenigen Forschern nun, die sich streng innerhalb dieser Grenzen gehalten haben, gehört Goethe. Wie kommt es nun aber, daß seine Anschauungen doch gerade von denjenigen oft erheblich abweichen, die wir bei den sogenannten reinen Empirikern finden? Die letzteren verwerfen ja den Standpunkt des Idealismus, und dieser ist doch der Goethes. Verträgt sich denn die Forderung der Erfahrung überhaupt mit dem Idealismus? Wir antworten: ja, wenn der Empiriker nicht bloß mit den Sinnen des Körpers, sondern auch mit denen des Geistes zu beobachten versteht. So wie das Auge Farben und Formen, wie das Ohr Töne, so liefert der Geist Ideen als Resultate der Erfahrung.
Dies ist ein Widerspruch, vernehmen wir von Seite der Empiriker. Ideen können nie Gegenstand der Erfahrung sein, denn sie sind nicht in der Außenwelt, sondern nur in uns, in unserer Seele enthalten. So sagen die Vertreter der Erfahrung, ohne zu merken, daß sie damit eine ungeheure Inkonsequenz begehen. Was berechtigt mich zu sagen: nur das gehört den Dingen der Außenwelt an was mit den äußeren Sinnesorganen wahrzunehmen ist? Die Objekte können sich mir doch nimmermeht ihrem ganzen Inhalte nach enthüllen, wenn ich ihnen vorschreibe, sie dürfen keine anderen Eigenschaften haben als solche, die mich meine physischen
Organe erkennen lassen. Das Prinzip der Erfahrung verlangt, daß ich alles, was an mir ist, den Objekten entgegenhalte, um allseitig ihr Wesen zu erforschen. Das sinnliche Auffassungsvermögen ist aber nur eine Seite im Wesen des Menschen. Und Goethe kann denjenigen nicht als wahren Forscher gelten lassen, der sich von vornherein dazu verdaiumt, von den Dingen nur die Hälfte kennenzulernen, weil er behauptet, nur die Hälfte seines Wesens liefere ihm die Wahrheit. Nur in der Entfaltung aller unserer Erkenntniskräfte erschließt sich uns nach Goethes Ansicht das Wesen der Dinge, soweit es uns überhaupt erkennbar ist.
Wer in einseitiger Weise bloß dem Denken, der Entwickelung unseres Begriffsvermögens sich hingibt, dessen wissenschaftliche Ansichten sind leer, inhaldos, sie tragen den Charakter des Über flüssigen, weil sie gerade das Gebiet, in dessen Rätsel sie uns ein-führen sollen, fliehen; wer nur den Sinnen vertraut, nichts sucht, als das, was sie ihm liefern, der krankt an geistiger Blindheit; er tastet an den Objekten herum, ohne den Faden zu kennen, der ihn ins Innere führt, wo sich ihm die scheinbare Regellosigkeit als gesetzliche Ordnung enthüllt. Der echte wissenschaftliche Geist gibt sich für Goethe darinnen kund, daß er zwischen sinnlicher Wahrnehmung und denkender Überlegung fortwährend abwechselt. Wie Einatmen und Ausatmen das Leben unterhalten, so unterhält das Hin- und Herbewegen des Geistes zwischen Ausbreitung über die Masse der Sinnenwelt und Zusammenziehung auf die gesetzmäßigen Quellen dieser Mannigfaltigkeit die sachgemäße Forschung. Ja, aller wissenschaftliche Betrieb wird Goethe zuletzt nur als solche lebensvolle Tätigkeit des Menschen verständlich. Theorien, Hypothesen sind an sich tot; sie gewinnen nur Leben, wenn sie den Geist wie Systole und Diastole beherrschen.* Nicht um die Resultate ist es Goethe zu tun, sondern darum, durch die
- - -
* Prof. Suphan macht mich während der Ausarbeitung dieses Aufsatzes auf eine Stelle in Biedermann, Goethes Gespräche, VII, S. 122, aufmerksam, die einen wichtigen Beleg für meine obigen Ausführungen liefert:
«So entgegnete er (Goethe) Herrn Vogel auf seine Behauptung, die Theorie müsse immer der Praxis vorangehen, mir Nachdruck, daß sie immer mir der Praxis zusammengehe.»
lebendige Kraft des Geistes der schaffenden Natur näherzukommen. Das können die nicht erreichen» die sich mit fertigem, totem Wissen begnügen, sondern nur jene, die schöpferisch in sich dies tote Material lebendig werden lassen, und so in sich das hervor-bringen, was außer ihnen die Natur werden läßt. Nicht was der Mensch aus der Welt zusammenzulesen vermag, ist für Goethe das Höchste, sondern wie er sich damit abfindet, um seinen Geist mit lebenswahrem Weltinhalt zu füllen.
Wem es nicht gelingt, die Dinge in der Weise auf sich wirken zu lassen, daß die Welt in seinem Innern so lebendig, so tätig und durch und durch wirksam ist wie die Welt außer uns, wo kein Teil ist, an dem nicht unzählige Kräfte angreifen, der hat im Sinne Goethes dem Grundsatze der Erfahrung nicht genug getan.
Was an der Welt ruhend, geworden, erstarrt erscheint, ist leerer Schein, ist nur das oberflächliche Ergebnis ewigen Werdens und Wirkens. Aber jene scheinbare Ruhe ist der Gegenstand der Sinne, dieses Werden und Wirken offenbart sich in der Idee.* Und so ist die Idee Erfahrungsergebnis. Sie enthüllt sich freilich nur dem, der sich nicht mit der oberflächlichen Erfahrung befriedigt. Goethe hatte über die Resultate seiner wissenschaftlichen Forschung nie eine andere Ansicht als die, daß er auf dem Wege der Beobachtung zu ihnen gelangt ist. Aber von dem Augenblicke an, wo er durch Schiller gedrängt wurde, doch über den Charakter seiner Erfahrungen nachzudenken, wurde ihm immer klarer, daß sein ganzes Streben nur ein Suchen nach Ideen ist, als den höchsten Formen, in denen sich die Wirklichkeit ausspricht.** Diese Überzeugung
- - -
* Zum ersten Male wurde die hiermit gekennzeichnete und durch Goethe» Nachlaß für de»sen wissenschaftliche Tätigkeit in voller Beleuch tung erscheinende Eigenart des größten deutschen Dichters von K. J. Schröer zum ästhetischen Prinzipe in der Gesamt-Auffassung desselhen gemacht. (Siehe Goethe» »Faust» 1 und II mit Einleitung und fortlaufender Erklärung und Dramen, Kürschners «Deutsche National-Literatur», 6. bis 11. Band.)
** Wir finden hier auf das theoretisch-wissenschaftliche Gebiet jene Anschauung übertragen, die Goethe im Sittlichen zu seiner hohen Auffassung der Liebe, als selbsdoser Hingabe an das Objekt, führte. (Siehe Schröer Goethe und die Liebe, und dessen Einleitung zum 3. Bande von Goethes Dramen, in Kürschners »Deutsche National-Literatur».)
drängte sich uns immer mehr und mehr auf, da wir uns an der Hand von Goethes hinterlassenen Papieren den Weg anschaulich zu machen suchten, den dieser Genius auf wissenschaftlichem Gebiete genommen hat. Da bleibt keine Beobachtung einzeln stehen; stets werden weitere verwandte an sie angereiht, um über das «Was» zum «Wie», über das Einzelne hinaus zum Ganzen zu kommen, um von der Kenntnisnahrne zur Anschauung aufzusteigen. Die Erfahrungen interessieren Goethe nie unmittelbar, wie sie an sich sind, sondern immer als Frage an die Natur. Wer sich in diese Notizen vertieft, der sieht überall hinter der einzelnen Aufzeichnung eine Idee walten, die sich im Geiste Goethes aus dem Unbestimmten immer ins Bestimmtere herausarbeitet.
Wer so auf dem Papiere die Zeichen verfolgt, die deutlich genug aussprechen, wie in Goethe durch stetigen Verkehr mit der Welt Ideen werden, dem ist auch begreiflich, was es heißt: Idealismus ist mit Erfahrungswissenschaft durchaus vereinbar. Denn der Idealismus ist eben nichts anderes als die ganze Erfahrung, die Summe alles dessen, was von den Dingen kennenzulernen uns möglich ist, während das, was die Empiriker gewöhnlich zum Gegenstande ihrer Wissenschaft machen, nur die halbe Erfahrung ist, die Swmnanden ohne die Summe. Francis Bacon, der bekannte englische Philosoph, sagte einmal, die wissenschaftliche Forschung sei eine Additionsaufgabe; aber er hat es nicht weiter gebracht als bis zu einer Anleitung, wie man die einzelnen Posten aufstellt; wie man die Summe findet, blieb ihm verborgen, weil er die Sinne für die einzigen Vermirtler der Erfahrung hielt und nicht wußte, daß die Vernunft den gleichen Anspruch auf diesen Titel hat. Goethe hat die letztere denn auch in ihre Rechite eingesetzt und damit eine hohe Sendung erfüllt. Die Sinne sind wunderbare Boten der Außenwelt, wenn der Geist die Kundgebungen ihrer ideellen Bedeutung nach versteht, die sie ihm bringen;. aber ihre Schrift-züge sind wertlos, wenn wir bloß hinstarren auf das, was wir lesen sollten. Wer behauptet: es gäbe nichts zu lesen, dem werden alle jene, die bei Goethe in die Schule gegangen sind, antworten: suche den Grund nicht in den Dingen dieser Welt, sondern in dir.
DIE PHILOSOPHIE IN DER GEGENWART UND IHRE AUSSICHTEN FÜR DIE ZUKUNFT
In philosophischen Kreisen hört man vielfach über die Abnahme des Interesses für die Philosophie bei den Gebildeten der Gegenwart klagen. Die in dieser Klage ausgesprochene Meinung kann aber jedenfalls nicht ganz im allgemeinen aufrecht erhalten werden. Eine Anzahl von Erscheinungen sprechen dagegen. Man denke nur, welchen Einfluß Eduard von Hartmann, gegenwärtig Deutschlands gtößter Denker, auf unsere Zeitgenossen ausgeübt hat. Seine zuerst im Jahre 1868 erschienene «Philosophie des Unbewußten> hat bis heute zehn Auflagen erlebt. Und die Literatur, die sich mit der Weltanschauung dieses Philosophen beschäftigt, ist ins Unübersehbare angewachsen. Welche Wirkung ferner haben Richard Wagners ästhetische Abhandlungen auf die Kunstanschauung der Gegenwart gehabt! Begeistert wurden die hier vorgetragenen Lehren, namentlich von der jüngeren Generation, aufgenommen. Auch auf den Eifer, mit dem Friedr. Alb. Langes « Geschichte des Materialismus> eine Zeitlang gelesen wurde, muß hier hlngedeutet werden. Nicht weniger die Art, wie ganz seichte, aber immerhin die philosophischen Grundprobleme behandelnde Schriften, wie Ludwig Büchners «Kraft und Stoff», Carl Vogts «Köhlerglaube und Wissenschaft», verschlungen wurden, kommt in Betracht. Darwins und Haeckels entwickelungsgeschichtliche Schriften fanden ein großes Publikum. Ungeheures Aufsehen endlich macht in unserer Zeit Friedrich Nietzsche, dieser tragische Held des Gedankens, der an höchste Probleme des Menschengeistes herantritt, aber ohne logisches Gewissen, ohne Disziplin des Denkens im Reiche der Ideen gleichsam nur wühlt. Er hat auf der einen Seite Begeisterung hervorgerufen, die sich freilich über ihren eigentlichen Inhalt so unklar wie möglich ist, auf der andern Seite geärgert, empört, zum schärfsten Widerspruch herausgefordert. Kalt gelassen aber hat er wohl nur wenige aus der großen Zahl derer, die sich mit seinen kühnen Gedanken befaßt haben; ein deutlich sprechender Beweis dafür, daß das philosophische
Interesse in unserer Zeit einer Anregung in großem Stile doch entgegenkommt.
Auf einem weiten Gebiete scheint aber allerdings die Phllosos phie ihre Macht und ihren Einfluß eingebüßt zu haben. Das ist dasjenige der Einzelwissenschaften: Kultur- und namentlich Literaturgeschichte, Geschichte und die Naturwissenschaften. Am auffallendsten macht sich das in der Literaturgeschichte und in den Naturwissenschaften geltend. Wahrhaft kläglich ist die Behandiungsweise, welche die Schöpfungen unserer klassischen Dichter in literarhistorischen Monographien, namentlich solchen im Sinne der Schererschen Schule, erfahren. Hier fehlt oft die aller-geringste Kenntnis von philosophischen Begriffen und Anschauungen. Und wie irrtümlich ist doch der Glaube, daß man die letzteren bei Beurteilung der Kunstleistungen unserer klassischen Zeit entbehren könne! Vor allen anderen Dingen ist notwendig, daß man den Kreis von Anschauungen und Ideen desjenigen Menschen ganz beherrscht, dessen Kunstschöpfungen man würdigen will. In den Werken unserer Klassiker, Lessing, Herder, Goethe, Schiller, Jean Paul, Schlegel u. a., spiegelt sich aber durchaus der philosophische Gehalt jener großen Zeit, in der sie lebten. Und wer kein Verständnis für dieses inhaltliche Element ihrer Arbeiten hat, der ist auch zur ästhetischen Würdigung ihrer Form nicht geeignet. Aber auch bei Behandlung anderer Epochen unserer Literatur können wir bemerken, daß die Fachgelehrten ein wahrhaftes Grauen vor philosophischer Behandlungsweise empfinden.
Beinahe noch übler sieht es in den Naturwissenschaften aus. Hier findet sich eine Anhäufung unendlicher Detalls, denen sich fast nirgends leitende Gesichtspunkte, große Ausblicke beigesellen. Wer eine charakteristische Einzelerfahrung ausnutzen will, um tiefer in den Zusammenhang der Naturdinge einzudringen, gilt sogleich für einen Schwärmer. Die gedankenloseste Registrier-arbeit macht sich hier breit. Und wenn Richard Falckenberg in seiner geistvollen Antrirtsrede: «Über die gegenwärtige Lage der deutschen Philosophie» (Leipzig 1890, S.6) sagt, «die Zeit müsse erst noch kommen, wo der Charakter eines unphilosophischen
Kopfes zu den Ehrentiteln gezahlt würde>, so möchten wir demgegenüber behaupten: in manchen naturwissenschaftlichen Kreisen ist sie allerdings bereits gekommen, diese Zeit.
Die angeführten Erscheinungen zeigen, daß der Vorwurf wegen Mangels an Interesse für philosophische Betrachtungsweise wohl den Vertretern der einzelnen Fachwissenschaften gemacht werden kann, nicht aber dem gebildeten Lesepublikum überhaupt.
Angesichts dieser Erscheinungen ist wohl die Frage berechtigt: worin sind die Gründe jener Emanzipation der Einzelwissenschaften von der Philosophie zu suchen?
Nicht zum geringsten Teile liegen sie in der historischen Entwickelung der Philosophie in Deutschland. Es ist ja zweifellos, daß den großen Philosophen unseres Volkes: Kant, Fichte, Schelling, Hegel, bei aller Genialität und bei dem wahrhaft bewundernswerten Zug ins Große, der ihnen allen eigen war, doch eines gefehlt hat: die Gabe, sich leicht verständlich zu machen. Es gehört entweder eine ungewöhnliche Gewandtheit in der Verrichtung von Gedankenoperationen dazu, so daß das Denken mit der Leichtigkeit des Spielens geschieht, oder aber eine große Selbstüberwindung, um sich in die Sphären zu erheben, in die uns jene Philosophen führen. Wer des einen nicht fähig ist und zum andern nicht guten Willen genug hat, für den ist das Eindringen in die Lehren unseres eigentlichen philosophischen Zeitalters eine Unmöglichkeit. Hierin müssen wir auch die Ursache für das Mißverstehen Hegels suchen. Dieser metaphysik-feindliche Philosoph, der mit einem unersättlichen Durst nach Erkenntnis des Wirklichen strebte, dieser entschiedenste aller Vertreter des Positivismus und der Empirie, er wird merkwürdigerweise gewöhnlich hingestellt als ein Ausdenker von leeren Begriffsschemen, die, alles Erfahrungswissen verleugnend, sich in ein wesenloses philosophisches Wolkenkuckucksheim verlieren. Man begreift nicht, daß es bei Hegel darauf ankommt, alles, was zur Erklärung einer Erscheinung beigezogen werden soll, restlos der Wirklichkeit zu entnehmen. Er will nirgendsher Elemente zu Hilfe rufen, wenn er diese unsere Welt erklären soll. Alles, was sie konstituiert, muß in ihr selbst liegen. So ist seine Anschauung ein strenger Objektivismus. Der
Geist soll nichts aus sich schöpfen, um es den Erscheinungen behufs ihrer Entzifferung aufzupfropfen. Wissenschaftliche Richtungen wie den modernen Atomismus, der eine ganze Welt noch hinter unserer Erscheinungswelt voraussetzt, würde Hegel energisch zurückweisen.
Was objektiv im Weltprozesse liegt, das soll nach Hegel Inhalt der Philosophie werden, nichts darüber. Und weil er als objektiven Gehalt der Welt nicht bloß ein Materielles anerkennen konnte, sondern die Gesetze des Daseins und Geschehens, die doch auch in der Wirklichkeit wahrhaft vorhanden sind, zum Weltinhalt rechnete, deshalb ist seine Lehre Idealismus. Was Hegel von den modernen Positivisten unterscheidet, ist nicht die Art des Forschens, ist nicht der Glaube, daß nur das Wirldiche Gegenstand der Wissenschaft sein kann. Darin stimmt er ganz mit ihnen überein. Er unterscheidet sich von ihnen aber durch die Ansicht, daß für ihn auch die Idee wirklich ist, oder umgekehrt, daß das Wirkliche real und ideell zugleich ist. Diesen Charakter der Hegelsehen Philosophie hat erst Eduard von Hartmann wieder verstanden, und er hat die ihm entsprechende Behandlungsart in seinen mustergultigen historischen Werken: und «Das religiöse Bewußtsein der Menschheit im Stufengang seiner Entwicklung» durchgeführt. Hartmann hat es aber auch verstanden, die Schwierigkeiten, die bei Hegel einem Verständnis in weiteren Kreisen entgegenstehen, und die wir oben erwähnt haben, zu vermeiden und Hegelsche Gesinnung mit verständlicher, auch dem weniger philosophisch Geschulten zugänglicher Darstellungsweise zu vereinigen. Hartmann sucht in seinen historischen Werken das Wirkliche mit gleicher Strenge wie die sich Historiker nennenden Zeitgenossen, aber er findet nicht wie sie nur die nackten Tatsachen, sondern auch den ideellen Zusammenhang der geschichtlichen Erscheinungen. Und es ist sehr zu bedauern, daß er nicht auf Literaturhistoriker und Historiker von dieser Seite her einen ähnlich maßgebenden Einfluß gewonnen hat wie durch seine «Philosophie des Unbewußten» auf gebildete Laien. Hartmann ist als der eigentliche Fortsetzer jener Philosophie großen Stiles anzusehen, die
durch Kant, Fichte, Schelling, Hegel und Schopenhauer die ganze Nation mächtig ergriffen hat
Warum hat denn aber auch er die eigentliche Fachwissenschaft so wenig zu beeinflussen vermocht? Diese Frage läßt sich nach unserer Ansicht ziemlich einfach beantworten. Der Grund liegt in dem Mißtrauen und Mangel an Verständnis, die ihin von den amtlich berufenen Vertretern seiner Wissenschaft entgegengebracht wurden und die erst in jungster Zeit und nur sehr langsam besseren Beziehungen Platz machen.
Dieses beklagenswerte Verhältnis zwischen der offiziellen Philosophie einer- und Hartinaun andererseits hat nun aber einen tieferen Grund. Hartmann ergriff sogleich, als er sich an philosophische Studien heranmachte, das zentrale Problem: wie verhält sich das Bewußtsein zu dem Unbewußten im Weltendasein, und was spielt überhaupt das Unbewußte für eine Rolle in Natur und Geist? Von da ausgehend erstreckt sich sein Denken auf alle wichtigeren Fragen der Philosophie, so daß er gleich bei seinem ersten Auftreten mit einem in sich geschlossenen Anschauungskreise vor dem Publikum erscheint. Die Schulphilosophie liebt das aber - rühmliche Ausnahmen abgerechnet - nicht Sie sieht nur die Bearbeitung von Einzel-Problemen gern und bevorzugt sogar jenen zaghaften Skeptizismus, der sich den großen, von jedem Menschen naturgemäß gestellten Fragen gegenüber so zurückhaltend als möglich benimmt. Zumeist sind es recht erkünstelte und selbstgemachte Probleme, an die sich die fachmännische Wissenschaft hält, während sie demgegenüber, was jedermann wissen will, nur die Miene des Zweiflers für die dem wahren Forscher zustehende ansieht und sofort den Vorwurf des Dilettantismus bei der Hand hat, wenn sie ein kühnes Losgehen auf derlei Dinge erblickt. Dadurch hat die Schulphilosophie sich allmählich von dem anderen Wissenschaftsbetriebe völlig isoliert, ihre Ergebnisse sind nicht mehr wichtig und interessant genug, um über die Einzelwissenschaften Macht zu gewinnen. Während es das Richtige wäre, wenn der Philosoph die allgemeinen Gesichtspunkte, die leitenden Ideen für die Einzelwissenschaften kennzeichnete und von den letzteren wieder die Ergebnisse aufnährme, um sie im Sinne einer Gesamtauffassung
der Dinge weiter zu benützen, sieht sich der gegenwärtige philosophische Fachgelehrte als Einzelforscher neben anderen an. Er geht neben den Spezialisten her, anstatt mit ihnen sich in lebendige Wechselwirkung zu setzen. Nur Hartmann hat seinen Philosophenberuf in dem charakterisierten idealen Sinne aufgefaßt. Er wurde dafür lange nicht für voll genominen und wird es von vielen Schulphilosophen auch heute nicht.
Wir sehen: die Stellung, welche die Philosophie im Leben und in der Kultur der Gegenwart einnimmt, ist durchaus keine solche, wie man sie wünschen möchte. Deshalb begraßen wir mit großer Freude ein Buch, das eben erschienen ist und das dazu bestimmt erscheint, Klarheit zu verbreiten über die Aufgaben und Ziele der Philosophie. Wir meinen Johannes Volkelts: «Vorträge zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart.» Gehalten zu Frankfurt a. M. im Februar und März 1891. Das Buch ist geeignet, auf den weitesten Leserkreis zu wirken und zu zeigen, was die Philosophie eigentlich will und für das Leben und die Kultur zu leisten vermag. Volkelt, obwohl wissenschaftlicher Philosoph im besten Sinne des Wortes — er und Johannes Rehmke haben die besten Bücher über Erkenntnistheorie geschrieben — hat immer einen freien, offenen Blick gehabt sowohl für die weitausgreifenden Aufgaben des Menschenlebens wie für die intimsten Erscheinungen desselben. Das erstere beweist seine Wiener Rede: «Kants kategorischer Imperativ und die Gegenwart» sowie seine Basler Antrittsrede: «Über die Möglichkeit der Metaphysik», das letztere sein Buch über «Die Traumphantasie» und seine Darstellung: «Franz Grillparzer als Dichter des Tragischen». In den uns vorliegenden Vorträgen stellt Volkelt erst den Gegensatz zwischen der Philosophie der Gegenwart und jener vom Anfänge des Jahrhunderts dar. Er zeigt, wie alles Intuitive, Persönliche, Kühne aus dieser Wissenschaft gewichen ist und einem verstandesmäßigen, unpersönlichen, skeptischen Betriebe Platz gemacht hat. Während man früher unerschrocken nach den Gründen der Erscheinungen fragte, ist man jetzt ängstlich bemüht, erst unser Erkenntnisvermögen zu prüfen, inwieweit es denn imstande sei, in die Geheimnisse der Welt einzudringen. Die Philosophie hat einen vorwiegend erkenntnistheo-
retischen Charakter angenommen. Sie ist allem metaphysischen Treiben feind geworden. Der Verfasser aber betont demgegenüber sowohl die Notwendigkeit wie die Möglichkeit einer Metaphysik. Nur meint er, daß sie nicht mit jener Kühnheit und Sicherheit wird auf ihr Ziel losgehen können, wie man das früher geglaubt hat. Er hat die Ansicht, daß sie, start mit wirklichen Lösungen zu prunken, sich vielfach wird damit genügen lassen müssen, die Richtung anzugeben, in welcher bestimmte Probleme zu verfolgen sind, die Fragestellungen genau zu formulieren, das Material her-beizutragen, welches zu einstigen Resultaten führen kann, ja in manchen Fallen wird sie nichts anderes können, als die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten angeben. Ebenso beweist Volkelt die Notwendigkeit jener Zweige der Philosophie, die gewöhnlich als Natur- und Geistesphilosophie angeführt werden, und zu welch letzterer er Psychologie, Ethik, Ästhetik und Religionsphilosophie rechnet. In allen Einzelwissersschaften kommt man zuletzt auf höchste Prinzipien, letzte Resultate, die innerhalb der Wissenschaft, in der sie gewonnen werden, nicht weiter zu verfolgen sind. Sie bilden den Inhalt dieser besonderen philosophischen Wissenschaften, von denen sie zu einem Ganzen von Weltanschauung zusammengefügt werden. Ferner legt Volkelt in schönster Weise dar, wie, wenn auch nicht die wissenschaftliche Philosophie, so doch die aus einer philosophischen Geistesanlage quellende Gesinnung die ganze menschliche Persönlichkeit durchdringt und zur ethischen, religiösen Grundlage des Lebens namentlich derjenigen Personen wird, für welche die positiven Religionen ihre zwingende Glaubenskraft verloren haben. Die Philosophie wird endlich nach Volkelts Ansicht diejenige Macht sein, welche durch Umwandlung der geoffenbarten Religion in Vernunftreligion eine Entwickelung des Christentums herbeiführen soll, wodurch dasselbe zu einem wirklich kulturfreundlichen Element im modernen Völkerleben werden kann. Zuletzt widmet der Verfasser seine Betrachtung dem Einflusse, den die Philosophie auf den modernen Fortschritt unserer Kultur haben wird. Sie muß eine wichtige Rolle schon deswegen in Gegenwart und Zukunft spielen, weil wir jenes Stadium überwunden haben, wo alle Kultur nur mehr aus einem gleichsam
unbewußten Wirken von Temperament und Gefühl entspringt. Wir streben bewußt, aus verständiger Überlegung, unseren Kulturzielen zu. Hierbei Dienste zu leisten, ist die Philosophie besonders geeignet.
Der Verfasser dieser Zeilen ist nicht in allem mit Volkelt einverstanden. Namentlich steht er in der Erkenntnistheorie auf einem anderen Standpunkte. Er darf dabei vielleicht auf seine eigene Schrift über Erkenntnistheorie hinweisen. Dessenungeachtet mochte er Volkelts Buch der Beachtung aller Kreise empfehlen.
Wir stehen ja zweifellos vor manchen Umwälzungen in bezug auf Denkweise und Wertschätzung der menschlichen Handlungen. Bei einer Neugestaltung der Verhältnisse wird die Philosophie ein kräftig Wörtlein mitzusprechen haben. Zur Vorbereitung sind solche Schriften wie die Volkeltsche besonders geeignet. Den zweiten Teil meines Themas werde ich in einem nächsten Artikel behandeln.
*
Ein Umschwung zum Bessern wird in dem philosophischen Leben erst eintreten, wenn wieder der Trieb erwacht, die Kraft des Denkens an den Zentralproblemen des Daseins zu erproben. Dieser Trieb ist gegenwärtig gelähmt. Wir leiden an Feigheit des Denkens. Wir können es nicht glauben, daß unser Denkvermögen ausreicht, um die tiefsten Fragen des Lebens zu beantworten. Ich habe es oft hören müssen: gegenwärtig sei es unsere Aufgabe, Baustein auf Baustein zu sammeln. Die Zeit sei vorbei, wo man, ohne erst die Materialien zur Hand zu haben, im stolzen Übermut philosophische Lehrgebäude aufführte. Wenn wir erst dieses Materials genug gesammelt haben, dann wird schon das rechte Genie erstehen und den Bau aufführen. Jetzt sei nicht die Zeit zum Systembauen. Diese Ansicht entspringt einer bedauernswerten Unklarheit über die Natur der Wissenschaft. Wenn die letztere die Aufgabe hätte, die Tatsachen der Welt zu sammeln, sie zu registrieren und sie zweckmäßig nach gewissen Gesichtspunkten systematisch zu ordnen, dann könnte man etwa so sprechen. Dann aber müßten wir überhaupt auf alles Wissen verzichten; denn mit
dem Sammein der Tatsachen würden wir wohl erst am Ende der Tage fertig werden, und dann gebräche es uns an der nötigen Zeit, die geforderte gelehrte Registrierarbeit zu vollziehen.
Wer sich nur einmal klar macht, was er eigentlich durch die Wissenschaft erreichen will, dem wird die Irrtümlichkeit jener eine unendliche Arbeit in Anspruch nehruenden Forderung gar bald einleuchten. Wenn wir der Natur gegenübertreten, dann steht sie zunächst wie ein tiefes Mysterium vor uns, sie dehnt sich wie ein Rätsel vor unseren Sinnen aus. Ein stummes Wesen blickt uns entgegen. Wie können wir Licht in die mystische Finsternis bringen? Wie das Rätsel lösen?
Der Blinde, der ein Zimmer betritt, kann nur Dunkelheit in demselben empfinden. Und wenn er noch so lange herumwandelt und alle Gegenstände betastet: Helligkeit wird ihm dadurch nimmer den Raum erfüllen. Wie dieser Blinde der Einrichtung des Zimmers, so steht im höheren Sinne der Mensch der Natur gegenüber, der von der Betrachtung einer unendlichen Zahl von Tatsachen die Lösung des Rätsels erwartet. Es liegt etwas in der Natur, was uns tausend Tatsachen nicht verraten, wenn uns die Sehkraft des Geistes abgeht, es zu schauen, und was uns eine einzige offenbart, wenn wir dieses Vermögen besitzen. Ein jegliches Ding hat zwei Seiten. Die eine ist die Außenseite. Sie nehmen wir mit unseren Sinnen wahr. Dann gibt es aber auch eine Innenseite. Diese stellt sich dem Geiste dar, wenn er zu betrachten versteht. An seine eigene Unfähigkeit in irgendeiner Sache wird niemand glauben. Wer bei sich die Fähigkeit vermißt, diese Innenseite wahrzunehmen, der leugnet sie am liebsten dem Menschen ganz ab, oder er verschreit diejenigen als Phantasten, die vorgeben, sie zu besitzen. Gegen ein absolutes Unvermögen läßt sich nichts machen, und man könnte die nur bedauern, die wegen desselben nie zur Einsicht in die Tiefen des Weltwesens kommen können. Der Psychologe aber glaubt nicht an diese Unfähigkeit. Jeder geistig normal-entwickelte Mensch hat das Vermögen, in jene Tiefen bis zu einem gewissen Punkte hinunterzusteigen. Aber die Bequemiichkeit des Denkens verhindert viele daran. Ihre geistigen Waffen sind nicht stumpf, aber die Träger sind zu faul, sie
zu handhaben. Es ist ja unendlich viel bequemer, Tatsache auf Tatsache zu häufen, als die Gründe für dieselben durch das Denken aufzusuchen. Vor allem ist bei solcher Tatsachenhäufung der Fall ausgeschlossen, daß ein anderer kommt und das von uns Vertretene umstößt. Man kommt auf diese Weise nie in die Lage, seine geistigen Positionen verteidigen zu müssen, man braucht sich nicht darüber aufzuregen, daß morgen von jemand das Gegenteil unserer heutigen Aufstellungen vertreten wird. Man kann sich, wenn man bloß mit tatsächlicher Wahrheit sich abgibt, hübsch in dem Glauben wiegen, daß uns diese Wahrheit niemand bestreiten kann, daß wir für die Ewigkeit schaffen. Jawohl, wir schaffen auch für die Ewigkeit, aber wir schaffen bloß Nullen. Diesen Nullen durch das Vorsetzen einer bedeutungsvollen Ziffer in Form einer Idee einen Wert zu verleihen, dazu fehlt uns eben der Mut des Denkens.
Davon haben heute wenige Menschen eine Ahnung, daß etwas wahr sein kann, auch wenn das Gegenteil davon mit nicht geringerem Rechte behauptet werden kann. Unbedingte Wahrheiten gibt es nicht. Wir bohren tief in ein Ding der Natur, wir holen aus den verborgensten Schachten die geheimnlsvollsten Weisheiten herauf, wir drehen uns um, bohren an einer zweiten Stelle: und das Gegenteil zeigt sich uns als ebenso berechtigt. Daß eine jede Wahrheit nur an ihrem Platze gilt, daß sie nur so lange wahr ist, als sie unter den Bedingungen behauptet wird, unter denen sie ursprünglich ergründet ist, das hat Hegels Genialität der Welt gelehrt. Es ist wenig begriffen worden.
Wer macht heute nicht einen respektvollen Knix, wenn der Name Friedr. Theod. Vischer genannt wird. Daß dieser Mann es als die höchste Errungenschaft seines Lebens bezeichnete, von Hegel grüridlich die oben ausgesprochene Überzeugung von dem Wesen der Wahrheit gelernt zu haben, das wissen aber nicht viele. Wüßten sie es, dann strömte ihnen noch eine ganz andere Luft aus Vischers herrlichen Werken entgegen, und man würde auf weniger zeremonielles Lob, aber auf mehr ungezwungenes Verständnis dieses Schriftstellers stoßen.
Wo sind die Zeiten, in denen Schiller tiefes Verständnis fand,
als er den philosophischen Kopf pries gegenüber dem Brotgelehrten! Jenen, der rückhaltlos nach den Wahrheitsschätzen gräbt, wenn er auch der Gefahr ausgesetzt ist, daß gleich darauf ein zweiter Schatzgräber ihm alles entwertet durch einen neuen Fund, gegenüber dem, der ewig nur das basale, aber unbedingt «wahre»: «Zweimal zwei ist vier» wiederholt.
Wir müssen den Mut haben, kühn in das Reich der Ideen einzudringen, auch auf die Gefahr des Irrtums hin. Wer zu feig ist, um zu irren, der kann kein Kämpfer für die Wahrheit sein. Ein Irrtum, der dem Geist entspringt, ist mehr wert als eine Wahrheit, die der Plattheit entstammt. Wer nie etwas behauptet hat, was in gewissem Sinne unwahr ist, der taugt nicht zum wissenschaftlichen Denker.
Aus feiger Furcht vor dem Irrtum ist unsere Wissenschaft der baren Flachheit zum Opfer gefallen.
Es ist geradezu haarsträubend, welche Charaktereigenschaften heute als Tugenden des wissenschaftlichen Forschers gepriesen werden. Wollte man dieselben ins Gebiet der praktischen Lebens-führung übersetzen, so käme das - Gegenteil eines festen, entschiedenen, energischen Charakters heraus.
Diese Mängel in unserem geistigen Leben hat nun jüngst ein Buch bloßzulegen versucht: Schlimm genug, daß gerade diese Schrift eine solche Verbreitung gefunden hat. Mängel sehen und darüber herfallen ist nicht schwer, wohl aber den Ursprung derselben aufsuchen. Man gehe vierzehn Tage hindurch jeden Abend in einen Gasthof, wo gebildete deutsche Bier-Philister sitzen, setze sich abseits und lausche ihren kritischen Redensarten. Dann gehe man nach Hause, notiere sorgfältig, was man gehört, setze zu jedem Satze ein Zitat aus einem bekannten Schriftsteller hinzu. Nach vierzehn Tagen schicke man dieses «Sammelwerk» in die Druckerei, und ein zweites Buch wird den deutschen Büchermarkt zieren, das in nichts dem «Rembrandt als Erzieher» an Wert nachstehen wird.
Der Verfasser dieses Buches bekämpft den Spezialismus in der Wissenschaft. Dies ist sein Grundirrtum. Nicht daß die Forscher sich speziellen Aufgaben widmen, ist der Fehler, sondern daß sie
in die Welt der Einzelheiten den universellen Geist nicht hinein-arbeiten können. Schlimm wäre es, wollten wir an Stelle der Er-forschung der individuellen Wesenheiten das Ausspinnen abstrakter Allgemeinheiten und grauer Theorien setzen. Studiere das Sandkorn, aber ergründe, inwiefern es des Geistes teilhaftig ist.
Nicht Mystizismus ist es, was wir hier vertreten wollen. Wer den Geist der Dinge dieser Welt in klaren, durchsichtigen Ideen sucht, der ist keineswegs Mystiker. Es gibt nichts, was mystisches Hell-Dunkel mehr ausschlösse als die kristallklare, bis in die letzten Verzweigungen mit scharfen Konturen ausgestaltete Welt der Ideen. Wer in diese Welt mit menschlicher Schärfe, mit strenger Logik sich einlebt, der wird im Bewußtsein, daß er sein geistiges Reich nach allen Richtungen durchschaut, nichts gemein haben mit dem Mystiker, der nichts schaut, sondern nur ahnt, der die Welt der Giönde nicht ausdenkt, sondern nur anschwärmt. Der Mathematiker ist das Vorbild für den mystikfreien Denker.
Also nicht endloses Sammeln von Einzeltatsachen ist unsere Aufgabe, sondern Schärfung des Geistesvermögens für das Schauen der Naturtiefen tut uns zunächst not.
Unsere Vernunft muß wieder dahin gelangen, sich ihrer Absolutheit bewußt zu sein; und dem feigen, sklavischen Unterordnen derselben unter die drückende Macht der Tatsachen muß ein Ende gemacht werden. Es ist unwürdig, daß ein Höheres, welches die Vernunft doch ist, sich zum bloßen Sasnmler von Dingen niedrigeren Wertes hergibt. Bestünde die Welt nur aus sinnenfällig wahrnehmbaren Dingen, dann müßte die Vernunft abdanken. Eine Aufgabe hat sie nur, wenn sich in der Welt das findet, was sie zu fassen vermag. Und das ist der Geist.
Ihn leugnen heißt die Vernunft in den Ruhestand versetzen.
Ist nun Aussicht vorhanden, daß dieser legitime Herrscher auf dem Throne im Reiche der Wissenschaft bald wieder in seine angehorenen Rechte eingesetzt wird? Die Beantwortung dieser Frage wird Gegenstand der nächsten Fortsetzung dieses Artikels sein.
ZU DEM «FRAGMENT» ÜBER DIE NATUR
Als Knebel anfangs 1783 im 32. Stück des Tiefurter Journales das Fragment gelesen hatte, schrieb er in sein Tagebuch:
«Goethes Fragment über die Natur hatte tiefen Eindruck auf mich. Es ist meisterhaft und groß. Es bestärkt mich in Liebe.» Der Aufsatz erschien wie die andern Beiträge des Journales ohne Namen des Verfassers. Die Ideen, die darin niedergelegt sind, vermochte Knebel nur Goethe zuzuschreiben. In gleicher Weise werden wohl auch andere Leser des Journals gedacht haben. Goethe selbst trat dieser Meinung entgegen. Er schrieb an Knebel: «Der Aufsatz im Tiefurter Journal, dessen Du erwähnst, ist nicht von mir, und ich habe bisher ein Geheimnis daraus gemacht, von wem er sei. Ich kann nicht leugnen, daß der Verfasser mit mir umgegangen und mit mir über diese Gegenstände oft gesprochen hat ... Er hat mir selbst viel Vergnügen gemacht und hat eine gewisse Leichtigkeit und Weichheit, die ich ihm vielleicht nicht hätte geben können.» Und Frau von Stein schreibt am 28. März 1783 an Knebel: «Goethe ist nicht der Verfasser, wie Sie es glauben, von dem tausendfältigen Ansichtenbilde der Natur; es ist von Tobler; mitunter ist mir's nicht wohltätig, aber es ist reich!» Wären diese Briefstellen nicht vorhanden, so erschiene heute ein Aufwerfen der Fragen: «Ist Goethe der Verfasser dieses Aufsatzes?» oder «Inwieferne gehören die in demselben ausgesprochenen Gedanken ihm an?» geradezu unmöglich. Wenn wir in wenigen Worten sagen sollen, was bisher wohl jedem Kenner von Goethes wissenschaftlicher Entwickelung die Überzeugung von Goethes Autorschaft aufgedrängt hat, so ist es der Umstand, daß der letztere im Fortschreiten zu seinen späteren Naturanschauungen einmal notwendig durch die Stufe durchgegangen sein muß, die in dem Aufsatze festgehalten ist. Als Ernst Haeckel zum Beleg dafür, daß Goethe einer der ersten Propheten einer einheitlichen (monistischen) Naturauffassung war, eine besonders charakteristische Arbeit desselben an die Spitze seiner «natürlichen Schöpfungsgeschichte» stellen wollte, da wählte er den Aufsatz «Die Natur». Hiermit ist aber gar nichts anderes ausgesprochen, als was Goethe
selbst in hohem Alter, als ihm der aus seinem Gedächtnisse längst entschwundene Aufsatz vorgelegt wurde, für das Richtige gehalten hat. Im Jahre 1828 erhielt er denselben aus dem Nachlaß der Herzogin Anna Amalia. Er nahm keinen Anstand, die darin ausgesprochenen Ideen als die seinigen zu bezeichnen, obwohl er sich tatsächlich an die Abfassung nicht erinnern konnte. In einer erläuternden Bemerkung zu dem Fragment, die er 1828 nieder-schreibt, lesen wir: «Daß ich diese Betrachtungen verfaßt, kann ich mich faktisch zwar nicht erinnern, allein sie stimmen mit den Vorstellungen wohl überein, zu denen sich mein Geist damals ausgebildet.» Und weiter oben: «Er ist von einer wohlbekannten Hand geschrieben, deren ich mich in den achtziger Jahren in meinen Geschäften zu bedienen pflegte.» Diese Hand ist die Seidels, von der auch die andern Goetheschen Beiträge zum Tiefurter Journal geschrieben sind. Zu diesen historischen Zeuguissen gehört auch ein Blatt, das im Goethe-Archiv unter den naturwissenschaftlichen Manuskripten Goethes liegt und das wohl eine Aufzeichnung des Kanzlers von Müller ist. (Oben am Rande steht von Eckermanns Hand mit Bleistift: Betrifft wahrscheinlich den Aufsatz: Die Natur, in G.Werken 1890, Bd. 40, S.385.) Wir heben aus derselben folgende Stellen heraus: d. 25. Mai 1828. «Vorstehender Aufsatz, ohne Zweifel von Goethe, wahrscheinlich für das Tiefurter Journal bestimmt, von Einsiedeln dazu mit Nr.3 bezeichnet und also etwa aus den ersten achtziger Jahren, jedoch vor der Metamorphose der Pflanzen geschrieben, wie Goethe selbst mir die Vermutung äußerte, war mir am 24. Mai 1828 von ihm kommuniziert. Da er ihn drucken lassen wird, so habe ich kein Bedenken gefunden, ihn vorläufig abzuschreiben.» ... d. 30. Mai 1828. «Nach einem Gespräch bekennt sich Goethe nicht mit voller Überzeugung ganz dazu; und auch mir hat geschienen, daß es zwar seine Gedanken, aber nicht von ihm selbst, sondern per traducem niedergeschrieben. Die Handschrift ist Seidels, des nachherigen Rentbeamten, und da dieser in Goethes Vorstellungen eingeweiht war und eine Tendenz zu solchen Gedanken hatte, so ist es wahrscheinlich, daß jene Gedanken als aus Goethes Munde kollektiv von ihm niedergeschrieben.» Die Ansicht, daß Seidel
wirklichen Anteil an der Autorschaft habe, wird wohl niemand festhalten können; dagegen spricht die ganz einzigartige Harmonie zwischen den Gedanken des Aufsatzes und der Form, in der sie ausgesprochen sind. Das sind keine umgeformten Gedanken, es sind solche, die ganz wie sie sind konzipiert sein müssen. Man kann sich bei fast keinem Satze denken, daß der Inhalt genauer oder schöner formuliert werden könne. Wenn der Aufsatz nicht ein Diktat Goethes, sondern nach einer mündlichen Mitteilung von einem andern abgefaßt ist, dann könnte das nur von jemandem geschehen sein, der auf solcher Bildungshöhe stand, daß er Goethe nach allen Seiten erfassen und seine Gedanken in ihrer künstlerisch vollendeten Gestalt fast wörtlich aus dem Gedächtnisse niederschreiben konnte. Nun scheint der von Frau von Stein genannte G. Chr. Tobler in der Tat ein solcher Mann gewesen zu sein. Frau Herder schrieb über ihn an Müller: «Er wurde in diesem Zirkel (Goethes und der fürstlichen Personen) sehr geehrt, geliebt und als der philosophischste, gelehrteste, geliebteste Mensch erhoben; kurz, sie sprachen von ihm als von einem Menschen höherer Art.» Und J. G. Müller schrieb in sein Tagebuch, als er im April 1781 Tobler mit Passavant in Münden kennengelernt hatte: «Tobler ist ganz und gar griechischen Geblütes, sein einziges Bestreben ist, immer menschlicher zu werden, voll Gesundheit und Manneskraft wie ein junger Baum; wen er liebt, den liebt er ganz. An den simplen Lichtsätzen des Christentums hat er nicht genug. Er ist bald Christ, bald Grieche...» Tobler brachte nur den Sommer 1781 in Weimar zu. Er wohnte bei Knebel, und Goethe verkehrte viel mit ihm. In einem Briefe Goethes an Lavater vom 22. Juni 1781 sagt der erstere, daß er Tobler sehr «lieb gewonnen», und das Tagebuch enthält unter dem 2. August die Bemerkung: «Mit Toblern über Historie bei Gelegenheit Borromäus.» Das sind Beweise dafür, daß intime Gespräche über allgemeine Anschauungen zwischen Goethe und Tobler stattgefunden haben können, und daß der letztere eine Ausführung Goethes, das sich mit dem Fragment «Natur» deckt, zu Papier gebracht haben kann.
Daß aber Tobler keine andere Rolle dabei spielen konnte als
die eines Berichterstatters, der sich möglichst genau an den Wortlaut des Gehörten hielt, dafür sprechen gewichtige innere Gründe, die aus der Betrachtung des Verhältnisses des fraglichen Aufsatzes zu Goethes späteren Arbeiten über Naturwissenschaft hervorgehen. Er selbst sagt in der bereits oben zitierten erläuternden Bemerkung: «Ich möchte die Stufe damaliger Einsicht einen Komparativ nennen, der seine Richtung gegen einen noch nicht erreichten Superlativ zu äußern gedrängt ist. Man sieht die Neigung zu einer Art von Pantheismus, indem den Welterscheinungen ein unerforschliches, unbedingtes, humoristisches, sich selbst widersprechendes Wesen zum Grunde gedacht ist, und mag als Spiel, dem es bitterer Ernst ist, gar wohl gelten.
Die Erfüllung aber, die ihm fehlt, ist die Anschauung der zwei großen Triebräder der Natur: der Begriff von Polarität und von Steigerung, jene der Materie, insofern wir sie materiell, diese ihr hingegen, insofern wir sie geistig denken, angehörig.»
Goethes wissenschaftliche Entwickelung stellt sich der genaueren Betrachtung als ein fortschreitendes Ausgestalten der im Aufsatz «Die Natur» ausgesprochenen Maximen dar. In diesen Sätzen sind die allgemeinen Forderungen aufgestellt, nach denen das Denken bei der Erforschung besonderer Naturgebiete zu verfahren hat. Diesen Prinzipien entspricht alles Naturgeschehen. Wie das im einzelnen vor sich geht, sucht Goethe dann später auf verschiedenen Gebieten zu ergründen. Der in Rede stehende Aufsatz ist eine Art Lebensprogramm, das allem Goetheschen Denken über die Natur zugrunde liegt.
Wo immer wir mit der Betrachtung von Goethes Forschungen einsetzen, bestätigt sich uns dieses. In der Geologie stellt Goethe unabhängig von anderen Forschern den Grundsatz fest, daß dieselben Gesetze, die gegenwärtig die auf der Erdoberfläche vor sich gehenden Bildungen bedingen, auch in den verflossenen Epochen gültig waren und daß dieselben niemals eine gewaltsame Unterbrechung durch ausnahmsweise Umwälzungen und so weiter erlitten haben. Dieses Prinzip weist zurück auf die Stelle in dem Fragment: «Sie (die Natur) schafft ewig neue Gestalten; was da ist, war noch nie, was war, kommt nicht wieder — alles ist neu und
doch immer das Alte.» «Auch das Unnatürlichste ist Natur. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgendwo recht.»
Fast wie die Pflanze aus dem Samen hat sich die Metamorphosenlehre aus folgenden Sätzen des Fragmentes entwickelt: «Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillstehen in ihr.» «Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus den Individuen.» «Sie hat wenige Triebfedern, aber nie abgenutzte, immer wirksam, immer mannigfaltig.» In dem ersten Satze ist schon ganz deutlich der Ansatz zu dem Gedanken von der Umwandlung der einzelnen Organe eines Lebewesens und der fortschreitenden Entwickelung derselben gemacht. Man braucht, um einen Beweis zu haben, nur folgende Stelle der «Metamorphose» (1790) damit zu vergleichen: «Betrachten wir alle Gestalten, besonders die organischen, so finden wir, daß nirgends ein Bestehendes, nirgends ein Ruhendes, ein Abgeschlossenes vorkommt, sondern daß vielmehr alles in steter Bewegung schwanke.» Der angeführte Satz über die «Individualität» ist der Keim zur Idee des Typus, die uns in Goethes osteologischen Arbeiten entgegentritt. In den «Vorträgen über den Typus» (1796) sagt Goethe: «Dies also hätten wir gewonnen, ungescheut behaupten zu dürfen, daß alle vollkommenern organischen Naturen, worunter wir Fische, Amphibien, Vögel, Säugetiere und an der Spitze der letztern den Menschen sehen, alle nach Einem Urbilde geformt seien, das nur in seinen sehr beständigen Teilen mehr oder weniger hin und her weicht und sich noch täglich durch Fortpflanzung aus- und umbildet.» Das heißt aber nichts anderes als: die Natur schafft zwar Individuen, aber aller Individualität liegt der Typus zugrunde; auf diesen kommt es zuletzt doch an und nicht auf die Individuen. Ja, auch die Art, wie die Natur verfährt, um aus der allgemeinen Form des Typus heraus eine besondere Gestalt zu schaffen, finden wir in dem Fragment angedeutet. Diese Art besteht darinnen, daß ein Organ oder eine Organgruppe besonders stark entwickelt ist, und dagegen die anderen Teile des Typus zurückstehen müssen, weil die Natur nur einen gewissen Etat für jedes Lebewesen hat, den sie nicht überschreiten
darf. Je nachdem dann die eine oder andere Partie des Typus entwickelt ist, entsteht die eine oder die andere Form der Lebewesen. In dem Aufsatz über den Streit zwischen Geoffroy de Saint Hilaire und Cuvier in der französischen Akademie faßt Goethe diese Regel in die Worte zusammen: ... . daß die haushälterische Natur sich einen Etat, ein Budget vorgeschrieben, in dessen einzelnen Kapiteln sie sich die vollkommenste Willkür vorbehält, in der Hauptsumme jedoch sich völlig treu bleibt, indem, wenn an der einen Seite zu viel ausgegeben worden, sie es der andern abzieht und auf die entschiedenste Weise sich ins Gleiche stellt.» Ganz der gleiche Begriff ist im Fragment enthalten:
«Gibt sie (die Natur) eins (ein Bedürfnis) mehr, so ist's ein neuer Quell der Lust; aber sie kommt bald ins Gleichgewicht.» Zwei parallele Gedankenreihen sind auch die folgenden. Fragtuent: «Sie (die Natur) ist die einzige Künstlerin; aus dem simpelsten Stoff zu den größten Kontrasten»; und in den osteologischen Vorträgen:
«Betrachten wir nach jenem erst im allgemeinsten aufgestellten Typus die verschiedenen Teile der vollkommensten Tiere, die wir Säugetiere nennen, so finden wir, daß der Bildungskreis der Natur zwar eingeschränkt ist, dabei jedoch wegen der Menge der Teile und wegen der vielfachen Modifikabilität die Veränderungen der Gestalt ins Unendliche möglich werden.» Selbst der Kernpunkt der Metamorphosenlehre, daß der unendlichen Mannigfaltigkeit der organischen Wesen ein einziger Urorganismus zugrunde liegt, findet sich in der im «Fragment» angedeuteten Idee: «Jedes ihrer (der Natur) Werke hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isoliertesten Begriff, und doch macht alles Eins aus.»
Nicht minder bemerkenswert ist der Umstand, daß der Gesichtspunkt, von dem aus Goethe später die Mißbildungen an Organismen ansah, bereits in unserem Aufsatze eingenommen ist. Die Abweichung von der gewöhnlichen Gestalt eines Naturwesens ist nach dieser Annahme nicht eine Abweichung von den allgemeinen Naturgesetzen, sondern nur eine Wirkungsweise derselben unter besonderen Bedingungen. «Die Natur bildet normal, wenn sie unzähligen Einzelheiten die Regel gibt, sie bestimmt und bedingt; abnorm aber sind die Erscheinungen, wenn die Einzelheiten
obsiegen und auf eine willkürliche, ja zufällig erscheinende Weise sich hervortun. Weil aber beides nah zusammen verwandt und sowohl das Geregelte als Regellose von Einem Geiste belebt ist, so entsteht ein Schwanken zwischen Normalem und Abnormem, weil immer Bildung und Umbildung wechselt, so daß das Abnorme normal und das Normale abnorm zu werden scheint.» Das ist in reiferer Form (der Aufsatz, dem der Satz angehört, ist im Hinblick auf Jägers Werk «Über die Mißbildung der Gewächse», das 1814 erschien, niedergeschrieben) der Gedanke aus dem Fragment: «Auch das Unnatürlichste ist Natur»
Wenn wir absehen von den speziell auf das Reich der unorganischen Natur bezüglichen Prinzipien Goethes, so finden wir dessen ganzes Gedankengebäude in dem Fragment «Natur» bereits vorgebildet. In der allgemeinen, abstrakten Weise, wie diese Ideen hier stehen, erscheinen sie wie die Verkündigung einer neuen Weltanschauung. Man vermag sie nur einem Geiste zuzuschreiben, der eigene, neue Wege zur Erklärung der Erscheinungen einschlagen wollte. Die Erfüllung dieser Verkündigung sind Goethes spezielle Arbeiten über naturwissenschaftliche Gegenstände. Hier erst erhalten jene allgemeinen Sätze ihren vollen Wert, ihre eigentliche Bedeutung. Wir verstehen sie sogar erst ganz, wenn wir sie in Goethes Metamorphosenlehre, in seinen osteologischen Studien und in seinen geologischen Betrachtungen verwirklicht sehen. Hätten wir diese letzteren ohne die allgemeinen theoretischen Grundsätze, so müßten wir sie selbst durch sie ergänzen. Wir müßten uns fragen: wie stellte Goethe die Natur im ganzen vor um sich über die Pflanzen- und Tierwelt die ihm eigenen Vorstellungen bilden zu können? Die Beantwortung dieser Frage kann aber mit nichts besser und befriedigender gegeben werden als mit dem Inhalte des Fragmentes «Die Natur». Goethe sagt in der «Geschichte der Farbenlehre»: «Wie irgend jemand über einen gewissen Fall denke, wird man nur erst recht einsehen, wenn man weiß, wie er überhaupt gesinnt ist.» Wir wissen erst vollständig, wie Goethe über einen einzelnen Fall in der Natur gedacht, wenn wir aus dem besprochenen Fragment erfahren haben, was für Anschauungen er über die Natur überhaupt gehabt hat.
Diese Beziehung erscheint doch wichtiger als die Frage, ob derjenige, welcher die Niederschrift des Aufsatzes besorgt hat, ein unmittelbares Diktat oder einen mehr oder weniger wörtlichen Bericht aus dem Gedächtnlsse geliefert hat.
ZUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE
Menschen von umfassendem, weltmännischem Geiste finden oft das erlösende Wort für eine Sache, um die sich stubensitzende Gelehrte lange Zeiträume hindurch vergeblich die Köpfe zerbrochen haben.
Was soll die Philosophie neben und über den einzelnen Spezialwissenschaften? Die Vertreter der letzteren sind wohl gegenwärtig nicht abgeneigt, diese Frage einfach dahin zu beantworten: sie soll überhaupt nichts. Das ganze Gebiet der Wirklichkeit wird, nach ihrer Ansicht, von den Spezialwissenschaften umspannt. Wozu noch etwas, das über diese hinausgeht. Derjenige, der den prägnantesten Ausdruck dafür gebraucht hat, ist der - Arbeiter-apostel Ferdinand Lassalle. «Die Philosophie kann nichts sein als das Bewußtsein, welches die empirischen Wissenschaften über sich selbst erlangen.» Das sind seine Worte. Eine bessere Formel für die Sache kann man wohl kaum finden.
Alle Wissenschaften betrachten es als ihre Aufgabe, die Wahrheit zu erforschen. Unter Wahrheit kann nichts anderes verstanden werden als ein System von Begriffen, welches in einer mit den Tatsachen übereinstimmenden Weise die Erscheinungen der Wirklichkeit in ihrem gesetzmäßigen Zusammenhange abspiegelt Bleibt jemand nun dabei stehen und sagt, für ihn habe das Netz von Begriffen, das ihm ein gewisses Gebiet der Wirklichkeit abbildet, einen absoluten Wert, und er braucht nichts darüber, so kann man ihm ein höheres Interesse nicht andemonstrieren. Nur wird uns ein solcher nicht erklären können, warum seine Begriffssammlung
einen höheren Wert hat als zum Beispiel eine Briefmarkensammlung, die doch auch, entsprechend systematisch geordnet, gewisse Zusammenhänge der Wirklichkeit abbildeti Hierinnen liegt der Grund, warum der Streit über den Wert der Philosophie mit vielen Naturforschern zu keinem Resultate führti Sie sind Begtiffsliebhaher in dem Sinne, wie es Marken- oder Münzenliebhaber gibti Es gibt aber ein Interesse, das darüber hinausgehti Dieses sucht mit Hilfe und auf Grund der Wissenschaften den Menschen über seine Stellung zum Universum aufzuklären, oder mit anderen Worten: dieses Interesse bringt den Menschen dahin, daß er sich in eine solche Beziehung zur Welt setzt, wie es nach Maßgabe der in den Wissenschaften gewonnenen Resultate möglich und notwendig ist.
In den einzelnen Wissenschaften stellt sich der Mensch der Natur gegenüber, er sondert sich von ihr ab und betrachtet sie, er entfremdet sich ihri In der Philosophie sucht er sich wieder mit ihr zu vereinigeni Er sucht das abstrakte Verhältnis, in das er in der wissenschaftlichen Betrachtung geraten ist, zu einem realen, konkreten, zu einem lebendigen zu machen. Der wissenschaftliche Forscher will sich durch die Erkenntnis ein Bewußtsein von der Welt und ihren Wirkungen erwerben, der Philosoph will sich mit Hilfe dieses Bewußtseins zu einem lebensvollen Gliede des Welt-ganzen macheni Die Einzelwissenschaft ist in diesem Sinne eine Vorstufe der Philosophie. Wir haben ein ähnliches Verhältnis in den Künsten. Der Komponist arbeitet auf Grund der Kompositionslehrei Die letztere ist eine Summe von Erkenntnissen, die eine notwendige Vorbedingung des Komponierens sind. Das Komponieren verwandelt die Gesetze der Musikwissenschaft in Leben, in reale Wirklichkeit. Wer nicht begreift, daß ein ähnliches Verhältnis auch zwischen Philosophie und Wissenschaft besteht, der taugt nicht zum Philosophen. Alle wirklichen Philosophen waren freie Begriffskünstler. Bei ihnen wurden die menschlichen Ideen zum Kunstmateriale und die wissenschaftliche Methode zur künstlerischen Technik. Dadurch wird das abstrakte wissenschaftliche Bewußtsein zum konkreten Leben erhoben. Unsere Ideen werden Lebensmächte. Wir haben nicht bloß ein Wissen von den Dingen.
sondern wir haben das Wissen zum realen, sich selbst beherrschenden Organismus gemacht; unser wirkliches, tätiges Bewußtsein hat sich über ein bloßes passives Aufnehmen von Wahrheiten gestellt. Hierinnen suche ich den Sinn der Lassalleschen Worte.
Mit dieser Auffassung der Philosophie sollten sich insbesondere jene durchdringen, die die historische Entwickelung derselben schriftstellerisch darstellen oder im akademischen Lehrvortrage vorbringen wollen. Gegenüber mancher unerfreulichen Erscheinung auf diesem Gebiete begrüßen wir mit Freuden ein eben erschienenes Buch: «Die Hauptprobleme der Philosophie in ihrer Entwicklung und teilweisen Lösung von Thales bis Robert Hamerling. Vorlesungen, gehalten an der K. K. Wiener Universität von Vinzenz Knauer (Wien 1892).»
Schon aus der Darstellung der Geschichte der Philosophie von demselben Verfasser (Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Neuzeit. Zweite verbesserte Auflage. 1882) haben wir den Eindruck erhalten, daß wir in Vinzens Knauer mit einer philosophischen Natur im wahrsten Sinne des Wortes zu tun haben. Nicht ein äußerlicher Betrachter, sondern ein in der Ideenwelt lebender Mann schildert da die Erscheinungen der Philo-sophie in alter und neuer Zeit. Und durch das neue Buch sind wir in dieser Überzeugung nur bestärkt worden. Die Vorlesungen sind in hohem Grade geeignet, das philosophische Denken anzuregen. Wir haben es nicht mit dem Historlker zu tun, der über ein System nach dem andern ein Referat bringt und dann von irgendeinem Standpunkte eine Kritik anfügt - solche Künste haben J. H. Kirchsnitnn, Thilo und andere bis zum Ekel getrieben -, sondern mit einem Philosophen, der die Probleme lebendig seinen Zuhörern und Lesern entwickelt.
Es gibt Leute, die es für Objektivität halten, wenn sie den von ihnen behandelten Problemen so äußerlich wie möglich gegenüberstehen. Sie wollen alles aus der Vogelperspektive betrachten. Solche sogenannte Objektivität bringt es aber zu keiner wahrhaften Vergegenwärtigung ihres Gegenstandes. Knauer hat eine andere, die echte Objektivität; er dringt in die Ideen eines Philosophen so tief ein, daß er sie vor unserem Geiste in möglichst unverfälschter
Weise wieder auferstehen läßt. Er weiß das dramatische Element, das den Ideengängen jedes wahren Philosophen eignet, wieder zu beleben. Wo wir so oft nur «der Herren eigenen Geist» verspüren, da führt uns Knauer wirklich in den «Geist der Zeiten» ein.
All das ist natürlich nur möglich bei jenem hohen Maße von Beherrschung des Stoffes, die wir an Knauer bewundern. Jeder Satz zeugt für ein langes, gründliches Einleben in die philosophischen Weltanschauungen.
Ganz uneingeschränkt möchte ich dieses Lob dem ersten Teile des Buches, den ich bis zu Thomas von Aquino ausdehne, zuerkennen. Von Thomas von Aquino ab scheint mir die Hinneigung Knauers zu dualistischen und pluralistischen Vorstellungen die freie historische Darstellung zu beeinträchtigen. Ich für meine Person habe das in dem zweiten Teile schmerzlich empfunden. Ich zähle Knauers Darstellung der aristotelischen Philosophie zu den klarsten, durchsichtigsten und richtigsten, die es gibt; seine Behandlung der modernen Philosophie scheint mir noch nicht so weit von scholastischen Begriffen frei zu sein, um der monistischen Philosophie gerecht werden zu können. Knauer verkennt den Unterschied zwischen ahstraktem und konkretem Monismus. Der erstere sucht eine Einheit neben und über den Einzeldingen des Kosmos. Dieser Monismus kommt immer in Verlegenheit, wenn er die Vielheit der Dinge aus der verabsolutierten Einheit ableiten und begreiflich machen soll. Die Folge ist gewöhnlich, daß er die Vielheit für Schein erklärt, was eine vollständige Verflüchtigting der gegebenen Wirklichkeit zur Folge hat. Schopenhauers und Scheliings erstes System sind Beispiele für diesen abstrakten Monismus. Der konkrete Monismus verfolgt das einheitliche Weltprinzip in der lebendigen Wirklichkeit. Er sucht keine metaphysische Einheit neben der gegebenen Welt, sondern er ist überzeugt, daß diese gegebene Welt die Entwickelungsmomente enthält, in die sich das einheitliche Weltprinzip in sich selbst gliedert und auseinanderlegt.
Dieser konkrete Monismus sucht nicht die Einheit in der Vielheit, sondern er will die Vielheit als Einheit begreifen. Der dem konkreten Monismus zugrunde liegende Begriff der Einheit faßt
die letztere als substantielle, die den Unterschied in sich selbst setzt. Ihr steht gegenüber jene Einheit, welche überhaupt unterschiedslos in sich, also absolut einfach ist (die Herbartschen Realen), und jene, welche von den in diesen Dingen enthaltenen Gleichheiten die ersteren zusammenfaßt zu einer formalen Einheit, etwa wie wir zehn Jahre zu einem Dezennium zusammenfassen. Nur die beiden letzteren Einheitsbegriffe kennt Knauer. Der erstere kann, da er die unterschiedenen Dinge der Wirklichkeit nur aus dem Zusammenwirken vieler einfacher Realen erklären kann, zum Pluralismus führen; der letztere kommt zum abstrakten Monismus, weil seine Einheit keine den Dingen immanente, sondern eine neben und über denselben existierende ist. Knauer neigt zum Pluralismus hin. Die konkret-monistischen Elemente der neueren Philosophie übersieht er. Deswegen erscheint mir dieser Teil seiner Vorlesungen mangelhaft.
Ich bekenne mich zum konkreten Monismus. Mit seiner Hilfe bin ich imstande, die Ergebnisse der neueren Naturwissenschaft, namentlich der Goethe-Darwin-Haeckelschen Organik, zu verstehen. Hätte Knauer die Wissenschaft vom Organischen bei seinen Auseinandersetzungen ebenso berücksichtigt, wie er es mit vollem Recht mit der des Unorganischen (Wärmeäquivalent, Erhaltung der Kraft, zweiter Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie) tut, so hätte er die Schwierigkeit der Anwendung des Pluralismus durchschauen müssen. Es ist unmöglich, die Entwickelungslehre (und ihre Konsequenzen: Vererbungs-, Anpassungstheorie und biogenetisches Grundgesetz) mit Hilfe des Zusammenwirkens unterschiedener einfacher Realen widerspruchslos zu begreifen.
Diese Einwände sollen mich aber durchaus nicht abhalten, die große Bedeutung auch des zweiten Teiles des Knauerschen Buches anzuerkennen. Neben der klaren, originellen Auseinandersetzung über die Herbartschen Gedankengänge sehe ich diese Bedeutung in der umfassenden und gerechten Behandlung des Hamerlingschen Philosophierens. Daß Hamerling in so vorurteilsfreier, rückhaltsloser Weise der Reihe der Philosophen angegliedert erscheint, ist ein nicht hoch genug anzuschlagendes Verdienst, das sich
Knauer durch diese Vorlesungen erworben hat. Er hat damit als Philosophiehistoriker ein Wort zuerst gesprochen. Wer nur die von jedermann anerkannten philosophischen Systeme in einer neuen Weise zusammenstellt und auseinanderenrwickelt, der läßt sich gar nicht vergleichen mit demjenigen, welcher als erster die Bedeutung einer Erscheinung erkennt. Das an diesen Vorlesungen anzuerkennen, hindert mich der Umstand nicht, daß ich selbst mich ganz anders zu Hamerling stelle als Knauer. Ich schätze die philosophische Auffassung des Dichterphilosophen wegen der vielen monistischen Elemente, die sie trotz der Hinneigung zur dualistischen und pluralistischen Weltanschauung hat. Dieser Umstand kann meiner Auffassung nach so lange nicht richtig beurteilt werden, als sich die deutsche Philosophie in der den freien Blick in die Weltverhältnisse vollständig trübenden Abhängigkeit von Kant befindet. Die Kantsche Philosophie ist eine dualistische. Sie gründet den Dualismus auf die Einrichtung des menschlichen Erkenntnis-Organismus. Und daß die Sätze, die Kant für die Subjektivität des Erkennens beigebracht hat, in mehr oder weniger modi-fizierter Gestalt unantastbar seien, gilt heute sozusagen als Grund-dogma der Philosophie. Wer daran zweifelt, wird von vielen als ungeeignet zum philosophischen Denken erklärt. Wer unabhängig von diesem Vorurteile eine eigene Meinung hat, der kann heute schlimme Erfahrungen machen. Ich habe es jüngst selbst erfahren. Als man in Deutschland im vorigen Jahre eine «Gesellschaft für ethische Kultur» nach dem Muster ähnlicher Vereinigungen in England und Amerika bildete, da ergriff ich die Gelegenheit, um meine Meinung über eine solch iückständige Gründung öffentlich auszusprechen (u. a. im «Literar. Merkur», Jahrg. XII. 1892, Nr.40, und «Zukunft», 1892, I. Band, Nr. 5). Meine diesbezüglichen Ansichten wurzeln in meinen erkenntnistheoretischen Über-zeugungen, die ich zuletzt in meiner Schrift «Wahrheit und Wissenschaft» begründet habe. Die letzteren stellen eine von Kant unabhängige, den Lehren des modernen Monismus gewachsene Erkenntnistheorie dar. Sie liefern den vollen Beweis dafür, daß ich zu meinen Ansichten ganz unabhängig von Nietzsche gelangt bin. Trotzdem wurde ich von deutschen Philosophen, die doch von der
Sache etwas verstehen sollten, einfach des Nietzscheanismus beschuldigt und mir nicht nur Mangel an Verstand, sondern auch unmoralische Gesinnung vorgeworfen. Mich beirrt das nicht weiter. Über meinen Verstand denkt doch mancher anders als die Herren von der «ethischen Kultur»; und was meine Moral betrifft: in den Schulzeugnissen steht: «musterhaft», später hieß es: «den akademischen Gesetzen vollkommen gemäß»; seither hat mir jede Obrigkeit, die ich in Anspruch nahm, ein gutes Sittenzeugnis gegeben. Ich habe also, wie es scheint, doch nichts getan, was einen deutschen Gelehrten veranlassen sollte, mich vor einen «moralischen Richterstuhl» zu fordern (vgl. Ferd. Tönnies, «Ethische Kultur und ihr Geleite»). Oder gehört es zu den Erkenntnissen der neuen «ethischen Kultur», daß man wegen seiner theoretischen Ansichten moralisch verurteilt wird?
ZUR HYPNOTISMUSFRAGE
Die Erscheinungen des Hypnotismus und der Suggestion, denen in der Gegenwart die Forschung ein reges Interesse entgegenbringt, sind von solcher Art, daß die Vertreter der verschiedensten geistigen Gebiete die Notwendigkeit fühlen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dem Arzt scheint mit der Hypnose ein Mittel an die Hand gegeben zu sein, um funktionelle von organischen Erkrankungen unterscheiden zu können, und zugleich die Möglichkeit, die ersteren durch suggestiven Eingriff zu heilen. Der Rechts-gelehrte wird nicht umhinkönnen, bei Fragen, in denen der freie Wille und die persönliche Verantwortlichkeit in Betracht kommen, auf die Wirkung Rücksicht zu nehmen, welche Auto- und Fremdsuggestionen auf den Menschen haben. Die juridische Praxis wird stets darauf bedacht sein müssen, daß durch suggestiven Einfluß die Aussagen der Angeklagten sowohl wie jene der Zeugen eine von der Wahrheit mehr oder weniger abweichende Gestalt annehmen können. Auf dem Gebiete der Religions- und Kulturgeschichte
wird sich manches unter Berufung auf den Hypnotismus besser erklären lassen als ohne dieselbe. Daß von hier aus auch auf die Erscheinungen der künstlerischen Phantasietätigkeit ein erklärendes Licht fällt, scheint mir unzweifelhaft. Und damit komme ich in ungezwungener Weise zu jener Wissenschaft, die an der Hypnotismusfrage vor allen anderen Gebieten interessiert ist, zur Psychologie. Ich muß Hans Schmidkunz (Psychologie der Suggestion>, S.5) recht geben, wenn er hier eine wichtige Ergänzung unserer bisherigen Psychologie sucht. Und es ist im höchsten Grade zu bedauern>, daß ein Forscher wie W. Wundt sich der unglaublichsten Verdrehungen einzelner Behauptungen des Schmidltunzschen Buches bei der Beurteilung desselben schuldig macht. Wundt hat sich durch seine experimentellen Untersuchungen um die Psychologie große Verdienste und bei den philosophierenden und philosophisch gebildeten Zeitgenossen ein hohes Ansehen erworben. Wir wollen die ersteren nicht bestreiten, gegen das letztere uns nicht auflehnen, wenn wir seine jüngst erschienene Schrift über «Hypnotismus und Suggestion» zu denjenigen zählen, die auf dem psychologischen Felde eher Verwirrung als Aufklärung schaffen. Die einseitige, in gewissem Sinne rein mechanische Art, wie Wundt das Seelenleben betrachtet, läßt ihn den Wert, den zum Beispiel die Annahme eines Doppelbewußtseins (Ober- und Unterbewußtseins) für die Aufhellung der fraglichen Tatsachen hat, vollständig verkennen. Er findet darinnen «ein ausgeprägtes Beispiel jener Art psychologischer Scheinserklärungen, die darin bestehen, daß man für die erklärenden Dinge einen neuen Namen einführt» (S. 36). Wundt übersieht, daß solche Theorien, wenn sie auch nicht berufen sind, das letzte Wort über die Tatsachen zu sprechen, doch die in der Wirklichkeit fortwährend ineinanderfließenden realen Momente begrifflich scharf auseinanderhalten, welches der erste Schritt ist zu einer wirklichen Erklärung. Wundts eigene Ansichten scheinen mir völlig unzureichend. Er will alle in Betracht kommenden Tatsachen aus einem von dem normalen nur graduell abweichenden Funktionieren des gewöhnlichen Vorstellungsmechnnismus ableiten. Wie dadurch aber jenes Verhalten zur Außenwelt erklärlich werden soll, das
wir in der Hypnose beobachten, vermag ich nicht einzusehen. Mir erscheint dieses nur begteiflich, wenn in der Hypnose eine solche Modifikation unserer Bewußtseinsfunktionen eintritt, daß wir zu unserer Umgebung in eine Wechselwirkung treten, die der rein physikalischen Beziehung urn eine Stufe nähersteht als die unseres gewöhnlichen Seelenlebens. Diese Wechselbeziehung wird durch unser höheres Geistesleben verdeckt wie ein schwächeres Licht durch ein stärkeres; sie macht sich aber geltend, wenn das normale Bewußtsein verdunkelt wird. Wir steigen im letzteren Falle auf der Leiter der Weltwirkungen um eine Stufe herab; wir stehen mit der rein physischen Natur in einem innigen Kontakt. Die Vorgänge der letzteren wirken, ohne durch unser höheres Bewußtsein hindurchzugehen, auf uns ein. Ohne der Sache diese Wendung in die universelle Naturphilosophle zu geben, kommen wir nicht weiter.
Ich möchte meine Ansicht über Wundts Schrift in folgendem zusammenfassen. Wenn ich den Begriff, den dieser Psychologe vom Bewußtsein hat, betrachte, so scheint er durchaus dem nicht zu entsprechen, was sich aus einer erschöpfenden Vertiefung in das menschliche Seelenleben ergibt. Wäre der Wundtsche Begriff des Bewußtseins richtig, dann befände sich der Mensch immer in Hypnose>, und unsere Bewußtseinszustände wären uns von dem mechanisch ablaufenden Vorstellungsmechanismus suggeriert. Nur weil sich die Wundtsche Psychologie gar nicht über jene Stufe des Bewußtseins erhebt, welches seinen Inhalt mehr oder weniger auf dem Wege der Suggestion erhält, deshalb sieht sie auch den tief-greifenden Unterschied nicht zwischen einer suggerierten und einer vom Wachbewußtsein aufgenommenen Vorstellungsmasse.
In physiologischer Beziehung finde ich die Erklärung am annehmbarsten, daß sie subkordikalen Hirnzentren zur Vermittlung jener Funktionen dienen, welche sich im Zustande der Hypnose abspielen, und zwar unter Ausschaltung der Großhirnrinde, die nur bei wachem Bewußtsein tätig ist.
Außer der Wundtschen Schrift liegt eine Reihe von anderen desselben Gegenstandes vor mir. Wer einen leichtfaßlichen Leitfaden durch das Gesamtgebiet dieser Erscheinungen sucht, dem
empfehle ich H. Schmidkunz: «Der Hypnotismus».* Erscheinungen, Anwendung, Auffassungen und Gefahren des Hypnotismus finden sich da von kundiger Hand übersichtlich dargestellt. Eine eingefügte soranambule Krankengeschichte und ein ausgezeichnetes Kapitel über Geschichte des Hypnotismus erhöhen noch den Wert des in jeder Hinsicht trefflichen Buches. Wer einen typischen Fall von Hypnose (mit vier Modifikationen des Bewußtseins) und die Ansichten eines bedeutenden Klinlkers über dieses Gebiet kennenlernen will, der muß nach dem Buche von v. Krafft-Ebing** greifen. In den «Zeitfragen des christlichen Volkslebens» ist von C. Ziegler*** eine Abhandlung erschienen, die auf dem Standpunkt des sogenannten «großen Hypnotismus» der Pariser Schule steht. Letztere (mit Charcot an der Spitze) sieht in den in Frage kommenden Erscheinungen nur spezielle Fälle von Hysterie. Der Blick des Verfassers ist dadurch erwas getrübt, gleichwohl erscheint mir das Schriftchen wegen der guten Zusammenstellung der Erscheinungen lesenswert. Ähnliches habe ich zu sagen über eine Broschüre von Dr. Karl Friedr. Jordan.**** Was hier verwirrend wirkt, ist der Umstand>, daß der Verfasser ein Anhänger der Theorie vom Lebehs-Agens des Prof. Gustav Jäger ist. Eine über das gewöhnliche Maß hinausgehende Menge dieses Agens strömt, nach Jordan, vom Hypnotiseur auf den zu Hypnotisierenden über und bewirkt in dem letzteren den somnambulen Zustand. Sieht man von dieser in der Beobachtung keine Srütze findenden Anschauung ab, so liefert auch diese Schrift eine gute Zusammenstellung dessen, was für den Hypnotismus in Betracht kommt.
- - -
* Der Hypnotismus in gemeinfaßlicher Darstellung. Mit einer somnambulen Krankengeschicbte>. Von Dr. Hans Schmidkunz. Stuttgart 1893 (VI, 266 5.).
** Eine experimentelle Studie auf dem Gebiete des Hypnotismus nebst Bemerkungen über Suggestion und Suggestionstherapie. Von Dr. R. v. KrafftEbing. 3. Aufl. Stuttgart 1893 (108 S.).
*** Der Hypnotismus. Von C. Ziegler (Zeitfragen des christlichen Volks-lebens, XVI, 1). Stuttgart 1892 (63 S.).
** * * Das Rätsel des Hypnotismus und seine Lösung. Von Dr. Karl Friedr. Jordan>. 2. Aufl. Berlin 1892 (IV, 79 S.).
Verworren und unklar erscheint mir eine Studie über Hypnotismus von Otto von Berlin>.* Sie ist aber bei alledem ernster zu nehmen als die neueste Publikation von Dr. F. Wollny.** Wir haben es hier mit einem ganz sonderbaren Herrn zu tun. Woliny wittert geheime Gesellschaften>, welche durch besonders eingerichtete Apparate die Macht haben>, auf das Individuum sowohl wie auf ganze Menschenmassen einen magnetischen Einfluß auszuüben und sie zu allen möglichen Handlungen zu veranlassen. Der Verfasser hat ein Gleiches auch bereits früher in einer Anzahl von Schriften ausgesprochen>, sogar eine Eingabe an die Reichsbehörden wegen Verfolgung des vermeintlichen Unfugs gemacht. Ich glaube, Wollny leidet an jener Art von partiellem Wahnsinn, die wir öfter zu beobachten Gelegenheit haben. Seine Schrift hat daher nur pathologisches Interesse>.
Im Arhluß an diese Bemerkungen möchte ich ein paar Worte hierhersetzen über eine Frage, die im Hinblick auf die Erfahrungen des Hypnotismus den philosophischen Denker vor allen anderen Dingen interessiert. Ich meine die nach dem Verhältnis der Suggestion zu der auf logischem Wege gewonnenen Überzeugung. Es kann ja kein Zweifel darüber bestehen, daß bei aller qualitativen Verschiedenheit des hypnotischen von dem normalen Bewußtsein, Auto- und Fremdsuggestionen auch in dem letzteren eine große Rolle spielen und ein großer Teil dessen>, was wir glauben und für wahr halten, auf suggestive Weise sich in uns festgesetzt hat. Niemals darf aber ein durch Suggestion zustande gekommener Vorstellungskomplex den Wert einer Überzeugung in Anspruch neumen. Um so wichtiger ist es, die bezeichneten Gebiete streng auseinanderznhalten. Wissenschaftliche Bedeutung kann ja doch nur dasjenige haben, was logisch erworbene Überzeugung ist.
Wie kommt ein Urteil zustande? Wir kämen nie in die Lage, Vorstellungen logisch zu verbinden, wenn uns nicht die reale Einheit des Universums auseinandergelegt in eine Vielheit von Vorstellungen
- - -
* Kaleidoskopische Studie über Hypnotismus und Suggestion. Von Otto von Berlin. Freiburg 1892 (73 5>.).
* * In Saehen der Hypnose und Suggestion. Ein Vademecum für Herrn Prof. Wundt. Von Dr. F. Wollny. Leipzig 1893 (24 S.).
erschiene. Der Grund für das letztere liegt in unserer geistigen Organisation. Wären wir anders organisiert, dann wurden wir etwa den ganzen (physischen und geistigen) Kosmos mit einem einzigen Blicke überschauen. Es gäbe kein wissenschaftliches Denken. Das letztere besteht eben darinnen, die getrennten Elemente der Welt durch bewußte Tätigkeit zu vereinigen. Derch Entwickelung dieser Tätigkeit nähern wir uns immer mehr jenem Überschauen der Welt mit einem Blicke. Soll dieses Vereinigen ein wirklich logisches sein, dann ist zweierlei dazu notwendig. Erstens müssen wir die Elemente der Welterscheinungen im abgesonderten Zustande ihrem Inhalte nach genau durchschauen; zweitens aus diesem Inhalte die Art und Weise finden, wie wir die getrennten Einzelheiten in objektiver Weise dem einheitlichen Weltganzen einzufügen haben. Nur dann, wenn sich die uns gegebenen Weltelemente ganz passiv bei dieser Vereinigung verhalten und diese lediglich durch unser «Ich» zustande kommt, dann ist das Ergebnis mit dem Namen einer Überzeugung zu belegen.
Es ist aber ohne Frage, daß dieselbe Verbindung von Vorstellungen, die durch unser «Ich» bewirkt wird, auch sich unabhängig von demselben bloß durch die Anziehungskraft der Vorstellungen selbst vollziehen kann. Dies wird geschehen, wenn das «Ich» auf irgendeine Weise ausgeschaltet, in Untätigkeit versetzt wird. Die menschliche Psyche vereinigt ja zwei Momente: sie nimmt die Welt als Mannigfaltigkeit auf, als eine Summe von Einzellieiten, und sie verbindet dieselben auf höherer Stufe wieder zu jener Einheit der sie entstammen. Weil sie einer solchen Einheit angehören, so werden sie nach Vereinigung auch dann streben, wenn sie im Bewußtsein anwesend sind und ihnen das «Ich» nicht als regelnder Faktor entgegentritt. Ist das der Fall, so haben wir es hier mit der Suggestion im weitesten Sinne zu tun. Für eine monistische Weltauffassung ist die letztere völlig verständlich. Was in einer Einheit wurzelt, strebt nach Verbindung, wenn es irgend. wo als Vielheit auftritt. Da nun die Gesamtheit der Lebenserscheinungen eines Menschen immer das Ergebnis der in seinem Bewußtsein tätigen Kräfte ist, so wird sich dieselbe in zweifacher
Weise geltend machen können. Ist der Vorstellungsablauf geregelt von dem «Ich», so werden die Erscheinungen der Persönlichkeit auch nur aus der Tätigkeit desselben abzuleiten sein; wird hingegen das «Ich» ausgelöscht, so muß die Ursache dessen, was sich in und mit der Persönlichkeit vollzieht, außerhalb derselben gesucht werden. Jeder Vorstellungskomplex oder jede Handlung der letzteren Art ist nur als Suggestion aufzufassen. Zwischen dem in tiefer Hypnose Handelnden und dem Schulgelehrten, dessen Methode nicht auf Erwägungen seines eigenen «Ich», sondern auf solchen des Schulhauptes beruht, ist nur ein gradueller Unterschied. Erst derjenige, der die Weltzusammenhänge so durchschaut, daß sein Urteil völlig unabhängig wird von jeglichem äußeren Einflusse, erhebt seinen Vorstellungsinhalt über eine Summe von Suggestionen. Wir können deshalb bei so vielen Menschen sagen, wie sie in einem gegebenen Falle handeln oder denken werden, weil wir die Suggestionen kennen, unter deren Einfluß sie stehen. Ein unter Wirkung einer Suggestion lebender Mensch gliedert sich ein in die Kette niederer Naturvorgänge, wo ja auch immer die Ursachen zu einer Erscheinung nicht in derselben, sondern außer ihr gesucht werden müssen>. Nur das «Ichbewußtsein» hebt uns heraus aus dieser Kette, zerreißt die Verbindung mit der übrigen Natur, um sie innerhalb des Bewußtseins wieder zu schließen>. Diese zentrale Stellung dem «Ich» im Gebiete der Wissenschaft gegeben zu haben, ist ein gar nicht genug zu schätzendes Verdienst Joh. Gottlieb Fichtes. In diesem Denker hat die Entwickelung der menschlichen Vernunft einen Sprung vorwärts gemacht, der mit nichts zu vergleichen ist. Es ist bezeichnend für die deutsche Philosophie der Gegenwart, daß sie keine Ahnung von diesem Sprunge hat. Der Mensch, der sich zum Verständnis Fichtes erhebt, muß eine Veränderung an sich erfahren, wie ein Blindgeborener, dem durch eine Operation das Sehen geschenkt wird. Alle Verirrungen, sowohl die des Spiritismus wie die der physiologischen Psychologie, können nur von dem beurteilt werden, der Fichte kennt. Du Prel würde es nie einfallen, die Handlung einer somnambulen Person höher zu stellen als die vom «Ichbewußtsein» bedingte, wenn er das letztere in intimerer Anschauung
erfaßt hätte. Er wüßte dann, daß alles, was nicht vom «Ich» bedingt ist, um eine Stufe der physikalischen Natur nähersteht als dasjenige, bei dem das der Fall ist. Indem die Spiritisten die Suggestionen des dem «Ich» entfremdeten Bewußtseins zum Inhalte ihrer Lehren machen, sprechen sie der Wissenschaft Hohn, da diese nur aus den vom «Ich» vollzogenen Urteilen bestehen kann. Sie stellen sich auf die gleiche Stufe mit den Offenbarungsgläubigen, die auch die suggerierten Vorstellungsinhalte von außen zum Inhalt ihrer Anschauungen machen. Es ist recht charakteristisch für die Stumpfheit und Feigheit der denkenden Vernunft in unserer Zeit, daß alle Augenhliclte die Tendenz auftritt, mit Ausschluß des Gedankens eine Weltansicht zu gewinnen.
HERMANN HELMHOLTZ
Die deutschen Physiker der Gegenwart sind darin einig, daß es der größte unter ihnen ist, der am 8. September 1894 die Augen für immer geschlossen hat. Weite Kreise von Gebildeten haben sich seit Jahrzehnten daran gewöhnt, vorzüglich zu den Schriften zweier hervorragender Zeitgenossen ihre Zuflucht zu nehmen, wenn sie einen Rat brauchen bezüglich der zwei wichtigsten Fra-gen, die die Betrachtung der Natur in jedem denkenden Menschen erweckt. Wem darnach dürstet, etwas darüber zu erfahren, wie die Lebewesen, also auch der Mensch, entstanden sind und sich entwickelt haben, der greift nach den Werken Ernst Haeckels; wer den Einwirkungen der Natur auf die Sinne des Menschen nachsinnt, dem geben die Arbeiten Hermann Helmholtzens die mannigfaltigste Anregung. Diese beiden Männer sind die Verkörperung unseres gegenwärtigen Naturerkennens. Der eine ist bemüht, das Rätsel des Werdens lebendiger Wesen zu lösen; der andere vertiefte sich in das Gewordene und spürte den Gesetzen seines Wirkens nach. Wenigen Forschern ist es gelungen, ihre Leistungen noch bei ihren Lebzeiten in so hohem Maße anerkannt
zu sehen wie Hermann Helmholtz. Von allen Teilen der Welt liefen die Ehrenbezeugungen und Auszeichnungen ein, als er vor drei Jahren seinen siebzigsten Geburtstag feierte. Solch seltener Erfolg erregt Verwunderung, wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten die Bahnbrecher der Wissenschaften oft zu kämpfen haben, besonders wenn sie wie Helmholtz es verschmähen, aus dem Kreise ihres wissenschaftlichen Arbeitens herauszutreten und sich an Zweigen des öffentlichen Lebens zu beteiligen, für die mehr Interesse vorhanden ist als für die strenge Wissenschaft. Die Verwunderung schwindet, sobald man einen Blick auf die geschichtliche Stellung des verstorbenen Forschers innerhalb der wissenschaftlichen Entwickelung des letzten Jahrhunderts wirft. Helmholtzens Jugend fällt in eine Zeit, die reicher als irgendeine an brennenden wissenschaftlichen Fragen war. Er fand eine Unzahl von Aufgaben vor, die in einem Zustande waren, daß die Lösung jeden Tag erwartet werden durfte. Dabei waren die Methoden der Forschung so weit ausgebildet, daß es in vielen Fällen nur eines kleinen Schrittes bedurfte, um auf den bereits eingeschlagenen Wegen zu epochemachenden Entdeckungen zu gelangen. Der große Anreger auf naturwissenschaftlichem Gebiete in Deutschland ist Johannes Müller, der Lehrer Helmholtzens und Haeckels und vieler anderer, mit deren Namen die moderne Naturanschauung verknüpft ist. Allen jenen, die bei der Feier des sechzigsten Geburtstages Ernst Haeckels, am 17. Februar 1894, in Jena anwesend waren, wird es unvergeßlich sein, mit welcher Begeisterung dieser Forscher die Worte sprach, mit denen er den Einfluß schilderte, den Johannes Müller auf ihn ausgeübt hat: «Ich hatte schon vergleichende Anatomie ... gehört und kam, so wohl vorbereitet, in die Vorlesungen von Johannes Müller, einem Manne, dessen außerordentliche Größe und Hoheit mir noch heute lebhaft vor Augen steht. Wenn ich jetzt bisweilen bei der Arbeit ermüde, brauche ich nur das Bild von Johannes Müller, welches in meinem Arbeitszimmer vor mir hängt, anzusehen, um neue Kraft zu gewinnen. ... Er lehrte vergleichende Anatomie und Physiologie. ... Ich hatte vor seiner gewaltigen Persönlichkeit eine solche Verehrung, daß ich es nicht wagte, ihm näherzutreten Mehrere
Male ist es mir passiert, daß ich ihn um Rat fragen wollte. Mit Herzklopfen stieg ich die Treppe hinan, faßte an die Klingel, wagte aber nicht zu läuten, sondern kehrte wieder um.» So wird uns der Mann von seinen Schülern geschildert, der die wissenschaftliche Strömung einleitete, innerhalb welcher Helmholtz seine großen Erfolge errang. Johannes Müller säuberte die Wissenschaft von einer ganzen Reihe von Vorurteilen, um freie Bahn zu bekommen für eine zwar nüchterne, aber auf unbefangene Anschauung gegründete Erkenntnis der Vorgänge im tierischen und menschlichen Organismus. Er nahm den Kampf auf gegen die kurzsichtige Anschauungsweise, die für die unorganische und organische Natur zwei grundverschiedene Erklärungsprinzipien annimmt, zwischen denen eine Vermittlung unbedingt ausgeschlossen sein soll. Zur Erklärung der unorganischen Natur nahm diese Ansicht die mechanischen, chemischen und physikalischen Kräfte an, zur Aufhellung der Erscheinungen des organischen Lebens glaubte sie einer besonderen «Lebenskraft» zu bedürfen, von der aber eine klare Vorstellung unmöglich ist. Die Ausdehnung der physikalischen Betrachtungsweise und ihrer Methoden auf die Erforschung der belebten Natur bildet den Grundzug des sogenannten «naturwissenschaftlichen Zeitalters», das mit Johannes Müller seinen Anfang nahm. In vollkommenster Weise tragen das Gepräge dieses Zeitalters die Forschungsergebnisse Helmholtzens. Jede wissenschaftliche Annahme ist unberechtigt, die den Gesetzen der mechanischen Physik widerspricht: das war das Ende seines Denkens. Wer von einer «Lebenskraft» spricht, macht den Organismus zu einem Perpetuum mobile, einem sich selbst bewegenden Beweger. Er läßt die Kraft, die zur organischen Bewegung notwendig ist, aus dem Nichts entspringen. Das ist unmöglich. Jede Kraftform kann nur durch Umwandlung aus einer andern entstehen. Es gibt im Weltall eine unveränderliche Kraftmenge, und alle Arten von Kräften, die organischen ebenso wie die unorganischen, können nur Formen dieser einen Kraft sein. Wo Kraft entsteht, muß sie aus der Umwandlung einer ihr entsprechenden Menge einer andersgearteten Kraft hervorgehen. Dies ist das heute berühmte «Gesetz von der Erhaltung der Kraft», das Helmholtz
im Jahre 1847 vor den Mitgliedern der Berliner Akademie der Wissenschaften verteidigte. Daß die Aufstellung dieses Gesetzes im wahrsten Sinne des Wortes eine Forderung der Zeitanschauung war, beweist die Tatsache, daß es in derselben Zeit auch von dem Württemberger Julius Robert Mayer gefunden wurde. Die Anwendung der physikalischen Forschungsmethode auf die Vorgänge des organischen Lebens führte Helmholtz auf den Gedanken, die Geschwindigkeit zu bestimmen, mit der ein auf einen Nerv ausgeübter Reiz im Organismus sich fortpflanzt. Daß ihm dies gelang, war ein Erfolg der physikalischen Denkrichtung. Es war der Beweis geliefert, daß die Vorgänge innerhalb wie außerhalb des Organismus gemessen werden können.
Der gleichen physikalischen Methode bediente sich Helmholtz auch zur Erforschung der Gesetze, nach denen uns unsere Sinne die Wahrnehmung der Außenwelt vermitteln. Auch auf diesem Felde hatte Johannes Müller die Bahn vorgezeichnet. Von ihm stammt die Ansicht, daß die Art der Empfindung, die ein äußerer Eindruck auf uns macht, von den Sinnesnerven abhängt, durch die er vermittelt wird. Wird der Sehnerv erregt, so entsteht Lichtempfindung, gleichgültig, ob Licht oder elektrischer Strom oder ein Druck auf das Auge einwirkt. Durch diesen Satz war die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf die Einrichtung der Sinnesorgane gelenkt. Hier fand Helmholtz ein fruchtbares Arbeitsgebiet. Eine folgenreiche Erfindung auf demselben machte ihn mit einem Schlage zum berühmten Mann. Es ist der Augenspiegel, durch den die Bilder auf der Netzhaut im Auge und Teile dieser Netzhaut selbst beobachtet werden können. Auch für diese Erfindung fand Helmholtz alles vorbereitet. Brücke, ebenfalls ein Schüler Johannes Müllers, hatte sich mit der Theorie des Augenleuchtens beschäftigt, das darauf beruht, daß ein Teil des Lichtes, das auf die Netzhaut fällt, wieder nach außen zurückgeworfen wird. Brücke hatte nur versäumt, sich die Frage vorzulegen, welchem optischen Bilde das aus dem Auge zurückkehrende Licht angehört. Auf diese Frage stieß Helmholtz, als er sich überlegte, wie er seinen Schülern die Brückesche Theorie des Augenleuchtens am besten beibringen könnte. Mit ihrer Beantwortung war zugleich
das Instrument gegeben, das uns in das Innere des menschlichen Auges einen Blick tun läßt und das dadurch der Augenheilkunde neue Wege wies. Damit hat Helmholtz den Beweis erbracht, daß die neuere Naturwissenschaft auch diejenigen befriedigen muß, die es mit Baco von Verulam, dem Vater der Erfahrungswissenschaft, halten und glauben, daß die Wissenschaft ihre Erkenntnisse aus dem Leben schöpfen soll, um sie auch für das Leben praktisch verwendbar zu machen. Für seine äußere Stellung in der Welt war die Konstruktion des Augenspiegels entscheidend; Er fand nun kein Hindernis mehr, seine großen Pläne in bezug auf die Physiologie der Sinnesorgane auszuführen. In zwei umfangreichen Werken legte er die Funktionen des Auges und des Ohres dar. Längst bekannte Tatsachen rückte er in eine neue Beleuchtung, mangelhafte Methoden verbesserte er. Wo es sich darum handelte, durch neue Apparate Lücken der Forschung, die seine Vorgänger offengelassen hatten, auszufüllen, da ließ ihn sein Scharfsinn nie im Stiche. Auf diese Weise hat er in seiner «physiologischen Optik» und in seiner «Lehre von den Tonempfindungen» Werke geliefert, die grundlegend für die Wissensgebiete geworden sind, denen sie angehören. Die Vorgänge im Auge bei Einwirkung äußerer Gegenstände und nach Aufhebung des äußeren Einflusses unterwarf er einer genauen Untersuchung; für die Empfindung der Farben und Farbennuancen ersann er auf Grund der Ansichten Th. Youngs geistreiche Hypothesen. Manche von seinen Ausführungen sind unserer gegenwärtigen Erfahrung gegenüber nicht mehr haltbar; aber jeder, der dieses Forschungsfeld betritt, sucht zunächst den Anschauungen Hermann Helmholtzens gegenüber eine Stellung zu gewinnen. Ein Beweis dafür ist die vor kurzem erschienene «Theorie des Farbensehens» von Ebbinghaus. Helmholtz widerspricht niemand, ohne vorher ihm die Anerkennung seiner Leistungen ausgesprochen zu haben.
Wie eine Erleuchtung wirkte, was Helmholtz in der «Lehre von den Tonempfindungen» über das Wesen der Klangfarbe vorbrachte. Daß die sogenannten Töne der Violine, des Klaviers und so weiter, ja auch die der menschlichen Stimme gar keine einfachen Töne, sondern aus einem Ton mit seinen zahlreichen Obertönen
zusammengesetzte Klangphänomene sind, hatte Helmholtz aus Beobachtungen erschlossen, die zuerst G. S. Ohm gemacht hat. Durch Berücksichtigung der Erfahrungen, welche die Mikroskopiker über den Bau des Ohres gewonnen hatten, gelang es ihm, eine Anschauung darüber zu gewinnen, wie das Gehörorgan die zusammengesetzten Elemente wieder in ihre Elemente zerlegt und auf diese Weise dem Bewußtsein die Wahrnehmung der Klangfarbe vermittelt. Die Erscheinung der Akkorde erklärt Helmholtz aus dem Auftreten sogenannter Schwebungen bei dem gleichzeitigen Erklingen zweier verschieden hoher Töne, die in dem wechselweisen An- und Abschwellen der Tonstärken bestehen. Helmholtz wollte mit diesem Werke eine physiologische Grundlage der Musikästhetik geben. Wie genau er wußte, daß die Ästhetik neben der Naturwissenschaft ein selbständiges Gebiet habe, das er selbst gar nicht betreten wollte, das beweisen seine Worte im Schlußkapitel des Buches, wo er in bezug auf die Fragen, die jenseits der Physiologie liegen, sagt: «Freilich beginnt auch hier erst der interessantere Teil der musikalischen Ästhetik handelt es sich doch darum, schließlich die Wunder der großen Kunstwerke zu erklären, die Äußerungen und Bewegungen der verschiedenen Seelenstimmungen kennenzulernen. So lockend aber auch das Ziel sein möge, ziehe ich es doch vor, diese Untersuchungen, in denen ich mich zu sehr als Dilettant fühlen würde, anderen zu überlassen und selbst auf dem Boden der Naturforschung, an den ich gewöhnt bin, stehenzubleiben.» Diese Worte sollten diejenigen beherzigen, die da glauben, daß alles Heil von der Naturwissenschaft kommen muß, und bei denen sogleich aller Denkermut erlischt, wenn sie nicht den festen Boden experimenteller Tatsachen unter den Füßen haben.
Der engere Kreis der mathematischen Physiker und Mathematiker erblickt in Hermann Helmholtz einen führenden Geist auch auf seinem Wissensgebiete. Es glückte ihm, Probleme zu lösen, an denen Euler und Lagrange vergeblich ihren Scharfsinn versucht hatten. Er fand in vielen Dingen Antworten, wo andere nur klar erkannt haben, daß eine Frage vorliegt. Wer in solcher Weise wirkt, der befriedigt viele, weil er sie von dem Alpdrucke quälender
Rätsel befreit. Von Johannes Müllers gewaltigen Forderungen ist heute manche erfüllt. Helmholtz ist der größte unter denen, die an dieser Erfüllung gearbeitet haben. Er gehörte zu den besten seiner Zeit, weil er ihre Aufgaben verstand wie wenige. Seine Kunstanschauungen wurzelten in dem Boden des Klassizismus. Der klassischen Tonkunst wollte er in seiner «Lehre von den Tonempfindungen» eine naturwissenschaftliche Unterlage schaffen. Das hinderte ihn nicht, Richard Wagners Genie volles Verständnis entgegenzubringen. Wir Jüngeren brauchen uns deshalb doch nicht darüber zu täuschen, daß wir Helmholtzens Anschauungen auf vielen Gebieten nicht mehr teilen können. Eine neue Kunstanschauung, eine neue Philosophie erfüllt uns, und diese werden auch eine neue Naturanschauung im Gefolge haben, die mit manchem brechen wird, was mit Helmholtzens Namen verknüpft ist. Aber aus jeder Zeitanschauung entspringen Leistungen, die unvergänglich sind, und zu ihnen gehören diejenigen, die Helmholtz aus dem Charakter seiner Zeit heraus der Wissenschaft einverleibt hat.
WILHELM PREYER. Gestorben am 15. Juli 1897
I
Ein kühner Forscher, ein fruchtbarer Denker voll anregender Ideen, ein unermüdlicher Sucher nach neuen Wegen und Zielen der Wissenschaft und des Kulturlebens war WilheIrn Preyer. Die Physiologie stand im Mittelpunkte seines Schaffens. Sein umfassender Geist war in allen Gebieten der Naturwissenschaft heimisch. Überaliher flossen ihm die Gedanken, die Tatsachen, die er in dem großen Ideengebäude verarbeitete, das ihrn als Physiologie im weitesten Sinne des Wortes vorschwebte. Weite, geist-volle Ausblicke eröffnen seine Schriften. Ausgetretene Pfade zu gehen war ihtn ganz unmöglich. Was er angriff, wurde durch
seine Arbeit, durch sein Denken ein Neues. Einen freien, ungetrübten Blick hatte er für alles Bedeutende, das im geistigen Leben der letzten Jahrzehnte auftrat. Er wußte stets, was Zukunft hatte. Ernst Haeckel sagt in dem Geleitworte, das er der vor kurzem erschienenen Darwin-Biographie Preyers vorausschickt: «Sie gehören ja gleich mir zu der geringen Zahl derjenigen Naturforscher, welche gleich nach dem Erscheinen von Darwins epochemachendem Werk über den Ursprung der Arten von dessen gewaltiger Bedeutung überzeugt waren und welche den Mut hatten, dessen grundlegende Anschauungen zu einer Zeit entschieden zu vertreten, in welcher sich noch die große Mehrzahl der Fachgenossen ablehnend oder feindlich verhielt. Preyer gehörte nicht zu jenen in ihrer Beschränktheit glücklichen Gelehrten und Denkern, die eine Summe von Überzeugungen durch Überlieferung sich aneignen und dann in der Richtung, die ihnen dadurch vorgezeichnet ist, selbst einige Schritte weitermachen. Der Glaube, daß sie einen sicheren Weg einschlagen, macht solche Gelehrte ungeeignet, große Irrtümer zu begehen. Sie lassen sich auf kühne Wagnisse in der Wissenschaft nicht ein. Preyer wagte viel. Manche seiner Ideen werden im Kreise seiner Fachgenossen als Verirrungen angesehen. Vieles von dem, was er als seine Ansicht vertreten hat, wird sich im Laufe der Zeit als unhaltbar erweisen. Aber er war als Irrender anregender als die andern, die nicht fehlen können, weil im Verkehr mit wissenschaftlicher Kleinmünze große Irrtümer nicht begangen werden können. Von Lombroso wird erzählt, daß ihm das Neue im geistigen Leben an sich sympathisch ist, bloß weil es neu ist. Etwas Ähnliches gilt von Preyer. Er vertiefte sich mit Vorliebe in die Gebiete der Wissenschaft, die jung sind. Der Hypnotismus, die Graphologie, die Frage, ob Bacon der Verfasser von Shakespeares Dramen ist, beschäftigten ihn und regten ihn zu Schriften und Aufsätzen an, die wertvoll und originell sind, trotzdem ihr Inhalt starken Zweifeln begegnen muß. Dingen, die manchem so absurd erscheinen, daß er gar nicht ernsthaft über sie reden will, wendete Preyer seine Arbeit und sein Denken zu. Die wissenschaftliche Betrachtung der Handschrift bildete in der letzten Zeit seine Lieblingsbeschäftigung.
Die Seele des Menschen, sein Wesen, seinen Charakter in der Handschrift zu finden, galt ihm als Aufgabe einer wissenschaftlichen Graphologie. Wissenschaftliche Vorurteile, eine gewisse Richtung gelehrter Erziehung bringen hei vielen den Glauben hervor, daß es unwissenschaftlich sei, sich auf gewisse Dinge einzulassen. Die Mehrzahl unserer wissenschaftlichen Zeitgenossen ist der Meinung, daß solche Dinge wie die Graphologie einer wissenschaftlichen Bearbeitung unfähig sind. Sie kommen zu einer solchen Meinung, weil sie sich ganz bestimmte Vorstellungen darüber gebildet haben, was in der Natur möglich ist und was nicht. Was zu diesen Vorstellungen nicht stimmt, lehnen sie einfach ab. Geister wie Preyer können sich von solchen Vorstellungen nicht gefangennehmen lassen. Sie wissen, wie wenig fest die . In dem Buche, das er über diesen Gegenstand geschrieben hat, stehen mehr und bedeutungsvollere psychologische Erfahrungen und Ideen als in den Schriften der exakten Modepsychologen, die durch das Experiment im Laboratorium der Menschenseele nahekommen wollen. Ein feiner Blick für das Intime im Leben des Kindes, eine ungeheure Kombinationsgabe ist Preyer eigen. In bewundernswerter Weise schließen sich bei ihm die Beobachtungen zu einem großen wissenschaftlichen Gebäude zusammen. Meister in der Detailarbeit und geistvoller Entdecker großer Zusammenhänge ist Preyer zugleich. Seine Darwin-Biographie ist ein Meisterwerk in bezug auf Durchdringung des Stoffes mit großen wirksamen Ideen. In wenigen bedeutungsvollen Strichen
zeichnet Preyer den Anteil hin, den der Darwinismus an allen Gebieten des modernen Geisteslebens hat.
Niemals ist es Preyer bloß um die Erkenntnis allein zu tun. Er will das durch die wissenschaftliche Betrachtung Gewonnene in den Dienst des Lebens stellen. Sein Buch hat nicht bloß die Aufgabe, das Seelenleben des Menschen zu erforschen, sondern auch die andere, der Pädagogik eine gediegene psychologische Grundlage zu schaffen. «Immer mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß die Psychogenesis die notwendige Gtundlage der Pädagogik bildet. Ohne das Studium der Seelen-entwicklung des kleinen Kindes kann die Erziehung und Unterrichtskunst in der Tat auf festem Boden nicht begründet werden. ... Die Kunst, das kleine Kind werden zu lassen, ist viel schwerer als die, es vorzeitig zu dressieren>, sagt er in der Vorrede des genannten Werkes. Aus derselben Quelle fließen die Ansichten, die er über die notwendige Reform des höheren Schulwesens geäußert hat. Preyer ist hier radikal. Er will die klassische Gymnasialbildung ersetzt wissen durch eine im Geiste der modernen naturwissenschaftlichen Anschauungsweise gehaltene. Die Erkenntnisse, die unsere Zeit bewegen, soll das Gymnasium dem Jüngling überliefern. Man braucht nur den Mut zu haben, im Geiste unserer Zeit zu denken, und man muß Preyers Ideen zustimmen. Nur mutlose Geister, die jeder Reform abhold sind, können hier wider-sprechen. Solche Geister fürchten sich vor jeder Umwälzung. Wie das Alte wirkt, sehen sie; wie das Neue wirken wird, davon können oder wollen sie sich keine Vorstellung machen. Sie wollen das Alte, weil es bequem ist. Rege Geister wie Preyer hassen den Stillstand als solchen. Sie werden stets mit reformatorischen Ideen sich tragen, weil sie wollen, daß alle Dinge stets im Werden, im Flusse sein sollen.
II
Preyer betont, daß «jedes physiologische System, welches auf Vollständigkeit Anspruch macht, genötigt ist, zahlreiche und große Lücken durch Vermutungen auszufüllen. Und weil diese immer
subjektiv sind, gibt es kein physiologisches Lehrgebäude, das sich eines allgemeinen Beifalls erfreute>. Von dem Recht auf solche Vermutungen hat der energische Denker a4sgiebigen Gebrauch gemacht. Denn er wußte, daß die Tatsachen dem Forscher zurneist erst dann ihr Wesen enthüllen, wenn er vorher sich über ihren Zusammenhang hypothetische Vorstellungen gemacht hat. Die Gesetzmäßigkeit, die sich zuletzt als die richtige herausstellt, kann sehr verschieden sein von der vermutungsweise ausgesprochenen; diese hat doch erst den Weg gewiesen, der zu jener geführt hat. Eine kühne Vermutung hat Preyer über den Ursprung des Lebendigen ausgesprochen. Sein Denkermut ließ es nicht zu, vor dieser Grundfrage aller Physiologie haltzumachen. Viele zeitgenössische Physiologen wagen kein Wörtlein über diese Frage zu sagen, weil ihnen die Wissenschaft dazu noch nicht weit genug zu sein scheint. Andere sind der Ansicht, daß es in nicht zu ferner Zeit gelingen werde, das Rätsel des Lebensursptungs dadurch zu lösen, daß man im Laboratorium künstlich aus Kohlensäure, Ammoniak, Wasser und Salzen lebendige Substanz herstellen werde. Dadurch, meinen sie, wird erwiesen sein, daß sich einst auch in der Natur Lebendiges aus Unlebendigem, durch Urzeugung, entwickelt habe. Die organischen Prozesse werden dann nur als komplizierte mechanische, physikalische und chemische Vorgänge erscheinen, und man wird sie mit Hilfe der Gesetze der Physik und Chemie erklären können, wie man heute die Erscheinungen der unorganischen Natur erklärt. Eine dritte Art von Forschern hält das aber ganz und gar für unmöglich. Bunge zurn Beispiel erklärt: «Je eingehender, vielseitiger, gründlicher wir die Lebenserscheinungen zu erforschen streben, desto mehr kommen wir zur Einsicht, daß Vorgänge, die wir bereits geglaubt hatten, physikalisch und chemisch erklären zu können, weit verwickelterer Natur sind und vorläufig jeder mechanischen Erklärung spotten Alle Vorgänge in unserem Organismus, die sich mechanistisch erklären lassen, sind ebensowenig Lebenserscheinungen wie die Bewegung der Blätter und Zweige am Baume, der vom Sturme gerüttelt wird, oder wie die Bewegung des Blütenstaubes, den der Wind hinüberweht von der männlichen Pappel zur weiblichen.» Dies letztere ist ungefähr
auch Preyers Meinung. Er gab nicht zu, daß jemals Lebendiges aus Leblosem entstanden sein könne, weil ihm die organische Gesetzmäßigkeit höherer Art zu sein schien als die anorganische. «Wird die Urzeugung angenommen,» sagt Preyer, «so sind zwei Fälle möglich. Entweder sie hat in früheren Epochen, die weit hlnter uns in der Vergangenheit liegen, stattgefunden und findet gegenwärtig nicht mehr statt, oder sie hat ehedem stattgefunden und findet gegenwärtig noch statt. Zugunsten des ersteren Falles wird geltend gemacht, daß während der raschen Abkühlung der Erdoberfläche ganz andere Zustände vorhanden waren als jetzt, andere Luft und anderes Licht, andere Verteilung des Festen und Flüssigen, andere chemische Verbindungen und andere Temperaturen der Meere. Es konnte also möglicherweise, so wird von narnhaften Forschern behauptet, damals, unter so eigentümiichen, nicht wiederkehrenden Bedingungen, der eigentümliche, nicht wiederkehrende Vorgang der Urzeugung stattfinden, bis die Erdoberfläche, allmählich der jetzigen ähnlicher geworden, sich soweit verändert hatte, daß zwar lebende Körper bestehen, aber nicht mehr ohne Dazwischenkunft lebender Körper entstehen konnten.» Preyer findet, daß diese Auffassung auf schwachen Füßen stehe. «Es ist unerfindlich, was, nachdem einmal die Bedingungen für die Zusammenfügung toter Körper zu lebenden da waren, worauf Leben entstand und bestehen blieb, sich verändern sollte, so daß es zwar in seinen niedersten Formen fortdauern und sich weiter entfalten, aber nicht mehr durch Urzeugung, sondern nur durch Zeugung sich erneuern konnte. Es ist kein Grund angebbar, weshalb, wenn einmal die Selbstzeugung stattfand, sie nicht auch gegenwärtig stattfinden sollte.> Die Bedingungen, die heute zum Leben notwendig sind, mußten doch zur Zeit der Urzeugung auch schon vorhanden sein, sonst hätte das gezeugte Lehen sich nicht erhalten können. Die Änderung in diesen Bedingungen des Lebens kann also eine erhebliche nicht sein. Wenn Urzeugung in der Vorzeit möglich war, muß sie auch heute möglich sein. Aber alle Versuche, künstlich im Laboratorium Lebendiges aus Leblosem herzustellen, sind gescheitert. «Es werden zwar», meint Preyer, «in den nächsten Jahren noch mehr solcher Versuche angestellt werden. und namentlich
wird man trachten, die Bedingungen, welche auf dem tiefen Meeresboden allein realisiert sind, im Laboratorium künstlich herzustellen, aber zugunsten der Ansicht, daß ein positives Resultat überhaupt erzielbar sei, ist kein triftiges Argutuent beizubringen. Die Zahl der chemischen Elemente, welche zu solchen Versuchen dienen können, ist eine kleine, und wenn auch die quantitativen Verhältnisse, die absoluten Mengen, die Druckgrade, die Temperaturen der einzelnen Ingredienzien höchst variierbar sind, so bleiben doch, mit Rücksicht namentlich auf die den Protoplasmabewegungen allein zuträglichen Wärmegtenzen, im Experimente die Mischungsmöglichkeiten innerhalb relativ enger Schranken eingeschlossen.>
Wer leugnet, daß lebendige Materie aus lebloser im Laufe der Zeit sich entwickelt habe, und dennoch auf dem Boden der heutigen Naturwissenschaft stehenbleiben will, der muß annehmen, daß das Lebendige unentstanden, ewig ist. Zu dieser Ansicht hat sich Eberhard Richter entschlossen. Er verteidigte im Mai 1865 die Meinung, daß die Lebenskeime ewig seien. Da sie aber auf der Erde in der Zeit, als diese glutflüssig war, nicht gedeihen konnten, so müssen sie später, als die Abkühlung genügend vorgeschritten war, von anderen Himmelskörpern auf unseren Planeten gelangt sein. Richter sagt: «Die Astronomie zeigt, daß im Weltraume Unmassen feiner Substanzen schweben; von den fast körperlosen Kometenschweifen bis zu den in unserer Atmosphäre erglühenden und häufig auf die Erde fallenden Meteorsteinen. In letzteren hat die Chemie außer den geschmolzenen Metallen noch Reste von organischer Substanz (Kohle) nachgewiesen. Die Frage, ob diese organischen Stoffe, bevor sie durch Erglühen des Aeroliths zerstört wurden, aus formiosem Urschleim oder aus geformten organischen Gebilden bestanden haben, ist jedenfalls für letztere zu entscheiden, denn dafür haben wir eine entsprechende Erfahrung in unserer Atmosphäre. Nachdem Richter von den in der Erdluft vorhandenen Pilzkeimen und Infusorien gesprochen hat, sagt er: «Wenn nun aber einmal mikroskopische Geschöpfe so hoch in der Atmosphäre der Erde schweben, so können sie auch gelegentlich, zum Beispiel etwa unter Attraktion vorüberfliegender Kometen
oder Aerolithen, in den Weltraum gelangen und dann auf einem bewohnbar gewordenen, das heißt der gehörigen Wärme und Feuchtigkeit genießenden, anderen Weltkörper aufgefangen, sich durch selbsteigene Tätigkeit wieder entwickeln.> Seinen Grundgedanken verknüpft Richter mit allerlei Dingen, die unhaltbar sind. Dennoch ist er nicht einfach von der Hand zu weisen. Es ist eine Tatsache, daß auf der Erde zahlreiche Organismen, Keime und Eier jahrhundertelang, ohne die geringste Lebenserscheinung zu zeigen, ihre Lebensfähigkeit behalten können. Solche lebendige Substanzen geraten durch Entziehung notwendiger Lebensbedingungen in einen leblosen Zustand; sie können aber wieder belebt werden, wenn die geeigneten Umstände geschaffen werden. Man nennt sie anabiotisch. Es könnte also sein, daß in den Körpern, die aus dem Weltraum auf die Erde fallen, Substanzen enthalten seien, in denen schlummerndes Leben ist, das auf der Erde unter geeigneten Bedingungen geweckt werden kann. Auf diese Art könnte die einst tote Erde mit Leben bevölkert worden sein. Diese Hypothese ist so wenig abenteuerlich, daß sich Helmholtz und Thomson für ihre wissenschaftliche Berechtigung ausgesprochen haben.
Preyer bezeichnet sie dennoch mit vollem Recht als unzulänglich. Sie leistet nichts. Sie sagt: Leben ist nicht auf der Erde aus Leblosem entstanden, sondern von andern Weltkörpern auf sie gelangt. Da wiederholt sich doch für die andern Weltkörper dieselbe Frage. Ist es dort aus Unorganischem entstanden oder ewig vorhanden gewesen? Preyer greift zu einer andern Hypothese. Warum soll nicht das Lebendige, das Ursprüngliche, das erste sein und das Leblose sich aus dem anfangs allein vorhandenen Lebendigen entwickelt haben? Preyer findet die Ansicht durchaus berechtigt, daß «durch Lebensvorgänge allein, welche schon vor der Erdbildung waren, alles Anorganische durch Ausscheidung, Erstarrung, Verwesung, Abkühlung lebender Körper entstand, wie es auch gegenwärtig der Fall ist». Preyer findet, daß der Unterschied des Anorganischen vom Organischen von den Naturforschern vielfach in einem ganz falschen Lichte gezeigt wird. Manche unorganische Vorgänge können als Übergänge von dem Leblosen zu dem
Lebendigen aufgefaßt werden. Sie stellen Analoga der Lebenstätigkeit dar, wenn man genau zusieht. «Ein naheliegendes Beispiel ist das Meer, welches dieselbe Luft einatmet wie wir, vielerlei Dinge als seine tägliche Nahmng in sich aufnimmt und assi-miliert, indem es sie auflöst, so daß sie konstante Meeresbestand-teile werden. Auch das Meer kann als solches - wie ein Organismus - nur innerhalb enger Temperaturgrenzen bestehen, denn wenn es bei zu großer Abkühlung fest wird, bei zu großer Wärme verdampft, so erlischt sein Leben. Strömungen zeigen auch die Ozeane im Innern. Flüsse führen ihnen Wasser zu wie Adern den nährenden Saft in die Körperteile. An den Strand werden die Auswürflinge des Meeres, seiner toten Teile, das Eis, Edukte und Produkte seines Stoffwechsels geworfen. Es produziert durch die Reibung seiner Wassermassen aneinander Wärme, und es verschluckt, wenn es kälter als die Luft ist, deren Wärme. Es erzeugt sich immer aufs neue, wie das Protoplasma... Auch das Feuer kann man im allgemeinen lebendig nennen. Es atmet dieselbe Luft, die wir atmen, und erstickt, wenn wir sie ihm entziehen. Es verzehrt mit unersättlicher Gier, was seine rüngeinden Organe ergreifen, und nährt sich von seiner Beute. Es wächst mit langsamer Bewegung, im Dunkeln beginnend, wie der Keim unmerklich, dann glimmt es, entfaltet sich immer mehr wachsend schnell zu himmel-anstrebender Lohe und pflanzt sich fort mit erschreckender Eile, überalihin Funken entsendend, die neue Feuer gebären.» Man denke sich diese an das Lehen erinnernden Erscheinungen zu voller Lebendigkeit erhöht, und man hat jenen Zustand der einst lebendigen Erdinasse, aus der sich sowohl das gegenwärtig Lebende wie das gegenwärtig Leblose abgeschieden hat. Preyer behauptet nicht, daß die einfachste Lebenssubstanz, die wir heute kennen, vom Anfang der Erdbildung an vorhanden war, sondern daß die anfang-lose Bewegung im Weltall nicht eine bloß mechanische oder physische, sondern daß sie eine lebendige ist und daß die einfache Lebenssubstanz notwendig übrigbleiben mußte, nachdem durch die Lebenstätigkeit des glühenden Planeten an seiner Oberfläche die jetzt als anorganisch bezeichneten Körper ausgeschieden worden waren. «Die schweren Metalle, einst auch organische Elemente,
schmolzen nicht mehr, gingen nicht wieder in den Kreislauf zurück, der sie ausgeschieden hatte. Sie sind die Zeichen der Totenstarre vorzeitiger gigantischer glühender Organismen, deren Atem vielleicht leuchtender Eisendampf, deren Blut flüssiges Metall und deren Nahrung vielleicht Meteoriten waren.»
Eine ähnliche Vorstellung wie Preyer hat später G. Th. Fechner in seinen «Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen» vertreten. Auch er faßt das Weltall als ursprünglich belebt auf.
Die philosophischen Geister muß Preyers Anschauung anziehen. Sie werden niemals begreifen können, wie durch Summierung von mechanischen, physikalischen und chemischen Vorgängen die Erscheinungen des Lebens erklärbar sein sollen. Daß sich Lebendiges in Lebloses verwandle, ist durchaus begreiflich und durch die tägliche Erfahrung bewiesen; daß sich Lebendiges aus Leblosem entwickle, widerstreitet aller in das Wesen der Dinge dringenden Beobachtung. Die unorgunischen Vorgänge sind im organischen Körper in gesteigerter Form vorhanden, in einer Form, die ihnen innerhalb der unorganischen Natur nicht zukommt. Sie können sich nicht selbst zu organischer Tätigkeit steigern, sondern müssen, um dem Leben zu dienen, erst von einem Organismus eingefangen, angeeignet werden.
Gegenüber der Hypothese von der Urzeugung ist die Preyers die philosophischere. Feinere Geister werden Preyer zustimmen, wenn er meint: «In der Tat liegt die Vermutung nahe, daß das Leben und die Wärme der Himmeiskörper wie der Organismen im engern Sinne nicht bloß untrennbar aneinandergebunden denselben großen Gesetzen gehorchen, sondern in letzter Instanz derselben Quelle entstammen. Das intensivste Leben lebt die Sonne. Und wenn auch unsere Erde nur ihr Trabant ist, so hat sie doch Licht von ihrem Licht, Wärme von ihrer Wärme und in ihrem Schoße Leben von ihrem Leben: und es ist kein bloßes Phantasie-spiel, zu meinen, daß auch wir Menschen ursprünglich dem Feuer am Firmamente entstammen.»
III
Das Leblose leitet Preyer aus dem Lebendigen her. Das Weltall ist ihm ein großer, alles umfassender Organismus. Von dieser Anschauung ist nur ein Schritt zu der weiteren, sich die Welt als beseelten, geisterfüllten Organismus vorzustellen. Auch diesen Schritt hat Preyer getan. Die Sätze der Mechanik, «die Materie ist tot; sie fühlt nicht», sieht er als Verirrung an. Er vermutet, daß auch das kleinste, scheinbar tote Körperteilchen mit Empfindung, also mit Geist begabt ist. Es entspricht den Tatsachen anzunehmen, daß «nirgends eine scharfe Grenze zwischen empfindungsfähigen und empfindungsunf ähigen Wesen existien, sondern aller Materie ein gewisses Empfindungsvermögen zukommt, welches aber nur bei einer bestimmten, äußerst komplizierten Anordnung und Bewegung der Teilchen es zur Empfindung kommen lassen kann. Daher die einfachen Stoffe, die toten Körper, wenn sie auch zum Teil sehr leicht durch geringfügige Einflüsse verändert werden, trotz ihres dunklen Empfindungsvermögens doch nicht merklich empfinden können, sowie sie aber Bestandteile der grauen Substanz des Gehirns oder nur des lebendigen Protoplasmas werden (durch die Nahrungsaufnahme), mit andern zusammen in unübersehbar komplizierter Bewegung die Empfindung explosionsähnlich entstehen lassen, wenn jetzt ein Eindruck auf sie ausgeübt wird.»
Der Geist schlummert ursprünglich in der Materie, aber er ist in diesem Schlummerzustand tätig, er gestaltet die Materie, er organisiert sie, bis sie eine solche Form angenommen hat, daß er selbst in der ihm angemessenen Weise zur Erscheinung kommen kann. Dies ist das Leitmotiv, von dem Preyer bei all seinem Beobachten und Denken in Physiologie und Psychologie beherrscht wurde. Er wollte die organische Entwickelung nicht bloß deshalb verfolgen, um zu sehen, wie die eine Form aus der andern hervorgeht. Er suchte in der Tätigkeit, in der Funktion, die ein Organ zuletzt zu verrichten hat, den Grund, warum es sich in einer bestimmten Weise entwickelt. «Was bestimmt in der Stammesentwickelung die endgültige Gestalt? Ich antworte: Die Funktion.
Erst wenn sich diese betätigt, beginnt die Differenzierung des Substrats der ursprünglichen Wesen. Nicht das Organ ist es, von dem die Funktion ihre Entstehung abzuleiten hat, sondern ursprünglich verhält es sich gerade umgekehrt. Die Funktionen schaffen sich ihre Organe. Oder um den schwer definierbaren Ausdruck zu vermeiden, kann man sagen: das Bedürfnis bestimmt die organische Form, welche dann vererbt wird und erst in dem Embryo höherer Tiere, in der Anlage wenigstens, der Funktion vorhergeht.» Das Höchste, das Letzte, das entsteht, ist für Prcyer der Schöpfer des Ersten, des zeitlich Vorangehenden. «Jede einzelne Verrichtung des Menschen muß Schritt für Schritt verfolgt werden, einmal im individuellen Leben zurück bis zu ihrem ersten Auftreten im lebenden Ei und dann in der Reihe der Tiere, welche seinen Vorfahren noch nahestehen, und von diesen weiter bis zu dem schon nicht mehr tierischen, auch nicht pflanzlichen, nur noch lebendigen Protoplasma. Dann wird man anfangen zu wissen, woher die hohen und niedern Funktionen, zum Beispiel das Sprechen und Sehen, ebenso wie das Atmen und Wachsen stammen, und wie sie so geworden sind, wie sie sind.» Das Bedürfnis zu sprechen läßt gewisse Organe eine solche Entwickelung durchmachen, daß sie zuletzt Sprachorgane werden. Wer in dieser Weise die organische Entwickelung ansieht, dem kann das Streben, die Lebens- und Seelenvorgänge mechanisch zu erklären, nur als eine geschichtlich merkwürdige Verirrung erscheinen. «Wenn wirklich die Physiologie nichts anderes wäre als auf die Lebensvorgänge angewandte Physik und Chemie, dann wäre sie keine Wisserischaft für sich, dann gliche sie der Technologie und Maschinenbaukunde und sonstigen angewandten Disziplinen», sagt Preyer, und er fährt fort: «daß es überhaupt dahin kommen konnte, sie geradezu als die Physik der Organismen oder die Lehre vom Mechanismus und Chemismus der lebenden Körper anzusehen und zu definieren, ist eine historisch wichtige Tatsache. Der große Irrtum entstand durch die erst in diesem Jahrhundert, zumal in den letzten Jahrzehnten sich häufenden physikalischen Erklärungen einzelner Lebenserscheinungen und durch die vielen künstlichen Nachbildungen chemischer Erzeugnisse des Tier- und Pflanzenstoffwechsels. ...
Niemand bezweifelt, daß ohne fortwährende Verwertung, Anwendung und Ausbildung physikalischer und chemischer Grund- und Lehrsätze die Erforschung der Lebensvorgänge nicht fortschreiten kann. Daraus folgt aber durchaus nicht, daß die Lebensiehre weiter nichts als Physik und Chemie der lebenden Körper sei... Es gibt im gesunden Organismus so viele Vorgänge, welche, dem Physiker und Chemiker unverständlich bleibend, gar nicht in den Bereich ihrer Untersuchungen kommen, daß man die Ausdehnung physikalisch-chemischer Erklärungsversuche auf dieselben ebenfalls unzulässig, unwissenschaftlich, willkürlich nennen muß. Hier liegt ein Fall von verfehlter Induktion vor, wie er in der Kindheit häufig beobachtet wird: weil vieles gut schmeckt, was in den Mund gelangt, deshalb muß alles in den Mund gebracht werden.»
Preyer hat eine Reihe interessanter Beobachtungen auf dem Gebiete der Sinnesphysiologie und der Psycho-Physiologie gemacht und die Ergebnisse derselben in Schriften veröffentlicht, die durch scharfe Formulierung des Dargestellten mustergültig sind. Meiner Meinung nach stehen auch diese Arbeiten unter dem Einflusse der Vorstellung, daß es der Geist ist, der den Organismus gestaltet. In welcher Wechselwirkung stehen Geist und Körper? Wie wirken die Sinne, um dem Geiste das zu vermitteln, was er zu seiner Erhaltung braucht? Das sind Fragen, die derjenige stellt, der meint, der Geist schaffe sich eine solche organische Gestalt, daß er in einer seinen Bedürfnissen angemessenen Weise zur Erscheinung kommen kann. Die Abhängigkeit der Muskelzusammenziehung von der Stärke des auf den Muskel ausgeübten Reizes einerseits und die Abhängigkeit der im Muskel ausgelösten Bewegung von dem Reize andererseits (das myophysische Gesetz) machte Preyer zum Gegenstand einer bedeutenden Abhandlung (1874). Auch untersuchte er die Natur der Empfindungen («Elemente der reinen Empfindungslehre», Jena 1877) und stellte Beobachtungen darüber an, welche Schwingungen als Ton wahrgenommen werden und welche sich nicht mehr als Ton kundgeben, weil sie zu langsam oder zu schnell verlaufen («Über die Grenzen der Tonwahtnehmung», Jena 1876). Seine Forschungen über das Wesen des Schlafes, der Hypnose, des Gedankenlesens haben alle den gleichen
Ursprung: er wollte die intimen Beziehungen des Geistigen und Körperlichen erkennen. Und nicht weniger sind seine Bestrebungen auf dem Gebiete der Graphologie aus seiner Grundvorstellung hervorgegangen. Er wollte in dem geschriebenen Worte den Geist erkennen, der sich seinen Körper geschaffen hat.
CHARLES LYELL. Zur hundertjährigen Wiederkehr seines Geburtstages
Das geistige Leben der Gegenwart hätte eine völlig andere Physiognomie, wenn in diesem Jahrhundert zwei Bücher nicht erschienen wären: Darwins «Entstehung der Arten» und Lyells «Prinzipien der Geologie». Anders, als sie es tun, sprächen die Professoren in den Hörsälen der Universitäten über viele Dinge, anders, als es ist, wäre das religiöse Bewußtsein der gebildeten Menschheit, andere Ideen, als die wir aus ihnen vernehmen, hätte Ibsen in seinen Dramen verkörpert: wenn Darwin und Lyell nicht gelebt hätten. Die dramatische und erzählende Literatur lebte ein anderes Leben, wenn wir die genannten Bücher nicht hätten. In der Geistesluft, die wir einatmen, ist der Inhalt dieser Bücher als wichtiger Bestandteil enthalten. Wir können uns nicht leicht eine Vorstellung davon machen, wie wir dächten, wenn Darwin und Lyell ihre Gedanken dem Geistesorganismus der Menschheit nicht eingeimpft hätten. Man braucht niemals eine Zeile in der «Entstehung der Arten» und in den «Prinzipien der Geologie» gelesen zu haben, und man steht doch unter dem Einflusse dieser Büchet Nicht nur unser Denken, auch unser Empfindungsleben hat von ihnen sein charakteristisches Gepräge erhalten. Ein junger Mensch, der diese Bücher heute liest, glaubt in ihnen nichts zu finden, was er noch nicht weiß. Viele von uns wachsen mit den Ideen Darwins und Lyells auf, bevor sie von diesen großen Naturbeobachtern mehr als die Namen, ja bevor sie vielleicht auch nur die Namen kennen. Viele von uns müssen zu Menschen, die nicht
mit diesen Ideen aufgewachsen sind, eine ganz andere Sprache sprechen, als diejenige ist, an die sie gewöhnt sind. Wir fangen an, die Menschen, die unsere Sprache nicht verstehen, wie Wesen zu betrachten, die Überbleibsel einer vergangenen historischen Epoche sind. Wie viele es sind, die so denken, darauf kommt es nicht an. Die Hauptsache ist, daß wir in uns, die wir so denken, die eigentlichen und wahren Gegenwartsmenschen sehen. Wir wissen, daß wir die Jungen und andere die Alten sind. Wir blicken vorwärts, die anderen rückwärts. Von unseren Ideen wird der künftige Kulturhistoriker eine neue Epoche des Denkens beginnen lassen müssen. Der Gedanke an die Zukunft ruft in uns Freude und Entzücken hervor, weil die Zukünftigen uns als ihre Vorläufer betrachten werden. Diese Zukünftigen werden mehr wissen, mehr können als wir, aber sie werden Empfindungen haben, die den unsern verwandt sind. Wir stehen diesen Menschen näher als dem Kanzelredner, der mit uns zu gleicher Zeit geboren ist. Die Ersten, die Größten, die Führenden unter uns sind Lyell und Darwin. Wir sind ihnen unendlich dankbar, weil wir glauben, daß wir ohne sie zu einem absterbenden Teile der Menschheit gehörten. Unser Empfindungsleben spricht sie heilig. Wir schaudern vor dem Geist-Erleben, das wir gelebt hätten, wären sie uns nicht vorangegangen. Wir haben sogar das «richtige Urteil» über die Größen älterer Zeiten verloren, weil sie uns zunächst die wichtigsten sind. Wir grämen uns deshalb nicht. Wir wollen nicht die Dinge nehmen so objektiv, wie sie sind; wir wollen leben, und aus unserem Leben soll noch etwas werden; es soll die Kräfte des Wachstutns in sich tragen. Lieber wollen wir darauf blicken, was noch nicht getan ist, als uns in Betrachtungen über das Geschehene verlieren. Wären wir gerechter: wir wären unfruchtbarer. Wir haben gegenüber den Geistern, die uns nahestehen, die Ungerechtigkeit des Sohnes, der seine Eltern mehr liebt als andere, die ihm fernestehen. Wir lieben Darwin mehr als Aristoteles, Lyell mehr als Plato, weil Darwin und Lyell unsere gutbekannten Väter, Plato und Aristoteles Ahnenbilder sind, die wir in unserem Geistesschlosse aufgehängt haben. Wenn wir in Lyell und Darwin lesen, ist es, wie wenn jemand uns eine warme Hand gibt; wenn
wir Plato und Aristoteles studieren, so, wie wenn wir in einem Ähnensaal spazierengingen. Mit Darwin und Lyell leben wir, über Plato und Aristoteles lernen wir.
Wir geben Darwin und Lyell nicht immer recht, wir widersprechen ihnen in vielen Dingen, aber wir fühlen, daß sie auch dann in unserer Sprache reden, wenn wir ihnen widersprechen. Wir rechnen manche zu den unsrigen, die Darwin und Lyell in der schärfsten Weise bekämpfen, aber wir wissen, daß auch unser Widerspruch, wenn er fruchtbar ist, dies nur durch jene beiden Geister hat werden können. Große Geister bringen auch ihre Gegner hervor, und mit den Gegnern zusammen bringen sie die Menschheit vorwärts. Auch wenn die zukünftige Menschheit zu wesentlich anderen Vorstellungen kommen sollte, als Darwin und Lyell sie hatten, so werden diese Söhne der Zukunft doch in den beiden Märmern ihre Väter zu verehren haben.
Einen neuen Charakter hat Lyell dem Denken über die Bildung der Erde gegeben. Vor ihm beherrschten dieses Denken Vorstellungen, die uns heute kindlich vorkommen. Wir sehen nicht ein, warum die gewaltigen Gebirgsbildungen durch andere Kräfte hervorgebracht sein sollen, als diejenigen sind, die heute noch herrschen. Lyell sah, daß im Laufe nachweisbarer Zeiträume das fließende Wasser die Steinmassen von den Gebirgen loslöst und sie an anderer Stelle wieder absetzt. Es verschwinden dadurch Bildungen an einem Orte und andere entstehen an einem andern wieder. Das geht langsam vor sich. Aber man denke sich solche Wirkungen durch unermeßliche Zeiträume fortgesetzt, so wird man sich vorstellen können, daß durch diese noch heute herrschenden Kräfte die ganze Erdoberfläche diejenige Gestalt angenommen hat, die sie gegenwärtig hat. Dazu kommen die Umgestaltungen, welche heute die Erdoberfläche durch schwimmende Eisberge, durch wandelnde Gletscher, die Schutt und Gerölle mit sich führen, erhält. Man denke ferner an Erdbeben und an vulkanische Erscheinungen, die den Boden heben und senken, man denke an den Wind, der Dünen aufwirft, und an das langsame allmähliche Verwittern der Gesteine. Alles, was zur Bildung der Erde bis jetzt geschehen ist, kann so geschehen sein, daß im Laufe langer Zeiträume jene
genannten Wirkungen vorhanden waren. Wir zweifeln heute nicht, daß sich die Sache so verhält. Aber vor Lyell dachten die Menschen anders. Sie glaubten, daß die mächtigen Gebirgsbildungen durch augenblicklich wirksame, außerordentliche Kräfte bewirkt worden seien. Wenn eine Gestalt der Erdoberfläche reif war, zugrunde zu gehen, so griff die Schöpferkraft von neuem ein, um unserem Planeten ein neues Antlitz zu geben; so dachten unsere Vorfahren. Wir erkennen, wenn wir die Erdrinde untersuchen, daß eine Anzahl von Erdepochen da war und wieder untergegangen ist. Die untergegangenen Erdepochen finden wir als übereinandergetürmte Schichten der Erdrinde. In jeder Schicht entdecken wir versteinerte Tier- und Pflanzenformen. Unsere Vorfahren nahmen an, daß immer und immer wieder die Schöpferkraft das Leben einer Epoche habe zugrunde gehen lassen und ein neues an die Stelle gesetzt habe. Lyell zeigte, daß dies nicht der Fall ist. Durch allmähliches Wirken der Kräfte, die heute noch tätig sind, hat sich eine Epoche aus der andern entwickelt; und in jeder folgenden Epoche lebten diejenigen Lebewesen, die sich aus der vorigen erhalten haben und die sich den neuen Lebensbedingungen anpassen konnten. Die Geschöpfe der jüngeren Erdperioden sind die Nachkommen derjenigen, die in älteren gelebt haben.
Von unendlicher Fruchtbarkeit war dieser Gedanke für Darwin. Er hat erkannt, daß im Laufe der Zeiten sich die tierischen Arten verändern können. Daß die Tierarten nicht jede für sich geschaffen sind, sondern daß sie miteinander verwandt sind, daß sie auseinander hervorgegangen sind. Nimmt man diese Erkenntnis mit Lyells Gedanken zusammen, so wird klar, daß alles Leben auf der Erde, das vergangene und das zukünftige, eine große natürliche Einheit bildet. Die Vorgänge, die wir heute mit Augen sehen und mit unseren Geisteskräften verstehen, haben immer stattgefunden. Keine anderen waren je da. Was heute geschieht, geht ohne Wunder und ohne überirdische Einwirkungen vor sich. Darwin und Lyell haben gezeigt, daß es so wunderlos immer auf der Erde zugegangen ist. Dadurch sind sie die Schöpfer einer ganz neuen Weltanschauung, eines ganz neuen Empfindens, einer neuen Lebensführung.
Auf unser ethisches Leben haben sie den weitestgehenden Einfluß. Sie haben uns freigemacht von den Gefühlen, die wir Wesen gegenüber empfinden müßten, die in Wind und Wetter hausen. Wer in dem Gewitter den herannahenden Gott sieht, empfindet anders als derjenige, welcher glaubt, daß Gewitter und Erdbeben ebenso natürlich sind wie die Wirkung, die ein auf den Erdboden fallender Stein ausübt. Wer an die Gedanken Darwins und Lyells glaubt, steht den Naturkräften anders gegenüber als derjenige, welcher an die überirdischen Götter sich hält. Die Götter können ihm nicht mehr helfen, ihm nicht mehr schaden, sie können ihn nicht belohnen und nicht bestrafen. Er ist frei geworden von Furcht und Hoffnung gegenüber unerforschlichen Gewalten. Das Natürliche ist ihm das All, und das Natürliche kann man erforschen. Man kann es auch bezwingen und in den Dienst der menschlichen Ideen stellen. Man kann sich mit Bewußtsein zum Herrn der Erde machen. Die Ehrerbierung schwindet, aber der Stolz nimmt zu. Man will weise herrschen, aber nicht mehr demütig gehorchen und sich undurchdringlichen Ratschlüssen fügen. Die Weltanschauung des Stolzes, des selbstbewußten Menschen haben Darwin und Lyell an die Stelle der Weltanschauung der Demut, der Unterwürfigkeit gesetzt. Zur Befreiung der Menschheit haben sie Unsagbares getan. Sie haben uns gelehrt, keinen Altar dem «unbekannten Gotte» zu errichten, sondern unsere Dienste dem bekannten Geiste der Natur darzubringen. Sie haben den Menschen gelehrt, sich nicht als Zwerg anzusehen, sondem als Held zu wirken. Dem Handeln, dem Wollen haben sie eine freie Bahn geschaffen, weil sie es von dem Schwergewicht befreit haben, das ihm angehängt wird durch den jenseitig wirkenden Willen. Sie haben dem Wissen gezeigt, wo es sein Feld hat, und ihm dadurch erst wirklich die Macht gegeben. Erst seit Lyell und Darwin kann man es als Wahrheit empfinden, daß Wissen Macht ist. Füge dich in das, was dir vorbestimmt ist, mußten sich die Leute vor Lyell und Darwin sagen; tue, wovon du einsiehst, daß es wertvoll ist, können sie sich heute sagen.
Alle Rückfälle in eine alte Weltanschauung werden die geschilderte Entwickelung nicht aufhalten können. Was Ernst Haeckel bei
Gründung der ethischen Gesellschaft in Berlin gesagt hat, daß moderne Sittlichkeit, moderne Religiosität und modernes Handeln auf der Grundlage der modernen Weltanschauung sich aufrichtet: es ist eine unumstößliche Wahrheit. Ich kann nicht von Lyell oder Darwin sprechen, ohne an Haeckel zu denken. Alle drei gehören zusammen. Was Lyell und Darwin begonnen haben, das hat Haeckel weitergeführt. Er hat es ausgebaut in dem vollen Bewußtsein, damit nicht nur dem wissenschaftlichen Bedürfnis, sondern auch dem religiösen Bewußtsein der Menschen zu dienen. Er ist der modernste Geist, weil seiner Weltanschauung nichts von alten Vorurteilen mehr anhaftet, wie das zum Beispiel bei Darwin noch der Fall war. Er ist der modernste Denker, weil er in dem Natürlichen das einzige Gebiet des Denkens sieht, und er ist der modernste Empfinder, weil er das Leben nach Maßgabe des Natürlichen eingerichtet wissen will. Wir wissen, daß er mit uns den Geburtstag Lyells als Festtag begeht, weil er für ihn der Tag sein muß, der den einen Begründer der neuen Weltanschauung gebracht hat. Der Festtag, der Lyell gilt, bringt uns so recht zum Bewußtsein, daß wir zur Haeckelgemeinde gehören. Wenn Haeckel über die Vorgänge der Natur mit uns redet, hat jedes Wort für uns eine Nebenbedeutung, die mit unserem Empfinden verwandt ist. Er sitzt am Steuer; er steuert kräftig. Wenn wir auch an mancher Stelle, an die er uns führt, nicht gerade vorbei wollen; er hat doch die Richtung, die wir einschlagen wollen. Aus Lyells und Darwins Händen hat er das Steuerruder bekommen, sie hätten es keinem Besseren geben können. Er wird es an andere abgeben, die in seiner Richtung führen. Und unsere Gemeinde segelt rasch vorwärts, hinter sich lassend die hilflosen Fährmänner der alten Weltanschauungen.
Dies sind die Vorstellungen, die der 14. November, an dem Lyells Geburtstag zum hundertsten Male wiedergekehrt ist, in mir aufgeregt hat.
HERMAN GRIMM. Zu seinem siebzigsten Geburtstage
Wir empfinden es als Glück, mit gewissen Menschen zu gleicher Zeit lehen zu dürfen Soll ich solche Menschen nennen, so gehört unter die ersten Herman Grimm, der am 6. Januar seinen siebzigsten Geburtstag feiert. Er hat mir Richtungen des geistigen Lebens gezeigt die mir kein anderer hätte zeigen können. Ich bin durch ihn in eine Vorstellungswelt eingeführt worden, in die mich kein anderer hätte einführen können. Ich könnte nur zwei bis drei Schriftsteller der Gegenwart anführen, von denen ich wie von ihm sagen kann: hei den ersten Sätzen jedes seiner Bücher, jedes seiner Essays habe ich ein persönliches Verhältnis zu ihm. Er gehött zu den Schriftstellern, denen ich von Jugend an die größten Sympathien entgegengebracht habe. Wenige achte ich in den Fällen, wo ich ihnen widersprechen muß, so wie ihn. Bei anderen stumpft der Widerspruch, in den wir gegen sie geraten, die Liebe zu ihnen ab. Bei ihm nie. Ich habe das Gefühl, daß alles, was er sagt, aus hohen Regionen kommt und hingenommen werden muß, auch wenn wir glauhen, anderer Meinung sein zu müssen. Ich kann Herman Grimm gegenüher nicht von Irrtum sprechen.
Alles, was Herman Grimm schreibt und spricht, hat den persönlichsten Charakter seines Wesens. Was er durch emsige Gelehrten-arbeit erforscht was er durch die sorgfältigste Beobachtung gewinnt, spricht er wie eine persönliche Ansicht, wie eine subjektive Meinung aus. Er schreibt keinen Satz, hinter dem man nicht seine Persönlichkeit empfindet. Persönliche Erlebnisse spricht er aus, ob er von Goethe, Homer, Raphael, Michelangelo oder von Shakespeare spricht. Die persönlichen Erlebnisse eines tief und vomehm empfindenden Geistes.
Eine vornehme Persönlichkeit in des Wortes edelster Bedeutung steht vor meiner Seele, wenn ich an Herman Grimm denke. Jedes Ding, das er anfaßt, gewinnt in seinen Händen eine eigenartige Bedeutung. Man kann es unter der Idee der Vornehmheit betrachten. Die Größe, die in der Vornehmheit liegt, ist ihm
eigen. Es gibt Dinge, die ihm fremd bleiben, weil sie sich nicht unter dem Gesichtswinkel der Vornehmheit betrachten lassen.
Die strengen Forscher, die auf sogenannte Objektivität halten, ärgern sich über Herman Grimm. Man hat in dieser Richtung sehr abfällige Urteile hören können, als sein Buch über Homer erschienen wat Ich habe für dieses Buch eine ganz besondere Vorliebe. Ein rein menschliches Interesse fesselt mich an das Werk. Andere schreiben über Homer so, wie es die unpersönliche Herman Grimms Werke über Michelangelo und Raphael zeigen uns diese Künstler in einer Beleuchtung, in der wir sie nur durch ihn sehen können. Seine Auffassung wird fortleben in der Entwickelung der Kunstgeschichte.
Nicht auf die Breite der geschichtlichen Entwickelung kommt es Herman Grimm an. Die großen Persönlichkeiten sind ihm das Wesentliche. Daß die abendländische Kultur einen Homer, Sophokles, Michelangelo, Raphael, Dante, Shakespeare, Goethe hervorgebracht hat, macht für ihn den Wert dieser Kultur aus. Was zwischen diesen Geistern liegt, soll nur um ihretwillen betrachtet werden.
Obwohl Herman Grimm uns große historische Perspektiven eröffnet, hat die historische Betrachtungsweise nie sein Gefühl für die unmittelbare Gegenwart verdunkelt. Er lebt in der Gegenwart, wenn auch auf seine Weise. Über jede bedeutendere Frage der Gegenwart hören wir seine Meinung mit dem höchsten Interesse.
Das Bild, das Herman Grimm von Goethe entwirft, ist nicht nach dem Sinne der Goetheforscher. Das kommt davon, daß er jeden Zug, jede Äußerung Goethes mit persönlichem Anteil betrachtet. Ihm ist Goethes Bild eine Sache, die er als eine ganz subjektive ansieht. Die Frage, was ist mir Goethe, leuchtet durch alle seine Ausführungen durch. Er betrachtet Goethe, insofern dieser ein Element ist, das in sein eigenes leben wirksam eingreift. Er sagt von Goethe Dinge, von denen er die Empfindung hat, daß er sie sagen muß, wenn ihm Goethe wert sein soll. Dinge, die Herman
Grimm nicht interessieren, sagt er nicht, auch wenn die Gelehrten von ihnen glauben, daß sie für das Verständnis Goethes bedeutungsvoll sind. Herman Grimms Goethe ist nicht der «objektive» Goethe, aber wir möchten ihn nicht als Bestandteil unseres Geisteslebens entbehren.
Vor wenigen Wochen hat uns Herman Grimm die dritte Auflage eines Novellenbandes geschenkt. Eine tief zum Herzen sprechende Schönheit ist allen novellistischen Werken Grimms eigen. Wer sie liest, empfindet an ihnen in einem charakteristischen Falle, was Kultur ist. Man hat das Gefühl, daß man einer Persönlichkeit gegenübersteht, die ein stilvolles Leben führt.
Der Stil in der Lebensführung scheint mir ein hervorragender Zug in Herman Grimms Persönlichkeit zu sein. Es stimmt alles zu einem Ganzen, was er im einzelnen tut. Nichts fällt aus dem großen Zug heraus, der uns bei ihm auffällt.
Unsere naturwissenschaftliche Art, die Dinge anzusehen, liegt Herman Grimm ferne. Sie ist in vielen Punkten für sein persönliches Empfinden verletzend. Ihm ist die menschliche Natur, wie sie sich gegenwärtig vor unseren Augen darlebt und wie sie sich in den Werken der Phantasie und Vernunft äußert, der liebste Betrachtungsgegenstand. Wie sich diese Natur organisch aus anderen Formen entwickelt hat, interessiert ihn daneben nicht. Über die höchsten philosophischen und religiösen Fragen scheint ihm ein natürliches Empfinden besseren Aufschluß zu geben als die naturwissenschaftliche Anschauungsweise.
Ein Ausfluß dieser seiner Art, die Dinge anzusehen, ist Herman Grimms Stil. Jeder Satz entspringt bei ihm einem persönlichen Impuls. Das Folgern eines Satzes aus dem andern, die Herleitung von Urteilen aus Grundannahmen kennt er nicht. In seinem Fortschreiten von Satz zu Satz gibt es keine Ausgangspunkte und Ergebnisse. Jede Behauptung entspringt aus einem neuen Erlebnis. Dieser Eigenart seines Stiles ist es zuzuschreiben, daß wir beim Lesen seiner Bücher an innerem Lebensgehalt reicher zu werden glauben.
Er gibt uns stets frisches warmes Leben: deshalb bringen wir ihm auch solches entgegen.
DAS SCHÖNE UND DIE KUNST
Ein Buch, das schöne Erinnerungen wachruft, liegt vor mir. Robert Vischer, der Sohn des berühmten Ästhetikers Friedrich Theodor Vischer, hat mit der Veröffentlichung der Werke seines Vaters begonnen. «Das Schöne und die Kunst» nennt er das Buch, das er mit großer Mühe und Sorgfalt aus hinterlassenen Papieren des Verstorbenen und aus den Nachschriften der Schüler zusammengestellt hat.
Während ich das Buch lese, tauchen in mir wieder alle die Vorstellungen auf, die ich mir einst über das Wesen der Künste gemacht habe. Das «einst» bedeutet die Zeit vor achtzehn bis zwanzig Jahren. Leute meines Alters haben sich damals aus den Werken über Asthetik von Vischer, Weiße, Carriére, Schasler, Lotze und Zimmermann Aufklärung über die Natur der Künste geholt.
Diese Männer kamen von der Philosophie her, welche die Bildung der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts beherrscht hat. Auf Hegel stützten sich die einen, auf Herbart die anderen.
Und die Kunst war diesen Männern eine philosophische Angelegenheit.
Goethe, Schiller, Jean Paul haben sich in ihrer Art auch über das Wesen der Kunst Vorstellungen gebildet. Sie gingen dabei von der Kunst selbst aus. Was der Mensch gezwungen ist zu denken, wenn er die Kunst auf sich wirken läßt, sprachen sie aus. Aus der Kunst heraus waren ihre Begriffe über Kunst geboren.
Vischer, Carrié re, Weiße, Zimmermann, Schasler gingen ursprünglich nicht von der unmittelbar lebendigen Natur aus. Sie dachten über die Gesamtheit der Welterscheinungen nach. Und zu diesen Welterscheinungen gehören auch die Erzeugnisse des künstlerischen Schaffens. Wie sie nach dem Wesen des Lichtes, der Wärme, der tierischen Entwickelung fragten, so fragten sie auch nach dem Wesen der Kunst. Ihre Ausgangspunkte waren die von Erkenntnismenschen, nicht die künstlerisch empfindender Naturen.
Ich meine natürlich nicht, daß einem Manne wie Fr. Th. Vischer das künstlerische Empfinden im höchsten und reinsten Sinne des Wortes abzusprechen ist. Jm Gegenteil: sein Verhältnis zur Kunst
ist das denkbar lebendigste und persönlichste. Aber wenn er üher die Kunst spricht, so spricht er als Philosoph.
Eine Verwirklichung des göttlichen Geistes war für Vischer die Welt. Eine Darstellung des göttlichen Geistes in dem Marmor, in Linien und Farben, in Worten ist ihm deswegen die Kunst. Wie verwirklicht der Künstler den göfflichen Geist im sinnlichen Stoffe? Das war für Vischer die Grundfrage. Eine hohe, eine reife philosophische Schulung liegt allen seinen Ausführungen zugrunde. Die Sprache, die er spricht, wird heute nurmehr von wenigen verstanden. Sie konnte nur von denjenigen verstanden werden, welche die philosophischen Gedanken Schellings und Hegels als Bestandteil ihrer Bildung in sich hatten. Nur diese konnten Interesse haben für die Fragen, welche Vischer stellte, für die Gedanken, die er mitteilte.
Heute können nur wenige ein Buch von Vischer so lesen, wie es seine Zeitgenossen lasen. Für die Menschen der Gegenwart werden darinnen Dinge besprochen, die sie nichts angehen.
Für Vischer war die Kunst letzten Endes doch eine unpersönliche Angelegenheit. Sie gehörte zu den Aufgaben, welche dem Menschen von höheren Mächten gestellt werden. Zwar glaubt Vischer nicht an einen persönlichen Gott. Aber er glaubt doch an einen Gott. An ein geistiges Grundwesen, das sich in der Natur, in der Geschichte, in der Kunst auslebt. Dieses Grundwesen steht über dem Menschen. Unsere Besten haben diesen Glauben aufgegeben. Ihnen ist der Geist nichts Selbständiges. Ihnen ist der Geist nur da, insofern die Natur die Fähigkeit hat, Geistiges aus sich hervorzubringen. Der höchste Geist wird für sie durch den Menschen hervorgebracht, der ihn aus seiner Natur gebiert. Nur wenn der Mensch das Geistige schafft, ist es da. Vischer glaubt, das Geistige sei an sich da, und der Mensch müsse es ergreifen. Die Heutigen glauben: nur das Natürliche ist ohne den Menschen da, und das Geistige wird durch den Menschen erst erzeugt. Deshalb ist für Vischer der Künstler ein Mensch, der von dem göttlichen Geiste erfüllt ist und ihn in seinen Werken verkörpert. Für die Heutigen ist der Künstler ein Mensch, der das Bedürfnis hat, den Dingen Gewalt anzutun und ihnen das Gepräge seiner Persönlichkeit
zu geben. Sie glauben nicht, daß sie einen Geist verkörpern sollen, sie wollen Dinge schaffen, wie sie ihren Vorstellungen, ihrer Phantasie entsprechen.
Vischer sagt: der Bildhauer prägt dem Marmor eine menschliche Gestalt ein, die keinem wirklich vorhandenen Menschen gleicht, weil er unbewußt in sich das Bild, die Idee der ganzen Menschheit, das Urbild des Menschen trägt und dieses verkörpern will. Dieses Urbild ist das Göttliche im Menschen. Die Modernen wissen nichts von einem solchen Urbilde. Sie wissen nur, daß ihnen eine Gestalt vor die Seele tritt, wenn sie den Menschen betrachten, und daß sie diese Gestalt verwirklichen wollen. Sie wollen neben der natürlichen Welt eine künstliche gebären, die ihnen ihr Temperament, ihre Phantasie eingibt. Eine menschlich gewollte Welt ist das, keine aus dem göttlichen Geist entsprungene.
Die Heutigen verstehen es nicht mehr, wenn man von der Kunst wie von einer Verwirklichung des Göttlichen spricht, sie können nur begreifen, daß der Mensch das Bedürfnis hat, Dinge nach seinem Temperament, nach seiner Eingebung zu gestalten.
Menschlich wollen die Modernen über die Kunst sprechen; auf den religiösen Zug, der Vischers Ausführungen zugrunde liegt, wollen sie nicht mehr eingehen.
GRAF LEO TOLSTOI • WAS IST KUNST?
Graf Leo Tolstoi hat eine Schrift veröffentlicht. Der russische Romancier hat sich, seit er unter die Moralprediger gegangen ist, die Sympathien eines großen Teiles seiner ehemaligen Verehrer zerstört. Der Jnhalt seiner Morallehre steht durchaus nicht auf der Höhe seines Künstlertums. Eine Gefühlsmoral, die sich auf allgemeine Menschenliebe und Mitleid stützt und die auf Bekämpfung des Egoismus abzielt, ist dieser Inhalt. Verwässertes Christentum ist der beste Ausdruck, den man dafür finden kann. Vom Standpunkte dieser Morallehre beantwortet Tolstoi auch die
Frage, die er sich jetzt stellt: «Was ist Kunst?» Zunächst weist er darauf hin, welch ungeheure menschliche Arheitskraft dazu aufgewendet werden muß, usn ein Werk der Kunst zustande zu bringen. Er geht von einer Opernprobe aus, bei der er einmal anwesend war. Er schildert, welche Zeit und Mühe eine solche Probe kostet und wie lieblos die Leiter derselben das Personal behandeln, mit dem sie es zu tun hahen. Und dann sagt er sich: was kommt bei all der Mühe und Arbeit heraus? «Für wen geschieht denn das alles? Wem kann es gefallen? Wenn auch dann und wann in dieser Oper schöne Motive vorkommen, die angenehm zu hören sind, so könnte man sie doch einfach absingen, ohne diese dusamen Verkleidungen, Aufzüge, Rezitative und Armschwingungen. Ein Ballett aber, in dem halbnackte Frauen sinnlich aufregende Bewegungen vorführen und sich in Girlanden verwickeln, ist nichts weiter als eine moralverderbende Vorstellung, so daß man nicht einmal begreifen kann, für wen sie berechnet ist. Ein gebildeter Mensch hat die Sachen satt bekommen, und ein gewöhnlicher Arbeiter versteht sie einfach nicht. Sie kann nur - was ich auch noch bezweifeln möchte - denen gefallen, die von sogenannten herrschaftlichen Vergnügungen noch nicht übersättigt sind, aber sich herrschaftliche Bedürfnisse angeeignet haben und ihre Bildung zeigen wollen wie etwa junge Lakaien ... Und diese ganze häßliche Duminheit wird nicht gutmütig, nicht einfach heiter, sondern mit Bosheit, mit tierischer Grausamkeit einstudiert.»
Man muß, weil die Kunst solche Opfer fordert, sich fragen: Was ist der Zweck der Kunst? Was trägt die Kunst zum Ganzen der menschlichen Kulturentwickelung hei? Um sich diese Frage zu beantworten, hält Tolstoi Umschau bei den deutschen, französischen und englischen Asthetikern, die über die Aufgaben der Kunst ihre Anschauungen veröffentlicht haben. Er kommt zu einem ungünstigen Urteil über diese Ästhetiker. Er findet, daß keine Übereinstimmung herrscht über den Begriff der Kunst. «Sieht man» - sagt er - «von den ganz ungenauen und den Begriff der Kunst nicht deckenden Definitionen der Schönheit ab, welche deren Wesen bald im Nutzen, bald in der Zweckmäßigkeit, bald in der Symmetrie, bald in der Ordnung, bald in der Proportionalität,
bald in der Glätte, bald in der Harmonie der Teile, bald in der Einheit, bald in der Mannigfaltigkeit, bald in den verschiedenen Verbindungen dieser Prinzipien finden, sieht man von diesen ungenügenden Versuchen objektiver Definitionen ab, - so können alle ästhetischen Bestimmungen der Schönheit auf zwei Grundansichten zurückgeführt werden: die erste, daß die Schönheit etwas für sich Bestehendes ist, eine der Erscheinungen des absolut Vollkommenen, der Idee, des Geistes, des Willens, von Gott, - und die zweite, daß die Schönheit ein gewisses von uns empfundenes Vergnügen ist, welches persönliche Vorteile nicht zum Zwecke hat.»
Tolstoi findet beide Ansichten unvollkommen, und er sieht den Grund der Unvollkommenheit darin, daß sie auf einer primitiven Ansicht von der menschlichen Kultur beruhen. Auf einer primitiven Stufe der Anschauungen sehen die Menschen auch den Zweck des Essens in dem Genusse, den ihnen das Essen bereitet. Eine höhere Stufe der Einsicht ist die, wenn sie erkennen, daß die Ernährung und damit die Förderung des Lebens der Zweck des Essens ist, und wenn sie den Genuß nur als eine untergeordnete Beigabe betrachten. In gleicher Weise steht der Mensch auf einer niedrigen Stufe, welcher glaubt, daß der Zweck der Kunst in dem Genusse der Schönheit bestehe. «Um die Kunst genau zu definieren, muß man vor allen Dingen aufhören, sie als Mittel zum Genuß zu betrachten, dagegen muß man in der Kunst eine der Bedingungen des menschlichen Lebens sehen. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, müssen wir zugeben, daß die Kunst eines der Mittel zum Verkehr der Menschen untereinander ist.» Nicht als Selbstzweck läßt Tolstoi die Kunst gelten. Die Menschen sollen einander verstehen, liehen und fördern; das ist ihm der Zweck jeder Kultur. Die Kunst soll nur ein Mittel sein, diesen höheren Zweck zu verwirklichen. Durch die Worte teilen sich die Menschen ihre Gedanken und ihre Erfahrungen mit. Der Einzelne lebt durch die Sprache in und mit dem Ganzen des Menschengeschlechtes. Was Worte allein nicht vermögen, um dieses Zusammenleben hervorzubringen, das soll die Kunst bewirken. Sie soll die Empfindungen und Gefühle von Mensch zu Mensch vermitteln, wie
es die Worte mit den Erfahrungen und Gedanken machen. «Die Tätigkeit der Kunst beruht darauf, daß der Mensch, indem er durch das Ohr oder das Auge den Ausdruck der Gefühle eines anderen wahrnimmt, diese Gefühle nachzuempfinden vermag.»
Ich glaube, daß von Tolstoi übersehen wird, welchen Ursprung die Kunst hat. Nicht auf die Mitteilung kommt es dem Künstler zunächst an. Wenn ich eine Erscheinung der Natur oder des Menschenlebens sehe, so treibt mich ein ursprünglicher Trieb dazu, mir im Geiste ein Bild von dieser Erscheinung zu machen. Und meine Phantasie drängt mich dazu, dieses Bild in einer Weise um- und auszugestalten, die gewissen Neigungen in mir entspricht. Zur Ausgestaltung dieses Bildes bediene ich mich der Mittel, die meinen Fähigkeiten entsprechen. Wenn diese Mittel die Farben sind, so male ich, und wenn es die Vorstellungen sind, so dichte ich. Ich tue das nicht, um mich mitzuteilen, sondern weil ich das Bedürfnis habe, mir von der Welt Bilder zu machen, die meine Phantasie mir eingibt. Ich bin nicht zufrieden mit der Gestalt, welche die Natur und das Menschenleben für mich haben, wenn ich sie bloß als passiver Zuschauer betrachte. Ich will Bilder machen, die ich selbst erfinde oder die ich doch - wenn ich sie auch von außen aufnehme in meiner Weise wiedergebe. Der Mensch will nicht bloßer Betrachter, er will nicht reiner Zuschauer den Weltereignissen gegenüber sein. Er will auch aus Eigenem etwas zu dem hinzu erschaffen, das von außen auf ihn eindringt. Deshalb wird er Künstler. Wie dies Geschaffene dann weiter wirkt, ist eine Folgeerscheinung. Und wenn von der Wirkung der Kunst auf die menschliche Kultur gesprochen werden soll, so mag Tolstoi Recht haben. Aber die Berechtigung der Kunst als solche muß, unabhängig von ihrer Wirkung, in einem ursprünglichen Bedürfnisse der menschlichen Natur gesucht werden.
ÜBER WAHRHEIT UND WAHRSCHEINLICHKEIT DER KUNSTWERKE
Über dieses Thema gibt es einen interessanten Aufsatz Goethes in Gesprächform. In demselben wird die Frage: in erschöpfender Weise behandelt. Was da gesagt wird, wiegt Bände auf, die in neuerer Zeit über diesen Gegenstand geschrieben worden sind. Da gegenwärtig ein ebenso lebhaftes Interesse wie eine große Ver-wirrung über die Frage herrschen, dürfte es wohl hier am Platze sein, an die Hauptgedanken des Goetheschen Gespräches zu erinnern.
Es nimmt seinen Ausgang von der Darstellung des «Theaters im Theater». «Auf einem deutschen Theater ward ein ovales, gewissermaßen aruphitheatralisches Gebäude vorgestellt, in dessen Logen viele Zuschauer gemalt sind, als wenn sie an dem, was unten vorgeht, teilnähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden und wollten übelnehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit fiel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier aufgezeichnet wird.»
Das Gespräch findet statt zwischen einem Anwalt des Künstlers, der mit den gemalten Zuschauern seine Aufgabe gelöst zu haben glaubt, und einem Zuschauer, dem solche gemalte Zuschauer nicht genügen, weil er Naturwahrheit verlangt. Dieser Zuschauer will, daß ihm «wenigstens alles wahr und wirklich scheinen solle». «Warum gäbe sich denn der Dekorateur die Mühe, alle Linien aufs genaueste nach den Regeln der Perspektive zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollkommensten Haltung zu malen? Warum studierte man aufs Kostüm? Warum ließe man es sich so viel kosten, ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versetzen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empfindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Gebärden der Wahrheit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?»
Der Anwalt des Künstlers macht nunmehr den Zuschauer darauf aufmerksam, inwiefern ihn das alles nicht berechtige zu sagen, er müsse im Theater die Menschen und Vorgänge nicht so vor sich haben, daß sie ihm wahr scheinen; er müsse vielmehr behaupten, daß er in keinem Augenblicke die Empfindung habe, Wahrheit zu sehen, sondern einen Schein, allerdings einen Schein des Wahren.
Zunächst glaubt nun der Zuschauer, daß der Anwalt ihm ein Wortspiel vorführe. Fein läßt hierauf Goethe den Anwalt antworten: «Und ich darf ihnen darauf versetzen, daß, wenn wir von Wirkungen unseres Geistes reden, keine Worte zart und subtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürfnis des Geistes anzeigen, der, da wir das, was in uns vorgeht, nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensätze zu operieren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten und so gleichsam die Sache in die Mitte zu fassen sucht.
Menschen, die nur gewohnt sind, in den grobklotzigen Vorstellungen zu leben, die das Alltagsieben erzeugt, sehen oft unnötige Wortklauberei in den zarten, begrifflichen Unterscheidungen, die derjenige machen muß, der die feinen, unendlich komplizierten Verhältnisse der Wirklichkeit begreifen will. Zwar ist es richtig, daß sich mit Worten trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten lasse, aber nicht immer ist derjenige schuld, der das System bereitet, daß kein Begriff bei dem Worte ist. Oft kann auch derjenige, der die Worte hört, den Begriff nur nicht mit dem gehörten Worte verbinden. Es wirkt oft komisch, wenn die Leute sich darüber beklagen, dal3 sie bei den Worten dieses oder jenes Philosophen sich nichts denken können. Sie glauben immer, es läge an dem Philosophen - oft liegt es aber an den Lesern, die nur nichts denken können, während der Philosoph sehr viel gedacht hat.
Es ist ein großer Unterschied zwischen «wahr scheinen> und haben. Die theatralische Darstellung ist selbstverständlich Schein. Man kann nun der Ansicht sein, daß der Schein eine solche Gestalt haben müsse, daß er die Wirklichkeit vortäusche. Oder man kann der Überzeugung sein, daß der Schein aufrichtig zeigen solle: ich bin keine Wirklichkeit; ich bin Schein. Wenn der Schein diese Aufrichtigkeit hat, dann kann er seine
Gesetze nicht aus der Wirklichkeit nehmen, dann muß er eigene Gesetze für sich haben, die nicht die gleichen mit denen der Wirklichkeit sind. Wer einen künstlerischen Schein will, der die Wirklichkeit nachäfft, der wird sagen: in einer theatralischen Darstellung muß alles so verlaufen, wie es in der Wirklichkeit verlaufen wäre, wenn derselbe Vorgang sich zugetragen hätte. Wer einen künstlerischen Schein will, der sich aufrichtig als Schein gibt, der wird hingegen sagen: in einer theatralischen Darstellung muß manches anders verlaufen, als es in der Wirklichkeit zu verlaufen pflegt; die Gesetze, nach denen die dramatischen Vorgänge zusaannenhängen, sind andere als diejenigen, nach denen die wirklichen zusammenhängen.
Wer einer solchen Überzeugung ist, muß also zugeben, daß es in der Kunst Gesetze für den Zusammenhang von Tatsachen gibt, für die ein entsprechendes Vorbild in der Natur nicht vorhanden ist Solche Gesetze vermittelt die Phantasie. Sie schafft nicht der Natur nach, sie schafft neben der Naturwahrheit eine höhere Kunstwahrheit.
Diese Überzeugung läßt Goethe den «Anwalt des Künstlers» aussprechen. Dieser behauptet, «daß das Kunstwahre und das Naturwahre völlig verschieden sei, und daß der Künstler keineswegs streben sollte noch dürfte, daß sein Werk eigentlich als ein Naturwerk erscheine».
Naturwahrheit werden nur diejenigen Künstler in ihren Werken liefern wollen, denen die Phantasie fehlt, die deshalb kein Kunstwahres erschaffen können, sondern die bei der Natur eine Anleihe machen müssen, wenn sie überhaupt etwas zustande bringen wollen. Und nur diejenigen Zuschauer werden Naturwahrheit in den Kunstwerken verlangen, die nicht ästhetische Kultur genug haben, um sich zu der Forderung eines besonderen Kunstwahren neben dem Naturwahren zu erheben. Sie kennen nur das Wahre, das sie täglich erleben. Und wenn sie der Kunst gegenüberstehen, dann fragen sie: stimmt dieses Künstliche mit dem überein, was wir als Wirklichkeit kennen? Der Mensch mit ästhetischer Kultur kennt ein anderes Wahres als dasjenige der gemeinen Wirklichkeit. Er sucht dieses andere Wahre in der Kunst.
Goethe läßt seinen «Anwalt des Künstlers» den Unterschied zwischen einem Menschen mit ästhetischer Kultur und einem solchen ohne diese durch ein sehr derbes, aber vortreffliches Beispiel erläutern. «Ein großer Naturforscher besaß unter seinen Haustieren einen Affen, den er einst vermißte und nach langem Suchen in der Bibliothek fand. Dort saß das Tier an der Erde und hatte die Kupfer eines ungebundenen, naturgeschichtlichen Werkes am sich her zerstreut. Erstaunt über dieses eifrige Studium des Hausfreundes, nahte sich der Herr und sah zu seiner Verwunderung und zu seinem Verdruß, daß der genäschige Affe die sämtlichen Käfer, die er hie und da abgebildet gefunden, herausgespeist habe.»
Der Affe kennt nur naturwirkliche Käfer, und die Art, wie er sich im gemeinen Leben zu solchen naturwirklichen Käfern verhält, ist die, daß er sie verspeist. Auf den Abbildungen tritt ihm nicht Wirklichkeit, sondern nur Schein entgegen. Er nimmt den Schein nicht als Schein. Denn zu einem Scheine könnte er kein Verhältnis gewinnen. Er nimmt den Schein als Wirklichkeit und verhält sich zu ihm wie zu einer Wirklichkeit.
In dem Falle dieses Affen sind diejenigen Menschen, die einen künstlerischen Schein so wie eine Wirklichkeit nehmen. Wenn sie eine Raubszene oder eine Liebesszene auf der Bühne sehen, dann wollen sie von dieser Raub- oder Liebesszene genau dasselbe haben wie von entsprechenden Szenen in der Wirklichkeit.
Der «Zuschauer» in Goethes Gespräch wird durch das Beispiel vom Affen zu einer reineren Anschauung vom künstlerischen Genusse gebracht und sagt: «Sollte der ungebildete Liebhaber nicht eben deswegen verlangen, daß ein Kunstwerk natürlich sei, um es nur auch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können?» - Das Kunstwerk will auf eine höhere Art genossen sein als das Naturwerk. Und wer diese höhere Art des Genusses nicht durch ästhetische Kultur in sich gepflanzt hat, der gleicht dem Affen, der die gemalten Käfer frißt, statt sie zu betrachten und sich durch ihre Betrachtung naturwissenschaftliche Kenntnisse zu erwerben. Der «Anwalt» bringt das in die Worte: «Ein vollkommenes Kunstwerk ist ein Werk des menschlichen
Geistes, und in diesern Sinne auch ein Werk der Natur. Aber in-dem die zerstreuten Gegenstände in eins gefaßt und selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Würde aufgenommen werden so ist es über die Natur. Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ist, aufgefaßt sein, und dieser findet das Vortreffliche, das in sich Vollendete auch seiner Natur gemäß. Davon hat der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein Kunstwerk wie einen Gegenstand, den er auf dem Markte antrifft: aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Vorzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Zusammenstellung, das Überirdische der kleinen Kunst-welt; er fühlt, daß er sich zum Künstler erheben müsse, um das Werk zu genießen, er fühlt, daß er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerke wohnen, es wiederholt anschauen und sich selbst dadurch eine höhere Existenz geben müsse.»
Die Kunst, welche bloße Naturwahrheit anstrebt, äffische Nachahmung der gemeinen alltäglichen Wirklichkeit, ist in dem Augenblicke widerlegt, in dem man in sich die Möglichkeit fühlt, sich die oben geforderte «höhere Existenz» zu geben. Diese Möglichkeit kann im Grunde nur jeder bei sich selbst fühlen. Deshalb wird es eine allgemeine, überzeugende Widerlegung des Naturalismus nicht geben können. Wer nur die gemeine, alltägliche Wirklichkeit kennt, wird immer Naturalist bleiben. Wer in sich die Fähigkeit entdeckt, über das Naturwesen hinaus ein besonderes Kunstwesen zu schauen, wird den Naturalismus als die ästhetische Weltanschauung künstlerisch bornierter Menschen empfinden.
Wenn man dieses eingesehen hat, wird man nicht mit logischen oder anderen Waffen gegen den Naturalismus kämpfen. Denn ein solcher Kampf käme dem gleich, wenn man dem Affen nachweisen wollte, daß gemalte Käfer nicht zum Fressen, sondern zum Betrachten gehören. Wenn man schon soweit kommen würde, dem Affen begreiflich zu machen, daß er gemalte Käfer nicht fressen soll: eines würde er doch nie einsehen, närnlich wozu gemalte Käfer sind, da man sie doch nicht fressen darf. Ebenso geht es mit dem ästherisch Ungebildeten. Er wird vielleicht bis zu der
Einsicht zu bringen sein, daß ein Kunstwerk nicht so zu behandeln ist wie ein Gegenstand, den man auf dem Markte antrifft. Aber da er doch nur ein solches Verhältnis versteht, wie er zu den Gegenständen des Marktes gewinnen kann, so wird er nicht einsehen, wozu denn Kunstwerke dann eigentlich da sind.
Dies ist ungefähr der Inhalt des erwähnten Goetheschen Gespräches. Man sieht, daß in demselben in einer vornehmen Weise Fragen behandelt werden, die heute von vielen einer erneuten Prüfung unterzogen werden. Die Prüfung dieser sowie vieler anderer Dinge wäre nicht notwendig, wenn man sich die Mühe nehmen wollte, sich in die Gedanken derer zu vertiefen, die im Zusammenhange mit einer einzig hohen Kultur an diese Sachen herangetreten sind.
NEUJAHRSBETRACHTUNG EINES KETZERS
Die letzten Jahre haben uns eine stattliche Zahl von Betrachtungen über die Kulturerrungenschaften des ablaufenden Jahrhunderts gebracht. Und in den zwei Jahren, die wir in diesem Säkulum noch zu durchleben haben, werden sich diese Betrachtungen wohl ins Unübersehbare anhäufen. Geister, die gerne das Selbstverständliche immer von neuem hetonen, mögen den Einwand geltend machen, daß der Ablauf eines Jahrhunderts ein rein zufälliger Einschnitt in dem Entwickelungsgange der Menschheit ist und daß bei einer andern Zeitrechnung dieser Einschnitt mit einer ganz anderen Phase dieser Entwickelung zusammenfallen könnte. Gegenüber der suggestiven Wirkung, die davon ausgeht, daß das Jahrhundert zahlenmäßig als Ganzheit erscheint, kann ein solcher Einwand nicht aufkommen.
Neben diesem allgemeinen gibt es für die gegenwärtige Jahrhundertwende noch einen besonderen Grund, auf die Errungenschaften
unserer Kultur und die Richtungen, die sie augenblicklicb einschlägt, einen orientierenden Blick zu werfen.
Das nächste, was bei einer solchen Betrachtung auffällt, ist der ungeheure Reichtum an neuen Bedingungen zur Beherrschung der Naturkräfte und der damit verbundene Fortschritt der praktischen Lebensgestaltung. Von der Eisenbahn und Dampfschiffahrt bis zum Telephon müßte man die Reihe der Erfindungen mit ihren ungeheuren Wirkungen Revue passieren lassen, wenn man diesen Gedanken allseitig beleben sollte.
Und nicht anders steht es mit den neuen Bedingungen, die geschaffen worden sind, um unsere Kenntnisse von der Welt zu erweitern. Welche Einblicke über die Natur gewähren die Spektralanalyse, die Entdeckung Röntgens, die Studien über das Alter des Menschengeschlechtes, die organische Entwickelungstheorie und anderes, auf dessen Anführung ich hier naturgemäß verzichte, da es mir nur darauf ankommt, auf diese Dinge hinzudeuten.
Trotz aller dieser und manch anderer Errungenschaften, zum Beispiel auf dem Gebiete der Kunst, kann aber der tiefer blickende Mensch gegenwärtig doch nicht recht froh über den Bildungsinhalt der Zeit werden. Unsere höchsten geistigen Bedürfnisse verlangen nach etwas, was die Zeit nur in spärlichem Maße gibt.
Im Sinne Goethes kann man von der Bildung sagen, daß sie durch die reinste Kultur zur höchsten Glückseligkeit führen müsse. Unsere Bildung führt zu dieser Glückseligkeit nicht. - Sie läßt die feinsten Geister im Stich, wenn diese die Befriedigung der intirnsten Bedürfnisse ihres Gemütes suchen. In dieser Beziehung bietet der Ausgang des Jahrhunderts einen andern Anblick als dessen Beginn. Man vergegenwärtige sich, wie vor hundert Jahren Fichte die Geister entzündete, als er die Gesamtheit der Zeitbildung mit den innersten Bedürfnissen des menschlichen Geistes in Einklang zu bringen suchte. In der gleichen Richtung haben Schelling und Hegel das Wissen von den äußeren Dingen vertieft. Und wie wurden die Stimmen dieser Geister gehört!
Um die Mitte des Jahrhunderts tritt ein völliger Wandel ein. Die so zahllos auf den Menschen einstürmenden Erkenntnisse von den äußeren Dingen scheinen die Fähigkeit vollständig in den
Hintergrund zu drängen, Einblick zu halten in die eigene Seele und eine Harmonie zu suchen zwischen Außenwelt und Innenwelt.
Einen geradezu paradoxen Ausdruck erhält diese Wandlung durch die geringe Achtung, deren sich die Philosophie und ihre Träger in der Gegenwart erfreuen. Wie nimmt sich gegenüber dieser Geringschätzung Nietzsches Ansicht aus, daß das Griechenvolk deshalb so hoch stehe, weil es nicht wie andere Völker Propheten, sondern seine sieben Weisen als Menschenideale hinstellt?
Man darf sich nicht wundern, wenn gegenüber solchen Erscheinungen Geister mit tieferen geistigen Bedürfnissen die stolzen Gedankengebäude der Scholastik befriedigender finden als den Ideengehalt unserer eigenen Zeit. Otto Willmann hat ein hervor-ragendes Buch geschrieben, seine «Geschichte des Idealismus» (Braunschweig 1894-97), in dem er sich zum Lobredner der Welt-anschauung vergangener Jahrhunderte aufwirft. Man muß zugeben: der Geist des Menschen sehnt sich nach jener stolzen, umfassenden Gedankendurchleuchtung, welche das menschliche Wissen in den philosophischen Systemen der Scholastiker erfahren hat. Und dieser Geist wird irurner unbefriedigt sein von Geständnissen, wie der große Physiker Hermann Helmholtz in seiner Weimarischen Götterrede vor einigen Jahren eines abgelegt hat. Er sagte: gegen über dem Reichtum unseres gegenwärtigen Wissens ist es kaum möglich, daß ein umfassender Geist auftrete, der die Gesamtheit dieses Wissens mit einem einheitlichen Ideenkreis umspannt.
Dem Drang der menschlichen Seele nach Eingliederung alles Wissens in eine Gesamtanschauung, aus der die höchsten geistigen Bedürfnisse befriedigt werden können, steht in unserer Zeit die Mutlosigkeit unseres Denkens gegenüber, welche es nicht dazu kommen läßt, eine solche Gesamtanschauung zu gewinnen.
Diese Mutlosigkeit ist ein charakteristisches Merkmal des geistigen Lebens an der Jahrhundertwende. Sie trübt uns die Freude an den Errungenschaften der jüngstvergangenen Zeiten.
Wo immer jemand auftritt, der ein Gesamtbild unseres Wissens zu entwerfen sucht, da tönen unzählige von dieser Mutlosigkeit
zeugende Stimmen, welche die Unmöglichkeit eines solchen Gesamtbildes betonen, welche behaupten, daß unser Wissen zu einem solchen Abschlusse noch lange nicht reif sei. Auch solche Stimmen sind hörbar, die die Unmöglichkeit eines solchen Abschlusses verteidigen. Der menschliche Geist hätte gerade durch die Erfolge der Wissenschaften gesehen, wie unfähig er sei, über diejenigen Dinge etwas zu erkennen, die ehedem von den Philosophen zu Gegenständen des Nachdenkens gemacht worden sind.
Ginge es nach der Meinung der Leute, die solche Stimmen vernehmen lassen, so würde man sich begnügen, die Dinge und Erscheinungen zu messen, zu wägen, zu vergleichen, sie mit den vorhandenen Apparaten zu untersuchen: niemals aber würde die Frage erhoben nach dem höheren Sinn der Dinge und Erscheinungen.
Der unerschütterliche Glaube, daß das Denken dazu berufen ist, die Welträtsel zu lösen, ist uns verlorengegangen. Nur bei wenigen Forschern, wie zum Beispiel bei Ernst Haeckel, ist die Neigung vorhanden, das vorhandene Wissen so zu durchdringen, daß sich ein solcher Sinn ergibt. - Es kommt nicht darauf an, ob man mit den Gedanken übereinstimmt, die Haeckel in seiner Schrift Tatsache aber ist, daß Gedanken dieser Art heute gegenüber der allgemeinen Mutlosigkeit, ja Feigheit des menschlichen Denkens wenig Wirkung haben.
Es ist daher gar nicht zu verwundern, wenn überall die Reaktion auf geistigem Gebiet ihr Haupt erhebt. Solange die naturwissenschaftlich gebildeten Denker zu mutlos sind, um vom Standpunkte ihrer Erkenntnis aus einen Ersatz für die veralteten religiösen Vorstellungen zu bieten, werden Menschen, die das Bedürfnis nach einer Weltanschauung haben, zurückgreifen auf die überlieferten
Vorstellungen; und die wenigen, die im Sinne einer modernen Weltauffassung sich ihr Leben einrichten, werden Sänger bleiben ohne Publikum. Ich möchte damit die Gründe erklärt haben, welche bewirken, daß die vorgeschrittensten Geister der Gegenwart so wenig verstanden werden.
LUDWIG BÜCHNER. Gestorben am 30. April 1899
Wenn heute die Rede auf Ludwig Büchner kommt, wird man nur selten einem anderen Urteile als dem begegnen, daß sein «populäres Gerede> längst abgetan ist und daß er «in seiner Oberflächlichkeit allen Halbwissern und Dilettanten naturwissenschaftlich interessante Tatsachen und eine darnit vermischte, kindlich rohe Metaphysik in leichtfaßlicher Form darbot». So charakterisiert zum Beispiel ein gegenwärtig viel genannter Philosoph, Theobald Ziegler, in seinem jüngst erschienenen Buche «Die geistigen und sozialen Strömungen des neunzehnten Jahrhunderts> den eben verstorbenen Denker. Es ist eine bunte Gesellschaft, deren Mitglieder in diesem Urteil einig sind. Philosophen, die noch immer höhere Erkenntnisquellen zu haben meinen als die an der «rohen Wirklichkeit haftende Naturwissenschaft», gesellen sich zu kleinmütigen Naturforschern, die es nicht wagen, aus den von ihnen beobachteten Tatsachen konsequente Schlüsse auf die Stellung des Menschen und seines Geistes innerhalb der Natur zu ziehen. Katholisches, protestantisches und anderes Pfaffentum greift mit wahrer Lüsteraheit die absprechenden Urteile solcher rückständigen Philosophen und Naturforscher auf, weil die im eigenen theologischen Arsenal aufgespeicherten Waffen allmählich doch zu stumpf geworden sind. Mystisch veranlagte Naturen finden sich in ihren heiligsten Gefühlen verletzt durch den «plumpen» Freidenker, welcher das menschliche Seelenleben auf stoffliche Grundlagen zurückführen will.
Die meisten dieser absprechenden Urteile über Ludwig Büchner entspringen aus Geistern, die dessen Schriften in einem viel oberflächlicheren Sinne auffassen, als sie gemeint sind, und die über nichts deshalb zu reden wissen als über den flachen und seichten Materialismus, den sie selbst aus ihnen herauszulesen verstehen. Der Mann, der die Kühnheit und Schärfe des Denkens hat, um aus den naturwissenschaftlichen Errungenschaften des Jahrhunderts die notwendigen Schlüsse zu ziehen, Ernst Haeckel, spricht immer nur mit voller Anerkennung von dem Verfasser von «Kraft und Stoff» als von einem Denker, der unter den Vorläufern Darwins einen Ehrenplatz einnimmt.
Es soll nicht geleugnet werden, daß Ludwig Büchner ein einseitiger Denker ist und daß man auch bei voller Zustimmung zu den Erkenntnissen der Naturwissenschaft zu tieferen Vorstellungen kommen kann, als es seiner auf grobe Linien veranlagten Ideenrichtung möglich war. Aber es muß zugleich betont werden, daß diese Ideenrichtung mit den Empfindungen, die sie im Gefolge hat, unserem modernen Seelenleben unendlich viel näher steht als die philosophischen Gedankengebäude, die mit ihren höheren Erkenntnisquellen die überlebten Vorstellungen früherer Zeiten künstlich retten wollen. Es ist eine durchaus moderne, wenn auch vielleicht einer Vertiefung fähige Behauptung, daß der Mensch aus Licht und Asche gezeugt ist, daß die Tätigkeit derselben Naturkräfte ihn ins Leben ruft, der auch die Pflanze ihr Dasein verdankt. Und aller Tiefsinn, der von Philosophen und Theologen aufgebracht wird, um zu beweisen, daß der Geist ein Höheres, Ursprünglicheres sei als die stoffliche Welt, liegt unserem Empfinden ferner als solch eine Behauptung.
Es wird immer viel zu wenig darauf hingewiesen, woher eigentlich das Gefasel über den «rohen Materialismus» stammt. Es hat seinen Grund gar nicht in der Vernunft, sondern in der Empfindungs- und Gefühlswelt. Eine jahrtausendalte Erziehung des Menschengeschlechtes, zu der das Christentum ein Ungeheures beigetragen hat, war imstande, uns die Empfindung einzupflanzen, daß der Geist etwas Hohes, die Materie etwas Gemeines, Rohes sei. Und wie soll das Hohe aus dem Gemeinen stammen? Die
Vernunft wird sich vergeblich bemühen, in dem wundervollen Bau der materiellen Natur etwas Niedrigeres zu sehen als in den Vorstellungen, die Philosophen und Theologen sich von den hohen geistigen Wesenheiten machen. Sie wird es nimmermehr begreifen, warum der großartige Bau des Gehirns etwas Rohes sein soll gegenüber dem Himmel mit seinen ätherischen Engeln und Heiligen oder gegenüber dem «Willen» Schopenhauers oder dem «Unbewußten» Eduard von Hattmanns. Nur wer befangen ist in den Empfindungen, die aus der völligen Verkennung des materiellen Daseins entspringen, kann sich auflehnen gegen Sätze wie den, welchen vor kurzem Ernst Haeckel in seiner Schrift «Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung des Menschen» ausgesprochen hat: «Die physiologischen Funktionen des Organismus, welche wir unter dem Begriff der Seelentätigkeit - oder kurz der ‹Seele› - zusammenfassen, werden beim Menschen durch dieselben mechanischen (physikalischen und chemischen) Prozesse vermittelt wie bei den übrigen Wirbeltieren. Auch die Organe dieser psychischen Funktionen sind hier und dort dieselben: das Gehirn und das Rückenmark als Zentralorgane, die peripheren Nerven und die Sinnesorgane. Wie diese Seelenorgane sich beim Menschen langsam und stufenweise aus den niederen Zuständen ihrer Wirbeltier-ahnen entwickelt haben, so gilt dasselbe natürlich auch von ihren Funktionen, von der Seele selbst. - Diese naturgemäße... Auffassung der Menschenseele steht im Widerspruche zu den dualistischen und mythologischen Vorstellungen, welche der Mensch seit Jahrtausenden sich von einem besonderen, übernatürlichen Wesen seiner gebildet hat und welche in dem seltsarnen Dogma von der gipfelt. Wie dieses Dogma den größten Einfluß auf die ganze Weltanschauung des Menschen gewonnen hat, so wird es selbst heute noch von den meisten Menschen als unentbehrliche Grundlage ihres ethischen Wesens hoch-gehalten. Der Gegensatz, in welchem dasselbe zu der natürlichen Menschenentwicklungslehre steht, wird zugleich noch in den weitesten Kreisen als der gewichtigste Grund gegen deren Annahme betrachtet oder selbst als Widerlegung der narürlichen Schöpfungsgeschichte überhaupt.» (S. 42 f.)
Man braucht nur die anerzogenen Vorurteile gegen das Natürliche, sein Werden und Sein, abzulegen, und man wird in diesem Natürlichen etwas finden, das in weit höherem Maße jene Gefühle und Empfindungen verdient als die sogenannte übernatürliche Welt, an die die Menschen diese Gefühle so lange Zeit gehängt haben. Die Errungenschaften der Naturwissenschaften werden nur dann eine ihrer würdige Welt- und Lebensauffassung erzeugen, wenn das Empfindungsleben sie nach ihrem eigenen, nicht nach einem aus einer mythologischen Erziehung ihnen beigelegten Wert zu beurteilen vermag.
Bei Denkern wie Büchner kommt es nicht darauf an, daß sich in ihren Schlußfolgerungen Widersprüche nachweisen lassen, sondern darauf, daß sie ihrem Gefühlsleben nach den natürlichen Vorgängen diesen ihnen eigenen Wert beizulegen wissen. Wer schärfer zu denken vermag, wird diese Widersprüche vermeiden, aber er wird sich deshalb doch mit Büchner einig wissen in der Anschauung über die Natur und die Stellung des Menschen innerhalb derselben. Die feinsten Ideen moderner Philosophen, die die Welt aus einem besonderen Geisrwesen herleiten, erscheinen antediluvianisch gegenüber den groben und derben Gedankengängen dieses Materialisten. Ein Philosoph, der heute noch von einem «unbewußten Geiste», von einem «Willen in der Natur» spricht, und ein kindlich Gläubiger, der die Meinung hat, daß seine Seele nach dem Tode in ein göttliches Himmelreich wandert, gehören zusammen. Ein Materialist, der sagt, die Gedanken sind Erzeugnisse von Kraft und Stoff, und ein Denker, der auf vernünftige Weise diesen Gedanken vertieft und zu einer Herz und Kopf befriedigenden Weltanschauung ausgestaltet, gehören auch zusammen. Die Verwandtschaft in der Erkenntnis-Gesinnung steht höher als die logische Kraft des Denkens. Deshalb werden gerade diejenigen, welche die groben Behauptungen Büchners im Sinne eines höheren Denkens zu fassen wissen, nicht einstimmen können in die wegwerfenden Urteile der flachen Geister, hinter deren scheinbar philosophischem Gerede sich doch nichts verbirgt als die mehr oder weniger bewußte Sucht, so viele Fetzen einer überlebten Weltanschauung zu retten, als nur irgend noch möglich ist. Ludwig
Büchner war gewiß kein großer Pfadfinder der neuen Weltanschauung. Er war ein Mann, der große Wahrheiten mit hingebender Begeisterung ergriffen hat und in einer Weise auszusprechen wußte, die sie auch für denjenigen verständiich macht, dem eine höhere logische und wissenschaftliche Schulung fehlt. Und diejenigen, welche davon sprechen, daß Halbwisser und Dilettanten sich ihre Bildung aus seinen Schriften holen, sollten bedenken, daß es auch nicht gerade Ganzwisser und Meister sind, welche die Lehren des Herrn Ziegler nachplappern. Die Tausende und aber Tausende, welche sich aus den Sätzen von «Kraft und Stoff» eine Lebensauffassung zusammengezimmert haben, sind gewiß um nichts schlechter als die anderen, die dasselbe mit den Aussprüchen Schopenhauers tun oder gar mit denen ihrer Pastoren. Ja, sie sind wahrscheinlich um ein erhebliches besser. Denn es ist besser, ein Flachling im Vernünftigen zu sein als ein solcher im Widervernünftigen.
Wer den Entwickelungsgang des geistigen Lebens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts verfolgt, wird das Mißverständnis allerdings begreifen, dem Büchners geistige Physiognomie heute ausgesetzt ist. Es bieten ja nicht allein die Religionsgenossenschaften alle ihre Kräfte auf, um das Licht, das von den neugewonnenen Naturerkenntnissen ausgeht, zu verdunkeln - ein Bestreben, in dem sie von den reaktionären und einsichtslosen Regierungen uberall die kräftigste Unterstützung finden -, sondern auch innerhalb des Wissenschaftsbetriebes selbst herrscht vieffach eine bedauerliche Rückständigkeit. Wie wenig Verständnis herrscht bei den Philosophen unserer Zeit für die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise und ihre Errungenschaften! Sie haben in den sechziger Jahren den Ruf erhoben: Zurück zu Kant! Sie wollen dessen Anschauungen zum Ausgangspunkt nehmen, um sich über das Wesen des menschlichen Erkennens und dessen Grenzen zu orientieren. Aus dieser Strömung heraus ist eine große, aber durchaus unfruchtbare Literatur erwachsen. Denn Kant ist es nicht darauf angekommen, in unbefangener, vorurteilsloser Weise das Wesen der Erkenntnis zu ergründen, sondern er wollte vor allen Dingen über dieses Wesen eine Ansicht gewinnen, die es ihm erlaubte,
gewisse religiöse Dogmen doch wieder durch ein Türchen in das menschliche Geistesleben einzuführen. Er hat mehr oder weniger bewußt alle seine Begriffe so formuliert, daß gewisse Glaubensvorstellungen unangetastet bleiben. Man muß ihn von dem Satze aus verstehen, in dem er selbst sein Streben zusammengefaßt hat: Ich wollte das Wissen begrenzen, am für den Glauben Platz zu gewinnen. Zu diesem Ziel leisten die Philosophen von heute Handlangerdienste. Und es bietet ein merkwürdiges Schauspiel, wenn man sie bei ihrer Arbeit betrachtet, die sie verrichten, ohne sich über den eigentlichen Impuls ihres Königsberger Verführers völlig klar zu sein. Für denjenigen, der sich gegenwärtig bemüht, eine Weltanschauung aufzubauen, ist daher die Beschäftigung mit dieser in den Fußstapfen Kants wandelnden Philosophie so gut wie nutzlos. Er verliert durch diese Beschäftigung nur die kostbare Zeit, die er viel besser dazu verwenden könnte, die unendlich fruchtbaren Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft sich anzueignen. In Darwins und Haeckels Schriften findet man eine reiche und die einzig richtige Grundlage zum Ausbau einer Weltanschauung; von vielen Richtungen der zeitgenössischen Philosophie fühlt sich derjenige unendlich angeödet, der nach einer solchen Weltanschauung strebt. Ihm steigt unwillkürlich der Gedanke auf: Wie anders hätte sich unser geistiges Leben entwickelt, wenn man von den durch Büchner geschaffenen Anfängen einer auf die Naturwissenschaft gestützten Lebensauffassung weitergegangen wäre, statt diese Anfänge mit unfruchtbaren logischen Spitzfindigkeiten zu bekämpfen?
Nur weil man zu diesem Weitergehen in vielen wissenschaftlichen Kreisen nicht fähig war, konnte es kommen, daß Ausführungen wie die Du Bois-Reymonds über «Die Grenzen des Naturerkennens» einen tieferen Eindruck machten. Eine solche Rede kann nur ein Mann halten, der die Tragweite der natur-wissenschaftlichen Methode mißversteht und deshalb auch zu keiner Klarheit über die Schlüsse kommen kann, zu denen diese Methode führt. Es war eine Naivität allerersten Ranges, als Du Bois-Reymond der menschlichen Erkenntnis eine Grenze setzte, weil sie niemals einsehen werde, wie es komme, daß aus
den Vorgängen des Gehirnes sich Empfinden und Denken, Bewußtsein entwickle. Er sagte: Man kann nicht verstehen, warum es einer Summe materieller Teilchen nicht gleichgültig sein sollte, wie sie liegen und sich bewegen und warum sie durch eine be-stimmte Lage und Bewegung die Empfindung , durch eine andere das Gefühl des Schmerzes hervorrufert Der zur Erforschung einzelner natürlicher Tatsachen außerordentlich bef ähigte Forscher hatte keine Ahnung davon, daß er sich zuerst willkürlich eine gewisse Vorstellung von dem Wesen des Stoffes und seiner Wirkungen zurechtgelegt hat und daß nur diese seine ausgeklügelte Idee ihn nicht zu einem Verstehen des Zusammenhanges von Gehirn und Bewußtsein kommen ließ. Der einzig sinngemäße Weg ist derjenige, den Haeckel einschlägt, wenn er Materie und Kraft schon so vorstellt, daß der durch die Erfahrung unwiderleglich bewiesene Zusammenhang derselben mit den Erscheinungen des Geistes seine Erklärung findet.
Ohne Verständnis der naturwissenschaftlichen Resultate und der Methoden, durch welche diese Resultate gewonnen werden, ist heute keine Weltanschauung möglich. Und daß Büchner dies erkannt hat, daß er auf Grund dieser Methoden und Resultate eine Weltanschauung zu gewinnen trachtete, ist sein nicht wegzuleugnendes Verdienst. Was er getan hat, ist viel wichtiger als alles, was der Neukantianismus und was Naturforscher vom Schlage Du Bois-Reymonds mit Reden wie die über Das Buch «Kraft und Stoff» war ein Hauptschlag gegen die traditionellen Glaubensvorstellungen. Und die Reaktionäre wissen, warum sie Büchner im Grunde ihrer Seele hassen und gerne zu den Ausführungen Du Bois-Reymonds und seiner Gesinnungsgenossen greifen, wenn sie sich selbst zu unfähig vorkommen, um die neuen Anschauungen aus dem Felde zu schlagen.
Aus den Kreisen, in welche Büchners Anschauungen gedrungen sind, ist auch eine freiheitsgemäße Auffassung der ganzen menschlichen Lebensgestaltung hervorgegangen. Die sittlichen Begriffe haben durch sie eine gründliche Reform erfahren. Wie stark in unserer Kulturentwickelung das Bedürfnis nach einer solchen Reform
war, das zeigt der Fortgang, den die Hegelsche Philosophie nach dem Tode des Meisters genommen hat. Auf ihre Art haben David Friedrich Strauß, Friedrich Theodor Vischer, Ludwig Feuer-bach, Bruno Bauer und Max Stirner im Sinne der naturgemäßen Weltauffassung gewirkt. Der Darwinismus hat dann die Möglichkeit geboten, aus der Beobachtung der Tatsachen eine Stütze der großen Konzeptionen dieser Denker zu gewinnen. Wie zwei Arbeitergruppen, die von beiden Seiten eines Berges einen Tunnel graben und sich in der Mitte begegnen, so treffen die in der Weise der genannten Philosophen wirkenden Geister mit den auf dem Darwinismus bauenden Forschern zusammen.
Tief steckt unseren Zeitgenossen noch die Sucht im Leibe, das Wissen zu beschränken, um für den Glauben Platz zu bekommen. Und Geister, welche dem Wissen die Macht zuerkennen, den Glauben allmählich zu verdrängen, werden als unbequem empfunden. Ja, «es ist zum Entzücken gar», wenn man irgendwelche Fehler in ihren Gedankengängen nachweisen kann. Als ob es nicht eine alte Erkenntnis wäre, daß im Anfange alle Dinge in unvollkommener Gestalt auftauchen!
Es scheint, als ob Büchner schmerzlich von der Verkennung berührt gewesen wäre, die ihm in der letzten Zeit seines Lebens entgegengetreten ist. Die Leitung dieser Zeitschrift ist so glücklich, im Anschlusse an diese Würdigung des eben Dahingeschiedenen einen Aufsatz zu veröffentlichen, der jedenfalls zu dem letzten gehört, was der kühne und vorurteilslose Denker, der unerschrockene Mann und starke Charakter geschrieben hat. Und es scheint, als ob er die Bemerkungen über die «Lebenden und Toten> nicht ohne schmerzlichen Hinblick auf sein eigenes Schicksal geschrieben hätte.
ERNST HAECKEL UND DIE «WELTRÄTSEL»*
I
Was soll die Philosophie neben und über den einzelnen Spezialwissenschaften? Die Vertreter der letzteren sind wohl gegenwärtig nicht abgeneigt, diese Frage einfach dahin zu beantworten: sie soll überhaupt nichts. Das ganze Gebiet der Wirklichkeit wird nach ihrer Ansicht von den Spezialwissenschaften umspannt. Wozu noch etwas, das über diese hinausgeht?
Alle Wissenschaften betrachten es als ihre Aufgabe, die Wahrheit zu erforschen. Unter Wahrheit kann nichts anderes verstanden werden als ein System von Begriffen, welches in einer mit den Tatsachen übereinstimmenden Weise die Erscheinungen der Wirklichkeit in ihrem gesetzmäßigen Zusammenhange abspiegelt. Bleibt jemand nun dabei stehen und sagt, für ihn habe das Netz von Begriffen, das ihm ein gewisses Gebiet der Wirklichkeit abbildet, einen absoluten Wert und er brauche nichts darüber, so kann man ihm ein höheres Interesse nicht andemonstrieren. Nur wird uns ein solcher nicht erklären können, warum seine Begriffssammlung einen höheren Wert habe als zum Beispiel eine Briefmarkensammlung, die doch auch, entsprechend systernatisch geordnet, gewisse Zusammenhänge der Wirklichkeit abbildet. Hierin liegt der Grund, warum der Streit über den Wert der Philosophie mit vielen Naturforschern zu keinem Resultate führt. Sie sind Begriffsliebhaber in dem Sinne, wie es Marken- und Münzenliebhaber gibt. Es gibt aber ein Interesse, das darüber hinausgeht Dieses sucht mit Hilfe und auf Grund der Wissenschaften den Menschen über seine Stellung zum Universum aufzuklären, oder mit anderen Worten: dieses Interesse bringt den Menschen dahin, daß er sich in eine solche Beziehung zur Wek setzt, wie es nach Maßgabe der in den Wissenschaften gewonnenen Resultate möglich und notwendig ist.
- - -
* «Die Welträtsel.» Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. Von Ernst Haeckel. Verlag von Emil Strauß. Bonn 1899.
In den einzelnen Wissenschaften stellt sich der Mensch der Natur gegenüber, er sondert sich von ihr ab und betrachtet sie; er entfremdet sich ihr. In der Philosophie sucht er sich wieder mit ihr zu vereinigen. Er sucht das abstrakte Verhältnis, in das er in der wissenschaftlichen Betrachtung geraten ist, zu einem reiilen, konkreten, zu einem lebendigen zu machen. Der wissenschaftliche Forscher will sich durch die Erkenntnis ein Bewußtsein von der Welt und ihren Wirkungen erwerben; der Philosoph will sich mit Hilfe dieses Bewußtseins zu einem lebensvollen Gliede des Weltganzen machen. Die Einzelwissenschaft ist in diesem Sinne eine Vorstufe der Philosophie. Wir haben ein ähnliches Verhältnis in den Künsten. Der Komponist arbeitet auf Grund der Kompositionslehre. Die letztere ist eine Summe von Erkenntnissen, die eine notwendige Vorbedingung des Komponierens sind. Das Komponieren verwandelt die Gesetze der Musikwissenschaft in Leben, in reale Wirklichkeit. Wer nicht begreift, daß ein ähnliches Verhältnis auch zwischen Philosophie und Wissenschaft besteht, der taugt nicht zum Philosophen. Alle wirklichen Philosophen waren freie Begriffskünstler. Bei ihnen wurden die menschlichen Ideen zum Kunstmateriale und die wissenschaftliche Methode zur künstlerischen Technik. Dadurch wird das abstrakte wissenschaftliche Bewußtsein zum konkreten Leben erhoben. Unsere Ideen werden Lebensmächte. Wir haben nicht bloß ein Wissen von den Dingen, sondern wir haben das Wissen zum realen, sich selbst beherrschenden Organismus gemacht; unser wirkliches, tätiges Bewußtsein hat sich über ein bloßes passives Aufnehmen von Wahrheiten gestellt.
Ich habe es oft hören müssen: gegenwärtig sei es unsere Aufgabe, Baustein auf Baustein zu sammeln. Die Zeit sei vorbei, wo man, ohne erst die Materialien zur Hand zu haben, im stolzen Übermut philosophische Lehrgebäude aufführte. Wenn wir erst dieses Materials genug gesammelt haben, dann wird schon das rechte Genie erstehen und den Bau aufführen. Jetzt sei nicht die Zeit zum Systembauen. Diese Ansicht entspringt einer bedauernswerten Unklarheit über die Natur der Wissenschaft. Wenn die letztere die Aufgabe hätte, die Tatsachen der Welt zu sammeln, sie zu registrieren und sie zweckmäßig nach gewissen Gesichtspunkten
systematisch zu ordnen, dann könnte man etwa so sprechen. Dann aber müßten wir überhaupt auf alles Wissen verzich-ten, denn mit dem Sammeln der Tatsachen würden wir wohl erst am Ende der Tage fertig werden, und dann gebräche es uns an der nötigen Zeit, die geforderte gelehrte Registrierarbeit zu vollziehen.
Wer sich nur einmal klarmacht, was er eigentlich durch die Wissenschaft erreichen will, dem wird die Irrtümlichkeit jenet eine unendliche Arbeit in Anspruch nehmenden Forderung gar bald einleuchten. Wenn wir der Natur gegenübertreten, dann steht sie zunächst wie ein tiefes Mysterium vor uns, sie dehnt sich wie ein Rätsel vor unseren Sinnen aus. Ein stummes Wesen blickt uns entgegen. Wie können wir Licht in diese mystische Finsternis bringen? Wie das Rätsel lösen?
Der Blinde, der ein Zimmer betritt, kann nur Dunkelheit in demselben empfinden. Und wenn er noch so lange herumwandelt und alle Gegenstände betastet: Helligkeit wird ihm dadurch nimmer den Raum erfüllen. Wie dieser Blinde der Einrichtung des Zimmers, so steht im höheren Sinne der Mensch der Natur gegenüber, der von der Betrachtung einer unendlichen Zahl von Tatsachen die Lösung des Rätsels erwartet. Es liegt etwas in der Natur, was uns tausend Tatsachen nicht verraten, wenn uns die Sehkraft des Geistes abgeht, es zu schauen.
Ein jegliches Ding hat zwei Seiten. Die eine ist die Außenseite. Sie nehmen wir mit unseren Sinnen wahr. Dann gibt es aber auch eine Innenseite. Diese stellt sich dem Geiste dar, wenn er zu betrachten versteht. An seine eigene Unfähigkeit in irgendeiner Sache wird niemand glauben. Wer bei sich die Fähigkeit vermißt, diese Innenseite wahrzunehmen, der leugnet sie am liebsten dem Menschen ganz ab, oder er verschreit diejenigen als Phantasten, die vorgeben, sie zu besitzen. Gegen ein absolutes Unvermögen läßt sich nichts machen, und man könnte die nür bedauern, die wegen desselben nie zur Einsicht in die Tiefen des Welewesens kommen können. Der Psychologe aber glaubt nicht an diese Unfähigkeit. Jeder geistig normal entwickelte Mensch hat das Vermögen, in jene Tiefen bis zu einem gewissen Punkte hinunterzusteigen.
Aber die Bequemlichkeit des Denkens verhindert viele daran. Ihre geistigen Waffen sind nicht stumpf, aber die Träger sind zu lässig, sie zu handhaben. Es ist ja unendlich viel bequemer, Tatsache auf Tatsache zu häufen, als die Gründe für dieselben durch das Denken aufzusuchen. Vor allem ist bei solcher Tatsachenhäufung der Fall ausgeschlossen, daß ein anderer kommt und das von uns Vertretene umstößt Man kommt auf diese Weise nie in die Lage, seine geistigen Positionen verteidigen zu müssen; man braucht sich nicht darüber aufzuregen, daß morgen von jemand das Gegenteil unserer heutigen Aufstellungen vertreten wird. Man kann sich, wenn man bloß mit tatsächlicher Wahrheit sich abgibt, hübsch in dem Glauben wiegen, daß uns diese Wahrheit niemand bestreiten kann, daß wir für die Ewigkeit schaffen. Jawohl, wir schaffen auch für die Ewigkeit, aber wir schaffen bloß Nullen. Diesen Nullen durch das Vorsetzen einer bedeutungsvollen Ziffer in Form einer Idee einen Wert zu verleihen, dazu fehlt uns eben der Mut des Denkens.
Davon haben heute wenige Menschen eine Ahnung: daß etwas wahr sein kann, auch wenn das Gegenteil davon mit nicht geringerem Rechte behauptet werden kann. Unbedingte Wahrheiten gibt es nicht. Wir bohren tief in ein Ding der Natur, wir holen aus den verborgensten Schachten die geheimnisvollsten Weisheiten herauf; wir drehen uns um, bohren an einer zweiten Stelle: und das Gegenteil zeigt sich uns als ebenso berechtigt. Daß eine jede Wahrheit nur an ihrem Platze gilt, daß sie nur so lange wahr ist, als sie unter den Bedingungen behauptet wird, unter denen sie ursprünglich gegründet ist, das muß vor allem begriffen werden.
Wer macht heute nicht einen respektvollen Knix, wenn der Name Friedrich Theodor Vischer genannt wird? Daß dieser Mann es als die höchste Errungenschaft seines Lebens bezeichnete, gründlich die oben ausgesprochene Überzeugung von dem Wesen der Wahrheit erlangt zu haben, das wissen aber nicht viele. Wüßten sie es, dann strömte ihnen noch eine ganz andere Luft aus Vischers herrlichen Werken entgegen; und man würde auf weniger zeremonielles Lob, aber auf mehr ungezwungenes Verständnis dieses Schriftstellers stoßen.
Wo sind die Zeiten, in denen Schiller tiefes Verständnis fand, als er den philosophischen Kopf pries gegenüber dem Brotgelehrten! Jenen, der rückhaltlos nach den Wahrheitsschätzen gräbt, wenn er auch der Gefahr ausgesetzt ist, daß gleich darauf ein zweiter Schatzgräber ihm alles entwertet durch einen neuen Fund gegenüber dem, der ewig nur das banale, aber unbedingt «wahre»: «Zweimal zwei ist vier» wiederholt.
Wir müssen den Mut haben, kühn in das Reich der Ideen einzudringen, auch auf die Gefahr des Irrtums hin. Wer zu feig ist, um zu irren, der kann kein Kämpfer für die Wahrheit sein. Ein Irrtum, der dem Geist entspringt, ist mehr wert als eine Wahrheit, die der Plattheit entstammt. Wer nie etwas behauptet hat, was in gewissem Sinne unwahr ist, der taugt nicht zum wissenschaftlichen Denker.
Aus feiger Furcht vor dem Irrtum ist unsere Wissenschaft der baren Flachheit zum Opfer gefallen.
Es ist geradezu haarsträubend, welche Charaktereigenschaften heute als Tugenden des wissenschaftlichen Forschers gepriesen werden. Wollte man dieselben ins Gebiet der praktischen Lebens-führung übersetzen, so käme das - Gegenteil eines festen, entschiedenen, energischen Charakters heraus.
Einem festen, kühnen Denkermut verdankt nun ein eben erschienenes Werk seine Entstehung, das auf Grundlage der großen tatsächlichen Ergebnisse der Naturwissenschaft und aus einem wahren, echten philosophischen Geiste heraus zugleich die Lösung der Welträtsel versucht: Ernst Haeckels «Die Welträtsel».
II
«Vierzig Jahre Darwinismus! Welcher ungeheure Fortschritt unserer Naturerkenntnis! Und welcher Umschwung unserer wichtigsten Anschauungen, nicht allein auf den nächstbetroffenen Gebieten der gesamten Biologie, sondern auch auf demjenigen da Anthropologie und ebenso aller sogenannten!» So konnte Ernst Haeckel in der Rede, die er auf dem vierten internationalen Zoologenkongreß in Cambridge am 26. August
1898 gehalten hat, von den naturwissenschaftlichen Errungenschaften sprechen, die sich an den Natnen Darwin knüpften. Haeckel selbst hat schon vier Jahre nach dem Erscheinen von Darwins epochemachendem Werke «Über die Entstehung der Arten im Tier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung» (London 1859) mit seiner (Berlin 1866) sich zu dem berufenen Vorkämpfer, aber auch dem Fortführer der Darwinschen Anschauungen gemacht. Die Kühnheit des Denkens, die vor keiner Konsequenz, die sich aus der neuen Lehre ergab, zurückschreckende Geistesschärfe die-ses Naturforschers und Weltdenkers traten bereits in diesem Buche klar zutage. Seither hat er selbst weitere dreiunddreißig Jahre unermüdlich mitgearbeitet an dem Aufbau der naturwissenschaftlichen Weltanschauung, die unser Jahrhundert als das «Jahrhundert der Naturwissenschaft» erscheinen läßt. Spezialarbeiten, die ein helles Licht verbreiten über bisher unbekannte Gebiete des Naturlebens, und zusammenfassende Schriften, welche von dem neu gewonnenen Gesichtspunkte aus das ganze Gebiet der Erkenntnisse behandelten, die heute unsere höchsten geistigen Bedürfnisse befriedigen, sind die Frucht dieses mit seltener Energie ausgestatteten Forscherlebens.
Und jetzt legt uns dieser Geist in seinen «Welträtseln» «die weitere Ausführung, Begründung und Ergänzung der Überzeugungen» dar, welche er in seinen anderen «Schriften bereits ein Menschenalter hindurch vertreten» hat.
Was demjenigen, der sich verständnisvoll mit Haeckels Leistungen beschäftigt, vor allen Dingen in die Augen springt, das ist die Einheitlichkeit und Geschlossenheit der Denkerpersönlichkeit, von der sie ausgehen. In ihm ist nichts von dem fragwürdigen Streben derjenigen, welche die «Versöhnung von Religion und Kultur» suchen, um «fromm fühlen und frei denken zugleich» zu können. Für Haeckel gibt es nur eine Quelle wahrer Kultur: «Mutiges Streben nach Erkenntnis der Wahrheit» und «Gewinnung einer klaren, fest darauf gegründeten, naturwissenschaftlichen Weltanschauung» (Welträtsel, S.3 f.). Ihm ist auch die eiserne Strenge des Denkers eigen, der mit Unerbittlichkeit alles als Unwahrheit
kennzeichnet, was er als solches erkannt hat. Mit solcher Strenge führt er seinen Krieg gegen die reaktionären Mächte, die am Ende unseres aufgeklärten Jahrhunderts gern wieder frühere Finsternis des Geistes zurückrufen möchten.
«Die Welträtsel» sind ein Buch, eingegeben von der Hingabe an die Wahrheit und von dem Abscheu vor veralteten und der wissenschaftlichen Einsicht schädlichen Bestrebungen. Ein Buch, das für uns nicht nur erhebend ist wegen der Höhe der Einsicht, von der aus der Verfasser das Leben und die Welt betrachtet, sondern auch durch die moralische Energie und die Erkenntnisleidenschaft, die uns aus ihm entgegenleuchten. Für Haeckel ist die naturgemäße Weltanschauung Glaubensbekenntnis geworden, das er nicht bloß mit der Vernunft, sondern mit dem Herzen verteidigt. «Durch die Vernunft allein können wir zur wahren Natur-Erkenntnis und zur Lösung der Welträtsel gelangen. Die Vernunft ist das höchste Gut des Menschen und derjenige Vorzug, der ihn allein von den Tieren wesentlich unterscheidet. Allerdings hat sie aber diesen hohen Wert erst durch die fortschreitende Kultur und Geistesbildung, durch die Entwickelung der Wissenschaft erhalten.
... Nun ist aber in weiten Kreisen noch heute die Ansicht verbreitet, daß es außer der göttlichen Vernunft noch zwei weitere (ja sogar wichtigere!) Erkenntniswege gebe: Gemüt und Offenbarung. Diesem gefährlichen Irrtum müssen wir von vornherein entschieden entgegentreten. Das Gemüt hat mit der Erkenntnis der Wahrheit gar nichts zu tun. Was wir nennen und hochschätzen, ist eine verwickelte Tätigkeit des Gehirns, welche sich aus Gefühlen der Lust und Unlust, aus Vorstellungen der Zuneigung und Abneigung, aus Strebungen des Begehrens und Fliehens zusammensetzt. Dabei können die verschiedensten andern Tätigkeiten des Organismus mitspielen, Bedürfnisse der Sinne und der Muskeln, des Magens und der Geschlechtsorgane usw. Die Erkenntnis der Wahrheit fördern alle diese Gemütszustände und Gemütsbewegungen in keiner Weise; im Gegenteil stören sie oft die allein dazu befähigte Vernunft und schädigen sie häufig in empfindlichem Grade. Noch kein ist durch die Gehirn-funktion des Gemüts gelöst oder auch nur gefördert worden. Dasselbe
gilt aber auch von der sogenannten und den angeblichen, dadurch erreichten; diese beruhen sämtlich auf bewußter oder unbewußter Täuschung (Welträtsel, S.19 f.). So spricht nur eine Persönlichkeit, deren eigenes Gemüt ganz durchdrungen ist von der Wahrheit dessen, was die Vernunft offenbart. Wie nehmen sich gegenüber solchem Denkermut heute diejenigen aus, die noch immer Worte der Bewunderung übrig haben für solche, die die Religion auf das Gemüt aufbauen und «sie als persöniiches Erlebnis unabhängig» machen wollen «von der fortschreitenden Wissenschaft»?
Ein tief philosophischer Grundzug in seiner Vorstellungsart versetzte Haeckel in die Möglichkeit, von der Naturwissenschaft aus die Lösung der höchsten menschlichen Fragen zu unternehmen, und ein sicherer Blick für die gesetzmäßigen Zusammenhänge in natürlichen Vorgängen, die der unmittelbaren Beobachtung so verwickelt als möglich erscheinen, bewirken in seinem Weltbilde jene monumentale Einfachheit, die immer im Gefolge der Größe in Dingen der Weltanschauung erscheint. Einer der größten Naturforscher und Denker aller Zeiten, Galilei, hat gesagt, daß die Natur in allen ihren Werken der nächsten, einfachsten und leichtesten Mittel sich bediene. An diesen Ausspruch werden wir immerfort erinnert, wenn wir Haeckels Anschauungen verfolgen. Was so mancher Philosoph auf den abgelegensten Wegen der Spekulation sucht, das findet er in der einfachen, klaren Sprache der Tatsachen. Aber er bringt diese Tatsachen wirklich zum Sprechen, so daß sie nicht geistlos nebeneinanderstehen, sondern sich in philosophischer Weise gegenseitig erklären. «Als einen der erfreulichsten Fortschritte zur Lösung der Welträtsel müssen wir es begrüßen, daß in neuerer Zeit immer mehr die beiden einzigen dazu führenden Wege: Erfahrung und Denken - oder Empirie und Spekulation - als gleichberechtigte und sich gegenseitig ergänzende Erkenntnismethoden anerkannt worden sind Allerdings gibt es auch heute noch manche Philosophen, welche die Welt bloß aus ihrem Kopfe konstruieren wollen und welche die empirische Naturerkenntnis schon deshalb verschmähen, weil sie die wirkliche Welt nicht kennen. Anderseits behaupten auch heute
noch manche Naturforscher, daß die einzige Aufgabe der Wissenschaft das; das sei vorüber und an ihre Stelle sei die Naturwissenschaft getreten. (Rudolf Virchow, Die Gründung der Berliner Universität und der Übergang aus dem philosophischen in das naturwissenschaftliche Zeitalter, Berlin 1893.) Diese einseitige Überschätzung der Empirie ist ebenso ein gefährlicher Irrtum wie jene entgegengesetzte der Spekulation. Beide Erkenntnis -Wege sind sich gegenseitig un-entbehrlich. Die größten Triumphe der modernen Naturforschung, die Zellentheorie und die Wärmetheorie, die Enrwicklungstheorie und das Substanzgesetz, sind philosophische Taten, aber nicht Ergebnisse der reinen Spekulation, sondern der vorausgegangenen, ausgedehntesten und gründlichsten Empirie» (Welträtsel, 5.20 f.).
Daß es nur eine Art von Naturgesetzmäßigkeit gibt und daß wir eine solche Gesetzmäßigkeit in gleicher Weise verfolgen können in dem Stein, der auf einer schiefen Ebene herunterrollt nach dem Gesetz der Schwere, in dem Wachsrum der Pflanze, in der Organisation des Tieres und in den höchsten Vernunftleistungen der Menschen: diese Überzeugung zieht sich durch Haeckels ganzes Forschen und Denken. Eine Grundgesetzlichkeit im ganzen Universum erkennt er an. Deshalb nennt er seine Weltanschauung Monismus im Gegensatz zu denjenigen Ansichten, die für die mechanisch verlaufenden Naturvorgänge eine andere Art von Gesetzmäßigkeit annehmen als für die Wesen (die Organismen), in denen sie eine zweckmäßige Einrichtung wahrnehmen. Wie die elastische Kugel fortrollt, wenn sie von einer andern gestoßen wird: mit derselben Notwendigkeit hängen auch alle Lebensvorgänge im Tierreich, ja auch alle geistigen Ereignisse irn Kulturgange der Menschheit zusammen.
«Die alte Weltanschauung des Ideal-Dualismus mit ihren mystischen und anthropistischen Dogmen versinkt in Trümmer; aber über diesem gewaltigen Trümmerfelde steigt hehr und herrlich die neue Sonne unseres Real-Monismus auf, welche uns den wunderbaren Tempel der Natur voll erschließt. In dem reinen Kultus des (Wahren, Guten und Schönen), welcher den Kern unserer neuen
monistischen Religion bildet, finden wir reichen Ersatz für die verlorenen anthropistischen Ideale von » (Welträtsel, S. 438 f.).
III
Ihren Grundcharakter erhält die Naturauffassung Haeckels durch die Beseitigung jeder Art von Zweckmäßigkeitslehre oder Teleologie aus den menschlichen Vorstellungen über Welt und Leben. Solange solche Vorstellungen noch vorhanden sind, kann von einer wirklich naturgemäßen Weltanschauung nicht die Rede sein. Diese Frage der Zweckmäßigkeit kommt in ihrer bedeutungsvollsten Form zur Geltung, wenn es sich um die Bestimmung der Stellung des Menschen in der Natur handelt. Entweder ist etwas dem Ahnliches, was wir Menschengeist, menschliche Seele und so weiter nennen, außerhalb des Menschen in der Welt vorhanden und bringt die Erscheinungen hervor, um sich selbst zuletzt im Menschen sein Ebenbild zu schaffen, oder dieser Geist ist im Laufe der natürlichen Entwickelung erst in dem Zeitpunkt vorhanden, in dem er im Menschen wirklich auftritt. Dann haben die natürlichen Vorgänge durch rein ursächliche Notwendigkeit den Geist hervorgebracht, ohne daß er durch irgendwelche Absicht in die Welt gekommen wäre. Dies letztere ergibt sich aus Haeckels Voraussetzung unwiderleglich. Im Grunde stammen alle anderen Gedanken aus veralteten theologischen Ideen. Auch wo solche Gedanken in der Philosophie noch heute auftreten, können sie für denjenigen, der genauer betrachtet, ihren Ursprung nicht verleugnen. Man hat das Grobe, Kindiiche der theologischen Mythologien abgestreift, aber doch zweckmäßig waltende Weltideen, kurz geistige Potenzen beibehalten. Schopenhauers Wille, Hartmanns Unbewußtes sind nichts anderes als solche Reste alter theologischer Vorstellungen. Vor kurzem hat wieder der Botaniker J. Reinke in seinem Buche «Die Welt als Tat» die Ansicht vertreten, daß das Zusammenwirken der Stoffe und Kräfte aus sich selbst die Formen des Lebens nicht hervorbringen könne, sondern daß es dazu durch Richtkräfte oder Dominanten in einer gewissen Weise
bestimmt werden müsse. Daß alle solchen Annahmen überflüssig sind, daß die Welterscheinungen für unser Erkenntnisbedürfnis vollständig erklärbar sind, wenn wir nichts weiter als die natur-gesetzliche Notwendigkeit voraussetzen: das zeigt Haeckels neues Buch in übersichtlicher Weise.
Es skizziert den Lauf der Weltentwickelung von den Vorgängen der unorganischen Natur bis herauf zu den Außerungen der menschlichen Seele. Die Überzeugung, daß die sogenannte «Weltgeschichte» eine verschwindend kurze Episode in dem langen Verlaufe der organischen Erdgeschichte und diese selbst wieder nur ein kleines Stück von der Geschichte unseres Planetensystems ist: sie wird mit allen Mitteln der modernen Naturwissenschaft gestützt. Die ihr entgegenstehenden Irrtümer werden unerbittlich bekämpft. Es lassen sich diese Irrtümer im Grunde alle auf einen einzigen zurückführen, auf die «Vermenschlichung» der Welt. Haeckel versteht unter diesem Begriffe «jenen mächtigen und weit verbreiteten Komplex von irrtümlichen Vorstellungen, welche den menschlichen Organismus in Gegensatz zu der ganzen übrigen Natur stellt, ihn als vorbedachtes Endziel der organischen Schöpfung und als ein prinzipiell von dieser verschiedenes, gottähnliches Wesen auffaßt. Bei genauerer Kritik dieses einflußreichen Vorstellungskreises ergibt sich, daß derselbe eigentlich aus drei verschiedenen Dogmen besteht, die wir als den anthropozentrischen, anthropomorphischen und anthropolatrischen Irrtum unterscheiden. I. Das anthropozentrische Dogma gipfelt in der Vorstellung, daß der Mensch der vorbedachte Mittelpunkt und Endzweck alles Erdenlebens - oder in weiterer Fassung der ganzen Welt - sei. Da dieser Irrtum dem menschlichen Eigennutz äußerst erwünscht und da er mit den Schöpfungsmythen der drei großen Mediterran-Religionen, mit den Dogmen der mosaischen, christlichen und mohammedanischen Lehre innig verwachsen ist, beherrscht er auch heute noch den größten Teil der Kulturwelt. -II. Das anthropomorphische Dogma ... vergleicht die Weltschöpfung und Weltregierung Gottes mit den Kunstschöpfungen eines sinnreichen Technikers oder und mit der Staatsregierung eines weisen Herrschers. Gott... wird... menschenähnlich
vorgestellt... III. Das anthropolatrische Dogma ... führt zu der göttlichen Verehrung des menschlichen Organismus, zum ‹anthropistischen Größenwahn›.» (Weiträtsel, S.13 f.) Die menschliche Seele gilt als höheres Wesen, das den untergeordneten Organismus zeitweilig bewohnt.
Solchen mythologischen Vorstellungen setzt Haeckel seine Überzeugung von der «kosmologischen Perspektive» gegenüber, wonach ewig - in dem Sinne wie der göttliche Weltgrund der Religionen - nur die Materie mit der ihr inwohnenden Kraft ist und aus den Vorgängen dieser kraftbegabten Materie sich alle Erscheinungen mit Notwendigkeit entwickeln. Die Gegner der monistischen Weltanschauung verwerfen diese deswegen, weil sie dasjenige, was den Charakterzug der höchsten Zweckmäßigkeit trägt, den tierischen und menschlichen Organismus, als das Werk einer blinden Notwendigkeit, ohne vorherbestimmte Absicht erklärt, also im Grunde durch einen bloßen Zufall entstanden sein läßt. Versteht man unter Zufall dasjenige, was eintritt, ohne daß vorher ein Gedanke von seinem Dasein irgendwo vorhanden war, so ist in naturwissenschaftlichem Sinne das ganze Weltall ein bloßer Zufall; denn «die Entwicklung der ganzen Welt ist ein einheitlich mechanischer Prozeß, in dem wir nirgends Ziel und Zweck entdecken können; was wir im organischen Leben so nennen, ist eine besondere Folge der biologischen Verhältnisse; weder in der Entwicklung der Weltkörper noch derjenigen unserer anorganischen Erdrinde ist ein leitender Zweck nachzuweisen» (Welträtsel, S. 316). Aber das allgemeine Gesetz, daß jede Erscheinung ihre mechanische Ursache hat, besteht dafür im ganzen Weltall, und in diesem Sinne gibt es keinen Zufall.
Man wird, wenn man die Ausführungen Haeckels verständnisvoll verfolgt, zu dem wahren Begriff dessen kommen, was man heute allein «wissenschaftliche Erklärung» nennen sollte. Die Wissenschaft darf nichts zur Erklärung einer Erscheinung herbeiziehen, als was dieser in der Zeit tatsächlich vorangegangen ist. Alle Vorgänge in der Welt sind durch solche bestimmt, die sich vor ihnen abgespielt haben. In diesem Sinne sind sie notwendig und kein Zufall. Unwissenschaftlich ist aber jede Erklärung, die
dem, was in der Zeit später liegt, irgendeinen Einfluß auf ein früher Entstandenes beilegt. Wer den Menschen erklären will, soll ihn aus Naturvorgängen erklären, die seinem Dasein vorangegangen sind, nicht aber soll er die Sache so darstellen, als ob die Entstehung des Menschen zurückgewirkt habe auf diese früheren Vorgange, das heißt, wie wenn diese rückwärts gelegenen Vorgänge sich so abgespielt haben, daß aus ihnen als Ziel der Mensch sich ergab. Eine Weltanschauung, die sich bei ihren Erklärungen nur an das «Vorher» hält und aus diesem das «Nachher» ableitet, ist so darstellt, als ob es auf dieses «Nachher» irgendwie hinwiese, ist Teleologie, Zweckmißigkeitslehre und damit Dualismus. Denn wäre sie richtig, dann wäre eine zweckmäßige Erscheinung doppelt in der Welt vorhanden, und zwar wirklich in dem Zeitraume, in dem sie eintritt, und geistig, ideell, der Anlage nach, vor ihrer wirklichen Entstehung, als Gedanke, als leitender Zweck im allgemeinen Weltenplane.
Mögen Haeckels lichtvolle Darstellungen dahin führen, daß der Unterschied von Teleologie und Monismus in weitesten Kreisen bald auf dasjenige Verständnis stoße, das man im Interesse des geistigen Fortschrittes wünschen muß.
MODERNE WELTANSCHAUUNG UND REAKTIONÄRER KURS
Es darf doch wohl als ein merkwürdiges Symptom der Zeit angesehen werden, daß gelegentlich des Jubiläums derjenlgen Körperschaft des Deutschen Reiches, welche die gelehrteste sein sollte, ein Theologe im Mittelpunkte des Festes stand. Zwar wird man sagen: der Professor Adolf Harnack sei ein freisinniger Theologe.
Aber eines bleibt doch wahr: die Theologie kann nur so weit freisinnig sein, als es ihr gewisse Grundanschauungen gestatten, ohne deren Anerkennung sie sich selbst aufheben würde. Ja, sie kann wissenschaftlich nur so weit sein, als ihr wesentlich zugehörige dogmatische Vorstellungen dies. erlaubeni Die Frage: «Ist die Theologie Wissenschaft im modernen Sinne?» kann nur mit einem klaren Nein beantwortet werdeni Die Wissenschaft muß, wenn sie diesen Namen verdienen soll, souverän, von der menschlichen Vernunft aus zu einer Weltanschauung kommen. Wir hören das zwar heute in allen Variationen immer und immer wieder betonen. Wenn aber eine wissenschaftliche Körperschaft ersten Ranges ein großes Fest feiert, dann erwählt sie sich nicht einen Mann der Wissenschaft, sondern einen Theologen zum Hauptsprecher und zum Darsteller ihrer Geschichte. Theologische Anschauungen spielten bei diesem Feste ja auch sonst eine so bedeutsame Rolle, daß die ultramontansten Preßorgane mit besonderer Freude von ihm sprechen.
Für viele unserer Zeitgenossen waren erst die schrillen Mißklänge der lex Heinze-Debatten notwendig, um sie zum Aufmerken darauf zu bringen, wie mächtig die reaktionärsten Gesinnungen in unser Leben eingreifen. Für feinere Zeichen, wie das heim Akademiefest zutage getretene, sind selbst die Artikelschreiber «freisinniger» Journale seelenblind.
Allerdings liegen die Gründe für den reaktionären Kurs der Gegenwart tief. Sie sind in der Tatsache zu suchen, daß die offiziellen Philosophen der Gegenwart absolut macht-, ja ratlos dem Ansturme unwissenschaftlicher Zeitströmungen entgegenstehen. Wir werden, um diese Gründe darzustellen, auf die Elemente blicken müssen, die den gegenwärtigen Bestand der Katheder-philosophie bewirkt haben. Meine Ansicht ist, daß diese Philosophie in der Tat ungeeignet ist, den Kampf gegen veraltete Vor-stellungen an der Seite der freiheitlichen Naturwissenschaft zu führen. Ich will bei dem Beweise für diese Behauptung von dem Manne ausgehen, der den tiefgreifendsten Einfluß auf das philosophische Denken der Gegenwart ausübt, auf Kant, und ich will versuchen zu zeigen, daß dieser Einfluß ein verderblicher ist.
I
Kant wurde durch die Bekanntschaft mit Humes Anschauung in der Überzeugung erschüttert, die er in früheren Jahren hatte. Daß wirklich alle unsere Erkenntnisse mit Hilfe der Erfahrung gewonnen werden, daran zweifelte er bald nicht mehr. Aber gewisse wissenschaftliche Lehrsätze schienen ihm doch einen solchen Charakter von Notwendigkeit zu haben, daß er an ein bloß gewohnheitsmäßiges Festhalten an denselben nicht glauben wollte. Kant konnte sich weder entschließen, den Radikalismus Humes mitzumachen, noch vermochte er bei den Bekennern der LeibnizWolffschen Wissenschaft zu bleiben. Jener schien ihm alles Wissen zu vernichten, in dieser fand er keinen wirklichen Inhalt. Richtig angesehen, stellte sich der Kantsche Kritizismus als ein Kompromiß zwischen Leibniz-Wolff einerseits und Hume andererseits heraus. Und die Kantsche Grundfrage lautet mit Rücksicht darauf: Wie können wir zu Urteilen kommen, die im Sinne von Leibniz und Wolff notwendig gültig sind, wenn wir zugleich zugeben, daß wir nur durch die Erfahmng zu einem wirklichen Inhalte unseres Wissens gelangen? Aus der in dieser Frage liegenden Tendenz läßt sich die Gestalt der Kantschen Philosophie begreifen. Hatte Kant einmal zugegeben, daß wir unsere Erkenntnisse aus der Erfahrung gewinnen, so mußte er der letzteren eine solche Gestalt geben, daß sie die Möglichkeit von allgemein- und notwendig-gültigen Urteilen nicht ausschloß. Das erreichte er dadurch, daß er unseren Wahrnehmungs- und Verstandesorganismus zu einer Macht erhob, der die Erfahrung miterzeugt. Unter dieser Voraus-setzung konnte er sagen: Was auch immer aus der Erfahrung von uns aufgenommen wird, es muß sich den Gesetzen fügen, nach denen unsere Sinnlichkeit und unser Verstand allein auffassen können. Was sich diesen Gesetzen nicht fügt, das kann für uns nie ein Gegenstand der Wahrnehmung werden. Was uns erscheint, das hängt also von den Dingen außer uns ab; wie uns die letzteren erscheinen, das ist von der Natur unseres Organismus bedingt. Die Gesetze, unter denen sich derselbe etwas vorstellen kann, sind somit die allgemeinsten Naturgesetze. In diesen liegt auch das
Notwendige und Allgemeingültige des Weltlaufes. Wir sehen: im Kantschen Sinne sind die Gegenstände nicht deshalb in räumlicher Anordnung, weil die Räumlichkeit eine ihnen zukommende Eigen-schaft ist, sondern weil der Raum eine Form ist, unter welcher unser Sinn die Dinge wahrzunehmen befähigt ist; zwei Ereignisse verknüpfen wir nicht deshalb nach dem Begriffe der Ursachlichkeit, weil dies einen Grund in der Wesenheit derselben hat, sondern weil unser Verstand so organisiert ist, daß er zwei in aufeinanderfolgenden Zeitmomenten wahrgenommene Prozesse diesem Begriff gemäß verknüpfen muß. So schreiben unsere Sinnlichkeit und unser Verstand der Erfahrungswelt die Gesetze vor. Und von diesen Gesetzen, die wir selbst in die Erscheinungen legen, können wir uns natürlich auch notwendig gültige Begriffe machen.
Klar ist es aber auch, daß diese Begriffe einen Inhalt nur von außen, von der Erfahrung erhalten können. An sich sind sie leer und bedeutungslos. Wir wissen durch sie zwar, wie uns ein Gegenstand erscheinen muß, wenn er uns überhaupt gegeben wird. Daß er uns aber gegeben wird, daß er in unseren Gesichtskreis eintritt, das hängt von der Erfahrung ab. Wie die Dinge an sich, abgesehen von unserer Erfahrung, sind, darüber können wir durch unsere Begriffe also nichts ausmachen.
Auf diese Weise hat Kant ein Gebiet gerettet, auf dem es Begriffe von notwendiger Geltung gibt, aber er hat zugleich die Möglichkeit abgeschnitten, mit Hilfe dieser Begriffe über die eigentliche, absolute Wesenheit der Dinge etwas auszumachen. Kant hat, um die Notwendigkeit unserer Begriffe zu retten, deren absolute Anwendbarkeit geopfert. Um der letzteren willen wurde aber die erstere in der Vor-Kantschen Philosophie geschätzt. Kants Vorgänger wollten aus der Gesamtheit unseres Wissens einen zentralen Kern bloßlegen, der seiner Natur nach auf alles, also auch auf die absoluten Wesenheiten der Dinge, auf das «Innere der Natur», anwendbar ist. Das Ergebnis der Kantschen Philosophie ist aber, daß dieses Innere, dieses «An sich der Objekte», niemals in den Bereich unserer Erkenntnis treten, nie ein Gcgenstand unseres Wissens werden kann. Wir müssen uns mit der subjektiven
Erscheinungswelt begnügen, welche in uns entsteht, wenn die Außenwelt auf uns einwirkt. Kant setzt also unserem Erkenntnisvermögen unübersteigliche Schranken. Von dem können wir nichts wissen. Ein offizieller Philosoph der Gegenwart hat dieser Ansicht folgenden präzisen Ausdruck gegeben: «Solange das Kunststück, um die Ecke zu schauen, das heißt ohne Vorstellung vorzustellen, nicht erfunden ist, wird es bei der stolzen Selbstbescheidenheit Kants sein Bewenden haben, daß vom Seienden dessen Daß, niemals aber dessen Was erkennbar ist», das heißt wir wissen, daß etwas da ist, welches die subjektive Erscheinung des Dinges in uns bewirkt, was aber hinter der letzteren eigentlich steckt, bleibt uns verborgen.
Wir haben gesehen, daß Kant diese Ansicht angenommen hat, um von jeder der zwei entgegengesetzten philosophischen Lehren, von denen er ausging, möglichst viel zu retten. Aus dieser Tendenz heraus entwickelte sich eine gekünstelte Auffassung unseres Erkennens, die wir nur mit dem zu vergleichen brauchen, was die unmittelbare und unbefangene Beobachtung ergibt, um die ganze Haltlosigkeit des Kantschen Gedankengebäudes einzusehen. Kant denkt sich unsere Erfahrungserkenntnis aus zwei Faktoren zustande gekommen: aus den Eindrücken, welche die Dinge außer uns auf unsere Sinnlichkeit machen, und aus den Formen, in denen unsere Sinnlichkeit und unser Verstand diese Eindrücke anordnen. Die ersteren sind subjektiv, denn ich nehme nicht das Ding wahr, sondern nur die Art und Weise, wie meine Sinnlichkeit davon affiziert wird. Mein Organismus erleidet eine Veränderung, wenn von außen etwas einwirkt. Diese Veränderung, also ein Zustand meines Selbst, meine Empfindung ist es, was mir gegeben ist. Im Akte des Auffassens nun ordnet unsere Sinnlichkeit diese Empfindungen räumlich und zeitlich, der Verstand wieder das Räumliche und Zeitliche nach Begriffen. Auch diese Gliederung der Empfindungen, der zweite Faktor unseres Erkennens, ist somit ganz und gar subjektiv. Diese Theorie ist weiter nichts als eine willkürliche Gedankenkonstruktion, die vor der Beobachtung nicht standhalten kann. Legen wir uns einmal zuerst die Frage vor: Tritt irgendwo für uns eine einzelne Empfindung auf, einzeln für sich
und abgesondert von anderen Elementen der Erfahrung? Blicken wir auf den Inhalt der uns gegebenen Welt. Er ist eine kontinuierliche Ganzheit. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf irgendeinen Punkt unseres Erfahrungsgebietes richten, so finden wir, daß sich ringsherum anderes anschließt. Ein Abgesondertes, für sich allein Bestehendes gibt es hier nirgends. Eine Empfindung schließt sich an die andere. Wir können sie nur künstlich herausheben aus unserer Erfahrung, in Wahrheit ist sie mit dem Ganzen der uns gegebenen Wirklichkeit verbunden. Hier liegt ein Fehler, den Kant gemacht hat. Er harte eine ganz falsche Vorstellung von der Beschaffenheit unserer Erfahrung. Die letztere besteht nicht, wie er glaubt, aus unendlich vielen Mosaiksteinchen, aus denen wir durch rein subjektive Vorgänge ein Ganzes machen, sondern sie ist uns als eine Einheit gegeben: eine Wahrnehmung geht in die andere ohne bestimmte Grenze über.
II
Die Gründe der Reaktion innerhalb der modernen Wissenschaft
Eine Weltanschauung strebt darnach, die Gesamtheit der uns gegebenen Erscheinungen zu begreifen. Wir können aber stets nur Einzelheiten der Wirklichkeit zum Gegenstande unserer Erfahrungserkenntnis machen. Wollen wir eine Einzelheit für sich abgesondert betrachten, dann müssen wir sie erst künstlich aus dem Zusammenhange herausheben, in dem sie sich befindet. Nirgends ist uns zum Beispiel die Einzelempfindung des Rot als solche gegeben, allseitig ist sie von anderen Qualitäten umgeben, zu denen sie gehört und ohne die sie nicht bestehen könnte. Wir müssen von allem übrigen absehen und unsere Aufmerksamkeit auf die eine Wahrnehmung richten, wenn wir sie in ihrer Vereinzelung betrachten wollen. Dieses Herausheben eines Dinges aus seinem Zusammenhange ist für uns eine Notwendigkeit, wenn wir die Welt überhaupt betrachten wollen. Wir sind so organisiert, daß wir die Welt nicht als Ganzes, als eine einzige Wahrnehmung auffassen können. Das Rechts und Links, das Oben und Unten,
das Rot neben dem Grün in meinem Gesichtsfelde sind in Wirklichkeit in ununterbrochener Verbindung und gegenseitiger Zu-sammengehörigkeit. Wir können den Blick aber nur nach einer Richtung wenden und das in der Natur Verbundene nur getrennt wahrnehmen. Unser Auge kann immer nur einzelne Farben aus einem vielgliedrigen Farbenganzen wahrnehmen, unser Verstand einzelne Begriffsglieder aus einem in sich zusammenhängenden Ideengebäude. Die Absonderung einer Einzelempfindung aus dem Weltzusammenhange ist somit ein seelischer Akt, bedingt durch die eigentümliche Einrichtung unseres Geistes. Wir müssen die einheitliche Welt in Einzelempfindungen auflösen, wenn wir sie betrachten wollen.
Wir müssen uns aber darüber klar sein, daß diese unendliche Vielheit und Vereinzelung in Wahrheit gar nicht besteht, daß sie ohne alle objektive Bedeutung für die Wirklichkeit selbst ist. Wir schaffen ein zunächst von der Wirklichkeit abweichendes Bild derselben, weil uns die Organe fehlen, sie in ihrer ureigenen Gestalt in einem Akte aufzufassen. Aber das Trennen ist nur der eine Teil unseres Erkenntnisprozesses. Wir sind beständig damit beschäftigt, jede Einzelwahrnehmung, die an uns herantritt, einer Gesamtvorstellung einzuverleiben, die wir uns von der Welt machen.
Die sich hier notwendig anschließende Frage ist nun die: Nach welchen Gesetzen verknüpfen wir das, was wir erst getrennt haben? Die Trennung ist eine Folge unserer Organisation, sie hat mit der Sache selbst nichts zu tun. Deshalb kann auch der Inhalt einer Einzelwahrnehmung durch den Umstand nicht verändert werden, daß sie für uns zunächst aus dem Zusainmenhange gerissen erscheint, in den sie gehört. Da aber dieser Inhalt durch den Zusammenhang bedingt ist, so erscheint er in seiner Absonderung zunächst ganz unverständlich. Daß an einer bestimmten Stelle des Raumes gerade die Wahrnehmung des Rot auftrete, ist von den mannigfaltigsten Umständen bewirkt. Wenn ich nun das Rot wahrnehme, ohne gleichzeitig auf diese Umstände meine Aufmerksamkeit zu richten, so bleibt es mir unverständlich, woher das Rot kommt. Erst wenn ich andere Wahrnehmungen heranziehe, und zwar solche Dinge und Vorgänge, an die sich jene Wahrnehmung
des Rot anshließt, dann verstehe ich die Sache. Jede Wahrnehmung weist mich also über sich selbst hinaus, weil sie aus sich selbst nicht zu erklären ist. Ich verbinde deswegen die durch meine Organisation aus dem Weltganzen abgesonderten Einzelheiten gemäß ihrer eigenen Natur zu einem Ganzen. In diesem zweiten Akte wird somit das wiederhergestellt, was in dem ersten zerstört wurde: die Einheit des Wirklichen tritt wieder in ihr Recht gegenüber der von meinem Geiste zunächst in sich aufgenommenen Vielheit.
Der Grund, warum wir uns der objektiven Gestalt der Welt nur auf dem gekennzeichneten Umwege bemächtigen können, liegt in der Doppelnatur des Menschen. Als vernünftiges Wesen ist er sehr wohl imstande, sich den Kosmos als eine Einheit vorzustellen, in der jedes Einzelne als Glied des Ganzen erscheint. Als sinnliches Wesen jedoch ist er an Ort und Zeit gebunden, er kann nur einzelne der unendlich vielen Glieder des Kosmos wahrnehmen. Die Erfahrung kann daher nur eine durch die Beschränktheit unserer Individualität bedingte Gestalt der Wirklichkeit liefern, aus welcher die Vernunft erst das gewinnen muß, was den einzelnen Dingen und Vorgängen innerhalb der Wirklichkeit ihren gesetzmäßigen Zusammenhang gibt. Die sinnenfällige Anschauung entfernt uns also von der Wirklichkeit, die vernünftige Betrachtung führt uns darauf wieder zurück. Ein Wesen, dessen Sinnlichkeit in einem Akte die Welt anschauen könnte, bedürfte der Vernunft nicht. Ihm lieferte eine einzelne Wahrnehmung, was wir mit unserer geistigen Organisation nur durch das Zusammenfassen unendlich vieler einzelner Erfahrungsakte erreichen können.
Die eben angestellte Untersuchung unseres Erkenntnisvermögens führt uns zu der Ansicht, daß die Vernunft uns die eigentliche Gestalt der Wirklichkeit liefert, wenn sie die einzelnen Erfahrungserkenntnisse in entsprechender Weise verarbeitet. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen durch den Umstand, daß die Vernunft scheinbar ganz innerhalb unseres Selbst liegt. Wir haben gesehen, daß in Wahrheit ihre Tätigkeit dazu bestimmt ist, gerade den unwirklichen Charakter, den unsere Erfahrung durch die sinnliche Wahrnehmung erhält, aufzuheben. Durch diese Tätigkeit
stellen die Wahrnehmungsinhalte selbst in unserem Geiste den objektiven Zusammenhang wieder her, aus dem sie unsere Sinne gerissen haben.
Wir sind nun an dem Punkte, wo wir das Irrtümliche der Kant-schen Auffassung durchschauen können. Was eine Folge unserer Organisation ist: das Auftreten der Wirklichkeit als unendlich viele getrennte Einzelheiten, das faßt Kant als objektiven Tatbestand auf; und die Verbindung, die sich wieder herstellt, weil sie der objektiven Wahrheit entspricht, die ist ihm eine Folge unserer subjektiven Organisation. Gerade das Umgekehrte von dem ist wahr, was Kant behauptet hat. Ursache und Wirkung zum Beispiel sind ein zummengehöriges Ganzes. Ich nehme sie getrennt wahr und verbinde sie in der Weise, wie sie selbst zueinander streben. Kant hat sich durch Hume in den Irrtum hineintreiben lassen. Letzterer sagt: Wenn wir zwei Ereignisse immer und immer wieder in der Weise wahrnehmen, daß das eine auf das andere folgt, so gewöhnen wir uns an dieses Zusammensein, erwarten es auch in künftigen Fällen und bezeichnen das eine als Ursache, das andere als Wirkung. - Das widerspricht den Tatsachen. Wir bringen zwei Ereignisse nur dann in eine ursächliche Verbindung, wenn eine solche aus ihrem Inhalte folgt. Diese Verbindung ist nicht weniger gegeben als der Inhalt der Ereignisse selbst.
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet findet die alltäglichste sowohl wie die höchste wissenschaftliche Denkarbeit ihre Erklärung. Könnten wir die ganze Welt mit einem Blick umspannen, dann wäre diese Arbeit nicht notwendig. Ein Ding erklären, verständiich machen heißt nichts anderes, als es wieder in den Zusammenhang hineinsetzen, aus dem es unsere Organisation herausgerissen hat. Ein Ding, das an sich vom Weltganzen abgetrennt ist, gibt es nicht. Alle Sonderung hat bloß eine subjektive Geltung für uns. Für uns legt sich das Weltganze auseinander in Oben und Unten, Vor und Nach, Ursache und Wirkung, Gegenstand und Vorstellung, Stoff und Kraft, Objekt und Subjekt und so weiter. Alle diese Gegensätze sind aber nur möglich, wenn uns das Ganze, an dem sie auftreten, als Wirklichkeit gegenübertritt. Wo das nicht der Fall ist, können wir auch nicht von Gegensätzen sprechen.
Ein unmöglicher Gegensatz ist der, den Kant als «Erscheinung» und Solange wir mit solchen willkürlichen Annahmen, wie das Die Rätselhaftigkeit eines Dinges besteht nur, solange wir es in seiner Besonderheit betrachten. Diese ist aber von uns hervorgebracht und kann auch von uns wieder aufgehoben werden. Eine Wissenschaft, welche die Natur des menschlichen Erkenntnis-prozesses versteht, kann nur so verfahren, daß sie alles, was sie zur Erklärung einer Erscheinung braucht, auch innerhalb der uns gegebenen Welt sucht. Eine solche Wissenschaft kann als Monismus oder einheitliche Naturauffassung bezeichnet werden. Ihr steht der Dualismus oder die Zweiweltentheorie gegenüber, welche zwei voneinander absolut verschiedene Welten annimmt und die Erklärungsprinzipien für die eine in der andern enthalten glaubt.
Diese letztere Lehre beruht auf einer falschen Auslegung der Tatsachen unseres Erkenntnisprozesses. Der Dualist trennt die Summe alles Seins in zwei Gebiete, von denen jedes seine eigenen Gesetze hat und die einander äußerlich gegenüberstehen. Er vergißt, daß jede Trennung, jede Absonderung der einzelnen Seinsgebiete
nur eine subjektive Geltung hat. Was eine Folge seiner Organisation ist, das hält er für eine außer ihm liegende objektive Naturtatsache.
Ein solcher Dualismus ist auch der Kantianismus. Denn für diese Weltanschauung sind Erscheinung und «An sich der Dinge» nicht Gegensätze innerhalb der gegebenen Welt, sondern die eine Seite, das «An sich», liegt außerhalb des Gegebenen. Solange wir das letztere in Teile trennen, mögen dieselben noch so klein sein im Verhältnis zum Universum, folgen wir einfach einem Gesetze unserer Persöniichkeit; betrachten wir aber alles Gegebene, alle Erscheinungen als den einen Teil und stellen ihm dann einen zweiten entgegen, dann philosophieren wir ins Blaue hinein. Wir haben es dann mit einem bloßen Spiel mit Begriffen zu tun. Wir konstruieren einen Gegensatz, können aber für das zweite Glied keinen Inhalt gewinnen, denn ein solcher kann nur aus dem Gegebenen geschöpft werden. Jede Art des Seins, die außerhalb des letzteren angenommen wird, ist in das Gebiet der unberechtigten Hypothesen zu verweisen. In diese Kategorie gehört das Kantsche «Ding an sich» und nicht weniger die Vorstellung, welche ein großer Teil der modernen Physiker von der Materie und deren atomistischer Zusammensetzung hat. Wenn mir irgendeine Sinnesempfindung gegeben ist, zum Beispiel Farbe- oder Wärme-Empfindung, dann kann ich innerhalb dieser Empfindung qualitative und quantitative Sonderungen vornehmen; ich kann die räumliche Gliederung und den zeitlichen Verlauf, die ich wahrnehme, mit mathematischen Formeln umspannen, ich kann die Erscheinungen gemäß ihrer Natur als Ursache und Wirkung ansehen und so weiter: ich muß aber mit diesem meinem Denkprozesse innerhalb dessen bleiben, was mir gegeben ist. Wenn wir eine sorgfältige Selbstkritik an uns üben, so finden wir auch, daß alle unsere abstrakten Anschauungen und Begriffe nur einseitige Bilder der gegebenen Wirklichkeit sind und nur als solche Sinn und Bedeutung haben. Wir können uns einen allseitig geschlossenen Raum vorstellen, in dem sich eine Menge elastischer Kugeln nach allen Richtungen bewegt, die sich gegenseitig stoßen, an die Wände an- und von diesen abprallen; aber wir müssen uns darüber
klar sein, daß dies eine einseitige Vorstellung ist, die einen Sinn erst gewinnt, wenn wir uns das rein mathematische Bild mit einem sinnenfällig wirklichen Inhalt erfüllt denken. Wenn wir aber glauben, einen wahrgenommenen Inhalt ursächlich durch einen unwahrnehrnbaren Seinsprozeß, der dem geschilderten mathematischen Gebilde entspricht und der außerhalb unserer gegebenen Welt sich abspielt, erklären zu können, so fehlt uns jede Selbst-kritik. Den beschriebenen Fehler macht die moderne mechanische Wärmetheorie. Wenn wir sagen, das zusammenhängen, nur subjektiv. Sobald wir etwas von der in sich zusammenhängenden Wahrnehmungswelt in den Geist hereinnehmen, so müssen wir alles, auch die Atome und ihre Bewegungen, hereinnehmen. Wir müßten die ganze Außenwelt leugnen.
Ganz dasselbe kann in bezug auf die moderne Farbentheorie gesagt werden. Auch sie verlegt etwas, was nur ein einseitiges Bild der Sinnenwelt ist, hinter diese als Ursache derselben. Die ganze Wellentheorie des Lichtes ist nur ein mathematisches Bild, das die räumlich-zeitlichen Verhältnisse dieses bestimmten Erscheinungsgebietes einseitig darstellt. Die Undulationstheorie macht dieses Bild zu einer realen Wirklichkeit, die nicht mehr wahrgenommen werden kann, sondern die vielmehr die Ursache dessen sein soll, was wir wahrnehmen.
III
Die Gründe der Reaktion innerhalb der Wissenschaft
Es ist nun gar nicht zu verwundern, daß es dem dualistischen Denker nicht gelingt, den Zusammenhang zwischen den beiden von ihm angenommenen Welten - der subjektiven in uns und der objektiven außer uns - begreiflich zu machen. Die eine ist ihm
erfahrungsmäßig gegeben, die andere von ihm hinzugedacht. Er kann also auch folgerichüg alles, was die eine enthält, nur durch Erfahrung, was in der andem enthalten ist, nur durch Denken gewinnen. Da aber aller Erfahrungsinhalt nur eine Wirkung des hinzugedachten wahren Seins ist, so kann in der unserer Beobachtung zugänglichen Welt nie die Ursache selbst gefunden werden. Ebensowenig ist das Umgekehrte möglich: aus der gedachten Ursache die erfahrungsmäßig gegebene Wirklichkeit abzuleiten. Dies letztere deshalb nicht, weil nach unseren bisherigen Auseinandersetzungen alle solche erdachten Ursachen nur einseitige Bilder der vollen Wirklichkeit sind. Wenn wir ein solches Bild überblicken, so können wir mittels eines bloßen Gedankenprozesses nie das darin finden, was nur in der beobachteten Wirklichkeit damit verbunden ist. Aus diesen Gründen wird derjenige, welcher zwei Welten annimmt, die durch sich selbst getrennt sind, niemals zu einer befriedigenden Erklärung ihrer Wechselbeziehung kommen können.
Wer die eigentlichen wirklichen Wesenheiten außerhalb der Welt der Erfahrung ihr Wesen treiben läßt, der setzt unserer Erkenntnis Grenzen. Denn wir nähmen, wenn seine Voraussetzung richtig ist, nur die Wirkung wahr, welche die wirklichen Wesen auf uns ausüben. Diese, als die Ursachen, sind ein uns gänzlich unbekanntes Land. Und hiermit sind wir bei der Pforte angelangt, wo die moderne Wissenschaft alle alten religiösen Vorstellungen einlassen kann. Bis hierher und nicht weiter, sagt diese Wissenschaft. Warum sollte der Herr Pastor mit seinem Glauben nun nicht dort anfangen, wo Du Bois-Reymond mit seinem wissenschaftlichen Erkennen aufhört.
Der Anhänger der monistischen Weltanschauung weiß, daß die Ursachen zu den ihm gegebenen Wirkungen im Bereiche seiner Welt liegen müssen. Mögen die ersteren von den letzteren räumlich oder zeitlich noch so weit entfernt liegen: sie müssen sich im Bereiche der Erfahrung finden. Der Umstand, daß von zwei Dingen, die einander gegenseitig erklären, ihm augenblicklich nur das eine gegeben ist, erscheint ihm nur als eine Folge seiner Individualität, nicht als etwas im Objekte selbst Begründetes. Der Bekenner
einer dualistischen Ansicht glaubt die Erklärung für ein Bekanntes in einem willkürlich hinzugedachten Unbekannten annehmen zu müssen. Da er dieses letztere unberechtigterweise mit solchen Eigenschaften ausstattet, daß es sich in unserer ganzen Welt nicht finden kann, so statuiert er hier eine Grenze des Erkennens. Unsere Auseinandersetzungen haben den Beweis geliefert, daß alle Dinge, zu denen unser Erkenntnisvermögen angeblich nicht gelangen kann, erst zu der Wirklichkeit künstlich hinzugedacht werden müssen. Wir erkennen nur dasjenige nicht, was wir erst unerkennbar gemacht haben. Kant gebietet unserem Erkennen Halt vor einem Geschöpfe seiner Phantasie, vor dem « Ding an sich», und Du Bois-Reymond stellt fest, daß die unwahrnehmbaren Atome der Materie durch ihre Lage und Bewegung Empfindung und Gefühl erzeugen, um dann zu dem Schlusse zu kommen: wir können niemals zu einer befriedigenden Erklärung darüber gelangen, wie Materie und Bewegung Empfindung und Gefühl erzeugen, denn «es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammenwirken Bewußtsein entstehen könne». Diese ganze Schlußfolgerung fällt in nichts zusammen, wenn man erwägt, daß die sich bewegenden und in bestimmter Weise gelagerten Atome ein Geschöpf des abstrahierenden Verstandes sind, dem ein absolutes, von dem wahrnehmbaren Geschehen abgesondertes Dasein gar nicht zugeschrieben werden darf.
Eine wissenschaftliche Zergliederung unserer Erkenntnistätigkeit führt, wie wir gesehen haben, zu der Überzeugung, daß die Fragen, die wir an die Natur zu stellen haben, eine Folge des eigentümlichen Verhältnisses sind, in dem wir zur Welt stehen. Wir sind beschränkte Individualitäten und können deshalb die Welt nur stückweise wahrnehmen. Jedes Stück an und für sich betrachtet ist ein Rätsel oder anders ausgedrückt eine Frage für unser Erkennen. Je mehr der Einzelheiten wir aber kennenlernen, desto klarer wird uns die Welt. Eine Wahrnehmung erklärt die
andere. Fragen, welche die Welt an uns stellt und die mit den Mitteln, die sie uns bietet, nicht zu beantworten wären, gibt es nicht. Für den Monismus existieren demnach keine prinzipiellen Erkenntnisgrenzen. Es kann zu irgendeiner Zeit dies oder jenes unaufgeklärt sein, weil wir zeitlich oder räumlich noch nicht in der Lage waren, die Dinge aufzufinden, welche dabei im Spiele sind. Aber was heute noch nicht gefunden ist, kann es morgen werden. Die hierdurch bedingten Grenzen sind nur zufällige, die mit dem Fortschreiten der Erfahrung und des Denkens verschwinden. In solchen Fällen tritt dann die Hypothesenbildung in ihr Recht ein. Hypothesen dürfen nicht über etwas aufgestellt werden, das unserer Erkenntnis prinzipiell unzugänglich sein soll. Die atomistische Hypothese ist eine völlig unbegründete, wenn sie nicht bloß als ein Hilfsmittel des abstrahierenden Verstandes, sondern als eine Aussage über wirkliche, außerhalb der Empfindungsqualitäten liegende wirkliche Wesen gedacht werden soll. Eine Hypothese kann nur eine Annahme über einen Tatbestand sein, der uns aus zufälligen Gründen nicht zugänglich ist, der aber seinem Wesen nach der uns gegebenen Welt angehört. Berechtigt ist zum Beispiel eine Hypothese über einen bestimmten Zustand unserer Erde in einer längst verflossenen Periode. Zwar kann dieser Zustand nie Objekt der Erfahrung werden, weil mittlerweile ganz andere Bedingungen eingetreten sind. Wenn aber ein wahrnehmendes Individuum zu der vorausgesetzten Zeit dagewesen wäre, dann hätte es den Zustand wahrgenommen. Unberechtigt dagegen ist die Hypothese, daß alle Empfindungsqualitäten nur quantitativen Vorgängen ihre Entstehung verdanken, weil qualitätslose Vorgänge nicht wahrgenommen werden können.
Der Monismus oder die einheitliche Naturerklärung geht aus einer kritischen Selbstbetrachtung des Menschen hervor. Diese Betrachtung führt uns zur Ablehnung aller außerhalb der Welt gelegenen erklärenden Ursachen derselben. Wir können diese Auffassung aber auch auf das praktische Verhältnis des Menschen zur Welt ausdehnen. Das menschliche Handeln ist ja nur ein spezieller Fall des allgemeinen Weltgeschehens. Seine Erklärungsprinzipien dürfen daher gleichfalls nur innerhalb der uns gegebenen
Welt gesucht werdeni Der Dualismus, der die Grtmdkräfte der uns vorliegenden Wirklichh:eit in einem uns unzugänglichen Reiche sucht, versetzt dahin auch die Gebote und Normen unseres Handelns. Auch Kant ist in diesem Irrtume befangen. Er hält das Sittengesetz für ein Gebot, das von einer uns fremden Welt dem Menschen auferlegt ist, für einen kategorischen Imperativ, dem er sich zu fügen hat, auch dann, wenn seine eigene Natur Neigungen entfaltet, die einer solchen aus einem Jenseits in unser Diesseits hereintönenden Stimme sich widersetzen. Man braucht sich nur an Kants bekannte Apostrophe an die Pflicht zu erinnern um das erhärtet zu finden: «Pflicht! du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst», der du «ein Gesetz aufstellst. .., vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich insgeheim ihm entgegenwirken.» Einem solchen von außen der menschlichen Natur aufgedrungenen Imperativ setzt der Monismus die aus der Menschenseele selbst geborenen sittlichen Motive entgegen. Es ist eine Täuschung, wenn man glaubt, der Mensch könne nach anderen als selbstgemachten Geboten handeln. Die jeweiligen Neigungen und Kulrurbedürfnisse erzeugen gewisse Ma::imen, die wir als unsere sittlichen Grundsätze bezeichnen. Da gewisse Zeitalter oder Völker ähnliche Neigungen und Bestrebungen haben, so werden die Menschen, die denselben angehören, auch ähnliche Grundsätze aufstellen, um sie zu befriedigen. Jedenfalls aber sind solche Grundsätze, die dann als ethische Motive wirken, durchaus nicht von außen eingepflanzt, sondern aus den Bedürfnissen heraus geboren, also innerhalb der Wirklichkeit erzeugt, in der wir leben. Der Moralkodex eines Zeitalters oder Volkes ist einfach der Ausdruck dafür, wie Anpassung und Vererbung innerhalb der ethischen Natur des Menschen wirken. So wie die Natuuwirkungen aus Ursachen entspringen, die innerhalb der gegebenen Natur liegen, so sind unsere sittlichen Handlungen die Ergebnisse von Motiven, die innerhalb unseres Kulturprozesses liegen. Der Monismus sucht also den Grund unserer Handlungen im strengsten Sinne des Wortes innerhalb der Natur. Er macht dadurch den Menschen aber auch zu seinem eigenen Gesetzgeber
Der Mensch hat keine andere Norm als die aus den Naturgesetzen sich ergebenden Notwendigkeiten. Er setzt die Wirkungen der Natur im Gebiete des sittlichen Handelns fort.
Der Dualismus fordert Unterwerfung unter die von irgendwoher geholten sittlichen Gebote; der Monismus weist den Menschen auf sich selbst und auf die Natur, also auf seine autonome Wesenheit. Er macht ihn zum Herrn seiner selbst. Erst vom Standpunkte des Monismus aus können wir den Menschen als wahrhaft freies Wesen im ethischen Sinne auffassen. Nicht von einem anderen Wesen stammende Pflichten sind ihm auferlegt, sondern sein Handeln richtet sich einfach nach den Grundsätzen, von denen jeder findet, daß sie ihn zu den Zielen führen, die von ihm als erstrebenswert angesehen werden. Eine dem Boden des Monismus entsprungene sittliche Anschauung ist die Feindin alles blinden Autoritätsglaubens. Der autonome Mensch folgt eben nicht der Richtschnur, von der er bloß glauben soll, daß sie ihn zum Ziele führt, sondern er muß einsehen, daß sie ihn dahin führe, und das Ziel selbst muß ihm individuell als ein erwünschtes erscheinen.
Der autonome Mensch will nach Gesetzen regiert werden, die er sich selbst gegeben hat. Er hat nur eine einzige Vorbilderin - die Natur. Er setzt das Geschehen da fort, wo die unter ihm stehende organische Natur stehengeblieben ist. Unsere ethischen Grundsätze finden sich vorgebildet auf primitiverer Stufe in den Instinkten der Tiere. Kein kategorischer Imperativ ist etwas anderes als ein entwickelter Instinkt.
IV
Wahrhaft lähmend auf die Ausbildung eines allseitig ausgreifenden Denkens hat die durch den «Rückgang zu Kant» bewirkte Annahme von Grenzen des menschlichen Erkennens gewirkt Gedeihen kann eine vorurteilslose Weltanschauung nur, wenn das Denken den Mut hat, bis in die letzten Schlupfwinkel des Seins, bis auf die Höhen der Wesenheiten zu dringen. Die reaktionären Weltanschauungen werden immer ihre Rechnung finden, wenn
sich das Denken selbst seine Flügel beschneidet. Eine Erkenntnislehre, die von einem unerkennbaren Man versuche es, sich auszumalen, wo wir heute stünden, wenn wir in den letzten Jahrzehnten in unseren höheren Bildungsstätten nicht die Lehre von allen möglichen Erkenntnisgrenzen gehabt härten, sondern die Goethesche Forschergesinnung, in jedem Augenblicke mit dem Denken so weit zu dringen, als es die Erfahrungen gestatten, und alles übrige als Problem nicht als unerkennbar hinzustellen, sondern ruhig der Zukunft zu überlassen. Bei einer solchen Maxime hätte die Philosophie den in den fünfziger Jahren zwar etwas ungeschickt, aber doch in nicht unrichtiger Weise begonnenen Streit gegen den theologischen Glauben bis heute zu einem schönen Punkte bringen können. Wir wären vielleicht doch heute so weit, die theologischen Fakultäten mit einem Lächeln wie lebendige Anachronismen zu betrachten. Theologisierende Philosophen, wie zum Beispiel Lotze, haben unerhörtes Unglück angerichtet. Ihnen hat die Ungeschicklichkeit eines Carl Vogt, der auf dem ganz richtigen Wege war, das Spiel leicht ge-macht. 0, dieser Vogt! Hätte er doch statt des unglückseligen Vergleiches: die Gedanken verhalten sich zu dem Gehirn wie der Urin zu den Nieren, einen besseren gewählt. Man konnte ihm leicht einwenden, die Nieren sondern Stoff ab; kann man den Gedanken mit einem Stoff vergleichen? Und wenn, muß nicht das Abgesonderte schon vor der Absonderung in einer bestimmten
Form vorhanden sein? Nein, Vogt der Dicke hätte sagen müssen, die Gedanken verhalten sich zu den Gehirnvorgängen wie die bei einem Reibungsvorgang entwickelte Wärme zu diesem Reibungsvorgang. Sie sind eine Funktion des Gehirns, nicht ein von ihm abgesonderter Stoff. Da hätte der biedere philosophische Struwwel-peter Lotze nichts einwenden können. Denn ein solcher Vergleich hält allen Tatsachen stand, die sich nach naturwiseensahaftlicher Methode über den Zusammenhmg von Gehirn und Denken feststellen lassen. Die Materialisten der fünfziger Jahre führten einen ungeschickten Vorpostenkampf. Dann kamen die Die Reaktion auf allen Gebieten des Lebens macht sich heute wieder breit. Und die Erkenntnis, die die einzige wirkliche Kämpferin gegen sie sein kann, hat sich die Hände gebunden. Was nützt es, daß der Naturforscher in seinem Laboratorium und auf seiner Lehrkanzel seinen Schülern die Augen über die Gesetze der Natur öffnet, wenn sein Kollege, der Philosoph, doch sagt: alles, was ihr da von dem Naturforscher hört, ist nur Außenwerk, ist Erscheinung, bis über eine gewisse Grenze kann unser Wissen nicht dringen. Ich muß gestehen, daß es für mich unter solchen Verhältnissen kein Wunder ist, wenn neben der fortgeschrittensten Wissenschaft der blindeste Köhlerglaube sein Haupt kühn erhebt. Weil die Wissenschaft mutlos ist, ist das Leben reaktionär. Kämpfer sollt ihr sein, ihr Philosophen, vordringen sollt ihr immer weiter ins Unbegrenzte. Aber nicht Aufpasser sollt ihr abgeben, damit die moderne Weltanschauung die Grenzen nicht überschreite, über die die veraltete Theologie doch in jedem Augenblick hinausgeht. Es ist doch wahrlich sonderbar, daß die Pfarrer jeden Tag die Geheimnisse derjenigen Welt enthüllen dürfen, über die der vorurteilslose Denker sorgsarnes Schweigen sich auferlegen soll. Je feiger die Philosophie ist, desto kühner ist die Theologie. Und gar die Ansichten, die über das Wesen unserer Schulen herrschen. Man sucht womöglich alles aus dem Unterrichte fernzuhalten, was die Naturwissenschaft als Weltanschauungskonsequenz an ihre festgestellten Tatsachen knüpft, weil in
die Schule unbewiesene Hypothesen - wie man sagt - nicht gehören, sondern nur unbedingt sichere Tatsachen. Aber in dem Religionsunterricht! Ja, Bauer, das ist etwas anderes. Da dürfen die «unbewiesenen» Glaubensirrtikel ruhig weiter kultiviert werden. Der Religionslehrer, der weiß, wovon der Geologe
DIE KÄMPFE UM HAECKELS «WELTRÄTSEL»
Ein Ereignis, das tief im Geistesleben unserer Zeit wurzelnde Gegensätze in ihrer schroffsten Form an die Oberfläche des literarischen Kampfes gebracht hat, sahen wir in den letzten Monaten sich abspielen. Der Mann, der vor nahezu vier Jahrzehnten mit seltenem Denkermute die folgenschweren Gedanken Darwins über die Entstehung der Lebewesen zur umfassenden Weltanschauung ausgebildet hat, ist mit einer Schrift: hervorgetreten. Ernst Haeckel wollte in diesem Buche eine «kritische Beleuchtung» der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit für weitere gebildete Kreise geben und auf Grund seiner reichen Forscherarbeit die Frage beantworten: «Welche Stufe in der Erkenntnis der Wahrheit haben wir am Ende des neunzehnten Jahrhunderts wirklich erreicht? Und welche Fortschritte nach unserm unendlich fernen Ziele haben wir im Laufe desselben wirklich
gemacht?»* Über die Ausführungen des Vorkämpfers der Darwinschen Vorstellungsart hat sich nun ein Kampf erhoben, dessen hervorstechendste Eigenschaft die ist, daß er nicht im Tone ruhiger leidenschaftsloser Auseinandersetzung, sondern in erbitterter, stürmischer Art geführt wird. Nicht logische Verirrungen, nicht unbewiesene Behauptungen, nicht Erkenntnisfehler allein sind es, die Ernst Haeckel zum Vorwurf gemacht worden sind, sondern das wissenschaftliche Gewissen, der moralische Sinn, die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Forschen überhaupt sind ihm abgesprochen worden. Darwin hat von Haeckels «Natürlicher Schöpfungsgeschichte» gesagt: «Wäre dieses Buch erschienen, ehe meine Arbeit (über die (Abstammung des Menschern) geschrieben war, würde ich sie wahrscheinlich nie zu Ende geführt haben; fast alle Folgerungen, zu denen ich gekommen bin, finde ich durch diesen Forscher bestätigt, dessen Kenntnisse in vielen Punkten viel reicher sind als meine» (Einleitung des Werkes (Abstammung des Menschen).
Und jetzt, da dieser von dem großen Reformator der Naturwissenschaft einst in dieser Weise ausgezeichnete Forscher die Summe seiner Lebensarbeit in einer abschließenden Schrift zieht, sehen wir ihn in der maßlosesten Weise von vielen Seiten geradezu als den Typus eines Denkers hingestellt, wie er nicht sein soll. Denn die Richtung, in welcher der ganze Kampf geführt wird, ist durchaus charakterisiert durch die Worte, die einer seiner Gegner, der in weiten Kreisen angesehene Philosoph Friedrich Paulsen, im Julihefr der «Preußischen Jahrbücher» gebraucht hat. «Es war nicht Freude an dem Inhalt, es war vielmehr Indignation, die mich ... zu lesen trieb, die Indignation über die Leichtfertigkeit, womit hier von ernsten Dingen gehandelt wurde. Daß es ein Mann von Ruf war, der hier sprach, ein Mann, den Tausende als Führer verehren, der selbst mit Stolz in Anspruch nimmt, dem
* Der Verfasser dieses Aufsatzes hat die Bedeutung der Haeckelschen Weltanschauung und ihre Stellung im gegenwärtigen Geistesleben bereits einmal vor dem Erscheinen der «Welträtsel» nach dem damaligen Stande der Sachlage in dieser Zeitschrift geschildert. Vergleiche mein «Ernst Haeckel und seine Gegner» in L. Jacobowskis «Freier Warte», Bd. I (J. C. C. Bruns’ Verlag, Minden i. W. 1900).
neuen Jahrhundert voranzugehen und den Weg zu weisen, das steigerte die Indignation, und sie wurde nicht gemildert, sondern geschärft dadurch, daß ich hier vielfach Gedanken, die mir wert sind, in allerlei Verzerrungen wiederkehren sah ... Ich habe mit brennender Scham dieses Buch gelesen, mit Scham über den Stand der allgemeinen Bildung und der philosophischen Bildung unseres Volkes. Daß ein solches Buch möglich war, daß es geschrieben, gedruckt, gekauft, gelesen, bewundert, geglaubt werden konnte bei dem Volk, das einen Kant, einen Goethe, einen Schopenhauer besitzt, das ist schmerzlich.»
Man fragt sich: Was hat der Mann getan, dem solche Vorwürfe ins Gesicht geschleudert werden? Wer ruhig und leidenschaftslos die durchliest und sich dabei lediglich in seinem Urteile durch die naturwissenschaftlichen Ergebnisse der letzten vierzig Jahre bestimmen läßt, der muß sich sagen: Haeckel hat, allerdings mit rückhaltloser Schärfe, aber sachgemäß das Bekenntnis dargestellt, das er sich aus seiner unermüdlichen Forscherarbeit heraus gebildet hat. Er hat eine reinliche Scheidung vollzogen zwischen den Vorstellungen derer, die sich ihren auf Grund der Naturgesetze bilden, und denen, die hierfür andere Quellen anerkennen. Er wird selbst leidenschaftlich, wenn es gilt, jahrhundertealte Vorurteile gegen die von ihm vertretene Anschauung zu bestreiten, aber seine Leidenschaft ist die einer Persönlichkeit, die mit ganzem Herzen, mit tiefem gemütlichem Anteile an dem hängt, was sie als richtig erkannt zu haben glaubt. Alles, was Haeckel in den «Welträtseln» vorbringt, ist nichts anderes als das Ergebnis dessen, was er fünf Jahre vorher in streng wissenschaftlicher Weise in seiner ausgeführt hat, in einer Arbeit, für die er eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Auszeichnungen der Gegenwart, den erhalten hat, der von der Turiner Akademie der Wissenschaften dem Gelehrten zu erteilen war, der «im Laufe des Qua- drienniums 1895-1898 die wichtigste und nützlichste Erfindung gemacht oder das gediegenste Werk auf dem Gebiete der physikalischen und experimentalen Wissenschaften, der Naturgeschichte, der reinen und angewandten Mathematik, der Chemie, der Physik
und Pathologie veröffentlicht, ohne die Geologie, die Geschichte, die Geographie und die Statistik auszuschließen». Im weiten Umkreis aller dieser Geistesgebiete hat also die Akademie der Wissenschaften zu Turin für die Jahre 1895 bis 1898 kein Werk, ja keine Erfindung finden können, die wichtiger und nützlicher wäre als Haeckels «Phylogenie». -Könnte sich Ernst Haeckel damit begnügen, seine die gesamten Lebenserscheinungen vom Standpunkte der gegenwärtigen Wissenschaft umfassenden Einsichten in einer Weise vorzutragen, die von der «strengen Wissenschaft» unserer Zeit als die einer Methode anerkannt ist: man würde sich wahrscheinlich darauf beschränken, das Urteil der Turiner Akademie zu einem allgemeinen zu machen und ihn den bedeutendsten Biologen nach Darwin nennen. Aber Haeckels geistiger Charakter verträgt keine Halbheit. Er ist nicht imstande wie so viele seiner naturforschenden Zeitgenossen, sich zu sagen: hier das naturwissenschaftliche Denken - hier der religiöse Glaube. Er fordert den strengen Einklang zwischen den beiden. Was seine Vernunft als Gnindwesen der Welt erkannt hat, das will sein Gemüt auch religiös verehren. Die Wissenschaft hat sich bei ihm in der natürlichsten Weise zum religiösen Bekenntnis umgeformt. Er kann nicht zugeben, daß man «glauben» könne, was nicht im Sinne der Wissenschaft gedacht ist. Deshalb führt er einen rücksichtslosen Kampf gegen Glaubensvorstellungen, die für ihn im Widerspruch mit der Wissenschaft stehen. Er hat kein Verständnis für diejenigen, die im Sinne Kants dem Wissen nur ein beschränktes, diesseitiges Gebiet zuweisen möchten, damit im Felde des Unerkennbaren der Glaube sich um so sicherer festsetzen könne.
Man wird Haeckel nie verstehen, wenn man ihn, wie das Paulsen und wie es auch der allerdings in einem würdigeren Tone sprechende Julius Baumann («Haeckels Welträtsel nach ihren starken und schwachen Seiten») tun, als dogmatischen Philosophen nimmt. Alle seine Ausführungen werden dadurch verzerrt. Man muß ihn, wenn man seinen Aussprüchen den rechten Sinn geben will, bei seinen Gedankenbildungen belauschen. Charakteristisch ist zum Beispiel, wenn er sagt: «Jeder Naturforscher, der gleich mir lange
Jahre hindurch die Lebenstätigkeit der einzelligen Protisten beobachtet hat, ist positiv überzeugt, daß auch sie eine Seele besitzen; auch diese besteht aus einer Summe von Empfindungen, Vorstellungen und Willenstätigkeiten; das Empfinden, Denken und Wollen unserer menschlichen Seele ist nur stufenweise davon verschieden.» Obwohl Haeckel hier von Empfindungen und Willenstätigkeiten der einzelligen Lebewesen spricht, so behauptet er von diesen Wesen nicht mehr, als er sieht. Er hat nicht den Gedanken, daß irgendwie in der Zelle eine Seele verborgen sei; er hält sich an die Erfahrung. Was seinem Auge sich darbietet, das nennt er Empfindung und Wille, weil er findet, daß es sich durch nichts anderes von den komplizierten Seelentätigkeiten der höheren Tiere und des Menschen unterscheidet als dadurch, daß es einfacher, primitiver ist. Der Irrtum bei den Philosophen, die ihn beurteilen wollen, entsteht nun dadurch, daß sie der Ansicht sind: man müsse irgend etwas hinzudenken zu dem, was die Sinne darbieten, um eine Erklärung liefern zu können. Sie vergleichen dann, was sie hinzudenken mit dem, was Haeckel nach ihrer Meinung hinzudenkt. Dann finden sie seine philosophischen Begriffe im Vergleich mit den ihrigen dilettantisch. Sie haben sich auf Grund der Entwickelung, welche die Philosophie genommen hat, bestimmte, scharfgeprägte Vorstellungen davon gebildet, was Empfindung, was Wille ist. Es erscheint ihnen dann als nichts anderes denn als philosophischer Unsinn, wenn Haeckel von Empfindung und Wille einzelliger Gebilde spricht. - Wie weit das Mißverständnis gehen kann, zeigt sich klar an Urteilen, die Paulsen fällt. Er findet in der Stufenleiter der Seele, die Haeckel gibt, das schlimmste Beispiel eines «öden und inhaltleeren Schematisierens», das ihm bekannt ist. Haeckel geht von den einfachsten Lebenstätigkeiten der niedersten Wesen aus und verfolgt, wie die Seele immer reicher, komplizierter wird, wenn man stufenweise zu den höheren Tieren hinaufsteigt. Was soll daran «öde und inhaltleer» sein? Der Inhalt, um den es sich hier handelt, ist doch der denkbar reichste. Es sind die unübersehbaren Beobachtungen, die wir über die Lebensäußerungen der Organismen gemacht haben. Wer den Gedanken Haeckels voll zu Ende denken wollte, der müßte
die kurze Gedankenskizze, die er gibt, ausfüllen mit einem unendlichen Reichtum an Erfallrungen. Wer mit dem Schema nichts anderes mirdenkt, als was darin unmittelbar dem Wortlaute nach ausgesprochen ist, dem allerdings muß der Gedankengang als «ödes, inhaltloses» Schematisieren erscheinen. Was also will Paulsen? Man kann sich davon einen Begriff machen, wenn man sich an eine in philosophischen Schriften auch der Gegenwart immer wiederkehrende Behauptung hält: eine wirkliche Entwickelung könne nur so verstanden werden, daß alle Wirkungen der Anlage nach in der Ursache bereits vorhanden sind. Man glaubt, daß man, wenn das nicht der Fall, nur von einer zeitlichen Aufeinanderfolge eines Zustandes auf einen anderen, nicht aber von einer Evolution des einen aus dem anderen sprechen könne>. Wer diese Ansicht von Entwickelung hat, der kann allerdings mit der Weltanschauung Haeckels nichts anfangen. Für ihn bleibt der ganze Haeckelsche Monismus unverständlich. Denn im Sinne dieses Monismus kann von einem Vorhandensein der Wirkung in der Ursache allerdings nicht die Rede sein. Alle Wirkungen sind dieser Weltanschauung gemäß wahre, echte Neubildungen. Als die Erde ihre letzte Entwickelungsphase noch nicht erreicht hatte, als es auf ihr noch keine Menschen gab, da war in den damals lebenden menschen-ähnlichen Affen der Mensch in keiner Weise schon vorhanden. Er war ebensowenig vorhanden, wie in Sauerstoff und Wasserstoff Wasser vorhanden ist. Auch das Wasser entwickelt sich aus Sauerstoff und Wasserstoff, aber weder der eine noch der andere Stoff enthält der Anlage nach das Wasser. Es ist eine vollständige Neubildung. Und nehmen wir einmal an, es wäre nirgends Wasser vorhanden, wohl aber Sauerstoff und Wasserstoff, so könnte kein intelligentes Wesen aus der Beobachtung sagen, was entsteht, wenn man beide Stoffe verbindet. Das kann nur durch die Erfahrung bestimmt werden. Auch die höheren Seelentätigkeiten sind der Anlage nach nicht in den niederen enthalten. Sie sind durchaus Neubildungen. So ist in gewissem Sinne für den Monismus Haeckels die Entwickelung wirklich nur die Aufeinanderfolge eines Zustandes auf den anderen und nicht das Herauswickeln des einen aus dem andern. Wer in dieser Richtung mit Haeckel nicht
mitgeht, der kann gar nicht wissen, was dieser mit der «Stufenleiter der Seele» will. Er wkd sich sagen: ich mag die Begriffe, die ich mir von den niederen Lebewesen gebildet habe, drehen und wenden wie ich will; ich kann aus ihnen nicht entwickeln, was sich mir als Seelenleben der höheren Wesen darstellt. Philosophen von der Art Paulsens verlangen eben von der rein logischen Begriffsentwickelung, was diese nimmermehr leisten kann, was vielmehr nur die Beobachtung liefern kann. Weil sie nicht in eben dem Sinne wie Haeckel fortwährend Beobachtungsstoff aufnehmen, wenn sie von Begriff zu Begriff schreiten, bleiben sie bei den ersten Begriffen, die sich Haeckel gebildet hat, stehen und finden dann das Ganze «öde und inhaltleer».
Haeckel spricht den schärfsten Tadel über diejenigen Psychologen aus, die «über das immaterielle Wesen der Seele, von dem niemand etwas weiß, phantasieren und diesem unsterblichen Phantom alle möglichen Wundertaten zuschreiben». Paulsen -fertigt ihn ab, indem er sagt: «Ich brauche nicht zu sagen, wie grotesk jedem, der auch nur ein wenig in der psychologischen Literatur der letzten Jahrzehnte bewandert ist, diese Schilderung ihres Zustandes erscheinen muß. Es ist, als ob jemand von Psychologie redet, der die letzten dreißig Jahre verschlafen und nur etwa aus Langes oder aus Büchners ein paar Reminiszenzen im Ohr hat.» Welche Verkennung dessen, was Haeckel eigentlich will! Kann denn im Ernste diesem Denker jemand zumuten, daß er der Ansicht sei: es gäbe keine nur durch innere Anschauung zu beobachtenden Seelentätigkeiten? Kann man wirklich Haeckel für so naiv halten, daß er die Molekularbewegungen des Gehirnes mit dem Inhalt der Psychologie verwechselt? Auch Haeckel fällt es natürlich nicht ein zu glauben, daß Gehirnphysiologie Psychologie sei. Wer die menschliche Seele verstehen will, der muß hinuntersteigen in ihre ureigenen Zustände; aus den Denkorganen im Gehirn wird er sie nimmermehr erkennen. Aber ein anderes ist, eine Sache in der Eigenart ihres Wesens erkennen; ein anderes sie wissenschaftlich erklären. Haeckel hat das biogenetische Grundgesetz aufgestellt. Es besagt, daß jedes höhere Lebewesen während seiner Keimesentwickelung in abgekürzter
Weise die Formen annimmt, die seine Vorfahren im Laufe ihrer Entwickelung durchgemacht haben. Wollen wir einen Menschenkeim in seinen aufeinanderfolgenden Formen verstehen , so müssen wir aufsteigen zu den tierischen Ahnen des Menschen. Wer einen Menschenkeim für sich betrachtet, ohne auf die Her-kunft des Menschen Rücksicht zu nehmen, der kann sich nur allerlei abenteuerliche Vorstellungen über die aufeinanderfolgenden Formen bilden, die dieser Keim annimmt. Er kann allenfalls sagen, ein göttlicher Wille prägt hintereinander diese Formen aus , oder ein inneres mystisches Bildungsgesetz ist vorhanden, das die Umformung bewirkt. Wer aber hinaufsteigt zu den Menschen-ahnen, der findet die Wesen, die einmal so ausgesehen haben wie der menschliche Embryo heute auf gewissen Stufen, und er sagt sich, dieses Aussehen ist ein Ergebnis der Vererbung. In demselben Fall wie der Embryologe, der den Menschenkeim rein für sich betrachtet, ist der Psychologe, der die Seele des Menschen für sich betrachtet. Diese Seele wird nur erklärlich, wenn man von ihr hinaufsteigt zu den niederen Lebensäußerungen, aus denen sie sich entwickelt hat. Ebenso töricht wie es nun wäre , wenn jemand sagte, man brauche den Menschenkeim nicht zu beobachten, denn er ist ja nur eine Wiederholung früherer Formen, ebenso töricht wäre es , wenn man behauptete, man brauche die Seele in ihrem Eigenleben nicht selbst zu beobachten.
Ernst Haeckel ist Narurforscher, nicht Fachphilosoph. Man kann nicht leugnen, daß er den philosophischen Begriffen zu weilen Gewalt antut, wenn er sie verwendet. Einer wohlgeschulten, in der Geschichte der Philosophie bewanderten Persönlichkeit ist es natürlich ein leichtes, Haeckel Irrtümer in bezug auf die Ideen der Philosophen nachzuweisen, denen er - wie Spinoza -zustimmt oder die er - wie Kant - bekämpft. Paulsen schulmeistert ihn denn gehörig wegen seiner Mißverständnisse in bezug auf Kant. Ein anderer philosophischer Denker, Richard Hönigswald, hat in der Schrift «Ernst Haeckel, der monistische Philosoph» nachzuweisen gesucht, wie wenig die von Haeckel gebrauchten Ausdrücke «Monismus», «Dualismus», «Substanz» und so weiter die Piüfung durch die gebräuchlichen philosophischen Disziplinen
bestehen können. Es ist völlig überflüssig, sich mit derlei gegnerischen Ausführungen einzulassen. Alle diese Herren haben in gewissem Sinne von ihrem Standpunkte aus recht>. Sie haben sich in ein gewisses Begriffsnetz eingesponnen, und mit dem stimmt nicht, was Haeckel sagt>. Und dieser trifft oft nicht genau den Sinn philosophischer Vorstellungen, wenn er von ihnen redet. Kann es denn aber überhaupt die Aufgabe der philosophischen Kritik sein, einen Forscher, der sich streng an die Beobachtung hält, von dem Gesichtspunkte hergebrachter Vorstellungen zu schuimeistern? Haeckel hat in allen Fällen, wo er solche Vorstellungen bekärnpft, ein sicheres Gefühl dafür, daß sich mit ihnen im Hinblick auf die wirkliche Naturgesetzmäßigkeit nichts anfangen läßt. Seine Angriffe sind nicht immer logisch ganz zutreffend. In solchen Fällen hätten aber die Philosophen die Aufgabe, den Naturforscher in seinem Sinne zu verstehen, zu zeigen, wie er die Begriffe verwendet. Dann würden sie zuweilen finden, daß man manches philosophisch schärfer, logischer im strengen Wortsinne sagen kann als et, nicht aber, daß er sacblich unrecht hat.
Man erhält keine günstige Vorstellung von den offiziellen Vertretern der Philosophie in der Gegenwart, wenn man sieht, wie diese ihre Aufgabe verkennen. Haeckel nennt seine Weltanschauung «Monismus». Wäre es nicht eine würdigere Aufgabe, zu zeigen, in welchem Sinne Haeckel dieses Wort versteht, als immer wieder und wieder darauf zu pochen, daß er doch Stoff und Kraft, also eine Zweiheit annehme, folglich doch kein «Monist» sei. Haeckel will für die organische Welt und für das geistige Leben keine anderen Erklärungsmethoden, als diejenigen sind, die wir in der unorganischen Natur anwenden. Er ist der Meinung, daß mit derselben Notwendigkeit, mit der sich Wasserstoff und Sauerstoff unter gewissen Bedingungen zu Wasser verbinden, auch Kohlenstoff, Stickstoff und andere Elemente unter gewissen Umständen zu einem Lebewesen werden; und ferner, daß durch die gleiche Art von Gesetzmäßigkeit, von der die stoffliche Welt beherrscht wird, auch der «Geist» bedingt wird. Wenn ihm jemand mit einem Begriff kommt wie die «rohe, unbelebte Materie, die doch nie und nimmer zum Geist werden könne», so wird Haeckel
erwidern: sieh dir doch diese Materie an, bringe Stoffe unter gewissen Bedingungen in der Retorte zusammen und denke folgerichtig, so wirst du nicht mehr sagen: aus Materie könne nicht Geist werden, sondern dein Begriff von einer «rohen, unbelebten Materie» ist eben ein falscher, ein solcher, der zu der Wirklichkeit keine Beziehung hat. Die Einheitlichkeit in der ganzen Welterklärung: das ist es, was Haeckel verlangt. Und diese Einheitlichkeit nennt er monistisch. Man darf gegenüber dem Kampfe, den wir in den letzten Monaten miterlebt haben, sagen: wer den Natur-forscher will verstehen, muß in des Naturforschers Lande gehen. Es kommt nicht darauf an, daß Paulsen, wie er uns versichert, an keine «besondere, unsterbliche Seelensubstanz» und auch nicht daran glaubt, daß «überhaupt die Welt eintnal von einem menschenähnlichen Einzelwesen in ähnlicher Art wie ein Produkt menschlicher Kunst hervorgebracht worden ist». Es kommt vielmehr darauf an, sich über die natürlichen Vorgänge solche Vorstellungen zu bilden, daß die ihnen widersprechende «besondere, unsterbliche Seelensubstanz» und das «menschenähnliche Wesen» wirklich innerhalb der Naturerklärung entbehrlich werden.
Und solche Vorstellungen trägt Haeckel in seinem Bekenntnis-buche vor. Er fand sich genötigt, einmal schonungslos mit allem abzurechnen, was zu andern, ihnen widersprechenden Vorstellungen gehört. Wer unbefangen urteilt, muß sich erhoben fühlen durch die mutige Konsequenz, mit der er diese Abrechnung in dem Kapitel über «Wissenschaft und Christentum» vollzieht. Man wird vielleicht in diesem Abschnitt des Buches nicht alles geschmackvoll finden, man wird zugeben können, daß für vieles ein anderer Ton hätte gefunden werden können, ja auch, daß manches zur Befestigung der monistischen Weltanschauung gar nicht hätte gesagt zu werden brauchen. Aber gibt es denn gar keinen psychologischen Sinn mehr in unseren gegenwärtigen Philosophen? Ist es denn so unbegreiflich, daß einer der ersten Verkünder einer Weltanschauung in seinen Ausführungen zu leidenschaftlich wird, daß er mehr als «objektiv» zu nennen ist, begeistert für eine Ideenwelt, die er Schritt für Schritt in unermüdlicher Forscher-und Denkerarbeit erkämpft hat? Wer das nicht unbegreiflich findet,
wird nicht einstimmen können in den Zornesausbruch Paulsens über die «äußerst peinlich beruhrende Neigung (Haeckels), das, was Jahrhunderten heilig gewesen ist, in den Schmutz häßlicher Anekdoten und niedriger Witzeleien herabzuziehen». Noch weniger wird ein solcher aber irgendwelches Verständnis einer Schrift entgegenbringen können wie der des Kirchenhistorikers Loofs in Halle: «Anti-Haeckel. Eine Replik nebst Beilagen.» Loofs stellt sich auf einen Standpunkt, der mit der Weltanschauung Haeckels im Grunde nicht das allergeringste zu tun hat, der aber so geeignet wie nur irgend möglich ist, von der Hauptsache abzulenken und unter dem Schein, als ob Haeckel in einer Nebensache ein schweres Unrecht begangen hätte, die Vorstellung hervorzurufen, er sei ein ganz unwissenschaftlicher, aller wahren Methode hohn-sprechender Geist. Haeckel stützt sich in den Ausführungen über die christliche Kirchengeschichte auf das Werk eines englischen Denkers (Stewart Roß), das unter dem Pseudonym Saladin erschienen ist und unter dem Titel «Jehovas gesammelte Werke, eine kritische Untersuchung des jüdisch-christlichen Religionsgebäudes auf Grund der Bibelforschung» in deutscher Übersetzung vorliegt Loofs stellt die Sache so dar, als ob es sich hier um ein wüstes, von einem völligen Ignoranten und schmutzigen Gesellen geschriebenes Pamphlet gegen das Christentum handelte, das mit Ausschluß aller Kenntnisse in neuerer Bibelforschung und Kirchengeschichte geschrieben ist. Und was Loofs aus dem Buche vor-bringt und was er über dasselbe sagt, ist allerdings nur zu geeignet, diejenigen irrezuführen, die das Buch des Engländers nicht zur Hand nehmen. Sie müssen glauben, Haeckel wäre wirklich hier in Unwissenheit und Leichtfertigkeit so weit gegangen, eine Schmähschrift heranzuziehen, von der Loofs versichert, daß es leichter sein würde, «einem verwahrlosten Hund die Flöhe abzusuchen, als die wissenschaftlichen Torheiten zu sammeln, die das Buch enthält». Aber eben nur die können so urteilen, die die Schrift Saladins nicht kennen. Wer nur weniges darin liest, wird bald finden, daß er es mit einem wenn auch vom Standpunkte der zufällig jetzt für richtig geltenden kirchengeschichtlichen Meinungen nicht völlig einwandfreien, so doch ehrlichen Wahrheitsucher zu tun hat, dem
alles andere näher liegt, als in frivoler Weise von irgend etwas zu sprechen, was Menschen heilig ist>. Möchte man dem Buche auch eine geschmackvollere Ausdrucksweise wünschen: so muß man doch die tiefste Sympathie empfinden mit dem Verfasser, der einen kühnen, überall von einem tiefen Gemüte zeugenden Kampf führt gegen Ideen und Einrichtungen, die er für verkehrt, für schädlich und dem Menschenwohl störend hält. - Man kann nicht verwundert genug darüber sein, daß ein Gegner Haeckels sich gefunden hat, der an den eigentlichen Streitpunkten vollständig votübergeht und der es nicht für unangemessen hält, einen Naturforscher in einer Weise anzugreifen, die einzig und allein bei einem Gelehrten einen Sinn hätte, der als Kirchenhistoriker auftreten wollte.
Über eines hat uns jedenfalls dieser ganze Kampf volle Klarheit gebracht. Es hat sich gezeigt, daß unser ganzes Geistesleben weit und breit durchsetzt ist mit Vorstellungen, die unverträglich sind mit den ehrlich und rückhaltlos gezogenen Folgerungen der Naturwissenschaften. Die Unsachlichkeit und Leidenschaftlichkeit, mit der die Träger solcher Vorstellungen diesmal gekämpft haben, ist zugleich ein Beweis dafür, daß ihre Gtünde schwach geworden sind. Hat man auch zu erwarten, daß die Zukunft Haeckels Gedanken in manchem Sinne berichtigen werde: diese Berichtigung wird nicht von denen herkommen können, die ihn heute bekämpfen. Hat er auch nicht überall das Richtige getroffen, er hat doch zweifellos den Weg betreten, auf dem die Bildung des Geistes weiterschreiten wird.
BARTHOLOMÄUS CARNERI, DER ETHIKER DES DARWINISMUS
Was soll aus der sittlichen Weltordnung werden, wenn sich die Überzeugung in weitesten Kreisen Bahn bräche, daß der Mensch aus affenähnlichen Tieren durch rein natürliche Kräfte sich allmählich entwickelt habe? Beunruhigend stieg diese Frage in vielen Gemütern auf, als kühne Denker nach dem Erscheinen des großen
naturwissenschaftlichen Reforruwerkes Charles Darwins «Über die Entstehung der Arten im Tier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung» den notwendigen Schluß zogen, daß mit der Vorstellungsweise des großen Forschers vor dem Menschen nicht haltgemacht werden dürfe, sondern daß der Gedanke vom tierischen Ursprunge des vollkommensten Lebewesens fortan als ein sicherer Bestandteil der Weltanschauung gelten müsse. Die Zahl der weitschauenden Persönlichkeiten, die im Lauf der letzten vier Jahrzehnte der Meinung von der Gefährlichkeit des Darwinismus für die moralische und soziale Entwickelung der Menschheit mit treffenden Gründen entgegengetreten sind, ist nicht gering. Der erste aber, der innerhalb des deutschen Geisteslebens mit umfassendem Blick eine Neugestaltung der ethischen Gedankenwelt auf der Grundlage der neuen naturwissenschaftlichen Einsichten unternommen hat, ist der österreichische Denker Bartholomäus Carneri.
Elf Jahre nach Darwins Auftreten legte er der Welt sein Buch vor (Wien 1871). Unablässig ist er seitdem bemüht gewesen, seine Grund-gedanken nach allen Seiten auszubauen.* Heute, da wir vierzig Jahre Darwinismus hinter uns haben, müssen wir uns bei einer unbefangenen Umschau über die in Betracht kommende Literatur gestehen, daß niemand das Gebiet der Ethik im Sinne der neuen Geistesrichtung so gründlich, so einwandfrei und formvollendet behandelt hat. Wenn dies augenblicklich noch nicht überall, wo es sollte, genügend gewürdigt wird, so hat das keinen andern Grund als den, daß die Geister noch zu sehr beschäftigt sind, die Erkenntnisse des Darwinismus auf rein naturwissenschaftlichem Felde auszubauen und gegen Angriffe sicherzustellen. Sie können daher der darwinistischen Ethik noch nicht die volle, ihr zukommende Aufmerksamkeit zuwenden. Es kann aber kein Zweifel darüber bestehen, daß man in nicht ferner Zukunft, wenn man nicht mehr bloß von der Naturlehre des Darwinismus, sondern von dessen
- - -
* Es sind von ihm noch erschienen: Gefühl, Bewußtsein, Wille. Eine psychologische Studie (Wien 1876); Der Mensch als Selhstzweck (1877); Grundlegung der Ethik (Wien 1881); Entwicklung und Glückseligkeit
(Stuttgart 1886); Der moderne Mensch. Versuche einer Lebensführung (Bonn 1891); Eripfindung und Bewußtsein (1893).
umfassender Weltanschauung sprechen wird, Carneris Leistungen als diejenigen bezeichnen wird, welche an der Begründung dieser Weltanschauung einen hervorragenden Anteil haben.
Was Carneri befähigte, die sittlichen Begriffe auf eine solch neue Grundlage zu stellen, das war die Unbefangenheit, mit welcher er dem Darwinismus entgegentrat, und die geistige Sehschärfe, die ihn sogleich die volle Tragweite der neuen Anschauungen für die menschliche Lebensgestaltung erkennen ließ; Er ließ sich durch keine Einwände in der Überzeugung beirren, daß durch den Darwinismus die Richtung gegeben sei, in der sich künftig das Denken bewegen müsse; «Frei wird es natürlich immer jedem stehen, dem Darwinismus gegenüber als Vogel Strauß sich zu verhalten; hat er, außer dem Kopf, auch den Magen mit seinem Vorbild gemein und kann er die Kost verdauen, die täglich schwerer aus der Küche der sogenannten guten alten Zeit ihm gereicht wird, so wünschen wir ihm Glück zu seiner Stellung. Solang wir aber nicht denken können, der Mensch habe sich zum aufrechten Gang, um sich zu bücken, aufgerafft, solang blicken wir der neuesten Zeit voll ins Angesicht; und je fester unser Bild wird, desto heller erscheint uns ihr Auge, desto milder ihr Lächeln. Nach denselben Gesetzen, welchen gemäß im der Mensch aus der Tierheit sich erhoben hat, sehen wir den Begriff der Sittlichkeit am Horizont der Menschheit aufgehen als eine Sonne, vor deren Strahl zwar mancher zu sehr ans Dunkel gewöhnte Blick zurückscheuen, der leuchtendste Stolz eitler Selbstsucht als fahler Flitter schwinden mag, die aber dieser Erde den Tag verkündet, die Erfüllung der Verheißung jenes Morgens, an dem zuerst ein Auge, im Hochgefühl des erwachten Selbstbewußtseins die schmerzliche Starrheit abstreifend, die das Antlitz des Tieres nie verläßt, - lachend hinaussah ins wechselvolle Leben» (Sittlichkeit und Darwinismus, S. 14). So spricht sich Carneri selbst aus über die Sinnesart, die ihn dazu geführt hat, den Darwinismus heraufzuleiten aus dem Gebiete der Naturwissenschaft in dasjenige der sittlichen Lebensführung des Menschen; - Mit der Unbefangenheit verband sich in Carneris Geist ein hoher Grad von Vertrautheit mit der philosophischen Vorstellungsart idealistischer
Denker; Ein solcher war in der Zeit, in der seine Anschauungen heranreiften - in den sechziger Jahren -, eine Seltenheit. Man sah geringschätzig auf die «Begriffsdichtungen» eines Hegel und Spinoza herab und glaubte, durch einseitiges Beobachten der sinnenfälligen Tatsachen allein zu einer sicheren Erkenntnis gelangen zu können. Es gilt für Carneri als eine feste Gedankengrundlage, daß der Stoff in sich alle die Kräfte birgt, die sämtliche Welt-geschehnisse von der einfachen räumlichen Bewegung bis zu den h&hstentwickelten Leistungen des Geistes hervorbringen. Aber er ist sich auch vollkommen klar darüber, daß man mit den Naturgesetzen, die sich auf die körperlichen, materiellen Vorgänge beziehen, die geistigen Verrichtungen nicht erklären kann; Er ist vollkommen davon überzeugt, daß alles Leben ein chemischer Prozeß ist; «Die Verdauung beim Menschen ist ein solcher wie die Ernährung der Pflanze» (Sittlichkeit und Darwinismus, S. 46); Er betont aber zugleich, daß sich der chemische Prozeß auf eine höhere Stufe heben muß, wenn er Leben werden will; «Das Leben ist ein chemischer Prozeß eigener Art, es ist der individuell oder zum Individuum gewordene chemische Prozeß; Der chemische Prozeß kann nämlich einen Punkt erreichen, auf welchem er gewisser Bedingungen, deren er bis dahin bedurfte ... entraten kann» (Sittlichkeit und Darwinismus, 5; 14); «Als Materie fassen wir den Stoff, insofern die aus seiner Teilbarkeit und Bewegung sich ergebenden Erscheinungen körperlich, das ist als Masse, auf unsere Sinne wirken; Geht die Teilung oder Differenzierung so weit, daß die daraus sich ergebenden Erscheinungen nicht mehr sinnlich, sondern nur mehr dem Denken wahrnehmbar sind, so ist die Wirkung des Stoffes eine geistige> (Grundlegung der Ethik, 5; 30); Damit ist die «Unzertrennlichkeit des Geistes von der Körperlichkeit» vollkommen anerkannt, zugleich aber dem Geistigen, trotz seines Ursprunges aus dem Körperlichen, seine selbständige über das Materielle hinausgehende Bedeutung gesichert. So wahrt Carneri der idealistischen Betrachtungsweise für die geistigen Erscheinungen des Stoffes ihr Recht neben der materialistischen, die auf das zu beschränken ist, was allein den Sinnen zugänglich ist; Nur ein Denker, der aus der idealistischen
Weltanschauung seine Bildung geholt hat, und der deshalb in seiner Betrachtung den Boden des Materialismus auch in dem Augenblicke verlassen konnte, wo der materielle Prozeß zum geistigen heraufsteigt, war berufen, die Ethik des Darwinismus auszubauen; Carneris Auffassung der sittlichen Kräfte ist eine idealistische, trotzdem er die ursprüngliche Wurzel der Sittlichkeit nirgends anders sucht als da, wo auch der Ursprung der physikalischen und chemischen Vorgänge zu finden ist; «Mit der Annahme der Unzertrennlichkeit von Kraft und Stoff, Geist und Materie, sind alle im engern Sinne freien Kräfte aufgegeben, mithin auch der Geist als etwas unabhängig vom Körper Bestehendes; damit ist jedoch der Geist so wenig aufgegeben als die Kraft. Mit dem Spiritualismus ist es aus, aber darum noch nicht mit dem Idealismus; dieser bleibt das Feld der Philosophie, während die Naturforschung allein im Realismus zu Hause ist» (Sittlichkeit und Darwinismus, S. 8).
Carneri ist als Denker ein Künstler allerersten Ranges; Ihm ist in seltener Art das Vermögen eigen, den Inhalt seiner Begriffe in plastisch vollendeter Weise hinzustellen. Wie er von den einfachen Naturerscheinungen, die wir sinnlich wahrnehmen, auf-steigt zu den Ideen der Sittlichkeit, ist eine Meisterleistung dieser Art. Man sieht in gedanklich-anschaulicher Form an der Hand sei ner Auseinandersetzungen die chemischen Prozesse sich individualisieren, zum lebendigen Individuum werden, das dann eine Wirkung von außen nicht mehr als unorganische Bewegung aufnimmt, sondern zur Empfindung werden läßt; «Das wichtigste Merkmal alles Lebendigen und ausschließlich ihm eigen ist die Empfindung; Es ist diese die Form, in welcher bei allem Lebendigen das auftritt, was wir bei der übrigen Natur Reagieren nennen; Die Empfindung ist eigentlich nur die Befähigung zum Reagieren, aber zu einem Reagieren höherer Art;.. Die Empfindung ist dem Leben im engern Sinn das, was dem Stoff die Teilbarkeit ist» (Grundlegung der Ethik, S. 43). In ebenso anschaulicher Art steigt Carneri zu den weiteren Vorstellungen auf, die uns befähigen, die Idee des Lebens zu fassen. «Die Empfindung;.. wird im Gehirn, als dem Organ, in welchem das ganze Individuum zentral sich zusammenfaßt, dem Individuum als Ganzem vorgestellt.
Indem dadurch eine Empfindung dem Individuum mitgeteilt wird, erhebt sich die Empfindung des Teils zu einer Empfindung des Ganzen; Darum nennen wir die Vorstellung eine Empfindung höherer Art. Das Individuum empfindet sie, sie ist eine empfundene Empfindung oder ein Gefühl» (Grundlegung der Ethik, S. 102). Man sieht am Leitfaden Carnerischer Begriffe das Materielle allmählich geistig werden; man sieht den Stoff die geistigen Erscheinungen aus sich heraus entfalten. «Erst mit dem Erwachen des Bewußtseins wird die Empfindung zum Gefühl, und erst von da an wird ... das Nachteilige zur Unlust, das Fördernde zur Lust. Damit beginnt das Seelenleben in seiner höheren Bedeutung» (Grundlegung der Ethik, S. 123). Den höchsten Grad von Individualisierung erreichen die Naturprozesse im menschlichen Selbstbewußtsein. Die Naturprozesse haben sich da von ihrem Mutterboden losgerissen; sie schauen durch die Vorstellung nicht mehr einen äußeren Vorgang an; sie schauen sich selbst an. Dadurch entsteht der Schein, als wäre der individualisierte Naturprozeß ein Selbständig-Geistiges mit einem ganz anderen Ursprünge als die übrigen stofflichen Vorgänge. «Was bei der Geistestätigkeit den Schein uns erzeugt, als wäre der Mensch ein Doppelwesen, als wäre der irdische Leib von einem überirdischen Funken durchglüht und erleuchtet, ist eine Täuschung» (Grundlegung der Ethik, S. 136). Was wir in unserm Innern wahrnehmen, ist ein Naturprozeß wie jeder andere stoffliche Vorgang. Und hier — innerhalb dieses zum Selbstbewußtsein gesteigerten Naturprozesses — wird die Welt des Sittlichen geboren. Das Sittliche ist nur die Fortsetzung rein natürlicher Vorgänge. Es kann demnach nicht die Frage sein, was soll der Mensch als Sittliches anerkennen. Ein solches Sittliches müßte ihm von irgendwoher gegeben werden; und dann wäre erst die Frage da: Kann denn der Mensch Sittengebote, die von außen an ihn herantreten, vermöge seiner natürlichen Kräfte auch befolgen? Es kann sich vielmehr nur darum handeln: Welche Begriffe von Sittlichkeit werden geboren, wenn sich das allgemeine Naturgeschehen heraufhebt zum menschlichen Selbstbewußtsein? So wenig es einen Sinn hat zu sagen, eine Blume soll so oder so sein, so wenig hat es
einen zu behaupten, der Mensch soll dies oder jenes tun. Carneri stellt mit aller Schärfe seinen Begriff von Ethik dem anderer Denker entgegen. «Während die Moralphilosophie bestimmte Sittengesetze aufstellt und zu halten befiehlt, damit der Mensch sei, was er sein soll, entwickelt die Ethik den Menschen, wie er ist, darauf sich beschränkend, ihm zu zeigen, was noch aus ihm wer-den kann: dort gibt es Pflichten, deren Befolgung Strafen zu erzwingen suchen, hier gibt es ein Ideal, von dem aller Zwang ablenken würde, weil die Annäherung nur auf dem Wege der Erkenntnis und Freiheit vor sich geht» (Sittlichkeit und Darwinismus, S.1). Dasjenige, was der Mensch anstrebt, wenn er sich über die Stufe der Tierheit erhebt, das, wovon alles andere abhängt, ist die Glückseligkeit. «Das Ideal des Glücks ist veränderlich und einer fortwährenden Veredelung fähig; aber unter allen Umständen ist das Streben nach Glück die Grundtriebfeder aller menschlichen Unternehmungen. Und nichts ist irriger als die Ansicht, es sei dieser Trieb ein des Menschen unwürdiger, der ihn dem Tiere gleichstellt. Dem Tiere ist dieser Trieb fremd: es kennt nur den Selbsterhaltungstrieb, und ihn zum Glückseligkeitstrieb zu erheben, hat das menschliche Selbstbewußtsein zur Grundbedingung» (Grundlegung det Ethik, S.147). Da, wo auf der Stufenleiter des lebendigen Werdens der Glückseligkeitstrieb erwacht, beginnt das früher gleichgültige Naturgeschehen ein sittliches Handeln zu sein. Alle höheren sittlichen Ideen haben in dem Streben nach Glück ihren Ursprung. «Der Märtyrer, der hier für seine wissenschaftliche Überzeugung, dort für seinen Gottesglauben das Lehen hingibt, hat auch nichts anderes im Sinn als sein Glück: jener findet es in seiner Überzeugungstreue, dieser sucht es in einer hesse-ren Welt. Allen ist Glückseligkeit das letzte Ziel, und wie verschieden auch das Bild sein mag, das sich das Individuum von ihr macht, von den rohesten Zeiten bis zu den gebildetsten, ist sie dem empfindenden Lebewesen Anfang und Ende seines Denkens und Fühlens. Es ist der Selbsterhaltungstrieb, dessen zahllose Ausstrahlungen an diesem einen Punkt sich sammeln, um so viel Wünsche zu reflektieren, als es Individuen gibt» (Grundlegung der Ethik, S.146).
Durch die Losreißung von dem Mutterboden der Natur wird der Mensch ein selbständiges, ein freies Wesen. Es ist ein Beweis davon, wie tief Carneri in den Geist des Darwinismus sich eingelebt hat, daß er dem Freiheitsbegriff die Fassung gegeben hat, die mit naturwissenschaftlichen Vorstellungen verträglich ist. Gibt es denn innerhalb der darwinistischen Weltanschauung noch einen Platz für die Freiheit? Carneri antwortet mit «Ja». Zwar unterliegt alles, was geschieht, also auch jede Handlung des Menschen, den ewigen, ehernen Naturgesetzen. Aber von dem Punkte an, wo der Mensch sich loslöst von der übrigen Natur, werden die Naturgesetze zu Gesetzen seiner eigenen Wesenheit. «Seine weitere Entwicklung ist sein eigenes Werk, und was auf der Bahn des Fortschrittes ihn erhalten hat, war die Macht und allmähliche Klärung seiner Wünsche» (Grundlegung der Ethik, S.143). Und die Naturgesetze, die der Mensch zu einem Inhalte seines Wesens gemacht hat, sind seine Gedanken und Ideen. Sie sind nichts anderes als die höchst gesteigerten, vollkommen entwickelten Natur-prozesse. Nicht dadurch ist der Mensch frei, daß er beliebige, von einem unbekannten Orte hergeholte Sittengebote befolgen kann oder nicht, sondern dadurch, daß er die Entwickelung der Natur ah sein eigenes Werk fortführt. Mit vollkommener Klarheit spricht Carneri dieses als seine Ansicht aus: «Wohl ist der Mensch an die Gesetze der Natur gebunden; aber die Natur weiß nichts vom Menschen und seinen Gesetzen. Erst im Menschen bringt sie's zum Denken. Sie kümmert sich auch gar nicht um den Menschen; und nur weil der Mensch zur Erreichung seiner Zwecke an die Mittel gebunden ist, die er in der Natur vorfindet, und er seine Wege zum Ziel darnach sich ehnet, sieht manches Mittel aus, als wär es ihm zu diesem oder jenem Zweck von der Natur entgegengebracht» (Der Mensch als Selbstzweck, S.89). Wenn die Naturgesetze in dem Menschen wirksam sein sollen, so muß er sich mit ihnen durchdringen, sie müssen zum Gehalt seines Denkens werden. Der Mensch kann das Werk der Natur in seinem sittlichen Handeln nur fortsetzen, wenn er in den Sinn des natürlichen Daseins eindringt, wenn er nach Erkenntnis der Naturerscheinungen trachtet. In der Erkenntnis sucht daher Carneri die
Grundlage der Sittlichkeit. Nicht irgendwelche in der Luft hängenden Sittengebote, sondern die Wahrheit nur kann den Menschen zum sittlichen Handeln bringen. Nur das mit «der Wahrheit übereinstimmende Denken, das die Dinge in ihrer Notwendigkeit erkennt, und dem dadurch das allgemeine Gesetz zu seinem eigenen wird, erhebt den Verstand zur Vernunft, den Willen zur Freiheit. Der Mensch will eben nur, insofern er weiß. Daher der unendliche Wert echter Intelligenz. Wir verkennen nicht die Größe der Opfer, welche die neue Lehre vom Menschenherzen fordert; aber diese Opfer sind keine mehr, sobald wir der ganzen Größe der Aufgabe uns bewußt werden, mit welcher die neue Lehre an den Menschengeist herantritt. Gefallen ist die Schranke, die gebieterisch wie keine dem Denken Halt gebot, und es gehört in der Tat eine hohe Befangenheit dazu, darin eine Beeinträchtigung der Forderungen des Denkens erblicken zu wollen» (Sittlichkeit und Darwinismus, S. 13 f.). Der Mensch, der sich Ziele, Ideale seines Handelns setzt, kann jedoch nicht bei den bloßen Naturgesetzen in seinem Denken stehenbleiben. Er lieferte sonst mit seiner Sittlichkeit nicht eine Fortsetzung, sondern eine bloße Kopie des Naturgeschehens. Der Mensch ist als sittlich Denkender zugleich Schaffender. Aus seinem Denken entspringen als neue Schöpfungen sittliche Ideen. Sein Denken erfährt also, damit es zur sittlichen Kraft wird, eine Steigerung. Es wird zur Phantasie, die dem Handeln seine Ziele vorsetzt. In der ethischen Phantasie findet Carneri den neuen Begriff, der an die Stelle der alten moralischen Gebote treten muß. Die Phantasie ist es, die «unserm Denken lebendige Wärme einhaucht» und die «mit Ideen in Wechselwirkung tretend, das Ideale schafft» (Grundlegung der Ethik, S. 370 f.).
In solcher Weise erreicht Carneri die höchsten menschlichen Begriffe, trotzdem er von den einfachsten naturwissenschaftlichen Vorstellungen seinen Ausgangspunkt nimmt. Daß der Charakter des Geistigen, der Idealität des Sittlichen gewahrt werde, ist sein Bestreben, trotzdem er sich streng auf den Boden des Darwinismus stellt. Er ist ein Feind jeglicher Unklarheit in Begriffen. Deshalb hat er in seiner Schrift «Empfindung und Bewußtsein» (1893)
mit Energie gegen das Verschwommene einer Weltanschauung protestiert, die dem Zusammenhang von Geist und Natur dadurch gerecht zu werden sucht, daß sie sagt: «Kein Geist ohne Materie, aber auch keine Materie ohne Geist.» Carneri hält den vielfach verkehrten Deutungen dieses Goetheschen Satzes entgegen: «Die Überzeugung, daß es keinen Geist ohne Materie gebe, das heißt, daß alle geistige Tätigkeit an eine materielle gebunden sei, mit deren Ende auch sie ihr Ende erreicht, fußt auf Erfahrung; während nichts in dieser Erfahrung dafür spricht, daß mit der Materie überhaupt Geist verbunden sei.» Der Geist kommt nach Carneris Anschauung nicht der Materie als solcher zu, sondern dem zu höheren Stufen der Tätigkeit organisierten Stoffe. Nicht der Stoff ist es, der Geist hat, sondern auf der Organisation, die der Stoff angenommen hat, beruht es, daß Geist erscheint. Wollte man die Materie beseelt nennen, so verführe man wie jemand, der nicht dem Mechanismus der Uhr, sondern den Metallen, die in ihr verarbeitet sind, die Fähigkeit zuschriebe, Zeitangaben zu machen. Wenn man auch wird zugeben müssen, daß in Haeckels Schriften ein Ausdruck der naturwissenschaftlichen Denkweise vorliegt, der in der von Carneri angedeuteten Weise nicht mißverstanden werden sollte, so darf man doch die genannte kleine Schrift wegen ihrer mustergültigen Prägung wichtiger Begriffe als einen der wertvollsten Beiträge zum Darwinismus bezeichnen. Zu welcher Höhe der Lebensanschauung Carneri sich durch seine Arbeiten an der Ethik erhoben hat, das geht aus seinen Schriften «Der Mensch als Selbstzweck» (1877) und «Der moderne Mensch. Versuche einer Lebensführung» (1891) hervor. Die Früchte einer aus dem Darwinismus geschöpften Überzeugung erscheinen hier als edelste Vorstellungen über Welt und Mensch. Und wer Carneri zugehört hat damals, als er, der Mitglied des österreichischen Abgeordnetenhauses war, seine inhaltvollen, von einem hohen Ethos durchdrungenen Reden hielt, dem wird der Eindruck nicht mehr aus der Seele weichen, den er erhalten haben muß. Unvergeßlich muß ihm dies Bild eines Kämpfers für die Wahrheit bleiben, das er vor sich hatte in dem Augenblick, da der Kämpfer die Wahrheit ins Leben einführen wollte.
MODERNE SEELENFORSCHUNG
Die Entwickelung der Wissenschaften im letzten Jahrhundert könnte man nicht mit Unrecht einen Eroberungszug des natur wissenschaftlichen Geistes über fast alle Gebiete des menschlichen Erkennens nennen. Was für eine sieghafte Gewalt diesem Zuge eigen ist, das sieht man wohl nirgends besser als an dem Charakter, den die Erforschung der menschlichen Seele in fachwissenschaftlichen Kreisen während der letzten Jahrzehnte angenommen hat. Der moderne Psychologe, der mit seinen Zähl- und Meßappa-raten den auf- und abflutenden Erscheinungen unseres Innern beizukommen sucht, hat wenig Ähnlichkeit mit dem früheren Seelenforscher, der bloß mit dem geistigen Auge nach der eigenen Seele sehen wollte; er sieht dafür um so ähnlicher dem physikalischen oder chemischen Experimentator. Man wird, wenn man die Art der modernen Seelenforschung kennzeichnen will, immer wieder auf ein Wort verweisen müssen, das der große Denker und Schriftsteller Friedrich Albert Lange, der Verfasser der «Geschichte des Materialismus», geprägt hat: «Psychologie ohne Seele.» Es ist ein Wort, das leicht mißverstanden werden kann. Es hatte als Schlachtruf seine gute Bedeutung. Es sollte besagen, daß, wer die Seele erforschen will, keinen vorgefaßten Begriff von dieser «Seele» haben dürfe. Und einen derartigen Vorwurf erhob Lange gegen die älteren Psychologen. Sie hätten gewisse dogmatische Vorstellungen von der Seele. Sie stellten sich darunter ein Wesen mit ganz bestimmten Eigenschaften vor. Und wenn sie dann an die Ergründung der wirklichen seelischen Erscheinungen gingen, dann würde ihr Blick durch diese vorgefaßten Dogmen getrübt. Wer zum Beispiel der Meinung ist, der menschliche Wille sei unbedingt frei, der sieht die Vorgänge des Willens nicht unbefangen. Sie nehmen in seiner Beobachtung unwillkürlich einen solchen Charakter an, daß dabei die Meinung von dem «freien Willen» bestehen kann. Lange fordert nun von den Seelenforschern das Aufgeben aller solchen Meinungen. Untersucht, sagt er ihnen, die Vorgänge des Willens, wie sie sich euch darbieten, und laßt zunächst völlig unbestimmt, ob der Wille frei oder unfrei sei. Ob
er es ist, das könnt ihr nicht vorher sagen, sondern das muß erst das Ergebnis e,irer Untersuchung sein. Es drängt sich der Vergleich mit einer historischen Tatsache auf, wenn man über das Wort «Seelenkunde ohne Seele» nachdenkt. Golumbus fuhr einst gegen Westen in der Absicht, auf ein bekanntes Land zu stoßen. Er fand ein unbekanntes. Die Psychologen sollen sich bewußt sein, daß der rechte Begriff der Seele nicht vor der Untersuchung bekannt sein kann, sondern daß er erst am Ende ihrer Entdeckungsreisen ihnen vor Augen treten kann. Demgemäß verfahren auch die modernen Psychologen. Sie suchen sich Mittel und Wege, die Erscheinungen des Seelenlebens in ihrem Zusammenhange kennenzulernen und sind davon überzeugt, daß sie am Ende ihrer Fahrt auf eine Vorstellung von der «Seele» stoßen werden. Langes Wort hat in Beziehung auf die Seelenfrage denselben Sinn, den man mit dem ähnlichen verbinden könnte, «Naturwissenschaft ohne Natur». Auch der Naturforscher legt ja keine vorgefaßte Meinung von der. «Natur» zugrunde, wenn er an seine Forschungen geht. Er untersucht die Erscheinungen des Lichtes, der Elektrizität, des Lebens und ist überzeugt, daß erst aus der Gesamtheit seiner Forschungen sich ein umfassender Begriff der Natur ergeben werde.
Ganz von dieser Denkweise beherrscht war der Forscher und Denker, der völlig neue Gesichtspunkte in die Seelenforschung gebracht hat: Gustav Theodor Fechner. Von einer Methode, die Goethe mit seinem weitausschauenden wissenschaftlichen Blick für alle Naturforschung forderte, hat Fechner gezeigt, inwiefern sie in der Psychologie Anwendung finden kann. «Wenn wir die Erfahrungen - dies sind Goethes Worte -, welche vor uns gemacht worden, die wir selbst oder andere zu gleicher Zeit mit uns machen, vorsätzlich wiederholen, und die Phänomene, die teils zufällig, teils künstlich entstanden sind, wieder darstellen, so nennen wir dies einen Versuch. Der Wert eines Versuches besteht vorzüglich darin, daß er, er sei nun einfach oder zusammengesetzt, unter gewissen Bedingungen mit einem bekannten Apparat und mit erforderlicher Geschicklichkeit jederzeit wieder hervorgebracht werden könne, so oft sich die bedingten Umstände vereinigen lassen.»
Dem Versuch in der Psychologie sein Recht angewiesen zu haben, ist das Verdienst, das sich Fechner durch die Darlegungen seines Werkes «Elemente der Psychophysik» (1860) erworben hat. Ein Problem, das den menschlichen Geist beschäftigt, solange er sich mit Erkenntnisfragen zu tun macht, das Verhältnis des Körperlichen zum Geistigen, erschien hier zum ersten Male in einem Sinne behandelt, den auch Goethe vollkommen zutreffend mit den Worten charakterisiert hat: «Die Bedächtlichkeit, nur das Nächste ans Nächste zu reihen, oder vielmehr das Nächste aus dem Nächsten zu folgern, haben wir von den Mathematikern zu lernen, und selbst da, wo wir uns keiner Rechnung bedienen, müssen wir immer so zu Werke gehen, als wenn wir dem strengsten Geometer Rechenschaft zu geben schuldig wären.» So dachte und verfuhr Fechner in dem Gebiete, wo sich Körperliches und Seelisches berühren. Auf meine Hand drückt ein Gewicht. Ich empfinde den Druck. Eine physische Erscheinung — der Druck — bewirkt eine seelische, die Empfindung. Ich vergrößere den Druck. Auch meine Empfindung steigert sich. Fechner fragt: Wie kann ich durch Zahlen ausdrücken, in welchem Maße sich die Empfindung steigert, wenn der Druck zunimmt? Die Abhängigkeit des Seelischen vom Physischen wird so bestimmt, als wenn man dem strengsten Geometer Rechenschaft schuldig wäre. Wilhelm Wundt, der auf diesem Gebiete in Fechners Geist weitergearbeitet hat, findet von dem Begründer der «Psychophysik»: «Vielleicht in keiner seiner sonstigen wissenschaftlichen Leistungen tritt die seltene Vereinigung von Gaben, über die Fechner verfügte, so glänzend hervor wie in seinen psychophysischen Arbeiten. Zu einem Werke wie den «EIementen der Psychophysik» bedurfte es einer Vertrautheit mit den Prinzipien exakter physikalisch-mathematischer Methodik und zugleich einer Neigung, in die tiefsten Probleme des Seins sich zu vertiefen, wie in dieser Vereinigung nur er sie besaß. Und dazu brauchte er jene Ursprünglichkeit des Denkens, welche die überkommenen Hilfsmittel frei nach eigenen Bedürfnissen umzugestalten wußte und kein Bedenken trug, neue und ungewohnte Wege einzuschlagen. Die um ihrer genialen Einfachheit halber bewundernswerten, aber doch nur beschränkten Beobachtungen
E. H. Webers, die vereinzelten, oft mehr zufällig als planrnäßig gefundenen Versuchsweisen und Ergebnisse anderer Physiologen - sie bildeten das bescheidene Material, aus dem er eine neue Wissenschaft aufbaute.» Eine mathematische Formel sagt uns, seit Fechners genialem Gedanken, wie die Empfindung sich bei einem zunehmenden äußeren Reiz steigert, ebenso wie seit Galileis grundlegenden Vorstellungen eine mathematische Formel uns sagt, wie die Geschwindigkeit wächst, wenn eine Kugel auf einer schiefen Ebene hinunterrollt. Die Psychologie ist eine Experimentalwissenschaft geworden. Ihr neues Gepräge kommt deutlich zum Ausdruck in Wundts «Vorlesungen über die Menschen- und Tier-seele» (1863). Wir lesen da: «Ich werde in den nachfolgenden Untersuchungen zeigen, daß das Experiment in der Psychologie das Haupthilfsmittel ist, welches uns von den Tatsachen des Bewußtseins auf jene Vorgänge hinleitet, die im dunklen Hintergrunde der Seele das bewußte Leben vorbereiten. Die Selbstbeobachtung liefert uns, wie die Beobachtung überhaupt, nur die zusammengesetzte Erscheinung. In dem Experiment erst entkleiden wir die Erscheinung aller der zufälligen Umstände, an die sie in der Natur gebunden ist. Durch das Experiment erzeugen wir die Erscheinung künstlich aus den Bedingungen heraus, die wir in der Hand halten. Wir verändern diese Bedingungen und verändern dadurch in meßbarer Weise auch die Erscheinung. So leitet uns immer und überall erst das Experiment zu den Naturgesetzen, weil wir nur im Experiment gleichzeitig die Ursachen und die Erfolge zu überschauen vermögen.» Das bloße Versenken in das eigene Innere, die Selbstbeobachtung, hat bei den Fachpsycholo-gen wesentlich an Vertrauen eingebüßt. Wundt hat sich gegen sie in der schärfsten Weise gewendet. Er fragt: Was hat denn die Psychologie durch die Selbstbeobachtung gewonnen? Wenn ein Bewohner einer anderen Welt auf unsere Erde herabstiege und aus den Lehrbüchern der Psychologie auf die Natur der menschlichen Seele schließen wollte, so würde er wahrscheinlich zu dem Ergebnisse kommen, daß sich die verschiedenen Schilderungen der Psychologen, die alle ihre Anschauungen aus der Selbstbeobachtung gewonnen haben wollen, auf Wesen ganz verschiedener Welten
bezögen. «Es ist nichts besonderes dabei, sich einen Menschen zu denken, der irgendein äußeres Objekt aufmerksam beobachtet. Aber die Vorstellung eines solchen, der in die Selbstbeobachtung vertieft ist, wirkt fast mit unwiderstehlicher Komik. Seine Situation gleicht genau der eines Münchhausen, der sich an dem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen will.» Dieses Urteil ist zweifellos einseitig. Aber es ist durchaus begreiflich bei dem Führer der experimentellen Seelenforschung. Kraepelin, der Herausgeber der «Psychologischen Arbeiten», kennzeichnet Wundts Verdienste gewiß richtig, wenn er sagt: «Wir sind geneigt, das Bestehen einer physiologischen Psychologie als etwas so Selbstverständliches hinzunehmen, daß es stellenweise schon in Vergessenheit zu geraten beginnt, welchen ungeheuren Einfluß gerade erst Wundts zusammenfassende und anregende Tätigkeit auf den Ausbau alter und die Entstehung neuer psychologischer Forschungsgebiete ausgeübt hat.» Es ist unbedingt richtig, daß die Selbstbeobachtung eine reiche Quelle von Irrtümern ist. Aber ebenso zweifellos ist es, daß uns nichts intimer, unmittelbarer bekannt ist als gerade unser eigenes Innere. Was wir auch sonst beobachten mögen: es bleibt uns ein Äußeres. Wir können nicht in seinen Kern dringen. Im Kreise unserer seelischen Erscheinungen stehen wir mitten drinnen. Sie stehen uns also nahe wie nichts anderes in der Welt. Sollte das nicht zugleich die Ursache davon sein, daß wir bei der Beobachtung dieser Erscheinungen so vielen Fehlern ausgesetzt sind? Objektivität und Unbefangenheit ist dem Nahen gegenüber gewiß schwieriger als dem Entfernten gegenüber. Weil die Selbstbeobachtung etwas so Unmittelbares ist, darum wird sie wohl auch eine schwierige sein. Und es wäre wohl möglich, daß eine ausreichende Selbstbeobachtung nur derjenige üben könnte, der wohlgeschult von andern Beobachtungsfeldern kommt. Was Goethe von der Natur im allgemeinen sagte: «Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben», dies Wort muß besonders von der Natur der Seele gelten. Es gibt aber weite Gebiete des Seelenlebens, denen mit «Hebeln und Schrauben» so viel abzugewinnen ist, daß ihre Gesetze uns in strengen Rechenformeln entgegentreten. - Auf
mein Ohr wirkt ein Schalleindruck. Ich empfinde ihr. Meine Empfjndung setzt meinen Willen in Bewegung. Ich fühle mich durch den wahrgenommenen Schall veranlaßt, eine Handlung auszuführen. Der psychologische Experimentator bemächtigt sich dieses Tatbestandes. Er schaltet in einen elektrischen Stromkreis eine Uhr ein, deren Zeiger sich so lange bewegen, als auf irgendeine Vorrichtung ein Druck ausgeübt wird. Es seien zwei solcher Vorrichtungen in den Stromkreis eingeschaltet. Dann bewegt sich der Zeiger nur so lange, als auf beide Vorrichtungen gedrückt wird. Ein Beobachter mache nun folgendes. Er drücke auf die eine Vorrichtung so lange, bis er einen bestimmten Schall wahrnimmt. Dann lasse er los und drücke zugleich auf die zweite Vorrichtung. Während er dies tut, bewegt sich der Zeiger. Es gibt also eine Zeit, in der er auf beide Vorrichtungen drückt. Dies ist die Zeit, die verflossen ist zwischen dem Empfang des Sinneseindruckes und der Handlung, die auf diesen Eindruck folgt. Man findet, daß ein Achtel bis ein Sechstel einer Sekunde verfließt von der Auffassung einer Sinnesempfinlung bis zu dem Augenblick, in welchem der Mensch eine Bewegung auf diese Empfindung hin ausführen kann. Man erforscht durch ähnlich geistreiche Vorkehrungen die Abnahme der Stärke einer Erinnerung mit der Zeit, die verflossen ist, seit ein Eindruck dem Gedächtnisse einverleibt worden ist; man kann erkennen, wie rasch sich eine neue Vorstellung an eine alte angliedert; man kann ferner den Einfluß der Ermüdung, der Übung auf unser Seelenleben beurteilen und ähnliche Erscheinungen in unerschöpflicher Fülle und Mannigfaltigkeit. In einer stattlichen Reihe von Bänden hat Wundt als «Philosophische Studien» Ergebnisse solcher Forschungen veröffentlicht, die von ihm und seinen Schülern in der Mutteranstalt der Experimentalpsychologie, in seinem Leipziger Laboratorium, ausgeführt worden sind. Eine Reihe deutscher und auswärtiger Hochschulen haben sich nach dem Leipziger Muster ähnliche Anstalten eingerichtet. Aus allen Teilen der gebildeten Welt fanden sich in Leipzig die Schüler ein, die sich unter Wundts Führung die neuen Methoden aneigneten. Und überallhin trugen sie die modernen psychologischen Untersuchungsweisen. In Kopenhagen und Jassy, in Italien
und Amerika lehrt man Experimentalpsychologie im Geiste des Leipziger Forschers. Eine Anzahl bedeutender Gelehrter kann namhaft gemacht werden, die mehr oder weniger selbständig ihren psychologischen Laboratoriuinsarbeiten obliegen und zu schönen Ergebnissen gelangt sind. Carl Stumpf hat namentlich auf dem Felde der Tonpsychologie, Hermann Ebbinghaus auf dem der Gedächmiserscheinungen Wertvolles geleistet. Ernst Mach ist besonders glücklich in der Vereinigung des Experimentes mit der geistvollen Erklärung desselben. Hugo Münsterberg, der lange in Zürich gewirkt hat, wurde zur Pflege der neuen Wissenschaft nach Cambridge berufen.
Es ist in einem kurzen Überblick unmöglich, auf alle die Perspektiven hinzuweisen, die durch die Experimentalpsychologie er-öffnet werden. Unter vielern wird gewiß nicht das Unwichtigste sein, was die Pädagogik von dem jungen Forschungszweige zu lernen hat. Der Unterrichtende, der die Gesetze des jugendlichen Seelenlebens zu lenken hat, wird sich künftig nach den experimentell festgestellten Gesetzen dieses Seelenlebens zu richten haben. Er wird dem Gedächtnisse, der Übung nur so viel zuzutrauen haben, als diese Seelenvermögen nach den psychologischen Ergebnissen leisten können. - Und an die Psychiatrie stellt Kraepelin die entschiedene Forderung, sich die Ergebnisse der Experimentalpsychologie zunutze zu machen. Dieser Forscher ist seit vielen Jahren bemüht, die Frage zu beantworten, auf «welche Weise und in welchem Umfange» dies möglich ist. Er ist der Meinung, daß der Zeitpunkt gekommen sei, in dem die Psychiatrie mit den bisher gebräuchlichen Beobachtungsmethoden keinen weiteren Fortschritt machen kann. Es müssen zu diesen Methoden diejenigen der frisch aufblühenden Experimentalseelenkunde treten. - Es ist gerade das Zeugnis Kraepelins, auf das man sich gerne berufen mag, wenn es auf die Würdigung der neuen Wissenschaft ankommt. Denn dieser besonnene und geistvolle Forscher ist auch gegen die Schattenseiten nicht blind, welche dieser Wissenschaft durch manche ihrer Ve?treter eigen sind. «Wir müssen zugeben, daß unter der Hochflut experimenteller Arbeiten, welche uns das letzte Jahrzehnt gebracht hat, so manche den berechtigten Anforderungen
nicht genügt, daß mit dem Weizen auch das Unkraut vielfach üppig in Saat geschossen ist. » Ebenso wahr sind aber auch die andern Worte Kraepelins: «Gleichwohl dürfen wir heute mit Sicherheit erwarten, daß die junge Wissenschaft diese EntwickIungskrankheit ohne Schaden überstehen und dauernd ihren selbständigen Platz neben den übrigen Zweigen der Naturwissenschaft und insonderheit der Physiologie zu behaupten imstande sein wird.»
HERMAN GRIMM. Gestorben am 16. Juni 1901
Den 16. Juni ist Herman Grimm gestorben. Wer die Art seines Geistes zu schätzen wußte, den überkam bei der Nachricht von seinem Hingange das Gefühl, mit ihm ist eine der Persönlichkeiten von uns geschieden, denen die, welche ihren Bildungsweg im letzten Drittel des abgelaufenen Jahrhunderts zurückgelegt haben, Unsagbares verdanken. Er war für uns die lebendige Vermittlung mit dem Zeitalter Goethes. Die uns nachfolgen, werden keine Zeitgenossen haben, die so über Goethe zu sprechen wissen wie Herman Grimm. Wenn er auch bei Goethes Tode selbst erst vier Lebensjahre zählte, so darf man doch von Herman Grimm wie von einem Zeitgenossen Goethes sprechen. Er war der Schwiegersohn Bettinas, die ganz in Goethes Ideenwelt aufging und von der wir das schöne Buch haben «Goethes Briefwechsel mit einem Kinde». Und Herman Grimm selbst war ganz heimisch innerhalb einer Vorstellungswelt, die ihre Nahrung aus einem unmittelbaren persönlichen Verhältnis zu Goethe sog. Aus dieser Vorstellungsart urteilte er über alle Dinge, nicht nur über Goethe selbst. Wie er seine Bücher über Michelangelo, über Raphael schrieb, so konnte sie nur ein Mann schreiben, der zu Goethe stand wie Herman Grimm. Man wird auch anders über diese Genien urteilen können, und man wird von anderen Kunstperspektiven und anderen
Zeitbedürfnissen heraus anders urteilen müssen. Aber näher in der Auffassungsweise wird ihnen kauin ein Zeitalter kommen können als dasjenige Goethes. Daß sie in der Auffassung des GoetheZeitalters geschrieben sind, das wird Herman Grimms Werken für immer einen unvergleichlichen Wert geben.
Wer Herman Grimm persönlich kannte, hatte im höchsten Maße die Empfindung, wie wenn durch diesen Mann noch Goethe selbst mittelbar zu ihm spräche. - Diesen Eindruck hatte auch der, dessen persönlicher Verkehr mit Herman Grimm sich über so kurze Zeiträume beläuft wie der des Schreibers dieser Zeilen. Ich denke oft an schöne Stunden, die ich in Weimar mit ihm verbringen durfte. Besonders lebhaft schwebt mir eine Unterredung vor, die ich mit ihm allein hatte, als er mich einmal aufforderte, in einem Weimarer Hotel an seinem Mittagsmahle teilzunehmen. Er sprach von seiner Geschichte der deutschen Phantasie als von einem Werke, in dem sich ihm zusammenfaßte, was er über den Entwickelungsgang des deutschen Volkes gedacht hatte. Wie wußte er doch auf die charakteristischen Stellen zu deuten, in denen sich der Kulturgehalt einer Zeit wie in Brennpunkten sammelte. Man mochte selbst über irgend etwas mehr oder weniger anders denken wie er: blitzschnell befiel einem bei jeder seiner Ausführungen die Empfindung, daß sein Gesichtspunkt in irgendeiner Weise berechtigt und im höchsten Maße bedeutend und fruchtbar sei. Ich bin der Meinung, daß man durch nichts die eigentliche Art der deutschen Kultur im zweiten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts so vor seinen Augen sehen konnte, wie wenn man Persönlichkeiten wie Herman Grimm sprechen hörte. Ich habe noch einen Mann kennengelernt, bei dem Ähnliches zutraf, meinen hochverehrten Lehrer Karl Julius Schröer. Er ist vor einigen Monaten in Wien gestorben. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, bald das Bild dieser so verkannten Persönlichkeit, wie es in meiner Seele lebt, zu zeichnen. In etwas anderer Art als Herman Grimm lebte auch er ganz in der Vorstellungsart Goethes. Es liegt in der Natur unseres Zeitalters, daß diejenigen, die nur um acht oder zehn Jahre jünger sind als meine Altersgenossen, ein ganz anderes Bild sich von solchen Persönlichkeiten machen müssen als wir.
Im gewissen Sinne stand Herman Grimm den Grundbedürfnissen unserer Zeit ganz fern. Die sozialen Störungen unserer Tage lagen von seinem Verständnis ab, und den Anschauungen der Darwin und Haeckel gegenüber hat ihn wohl stets ein fröstelndes Gefühl ergriffen. Aber gerade deshalb - so paradox es auf den ersten Blick erscheinen mag, wenn man solches sagt - ist sein Buch über Goethe ein geschichtliches Dokument, wie es nicht viele gibt Es wird niemand mehr so über Goethe schreiben können. Nicht unsere Gegenwartskultur und keine folgende wird das möglich machen. Auf Goethes Generation mußte eine folgen, die noch so viel von Goethe hatte, daß sie unbeirrt um alles Folgende sein Bild festhalten konnte. Herman Grimm gehörte dieser Generation an. Was auch immer über Goethe noch gesagt wird, Grimms «Goethe» kann nicht überholt werden. So wie er wird keiner mehr über Goethe empfinden können; aber in diesen Empfindungen über Goethe lebte sich das Goethe-Zeitalter erst voll aus.
Die sich im «eigentlichen Sinne» Gelehrte nennen, wollten Herman Grimm nicht zu den Ihrigen zählen. Sie sprechen ihm die en gezählt werden. Er wußte zu gut, wie es um die «Methode» steht. Sie ist zumeist eine Krücke für alle diejenigen, die aus Mangel an persönlicher Kraft nicht auf eigenen Füßen gehen können und aus ihrer Eigenschaft heraus zu nichts kommen. Er wußte, daß ihm nur Methode absprechen kann, wer «selbst nichts hat, als nur Methode». Seine Überzeugung war: «Die Persönlichkeit des Einzelnen innerhalb seines beschränkten Kreises wird immer das Wertvolle bleiben.»
Dr. RICHARD WAHLE. GEHIRN UND BEWUSSTSEIN
#G030-1961-SE473 - Methodische Grundlagen der Anthroposophie 1884 - 1901
#TI
III
#G030-SE475
Dr. RICHARD WAHLE GEHIRN UND BEWUSSTSEIN
Physiologisch-psychologische Studie. Wien 1884
#TX
Diese Schrift ist eine von jenen in unserer Zeit irimer seltener werdenden philosophischen Erscheinungen, die ein hesrimmtes wissenschaftliches Problem nicht vom Standpunkte irgendeiner Schulrichtung, sondern selbständig und voraussetzungslos zu lösen versuchen. Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, die Bedeutung der physiologischen Erforschung des Gehirnmechanismus für die Erkenntnis der Bewußtseinserscheinungen darzulegen. Zunächst widerlegt er die in naturwissenschaftlichen Kreisen heute allgemein geltende Ansicht, daß die uns unmittelbar durch die Sinne gegebene Welt, dieser Komplex von Farben, Tönen, Gestalten, Wärmedifferenzen und so weiter nichts weiter sei als die Wirkung objektiver materieller Vorgänge auf unsere subjektive Organisation. Die Erscheinungswelt sei also im Grunde ein subjektiver Schein, der nur so lange Bestand habe, als wir unsere Sinne den Eindräcken der materiellen Prozesse offenhalten, wogegen diese Prozesse selbst aus einer von uns ganz unabhängigen eigenen Wirklichkeit gesättigt und so die wahre Ursache aller Naturerscheinungen seien. Wahle zeigt nun, daß den Vorgängen in der Materie gar kein höherer Grad von Wirklichkeit zukommt als jener angeblich von ihnen bewirkten subjektiven Welt. Wir müssen beide als uns vorliegende Vorkommnisse betrachten, die uns als zusammengehörig (koordiniert) gegenübertreten, ohne daß wir berechtigt wären anzunehmen, das eine sei die wahre Ursache des anderen. Es ist so, wie wir etwa Tag und Nacht als einander koordiniert ansehen müssen, ohne daß das eine von beiden als Wirkung des anderen betrachtet werden könnte. So wie hier die notwendige Aufeinanderfolge in dem Bau und den Vorgängen unseres Sonnensystems begrundet liegt, so wird auch die Koordination eines materiellen Prozesses und einer Empfindungsqualität, zum Beispiel Ton, Farbe und so weiter, von irgendeinem wahrhaften Tatbestand bedingt sein; jedenfalls aber nicht davon, daß der erstere die letztere bewirkt. Nun ergibt sich die Zusammengehörigkeit
von Gehirnmechanismus und Bewußtsein nur als ein spezieller Fall einer solchen Koordination. Wir sind, nach Wahle, nur in der Lage wahrzunehmen, daß beide parallel verlaufende Vorkommnisse sind; wir sind aber nicht berechtigt, das Bewußtsein als reale Folge des Gehirnmechanismus anzusehen. Die Physiologie behält recht, wenn sie die materiellen Korrelate zu den geistigen Phänomenen sucht; aber die materialistische Phantastik, die den Geist zum wahrhaften Produkte des Gehirns machen will, erhält den Abschiedsbrief. Ja, jener arbeitet Wahle sogar entgegen, indem er zeigt, daß die bisher in der Psychologie als selbständige Akte des Bewußtseins geltenden Phänomene, wie Anerkennen, Verwerfen, Lieben, Wünschen, Wollen und so weiter, nichts anderes sind als miteinander oder mit anderen koordinierte Vorkommnisse, die gar nicht die Annahme einer besonderen subjektiven Tätigkeit, welche der Physiologie ungünstig wäre, nötig machen. Die Bewußtseinsphänomene führt der Verfasser auf ein allgemeines Gesetz zurück, wodurch eine Vorstellung durch eine ihr nicht ganz, sondern teilweise gleiche in das Bewußtsein zurückgerufen werden kann. So wäre es bloß Aufgabe der Physiologie, für diesen psychologischen Befund den korrespondierenden mechanischen Tatbestand im Gehirne zu finden, was gewiß leichter ist, als wenn das für jeden der obenangeführten angeblichen Bewußtseinsakte geschehen müßte.
Die Hauptbedeutung dieses Werkchens liegt darin, einmal in scharfen Konturen gezeigt zu haben, was uns eigentlich die Erfahrung gibt und was oft zu ihr nur hinzugedacht wird. Alles, was die einzelnen Wissenschaften finden können, besteht nur in dem Konstatieren zusammengehöriger Vorkommnisse, wobei wir voraussetzen müssen, daß die Hinzugehörigkeit selbst in irgendeinem wahrhaften Tatbestande gegründet liege. Wir halten das von dem Verfasser Vorgebrachte für durchaus überzeugend, glauben jedoch, daß er die letzte Konsequenz seiner Ansichten nicht gezogen hat. Sonst hätte er wohl gefunden, daß uns jene wahrhaften Tatbestände selbst als erfahrungsmäßige Vorkommnisse - nämlich die ideellen - gegeben sind und daß die Negation des Materialismus folgerichtig zum wissenschaftlichen Idealismus führt.
Sehen wir somit eigentlich in dem Fortschreiten von der durchaus soliden Grundlage, die Wahle gelegt, zu einer höheren Stufe der Erkenntnis das Richtige, so gestehen wir doch rückhaltlos, daß wir in dieser Schrift eine hervorragende Leistung erblicken, die bestimmend auf den Zweig der Wissenschaft wirken wird, dem sie angehört, und die gewiß in der Geschichte der Philosophie eine Stelle einnehmen wird.
ÜBER DAS VERHÄLTNIS THOMAS SEEBECKS ZU GOETHES FARBENLEHRE
Aus dem soeben erschienenen Buche: «Erinnerungen an Moritz Seebeck» von Kuno Fischer (Heidelberg 1886) möchten wir einige Punkte anführen, die ein klares Licht auf das Verhalten werfen, das der ausgezeichnete Physiker Thomas Seebeck (der Vater Moritz') der Farbenlehre Goethes gegenüber beobachtete. Nur ein paar Worte mögen vorausgehen. Seebeck, dem wir die epochemachende Entdeckung der entoptischen Farben verdanken, wurde von Goethe als ein begeisterter Anhänger seiner Farbenlehre an-gesehen. Die beiden verkehrten besonders 1802 bis 1810 viel in Jena, wo sie gemeinschaftlich Versuche auf dem Gebiete dieser Wissenschaft anstellten. Im Jahre 1818 wurde Seebeck zum Mitgliede der Berliner Akademie berufen. Dem scheinen nicht geringe Hindernisse im Wege gestanden zu sein. So berichtet Zelter nach Seebecks Tode an Goethe: «wie der Minister Arbeit gehabt, den bedeutenden Mann in die Akademie zu schaffen, der doch der berufenen Farbenlehre ergeben gewesen, sich aber nachher im Amte selber, wo nicht als Abgefallener, doch gemäßigt erwiesen habe, weil er sich in der Mathematik nicht stark gefunden» (siehe Fischer, S.11). Als Abgefallenen betrachtete ihn denn auch Goethe nach der Berufung. Er hatte ibm Unrecht getan. Seebeck war bis zu seinem Tode treu geblieben, wie eben Fischer in seinem Buche nachweist. Seite 19 sagt derselbe: «Was Seebecks Verhalten zur
Farbenlehre betrifft, so hat Goethe dasselbe nicht richtig beurteilt. Auch als Akademiker hat Seebeck seine Ansicht weder geändert noch verheimlicht. Wir hören darüber das voliwichtige Zeugnis der akademischen Gedächtnisrede: «Gemeinsames Interesse an den Farbenerscheinungen veranlaßte, daß er und Goethe öfters Versuche zusammen anstellten, wobei zwar im einzelnen manche Abweichungen zur Sprache kamen, in den Hauptbeziehungen jedoch Übereinstimmung der Ansichten von dem Wesen der Farbe stattfand... In der Farbenlehre stand er auf Goethes Seite und behauptete, wie dieser, die Einfachheit des weißen Lichts.» Seite 13 ff. zitiert Fischer den Brief, den Moritz Seebeck bei dem Tode seines Vaters (20. Dezember 1831) an Goethe richtete. Darin heißt es: «Ew. Exzellenz Schriften jedes Inhalts kamen nicht von seinem (Seebecks) Tische, sie waren seine liebste Lektüre; oft sprach er es aus: «Unter allen lebenden Naturforschern ist Goethe der größte, der einzige, der weiß, worauf es ankommt.» Wir möchten gerade in dem Verhältnis Seebecks zu Goethes Farbenlehre den Beweis erblicken, daß von einem Verlassen der tiefen Auffassung Goethes bei dem gar nicht mehr die Rede sein kann, der wirklich so in sie eingedrungen ist, daß er den Punkt gefunden hat, auf den alles ankommt.
HUNDERT JAHRE ZURÜCK. Zur Farbenlehre
Außer dem zweiten Teile des «Faust» ist über kein Werk Goethes so geringschätzend geurteilt worden wie über seine Farbenlehre. Seine poetischen Schöpfungen werden immer mehr zur Grundlage unserer ganzen Bildung und seine gewaltige Naturauffassung mit ihren wunderbaren Konsequenzen im Reiche des Organischen erfreut sich immer mehr der Anerkennung derer, die Tiefblick genug besitzen, einzusehen, daß gerade sie das geistige Band bildet für die Unzahl der heute auf naturwissenschaftlichem Boden bekannten Tatsachen. Nur die Farbenlehre gilt als der mißlungene
Versuch eines Mannes, dessen ganzer Geistesrichtung die Denkweise fremd war, die in der Physik maßgebend ist. Dieser schroffen Ablehnung steht die vollwichtige Tatsache gegenüber, daß gerade die Farbenlehre die reifste Frucht von Goethes Forschen ist, daß also gerade in ihr seine Naturauffassung sich bewähren mußte. Das genügt allein schon, die Akten hierüber noch einmal zu prüfen. Vielleicht ist die Fragestellung bisher nicht die rechte gewesen. Wir wollen uns bemühen, dieselbe wenigstens in einem Punkte zu berichtigen: was Goethes Verhältnis zur Mathematik betrifft. Gerade der Umstand, daß er kein Mathematiker gewesen, steht ja einer unbefangenen Beurteilung seiner Farbenlehre störend im Wege. Wer aber das von Goethe über Mathematik Gesagte eingehend erwägt, wird sehen, wie der Dichter bemüht war, die Grenze zu finden, wo in der Naturwissenschaft Mathematik am Platze ist, wo nicht. Damit wollte er zugleich das Reich seines Forschens begrenzen. Mit Rücksicht darauf ergeben sich in bezug auf diesen Punkt folgende Hauptfragen: 1. Hat Goethe diese Grenze richtig bestimmt? 2. Hat er sie gebührend berücksichtigt? und 3. Hätte er bei genauer Bekanntschaft mit der Mathematik seiner Farbenlehre eine andere Gestalt geben können, ohne zugleich seiner ganzen Naturauffassung untreu zu werden? Diese Fragen müssen künftig die Grundlage bilden, wenn es sich um die Beurteilung von Goethes Farbenlehre handelt. Mindestens, so scheint es uns, sollte man über Goethes Farbenlehre nicht weiter den Stab brechen, ohne früher diese Fragen zu erledigen.
ERNST MELZER. GOETHES PHILOSOPHISCHE ENTWICKLUNG
Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie unserer Dichterheroen
Neiße 1884
Daß am Ende des vorigen und am Anfange dieses Jahrhunderts in Deutschland Philosophie und Dichtung gleichzeitig einen gewaltigen Aufschwung erlebten, ist kein zufälliges Zusammentreffen. Es fand eine Vertiefung des ganzen Wesens der Nation statt,
und es war eine und dieselbe Botschaft, die von Philosophen sowohl als von Dichtern verkündet wurde. Die deutsche Philosophie und die deutsche Dichtung der klassischen Periode fließen aus einer Geistesrichtung. Daraus erklärt es sich, warum unsere größten Dichter: Lessing, Herder, Schiller, Goethe, auch den Drang fühlten, sich mit den tiefsten Fragen der Wissenschaft auseinanderzusetzen. Sie sind nicht bloß vollendete Künstler, sie sind vollendete Menschen im höchsten Sinne des Wortes. Daß neben den der Betrachtung der Kunstschöpfungen unserer Klassiker gewidmeten Schriften auch die ihren philosophischen Gedankenkreisen zugewendeten stets zunehmen, ist hieraus erklärlich. Das oben-genannte Buch behandelt die philosophische Entwickelung Goethes. Der Geist, in dessen Schaffen die verschiedenen Ausgestaltungen des deutschen Volksgeistes sich zu der schönsten Harmonie vereinigt haben, ist Goethe. Künstlerische Gestaltungskraft und wissenschaftlicher Einblick in die Triebkräfte der Natur und des Menschengeistes sind die Elemente, die in das Wesen dieses Geistes eingeflossen, jedoch so, daß sie ihr Sonderdasein aufgegeben haben und zu einem einheitlichen Ganzen, zu einer unsere Weltanschauung zugleich erweiternden und vertiefenden Individualität wurden. Nur so betrachtet wird die Rolle klar, die die Philosophie in dem Organismus des Goetheschen Geistes spielt. Eine Schrift über Goethes philosophische Entwickelung müßte zeigen, inwie-fern die Philosophie erstens eine bei seinem künstlerischen Schaffen mittätige Kraft und zweitens eine seine wissenschaftlichen Versuche stützende Grundlage ist. Aus den aphoristischen Äußerungen über seine Weltanschauung allein können wir kein Bild derselben gewinnen, wenn sie auch vielfach klärend und ergänzend für dasselbe sind. Wenden wir das Gesagte auf Melzers Buch an, so müssen wir gestehen, daß der Verfasser die springenden Punkte der Sache nicht erkannt hat. Wir möchten dabei manches Gute seines Buches nicht übersehen. Es gehört dazu vor allem die Grundtendenz desselben, Goethe nicht aus einzelnen Äußerungen, sondern aus dem Gange seiner Entwickelung zu erkennen (S.3). Wenn aber der Verfasser trotz dieser Tendenz (S. 36) zum Beispiel findet, daß Goethes philosophisch-religiöse Ansicht am Ende
seiner Jugendperiode eine Art Mittelding zwischen Rationalismus und Orthodoxie sei, so zeigt das, wie wenig er sieht, worauf es eigentlich ankommt. Schlagworte, wie Naturalismus, Rationalis-mus, Pantheismus, führen uns in Goethes Geist einmal nicht hin-ein; sie verlegen uns nur den Zugang in die Tiefe seines Wesens. Deshalb geht für Melzer auch das Vollbestimmte, Individuelle der Goetheschen Weltanschauung verloren. So sieht er die Quintessenz des Aufsatzes «Die Natur» (S. 24) in dem Satze: «sie (die Natur) ist alles» und definiert demzufolge Goethes Ansicht als Naturalismus. Während aber der Naturalismus die Natur nur in ihren fertigen Produkten sieht, als tote, abgeschlossene, und in dieser Gestalt den Geist mit ihr identifiziert, geht Goethe auf sie als Produzentin, als schöpferische, zurück und dringt so über die Zufälligkeit zur Notwendigkeit vor. Er erreicht damit jene Quelle, aus der Geist und Natur zugleich fließen und kann von dieser wirklich sagen: «sie ist alles.» Goethe hatte der Welt etwas zu verkünden, was sich mit keinem überlieferten Gedankengebäude umspannen, noch weniger mit den hergebrachten philosophischen Kunstausdrücken aussprechen läßt. Es lag in ihm eine Welt von ursprünglichen Ideen, und wenn von dem Einfluß älterer oder neuerer Philosophen auf ihn gesprochen wird, so kann das nicht in dem Sinne geschehen - wie es Melzer tut -, als ob er auf Grund von deren Lehren seine Ansichten gebildet habe. Er suchte Formeln, eine wissenschaftliche Sprache, um den in ihm liegenden geistigen Reichtum auszusprechen. Diese fand er bei den Philosophen, vornehmlich bei Spinoza. Den Fehler, Goethes Ideenwelt als das Resultat verschiedener von ihm aufgenommener Lehren darstellen zu wollen, teilt Melzer mit vielen, die sich mit der dem Goetheschen Schaffen zugrunde liegenden Philosophie beschäftigt haben. Es wird dabei übersehen, daß, wer Goethes philosophische Entwickelung darstellen will, vor allem aus dessen Wirken den Glauben an die Ursprünglichkeit seiner Sendung und die Genialität seines Wesens gewonnen haben muß.
ÜBER DEN GEWINN DER GOETHE-STUDIEN DURCH DIE WEIMARER AUSGABE IN NATURWISSENSCHAFTLICHER BEZIEHUNG
[Chronik des Wiener Goethe-Vereins, 4. Jg., III. Bd, Nr. 11]
«Goethe - und noch immer kein Ende! Kritische Würdigung der Lehre Goethes von der Metamorphose der Pflanzen», so nennt sich eine jüngst erschienene Schrift von K. Fr. Jordan (Hamburg 1888, Verlagsanstalt und Druckerei AG), in welcher wieder einmal der Beweis versucht wird, daß Goethes Weltanschauung jeder wissenschaftliche Wert abgehe, daß dem großen Dichter überhaupt der «rechte wissenschaftliche Sinn» gemangelt habe. Als Grund für diese Behauptung gibt der Verfasser an, daß Goethe eine von der mechanischen Naturauffassung völlig abweichende Geistesrichtung einschlug. Für Jordan aber hört die Wissenschaft da auf, wo die mechanische Auffassung aufhört; «die Wissenschaft muß mechanisch sein, denn die mechanischen Vorgänge sind dem menschlichen Geiste die faßlichsten», behauptet er. Mit solchen geistigen Voraussetzungen sich bis zur Geisteshöhe Goethes zu erheben, ist nun freilich eine Unmöglichkeit. Es soll nicht geleugnet werden: Goethe war ein Gegner der von Jordan vertretenen Denkweise. Aber er war es deshalb, weil seinem tief in das Wesen der Dinge dringenden Geiste klar war, daß diese Denkweise nur für die Erkenntnis der unteren Stufen des Naturdaseins ausreicht und daß uns ein Einblick in die eigentlichen Gesetze des organischen Lebens verschlossen bliebe, wenn wir uns nicht über das Denken der mechanischen Gesetzlichkeit erheben könnten. Gerade Goethes Idee der Pflanzen-Metamorphose ist ein Beweis dafür, daß uns unser Erkenntnisvermögen auch da nicht im Stiche läßt, wo wir an das Leben herantreten, das in seiner Wesenheit doch niemals von der Mechanik erfaßt werden wird. Mit dieser Idee sind der Organik ebenso neue Wege gewiesen worden wie mit Galileis Grundgesetzen der Mechanik. Wer sich dieser Tatsache verschließt, wird nicht nur niemals zu einer gerechten Würdigung der wissenschaftlichen Stellung Goethes kommen, sondern er fügt
auch der Wissenschaft selbst einen erheblichen Schaden zu, denn er entzieht ihr ein bereits erschlossenes Gebiet fruchtbarer Ideen.
Schreiber dieser Zeilen versucht nun seit einer Reihe von Jahren jenen Standpunkt Goethe, dem Forscher, gegenüber zu vertreten, der dessen ganz eigenartiger Stellung innerhalb der Geschichte der Wissenschaft gerecht wird. Bei der oft aphoristischen, oft fragmentarischen Art, in der uns Goethes wissenschaftliche Ideen in seinen Werken vorliegen, war es dabei notwendig, oft über das bloße Studium und die Auslegung des vorhandenen Stoffes hinaus-zugehen und die verbindenden Gedanken zu suchen, die in Goethes Geist lagen und die vielleicht überhaupt nicht aufgezeichnet, vielleicht aus irgendeinem Grunde im Pulte zurückgeblieben waren. Dadurch gestaltete sich ein Ganzes Goethescher Weltanschauung aus, das freilich von den gebräuchlichen Auffassungen sehr abwich. Der Einblick nun, der mir vor kurzem in die hinterlassenen Papiere des Dichters wurde, erfüllte mich mit innigster Befriedigung. - Mit der Herausgabe eines Teiles der wissenschaft-lichen Schriften Goethes für die Weimarische Goethe-Ausgabe betraut, war es mir gegönnt, das ungedruckte reiche Material zu prüfen. Diese Prüfung ergab nun durchwegs eine vollkommene Bestätigung dessen, was man bei einer gründlichen, liebevollen Vertiefung in die wissenschaftlichen Werke des Dichters wohl erkennen mußte, womit man aber dennoch auf solche Widersprüche wie jene Jordans gefaßt sein mußte, weil jene verbindenden Gedanken, von denen wir oben gesprochen, für viele Menschen doch zu sehr den Charakter des Hypothetischen trugen. Wir meinen damit nicht, daß für uns jenes Ganze Geethescher Auffassung nicht vollen wissenschaftlichen Wert gehabt hätte, aber das ist eine Überzeugung, die zuletzt nur der gewinnen kann, der den Willen zu einer solchen liebevollen Vertiefung in Goethes Geist hat - und das ist ja doch nicht jedermanns Sache; wenigstens scheint es so. - Durch die neue Weimarer Ausgabe wird nun ein Zweifaches gewonnen werden: einmal wird jeder Zweifel darüber verstummen müssen, wie Goethe über gewisse Punkte in der Naturwissenschaft dachte, weil seine eigenen Ausführungen deutlich und klar seinen Standpunkt bestimmen; zweitens wird der
hohe wissenschaftliche Ernst, der aus diesen Ausführungen spricht, endiich das Urteil, das den Dichtet als wissenschaftlichen Dilettanten hinstellen möchte, einfach als oberflächlich erscheinen lassen. Goethe ein Dilettant! Er, der mit der Mehrzahl der geistig Strebenden Deutschlands in seiner Zeit unmittelbare Beziehungen hatte und in so viele weltbewegende Ideen mit persönlichem Anteil eingriff! Wir sehen die größten Gelehrten seiner Zeit mit ihm die Gedanken über ihre Entdeckungen austauschen, wir sehen seine fördernde Anteilnahme an der ganzen Entwickelung seiner Zeit.
Man hat versucht, Goethe als einen Vorläufer Darwins hinzustellen. Es war das die wohlwollende Überzeugung derjenigen, die im Darwinismus das «Um und Auf» aller Wissenschaft von den Lebewesen sehen und die dadurch Goethes wissenschaftliche Ausführungen «retten» wollten. Diese Ansicht hat bei den mehr zur Du Bois-Reymondschen Schule hinneigenden Naturforschern Widerspruch hervorgerufen, weil zahllose Stellen in Goethes Schriften durchaus nicht mit der heute üblichen Auffassung der Lehre Darwins in Einklang zu bringen sind. Man konnte nun nicht in Abrede stellen, daß diese beiden Parteien scheinbar gewichtige Gründe für ihre Behauptungen aufbringen konnten. Dem tiefer Blicken-den war freilich klar, daß Goethe ein Darwinianer im landläufigen Sinne niemals sein konnte. Seinem Blicke entging es ja nicht, daß alle Naturwesen im innigen Zusammenhange miteinander stehen, daß es nichts Unvermitteltes in der Natur gibt, sondern daß Übergänge zwischen den in ihrer Bildung verschiedenen Lebewesen die ganze Natur als eine stetige Stufenfolge erscheinen lassen müssen. Aber er blickte tiefer als der Darwinismus von heute. Während dieser nur die verwandtschaftlichen Beziehungen der organischen Wesen und die Beziehungen zu ihrer Umgebung untersucht, um dadurch einen möglichst vollständigen Stammbaum alles Lebens auf der Erde zu gewinnen, drang Goethe auf die Idee des Organischen, auf dessen innere Natur. Er wollte untersuchen, was ein organisches Wesen ist, um daraus dann die Möglichkeit einzusehen, wie es in so und so viel mannigfaltigen Formen auftreten kann. Der heutige Darwinismus sucht die verschiedenen
Gestalten des ewigen Wechsels. Goethe suchte das Dauernde in diesem Wechsel. Der Naturforscher der Gegenwart fragt: welcher Einfluß des Klimas, der Lebensweise hat statt-gefunden, damit sich aus jenem Lebewesen dieses entwickelt hat? Goethe fragte: welche inneren organischen Bildungsgesetze sind bei jener Entwickelung wirksam. Goethe verhält sich zu dem modernen Naturforscher wie der Astronom, der durch zusammen-fassende kosmische Gesetze die Erscheinungen am Himmel erklärt, zu dem Beobachter sich verhält, der durch das Fernrohr die verschiedenen Stellungen der Sterne erfahrungsgemäß feststellt. Goethes naturwissenschaftliche Ausführungen sind nicht nur eine prophetische Vorausnahme des Darwinismus, sondern sie sind die ideelle Voraussetzung desselben. Durch sie wird sich die moderne Naturwissenschaft ergänzen müssen, sonst wird sie sich nicht von der bloßen Erfahrung zur Theorie erheben. Die Weimarische Ausgabe aber wird durch die Veröffentlichung des Nachlasses Goethes den unumstößlichen Nachweis von dieser Behauptung erbringen. Sie wird uns jene vermittelnden Gedanken zeigen, durch die Goethes Stellung zum Darwinismus im angedeuteten Sinne klar werden wird. Die hierüber stark ins Schwanken gekommenen Anschauungen werden eine wesentliche Befestigung erfahren. Goethes Idealismus in der Wissenschaft wird ebensowenig angezweifelt werden können wie die Bedeutsamkeit und Tiefe seiner wissenschaftlichen Ideen. Wenn man sich wird überzeugen können, von welchem Ringen nach wahrer Erkenntnis, nach wissenschaftlicher Gründlichkeit seine Gedanken gleich bei ihrem Entstehen zeugen, dann wird man wohl nicht mehr behaupten, der «große Dichter» habe keinen wissenschaftlichen Sinn gehabt.
In der Einleitung zum zweiten Bande meiner Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften (Kürschners «Deutsche National-Literatur», Goethes Werke, Band XXXIV, S. XXXVIII f.) habe ich bereits darauf hingewiesen, daß Goethe einen Aufsatz über wissenschaftliche Methode geschrieben hat, den er am 17. Januar 1798 an Schiller sandte, der aber in den Werken leider nicht enthalten ist. Ich versuchte damals eine Rekonstruktion der in dem Aufsatze enthaltenen Ansichten über naturwissenschafuiche Forschung.
Der Aufsatz schien mir die wichtigsten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen Goethes zu enthalten. - Er ist uns nun auch erhalten! - Er schließt sich an den über den «Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt» an (s. o., Goethes Werke, Band XXXIV, S. 10 f.), ist aber von beiden der ungleich wichtigere. Er enthält ein Programm aller naturwissenschaftlichen Forschung; er zeigt, wie sich dieselbe entwickeln muß, wenn sie den Anforderungen unserer Vernunft ebenso wie dem objektiven Gange der Natur gerecht werden will. Das alles in genialen Zügen, die uns mit einem Male auf jene geistige Höhe erheben, wo der Blick unbeirrt in die Geheimnisse der Natur dringt. In diesem Aufsatze haben wir den unmittelbarsten Ausdruck des Goetheschen wissenschaftlichen Geistes. Wer in Zukunft etwas gegen diesen Geist wird vorbringen wollen, mag sich zuerst an diesem Aufsatze versuchen. Von da wird Licht ausgehen über alle übrigen Goetheschen Schriften, soweit sie die Wissenschaft angehen.
Aus alledem ersieht man, daß durch die neue Ausgabe vor allen andern Dingen eines gewonnen wird: Wir werden imstande sein, besser als dies bisher möglich war, jede einzelne Geistestat Goethes in dem Zusammenhange mit seinem Wesen zu betrachten. Und es wird die Aufgabe der Ausgabe in dieser Hinsicht sein, dies durch Anordnung und Auswahl des Aufzunehmenden so viel als möglich zu erleichtern. Gerade in wissenschaftlicher Beziehung wird daher die Goetheforschung, welche die Frau Großherzogin von Weimar mir nicht genug zu preisender liebe-voller Hingabe in ihren Schutz genommen, durch die Publikationen des Goethe-Archivs gewinnen.
Es ist kein Zweifel, daß auch manches Fragmentarische mit zur Veröffentlichung gelangen muß, daß mancher angefangene und dann liegengebliebene Aufsatz vor die Augen der Leser treten wird. Auf diese stilistische Vollständigkeit kommt es aber nicht an. Die Hauptsache ist, daß wir alles, was an Geistesprodukten Goethes uns erhalten geblieben ist, in einer solchen Gestalt vor Augen haben, daß wir in der Lage sind, uns ein geistiges Bild seiner Weltanschauung zu machen. Und in dieser Hinsicht sind Riemer und Eckermann von manchem Fehler, den sie bei der
Redaktion der nachgelassenen Werke gemacht haben, wohl nicht freizusprechen. Sie haben manches weggelassen, was zum Verständnisse notwendig ist, und haben in der Anordnung nicht jenes allein richtige Prinzip verfolgt, welches die einzelnen Schriften in jener Folge bringt, daß sie sich gegenseitig selbst als Kommentar dienen.
Aber das Bekanntwerden auch des Skizzenhaften, Fragmentarischen hat noch einen weiteren Vorteil. Wir werden, indem wir oft den Gedanken in Goethes Geist aufschießen sehen, gerade aus dieser seiner ersten Gestalt die eigentliche Tragweite desselben und die Bedeutung erkennen, und wir werden hieraus die ganze Tendenz des Goetheschen Strebens miterleben. Wir werden mit ihm ringen, indem wir hineinblicken, wie sein stets in die Tiefen gehender Geist sich zur Klarheit allmählich emporringt. Es wird uns möglich sein, ihm auf seinen Wegen nachzugehen und dadurch uns immer in seine Denkweise einzuleben.
Wir werden sehen, wie sich Goethe klar bewußt war, daß wir, wo immer wir in der Erfahrungswelt einsetzen, bei stetigem unablässigen Wollen endlich doch der Idee begegnen müssen. Er geht nie auf eine Idee aus. Naiv sucht er nur die Erscheinungen zu erfassen, aber er findet zuletzt immer die Idee. Dafür ist jede Zeile seiner Arbeiten ein vollsprechender Beweis.
Zusammenfassend möchten wir sagen: Goethes wissenschaftliche Individualität wird in ihrer vollen Bedeutung in kurzer Zeit so klar vor unseren Blicken auftauchen, daß eine Schrift wie die eingangs erwähnte von Jordan von der gebildeten Welt Deutschlands als eine immerhin beklagenswerte, aber doch im Wesen unschädliche Schulverirrung angesehen werden wird.
EDUARD GRIMM. ZUR GESCHICHTE DES ERKENNTNISPROBLEMS
Leipzig, 1890
[Weimarische Zeitung 1891, Nr. 20]
Vor wenigen Wochen wurde die deutsche Philosophie um ein wertvolles Buch bereichert, das in Weimar entstanden ist. Der Umstand, daß der Verfasser des Werkes der Archidiakonus Dr. Eduard Grimm ist, und die wissenschaftliche Bedeutung, die demselben zukommt, rechtfertigen es wohl hinlänglich, wenn wir an dieser Stelle der innigen Befriedigung Ausdruck geben, die uns die Lektüre desselben gewährt hat. Wir fanden eine der interessantesten Epochen in der Entwickelung der Wissenschaft in wahrhaft mustergilltiger Weise erörtert. Das Buch stellt sich zur Aufgabe, die Lehren der fünf englischen Philosophen: Francis Bacon (1561 bis 1626), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1709), George Berkeley (1685-1753), David Hurne (1711-1776) für die Erkenntnistheorie darzustellen, das ist für jene Wissenschaft, welche sich damit befaßt, die Frage zu beantworten: inwieweit ist der Mensch imstande, durch sein Denken die Welträtsel zu lösen und die Gesetze der Natur und des Lebens zu erforschen?
Die wissenschaftliche Periode, der jene fünf Denker angehören, ist darum so außerordentlich bedeutsarn, weil gerade sie einen der wichtigsten Wendepunkte in dem wissenschaftlichen Leben bezeichnet. Die Weisheit des Mittelalters hatte sich damit begnügt, jene Wege weiterzuwandeln, die der gewaltige Lehrer Alexanders des Großen, Aristoteles, betreten hat. Die Art, wie er die Aufgaben der Wissenschaften angefaßt, die Ziele, die er gesteckt, galten als unanfechtbar auch dann noch, als längst neue Beobachtungen und Erfahrungen mit denselben nicht mehr recht in Einklang zu bringen waren. Dadurch aber ward jeder Fortschritt gehemmt, die freie Entfaltung eines von den Entdeckungen im Felde der Wissenschaft geforderten freien und unabhängigen Denkens unmöglich gemacht. Da trat Francis Bacon auf den Plan. Reinigung der Wissenschaft von allen hergebrachten Vorurteilen und vollständig neuer Aufoau derselben auf Grund der damals neuen Erningenschaften
war sein Ziel. Grimm versteht es nun meisterhaft, Bacon gerade da zu erfassen, wo seine große Bedeutung für die Entwickelung des europäischen Denkens arn deutlichsten hervor-tritt. Durch das Festhalten an Grundsätzen, die einer längst vergangenen Zeit angehörten und nur für das Leben dieser Zeit Gültigkeit und Wert haben konnten, hatte sich die Wissenschaft dem Leben der unmittelbaren Gegenwart entfremdet, ja war vollständig unbrauchhar für dasselbe geworden. Aber «alle Wissenschaft ist aus dem Leben hervorgegangen und entnimmt aus demselben das Recht und die Grundlage ihres Bestehens. Entfernt sie sich allzuweit von diesem ihrem Ursprung, so kann es nicht fehlen, daß das Leben selbst mit der ihm eigenen unmittelbaren Gewalt sich ihr entgegensetzt und zu einer Neubildung der Wissenschaft hin-drängt. In solcher Art tritt Franz Bacon von Verularn der Wissen-schaft seiner Zeit entgegen. Er macht ihr den Vorwurf, sie gleiche einer Pflanze, die, von ihrem Stocke abgerissen, in keinem Zusammenhange mehr steht mit dem Leibe der Natur und deshalb auch keine Nahrung mehr aus demselben empfängt.» (Vgl. Grimm, Zur Geschichte des Erkenntnisproblems, 8.5-6.) Wie nun Bacon durch die Aufstellung einer untrüglichen Beohachtungs- und Versuchsmethode die Wissenschaft in das rechte Geleise bringen will, wie er dadurch, daß er allen Vorurteilen und Irrtümern sowohl hei den Gelehrten wie bei allen übrigen Gebildeten schonungslos zu Leibe geht, nur dem unbedingt sicheren Wissen Eingang verschaffen will, das setzt Grimm mit ebensoviel Gründlichkeit wie wahrhaft philosophischer Überlegenheit auseinander. Dem, wie überhaupt dem ganzen Buche gegenüber, müssen wir die einzig geschichtlich richtige Methode rühmen, die den in Betracht kommenden Denkern dadurch vollste Gerechtigkeit widerfahren läßt, daß sie sie überall, wo es nötig erscheint, selbst zu Worte kommen läßt. Die wohltuende Wirkung, die von dem Buche ausgeht, ist zum nicht geringen Teile in dem Umstande zu suchen, daß der Verfasser nicht, wie so viele neuere Geschichtsschreiber der Wissenschaft es machen, seine eigenen wissenschaftlichen Ansichten bei Beurteilung fremden Denkens hervorkehrt, sondern das für den Einsichtigen doch überall sichtbare persönliche Können in
den Dienst einer allseitigen objektiven Entwickelung der behandelten Gedankensysteme stellt.
Die Baconsche Denkrichtung hatte bei all ihrer hohen Bedeutung sich einer einseitigen Überschätzung der bloßen Beobachtung der Dinge auf Kosten des selbständigen, aus der eigenen Brust des Menschen schöpfenden Denkens schuldig gemacht. Dieser Mangel wurde noch größer bei Thomas Hobbes, der in dem Denken nichts sah als eine durch die Sprache vermittelte Fähigkeit. «Verstand ist das Verstehen der Worte.» (Grimm, S. 87.) Daß das Denken von sich aus und durch sich selbst zu Erkenntnissen kommen kann, leugnet Hobbes. «Die sinnliche Wahrnehmung, die Imagination und die Aufeinanderfolge unserer Vorstellungen, die wir Erfahrung nennen, ist das uns von der Natur Gegebene.» (Grimm, S. 85-86.) «Als Vernunft bezeichnet Hobbes jene Tätigkeit, durch welche wir Vorstellungen und Worte zusararnensetzen.» (Grimm, S. 87.) So beruht nach Hobbes die Wissenschaft nicht auf einem denkenden Begreifen der Welt, sondern lediglich auf vernünftigem Gebrauch und richtigem Verständnis der Worte. Daß die Worte Ideen vermitteln und erst auf diesen unsere Erkenntnis beiuht, ist ein Satz, der für Hobbes nicht existiert. Daß unter solchen Umständen das Wissen keinen selbständigen Zweck mehr haben kann, ist wohl begreiflich. Daher findet Hobbes: «Das Wissen ist urn des Könnens willen da, die Mathematik um der Mechanik, alle Spekulation um irgendeines Werkes, irgendwelchen Handelns willen.» (Grimm, S. 99.) Gewiß: ein Wissen, das nur aus Worten besteht, kann keinen selbständigen Wert haben. Allerdings glaubte Hobbes, das, was er wollte, nur dadurch erreichen zu können, daß er der Wissenschaft diese Wendung gab. Was wir in einzelnen Fällen beobachten, erfahren, hat ja nur eine eingeschränkte Wahrheit. Wir können nie wissen, ob es sich auch in allen den Fällen bewahrheitet, die wir nicht beobachtet haben. Die Worte aber stellen wir willkürlich fest; bei ihnen wissen wir also genau, wie weit das Gültigkeit hat, was sie behaupten. Verhängnisvoll wurde diese Ansicht Hobbes für seine Grundlegung der Sitten- und Staatslehre. Denn beruht alles, was objektive Gültigkeit hat, nur auf der Willkür der Worte, so hört jeder wirkliche
Unterschied von «Gut» und «Bös» auf. Auch diese Begriffe werden zu willkürlichen Geschöpfen des Menschen. «Es gibt keine allgemeine Regel über Gut und Böse, die aus dem Wesen der Dinge selbst genommen wäre.» (Grimm, S. 135-136.) Und im Staate kann die Ordnung nicht dadurch aufrechterhalten werden, daß die Menschen durch Vernunft, durch freie Einsicht ihre Triebe beherrschen, sondern allein dadurch, daß ein despotischer Herrscher die Beobachtung der willkürlich aufgestellten Sitten-gesetze erzwingt.
Im Mittelpunkt des Grimmschen Werkes steht John Locke. Er ist ja «der erste Philosoph, der die Frage nach der Erkenntnis als eine durchaus selbständige und für sich bestehende Aufgabe in den Mittelpunkt der Forschung stellt». (Grimm, S. 173.) Auf dem Kontinente ist René Descartes (Cartesius 1596-1650) der Begründer einer neuen, aus den Banden des Aristoteles sich befreienden Philosophie. Dieser sieht den Grund, warurn wir zu einem unbedingten und unzweifelhaften Wissen kommen können, darinnen, daß uns gewisse Ideen angeboren sind. Wir brauchen dieselben bloß aus den verborgenen Tiefen unserer Seele heraufzu-heben und in das volle Licht des Bewußtseins zu stellen. Dieser Ansicht setzte nun Locke den Satz entgegen, daß wir gar keine angeborene, sondern nur erworbene Erkenntnisse haben. Wir bringen, nach Locke, keinerlei Erkenntnisse mit uns zur Welt, sondern allein die Fähigkeit, uns solche zu erwerben. Von dieser Einsicht ausgehend, sucht er die Quellen und die Gültigkeit unseres Wissens zu untersuchen. Er gelangt dabei zu einem Satze, der heutzutage geradezu einen Bestandteil des modernen Bewußtseins ausmacht, nämlich, daß nur Masse, Gestalt, Zahl und Bewegung Eigenschaften sind, die wirklich in den Körpern existieren, während Farbe, Ton, Wärme, Geschmack und so weiter nur Wirkungen der Körper auf unsere Sinne seien, nicht aber etwas in den Körpern selbst.
George Berkeley behauptet nun, daß auch die erstgenannten Eigenschaften kein von unserem Vorstellen unabhängiges Dasein haben, sondern daß sie nur existieren, insofern wir sie vorstellen. Es gibt überhaupt keine Dinge, die unseren Vorstellungen entsprechen.
Berkeley leugnet das Dasein einer Körperwelt und läßt nur Geister existieren, in denen das göttliche Wesen durch seine alles beherrschende Kraft die Vorstellungen hervorruft. «Was ich wahrnehme, das muß ich auch vorstellen; etwas, wovon ich gar keine Vorstellung habe, kann auch nicht Gegenstand meiner Wahrnehmung oder Erfahrung sein, das existiert für mich überhaupt nicht.» «Deshalb gibt es über die Grenze der Vorstellung hinaus keine Wahrnehmung, keine Existenz, keine Erfahrung.» (Grimm, S. 385.)
David Hume endlich nimmt den Standpunkt Lockes, daß wir alle unsere Erkenntnisse nur durch Beobachtung gewinnen können, wieder auf. Da wir aber durch Beobachtung immer nur Aufschluß über einzelne Fälle gewinnen können, so haben wir auch nur solches auf Einzelnes bezügliches Wissen und keine allgemein gültige Erkenntnis. Wenn ich sehe, daß ein Ding immer auf das andere folgt, so nenne ich das letztere Ursache, das erste Wirkung. Ich erwarte, daß in ähnlichen Fällen dieselbe Ursache dieselbe Wirkung hervorruft. Daß dies so sein muß, kann ich nie wissen. All unsere Überzeugung beruht auf der Gewohnheit, das immer vorauszusetzen, was wir öfter bewahrheitet gefunden haben. So gelangt Hume zu einem vollständigen Zweifel an aller eigentlichen Erkenntnis.
Dieser Zweifel hat Kant, nach dessen eigenem Bekenntnis, aus seinem wissenschaftlichen &hlummer gerissen und zu seinem großen, die wissenschaftliche Welt in allen Tiefen aufrührenden Werke, zur «Kritik der reinen Vernunft», angeregt. Dadurch hat Hume, und insofern dieser auf seinen genannten Vorgängern fußt, auch letztere auf die deutsche Wissenschaft einen maßgebenden Einfluß ausgeübt.
Die Gedankenentwickelung und die Bedeutung der von Grimm behandelten Forscher zu kennen, ist für das Verständnis der neueren Philosophie ein unbedingtes Erfordernis. Daher hat sich der Verfasser durch sein Buch ein bleibendes Verdienst erworben. Mit durchdringender Klarheit zeigt er uns die Fäden, welche die fünf Männer miteinander verbinden, mit bewundernswerter Schärfe weist er immer auf jene Seite hin, in der jeder von ihnen einen
und denselben Grundgedanken entwickelt hat. Eigentlich ist es ja eine Frage, die sie alle behandeln; nur führt sie die verschiedene Beleuchtung, in die sie dieselbe rücken, immer zu anderen Folgerungen. Alle sind beseelt von dem Streben nach befriedigender Erkenntnis, und ebenso sind sie von der Überzeugung durchdrungen, daß nur Beobachtung und Erfahrung uns wahrhaft Er-kenntnisse liefern. Nicht weniger ausgezeichnet als die Darlegung der Abhängigkeit der einzelnen Darlegungen voneinander ist Grimms Beleuchtung des Entwickelungsganges, den dieselben durchgemacht haben. Besonders charakteristisch ist derselbe für Berkeley und Hume. Grimm erweist sich in der Klarstellung dieser Verhältnisse auch als Meister psychologischer Analyse.
Wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir unser Urteil über Grimms Buch in den Worten gipfeln lassen: Für den Fachmann ist es ein Werk, an dem er nicht vorübergehen darf, wenn er der in Rede stehenden Epoche nähertreten will, für 4en Gebildeten eine interessante, ihn über unzählige Fragen orientierende Lektüre.
ALLAN KARDEC. DER HIMMEL UND DIE HÖLLE
oder die göttliche Gerechtigkeit nach den Aufschlüssen der Kunde vom Geist; sodann beleuchtet an zahlreichen Beispielen bezüglich der wirklichen Lage der Seele während und nach dem Tode. Ins Deutsche übertragen von Christ. Heinr. Wilh. Feller. Berlin 1890
Wir leben in einer Zeit, in der ein großer Teil des wissenschaftlichen Treibens vollständig zur Verstandessache geworden ist, und in der auch die bedeutendsten Vertreter der Gelehrsamkeit nichts mehr zu bieten wissen, was den Bedürfnissen des Herzens und Gemütes irgendwie Genüge leisten könnte. Da ist es denn auch kein Wunder, wenn religiös angelegte Naturen das auf einem von der Wissenschaft abgelegenen Wege zu erreichen suchen, was
ihnen diese versagt. Man könnte nun glauben, daß die Religion selbst einen solchen Weg eröffne. Das wäre auch der Fall, wenn nicht eine auf Erfahrung und Augenscheinlichkeit gegründete Denkweise den Geist vieler unserer Zeitgenossen in eine Richtung gebracht hätte, die sich rült der unbefangenen Anschauungsart religiöser Menschen nicht verträgt. Man hat ein Bedürfnis nach religiösen Wahrheiten, aber man will sie nicht glauben, sondern erfahrungsgemäß beweisen. Man will mit den Mitteln der Anschauung und des Versuches das erkennen, was die Religionen durch den Glauben zu vermitteln suchen. Auf diese Weise entsteht ein ganz unklares und ungesundes Gemisch von Religion und scheinbarem Erfahrungswissen, das nach keiner Seite hin eine Existenzberechtigung hat. Das Werk, dem diese Zeilen gewidmet sind, trägt alle schlechten Eigenschaften an sich, die aus der gekennzeichneten Verschmelzung zweier nicht zusammengehöriger Halbheiten entspringen. Es entwickelt zuerst, und zwar vom Standpunkte einer ganz egoistischen sittlichen Weltansicht aus, die Lehren von Himmel, Hölle, Engel, Teufel und von dem Fortleben nach dem Tode. Dann werden ganz unkritisch scheinbare Tatsachen als Beweise für diese Lehren angeführt. Eine Reihe von Verstorbenen soll den Mitgliedern einer «Geisterforschungsgesell-schaft», der auch der Verfasser angehörte, erschienen sein und Mitteilungen über das Jenseits gemacht haben. Bei der Erzählung dieser «Tatsachen» wird auch nicht mit einem Worte erwähnt, ob denn bei den Versammlungen irgendwelche Vorkehrungen getroffen worden sind, um absichtliche oder unabsichtliche Täuschungen auszuschließen. Daß sie Maßregeln dieser Art treffen, suchen doch heute selbst die Anhänger des plumpsten Spiritismus der Welt beizubringen. Wir sind nicht so kurzsichtig, daran zu zweifeln, daß es Erscheinungen geben könne, für deren Erklärung unsere augenblicklichen wissenschaftlichen Anschauungen sich zu eng zeigen; aber solche Tatsachen müssen ebenso methodisch und objektiv-wissenschaftlich untersucht werden wie die Phänomene der Optik und Elektrizität. So wenig es uns zu einem Ziele führte, wenn wir die Lichtbrechung oder die elektrischen Erscheinungen mit Zuhilfenahme von «Geistern> erklärten ebensowenig kann es
einen Wert haben, mit solchen Mitteln jenem kleinen Reste von Tatsachen beikommen zu wollen, der übrigbliebe, wenn man aus den Behauptungen und Erzählungen der «Spiritisten» und «Spiritualisten> alles entfernte, was auf Täuschung und Schwindel beruht.
AUCH EIN KAPITEL ZUR «KRITIK DER MODERNE»
Bei einem großen Teile unserer Zeitgenossen herrscht heute die Überzeugung, daß der Stil der geistigen Lebensführung, wie er seinen letzten gewaltigen Ausdruck in dem Wirken der deutschen Klassiker gefunden hat, und wie er in Gesinnung und Schaffen der Epigonen ein allerdings mattes Dasein noch führt, vom Schau-platze zu verschwinden hat und einer vollständig neuen Lebensgestaltung weichen soll. Nicht etwa als ein Irrweg, den man verlassen muß, wird die «alte Kultur» von den jüngeren, schöpferischen Geistern bezeichnet, sondern als ein Bildungs-Ideal, das alles gezeitigt hat, was es aus sich heraus entsprießen lassen konnte, und aus dem neue Blüten nicht mehr zu gewinnen sind. Wir müssen uns das ganze geistige Leben neu einrichten, an die Stelle des klassischen müssen wir den modernen Geist setzen, so lautet das Feldgeschrei der jungen Generation. Es ist ein großer Fehler, von seiten der Anhänger der «alten Richtung» dieses Feldgeschrei einfach zu überhören oder es ungeprüft als unreif hinzustellen. Ein solches Vorgehen ist schon deshalb gerichtet, weil auf geistigem Gebiete kein Ding der Welt mit dem für etwas ganz Fremdes zugerichteten Maßstabe gemessen werden kann, sondern nur mit dem aus der Sache selbst gewonnenen. Es ist geradezu komisch, wenn Leute, die in jedem Satze, den sie niederschreiben, zeigen, daß ihre ästhetische Urteilskraft gerade hinreicht, um philologische Silbenstecherei zu treiben, über eine Richtung geringschätzend sich äußern, deren Vertreter an Geist weit höher stehen als jene angeblichen Kunstrichter aus der klassischen Schule. Wer nicht den Willen hat, mit der Gegenwart sich auseinanderzusetzen,
der sollte auch seine Betrachtungen über geistiges Schaffen der Vergangenheit sich ersparen. Goethe, Schiller oder Lessing kann heute nur der beurteilen, der sich auf einen freien Standpunkt gegenüber der geistigen Gegenwart erhoben hat. Auf den Standpunkt der wollen wir also durchaus verzichten, wenn wir darangehen, die kritische Sonde an die GrundTendenzen der anzulegen. Auch bemerken wir zum voraus, daß wir uns darauf beschränken werden, die Strömungen nur innerhalb des deutschen Geisteslebens in skizzenhafter Weise zu charakterisieren.
Der Geist, der innerhalb dieses Gebietes eine Neugestaltung aller Lebensführung im weitesten Sinne anstrebt, ist Friedrich Nietzsche. Auch die beiden letzten Publikationen Hermann Bahrs (Die Überwindung des Naturalismus. Dresden 1891, E. Piersons Verlag, 323 5.) und Conrad Albertis (Natur und Kunst. Beiträge zur Untersuchung ihres gegenseitigen Verhältnisses. Leipzig 1891, Wilhelm Friedrich), die zu diesen Zeilen den unmittelbaren Anlaß geben, beweisen dies, indem sie ausdrücklich in der Weltanschauung Friedrich Nietzsches eine von den Haupttriebkräften der Kultur der Zukunft sehen. Nietzsches Hauptverdienst liegt zunächst darinnen, in scharfer Weise die Ansicht vertreten zu haben, daß alle Maßstäbe, an denen wir das messen, was Menschen tun und hervorbringen, ein geschichtlich Gewordenes, kein für die Ewigkeit absolut Feststehendes sind. Die Werte, die wir heute den Handlungen der Menschen beilegen, sind nicht absolut, sendern nur relativ richtig, und sie können, wenn die Zeit gekommen ist, durch vollständig neue ersetzt werden. Und diese Zeit hält Nietzsche für gekommen, denn er wollte seinen fortwährend an der Grenzscheide zwischen «Wahnsinn und Genialität» schwebenden Büchern zunächst das über die «Umwertung aller Werte» nachfolgen lassen. Die Umnachtung des Geistes hat diesen Mann verhindert, ein Werk zu schaffen, das jedenfalls zu den merkwürdigsten aller Zeiten gehört hätte. Wir sind es müde geworden, weiter so zu urteilen, wie wir es bisher getan, wir müssen neue sittliche Ansichten gewinnen, das ist Nietzsches Überzeugung. Dieses Müdesein des Alten, dieser Glaube, daß für den geistig strebenden
Menschen die Grundsätze und Grundgefühle der alten Zeit nicht mehr ausreichen, dieses zunächst ganz unbestimmte Herausbegeh-ren aus den geschichtlichen Bahnen und das Sehnen nach neuen Schaffensformen, dies ist der Grundzug der jüngsten literarischen Bestrebungen in Deutschland. Wer sich nun mit den freilich durchaus unklaren Zielen dieser Bestrebungen bekanntmachen will, dem können die schon erwähnten Werke Bahrs und Albertis als gute Führer empfohlen werden. Hermann Bahr ist ohne Zweifel der bedeutendste Theoretiker dieser jungen Richtung. Genial veranlagt, etwas leichtsinnig in seinen Urteilen, zu flott, um immer ernst, zu tiefblickend, um stets leicht genommen zu werden, von einer fabelhaften Leichtigkeit im Produzieren, von zynischer Unverfrorenheit in oberflächlicher Abschätzung mancher für ihn doch zu tief sitzender geistiger Elemente ist Hermann Bahr für uns überhaupt der bedeutendste Kopf, insofern wir uns auf das Gebiet der Literatur und Ästhetik des jüngsten Deutschlands beziehen.
So wenig irgend etwas in der Natur, so wenig sind die Prozesse im geistigen Leben der Menschen etwas Stillstehendes. Eine jede Kulturströmung ist von dem Punkte an, wo sie einsetzt, in fortwährender Entwickelung begriffen. Die Träger derselben suchen sie immerfort zu vertiefen, suchen immer neue Seiten derselben an die Oberfläche zu bringen. Das Kennzeichen für die innere Gediegenheit und den Wert derselben wird der Umstand sein, daß die Wahrheit und Größe immer mehr zum Ausdruck kommt, je weiter die Entwickelung fortschreitet. In sich widersprechende und wertlose Richtungen aber sind dadurch charakterisiert, daß sie sich von innen heraus, durch Weiterentfaltung ihres eigenen Prinzipes selbst ad absurdum führen. Ja, man kann eine Richtung nur dann wahrhaft widerlegen, wenn man zeigt, daß sie bei strenger Verfolgung ihrer Ausgangspunkte in dieser Weise sich selbst aufzehrt. Hermann Bahr hat nun die möglichen Entwickelungsstadien der «Moderne» mit einer geradezu nervösen Hast durchlaufen und in seinem letzten Buche dasjenige erreicht, von dern ausgehend ihm demnächst ganz gewiß selbst die Absurdität der ganzen Richtung einleuchten muß.
Den Anfang machte das jüngste Deutschland damit, daß es den
schablonenhaften Kunstformen eines mißverstandenen Klassizismus gegenüber die Forderung stellte: man müsse sich mit wirklichem Leben wieder durchdringen, man müsse darstellen, was man selbst beobachtet, nicht was man von den Vorfahren erlernt habe. Wir wollen das Leben zeichnen, wie wir es sehen, wenn wir die Augen öffnen, nicht wie es uns erscheint, wenn wir es durch die Brille betrachten, die wir uns durch Vertiefung in die Vorzeit zubereiten. Und wir wollen vor allen anderen Dingen kein Gebiet der Wirklichkeit von der künstlerischen Verarbeitung ausschließen. Das führte zunächst zur Aufnahme neuer Stoffe in die Kunst. Die tieferen, arbeitenden Schichten des Volkes hatten ja bis in die jüngste Zeit herein nur eine untergeordnete Rolle in der Kunst gespielt. Daher holten nun die Dichtung und auch die Malerei ihre Stoffe. Die Leiden und Freuden auch des einfachsten Mannes können ja künstlerisch dargestellt werden, die ganze ästhetische Rangleiter vom Burlesken bis zum Hoch-tragischen findet sich ja bei der Arbeiterfamilie nicht weniger als im Fürstenschlosse. Diese rein stoffliche Erweiterung der Kunst konnte sich natürlich vollziehen, ohne die Formen der alten Asthetik zu sprengen. Das Stoffliche macht ja das Künstlerische nicht aus, und die Kunstformen können ja dieselben bleiben, ob sie nun mit diesem oder mit jenem Stoffe erfüllt werden. Aber der Umstand, daß die Vertreter der jüngeren Richtung nicht genug Tiefe der Bildung besaßen, führte sogleich am Beginne zu einem verhängnisvollen Irrtum. Der Mann der unteren Klasse stellt nämlich in weit geringerern Maße als der «Gebildete» eine sogenannte Individualität dar. Er ist weit mehr das bloße Ergebnis von Erziehung, Beruf und Lebensverhältnissen als der gesellschaftlich höher Stehende. Das ist ja gerade das Streben der Arbeiterbildungsvereine, aus bloßen Schahlonenmenschen durch Bildung Individualitäten zu schaffen. Nimmt man also ein Mitglied des vierten Standes einfach, wie es heute ist, so wird man gewahr werden, daß das Zentrum der Persönlichkeit, der Born des Individuellen fehlt, daß das Charar:terisieren von innen heraus unmöglich, dagegen die Ableitung aus dem Milieu zur Notwendigkeit wird. Das jüngste Deutschland sah dies nun nicht bloß als
eine besondere Folge des Stoffgebietes an, das es sich gewählt hatte, sondern es bezeichnete es geradezu als Forderung der , den Menschen nicht mehr aus dem Mittelpunkt seines Wesens heraus zu charakterisieren, sondern aus Zeit- und Ortsverhältnissen, kurz aus dem Milieu. Dies war das erste Stadium der «Moderhe». Es ist damit aber auch der Standpunkt angegeben, den das Buch von Conrad Alberti einnimmt. Der Verfasser begeht dabei freilich noch einen zweiten Fehler. Er bringt die Kunst in eine ganz ungerechtfertigte Abhängigkeit von der wissenschaftlichen Überzeugung, die in irgendeiner Zeit herrschend ist. Er glaubt, die Kunst, die vom Individuellen, vom Innern ausgegangen ist, hätte in dem Momente ihrer Auflösung entgegengehen müssen, da die Psychologie «die alte Legende von dem freien Willen des Menschen zerstört» habe. Diese Leistung schreibt er der von Wundt begründeten psychologischen Weltanschauung zu. Wenn irgend etwas aber unbestreitbar ist, so ist es der Satz, daß eine solche Einmischung der Theorie, des Verstandes der Tod aller wahren Kunst ist. Was für eine Verkehrtheit liegt doch in dem Bestreben, die Kunst zu einem Ausdrucksmittel wissenschaftlicher Sätze zu machen! Das wissenschaftliche Treiben muß sich unter allen menschlichen Verrichtungen am allermeisten von der Wirklichkeit entfernen, um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Die Wissenschaft gelangt oft auf langen Umwegen mittel-bar zu ihren Ergebnissen. Indem die Wissenschaft die Gesetze des Wirklichen erforscht, streift sie gerade dasjenige ab, was die Kunst in unmittelbarer Auffassung ergreifen muß: das Leben in seiner vollen Frische. Es ist das tragische Verhängnis der «Moderne», daß sie in ihrem Wirklichkeits-Enthusiasmus so weit ging, das Allerunwirklichste für das Allerwirklichste zu halten. Das Buch von Conrad Alberti steht also auf der ersten Stufe des modernen Wirklichkeitsdusels, der Wirklichkeit fordert, aber keine Ahnung davon hat, wo eigentlich Wirklichkeit sitzt. Gegenüber Hermann Bahrs «Die Überwindung des Naturalismus> muß die Ansicht Albertis als antiquiert gelten. Hermann Bahr verwarf diese erste Entwickelungsstufe gerade aus dem Grunde, weil er fand, daß sie durchaus die Wirklichkeit nicht wiedergebe. Ersuchte
nun zunächst die Erlösung darinnen, daß er die Faktoren, aus denen er den Menschen-Charakter konstruieren wollte, von der äußeren Natur in die innere, in den Organismus, in die Nerven verlegte. Der Mensch ist nicht das bloße Ergebnis der äußeren Verhältnisse, sondern er ist so, wie es die Konstitution seines Nervensystems bedingt. Wollt ihr einen Menschen etkennen und charakterisieren, dann schlagt ihm den Schädel ein, zerfasert sein Gehirn, zieht ihm die Haut ah und legt seine Nervenstränge bloß, so sagte der gehäutete Bahr zunächst. Daß sich mit dieser Ansicht doch auch seht wenig anfangen lasse, sah denn Hermann Bahr bald ein, und er schritt weiter auf der Wanderung, die ihm endlich die volle Wirklichkeit vermitteln sollte. Und heute sagt er: alle alte Kunst zeigte die Wirklichkeit, wie sie durch den menschlichen Geist hindurchgegangen, wie sie von der Phantasie erfaßt und gestaltet ist, also sie brachte ein Ableitungsprodukt der Wirklichkeit, nicht diese selbst. Wir müssen das anders machen. Wir müssen Werke schaffen, die ganz so auf uns wirken, wie die Wirklichkeit selbst. Der Maler darf nicht eine Fläche so malen, daß sie in der Einbildungskraft des Betrachters denselben Effekt hervorruft wie die wirkliche Fläche, sondern sie muß mein Nervensystem genau in derselben Weise beeinflussen wie die Wirklichkeit selbst. Das heißt aber aus dem Bahrisch-Paradoxen in gesundes Deutsch übertragen: die Kunstprodukte sollen nicht Kunst-produkte, sondern Naturerzeugnisse sein. Was nun der Künstler überhaupt noch in der Welt soll, das mag Hermann Bahr wissen, wir nicht. Da sollte man doch lieber das rein Natürliche von der Natur selbst schaffen lassen. Denn wenn es darauf ankommt, die Wirklichkeit selbst zu gestalten, dann, fürchte ich, wird der genialste Künstler der Natur gegenüber immer nur ein Stümper sein. So stellt denn der Standpunkt, den Hermann Bahrs neuestes Buch erreicht, denjenigen dar, in dem die «neue Kunst» an ihren eigenen Prinzipien, an ihrer Grundforderung nach reiner Wirklichkeit sich selbst ad absurdum führt. Hätte Hermann Bahr mit seinem interessanten, geistreichen Werke die Selbstironie der «Moderne» schreiben wollen, er könnte diesen Versuch gar nicht besser angefangen und durchgeführt haben.
Der Verfasser dieses Artikels hofft, die in demselben aufgenommenen Gedankengänge demnächst in einer kleinen Schrift gehörig erweitern und tiefer begründen zu können. Dieselbe soll die Hauptströmungen des geistigen Lebens der Gegenwart und deren Bezug zur Vergangenheit und einer möglichen Zukunft darstellen.
ADOLF STEUDEL. DAS GOLDENE ABC DER PHILOSOPHIE
Einleitung zu dem Werke «Philosophie im Umriß». Neu herausgegeben und mit Bemerkungen versehen von Max Schneidewin.
Friedrich Stahn. Berlin 1891
Dieses Buch gehört in die Gruppe der vielen unnötigen, die die Literatur der Gegenwart hervorbringt. Steudel befand sich als Philosoph auf jenem flachen Standpunkt, der glaubt, das überallher zusammengelesene Wissensmaterial durch bloße Verstandeserwägungen, die über die einzelnen Erfahrungstatsachen angestellt werden, zu philosophischen Resultaten vertiefen zu können. Daß die Philosophie ein Objekt braucht, das nicht in der Sphäre des «sinnenfällig und verstandesmäßig» Gegebenen liegt, davon hatte Steudel keine Ahnung. Daher fehlt ihm auch ganz das Organ, um die großen Fortschritte der Philosophie durch Fichte, Schelling und Hegel würdigen zu können, und er möchte alle tiefere Intuition von dem aus Nicolaischer Gesinnung hervorgehenden Verstandesraisonnement, das jene Leuchten der Wissenschaft trotz ihrer großen Fehler in so gewaltigen Geistes-schlachten zu Boden streckten, wieder abgelöst sehen. Er will gegenüber dem absoluten Vernunfturteil das absolute Verstandes-urteil geltend machen. Der Unterschied ist nur der, daß das Absolute der Vernunft tief, das des Verstandes aber oberflächlich ist. Bei alledem muß man das redliche Streben Steudels anerkennen, und für den philosophischen Fachmann ist es von Interesse, Steudels «Philosophie im Umriß» als das konsequenteste Werlt des seichten Menschenverstandes, den ja noch immer viele - oder
vielmehr heute erst recht viele - für den einzig gesunden halten, durchzulesen. Wem aber mit einem besonderen Abdruck der Einleitung, die gar keinen selbständigen Wert hat, sondern einen solchen nur im Zusammenhang mit dem ganzen Werke erhält, gedient werden soll, das vermögen wir nicht zu erkennen.
#TI
J. R. MINDE. ÜBER HYPNOTISMUS
Vortrag. München 1891
Kurze Zusammenstellungen der Haupttatsachen des Hypnotismus und der Suggestion, wenn sie mit vollkommener Beherrschung des Gebietes gemacht werden, sind in der Gegenwart sehr zweckmäßig. Sie kommen einem brennenden Interesse der Zeit entgegen. Daß alle wissenschaftlichen Anforderungen bei der in Rede stehenden Schrift erfüllt sind, dafür bürgt der Name ihres Verfassers. Daß sie sich fast nur an Ärzte und weniger an das gebildete Laienpublikum wendet, wollen wir ihr nicht zum Vorwurf machen. Das letztere hat an der ausgezeichneten Schrift von Forel ein alle Ansprüche wegen rascher und allseitiger Orientierung erfüllendes Mittel. Wer aber naturwissenschaftliche Bildung genug besitzt, um sie zu verstehen, für den bietet auch die Mindesche Broschüre vortreffliche Gelegenheit, von dem Umfange der beim Hypnotismus in Betracht kommenden Erscheinungen sich Kenntnis zu verschaffen. Daß vor den Gefahren gewarnt wird, die daraus erwachsen können, wenn nach der Ansicht einiger unberufener Heißsporne der Hypnotismus und die Suggestion als Erziehungsmittel oder behufs Festhaltung von Gemüts-stimmungen für künstlerische Zwecke verwendet würde, finden wir ganz berechtigt. Der Hinweis darauf, daß mit der physiologischen Lösung des Rätsels, das den Schlaf einhüllt, auch jene des Problems der Hypnose nähergerückt erscheinen wird, scheint uns am Platze. Dankbar wird jeder Leser auch für die Zusammenstellung
der Daten am Schlusse sein, die eine klare Übersicht darüber verschaffen, wann und durch wen - den von uns unter dem Namen der hypnotischen bezeichneten - verwandte Erscheinungen bereits früher beobachtet und zu erklären versucht worden sind.
WILHELM SCHÖLERMANN. FREILICHT! Eine Plein-air-Studie.
Düsseldorf 1891
Das Schriftchen behandelt eine in das Kunstleben der Gegenwart tief eingreifende Frage: inwiefern ist der Realismus in der Malerei, und zwar in jener Form, wie er sich am deutlichsten bei Liebermann und Uhde darstellt, künstlerisch gerechtfertigt? Es ließe sich erst darüber streiten, ob denn die ganze Fragestellung überhaupt gerechtfertigt ist. Der Künstler schafft, wie er kann, und fragt nicht nach ästhetischen Prinzipien. Wenn irgend jemand besondere Arilage hat zur treuen phantasielosen Wiedergabe der Natur und ein besonderes Auge für gewisse häßliche Seiten derselben, so werden seine Werke ein dementsprechendes Gepräge tragen. Ob die Ästhetik dann solchen Werken einen höheren oder niederen Rang anweist, ist freilich eine andere Sache. Momentane, von der Mode abhängige Urteile mögen die Schöpfungen der Kunst vielleicht für eine kurze Zeit völlig anders abschätzen als die Ästhetik. Die letztere darf sich dadurch nicht beirren lassen. Nur wer sein Urteil frei erhält von den Launen des Zeitgeschmackes und feste Prinzipien hat, kann als wissenschaftlich gebildeter Ästhetiker in Betracht kommen. Mit den Prinzipien einer solchen Ästhetik werden die Künstler aber immer im Einklang stehen, selbst wenn sie sich dessen nicht voll bewußt sind. Nur wird eine wissenschaftliche Ästhetik nie auf das Was, auf den Stoff der Kunstwerke losgehen, sondern stets auf das Wie, auf das von dem Künstler aus dem Stoffe Geformte. Darauf zielt es, wenn Heine sagt: «Der große Irrtum besteht immer darin, daß
der Kritiker die Frage aufwirft: was soll der Künstler? Viel richtiger wäre die Frage: was will der Künstler? » Schöiermann zitiert auf Seite 41 diese Stelle, aber ich finde, daß er sie im Verlaufe seiner Ausführungen viel zu wenig beherzigt. Sonst müßte sich seine Untersuchung auf die Frage zuspitzen: was wollen die modernen Künstler, und was können sie in der Art, wie sie schaffen, erreichen? Sie wollen ein treues Abbild der Natur wiedergeben. Aber die Mittel, mit denen der Maler arbeitet, sind viel geringer an Zahl als die, mit denen die Natur selbst schafft. Der Maler vermag in sein Bild nichts hineinzuarbeiten als die Projektion der Form auf eine zweidimensionale Raumgröße, das Hell-Dunkel und die Farbe. Was steht der Natur außer diesen Mitteln noch alles zur Verfügung, um eine Landschaft, eine Person hervorzubringen? Und doch muß der Maler mit seinen wenigen Mitteln eine ähnliche Totalwirkung hervorbringen wie die Natur mit ihrem Übermaße. Daraus folgt, daß er die Farbe, die Kontur und so weiter im einzelnen wird anders gestalten müssen als die Natur, wenn er in dem Gesamteindruck die letztere erreichen will. Wiedergabe der Natur im ganzen bedingt mannigfache Abweichung im einzelnen. Diese Gmndmaxime aller ästhetischen Betrachtungen scheint der Verfasser nicht zu kennen; deshalb erscheint uns sein Versuch der Wissenschaft gegenüber prinzipien-los, als launenhafte Sammlung von Aphorismen, denen die rechte Grundlage fehlt; der Malerei gegenüber lieblos, nach vorgefaßten Meinungen aburteilend, nicht berücksichtigend, daß nur die selbstlose Vertiefung in die Schöpfungen eines Künstlers wie Uhde zu einem Urteile berechtigt.
FRANZ BRENTANO. DAS GENIE
Vortrag, gehalten im Saale des Ingenieur- und Architektenvereins
in Wien. Leipzig 1892
Über das Genie ist in letzter Zeit vieles geschrieben worden. In weiteren Kreisen hat namentlich Lombrosos Buch: «Genie und Irrsinn> großes Aufsehen gemacht. Mit umfassender Sachkenntnis sucht der italienische Gelehrte alle die Fälle auf, in denen geniale Äußerungen des menschlichen Geistes an das unheimliche Gebiet der Geistesstörungen grenzen. Eine Reihe der größten Geister zeigten entweder in der Blüte ihres Strebens Irrsinnserscheinun-gen oder verfielen dem Wahnsinne am Abende ihres Lebens. Das würde zu der Annahme führen, daß Genialität nicht eine Entwickelungsstufe des gesunden menschlichen Geistes ist, sondern eine abnorme Erscheinung desselben. Diese Meinung scheint immer mehr Anhänger für sich zu gewinnen. Abweichend davon ist Eduard von Hartmanns Ansicht. Nach derselben liegt das Genie, im Gegensatz zur vollbewußten, verstandesmäßigen Geistestätigkeit, in einem Entfalten von Elementen, die im unbewußten Mutterschoße der Seele ruhen. Nur derjenige, bei dem diese Elemente aus diesen geheimnisvollen Tiefen herauf sich in die Sphäre des Geistes arbeiten, bringt Geniales hervor. Charakterisiert Hartmann auf diese Weise das Genie als etwas durchaus Normales, so sieht er es doch aber als ein von der Begabung des normalen Menschen qualitativ Verschiedenes an. Beiden hiermit angedeuteten Anschauungen steht diejenige Brentanos ablehnend gegenüber. Sie sieht in dem genialen Schaffen nur eine quantitative Steigerung derjenigen Tätigkeit des Geistes, die jeder Durchschnittsmensch fortwährend vollbringt. Die geistigen Funktionen des gewöhnlichen Menschen: Perzeption, Apperzeption, Reproduktion und Kombination vollziehen sich beim Genie nur leichter, rascher und in einer Weise, die dem Inhalt der Sachen mehr entspricht, als das bei der Mehrzahl der Individuen der Fall ist. Das Genie ist für geheime Beziehungen der Dinge zueinander empfänglicher als der Durchschnittsmensch. Was dieser erst auf dem
mühevollen Wege eifrigen Forschens entdeckt, durchdringt jenes auf den ersten Blick. Brentano sucht nachzuweisen, daß nur aus dieser Steigerung der geistigen Vermögen die Schöpfungen Newtons, Kants, Goethes und Mozarts entsprungen sind. Diese Ausführungen sind geeignet, das Bewußtsein des Durchschnittsmenschen zu heben. Sie wollen die Kluft aus der Welt schaffen, die man zwischen Geistern ersten und zweiten Ranges annimmt. Uns scheint aber die Fragestellung keine ganz richtige zu sein. Genialität erscheint uns als das inhaitschaffende Vermögen des Geistes und den Gegensatz zu bilden zu der bloß formalen Verstandestätigkeit. Beide Vermögen sind in jedem Menschengeiste vorhanden; bei dem einen überwiegt das erste, bei dem andern das zweite. Genie nennen wir einen Menschen, bei dem das inhaitschaffende Vermögen in hervorragendem Maße ausgebildet ist. Nicht als Steigerung der formalen Anlagen erscheint uns die Genialität sondern als eine hervorstehende Ausbildung einer besonderen Seite des Geistes, die bei der Mehrzahl der Menschen nur wenig entwickelt ist.
KARL BLEIBTREU. LETZTE WAHRHEITEN
Leipzig 1892
Wenn jemand, wie es nach dem Titel gerechtfertigt erschiene, in diesem Buche die Resultate philosophischer Erwägungen suchte, so wird er sich arg getäuscht sehen. Ansichten wird man finden. wie sie Laune und Willkür eines geistreichen, aber den Ernst ruhigen Denkens scheuenden Mannes aufstellen, aber man wird sich auch beleidigt fühlen über die Zumutung, das allersubjektivste Gerede in Dingen hinnehmen zu sollen, worüber nur die Vernunft sprechen sollte, die sich bis zu einem möglichst hohen Grade der Objektivität durchgearbeitet hat. Bleibtreu spricht über das Wesen des Menschen, über Geschlechtsverhältnis und Liebe, über Ehe und Familienleben, über das Genie, über Intellekt und Wille, über Strafgesetz und Sozialismus alles aus, was ihm gefällt,
ohne sich weiter darüber Skrupeln zu machen, daß persön-liche Vorliebe für eine Ansicht doch noch kein Kriterium ihrer Wahrheit ist. Herrn Bleibtreu vorzuwerfen, daß durch solche Schriften, wie die seinige es ist, das Gefühl für die Gewissenhaftigkeit in den großen Lebens- und Weltfragen abgestumpft wird, dazu bin ich nicht Philister genug, habe mich auch vielleicht beim Lesen derselben zu gut amüsiert. Auch mir hat manche geistreichelnde, halb-, viertel- und achtelwahre Behauptung ganz gut gefallen. Aber das Buch ist doch schlecht, und zwar deshalb, weil Herr Bleibtreu keine Ahnung davon hat, daß ein jeglich Ding viele Seiten hat. Von jedem Satze, den er aufstellt, ist auch das Gegenteil wahr. Ein deutscher Schriftsteller, der das nicht weiß, erscheint wie ein Überbleibsel aus dem vorigen Jahrhundert. Seit die Deutschen eine Philosophie und Goethes Werke haben, wissen sie, daß ein Augpunkt nicht genügt, um ein Ding zu betrachten, sondern daß man um dasselbe herumgehen und es von allen Seiten ansehen muß. Es ist ja prächtig, was Herr Bleib-treu vom Genie sagt, daß es sein eigener Maßstab ist, daß es ohne ein fast bis zum Größenwahn gehendes Selbstbewußtsein nicht bestehen kann; aber damit ist das Wesen des Genies nur von einer Seite beleuchtet, und das gibt immer ein Zerrbild, eine Karikatur. Bleibtreu ist ein Karikaturenzeichner der «letzten Wahrheiten». Er tritt für Monogamie mit Auflöslichkeit der Ehe ein. Die Kinder sollen der Mutter gehören. Vaterliebe hält er für Heuchelei. Wer A sagt, der muß auch B sagen. Das heißt in diesem Falle: wer Dinge wie Bleibtreu fordert, muß uns auch die sozialen Verhältnisse schildern, unter denen dieselben möglich sind. Die Verwandtschaft von Genie und Irrsinn behauptet Bleib-treu im Anschlusse an Lombroso. Er will die Sache sogar genauer formulieren: Unter ungünstigen Umständen tritt überall da Irrsinn ein, wo unter günstigen Umständen Genialität. Hat denn Herr Bleibtreu nie gehört, daß sich die Genialität auch unter den ungünstigsten Umständen entwickelt hat? Oder sagt er einfach:
ja, dann waren diese Umstände nur scheinbar ungünstig; in Wahrheit aber gerade dem Genie günstig, das durch diese oder jene Schwierigkeit erst recht gestählt wurde? Auf diese Weise könnte
man natürlich jeden beliebigen Satz begründen. Bleibtreus Gründe unterscheiden sich an Wert übrigens nicht sehr von diesen. Alles in allem: Bleibtreus Buch hätte nur dann einen Sinn, wenn der Verfasser ein Gott und seine Behauptungen göttliche Gebote wären, eine Art von Offenbarungen, welche die übrige Menschheit einfach kritiklos hinnehmen müßte. Wir halten den Herrn Bleibtren für keinen Gott, sein Buch aber für amüsantes, dilettantenhaftes Geschreibsel.
GEGEN DEN MATERIALISMUS
Gemeinverständliche Flugschriften, herausgegeben von Dr. Hans Schmidkunz. Stuttgart 1892. - 1. Moriz Carriére, Materialismus und Ästhetik. Eine Streitschrift. - II. Gustav Buhr, Gedanken eines Arbeiters über Gott und Welt. Mit einer Einleitung von Theobald Ziegler. - III. Ola Hansson, Der Materialismus in der Literatur
Eine aufrichtige Befriedigung muß diese Sammlung von Flugschriften gegen den Materialismus jedem Gebildeten bereiten, der noch nicht von dem verführerischen Sirenengesange des Materialismus auf bedenkliche Abwege des Denkens gebracht ist. Hans Schmidkunz erwirbt sich ein großes Verdienst dadurch, daß er die Stimmen der Idealisten aufruft gegen die verheerenden Wirkungen einer Weltanschauung, die geeignet ist, einen weiten Anhängerkreis zu gewinnen, weil sie eine Grundeigenschaft hat, durch die man die Menge immer anzieht: die Banalität. Hans Schmid-kunz hat auch durch seine eigenen Schriften bewiesen, daß sein Hauptstreben dahin geht, dem Materialismus einen Damm entgegenzusetzen. Er hat die schwierigen Gebiete des Hypnotismus und der Suggestion für die Psychologie zu durchforschen gesucht, weil er hier Aufgaben zu finden glaubte, denen der Materialismus mit seinen Trivialitäten nicht beikommen kann. In diesem Sinne begrüßen wir das Unternehmen als ein im eminenten Sinne zeitgemäßes. Wenn wir nun auf die drei ersten Schriften der Serie
eingehen, so müssen wir als die weitaus beste, ja als eine ganz einzige Leistung in ihrer Art die von Carriére rühmen. In seiner vornehmen, von tiefer philosophischer Einsicht ebenso wie von feiner Kunstkennerschaft geleiteten Art weist der hervorragende Ästhetiker nach, wie der Materialismus nie imstande sein wird, das Wesen des Schönen zu begreifen und eine Ästhetik zu begründen. Der Naturalismus und Materialismus sind nach seinen Ausführungen weder imstande, das Schöne hervorzubringen noch es zu begreifen. Wer nicht an eine ideale Welt glaubt, hat keine Veranlassung und damit auch keine Berechtigung, der Welt der Natur eine solche der Kunst gegenüberzustellen. Die gemeine Wirklichkeit durch eine Art photographisches Verfahren in der Kunst einfach wiederzugeben, ist keine durch die Natur des Menschen gegebene Aufgabe. Nur wer Sinn und Verständnis für eine ideale Welt hat, der weiß, warum die Wirklichkeit mit Notwendigkeit aus sich selbst heraus ein höheres Reich, das des Idealismus, gebiert. Mit schlagenden Worten zeigt Carriére, wie die gemeine Sinnenwelt in jedem ihrer Punkte uns über sich selbst hinausweist. Wir verstehen sie nicht, wenn wir bei ihr stehenbleiben.
In zweiter Linie steht die Schrift von Ola Hansson. Es wird in der Gegenwart viel gesprochen von diesem Manne, namentlich die jüngere Generation tut es. Es ist auch immer viel Anregendes in seinen Aufsätzen und Schriften. Aber sein ganzes geistiges Wesen erscheint uns wie ein Organismus ohne Rückgrat. Es vibrieren alle Nerven an seinem Leibe in der regsten Weise bei dem leisesten Eindrucke der Außenwelt. Dann fühlt sich auch sein Geist zu den mannigfaltigsten, immer geistreichen Bemerkungen veranlaßt. Er sagt dann auch manches Triviale, aber nie in trivialer Weise. Nur fehlt all seinem Schaffen das Zentruin. Seine einzelnen Aussprüche und Ansichten stimmen nicht zusammen. Es fehlt an einem gemeinsamen Zug, der sein ganzes Wesen durchzöge. Dieser Mangel seiner ganzen Persönlichkeit tritt uns auch hier entgegen. Er sagt vieles Interessante, aber es greift keine Totalanschauung durch. Seine Ausführungen gipfeln auch nicht recht in greifbaren Schlußergebnissen. Was er über die Mechanisierung unserer ganzen Literatur sagt, über die Verdrängung des
Künstlers durch den Schriftsteller, den Journalisten, ist treffend, aber es entbehrt jeder Tiefe. Die Schrift ist eine Sammlung geist-reicher Aperçus, aber durchaus nicht geistvoller. Wer nach Carriére, dem Idealisten, der auf der gründlichen, tiefen deutschen Philosophie fußt, den modernen, prinzipienlosen Vielredner hören will, und zwar in einer typischen Form, der lese diese Broschüre von Ola Hansson. Wir schreiben diesen Satz in einem guten Sinne nieder, denn von Rechts wegen soll jeder Gebildete, der mit der Gegenwart lebt, diesen Typus kennenlernen.
Was endiich Buhrs Schrift betrifft, so ist es immerhin interessant zu vernehmen, was ein einfacher Arbeiter - ein solcher ist Buhr - über Gott, Welt und Menschenwesen denkt. Doch müssen wir gestehen, daß wir solche Anschauungen schon öfter, sogar häufig, aus dem Munde von Arbeitern gehört haben. Buhr hat vor anderen nur voraus eine gewisse Beherrschung der Sprache, die ihn in den Stand setzt, seine Gedanken in klarer, verständlicher Form auszusprechen. Diese Eigenschaft ist allerdings hoch anzu-schlagen bei der geringen Belesenheit Buhrs, wie sie uns Theobald Ziegler in seiner sehr lesenswerten Einieitung schildert. Wer eine Arbeiter4ndividualltät in ihrer vollen Tiefe kennenlernen will, dem wird diese Schrift von großem Nutzen sein.
Damit möchten wir die drei ersten Schriften gegen den Materialismus als eine in unserer Zeit sehr beachtenswerte und verdienstvolle Erscheinung den weitesten Kreisen empfohlen haben.
DAS DASEIN ALS LUST, LEID UND LIEBE
Die altindische Weltanschauung in neuzeitlicher Darstellung.
Ein Beitrag zum Darwinismus, Braunschweig 1891
Zeus im Frack mit weißer Binde, das ist der Eindruck, den uns die indische Evolutionslehre, als moderner Darwinismus drapiert, macht. Man braucht nur zweierlei Bedingungen zu erfüllen: die Esoterik der Inder grobanschaulich zu nehmen und den Darwinismus
mißverständiich über das Reich der Körperwelt auszudehnen, dann kann man ein philosophisches Ungeheuer schaffen, wie es dieses Buch ist. Die intuitive Weisheit des Orients strömt in einem tiefen Bette. Nur der Forscher, der sich in das für die Erkenntnis gefährliche Element wagt, kann den Grund erreichen. Der Verfasser dieses Buches will mit Verstandesaugen bis zu demselben sehen. Er muß daher den Fluß in ein breites, seichtes Bett ableiten. Das ist ihm gelungen. Man kann ohne geistige Schwimmkunst bei dem Werke auskommen. Das Wasser der mechanischen Naturerklärung, zu dem der Verfasser - er steht nicht auf dem Titelblatt - uns führt, reicht kaum bis an die Knöchel. Wer im Individuum den Allgeist, im Einzelwesen die Summe von Existenzen, die dasselbe zu durchlaufen hat, erkennen will, der muß vor allen andern Dingen begreifen, daß dies nur durch Vertiefung in sein Inneres geschehen kann, nicht durch eine äußerliche Betrachtungsweise. Wer seine eigene Individualität als Menschen-wesen versteht, der findet alle niederen Daseinsformen in sich; er sieht sich als oberstes Glied einer weiten Stufenleiter; er weiß, wie alles andere lebt, wenn er es nachzuleben, wiederzuleben versteht. Ein höheres Leben vermag jedes niedere in sich aufzunehmen und in seiner Art wieder zu vergegenwärtigen. Darauf beruht die Möglichkeit des Verstehens der Welt durch den Menschen. Diesen Gedanken als eine in der Zeitenfolge vor sich gehende Verkörperung des Individuums in verschiedenen, immer vollkornmeneren Formen vorzustellen ist bloß bildliche Darstellung. So meint es die Esoterik. Wer die Bilder für die Sache nimmt, weiß nichts von Esoterik. Es ist geradezu eine Eigentümlichkeit des morgenländischen Geisteslebens, daß es Bilder schafft, die mit bis ins einzelne gehender Genauigkeit und Anschaulichkeit große Menschheitsgedanken ausdrücken. Man sollte für die weiteste Verbreitung dieser Bildermassen sorgen, aber man soll sie nicht durch Aufpfropfung abendländischen Realismus entstellen. Das vorliegende Buch besorgt das bis zur Unkenntlichkeit.
WEIMARER GOETHE-AUSGABE. BERICHT DER REDAKTOREN UND HERAUSGEBER
Zweite Abteilung, Band 6 und 7
Der sechste und siebente Band der zweiten Abteilung (naturwissenschaftliche Schriften) enthält Goethes morphologische Arbeiten, insofern sie sich auf Botanik beziehen. Was aus den Heften «Zur Morphologie» (1817-1824) in die «Nachgelassenen Werke» übergegangen ist, wurde hier vereinigt mit den noch ungedruckten Abhandlungen und Skizzen zu diesem Gegenstande, an denen das Archiv besonders reich ist. Dadurch ist Goethes «Theorie der Pflanze» in ihrer vollen Ausdehnung und in sich geschlossenen Gestalt in diesen beiden Bänden enthalten. Die in den «Nachgelassenen Werken» veröffentlichten Aufsätze ließen manche Frage offen über die Prinzipien, auf denen diese Theorie beruht, und über die Konsequenzen, die Goethe daraus gezogen hat. Der kundige Leser mußte durch eingefügte Hypothesen die Sache erst abrunden. Manche der hiermit angedeuteten Lücken erscheinen durch die Veröffentlichung des handschriftlichen Nachlasses nunmehr ausgefüllt.
Als Grundstock des sechsten Bandes wurde angesehen, was in dem 1831 erschienenen «Versuch über die Metamorphose der Pflanzen. Übersetzt von Friedrich Soret, nebst geschichtlichen Nachträgen» enthalten ist. Das Archiv enthält für den größten Teil dieser Partie die handschriftlichen Unterlagen. Daran schließt sich das Zugehörige aus dem ungedruckten Nachlaß in solcher Anordnung, daß Goethes Ideen in jener systematischen Folge erscheinen, die durch ihren Inhalt gefordert ist, und zwar: 1. Zur Morphologie der Pflanzen im allgemeinen, die Prinzipien enthaltend (S. 279-322); 2. Spezielle Fragen und Beispiele aus der Metamorphosenlehre (S.323-344); 3. Naturphilosophische Grundlagen und Konsequenzen der ganzen Lehre (S.345-361); 4. Auf Grenzgebiete zwischen Morphologie und Ästhetik Bezügliches (S. 362-363). Diese Aufsätze enthalten die Grundprinzipien der
Goetheschen Anschauungen über Organik, seine Gedanken über das Wesen und die Verwandtschaft der Lebewesen und über die notwendigen Anforderungen an eine wissenschaftliche Systematik derselben. Paralipomena I (S. 4O1-446) umfassen Vorarbeiten über die Metamorphose der Insekten; Paralipomena II (S. 446-451) eine Definition der Morphologie in jenem großen Stile, wie sich Goethe diese Wissenschaft dachte, und Anmerkungen zu den einzelnen Sätzen der Metamorphosenlehre, endlich Skizzen über die Metamorphose der Würmer und Insekten. Alles unter «Paralipomena» Untergebrachte ist bisher ungedruckt.
Der siebente Band bringt alle botanischen Arbeiten Goethes aus der Zeit vor der Entdeckung der Metamorphose, in denen sich erst das Ringen mit dieser Idee kundgibt, dann die Aufsätze, welche die Auseinandersetzung mit gleichzeitigen oder geschichtlichen Erscheinungen vom Standpunkte der Metamorphosenlehre enthalten. In die erste Reihe gehören die «Vorarbeiten zur Morphologie» (bisher ungedruckt), in die zweite die Aufsätze über die Spiraltendenz der Vegetation, über die Systematik der Pflanzen, Rezensionen botanischer Werke, die Arbeit über Joachim Jungius, die Aphorismen «Über den Weinbau» (ungedruckt), die Übersetzung des Kapitels «De la symétrie vegetale» aus de Candolles «Organographie végétale» (ungedruckt), die Besprechung des in der französischen Akademie zwischen Geoffroy de SaintHilaire und Cuvier ausgebrochenen Streites und endlich der «Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre» (ungedruckt), welcher die letzte Konsequenz der Goetheschen Organik zieht und mit der teleologischen Naturanschauung Abrechnung hält. Für den gedruckten Teil waren wieder die im Archiv befindlichen Handschriften maßgebend. Die «Paralipomena» enthalten durchwegs Ungedrucktes, und zwar: Goethes Notizen über Botanik, wie er sie sich auf der italienischen Reise gemacht hat, seine Studien über die Infusorien und über die Wirkung des Lichtes und der Farben auf die Pflanzen, zuletzt Skizzen und Vorarbeiten und so weiter. Bei der Frage, was von dem handschriftlichen Nachlasse in den Text aufgenommen werden sollte, trat die Rücksicht auf die formelle Vollendung in den Hintergrund gegenüber der Notwendigkeit,
daß im Wissenschaftlichen alles beigebracht werden muß, was dem Gedankengebäude Goethes angehört. Auch Fragmentarisches und Skizzenhaftes wurde aufgenommen, wenn es zur Anschauung Goethes Neues hinzubrachte oder anderwärts ausgesprochene Ideen in einem neuen Zusammenhange zeigte. Grundsatz war: alle vorhandenen Materialien so zusammenzustellen, daß der Leser ein vollständiges, lücl:enloses Bild von Goethes «System der Botanik» erhält.
Zweite Abteilung, Band 9
Der neunte Band der naturwissenschaftlichen Schriften enthält alle Arbeiten Goethes, die durch eine entsprechende Anordnung einen Umriß seiner geologischen Ideen geben. Untersuchungen über Einzelfragen und weitere Ausführungen zu seinen grundlegenden Vorstellungen wurden hier ausgeschieden und in den zehnten Band verwiesen. Band 9 und 10 sollen sich binsichtlich der Geologie ebenso ergänzend zueinander verhalten wie Band 6 und 7 in bezug auf die Morphologie. Die Verteilung des Stoffes wurde in diesem Bande gemäß der Art vorgenommen, wie sich Goethes Gedanken naturgemäß zu einem systematischen Ganzen zusammenschließen. Die Betrachtungen über die empirischen Grundlagen bilden den Anfang, daran schließen sich theoretische Erwägungen über die Entstehung einzelner geologischer Gebilde, den Schluß bilden die umfassenden Ansichten über Erd- und Welt-bildung. In die erste Abteilung gehören die Aufsätze: «Zur Kenntnis der böhmischen Gebirge und der in andern Gegenden»; in die zweite die Arbeiten über Entstehung und Bedeutung des Granits und anderer Gesteine; in die dritte Goethes Beiträge zu den großen Fragen des Vulkanismus und Neptunismus, seine Ausführungen über Atomismus und Dynamismus in der Geologie und seine schematischen und skizzenhaften Aufzeichnungen zur höheren Geologie und Kosmologie. In bezug auf die zweite Reihe ist im besonderen zu erwähnen, daß sich an die zuerst in der Hempelschen Ausgabe veröffentlichte Abhandlung über den Granit, die
Goethe 1784 verfaßte, eine bisher ungedruckte anschließt, welche die Gedanken jener ersten in wissenschaftlich strengerer Form ausspricht. Im dritten Kapitel wird die ebenfalls zuerst in Hempels Ausgabe gedruckte Disposition zu einer Abhandlung über den Bildungsprozeß der Erde und die dabei wirksamen Agentien ergänzt durch handschriftlich im Archiv vorhandene Arbeiten (Entvrurf einer allgemeinen Geschichte der Natur, &hema zurn geologischen Aufsatz, Gesteinslagerung), die als Vorarbeiten zu einer «allgemeinen Geschichte der Natur» aufzufassen sind. Auch für Goethes Verhältnis zu den Vulkanisten und Neptunisten ergab das Handschriftenmaterial des Archivs die wichtigen Skizzen: «Ursache der Vulkane wird angenommen» und «Vergleichs-Vorschläge, die Vulkanier und Neptunier über die Entstehung des Basalts zu vereinigen».
In den Paralipomenis sind enthalten: 1. Eine mit kritischen Bemerkungen Goethes versehene Inhaltsangabe des Noseschen Werkes: «Kritik der geologischen Theorie, besonders der von Breislak und jeder ähnlichen», die für die Auffassung von Goethes eigenen Ansichten von Bedeutung ist. 2. Ergänzende Skizzen zu den Aufsätzen über die Gebirge Böhmens und anderer Gegenden.
Die Notwendigkeit einer neuen Anordnung der Aufsätze dieses Bandes ergab sich aus dem Umstande, daß sie in Goethes Heften «Zur Naturwissenschaft» in der zufälligen Folge ihres Entstehens gedruckt sind. Diese Folge, die dann auch in den Nachgelassenen Schriften beibehalten wurde, entspricht aber keineswegs dem Inhalte.
Zweite Abteilung, Band 10
In ähnlicher Weise wie im sechsten und siebenten Bande mit den botanischen Arbeiten Goethes wurde im neunten und zehnten mit den geologischen verfahren. Alles zu einern systematischen Ganzen sich Zusammenschließende, Goethes geologische Anschauungen im allgemeinen Charakterisierende, wurde dem neunten Bande einverleibt; alles aus der systematischen Ideenentwickelung Herausfallende
wurde in den zehnten Band aufgenommen. Dieser enthält daher die den Inhalt des neunten Bandes ergänzenden und erweiternden Aufsätze und Skizzen. Sie sind von dreierlei Art: 1. Entwickelungen von Goethes Gedanken üher mineralogische und geologische Grundbegriffe, im Anschluß an entsprechende Naturobjekte (S.1-71); 2. Ansichten über die Grundgesetze des Wirkens der unorganischen Naturkräfte, die anfangen mit den Bildungsgesetzen der Kristalle und endigen mit den Ursachen der Gebirgsgestaltung (S.73-97); 3. Darstellungen über geologische Objekte und Phänomene in ihrer Abhängigkeit von bestimmten örtlichen Verhältnissen (S.99-207). Der wichtigste Aufsatz des ersten Abschnittes ist der bisher ungedruckte über den Ausdruck «Porphyrartig> (S. 7-17). Goethe hat ihn am 12. März 1812, angeregt durch die &hrift von Raumers «Geognostische Fragmente», zu diktieren begonnen (vgl. Tagebuchnotiz). Er enthält die terminologische Auseinandersetzung über den für Goethes geologische Betrachtungsweise wichtigsten Begriff von einer ursprünglichen unterschiedlosen Einheit der einzelnen ein bestimmtes Gestein bildenden Mineralmassen, aus der im Laufe der Zeit die Bestandteile durch Differenzierung entstanden sind. Weitere Ausführungen dieses der materialistisch-atomistischen Anschauung von der Aggregation der ursprünglich als getrennt angenommenen Bestandteile eines Gesteins entgegengesetzten Gedankens enthalten die S.18-45. Hier werden die Bedingungen dargelegt, unter denen sich die Scheidung der Bestandteile einer Gesteinsgrundmasse vollzieht, und die Störungen, die dieser Prozeß erleiden kann, geschildert. Als eine Art Darlegung des Verhältnisses der einzelnen Gesteine zueinander schließt sich der Aufsatz «King Coal» an (S. 46-50). Den Schluß des Abschnittes bilden die Bemerkungen Goethes über Begleiterscheinungen der Gletscher, Schichtung von Gebirgsmassen, Gangbildung, Zerreißen unorganischer Massen. Alles hier Beigebrachte, mit Ausnahme von S. 46-50, ist bisher ungedruckt.
Der zweite Abschnitt enthält Auseinandersetzungen über die Bildung unorganischer Formen der festen (S.75-82) und der fest-flüssigen Materie (Gerinnen, S. 83-84). Dann folgt der Aufsatz
über die «Bildung der Edelsteine» (S. 85-87), den Goethe auf eine Anfrage des Geologen Leonhard im März 1816 geschrieben hat. Die Gedanken, die er hier über die Entstehung einer besonderen Art von Naturkörpern ausspricht, leiten hinüber zu den Ausführungen über die bei der Gesteins- und Gebirgsbildung in Betracht kommenden Kräfte chemischer Art, denen das Kapitel (S. 90-97) enthalten die Daten, die Goethe zusainmenzustellen in der Lage war, als induktive Basis für die in der Abhandlung «Geologische Probleme und Versuche ihrer Auflösung» rein deduktiv aus seiner Weltanschauung im allgemeinen entwickelten Ideen. Auch die Aufsätze dieses Abschnittes sind bisher ungedruckt.
Der letzte Hauptteil des Bandes beginnt mit Ausführungen über die geologischen Verhältnisse des Leitmeritzer Kreises, besonders über die Zinnformation (S. 101-126). Dieses Kapitel erscheint hier als geschlossene Einheit, weil es von Goethe selbst als solche aufgefaßt wurde. Er hat es zu einem Aktenfaszikel zusammenheften lassen und am 3. Januar 1814 mit einem einführenden Briefe (der Paralipomena S.251 mitgeteilt ist) an Knebel zur Durchsicht gesandt. S. 129-182 enthält das dem Gebiet der rein topographischen Geologie Angehörige. Bloße Verzeichnisse von Mineralien- und Gesteinssammlungen wurden hier nicht aufgenommen, sondern nur dasjenige zusammengestellt, dem ein in Goethes geologischen Ansichten wurzelnder Gedanke als Prinzip der Aufzählung einzelner Objekte zugrunde liegt oder an das sich ein solcher als Folgerung knüpft. Die Aufzeichnungen über «Mineralogie von Thüringen und angrenzender Länder> (S. 135ff.) sind einem Faszikel entnommen, das aus dem Anfange der achtziger Jahre stammt. Die Angaben über böhmische Mineralien (S. 142-150) sind im Jahre 1822 in Eger niedergeschrieben (Tag-und Jahreshefte 1822).
Anhangsweise wurde an den Schluß des Bandes gestellt, was sich in keinem der drei Abschnitte unterbringen ließ, wie die Gedanken über einen Brief und ein Buch des Geologen von Eschwege (S. 183-185), ein paläontologischer Aufsatz (S. 186-188) und die
Abhandiung über das am Tempel des Jupiter Serapis bei Puzzuoli zu betrachtende Naturphänomen, endlich eine Auseinandersetzung über geologische Methoden. Die letztere gehört an diese Stelle, weil sie darauf hindeutet, wie Goethe die deduktive und induktive Methode als Einseitigkeiten erkannt und gefordert hat, daß sie in einer höheren Naturansicht aufgehen. Der Aufsatz schließt auf diese Weise die Bände 9 und 10 zu einetn Ganzen zusammen. Ungedruckt sind von diesern letzten Abschnitt die S.99-150, 174176, 185-188, 205-207. Die Paralipomena des Bandes enthalten geologische Vorarbeiten Goethes und Aufzeichnungen einzelner Gedanken, die sich in das Gefüge des Textes nicht einreihen ließen.
Zweite Abteilung, Band 11
Der elfte Band der naturwissenschaftlichen Schriften soll ein Bild liefern von Goethes naturphilosophischen Ideen und von seinen Vorstellungen über naturwissenschaftliche Methoden. Bei der Anordnung der Aufsätze und Skizzen waren zwei Gesichtspunkte maßgebend: erstens den inhaltlichen Zusammenhang der Ideen selbst, zweitens die methodische Behandlung anschaulich zu machen, die die Naturwissenschaft unter ihrem Einflusse erfährt. Herangebildet an der Erforschung des organischen Lebens, haben Goethes Vorstellungen über wissenschaftliche Methodik erst eine feste Gestalt gewonnen, als er sich mit den weniger verwickelten Erscheinungen der unorganischen Natur beschäftigte. Deshalb hat er seine hierauf bezüglichen Aufsätze mit Anlehnung an seine physikalischen Arbeiten geschrieben.
Das Prinzip der Anordnung für S.1-77 ist: Vorangestellt sind die Abhandlungen über die allgemeinen Intentionen in der Natur-philosophie (S. 1-12); dann folgen die Auseinandersetzungen über naturwissenschaftliche Methoden (S. 13-44: Glückliches Ereignis, Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt und die ungedruckten Aufsätze: Erfahrung und Wissenschaft, Beobachtung und Denken); den Abschluß dieses Teiles bilden die Aufsätze,
in denen Goethe in der zeitgenössischen Philosophie die Rechtfertigung suchte für seine zuerst naiv beobachtete Methode in der Organik (S. 45-55: Einwirkung der neueren Philosophie, Anschauende Urteilskraft); S. 56-77 (Bedenken und Ergebung, Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort, Vorschlag zur Güte, Analyse und Synthese, Ernst Stiedenroths Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen) enthalten das, was Goethe anzuführen hatte zur Rechtfertigung seines Hinausgehens über die durch die damalige Philosophie gegebenen Grundlagen, namentlich über die in der Organik herrschende teleologische Betrachtungsweise.
War letztere der Goetheschen Anschauungsweise bei Betrachtung des organischen Lebens im Wege, so war es im Gebiete der Physik die Alleinherrschaft der Mathematik. Die Aufsätze S.78-102 enthalten Goethes Ansichten über die Anwendbarkeit der Mathematik in der Naturwissenschaft und über die Grenzen dieser Anwendung. S. 103-163 enthält die Quintessenz der Goetheschen Naturansicht in einzelnen Aphorismen. Die Mehrzahl derselben ist in den «Nachgelassenen Werken» gedruckt. Die von Eckermann getroffene Anordnung ist beibehalten worden, nur an zwei Stellen (S. 132, 6-10, und S.132, 16 bis S.133, 2) sind bisher ungedruckte Aussprüche, die notwendig hier ihre Stelle finden müssen, eingeschoben worden. Alles übrige Ungedruckte ist an die bereits gedruckte Masse als ein besonderes Kapitel angereiht worden. Die Anordnung dieser Aphorismen in den «Nachgelassenen Werken» ist deshalb beibehalten worden, weil aus den Daten, die sich auf den vorhandenen Handschriften finden, hervorgeht, daß Goethe zum größten Teile selbst noch mit Eckermann die Redaktion besorgt hat. Zu sondern, was Goethes Anteil und was nachträgliche Arbeit Eckermanns ist, erscheint nicht möglich. S. 164166 behandelt die Polarität als allgemeines Urphänomen; S. 167-169 die Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks für die Ur-phänomene; S. 170-174 die Reihe der physikalischen Wirkungen, geordnet nach den S. 11 gewonnenen Prinzipien der Polarität und der Steigerung; S. 175 eine allgemeine physikalische Beobachtung; S. 176-239 Goethes System der physikalischen Erscheinungen. Den
Anlaß, dieses System niederauschreiben, gaben für Goethe die Vorträge, die er im Winter 1805/06 einem Kreise von Weimarer Damen gehalten hat. Da Goethe nicht etwa durch die Absicht, eine leichtfaßliche Darstellung zu bieten, die wissenschaftlichen Forderungen beeinträchtigen ließ, die er stellte, und für den angegebenen Zweck die Physik in der individuellen Gestalt durch-arbeitete, die sie seinen Prinzipien gemäß annehmen mußte, so steht das Schema dieser Vorträge hier als Beispiel, wie er seine methodischen Gesichtspunkte im besonderen durchgeführt wissen wollte. Die schematische Darstellung der Farbeniehre erscheint an dieser Stelle, weil sie hierher als ein integrierender Teil des physikalischen Schemas gehört. Die Aufsätze: Polarität (S. 164-166), Symbolik (S. 167-169), Physikalische Wirkungen (S. 170-174), Allgemeines (S. 175), die Tabelle der physikalischen Wirkungen zwischen S. 172 und 173 und das physikalische Schema waren bisher ungedruckt. An die physikalischen Schematisierungen schließt sich dann der Aufsatz über ein «physisch-chemisch-mechanisches Problem» (S. 240-243). Den Aufsätzen über den inneren (sachlichen) Zusammenhang der naturwissenschaftlichen Ideen folgen die über die Entstehung derselben innerhalb der Entwickelung des menschlichen Geistes (Einfluß des Ursprungs wissenschaftlicher Entdeckungen S. 244-245, Meteore des literarischen Himmels S. 246-254, Erfinden und Entdecken S. 255-262). Von den Aphorismen des letzten Kapitels sind bisher ungedruckt: S. 259, 1 bis S. 261, s. - «Naturphilosophie» (S. 263-264) und «Eins und Alles» (S. 265-266) gehören in die naturwissenschaftlichen Schriften, das erste wegen des Inhalts, das zweite, weil Goethe es selbst in die morphologischen Hefte (II, 1) aufgenommen hat. Sie bilden den Schluß der zur «Allgemeinen Naturlehre» gezählten Aufsätze, weil sie Gedanken enthalten, welche über die Grenze der Naturanschauung im engeren Sinne hinausgehen und von dieser in die Goethesche allgemeine Weltanschauung hinüber-leiten. Einem gleichen Zwecke dient die S. 313-319 gedruckte Studie nach Spinoza, die wegen ihres rein erkenntnistheoretischen Inhalts keinen Bestandteil der naturwissenschaftlichen Aufsätze bilden kann, wohl aber als eine Art Anhang zu denselben zu betrachten
ist. Der Aufsatz ist im XII. Band des Goethe-Jahrbuchs durch Bernhard Suphan zuerst veröffentlicht. Angegliedert an die naturphilosophischen Aufsätze sind die psychophysischen: «Das Sehen in subjektiver Hinsicht» (S. 269-284) und die bisher un-gedruckte «Tonlehre» (S. 287-294). Den Schluß des Bandes bilden die sämtlich hier zuerst gedruckten Aufsätze: Naturwissenschaftlicher Entwicklungsgang (S. 295-302), die biographische Einzelheit (S. 303), und die der allgemeinen Wissenschaftslehre angehörigen Skizzen: Dogtuatismus und Skeptizismus (S. 307-308), Induktion (S. 309-310), In Sachen der Physik contra Physik (S. 311-312). Letztere Tabelle verteilt den für die Physik in Betracht kommenden Erfahrungsstoff auf das mathematische, beziehungsweise chemische Gebiet. Das sind rein didaktische Gesichts-punkte; daher können sie nicht der fortlaufenden Ideenentwickelung eingegliedert werden.
Zweite Abteilung, Band 12
Als wichtigster Bestandteil sind in diesem Bande Goethes Arbeiten über Meteorologie enthalten. Sein Inhalt setzt sich aus folgenden Stücken zusammen. Das erste bildet der Aufsatz «Wolkengestalt» (S. 5-13), der mit Anlehnung an Luke Howards «On the Modifications of Clouds. London 1803> geschrieben ist. Goethe kannte, als er seine Aufzeichnungen niederschrieb, nur ein Referat über Howards Arbeit, das in Gilberts Annalen 1815 enthalten ist und auf das er durch den Großherzog hingewiesen wurde (vgl. S. 6 des Textes). Entstanden ist der Aufsatz im Herbst 1817; zuerst abgedruckt wurde er im dritten Heft des ersten Bandes «Zur Natur-wissenschaft». An diese Arbeit schließt sich in demselben Hefte der Text unseres Bandes S. 15-41. Das folgende von S. 42-45, 3, steht im vierten Heft des ersten; S. 45-58, 10, im ersten Heft des zweiten Bandes «Zur Naturwissenschaft». Handschriftlich ist von diesem Teile des Textes nur S. 5-13, Z. 15, im Archiv vorhanden. Den zweiten Teil des Textes nimmt die Abhandlung «Über die Ursache der Barometerschwankungen» (S. 59-73) ein. Sie steht
im zweiten Hefte des zweiten Bandes «Zur Naturwissenschaft» und enthält eine vorläufige Mitteilung über die für Goethes ganze naturwissenschaftliche Anschauungsweise besonders wichtige Hypothese, daß die Ursachen der Barometerschwankungen nicht kosmische, sondern tellurische seien und daß in einer gesetzmäßig sich ändernden Stärke der Anziehungskraft der Erde diese Ursache zu suchen sei. Die ausführliche Darlegung dieser Ansicht findet sich erst in den «Nachgelassenen Werken» unter dem Titel: «Versuch einer Witterungslehre». Dieser Aufsatz enthält in systematischer Folge Goethes Gedanken über meteorologische Phänomene, deren gegenseitige Beziehungen und Ursachen. Wir haben ihn zum dritten Teil des Textes gemacht (S. 74-109). Er ist handschriftlich vorhanden, und zwar in einer Niederschrift, die zum Teil von Eckermann, zum Teil von Goethes Schreiber John besorgt ist. Goethe selbst hat den größten Teil noch sorgfältig durch-korrigiert. Diese Niederschrift und der Druck in den «Nachgelassenen Werken» bilden die Grundlage für unsern Text. An diese bereits gedruckten Teile des Bandes schließen sich die ungedruckten Aufsätze «Karlsbad» (S. 110-114), Zur Winderzeugung (S. 115), Wolkenzüge (S. 116-117), Konzentrische Wolkensphären (S. 118-119), Witterungskunde (S. 120), Bisherige Beobachtung und Wünsche für die Zukunft (S. 121-122), Meteorologische Beobachtungsorte (S. 123-124). Der letzte Aufsatz verhält sich zu den meteorologischen Arbeiten Goethes wie die methodologischen Skizzen am Schluß des siebenten und zehnten Bandes zu den morphologischen und geologischen Arbeiten. Er ist eine methodologische Rechtfertigung der Goetheschen Anschauungsweise. An die meteorologischen Teile schließen sich die «Naturwissenschaftlichen Einzelheiten»: Betrachtungen über eine Sammlung krankhaften Elfenbeins, Über die Anforderungen an naturhistorische Abbildungen im allgemeinen und an osteologische insbesondere, Johann Kunckel, Jenaische Museen und Sternwarte. Diese Aufsätze lassen sich nicht in eines der gebräuchlichen naturwissenschaftlichen Fächer einreihen. Sie sind deshalb auch in den «Nach-gelassenen Werken» schon in dem besonderen Kapitel «Natur-wissenschaftliche Einzelheiten» untergebracht. Den Schluß des
Textes bilden einige an den Inhalt früherer Bände sich anreihende, aber erst nach dem Druck derselben aufgefundene Skizzen. Den Anfang der «Paralipomena» bildet die von Goethe bei meteoro-logischen Beobachtungen zugrunde gelegte «Instruktion». Er hat dieselbe mit Beihilfe der Jenenser Meteorologen im Jahre 1817 ausgearbeitet und 1820 verbessert. Er wünschte, daß nach dieser Instruktion die Beobachtungen an einzelnen Orten gemacht würden (vgl. S. 123). Den übrigen Teil der Paralipomena bilden Einzelheiten, die dem Gebiet der Meteorologie angehören und die sich dem systematischen Ganzen des Textes nicht eingliedern ließen.
Mit dem zwölften Bande schließt die zweite, größere Hälfte der naturwissenschaftlichen Abteilung, die Sammlung der Schriften zur Morphologie, Geologie und Meteorologie. Es wird diesem Bande deshalb, auf Anordnung der Redaktion, ein die Bände 6-12 umfassendes Namen- und Sachregister beigegeben.
J. G. VOGT. DIE UNFREIHEIT DES WILLENS
(der Determinismus) und die Frage der Verantwortlichkeit für
unsere Handlungen. Leipzig 1892
Wir haben es hier mit einer Schrift zu tun, welche die Trivialitäten der Kraft- und Stoffhelden wieder aufwärmt. Der Irrtum, der hier zugrunde liegt, ist einfach der, daß Vogt, so wie alle Deterministen, das Wesen der Kausalität verkennt. Es beruht auf einer gewissen Dürftigkeit des Denkens, die Kategorie der Ursächlichkeit für die einzige zu halten, von denen die Welterscheinungen beherrscht werden. Diese Dürftigkeit ist freilich heute ein weit verbreiteter Mangel. Wir müssen es immer und immer wieder hören, daß es die Aufgabe der Wissenschaft sei, zu den Erscheinungen, die uns durch die Beobachtung gegeben werden, die Ursachen zu suchen. Dies ist weiter nichts als eine ganz einseitige, auf einem Vorurteil beruhende Forderung. Die Erscheinungen
hängen noch in ganz anderer Weise miteinander zusammen als nach dem Gesetze von Ursache und Wirkung. Wir haben einen Vorgang noch durchaus nicht begriffen, wenn wir seine Ursache kennen. Wir müssen uns vielmehr in seine eigene Wesenheit vertiefen. Der Physiker studiert heute gar nicht mehr das Wesen der Farben, sondern die sie verursachenden Wellenvorgänge, der Psychologe nicht mehr die Handlungen der Persönlichkeit, sondern deren unpersönliche Veranlassungen. Das soll empirische Forschung sein! Wer sich wahrhaftig in die Natur der menschlichen Persönlichkeit vertieft, der wird einfach die Freiheit als eine Tatsache hinstellen müssen, die ebenso erfahrungsgemäß gegeben ist wie die Wärme- und Lichtvorgänge.
Dr. R. v. KOEBER - DIE LEBENSFRAGE
Eine erkenntnistheoretische Studie. Leipzig 1892
Eduard von Hartmann vertritt in der Erkenntnistheorie den sogenannten transzendentalen Realismus. Dieser nimmt die Idealität der uns gegebenen Erscheinungswelt an, behauptet aber, daß der Inhalt derselben auf ein transsubjektives Ding an sich ttanszendental bezogen werden müsse. Er geht von der Ansicht aus, daß unsere in den Formen des Raumes, der Zeit und der Kausalität vorhandene Sinnes- und Gedankenwelt durch und durch subjektiven Charakter habe, daß jedoch diese Welt durch die Einwirkung einer objektiven auf unser Subjekt zustande komme. Er glaubt auf diese Weise den Illusionismus zu überwinden, der die ganze Wirklichkeit in eine Summe subjektiver Erscheinungen aufzulösen droht, hinter denen nichts Objektives steckt. Diese erkenntnistheoretische Ansicht ist durch die realistischen Elemente von Kants «Kritik der reinen Vernunft» entstanden, die ein ganz unklares Durcheinander von Idealismus und Realismus ist. Wer nur mit einigermaßen unbefangenem Blicke diesen transzendentalen Realismus ansieht, der muß zu der Überzeugung
kommen, daß jenes von ihin hypothetisch angenommene «Ding an sich» aber weiter nichts ist als eine Ablagerungsstätte für alle möglichen unklaren Vorstellungen. Der christliche Offenbarungsßlauhe kann seinen ganzen Himmel mit sämtlichen Engeln, der Spiritist all seine Spirits in jene dunkle Region versetzen, wo das «Ding an sich» wuchert. Daß letzterer Fall wirklich eintreten kann, dafür ist das uns vorliegende Buch ein vollgültiger Beweis. Dr. Koeber bettet den ganzen spiritistischen Glauben der Aksakow und Genossen in das bequeme Lager des «Ding an sich». Dem transzendentalen Realismus steht der immanente Monismus gegenüber, der in folgenden Sätzen wurzelt: 1. Die uns gegebene Welt ist aus sich selbst erklärbar, ohne Zuhilfenahme eines außerhalb liegenden Prinzips. 2. Für die Annahme eines «Ding an sich> findet sich in unserem ganzen Begriffssysteme keine Notwendigkeit. 3. Die Annahme, daß die uns gegebene Welt bloß eine Summe von Vorstellungen ist, ist eine unberechtigte.
Weil der transzendentale Realismus die in Punkt 3 angedeutete Annahme macht, muß er die Welt für eine Illusion erklären, falls sie nicht in einem «Ding an sich> gegründet ist. In dieser Annahme liegt aber auch der Grundirrtum dieser Anschauung. Den gesamten Weltinhalt für Illusion zu erklären, hat überhaupt gar keinen Sinn. Die Vorstellung, daß etwas eine Illusion ist, hat nur Berechtigung, wenn es sich herausstellt, daß jenes «Etwas» der Sache nicht wahrhaftig gleichkommt, wofür man sie gewissen charakteristischen Eigenschaften nach gehalten hat. Dazu muß aber jenes andere, mit dem die Verwechselung stattgefunden hat, überhaupt existieren. Den gesamten Weltinhalt kann man aber doch nicht mit irgendeinem anderen verwechseln. Eine solche Verabsolutierung des Begriffes der Illusion ist ein Widerspruch in sich selbst.
Eduard von Hartmanns großartige philosophische Schöpfungen beruhen darauf, daß er in der Natur- und Geschichtswissenschaft nicht den transzendentalen Realismus, sondern den immanenten, konkreten Monismus zugrunde legt. Dadurch hat er jene idealistisch-evolutionistische Richtung der Wissenschaft begründet, die allein zu einer vernünftigen Weltanschauung führt. Ich stehe
nicht an, wegen dieses Umstandes die «Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins» und zu den bedeutendsten Philosophischen Schöpfungen zu zählen, die es gibt. Der «transzendentale Realismus» aber scheint mir aus einem Jrrtum zu entspringen und zu unzähligen Verirrungen zu führen. Das Koebersche Buch ist eine solche.
FRANZ BRENTANO. ÜBER DIE ZUKUNFT DER PHILOSOPHIE
Mit apologetisch-kritischer Berücksichtigung der Inaugurationsrede
von Adolf Exner «Über politische Bildung» als Rektor der Wiener
Universität. Wien 1893
Brentano legt Wert darauf, einer der ersten gewesen zu sein, der das Wort ausgesprochen hat: «Die Methode der Philosophie ist keine andere als die der Naturwissenschaften.> Von der allgemeinen Anerkennung dieses Prinzips macht er in vorliegender Broschüre das Schicksal der Philosophie in der Zukunft abhängig. Wir müssen darinnen die Signatur einer unphilosophischen Denkungsart erkennen. Die Ausdehnung der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise auf gewisse zum Beispiel psychologische Gebiete kann nichts liefern als einen Zuwachs der Naturwissenschaft, eine Erweiterung der letzteren um einen neuen Inhalt, niemals aber Philosophie. Wundts Experimentalpsychologie ist ein naturwissenschaftliches, kein Philosophisches Kapitel. Die Philosophie kann sich nicht damit begnügen, Erfahrungen zu sanameln und zu systematisieren; sie muß um eine Stufe tiefer gehen und fragen: was bedeutet überhaupt die Erfahrung; welchen Wert hat sie? Durch das Philosophische Denken können Erfahrungswahrheiten erst in das rechte Licht gerückt werden. Wer es versteht, mit dem richtigen Begriffe irgendeine Sache zu betrachten, dem zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite als dem, der sie einfach auf sich wirken läßt. Begriffe aber können wir nie erfahren. Sie müssen im Denken erzeugt werden. Nie wäre Haeckel zum
ontogenetischen Grundgesetze gelangt, wenn er es nicht frei im Denken (durch Intuition) konzipiert hätte. Es ist ganz vergebens, die Tatsachen einfach zu beobachten. Wir müssen sie unter gewisse Gesichtspunkte stellen. Auch das bloße Experiment reicht dazu nicht hin. Ohne leitende Ideen bleibt es nur ein künstlich hergestelltes Beobachtungsobjekt. Wenn wir beim Experiment auch die Bedingungen einer Erscheinung selbst hergestellt haben und daher genau den Zusammenhang zwischen Bedingung und Bedingtem kennen, so erfahren wir dadurch doch gar nichts über das Wesen dieses Zusammenhangs.
In der reinen Mathematik haben wir ein Beispiel, wie wir wirklich zur Erkenntnis dieses Wesens kommen können. Dies ist deshalb der Fall, weil wir hier mit Objekten zu tun haben, die wir nicht von außen anschauen, sondern die wir restlos selbst erzeugen. Die reine Mathematik kann im Gegensatz zu deiu Erfahrungswissen als eine Erkenntnis des Wesens ihrer Objekte gelten. Daher kann sie der Philosophie mit Recht als Vorbild dienen. Die letztere muß nur die Einseitigkeit des mathematischen Urteiles überwinden. Diese Einseitigkeit liegt in dem abstrakten Charakter der mathematischen Wahrheiten. Sie sind bloß formal. Sie bauen sich auf bloßen Verhältnisbegriffen auf. Sind wir imstande, Gebilde selbst zu erzeugen, die einen realen Inhalt haben, dann erhalten wir eine Wissenschaft nicht bloß von Formen, wie die Mathematik eine ist, sondern von Wesenheiten, wie es die Philosophie sein soll. Das oberste Gebilde dieser Art ist das «Ich>. Dies kann nicht durch Erfahrung gefunden, sondern nur durch freie Intuition erzeugt werden. Wer diese Intuition zu erzeugen vermag, der merkt alsbald, daß er damit nicht einen Akt seines einzelnen, zufälligen Bewußtseins vollzogen hat, sondern einen kosmischen Prozeß: er hat den Gegensatz von Subjekt und Objekt überwunden; er hat die inhaltliche Welt in sich, aber auch skh in der Welt gefunden. Von da ab betrachtet er nicht mehr die Dinge wie ein Außenstehender, sondern wie einer, der innerhalb derselben steht. In diesem Augenblicke ist er Philosoph geworden. Die Philosophie will die Dinge erleben, nicht wie die Erfahrungswissenschaft bloß betrachten. Dies ist ein prinzipieller Unterschied.
Wer ihn nicht zugeben und die naturwissenschaftliche Methode einfach auf die Philosophie anwenden will, der hat keinen Begriff von der letzteren. Die allgemeine Anerkennung des Brentanoschen Satzes wäre für mich gleichbedeutend mit dem allgemeinen Verfall der Philosophie.
#TI
ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND PHILOSOPHISCHE KRITIK
Im Verein mit mehreren Gelehrten vormals herausgegeben von
Dr. I. H. Fichte und Dr. H. Ulrici, redigiert von Dr. Richard Falckenberg,
Professor der Philosophie in Erlangen. Neue Folge.
100. Band i. und 2. Heft, 101. Band i. Heft. Leipzig 1892
Die «Zeitschrift für Philosophie> nimmt unter den philosophischen Zeitschriften Deutschlands eine hervorragende Stelle ein. Die drei uns vorliegenden Hefte beweisen das von neuem. Aus dem reichen Inhalt des ersten hehe ich besonders hervor den Aufsatz von Dr. Nicolaus von Seeland: und eine kurze Bemerkung Eugen Drehers über das «Gesetz von der Erhaltung der Kraft» und über das Beharrungsvermögen. Die Kritik, welche Dreher, meines Erachtens einer unserer begabtesten und leider verkanntesten Physiker, an der genialen Konzeption Jul. Roh. Mayers übt, scheint mir im höchsten Grade beachtenswert. Ich möchte hierbei die Gelegenheit ergreifen, auf Eugen Drehers Schriften und Aufsätze überhaupt hinzuweisen. Bedauerlicherweise gelingt es diesem Gelehrten nicht, über den Dualismus hinauszukommen und zum Monismus sich durchzuringen. Wo aber dieser prinzipielle Mangel seines Denkens nicht in Betracht kommt, da sind seine Ausführungen durch das Originelle seiner Betrachtungsweise von der größten Wichtigkeit.* Das zweite Heft enthält einen Beitrag von
- - -
* Auch im zweiten Heft finden wir einen bemerkenswerten Aufsatz Drehers: Kritische Bemerkungen und Ergänzungen zu Kants Antinomien.
Robert Schellwien In diesem Hefte begegnen wir noch dem Aufsatze: «Philosophische Randbemerkungen zu den Verhandlungen über den preußischen Volksschulgesetzentwurf» aus der Feder des scharfsinnigen, durch die Kühnheit seines Denkens uns von jeher sympathischen Max Schasler.
Das nächste ist ein Jubiläumsheft. Die Zeitschrift eröffnet damit das zweite Hundert ihrer Bändereihe. Aus diesem Grunde ist dasselbe mit dem Bildnis I. H. Fichtes, des Begründers der Zeitschrift, geschmückt und bringt einen Bericht Rud. Seydels über die Entstehung derselben, der sehr lesenswert ist. Er schildert in anregender Weise die Bedürfnisse, denen das philosophische Unter-nehmen seine Entstehung verdankt, und die Tätigkeit der an seiner Gründung beteiligten Männer. Den Anfang der Abhandlungen dieses Heftes machen «Psychologische Aphorismen> von Otto Liebmann. Wie alles, was der kritische Geist dieses Forschers mit seiner wahrhaft ätzenden Schärfe in Behandlung nimmt, erfährt auch das psychologische Gebiet hier reiche Anregung durch scharfe
Fassung der Begriffe, präzise Stellung der Probleme und klare Angabe der Tendenzen, welche die Bestrebungen zur Lösung zu nehmen haben Von hohem Interesse ist ein Aufsatz von Eduard von Hartmann: «Unterhalb und oberhalb von Gut und Böse». In bezug auf diese beiden Begriffe unterscheidet Hartmann drei ex-klusive Standpunkte: I. Den naturalistischen, der einzig und allein das individuell-egoistische Bedürfnis- und Triebleben zum Ausgangspunkte des Handelns macht, die Tendenzen desselben zum einzigen Moralprinzipe stempelt und jede Regelung desselben durch die Gesetze der praktischen Vernunft ablehnt 2. Den moralistischen, der die abstrakten Imperative der Vernunft als oberste praktische Maximen statuiert und jede Art des Handelns, auch das göttliche, für durch sie gebunden erklärt. 3. Den supranatura listischen, der den Willen des gottbeseelten Menschen über die Vernunftgesetze stellt und behauptet, wenn ein Mensch von den ewigen Ratschlüssen Gottes so durchdrungen ist, daß er sie zu seiner eigenen ethischen Triebkraft gemacht hat, dann sei er an keine Vernunftgesetze mehr gebunden. Diese Rarschlüsse stünden höher als alle Vernunft. Nur der mittlere Standpunkt kann eine eigentliche Moral begründen. Der erste und der letzte sind, weil sie Prinzipien des Handelns aufstellen, die von den Regeln der praktischen Vernunft verschieden sind, «jenseits von Gut und Böse>, und zwar der erstere «unterhalb», der zweite «oberhalb». Hartmann charakterisiert nun das Einseitige der drei Standpunkte und findet, daß sich die beiden wichtigsten Fragen der Ethik, die der Verantwortung und der Entstehung des Bösen, nur durch eine Durchdringung der drei Sphären lösen lassen. Der beschränkte Raum macht es uns unmöglich, in eine kritische Auseinander-setzung über dieses die wichtigsten Probleme der praktischen Philosophie behandelnde Thema einzugehen.
Wertvoll an diesem Hefte ist auch der «Jahresbericht über Erscheinungen der anglo-amerikanischen Literatur aus der Zeit von 1890 bis 1891» von Friedrich Jodl. Noch haben wir auf den Umstand aufmerksam zu machen, daß eine Reihe von philosophischen Erscheinungen der Gegenwart bemerkenswerte Besprechungen erfahren und daß eine Bibliographie philosophischer Schriften
und eine Inhaltsangabe aus philosophischen Zeitschriften des In- und Auslandes die einzelnen Hefte dieses Werkes schließen, das keiner entbehren kann. der sich für die Philosophie der Gegenwart interessiert.
#TI
Dr. LEOPOLD DRUCKER. DIE SUGGESTION UND IHRE FORENSISCHE BEDEUTUNG
Vortrag, gehalten in der Wiener juristischen Gesellschaft
am 14. Dezember 1892. Wien 1893
Die Frage nach der forensischen Bedeutung der Suggestionsphänomene gewinnt mit jedem Tage an Wichtigkeit. Daß Menschen mit Hilfe der Suggestion zu Verbrechen verleitet werden können, zwingt zu einer Berücksichtigung des Hypnotismus in der Rechtspflege. Auch schon der Umstand darf von der Gesetzgebung nicht übersehen werden, daß Handlungen, die dem Zivilrecht unterstehen, unter einem Einfluß vollzogen werden können, der die Verantwortlichkeit und den freien Willensentschluß bis auf den Nullpunkt herabzusetzen vermag. Mit Recht sagt Dr. Drucker: «Wie es die Verbreitung der Chemie mit sich gebracht hat, daß heute jeder ohne besondere Schwierigkeiten Sprengmittel der gefährlichsten Art erzeugen kann, so daß sich der Gesetzgeber bewogen gefunden hat, ein eigenes Gesetz über die Erzeugung und den Verkehr mit Sprengmitteln zu schaffen, so wird die Verbreitung der Lehren über die Suggestion und den Hypnotismus in einigen Jahren es dahin bringen, daß jedermann die nicht schwere Kunst des Hypnotisierens erlernt; wird ja heute bereits in breiten Bevölkerungsschichten das Hypnotisieren als Sport betrieben, wird ja heute bereits von der Bühne gezeigt, wie man zu hypnotisieren habe. Ist aber einmal dieses Übel eingebürgert, dann ist die Ausrottung desselben sehr schwer, fast unmöglich. Es gehört daher zu den Pflichten des Gesetzgebers, solchen Zuständen vorzubeugen.> In welchem Grade verschiedene Länder schon heute nach den bestehenden Gesetzgebungen
in der Lge sind, die nachteiligen Folgen von Handlungen, die unter suggestivem Einfluß geschehen sind, als strafbar beziehungsweise als ungültig zu betrachten, das stellt Dr. Drucker in sehr dankenswerter Weise zusaninert Ich habe übrigens die Überzeugung, daß dies noch in weit höherem Maße der Fall sein könnte, wenn bei Rechtssprechungen mehr der Geist der Gesetze und weniger der Buchstabe derselben ausschlaggebend wäre, oder besser gesagt: wenn der letztere dazu benützt würde, besser in den ersteren einzudringen. Man kann Prozesse erleben, deren Gang dem Laien ein Schaudern erregt über die Fülle der aufgewendeten juristischen Sophisterei und den doch der gelehrte Jurist als schlechtweg naturgemäß erklärt Fachmännische Bildung erweitert manchmal den Horizont; oft aber engt sie ihn so ein, daß der Weg von Hamburg nach Altona über Verona genommen wird.
JULIUS DUBOC. GRUNDRISS EINER EINHEITLICHEN TRIEBLEHRE VOM STANDPUNKTE DES DETERMINISMUS
Leipzig 1892
Wie in Dubocs übrigen Schriften, so findet man auch in dieser eine große Zahl trefflicher Ansichten über einzelne Gebiete des Lebens und der Wissenschaft. Wer Ansprüche stellt, die in die Tiefen der Wissenschaft gehen und die über den Standpunkt der modernen rationalistischen Aufklärung hinausgehen, wird aus diesem Buche wenig Befriedigung schöpfen. Was ein gebildeter Mann, ohne Philosoph zu sein, über philosophische Probleme denkt, ist interessant hie und da im Gespräche zu hören; systematisch zu einem Buche verarbeitet, trägt es den Charakter der Plattheit und Trivialität. Willkürliches Raisonnement ist eben durchaus keine Philosophie. Sätze wie dieser: «Wenn man im Sinne einer ethischen Mechanik lediglich den seelischen Bewe-gungsapparat ins Auge faßt, so fällt jedes Moment, welches im
Menschen wirkend ihn in seinem Tun und Verhalten antreibt und bestimmt, unter die Gesamtrubrik der Antriebe oder Triebe> (S.49> besagen über das Wesen der ins Auge gefaßten Sache gar nichts. Weil aber der Verfasser eine gesunde Beobachtungsgabe 1kenntnissen, die bemerkenswert sind. Dazu gehören seine Ansichhat, kommt er selbst von unzulänglichen Prinzipien aus zu Er1ten über den Charakter der Lust- und Unlustempfindungen und deren Bezug zum sittlichen Handeln. Der Trieb geht als solcher ursprünglich nicht auf die Herbeiführung einer Lustempfindung, sondern auf Herstellung des auf einem gewissen Gebiete verlotengegangenen inneren Gleichgewichts des Menschen (S. 55). «Indem aus der Betätigung des Triebes eine Empfindung der Lust quillt, die dann als solche vorgestellt werden kann, zur Vorstellung (zur Lustempfindung) wird, besuht diese Vorstellung auf dem ihr vorangehenden Trieb resp. dessen Betätigung. Insofern , wenn man unter wecken soviel wie ins Leben rufen versteht. Dagegen kann im weiteren Verlaufe die einmal selbständig gewordene Vorstellung der Lust sehr wohl den Trieb wecken, resp. ihn stimulieren, anspornen, wachrufen» (S.109 f.). Der Trieb, der auf seine Betätigung geht, ist also das erste; daß er Lust im Gefolge hat, das zweite. Diese Erkenntnis ist von der allergrößten Wichtigkeit, denn sie zeigt, daß das Leben zunächst nicht auf die Lust ausgeht, sondern auf die Herstellung seines gestörten Gleichgewichtes. Erst die Erfahrung, daß mit der Betätigung eines bestimmten Triebes eine bestimmte Lust verbunden ist, führt dann dazu, diese Lust selbst zu suchen und sich dazu der Befriedigung des Triebes zu bedienen. Dehnt man dieses Gesetz auch auf die sittlichen Triebe aus, so richtet es sich gegen die eudämonistische Ethik, welche behauptet, daß das Ziel des menschlichen Wollens die Lust sei. Die Wahrheit ist, daß die Lust sich nur als notwendige Folge an die Erfüllung unseres Wollens knüpft. Die in dem Kapitel #SE030-534
#TI
GOETHES BEZIEHUNGEN ZUR VERSAMMLUNG DEUTSCHER NATURFORSCHER UND ÄRZTE IN BERLIN 1828
Nach einem Aktenstück seines Archivs
Seit 1822 halten die deutschen Naturforscher und Ärzte alljährlich eine Versanmilung ab, an der die Fachgenossen des In- und Auslandes teilnehmen. Die Anregung zu dieser Institution ging von Oken aus. Der Zweck der Versammlungen ist: Austausch von Meinungen, persönliches Bekanntwerden der Naturforscher miteinander und Kenntnisnahme der Versammelten von den Sasamlungen und wissenschaftlichen Anstalten des Versammlungsortes, zu dem jedes Jahr eine andere größere deutsche oder österreichische Stadt auserwählt wird. Goethe mußte diese Einrichtung mit Freuden begrüßen. Seine Teilnahme war eine besonders rege an den Versammlungen in München 1827 und in Berlin 1828. Im ersten Jahre hat Goethes Interesse noch besondere Erhöhung erfahren durch den Aufenthalt Zelters in München, der mit dem der Naturforscher zusammenfiel. (Vgl. Goethes Briefwechsel mit Zelter, IV, S.381ff.) Die Bedeutung der Zusammenkünfte der Forscher trat Goethe besonders lebhaft vor Augen, als er am 30. Oktober 1827 von seinem Freunde Kaspar Sternberg eine Beschreibung der Münchener Veranstaltungen erhielt. «Den Be-schluß des heurigen Reisezyklus» - schreibt Sternberg - «machte die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in München; ein bewährter Freund, welchen der König nach seinem Porträt, das er in Weimar gesehen, sogleich erkannte, wird bei seiner Rückreise über diesen Verein Nachricht erteilt haben.» Mit dem ist eben Zelter gemeint. Die Ausführungen des Briefes machten auf Goethe einen solchen Eindruck, daß er eine Stelle daraus entnahm, überarbeitete, mit einigen Sätzen ein-leitete und auf diese Weise folgenden kleinen Aufsatz über die Bedeutung der Versammlungen deutscher Naturforscher und Ärzte verfertigte: «Wenn wir eine europäische, ja eine allgemeine Weltliteratur
zu verkündigen gewagt haben, so heißt dieses nicht, daß die verschiedenen Nationen voneinander und ihren Erzeugnissen Kenntnis nehmen, denn in diesem Sinne existiert sie schon lange, setzt sich fort und erneuert sich mehr oder weniger. Nein! hier ist viel-mehr davon die Rede, daß die lebendigen und strebenden Literato-ren einander kennenlernen und durch Neigung und Gemeinsinn sich veranlaßt finden, gesellschaftlich zu wirken. Dieses wird aber mehr durch Reisende als durch Korrespondenz bewirkt, indem ja persönlicher Gegenwart ganz allein gelingt, das wahre Verhältnis unter Menschen zu bestimmen und zu befestigen.
Schaue man also nicht zu weit umher, sondern erfreue sich zuerst, wenn im Vaterland sich Gesellschaften, und zwar wandernde, von Ort zu Ort sich bewegende Gesellschaften hervortun; weshalb denn uns die Nachricht eines würdigen Freundes von dem letzten in München versammelten Verein der Naturforscher höchst erwünscht gewesen, welche folgendermaßen lautet: #SE030-536
östlichen Staaten verwandte Naturforscher heranzuziehen. So hätte dann das Wandern abermals einen schönen, heilsamen Zweck erreicht. Der Himmel gönne dem wissenschaftlichen Streben in unserm deutschen Vaterland noch lange Friede und Ruhe, so wird sich eine Tätigkeit entfalten, wie sie die Welt nur in einem Jahr-hundert nach Erfindung des Druckes bei weit geringeren Hilfsmitteln erlebt hat.»
Die Stelle: «Am erfreulichsten erscheint - Hilfsmitteln erlebt hat» ist mit Ausnahme einiger Goethescher Abänderungen gleichlautend mit einem Teile des Sternbergschen Briefes (Vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg, Si 178 f.). In seinem Antwortbriefe vom 27. November 1827 an Sternberg schreibt Goethe:
«Wenn ich schon von manchen Seiten her verschiedentliche Kenntnisse erlangte von dem, was in München vorgefallen, so betraf doch solches mehr das Äußere, welches denn ganz stattlich und ehrenvoll anzusehen war, als das Innere, die Mitteilungen nämlich selbst ... Um so erwünschter eben ist es mir, aus zuversichtlicher Quelle zu vernehmen: daß wenigstens der Hauptzweck des näheren Bekanntwerdens und zu hoffenden wahrhaften Vereinigens unserer Naturforscher nicht verrückt worden. &hon daß man sich über den Ort vereinigt, wo man das nächste Jahr zusammenzukommen gedenkt, gibt die besten Hoffnungen, und gewiß ist die Versammlung in Berlin unter den Auspizien des allgemein anerkannten Alexander von Humboldt geeignet, uns die besten Hoffnungen einzuflößen> (Briefwechsel mit Sternberg, S.180 f.). Diese Versammlung in Berlin brachte zwei für Goethe wichtige Tatsachen. Von zwei bedeutenden Naturforschern wurden in öffentlichen Reden Goethes Verdienste um die Naturwissenschaft in warmen Worten anerkannt. Alexander von Humboldt hielt die Eröffnungsrede. Er gedachte auch der abwesenden Natur-forscher und darunter Goethes mit den Worten: «Wenn ich aber, im Angesichte dieser Versammlung, den Ausdmck meiner persönlichen Gefühle zurückhalten muß, so sei es mir wenigstens gestattet, die Patriarchen vaterländischen Ruhmes zu nennen, welche die Sorge für ihr der Nation teures Leben von uns entfernt hält: Goethe, den die großen Schöpfungen dichterischer
Phantasie nicht abgehalten haben, den Forscherblick in alle Tiefen des Naturlebens zu tauchen, und der jetzt in ländlicher Abgeschiedenheit um seinen fürstlichen Freund wie Deutschland um eine seiner herrlichsten Zierden trauert» (Isis, Bd. XXII, S. 254). Und Martius, der Münchener Botaniker, sagte an einer Stelle seines Vortrages «Über die Architektonik der Blumen» im Hinblick auf Goethes «Metamorphose der Pflanzen»: «Vor allem bemerke ich, daß die Grundansicht, welche ich hier vorzulegen mir die Ehre gebe, nicht etwa bloß das Resultat meiner Forschungen ist, sondern daß sie teilweise wenigstens von vielen bereits angenommen worden und überhaupt das Resultat jener morphologischen Ansicht von der Blume ist, die wir unserem großen Dichter Goethe danken. Alles ruht nämlich auf der Annahme, daß in der Blume nur Blätter seien (daß Kelch, Staubfäden, Krone, Pistill nur Modifikationen der pflanzlichen Einheit darstellen) oder daß das Blatt diejenige Einheit sei, mit der wir rechnen können» (Isis, Bd. XXII, S. 334). Goethe schenkte denn auch den Vorgängen in Berlin eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Ein im Goethe-Archiv noch vorhandenes Heft ist ein Beweis davon. Wir finden in demselben einen Teil der auf die Versammlung bezüglichen gedruckten Aktenstücke zusammengeheftet. Es sind folgende: «Übersichtskarte der Länder und Städte», welche Abgeordnete zu der Versammlung gesendet haben; eine «Benachrichtigung an die Mitglieder» über die einzelnen Veranstaltungen bei der Versanamlung*; das «gedruckte Verzeichnis der Teilnehmer mit deren Wohnungsnachweis»; das Programm der Eröffnungsfeier im Konzertsaale, die Zelter leitete und bei der Kompositionen von Mendelssohn, Zeltet, Flemming, Rungenhagen und Wollank zum Vortrag kamen; die Eröffnungsrede von Humboldts mit dessen eigenhändiger Widmung an Goethe: «Herrn Geh. Rat von Goethe
- - -
* Einer praktischen Maßregel der Veranstalter sei hier gedacht. Es steht in der «Benachrichtigung an die Mitglieder»: «Damit von den kostbaren Stonden des Beisammenseins keine der Erfüllung polizeilicher Vorschriften geopfert zu werden brauche, hat die wohlwollende Behörde angeordnet, daß für diesen Fall ausnahmsweise die Meldung durch die Geschäftsführer genüge. Jedes der Mitglieder ist daher von der Gestellung auf dem Fremden-Bureau und der Lösung einer Aufenthaltskarte befreit.»
unter innigster dankbarster Verehrung A. v. Humboldt»; der Vortrag «Über den Charakter der Vegetation auf den Inseln des Indischen Archipels> von C. G. C. Reinwardt, dem Leydener Botaniker, ebenfalls mit dessen eigenhändiger Widmung: «Sr. Excellenz dem Minister v. Goethe aus innigster Verehrung vom Verfasser»; ein
«Es entbrennen im feurigen Kampf die eifernden Kräfte,
Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund» Schiller
und «Es soll sich regen, schaffend handeln,
Erst sich gestalten, dann verwandeln,
Nur scheinbar steht's Momente still.
Das Ew'ge regt sich fort in allen:
Denn Alles muß in Nichts zerfallen,
Wenn es im Seyn beharren will.» Goethe
Das hier Mitgeteilte ist ein Beleg dafür, daß die Naturforscherversammlung vom Jahre 1828 Goethe einen erfreulichen Einblick gewähren konnte, wie sehr auch seine naturwissenschaftlichen Bestrebungen auf das deutsche Geistesleben gewirkt hatten.
MODERNE KRITIK
Wie so viele andere habe auch ich während meiner Studienzeit in Lessings «Hamburgischer Dramaturgie» das Vorbild aller kritischen Kunst gesucht. Im einzelnen, sagte ich mir, haben wir ja seit Lessing unendlich viel über das Wesen der Künste gelernt; aber seine Auffassung von dem Berufe des Kritikers hielt ich für die einzig wahre und echte. Der Geist, von dem seine kritischen Leistungen durchdrungen sind, schien mir maßgebend für alle Zeiten zu sein. Die Tradition der Schule sorgt dafür, daß wir von solchen Ansichten während unserer Bildungszeit uns gefangen-nehmen lassen. Als ich mich aber in die modernen psychologischen Einsichten vertiefte, als ich zu eigenen Anschauungen über die Natur des menschlichen Geistes mich durchgearbeitet hatte da stellte sich mir die Überzeugung meiner Jugend als Illusion dar. Lessing hat den Sinn, in dem die Poetik des Aristoteles geschrieben ist, gläubig hingenommen. Wie der Christ der Bibel, so steht Lessing der Ästhetik des griechischen Denkers gegenüber. Wenn man die «Hamburgische Dramaturgie» liest, hat man die Empfindung, daß durch den Reformator der deutschen Kritik Aristoteles in der Ästhetik zu der Hohe emporgehoben werden sollte, von der er in der Naturwissenschaft durch Bacon und Descartes längst herabgestürzt worden war. Je öfter ich diese Dramaturgie in die Hand nahm, desto stärker wurde in mir das Gefühl, daß der Geist der Scholastik in ihr wieder auflebte. Die Scholastiker hatten keinen Blick für die Wirklichkeit, die wahre unbefangene Betrachtung der Welt ist bei ihnen nicht zu finden. Dafür vertieften sie sich in die Schriften des Stagiriten und glaubten, alle Weisheit sei bereits in diesen enthalten. Nichts galt
ihnen die Autorität der Erfahrung, der Beobachtung; desto mehr aber die des Aristoteles. In Lessings Kunstwissenschaft schien mir dieser scholastische Geist wieder erstanden zu sein. Durch die Brille einer alten Überlieferung, nicht mir freiem, naivem Blick betrachtet er das Wesen des künstlerischen Schaffens. Wer die moderne naturwissenschaftliche Anschauungsweise in sich ausgebildet hat, muß sich von der «Hamburgischen Dramaturgie» ebenso abwenden, wie er sich von der Philosophie des Thomas von Aquino abwendet. Von ewigen Kunstregeln, die dem menschlichen Geiste ich weiß nicht woher sich offenbaren, spricht Aristoteles, spricht auch Lessing. Und von solchen Regeln spricht im Grunde der ganze Chor der Ästhetiker des eben ablaufenden Jahrhunderts. Sie alle, von Kant bis zu Carrière, Vischer und Lotze lehren, wie eine Tragödie, wie eine Komödie, wie eine Ballade beschaffen sein muß. Nicht wie der Botaniker, der das Leben der Pflanze studiert, beobachten sie das wirkliche Leben der Kunst; sondern wie ein Gesetzgeber verhalten sie sich, der aus der reinen Vernunft die Gesetze hervorgehen läßt, nach denen sich die Wirklichkeit richten soll. Das abschreckende Beispiel Vischers taucht da in meiner Seele auf, der aus der ästhetischen Wissenschaft herleitete, wie Goethe seinen Faust hätte dichten sollen. In solcher ästhetischen Betrachtungsweise lebt nicht eine Spur echter Psychologie. Diese führt zu der Ansicht, daß eine Ästhetik wie die des neunzehnten Jahrhunderts ein Unding ist. In dem Sinne, in dem es eine Botanik, eine Zoologie gibt, kann es keine Ästhetik geben. Denn die Pflanzen, die Tiere haben ein Gemeinsames, das in ihnen allen lebt. Und der Ausdruck dieses Gemeinsamen sind die Naturgesetze. Eine Pflanze ist dadurch eine Pflanze, daß sie das Allgemeine der Pflanzennatur in sich trägt. Das Kunstwerk aber entspringt aus der menschlichen Individualität. Und das Wertvollste an einem Kunstwerk, dasjenige, wodurch es seine höchste Vollendung erhält, entspringt aus der Eigenart des Künstlers, die nur einmal in der Welt vorhanden ist. Ein Kunstwerk ist um so bedeutender, je mehr es von dem an sich trägt, was sich nicht wiederholt, was nur in einem einzigen Menschen vorhan. den ist. Ein Pflanzenindividuum kann nicht originell sein, denn
es liegt in seinem Wesen, daß sich in ihm die Gattung auslebt. Ein Kunstwerk von höchstem Range ist immer originell, denn der Geist, aus dem es entsprungen ist, findet sich nicht ein zweites Mal in der Welt. Ein Maikäfer ist organisiert wie der andere; eine genialische Individualität ist nur in einem Exemplar vorhanden. Es kann keine allgemeinen Kunsrgesetze, keine allgemeine Ästhetik geben. Jedes Kunstwerk fordert eine eigene Ästhetik. Und jede Kritik, die auf dem Aberglauben aufgebaut ist, daß es eine Ästhetik gibt, gehört für den naturwissenschaftlich Denkenden zum alten Eisen. Leider ist fast unsere gesamte Kritik mehr oder weniger von diesem Aberglauben noch beherrscht. Selbst diejenigen jüngeren Kritiker, die theoretisch die Ästhetik überwunden haben, schreiben meist so, daß man jeder ihrer Zeilen ansieht: in ihnen schlummett unbewußt doch der Glaube an allgemeingültige Kunstregeln.
Nein, so wie jedes wahre Kunstwerk ein individueller, persönlicher Ausfluß eines einzelnen Menschen ist, so kann jede Kritik auch nur die ganz individuelle Wiedergabe der Empfindungen und Vorstellungen sein, die in der Seele der betrachtenden Einzelpersönlichkeit aufsteigen, während sie sich dem Genusse des Kunstwerkes hingibt. Ich kann niemals sagen, ob ein Gedicht objektiv gut oder schlecht ist, denn es gibt keine Norm des Guten oder Schlechten. Ich kann nur den persönlichen Eindruck schildern, den das Kunstwerk auf mich macht. Und ich kann als Kritiker von dem Leser nie verlangen, daß er durch meine Kritik etwas über den «objektiven Wert» des Kunstwerkes erfahre; sondern nur daß er sich für die Art, wie es auf mich wirkt, und für den Ausdruck, den ich dieser Wirkung zu geben vermag, inretessiere. Ich erzähle einfach: dies ist in mir vorgegangen, während ich das Werk betrachtet habe. Ich schildere einen Vorgang meines inneren Lebens. Wer sich dafür interessiert, was in mir vorgeht, während ich eine Tragödie anhöre oder eine Landschaft betrachte, der wird meine Kritik lesen. Wem meine Empfindungen und Vorstellungen einem Drama, einem Gemälde gegenüber gleichgültig sind, dem mag ich auch nicht einreden, er erfahre durch meine Kritik etwas über die Bedeutung des Kunstwerkes.
Alle diejenigen, die ihre Urteile in allgemeinen Äsrheriken niedergelegt haben, konnten auch nichts anderes bieten als ihre individuellen, persönlichen Meinungen über die Kunst. Aus Vischers Ästhetik kann niemand erfahren, wie ein Lustspiel beschaffen sein soll, sondern nur was in Vischers Seele vorgegangen ist, wenn er ein Lustspiel gesehen oder gelesen hat. Deshalb ist eine Kritik um so mehr wert, je bedeutender die Persönlichkeit ist, von der sie ausgeht. So individuell die Empfindungen sind, die der Lyriker in einem Gedichte zum Ausdruck bringt, so individuell sind die Urteile, die der Kritiker vorbringt. Nicht weil wir erfahren wollen, ob ein Kunstwerk so ist, wie es sein soll, lesen wir eine Kritik, sondern weil es uns interessiert, was die kritisierende Persönlichkeit innerlich durchlebt, wenn sie sich dem Genusse des Werkes hingibt. Die wahrhaft moderne Kritik kann keine Ästhetik anerkennen; ihr ist jedes Kunstwerk eine neue Offenbarung; sie urteilt in jeder Kritik nach neuen Regeln, wie das wahre Genie bei jedem Werke nach neuen Regeln schafft. Deshalb macht diese Kritik auch keinen Anspruch darauf, etwas Abschließendes, Allgemeinrichtiges über ein künstlerisches Werk zu sagen, sondern nur darauf, eine persönliche Meinung auszusprechen.
ANTON VON WERNER
(betr. einen Ausspruch desselben gegen die moderne Malerei)
Anton von Werner, der Leiter der Berliner Hochschule für bildende Künste, hat in einer Rede, die er vor kurzem bei der Preisverteilung in seiner Anstalt gehalten hat, über die moderne Richtung in der Malerei ein unbarmherziges Verdammungsurteil gefällt. Seine Sätze klingen so, als wenn er künstlich die Augen geschlossen hätte vor all dem Bedeutenden, das diese Richtung schon hervorgebracht hat, und vor all den Keimen, die für die Zukunft noch manches Große versprechen. Von Werner verteidigt
die Tradition, das Bewährte gegenüber dem Suchen nach neuen Schaffensweisen. Es scheint, wie wenn er das Alte, das Hergebrachte auch da verteidigen wollte, wo es in absteigender Entwickelung zur Schablone, zum seelenlos Formellen geführt hat. Er blickt auf den Zeitraum des letzten Vierteljahrhunderts zurück und findet, daß in dieser Zeit überhaupt entweder nichts Neues geschaffen worden ist, oder daß das Neue nicht gut ist. Von Werner macht sich die Sache leicht. Er rechnet bloß das Schlechte zu dem Neuen, das Gute dagegen zu dem Alten. Das trifft zwar die Sache nicht, denn wer solches behauptet, dem müssen die Organe fehlen für den frischen, freien, von der Tradition unabhängigen Zug der modernen Malerei. Aber es ermöglicht, über die Abgeschmackrheit, Häßlichkeir und den Dilettantismus der neuen Richtung kräftige, volltönende Zornesworre zu sprechen.
JACOB BURCKHARDT. Gestorben am 8. August 1897
Ein Mann mir den seltensten Geisresgaben ist in diesen Tagen aus dem Leben geschieden. Jacob Burckhardr, der unvergleichliche Darsteller der Renaissance, ist am 8. August gestorben. Er ist uns gewesen, was wenige Schriftsteller uns sein können. Denn wenige besitzen die Kraft, mit solcher Größe ein Zeitalter vor unserer Seele auferstehen zu lassen, wie dies Burckhardt in seinem Werke «Die Kultur der Renaissance in Italien» (1860) vermocht hat. Wer dies Buch in der Weise in sich aufgenommen hat, wie es dies nach seinem Werte verdient, der muß es zu den wichtigsten Mitteln seiner Bildung rechnen. In einfachen großen Linien werden die geistigen Kräfte der Renaissance gezeichnet, plastisch, mit riefdringendem Einblick die großen Gestalten geschildert. Man lebt in den Ideen, in den Empfindungen der gewaltigen Zeit, wenn man sich in Burckhardts Buch vertieft. Kein Gefühl, kein Gedanke, keine Ausschreitung erscheint unbegreiflich, wenn
man den Ausführungen des genialen Mannes gefolgt ist. Er schafft im besten Sinne des Wortes nach, was die Renaissance erregt, was sie in Taten ausgelebt hat. Er schildert mir dramatischer Kraft. Er kennt, was die Zeit, was die Personen der Zeit im Innersten bewegt. Leute, die Burckhardt als Lehrer kennen, versichern, daß er im mündlichen Vortrage hinreißend war, daß er vergangene Zeiten in herrlicher Weise vor den Zuhörern lebendig zu machen wußte. Wer sich in seine Schriften vertieft, wird das ohne weiteres glauben und verstehen. Was man von so vielen Historikern sagen kann, es ist im Grunde der Herren eignet Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln: auf Burckhardt hat es keine Anwendung. Er weiß den Geist der Zeiten zu erwecken in seiner ureigenen Gestalt.
Welch gewaltige Wirkungen Burckhardt auf empfängliche Geister auszuüben vetmochte, das zeigte sich am besten an derjenigen, die er auf Friedrich Nietzsche gehabt hat. Die Zeiten, in denen die großen Individuen gediehen: sie waren Nierzsches geistige Heimat. Und niemand wußte ihn besser in diese zu führen als Burckhardt. Wie Nietzsche bei den Darlegungen des großen Historikers auflebte, wie er bei ihm die Geisresluft fand, die er am liebsten atmen mochte, das hat er mit Worten höchster Begeisterung anerkannt. Daß er in Basel, als er als junger Professor in diese Stadt kam, Jacob Burckhardt fand und sich freundschaftlich an ihn anschließen konnte, rechnete Nietzsche zu den guten Geschenken, die ihm vom Schicksal gegönnt waren. Und die Art, wie Burckhardt dem jungen Genie entgegenkam, spricht für den großen Zug in seiner Persönlichkeit. Er hatte von Anfang an die richtige Empfindung davon, welche geistige Kraft in dem jungen Philosophen sich an die Oberfläche arbeitete. Er verstand ihn schon damals wie wenige. Es spricht immer für die eigene Größe eines Geistes, wenn er einen andern Großen sofort als solchen zu erkennen vermag.
VIKTOR MEYER
Dr. Viktor Meyer, einer der bedeutendsten Chemiker der Gegenwart, von dem die Wissenschaft noch vieles erwartete, hat am 8. August seinem Leben ein Ende gemacht. Die Kunde wirkt erschütternd, denn alles, was von dem hervorragenden Forscher in der letzten Zeit bekannt geworden ist, ließ schließen, daß er mir voller Kraft dem Ziele entgegenarbeirere, das er öfter als das nächste der gegenwärtigen Chemie erklärt hat: der Zerlegung der Stoffe, die man heute als Elemente bezeichnet, in einfachere Marerien. Mir bewundernswerter Arbeitskraft, mit einem großen Zielbewußtsein ersann er experimentelle Methoden, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Wie die Naturkörper zusammengesetzt sind und welches ihre einfachen Bestandteile sind: diese Fragen beschäftigten ihn. Sie wollte er durch seine unter den schwierigsten Verhältnissen angestellten Laboraroriumsversuche lösen. Die komplizierte Art, wie sich die einfachen Körper zu den Verbindungen zusammensetzen, mir denen es die organische Chemie zu tun hat, reizte seinen Forschungsgeisr. Daß er neue Stoffe entdeckte, die Aldoxime, das Thiophen, erscheint wie eine Begleiterscheinung seines Forschens. Dieses selbst zielte darauf hin, die Konstitution der Materie auf experimentellem Wege zu ergründen. Es ist tief bedauerlich, daß er sich genötigt sah, seine schöne Arbeit einzustellen. Es ist viel zu tun auf dem Felde, das er zu dem seinigen gemacht hat.
DARWINISMUS UND GEGENWART
In diesen Tagen wurde in den Zeitungen erzählt, daß den DarwinEnthusiasren, die vor drei bis vier Jahren daran gingen, Sammlungen zu einem Denkmal für den großen Naturforscher einzuleiten, durch einen Zwischenfall schlimm mitgespielt worden ist. Das Denkmal sollte in Darwins Vaterstadt Shrewsbury errichtet werden. Kaum waren die Veranstaltungen zu den Sammlungen gemacht,
da erhob sich ein furchtbarer Sturm und warf den Kirchturm von Shrewsbury um. Das war ein Wink Gottes für die Frommen. Es war ihnen geoffenbart worden, daß sie für das Denkmal des großen Kerzers nichts spenden sollen. Dagegen laufen in Hülle und Fülle die Gelder zum Aufbau des Kirchturms ein, der sich zum Werkzeug eines höheren Willens hatte hergeben müssen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist. Mich interessiert sie als Symptom für den schroffen Gegensatz, der zwischen zwei Weltanschauungen in der Gegenwart besteht, zwischen der christlichen und der auf naturwissenschaftlichen Grundlagen erbauten modernen Denkweise. Mir fiel der Fall Bautz und manches andere dabei wieder ein. Baurz ist jener Theologieprofessor in Münster, der in mündlicher Rede auf der Lehrkanzel und in seinen Schriften die Ansicht vertritt, daß sich Hölle und Fegefeuer im Innern der Erde befinden und mit den Vulkanen und Erdbeben im Zusammenhange stehen. So oft die Dinge dieser Art durch die Presse bekannt werden, kann man an allen Orten die Rufe der Entrüstung unserer Freigeister, Fortschrirtler und sonstigen «auf der Höhe der Zeit Stehenden» hören. Am liebsten möchten sie nach der Staatsgewalt rufen und einen Mann, der Ähnliches wie das Angeführte lehrt, von seinem Posten entfernen lassen.
Mir drängt sich, so oft ich den Gegensatz der erwähnten zwei Weltanschauungen gewahr werde, die Frage auf: Mit welchen Waffen wird hüben und drüben gekämpft? Am meisten zu schätzen sind diejenigen Kämpfer, die ihre Waffen am besten schärfen. Und gerade in Hinsicht auf die Zurichtung der Kampfmirrel könnten unsere «Modernen» von Männern wie Baurz unendlich viel lernen. Was Bautz auszeichnet, ist der Mut, die Gedanken zu Ende zu denken, die sich mit Notwendigkeit aus seiner Weltanschauung ergeben. Er spricht die letzten Ideen aus, zu denen er kommen muß, wenn er die ersten seines Bekenntnisses angenommen hat. Seine Art ist weitaus wertvoller als die der liberalen Theologen, die den Inhalt der christlichen Lehre so verwässern, daß zur Not sogar der moderne Darwinismus einen Bestandteil des christlichen Bekenntnisses bilden kann. Aber wie sehr man
sich auch Mühe geben mag: nie wird es jemandem gelingen, Einklang zu stiften zwischen der christlichen und der naturwissenschaftlich-modernen Weltanschauung. Ohne eine persönliche, weise Führung der Welrgeschicke, die sich in Zeiten der Not durch Fingerzeige wie das Umwerfen des Turmes von Shrewsbury ankündigt, gibt es kein Christentum; ohne die Leugnung einer solchen Führung und die Anerkennung der Wahrheit, daß in dieser unseren Sinnen zugänglichen Welt alle die Ursachen der Ereignisse liegen, gibt es keine moderne Denkweise. Nichts Übernatürliches greift jemals in die Natur ein; alles Geschehene beruht auf den Elementen, die wir mit unseren Sinnen und unserem Denken erreichen: erst wenn diese Einsicht nicht in das Denken allein, sondern in die Tiefe des Empfindungslebens eingedrungen ist, kann von moderner Anschauungsweise gesprochen werden. . Aber davon sind unsere «modernen Geister» recht weit entfernt. Mit dem Denken geht es. Der Verstand der Zeitgenossen findet sich allmählich mir dem Darwinismus ab. Aber die Empfindung, das Gefühl, die sind noch durchaus christlich. Das Gemüt vermag aus dem Inhalt der natürlichen Wirklichkeit nicht jene Erhebung zu schöpfen, die es aus den Lehren der Religion zu ziehen imstande ist. Und aus diesem Zwiespalt der «modernen» Geister entspringt die Mutlosigkeit, die sie davor zurückschrecken läßt, die Konsequenzen ihrer Gedankenvorausserzungen zu ziehen. Wie feige erscheint doch das Gerede: daß die Wissenschaft nicht weit genug ist, um über die letzten Fragen etwas zu sagen gegenüber der Kühnheit, mit der Dr. Baurz seine Ansicht von Hölle und Fegefeuer vertritt! Wo sind die modernen Geister, die den Mut haben, ihre Ansichten zu Ende zu denken? Und die wenigen, die ihn haben, wie werden sie behandelt! Man denke an die Anfeindungen, die Ernst Haeckel von seinen Fachgenossen erfahren hat, weil er nicht bei der Feststellung einzelner Tatsachen stehenblieb, sondern aus seinen naturwissenschaftlichen Einsichten ein Gebäude moderner Weltansicht aufbaure.
Charakteristisch für die Art, wie sich unsere klugen Freigeisrer zu Männern verhalten, die den höchsten Fragen wacker an den Leib rücken, sind die Ansichten, die man über Friedrich Nierzsche
zu lesen bekommt. Daß sich hier einmal einer in die tiefsten Probleme des Erkennens eingewiihlt, daß er nicht innegehalten hat, bis er in die Untergründe des Daseins gedrungen war, daß er Jenseirsglauben und Diesseirsverehrung in unvergleichlich großer Weise einander gegenübergestellt und den Kultus des Diesseits im höchsten Sinne entwickelt hat: was geht das alles unsere «modernen Geister» an. Sie kümmern sich überhaupt nicht um seine Anschauungen, Gedanken, für die er gelebt und gelitten hat, aus denen ihm alle Wollust des Daseins gequollen ist. Nein, sie erfreuen sich bloß an dem Dichter Nierzsche. Ich werde gewiß niemandem die Berechtigung abstreiten, sich an den poetischen Schönheiten der Darstellung Nietzsches zu erheben. Aber nur sich an diese hängen, scheint mir ein bequemes Mittel, diesen Geist groß nennen zu dürfen. Nein, ihn sollte niemand groß nennen, der nicht die riefgtündigen Gedankengänge des «Jenseits von Gut und Böse» in ihrer vollen Bedeutung würdigen kann. Hier ist eine Tiefe der Ideen, die vorher in der geistigen Geschichte der Menschheit noch nie erreicht war. Aber dies ist unseren Modernen gleichgültig. Sie müßten sich, wenn sie auf diese Urdinge eingehen wollten, für oder gegen diese Ideen aussprechen. Dazu ist ihr Denken zu untüchrig oder mutlos. Sie berauschen sich dafür lieber an der Sprache des Zarathustra. Stumpfheit und Lässigkeit des Denkens: das ist vielfach die Signatur unserer «modernen Geister». Sie stehen in dieser Beziehung hinter den Frommen zurück, die kein Darwin-Denkmal wollen, weil der Kirchturm eingestürzt ist. Diese Frommen haben eine geschlossene Weltansicht; die «Modernen» haben meist nur Stückwerk. Dieser Gedanke entsteht immer in mir, wenn ich die beiden Weltanschauungen, Christentum und modernen Naturalismus, aufeinandetstoßen sehe. Mir gefallen da immer meine Gegner besser als diejenigen, deren Meinung sich der meinigen nähert. Am wenigsten aber gefallen mir die vermittelnden Geister: die Theologen, welche Darwin verteidigen, und die Narurlehrer, die sich für das Christentum aussprechen. Man muß verwischen, was für jede dieser Anschauungen das Charakteristische ist, wenn man eine solche Vermittlerrolle spielen will. Gesund ist aber nur das ehrliche und offene
Fortschreiten bis zu den wahren Konsequenzen einer Meinung, die man sich gebildet hat. Nur seine ganzen Persönlichkeiten haben das Christentum groß gemacht; nur die ganzen Persönlichkeiten werden auch die moderne Denkungsweise zur Kultur-trägerin machen.
#TI
RUDOLF HEIDENHAIN. Gestorben am 13. Oktober 1897
Die Bedeutung zu schildern, welche der vor einigen Tagen verstorbene Physiologe Rudolf Heidenhain für seine Fachwissenschaft hat, gehört nicht zu den Aufgaben dieser Wochenschrift. Nicht unberücksichtigt aber soll bleiben, daß in dem Breslauer Universitätslaboratorium Heidenhains Arbeiten gemacht worden sind, die für jeden wichtig sind, der nach einer allgemeinen Weltauffassung Bedürfnis hat. In unserer Zeit des Spezialisrenrums dringen die Ergebnisse gelehrter Einzelarbeir nicht leicht in das allgemeine Bewußtsein der Gebildeten. Diesem Umstande ist es zum Teile zuzuschreiben, daß Heidenhains Untersuchungen über das Leben der Zelle auf unsere moderne Weltanschauung nicht den Einfluß ausgeübt haben, den sie ihrer Natur nach hätten ausüben müssen. Allerdings kommt noch etwas anderes dazu, das ich später erwähnen will.
Unsere Naturauffassung strebt deutlich dern Ziele zu, das Leben der Organismen nach denselben Gesetzen zu erklären, nach denen auch die Erscheinungen der leblosen Natur erklärt werden müssen. Mechanische, physikalische, chemische Gesetzmäßigkeit wird im tierischen und pflanzlichen Körper gesucht. Dieselbe Art von Gesetzen, die eine Maschine beherrschen, sollen, nur in unendlich komplizierter und schwer zu erkennender Form, auch im Organismus tätig sein. Nichts soll zu diesen Gesetzen hinzutreten, um das Phänomen, das wir Leben nennen, möglich zu machen. Sie sollen es in vielfältiger Verkettung allein imstande sein. Diese
mechanistische Auffassung der Lebenserscheinungen gewinnt immer mehr an Boden. Sie wird aber denjenigen nie befriedigen, der fähig ist, einen tieferen Blick in die Naturvorgänge zu tun. Ein solcher wird erkennen, daß in dem Organismus Gesetze höherer Art wirksam sind als in der leblosen Natur. Es wird ihm klar werden, daß nur derjenige solche Gesetze leugnen kann, der sie nicht sieht. Der tiefer Blickende wird sich mit niemandem gerne über die Gesetze des organischen Lebens streiten, wie sich der Farbensehende mit dem Farbenblinden nicht über die Farben streiret. Ein solcher tiefer Blickender weiß, daß schon in der kleinsten Zelle Gesetze höherer Art wirksam sind als in der Maschine.
Durch Untersuchungen wie diejenigen Heidenhains gewinnen die Ideen über besondere Gesetze der Organismen bestimmten Inhalt im einzelnen. Dieser Forscher hat gezeigt, daß die Zellen der Speicheldtüsen in lebendiger Tätigkeit begriffen sind, wenn das Absonderungsprodukr derselben erzeugt wird. Es wird also die Absonderung nicht durch bloße physikalische Ursachen, sondern durch das aktive Leben der kleinen Organe bewirkt. Ein Ähnliches hat Heidenhain für die Zellen der Niere und der Darmwandungen nachgewiesen. Nicht der bloße mechanische Blutdruck oder die chemischen Kräfte, die in Betracht kommen, sind allein tätig, sondern besondere organische Triebkräfte. Diese Triebkräfte können unter bestimmten Bedingungen allein, unabhängig von mechanischen Wirkungen arbeiten, unter bestimmten andern in Kombination mir jenen andern.
Charakteristisch für die Denkart der modernen Narurforscher bleibt es, daß Heidenhain aus seinen Versuchen selbst nicht den Schluß gezogen hat, daß das Leben der Zellen höheren Gesetzen gehorcht als die Dinge der unorganischen Natur. Er lebte in dem Wahne, daß das Eigenleben, das er in den Zellen wahrnahm, sich doch noch werde aus physikalischen und chemischen Vorgängen erklären lassen. Man begegnet hier der Anschauungsweise, welche sogleich in Mystizismus zu verfallen glaubt, wenn sie den Boden der einfachen Gesetzmäßigkeit verläßt, nach der ein Stein zur Erde fällt oder nach der zwei Flüssigkeiten sich mischen. Man glaubt in das Gebiet des Wunders, der Gesetzlosigkeit zu kommen,
wenn man aus dem Bereiche der rein mechanischen Naturgesetze heraustritt. Dies ist der zweite Grund, warum Heidenhains Versuche auf die Weltanschauung der Zeit nicht genügend gewirkt haben. Die Naturforscher von heute sind in ihrem Denken zu feige. Wo ihnen die Weisheit ihrer mechanischen Erklärungen ausgeht, da sagen sie: für uns ist die Sache nicht erklärbar. Die Zukunft wird Aufschluß bringen. Sie wagen sich nicht weiter vor, als sie mit den armseligen Gesetzen der Mechanik, Physik und Chemie dringen können. Ein kühnes Denken erhebt sich zu einer höheren Anschauungsweise. Es versucht, nach höheren Gesetzen zu erklären, was nicht mechanischer Art ist. All unser naturwissenschaftliches Denken bleibt hinter unserer naturwissenschaftlichen Erfahrung zurück. Man rühmt heute die naturwissenschaftliche Denkart sehr. Man spricht davon, daß wir im naturwissenschaftlichen Zeitalter leben. Aber im Grunde ist dieses naturwissenschaftliche Zeitalter das ärmlichste, das die Geschichte zu verzeichnen hat. Hängenbleiben an den bloßen Tatsachen und an den mechanischen Erklärungsarten ist sein Charakteristikum. Das Leben wird von dieser Denkart nie begriffen, weil zu einem solchen Begreifen eine höhere Vorsrellungsweise gehört als zur Erklärung einer Maschine.
FERDINAND COHN zum 50 jährigen Doktorjubiläum
Der hervorragende Botaniker Ferdinand Cohn feiert in diesen Tagen sein fünfzigjähriges Doktorjubiläum. Die Pflanzenphysiologie verdankt Cohn ungeheuer viel. In seinem Institut an der Breslauer Hochschule wurden bedeutende Arbeiten gemacht und eine startliche Zahl von Schülern gebildet. Die Gebiete, denen er sich vorzüglich widmete, waren die Morphologie und Entwickelungsgeschichre der niederen Pflanzen, die Biologie der Bakterien. Cohns Schüler rühmen sein vorzügliches Lehrtalent, sein außerordentliches
Entgegenkommen gegenüber jüngeren Gelehrten. Seine schriftstellerische Darstellungsgabe ist eine ungewöhnliche. In seinen populären Schriften («Die Pflanze») kommt diese seine Fähigkeit ganz besonders zum Vorschein. Wenige schreiben solche Schriften in einer so eindringlichen, geschmackvollen und schönen Sprache. Soweit das bei wissenschaftlichen Schriften möglich ist, erhebt sich Cohn sogar zu einer kunstvollen, poetischen Darstellung. Ein feiner Natursinn, der in allen seinen Aufsätzen sich verrät, verleiht deren Lektüre einen ganz besonderen Reiz. Sein Aufsatz «Goethe als Botaniker» gehört zu den Perlen wissenschaftlicher Abhandlungen. Ferdinand Cohn ist auch ein feinsinniger, für alles Bedeutende begeisterter Kunstkenner und Kunstliebhaber.
KARL FRENZEL. Zu seinem siebzigsten Geburtstage
Am 6. Dezember feierte Karl Frenzel seinen siebzigsten Geburtstag. Ich liebe es nicht, an solchen Tagen die üblichen Geburtsragsartikel zu bringen. Aber ich schweige auch nicht gerne, wenn mein Gefühl sich aussprechen will. Um eine Monographie oder auch nur eine kurze zutreffende Charakteristik über Karl Frenzel zu schreiben, bin ich nicht der richtige Mann. Dennoch glaube ich, daß im gegenwärtigen Augenblicke gerade ich im «Magazin für Literatur» Karl Frenzel den Geburtstagsgruß dieses Organs darbringen soll. Er ist mir der literarischen Entwickelung Deutschlands verwachsen wie wenige. Wir Jüngeren stehen zu Schriftstellern, wie er ist, in einem ganz eigentümlichen Verhältnis. Wir haben von ihnen sehr viel gelernt. Wir sind ihnen den größten Dank schuldig. Wir fühlen das. Und doch können wir nicht ihre Bahnen gehen. Wir sind ihre ungerarenen Söhne. Die Väter schelten uns. Wir lieben sie, aber wir gehorchen ihnen nicht. Wir sind ungezogen und verdienen nach ihrer Ansicht die Rute. Aber wir wünschen, daß unsere Väter sehen mögen, daß aus uns Ungeratenen
doch noch etwas wird. Auch von Karl Frenzel möchte ich wünschen, daß es ihm gegönnt sein möge, an uns noch Freude zu erleben. Das wird vielleicht etwas lange dauern. Aber daß er es dann noch mirerlebe, das ist es gerade, was ich ihm wünsche.
Ich habe aus Frenzels Essays ungeheuren Nutzen gezogen. Ich habe mich oft über den richtungsicheren Kritiker gefreut. In diese Freude mischte sich nur immer etwas wie Neid. Doch ist Neid nicht das richtige Wort. Es gibt aber kein besseres. Die Kritiker seiner Generation wußten von Kindesbeinen an, was sie wollten. Sie haben «Prinzipien», die sie auf alles anwenden. Wir Gegenwärtigen leben von heute auf morgen. Was wir heute glauben, ist morgen für uns überwunden. Und was wir gestern gesagt haben, verstehen wir heute kaum mehr. Frenzels Alrersgenossen waren gesetzte Leute, die einen festen Standpunkt hatten, von dem sie nicht einen Schritt nach rechts oder links abwichen. Wir springen von Standpunkt zu Standpunkt. Wir sind Suchende, Zweifelnde, Fragende. Sie hatten eine gewisse Sicherheit. Welches der rechte Weg in der Kunst, in der Philosophie, in der Wissenschaft, in der Politik ist, das wußten sie. Jedes neue Talent konnren sie einreihen. Wir können das alles nicht. Wir wissen fast nicht mehr, ob ein neues Buch, das wir lesen, bedeutend ist oder nicht. Wir sehen uns jedes Talent von allen Seiten an, und dann wissen wir zumeist gar nichts. Wir sind in eine rechte Anarchie hineingeraten. Über unsere größten Zeitgenossen haben wir jeder eine andere Meinung.
Selbst wenn wir einig sind in der Verehrung für einen Zeitgenossen, so streiten wir uns. Der eine sucht in dem, der andere in jenem seine Bedeutung.
Ich erinnere mich noch, wie ich als Jüngling zu Friedrich Theodor Vischer aufblickte. Jeder seiner Sätze bohrte sich wie ein Pfeil in meine Seele. Und jetzt lese ich ihn mir ganz anderen Gefühlen. Er interessiert mich nur mehr, aber er erwärmt mich nicht mehr. Er ist mir fremd geworden.
Vielleicht finden es manche pietärlos, daß ich diese Worte als Geburtsragsgruß dem Siebzigjährigen darbringe. Aber es verbindet uns doch etwas, indem wir uns verstehen: das ist gegenseitige
Aufrichtigkeit. Wahr wollen wir gegeneinander sein. Wir wollen uns keine Phrasen vormachen. Wir wollen unseren Vätern sagen, daß wir sie verehren, daß sie uns die höchste Achtung einflößen. Aber wir wollen ihnen auch sagen, daß wir andere Wege gehen wollen. Die Pietät ist gewiß eine Tugend, aber sie saugt die Kraft aus dem Menschen. Und wir brauchen die Kraft, weil wir neue Aufgaben vor uns sehen.
Es war eine schöne Zeit, in der Karl Frenzel wirkte; eine Zeit voll von reifen Ideen, voll von vollendetet Kunst. In sich abgeschlossene, harmonische Naturen waren diejenigen, mit denen er die Mannesjahre zugleich erlebte. Sie waren auch deswegen glücklicher als wir. Sie Versprachen sich mehr von ihren Idealen als wir von den unsrigen. Sie sogen mehr Lebensheiterkeit aus diesen Idealen. Sie waren eben größere Idealisten. Wir fürchten uns vor Idealen wie vor täuschenden Trugbildern. Wir sprechen nicht mehr die beseligenden Worte: die Idee muß doch siegen!
HANS BUSSE . GRAPHOLOGIE UND GERICHTLICHE HANDSCHRIFTENUNTERSUCHUNGEN
Leipzig 1898
Unter dem Titel «Graphologie und gerichtliche Handschriften-Untersuchungen> hat Hans Busse ein Schrifrchen erscheinen lassen (bei Paul List, Leipzig), das durch Anknüpfung an die DreyfusAngelegenheit ein aktuelles, durch klare Auseinandersetzungen über das Wesen und die Bedeutung der Graphologie ein tieferes Interesse zu erregen geeignet ist. Die Zeit ist vorüber, in der man mit vornehmem Achselzucken über die Berechtigung dieses Wissenszweiges zur Tagesordnung übergehen konnte. Zwei bedeutende Seelenforscher, Benedikt und Ribot, haben sich ja auch vor kurzem dahin ausgesprochen, daß sich in den Schriftzügen der Charakter der Persönlichkeit ausdrückt. Durch die wissenschaftliche, erfahrungsgemäße Erforschung des Zusammenhanges dieser
Züge mit dem Gepräge der Persönlichkeit werden sich ebenso reizvolle wie nützliche Erkenntnisse ergeben. Die Graphologie muß ein wichtiges Kapitel der Psychologie werden. In viel höherem Maße als in den Gesichtszügen muß sich der individuelle Charakter eines Menschen in seiner Schrift ausdrücken. Denn die Gesichtszüge vermögen sich nur innerhalb von der Natur gesteckter Grenzen beweglich zu erhalten, um sich der Wandiung der menschlichen Natur anzuschmiegen. Die Schrift ist solchen Grenzen nicht unterworfen. Eine Krisis in der Entwickelung einer Persönlichkeit wird stets einen Wandel in seiner Schrift nach sich ziehen. Je freier, selbsrherrlicher ein Mensch ist, desto mächtiger wird er seine Eigenart in der Schrift auszuprägen wissen. Unfreie Naturen werden gewissen Schrifrformen, die ihnen gelehrt worden sind, unterworfen bleiben. Einen Durchschnittsmenschen wird man immer daran erkennen, daß seine Schrift keine individuelle, sondern die seines Schreiblehrers ist. Die Schrift ist wie der Stil der Charakter des Menschen.
EINE NEUE THEORIE DER ERDWÄRME
Beachtung verdient eine neue Theorie der Erdwärme, die Dr. Otterbein in der «Allgemeinen deutschen Universitärszeirung» aufstellt. Die Erde ist zwei Bewegungen unterworfen, der Drehung um ihre Achse und derjenigen um die Sonne. Diese Bewegungen hemmen sich zum Teile. Und da auf diese Weise die durch die Bewegung geleistete Arbeit verlorengeht, muß nach dem allgemeinen physikalischen Gesetze, wonach aus scheinbar verlorener Arbeit Wärme entsteht, die fortwährend durch Ausstrahlung in den Weltraum verschwindende Erdwärme sich erneuern. Die Erde würde demnach nicht dem Schicksale verfallen, allmählich sich bis zur völligen Totenstarre abzukühlen, sondern sie könnte ewig jung bleiben.
*
DIE PSYCHOLOGIE DER EXAMENKANDIDATEN
Einen höchst interessanten Aufsatz hat Dr. Arthur Adler in der «Zeitschrift für praktische Ärzte» (Frankfurt 1898, VII. Jahrgang, Nr.3) veröffentlicht. Er behandelt die Psychologie des Examen-kandidaten und bringt außerordentlich Lehrreiches zur Seelenkunde bei. Die abnormen Zustände, in denen sich die Seele eines Prüflings befindet, und die Wirkungen dieser Zustände auf den ganzen Menschen werden klar und einleuchtend dargestellt. Die Unterschiede, die sich in bezug auf diese Wirkungen ergeben, je nachdem der Kandidat einen starken, gesunden oder einen kränkelnden, nervösen Organismus hat, werden hervorgehoben. Namentlich die psychologischen Gründe des Selbstmordes bei Examen-kandidaten sind vortrefflich geschildert.
EMILE RIGOLAGE . LA SOCIOLOGIE PAR AUGUSTE COMTE
Emile Rigolage hat soeben den zweiten Band seines mir umsichtvoller Kunst gearbeiteten Auszuges aus Augusre Comres Schriften unter dem Titel «La Sociologie par Auguste Comte» herausgegeben (Bibliothque de Philosophie contemporaine, Paris, Felix Alcan). Das Buch isr bereits vor 15 Jahren in erster Auflage erschienen und von Kirchmann ins Deutsche übertragen worden. Compte ist ein Denker, den man kennen muß als Beispiel einer ideenlosen Persönlichkeit. Daß der Inhalt der Philosophie Ideen sind, davon hat Comre keine Ahnung. In seinem Kopfe blitzen keine Ideen auf, wenn er die Dinge der Welt betrachtet. Deshalb ist seine sogenannte Philosophie das Zerrbild alles wahren und echten Philosophierens. Was sie über die Welt gedacht haben, das haben die Philosophen aller Zeiten in ihren Werken niedergelegt:
Sie sind stets über das bloße Beobachten hinausgegangen. Dieses Beobachten ist Sache der Erfahrungswissenschafren. Neben diesen Einzeldisziplinen hat die Philosophie keine Berechtigung, wenn
sie nicht den tieferen, den ideellen Kern der Dinge aufsucht. Aber Comre weiß nichts von einem solchen Kern. Er ist ohne jegliche Intuition und Phantasie. Deshalb ist er der Meinung, die Philosophie habe aus Eigenem nichts zu den Einzelwissenschaften hinzuzufügen, sondern bloß das zusammenzustellen und in eine systematische Ordnung zu bringen, was durch diese Einzelwissenschaften erkannt worden ist. Es bedeutet den Bankerort der Philosophie, wenn man im Sinne Comtes philosophiert. Alles, was man zu wissen braucht, um einen Ein- und Überblick über das ganz öde und unfruchtbare «System» Comtes zu gewinnen, findet sich musterhaft in dern oben genannten Auszug zusammengestellt. Der Verfasser der Schrift hat sich gründlich eingelebt in die Ansichten Comtes und war deshalb imstande, die bezeichnenden Dinge herauszuheben, auf die es ankommt. Ein solches Zusammenfassen ist besonders bei Comte schwierig. Denn eben weil leitende Grundgedanken ganz fehlen, fällt alles auseinander.
Mir scheint, daß das Buch gerade gegenwärtig nützlich werden kann. Auch andere Philosophen bestreben sich immer mehr und mehr, der Philosophie einen Charakter zu geben, der sie den Einzelwissenschaften ähnlich machen soll. Man spricht sogar von exakter Philosophie. Wohin man kommt, wenn solche Exaktheit auf die Spitze getrieben wird, kann man bei Comre lernen. Die Un- und Widerphilosophie ist die Folge. Und da man die Schädlichkeir einer Tätigkeit am besten erkennt, wenn man sie in ihre Extreme verfolgt und in ihren Auswüchsen beobachtet, so sei Comres Philosophieren den Zeitgenossen als abschreckendes Beispiel empfohlen. Sie mögen aus ihm lernen, wie man es nicht machen soll, wenn etwas Ersprießliches auf diesem Gebiete zustande kommen soll.
Ich habe den Glauben, daß wir doch einer Zeit entgegengehen, in welcher das philosophische Streben wieder die ihm gebührende Achtung haben wird. Die unfruchtbaren Versuche Comres und anderer mußten gemacht werden, weil man erst irren muß, um später der Wahrheit beizukommen.
DAS THEATER DER NATURSCHAUSPIELE
Ein solches hat M. Wilhelm Meyer in der Berliner «Urania> gegründet. Er hat sich soeben über seine Intentionen mir dieser Anstalt in einem ausführlichen Artikel der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung ausgesprochen (Beilage zu den Nummern vom 8. und 9. April). Sein Grundgedanke ist, daß das Theater das Nacheinander in der Zeit, das ist Vorgänge im allgemeinen, darzustellen habe. Bisher ist man bloß bei Vorgängen aus dem Menschenleben stehengeblieben. Und auch da hat man sich auf einen Ausschnitt beschränkt. Die Dramen, in denen nicht die Ereignisse des Liebeslebens den Mittelpunkt bilden, sind nur in geringer Zahl vorhanden. Meyer ist Bekenner der naturwissenschaftlichen Weltanschauung, und zwar in der Form, die diese in den letzten Dezennien angenommen hat. Die Vorgänge, in denen der Mensch eine Rolle spielt, sind ihm nur ein kleines Glied innerhalb des großen Schauspiels, dessen Schauplatz der Kosmos ist. Das Leben des Kosmos in künstlerischer Weise gruppiert, kombiniert, durch die auf Grund der Naturgesetze arbeitende Phantasie belebt, will er rhearralisch darstellen. Innerhalb dieses großen Ganzen soll der Mensch mir seinen Schicksalen erscheinen, nicht ausgesondert für sich. Wie ein Stern entsteht, wie sich auf dem Sterne das unorganische Reich entfaltet, wie sich aus diesem das Pflanzen- und Tierleben entwickelt, wie auf dessen Grundlage der Mensch ins Dasein tritt und von ihm abhängig ist: das will Meyer künstlerisch veranschaulichen. Das ist eine löbliche, eine schöne Aufgabe. Er hat dafür büßen müssen. Seine Kollegen bei der «Urania» haben ihn aus dem Institute hinausgedrängelt, weil ihnen sein Wirken zu wenig wissenschaftlich, zu populär war. Er hat nicht genug langweilige Vorträge gehalten. Er wollte die Wissenschaft zur Kunst erheben und durch die Phantasie auf das Fassungsvermögen wirken. So etwas ist unerhört in deutschen Landen...
Soweit hat Meyer unsere Sympathien. Aber sein Aufsatz hat mir gezeigt, daß er an dem Fehler all der Bekenner moderner naturwissenschaftlicher Weltanschauung krankt. Er verkennt, daß alles außer dem Menschenleben doch minder bedeutend ist als
dieses. Er bildet sich ein, daß der Mensch ein Körnchen im Weltall nur ist und daß es ein kindliches Vorurteil genannt werden muß, wenn man den Menschen als Endglied und Ziel alles Daseins betrachtet. Die modernen Aufklärer nennen solchen Standpunkt anrhropozenrrisch und glauben ungeheuer viel getan zu haben, wenn sie erklären, daß das Weltall unendiich viel größer ist als der kleine Mensch. Wir stehen nicht auf diesem Standpunkte. Wir sind Anhänger des naturwissenschaftlichen Bekenntnisses im modernsten Sinne. Aber so wenig wir an die Vorsehung im christlichen Sinne glauben, so sehr glauben wir daran, daß doch im kleinsten Menschenschicksal ein unendlich Erhabeneres liegt als im Kreislauf von Millionen Sonnen. Und deshalb möchten wir das Theater der Naturschauspiele nicht überschätzen, es namentlich nicht als eine wichtigere Sache hinstellen als die Darstellung menschlicher Leiden und Freuden. Daß der Mensch sich erkennt, sich würdigt und sich seiner Bestimmung bewußt wird:
das ist doch das Wichtigste auf dieser Erde. Und das Theater der Narurschauspiele wird auch wenn seine Urheber es nicht wollen -. zuletzt den Menschen zur Erkenntnis des Menschen führen, das heißt ihm zeigen, daß der ganze Kosmos nur seinetwillen da ist. Wenn er Einblick in die Erscheinungen und Vorgänge gewinnt, die seinem Leben vorhergingen, innerhalb welcher er steht, wird er seine einzige Stellung in der Welt richtig beurteilen, wird er zwar nicht mehr glauben, daß Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, ihn von sündiger Schmach zu befreien, wird er aber einsehen, daß unzählige Himmel da sind, um ihn zuletzt hervorzubringen und ihn sein Dasein genießen zu lassen.
#TI
M. LAZARUS . DAS LEBEN DER SEELE
In Monographien über seine Erscheinungen und Gesetze
1. Auflage, Berlin 1856; 3. Auflage, 188397, 3 Bände
Am 28. Mai feiert M. Lazarus sein 25jähriges Jubiläum als Professor an der Berliner Universität. Seine Schüler werden an diesem Tage gewiß ihres Lehrers gedenken. Man braucht aber nicht sein
Schüler zu sein, um diesen seinen Jubiläumstag mirzufeiern. Denn Lazarus «Leben der Seele» ist ein Buch, das jeder gelesen haben muß, der auf Bildung Anspruch machen will. Weite Perspektiven, große Horizonte sind in diesem Buche allerdings nicht zu finden. Aber der feine Beobachrungssinn und die eindringliche Darstellungsgabe, die in ihm so wunderbar anmutig sind, wirken wie eine dramatische Spannung. Man wird gutmütig, wenn man das Buch liest. Die breite Behaglichkeit, in der es geschrieben ist, tut dazu das Ihrige. Es wird wenige Bücher geben, bei denen man so wenig in Aufregung kommt wie bei diesem und bei denen zugleich so viel wirkliche Seelenerkennris in uns übergeht. Man nennt Lazarus auch den Begründer der Völkerpsychologie. Diese Wissenschaft ist noch zu problematisch, um beim 25jährigen Professorenjubiläum des Begründers über sie etwas sagen zu dürfen.
KARL JENTSCH. SOZIALAUSLESE
Leipzig 1898
Unter diesem Titel hat soeben Karl Jenrsch ein Buch veröffentlicht. Die Anwendung der naturwissenschaftlichen Denkweise unserer Zeit auf den Enrwickelungsgang der Menschheit führt zu diesem Begriff. Wie in der übrigen Natur diejenigen Formen sich erhalten, die sich im Kampfe ums Dasein als die stärkeren erweisen, so ist das auch in der geschichtlichen Entwickelung des Menschen der Fall. Durch Anwendung dieses Begriffes gelangt man zur Überwindung aller Zweckursachen. In der Natur werden heute wohl nur zurückgebliebene Geister an Zweckursachen glauben. In den Anschauungen über menschliche Entwickelung aber scheint diese Vorstellung weniger leicht zu vertilgen zu sein. Das zeigt sich am klarsten bei dem Autor des genannten Buches. Während andere, wie zum Beispiel Huxley, Alexander Tille und so weiter, den Fortgang der Menschheit ganz analog dem übrigen Naturwirken im Sinne des Darwinismus auffassen, glaubt Jenrsch
nicht ohne die Annahme einer zweckmäßigen Einrichtung der geschichtlichen Tatsachen auszukommen. Man muß aber festhalten: Wer eine zweckmäßige Einrichtung in der Natur oder Menschenwelt annimmt, muß auch an einen weisen Schöpfer dieser Einrichtung glauben. Und wer dies tut, fällt zurück in alte theologische Vorurteile, die durch die darwinisrische Weltauffassung überwunden sein sollten. Aber es wird noch lange dauern, bis die Reste der alten theologischen Vorstellungen aus den Köpfen der Menschen verschwunden sein werden. In dieser oder jener Form werden sie immer noch spuken.
DIE ZULASSUNG DER FRAUEN ZUM MEDIZINISCHEN STUDIUM
In diesen Tagen haben die Teilnehmer des Ärztetages in Wiesbaden beschlossen, erst dann für die Zulassung der Frauen zum medizinischen Studium zu stimmen, wenn sich auch die andern Fakultäten entschließen, weibliche Kräfte in ihren Schoß aufzunehmen. Also die Medizinmänner sind der Ansicht, daß es weibliche Ärzte erst geben soll, wenn es auch weibliche Richter, Rechtsanwälte und Pastoren gibt. Nun ist das ja zu naiv, als daß man recht daran glauben möchte, daß eine Versammlung ernster Männer zu einem solchen Entschluß kommt. Es gibt einen alten Satz, den gewiß alle die auch kennen, die an der in Rede stehenden Beschlußfassung teilgenommen haben, und der diesen Teilnehmern nur in der Wiesbadener Luft aus dem Gedächtnisse entschwunden zu sein scheint. Dieser Satz heißt: Alles schickt sich nicht für alle. Ich kann mir Leute vorstellen, die es ganz gut fänden, wenn Frauen zum Beispiel Frauenärzte wären, denen aber doch ein weiblicher Pastor, auf der Kanzel predigend, als komische Figur erschiene. Aber so etwas ist einfach; und so einfache Dinge sind wohl den gelehrten Herren in Wiesbaden nicht eingefallen.
DIE AUFSTELLUNG VON NATURFORSCHER-BÜSTEN AUF DER POTSDAMER BRÜCKE
In Berlin ärgern sich die Lokalpatrioten. Die Stadtväter haben beschlossen, auf der neuerrichteten Potsdamer Brücke Denkmäler von vier Naturforschern aufzustellen. Gauß, Werner Siemens, Helmholrz und Röntgen sollen wir in Zukunft erblicken, wenn wir nicht mehr nötig haben werden, uns durch das wüste Gerölle und Geschürt, das gegenwärtig die Potsdamer Straße in zwei Teile teilt, durchzuarbeiren. Nun steht es zwar fest, daß unser Zeitalter das der Naturwissenschaften und der technischen Fortschritte ist, aber einige Menschen möchten doch, daß das spezifische Berlinertum betont werden solle, wenn eine Brücke doch wohl mir Hilfe der modernen Technik und nicht mir dern spezifischen Berlinertum gebaut wird. Solche Menschen schimpfen jetzt über die Stadtväter, die dern Geiste der Naturwissenschaft huldigen und Gauß, den Braunschweiger, Siemens, den Hannoveraner, Helmholtz, den Brandenburger, und Röntgen, den Rheinländer, auf der Potsdamer Brücke aufstellen. Kein einziger Urberliner darunter, sagen die Leute. Röntgen komme nur deshalb hin, weil er bei Hof beliebt ist. Nun, ich wünschte, daß man nur Menschen Anerkennung brächte, die es ebenso verdienen, bei Hofe beliebt zu sein wie Röntgen. Wenn man mir dem Beschluß, den genialen Entdecker der Röntgenstrahlen auf die Potsdamer Brücke hinzustellen, dem Hofe einen Dienst hat erweisen wollen, so möchte ich nur, daß man durch die Unrerränigkeir dem Bedürfnisse der Zeit immer so entgegenkäme wie in diesem Falle.
KÜNSTLERBILDUNG
Vor einigen Tagen hatte ich einen Traum. Ich träumte von einem Leitartikel der «Zukunft». Ich las ganz deutlich in einer Auseinandersetzung, die über die Berechtigung des Bundes der Landwirte, über Stirner, Nierzsche und das monarchische Gefühl handelte, einen Satz über Kant. Ich traute meinen Augen nicht, aber
in diesem Satze stand wörtlich: «die Kategorie des Imperativs». Ich war im Traume sehr verwundert, denn solche Blößen gibt sich doch Maximilian Harden nicht. Er hat zwar einmal einen Satz in einem Leitartikel der «Zukunft» geschrieben, in dern er zeigte, daß er von Kants «Kategorischem Imperativ» keinen rechten Begriff hat; aber daß er gar «Die Kategorie des Imperativs» schreibt statt «Der kategorische Imperativ»: das versetzte mich selbst im Traume in Verwunderung. Ich wachte auf, rieb mir die Augen und sagte mir: o du Träumer, das kam wieder von solch einem Ärger über die Schriftstellerei. Du ärgerst dich so furchtbar über den vielen Unsinn, der dir täglich durch die «Ritter der Feder» vor Augen tritt, daß dich der Ärger im Schlafe verfolgt. Aber meine Träume übertreiben. Es ist nicht wahr, daß jemals in einem Leitartikel der «Zukunft» «Die Kategorie des Imperativs» zu lesen war.
Sie werden wohl recht haben, meine Träume. Denn Alfred, mein Kerr, hat mir einmal gesagt: ich wolle nicht so recht ins Zeug gehen und nach Herzenslust schimpfen. Der verbissene Groll wird es wohl sein, der mich im Schlafe als Alpdrücken verfolgt.
Ich kleidete mich an, trank Kaffee, und dann mußte ich mir aus einem Geschäfte der Potsdamer Straße etwas holen. Ich sah zum ersten Male die beiden plastischen «Kunstwerke», die auf der Potsdamer Brücke aufgestellt sind. Ein biederer, jovialer Mann sitzt da, mir milden Zügen. Ich könnte ihn für einen braven Werkmeister einer Fabrik halten, in der Kabeltaue und elektrische Apparate hergestellt werden. Es soll Werner Siemens, der größte Elektrotechniker, sein. Da ich nicht ausgegangen war, die Geheimnisse der plastischen Kunst zu studieren, so ging ich vorüber, nicht sonderlich unbefriedigt, sie nicht gefunden zu haben. C. Moser hat das Denkmal gemacht.
Ich gelangte ans andere Ende der Brücke. Da sitzt ein anderer Mann. Ein Schulmeister, der eben nachdenkt, wie er den Kindern das ABC beibringen soll. Doch nein es soll Hermann Helmholtz sein. Ich habe immer geglaubt: der plasrische Künstler soll mir den äußeren Zügen eines Mannes auch dessen Bedeutung der
Nachwelt überliefern. Und bei Helmholrz scheint mir das so gar schwierig nicht zu sein. Wer sich in seine Schriften vertieft, wird eine scharf umrissene Vorstellung von der Persönlichkeit dieses Mannes erhalten. Und wer diese Vorstellung vergleicht mir den Zügen seines Gesichtes, wird den Einklang der körperlichen und der geistigen Physiognomie erkennen, die bei ihm so auffällig war. Und Helmholrz hat ja auch Lebenserinnerungen geschrieben. Wer ihn je gesehen hat, muß bei jeder Zeile an die äußere Erscheinung des Forschers denken. Der Mann, der, von Max Klein gebildet, das eine Ende der Potsdamer Brücke zieren soll, erinnert in keinem Zuge an den Schreiber dieser Erinnerungen.
Aber noch mehr. Hermann Helmholrz ist wie wenige Forscher Typus innerhalb einer gewissen naturwissenschaftlichen Richtung der Gegenwart. Er ist nicht ein Genie wie sein großer Lehrer Johannes Müller. Er hat zu den Entdeckungen und Erfindungen, die sich an seinen Namen knüpfen, nichr den ersten Anstoß gegeben. Wer mir das nicht glauben will, der lese darüber in den erwähnten Erinnerungen. Er hat mit großem Scharfblick und durch unermüdliche Arbeit die Konsequenzen aus den Leistungen seiner Vorgänger gezogen. Aus vielem möchte ich die Erfindung des Augenspiegels herausheben. Als Helmholrz an die Untersuchungen ging, die ihn zu dieser Erfindung führten, waren die von den Vorgängern geleisteten Arbeiten so weit gediehen, daß es nur einer Kleinigkeit bedurfte, um das wichtige Instrument zu konstruieren, eines letzten Schrittes auf einem Wege, der genau vorgezeichnet war. Und ebenso war es auf den anderen Gebieten, auf denen Helmholrz arbeitete. Er lebte in einer Zeit, die reif war zu ganz bestimmten naturwissenschaftlichen Entdeckungen, weil die Vorarbeiten zu ihnen in überreicher Fülle da waren. Diese Zeit forderte exakte wissenschaftliche Arbeiter, die durch scharfsinnig konstruierte Werkzeuge, durch sorgfältige Laboratoriumsarbeit, durch unermüdliches Experimentieren die wissenschaftlichen Ideen einer vorangegangenen Zeit im einzelnen durchführren. Johannes Müller, Purkinje und andere haben in der ersten Hälfte des Jahrhunderts leitende Ideen angegeben; Helmholtz, Brücke, Ludwig, Du Bois-Reymond sind von den übernommenen
Gesichtspunkten aus zu epochemachenden Einzelenrdeckungen gekommen. Der Scharfblick für die Einzelheiten des Narurwirkens, für experimentelle Forschung, für unermüdliche Beobachtung sind die Eigenheiten des Typus eines Narurforschers, den Helmholrz darstellt. Will man sich diesen Typus an seinem Gegensatz klarmachen, so braucht man sich nur an Ernst Haeckel zu erinnern. Dieser ist ganz anders als die zu der genannten Gruppe Gehörigen. Auch er hat die Konsequenzen eines großen Vorgängers gezogen. Aber er ist nicht nur im einzelnen über Charles Darwin hinausgegangen. Er hat ein Gebäude aufgeführt, zu dern sein Vorgänger den Unrerbau geliefert hat; Helmholtz und die anderen Genannten haben die Einrichtungsstücke zu einem fertigen, aber allerdings im Innern noch leeren Gebäude geliefert. Diese typische Bedeutung Helmholrzens müßte die bildliche Darstellung seiner Gestalt veranschaulichen.
Aber dazu härte allerdings der Künstler, dern eine solche Aufgabe zugefallen ist, die wissenschaftliche Eigenart und Bedeutung Helmholrzens aus seinen Werken studieren müssen. Ich bin so naiv zu glauben, daß dies jeder Künstler tut, bevor er einen Mann im Bilde darstellt. Das Helmholrz-Denkmal auf der Berliner Potsdamer Brücke hat mich allerdings vom Gegenteile überzeugt.
Da lagen zu Füßen des Forschers Bücher, obenauf ein Buch, auf dessen Rücken stand o Physiker, wendet rasch das Auge weg, bevor es zu sehr beleidigt wird : «Die Physiologie der Optik.» Der bildende Künstler ist also nicht einmal bis zum Titel-blatte ja nicht einmal bis zum Rücken eines gebundenen Exemplars von Helmholrzens «Physiologischer Optik» vorgedrungen.
Was mir mein Traum von einem Schriftsteller nur vorgegaukelt hat: ein bildender Künstler hat es in Wirklichkeit umgesetzt. Denn statt «Physiologische Optik> zu sagen «Die Physiologie der Optik» ist gerade so, als wenn man statt «Kategorischer Imperativ» sagte «Die Kategorie des Imperativs». Aber so etwas macht nicht einmal ein Leirarrikler. Wir Schriftsteller sind doch bessere Menschen.
Aber «Die Physiologie der Optik» ist nicht das einzige, was laut schreiend die «Bildung» eines bildenden Künstlers charakterisiert
. Unter dieser «Physiologie der Optik» liegt noch ein anderes Buch. Dieses ist etwa vier Zentimeter dick. Auf seinem Rücken steht: «Die Erhaltung der Kraft.» Nun hat Helmholtz über diesen die moderne Physik beherrschenden Begriff eine nur wenige Seiten starke Abhandlung geschrieben. Herr Max Klein hat zwar die vorhandenen Werke Helmholrzens keines Blickes gewürdigt, er hat aber dafür im Geiste ein nicht vorhandenes gesehen.
Die Gelehrten der Berliner Zeitungen haben die Sünde wider den Geist jeglicher Bildung gerügt; und deshalb ist der eine der Fehler gutgemacht worden. Ich weiß nicht, ob die Worte, die ein paar Tage hindurch zum Ärger vorübergehender gebildeter Leute am Helmholrz-Denkmal zu lesen waren, um die Schande zu verbergen, bei nachtschlafender Zeit in die richtige Lesart verwandelt worden sind. Heute lesen wir allerdings das korrigierte: «Die physiologische Optik.» Dagegen wird sich ein wohlwollender Korrektor wegen des zweiten «Versehens» schon noch einmal bemühen müssen. Dunner wird ja dieses zweite Buch nicht zu machen sein; aber man kann doch einen besseren Zeitungsleser fragen, und der wird raten, auf dieses Werk zu setzen: «Tonempfindungen», denn daß Helmholrz eine «Lehre von den Tonempfindungen» geschrieben hat, weiß eben ein besserer Zeitungsleser.
Wer mich einen kleinlichen Nörgler nennt, weil ich dies schreibe, dem entgegne ich: Es ist mir im Grunde ganz einerlei, was auf den Denkmälern der Potsdamer Brücke steht, aber mir erscheint die Sache wie ein betrübendes Symptom. Wie muß es mir der «Bildung» bildender Künstler beschaffen sein, denen solche «Versehen» passieren? Und welches Bild kann ein Künstler der Nachwelt von einem Manne überliefern, den er so kennt, wie der Schöpfer des Helmholrz-Denkmals dessen Schriften?
Man höre ihnen nur einmal zu, den bildenden Künstlern, wenn sie sich über die Auslassungen, die Schriftsteller über ihre Werke machen, belustigen. Und man tröste sich, wenn man Schriftsteller ist und über die Potsdamer Brücke in Berlin geht, damit, daß wohl kaum ein «Schreibender» über einen «Bildenden» einen ähnlichen Unsinn schreiben wird, wie ein «Bildender» hier über
einen «Schreibenden» gebildet hat. Ja, ja, wir Schreibenden sind doch bessere Menschen, und keinem von uns kann es passieren, daß er bei noch so gründlicher Unkenntnis von Kanrs philosophischen Anschauungen statt «Kategorischer Imperativ » schreibt «Die Kategorie des Imperativs». So etwas kann uns nur ein böser, boshafter Traum vorgaukeln.
DIE SIEBZIGSTE VERSAMMLUNG DEUTSCHER NATURFORSCHER UND ÄRZTE
Die siebzigste Versamanlung deutscher Naturforscher und Ärzte wird in der Zeit vom 19. bis 24. September in Düsseldorf statt-finden. Die Themen der angekündigten Vorträge sind vielversprechend. Es werden sprechen: Professor Dr. Klein (Göttingen) über: «Universität und technische Hochschule>, Professor Dr. Tillmanns (Leipzig> über: «Hundert Jahre Chirurgie», Professor Dr. Martius (Rostock) über: «Krankheitsursachen und Krankheitsaalagen>, Professor van t'Hoff (Berlin> über: «Die zunehmende Bedeutung der anorganischen Chemie». Neben anderen Vorträgen hat auch noch Professor Virchow einen Vortrag über ein später zu bestimmendes Thema zugesagt. Außer den schon bestehenden Sektionen soll eine neue für angewandte Mathematik und Ingenieurwissenschaften sowie eine solche für Geschichte der Medizin errichtet werden. Mit der Versammlung sollen vier Ausstellungen verbunden sein: 1. eine historische, 2. eine solche, welche die Photogiaphie im Dienste der Wissenschaft darstellt, 3. eine solche von naturwissenschaftlichen, medizinisch - chirurgischen, pharmazeutischen und hygienischen Apparaten, Präparaten und so weiter, und 4. eine physikalische und chemische Lehrmittelausstellung. Mit dieser Naturforscherversammlung - heute darf nirgends ein moderner Zug fehlen - wird ein Kongreß alkoholfeindlicher Ärzte verbunden sein.
*
In den Bemerkungen, die in der letzten Nummer dieser Zeitschrift über die siebzigste Versanunlung deutscher Naturforscher und Ärzte enthalten waren, ist des Vortrags gedacht worden, den Professor J. Baumann über den Bildungswert von Gymnasien und Realgymnasien und über die Bedeutung des naturwissenschaftlichen Unterrichts gehalten hat. Eine schöne Ergänzung zu den Ausführungen Baumanns lieferte ein anderer Redner dieser Versammlung: Professor Pietzker (Nordhausen). Er sprach sich darüber aus, wie der naturwissenschaftliche Unterricht nach seiner Meinung eingerichtet werden müsse, wenn er den Erfordernissen des modernen Geisteslebens entsprechen soll. Es ist vor allen Dingen eine Durchdringung des Wissensstoffes mit philosophischem Geiste notwendig. Nicht nur der klare Blick für die augenfälligen Vorgänge, sondern auch das Denken über diese Vorgänge soll gepflegt werden. Es ist erfreulich, daß sich wieder Stimmen vernehmen lassen, die dem Nachdenken zu seinem Rechte verhelfen wollen, nachdem es fast ein halbes Jahrhundert hindurch von seiten der Naturforscher mit dem Bann belegt und dafür die gedankenlose Beobachtung gehätschelt worden ist.
*
PREISAUFGABE DER BERLINER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
Die Berliner Akademie der Wissenschaften hat eine Preisaufgabe gestellt: «Darstellung des Systems von Leibniz, welche in eindringender Analyse der Grundgedanken und ihres Zusammenhanges sowie in der Verfolgung ihrer Quellen und allmählichen Entwicklung über die bisherigen Darstellungen wesentlich hinausgeht usw.> - heißt das Thema. Der brave Mann, der dieses «zeitgemäße> Thema zur Zufriedenheit der Herren von der Berliner Akademie lösen wird, soll 5000 Mark erhalten. Von vornherein erkläre ich: vor gelehrten Arbeiten habe ich allen schuldigen Respekt; wenn aber eine solche Körperschaft heute 5000 Mark übrig hat für die Darstellung eines Gedankensystems, das uns gar nichts mehr angeht, so kann ich doch nicht umhin, meine Verwunderung
darüber auszudrücken. Wenn auch Leibniz der Stifter der Berliner Akademie ist: heute für sein Gedankensystem einen Preis auszuschreiben, würde er selbst nicht billigen. Wir haben wahrhaft Wichtigeres zu tun. Unsere gegenwärtige Wissenschaft stellt uns notwendige Probleme. Und die Berliner Akademie findet es angemessen, einen Preis auszuschreiben für ein Thema, das man einem Liebhaber ganz gut überlassen könnte. Die Lösung dieser Frage käme noch immer im rechten Moment. Wann wird doch die Zeit kommen, in der auch die gelehrten Körperschaften lernen werden, ihre Kräfte in den Dienst der Zeit zu stellen?
*
«Huxley-Vorlesung» von Virchow in London
Am 3. Oktober hielt Virchow in London die Huxley-Vorlesung zur Eröffnung des Wintersemesters der medizinischen Schule des Charing-Croß-Hospitals. Er charakterisierte Huxley als den Mann, der die Konsequenzen der Darwinschen Lehre als kühner Denker gezogen und deren Gesichtspunkte für weite Gebiete der Forschung fruchtbar gemacht hat.
C. A. FRIEDRICH. DIE WELTANSCHAUUNG EINES MODERNEN CHRISTEN
Leipzig 1897
Menschen, die mit ihren Empfindungen, mit ihrem Gemütsleben hinter den Erkenntnissen zurückbleiben, die ihnen die fortschreitende Wissenschaft und Erfahrung aufdrängen, wird es irarner geben. Was sich des Herzens bemächtigt hat, das ist durch vernünftige Einsicht nicht so leicht zu widerlegen. Alles, was über den Kampf zwischen Glauben und Wissen gesagt wird, läßt sich zuletzt auf den Gegensatz zurückführen, der besteht zwischen den
traditionellen Mächten, die sich im Gemüte eingenistet haben, und den Ideen und Begriffen, denen sich die Vernunft nicht verschließen kann. Starke Naturen werden diesen Kampf nicht empfinden. Sie bleiben entweder den gewohnheitsmäßigen Vorstellungen, die sie von den Vätern ererbt haben, treu und lehnen alle neuen Einsichten ab, oder sie segeln mit voller Kraft in das Neue hinein und reißen ihr Herz los von dem Hergebrachten. Schwache Naturen dagegen schwanken zwischen Altem und Neuem unsicher hin und her. Von jenem können sie nicht lassen; dieses können sie nicht von sich weisen. Sie sind es dann, welche die Versöhnung von Glauben und Wissen, von Religion und Erkenntnis, zum Gegenstande ihrer Betrachtung machen. Eine starke Natur war der österreichische Erzbischof, der einst gesagt hat: «Die Kirche kennt keinen Fortschritt.> Eine starke Natur ist Ernst Haeckel, der einfach den Inhalt der modernen Natureinsicht an die Stelle der alten Religion setzt. Eine schwache Persönlichkeit dagegen ist der Verfasser der obengenannten Schrift. Er hat die höchste Achtung vor der modernen Erkenntnis. Er möchte, daß diese Erkenntnis so fruchtbar als möglich wirke. Aber alles, was er über die modernen Anschauungen sagt, ist ven christlichreligiösen Empfindungen miteingegeben. Christliches Fühlen und modernes Denken sucht er miteinander zu versöhnen. Der Wunsch ist bei ihm der Vater des Gedankens. Er wünscht, daß dem modernen Wissen die weiteste Verbreitung werde, und er wünscht auch, daß die Menschen christlich fühlen. Seine Vorstellungen formen sich nach seinen Wünschen. Er liefert den «Beweis», daß der Mensch um so christlicher werden wird, je moderner er wird. Für denjenigen, der die modernen Einsichten bereits in sein Fühlen, in sein Herz aufgenommen hat, sind Friedrichs «Beweise» durchaus keine Beweise. Er braucht auch solche Beweise nicht. Denn ihm ist klar, daß sich mit der modernen Weltanschauung vollkommen leben läßt, wenn man sich nur in sie eingelebt hat. Alle Wärme der Empfindung, allen Enthusiasmus bringt er den Vorstellungen dieser Weltanschauung entgegen, wie sie unsere Vorfahren den christlichen Ideen entgegengebracht haben. Aber der Verfasser des Buches «Weltanschauung eines modernen Christen»
hat für die alten Vorstellungen Wärme des Herzens, für die modernen Anschauungen Kälte des Verstandes. Vergebens sucht er aus den neuen Einsichten deshalb die Gefühle herauszupressen, die sich aus der christlichen Theologie ergeben haben. Durch eine strenge, sympathische Gesinnung, die aus dem Buche spricht, wird es manchem interessant sein, der sich mit den Fragen zu beschäftigen geneigt ist, die der Verfasser zu beantworten sucht. Allerdings wird für viele diese neuere Art von Pietismus und Gefühlsduselei auch langweilig sein. Der Psychologe wird das Buch beiücksichtigen müssen. Der Verfasser ist als Typus für eine große Anzahl von Menschen zu betrachten. Sie streben alle nach einer Aussöhnung zweier geistiger Gebiete, die nicht auf die Dauer nebeneinander bestehen können, zwischen denen es nur einen Waffenstillstand, aber keinen Friedensschluß geben kann.
ROBERT ZIMMERMANN. Gestorben am 1. September 1898
Am 1. September ist der Philosoph Robert Zimmermann gestorben. Er hat durch mehr als dreißig Jahre an der Wiener Universität Philosophie gelehrt. In seinen Anschauungen war er ein orthodoxer Schüler Herbarths. Seit dem Jahre 1884 hat er in einer stattlichen Anzahl von Schriften die Lehre dieses Philosophen weitergebaut. Die Ästhetik war sein Lieblingsgebiet. Er hat eine Geschichte dieser Wissenschaft geschrieben und seinen eigenen Standpunkt auf diesem Gebiete in einem Buche dargelegt.
ERNST HAECKEL. DIE KUNSTFORMEN DER NATUR
Leipzig 1899
Ernst Haeckel hat es unternommen, die unerschöpfliche Fülle wunderbarer Gestalten, welche die Natur ihren organischen Schöpfungen verleiht und «durch deren Schönheit und Mannigfaltigkeit
alle vom Menschen geschaffenen Kunstformen weitaus übertroffen werden>, in einem Werke darzustellen, dessen erste Lieferung vorliegt. «Die Kunstformen der Natur» ist der Titel des Werkes, das zunächst fünf Lieferungen mit fünfzig Tafeln umfassen (das Heft zu zehn Tafeln) und das im Falle einer günstigen Aufnahme um zehn weitere Hefte vermehrt werden soll. Nach Vollendung von zehn Heften will Haeckel eine allgemeine Einleitung zu dem Werke geben, welche die systematische Ordnung sämtlicher Formengruppen enthält. Das erste Heft des interessanten Werkes begleitet Haeckel mit einem Vorworte, dem wir folgende Worte entnehmen: «Seit frühester Jugend von dem Formenreize der lebenden Wesen gefesselt und seit einem halben Jahrhunderte mit Vorliebe morphologische Studien pflegend, war ich nicht nur bemüht, die Gesetze ihrer Gestaltung und Entwicklung zu erkennen, sondern auch zeichnend und malend tiefer in das Geheimnis ihrer Schönheit einzudringen. Auf zahlreichen Reisen, die sich über einen Zeitraum von fünfundvierzig Jahren erstrecken, habe ich alle Länder und Küsten Europas kennengelernt und auch an den interessantesten Gestaden des nördlichen Afrika und des südlichen Asien längere Zeit gearbeitet. Tausende von Figuren, die ich auf diesen wissenschaftlichen Reisen nach der Natur gezeichnet habe, sind bereits in meinen größeren Monographien publiziert; einen anderen Teil will ich bei dieser Gelegenheit veröffentlichen. Außerdem werde ich bemüht sein, aus der umfangreichen Literatur die schönsten und ästhetisch wertvollsten Formen zusammenzustellen. »
#TI
PAUL NIKOLAUS COSSMANN. ELEMENTE DER EMPIRISCHEN TELEOLOGIE
Stuttgart 1899
Dieses Buch ist eine der in unserer Zeit leider gar nicht seltenen literarischen Erscheinungen, deren Verfasser einen großen Teil der Schuld an der bedauerlichen Tatsache tragen, daß die Philosophie
immer mehr in Mißkredit kommt. Eine selbstverständliche, von keinem Vernünftigen angezweifelte Wahrheit wird mit behaglicher Breite auf 129 Seiten abgehandelt. Etwas, was vor aller Augen liegt, wird in abstrakteste Formeln gekleidet, und dabei passiert dem Autor das Unglück, daß er in der Welt seiner Abstraktionen den sicheren Boden unter den Füßen verliert, und daß er gar nicht ahnt, daß mit seinen «Formulierungen» gar nichts gesagt ist. Fr will zeigen, daß es in der Natur, in der alles nach Ursache und Wirkung zusammenhängt, auch Erscheinungen gibt, die noch in anderen Zusammenhängen stehen. Ursache und Wirkung bilden einen zweigliedrigen Zusammenhang. Coßmann sucht innerhalb der Welt des Lebens dreigliedrige Zusammenhänge darzutun. Das Netzhautbild des Auges entsteht als Wirkung eines Lichtreizes auf den augbegabten Organismus. Wir haben einen zweigliedrigen Zusammenhang. Der Lichtreiz wirkt auf den Organismus, und das Augenlid wird geschlossen zum Schutz gegen den Reiz. Wir haben einen dreigliedrigen Zusammenhang, einen solchen zwischen der Ursache - dem Lichtreiz - der Wirkung -dem Lidschluß - und dem Zweck, dem Schutz des Organs. Zweigliedrige Zusammenhänge sollen kausal, dreigliedrige teleologisch zweckmäßig genannt werden. Der Naturforschung der Gegenwart wird der Vorwurf gemacht, daß sie alles aus den Zusammen-hängen von Ursachen und Wirkungen erklären will; und von der Naturforschung der Zukunft wird erträumt, daß sie die Teleologie in ihrer Herrlichkeit zur Geltung bringen werde. Was Herr Coßmann auf seinen 129 Seiten breit auseinandersetzt, findet sich in folgenden acht Zeilen des Buches «Die Welträtsel> von Ernst Haeckel, den unser Verfasser gewiß zu denjenigen rechnet, die teleologische Zusammenhänge übersehen: «Im Körperbau und in der Lebenstätigkeit aller Organismen tritt uns die Zwecktätigkeit unleugbar entgegen. Jede Pflanze und jedes Tier erscheinen in der Zusammensetzung aus einzelnen Teilen ebenso für einen bestImmten Lebenszweck eingerichtet wie die künstlichen, vom Merschen erfundenen und konstruierten Maschinen, und solange ihr Leben fortdauert, ist auch die Funktion der einzelnen Organe ebenso auf bestimmte Zwecke gerichtet wie die Arbeit in den einzelnen
Teilen der Maschine.» Coßmann tut weiter nichts, als diese anleugbare Tatsache in unsäglich pedantische Formeln bringen. Gegen solche philosophische Spielerei braucht man nichts einzuwenden. Mit ihr sollen sich diejenigen beschäftigen, die nichts Vernünftigeres in der Welt zu tun finden. Wenn aber Herr Coßmann glaubt, daß die organische Naturwissenschaft die Teleologie in sich aufnehmen soll, so muß ihrn gesagt werden, daß er das Verhältnis der modernen Naturwissenschaft zu der Teleologie nicht versteht. Eine Lokomotive ist zweifellos zweckrnäßig gebaut, und Herr Coßmann könnte ihre Wirksamkeit auf seine nette dreigliedrige Formel zurückführen. Demjenigen, der die Lokomotive bauen soll, ist aber nicht damit gedient, wenn man ihm den Zweck reinlich beschreibt. Er muß die Ursachen kennen, durch die der Zweck erreicht wird. So empfindet der Naturforscher der Natur gegenüber. Er stellt die Zwecke fest; aber er sucht dann die zweckruäßigen Wirkungen aus den Ursachen zu erklären. So wenig eine Maschine nach ihrem Zwecke gebaut werden kann, so wenig kann ein Lebewesen aus seiner zweckmäßigen Einrichtung heraus erklärt werden.
Aber Herrn Coßmann trifft noch ein schwererer Vorwurf. Der Zweck tritt in der Zeitfolge nach der Ursache auf. Wenn wir nun von der Zeit absehen und bloß in Betracht ziehen, daß ein notwendiger Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung besteht, dann können wir jede Ursache auch ebensogut aus ihrer Wirkung ableiten wie umgekehrt die Wirkung aus der Ursache. Wir brauchen in einer Formel der Mechanik, die eine Wirkung aus der Ursache ableitet, nur die Zeit mit negativem Vorzeichen einzusetzen, dann haben wir die Möglichkeit, das Frühere aus dem Späteren abzuleiten. Erscheint dann das Spätere als Zweck, so wird der ursächliche Zusammenhang ein zweckmäßiger, und man braucht Herrn Coßmanns dreigliedrige Formel nicht. Herr Coßmann hätte nun erst, wenn er wirklich etwas beweisen wollte, eine Aufgabe. Er müßte zeigen, daß einer innerhalb der Mechanik geltenden Tatsache auch eine solche auf teleologischem Gebiete entspricht. Diese Tatsache ist für die Mechanik die, daß wir im Gedanken einen Vorgang uns rückläufig vorstellen können (durch
das negative Vorzeichen vor der Zeit), daß aber in Wirklichkeit dieser Vorgang nicht rückläufig stattfinden kann. In der Teleologie müßte gezeigt werden, daß die Rückwirkung des Zweckes, die wir uns vorstellen können, auch wirklich vorhanden ist. Davor hütet sich Herr Coßmann wohl, denn er müßte dann zu dem einzigen Ausweg kommen, den es für den Zwecktheoretiker gibt, zur Konstatierung der «Weisheit und des Verstandes>, die die Organismen erst so geordnet haben, wie wir sie uns nachher vorstellen. «Ob es außer, neben, über den mit blinder, absichtsloser Notwendigkeit weiterarbeitenden causas efficientibus (Naturkräften) noch besondere Zweckursachen, causae finales, gibt, darüber herrscht Schulstreit und ist Schulstreit möglich; aber daß es in der Natura naturata eine vom Menschen unabhängige, aller seiner Kunst unendlich überlegene Zweckmäßigkeit gibt, darüber nicht», sagt Otto Liebmann in «Gedanken und Tatsachen» (1. Heft, S. 91). Zur Entscheidung über das erstere hat Coßmann nichts, rein gar nichts beigetragen; zur Feststellung des letzteren brauchten wir ihn nicht. Wir haben das Werk eines Dilettanten vor uns, der sich die Allüren eines Philosophen angeeignet hat.
#TI
Dr. HEINRICH v. SCHOELER. KRITIK DER WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNIS
Eine vorurteilslose Weltanschauung. Leipzig 1898
Im Jahre 1865 hat Otto Liebmann in seiner Schrift «Kant und die Epigonen» die Forderung erhoben, wir müssen in der Philosophie zu Kant zurückkehren. In der Erfüllung dieser Forderung sieht er das Heil seiner Wissenschaft. Er hat damit nur der Ansicht der überwiegenden Mehrheit der Philosophen unserer Zeit Ausdruck gegeben. Und auch viele Naturforscher, insofern sich dieselben um philosophische Begriffe noch bekümmern, sehen in der Kantschen Lehre die einzig mögliche Form der Zentralwissen-schaft. Von Philosophen und Naturforschern ausgehend, ist diese
Meinung auch in die weiteren Kreise der Gebildeten, die ein Interesse für Philosophie haben, gedrungen. Damit hat die Kantsche Anschauungsweise die Bedeutung einer treibenden Kraft in unserem wissenschaftlichen Denken erlangt. Ohne je eine Zeile von Kant gelesen oder einen Satz aus seiner Lehre gehört zu haben, sehen viele unserer Zeitgenossen das Weltgeschehen in seiner Art an. Seit einem Jahrhundert wird immer wieder und wieder das stolz klingende Wort ausgesprochen: Kant habe die denkende Menschheit von den Fesseln des philosophischen Dogmatismus befreit, welcher leere Behauptungen über das Wesen der Dinge aufstellte, ohne eine kritische Untersuchung darüber anzustellen, ob der menschliche Geist auch fähig sei, über dieses Wesen etwas schlechthin Gültiges auszumachen. Für viele, welche dies Wort aussprechen, ist aber an die Stelle des alten Dogmas nur ein neues getreten, nämlich das von der unumstößlichen Wahrheit der Kantschen Grundanschauungen. Diese lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen: Ein Ding kann von uns nur wahrgenommen werden, wenn es auf uns einen Eindruck macht, eine Wirkung ausübt. Dann ist es aber immer nur diese Wirkung, die wir wahrnehmen, niemals das Ding an sich. Von dem letzteren können wir uns keinerlei Begriff machen. Die Wirkungen der Dinge auf uns sind unsere Vorstellungen. Was uns von der Welt bekannt ist, sind also nicht die Dinge, sondern unsere Vorstellungen von den Dingen. Die uns gegebene Welt ist nicht eine Welt des Seins, sondern eine Vorstellungs- oder Erscheinungswelt. Die Gesetze, nach denen die Einzelheiten dieser Vorstellungswelt verknüpft sind, können dann natürlich auch nicht die Gesetze der «Dinge an sich» sein, sondern jene unseres subjektiven Organismui Was für uns Erscheinung werden soll, muß sich den Gesetzen unseres Subjektes fügen. Die Dinge können uns nur so erscheinen, wie es unserer Natur gemäß ist. Der Welt, die uns erscheint - und diese allein kennen wir -, schreiben wir selbst die Gesetze von Was Kant mit diesen Anschauungen für die Philosophie gewonnen zu haben glaubte, wird klar, wenn man einen Blick auf die wissenschaftlichen Strömungen wirft, aus denen er herausgewach-sen ist und denen er sich gegenüberstellt. Vor der Kantschen Reform
waren die Lehren der Leibniz-Wolffschen Schule in Deutschland die alleinherrschenden. Die Anhänger dieser Richtung wollten auf dem Wege des rein begrifflichen Denkens zu den Grund-wahrheiten über das Wesen der Dinge kommen. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse galten als die klaren und notwendigen gegenüber den durch sinnliche Erfahrung gewonnenen, die man für verworren und zufällig ansah. Nur durch reine Begriffe glaubte man zu wissenschaftlichen Einsichten in den tieferen Zusammenhang der Weltereignisse, in die Natur der Seele und Gottes, also zu den sogenannten absoluten Wahrheiten zu gelangen. Auch Kant war in seiner vorkritischen Zeit ein Anhänger dieser Schule. Seine ersten Schriften sind ganz in ihrem Sinne gehalten.
Ein Umschwung in seinen Anschauungen trat ein, als er mit den Ausführungen des englischen Philosophen Hume bekannt wurde. Dieser suchte den Nachweis zu führen, daß es andere als Erfahmngserkenntnisse nicht gebe. Wir nehmen den Sonnenstrahl wahr, und hierauf bemerken wir, daß der Stein, auf den ersterer fällt, sich erwärmt hat. Dies nehmen wir immer wieder und wieder wahr und gewöhnen uns daran. Deshalb setzen wir voraus, daß sich der Zusammenhang zwischen Sonnenstrahl und Erwärmung des Steines auch in aller Zukunft in derselben Weise geltend-machen wird. Eine sichere und notwendige Erkenntnis ist damit aber keineswegs gewonnen. Nichts verbürgt uns, daß ein Geschehen, das wir gewohnt sind, in einer bestimmten Weise zu sehen, nicht bei nächster Gelegenheit ganz anders ablaufe. Alle Sätze in unseren Wissenschaften sind nur durch Gewohnheit festgesetzte Ausdrücke für oft bemerkte Zusammenhänge der Dinge. Daher kann es auch über jene Objekte, um die sich die Philosophen bemühen, kein Wissen geben. Es fehlt uns hier die Erfahrung, welche die einzige Quelle unserer Erkenntnis ist. Über diese Dinge muß der Mensch sich mit dem bloßen Glauben begnügen. Will sich die Wissenschaft damit beschäftigen, so artet sie in ein leeres Spiel mit Begriffen ohne Inhalt aus. Diese Sätze gelten, im Sinne Humes, nicht nur von den letzten psychologischen und theologischen Erkenntnissen, sondern schon von den
einfachsten Naturgesetzen, zum Beispiel von dem Satze, daß jede Wirkung eine Ursache haben müsse. Auch dieses Urteil ist nur aus der Erfahmng gewonnen und durch Gewohnheit festgelegt. Als unbedingt gültig und notwendig läßt Hume nur jene Sätze gelten, bei denen das Prädikat irn Grunde schon im Subjekte eingeschlossen ist, wie das nach seiner Ansicht bei den mathematischen Urteilen der Fall ist.
Kant sucht das absolute Wissen dadurch zu retten, daß er es zu einem Bestandteil des menschlichen Geistes macht. Der Mensch ist so organisiert, daß er die Vorgänge in notwendigen Zusammenhängen, zum Beispiel von Ursache und Wirkung, sieht. Alle Dinge müssen, wenn sie dem Menschen erscheinen sollen, in diesen Zusammenhängen erscheinen. Dafür ist aber auch die ganze Erfahrungswelt nur eine Erscheinung, das heißt eine Welt, die an sich sein mag, wie sie will; für uns erscheint sie gemäß der Organisation unseres Geistes. Wie sie an sich ist, können wir nicht wissen. Kant suchte dem menschlichen Wissen seine Notwendigkeit, seine unbedingte Gültigkeit zu retten; deshalb gab er seine Anwendbarkeit auf «Dinge an sich» auf. H. v. Schoeler steht auf Kantschem Boden. Er sucht mit Aufwand von reichem Wissen, mit anerkennenswerter Kenntnis des Details der einzelnen Wissenschaften, den Nachweis zu führen, daß unser Wissen nicht bis zu den Quellen des Seins reicht. Wie Kant sucht auch er nicht in dem Wissen den höchsten Daseinsinhalt des Menschen. Kant hat das Wissen vernichtet, um der. Welt Platz zu machen, die er aus dem kategorischen Imperativ mit Hilfe des Glaubens hervor-zaubert. Schoeler sucht zu zeigen, daß sich unabhängig von allem Wissen in unserer Seele Daseinsziele ergeben, die uns das Leben viel lebenswerter erscheinen lassen als die Betrachtung des «plumpen Mechanismus der Natur> und des «physiologischen Automatismus des Leibes, in dem unsere Begierden wurzeln». «Die Idealität des Gefühlslebens ist das rettende Heilmittel, das unsere körperlichen Organe vor Degeneration bewahrt und unsere Seele gesund erhält und sie in den Stand setzt, alle ihre Kräfte harmonisch zu entfalten, in deren reger Betätigung allein, gleichviel auf welchem Gebiete gemeinnütziger Arbeit, der Zweck der menschenwürdigen
Existenz besteht. Wer den Idealen der Vernunft und den Kulturzielen des Menschentums gelebt hat, der hat gelebt für alle Zeiten; denn mehr als das Wissen gilt das Können -am höchsten steht die Tat.» Dieser Schlußfolgerung braucht kein Anhänger der modernen naturwissenschaftlichen Weltanschauung zu widersprechen. Sie ergibt sich für den, der die moderne Entwickelungstheorie versteht, als eine notwendige Folge diesen H. v. Schoeler würde das nachgewiesen gefunden haben, wenn er zu dem vielen Wissen, das er sich angeeignet hat, auch noch die Kenntnis meiner vor fünf Jahren erschienenen «Philosophie der Freiheit» hinzugefügt hätte. Ich grolle ihm nicht, weil er es nicht getan hat, finde mich aber auch nicht bemüßigt, ihm hier zu sagen, was er besser im Zusammenhange in meinem Buche lesen kann.
DER BRESSA-PREIS
Über den großen «Bressa-Preis», welcher am 7. Januar durch Beschluß der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Turin Herrn Professor Ernst Haeckel verliehen wurde, erfahren wir nachträglich folgendes Nähere: Der Preis (im Betrage von zehntausend Franken) ist von Dr. Caesar Alexander Bressa in Turin im Jahre 1876 gestiftet worden und wird alle vier Jahre verliehen, abwechselnd an italienische und an auswärtige Gelehrte. Der Wortlaut des bezüglichen Statuts besagt: «Dieser Preis wird bestimmt sein, den Gelehrten oder Erfinder beliebiger Nationalität zu belohnen, der im Laufe des Quadrienniums 1895-1898, nach dem Urteile der Akademie der Wissenschaften in Turin, die wichtigste und nützlichste Erfindung gemacht, oder das gediegenste Werk veröffentlicht haben wird auf dem Gebiete der physikalischen und experimentalen Wissenschaften, der Naturgeschichte, der reinen und angewandten Mathematik, der Chemie, der Physiologie und Pathologie, ohne die Geologie, die Geschichte, die Geographie und die Statistik auszuschließen. - Das Werk soll gedruckt sein; man nimmt Handschriften nicht an. - Die Akademie
gibt den Preis dem Forscher, welchen sie für den würdigsten hält, wenn er sich auch nicht beworben hat. » - In dem vorletzten Konkurse wurde der Preis (1892) an den berühmten, leider zu früh verstorbenen Professor Heinrich Hertz in Bonn erteilt für seine epochemachenden Entdeckungen über Elektrizität. Das Werk von Professor Haeckel, welchem diesmal der Preis zufiel, ist nicht (wie irrtümlich in einigen Zeitungen stand) dessen jüngst erschienenes philosophisches Buch über die «Welträtsel», sondern das dreibändige (in den Jahren 1894-1896 erschienene) Werk über die «Systematische Phylogenie; Entwurf eines natürlichen Systems der Organismen auf Grund ihrer Stammesgeschichte». Haeckel hat in diesem Werk alle die Untersuchungen über die natürliche Entwickelung der organischen Welt systematisch geordnet und zusammengefaßt, mit welchen er seit vierzig Jahren - seit dem Erscheinen von Darwins Hauptwerk über die «Entstehung der Arten» - ununterbrochen beschäftigt gewesen ist. Einen kurzen populären Auszug derselben hatte er schon 1868 in seiner «Natürlichen Schöpfungsgeschichte» gegeben, von welcher 1898 die neunte Auflage erschien.
GOETHE UND DIE MEDIZIN
Daß der große Dichter, dem nun auch die Hauptstadt Österreichs ein Denkmal gesetzt hat, zu den Naturwissenschaften ein Verhältnis hatte, welches für den Naturforscher von tiefgehendem Interesse ist, beweist die reiche Literatur, die über dieses Verhältnis existiert. Eine Reihe der bedeutendsten Naturforscher hat sich bemüht, Goethes Bedeutung für ihre Wissenschaft zu schildern. Man braucht nur an die einschlägigen Schriften Virchows («Goethe als Naturforscher und in besonderer Beziehung auf Schiller», 1861), Helmholtz' («Über Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten» und «Goethes Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Ideen», 1892), Haeckels («Goethe, Lamarck und Darwin», 1882), Cohns («Goethe als Botaniker», 1881) zu erinnern, um die
Vorstellung davon lebendig zu machen, welch hoher Wert den naturwissenschaftlichen Arbeiten des Dichters von seiten berufener Fachmänner beigemessen wird. Der Verfasser dieses Aufsatzes hat selbst durch eine Reihe von Arbeiten («Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften» in der Kürschnerschen Goethe-Ausgabe, 1883 bis 1897, und «Goethes Weltanschauung», 1897) die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Ideen Goethes und ihre Stellung innerhalb der wissenschaftlichen Entwickelung des neunzehnten Jahrhunderts darzulegen versucht. Wie man auch im übrigen über diese Bedeutung denken mag: eines scheint nach den genannten Arbeiten außer Zweifel zu sein, daß Goethe mit Recht in einem Rückblicke auf seine naturwissenschaftlichen Bemühungen sagen durfte: «Nicht durch eine außerordentliche Gabe des Geistes, nicht durch eine momentane Inspiration, noch unvermutet und auf einanal, sondern durch ein folgerechtes Bemühen bin ich endlich zu einem so erfreulichen Resultate gelangt.» Nicht bloß Lichtblitze einer genialen Persönlichkeit, sondern die Ergebnisse streng methodischer Arbeit haben wir in Goethes naturwissenschaftlichen Ideen vor uns. Und wenn wir Goethes Bemühungen geschichtlich verfolgen, so springt vor allem in die Augen, wie nahe er in bezug auf die Art seines Arbeitens dem Geiste der modernen naturwissenschaftlichen Methoden steht. Besonders deutlich haben dies die aus Goethes hinterlassenen Papieren herausgegebenen Aufzeichnungen gezeigt (Zweite Abteilung der großen Weimarer Goethe-Ausgabe, Band 6, 7, 9, 10, 11 und 12, herausgegeben von Steiner, Band 8, herausgegeben von Professor v. Bardeleben). Um nur auf eines hinzuweisen, seien die in diesen Papieren enthaltenen Aufzeichnungen Goethes über die Verwandtschaft der Schädelknochen mit den Wirbelknochen erwähnt. Man weiß, daß der Naturphilosoph Lorenz Oken zuerst öffentlich auf diese Verwandtschaft aufmerksam gemacht hat; und wer Goethes naturwissenschaftliche Schriften gelesen hat, dem ist auch bekannt, daß dieser vor Oken mit der entwickelungsgeschichtlich so bedeutsamen Tatsache vertraut war. Ein sicheres Fundament hat dieselbe jedoch erst dutch die im Jahre 1872 veröffentlichten Untersuchungen Carl Gegenbaurs
«Über das Kopfskelett der Selachier» erhalten. Die genannten Aufzeichnungen beweisen nun, daß Goethe nicht plötzlich, durch einen genialen Einfall, wie der Naturforscher Oken, sondern durch eine fortgesetzte methodische Arbeit zu seiner Theorie gelangt ist, und zwar durch eine solche, welche sich schon ganz in der Richtung bewegte, die später Gegenbaur zu seinen wichtigen Resultaten führte (vgl. darüber den Aufsatz Professor Karl v. Bardelebens «Goethe als Anatom» im XIII. Bande des Goethe-Jahrbuches, 1892). Der Dichter Goethe verfuhr viel methodischer als der Naturforscher Oken.
Es ist nun bei Goethe in vielen Fällen zu beobachten, daß eine scheinbar nebensächliche Bemerkung in seinen Schriften im eminentesten Sinne aufklärend wirkt für die ganze Art seines Arbeitens. Eine solche Bemerkung findet sich in dem «Anhang», den er 1817 dem Wiederabdruck seiner Schrift über die «Metamorphose der Pflanzen» hinzugefügt hat. Er betrachtet da gewisse pathologische Erscheinungen im Pflanzenreiche und spricht sich über dieselben in folgender Weise aus: «Die Natur bildet normal, wenn sie unzähligen Einzelheiten die Regel gibt, sie bestimmt und bedingt; abnorm aber sind die Erscheinungen, wenn die Einzelheiten obsiegen und auf eine willkürliche, ja zufällig scheinende Weise sich hervortun. Weil aber beides nah zusammen verwandt und sowohl das Geregelte als Regellose von esnem Geiste belebt ist, so entsteht ein Schwanken zwischen Normalem und Abnormem, weil immer Bildung und Umbildung wechselt, so daß das Abnorme normal und das Normale abnorm zu werden scheint. Die Gestalt eines Pflanzenteiles kann aufgehoben oder ausgelöscht sein, ohne daß wir es Mißbildung nennen möchten... Im Pflanzenreiche nennt man zwar das Normale in seiner Vollständigkeit mit Recht ein Gesundes, ein physiologisch Reines; aber das Abnorme ist nicht gleich als krank oder pathologisch zu betrachten. »Eine solche Bemerkung zeigt, wie Goethe über das Pathologische dachte. Er wußte, welchen Wert die Betrachtung des Krankhaften für den hat, der sich eine Ansicht über die Gesetze des Gesunden bilden will. Man geht gewiß nicht fehl, wenn man einen solchen Gedanken
Goethes in Verbindung bringt mit den Beziehungen, in denen der Dichter zur Medizin stand. Denn durch diese Beziehungen wurden seine naturwissenschaftlichen Vorstellungen in weitgehendem Maße beeinflußt. Man braucht nur seine eigenen Mitteilungen in «Dichtung und Wahrheit» zu verfolgen, um einen Einblick zu gewinnen in die bedeutsamen Anregungen, die Goethe der Medizin verdankt. Mehr als zu den Vertretern anderer Fächer fühlte er sich an den beiden Hochschulen, die er besuchte, zu denen der medizinischen Wissenschaften hingezogen. (Eine interessante Klarlegung des Verhältnisses Goethes zur Medizin hat vor kurzem Dr. P. H. Gerber, Privatdozent an der Universität in Königs-berg, gegeben in seiner Schrift «Goethes Beziehungen zur Medizin», Berlin 1900.) Über seinen Aufenthalt an der Universität in Leipzig erzählt der Dichter: «In der vielfachen Zerstreuung, ja Zerstückelung meines Wesens und meiner Studien traf sich's, daß ich bei Hofrat Ludwig den Mittagstisch hatte. Er war Medicus, Botaniker, und die Gesellschaft bestand außer Morus in lauter an-gehenden oder der Vollendung näheren Ärzten. Ich hörte nun in diesen Stunden gar kein ander Gespräch als von Medizin oder Naturhistorie, und meine Einbildungskraft wurde in ein ganz ander Feld hinübergezogen... Die Gegenstände waren unterhaltend und bedeutend und spannten meine Aufmerksamkeit.» Und später auf der Universität Straßburg verlebte Goethe eine anregende Zeit im Kreise von Medizinern. Er berichtet darüber:
Selbständigkeit und Wohlhaben eröffnet.» Aber Goethe beschränkte sich in Straßburg nicht auf derlei äußere Anregungen, sondern er trieb selbst fleißig medizinische und naturwissenschaftliche Studien. Er hörte die Vorlesungen über Chemie bei Spielmann und über Anatomie bei einem der bedeutendsten Anatomen der damaligen Zeit, bei Lobstein. Besondere Umstände veranlaßten ihn, noch weiteren Anteil an gewissen Zweigen der ärztlichen Kunst zu nehmen. Herder war nach Straßburg gekommen, um sich einer Augenoperation zu unterziehen. Goethe, der einen innigen Freundschaftsbund mit diesem hervorragenden Geist schloß, war bei der Operation anwesend und erzeigte sich dem Freunde auf Als Goethe dann 1775 von dem Herzog Karl August nach Weimar gerufen ward, trat er alsbald zur benachbarten Universität
Jena in Beziehungen. Und wieder waren es die Mediziner, bei denen er sich seine bedeutsamsten Anregungen holte. Er be-schäftigte sich unter Anleitung des Hofrates Loder eingehend mit Anatomie. Ein hinterlassenes Manuskript (jetzt veröffentlicht im VIII. Bande der Weimarischen Goethe-Ausgabe) zeigt, wie er diese Wissenschaft ganz im Sinne einer rationellen vergleichenden Methode getrieben hat. Eine Frucht dieser seiner Studien ist seine wichtige Entdeckung, daß der Mensch ebenso wie die anderen Wirbeltiere einen Zwischenkieferknochen in der oberen Kinnlade habe. Er bereicherte durch diese Jenenser Studien seine anatomischen Kenntnisse so weit, daß er selbst in der Lage war, den Schülern der Weimarer Zeichenakademie anatomischen Unter richt zu geben. Für die Gründlichkeit dieser Studien Goethes lie fert auch die Tatsache einen Beweis, daß er im Winter 1781 be. Hofrat Loder die damals von der «medizinischen Jugend gerade vernachlässigte» Bänderlehre besonders eifrig betrieb. Es war Goethes Bedürfnis nach einer der ganzen Anlage seines Geistes entsprechenden umfassenden Naturanschauung, das ihn zu einer energischen Beschäftigung mit der empirischen Naturwissenschaft, die er ja am besten in den Kreisen der medizinischen Fachmänner vorfand, trieb. Aber diese Beschäftigung hat auch bewirkt, daß der Dichter ein tiefes Verständnis für die medizinische Wissenschaft in sich ausbildete. Welcher Art dieses Verständnis war, zeigt wohl klar genug eine Schilderung, die er in «Dichtung und Wahrheit» von der medizinischen Bewegung der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gibt. «Es war nämlich vorzüglichen, denkenden und fühlenden Geistern ein Licht aufgegangen, daß die unmittelbare originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das beste sei, was der Mensch sich wünschen könne, und nicht einmal schwer zu erlangen. Erfahrung war also abermals das allgemeine Losungswort, und jedermann tat die Augen auf, so gut er konnte; eigentlich aber waren es die Ärzte, die am meisten Ursache hatten, darauf zu dringen, und Gelegenheit, sich danach umzutun... Weil nun wirklich einige außerordentliche Menschen, wie Boerhave und Haller, das Unglaubliche geleistet, so schien man sich berechtigt, von ihren
Schülern und Nachkommen noch mehr zu fordern. Man behauptete, die Bahn sei gebrochen, da doch in allen irdischen Dingen selten von Bahn die Rede sein kann; denn wie das Wasser, das durch ein Schiff verdrängt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenstürzt, so schließt sich auch der Irrturn, wenn vorzügliche Geister ihn beiseite gedrängt und sich Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß zusammen.» In einer wichtigen, den medizinischen Unterricht betreffenden Angelegenheit kam Goethe sogar zu einem fruchtbaren praktischen Vorschlag Er trug denselben zuerst als «Halbfiktion» im 3. Kapitel von «Wilhehn Meisters Wanderjahre» vor. Die Schwierigkeit, die notwendigen Gegenstände für den anatomischen Unterricht zu beschaffen, führte ihn auf den Gedanken, statt wirklicher organischer Körper plastische Nachbildungen zu pädagogischen Zwecken zu verwenden. Später wandte er sich mit einem entsprechenden Vorschlage an Geheimrat Beuth in Berlin. Aus dem Schreiben an diesen ist ein Teil in Goethes Werken unter dem Titel «Plastische Anatomie» abgedruckt. Er spricht hier davon, daß in Florenz seit langen Jahren diese «plastische Anatomie» ausgeübt wird, und fügt die Bemerkung hinzu: «Sollte man aber bei Forderung eines solchen Lokales nicht unmittelbar an Berlin denken, wo alles - Wissenschaft, Kunst, Geschmack und Technik - beisammen ist und daher ein höchst wichtiges, freilich kompliziertes Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgeführt werden könnte? » Goethe hat nach dieser Richtung hin ganz konkrete Vorschläge: «Man sende einen Anatomen, einen Plastiker, einen Gipsgießer nach Florenz, um sich dort in gedachter besondern Kunst zu unterrichten. Der Anatom lernt die Präparate zu diesem eigenen Zwecke auszuarbeiten. Der Bildhauer steigt von der Oberfläche des menschlichen Körpers immer tiefer ins Innere und verleiht den höheren Stil seiner Kunst Gegenständen, um sie bedeutend zu machen, die ohne eine solche Idealnachhilfe abstoßend und unerfreulich wären. Der Gießer, schon gewohnt, seine Fertigkeit verwickelteren Fällen anzupassen, wird wenig Schwierigkeit finden, sich seines Auftrages zu entledigen; es ist ihm nicht fremd, mit Wachs von mancherlei Farben und
allerlei Maßen umzugehen, und er wird alsbald das Wünschenswerte leisten.» Daß eine solche Anregung zu einem pädagogischen Hilfsmittel, das später so vielfache Anwendung fand, von Goethe ausging, beweist, wie gründlich er sich mit den Anforderungen des medizinischen Unterrichtes auseinandergesetzt hat. Wenn man die innigen Beziehungen Goethes zur Medizin überschaut, so kommt man nicht mit Unrecht zu der Behauptung: es kann nicht nebensächlich sein, daß auch in seiner Lebensdichtung, im «Faust», dieses Geistesgebiet eine wichtige Rolle spielt. Fausts Persönlichkeit erinnert an Paracelsus und andere medizinische Gelehrte des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Goethe hat von seinem eigenen Wesen viel in diese Gestalt hineingelegt. Und wenn wir die Reflexionen Fausts über seine Kunst als Arzt lesen, so dürfen wir daran denken, daß ähnliche Gedanken in Goethes Seele selbst oft aufgestiegen seien. Die Fragen über die Bedeutung der Medizin für das Leben haben Goethe gewiß oft beschäftigt, da er durch häufiges Kranksein auch von einer nicht bloß theoretischen Seite her Bekanntschaft mit der Heilkunst gemacht hat. Liegt es doch ganz im Geiste seiner Weltanschauung, das Körperliche in voller Einheit mit dem Geistigen zu denken. Er, dem alles Menschliche so innig vertraut war, mußte ja immer wieder zu der Wissenschaft zurückgeführt werden, von der er in Straßburg die Überzeugung gewonnen hatte, daß sie den ganzen Menschen beschäftigt, weil sie es mit dem ganzen Menschen zu tun hat. Es gibt aber auch einen Zweig der medizinischen Wissenschaft, dem Goethe durch sein künstlerisches Schaffen ganz besonders nahestand: die Psychiatrie. Wenn wir auch nicht behaupten können, daß Goethe sich mit diesem Gebiete theoretisch in gleicher Weise auseinandergesetzt hat wie mit den rein physischen Erscheinungen am lebendigen Organismus, so ist doch im höchsten Maße interessant, einen welch sicheren Blick er für psychische Abnormitäten hat. Sein Werther, Orest, der Harfenspieler im «Wilhelm Meister», seine Lila, Mignon und endlich Gretchen sind Musterleistungen in bezug auf Schilderung pathologischer Psychen. In feinsinniger Weise hat Gerber («Goethes Beziehungen zur Medizin») darauf aufmerksam gemacht,
daß Goethe den Charakter Mignons so zeichnet, wie er infolge der Abstammung dieses Mädchens von Geschwistern sein muß. Zahlreiche Wege führten Goethe zur Heilkunde hin. Er, der den Ausspruch getan hat, daß die wahre Kunst ein Ausdruck der höchsten Naturgesetze sein muß, daß die Dichtung auf den Grundlagen der Erkenntnis ruht, hat durch seine Beziehungen zur Medizin bewiesen, daß er diesem Geistesgebiete den rechten Platz in der Gesamtheit des menschlichen Geistes anzuweisen wußte.
Literatur
- Rudolf Steiner: Methodische Grundlagen der Anthroposophie, GA 30 (1989), ISBN 3-7274-0300-4 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |