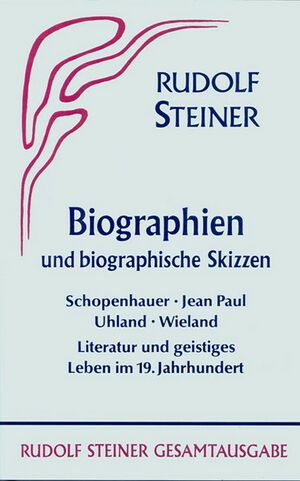Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 33
LITERATUR UND DAS GEISTIGE LEBEN IM XIX. JAHRHUNDERT
#G033-1967-SE007 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
BIOGRAPHISCHE SKIZZEN
#G033-SE009
LITERATUR UND DAS GEISTIGE LEBEN IM XIX. JAHRHUNDERT
1795 - 1840
#TX
Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts hatte Goethe den Höhepunkt seiner Entwickelung erreicht. Aus einem Geiste heraus, der auf die Einzelheiten der sinnlichen Erfahrung ebenso unbefangen blickte, wie er die tiefsten Geheimnisse des Natur- und Menschenlebens zu erforschen imstande war, hatte er eine Weltanschauung geschaffen, die als Erfüllung dessen erschien, was die besten Köpfe des achtzehnten Jahrhunderts ersehnt hatten. Von unbegrenzter Fruchtbarkeit erwies sich diese Weltanschauung für die Folgezeit: Eine Wirkung, wie die von Goethe auf das neunzehnte Jahrhundert ausgeübte, läßt sich kaum mit etwas anderem in der Geistesgeschichte der Menschheit vergleichen. Der Grund davon liegt in jener Universalität des Goetheschen Geistes, die Wieland veranlaßte, seinen großen Zeitgenossen den «menschlichsten aller Menschen» zu nennen. Durch diese Vielseitigkeit seines Geistes unterscheidet sich Goethe von denen, die mit ihm zusammen an der Grenzscheide des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts die große geistige Revolution herbeiführten. Voltaire, Rousseau, Lessing, Herder, Kant und Schiller haben Großes dadurch erreicht, daß sie ihr Schaffen in den Dienst eines Ideals stellten; Goethe dagegen brachte eine Vielheit menschlicher Fähigkeiten in sich so zur Ausbildung, daß sie in vollkommener Harmonie standen.
Wie sich Goethes Naturanlage von der seines Freundes
#SE033-010
und größten Zeitgenossen Schiller unterschied, das hat er selbst mit klaren Worten ausgesprochen: «Er predigt das Evangelium der Freiheit; ich wollte die Rechte der Natur nicht verkürzt wissen.» Schiller ging von der ethischen Forderung der Freiheit aus, Goethe von der Betrachtung der Natur und der Menschen. In dem Werke, an dem Goethe bis zu seinem Lebensende - 1832 - arbeitete, im «Faust», stellte er nicht einen Mann dar, der ein aus der Vernunft geborenes Ideal der Freiheit verwirklichen, sondern einen solchen, der durch Entfaltung der höchsten in dem Menschen vorhandenen Anlagen sich zur freien Persönlichkeit hindurcharbeiten will. Was in der menschlichen Natur enthalten ist, das soll hervortreten, während Faust durch die «kleine und die große Welt» wandert. Es war Goethes Überzeugung, daß die Natur der Quell aller Vollkommenheit ist, und daß das Beste nur schaffen kann, wer ihren Spuren folgt.
Goethes Jugenddichtungen waren ein Protest gegen die Unnatur, die er in seinem Zeitalter beobachten konnte. Er machte Götz von Berlichingen zum Helden eines Dramas, weil er seinen Zeitgenossen, die sich durch alle möglichen künstlichen Vorstellungen von der Natur entfernt hatten, einen Menschen zeigen wollte, dessen Taten aus seinen ursprünglichsten, natürlichsten Empfindungen hervorgingen. Von einer anderen Seite stellte er im «Werther» den Wert des Natürlichen dar. Daß die widernatürliche Sentimentalität Schiffbruch leiden muß, ist die Grundidee dieser Dichtung. Was ein Mensch durch seinen angeborenen Charakter und durch die Verhältnisse, in die ihn das Schicksal gestellt hat, erleben kann, darauf war Goethes Blick gerichtet. Die Leiden und Freuden des Lebens, wie sie sich in
#SE033-011
verschiedengearteten menschlichen Naturen abspielen, die Konflikte, die das Leben bringt, und die Genüsse, die es bietet, hat er in seinen dramatischen und erzählenden Dichtungen in unvergleichlicher Weise zur Darstellung gebracht. « Clavigo», « Stella», «Die Geschwister», «Egmont», « Iphi-genie» und «Tasso» sind Seelengemälde, geschaffen von einem Geiste, dem die tiefsten Geheimnisse der Menschen-natur offenbar geworden sind.
Goethes Streben, in seinen eigenen Schöpfungen nach denselben Gesetzen, zu verfahren, welche die Natur befolgt, führte ihn dazu, sein Kunstideal in der Welt der Antike zu suchen. Die Kunstwerke der Griechen, die er auf seiner italienischen Reise beobachtete, entlockten ihm den Ausspruch: «Ich habe die Vermutung, daß die Griechen nach den Gesetzen verfuhren, nach welchen die Natur selbst verfährt, und denen ich auf der Spur bin.» Nachdem er auf diese Weise erkannt zu haben glaubte, was das Ziel aller wahren Kunst sein muß, suchte er die bereits vor der italienischen Reise begonnenen Naturstudien weiter auszubilden. Er wollte die schaffenden Kräfte der Natur kennenlernen, um sie aus seinen Kunstwerken sprechen zu lassen. Nach seiner Rückkehr aus Italien, im Jahre 1788, war er auf dem Gebiete der Naturforschung nicht weniger tätig als auf dem der Dichtung. Daß für ihn künstlerisches Schaffen eine Art höhere Stufe des Naturwirkens war, sprach Goethe in seinem Buche über Winckelmann aus: «Indem der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Vollkommenheiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung
#SE033-012
aufruft und sich endlich zur Produktion des Kunstwerkes erhebt.» Durch seine Anlagen war Goethe von vornherein dazu bestimmt, überall das Natürliche, das Ursprüngliche in den Dingen zu suchen; aber das eigentliche tiefere Wesen der Natur glaubte er erst durch das Studium der Antike kennengelernt zu haben. Er war nun der Ansicht, daß er früher zwar der Natur treu gewesen, daß ihn aber erst die ideale Schönheit der Alten auf eine höhere Stufe der Existenz und des künstlerischen Wirkens gehoben habe. In seiner Jugend suchte Goethe rein aus seiner Natur heraus Dinge und Menschen nachzubilden; jetzt ließ er ein Kunstwerk nur gelten, wenn das Naturwahre zum Idealwahren verklärt, wenn das Einfach-Natürliche den strengen Stil-gesetzen unterworfen wurde, die der Schönheitssinn der Alten verlangte. Auf dieser Stufe der Entwickelung stand Goethe, als das achtzehnte Jahrhundert zu Ende ging. Eine reife Frucht seiner damaligen Kunstanschauung ist die im Jahre 1797 entstandene Dichtung «Hermann und Dorothea». Das Leben in einer Kleinstadt, echte und einfache Menschen aus dem Volke stehen in der Erzählung wie Schöpfungen der Natur selbst da; und über das Ganze ist die Einfalt und Größe ausgegosssen, wie wir sie an den Kunstwerken der Alten bewundern. Vollendete Naturtreue und höchste Stilkunst feiern hier ihre Vermählung.
Wenn man auch zugeben muß, daß in den Dichtungen Goethes, die im neuen Jahrhundert entstanden sind, das antike Schönheitsideal auf Kosten der unmittelbaren Wiedergabe des Natürlichen bevorzugt ist, so darf dabei doch nicht übersehen werden, daß durch die Erhebung zu diesem Ideal eine der höchsten Höhen der menschlichen Kultur erstiegen wurde.
#SE033-013
«Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle.» Diesen Spruch stellte Goethe über den zweiten Teil seiner Lebensbeschreibung «Dichtung und Wahrheit». In der Entwickelung weniger Menschen wird sich dieser Satz so erfüllt haben, wie in der seinigen. Was er an den alten Griechen bewunderte, daß sie «das Einzige, das ganz Unerwartete» geleistet haben, weil sie die sämtlichen Eigenschaften und Kräfte des Menschen gleichmäßig in ihrer Natur vereinigten, das hat er wieder zu erreichen vermocht. Seine Persönlichkeit ist im Fortschritte ihrer Entwickelung ein Abbild des Werdens der ganzen Menschheit. Erkaufen mußte Goethe diese Kulturhöhe allerdings mit der Entfremdung von den Interessen seiner Zeit- und Volksgenossen. Während Schiller, trotzdem er sich in seinen Schöpfungen dem Goetheschen Kunstideal immer mehr zu nähern suchte, im innigsten Einklang verblieb mit dem, was das Volk wollte und fühlte, stand Goethe nach seiner Rückkehr aus Italien mit seinen Anschauungen und Empfindungen allein. Seine Jugenddichtungen wirkten hinreißend auf viele; die Schöpfungen, die er in der «Epoche seiner Vollendung» schuf, fanden dagegen nur bei den Besten Verständnis. Allen ging darin Schiller voran, der in seinen tiefsinnigen Aufsätzen «BHefe über die ästhetische Erziehung des Menschen» und «Über naive und sentimentalische Dichtung» die Geistes- und Künstlerart Goethes als die höchste, die der Mensch erreichen kann, kennzeichnete. Am weitesten entfernt von der Kunstauffassung seines Volkes hat Goethe sich mit seinem unvollendet gebliebenen, im Anfange des 19. Jahrhunderts entstandenen Drama «Die natürliche Tochter». Hier wollte er Gestalten schaffen, von denen alles Zufällige, Gleichgültige abgestreift ist,
#SE033-014
die nur die Repräsentanten des Standes sind, in den das Schicksal sie hineingeboren hat. Goethe glaubte gerade dadurch die höhere Wahrheit zu erreichen, daß er das Alltägliche, das Individuell - Menschliche beiseite setzte; die Zeitgenossen vermißten dieses Individuelle, das zum Herzen spricht, weil es Leid und Freud des einzelnen ist - man nannte das Drama «marmorglatt und marmorkalt». Schiller dagegen urteilte: «Es ist ganz Kunst und ergreift dabei die innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit.» Und Fichte erklärte es für Goethes Meister-stück.
Am stärksten empfindet man den Umschwung in Goethes Kunstanschauungen an den Werken, deren Anfänge vor der italienischen Reise entstanden, die aber erst nach derselben zu Ende geführt wurden: in «Faust» und «Wilhelm Meister». Aus individuellen Charakteren, die «Faust» und «Wilhelm» in den ersten Teilen der Dichtungen noch waren, verwandelten sie sich in Repräsentanten für gewisse Menschengattungen; ja Faust sogar zum Abbilde und Symbol der ganzen strebenden Menschheit. Goethe glaubte erkannt zu haben, daß sich in den Tatsachen des Natur-und Menschenlebens, so wechselreich und mannigfaltig sie auch dem äußeren Anschein nach sind, gewisse große, einfache, ewig bleibende Gesetze verbergen. Während er in seiner Jugend die wechselnden Begebenheiten und die einzelnen Menschen um ihrer selbst willen darstellte, gelangte er auf der Höhe seines Lebens immer mehr dazu, die Ereignisse und Personen als Mittel zu betrachten, um die ewige Gesetzmäßigkeit zur Anschauung zu bringen. In dem im Jahre 1809 entstandenen Roman «Wahlverwandtschaften» werden die Neigungen und Leidenschaften der Menschen
#SE033-015
so vorgeführt, daß sich in ihnen ewige Gesetze, wie bei chemischen Vorgängen, offenbaren.
Am unmittelbarsten offenbarte sich die Allseitigkeit der Goetheschen Persönlichkeit in seinen lyrischen Gedichten. Von den intimsten und zartesten Empfindungen des liebenden Herzens bis zu den höchsten philosophischen Welt-ideen hat er das ganze menschliche Geistesleben in diesen Schöpfungen zum Ausdruck gebracht. Er hatte den naiven Naturton des Volksliedes ebenso wie die höchsten Formen der Kunstpoesie in seiner Gewalt; er fand den Ausdruck für die nackte, überquellende Sinnlichkeit in seinen «Römischen Elegien» und wußte die vergeistigte Liebe in seiner «Trilogie der Leidenschaft» darzustellen. Gerade diese Seite des Goetheschen Schaffens ist es, durch die er am meisten zu den Herzen der Menschen gesprochen hat; hier wirkte er am unwiderstehlichsten. «Diese Lieder umspielt ein unaussprechlicher Zauber. Die harmonischen Verse umschlingen dein Herz wie eine zärtliche Geliebte, das Wort umarmt dich, während der Gedanke dich küßt», sagte Heinrich Heine. Unversieglich schien die Quelle lyrischer Stimmungen bei Goethe; noch im höchsten Alter schuf er die Fülle köstlicher Lieder und Sprüche des «West-östlichen Divan», die einen mächtigen Einfluß auf die neuere Dichtung, namentlich auf Rückert und Platen, ausgeübt haben.
Sein Drang, die höchste geistige Kultur in sich selbst auszubilden, erklärt Goethes Verhalten gegenüber den großen Ereignissen seiner Zeit. Sein geringes Interesse für die Erhebung der Geister im Zeitalter der Revolution und für die nationale Begeisterung während der Befreiungskriege ist viel getadelt worden. Die Werke, in denen er sich mit
#SE033-016
der großen revolutionären Bewegung auseinandersetzte, der «Großkophta», die «Aufgeregten», der «Bürgergeneral», gehören zu den schwächsten Schöpfungen seines Geistes, und die Befreiungskriege, die andere zu so hinreißenden Tönen begeistert haben, vermochten seine Dichterkraft nicht in Tätigkeit zu setzen. Das Gewaltsame in den Ereignissen jener Epoche widerstrebte ihm, er verlangte nach Harmonie der Kräfte, deshalb ging er ruhig seinen eigenen Gang und zog sich von dem öffentlichen Leben zurück, wo dieses seiner Natur nicht entsprach. Das Leben in einer höheren idealen Wirklichkeit, zu dem sich Goethe erhoben hatte, nach einer langen Erfahrung und nachdem er die Kulturwelt der Alten in sich aufgenommen, erschien den Dichtern der Folgezeit, die ihre Richtung als die romantische bezeichneten, als das Vorrecht des wahren Künstlers. Ein Drang nach allem, was dem gewöhnlichen Leben fremd, was nur aus Genie und Einbildungskraft geboren ist, kennzeichnet diese Poeten. Sie bevorzugten in ihren Schöpfungen alles, was den Schein des Wunderbaren, des Geheimnisvollen, des Mystischen hat; die seltenen Empfindungen, die dem mitten im wirklichen Leben stehenden Menschen völlig fremd sind, machten sie vorzüglich zum Gegenstand der Dichtung.
Sie glauben in Goethes Kunstideal und in Johann Gottlieb Fichtes Weltauffassung die Rechtfertigung für ihre Anschauungen zu finden. Dieser Philosoph, der uns an anderer Stelle noch eingehend beschäftigen wird, hatte aus dem eigenen Ich des Menschen die höchste Welterkenntnis hervorzuholen gesucht und mit hinreißender Beredsamkeit die Lehre von der souveränen Persönlichkeit verkündet, die von den Brüdern August Wilhelm und Friedrich Schlegel
#SE033-017
aufgenommen und in ihrer Art ausgelegt wurde. Der geniale Mensch sollte sich seine eigene Welt mit besonderen Gesetzen schaffen. Das führte allerdings dahin, daß die Romantiker oft alle Naturnotwendigkeit außer acht ließen und der subjektiven Laune und Willkür alle Herrschaft einräumten. Ganz aus dieser Einseitigkeit heraus erwachsen ist Friedrich Schlegels Roman «Lucinde», in dem zügelloseste Sinnlichkeit, genialer Müßiggang und persönliche Willkür gepredigt werden. Es ist aber doch nur der Mangel an ursprünglicher Dichterkraft, der sich hier hinter einer künstlich angenommenen höheren Lebensauffassung verbergen will. Beide Schlegel vermochten in ihren eigenen Schöpfungen nur Unbedeutendes zu schaffen. Sie blieben Nachahmer fremder Formen. Um so Größeres leisteten sie als Ausleger und Vermittler der Werke anderer. Friedrich Schlegel eröffnete weite Ausblicke in fremde Geistesrichtungen und Kulturen in seinen Werken: «Über die Sprache und Weisheit der Inder» und «Geschichte der alten und neuen Literatur». Seine 1798 begründete Zeitschrift «Athenäum»wurde ein Sammelpunkt für die Geister, die der nüchternen und banalen Aufklärerei den Sinn für die höchsten Kunstideale entgegensetzen wollten. August Wilhelm Schlegel war zum Übersetzer und Nachdichter geboren. Durch seine Shakespeare-Übertragung hat er eine neue Epoche für das Verständnis des großen britischen Dramatikers geschaffen und bewiesen, in welch hohem Grade der deutsche Volksgeist imstande ist, die Dichtungen des Auslandes aufzunehmen. Durch diese Vermittlung fremder Poesien und die Vertiefung in die Vergangenheit des eigenen Volkes griffen die deutschen Romantiker tief in die Entwickelung der Literatur ein. Feinsinnig hat A. W.
#SE033-018
Schlegel Dantes dichterische Eigenart erklärt und in deutscher Sprache wiedergegeben, musterhaft Ludwig Tieck Cervantes übersetzt. Selbst da, wo die Beschäftigung mit fremden Literaturwerken zu Überschätzung gewisser Kunstleistungen führte, förderte sie doch das Verständnis derselben. Wenn zum Beispiel auch Friedrich Schlegel den Spanier Calder6n in einseitiger Weise den größten aller Dichter nannte, so hat er doch durch die geistvolle Erklärung seines Wesens sich ein bleibendes Verdienst erworben.
Von nicht geringerer Bedeutung war die Pflege des Sinnes für deutsche Vergangenheit bei der Mehrzahl der Romantiker. Diese Vorliebe für die mittelalterlich christliche Zeit ging aus ihrer Geringschätzung der wirklichen Welt, der unmittelbaren Gegenwart hervor. In die längst entschwundenen Zeiten, deren Wesen uns in unbestimmten Umrissen überliefert ist, ließen sich die Eigentümlichkeiten eines höheren, idealen Lebens hineinträumen, nach dem diese Dichter strebten. Wie die Sehnsucht nach einer verlorenen Heimat klingen die romantischen Stimmen über einstige Größe des deutschen Volkes, die im Laufe der Zeiten verlorengegangen sein soll. Aus diesem Vergangenheitskultus wuchsen riecks Erneuerungen älterer deutscher Dichtungen heraus, so die der Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter: «König Rother», «Schildbürger», «Magelone», «Melusine», und als hervorragendste Erscheinung, die Sammlung alter deutscher Lieder: «Des Knaben Wunderhorn», die zwischen 1805 und 1808 L. Achim von Arnim und Clemens Brentano herausgegeben haben. Dieses Liederbuch trug nicht wenig zur Hebung der nationalen Begeisterung bei. Mit diesen Bestrebungen der Romantiker hing das Aufblühen der germanistischen Studien zusammen.
#SE033-019
Jacob Grimm hat mit seiner 1819 begonnenen «Deutschen Grammatik», mit seinen Werken über «Deutsche Rechtsaltertümer» (i8z8) und «Deutsche Mythologie» (1835) in wissenschaftlicher Weise jene Vertiefung in die deutsche Vergangenheit fortgeführt, die August Wilhelm Schlegel mit seinen Aufsätzen über nordische Dichtkunst, über das «Nibelungenlied» und zahlreiche andere ältere Literaturdenkmale des deutschen Volkes begonnen hatte. Schon in den Jahren 1812-15 hatten die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm die «Kinder- und Hausmärchen», 1816-18 die «Deutschen Sagen» herausgegeben.
Daß diese Hinwendung zu den Quellen des deutschen Volkstums tief in der romantischen Geistesrichtung begründet war, geht daraus hervor, daß im innigen Bunde mit ihr zwei andere Erscheinungen auftraten, die aus der nationalen Eigenart der Deutschen erwachsen sind: der hohe Gedankenflug der idealistischen Philosophie durch Schelling, Hegel und Schopenhauer und der wunderbare Ausdruck, den das deutsche Gemüt in den Dichtungen dieser Zeit, namentlich durch Novalis und Eichendorff, fand. Der deutsche Idealismus feierte auf den Gebieten des Gedankens und der Empfindung die größten Triumphe. Fr. W. J. Schelling, der auf Fichtes Ansichten weiterbaute und auch in Jena wirkte, schuf ein Gedankenbild der Welt, das wie ein geniales Kunstwerk auf die Zeitgenossen wirkte, durch das es endlich gelungen ist, die harmonische Einheit des Weltalls in dem Spiegel des menschlichen Geistes zu zeigen. Schlag auf Schlag erschienen in der Zeit von 1795 bis 1805 die Schriften, in denen er seine kühnen Ideen über das Band der Natur und des Geistes entwickelte. In anderer Weise suchte G. W. Fr. Hegel den ganzen Umfang
#SE033-020
dessen in ein Gebäude zu bringen, was der menschliche Geist zu umspannen vermag. Was Fichte, Schelling und Hegel beseelte, war der Gedanke, daß in dem menschlichen Geiste die höchste Offenbarung alles Daseins verborgen liege, und daß man die tiefsten Schätze der Erkenntnis nur aus der eigenen Persönlichkeit schöpfen könne. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat ihnen dieses Betonen der eigenen Kraft des Geistes als Einseitigkeit ausgelegt und sich wieder mehr der Betrachtung der äußeren Natur zugewendet. Sie aber haben gerade durch diese Einseitigkeit gezeigt, zu welcher Gedankenhöhe der Mensch sich emporheben kann, und dadurch der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, dem idealistischen Zeitalter der Deutschen, das Gepräge aufgedrückt.
Einen anderen Charakter hat der weltabgewandte Sinn der Romantik in der Philosophie Arthur Schopenhauers angenommen, der im Jahre 1818 mit seiner «Welt als Wille und Vorstellung» auftrat. Die Geringschätzung der Wirklichkeit ward bei ihm zu der weltschmerzlichen Verurteilung alles Daseins und zu der Lehre von der Verneinung des Willens als alleiniger Erlösung von den Qualen und Leiden dieser Welt. Einen Einfluß hat dieser Philosoph allerdings -wie wir später sehen werden - erst dann ausüben können, als um die Mitte dieses Jahrhunderts Hegeis Stern zu erbleichen begann.
Den romantischen Sinn bildeten diese Philosophen nach der Richtung des Gedankens, die zeitgenössischen Dichter nach derjenigen des Gemütes aus. Krankhaft zwar, aber mit einer gewissen Innigkeit trat diese Seite der Romantik in den «Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders» im Jahre 1797 hervor, die von dem früh verstorbenen
#SE033-021
Wilhelm Wackenro der, dem Freunde Ludwig Tiecks, herrühren. Die zahlreichen Dichtungen Tiecks, der als Romanschriftsteller, Dramatiker und Märchendichter von den Romantikern sehr hoch gestellt wurde, zeigen gerade die weniger erfreulichen Eigenschaften dieser literarischen Epoche. Die Vertiefung des Seelenlebens, deren die Romantik fähig war, trat zutage durch die eigentlichen Dichter des deutschen Gemütes: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, und Josef von Eichendorff. Aus wunderbar zarten und tiefen Empfindungen heraus schrieb Novalis seine «Hymnen an die Nacht» (1797). Die tiefen Schmerzen, die ihm der Tod seiner Braut verursacht hatte, und die Sehnsucht nach dem eigenen Ende strömte er in diesen, von höchstem Schwunge der Phantasie eingegebenen Liedern aus. In seinem zur Zeit der Kreuzzüge spielenden Roman «Heinrich von Ofterdingen» gewannen die Empfindungen der romantischen Geistesart ihren bezeichnendsten Ausdruck.
Das Hinwegsetzen über die Gesetze der Natur und das Leben in Gebilden einer reinen Phantasiewelt hat die Romantiker oft zu den tollsten Sprüngen in der Darstellung der Menschen und Begebenheiten verleitet. Sie schufen zuweilen wahre Zerrbilder alles Natürlichen. Was die Personen, die sie darstellen, im Laufe eines Zeitraumes vollbringen, hängt nicht zusammen wie bei wirklichen Menschen, sondern wie bei den Gestalten, die uns im Traume erscheinen. Wenn in «Heinrich von Ofterdingen» die beiden Mädchen, die der Held liebt, Mathilde und Cyane, im Laufe der Begebenheiten zu einem einzigen Wesen verschmelzen, so ist das ein Beispiel dafür, wie die Romantiker Gestalten schufen, die Traumbildern gleichen. Aber bei Novalis war das alles in Poesie getaucht; die romantische
#SE033-022
Gesinnung sprach hier aus einem wahren Dichter. Die Liebenswürdigkeit und das Hinreißende dieser Gesinnung kam auch in Eichendorffs Dichtungen zur Erscheinung. Er trat zuerst 1808 mit Liedern auf, denen er bald weitere Gedichtsammlungen folgen ließ. Den eigenartigen Zauber der romantischen Stimmung hat er aber in die 1826 erschienene Novelle «Aus dem Leben eines Taugenichts» gelegt. Der Taugenichts führt ein Leben der Zwecklosigkeit und des Müßiggangs; er treibt nur unnütze Dinge. Dadurch ist er der Repräsentant des romantischen Ideals. Während aber Friedrich Schlegel von diesem Ideal in seiner «Lucinde» ein abstoßendes Zerrbild malte, hat es hier echte dichterische Begabung in anziehender Form verkörpert.
Eine merkwürdige Ausbildung fand die romantische Sehnsucht in Friedrich Hölderlin. Während die übrigen Dichter dieser Richtung meist auch in persönliche Berührung miteinander traten, ging er allein seinen Weg. Nur mit Schelling und Hegel war er befreundet. Für ihn war das Menschlich-Große und Erstrebenswerte im Griechentum vorhanden. Der Roman «Hyperion oder der Eremit in Griechenland», den er 1799 vollendete, zeigt, wie wenig sich Hölderlin heimisch fühlte in der Zeit, in der er lebte. Er träumte nur von der alten griechischen Welt. Sie besingt er auch in seinen bedeutenden lyrischen Dichtungen. Man möchte Hölderlin den romantischen Geist nennen, der auf der ersten Stufe stehengeblieben ist; denn auch die Brüder Schlegel gingen von einer schwärmerischen Verehrung der griechischen Kunst aus und wandten sich erst später dem Mittelalterlich-Christlichen zu.
Die Abkehr von dem Natürlichen brachte in diese ganze Strömung etwas Schwankendes und Unsicheres. Der romantische
#SE033-023
Geist war für die verschiedensten Geistesrichtungen zugänglich. Einerseits fühlten sich die Vertreter dieses Geistes zu einer Philosophie hingezogen, die alle Wahrheit unabhängig von religiösen Vorstellungen gewinnen wollte; andererseits traten sie in Beziehung zu dem philosophischen Erneuerer der christlichen Religion, zu Friedrich Schleier-macher, dem berühmten Prediger und Verfasser der «Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern». Mit ihm befreundete sich namentlich Friedrich Schlegel, und Schleiermacher schrieb «Vertraute Briefe über die Lucinde», in denen er die in diesem Roman verherrlichte Scheingenialität als Ausfluß einer hohen Gesinnung feierte.
In Ernst Theodor Amadeus Hoffmann kam dieses Unsichere und Willkürliche der Romantik am rückhaltlosesten zum Durchbruch. Bei ihm war alles launenhaft und subjektiv. Alles, was dem gewöhnlichen Gang der Dinge zuwider-lief, war Lieblingsgegenstand dieses Dichters. 1814 trat er mit seinen «Phantasiestucken in Callots Manier» hervor; 1816 schrieb er die «Elixiere des Teufels», in denen ein Mönch geschildert wird, der aus dem in einem Kloster auf-bewahrten, vom heiligen Antonius herrührenden Teufels-elixiere trinkt. Er wird dadurch in die abenteuerlichsten Verwicklungen getrieben, sein eigenes Ich wird zerstört; bald ist er es selbst, bald ein anderer. Die romantische Laune, die selbst das festgefügte Ich des Menschen vernichtet, begegnet uns hier in ihrer verwegensten Gestalt. In anderer Art waltet dieselbe Regellosigkeit in den 1822 vollendeten «Lebensansichten des Katers Murr».
Zu welch absonderlichen Ideen die Romantik sich verstieg, das beweist Chamissos im Jahre 1814 erschienenes Buch «Peter Schlemihls wundersame Geschichte». Auf einer
#SE033-024
Reise hatte der zerstreute Dichter Hut, Mantelsack, Handschuh, Schnupftuch und anderes verloren. Da fragte ihn Freund Fouqué, ob er denn noch seinen Schatten behalten habe? Das gab Veranlassung zu der Erzählung vom Peter Schlemihl, dem Manne, der die Welt ohne Schatten durchschweifen muß, und dessen Schicksal durch diesen Mangel eines notwendigen menschlichen Begleiters besiegelt ist. Chamissos Freund de la Motte-Fouqué veröffentlichte 1808 ein Heldenstück «Sigurd der Schlangentöter», das den ersten Teil der im Jahre 1810 erschienenen Nibelungentrilogie «Der Held des Nordens» bildete. 1811 ließ er das Märchen «Undine» folgen, in dem die romantische Naturpoesie ihren schönsten Inhalt ans Licht brachte.
Am meisten schien der romantische Geist der dramatischen Dichtung zu widerstreben. Tieck hat nur wertlose Dramen geschrieben; Arnim, Brentano und Fouqué versuchten sich auf diesem Gebiete vergebens. Um so bewundernswerter ist das Genie des großen Dramatikers, der aus dieser Richtung doch hervorgegangen ist: Heinrichs von Kleist. Nach einem von Zweifeln an sich und der Welt erfüllten, von furchtbaren Leidenschaften zermarterten Leben erschoß dieser große Dichter eine Freundin und sich in seinem 34. Jahre (1811). Im Jahre 1803 erschien seine erste Tragödie «Die Familie Schroffenstein», und dann folgten «Der zerbrochene Krug» 1808, den man mit Recht für eines der besten deutschen Lustspiele hält; ferner «Penthesilea», das «Käthchen von Heilbronn», «Hermannsschlacht», «Prinz von Homburg» und die gewaltige Erzählung «Michael Kohlhaas». Durch die Vorliebe für außer-gewöhnliche Seelenzustände zeigte Kleist seine Zugehörigkeit zur Romantik. Penthesilea und Käthchen lieben nicht
#SE033-025
wie gewöhnliche weibliche Wesen, sondern jene wie eine Tigerin, die in ihrer Wildheit den Geliebten zerfleischt, diese wie eine Hypnotisierte, die in hündischer Treue dem angebeteten Manne folgt. Ml diese durchaus der romantischen Vorstellungswelt entsprungenen Charaktere sind von Kleist mit Shakespearescher Kraft und Kunst gezeichnet. Die «Hermannsschlacht» wurde 1809 im Hinblick auf die deutsche Gegenwart gedichtet. Die Hebung des deutschen Nationalgefühles erwuchs aus der deutschen Romantik heraus, wie diese Geistesrichtung selbst aus einem tief im deutschen Volke wurzelnden Charakterzug entstanden ist. Ein Jahr nach der Schlacht von Jena hielt Fichte in dem von den Franzosen besetzten Berlin seine «Reden an die deutsche Nation», die bestimmt waren, alles in Kraft umzusetzen, was die Deutschen in sich hatten, um fremdes Joch abzuschütteln. Im Jahre 1805 versammelten sich die Vertreter der Romantik in Heidelberg ebenso um Arnim und Brentano, wie sie sich früher um Fichte, Schlegel und Tieck in Jena versammelt hatten. Hier hielt Josef Görres Vorlesungen über «Die deutschen Volksbücher», und die nationale Begeisterung für die deutsche Vorzeit wirkte auf die Tat-kraft der Gegenwart, so daß der Freiherr vom Stein sagen konnte, daß sich im Kreise der Heidelberger Romantiker «ein gut Teil des deutschen Feuers entzündet hat, welches später die Franzosen verzehrte». Hatte doch Achim von Arnim in der Einleitung des aus diesem Kreise herausgewachsenen «Knaben Wunderhorn» von seinem Glauben an eine Wiedergeburt Deutschlands gesprochen. Man muß in der Romantik die Ursprünge der vaterländischen Dichtung suchen, die in Ernst Moritz Arndt, Max von Schenkendorf, Theodor Körner so glänzende Vertreter gefunden hat.
#SE033-026
Durch die Romantik schöpfte der deutsche Geist reiche Anregung aus der Poesie aller Kulturstaaten, und dies setzte ihn instand, die Tiefen seiner Seele in den vollendetsten Kunstformen darzustellen. Die Wirkungen davon offenbarten sich in der folgenden Zeit. 1821 erschienen Platens formvollendete Ghaselen, 1822 Rückerts «östliche Rosen». Beide Dichter haben die Früchte der Romantik geerntet. Aus der ursprünglichen Kraft seines Volkes und aus der Kunst seiner unmittelbaren Vorgänger schöpfte in gleicher Weise Ludwig Uhland, der zum ersten Male im Jahre 1815 mit seinen Gedichten an die Öffentlichkeit trat, und der mit seinen Balladen sich zum volkstümlichsten Dichter der Deutschen nach Schiller gemacht hat. Bei Rückert, Platen und Uhland traten die Grundeigenschaften der Romantik nicht mehr in den Vordergrund. Das Gleiche war bei einem anderen Dichter aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, bei Wilhelm Müller, der Fall, der zu seinem 1821 erschienenen Buch «Lieder der Griechen» durch den Freiheitskampf dieses Volkes begeistert wurde.
Die eigentliche Romantik wurde durch ihre Neigung für Unwirkliches und Mystisches zuletzt völlig in die religiöse Schwärmerei getrieben, und nach den Befreiungskriegen leistete sie den reaktionären Bestrebungen ihre Dienste. Aus der Vorliebe für das christliche Mittelalter war zuletzt auch eine solche für die Unterdrückung des durch die französische Revolution entfesselten modernen Geistes geworden. Deshalb ist es nicht zu verwundern, daß das «junge Deutschland», das im Beginne der dreißiger Jahre die Erbschaft der Romantik antrat, zunächst in die ausgesprochenste Opposition zu der ihm vorangegangenen Literaturbewegung geriet.
Rückkehr zu den ursprünglichen Quellen des menschlichen
#SE033-027
Erkennens und des künstlerischen Schaffens kennzeichnet die deutschen Literaturströrmungen in der zweiten Hälfte des vorigen und in der ersten dieses Jahrhunderts. Die Weltanschauung sollte von alten Vorstellungen, die nichts als die Autorität der Überlieferung für sich hatten, befreit werden und die Kunst von Formen erlöst, die sich namentlich unter dem Einflusse des französischen Klassi-zismus ausgebildet hatten, und allmählich zu pedantischen Kunstgesetzen, zu äußerlicher, jede künstlerische Individualität tötender Manier geworden waren.
In welch hohem Grade diese Weltanschauung und Kunstrichtung sich überlebt hatte, zeigt sich auch darin, daß die literarische Bewegung bei dem stammverwandten englischen Volke zu Beginn des Jahrhunderts fast genau dieselbe Richtung einschlug.
Hier waren es die drei Dichter der sogenannten «See-schule», William Wordsworth, Robert Southey und Samuel Taylor coleridge, die zuerst herausstrebten aus der alt-gewordenen steifen Klassizität, als deren Hauptvertreter ihnen Pope erschien. Sie werden unter dem Namen «See-schule» zusammengefaßt, weil sie eine Zeitlang gemeinsam an den Ufern der Seen von Westmoreland und Cumberland lebten und die Naturschönheiten dieser Gegend zu vielen ihrer Dichtungen den Stoff lieferten. Sie wollten nicht wie ihre Vorgänger durch die Brille überlieferter Vorstellungen sehen und die Natur in althergebrachten Kunstformen besingen, sondern dieser sich naiv gegenüberstellen und eine natürliche Sprache reden. Der bedeutendste dieser drei Dichter, Coleridge, hat in seinem Wesen viel Ähnlichkeit mit den deutschen Romantikern. Auch er suchte das Mystische, Seltene in den Welterscheinungen auf und lebte in
#SE033-028
einer der Wirklichkeit fremden Traumwelt. Von geringerer Begabung war Wordsworth, dessen Naturschwärmerei etwas gesucht Naives hat, und der in seinen Dichtungen die angeschlagenen Naturtörne meist durch einen moralisierenden Ausklang zerstört. Von Southeys Schöpfungen sind nur die in der Jugend entstandenen interessant durch den Freiheitssinn, der aus ihnen spricht. Im Alter entwickelte sich aus dem Revolutionär ein Lobredner der Reaktion.
Der Dichter, der im Beginne der romantischen Bewegung in England die größte Wirkung ausübte, der Schotte Walter Scott, hat in seinen Schöpfungen nichts von dem weltumspannenden Sinn der deutschen Romantiker. Er suchte nicht die Wurzeln des Menschlichen in der ganzen Welt, sondern nur im eigenen Volkstum. Scotts i 805 erschienenes «Lied des letzten Minstrels» und seine 1810 veröffentlichte Dichtung «Die Jungfrau vom See» durchströmt echte Natur-frische und wahre, ursprüngliche Empfindung, aber nichts von der tiefen Sehnsucht der deutschen Romantik. Als Scott von der Poesie zur Prosa überging, gewann seine Darstellung fast den Ausdruck geschichtlicher Wiedergabe der Menschen und Begebenheiten. Er wurde der Schöpfer des historischen Romans. Aus den natürlichen Verhältnissen eines Erdstriches, aus den geschichtlichen Voraussetzungen einer bestimmten Zeit heraus schilderte er. Unter den mannigfaltigen Charakterzügen der Romantik war einer der, daß sie die Überschätzung des Kulturzustandes der Gegenwart, die der Aufklärungszeit eigen war, abgelegt hat. In dieser Zeit hatte man nur Sinn für diejenigen Vorstellungen über Religion, Wissenschaft, Sitte und so weiter, die man selbst für richtig hielt. Erst die Romantik erweckte wieder die Liebe für Menschen und Kulturen, die aus anderen als den
#SE033-029
gegenwärtigen Verhältnissen erwachsen sind. Gerade diesen Charakterzug der Romantik bildete Walter Scott aus. Fr läßt Menschen und Tatsachen aus dem Boden erwachsen, auf dem sie geboren sind, und genau im Lichte der Zeit erscheinen, der sie angehören. Was ein Geschichtsschreiber als Ideal betrachten muß, alles aus den gegebenen Verhältnissen heraus zu schildern, das ist in Scotts Romanen erfüllt. Daß er damit einem Bedürfnisse seiner Zeit entgegenkam, beweist die Tatsache, daß zum Beispiel im Jahre 1822 von Scotts Romanen 145 000 Bände gedruckt worden sind. Auf die ganze europäische Romanliteratur hat dieser Schriftsteller einen ungeheuren Einfluß ausgeübt. Überall fanden sich Nachahmer seiner Art.
Viel mehr echte Romantik steckte in dem Irländer Thomas Moore. Er trifft den Ton des Volkes und schwelgt zugleich in der farbenreichen Welt des Orients. Seine «Lalla Rookh» ist eine Dichtung, die von einer üppigen Sinnlichkeit und einer an bunten Bildern reichen Phantasie eingegeben ist. Seine bedeutsamste Leistung aber sind seine 1807 begonnenen «Irischen Melodien», in denen ihm die Schmach seines irischen Volkes, das unter Englands Herrschaft beispiellose Leiden erduldete, Töne entlockte, so groß und hinreißend, wie sie nur j e ein Sanger der Freiheit gesungen hat.
Zwei Dichter gehören dieser Zeit an, in denen eine aus den tiefsten Quellen der Menschenseele kommende Natur-empfindung einen hoheitsvollen lyrischen Ausdruck fand:
John Keats und Percy Bysshe Shelley. Wie eine Erhebung zu den Mächten, die als die obersten, die gewaltigsten die Welt beherrschen, erscheint ihr Seelenleben, und wie eine ewige Weltmusik dringen ihre Dichtungen ins Herz. Beide sind in jungen Jahren gestorben: Keats 1821 in einem Alter
#SE033-030
von 26 Jahren, Shelley ist, noch nicht 30 Jahre alt, im Meer-busen von Spezia ertrunken. Man kann über Keats nichts Schöneres sagen, als die Worte Shelleys in dem Trauer-gesang wiederholen, den er dem ihm geistig so Nah-verwandten widmete: «Er ist jetzt Eins mit der Natur.» Denn Keats ganzes Leben war Sehnsucht nach dem Einswerden mit ewigen Gewalten. Über seinen im Jahre 1818 begonnenen, unvollendet gebliebenen «Hyperion» sprach Byron die Worte: Das Gedicht «ist wirklich von den Titanen inspiriert und erhaben wie Aeschylos». Die Allegorie war Keats die liebste Form, in die er seine tiefe Natur-empfindung goß, und er erreichte darin eine Größe der Gestaltungskraft, der man kaum etwas anderes an die Seite zu setzen vermag.
Wenn man von einer Philosophie des Herzens sprechen darf, so muß man die Poesie Shelleys mit diesem Namen bezeichnen. Sein Sinn war auf die Tiefen der Weitgeheimnisse gerichtet; aber dieser Sinn war nicht die forschende Vernunft, sondern ein Herz, das das Erhabenste in der Natur mit seiner Liebe umfasssen wollte. In seinen Dichtungen scheinen die Elemente der Natur selbst in der ihnen angeborenen Sprache zu sprechen. Mit diesem umfassenden Natursinn verband sich bei Shelley eine unbegrenzte Liebe zur Freiheit. Und auch diese Liebe ist aus seinem Natursinn erwachsen. Er ging ganz auf in dem Leben der Natur, die alle Fesseln durch die Gewalt ihrer Kräfte zerreißt, so daß für ihn die Freiheit etwas war, ohne das er sich die Welt nicht denken konnte. Deshalb stellte er dem «Gefesselten Prometheus» seinen «Entfesselten» gegenüber, der die Ketten mit Würde erträgt, weil er weiß, daß die Stunde kommt, in der die Freiheit siegt. Und Shelley stellt diesen Sieg der
#SE033-031
Freiheit mit der ganzen Kraft dar, die einer notwendigen unbesiegbaren Naturgewalt zukommt.
Was bei Shelley aus einer bis an die Grenze des Menschlichen reichenden Naturempfindung hervorging: ein unbedingter Freiheitsdrang, war bei Georg Gordon Lord Byron die Folge einer stolzen Persönlichkeit, die mit Trotz und Größe sich allem entgegenstellt, was sie in der Entfaltung ihres angeborenen Menschentums begrenzen will. Ein Himmel und Hölle stürmender Sinn lebte in diesem Dichter. Alles, was Zwang ausübt, war von vornherein sein Gegenpol. Byron ist der Sänger, der den Stolz in der Menschen-natur besingt, und sein «Manfred», den er 1816 begonnen hat, das Lied von diesem Stolze. Manfred ist eine große Persönlichkeit, ein Mensch, dessen Seele durch das Bewußtsein, daß er eine schwere Schuld auf sich geladen hat, nicht erdrückt wird, der vielmehr trotz dieser Schuld gegen die Grenzen des Menschenmöglichen ankämpfen will. Byron fand Worte, um das Erhabenste auszusprechen, aber auch solche, die wie ein sicherer Pfeil alles das trafen, worauf sein Haß oder seine Verachtung sich richtete. Und er war da ein feiner Kenner, wo es sich darum handelte, das Kleine aufzuspüren, das sich mit dem Mantel des Großen umhüllte. Sein «Don Juan» ist ein Meisterwerk, wenn man ihn von dem Gesichtspunkte betrachtet, daß aller Scheinheiligkeit die Maske herabgerissen, aller Unwahrheit ihre niedrige Quelle vorgehalten werden sollte. Der Freiheitssinn trieb ihn an, seine Kraft der griechischen Bewegung zu widmen, weil er in den Griechen ein Volk sah, das, von den europäischen Mächten verlassen, sich seine Freiheit von den türkischen Unterdrückern erkämpfen wollte. Byron stellte alles, was er hatte, und sich selbst in den Dienst der Befreiung
#SE033-032
dieses Volkes. Er erlag bald, zwar nicht im Kampfe aber doch den Anstrengungen, die sein Tatendrang mit sich brachte.
In Frankreich, wo durch die politische Revolution der Bruch mit der Vergangenheit in der radikalsten Form zutage trat, wo durch Rousseau der Ruf nach Natürlichkeit und Freiheit am lautesten ertörnte, schritt die Revolutionierung der Geister am langsamsten fort. Die wahrhaft freien Persönlichkeiten haben ihre Kraft auf der Tribüne oder In Volksversammlungen verbraucht; sie fanden für die Kunst keine Zeit. Ein Dichter aber darf nicht vergessen werden, wenn von der Epoche der Revolution die Rede ist, der französische Hölderlin, Andr6 Chénier. Auch er fand sein Ideal im Hellenismus und entfaltete sein Talent in feinen, ins Ohr dringenden lyrischen Dichtungen. Er war der Vor-läufer der franzörsischen Romantik. Sein Bruder, Marie J ose ph Chénier, war radikaler Vertreter der revolutionären Poesie, der er auch treu geblieben ist, nachdem die franzörsische Volkserhebung in dem Hafen des Napoleonismus gelandet war. Als Revolutionspoet im eigentlichen Sinne des Wortes ist noch der Dichter der «Marseillaise», Joseph Rouget de l'Isle, zu nennen. Nicht mit Unrecht hat man gesagt, daß de l'Isle die Begeisterung, André Chénier den Schmerz der Volkserhebung verewigt hat. Dafür zog sich der letztere auch den Haß der Freiheitsmänner zu und mußte auf dem Blutgerüst enden. Daß jemand auch die traurigen Seiten der Revolution in Worte brachte, konnten die Freiheitsmänner nicht ertragen. Napoleons rücksichtslose Größe duldete nichts Bedeutendes neben sich; Antoine Arnault, Pierre Lebrun waren die Dichter, die den Ton fanden, der dem großen Napoleon gefiel. Anne Louise Germaine
#SE033-033
de Staël, eine Frau, welche die in Deutschland herrschenden Anschauungen auf ihren Reisen eingesogen hatte und eine Vorkämpferin moderner Anschauungen war, fand des Cäsaren Beifall nicht.
Die deutsche Romantik legte den Weg zurück von der Verherrlichung der Goetheschen, aus der antiken Kunst geholten Anschauungen, durch die Vertiefting in die mystisch-christlichen Vorstellungen einer verflossenen Zeit, bis zu den Handlangerdiensten, die sie in der Zeit der Reaktion dem römischen Ultramontanismus und den absolutistischen Gelüsten der Fürsten geleistet hat. Das war ein Zeit der Größe in einen verhängnisvollen Weg durch eine Verfall hinein. Die Franzosen erreichten diese letzte Stufe viel schneller. Schon 1802 erschien «Génie du christianisme ou les beautés de lä religion chrétienne» von Franqois René Vzcomte de Chateaubriand, in dem die Schönheit und Größe des Christentums gepriesen wurde, gegenüber allen Früchten, die Vernunft und Aufklärung bringen können. Derselbe Schriftsteller setzte diese Verherrlichung des Christentums später in seiner Dichtung «Les märtyrs» fort. Ein lyrischer Nachtreter Chäteäubriänds war Alphonse de Lilmartine, der zu der mystischen Gesinnung auch nuch die nötige Stimmung hinzufügte. Ein Poet mit allen Schwächen und Vorzügen des französischen Volkschäräkters war Pierre Jean Béranger, der liebenswürdige Liederdichter, dem reizvolle Sinnlichkeit, wohlklingende Rhetorik und auch einschmeichelnde Trivialität zur Verfügung ständen. Gleichzeitig mit diesen Dichtern, welche die französische Romantik, die zeitlich viel später als die deutsche und englische auftrat, vorbereiteten, wirkte der Prosaist Paul Louis Courier, der ein aufrichtiger, geistvoller Verfechter der
#SE033-034
Freiheit auch in der trüben Zeit der französischen Reaktion war, in der man Stimmen wie die seinige nicht gern hörte.
Älle die literarischen Bewegungen, die hier geschildert wurden, stehen im Zusammenhange mit den großen politischen und geistigen Bestrebungen um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Sie wurden abgelöst von den Geistesströmungen, die mit den politischen Revolutionen um die Mitte des Jahrhunderts Hand in Hand gingen.
#SE033-035
#TI
1840-1871
#TX
Goethe, Schiller und die Romantiker haben vor allem anderen ein künstlerisches Ideal im Auge gehabt: welche Forderungen der wahre Künstler an sich stellen muß, darauf ist es ihnen angekommen. Goethe hat auf der Höhe seiner Entwichelung sich in die Kunst der Griechen vertieft, weil er glaubte, daß bei ihnen das echte Künstlertum am reinsten zur Ausbildung gekommen sei. Schiller hat in weitausblickenden Abhandlungen («Über das Erhabene», «Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen», «Über naive und sentimentalische Dichtung») sich über die Bedingungen des künstlerischen Schaffens zu orientieren gesucht. Die Romantiker studierten die Literaturen verschiedener Zeiten und Völker, um sich über das Wesen des Schaffens aufzuklären. Diese Stellung des Menschen zur Kunst ist eine andere bei den Geistern, die Goethe und die Romantiker ablösten. Man bekam die Empfindung, daß ein solches Betonen des Künstlerischen als solchen die Kunst vom Leben entferne, und daß man das wirkliche Leben der Kunst wieder nähern müsse. Diese Empfindung beherrscht alle Bestrebungen derjenigen Dichter und Schriftsteller, die in der Geschichte des deutschen Geisteslebens unter dem Namen des «Jungen Deutschland» zusammengefaßt werden, eine Bezeichnung, die sich zuerst in einem Buche des Kieler Ästhetikers Ludolf Wienbarg «Ästhetische Feldzüge» (1834) fand, das die Widmung trug: «Dem jungen Deutschland, nicht dem alten, weihe ich dieses Buch». Hier wurde einer Kunst, die sich außerhalb des Lebens stellt, der Krieg erklärt. Aus der lebendigen Wirklichkeit heraus, aus einem harmonischen, den Menschen wahrhaft befriedigenden Dasein
#SE033-036
sollte die Kunst geboren werden. Wienb arg sah in dem hellenischen, ebenso wie in dem neueren, aus dem Christentum stammenden Lebensideal nur Einseitigkeiten. Den Griechen kam es auf Idealisierung des Sinnlichen, auf Ausgestaltung des körperlich Schönen an; das neuere Lebensideal hat das Geistige bevorzugt. Diese beiden Ideale sollten sich nun in einer höheren Einheit zusammenfinden, Sinnlichkeit und Geist sollten in gleicher Weise zu ihrem Rechte kommen. Von diesem allgemeinen Gesichtspunkt aus kam man zu Urteilen, die wesentlich verschieden waren von denen Goethes, Schillers und der klassischen sowohl wie der romantischen Epoche in der Literatur. Schillers Sprache und seinen idealen Schwung, Goethes stilvolle Ausdrucksweise schätze Wienbarg geringer als die Prosa, die sich möglichst an das unmittelbare Leben anschließt.
Wienbarg hat in seinem Buche nur zu einem deutlichen Ausdruck gebracht, was sich im geistigen Leben Deutschlands nach der Herrschaft der Romantiker vollzog. Charakteristisch für diesen Umschwung war das schriftstellerische Wirken Ludwig Börnes, dessen Grundzug nicht eine künstlerische, sondern eine politische Gesinnung war. Das Wort «politisch» muß, wenn man es auf diesen Schriftsteller anwendet, allerdings in dem erweiterten Sinne genommen werden, daß es alles umfaßt, was sich auf die Entwickelung der Menschheit, auf deren Fortschritt im geschichtlichen Leben bezieht. Die Kunst stand Börne um so höher, je mehr sie sich in den Dienst dieses menschlichen Fortschrittes stellt. Im Sinne dieser seiner Überzeugung leitete er die Zeitschriften, die er herausgab (die «Zeitschwingen», von 1814 an, und später die «Wage», von 1818-21); sie herrscht in allen seinen Werken und wird besonders anschaulich in seinen
#SE033-037
«Dramaturgischen Blättern», in denen er die dramatischen Kunstwerke nach sittlichen und politischen Grundsätzen beurteilte; die Gesinnung der Dichter, den moralischen Gehalt ihrer Leistungen rückte er in den Vordergrund. Der große Ernst seines Wesens und ein sprudelnder Witz machen den Zauber seiner Arbeiten aus. Alles, was er schrieb, stammt aus einer moralisch hochstehenden Natur und aus einem Kopfe, dessen Gedanken ebenso treffend wie geistreich waren; eine unvergleichliche Fundgrube solcher Gedanken sind seine «Briefe aus Paris» (1832-34). Wegen dieser seiner Natur war Börne ein Gegner Goethes, dessen rein künstlerische Gesinnung sein politisches und ethisches Pathos zum Widerspruche reizte. Goethes Kunstauffassung und Weltanschauung erschienen ihm lebensfeindlich. Eine solche Persönlichkeit, meinte Börne, entziehe dem Leben, dem Fortschritte der Menschheit ihre Kräfte. Einen tiefen Eindruck machte auf Ludwig Börne die Julirevolution; in den Tendenzen, die ihr zugrunde lagen, sah er etwas, was mit seinen Zielen verwandt war, denn er war seiner ganzen Anlage nach ein revolutionärer Geist. Aufrütteln wollte er seine Mitmenschen, damit sie die Schritte beschleunigten, die zur Freiheit hinführen. Wenn er bitter und ungerecht gegen Menschen und Zustände wurde, so entsprang das aus der wärmsten Begeisterung für den sittlichen und politischen Fortschritt.
Eine ganz anders geartete Persönlichkeit war Heinrich Heine. Er verdankte seine künstlerische Bildung noch ganz der romantischen Strömung, aber er war zugleich der Zerstörer dieser Geistesrichtung. In seinen Gedichten lebt das Träumerische der Romantik neben einem derben, realistischen Hineingreifen in das Leben. Wir haben bei der Schilderung
#SE033-038
der Romantik gesehen, wie sich die geniale Persönlichkeit über die Wirklichkeit hinwegsetzte und sich nach freier Willkür eine eigene Welt aufbauen wollte. In Heines Witz lebt diese Empfindung von der souveränen Persönlichkeit fort. Er nimmt den Anlauf zu den höchsten Gefühlen und verhöhnt diese wieder mit launenhaftester Willkür. Gerade durch diese Eigenheit ist Heine zu einer viel umstrittenen Persönlichkeit geworden. Das Spiel, das er mit Empfindung und Ausdruck treibt, machte diejenigen zu seinen Gegnern, die gegenüber den heiligsten Gefühlen nur Ernst und Würde gelten lassen wollen; die Anmut, Leichtigkeit, die Eleganz und der Reichtum des Geistes machen ihn zum Liebling aller, die vor allem nach ästhetisch-künstlerischen Genüssen streben. In seiner Seele wohnen die Gaben des wahrhaften Dichters, des sinnigen Märchenerzählers und des mephistophelischen Zynikers nebeneinander, und in seinen besten Schöpfungen hat die Frivolität neben den edelsten Vorstellungen Platz. Sein «Buch der Lieder» (1827) läßt deutlich den Einfluß der Romantiker, zum Beispiel Eichendorffs, erkennen; als ganz selbständiger Geist erscheint er dagegen in seinen «Reisebildern» (1826-31). Der frische, originelle Charakter, der sich in ihnen ausspricht, machte ihn bald zu einem viel gelesenen Schriftsteller. Die vollendetste Grazie des Stils und ein prickelnder Witz erscheinen in diesem Buche als der Ausfluß eines überlegenen Geistes. Die Persönlichkeit des Dichters tritt allerdings bisweilen stark in den Vordergrund, so daß es oft aussieht, als wenn es ihm auf das Kokettieren mit dieser Persönlichkeit allein ankäme; aber nicht minder oft scheint es, als wenn Heine durch seinen Witz, durch sein Spiel mit Empfindung und Gefühl nur sich selbst über eine schmerzliche Grundstimmung
#SE033-039
in seiner Seele hinweghelfen wollte. Dadurch fühlte er sich zu dem großen Dichter des Weltschmerzes hingezogen, zu Byron. Töne, die wir aus den Werken dieses Dichters zu hören gewohnt sind, klingen immer wieder bei Heine an. Was aus einer solchen Grundstimmung zu einer höheren Befriedigung führt, eine harmonische Weltauffas-sung, fehlte ihm allerdings. Er schwankt unsicher hin und her zwischen Romantik und nüchterner Verstandesaufklä-rung. In der Vorrede zu seinem «Atta Troll» (1841) hat er ein bezeichnendes Wort über sich ausgesprochen: «Ich schrieb Atta Troll zu meiner eigenen Lust und Freude in der grillenhaften Traumweise jener romantischen Schule, wo ich meine angenehmsten Jugendjahre verlebt und zuletzt den Schulmeister durchgeprügelt habe. In dieser Beziehung ist mein Gedicht vielleicht verwerflich. Aber du lügst, Brutus, du lügst, Cassius und auch du lügst, Asinius, wenn ihr behauptet, mein spott träfe jene Ideen, die eine kostbare Errungenschaft der Menschheit sind und für die ich selber so viel gestritten und gelitten habe. Nein, eben weil dem Dichter jene Ideen in herrlichster Klarheit und Größe beständig vorschweben ergreift ihn desto unwiderstehlicher die Lachlust, wenn er sieht, wie roh, plump und täppisch von der beschränkten Zeitgenossenschaft jene Ideen aufgefaßt werden.» In «Atta Troll»und in der 1844 geschriebenen Dichtung «Deutschland. Ein Wintermärchen» wird mit scharfer Satire und Bitterkeit dem damaligen Deutschland ein Spiegel vorgehalten. In den «Neuen Gedichten» (1844) treten des Dichters Vorzüge hinter einer von Frivolität nicht freien, zynischen Lebensauffassung zurück.
Börne und Heine strebten durch ihre Naturen aus der Romantik heraus. Sie waren anders veranlagte Menschen
#SE033-040
als die Schlegel, Novalis, Görres und so weiter; deshalb nahm ihr Wirken auch einen von der romantischen Strömung verschiedenen Charakter an. In welchem Grade sich aber diese Strömung schon in den zwanziger Jahren des Jahrhunderts überlebt hatte, das zeigt sich am klarsten bei Karl Immermann. Er war keine geniale Persönlichkeit wie Heine und hätte deshalb gewiß, wenn auch nicht Hervorragendes, so doch Gediegenes im Sinne der romantischen Schule geleistet, wenn sein Auftreten in deren Blütezeit gefallen wäre. Ihm war es aber gerade auferlegt, schmerzlich zu empfinden, daß eine bedeutende Kunstepoche sich überlebt hatte, und nicht in sich selbst die Kraft zu haben, neue Ideale hervorzubringen. Als Nachzügler großer Vorfahren fühlte er sich, und ein solcher war er auch. Das kommt in seinem Roman «Die Epigonen» (1836) deutlich zum Ausdruck. Eine weltschmerzliche Stimmung herrscht in diesem Werke. Der Dichter spricht über seine Zeit ein herbes Urteil und macht ihr zum Vorwurf, daß sie hinter der Vergangenheit so weit zurückstehe. Er selbst konnte nur durch Anlehnung an große Vorfahren, an Shakespeare, Goethe, Calder6n, etwas erreichen. Seine Dramen «Das Tal von Ronceval», «Edwin>, «Petrarca», «Auge der Liebe», «Cardenio>, «Trauerspiel in Tirol», «Alexis» sind durchaus Schöpfungen eines unselbständigen Geistes. Sie beweisen aber, daß Immermann eine gewisse Fähigkeit zum dramatischen Aufbau, zur fesselnden Komposition der Handlungen hatte. Deshalb konnte er der Gründer einer deutschen Musterbühne und einer echt künstlerischen Dramaturgie werden. Der Mangel seiner Begabung trat am schlimmsten in seinem «Merlin> zutage. Merlin ist das Gegenbild zu Christus, der Sohn einer Jungfrau und des Satans; in ihm
#SE033-041
kommt das Böse zur Wirklichkeit. Der Dichter hat es nicht vermocht, diesem alten sagenhaften Motiv neues dichterisches Leben zu geben. Wesentlich glücklicher war er in seinem 1838 erschienenen Roman «Münchhausen», in dem er die Hohlheit und Heuchelei der höheren Gesellschaft dem kernigen, gesunden Wesen des deutschen Bauernstandes gegenüberstellte.
Die Entwickelung, welche die deutsche Dichtkunst im zweiten Drittel des Jahrhunderts durchgemacht hat, kann man auch durch die Gegenüberstellung Franz Grill parzers und des um 22 Jahre jüngeren Friedrich Hebbel erkennen. Grillparzer stand mit seinem Kunstempfinden ganz innerhalb der Anschauungen Goethes und Schillers, Hebbel ging über diese in solchem Maße hinaus, daß man ihn durch die Aufgaben, die er sich stellte, geradezu als einen Vorläufer Henrik Ibsens bezeichnen kann. Sieht man von der «Ahnfrau», dem ersten ganz aus den Schicksalsideen der Romantiker hervorgegangenen Drama Grillparzers ab, so kann man sagen, daß es sich bei ihm stets darum handelte, in der Entwickelung der Charaktere und der Gestaltung der Handlung den Anforderungen klassischer Schönheit zu entsprechen; die künstlerischen Gesetze innerer Harmonie leiteten ihn, wenn er menschliche Leidenschaften schilderte und Vorgänge zur Darstellung brachte. Hebbel dagegen wandte sein Interesse vor allen Dingen den sittlichen Fragen der menschlichen Seele zu; er suchte weniger eine Motivierung nach künstlerischen, sondern vielmehr eine solche nach psychologischen Gesetzen. Daher kommt es, daß Grillparzer der Dichter einer ruhigen, vollendeten Schönheit wurde, Hebbel aber die reinen Schönheitsgesetze oft außer acht ließ, um einen bestimmten Zug der Seele, einer starken Leidenschaft
#SE033-042
einen charakteristischen Ausdruck zu geben. Grillparzers Dramen «Sappho», «Das goldene Vließ», «König Ottokars Glück und Ende», «Der Traum ein Leben», «Weh' dem, der lügt», «Die Jüdin von Toledo» und seine unvollendet gebliebene «Esther» verwirklichen auf dramatischem Gebiet dasjenige, was Goethe nach seiner italienischen Reise als Kunstideal hingestellt hat. Die Liebe in idealer Gestalt kommt in «Sappho», der natürliche Seelenadel und die Hoheit der Empfindung eines Weibes in der «Medea» - dem dritten Teile der Trilogie «Das goldene Vließ -, die männliche, heldenhafte Energie im «König Ottokar» zum vollendet schönen Ausdruck. Hebbel schreckte hingegen nicht zurück, das Menschliche bis zum Gigantischen zu steigern, wenn es sich darum handelt, weibliche Leidenschaft, wie in seiner «Judith», männliche Eifersucht, wie in «Herodes und Mariamne», oder das Unglück, das aus den gesellschaftlichen Vorurteilen und Verhältnissen hervorgeht, wie in «Maria Magdalena», zu zeichnen. In «Gyges und sein Ring» schildert er die Rache, zu der das Weib durch Verletzung seines Schamgefühles kommen kann, und in den «Nibelungen» stellt er menschliche Stärke und Schwäche in wahrhaft übermenschlicher Größe dar.
Ein anderer bedeutender Dichter, der wie Grillparzer noch ganz unter dem Einflusse klassischer Kunstanschauungen stand, war Otto Ludwig. Ohne ursprüngliche starke Veranlagung, suchte er sich durch bewußtes Vertiefen in die Gesetze der Kunst zu einer gewissen Höhe emporzu-arbeiten. Die erst nach seinem Tode veröffentlichten «Shakespeare-Studien» zeigen, wie gewissenhaft er über die Geheimnisse des dichterischen Schaffens grübelte. Obwohl er in seinen Dramen «Der Erbförster» und «Die Makkabäer»
#SE033-043
starke Leidenschaften schildert, haben diese Werke etwas Erklügeltes. Nur die Erzählung «Zwischen Himmel und Erde» läßt vergessen, daß nicht die Phantasie, sondern der Verstand den Dichter leitete.
In vollkommen bewußter Weise, mit dem klaren Ziel, eine neue Lebens- und Kunstauffassung heraufzuführen, stellten sich die Geister des «Jungen Deutschland», Gutzkow, Laube, Mundt, auf den Boden, den Wienbarg in seinen «Ästhetischen Feldzügen» bezeichnet hatte. Der bedeutendste in diesem Kreise war Karl Gutzkow, der am Ende der zwanziger Jahre in Berlin Hegels Vorlesungen gehört und die Vorstellungen eingesogen hatte, mit denen dieser Philosoph den Entwickelungsgang der Menschheit in der Geschichte erklärte. Die Idee Hegels, daß die Geschichte der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit sei, hat großen Eindruck auf den damals neunzehnjährigen Gutzkow gemacht. Und als die Nachrichten von der Pariser Julirevolution nach Deutschland kamen, da bekam der Drang nach persönlicher und sozialer Freiheit in seiner Seele einen mächtigen äußeren Anstoß. Er wollte sich hinfort ganz der Sache des Fortschrittes widmen. Die Schärfe und Klarheit seines Denkens befähigten ihn, sich in alle neuen Zeitideen rasch einzuleben, so daß er bald ein hervorragender Darsteller derselben wurde. Leicht ist es allerdings auch ihm nicht ge-worden, die romantischen Anschauungen völlig abzustreifen, und in seinem Erstlingswerk «Briefe eines Narren an eine Närrin» (1832) treffen wir noch deutlich auf sie. Schon in seinem nächsten Roman «Maha-Guru, Geschichte eines Gottes» (1833) kam aber eine neue Auffassung zur Geltung. Die Verherrlichung des unmittelbaren Lebens, der irdischen Ideale auf Kosten der jenseitigen, ist die Grundidee des
#SE033-044
Buches. Eines freien Daseins sollte sich der Mensch erfreuen, das nicht durch die hergebrachten gesellschaftlichen und religiösen Vorurteile in Fesseln geschlagen ist: das war Gutzkows Meinung. Das Verhältnis der beiden Geschlechter in diesem Sinne zu zeigen, stellte er sich in seinem Roman «Wally, die Zweiflerin» (1835) zur Aufgabe. Es mußte einmal ausgesprochen werden, daß wirkliche Sittsamkeit und Keuschheit nicht in der Unterdrückung, sondern in der Veredelung der Sinnlichkeit besteht. Gut ist nicht derjenige Mensch, der sich die Befriedigung seiner Triebe versagen muß, weil sie sonst ins Unmoralische versinken, sondern der, welcher sich seinem Sinnenleben ruhig überlassen kann, ohne eine solche Abirrung fürchten zu müssen. Diese Ansicht hat Gutzkow auch vertreten in der Vorrede, die er zu Schleiermachers Briefen über Schlegels «Lucinde» (1835) geschrieben hat. In ihr wurden in den schärfsten Worten diejenigen gebrandmarkt, die ein unbefangenes Hingeben an die Sinnenwelt als unmoralisch erklären und gerade dadurch zeigen, daß ihnen der höchste Begriff der Sittlichkeit fremd ist. Es war kein Wunder, daß Gutzkow mit solchen Anschauungen auf heftigen Widerstand stieß. Wolfgang Menzel war es, der am lautesten seine Stimme dagegen erhob. Dieser als Geschichtsschreiber nicht unbedeutende Mann war auf sittlichem und künstlerischem Gebiete von den einseitigsten Urteilen beherrscht. In grober, derber Ausdrucksweise verwarf er alles, was mit seinen philisterhaften moralischen und politischen Ansichten nicht zusammenstimmte. Auch Goethes Lebensführung und Kunst bezeichnete er von seinem pedantischen Richterstuhle aus als unsittlich. Er war ein gewandter Journalist und übte in den dreißiger Jahren als Herausgeber des Stuttgarter Morgenblattes
#SE033-045
einen bedeutenden kritischen Einfluß auf die Literatur aus. Seinem sicheren Blicke konnte nicht entgehen, daß in dem jungen Gutzkow eine bedeutende Kraft steckte. Er zog ihn daher zuerst in seine Nähe und ließ ihn fleißig für seine Zeitung arbeiten. Als aber durch die genannten Schriften Gutzkows Denkungsart in ihrer vollen Gestalt ans Licht trat, da wurde Menzel sein schärfster öffentlicher Ankläger. Zu dieser literarischen Agitation gegen die neue Weltanschauung gesellte sich auch noch eine politische: im Dezember 1835 verbot ein Bundestagsbeschluß alle Schriften der neuen Richtung, die Heines, Gutzkows, Wienbargs, Mundts und Laubes - auch die künftigen! Nicht einmal der Name dieser Männer durfte eine Zeitlang in deutschen Schriften genannt werden. Gutzkows feine Beobachtungsgabe für alles, was im geistigen Leben vorgeht, trat in einer Reihe bemerkenswerter Schriften in der Folgezeit zutage. «Zur Philosophie der Geschichte» (1836) bietet eine gedankenvolle Sammlung von Aphorismen über den Werdegang des menschlichen Geistes, «Goethe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte» (1836) dringt tief in den Geist des großen Dichters ein, «Börnes Leben» (1840) liefert eine verständnisvolle Charakteristik dieses Schriftstellers. Auch die geistigen Physiognomien anderer Zeitgenossen hat Gutzkow in einer Folge von Aufsätzen (später unter dem Titel «Säkularbilder» in den gesammelten Werken) treffend gezeichnet.
Welch harten Kämpfen derjenige ausgesetzt ist, der den überkommenen Ideenkreisen entgegentritt, mußte Karl Gutzkow in vollem Maße erfahren. Seine als unmoralisch angesehenen Schriften trugen ihm die Verurteilung zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe ein. Besonders schmerzlich
#SE033-046
aber war ihm, daß seine Gedanken- und Empfindungswelt auch Personen, mit denen ihn tiefere Neigungen verknüpften, von ihm abfallen ließ. Aus solchen schmerzlichen Gefühlen heraus ist die kleine Novelle «Der Sadducäer von Amsterdam» entstanden. In ihr wird der Gegensatz eines Menschen mit neuen, eigenen Anschauungen zur Gesellschaft geschildert. In vollkommenerer Weise hat Gutzkow dieselbe Idee dann 1847 in seinem Drama «Uriel Acosta» zur Darstellung gebracht; ein gutes Stück der Leiden, die der Held dieses Dramas zu bestehen hat, erfuhr der Dichter an seiner eigenen Person. Sie haben es auch bewirkt, daß er sich im späteren Alter immer mehr von den Lebenskämpfen zurückzog und auf deren Betrachtung und Darstellung beschränkte, ohne selbst tätig Anteil an ihnen zu nehmen. Schon in seinem psychologischen Roman «Blasedow und seine Söhne» (1838 bis 1839) überwiegt diese Beobachtung der Zeitverhältnisse von einem Standpunkt außerhalb ihrer selbst; völlig zum Durchbruche kam sie aber erst in den beiden großen Werken der fünfziger Jahre: «Die Ritter vom Geiste» (1850-52) und «Der Zauberer von Rom» (1858-61). In dem ersteren Roman werden von hoher Warte herab alle Zeitströmungen und typischen Zeitcharaktere in einem Kulturbild allerersten Ranges geschildert. Was in den Tiefen des Lebens seiner Zeit gärt, wohin die Geister streben, was sie vorwärts bringt und rückwärts drängt: alles wird plastisch in anschaulicher Breite und aus den genauesten Kenntnissen heraus dargestellt. Wie Gutzkow jedes berechtigte Streben zu würdigen wußte, dafür liefert sein Eintreten für einen begabten Dichter, der leider schon in seinem 24. Jahre (1837) starb, für Georg Büchner, den Beweis. Er hat dessen nicht ausgereifte, aber von wahrhafter Dichterkraft zeugende
#SE033-047
Tragödie «Dantons Tod» im Jahre 1835 herausgegeben und in die Literatur eingeführt.
Heinrich Laube bewegte sich zwar mit seinen ersten Werken «Das neue Jahrhundert» (1833), in dem er den polnischen Aufstand verherrlichte, und im «Jungen Europa» (1833-37), in dem er gegen gesellschaftliche und staatliche Schranken auftrat, in derselben Richtung wie Karl Gutzkow. Allein er hatte weder den gleichen Ernst der Gesinnung, noch die Tiefe der Lebensauffassung. Er war im Grunde eine auf die künstlerischen Äußerlichkeiten sehende Natur. Seine Dramen «Essex», «Die Karlsschüler» u. a. sind auf Theaterwirkung berechnete, die Regeln der Dramaturgie klug benützende Leistungen. Seine Hauptverdienste hat er sich auch nicht als Schriftsteller, sondern als Leiter des Leipziger Stadt-, des Wiener Burg- und Stadttheaters erworben. Seine dramaturgische und Regietätigkeit gilt heute noch in den Kreisen der Theaterfachleute als musterhaft und unübertroffen.
Die geringste Bedeutung innerhalb des «Jungen Deutschland» gewann Theodor Mundt. Er bekannte sich zwar zu den Grundsätzen der neuen Gedankenwelt, hatte aber nicht die künstlerische Kraft, sie in seinen Romanen zum Ausdruck zu bringen, die emanzipierte Frauen und aus ihrer Zeit hinausstrebende Naturen in doktrinärer, wenig fesselnder Weise behandeln.
Gleichzeitig mit diesen Vertretern des «Jungen Deutschland» kämpften philosophisch angelegte Geister für eine neue Weltanschauung. Die Hegelsche Philosophie hatte, während ihr Begründer in Berlin lehrte (1818-30), rasch sich aller tiefer strebenden Köpfe bemächtigt. Ihr Einfluß auf das wissenschaftliche, künstlerische, politische und soziale
#SE033-048
Leben war in Hegels letzten Lebensjahren ein solcher, wie ihn nie ein philosophisches System gehabt hat. Die Art, wie dieser Denker in einem weitausschauenden Gedankengebäude alles Wissen umfaßte, bewirkte, daß sich ihm auch diejenigen anschlossen, die zu mehr oder weniger abweichenden Meinungen gekommen wären, wenn sie auf die Sprache ihres eigenen Geistes gehört hätten. Nach dem Tode Hegels kamen diese Abweichungen dafür um so heftiger zum Vorschein. Die jüngeren Philosophen legten des Lehrers Worte nicht mehr unbefangen aus, sondern deuteten sie in ihrem eigenen Sinne um oder suchten sie ihren Ansichten gemäß fortzuentwickeln. In diese aus dem Hegeltum heraus sich entwickelnde philosophische Strömung wurden die religiösen Fragen aufgenommen und einer lebhaften Diskussion unterworfen. Hegel war der Ansicht, daß alle Wahrheit ihren höchsten, richtigsten Ausdruck in der philosophischen Gedankenwelt findet. Aber er war auch der Meinung, daß die Philosophie nicht die einzige Form für die Wahrheit ist -auch in der Religion ist sie vorhanden, nur noch nicht in der klaren, begrifflichen Weise, sondern als anschauliche Vorstellung in Sinnbildern. Diese Idee griff David Friedrich Strauß auf und bildete sie weiter. In seinem Buche «Das Leben Jesu» (1835-36) unterwarf er die evangelische Geschichte einer scharfsinnigen Kritik und kam zu dem Schlusse, daß dieselbe nur eine mythische Darstellung philosophischer Wahrheiten ist. Die ganze Menschengeschichte und jedes einzelne Menschenleben sind eine Verkörperung der göttlichen Wesenheit. Alles, was in der Welt zu jeder Zeit geschieht, ist eine Erscheinung dieses Göttlichen. In der evangelischen Geschichte hat die mythenbildende Neigung des menschlichen Geistes nur in einem einzelnen Fall bildlich
#SE033-049
hingestellt, was sich immer und überall vollzieht: die Menschwerdung Gottes. In noch viel radikalerer Weise griff bald Bruno Bauer in den Streit der Geister ein. Er prüfte die christlichen Wahrheiten von dem Standpunkte des menschlichen Selbstbewußtseins aus und ließ nur den Glauben an dasjenige gelten, was der Mensch aus dem eigenen geistigen Vermögen heraus als wahr anerkennen kann. Damit war einer besonderen kirchlichen Lehre neben der aus dem Geiste des Menschen heraus gewonnenen der Krieg erklärt. Ähnliche kritische Maßstäbe wurden nun auch an die anderen Verhältnisse des Lebens, an die Moral, den Staat, die Gesellschaft gelegt. Arnold Ruge und Echtermeyer begründeten im Jahre 1838 zur Vertretung solcher Fragen eine Zeitschrift, die «Halleschen Jahrbücher», die bald (1841) als so staatsgefährlich angesehen wurden, daß Preußen ihr Erscheinen verbot und sie nach Sachsen übersiedeln mußten.
Einen weiteren Schritt auf diesem Wege bedeutete Ludwig Feuerbachs Buch «Das Wesen des Christentums» (1841). Feuerbach ging von der Voraussetzung aus, daß der Mensch sein Wissen nur aus sich selbst gewinnen könne. Wenn dies aber der Fall ist, so kann der Mensch auch über kein höheres Wesen als über sich selbst irgendwelche Kenntnisse haben. Er soll daher vor allen Dingen Menschenkunde, Anthropologie, treiben. Nur weil der Mensch im Laufe seiner geschichtlichen Entwickelung nicht mit einer solchen zufrieden war, nahm er seine Zuflucht zu religiösen Vorstellungen. Er fand in sich den Gedanken des Menschen, stattete diesen mit allen Vollkommenheiten aus, zu denen sich menschliche Eigenschaften steigern lassen, idealisierte das Bild des Menschen und versetzte es als Gott in die Außenwelt. Es ist Feuerbachs Ansicht, daß der Mensch sich den Gott nach
#SE033-050
seinem eigenen Bilde geschaffen habe. Deshalb soll, nachdem dies erkannt ist, an die Stelle der Theologie die Anthropologie treten. Das Wissen über das Natürliche, das sich für die Sinne wahrnehmbar in Raum und Zeit ausbreitet, sollte nunmehr an die Stelle des Glaubens an das Übernatürliche treten. Auch in sittlicher Beziehung war damit eine wichtige Konsequenz verknüpft. Wenn der Mensch als das höchste Wesen angesehen wird, so kann auch das Handeln kein anderes Ziel haben, als das Ideal der Menschheit in vollkommenstem Sinne zu verwirklichen. Im Sinne dieser Moral wird ein Mensch um so tugendhafter sein, je mehr er sich diesem Ideale nähert. An die Stelle der religiösen Sittenlehre soll eine humane gesetzt werden. Wo Feuerbach diesen Gedanken fallen gelassen hat, nahm ihn Max Stirner wieder auf. Er sagte sich, wenn man nur das Wirkliche, das im Raum und in der Zeit Vorhandene gelten läßt, so muß auch das Ideal des «vollkommenen Menschen» fallen. Denn wirklich vorhanden ist nur der einzelne Mensch, nicht eine allgemeine Menschheit. Fühlte sich Feuerbach noch gedrängt, das Leben so einzurichten, daß es dem Ideale des Menschen nahekommt, fühlte er sich so gewissermaßen der ganzen menschlichen Gattung gegenüber verantwortlich, so empfindet Stirner eine solche Verantwortlichkeit nicht. Wer ein allgemeines Menschheitsideal anerkennt, muß auch zugeben, daß sich dieses nicht im Einzelnen, sondern nur in der ganzen Gattung ausleben kann. Der Einzelne geht zugrunde, die Gattung lebt weiter und entwickelt auch das Ideal weiter. Wird aber dieses Ideal als Spuk, als Hirngespinst hin-gestellt, wie Stirner das tut, dann hat der Mensch ihm gegenüber auch keine Verpflichtung. Er braucht sich nach nichts als nach seinen eigenen Neigungen zu richten, er ist
#SE033-051
nur sich allein verantwortlich. Diesen Standpunkt hat Stirner in seinem Werk «Der Einzige und sein Eigentum>
(1845) vertreten.
Man sieht hieraus, daß innerhalb des deutschen Denkens nach einer auf die erfahrungsmäßige Wirklichkeit gerichteten Weltanschauung gestrebt wurde. Es ist daher begreiflich, daß gerade in Deutschland Darwins Entdeckung von der natürlichen Entstehung der organischen Arten mit Begeisterung aufgenommen und von Denkern, die etwas vom Geiste Feuerbachs und seiner Zeit in sich aufgenommen hatten, zu einer Art natürlicher Religion ausgestattet worden ist. In ausgesprochenem Gegensatz zu diesen aus den Anschauungen Hegels sich entwickelnden Ideen stand der altgewordene Schelling, der eine nur durch vernünftige Gedankenentwickelung gewonnene Weltanschauung für unfähig hielt, die höchsten geistigen Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen, und deshalb nach einer Ergänzung durch eine höhere, aus der göttlichen Wesenheit selbst stammenden Wahrheit strebte. Friedrich Wilhelm IV. berief diesen Philosophen, der bis dahin seine «Philosophie der Offenbarung» in München gelehrt hatte, 1840 nach Berlin, um ein Gegengewicht zu haben gegen die Lehren der jüngeren Denker, die dem romantischen Sinne und den religiösen Überzeugungen des Königs wenig entsprachen. Der Einfluß der neuen Geistesrichtungen war aber damals so groß, daß Schellings Auftreten in Preußens Hauptstadt völlig wirkungslos blieb.
Das Ziel des «Jungen Deutschland», ein lebendiges Verhältnis zwischen Dichtung und Leben herzustellen, fand eine radikale Fortsetzung in der Bewegungsliteratur der vierziger Jahre. Ihr Hauptmerkmal liegt darin, daß sich die
#SE033-052
politische Stimmung der Zeit in den poetischen Schöpfungen unmittelbar aussprach. Die Unbehaglichkeit über die öffentlichen Zustände suchte einen dichterischen Ausdruck. Der größte Teil der aus dieser Stimmung hervorgegangenen Dichtungen hat keine bleibende Bedeutung. Sie vermochten nur in der Zeit einen tieferen Eindruck zu machen, in der weiteste Kreise von denselben Empfindungen ergriffen waren, wie diese politischen Sänger. Die Ärmlichkeit des Gedankengehaltes und der kleine Umkreis der Stoffe konnten späteren Epochen nicht von Interesse sein. Die «Unpolitischen Lieder», die August Heinrich Hoffmann, genannt , in den Jahren 1840 und 1841 herausgab, machen in dieser Richtung den Anfang. In einem derben studentischen Ton und oft mit schlagenden Witzworten wurden hier Aristokratie, Muckertum und Polizei angegriffen. Die eigentliche Begabung Hoffmanns von Fallers-leben zeigte sich aber nicht auf diesem Gebiete, sondern in der Schilderung des kindlichen Lebens, das er in Weisen besang, die an echte Volkslieder erinnern. Seine Tüchtigkeit als Erforscher von Sprachdenkmälern und der Volks-poesie befähigten ihn ganz besonders dazu. - Hinreißend wirkte in dieser Zeit Georg Herwegh, dessen «Gedichte eines Lebendigen mit einer Widmung an den Verstorbenen» 1841 in Zürich und Winterthur erschienen. Die schwungvolle Beredsamkeit und die Unerschrockenheit, mit denen hier von Freiheit und Menschenwürde gesungen wird, regte die Gemüter auf. Herwegh war eine Zeitlang der Lieblings-dichter vieler, bis man erkannte, wie wenig innere Wahrheit in seinem Pathos steckte, und daß die Begeisterung, die aus seinen Liedern sprach, doch nur eine erkünstelte war. Die frische, energische Gesinnung, die damals in Deutschland
#SE033-053
herrschte, bewirkte, daß auch mancher weniger bedeutenden Persönlichkeit Wertvolles gelang. Im «Rheinischen Jahrbuch» für 1841 erschien zum Beispiel das kräftige Lied «Der deutsche Rhein» von Nicolaus Becker. «Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein» war ein Wort, das im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeitseele heraus gesprochen war. Es war eine Erwiderung auf die Worte, die Alfred de Musset und andere französische Dichter über den Rhein hatten vernehmen lassen. Mit einem Rheinliede machte auch der politische Dichter Robert Prutz 1840 sich in weiteren Kreisen bekannt. «Der Rhein» ist die Dichtung einer gedankenreichen und tieffühlenden Persönlichkeit. Aber der Umstand, daß seine Schöpfungen mehr im Verstande als in der künstlerischen Phantasie ihren Ursprung haben, bewirkte, daß der Beifall, den Robert Prutz mit diesem Liede gefunden hat, bald einer viel kälteren Beurteilung wich. Seine «Politische Wochenstube», die 1843 erschien, ist eine dramatische Satire auf die damaligen politischen Verhältnisse. Sie hatte ebensowenig Wirkung wie seine «Gedichte», die in einzelnen Sammlungen 1843 und 1849 erschienen sind. Weit herzlichere Töne fand Prutz später, als die Zeit der politischen Kämpfe vorüber war. Seine Gedichte «Aus der Heimat» (1858) und die «Herbstrosen» (1865) galten der Liebe und einer oft spielenden, oft aber auch wahrhaft berauschenden Sinnlichkeit. Das Umfassende seines Geistes brachte er in literarhistorischen Werken zur Geltung, wie in der Schrift über den «Göttinger Dichterbund» (1841), einer «Geschichte des deutschen Journalismus» (1845) und den «Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Theaters» (1847).
Eine hervorragende Stellung innerhalb des Kreises politischer
#SE033-054
Dichter nahm Ferdinand Freiligrath ein. Er erregte 1838 allgemeine Aufmerksamkeit mit «Gedichten», in denen er zumeist orientalische Landschaften und Tiere sowie das Leben der Menschen des Morgenlandes in glühenden Farben und in einer klangvollen Sprache schilderte, und trat 1841 mit zarten, gemütvollen Dichtungen auf. Dem politischen Leben fühlte er sich damals so fernstehend, daß er in einem Gedichte im Morgenblatt («Aus Spanien») ausrief: «Der Dichter steht auf einer höheren Warte, als auf den Zinnen der Partei!» Aber schon 1844 überraschte er durch seine Zeitgedichte «Ein Glaubensbekenntnis», die aus einem stürmischen Freiheitsdrang und einem tiefen nationalen Gefühl hervorgingen. Er, der vorher begeistert vom Löwenritt in der Wüste, vom Mohrenfürsten, dem Gnu und Karroo, von der Macht der Liebe gesungen hatte, stürzte sich nun in die politische Dichtung. Ihr gehören auch die Sammlung «Ça ira» (1846) und seine «Politischen und sozialen Gedichte> (1849) an. Freiligrath wurde einer der radikalsten Revolutionspoeten, der die Herzen seiner Zeitgenossen mächtig ergriff durch eine anschauliche, lebens-volle Darstellung und durch seine treue, ehrliche Natur, die trotz der wuchtigsten Freiheits- und Fortschrittsrufe sich ihre Naivität bewahrte. Gedichte wie «Aus dem schlesischen Gebirge», voll tiefen Mitgefühls mit den Unterdrückten, lassen seine freisinnigen Töne in edlerem Lichte erscheinen als diejenigen Herweghs oder Hoffmanns von Fallersleben. Wie echt des Dichters nationale Begeisterung war, zeigen die herrlichen Worte, mit denen er die Siege des Jahres 1870 feierte.
Wie eine allgemeine Zeitstimmung auch Geister in eine Bewegung hineinreißen kann, die gar nicht ihrer Natur
#SE033-055
entspricht, zeigt sich an Franz Din gelstedt, dessen «Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters» 1841 erschienen sind. Der Verfasser ließ, was er gegen die damaligen deutschen Verhältnisse vorzubringen hatte, einen Nachtwächter sagen, der auf seinen nächtlichen Umgängen schildert, was in den Häusern vorgeht, an denen ihn sein Weg vorüberführt. Die Dichtungen sind voll Witz und Geist, ließen sich aber nicht so leicht singen wie diejenigen Hoffmanns von Fallersleben oder Herweghs und fanden deshalb weniger Anklang. Dingelstedt fühlte sich auch bald unbehaglich in der Rolle des Freiheitsdichters; es drängte ihn nach einflußreichen Stellungen, in denen er eine dankbarere, seinen Ehrgeiz mehr befriedigende Wirksamkeit entwickeln konnte. Solche fand er als Leiter der Hoftheater in Stuttgart, München, Weimar und schließlich des Wiener Burgtheaters. Seine Novellen und Dramen fanden auch in der Folgezeit nicht die Anerkennung wie seine Tätigkeit als Dramaturg sowie als Übersetzer und Bearbeiter Shakespearescher Werke.
Auch in Österreich machte sich der Freiheitsdrang der Zeit in politischen Dichtungen Luft. Der Ungar Karl Beck verdankte den Beifall, den er fand, einem aus nationalem Temperament stammenden farbenprächtigen und oft auch überschwenglichen Stile. Seine «Nächte, gepanzerte Lieder> (1838) schilderten die traurige Lage seines Volkes in wahrhaft ergreifender Weise. Auch aus seinen späteren Schöpfungen «Der fahrende Poet» (1838), «Jankó, der ungarische Roßhirt» (1842), «Gesänge aus der Heimat» (1852) und aus einem Roman (1863) «Mater Dolorosa» spricht eine hohe Begabung. Moritz Hartmann und Alfred Meißner knüpfen mit ihren ersten Dichtungen an die Erinnerungen
#SE033-056
ihres engeren Vaterlandes, Böhmen, an, jener mit seiner Sammlung «Kelch und Schwert» (1845), dieser mit seinem «Ziska» (1846). Beide ließen dann noch lyrische und erzählende Dichtungen folgen, die ihnen die Sympathien ihrer österreichischen Volksgenossen in reichem Maße brachten,
Ein Freiheitssänger in ganz anderem Sinne als die genannten war der in Ungarn geborene, aber von deutschen Eltern stammende Nikolaus Lenau. Seine Werke sind nicht aus der politischen Begeisterung, sondern aus der Sehnsucht nach seelischer, innerer Befreiung hervorgegangen; seine schmerzlichen Klagen galten nicht den Verhältnissen der Zeit, sondern der Unvollkommenheit alles Irdischen überhaupt. Eine Weltanschauung, die dem menschlichen Herzen keinerlei Trost bietet, verband sich bei ihm mit einer hohen dichterischen Kraft, die es ihm möglich machte, die schmerzvollen Grundempfindungen seines Wesens in einer erhebenden Weise zum Ausdruck zu bringen. Es ist bezeichnend für Lenau, daß er fand, Goethe habe den Fauststoff «nicht bis in den Grund erschöpft», und diesen deshalb in seiner Weise aufs neue behandelte. Die über den Widersprüchen der Welt schwebende höhere Auffassung, von der Goethe beherrscht war, befriedigte Lenau nicht. In seinen «Gedichten», die 1831 und 1838 erschienen, gibt sich seine Fähigkeit zur Darstellung von Naturstimmungen und die Zerrissenheit seines Gemütes in gleicher Weise kund. In «Savonarola» (1837) und in den «Albigensern» (1842) schilderte er religiöse Kämpfe in düstern Bildern; im «Don Juan», den Anastasius Grün nach seinem Tode herausgab, führte er das Schicksal dieser im Sinnengenuß schwelgenden Persönlichkeit in lyrisch schönen Einzelheiten vor Augen, brachte es aber nicht zu einer planvollen, einheitlichen Lösung der
#SE033-057
gestellten Aufgabe. Der Dichter verfiel 1844 in unheilbaren Wahnsinn und starb 1850. - In scharfem Gegensatz zu Lenaus Lebensansicht stand diejenige seines Freundes Anastasius Grün (Anton Graf von Auersperg), des poetischen Anwaltes einer zugleich freisinnigen und österreichisch-patriotischen Gesinnung. Die günstige Aufnahme, die er schon in seinem vierundzwanzigsten Jahre mit seinen «Blättern der Liebe», dem «Letzten Ritter» und dann 1831 mit den anonym erschienenen «Spaziergängen eines Wiener Poeten» fand, ist zum nicht geringen Teile dadurch zu erklären, daß ein Mitglied einer alten, hohen Adelsfamilie in kampflustiger und siegesfreudiger Weise sich in den Dienst der Freiheit und des Fortschrittes stellte. Seine rückhaltlose Art, von den Menschen und Dingen zu sprechen, sein Mut und sein hoffnungsvoller Blick in die zukünftige Entwickelung der politischen Verhältnisse wirkten überzeugend; er konnte manches scharfe Wort sagen, weil die Lauterkeit seiner Gesinnung und die Echtheit seines Patriotismus nie in Frage gestellt wurden. 1836 veröffentlichte er den epischlyrischen Zyklus «Schutt», in dem er von einem überlegenen Gesichtspunkt aus für eine freie Gestaltung Österreichs eintrat. «Der Pfaff von Kahlenberg» (1850), Grüns reifstes Werk, ist weniger bedeutend in seiner Grundidee, enthält aber eine herrliche Darstellung des Lebens in der Umgebung Wiens zur Zeit Ottos des Fröhlichen. Durch seine Nachbildungen hat Anastasius Grün einen Schatz slovenischer Volksdichtungen in die Literatur eingeführt.
Die Ziele und Anschauungen des «Jungen Deutschland» und der politischen Dichter gaben der literarischen Bewegung des deutschen Volkes in der Zeit von Goethes Tod bis zur Revolution im Jahre 1848 ihre hervorstechendsten
#SE033-058
Charakterzüge. Es gehören aber auch einzelne dichterische Persönlichkeiten dieser Epoche an, in deren Wesen nichts oder doch nur wenig von dieser allgemeinen Zeitphysiognomie zu bemerken ist. Für die wenig tiefgehenden geistigen Bedürfnisse sorgte Ernst Rau pach mit seinen Dramen, die von 1818 bis 1850 erschienen. Hohen künstlerischen Aufgaben strebte der Dramatiker Chr. Dietrich Grabbe nach, dessen Dichtungen trotz der Kraft des Ausdruckes und einer genialen Darstellungsgabe einem gebildeten Geschmacke wenig bieten können. Karl von Holtei ist der Schöpfer schlesischer Gedichte, eines anziehenden Romans «Christian Lammfell» und trefflicher Lustspiele, «Wiener in Paris», «Pariser in Wien». Johann Ludwig Franz Deinhardstein schenkte der Bühne geschmackvolle Stücke: «Hans Sachs» (1829) und «Garrick in Bristol» (1834), die einen großen Erfolg hatten. Eduard Bauern feld verband in seinen zahlreichen Lustspielen Geist und Charakteristik mit großem theatralischen Geschick. 1834 fand er mit seinen «Bekenntnissen» zum ersten Male Anerkennung als Lustspiel-dichter, und von da ab erfreute er sich bis in die siebziger Jahre als solcher der Beliebtheit weitester Kreise. Neben dem fruchtbaren Roderich Benedix, dessen Situationskomik nie in die Tiefe geht, aber oft von gesundem Sinn zeugt, und der in Theaterwirkungen bewanderten, immer auf Rührung hinarbeitenden Charlotte Birch-Pfeiffer, nahm Bauern-feld einen hervorragenden Platz im Spielplan der deutschen Bühnen in dieser Zeit ein. Auf dem Gebiete des ernsteren Dramas wirkte Friedrich Haim (Freiherr von Münch-Bellinghausen), dessen Trauerspiel «Griseldis» 1835 im Wiener Burgtheater großen Beifall fand, der 1857 durch den seines «Fechters von Ravenna> noch überboten wurde. Sein
#SE033-059
Drama «Wildfeuer» (1864) ist bis zur Gegenwart ein gern gesehenes Bühnenstück geblieben.
Aus dem sinnigen und humorvollen Wienertum heraus hat sich der Märchendramatiker Ferdinand Raimund entwickelt, dessen Dichtungen «Der Barometermacher auf der Zauberinsel», «Alpenkönig und Menschenfeind», «Der Verschwender» anfangs nur im Heimatlande des Schöpfers sich Geltung erringen konnten, dem aber eine spätere Zeit volle Würdigung zuteil werden ließ und einen Ehrenplatz neben seinem Landsmann Grillparzer einräumte. Er hat auf dem Gebiete der Wiener Posse keinen ebenbürtigen Nachfolger gefunden.
Einen eigenen Weg, abseits von den großen Zeitbewegungen, ging auch der schwäbische Dichter Eduard Mörike. Ihm stand Goethes Vorbild stets vor Augen; sein Roman «Maler Nolten» (1832) ist in deutlicher Weise von «Wilhelm Meister», seine gemütvollen Gedichte sind von der Goetheschen Lyrik beeinflußt.
Eine bedeutende Wirkung als Lyriker erzielte Emanuel Geibel, dessen Gedichte in den Jahren i 840-64 56 Auflagen erlebten. Natürliche Anmut, ein vollständiges Maßhalten der Empfindungen und die Leichtigkeit, mit der sich seine Lieder singen lassen, machten Geibel zum Liebling breiter Massen der Gebildeten. Von reizvollen Melodien getragen, haben es Gedichte wie «Der Mai ist gekommen, die Baume schlagen aus», «Ein lustiger Musikante marschierte am Nil», «Mag auch heiß das Scheiden brennen» zu einem seltenen Grade von Popularität gebracht. Den stürmischen Leidenschaften ging Geibel aus dem Wege; er war der Dichter der zarten Gefühle. Auch dort, wo seine Phantasie sich in die Natur vertiefte, suchte sie nicht das Gewaltige, sondern das
#SE033-060
Liebliche, wie die Frühlings-, Herbst- und Trinkgesänge seiner «Juniuslieder» (1848) beweisen. Die wilden Freiheitsrufe der politischen Dichter waren ihm zuwider. Dagegen widmete er lange vor der Errichtung des deutschen Reiches dem nationalen Einheitsstreben und dem deutschen Kaisertum, dessen Kommen er voraussah, manches schöne Wort; das Beste davon wurde 1871 in der Sammlung «Heroldrufe» vereinigt. In Geibels Dichtung sind alle Charakterzüge zu bemerken, die das literarische Leben der fünfziger und sechziger Jahre beherrschten. An die Stelle der Forderung nach fernliegenden Idealen und Zielen trat das Interesse für die unmittelbare Gegenwart, für das im Augenblick Erreichbare auf der einen Seite, eine gewisse Mutlosigkeit, ein Mangel an Lebensfreude auf der anderen Seite. Der ersteren Strömung entsprangen nicht nur die Dichtungen eines Oskar von Redwitz, Chr. Fr. Scherenberg, Otto Roquette, Friedrich Martin Bodenstedt, die eine Gegenbewegung gegen die politische Literatur brachten, sondern auch diejenigen Gustav Freytags, Gottfried Kellers, Willibald Alexis', Adalbert Stifters, der Gräfin Ida Hahn-Hahn und der Fanny Lewald, ferner die Schöpfungen Berthold Auerbachs. Die andere Strömung fand ihren Ausdruck in dem tiefgehenden Einfluß, den die lebensfeindliche Lehre Schopenhauers (S.20) übte. Dieser Philosoph war bis zu dieser Zeit so gut wie unbekannt geblieben. Jetzt erlangte er für alle diejenigen einen Wert, die wegen der gescheiterten Hoffnungen der vierziger Jahre zu einer gewissen Resignation gegenüber der Wirklichkeit getrieben wurden und sich deshalb gerne asketische Ideale und die Willensverneinung von einem Denker rechtfertigen ließen. Dazu kam allerdings, daß Schopenhauer sich durch seine
#SE033-061
im Jahre 1851 erschienenen «Parerga und Paralipomena» wieder in Erinnerung brachte, und daß er in diesem Werke seine Weltanschauung in faßlicherer Weise und mit mehr Witz aussprach, als dies in seinen früheren Büchern der Fall war.
Von Oskar von Redwitz erschien 1849 die erzählende Dichtung «Amaranth», die einen bedeutenden Eindruck machte, was wohl weniger auf ihren Wert als Erzählung, als auf die zarten lyrischen Bestandteile zurückzuführen ist, in denen eine wunderbare Naturstimmung zum Ausdruck kommt. Scherenbergs Bedeutung lag in seiner Fähigkeit zum Erzähler welthistorischer Ereignisse. Die Schlachten-bilder, die er in «Waterloo» (1849), «Ligny» (1849), «Leuthen» (1852) entwirft, haben einen Zug von Größe. Otto Roquettes «Prinz Waldmeisters Brautfahrt» (185 1) ist ein mit allen den lyrischen Mitteln, die auch Redwitz zur Verfügung standen, durchgeführter anmutiger Schwank. Auch seine Gedichte sind durch einen gleichen Grundcharakter beliebt geworden. Großes Aufsehen machte Fr. M. Bodenstedts gehaltvolles Werk «Tausend und ein Tag im Orient» (1850) besonders durch die fesselnden Schilderungen und die eingefügten Lieder, die 185 1 vermehrt als «Lieder des Mirza Schaffy» neu herauskamen. Der Dichter suchte, wie Goethe im «Westöstlichen Divan», in der Weise des morgenländischen Geistes seine Empfindungen auszusprechen und trat deshalb in fremder Maske auf.
Ganz im Banne der Anschauungen, die sich mit dem Scheitern der Märzbewegung abgefunden hatten, vorläufig mit dem Errungenen rechneten und das Leben ihrer Zeit dichterisch zu gestalten suchten, standen Gustav Freytags Leistungen. Auf ihn und einige andere hier genannte Schriftsteiler
#SE033-062
müssen wir im dritten Teile noch zurückkommen, da ihre Wirkungen zum Teil in eine spätere Zeit fallen. Erobert hat sich aber Freytag die deutsche Leserwelt bereits 1855 durch seinen Roman «Soll und Haben», in dem die sozialen Verhältnisse der damaligen Zeit eine künstlerische Behandlung erfahren haben. Die Richtung des Romans ist in dem Motto angegeben, das von Julian Schmidt herrührt, dem geistreichen Literarhistoriker, der mit Gustav Freytag zusammen eine Zeitlang die «Grenzboten» herausgegeben hat. Es heißt: «Der Roman soll das deutsche Volk da suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit.» Die kaufmännische Welt wird in ihrer zukunftversprechenden Tätigkeit anderen gesellschaftlichen Kreisen, besonders dem Adel, gegenübergestellt, ganz im Sinne einer bürgerlich freisinnigen Lebensauffassung. Eine treffliche Zeichnung der politischen Verhältnisse, der Wahlumtriebe der Parteien, des Einflusses der Presse im konstitutionellen Staatswesen, hatte Freytag schon 1853 in seinem Lustspiel «Die Journalisten» geliefert, von dem heute noch vielfach die Meinung gilt, daß ihm nicht leicht ein zweites in der deutschen Literatur an die Seite zu setzen ist.
Ein Meister in der Wiedergabe des wirklichen Lebens, ein feiner Beobachter der kleinsten Züge in den Vorgängen und Charakteren, insofern diesen eine wesentliche Bedeutung zukommt, war Gottfried Keller. Sein Roman «Der grüne Heinrich» zog gleich bei seinem Erscheinen (1854) die Aufmerksamkeit der ersten Kritiker in größtem Maße auf sich. Mit einer seltenen Naturtreue, mit hoher psychologischer Kunst schildert der Dichter die Entwickelung eines Künstlers mit all den Schwierigkeiten und Verirrungen, denen ein schwärmerischer, unpraktischer Idealist ausgesetzt ist. In
#SE033-063
den Erzählungen «Die Leute von Seldwyla» (,856) erreichte er in der Darstellung der schweizerischen Natur und ihres Volkes eine klassische Vollendung. Die Novelle «Romeo und Julia auf dem Dorfe», welche dieser Sammlung angehört, zählt dank der Wahrheit in der Zeichnung der Charaktere, Kraft in der Darstellung der Handlung und dem überlegenen Humor mit Recht zu den Perlen deutscher Dichtkunst.
Bei Keller sehen wir das Bestreben, ein Feld der Dichtung zu suchen, das keinen Anlaß zum Aussprechen unbestimmter Zukunftsideale gibt, bei dem der Dichter vielmehr die Möglichkeit hat, mit künstlerischem Sinne sich ganz in das zu versenken, was das Leben bietet. Der gleiche Drang liegt der Entstehung der «Dorfgeschichten» zugrunde, deren hervorragendster Pfleger Berthold Auerbach war. In den anspruchslosen Verhältnissen des Volkes, in dessen Gesundheit und Ursprünglichkeit, glaubte Auerbach einen Stoff zu finden, dem jene Harmonie in der künstlerischen Darstellung, die Goethe forderte, im höheren Maße entspricht, wie dem Leben der gebildeten Stände. Auerbachs «Schwarzwälder Dorfgeschichten» bringen uns die Bewohner des Schwarzwaldes mit künstlerischer Anschaulichkeit vor die Seele. Nach dem Idyllischen, nach dem bildungsfernen Lande zog es diesen Dichter; aus ihm heraus hat er seine Erzählungen «Barfüßele» (1856), «Neues Leben» (1852), «Josef im Schnee» (1861), «Edelweiß» (1861) geschaffen. In dem großen Roman «Auf der Höhe» (1865) hat er dann diese ihm bestvertraute Welt jener der höheren Kreise gegenübergestellt. Auerbach wußte überall in gleicher Weise durch Wärme der Darstellung wie durch scharfe Charakteristik zu fesseln.
#SE033-064
Mit der Phantasie eines Malers schilderte Adalbert Stifler die Naturdinge und -vorgänge. Seine «Studien» (1844-50) und die «Bunten Steine» (1853) sind Landschaftsbilder in Worten, durchdrungen von einer stillen Andacht gegenüber den herrlichen Schöpfungen der Natur und mit einer rührenden Hingabe an die geringsten Einzelheiten gezeichnet.
Abseits von dem fortschreitenden Gange der Literatur findet sich noch mancher deutsche Dichter, der vorübergehend sich einen Leserkreis erworben hat, wenn auch eine Geschichte des geistigen Lebens keine Veranlassung hat, ihn unter die führenden Geister zu zählen. So hat der von Walter Scott beeinflußte Willibald Alexis (Wilhelm Heinrich Häring) mit seinen Erzählungen «Der Roland von Berlin» (1840), «Der falsche Woldemar» (1842), «Die Hosen des Herrn von Bredow» (1846-48), «Ruhe ist die erste Bürgerpflicht» (1852), «Isegrim» (1854), «Dorothee» (1856) in weitesten Kreisen Preußens Anerkennung und Interesse gefunden. Er ist als Schilderer preußischer Zustände und Gegenden von großer Kraft und Fruchtbarkeit. Mit einem ergreifenden Volksschauspiele «Deborah» erwarb sich 1849 Salomon Hermann Mosenthal vielen Beifall. Dieselbe Kraft in der Darstellung zeigte er auch in späteren Dramen «Sonnwendhof» (1857), «Das gefangene Bild» (1858) und in anderen. Eine durch traurige Lebensverhältnisse an harmonischer Entwickelung gehinderte Persönlichkeit war Albert Emil Brachvogel, dessen Trauerspiel «Narziß» (1857) deutlich seinen Ursprung aus einem krankhaften Gemüt zeigt. Eine erfreulichere Dichtergestalt war dagegen Franz Nissel, der 1858 in dem Trauerspiel «Heinrich der Löwe» den Gegensatz zwischen dem Kaiser und dem mächtigen Vasallen mit großer dramatischer Kunst behandelt hat.
#SE033-065
Von entscheidendem Einfluß auf die Dichtung nach der Mitte des Jahrhunderts wurde der neue Geist, der sich in den Wissenschaften geltend machte. Die Zeit der großen philosophischen Ideengebäude war zunächst vorüber. Die Sinnenwelt und ihre Erscheinungen und die Naturgesetze, die sich aus dieser Welt ergeben, traten in den Vordergrund des Interesses. Man stand am Vorabend des Ereignisses, das auf die Denkweise der zweiten Hälfte des Jahrhunderts einen mächtigen Einfluß ausüben sollte, des Auftretens der Lehre Darwins. Die Durchdringung von wissenschaftlicher Erkenntnis und Dichtung tritt uns schon früher in Deutschland bei Friedrich von Sallet entgegen. Er begann als reiner Gefühlsdichter, vertiefte sich aber dann in die Wissenschaft und hat in seinem «Laienevangelium» (1842) den Versuch gemacht, die Erzählungen der Evangelien mit dem modernen Bewußtsein zu vereinigen, um allen denen eine Art religiöses Erbauungsbuch zu liefern, denen der Radikalismus eines Strauß und Feuerbach zu weit ging und die doch nach einer Darstellung der biblischen Geschichte, die der neuen Zeit entsprach, Bedürfnis hatten.
Eine Persönlichkeit wie Sallet zeigt, wie stark der deutsche Geist dazu neigt, Dichten und Denken durcheinander zu befruchten. Noch auffallender tritt uns diese Erscheinung entgegen bei Wilhelm Jordan, der geradezu als dichterischer Prophet der Darwinistischen Auffassung bezeichnet werden kann. Er hat in seiner groß angelegten Dichtung «Demiurgos, ein Mysterium» (1852-54) Ideen über die Entwickelung des Menschengeschlechtes ausgesprochen, die durch den Darwinismus ihre wissenschaftliche Beleuchtung gefunden haben. Der «Demiurgos» ist eine Gedankendichtung, in der sich ein Geist, der die wissenschaftliche Bildung
#SE033-066
seiner Zeit in umfassendster Weise beherrscht, über die treibenden Kräfte in der Welt und im Leben mit der entschiedenen Absicht ausspricht, alle Erscheinungen, auch die scheinbaren Übel und das Böse in der Welt, in ihrer Berechtigung für das Ganze des Alls darzustellen. Wie er dies in seinen späteren Werken zum Ausdruck gebracht hat, soll im dritten Teile dargestellt werden.
Der Gedankenschwere Jordans gegenüber steht der flotte, fröhliche Ton, den Joseph Viktor Scheffel fast gleichzeitig in seinem «Trompeter von Säckingen» (1853) anschlug. Die harmlos lustige Stimmung, von der diese Schilderung der Schicksale des treuherzigen deutschen Trompeters, der durch die päpstliche Gunst sein Edelfräulein erhält, beherrscht wird, erwarb dem Dichter rasch einen großen Leserkreis, der sich schon ein Jahr später durch den Roman «Ekkehard, eine Geschichte des zehnten Jahrhunderts», der auf dem Grunde einer großen Gelehrsamkeit in ansprechender Weise ein Kulturbild dieser Zeit entwirft, noch erweiterte. Auch in dem Liederbuche «Gaudeamus» (1868) und in den «Bergpsalmen» (1870) macht sich ein heiter-burschikoser Humor geltend, neben dem eine erstaunliche Gewalt über die Sprache und eine gemütvolle und geistreiche Schilderungskunst einhergeht.
Paul Heyses Novellen (deren erste Sammlung 1855 erschien) und Spielha gens «Problematische Naturen» (1860) waren die ersten Erscheinungen einer neuen literarischen Bewegung, der es vor allen Dingen auf die Lösung künstlerischer Aufgaben ankam. Das Ringen nach der vollkommensten dichterischen Darstellungsweise zeichnet diese Richtung aus. Ihr hat die wissenschaftliche Behandlung der Ästhetik vorgearbeitet, an der H.G. Hotho («Vorstudien
#SE033-067
für Leben und Kunst» 1835), Christian Hermann Weiße («System der Ästhetik»), Friedrich Theodor Vischer mit seiner «Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen» (1846-55) und Moritz Carriére («Ästhetik» 1859 und «Die Kunst im Zusammenhange der Kulturentwickelung und die Ideale der Menschheit» 1863-73) teilgenommen haben. Die Frage nach der vollkommensten Form des Romans und der Novelle beschäftigte nunmehr die Geister, und unter ihrem Ein-flusse standen auch die Dichter. Die literarischen Kämpfe und Bestrebungen, die sich in dieser Zeit abzuspielen begannen, dauern bis in die Gegenwart fort.
*
Um dieselbe Zeit, in der Männer wie Wienbarg, Mundt, Gutzkow dem literarischen Leben Deutschlands neue Forderungen stellten, vollzog sich auch in Frankreich ein gewaltiger Umschwung in der Dichtkunst. Die Entwickelung der französischen Verhältnisse am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts gab ihm aber einen wesentlich anderen Charakter. Vor der Revolution wandten sich die bedeutendsten Köpfe der aufklärerischen Philosophie zu, die das Geistesleben beherrschte, und neben der die Dichtkunst nur eine untergeordnete Rolle spielte. In der Folgezeit verbrauchte das politische und staatliche Treiben die geistigen Kräfte, und zwar in so hohem Grade, daß Frankreich in den ersten beiden Jahrzehnten keine Ahnung von den Schöpfungen des Vorläufers einer neuen Kunstrichtung, André Che'niers, hatte, der 1794 auf dem Blut-gerüste sein Leben endete. Von seinen Gedichten war bis 1819 fast nichts veröffentlicht; erst dann wurden seine Dichtungen aus seinem Nachlaß herausgegeben - die erste
#SE033-068
Erscheinung in Frankreich, die aus dem künstlerischen Geiste heraus stammt, durch den wenige Jahre später ein junges Dichtergeschlecht neue Bahnen suchte. Schwer hatten auf der Poesie der Franzosen die ästhetischen Formeln gelastet, die sie so lange für unumstößlich, für die wahren, ewigen Gesetze des Schönen gehalten und die schon die Kunst der alten Griechen beherrscht haben. Was für die Deutschen bereits im vorigen Jahrhundert Lessing mit solcher Meisterschaft erkannt und dargelegt hat, daß man die antike Kunst mißversteht, wenn man sie durch solche Regeln gefesselt glaubt, das hat man in Frankreich erst gegen das Jahr 1830 zu verstehen angefangen. Vorher lebten hier in den Anschauungen über die Dichtung in allem Wesentlichen die Ideen, welche Boileau im Jahre 1674 in seiner «Art poétique» vertreten hatte und die ihren Ausdruck in den klassischen Dramen Corneilles und Racines gefunden haben. Man hatte eine bestimmte Vorstellung davon, wie ein Kunstwerk beschaffen sein müsse, und in diese zwängte man jeden Stoff hinein, den man bearbeitete. Noch in den zwanziger Jahren wurden Versuche, Shakespeare auf die Bühne zu bringen, zurückgewiesen. Das änderte sich allerdings in wenigen Jahren. Schon 1826 fanden in Paris englische Vorstellungen des Lear, Hamlet, Othello Beifall; die französischen Übersetzungen der «Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur» von A. W. Schlegel, die in das Verständnis des großen Briten einführten, hatten ihre Wirkung getan. Man erkannte nun auch in Frankreich, daß es nicht Kunstgesetze gibt, die für alles gelten, sondern daß für jeden Stoff die ihm entsprechende Behandlung gefundexi werden müsse. Zu dieser Einsicht trug fremder Einfluß viel bei. Bei Walter Scott hatte man gelernt, daß jede Gegend,
#SE033-069
jede Bevölkerungsschicht sorgfältig studiert und nach ihrer individuellen Wesenheit dargestellt werden müsse; an Byron hatte man sich herangebildet und die durch keinen ästhetischen Regeizwang beeinflußte freie Äußerung der Empfindungen und Leidenschaften erfaßt. Goethes Dichtung suchte man zu verstehen, und die deutschen Romantiker, besonders E. Th. A. Hoffmann, brachten das ungebundene Walten der Phantasie in Fluß. So kam es denn, daß sich, vom Jahre 1825 angefangen, ein ähnliches Streben zeigte, wie dasjenige war, das in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Deutschland zur Verjüngung aller künstlerischen Ideale führte. Ihren Ausdruck fand diese neue Richtung in der 1824 begründeten Zeitschrift «Le Globe», ihren Stimmführer in Victor Hugo. Bereits 1824 hatte er in seinen «Odes et Ballades» einen von allen herkömmlichen Vorurteilen freien Ton angeschlagen; die dichterische Form war nicht mehr aus einer alten Kunstlehre entnommen, sondern aus der Natur der ausgesprochenen Empfindungen geboren. Und Hugos Drama «Hernani» (1830) bedeutete für Frankreich einen Bruch mit aller Überlieferung, wie einst in Deutschland Schillers «Räuber», mit denen es im Stoffe einige Ähnlichkeit hat. Das Drama rief zunächst einen Entrüstungssturm hervor. Aber das jüngere Geschlecht scharte sich um Hugo und brachte seine Anschauungen zum Siege. Wenn man näher zusieht, so zeigt sich, daß in dieser neuen Literaturbewegung, die man Romantik nannte, noch vieles von den charakteristischen Zügen der alten französischen Kunstauffassung zurückgeblieben ist. Zu einer solch unbefangenen, der Natur abgelauschten Dichtung, wie wir sie bei Shakespeare oder bei den deutschen Klassikern finden, kam man nicht. Das liegt im Charakter des französischen
#SE033-070
Volkes. Es drängt sich immer das Bestreben vor, das Natürliche zu verkünsteln. Die Lyrik strebt von der einfachen Wiedergabe der Empfindung zum Pathos; im Drama wird eine Person nicht so charakterisiert, wie es nach den Voraussetzungen ihrer Individualität sein müßte, sondern so, daß sie zu anderen Personen des Werkes in einem bestimmten Verhältnis steht; das Herausarbeiten von Gegensätzen steht über der einfachen Wahrheit. Das kann an allen Schöpfungen Victor Hugos beobachtet werden. Innerhalb der hiermit gezogenen Grenzen ist ihm aber sowohl in seinen Dramen «Marion de Lorme» (1829), «Le roi s'amuse» (1832), «Lucréce Borgia» (1833) und anderen, sowie in seinen Romanen «Han d'Islande» (1823), «Notre Dame de Paris» (1831), «Le dernier jour d'un condamné» (1829), «Les travailleurs de la mer» (1866) ein Überwinden des steifen französischen Klassizismus gelungen. Er suchte die Menschen aus den Verhältnissen ihrer Umgebung und ihrer Zeit heraus zu verstehen und besaß eine ebenso reiche Phantasie, wie eine plastische, alle Kunstmittel beherrschende Darstellungsgabe. Am hinreißendsten sind seine Gedichte, die trotz aller Rhetorik, die in ihnen herrscht, der Ausdruck einer alle Seiten der menschlichen Natur erfassenden Persönlichkeit sind.
In Alfred de Musset hat die französische Romantik ihren Dichter des Weltschmerzes gefunden. Bei ihm kommt eine hoffnungslose Stimmung, eine Verbitterung dem Leben gegenüber überall zum Durchbruch. Er hat sich in seinen «Confessions d'un Enfant du siécle» selbst geschildert. Eine schwache Persönlichkeit, die aus sich nichts zu machen weiß, die von keinem Ereignisse etwas erwartet, tritt uns da entgegen. Seine Stoffe entnahm er mit Vorliebe den Schattenseiten
#SE033-071
des Lebens; unerquickliche, abstoßende Vorgänge, moralisch anfechtbare Charaktere liebte er. Dazu kommt, daß in seiner Darstellung etwas Künstliches liegt, daß sich die Dinge bei ihm nicht nach natürlichen, sondern nach ausgedachten Gesetzen abspielen; er sprang mit Handlungen und Menschen in der absonderlichsten Weise um. Zuweilen allerdings gelangen ihm Meisterstücke der Charakteristik, wie in dem kleinen Drama «Bettine». Auf seine Entwickelung hat einen tiefgehenden Einfluß George Sand ausgeübt, mit der er eine Zeitlang befreundet war und auch eine gemeinsame Reise nach Italien unternahm. Doch hat auch diese in Zukunftsgedanken lebende, starke Persönlichkeit an dem Grundzug seines Wesens nichts Wesentliches geändert. Wie ein Einsiedler erscheint neben seinen Zeitgenossen, die in den weitesten Kreisen das stärkste Interesse hervorriefen, Marie Henry Beyle, der unter dem Namen Stendhal geschrieben hat. Er war vor allem ein intimer Kenner der menschlichen Seele und ein geistvoller Kopf. Allem, was er schuf, fehlt plastische Fülle; um so mehr aber war ihm Klarheit und Durchsichtigkeit der Ideen eigen. Für große, prachtvolle Persönlichkeiten hatte Beyle eine starke Neigung. Napoleon war ihm ein Muster des Menschlichen. Er betrachtete Menschen und Dinge gleichsam aus der Vogelperspektive. In seinem Roman «Le rouge et le noir» und einer Anzahl Tragödien prägt sich weniger eine sinn-bildliche Phantasie, als vielmehr eine gewisse abstrakte Vorstellungsart aus. Deshalb mußte er auf augenblickliche Anerkennung verzichten. Er hat aber mit der Gabe des Sehers vorausgesagt, was eingetroffen ist, daß das Jahrhundert nicht zu Ende gehen werde, ohne auf ihn zurückzukommen. In den letzten Jahrzehnten hat er nicht nur in
#SE033-072
Frankreich, sondern im ganzen gebildeten Europa seinen Leserkreis gefunden.
Unter denen, die mit ihm lebten, hatte er nur einen Verehrer, sein Gegenbild in jeder Beziehung: Honoré de Balzac, ein Schriftsteller von der denkbar größten Fruchtbarkeit, ein Darsteller der Wirklichkeit in ihren kleinsten Einzelheiten. Er kannte alle Strömungen und Kräfte des gesellschaftlichen Lebens und setzte sich zum Ziele, sie allseitig, genau und mit der Ruhe des Naturforschers zu schildern. Er wollte, daß sich seine Werke zu einer großen «menschlichen Komödie» zusammenschließen, die das menschliche Treiben und Denken seiner Zeit widerspiegelt. An der vollendeten künstlerischen Form lag ihm wenig; er griff jeden charakteristischen Zug auf und stellte ihn dar. Das unterscheidet ihn von seinen Zeitgenossen. Sein auf das Wirkliche gerichteter Sinn brachte Werke wie «Scénes de la vie parisienne», «Scénes de la vie de province» hervor. Er gab sich nirgends Illusionen über die Beweggründe hin, aus denen die Menschen handeln. Er spürte dem Eigennutz nach, um ihn in den verborgensten Schlupfwinkeln zu finden. Lange Zeit hat Balzac mit den traurigsten Lebens-verhältnissen zu kämpfen gehabt. Er hat dabei alle möglichen Widerwärtigkeiten kennengelernt und seine Begabung ganz in den Dienst des literarischen Erwerbes stellen müssen. Seit 1822 schrieb er große Romane, die er selbst für Machwerke hielt. 1831 trat er mit dem Werke «La Peau de Chagrin» hervor, in dem er sich als Künstler zeigte, der die verschiedensten Zustände und Personen der Gesellschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse zu zeichnen weiß. Über die Gesellschaftsschichten, in denen er selbst lebte, reichte allerdings sein Verständnis nicht hinaus. Deshalb erscheinen
#SE033-073
die ländlichen Charaktere, die er in «Les paysans» schildert, durchaus unwahr.
In bezug auf die kühle, naturwissenschaftliche Erfassung der Dinge verwandt mit Balzac ist Prosper Mérimée. Ihn interessierten die Dinge nur insofern, als sich ihnen künstlerisch etwas abgewinnen läßt. Er strebte nach einer Einfachheit und Ruhe der Darstellung, die oft den Eindruck des Gesuchten macht. Seine Novellen «Mosaique» (1833), «Contes et nouvelles» (1846), «Nouvelles» (1852) zeigen einen vornehmen Künstler, weniger aber einen warm empfindenden Menschen. Das Leben hat für Mérimée etwas, das sich gleich den Naturvorgängen mit einer gewissen Notwendigkeit abspielt; so schilderte er in der Novelle «Carmen» - der Quelle zu Bizets berühmter Oper - einen Menschen, der mit einer Gewalt zum Mörder wird, mit der eine Kugel fortrollt, die auf einer schiefen Ebene sich befindet. Die deutschen Romantiker wollten durch die Kunst sich ein eigenes, höheres Leben begründen, das nichts mit der Alltäglichkeit zu tun hat. Derselbe Zug ist bei Mérimée vorhanden. Das geht bei ihm so weit, daß er, der auch wissenschaftlich, als Geschichtsschreiber, tätig war, auf diesem Gebiete einen ganz anderen Geist zeigt. Da wird er trocken, pedantisch, ganz Beschreiber des Tatsächlichen. So wenig soll das gewöhnliche Leben mit der Kunst zu tun haben, daß er beide in seinem eigenen Schaffen ganz voneinander scheidet. Noch entschiedener auf diesem Standpunkt stand Théophile Gautier, Hugos begeistertster Anhänger, der es mit seinem romantischen Sinn so weit trieb, daß er in den abenteuerlichsten Trachten herumging. Bei ihm ward der Satz «Die Kunst um der Kunst willen» zum Glaubensbekenntnis. Sein Buch «Mademoiselle de Maupin» (1836)
#SE033-074
ist der Ausfluß dieser Auffassung, die nur eine Göttin, die Schönheit, kennt. Er war ein künstlerischer Genußmensch; das Nützliche, die Zwecke des Tageslebens haßte er förmlich; seine Phantasie schwelgte in sinnlichen Bildern und Farben. Der Roman «Le Capitaine Fracasse» wirkt plastisch wie ein Saal, in dem Werke der Bildhauerkunst aufgestellt sind.
Von Hugoschen Anschauungen gingen auch Casimir Delavigne und Alexandre Dumas aus, beide aber verflachten bald und lebten nicht künstlerischen Idealen nach, sondern kamen einem ungebildeten Geschmack entgegen. Delavigne war Meister in der Behandlung des Verses und geistreicher Dramendichter («VeApres siciliennes», « Marino Faliero» und andere), Dumas schrieb zahlreiche Romane, die dem Lesebedürfnis der Menge willkommenen Stoff boten. Auf einer noch tieferen Stufe steht Euge'ne Sue, welcher der Sensationslust diente und auf diesem Wege («Les Mystéres du Peuple») einer der meistgelesenen Schriftsteller wurde.
Wie in Deutschland die Romantik den kritischen Sinn zu einer hohen Vollendung brachte, so auch in Frankreich, das in Charles Sainte-Beuve einen Geist allerersten Ranges auf diesem Gebiete hervorbrachte. Er wirkte reformatorisch, indem er die Werke aus den Bedingungen ihres Entstehens, aus der Individualität ihres Schöpfers heraus begreiflich machte. Sein 1827-28 erschienenes «Tableau de la poésie française et du théatre français au xVIe siécle» war bahnbrechend für die moderne kritische Betrachtungsweise. In dieser Richtung bildete er die «zehnte Muse», wie er die Kritik nannte, immer mehr aus. Auf die französische Philosophie in dieser Zeit hatte die gleichzeitige deutsche einen
#SE033-075
wesentlichen Einfluß. Victor Cousin machte in den Jahren 1817 und 1818 eine Reise durch Deutschland und trat zu Hegel in ein freundschaftliches Verhältnis. Er verpflanzte dessen Ansichten nach Frankreich.
Auch nach England wirkte der deutsche Geist hinüber. Thomas Carlyle, der sich mit tiefem Verständnis in die Werke Goethes und Schillers einlebte, wurde hier der Vermittler. Er ist eine idealistisch veranlagte Persönlichkeit, mit einem Hang, überall in der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit die Gipfelpunkte herauszuheben. Das führte ihn zu einer Art Vergötterung heroischer Persönlichkeiten. Die großen Individuen sind ihm die Träger des Kulturfortschrittes. Was in den Massen gärt, kommt für ihn weniger in Betracht. Die bevorzugten Geister will er verstehen und ihren Einfluß in der Geschichte kennzeichnen. Für das Verständnis der deutschen Gedankenwelt und Kunst hat er in England in der fruchtbringendsten Weise gewirkt. Er hat das Leben Schillers beschrieben und Goethes Wilhelm Meister übersetzt. Der Idealismus Carlyles ist der eine Grundzug, der durch Englands geistige Entwickelung in dieser Zeit geht. Der andere ist eine nüchterne, unpoetische Anschauung des Lebens, ein Nützlichkeitsstandpunkt. Zwischen beiden unsicher hin und her schwankte Edward George Lytton-Buiwer, der sich in seinen zahlreichen Romanen als Erzähler von großer Fähigkeit in der Charakteristik und in der Komposition der Handlungen erweist. Das Fesselnde seiner Darstellungsweise hat allerdings mehr in einem klug berechnenden Verstande als in einer fruchtbaren, gestaltenschaffenden Phantasie seinen Ursprung. Dennoch fanden seine Werke einen großen Leserkreis. Alle charakteristischen Eigentümlichkeiten
#SE033-076
des englischen Geistes in dieser Zeit vereinigt aber der wirksamste Erzähler dieser Epoche, Charles Dickens, der wie wenige es verstanden hat, aus der Volksseele heraus zu schaffen. Das wurde in weitesten Kreisen gleich bei seinem Auftreten verstanden. Seine «Sketches of London» (1836) und noch mehr die «Pickwick Papers» (1837) machten ihn zum volkstümlichen Schriftsteller. Die traulichen Vorgänge im Familienkreise, die alltäglichsten Vorgänge, die einfachsten Empfindungen und Leidenschaften wußte er in der anmutigsten Weise zu zeichnen. Die Sitten des Volkes, sein Denken und Fühlen belauschte er mit den feinsten Sinnen und stellte sie mit der größten Anschaulichkeit, mit unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit, mit sinnigem Humor dar. Er ging an nichts vorüber, was das Kind des Volkes bewegt. Der Aberglaube, die natürliche Klugheit, der derbe Sinn, alles findet den berechtigten Platz in seinen Werken. «David Copperfield», «Little Dorrit», seine Weihnachts-bücher, besonders das spannende «A Christmas carol», gehören zu den gelesensten Schriften der Weltliteratur.
Die moralisierende Tendenz, die bei Dickens stark ausgeprägt ist, findet sich auch bei William Makepeace Thackeray. Ihm fehlte allerdings die Gemütsinnigkeit des ersteren. Dieser sprach zum Herzen und wirkte dadurch auf den sittlichen Sinn ein, ohne daß er unmittelbar Moral predigen wollte; Thackerays Bedeutung liegt in der Satire, mit der er Sitten und Verhältnisse geißelt. Schneidende Schärfe und Humor bestimmen die Physiognomie seiner in viele europäische Sprachen übersetzten Werke. Hinsichtlich des künstlerischen Verstandes verwandt mit ihm ist der Politiker Benjamin Disraeli, dem allerdings der anziehende Humor fehlt. Auch die Unzufriedenheit mit den Zuständen
#SE033-077
der Zeit hat in England ihre Dichter gefunden, und zwar in Thomas Hood ihren Lyriker, in Charles Kingsley den Romanschriftsteller. Dagegen ist Alfred Tennyson ein Künstler der lyrischen Form, einer leichten, wohilautenden Sprache, die seine Dichtungen in die weitesten Kreise trugen. Sein «Enoch Arden» ist weltberühmt geworden. Mit einem Drama « Paracelsus» führte sich 1836 ein gedankenreicher Dichter, Robert Browning, in die Literatur ein. Angeregt durch Shelley, beschäftigten ihn die tiefsten Fragen des strebenden Menschen. Ein faustischer Zug geht durch alle seine Ideendichtungen, die Dramen «Strafford», «Sordello», und auch durch die Gedichtsammlungen. Für ein untergeordnetes Lesebedürfnis sorgte Frederick Marryat durch seine Romane, deren Stoff vornehmlich dem See-und Reiseleben entnommen ist.
In Abhängigkeit von der englischen entwickelte sich seit den zwanziger Jahren des Jahrhunderts in Nordamerika eine Literatur. James Fenimore Cooper bewegte sich in den künstlerischen Bahnen Walter Scotts. Er zeichnet das amerikanische Leben, wie dieser das englische, auf dem Grunde der natürlichen Verhältnisse. Die Gestalten seiner Romane «Der Spion», «Lionel Lincoln», «Lederstrumpf-Erzahlungen», «Der Pilot», zeigt er uns in ihrem Herauswachsen aus den geographischen und kulturellen Verhältnissen, in denen sie leben. Washington Irving ist ein Erzähler mit einem ins Gemüt dringenden Humor und einer ansprechenden Begabung für die Erzählung. Auf dem Felde der Lyrik ragt William Cullen Bryant durch malerische Darstellung von Naturbildern und eine meisterhafte Behandlung der Sprache hervor. Der Romanschriftsteller Nathaniel Hawthorne ist
#SE033-078
ein Romantiker wie in Frankreich Nodier oder in Deutschland E. Th. A. Hoffmann. Die gewaltigste Persönlichkeit auf literarischem Gebiete in dieser Zeit ist Edgar Allan Poe, der für die Darstellung der abnormen Verhältnisse des Lebens, für die unerklärlichen Zustände der Seele, für das Grausige in der Erscheinungswelt eine besondere Neigung hatte. Seine Einbildungskraft lebt in wilden und wüsten Bildern, die aus pathologischen Tatsachen ihren Ursprung herleiten. Er hat nicht viel geschrieben, aber mit wenigem einen großen Eindruck gemacht. Seine Dichtungen «Der Rabe», «Tales of the Grotesque and Arabesque», «The Fall of the House of Usher» sind namentlich in den zahlreichen Kreisen, die sich in den letzten Jahrzehnten mit Spiritismus und Mystik, mit den Nachtseiten des Lebens beschäftigen, zu weiter Verbreitung gelangt.
In Europa gelangte der Däne Adam Gottlob Oehlenschläger zu einem größeren Einfluß. Seine Trauerspiele «Axel und Valborg», «Hakon Jarl» und andere, sowie seine Epen «Hrolf Krake», «Helge» und das Märchen «Aladdin» tragen einen durchaus romantischen Charakter; sie wurden in seinem Heimatlande wirklich volkstümlich, zugleich aber auch Eigentum vieler Gebildeten in allen Ländern Europas. Ein liebenswürdiger und naiver Künstler Dänemarks ist Hans Christian Andersen, der als Märchendichter sich die ganze Welt erobert, aber auch als Romanschriftsteller Anerkennung gefunden hat.
Der Osten Europas hat in dem Ungar Alexander Petöfi einen der hervorragendsten Lyriker, dessen Schöpfungen, voll glühenden Patriotismus und erwachsen aus den stärksten menschlichen Leidenschaften, in seinem Lande bis in die
#SE033-079
untersten Schichten des Volkes gedrungen sind. Der Panslavismus in Böhmen hat in Jan Kollár einen feurigen Sänger gefunden. In Litauen schenkte der Pole Adam Mickiewicz seinem Volke erzählende Dichtungen: «Konrad Wallenrod» (1828), «Pan Tadeuß» (1836) und Gedichte, die aus einem reichen Gemütsleben entsprossen sind und die auch außerhalb Polens in Übersetzungen viel gelesen werden. Die sozialen Bewegungen spiegeln sich innerhalb der polnischen Literatur in den Dichtungen Sigismund Krasiñskis und Ignaz Kraszewskis. Der erstere schildert die untergehende Kultur und träumt in unbestimmter Weise von dem Aufgang einer neuen; der letztere zeichnet in echt volkstümlicher Weise Bilder des sittlichen und gesellschaftlichen Lebens.
In Rußland begegnen uns in W. A. Schukowskij, Alexander Gribojedow, Alexander Puschkin und M. J. Lermontow Dichter, welche die Kultur ihres Volkes mit westeuropäischem Geiste durchtränken. Puschkin ist durch und durch Romantiker, ein Poet von großer lyrischer Kraft und hohem Idealismus der Weltauffassung; Lermontow ist eine energische Individualität mit einem bedeutenden Darstellungsvermögen. Er hat in Bodenstedt einen vorzüglichen Übersetzer gefunden. Ein Pfleger des russischen Volksliedes, bei dem aber der Kultureinfluß des Westens überall durchblickt, ist Alexei Wissiljewitsch Kolzow. Eine rein aus dem Boden des Russentums selbst erwachsene Dichtung ist in diesem Zeitraum noch nicht vorhanden.
#SE033-080
#TI
1871 - 1899
#TX
Das «Junge Deutschland» und die revolutionäre Dichtung um die Mitte des Jahrhunderts strebten nach einer innigen Durchdringung der allgemeinen Kulturideen der politischen Interessen mit dem künstlerischen Schaffen. Die Forderungen der Zeit fanden in den Werken der Dichter ihren Ausdruck. In den fünfziger Jahren bereitete sich eine Literaturströmung vor, die der Kunst gegenüber einen anderen Standpunkt einnahm. Man fragte jetzt weniger, was man in der Poesie aussprechen wolle; man richtete sein Augenmerk in erster Linie auf die vollkommenste Art und Weise, in der man einen Vorgang, eine Idee, ein Gefühl zu gestalten habe. Wie muß ein Drama, ein Roman, eine Novelle und so weiter beschaffen sein? Das waren Fragen, die das Zeitbewußtsein beschäftigten. In bezug auf die technische Vollendung der einzelnen Kunstformen stellte man strenge Ansprüche. Ein deutliches Zeugnis für diese Geistesrichtung sind zwei theoretische Werke schaffender Dichter: Gustav Freytags #SE033-081
zum Licht» (1861), «In Reih und Glied» (1866), «Hammer und Amboß» (1868) tritt dieses Streben nach der reinen Kunstform noch zurück hinter den sozialen Zielen, die der Dichter sich stellt. Im höchsten Maße ausgeprägt erscheint es in «Sturmflut» (1876). In den erstgenannten Romanen handelt es sich darum, die Gegensätze in den Anschauungen und der Lebensführung verschiedener Stände und Gesellschaftsschichten zu zeigen oder das Verhältnis des einzelnen Menschen zur Gesamtheit zu schildern. Das kulturgeschichtliche Interesse und Spielhagens Begeisterung für Freiheit und Fortschritt haben an diesen Werken gleichen Anteil mit den künstlerischen Absichten. In der «Sturmflut» werden die Erscheinungen des Natur- und Menschenlebens nicht mehr so einander gegenübergestellt, wie sie der unmittelbaren Beobachtung sich darstellen, sondern wie es der Kunstzweck fordert. Früher handelte es sich für den Dichter darum, anschaulich zu machen, welche Strömungen im Leben geeignet sind, andere zu besiegen; jetzt ist es ihm um die Aufstellung spannender Konflikte und befriedigender Lösungen in erster Linie zu tun. Dieser Richtung seines Schaffens ist Spielhagen bis zur Gegenwart treu geblieben. «Plattland» (1879), «Uhlenhaus» (1884), «Ein neuer Pharao» (1889), «Sonntagskind» (1893) sind Dichtungen, die noch immer einen bedeutenden Eindruck auf diejenigen machen, die daran nicht Anstoß nehmen, daß die Kunst dem wirklichen Leben in gewissem Sinne entfremdet ist. In noch höherem Grade als auf Spielhagen ist das Gesagte auf Paul Heyse anwendbar. Er hat die Form der Novelle zu ihrer reifsten Entwickelung gebracht. In der kunstvollen Verkettung von seelischen Vorgängen und Beziehungen ist er Meister. Den einfachsten Konflikten weiß er dadurch,
#SE033-082
daß er ihnen unerwartete Wendungen gibt, einen im höchsten Grade spannenden Verlauf zu verleihen. Die Kunst ist bei ihm ganz Selbstzweck geworden. Heyse steht der Wirklichkeit nicht wie ein unbefangener Beobachter gegenüber, sondern wie ein Gärtner der Pflanzenwelt, der bei jeder natürlichen Gattung sich fragt: in welcher Weise kann ich sie veredeln? Es gelingt ihm in gleicher Weise, das unmittelbare Leben der Gegenwart («Die kleine Mama») wie die Empfindungs- und Anschauungsweise vergangener Zeiten («Frau Alzeyer», Troubadour- Novellen) zu zeichnen; sein Ton klingt in vollendeter Schönheit, ob er ernst («Der verlorene Sohn») oder humoristisch ist («Der letzte Centaur»). Eine im höchsten Sinne des Wortes schöpferische Natur ist Heyse nicht, sondern ein Vollender ererbter Kunstanschauung und Lebensauffassung. Der Roman, mit dem er in den siebziger Jahren einen starken Erfolg erzielt hat, die «Kinder der Welt» (1873), ist aus der Gedankenbewegung erwachsen, die Hegels Nachfolger (sieheSeite4 8ff.) erregt haben. Wie die Kinder der Welt, die ihr religiöses Bedürfnis durch die freien Ansichten der Gegenwart zu befriedigen suchen, sich im Leben zurechtfinden, wird hier von einem Dichter dargestellt, bei dem dieser neue Glaube eine weltmännische Form angenommen hat. Eine ruhige, abgeklärte Schönheit ist der Grundcharakter dieses und der folgenden Romane Heyses: «Im Paradiese» (1875), «Der Roman der Stiftsdame» (1886), «Merlin» (1892). Eine üppige Sinnlichkeit, die sich graziös zu geben vermag, eine Weisheit, die über die Härten des Daseins sich keine Gedanken macht, treten uns überall in Heyses Schöpfungen, besonders in seinen lyrischen Dichtungen, entgegen. Der dramatischen Kunst ist eine solche Anschauungsart nicht
#SE033-083
gewachsen. Die lebendige Bewegung, welche das Drama braucht, kann nur aus dem Wesen einer Persönlichkeit hervorgehen, die tief hinuntersteigt in die Abgründe des Lebens. Daher vermochte Heyse mit seinen zahlreichen Dramen keinen Eindruck hervorzurufen. In ähnlichen Bahnen bewegen sich Adolf Wilbrandt und Herman Grimm. Der erstere liebt zwar kraftvolle Motive und starke Leidenschaften, die in grellen Gegensätzen sich entfalten, aber er schwächt diese sowohl als Dramatiker wie als Erzähler durch die Weichheit seiner Linien und die matten Farben ab. Eine Persönlichkeit, deren ganzes Seelenleben im ästhetischen Anschauen aufgeht, ist Herman Grimm. Ihn interessieren die Natur und die Kulturentwickelung nur so weit, als sie sich mit dem an der Kunst herangebildeten Urteile betrachten lassen. Sein Roman «Unüberwindliche Mächte» (1867) und seine «Novellen» stellen die Wirklichkeit so dar, als wäre sie nicht durch Naturgesetze, sondern durch den gebildeten Geschmack eines Weltkünstlers gestaltet. Einen Höhepunkt erreichte das Streben nach Formenschönheit bei Conrad Ferdinand Meyer. Bei ihm entspricht der äußeren künstlerischen Vollendung seiner Schöpfungen ein bedeutsamer Inhalt. Seine Phantasie beschäftigt sich mit den starken Leidenschaften und Trieben der Seele, und er ist imstande, Persönlichkeiten auf charakteristisch gezeichnetem geschichtlichen Hintergrunde darzustellen. Ein Roman wie «Jürg Jenatsch» (1876) oder Novellen wie «Die Versuchung des Pescara» (1887) und «Angela Borgia» (1890) leuchten in die Abgründe des Seelenlebens und sind zugleich von erhabener Schönheit. Seinen lyrischen Leistungen «Balladen» (1867) und «Gedichte» (1882) hat seine stets auf die großen Gegensätze gerichtete Einbildungskraft oft
#SE033-084
geschadet. Um so mehr konnte er sich ausleben in der Beleuchtung heldenhafter Naturen, wie sich in seiner Dichtung «Huttens letzte Tage» (1871) zeigt. Verwandte Gesichtspunkte liegen auch den Dichtungen des Österreichers Robert Hamerling zugrunde. Er strebt ebenso nach Vollendung der formalen Schönheit wie nach einer tiefen Auffassung des Weltzusammenhanges. Das ewige, ruhelose Ringen der strebenden Menschheit, die sich nach Ruhe und Erlösung sehnt, stellt er in Gegensatz zum leidenschaftlichen Lebensdrang in seinem «Ahasver in Rom» (1866), den Drang nach einem menschenwürdigen Dasein behandelt er in dem Epos «Der König von Sion» (1869), einem kulturhistorischen Gedicht, das die klassische Versform des Hexameters mit einer farbenprächtigen, glutvollen Darstellungsweise vereinigt. In dem Roman «Aspasia» (1876) sucht er ein Bild der schönheitstrunkenen und lebensfrohen griechischen Welt vor uns zu stellen, und in «Homunculus» (1888) geißelt er die Auswüchse seiner Zeit in grotesker Weise. Seine Lyrik stellt sich weniger als die eines unmittelbar empfindenden, als vielmehr eines sinnenden, pathetischen Dichters dar. Ein pessimistischer Zug geht durch Hamerlings ganzes Schaffen. Ganz beherrscht von solcher weltschmerzlichen Stimmung ist die Dichtung Hieronymus Lorms (Heinrich Landesmann). Er vereinigt die Fähigkeit des geistvollen Feuilletonisten mit der eines interessanten Erzählers und eines ergreifenden Lyrikers. Ein hartes persönliches Schicksal hat seiner düsteren Weltanschauung ein individuelles Gepräge verliehen.
Entfernen sich Dichter wie Spielhagen, Grimm, Meyer, Heyse, Hamerling nur durch die künstlerische Behandlungsweise von der naiven Anschauung, so ist dies bei
#SE033-085
Hermann Lingg, Felix Dahn und Georg Ebers auch in bezug auf das Stoffliche ihrer Werke der Fall. Bei jenen hat neben der impulsiven Phantasie die überlieferte Kunstbildung Anteil an ihrem Schaffen, bei diesen auch noch die gelehrte Kultur ihrer Zeit. In seinem Epos «Die Völkerwanderung» (1866-68) verarbeitet Lingg eine Fülle historischer Vorstellungen und wissenschaftlicher Einsichten, und auch in seiner Lyrik ist die Neigung zu geschichtlichen Bildern bemerkbar. Felix Dahn suchte in der germanischen Vorzeit und in den Ereignissen der Völkerwanderung, Georg Ebers in der altägyptischen Welt nach Inhalten für die Dichtung. Weder der eine noch der andere können es verleugnen, daß das mühsame Studium eine der Wurzeln ihrer Werke ist. Dahns «Kampf um Rom» (1876) und «Odhins Trost» (1880) sowie Ebers' «Eine ägyptische Königstochter» (1864) sind groß angelegte Kulturgemälde, aber nicht Ergebnisse unmittelbarer dichterischer Kraft.
Ein Dichter, der dagegen mit seinem ganzen Empfinden und Denken in dem wirklichen Leben wurzelt, ist der aus Galizien stammende Leopold von Sacher-Masoch. Der grelle Widerspruch zwischen der Niedrigkeit menschlicher Triebe und Leidenschaften und den hehren Idealen, die sich der Geist erträumt, beschäftigt seine Phantasie. Der Mensch möchte ein Gott sein und ist doch nur ein Spielball seiner tierischen Begierden: dieses Bekenntnis spricht aus SacherMasochs Werken. Der Idealismus ist ein frommer Wahn, der in nichts sich auflöst, wenn man die Natur in ihrer wahren Gestalt betrachtet. Um diese Grundempfindung auszusprechen, steht diesem Dichter eine auf das Pikante und Grelle gerichtete Einbildungskraft zu Gebote, die in üppigen Bildern schwelgt und vor der Darstellung wüster
#SE033-086
Vorgänge nicht zurückschreckt. Da sich Sacher-Masoch im Laufe seinerEntwickelung dem letzteren Hang seines Wesens und einer sensationslüsternen Vielschreiberei hingegeben hat, sind die vielversprechenden Anläufe, die er in Werken wie «Das Vermächtnis Kains» (1870) genommen hat, ohne Wirkung geblieben. Von ihm und Hamerling beeinflußt, hat die Wiener Dichterin Marie Eugenie delle Grazie in kunstvollen Gedichten und in einem umfassenden Epos «Robespierre» (1894) die idealistischenTräume der Menschheit in ihrer Wertlosigkeit gegenüber dem blinden, niederen Walten der Natur darzustellen versucht.
Eine Kunst, die sich um die großen Fragen des Daseins wenig kümmert, sondern in virtuosenhafter Weise einem zwar gebildeten, aber wenig in die Tiefen der Dinge dringenden Geschmack entgegenzukommen sucht, findet sich bei Julius Wolff und Rudolf Baumbach. Des ersteren «Wilder Jäger» (1877) und «Tannhäuser» (1880) und des letzteren «Zlatorog» (1877), sowie seine «Lieder eines fahrenden Gesellen» (1878) entsprachen in den achtziger Jahren dem Bedürfnis eines großen Publikums. Für die katholischen Kreise lieferte der Westfale Friedr. Wilh. Weber in seinen «Dreizehnlinden» (1878) ein geschichtliches Epos.
Aus der Kunstanschauung der Romantik ist die Dichtung Theodor Storms erwachsen. Diese Anschauung steht aber bei ihm im innigen Einklange mit einem kernhaften, fest im Leben und in der Natur seiner schleswig-holsteinischen Heimat wurzelnden Gemüt und einer Beobachtungsgabe, welche die Außenwelt zwar in weichen, oft nebelhaften Gestalten, doch stets in gesund-natürlicher Weise sieht. Er ist Meister in der Zeichnung von Stimmungsbildern. Wie ein Landschaftsbild, über das ein zarter Nebel sich lagert,
#SE033-087
erscheinen seine Schilderungen. Ein lyrischer Grundton spricht aus allen seinen Schöpfungen. Von erschütternder Tragik ist die Novelle «Aquis submersus» (1877); eine kraftvolle Darstellungskunst spricht aus dem «Schinimelreiter» . Auch die Gabe des Humors ist Storm eigen. Als lyrischer Dichter ist er ein Meister des Ausdrucks, der alle Töne findet von der zartesten Stimmung bis zu der markigen, scharfen Charakteristik. Seiner ganzen Anlage nach verwandt mit Storm ist Wilhelm Jensen. Sein Denken wurzelt in den sozialen, freiheitlichen Anschauungen der Gegenwart; seine Darstellungsweise erinnert an die phantastische Geistesrichtung der Romantik. Er braucht aufregende Szenen, grelle Lichter, um auszudrücken, was er will. Seine Romane «Um den Kaiserstuhl» (1878), «Nirwana» (1877), «Am Ausgange des Reichs» (1885) schildern historische Vorgänge in der Weise, daß Greuelszenen und schauerliche menschliche Geschicke in behaglicher Breite erscheinen. Die Gedichte Jensens zeichnet lyrischer Schwung, eine kunstvolle Sprache, aber auch oft eine absonderliche Empfindungsweise aus.
Wie Heyse und Grimm zu Goethes Kunstüberzeugung, Storm und Jensen zu derjenigen der Romantiker stehen, so der Humorist Wilhelm Raabe zu derjenigen Jean Pauls. Wie dieser unterbricht auch Raabe den Gang der Erzählung und spricht in eigener Person zu uns; wie sein Vorgänger entwickelt er die Handlung nicht ihrem natürlichen Laufe nach, sondern nimmt Dinge voraus oder kommt auf solche zurück. Auch durch die Wahl seiner Stoffe erinnert er an Jean Paul. Er bewegt sich im Kreise stiller, bescheidener, idyllischer Leiden und Freuden. Das Humoristische sucht er immer in den inneren Widersprüchen der menschlichen
#SE033-088
Charaktere. In scharfen Umrißlinien, mit einer entschiedenen Neigung zum Bizarren, zeichnet er Personen und Situationen. Ob er das Strebertum wie im «Hungerpastor» (1864) oder die Menschenfreundlichkeit schildert, die komisch wirkt, weil sie ungeeignete Wege einschlägt, wie im «Horacker» (1876): immer gelingen Raabe deutliche klare Physiognomien. Originelle Charaktere, gesellschaftliche Gegensätze sind sein Feld. Auch Hans Hoffmanns Bedeutung liegt auf dem Gebiete der humoristischen Darstellung von Charakteren. Die Hauptperson in dem Roman «Iwan der Schreckliche und sein Hund» (1889), ein Gymnasiallehrer, wirkt komisch durch alles, was an ihr und um sie ist: ihr Aussehen, ihre Bewegungen, ihre Hilflosigkeit gegenüber den Schülern. Die Novellensammlung «Das Gymnasium zu Stolpenburg» (1891) verrät auf jeder Seite den gemütvollen, ernsten Künstler. Als Satiriker hat sich Fritz Mauthner einen Namen gemacht. Seine parodistische Begabung führte ihn dazu, Stil und Empfindungsweise anderer in seinem Buch «Nach berühmten Mustern» (1879) karikierend nachzuahmen. In seinem «Villenhof» (1891) geißelt er Mißklänge im Berliner gesellschaftlichen Leben. In die Reihe der Humoristen muß auch Friedr. Theod. Vischer gestellt werden, der in seinem Roman «Auch einer» den komischen Typus eines Menschen gezeichnet hat, dessen Seelenverfassung alle Augenblicke durch die kleinen, zufälligen Störungen des Lebens aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Interessant ist bei Vischer das fortwährende Ineinanderspielen der theoretischen Ergebnisse seiner ästhetischen Studien und Spekulationen und einer unverkennbaren ursprünglichen dichterischen Naturanlage. Weil er alle Arten der künstlerischen Darstellungsweise durchforscht
#SE033-089
hat, zeigt er in seinen «Lyrischen Gängen» auf vielen Gebieten eine seltene Form- und Stilgewandtheit, - weil er eine Dichternatur ist, reißt er durch den Ausdruck seiner Empfindungen und den kühnen Schwung seiner Vorstellungswelt hin. Perlen der deutschen Literatur sind Vischers Abhandlungen «Kritische Gänge» und «Altes und Neues» durch den Tiefsinn der Ideen, durch einen vor keiner Konsequenz zurückschreckenden Denkermut und nicht weniger durch die Beherrschung des Essaystiles. Er ist ein universeller Kopf, der nach allen Seiten hin ausgreift. Die philosophischen, die künstlerischen, die religiösen, die wissenschaftlichen Zeiterscheinungen begleitet er und nimmt zu ihnen in kritischen Urteilen Stellung, die ihn als einen Führer der Geistesbewegung seiner Zeit und zugleich als kernigen, seinen sicheren Weg wandelnden Charakter erscheinen lassen. In Vischers Entwickelung findet der Umschwung, der sich in der deutschen Geisteskultur in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, einen deutlichen Ausdruck. Er ist ausgegangen von den idealistischen Überzeugungen der Hegelschen Philosophie. Aus ihr heraus hat er in den vierziger und fünfziger Jahren seine «Asthetik» geschrieben und dann in einer Selbstkritik wichtige Grundsätze dieser Anschauungen zurückgenommen.
Wie Vischer persönlich, so wich die Hegelsche Philosophie im ganzen in der zweiten Jahrhunderthälfte zurück vor neuen Anschauungen. Die großen naturwissenschaftlichen Resultate, die durch sorgfältige Beobachtung der natürlichen Tatsachen und durch das Experiment gewonnen wurden, erschütterten den Glauben an das reine Denken, durch den Hegel und seine Schüler ihre stolzen Ideengebäude errichtet haben. So kam es, daß sich das Zeitbewußtsein für philosophische
#SE033-090
Richtungen entschied, die weniger durch Strenge und Folgerichtigkeit der Gedanken, als vielmehr durch äußere Mittel wie eine leichtfaßliche, populäre Darstellungsweise und durch ein temperamentvolles Anfassen der Dinge gekennzeichnet sind. Schopenhauer mit seinem blendenden, pikanten, derben Stil hat dieser Strömung den Boden vorbereitet. Nur in einer solchen Zeitstimmung konnten philosophische Darstellungen wie Eduard von Hartmanns «Philosophie des Unbewußten» (1869) oder Eugen Dührings Schriften Beifall finden. Nicht der zweifellos in diesen Leistungen gelegene wertvolle Ideengelialt, sondern die Art, wie dieser vorgebracht wurde, machte Eindruck. In den siebziger und achtziger Jahren verschwand der philosophische Geist stetig aus der deutschen Bildung. Mit großer Deutlichkeit zeigt sich das in der Literaturgeschichtschreibung und in der literarischen Kritik. Die feinsinnige literarhistorische Betrachtung Hermann Hettners, die durch die Tatsachen hindurch sich auf die treibenden ideellen Gewalten richtete, die Art der Julian Schmidt, Gervinus u . a.,die nach den Ursachen der literarischen Erscheinungen suchten, wurden aufgegeben, und an ihre Stelle trat die Anschauungs-weise Wilhelm Scherers, der in seiner «Geschichte der deutschen Literatur» (1883) sich rein auf die Gruppierung des Tatsächlichen und auf die sichtbaren Teile der geschichtlichen Entwickelung beschränkt.
Es ist begreiflich, daß in einem Zeitraume, in dem die in langen Geisteskämpfen gewonnenen Bildungsstoffe in Auflösung begriffen sind, eine Fülle von Literaturerzeugnissen erscheint, die an Wert und Wirkung so ungleich als möglich ist. Emsige Vielschreiberei, die es nur auf das leichte Unterhaltungsbedürfnis des Publikums abgesehen hat, tritt neben
#SE033-091
unklarer Weltanschauungsliteratur auf; Schriftsteller, die eine leichte, witzige Darstellungsgabe haben, finden sich ein, und auch ernst strebende Geister, die nicht fähig sind, ihre eigenen Wege zu gehen und in der Verworrenheit der Zeitströmungen keinen festen Anhaltspunkt gewinnen können. Von der letzteren Art ist Eduard Grisebach, der in seinen Dichtungen «Der Neue Tannhäuser» (1869) und «Tannhäuser in Rom» (1875) den Stil Heines zum Ausdruck Schopenhauerscher Ideen gebraucht. Ähnliches ist auch von dem hochstrebenden Albert Lindner zu sagen, der im pathetischen Stile Dramen schuf, die aber doch deutlich den Stempel eines nach Originalität strebenden Epigonentums tragen. Größeres Glück hatte Ernst von Wildenbruch, der mit einem gewissen dichterischen Schwung und mit ausgezeichnetem Geschick für szenischen Aufbau eine lange Reihe von Dramen geschaffen hat. Eine edle Begeisterung für Heldengröße und eine idealisierende Darstellungsweise sind Wildenbruch eigen, und in seinen kleinen Erzählungen und Gedichten kommt Innigkeit des Empfindens und ein sympathisches Gemüt zum Durchbruch. Ein Geist, der aus einer ungesunden Nervosität heraus nach aufrüttelnden, stark erregenden Motiven sucht und diese in krasser, oft markerschütternder Weise wirken läßt, ist Richard Voß. Doch hat er auch die Fähigkeit, intime Seelenzustände darzustellen, die er allerdings mit allzu stürmischen Ereignissen in Zusammenhang bringt, wie in den Dramen «Eva» und «Alexandra». Daß er auch den Pulsschlag der Gegenwart versteht, hat er in seinem Drama «Die neue Zeit» gezeigt, in dem ein Pastors-sohn, der in die freigeistigen Anschauungen unserer Zeit hineingewachsen ist, in Konflikt kommt mit seinem an den Vorurteilen der alten Welt hängenden Vater. In ausgetretenen
#SE033-092
Bahnen wandeln Rudolf Gottschall, der sich als Dramatiker wie als Lyriker an die akademisch-ästhetischen Schablonen hält, Julius Grosse, der sich im Drama, Roman und in der Lyrik als geschmackvoller, aber wenig anregender Künstler erwiesen hat, und endlich Hans von Hopfen, dessen Leistungen kaum über die bloße Unterhaltungsliteratur sich erheben.
Eine Persönlichkeit, die im höchsten Grade Achtung verdient, ist Adolf Friedrich Graf Schack, ein nach Tiefe ringender und an die Form die höchsten Anforderungen stellender Dichter. Sein ethischer und künstlerischer Ernst ist bewunderungswert. Dieser spricht sich nicht nur in seinexi geistvollen literarhistorischenAufsätzen und in seiner Selbst-biographie «Ein halbes Jahrhundert» aus, sondern auch in der hochherzigen Unterstützung, die er Künstlern und künstlerischen Unternehmungen angedeihen ließ. Ein Meister strenger Kunstform ist auch Heinrich Leuthold, dessen melancholische Töne einesteils der Ausdruck qualvoller persönlicher Erlebnisse, andernteils aber auch der einer tief pessimistischen Weltanschauung sind. Ein Reflexionsdichter in vollstem Sinne des Wortes ist der Schweizer Dranmor (Ferdinand von Schmid), der in seiner leidenschaftlichen, unruhigen Art und seiner düstern Weltauffassung mit Leuthold viel Ähnlichkeit hat. Schack, Dranmor, Leuthold sind in erster Linie Lyriker. Als Schülerin Conrad Ferd. Meyers ist Isolde Kurz mit ihren «Florentinischen Novellen» (1890) aufzufassen, die aus einem vornehmen Geschmack und einer plastischen Phantasie hervorgegangen sind. Als Lyriker und Dramatiker ist Artur Fitger aufgetreten. Die düstere Weltanschauung, die wir bei so vielen Dichtern der siebziger und achtziger Jahre gefunden haben,
#SE033-093
ist auch ein Grundzug seiner lyrischen Schöpfungen. Sein kraftvolles, wenn auch in dem Aufbau wenig originelles Drama «Die Hexe» (1876) hat eine Zeitlang den lebhaftesten Beifall gefunden. Aus einem zarten Gemüte heraus, in dem die feinsten Regungen der Natur in harmonischer Weise nachzittern, sind die Dichtungen Martin Greifs geboren. Ihm sind Lieder von echt Goethescher Einfachheit und Natürlichkeit gelungen; für die dramatische Kunst, in der er sich auch versucht hat, fehlt es diesem weichen und feinen Geist an gestaltender Kraft und Schärfe der Charakteristik. Eine scharf geprägte Dichterphysiognomie ist der Süddeutsche Johann Georg Fischer. Bei ihm fühlt man überall gesunde Kraft, einen frohen Lebensmut durch, die in herrlicher Sprache, oft mit ungesuchtem Pathos, oft mit einfachster Volkstümlichkeit zutage treten. Auch er ist den Forderungen des dramatischen Aufbaues nicht gewachsen.
Eine echt norddeutsche Dichternatur von herber Schönheit ist Theodor Fontane. Er ist als Lyriker zurückhaltend mit seinen Empfindungen und von außerordentlicher Knappheit des Ausdruckes. Er stellt die Eindrücke, welche seine Gefühle erregen, nebeneinander und läßt uns dann mit unserem Herzen allein. Seine Phantasie schafft in monumentalen Bildern und hat eine einfache Größe, die namentlich in seinen «Balladen» (1861) zur vollen Geltung kommt. Ähnliche Eigentümlichkeiten charakterisieren ihn auch als Erzähler. Sein Stil ist fast nüchtern, aber immer ausdrucksvoll. Das preußische Leben und die norddeutsche Natur haben in ihm einen klassischen Darsteller gefunden. Er malt gleich gut in großen Zügen wie in den kleinsten Einzelheiten. Seine Romane «Adultera», «Irrungen - Wirrungen»,
#SE033-094
«Stine», «Stechlin» werden von dem Publikum, das nur interessante Lektüre sucht, wie von den strengsten Kritikern gleich geschätzt. Ein echter Dramatiker von bewundernswerter Treffsicherheit in der Charakteristik und der Fähigkeit, Vorgänge in lebensvoller Entwickelung darzustellen, ist der Österreicher Ludwig Anzengruber. Seine Dramen wurzeln in dem Geistesleben des österreichischen Bauern-und Mittelstandes in den siebziger Jahren. Namentlich das Streben nach einer freisinnigen Auffassung religiöser Vorstellungen und die Kämpfe, welche das Bauerngemüt durch solche Ziele zu bestehen hatte, verstand er darzustellen, zum Beispiel im «Pfarrer von Kirchfeld» (1870), in den «Kreuzelschreibern» (1872). Wie tief er aus der Bauernseele heraus die Motive holen konnte, das zeigte er im «Meineid-bauer» (1872), «G'wissenswurm» (1874) und im «Fleck auf der Ehr» (1888). Ludwig Ganghofer, der in Schauspielen wie «Der Herrgottschnitzer von Ammergau» und «Der Geigenmacher von Mittenwald» das oberbayerische Volks-leben, ähnlich wie Anzengruber das österreichische, behandeln wollte, traf nicht wie dieser die naturwahren Töne. Dagegen besitzt Niederösterreich in Joseph Misson einen Epiker, der in seiner leider unvollendet gebliebenen poetischen Erzählung «Da Naz, a niederösterreichischer Bauernbui, geht in d'Fremd» (1850) Gemüt, Vorstellungs- und Handlungsweise seines Volkes in unvergleichlicher Weise zum Ausdruck gebracht hat. Das gleiche ist bis zu einem hohen Grade dem Steiermärker Peter Rosegger mit seinen Landsgenossen in einer Reihe von Prosawerken gelungen, die aus einem sinnigen Gemüte, einem wackeren Charakter und einer behaglichen Erzählungsgabe geboren sind. Die volksmäßige Dichtung, die meist auch als Dialektpoesie
#SE033-095
innig die Ausdrucksform und Anschauungsweise des Volkes wiederzugeben sucht, hat in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts schöne Blüten getrieben. Franz von Kobell und sein Schüler Karl Stieler haben im oberbayerischen Dialekt kostbare Perlen der Volksdichtung geliefert. Franz Stelz-hammer hat in österreichischer Mundart Dichtungen geschaffen, die von solcher Natürlichkeit sind, daß sie wie aus dem Stegreif des Volkes heraus erwachsen scheinen. Von warmer Empfindung eingegeben, aber von einer viel geringeren Kraft und Ursprünglichkeit ist die Mundartdichtung des Wieners J. G. Seidl. Der schlesische Dialekt hat in Karl von Holtei, den wir bereits (S.58) als Erzähler und Dramatiker anführten, einen Dichter von naiver, humorvoller Ausdrucksweise gefunden. Die norddeutsche Mundart pflegten Klaus Groth und Fritz Reuter. Groth, der Sänger des «Quickborn» (1852), schafft zwar wie der aus dem Volksleben herausgewachsene Gebildete, aber die Liebe zu der Heimat, das Streben, seiner Mundart Geltung zu verschaffen, ersetzen reichlich bei ihm, was ihm an Ursprünglichkeit abgeht. Ganz aus der Volksseele heraus, aus ihrem intimsten Denken und Fühlen, stammen Fritz Reuters Dichtungen. Dabei ist er ein Charakterzeichner ersten Ranges. Sogleich die erste Gedichtsammlung Reuters: «Läuschen un Rimels» (1853) gewann ihm einen großen Kreis von Verehrern. Am besten zeigt sich sein glänzendes Erzählertalent, wenn er die eigenen Erlebnisse in die Darstellung verwebt, wie in «Ut mine Festungstid» (1862) und «Utmine Stromtid» (1863 bis 1864). In anschaulicher Weise schildert er die Gemüts-stimmung vor den Ereignissen im Jahre 1812. Es ist der Drang nach den Urquellen der Poesie, der sich in dem reichen Beifall ausspricht, den Dichtungen wie die Anzengrubers,
#SE033-096
Roseggers, Groths und Reuters in fast allen Kreisen gefunden haben. Man glaubte im einfachen Volksgemüt das wieder zu finden, wovon man sich in der hochentwickelten Kunstdichtung der Heyses, Meyers, Hamerlings entfernt hatte. Gleichzeitig mit dieser Strömung ging eine andere, die auf höhere künstlerische Forderungen verzichtete und die ihre Befriedigung im liebenswürdigen Witz, in flotter, wenn auch wenig tiefer Darstellung suchte. Diese Richtung fand ihr Feld besonders in dem leicht hingeworfenen Feuilleton und in dem geschickt gebauten, sensationell-spannenden Drama. Paul Lindau, Oskar Blumen thal, Hugo Lubliner, Adolf l'Arronge, Franz v. Schönthan, Gustav v. Moser, Ernst Wzchert u. a. sorgten für diese Geschmacksrichtung, die sich allmählich so weiter Kreise bemächtigte, daß Proteste wie derjenige Hans Herrigs, der in seiner Schrift «Luxustheater und Volksbühne» (1886) das Theater der wahren Kunst wiedererobern wollte, zunächst wirkungslos verhallten. Herrig wollte vor allem das Volk für seine Ideen gewinnen, und dieses Ziel erstrebten auch seine Lutherfestspiele.
Deutlich wahrnehmbar bleibt aber auch in den siebziger und achtziger Jahren in einzelnen Kreisen eine starke Empfänglichkeit für echte Kunst. Dafür ist ein Beweis die stetig wachsende Anerkennung, die Gott fried Keller gefunden hat. Allerdings stellten sich die Schöpfungen, die er, nach einer langen Zwischenzeit, den von uns bereits früher (S.62) gewürdigten hinzufügte, diesen vollkommen ebenbürtig an die Seite. Die «Sieben Legenden» (1872) bedeuten eine Reform des Legendenstils auf einer ganz neuen, realistischen Grundlage. Das «Sinngedicht» (1881) ist eine warm empfundene, reife Schöpfung. Die «Züricher Novellen» (1878)
#SE033-097
sind Kulturbilder aus Zürichs Vergangenheit, mit Einfachheit und Größe gemalt; «Martin Salander» (1886) zeichnet die politischen Verhältnisse der Schweiz mit überlegenem Humor. Während bei Keller jede neue Schöpfung zugleich von einer höheren Stufe der Künstlerschaft zeugte, pflegte Gustav Freytag seinen einmal gewonnenen Stil weiter. Künstlerisch bedeuten weder seine «Bilder aus der deutschen Vergangenheit» (1859-67), noch die Romanreihe «Die Ahnen», die nach 1870 erschien, einen Fortschritt. Eine Persönlichkeit, die den wahren Charakter der letzten vier Jahrzehnte in der Dichtung wiedergibt, ist Wzlhelm Jordan. Leider fehlt ihm die dichterische Kraft, um seiner auf der vollen Höhe der Zeit stehenden Weltanschauung einen künstlerischen Ausdruck zu geben. Er hat in seinem «Demiurgos» (S.65) die Weltanschauung Darwins prophet isch vorher verkündet; als sie wissenschaftlich begründet vorlag, trat sie auch in seinen poetischen Erzeugnissen mit voller Klarheit auf. Die Charaktere in seiner Neudichtung des deutschen Heldenepos «Nibelunge» (1868-74) sind aus dieser Anschauung erwachsen, und seine Romane «Die Sebalds» (1885) sowie «Zwei Wiegen» (1887) sind ganz aus dem Geiste der naturwissenschaftlichen Denkweise der Gegenwart heraus entstanden. Muß Jordan wegen seiner Weltanschauung als echt moderner Geist bezeichnet werden, so war doch gerade er es, der das wahrhaft Poetische in dem Zurückgehen auf einfache, primitive Verhältnisse der Kulturentwickelung sah. Er wollte die letzte uns überlieferte Form des Nibelungenliedes nur als eine Abschwächung einer älteren, viel großartigeren Gestalt gelten lassen. Deshalb lehnt er sich nicht an das spätere deutsche Nibelungenlied, sondern an die älteren nordischen Sagenwelten an. In solchem
#SE033-098
Streben nach den Urquellen sieht man deutlich einen Nachklang der Goetheschen und Herderschen Anschauungs-weise, die in der naiven und kindlichen Vorstellungswelt die Wurzel des Poetischen sieht. Auch die Wiederherstellung des Stabreimes durch Wilhelm Jordan ist auf eine solche Auffassung zurückzuführen.
In den achtziger Jahren setzte sich in der jüngeren deutschen Dichtergeneration die Überzeugung fest, daß auf den Wegen, welche die Poesie bis dahin eingeschlagen hatte, weitere Früchte nicht mehr zu holen seien. Man wollte nicht ferner Kunstaufgaben lösen, die durch die Anschauungs-weise Herders, Goethes, Schillers und der Romantiker gestellt waren. Das Leben und die Ideenkreise hatten sich ja wesentlich geändert seit den Zeiten, in denen jene Geister ihre Gedanken ausgebildet hatten. Die naturwissenschaftlichen Entdeckungen hatten dazu geführt, die Vorgänge der Außenwelt und ihr Verhältnis zum Menschen in einer neuen Beleuchtung zu sehen. Die technischen Erfindungen hatten die Lebensführung und die Beziehungen der einzelnen Volksklassen geändert. Ganze Stände, die früher nicht am öffentlichen Leben teilgenommen hatten, traten in dasselbe ein. Die soziale Frage mit allen ihren Folgen stand im Mittelpunkte des Nachdenkens. Solchem Umschwunge in der ganzen Kultur gegenüber empfand man das Festhalten an alten Traditionen in der Poesie als unmöglich. Das neue Leben sollte eine neue Dichtung hervorbringen. Dieser Ruf erhob sich immer stärker. Voran schritten im Jahre 1882 die Brüder Heinrich und Julius Hart mit ihren «Kritischen Waffengängen», in denen sie gegen das Überlieferte, das Überlebte eine scharfe Sprache führten. Dann folgten ihnen andere Dichter des jüngeren Geschlechtes. Im Jahre 1885
#SE033-099
erschien eine Auswahl von Dichtungen «Moderne Dichtercharaktere», in der das Streben nach einem neuen Kunststil mit Entschiedenheit sich geltend machte. Neben den Harts beteiligten sich Wilhelm Arent, Hermann Conradi, Karl Henckell, Arno Holz, Otto Erich Hartleben, Wolfgang Kirchbach an der neuen Strömung. Michael Georg Conrad gründete in demselben Jahre in München die «Gesellschaft», eine «Realistische Monatsschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben», die von denselben Zielen geleitet wurde, und Karl Bleibtreu erteilte in seiner «Revolution der Literatur» allem Hergebrachten eine kräftige Absage. Neben vielem Unreifen erschien innerhalb dieser Bewegung manche erfreuliche Gabe. In Karl Henckells sozialen Gesängen pulsiert oft wahre Leidenschaft, trotz seiner Vorliebe für Partei-schlagworte. Hermann Conradis phrasenhafte Romane spiegeln die Gärungen der Zeit anschaulich wieder, und in seinen lyrischen Schöpfungen findet man herzenswarme Töne eines Menschen, der sich rückhaltlos ausspricht, mit allen Fehlern und Sünden der Menschennatur. Auch in Julius Harts Gedichten spricht sich ein echtes Mitempfinden mit all dem aus, was die Zeit erregt. Arno Holz ließ 1885 sein «Buch der Zeit» erscheinen, in dem er für die soziale Not wirksame Worte fand. Es war vor allen Dingen das Gekünstelte, das Leben in Vorstellungen, die den Zusammenhang mit dem Leben verloren hatten, dem man den Krieg erklärte. Nicht nach alten Schablonen, nach dem Kunstempfinden einer verflossenen Zeit, sondern nach den Bedürfnissen und Eingebungen der eigenen Individualität wollte man wirken. Unter dem Einflusse solcher Gesinnungen kam ein Dichter zur Geltung, der allerdings sich vollständig unabhängig von dem bewußten, absichtlichen Streben
#SE033-100
nach Neuem entwickelte: Detlev v. Liliencron. Er ist eine Natur voll Lebenskraft und künstlerischer Gestaltungsgabe, ein feiner Kenner und Schilderer aller Reize des Daseins, ein Dichter, dem alle Töne zur Verfügung stehen, von dem tollsten Übermut bis zur zarten Darstellung hehrer Naturstimmungen. 1883 lenkte er mit seinen «Adjutanten-ritten» die Aufmerksamkeit auf sich, und seitdem hat er sich in einer Reihe von lyrischen Sammlungen als einer der hervorragendsten unter den Dichtern der Gegenwart bewährt. In seine Spuren traten Otto Julius Bierbaum und Gustav Falke, von denen besonders der letztere durch sein Streben nach Formvollendung Anerkennenswertes geleistet hat. Guten Eindruck machte bei seinem ersten Auftreten auch Karl Busse, ohne sich jedoch weiter auf gleicher Höhe behaupten zu können. Richard Dehmel ist ein schwungvoller Lyriker, der aber den Einklang zwischen dem abstrakten Gedanken und der unmittelbaren Empfindung nicht finden kann. Das Suchen nach neuen Zielen erzeugt in der Gegenwart die mannigfaltigsten Richtungen. Gegenüber dem Idealismus, der den Geist zu hoch stellte und vergaß, daß allem Geistigen die Sinnlichkeit zugrunde liegt, bildete sich eine Gegen-strömung, die in der letzteren schwelgte und in jeder Lebens-äußerung nur nach den rohen tierischen Trieben suchte. Wahre Orgien auf diesem Gebiete feierte Hermann Bahr in seinen Erzählungen «Die gute Schule» (1890) und «Dora» (1893). Auch Cäsar Flaischlen sucht in seinem Drama «Toni Stürmer» (1892) den Idealismus der Liebe als widerspruchsvoll darzustellen und zu zeigen, daß nur natürliche Leidenschaft die Geschlechter zusammenführt. Die soziale Bewegung wirft ihre Wellen auch in die Dichtung. An den bestehenden gesellschaftlichen Zuständen, an den herrschenden
#SE033-101
Moralanschauungen wird eine scharfe Kritik geübt in Werken wie «Schlechte Gesellschaft» (1886) von Karl Bleibtreu, «Die heilige Ehe» von Hans Land und Felix Holländer und in Max Kretzers «Die Betrogenen» (1882) und «Die Bergpredigt» (1889). Otto Erich Hartleben zeigt in seinen Dramen «Hanna Jagert» (1893), «Erziehung zur Ehe» (1894) und «Sittliche Forderung» (1897) die Selbst-auflösung gesellschaftlicher Ideen und schildert in seinen novellistischen Skizzen mit großer satirischer Kraft menschliche Schwächen. Als Lyriker ist ihm eine schöne Plastik des Ausdrucks und eine einfache, geschmackvolle Natürlichkeit eigen. Dem Streben nach vollkommener Befreiung des Individuums, das in Max Stirner einen Philosophen gefunden hat (S. 50), gibt John Henry Mackay in seinem Kultur-gemälde «Die Anarchisten» (1891), in Erzählungen wie «Die Menschen der Ehe» (1892) und in seinen das Ideal persönlicher Unabhängigkeit über alles stellenden Gedichten (gesammelt erschienen 1898) Ausdruck. Das Aneinander-prallen der Sittlichkeitsbegriffe verschiedener Stände behandelt Hermann Sudermann in seinen Dramen «Die Ehre», «Die Heimat», «Glück im Winkel». In seinen neueren Bühnenwerken «Johannes» und «Die drei Reiherfedern» hat er sich höhere Aufgaben gestellt. Er stellt die in der menschlichen Natur selbst liegende Tragik dar, ein Ziel, dem er auch in seinen Erzählungen «Frau Sorge», «Der Katzen-steg» nachgestrebt hat. Den Einfluß der modernen natur-wissenschaftlichen Weltanschauung auf die menschliche Seele veranschaulicht Wilhelm Bölsche in seinem Roman «Mittagsgöttin» (1891). Die jüngste Dramatik strebt dadurch nach Naturwahrheit, daß sie die Entwickelung der Vorgänge in der Dichtung nicht nach höheren, künstlerischen
#SE033-102
Gesetzen vor sich gehen läßt, sondern eine photographischtreue Abbildung der Wirklichkeit sucht. Auf diesem Wege voran gingen Johannes Schlaf und Arno Holz mit Dramen «Meister Ölze» und die «Familie Selicke», in denen die Naturwahrheit bis zum bloßen Abschreiben äußerer Vorfälle übertrieben wird. Ihnen folgte Gerhart Hauptmann, der in seinen Erstlingswerken «Vor Sonnenaufgang» (1889) und «Das Friedensfest» (1890) noch ganz in diesem Stile schuf, sich aber in den «Einsamen Menschen» (1891) zur Schilderung bedeutsamer seelischer Konflikte und zu geschlossener dramatischer Komposition erhob. In seinem «Kollegen Crampton» (1892) hat er dann ein ebenso natur-wahres wie kunstvolles Charaktergemälde geliefert. In «Hanneles Himmelfahrt» und der «Versunkenen Glocke» wird sein Stil bei aller Naturtreue idealistisch und romantisch. In den «Webern» (1892) wird die Wirklichkeitsdarstellung zu einer vollständigen Auflösung aller dramatischen Form, im «Fuhrmann Henschel» zeigt sich, daß Hauptmann Naturtreue und dichterische Komposition vereinigen kann. Max Halbe hat mit seinem Liebesdrama «Jugend» (1893) vielen Beifall gefunden durch die stimmungsvolle Schilderung jugendlicher Leidenschaften. Als er sich höhere Ziele steckte, wie in seinen Charakterdramen «Lebenswende» und «Der Eroberer», vermochte er nicht durchzudringen. Eine große Aufgabe stellte sich Ludwig Jacobowski in seinem «Loki» (1898), dem «Roman eines Gottes», in dem er tief in die Abgründe der menschlichen Natur hineinleuchtet und deren ewiges Streben durch den Kampf des zerstörenden Loki gegen die schaffenden Asen veranschaulicht. Mit seiner lyrischen Sammlung «Leuchtende Tage» (i 899) hat er sich den hervorragendsten modernen
#SE033-103
Dichtern angereiht. Er verbindet einfache Schönheit des Ausdrucks mit einer harmonischen Welt- und Lebensauffassung. Einen unvergleichlichen Einfluß auf die Denkweise der Gegenwart hat im letzten Jahrzehnt Friedrich Nietzsche ausgeübt. Er suchte durch eine radikale «Um-wertung aller Werte» den ganzen Weg, den die abendländische Kultur seit der Gründung des Christentums gegangen ist, als einen großen idealistischen Irrtum darzustellen. Die Menschheit müsse allen Jenseitsglauben, alle über das wirkliche Dasein hinausgehenden Ideen ablegen und ihre Kraft und Kultur rein aus dem Diesseits holen. Nicht in der Ebenbildlichkeit höherer Mächte soll der Mensch sein Ideal erblicken, sondern in der höchsten Steigerung seiner natürlichen Fähigkeiten bis zum «Übermenschen». Dies ist der Sinn seines dichterisch-philosophischen Hauptwerkes «Also sprach Zarathustra» .
In Frankreich bewegte sich die Literatur im letzten Drittel des Jahrhunderts zunächst in den Bahnen weiter, die vorher eingeschlagen waren. Das Drama entwickelte sich durch Emile Au gier, Alexander Dumas den Jüngeren und Victorien Sardou zum Sitten- und Gesellschaftsschauspiel. In demselben kam es vor allem darauf an, durch spannende Verwicklungen und entsprechende Lösungen irgendeine moralisierende Tendenz zu veranschaulichen. Daneben verschaffte sich eine dramatische Gattung Geltung, die auf den geistreichen Dialog und die Gesellschaftssatire den Hauptwert legte. Sie hat in Edouard Pailleron ihren Hauptvertreter. Die Schulung in geschickter Szenenführung trieb ihre höchsten Blüten in Labiche, Meilhac, Bisson. Bei ihnen spielt Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Vorgänge
#SE033-104
keine Rolle, sondern nur die auf Wirkung berechnete Entwickelung der Handlung, die an überraschenden Wendungen reich sein muß. In der Lyrik herrscht das Streben nach Korrektheit der Form, nach glattem, gefälligem Ausdruck in der «Schule der Parnassiens». François Coppée, R. F.A. Sully-Prudhomme und Charles Leconte de Lisle pflegen besonders diese Richtung. Auch Anatole France gehört ihr mit seiner nach klassischer Darstellungsweise strebenden Lyrik an. Ein echt romantischer Dichter ist dagegen Charles Baudelaire, der sich am liebsten in Rauschzuständen der Seele befindet und mit Vorliebe die unheimlichen, dämonischen Gewalten des menschlichen Innern darstellt. Alle dunklen Triebe will er bloßlegen. In Angstgefühlen und Wollusterregungen schwelgt er förmlich. Ein gesünderer Sinn findet sich bei Gustav Flaubert und namentlich bei den Brüdern Edmond und Jules de Goncourt, die darnach streben, die künstlerische Phantasie durch den objektiven Geist der Wissenschaft zu zügeln. Unter ihrem Einflusse entsteht ein Naturalismus, der die Wirklichkeit nicht nach der subjektiven Willkür gestalten will, sondern sich die objektiven Gesetze der Erkenntnis für die dichterische Schilderung der Dinge zunutze machen will. Man will keine ästhetischen Gesetze, sondern nur solche, die auf bloßer Beobachtung des Tatsächlichen beruhen. Ihren vollendeten Ausdruck fand diese Richtung in Emile Zola. Er will die Dinge und Vorgänge gar nicht mehr künstlerisch gestalten. Wie der wissenschaftliche Experimentator im Laboratorium die Stoffe und Kräfte in Zusammenhang bringt und dann abwartet, was sich durch ihr gegenseitiges Einwirken entwickelt, so stellt Zola versuchsweise Dinge und Menschen einander gegenüber und sucht die Entwickelung so weiterzuführen,
#SE033-105
wie sie sich ergeben müßte, wenn die gleichen Dinge und Menschen in der objektiven Wirklichkeit in derselben Weise sich gegenüberständen. Er bildet auf diese Weise den Experimentalroman aus. Dabei lehnt er sich an die Errungenschaften der modernen Wissenschaft an. Neben diesem Zolaschen Naturalismus geht ein anderer von der Art des Balzacschen weiter, der in Alphonse Daudet einen Hauptvertreter hat. Ein Erzähler mit glänzendem, in die Tiefe der Seele dringenden Wahrnehmungsvermögen ist Guy de Maupassant. Wichtige Kulturerscheinungen unserer Zeit sind in seinen Romanen und in stilistisch meisterhaften Novellen niedergelegt. Als Charakterzeichner stellt er die Personen mit scharfen Umrissen hin, und seiner Darstellung von Handlungen ist in gleichem Maße die natürliche Wahrheit wie eine kunstvolle Komposition eigen. Denjenigen Teil des Publikums, der in Deutschland bei Lindau, Blumenthal u. a. seine Rechnung findet, befriedigten in Frankreich Victor Cherbuliez, Hector Malot und Georges Ohnet. Ein feinsinniger Künstler mit raffinierter Technik ist Pierre Loti, der allerdings eine Kunstrichtung pflegt, die mehr für den entwickelten Geschmack des Künstlers als für einen breiteren Kreis geeignet ist.
In holländischer Sprache hat unter dem Namen #SE033-106
Einseitigkeit des Ausdruckes zurück, wenn er treffen will, was ihm notwendig zur Verfolgung erscheint. Eine Art führender Geist des holländischen Volkstumes in Belgien ist Hendrik Conscience, der mit seinen innigen Darstellungen bescheidener Lebensverhältnisse großen Eindruck gemacht und in seiner Heimat auch Nachahmer gefunden hat. Der Belgier M. Maeterlinck geht von einer mystischen Anschauung der Natur und der Menschenseele aus. Ihn interessieren weniger die klaren Gedanken und die wahrnehmbaren Vorgänge, als vielmehr die dunklen Kräfte, die wir in den Ereignissen der Außenwelt und in den Tiefen unseres unbewußten Seelenlebens ahnen. Sie stellt er in seinen Dramen dar, und ihnen sucht er philosophisch in seinen feingeistigen Aufsätzen nahezukommen.
Die englische Dichtung dieser Zeit erhält ihr charakteristisches Gepräge durch die Schöpfungen Algernon Charles Swinburnes. Er ist eine romantisch veranlagte Natur, ein feuriger Schilderer der Sinnlichkeit, ein Zeichner der großen Leidenschaften, aber auch der zarten Schwingungen der Seele und stimmungsvoller Naturbilder. Die See mit ihren mannigfaltigen Schönheiten ist ihm ein Lieblings-gebiet. Seine Wiegenlieder sind bezeichnend für sein sinniges Gemüt. Auf dramatischem Gebiete («Atalanta in Calydon») strebte er nach griechischer Formvollendung. Neben ihm kommen noch Matthew Arnold und Dante Gabriel Rosetti in Betracht. Der erstere erinnert in Weltanschauung und Ausdruck an Byron, der letztere sucht durch altertümliche Kunstmittel einen einfachen Stil zu erreichen. Eine ursprüngliche Natur mit einer kraftvollen Darstellungsgabe ist William Morris. Aus eingehender Beobachtung heraus schildert Rudyard Kipling das indisch-englische Leben in
#SE033-107
fesselnden Novellen, Romanen und in volkstümlich klingenden Gedichten.
In Amerika entwickelte sich seit der Mitte des Jahrhunderts eine von dem englischen Mutterlande unabhängige Literatur. Ein universeller Geist und starker Künstler ist Henry Wordsworth Longfellow. Als Lyriker hat er es zur Anerkennung in der ganzen gebildeten Welt gebracht. Aus seinen Gedichten spricht ein edler, großer Charakter. Für seine humane Weltauffassung sind diejenigen seiner Schöpfungen bezeichnend, in denen er ergreifend das Los der Sklaven besingt. Er ist auch ein ausgezeichneter Erzähler, dem weiche, innige und auch humorvolle Töne zu Gebote stehen. In «Hiawatha» hat Longfellow die alten Kultur-zustände des indianischen Volkes geschildert, in der «Goldenen Legende» behandelt er das ewige Dichterproblem, den strebenden und irrenden Menschen als Symbol der ganzen menschlichen Gattung. Die englische Prosa der Gegenwart hat in Washington Irving einen hervorragenden Meister gefunden. Sein Humor hat einen sentimentalen Zug. Am meisten unterscheiden sich in bezug auf den Stil vom Mutterlande Francis Bret Harte, der Verfasser der weltbekannten kalifornischen Erzählungen, und der gedankenvolle Humorist Mark Twain. In Walt Whitman hat das amerikanische Vorstellungs- und Empfindungsleben einen besonders charakteristischen Ausdruck gefunden. Von den Gedanken, die er zum Ausdruck bringt, bis zur Behandlung der Sprache ist alles im echtesten Sinne modern.
Am stürmischsten vollzog sich in den letzten Jahrzehnten der Umschwung von alten zu neuen Anschauungen im Norden Europas. Er entwickelte sich unter dem Einflusse einer erbarmungslosen, nichts schonenden Kritik der Traditionen.
#SE033-108
Georg Brandes, der geistvolle Däne, schritt voran. Ein kühner, begeisternder Freisinn verschafft ihm weiteste Wirkung. Sein geistiger Horizont ist von seltener Größe. Er war imstande, mit feinem Sinn in die verschiedenen Kulturen Europas sich einzuleben und hat sich dadurch eine Weite des Gesichtskreises angeeignet, die ihn befähigt, die geistigen Strömungen aller Länder in ihren wesentlichen Charakterzügen zu verfolgen. Dadurch, daß er die fruchtbaren Ideen überall suchte und sie der Bildung Dänemarks einimpfte, wurde er der Reformator der gesamten Weltanschauung seines Vaterlandes. Auf dem Gebiete der Dichtung wirkten in Dänemark der Lyriker Holger Drachmann und der große Stilkünstier J. P. Jacobsen, der zugleich ein gründlicher und tiefsinniger Kenner der menschlichen Seele ist, und der innere Vorgänge und Abgründe des Gemütes in stimmungsvoller Weise zu schildern vermag.
In Norwegen sind Björnstjerne Björnson, Henrik Ibsen und Arne Garborg die Schöpfer einer Dichtungsart, deren Einfluß heute überall in Europa zu spüren ist. Ihnen gingen wie Propheten voran Jonas Lie und Alexander Kjelland, der erste als bedeutender Psychologe und Schilderer des volkstümlichen Lebens, der letztere als scharfer Satiriker auf dem Gebiete sittlicher Anschauungen und gesellschaftlicher Mißstände. Björnson ist ein Dichter, der mit seiner Kunst den freiheitlichen Idealen seines Vaterlandes dient. Ein politischer Geist, der stets den Kulturfortschritt bei all seinem Schaffen im Auge hat und der aus seiner kernfesten Gesinnung heraus seinen Gestalten sichere, klare Umrisse zu geben vermag. Ein revolutionärer Geist ist Henrik Ibsen. Alles, was die moderne Kultur Umwälzendes in sich trägt, hat er auch in seine Persönlichkeit aufgenommen. Er ist eine
#SE033-109
reiche, vielseitige Natur. Seine Werke zeigen daher große Verschiedenheiten im Stil und in den Mitteln, mit denen er seine Weltanschauung darstellt. Die Zersetzungskeime, die in den Anschauungen, Sitten und sozialen Ordnungen der Gegenwart liegen, spürt er überall auf («Stützen der Gesellschaft» 1877), die Lügen des Lebens («Volksfeind» 1882), die Stellung der Geschlechter («Nora» 1879, «Gespenster» 1881) zeichnet er mit scharfem Griffel, dämonische Gewalten im menschlichen Seelenleben stellt er als tiefer Psychologe dar («Frau vom Meere» 1888, «Hedda Gabler» 1890, «Baumeister Solneß» 1892), das Mystische im Seelenleben gestaltet er charakteristisch («Klein Eyolf» 1894). Als Grundthema behandelt Ibsen die Tragik des menschlichen Lebens in «Brand» (1866) und in «Peer Gynt» (1867). Pfarrer Brand soll das faustische Ringen des Menschen, der in der Vorstellungs- und Gefühlsart der Gegenwart lebt, darstellen. Der Held kennt nur eine Liebe, die zu seinen Vernunftidealen, und läßt die Sprache des Gefühls nicht zur Geltung kommen. Statt sich der menschlichen Herzen zu bemächtigen, um durch sie in gütiger Weise zur Erfüllung seiner Forderungen zu gelangen, strebt er diesen mit rücksichtsloser Härte nach. Er wird unduldsam aus Idealismus. Darin liegt das Tragische seiner Persönlichkeit. Einen Gegensatz zu ihm bildet Peer Gynt, der Phantasiemensch, dessen Vorstellungen zu wenig in der Wirklichkeit wurzeln, um ihren Träger zu jener Tatkraft hinzureißen, durch die sich der Mensch im Leben durchsetzt. Die Vielseitigkeit der Ibsenschen Kunst offenbart sich besonders deutlich, wenn man die «Komödie der Liebe» (1862), die uns den Dichter als Zweifler an den Zielen des Lebens zeigt, neben den nur ein Jahr später entstandenen «Kronprätendenten» betrachtet,
#SE033-110
in denen sich Sicherheit und Zuversicht in der Weltanschauung des Schöpfers aussprechen. Die Abhängigkeit des Menschen von der äußeren Umgebung, von Anschauungen, innerhalb derer er lebt und die er als Überlieferung empfangen, stellt der «Bund der Jugend» (1869) dar, und die Bestimmtheit des Willens durch die unabänderliche, natürliche Notwendigkeit aller Dinge bringt «Kaiser und Galiläer» (1873) zur Anschauung. «Die Wildente» (1884) und «Rosmersholm» (1886) sind Seelengemälde, aus denen der tiefdringende psychologische Kenner spricht.
An die Stelle des griechischen Schicksals und der göttlichen Weltordnung setzt er als treibende Macht des Dramas die naturgesetzliche Notwendigkeit, die nicht die Schuldigen bestraft und die Guten belohnt, sondern die Handlungen der Menschen regiert, wie sie den auf eine schiefe Ebene gelegten Stein hinunterrollt («Gespenster»). Arne Garborg hat nicht wie Ibsen die Darstellungskunst der großen Linien, aber er malt das Seelenleben treu und ist ein scharfer Ankläger sozialer Einrichtungen. Das Geschlechtsleben steht bei ihm im Mittelpunkt der Betrachtungsweise. Auch die beiden Schweden August Strindberg und Ola Hansson sind kraftvolle Seelenmaler, doch nehmen sie ihre Stoffe gern aus der ungesunden Natur. Strindbergs Pessimismus, der allerdings aus tiefschmerzlichen Lebenserfahrungen stammt, stellt sich fast wie das Zerrbild einer gesunden Weltanschauung dar.
Große geistige Erschütterungen hat in dieser Zeit auch das russische Geistesleben durchgemacht. Während die ältere russische Literatur in ihren Ideen und Vorstellungen sowie auch in ihren Ausdrucksmitteln sich als Nachahmerin west-europäischer Kultur erweist, vertieft sich jetzt der Volksgeist
#SE033-111
und sucht aus den Tiefen der eigenen nationalen Wesenheit heraus sich seine Anschauungen aufzubauen. Auch hier geht die Kritik wieder bahnbrechend voran. In W. Belinskij hat Rußland einen Ästhetiker und Philosophen von großem geistigen Umblick und hohen Zielen. Rein logisch betrachtet entbehrt seine kritische Tätigkeit der Folgerichtigkeit; Belinskij ist fortwährend ein Suchender, der die verworrenen Vorstellungen und dunklen Triebe seines Volkes zur Klarheit bringen will. Dabei läßt er sich mehr von seiner sicheren Empfindung als von irgendwelchen abstrakten Ideen leiten. Wie unergründlich tief und zugleich wie träumerisch-verworren der Volksgeist ist, das beweisen die Schöpfungen Nicolai Gogols, der die furchtbarsten Anklagen gegen sein Vaterland schleudert, aber Anklagen, aus denen eine innige, tiefe Liebe spricht. Ein mystischer Sinn liegt seinem Vorstellen zugrunde, der ihn rastlos vorwärts-treibt, ohne daß er irgendein klares Ziel vor sich sieht. In N. Nekrassow, Iwan Tur gen jew, Ivan Gontscharow und in F. M. Dostojewskij arbeitet sich dieser dunkle Drang allmählich ins Klare. Turgenjew ist allerdings noch stark beeinflußt von westeuropäischen Ideen. Er schildert in zarten Bildern vornehmlich leidende Menschen, die irgendwie mit dem Leben nicht fertig werden können. Gontscharow und Pissemskij sind Darsteller des russischen Gesellschaftslebens, ohne weitere Ausblicke auf eine Weltanschauung. Dostojewskij ist ein genialer Psychologe, der in die Tiefen des Seelenlebens hinuntersteigt und in glänzenden, zuweilen allerdings grausigen Bildern das Innerste des Menschen enthüllt. Sein «Raskolnikow» wurde in ganz Europa als Muster psychologischer Darstellung empfunden. Ein Repräsentant des ganzen russischen Geisteslebens ist Graf Leo Tolstoi.
#SE033-112
Er entwickelte sich vom kraftgewaltigen Erzähler («Krieg und Frieden» 1872, «Anna Karenina» 1877) zum Propheten einer neuen Religionsform, die ihre Wurzeln in einem etwas gewaltsam ausgelegten Urchristentum sucht und die völlige Selbstlosigkeit zum Lebensideal erhebt. Auch in aller Kunst, die nicht auf das menschliche Mitgefühl und die Besserung des Zusammenlebens abzielt, sieht Tolstoi einen überflussigen Luxus, dem sich ein selbstloser Mensch nicht hingibt. In Ungarn begegnen wir dem phantasievollen Erzähler Maurus Jókai und dem Dramatiker Ludwig Doczi, ferner Emerich Mada'ch, der in seiner «Tragödie der Menschheit» den ungarischen Faust lieferte.
Der erfolgreichste der neueren italienischen Dichter ist Giosue' Carducci, der nach klassisch-schönem Ausdruck strebt. Ein Sänger feuriger Sinnlichkeit ist Lorenzo Stecchetti, und ein Charakteristiker von Bedeutung ist der Dramatiker Pietro Cossa. Das sizilianische Bauernleben behandelt in lebensfrischen Erzählungen Giovanni Verga. Seine sozialen Dichter hat Italien in Guido Mazzoni und Ada Negri. Auf dem Felde der Dramatik stehen sich der Idealist Felice Cavallotti und der Naturalist Emilio Praga gegenüber. -Von Spanien aus eroberte sich José Echegaray für kurze Zeit die Aufmerksamkeit des europäischen Publikums, dem er in seinem «Galeotto» ein vielbesprochenes Drama lieferte, dessen Struktur an die abstrakte Folgerichtigkeit eines Rechenexempels erinnert.
DIE HAUPTSTRÖMUNGEN DER DEUTSCHEN LITERATUR VON DER REVOLUTIONSZEIT (1848) BIS ZUR GEGENWART
#G033-1967-SE113 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
DIE HAUPTSTRÖMUNGEN DER DEUTSCHEN LITERATUR VON DER REVOLUTIONSZEIT (1848) BIS ZUR GEGENWART
I. Die literarische Revolution um die Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts
#TX
Am 8. Dezember habe ich mit dem Zyklus von Vorträgen über «Die Hauptströmungen der deutschen Literatur von der Revolutionszeit (1848) bis zur Gegenwart» begonnen, mit denen mich der Vorstand der «Freien Literarischen Gesellschaft» beauftragt hat.
Ich möchte die «Freie Literarische Gesellschaft» nicht zu einem Universitätskolleg machen, sondern ich möchte in diesen Vorträgen den Mittelweg finden zwischen dem leichten Ton französischer conférences und demjenigen der Hochschulvorlesungen, die in dem strengen Gang wissenschaftlicher Methodik einherschreiten. Auch eine reine historische Betrachtungsweise möchte ich den Mitgliedern der Gesellschaft nicht bieten. Wer wie ich selbst mitarbeiten will an dem Ausbau der neuen Weltanschauung, die uns möglich geworden ist durch die Revolutionierung des geistigen Lebens in diesem Jahrhundert, der blickt lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit, und er ist nur imstande, die Vergangenheit insofern zu schildern, als sie die Keime für die Gegenwart und Zukunft enthält.
Von unseren Gegenwartsempfindungen habe ich gesagt, daß sie so grundverschieden sind von den Empfindungen der bedeutendsten Geister aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts,
#SE033-114
daß wir gegenüber den Schriften dieser Geister das Gefühl haben, als seien sie in einem uns fremden Idiom geschrieben. Eine radikale Umwandlung der Weltanschauung hat sich in unserem Jahrhundert vollzogen, so radikal, wie wenige der Weltgeschichte gewesen sind. Wenn man diese Umwandlung mit wenigen Worten bezeichnen will, so muß man sagen: der Mensch ist aus einem demütigen, sich schwach fühlenden Wesen, das abhängig sein will von höheren Mächten, ein stolzes, selbstbewußtes Wesen geworden, das Herr seines eigenen Schicksals sein will, das sich nicht regieren lassen, sondern sich selbst regieren will. Nicht aus jenseitigen Mächten, sondern aus der Wirklichkeit, der er selber angehört, hat der Mensch gelernt, seine besten Kräfte zu schöpfen. Von dieser Lebensauffassung waren die besten Geister in der ersten Hälfte des Jahrhunderts weit entfernt. Sie waren noch von der alten Vorstellungswelt, von den alten religiösen Anschauungen beherrscht. Sie konnten in ihrer Empfindungswelt von dem jenseitigen Gotte, der die Geschicke der Menschen lenkt, nicht loskommen. Sie sehnten sich nach neuen Lebens-, nach neuen Staats- und Gesellschaftsformen; aber ihr Sehnen war ein dumpfes, ein unbestimmtes, weil es nicht hervorging aus der Triebkraft einer neuen Weltanschauung. Politische Revolutionen können sich im großen Stile nur vollziehen, wenn sie mit einer Revolutionierung des ganzen geistigen Lebens verknüpft sind. Eine solche große, umfassende Revolution brachte das Christentum hervor. Die politischen Revolutionen der letzten Zeit haben ihr Ziel nicht erreicht, weil ihnen die treibende Kraft, die Revolutionierung der Weltanschauung, fehlte. Männer wie Jahn, Börne, Sallet, Herwegh, Anastasius Grün, Dingelstedt, Freiligrath, Moritz Hartmann, Prutz wußten, daß die
#SE033-115
alte Vorstellungswelt abgebraucht, überreif, faul geworden war; aber sie waren nicht imstande, eine neue Welt der Ideen an die Stelle der alten zu setzen. Sie wurden Revolutionäre, nicht weil in ihnen eine neue Vorstellungswelt lebte, die sie verwirklichen wollten, sondern weil sie unzufrieden mit dem Bestehenden, erbittert über das Gegenwärtige waren.
Aber die Vorstellungswelt und die alte Staatsform gehörten zusammen. Diese Wahrheit sprach Hegel aus, als man ihm eine Professur in Berlin übertragen hatte. Hegel war der unproduktivste Geist, den man sich denken kann. Er war unfähig, aus seiner Phantasie eine neue Idee zu gebären. Aber er war einer der vernünftigsten Menschen, die je gelebt haben. Er durchdrang deshalb die alte Ideenwelt bis in ihre letzten Schlupfwinkel. Und diese Ideenwelt fand er verwirklicht im preußischen Staate. Deshalb konnte er sagen: alles Wirkliche ist vernünftig. Das letzte Wort der alten Weltanschauung hat Hegel ausgesprochen. Mit dieser Auffassung konnte man nicht revolutionieren. Dazu bedurfte es einer neuen Ideenwelt. Der erste Verkünder einer solchen ist Ludwig Feuerbach. Er hat die Menschen gelehrt, daß alle höheren Mächte Idole sind, die der Mensch in seiner eigenen Brust erzeugt hat und die er aus der eigenen Seele hinaus in die Welt versetzt hat, um sie zu verehren als über ihm wirkende Wesenheiten. Feuerbach hat den Menschen zum Herrn über sich selbst gemacht. Damit war der Anfang zu einer ganz neuen Ideenwelt gegeben. Die alte Ideenwelt war zum Idol, zum Spuk, zum Gespenst geworden, von denen sich der Mensch knechten ließ. Das hat Max Stirner mit den klarsten Worten gesagt, die je gesprochen worden sind. Fort mit allen Idolen war seine Losung. Und da blieb
#SE033-116
denn nichts zurück als das von nichts geknechtete, freie, fessellose «Ich», das seine Sache auf nichts stellt. Wir, in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, arbeiten daran, in diesem Nichts das All zu finden. Die alten Ideale liegen zerstört zu unsern Füßen; sie sind uns gegenüber ein Nichts, eine gähnende Kluft. Die Dichter, die Künstler, die Naturforscher, die Denker in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sind bestrebt, dieses Nichts wieder mit Leben zu füllen. Darwin und Haeckel haben eine neue Weltanschauung, neue religiöse Vorstellungen gebracht.
Durch Feuerbach sind die Geister revolutioniert worden, vorbereitet worden, Darwin und Haeckel zu verstehen. Diese Umwandlung der Weltanschauung ist die große Revolution des neunzehnten Jahrhunderts. Ihr gegenüber ist die politische Revolution im Jahre 1848 nur ein äußeres Zeichen, ein Symbol. Die geistige Revolution dauert noch heute fort. Sie wird die siegreiche sein.
Ich habe Freude darüber gehabt, daß sich zu diesem ersten meiner Vorträge die Mitglieder und Gäste der «Freien Literarischen Gesellschaft» so zahlreich einfanden.
#TI
2. Von Heinrich Laube zu Paul Heyse
#TX
Heinrich Laube ist mir der Typus des Literaten, der mit dem kalten und wenig in die seelischen Tiefen des Menschen gehenden Blick die Dinge betrachtet. In seiner Jugend lebte das Feuer des Revolutionärs in ihm, das ihn bis zur Verherrlichung des polnischen Aufstandes brachte. Allmählich überwuchert die Nüchternheit in seiner Natur; er wird der selbstbewußte Mann, der sich an die Dinge in dem Gefühle macht, daß er sie am richtigen Ende anzufassen versteht. Er
#SE033-117
ist der beste Regisseur des Jahrhunderts, weil er ein klares Auge für die Harmonie hat, in welche die Außenseiten der Dinge gebracht werden müssen, wenn sie wirken sollen. Er ist der Mann der Kulissenästhetik. Und Kulissenkünstler ist er auch als Dramatiker und als Romanschriftsteller. An seinen Gestalten vermißt man die Seele, in den von ihm geschilderten Begebenheiten die geschichtlichen Ideen. Anders ist Gutzkow. Er ist der bedeutendste unter den Geistern, welche um die Mitte des Jahrhunderts wirkten. Ist Laube als sozialer Anatom zu bezeichnen, so ist Gutzkow der philosophische Betrachter seiner Zeit zu nennen. Als umfassendes, tiefgründiges Dokument dieser Zeit erscheinen seine «Ritter vom Geiste» (185o-51). Alle typischen Gestalten der damaligen Gesellschaft, alle sozialen Strömungen führt Gutzkow vor, um ein allseitiges, vollkommenes Bild seiner Gegenwart zu zeichnen. Nicht weniger lebt der Geist dieser Zeit in seinem Roman «Der Zauberer von Rom» (1858-61). Die Licht- und Schattenseiten des Katholizismus, die sympathischen und unsympathischen Charakterköpfe, die er zeitigt, vereint Gutzkow zu einem Kulturgemälde von höchstem Wert. Nicht so bedeutend wie vielen andern erscheint mir Gustav Freytag. Ich sehe in allen seinen Schöpfungen den Geist der Journalistik. Mit all den Ungenauigkeiten, Schiefheiten und Halbheiten, mit denen der Leitartikler Menschen und Zustände charakterisiert, stattet Freytag seine Schöpfungen aus. Das zeitgemäße Schlagwort gilt in dieser Kunst des Charakterisierens mehr als der ungetrübte Blick in die Verzweigungen und in die Fülle der Wirklichkeit. In den «Journalisten» treten nicht wahre Gestalten, sondern halbwahre Figuren auf, wie sie in den Köpfen der Tagesschriftsteller leben. Dieser Bolz ist zwar so, wie ihn Freytag
#SE033-118
schildert, in der Wirklichkeit nicht zu finden; aber die Journalistik muß ihn erfinden, um an ihm die Zeitgedanken zum Ausdruck bringen zu können.
Uns Gegenwartsmenschen haben die Laubeschen, Gutzkowschen und Freytagschen Gestalten nicht mehr viel zu sagen. Uns haben sich im menschlichen Seelenleben und in der Geschichte wirksame Kräfte enthüllt, von denen die Geister um die Mitte des Jahrhunderts noch nichts wußten. In welchem Sinne diese Behauptung aufzufassen ist, werden meine nächsten Vorträge zeigen.
#TI
3. Das geistige Leben in Deutschland vor dem
deutsch-französischen Kriege
#TX
Die fünfziger und sechziger Jahre dieses Jahrhunderts zeigen eine Anzahl nebeneinanderlaufender Strömungen. Einseitige Richtungen des Geisteslebens gingen nebeneinander her. Erst in unserer Zeit hat ein Zusammenfluß dieser Einzelströmungen stattgefunden. Herman Grimm ist eine Persönlichkeit, in deren geistiger Physiognomie eine von diesen Strömungen zur Erscheinung kam. Es ist die rein ästhetische Weltanschauung, zu der er sich bekennt. Die Welt ist ihm nicht von «ewigen, ehernen Gesetzen», von Naturgesetzen beherrscht. Sie ist ihm ein Kunstwerk, das ein göttlicher Künstler geschaffen hat und das ihm unendliche Schönheiten enthüllt. Neben dieser rein ästhetischen Weltanschauung macht sich die auf einer breiteren geistigen Unterlage ruhende geltend, die David Friedrich Strauß begründet hat. Für Strauß ist die Persönlichkeit des Gottessohnes zu der göttlichen Idee verflüchtigt, die sich nicht in einem einzelnen menschlichen Individuum (Jesus), sondern nur in der ganzen
#SE033-119
Menschheit verwirklichen kann. Nicht in einem Menschen kann Gott irdisches Dasein gewinnen, sondern nur in dem Leben des Menschengeschlechtes.
Die dritte Weltanschauung, diejenige, welche am meisten zukunftverheißend war, wurde durch Charles Darwins «Entstehung der Arten» (1859) eingeleitet. Durch ihn und seinen Schüler Ernst Haechel trat die Naturverehrung an die Stelle der Gottesverehrung. Es gab nunmehr keinen Geist außer demjenigen, den die Natur aus sich selbst hervorzubringen vermag. Durch sie erst kann der Mensch so weit kommen, die ethische Befriedigung, die ihm ehedem nur durch den Ausblick auf ein Jenseits möglich war, aus der Natur selbst zu schöpfen. Nunmehr quellen aus dieser Erde seine Freuden.
Das künstlerische Dokument dieser Weltanschauungen sind Paul Heyses «Kinder der Welt». Es kommt nicht darauf an, was in diesem Roman erzählt wird. Es kommt darauf an, daß in ihm die Weltanschauungen der fünfziger und sechziger Jahre eine künstlerische Gestalt gewonnen haben.
Das Publikum, das durch diesen Roman seine Befriedigung fand, war ein solches, das zwar eine neue Weltanschauung, ein neues Denken und Empfinden brauchte, das aber kein Bedürfnis hatte nach einer Neugestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, der sozialen Ordnung.
Dem Leserkreis, der sich nach neuen Formen des Lebens sehnte, kam Friedrich Spielhagen entgegen. Er macht die sozialen Ideen und Strömungen seiner Zeit zum Gegenstand seiner Romane.
#SE033-120
#TI
4. Die literarischen Kämpfe im neuen Reich
#TX
In den siebziger Jahren sind innerhalb Deutschlands Kunst, Philosophie und Wissenschaft nicht Angelegenheiten, die im Mittelpunkte des Lebens stehen. Die Geister sind in Anspruch genommen von dem Bestreben, es sich im neuen Reich so bequem als möglich einzurichten. Die Politik nimmt das Interesse weit mehr in Anspruch als die künstlerischen Tendenzen. Diese bilden nur einen Luxus, eine Beigabe zum Leben, dem man sich in den Erholungspausen zuwendet. Dichter finden ein großes Publikum, welche Dinge besingen, die nichts zu tun haben mit dem Ernst des Lebens. Die Redwitz, Roquette, Rodenberg, Bodenstedt, Geibel sind so recht nach dem Geschmacke dieser Zeit. Man muß seine höheren geistigen Interessen vergessen, wenn man an diesen Dichtern ungetrübte Freude haben will. Die ewigen Traulichkeiten des Waldes, die Niedlichkeit der Vöglein, die träumerische Hingabe an die süßen Seiten der Natur sind nicht für Menschen, denen die Kunst das Höchste im Leben ist.
Die Fortentwickelung des menschlichen Geistes leidet unter der Zähigkeit der menschlichen Natur. Die Zeit, von der ich spreche, war noch nicht so weit, den ganzen Menschen mit jener Empfindungs- und Vorstellungsart zu durchdringen, von der die naturwissenschaftliche Weltanschauung beherrscht ist. Der alte Idealismus, der einseitig aus dem Geistigen die Welt begreifen will, herrscht noch vor. Man konnte noch nicht verstehen, daß aus der Natur, aus der unmittelbaren Wirklichkeit der Geist geboren wird. Ein voller Beweis dafür ist die Erscheinung Robert Hamerlings. Er ist der Typus eines Künstlers in einer überreifen Zeit. Er
#SE033-121
hat die Ideen der abendländischen Welt, ihrem ganzen Umfange nach, in sich aufgenommen. Aber er ist nicht imstande, die künstlerische Form, die er seinen Werken gibt, in vollen Einklang mit seinen Ideen zu bringen. Die sinnlich-üppigen Bilder, die farbenreichen Schilderungen, die er gibt, scheinen nur äußerlich seinen Ideen aufgepfropft. Wäre Hamerling wirklich ein moderner Geist, so müßte ihm der geistige Inhalt nicht neben und über der Wirklichkeit stehen, die er schildert, sondern er müßte ihm aus ihr herausquillen. Wie wenig man in dieser Zeit das Hervorgehen des Geistigen aus dem Sinnlich-Natürlichen begreifen konnte, wird am anschaulichsten an Sacher-Masoch. Mit einer feinen Auffassungsweise wühlt sich dieser Dichter in das Sinnliche ein. Er kennt alle Geheimnisse des Fleischlich-Natürlichen. Aber seine Schilderungen bleiben ganz im Gebiete der rohen, nackten Sinnlichkeit. Das Geistige erscheint daneben als eine Illusion, eine Schaumblase, welche das Sinnliche zur Täuschung des Menschen hervorbringt. Hamerling ist zur Hälfte Christ, zur andern Hälfte Heide; Sacher-Masoch ist der umgekehrte Christ, der mit dem Fleischlichen einen religiösen Kult treibt. So gewiß die Kunst Sacher-Masochs eine Einseitigkeit darstellt, so gewiß sind seine Werke Dokumente der siebziger Jahre, jener Zeit, die nicht die Kraft hatte, sich über Einseitigkeiten zu erheben.
In Hamerling und Sacher-Masoch lebt etwas, das in dem bloß Künstlerischen sich nicht erschöpft. Ein Glied innerhalb der menschlichen Wirksamkeit ist ihnen die Dichtung, ein Mittel, den ganzen Menschen auszuleben, der mehr ist als bloß Künstler. Ihnen stehen diejenigen gegenüber, welche eine Spätkunst pflegen, die nicht aus der menschlichen Natur unmittelbar fließt, sondern welche durch Umbildung, Weiterentwickelung
#SE033-122
früherer Kunstformen entstanden ist. Ihnen rechne ich zu: Hermann Lingg, Josef Victor Scheffel, Adalbert Stifter, iheodor Storm, Gott fried Ke/ler, Conrad Ferdinand Meyer, Theodor Fontane.
In klarster Weise zeigt sich der Grundcharakter des künstlerischen Empfindens der siebziger Jahre in der Dramatik. Während noch Brachvogel in echt deutscher Weise in der Ausgestaltung menschlicher Charaktere die Aufgabe der Dramatik sah, wird der beliebteste Dramatiker dieser Zeit zum bloßen Experimentator der dramatischen Form. Und ein wahrer großer Mensch wie Ludwig Anzengruber bleibt unbeachtet. Unter Paul Lindaus Führung hört die Dramatik auf, einem höheren geistigen Bedürfnisse zu dienen; sie wird zu einer Spielerei mit den von den Franzosen entlehnten Formen der tändelnden Bühnendichtung.
So war die geistige Atmosphäre der Zeit beschaffen, in der das junge deutsche Reich sich bildete. Eine gründliche Unzufriedenheit bei den jungen Köpfen ist daher nur zu begreiflich. Michael Georg Conrad, Max Kretzer, Karl Bleib-treu, Konrad Alberti machten sich zu den Wortführern der Unzufriedenen. Eine junge, zukunftverheißende Kunst wollten sie an die Stelle der greisenhaften, abgelebten setzen. Es kommt nicht darauf an, was die jungen Revolutionäre geleistet haben. Sie haben alle nicht gehalten, was sie versprochen haben. Es kommt vielmehr darauf an, daß sie einer Grundempfindung Ausdruck gegeben haben, die bei der jungen Generation der siebziger Jahre nur zu berechtigt war.
#SE033-123
#TI
5. Die Bedeutung Ibsens und Nietzsches für das moderne
Geistesleben
#TX
Im fünften meiner Vorträge versuchte ich die Bedeutung Ibsens und Nie tzsches für das moderne Geistesleben zu schildern. Ibsen hat in sich selbst die Kämpfe durchlebt, die sich zwischen den Geistern in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts abspielten. Er war nicht so glücklich, sich einer einseitigen Geistesströmung ganz hingeben und von einem Gesichtspunkte aus, etwa wie Schopenhauer, Max Stirner, Lassalle, David Friedrich Strauß, alles andere bekämpfen zu können. Seine Seele ist ein Kampfplatz, auf dem die geistigen Kampftypen alle auftreten und miteinander ringen, ohne daß eine zum Siege käme. Sein geistiges Wirken ist eine Diskussion vieler Einzelner, die in ihm wohnen.
Zwei Hauptströmungen durchziehen die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts. Die erste besteht in einer radikalen Sehnsucht nach Freiheit. Unabhängig wollen wir sein von jeglicher göttlichen Vorsehung, unabhängig von aller Tradition, von anerzogenen und vererbten Elementen des Lebens, unabhängig von dem Einflusse gesellschaftlicher und staatlicher Organisation. Herren unseres eigenen Geschicks wollen wir sein.
Dieser Sehnsucht steht der aus der modernen Naturwissenschaft fließende Glaube entgegen, daß wir ganz eingesponnen sind in das Gewebe einer starren Notwendigkeit. Wir sind Abkömmlinge der höchstentwickelten Säugetiere. Was diese vollbringen, ist eine Wirkung ihrer Organisation. Und auch, was wir Menschen handeln, denken und empfinden, ist ein Ergebnis unserer natürlichen Beschaffenheit. Es
#SE033-124
ist denkbar, daß die Naturwissenschaft soweit kommt, genau nachweisen zu können, wie die Teile unseres Gehirns gelagert sein und sich bewegen müssen, wenn wir eine bestimmte Vorstellung, eine bestimmte Empfindung oder Willensäußerung haben. Wie wir organisiert sind, so müssen wir uns verhalten. Wie kann dieser Erkenntnis gegenüber noch von Freiheit gesprochen werden?
Ich glaube, die Naturwissenschaft kann uns in schönerer Form, als die Menschen es je gehabt haben, das Bewußtsein der Freiheit wiedergeben. In unserem Seelenleben wirken Gesetze, die ebenso natürlich sind wie diejenigen, welche die Himmelskörper um die Sonne treiben. Aber diese Gesetze stellen ein Etwas dar, das höher ist als alle übrige Natur. Dieses Etwas ist sonst nirgends vorhanden als in den Menschen. Was aus diesem fließt, darinnen ist der Mensch frei. Er erhebt sich über die starre Notwendigkeit der unorganischen und organischen Gesetzmäßigkeit, gehorcht und folgt nur sich selbst. Die christliche Anschauung dagegen ist die, daß in diesem Gebiete, das der Mensch über die Natur hinaus für sich selbst hat, die göttliche Vorsehung waltet.
Einen Ausgleich zwischen dem Glauben an die starre Naturnotwendigkeit und dem Drange nach Freiheit hat Henrik Ibsen nicht finden können. Seine Dramen zeigen, daß er zwischen den beiden extremen Bekenntnissen hin-und herschwankt. Bald läßt er seine Personen nach Freiheit ringen, bald läßt er sie Glieder einer eisernen Notwendigkeit sein.
Erst Friedrich Nietzsche hat die Emanzipation der menschlichen von der übrigen Natur gelehrt. Der Mensch soll keinem überirdischen und keinem bloßen Naturgesetze
#SE033-125
folgen. Er soll nicht ein Spielball der göttlichen Vorsehung und nicht ein Glied in der Naturnotwendigkeit sein. Er soll der Sinn der Erde sein, das heißt das Wesen, das in voller Unabhängigkeit sich selbst auslebt. Aus sich heraus soll er sich entwickeln und keinem Gesetze unterliegen. Dies ist Nietzsches Ethik. Dies liegt seiner Vorstellung von einer «Umwertung aller Werte» zugrunde. Bisher hat man den Menschen begünstigt, der am besten den Gesetzen folgt, die man als die göttlichen oder die naturgemäßen zu erkennen glaubt. Ein Bild der Vollkommenheit hat man dem Menschen vorgehalten. Den Menschen, der nur aus sich heraus leben wollte, der jenem Bilde nicht nachstrebte, hat man als einen Störenfried der allgemeinen Ordnung betrachtet. Das soll anders werden. Der Typus, der nach all der Stärke, der Macht, der Schönheit, die nicht vorgezeichnet sind, sondern die in ihm selbst liegen, strebt, soll frei sich entwickeln können. Der Mensch, der nur nach dem Gesetze lebt, soll eine Brücke sein zwischen dem Tiere und dem Übermenschen, der das Gesetz selbst schafft.
Aller Jenseitsglaube wird überwunden sein, wenn der Mensch auf sich selbst sein Dasein zu bauen gelernt haben wird.
Ich möchte auch Zola als eine Persönlichkeit bezeichnen, die im Sinne der Weltanschauung Nietzsches wirkt. Nicht ein Höheres, Göttliches soll nach Zolas Meinung das Kunstwerk gegenüber der unmittelbaren Wirklichkeit darstellen, nein, dieses Wirkliche soll der Künstler so darstellen, wie er es durch sein Temperament sieht. Dadurch fühlt er sich als Schaffender und der, welcher ihn genießt, als Sinn der Erde. Beide bleiben innerhalb des Wirklichen, aber sie stellen es so dar, daß sie durch ihre Darstellung das Bewußtsein erwecken,
#SE033-126
der Mensch ist ein Naturwesen wie alle anderen Naturdinge, aber ein höheres, das aus sich heraus den Dingen eine freie Gestalt zu geben vermag.
#TI
6. Der Einfluß der Weltanschauung einer Zeit auf die
Technik der Dichtung
#TX
Schillers dramatische Technik ist nur möglich bei einem Dichter, der an eine moralische Weltordnung glaubt. Der dramatische Held muß im Sinne Schillers durch eine Schuld der tragischen Katastrophe zugeführt werden. Die Katastrophe muß als Strafe erscheinen. Wir, mit unserer rein naturwissenschaftlichen Weltanschauung, finden es absurd, wenn sich im Drama die Katastrophe an eine Schuld knüpft. Was in der Menschenwelt vorgeht, trägt für uns denselben Charakter moraifreier Notwendigkeit wie das Weiterrollen einer Billardkugel, die von einer anderen gestoßen wird. Eine solche Notwendigkeit befriedigt uns auch allein im Drama. Daran anknüpfend entwickelte ich den Zusammenhang zwischen der naturwissenschaftlichen Richtung der achtziger Jahre und dem dichterischen Naturalismus dieser Zeit. Die jungen Dichter dieser Zeit wollten genauso äußerlich die Tatsachen schildern, wie sie die Naturforscher beobachteten. Sie hingen an der Außenseite, welche den Sinnen offenliegt; die tieferen Zusammenhänge in Natur und Menschenleben, die sich nur dem Geiste enthüllen, berücksichtigten damals weder die Forscher noch die Künstler. Heute streben wir einer anderen Welt- und Lebensauffassung zu. Der Dichter wird die Tatsachen der Welt nicht so verknüpfen, wie sie im Lichte einer moralischen oder einer anderen göttlichen Weltordnung erscheinen, aber er wird sie auch
#SE033-127
nicht so verknüpfen, wie sie sich der bloßen äußeren, sinnenfälligen Beobachtung darbieten. Er wird das Recht seiner Persönlichkeit geltend machen. Sein Temperament, seine Phantasie bewegen ihn, die Dinge in einem anderen Zusammenhang zu sehen, als ihm die Beobachtung sie zeigt. Er wird sich durch die Dinge aussprechen, die er darstellt. Deshalb wird alle Ästhetik sich in Psychologie auflösen. Der einzige Grund für die Art, wie ein Dichter schafft, wird die Eigenart seiner Persönlichkeit sein. Ich möchte die Kritik, die sich aus dieser Anschauung notwendig entwickeln muß, die individualistische nennen, im Gegensatze zu der überlebten Kritik, die objektive Maßstäbe anlegt. Ich gebe diesmal nur dieses kurze Referat über meinen Vortrag, weil ich mich über die Sache nächstens an diesem Orte ausführlicher aussprechen möchte.
#TI
7. Das geistige Leben der Gegenwart
#TX
Wir leben in einer Zeit, in welcher die Revolutionierung der Geister durch die auf naturwissenschaftlichen Grundlagen gewonnene Weltanschauung auf alle Menschen ihre überzeugende Wirkung ausübt, die am geistigen Leben einen bemerkenswerten Anteil nehmen. Aber diese Wirkung ist bei vielen nur eine solche auf den Verstand. Diese Vielen sehen den Menschen als dasjenige Geschöpf an, als das sie ihn ansehen müssen, wenn sie die notwendigen Folgerungen aus Darwins weltumwälzenden Ideen ziehen. Aber das Herz dieser Geister, die Empfindungsweise sind nicht so weit wie ihr Verstand. Sie denken naturwissenschaftlich und empfinden christlich. Das verursacht in ihnen jene furchtbarschmerzliche
#SE033-128
Seelenstimmung, die entstehen muß, wenn man sich sagt: das Wertvolle ist die jenseitige Welt, die Welt der reinen Ideale und der himmlischen Güter, und wenn man zugleich erkennt, daß diese Welt ein leeres Hirngespinst, ein wesenloser Traum ist. Ein Geist, in dem diese schmerzliche Stimmung zu einem grandiosen dichterischen Ausdruck gekommen ist, ist Marie Eugenie delle Grazie. In einer bewundernswerten Dichtung «Robespierre» hat sie diesem Schmerz Worte verliehen. Die Erde ist ihr die brünstige Allmutter, welche nutz- und zwecklos, nur um ihrer Gier zu dienen, ewig neue Wesen erschafft und wieder zerstört, und welche von Zeit zu Zeit auch Propheten erschafft -Sokrates, Christus, Robespierre -, die von Idealen träumen, um die Menschen eine kurze Zeit hinwegzutäuschen über die Nichtigkeit des Daseins. Sie würden ohne diese idealistischen Träumer die Vernichtung dem Dasein vorziehen Durch die Idealisten werden die Menschen immer wieder zu neuer Lebenslust aufgereizt, aber zugleich um die wirkliche Erkenntnis geprellt.
Der Zwiespalt zwischen Kopf und Herz, zwischen Empfindung und Verstand ist der Inhalt des größten Teiles der zeitgenössischen Dichtung. Arno Holz, Julius Hart sind die Sänger dieses Zwiespaltes. Aber wir haben auch Lyriker, die aus der neuen Weltanschauung den Lebensmut und die Daseinsfreude schöpfen können, welche für wirklich Erkennende aus ihr fließt. Wir brauchen keinen Ausblick auf das Jenseits, um über die Trübsale des Diesseits hinweg-zukommen. Das hat in ergreifenden Gedichten vor allen der leider so frühverstorbene Hermann Conradi ausgesprochen. Das klingt auch in mancher Dichtung Wilhelm Jordans und vieler anderer durch.
#SE033-129
Wir haben aber auch einen Dichter, dem die moderne Empfindungsweise wie eingeboren ist, der sich nicht durch Kampf und Schmerz zu ihr durchgerungen hat, der naiv-modern ist: Otto Erich Hartleben. Die anderen müssen sich erst mit dem Christentum auseinandersetzen, um modern zu empfinden; er empfindet ursprünglich modern. Jeder Ton in seinen Dichtungen ist mir sympathisch, weil ich alles so empfinden muß wie er.
Ich habe nun in diesem Vortrage noch ausgeführt, was Wlhelm Jensen, WIheIm Raabe, Richard Dehmel, Detlev von Liliencron innerhalb der modernen Welt bedeuten; ich habe die gegenwärtige Dramatik (Max Halbe, Ernst von Wolzo gen, Hermann Sudermann, Gerhart Hauptmann, Otto Erich Hartleben) charakterisiert. In einem kurzen Referat kann ich den Inhalt des Vortrages nicht wiedergeben, in den ich alles das gedrängt habe, was ich über meine Zeitgenossen zu sagen habe.
Ich habe mich in diesen Vorträgen bemüht, ein Bild zu geben von der Revolutionierung der Geister in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Wir feiern gegenwärtig das Jubiläum der Revolution. Aber wichtiger als die politische Revolution ist uns die rein geistige unserer Weltanschauung. Wir gehen in das neue Jahrhundert hinüber mit wesentlich anderen Gefühlen, als sie unsere im Christentum erzogenen Vorfahren hatten. Wir sind wirklich «neue Menschen» geworden, aber wir, die wir uns zur neuen Weltanschauung auch mit dem Herzen bekennen, wir sind eine kleine Gemeinde. Wir wollen Kämpfer sein für unser Evangelium, auf daß im kommenden Jahrhundert ein neues Geschlecht erstehe, das zu leben weiß, befriedigt, heiter und stolz, ohne Christentum, ohne Ausblick auf das Jenseits.
LYRIK DER GEGENWART
#G033-1967-SE130 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
LYRIK DER GEGENWART
EIN ÜBERBLICK
I
#TX
Das Leben eines Zeitalters schafft sich seinen intimsten Ausdruck in der Lyrik. Was der Geist einer Epoche dem Herzen des einzelnen Menschen zu sagen hat, das strömt dieser in seinen Liedern aus. Keine Kunst spricht eine so vertrauliche Sprache wie die lyrische Poesie. Durch sie werden wir gewahr, wie innig verflochten die menschliche Seele mit den größten und den geringsten Vorgängen des Weltalls ist. Der gewaltige Genius, der auf der Menschheit Höhen wandelt, wird durch sein Lied zum Freunde des schlichtesten Gemütes. Wie es den Menschen zum Menschen hinzieht, das kommt in der Lyrik mit vollkommener Klarheit zum Vorschein. Denn wir fühlen es, daß wir auf keine Geistesgaben unserer Mitmenschen einen geringeren Anspruch haben als auf ihre lyrischen Schöpfungen. Was der Geist auf anderen Gebieten erringt, das scheint der ganzen Menschheit von vornherein zu gehören, und diese glaubt ein Recht auf Mit-genuß zu haben. Das Lied ist ein freiwilliges Geschenk, dessen Mitteilung dem selbstlosen Bedürfnis entspringt, die Geheimnisse der Seele nicht für sich allein zu besitzen.
Aus diesem Grundzug der lyrischen Kunst dürfte zu erklären sein, daß sie das schönste Versöhnungsmittel ist zwischen den verschiedensten Gesinnungen der Menschen. Das religiöse Gemüt und der atheistische Freigeist werden einander sympathisch begegnen, wenn jenes seinen Gott besingt,
#SE033-131
und dieser der Freiheit ein Lied erklingen läßt. Und die Lyrik ist auch das Feld, auf dem heute sich die Träger alter, reifer Kunstideale und die Geister einer werdenden, gährenden Weltanschauung am leichtesten verständigen.
Das deutsche Kunstempfinden im zweiten Drittel unseres Jahrhunderts stellt sich als Nachwirkung der klassischen und romantischen Geistesströmung dar. Das Verhältnis, in dem Goethe, Herder, Schiller und ihre Nachfolger zu Natur und Kunst gestanden, galt als etwas Vorbildliches. Man stellt hohe Anforderungen an sich; aber man fragt erst bei den Vorgängern an, ob diese Anforderungen auch die rechten seien. Diese Vorstellungsart wirkt bis in unsere Tage. Allmählich ging sie den schaffenden Geistern in Fleisch und Blut über. Sie standen in ihrem Bann, ohne daß sie sich dessen bewußt waren.
Ein solcher Geist ist Theodor Storm. Ein naives Anschauen der Natur, ein schlichter, gesunder Sinn sind bei ihm im Bunde mit einem hochentwickelten Gefühl für die künstlerische Form. Dieses Gefühl verdankt Storm dem Umstande, daß seine Jünglingszeit bald nach Goethes Todesjahr begann. Ihm hat die geistige Atmosphäre seines Zeitalters den Sinn für die vollendeten Kunstformen so anerzogen, als ob er ihm angeboren wäre. In diese Formen gießt Storm die stimmungsvollen lyrischen Anschauungen, die sein Natursinn und sein tiefes Empfinden ihm entgegentragen.
Andere Früchte, als bei dem norddeutschen Storm, hat der klassische Kunstsinn bei den zwei Schweizer Dichtern getragen, bei Conrad Ferdinand Meyer und Gott fried Keller. Naturen wie Meyer können nur in Zeiten gedeihen, denen Höhepunkte der Kultur vorangegangen sind. Sie
#SE033-132
haben als Erbschaft das Bedürfnis nach den höchsten Lebenszielen erhalten und zugleich einen künstlerischen Ernst, dem nicht leicht eine eigene Leistung genügt. Meyer möchte alles, was er erlebt, mit Würde erleben. Seine Ideale sind so ferne, daß er in fortwährender Angst schwebt, sie nie zu erreichen. Er möchte immerwährend in Festtagsempfindungen schwelgen, die sich andere nur zu bestimmten Zeiten erlauben. Das Erreichte bleibt bei ihm stets hinter dem Begehrten zurück, so daß ein unaufhörlicher Wechsel von Sehnen und Entsagen seine Seele durchzieht. In den Naturerscheinungen sieht er pathetische Symbole. An den naheliegenden Beziehungen zwischen den Dingen geht er vorüber; dafür sucht er nach seltenen, verborgenen Zusammenhängen zwischen den Wesen und Erscheinungen. Er wird überall die stärksten Gegensätze gewahr, weil sein ganzes Empfinden nach der großen Linie strebt.
Eine wesentlich andere Persönlichkeit ist Gottfried Keller. Bei ihm ist das Erreichbare der Maßstab, den er an alles anlegt. Seine ganze Lebensauffassung hat etwas Biederes, Ungekünsteltes. Der gesunde, schlichte Verstand und die freien, empfänglichen Sinne bestimmen allein sein Dasein. Er liebt sein Vaterland nicht aus einem ethischen Trieb heraus, sondern weil er sich in der Heimat am behaglichsten fühlt. Alles Gute dieser Heimat betont er kräftig, und das Unangenehme übersieht er wohlwollend. Er genießt die Dinge, wie sie sind, und macht sich nie Gedanken darüber, ob etwas auch anders sein könnte. Seine Schilderung der Natur gibt die Dinge wieder, wie sie sind; nach Symbolen und Gleichnissen, wie sie Conrad Ferdinand Meyer bildet, geht sein Sinn nicht. Vergeistigung der Gefühle und Empfindungen liegt nicht in seinem Wesen. Die Liebe hat bei
#SE033-133
ihm stets einen sinnlichen Zug. Die Sinnlichkeit ist aber eine keusche, derbgesunde. Er liebt nicht die Seele allein, er liebt auch den Mund; aber seine Liebe bleibt kindlich naiv.
Eine ähnliche Natur ist der süddeutsche Dichter Johann Georg Fischer. Bei ihm ist die Zufriedenheit mit dem Leben und seinen Genüssen in höchstem Grade vorhanden. Er liebt sein Dasein so stark und weiß sich so viel Seligkeit aus ihm zu ziehen, daß er auch ein Jenseits nur dann wünscht, wenn es so schön und gut ist wie das Diesseits. Er fühlt stets seine gesunde Kraft und ist nie im Zweifel, daß sie ihn sicher durch das Leben führen wird. Er weiß auch den Schatten des Lebens etwas Erfreuliches abzugewinnen. Seine Naturschilderung ist nicht so einfach wie die Kellers; sie hat etwas Sinnvollbildliches. Wenn er die weibliche Schönheit besingt, bewundern wir die Seelenreinheit, die in seinen Tönen liegt.
In schroffem Gegensatz zu diesen süddeutschen Dichternaturen steht die herbe Schönheit der Lyrik Theodor Fontanes. Meyer, Keller und Fischer halten nie zurück, was sie den Dingen gegenüber empfinden. Fontane stellt die Eindrücke, die seine Gefühle erregen, sinnvoll nebeneinander hin. Was in ihm dabei vorgeht, verschweigt er und läßt uns mit unserem Herzen allein. Er ist eine spröde Natur, die das eigene Ich gerne verbirgt. Bei seinen Schilderungen erbebt unsere Seele; er sagt uns nie, daß auch die seine erbebt. Die Bilder, die seine Phantasie schafft, haben etwas Monumentales. Der Ernst, die Hoheit des Lebens sprechen zu uns aus seinen Dichtungen. Bedeutsame Situationen, starke Gegensätze, stolze Menschencharaktere besingt er.
#SE033-134
Im echtesten Sinne nachklassisch ist die Lyrik Paul Heyses. Er hat alles von den Vorläufern: den reinsten Sinn für die Form, die veredelte Anschauung, den heiteren, auf die ewige Harmonie des Daseins gerichteten Künstlergeist. Er löst überall den Ernst des Lebens in die Heiterkeit der Kunst auf. Es ist seine Überzeugung, daß die Kunst den Menschen hinwegführen soll über die Lasten und das Drückende der Wirklichkeit. Ohne Zweifel ist eine solche Auffassung die eines echten Künstlers. Nur ist ein gewaltiger Unterschied, ob der Mensch sich durch die Mühsale des Lebens, durch die Dissonanzen des Daseins hindurchgerungen hat zur Anschauung der Harmonie, die der Welt zu Grunde liegt, oder ob er diese Anschauung einfach als Überlieferung hinnimmt. Im höchsten Sinne erhebend ist die Heiterkeit des Künstlers doch nur, wenn sie ihre Wurzeln im Lebensernste hat. Goethe sah in der Zeit seiner Vollendung die Welt mit der seligen Ruhe eines Weisen an, nachdem er sich diese Ruhe in heißen Kämpfen erworben hatte; Heyse sprang unvorbereitet in das Feld der ausgeglichenen Schönheit hinein. Er ist durch und durch eine Epigonennatur. Er hat einen sicheren Blick für die echten Schönheiten der Natur; aber sein Auge ist an Goethes Anschauungsart herangeschult worden. Heyse weiß die herrlichsten Wege zu gehen und dabei die wunderbarsten Beobachtungen zu machen; aber man hat immer das Gefühl, daß er von anderen gebahnte Wege geht, und daß er noch einmal entdeckt, was schon ein anderer gefunden hat.
Aus einer zarten Seele heraus, in der die feinsten Regungen der Natur und der Menschenseele in edler Weise nachzittern, sind die lyrischen Dichtungen Martin Greifs geboren.
#SE033-135
Er läßt sich nicht von dem Ganzen eines Eindruckes erregen, sondern nur von dem Seelenhaften desselben. Ein frommer, andächtiger Geist geht von Greifs Schöpfungen in uns über. Die stillen, bescheidenen Melodien, die in den Dingen wie verzaubert ruhen, erweckt Greif zum Leben. Wenn wir uns seinen Dichtungen hingeben, ist es, als wenn alle lauten, anspruchsvollen Töne der Welt schwiegen, und eine leise Sphärenmusik in unser Ohr dringe. Der frommen Ruhe der Seele, die Goethe so geliebt hat, ihr ist in Martin Greif ein Sänger erstanden.
Ein Dichter, dessen ganzes Schaffen wie ein einziger Schrei nach dieser seligen Ruhe ist, verbunden mit dem schmerzlichen Gefühl, daß ihm die Pforten dazu verschlossen sind, ist der Wiener Jakob Julius David. Düstere Bilder malt seine Phantasie, die eindringlich sprechen von den bitteren Leiden einer stolzen Seele. Das leidenschaftliche Verlangen, die glühende Sehnsucht wird jäh abgelöst von wehmütigem Entsagen. Als eine starke Natur kann David das Verlangen nicht verlernen. Ein Mißton geht durch alle seine Dichtungen, der jäh absticht von der Form-schönheit, die ihnen eigen. Er ist der Repräsentant derjenigen Dichter der Gegenwart, die wohl ihre Kunst an den großen Vorbildern herangebildet haben, die aber nicht zugleich imstande sind, sich zu der harmonischen Welt-auffassung dieser Vorbilder durchzuringen. David weiß, daß die Disharmonie nicht des Lebens tiefster Sinn ist, aber ihm offenbart sich die Harmonie nicht. Deshalb kann er nicht die Freude und die Lust, sondern höchstens das Vergessen und die Resignation besingen. Er vermag niemanden aus seinen Leiden aufzurichten, sondern nur ihn zu trösten und zur Ergebung zu mahnen.
#SE033-136
In stetig aufsteigender Entwickelung erblicken wir eineii anderen Wiener Dichter: Ferdinand von Saar. Er ist keine ausgeprägte Persönlichkeit, die aus innerer Kraft sich Richtung und Ziel selber weist. Er hat sich selbst verhältnismäßig erst spät gefunden. Durch Aneignung des Fremden, durch weise Seibsterziehung ist er bis dahin gelangt, wo das Genie einsetzt. In den «Nachklängen», die vor kurzem erschienen sind, tritt vornehme Künstierschaft und weise Weltbetrachtung in gleichem Maße zutage. Bilder von edel-schöner Form vermitteln eine tiefe Anschauung der Natur und der Menschen. Sie tragen aber nirgends das Gepräge von Eingebungen einer genialen Phantasie; sie sind allmählich herangereift in einem Leben, das unermüdlich der Vollendung zustrebte. Die hinreißende Begeisterung ist es nicht, zu der Saars Schöpfungen zwingen, sondern die ernste Verehrung. Saar ist einer von den Künstlern, die am stärksten auf uns wirken, wenn sie uns nicht das Individuelle ihres eigenen Herzens offenbaren, sondern wenn sie sich zum Sprecher dessen machen, was die ganze Menschheit bewegt.
Ähnliches dürfte von einem anderen Dichter der Gegenwart gelten, wenn dieser auch in vielen Beziehungen Saar so ferne wie möglich steht: von Emil Prinz von SchoenaichCarolath. Einen gewissen Grad von Ursprünglichkeit wird man Schoenaich-Carolath zugestehen müssen; es ist aber kein Zweifel darüber, daß er die künstlerische Höhe, zu der er gelangt ist, nur in einer Epoche erringen konnte, in der die ästhetische Bildung eine solche Stufe erreicht hatte wie in der seinigen. Geister wie er sind nur möglich innerhalb der Spätkultur eines Volkes, das kurz vorher Großes aus sich hat entwickeln lassen. Sie geben veredelt zurück,
#SE033-137
was sie empfangen haben. Schoenaich-Carolath hat Töne für alle Empfindungen des Menschen, für alle Vorgänge der Natur. Sein Anschauen dringt tief hinter die Erscheinungen. Er hat im Leben Kämpfe zu bestehen, aber man merkt, daß er während des Kampfes nie an dem endlichen Sieg zweifelt. Wenn man ihn eine Byronnatur genannt hat, hätte man nicht übersehen sollen, daß bei ihm der Byronschen Unrast eine glückliche Vertrauensseligkeit beigemischt ist.
Im echtesten Sinne des Wortes eine Nachblüte der klassischen deutschen Kunst ist Ernst von Wildenbruch. Wenn er zu uns spricht, so hören wir immer einen großen Vorgänger mitsprechen. Man darf wohl sagen, daß er das Dichten gelernt hat, freilich sehr gut gelernt hat. Er ist mehr ein Auserwählter als ein Berufener. Und das läßt sich heute von vielen sagen. Für diesmal sei es nur noch auf Alberta von Puttkammer angewendet. Sie vermag, vielleicht nur mit ein wenig zu viel Worten, Naturstimmungen hinzumalen mit unsäglichen Schönheiten. Das Leben erscheint ihr wie eine wonnige Elegie. Das Dasein hat auch für sie Dornen; aber sie läßt uns nie vergessen, daß die Dornen in Rosengärten sind.
#TI
II
#TX
Im Beginne der achtziger Jahre trat in Deutschland ein junges Dichtergeschlecht auf den Plan. Zu ihm zählten sich Geister, die in bezug auf Lebensanschauung und Begabung so verschieden als möglich waren. Sie fühlten sich aber einig in der Überzeugung, daß eine Revolution des künstlerischen Empfindens und Schaffens notwendig sei. In der Auflehnung gegen den herrschenden Geschmack der Zeit,
#SE033-138
in der Julius Wolff und Rudolf Baumbach als ernste Künstler betrachtet wurden, lag etwas Berechtigtes. Der Grundsatz: «Ernst ist das Leben, heiter die Kunst» war in flachen Köpfen zur Karikatur verzerrt worden. Virtuosenhafte poetische Tändelei unterschied man nicht mehr von der edelschönen Form, die aus den Tiefen der Seele geboren ist. Die Zeit rang nach einer neuen Weltanschauung, die mit den großen naturwissenschaftlichen Ergebnissen des neunzehnten Jahrhunderts rechnen wollte, und nach einer sozialen Gestaltung, die den im Kampf ums Glück Zurück-gebliebenen ihren gebührenden Platz anweisen sollte. Die tonangebenden Lyriker wußten nichts zu singen von solchen Umwälzungen. Diese Erkenntnis brachte in den Brüdern Heinrich und Julius Hart die Zornesworte hervor, mit denen sie iSSz dem Zeitgeschmack in ihren «Kritischen Waffengängen» den Krieg erklärten. Von der gleichen Gesinnung beseelt waren die Lyriker, die sich 1884 zu der Sammlung «Moderne Dichtercharaktere» vereinigten. Und diesem ersten Ansturm folgte die Gründung von Zeitschriften und die Herausgabe der Almanache, in denen der Abscheu vor veralteten Vorstellungen einen ebenso starken Ausdruck fand wie die kühnsten Hoffnungen für die Zukunft. Aus solchen Stimmungen heraus entwickelte sich die Anerkennung, die seit anderthalb Jahrzehnten in immer erhöhtem Maße einem Dichter entgegengebracht wird, der allerdings nicht, wie viele andere, absichtlich moderne Bahnen einschlägt, der aber auf naive Art mit einer lebensfrischen Phantasie den Kreis von Empfindungen umfaßt, von denen der Mensch der Gegenwart erregt wird: Detlev von Liliencron. Er ist ein daseinsfroher Mensch, der das Leben als sorglos Genießender durchwandelt und alle seine
#SE033-139
Reize mit eindringlicher Kraft zu schildern vermag. Ihm sind alle Töne eigen, von der übermütigsten Ausgelassenheit bis zu der inbrünstigsten Anbetung erhabener Natur-werke. Er vermag dem Leichtsinn und der Sorglosigkeit Jubelhymnen zu singen wie ein Weltkind, und er kann wie ein Priester fromm werden, wenn die Heide ihre stumme Schönheit vor ihm ausbreitet. Liliencron ist kein Dichter, der das Leben von einem Gesichtspunkt aus betrachtet. Eine einheitliche Weltanschauung, die in klare Ideen zu bringen wäre, wird man bei ihm vergebens suchen. Er geht in jedem Augenblicke ganz in den Eindrücken auf, denen er sich hingegeben hat. Was hinter den Dingen der Welt liegt, darüber macht er sich keine Sorgen und Gedanken. Dafür aber kostet er wie ein rechter Lebemann alles aus, was innerhalb der Dinge liegt. Und er findet immer den charakteristischen Ton und die vollkommenste Form, um die Fülle der Wahrnehmungen auszusprechen, die sich seinem nach der ganzen Breite der Wirklichkeit dürstenden Sinnen aufdrängen. Er hat nicht nötig, zwischen Wertvollem und Unbedeutendem in dieser Wirklichkeit zu unterscheiden, denn er verniag aus dem Anblick eines «alten, weggeworfenen, zerrissenen, halbverfaulten, verlassenen Stiefels» eine Empfindung zu schöpfen, deren Ausdruck sich würdig einer Stimmung einfügt, die der Dichter in uns erregt. Liliencron zeichnet Naturszenen und Erlebnisse mit derben, männlichen Linien; er setzt scharfe, vielsagende Farbenkontraste nebeneinander. In seiner Liederlyrik spricht sich das Kraftvolle seiner Persönlichkeit besonders deutlich aus. Nicht Innigkeit der Empfindung, nicht herber Schmerz sind imstande, sein sicheres Ichgefühl auch nur für einen Augenblick sich selbst zu entfremden.
#SE033-140
Unter Lilienorons Einfluß steht Otto Julius Bierbaum. Ihm fehlt aber das sichere Ichgefühl; er ist eine weiche, unselbständige Natur, die sich stets in den Eindrücken der Außenwelt verliert. Auch bei ihm ist nirgends etwas von einer Weltanschauung, von einer in die Tiefen der Wesen dringenden Auffassung zu merken. Während aber bei Lilienoron die scharf geprägte Persönlichkeitsphysiognomie für den gleichen Mangel entschädigt, entbehren durch ihn Bierbaums Schöpfungen des höheren Interesses. Seine liebenswürdige Beobachtungsgabe versteht wenig Bedeutungsvolles in den Dingen zu schauen. Sein Geist ist nicht mit dem geringsten Erkenntnisdrange beladen; was er mit leichtfertigem Blicke der Natur abguckt, das schildert er in anmutigen, aber bisweilen recht wenig charakteristischen Farben. Es gelingen ihm reizvolle Naturbilder; er vermag die kleinen Triebe des Herzens in einer prächtigen Weise darzustellen. Wo er Höheres anstrebt, wird er unnatürlich. Die großen Worte, die Krafttöne, zu denen er sich oft versteigt, klingen hohl, weil sie nichts Erschütterndes, Aufregendes mitzuteilen haben. Wie ein Spaziergänger, der gern einen Wanderer spielen möchte, erscheint Bierbaum. Wenn er so tut, als ob er kühn und übermütig durch das Leben pilgerte, so kann das nicht sonderlich interessieren, denn er geht den Abgründen und Gefahren recht weit aus dem Wege.
Fast entgegengesetzte Empfindungen erregt ein anderer von Liliencron abhängiger Dichter: Gustav Falke. Er sucht das Leben in seinen geheimnisvollen Tiefen auf, da, wo es Zweifel erregt und Rätsel aufgibt. Ein hochentwickeltes künstlerisches Gewissen zeichnet ihn aus. Die Vorgänge der Welt gestalten sich in seiner Phantasie zu schönheitsvollen Bildern. Er sucht in ernster Art nach dem Einklange zwischen
#SE033-141
Wünschen und Pflichten. Er strebt nach den Genüssen des Daseins; aber er möchte sie nur, wenn eigenes Verdienst sie ihm erringt. Der Sieg nach dem harten Kampfe ist nach seinem Sinne; den leichterrungenen kann er nicht sonderlich schätzen. Aus seinem ernsten Geiste heraus entspringt manche bange Frage an das Schicksal; ein fester Glaube, daß der Mensch zufrieden sein kann, wenn er sich den Bedingungen des Lebens anpaßt, führt ihn aus Zweifeln und Rätseln heraus. In Falkes Lyrik ist etwas Schwerflüssiges; das aber ist nur eine Folge seiner Auffassung, die nach den gewichtigen Eigenschaften der Dinge sucht.
Durch ernstes Kunststreben hat sich Otto Ernst von einem sentimentalen Pathetiker zu einem achtunggebietenden Dichter emporgearbeitet. Zwar entbehrt sein Ausdruck der Unmittelbarkeit und Selbständigkeit und seine Empfindung des Maßvollen; in seinen Sammlungen und unter seinen in Zeitschriften erschienenen Gedichten findet sich aber manches, das eine wahre Dichterpersönlichkeit zur Erscheinung kommen läßt. Besonders wo er in bescheidenem Kreise des häuslichen Glückes, der Alltagsvorgänge bleibt, gelingen Otto Ernst stimmungsvolle Schöpfungen von geschlossener Kunstform. In hohem Maße anziehend wird er, wenn er seinen Humor walten läßt, der nichts Weltbezwingendes, vielmehr etwas Philiströs-schalkhaftes hat, der aber für denjenigen den Nagel auf den Kopf trifft, der die in Betracht kommenden Dinge wichtig genug zu nehmen imstande ist. Man hat oft die Empfindung, daß Otto Ernst weit Vollendeteres leisten würde, wenn er sich naiv seinen ursprünglichen Gefühlen und Vorstellungen überlassen würde und diesen nicht fast immer Gewalt antäte durch die strenge Anschauung, die er von den Aufgaben der Kunst hat. Manch
#SE033-142
reizvolle Empfindung, manch sinniges Bild zerstört er durch einen angefügten erklügelten Vergleich, durch eine lehrhafte Wendung, durch eine philosophische Betrachtung, die viel sagen soll, aber meist doch nur trivial ist.
Dichter von weniger ausgeprägter Eigenart sind Arthur von Walipach, Wilhelm von Scholz und Hugo Salus. Wallpach erinnert durch seine Naturempfindung und durch sein Vertrauen in das Leben an Liliencron. Entzückende Stimmungsmalerei, zuweilen in flott aufgetragenen, zuweilen auch in intim abgestuften Tönen, sind ihm eigen. Wilhelm von Scholz ist einer der Dichter, bei denen jedes Gefühl, jede Vorstellung verzerrt wird, wenn sie von der Phantasie zum Bilde umgeschmolzen werden soll. Das Wort strebt stets über das hinaus, was die Empfindung umschließt. Wenn ihm ein schönes Bild vorschwebt, verdirbt er es sich, indem er den Inhalt doppelt betont. Seine Einbildungskraft begnügt sich nicht damit, zu sagen, was notwendig ist; sie überhäuft uns mit all den zufälligen Einfällen, die ihr neben dem Notwendigsten aufstoßen. Hugo Salus spricht zuweilen das Einfache auf zu seltsame Weise aus. Wer aus der Natur soviel Lust zu saugen weiß wie er, überrascht, wenn er diese Lust durch Vorstellungen veranschaulicht, die oft recht weit hergeholt sind. Salus richtet sein Auge gleichsam nicht unmittelbar auf die Dinge, sondern sucht ein verändertes Spiegelbild derselben auf.
Aus reinem Schönheitssinn und hochentwickeltem Geschmack sind die lyrischen Dichtungen Otto Erich Hart-lebens geboren. Seiner Ausdrucksweise ist eine seltene plastische Kraft eigen. Durchsichtige Klarheit und vollkommene Anschaulichkeit ist ein Grundzug seiner Phantasie. Das ist der Fall, trotzdem seine Einbildungskraft nur wenig
#SE033-143
von Bildern befruchtet wird, die der äußeren Natur entnommen sind. Sie gestaltet fast ausschließlich die inneren Erlebnisse der eigenen Persönlichkeit. Dieser Dichter, der als Novellist und Dramatiker so objektiv als möglich die Widersprüche der Wirklichkeit aufsucht und den in den Vorgängen des Lebens liegenden Humor mitleidlos enthüllt, führt in seiner Lyrik Zwiesprache mit seiner Seele, legt vor sich selbst intime Beichten ab. Man hat das Gefühl, daß es die wichtigsten, die bedeutungsvollsten Augenblicke seines Seelenlebens sind, in denen er sich als Lyriker ausspricht. Er ist dann ganz mit sich allein und mit wenigem, was ihm lieb in der Welt ist. An Wendepunkten seines Lebens, in Momenten, in denen Entscheidendes in seinem Herzen sich abspielte, sind seine schönsten Gedichte entstanden. Und aus ihnen spricht das Wohlgefühl ihres Schöpfers an der ruhigen, einfachen Schönheit, an Stil und künstlerischer Harmonie. Otto Erich Hartleben iSt mehr eine betrachtende als eine aktive Natur. Er hat nichts Stürmisches in seinem Wesen. Er ist weniger ein schaffender als ein gestaltender Geist. Den Inhalt läßt er am liebsten an sich herankommen, in der Formung hat er dann seine Freude; da entfaltet sich seine Produktivität. Lilienorons Schwung fehlt ihm, dafür aber besitzt er die stille Größe, von der Goethe in seinem «Winckelmann» behauptet, daß sie das Kennzeichen der wahren Schönheit ist. Inmitten des Sturmes und Dranges der Gegenwart darf man Otto Erich Hartleben, den Lyriker, als einen derjenigen bezeichnen, die sich klassischen Kunstidealen nähern. Seine ganze Persönlichkeit ist auf eine ästhetisch künstlerische Auffassung der Welt gestimmt. Die Lebensprobleme versteht er nur insofern, als der reife Geschmack darüber zu entscheiden berufen ist. Philosophie gibt
#SE033-144
es für ihn nur, insofern er ein persönlichstes Verhältnis zu ihren Fragen hat. Er kann weiche, innige Töne anschlagen, aber nur solche, die mit einer stolzen, in sich gefestigten Natur vereinbar sind. Alles Pathos ist ihm so fremd wie möglich.
Mit modernen Empfindungen weiß eine gewisse klassisch-akademische Form und Auffassung Ferdinand Avenarius in Einklang zu bringen. Seine Lyrik ist auf dem Untergrunde theoretischer Vorstellungen erwachsen. Seine Empfindungen treten nicht ganz unmittelbar zutage, sondern lassen überall die Vernunftideen durchscheinen. Er hat eine Dichtung «Lebe!» geschaffen, in der er nicht seine Gefühle mitteilt, sondern eine objektive Persönlichkeit die ihrigen. Diese Art objektiver Lyrik wird ein ganz ursprünglicher Geist niemals pflegen. Zu ihr ist notwendig, daß die künstlerische Überzeugung der künstlerischen Phantasie als Stütze dient.
#TI
III
#TX
Was wir bei manchem unserer bedeutendsten Lyriker der Gegenwart so schwer entbehren, den Ausblick auf eine große, freie Weltanschauung, das tritt uns im schönsten Sinne bei Ludwig Jacobowski entgegen. Er hat sich mit seiner jüngst erschienenen Sammlung «Leuchtende Tage» in die vorderste Reihe der zeitgenössischen Dichter gestellt. In diesem Buche liegt der ganze Umkreis des menschlichen Seelenlebens wie in einem Spiegel vor uns ausgebreitet. Die Erhabenheit und Vollkommenheit des Weltganzen, das Verhältnis der Seele zur Welt, die menschliche Natur in den verschiedensten Gestalten, die Leiden und Freuden der
#SE033-145
Liebe, die Schmerzen und Seligkeiten des Erkenntnistriebes, die rätselvollen Bahnen des Schicksals, die gesellschaftlichen Zustände und ihr Rückschlag auf das menschliche Gemüt: alle diese Glieder des großen Lebensorganismus finden in diesem Buche ihren dichterischen Ausdruck. Jedes einzelne Ding, dem dieser Dichter begegnet, erfaßt er mit empfänglichen Sinnen und mit fruchtbarer Phantasie; aber immer wieder findet er auch den Zugang zu dem Wesenhaften der Welt, das hinter dem Fluß der einzelnen Erscheinungen steht. Wie ein Symbol seiner ganzen Geistesart erscheint uns der Titel seines Buches «Leuchtende Tage». Wie «ewige Sterne» trösten ihn die «leuchtenden Tage» des Lebens für alle Leiden und Entbehrungen, mit denen der Weg zu unserem Lebensziel bewachsen ist. Aus harten Kämpfen heraus hat sich Jacobowski diese sonnige Weltanschauung gebildet. Sie gibt seinen Schöpfungen einen befreienden Grundton. Zu den höchsten Lebensinteressen drängt sein Gefühl mit einer Wärme und Innigkeit, die im schönsten Sinne persönlich, unmittelbar wirken. Wie den Philosophen seine Vernunft von dem einzelnen Erlebnis ablenkt und zu jenen hellen Regionen weist, wo das Vergängliche des Alltags nur ein Gleichnis ist für die ewigen Mächte der Natur, so drängt diesen Dichter seine unmittelbare Empfindung ebendahin. Er ist ein Weltempfinder, wie der Philosoph ein Weltdenker ist. Er sieht mit kindlich4ebhaften Sinnen die Dinge in ihren vollen, frischen Farbentönen; und er gestaltet sie im Sinne der Harmonie, ohne deren Anschauung der tiefer veranlagte Mensch nicht leben kann. Wer solche Dichterkraft besitzt, bei dem wirkt höchste Weisheit wie holdeste Naivität. Die drei monumentalsten Formen des Seelenlebens zeigen sich bei Jacobowski in ihrer innersten Verwandtschaft:
#SE033-146
die kindliche, die künstlerische und die philosophische. Weil er diese drei Formen in sich in ursprünglicher Weise vereinigt, gelingt es ihm, überall aus dem Leben die poetischen Funken zu schlagen. Er braucht nicht wie so viele der zeitgenössischen Lyriker nach Muscheln zu suchen, um ihnen kostbare Perlen zu entnehmen; ihm genügt das Saatkorn, nach dem er die Hand ausstreckt. Alles Erkünstelte, Ausgetiftelte liegt Jacobowski fern. Die nächsten, einfachsten, die klarsten Mittel sind es, deren er sich bedient. Wie das Volkslied stets den schlichtesten Ausdruck für den tiefsten Empfindungsgehalt findet, so auch dieser Dichter. Er hat das Gefühl für die großen, einfachen Linien des Weltzusammenhangs. Er wird verstanden von dem naiven Sinne, und er wirkt ebenso auf den Philosophen, der mit den ewigen Rätseln des Daseins ringt. Ob er uns von den Erlebnissen der eigenen Seele spricht, oder das Schicksal eines Menschen schildert, der vom Lande in die Großstadt verpflanzt wird, um da von dem Leben zermalmt zu werden: es wird uns in dem gleichen Maße ergreifen. In Jacobowskis Natur liegt das Zarte neben dem Kernhaften. Er hat ein festes Vertrauen in seine Seelenrichtung. Alle Schlagworte der Zeit, alle Lieblingsvorstellungen einzelner Strömungen der Gegenwart verschmäht er. Was aus der Kraft seiner Persönlichkeit fließt, ist für ihn allein bestimmend. Wir treffen bei ihm nichts von den abstrusen Seltsamkeiten derjenigen, die sich heute von dem gesunden Weltgetriebe abwenden und in einsamen Winkeln des Daseins nach allerlei ästhetischen und philosophisch mystischen Schrullen suchen; er kann den Lärm des Tages hören, weil er die Sicherheit in sich fühlt, sich zurechtzufinden.
Ein Lyriker, dessen höchste Kraft in der Gestaltung, in
#SE033-147
der plastischen Rundung des Bildes liegt, ist Carl Busse. Innerhalb des Rahmens dieses Bildes liegt selten etwas inhaltlich Bedeutendes, aber meist eine vielsagende Stimmung. Dabei zeichnet diesen Dichter ein feines Stilgefühl für das Äußere der Form aus. Er weiß in den Wendungen der Sprache, in der Harmonie des Ausdrucks die Grundempfindung eines Gedichtes sich ausleben zu lassen. Nicht um die Vertiefung eines Gefühles ist es ihm zu tun, sondern um seine anschauliche, farbenreiche Prägung. Wenn uns Busse eine Stimmung malt, so werden wir keinen Farbenton vermissen, der sie zu einem runden Ganzen macht, und wir werden auch nicht leicht durch einen fremden Ton gestört werden. Das Übersprudelnde der Empfindung, das Drängen der Leidenschaft erscheint bei ihm nie unmittelbar, sondern stets gedämpft durch das künstlerisch Maßvolle. Wenn er von der Natur spricht, so hält er sich in der Mitte zwischen dem Naiven und dem Pathetischen; wenn er uns die eigenen Affekte mitteilt, so drängen sie nicht im Sturm auf uns ein, sondern in abgemessenen Schritten. Busses Gleichnisse und Symbole sind nicht sinnig, aber prägnant; seine Vorstellungen bewegen sich frei und flott von Ding zu Ding; aber der Dichter weiß den Umkreis immer fest zu umgrenzen, innerhalb dessen sie sich ergehen dürfen. So wird Busses Poesie namentlich diejenigen befriedigen, welche in der Poesie die äußere Form über alles schätzen; die tieferen Naturen, die das Große, das Bedeutungsvolle des Inhalts suchen, werden von seinen Schöpfungen keine starken Eindrücke empfangen.
In einer höchst liebenswürdigen Art findet Martin Boelitz den Ausdruck für die intimsten Naturstimmungen. Die vorübergehenden Erscheinungen, die ein sorgsames Auge fordern,
#SE033-148
wenn ihre flüchtige, zarte Schönheit erlauscht werden soll, sind sein Gebiet. Naturbilder werden bei ihm nicht zu plastischen, aber zu sinnvollen Gleichnissen. Und abstrakte Vorstellungen kleidet er in ein sinnliches Gewand, daß wir sie wohl nicht zu greifen, aber zu fühlen glauben. So läßt er «alle Wünsche stille steh'n» und «den Tag träumen»; so personifiziert er die «Sehnsucht» und die «Einsamkeit». Er besingt weniger die Seele, die in den Dingen liegt, als diejenige, die wie ein zarter Duft zwischen den Dingen und über ihnen sich ätherartig ausbreitet. Wenn er von sich spricht, so tut er es im Tone einer geistvollen, ernsten Munterkeit. Seine Lebensanschauung ist eine heitere; aber sie entspringt nicht einem tieferen Denken, sondern einer naiven Sorglosigkeit. Er überwindet die Schwierigkeiten des Lebens nicht; er nimmt seine Wege dort, wo keine sind. Nicht die Kraft ist es, in deren Besitz er sich glücklich fühlt, sondern im Träumen von solcher Kraft.
Aus zwei Quellen schöpft Paul Remer: aus einem feinsinnigen Denken und einer symbolisch wirkenden Phantasie. Eine Sentenz, ein Gedanke liegt immer bei ihm zugrunde; aber er weiß diese in einen symbolischen Vorgang so hineinzuweben, daß wir das Hineingeheimnissen vergessen und uns in den Glauben versetzen: er habe das Symbolische aus dem Vorgange herausgeholt. Ob er uns auf diese Weise die Erlebnisse der Menschenseele symbolisch darstellt, ob er von Naturerscheinungen wie von menschlichen Handlungen spricht: er ist gleich anziehend. Wie er in einem Gedichte von einer Blinden sagt: sie lausche «den heimlichen Vertraulichkeiten der Dinge», so macht er es selbst. Nicht, was für Wirkungen die Dinge aufeinander ausüben, erzählt er, sondern was sich ihre Seelen zu sagen haben. Nicht die
#SE033-149
bunten Farben, nicht den lauten Ton der Natur schildert Remer, sondern was die Farben, die Töne für eine tiefere Bedeutung haben.
Scharfe, charakteristische Linien weist die Lyrik Kurt Geuckes auf. Nicht eine ureigene, individuelle Empfindungswelt hat er uns zu bieten. Tausende fühlten und fühlen wie er. Ein Idealismus, der allgemein-menschlich ist, beseelt ihn. Aber er besitzt eine seltene poetische Kraft, diesen Idealismus zum Ausdruck zu bringen. In streng geschlossenen, künstlerischen Formen entlädt sich keine originelle, aber eine gefestigte Weltanschauung. Die Nachtseiten des Lebens zeichnet des Dichters feurige Phantasie in tiefen, ergreifenden Bildern. Immer aber breitet sich über den Leiden und Schmerzen die Hoffnung aus, die in einer Gestalt erscheint, wie sie nur aus der Überzeugung eines echten Idealisten hervorgehen kann. Auch er greift zum Symbol, wenn er das Bedeutungsvolle in der Natur darstellen will, und die Symbole haben stets etwas Männlich-Treffsicheres. Aber auch die mystische Stimmung ist ihm nicht fremd, und er findet stets ein gesundes Pathos, um sie zum Ausdruck zu bringen. Sein Sinn ist dem Schönen und Großen in der Welt zugewendet, um deren willen er gerne das Kleine, Häßliche und Niederdrückende erträgt.
Ein edler Natursinn und eine freiheitbedürftige Seele spricht aus den Dichtungen Fritz Lienhards. Aber diese beiden Züge seiner Persönlichkeit wirken durch die Einseitigkeit, mit der sie auftreten, wenig erfreulich. Der Dichter wiederholt in ziemlich eintöniger Weise die gesunde Natur einfacher, ländlicher Verhältnisse und die Verkommenheit der Großstadt. Der herrliche Wasgauwald und der «Venus-berg» Berlin: in diese zwei Vorstellungen ist sein Lieben
#SE033-150
und sein Hassen eingeschlossen. Seinem Enthusiasmus für das frischgebliebene Land entspricht auch eine naive, mit den einfachsten Mitteln arbeitende Technik.
*
Wer die Triebkräfte der Kulturentwickelung in den letzten Jahrzehnten berechnen will, wird ohne Zweifel den Anteil der Frauen am öffentlichen Leben mit einer hohen Zahl ansetzen müssen. Vielleicht spricht sich aber dieser Anteil auf keinem Gebiete so deutlich aus wie auf dem der Dichtung. Denn während die Frau auf anderen Gebieten als Kämpfende, Ringende auftritt, ist sie hier eine Gebende, eine Mitteilende. Sonst sagt sie uns, was sie sein möchte; hier spricht sie aus, was sie ist. Große Einblicke in die Frauen-seele sind uns dadurch geworden. Indem die Frau sich ge-drängt fühlte, ihr Innenleben künstlerisch zu gestalten, ist ihr dasselbe selbst erst klar vor das Bewußtsein getreten. Wie Einblicke in eine neue Welt erscheinen den Männern Bücher wie Gabriele Reuters «Aus guter Familie», Helene Böhlaus «Halbtier» oder Rosa Mayreders «Idole».
Es ist begreiflich, daß die intimste Kunst, die Lyrik, uns auch die tiefsten Geheimnisse des Frauenherzens enthüllt. Die hervorstechendste Eigenschaft der modernen Frauen-lyrik ist die Offenherzigkeit in bezug auf die Natur des Weibes. Die Gegenwart, die rückhaltlose Wahrheit zu einer Forderung der echten Kunst gemacht hat, sie hat auch der Frau den Mund geöffnet. Was sie früher sorgsam verwahrt hat als Heiligtum des Herzens, das vertraut sie heute der Kunst an. Sie hat den Glauben, das Vertrauen in die eigene Wesenheit gewonnen, und während die bedeutenden Frauen früherer Zeiten unbewußt den Idealen und Zielen der Männer
#SE033-151
nachstrebten, wenn sie sich eine Lebensansicht bilden wollten, bauen die heutigen eine solche aus eigener Kraft auf.
Wie klar und innerlich gefestigt eine solche Lebensansicht sein kann, das zeigen uns die dichterischen Schöpfungen Ricarda Huchs. Sie hat sich einen hohen, freien Gesichtspunkt erobert, von dem aus sie die Erscheinungen der Welt überblickt. Zwar vermag sie von ihrer Höhe herab diese Welt nicht im Sonnenglanze zu erblicken, sondern nur resigniert sich über die Nichtigkeit des Daseins hinwegzusetzen, aber sie findet doch in dieser Resignation jene innere Freiheit, die der selbständig veranlagte Mensch braucht, um sich im Leben zurechtzufinden. Findet sie auch das Lebensschiff dem Tode, der Vernichtung zueilend, so zieht sie doch Befriedigung aus dem Bewußtsein, daß es ihr gegönnt ist, das Ziel fest ins Auge zu fassen. Es ist nicht zu verwundern, daß die weibliche Faustnatur nicht gleich im ersten Ansturm sich Befriedigung ihres Strebens zu schaffen weiß, da doch die männliche trotz Jahrtausende alten Ringens über die Zweifelsucht kaum hinausgekommen ist. Wie sollte ein weiblicher Nietzsche heute aus sich heraus das lebenbejahende «Uberweib» zum Ideal erheben, da wir doch in diesem Jahrhundert noch die Nirwanabegeisterung Schopenhauers erlebt haben und die Anschauung Novalis', der in dem Tod den wahren, höheren Zweck des Lebens sieht.
Nicht aus den großen Fragen des Daseins, nicht aus tiefen Zweifeln und Qualen, dafür aber auch aus einem echt weiblichen Gefühl heraus, sind die lyrischen Schöpfungen Anna Ritters erwachsen. Etwas Anmutig-Musikalisches ist über ihre Dichtung ausgegossen. Sie ringt nirgends mit der Form, aber sie erreicht zuweilen in dieser Richtung eine Vollendung,
#SE033-152
über die jedes kritische Bedenken verstummen muß. Ihre Begabung für Rhythmus und Sprachwohilaut erscheint in so hohem Maße natürlich, daß sich daneben die Ursprünglichkeit mancher gepriesener Naturdichter und -dichterinnen wie Gespreiztheit ausnimmt. Die Liebe erscheint in dem Lichte, das ihr nur das wahrhaftige, offenherzige Weib verleihen kann. Zart und keusch spricht aus Anna Ritters Gesängen die Sinnlichkeit; warm und innig drückt sich das weibliche Verlangen aus. Die Poesie der Mutter erscheint in anmutigem Zauber; das Leben der Natur tritt nicht kraftvoll, aber um so lieblicher aus dieser Dichterseele zutage. Ihre echt weibliche Gemütsart kommt in den «Sturmliedern» zum Vorschein. Es rast in ihnen nicht der große, männliche Sturm; aber dafür das Geheimnisvolle der Frauenseele. Es sind Stürme, die nicht durch das Ewig-Bedeutende, sondern durch einen glücklichen, temperamentvollen Optimismus des Lebens überwunden werden.
Mit klarem Bewußtsein über die Natur der Frau und ihr Verhältnis zum Manne ist Marie Stona begabt. Der Gegensatz der Geschlechter und die Wirkung dieses Gegensatzes auf das Wesen des Liebesgefühles: das sind die Vorstellungen, die ihre Seele durchzittern. Gibt der Mann dem Weibe ebensoviel, wie ihm dieses entgegenbringt, das ist für sie eine bange Frage. Und muß das Weib dem Manne nicht mehr geben, als er erwidern kann, wenn sie seine Kraft erhöhen und nicht zerstören soll? Wie kann das Weib seinen Stolz, seine Selbstbewußtheit bewahren und doch das Selbst auf dem Altar der Liebe hingebungsvoll opfern? Es sind ewige Kulturfragen des Weibes, denen diese Dichterin nachgeht, und die sie aus einem ebenso reichen wie tiefen Gemüte heraus zu gestalten sucht.
#SE033-153
Die Stimmungen, denen das Weib der Gegenwart verfällt, das wegen eines hochentwickelten Freiheits- und Persönlichkeitsgefühls die soziale Stellung unbehaglich findet, die ihm durch die hergebrachten Anschauungen geboten werden kann, bringen die Dichtungen Thekla Lin gens zum Ausdruck. In ihnen ist nichts von den Gedanken und Tendenzen zu finden, welche in der modernen Frauenfrage zum Vorschein kommen. Thekla Lingen bringt nur zum Ausdruck, was sie individuell denkt und fühlt. Aber gerade dieses Individuelle erscheint wie der elementare Inhalt des Kulturkampfes der Frau, der in den Emanzipationsbestrebungen nur verstandesmäßig gefärbt zutage tritt.
#TI
IV
#TX
Die moderne Geisteskultur macht es dem Menschen mit tiefem Gemüte nicht leicht, sich im Leben zurechtzufinden. Die durch Charles Darwin reformierte Naturwissenschaft hat uns eine neue Weltanschauung gebracht. Sie hat uns gezeigt, daß die Lebewesen in der Natur, von den einfachsten Formen bis zu den vollkommensten Formen herauf, sich nach ewigen, ehernen Gesetzen entwickelt haben, und daß der Mensch keinen höheren, reineren Ursprung habe als seine tierischen Mitgeschöpfe. Unser Verstand kann sich fernerhin dieser Überzeugung nicht verschließen. Aber unser Herz, unser Gefühlsleben kann dem Verstande nicht schnell genug folgen. Wir haben die Empfindung noch in uns, die eine Jahrtausende alte Erziehung dem Menschengeschlecht eingepflanzt hat: daß dieses natürliche Reich, diese irdische Welt, die nach der neuen Anschauung aus ihrem Mutter-schoße wie alle übrigen Geschöpfe so auch den Menschen
#SE033-154
hat hervorgehen lassen, gegenüber dem, was wir «ideal», «göttlich» nennen,ein niedriges Dasein habe. Wir möchten uns gerne als Kinder einer höheren Weltordnung fühlen. Es ist eine brennende Frage unserer seelischen Entwickelung, mit unserem Herzen der von der Vernunft erkannten Wahrheit zu folgen. Wir können nur dann wieder zum Frieden kommen, wenn wir das Natürliche nicht mehr verächtlich finden, sondern es verehren können als den Quell alles Seins und Werdens. Wenige unter unseren Zeitgenossen empfinden das so tief, wie es Friedrich Nietzsche gefühlt hat. Die Auseinandersetzung mit der modernen und naturwissenschaft-lichen Weltanschauung wurde für ihn zu einer sein ganzes Gemütsleben erschütternden Herzenssache. Vom Studium der alten Griechen und von Richard Wagners philosophischer Gedankenwelt ging er aus. Und in Schopenhauer fand er einen «Erzieher». Das Leiden auf dem Grunde jeder Menschenseele fühlte dieser feingeistige Mensch in besonderem Maße. Und die alten Griechen bis zu Sokrates mit ihren noch nicht von der Verstandeskultur verblaßten Trieben und Instinkten glaubte er mit diesem Leiden besonders behaftet. Die Kunst hatte ihnen, nach seiner Ansicht, nur dazu gedient, eine Illusion des Lebens zu schaffen, innerhalb welcher sie den Schmerz, der in ihnen wühlte, vergessen konnten. Wagners Kunst mit ihrem hohen, idealistischen Schwung schien ihm das Mittel zu sein, um uns Moderne in ähnlicher Weise über das tiefste Lebensleid hinwegzuführen. Denn tragisch ist die Grundstimmung jedes wahren Menschen. Und nur die künstlerische Phantasie kann die Welt erträglich machen. Den tragischen Menschen hatte Nietzsche in Schopenhauers Philosophie geschildert gefunden. Sie entsprach dem, was er durch seine Studien über die Weltanschauung
#SE033-155
im «tragischen Zeitalter der Griechen» gewonnen hatte. Mit solchen Gesinnungen trat er der modernen Naturwissenschaft gegenüber. Und sie stellte an ihn eine große Forderung. Sie lehrt, daß die Natur die Stufenfolge der Lebewesen durch Entwickelung hat entstehen lassen. An den Gipfel der Entwickelung hat sie den Menschen gestellt. Soll nun beim Menschen diese Entwickelung abbrechen? Nein, der Mensch muß sich weiterentwickeln. Er ist ohne sein Zutun vom Tiere zum Menschen geworden; er muß durch sein Zutun zum Übermenschen werden. Dazu gehört Kraft, frische ungebrochene Macht der Instinkte und Triebe. Und nun wurde Nietzsche ein Verehrer alles Starken, alles Mächtigen, das den Menschen über sich selbst hinausführt zum Übermenschen. Er konnte jetzt nicht mehr nach der künstlerischen Illusion greifen, um sich über das Leben zu täuschen; er wollte dem Leben selbst so viel Gesundheit, so viel Festigkeit einpflanzen, wie nötig ist, um ein übermenschliches Ziel zu erreichen. Aller Idealismus, so meinte er jetzt, sauge diese Kraft aus dem Menschen, denn er führe ihn hinweg von der Natur und spiegele ihm eine unwirkliche Welt vor. Allem Idealismus macht nun Nietzsche den Krieg. Die gesunde Natur betet er an. Er hatte die naturwissenschaftliche Überzeugung in sein Gemüt aufzunehmen gesucht. Aber er nahm sie in einen schwachen, kranken Organismus auf. Seine eigene Persönlichkeit war kein Träger, keine Pflanzstätte für den Übermenschen. Und so konnte er zwar diesen der Menschheit als Ideal vorsetzen, er konnte in begeisterten Tönen von ihm reden, aber er fühlte den grellen Kontrast, wenn er sich selbst mit diesem Ideal verglich. Der Traum vom Übermenschen ist seine Philosophie; sein wirkliches Seelenleben mit der tiefen Mißstimmung über die
#SE033-156
Unangemessenheit des eigenen Daseins gegenüber allem Übermenschentum erzeugte die Stimmungen, aus denen seine lyrischen Schöpfungen entsprungen sind. Bei Nietzsche ist nicht nur ein Zwiespalt zwischen Verstand und Gemüt vorhanden; nein, mitten durch das Gemütsieben selbst geht der Riß. Alles Große kommt aus der Stärke: das war sein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, das nicht nur seine Vernunft anerkannte, sondern an dem er hing mit seinem ganzen Empfinden. Und wie das Gegenteil von ihm selbst erschien ihm der starke Mensch. Der unsägliche Schmerz, der ihn über-kam, wenn er sich im Verhältnis zu seiner Ideenwelt betrachtete, ihn sprach er in seinen Gedichten aus. Eine in sich gespaltene Seele lebt sich in ihnen aus. Man muß das tief Tragische in Nietzsches Seelenschicksal nachfühlen, wenn man seine Dichtungen auf sich wirken lassen will. Man begreift dann das Düstere in denselben, das nicht aus der Lebensfreude stammen kann, für die er als Philosoph solch schöne Worte gefunden hat. Weil Nietzsche die moderne Weltauffassung der Naturwissenschaft zu seiner persönlichen Sache gemacht hat, darum hat er auch persönlich unter ihrem Einflusse namenloses Leid erfahren. Er, der Denker der Lebensbejahung, der jauchzend verkündet, daß wir unser Leben nicht nur einmal leben, daß alle Dinge eine «ewige Wiederkunft» erleben: er wurde der Lyriker des absterbenden Lebens. Er sah für sein eigenes Dasein die Sonne sinken, er sah den schwächlichen Organismus einem furchtbaren Ende zueilen, und er mußte aus diesem Organismus heraus die Lebensfreude predigen. Leben bedeutete für ihn: Leiden ertragen. Und wenn das Dasein unzählige Male wieder-kehrt: ihm kann es doch nichts bringen als nimmer endende Wiederholung der gleichen Qualen.
#SE033-157
Verheißungsvoll hat die Dichterlaufbahn Hermann Conradis begonnen. Eine Jünglingspoesie ist alles, was er in der kurzen Spanne Zeit geschaffen hat, die ihm zu leben gegönnt war. Sie sieht aus wie die Morgenröte vor einem Tage, der an stürmischen, aufregenden Ereignissen ebenso reich ist, wie an erhabenen und schönen. Zweierlei lastet auf dem Grunde seiner nach allen Genüssen und Erkenntnissen dürstenden Seele. Das ist die Einsicht in das schmerzliche Los der ganzen Menschheit, deren Blicke hinausschweifen bis zu den fernsten Sternen und welche die ganze Welt mit ihrem Leben umfassen möchte, und die doch verurteilt ist, ihr Dasein gebannt zu sehen an einen kleinen Stern, an ein Staubkorn im All. Das andere ist das Gefühl, daß sein eigenes Selbst zu schwach ist, um das Wenige zu seinem eigenen Besitz zu machen, was dem Menschen in seinem begrenzten Dasein zugeteilt ist. Weit muß der Mensch zurückbleiben hinter dem, was sein Geistesauge als fernes Ziel erschaut; aber ich kann selbst die nahen Ziele der Menschheit nicht einmal erreichen: diese Vorstellung spricht aus seinen Dichtungen. Sie regt in seinem Gemüte Empfindungen auf, die dem ewigen Sehnen der ganzen Menschheit entsprechen, und auch solche, die seinem persönlichen Schicksal tiefergreifen-den Ausdruck geben. Mit dämonischer Gewalt stürmen diese Empfindungen durch seine Seele. Der Drang nach den Höhen des Daseins erzeugt in Conradi ein maßloses Verlangen; aber diese Maßlosigkeit tritt nie ohne ernste Sehnsucht nach Harmonie des Denkens und Wollens auf. Die Gedankenwelt des Dichters strebt nach den Regionen des «großen Weltbegreifens». Aber immer wieder fuhlt er sich in das banale, wertlose Leben zurückversetzt und muß sich der dumpfen Resignation hingeben. Magere Zukunftssymbole
#SE033-158
malen sich in der Seele dann, wenn diese von glühendem Triebe nach Befriedigung in der Gegenwart erfaßt wird. Solcher Wechsel der Stimmungen ist nur in einem Geiste möglich, in dem das Hohe der Menschennatur wohnt, und der sich doch auch mutig eingesteht, daß er nicht frei iSt von dem Niedrigen dieser Natur. Eine grenzenlose Aufrichtigkeit gegenüber den Instinkten in seiner Persönlichkeit, die ihn herabzogen von dem Edlen und Schönen, war Conradi eigen. Er wollte das eigene Selbst mit allen seinen Sünden heraufholen aus den Abgründen seines Innern. Ihm ist jene Größe eigen, die in dem Bekenntnis der eigenen Irrwege des Empfindens und Fühlens liegt. Weder die Erinnerung an die Vergangenheit noch die Hoffnung in die Zukunft kann ihn befriedigen. Jene ruft ihm das quälende Gefühl verlorener Unschuld und Lebenslust hervor, diese wird ihm zu einem traumhaften Nebelbilde, das sich in nichts auflöst, wenn er es greifen will. Und von allen diesen Empfindungen in seiner Seele weiß Conradi in kühnen und zugleich schönen Formen der Dichtung zu sprechen. Er hat den Ausdruck in außerordentlichem Maße in seiner Gewalt. Die Kraft des Gefühles vereinigt sich bei ihm mit echter Künstlerschaft. Eine umfassende Phantasie ist ihm eigen, die überailher die Vorstellungen zu holen weiß, um ein inneres Leben darzustellen, das alle Räume der Welt durchmessen möchte.
In einer ähnlichen Geistesrichtung hat Richard Dehmeis Dichtung ihren Ursprung. Auch er möchte die ganze weite Welt mit seiner Empfindung umspannen. Er will in die Geheimnisse dringen, die in den Tiefen der Wesen wie verzauberte Wesen ruhen, und zugleich verlangt er nach den Genüssen, die uns von den Dingen des Alltags beschert werden. Er ist eigentlich eine philosophisch angelegte Natur, ein
#SE033-159
Denker, der es sich versagt, die Pfade der Vernunft, der ideellen Welt zu gehen, weil er auf dem Felde der Dichtung, des sinnenfälligen, bildlichen Vorstellungslebens bessere Früchte zu pflücken hofft. Und die Früchte, die er da findet, sind wirklich oft auserlesene, trotzdem man ihnen anmerkt, daß sie jemand gesammelt, dem andere, die seiner Natur besser entsprechen, noch leichter zugefallen wären. Er könnte den Gedanken in reinster, durchsichtigster Form haben, aber er will ihn nicht. Er strebt nach der Anschauung, nach dem Bilde. Deshalb erscheint seine Poesie wie eine symbolische Philosophie. Nicht die Bilder offenbaren ihm das Wesen, die Harmonie der Dinge, sondern sein Denken verrät sie ihm. Und dann schießen die Anschauungen um den Gedanken herum an, wie die Stoffe bei der Bildung eines Kristalls in einer Flüssigkeit. Wir können aber selten bei diesen Bildern, bei diesen Anschauungen stehenbleiben, denn sie sind nicht ihrer selbst wegen, sondern des Gedankens wegen da. Sie haben als Bilder etwas Unplastisches. Wir sind froh, wenn wir durch das Bild auf den Gedanken hindurchsehen. Am hervorragendsten erscheint Dehmel, wenn er in der bedeutungsvollen Ausdrucksweise, die ihm eigen ist, seine Vorstellungen unmittelbar ausspricht und nicht erst nach Anschauungen ringt. Wo er Ideen in ihrer reinen, gedankenmäßigen Form hinstellt, da wirken sie groß und schwerwiegend. Auch gelingt es ihm zuweilen, seine Ideen in herrlichen Symbolen zum Ausdruck zu bringen, aber nur dann, wenn er in einfachster Form einige charakteristische Sinnesvorstellungen zusammenstellt. Sobald er nach einer reicheren Fülle solcher Vorstellungen greift, springt das Seltsame seiner Phantasie, das Unbildliche seiner Intuition in die Augen. Was uns aber auch dann mit ihm versöhnt,
#SE033-160
das ist der große Ernst seines Wollens, die Tiefe seiner Empfindungswelt und die stolze Höhe seiner Gesichtspunkte. Seine Wege führen immer zu interessanten, fesseln-den Zielen. Man folgt ihm selbst dann gern, wenn man schon im Beginne der Wanderung die Überzeugung gewinnt, daß es sich um einen Irrweg handelt. Der Mensch Dehmel zeigt sich stets größer als der Dichter. Die große Geste mag bei ihm oft stören, ja sie kann zuweilen wie Pose erscheinen, aber nie kann ein Zweifel darüber aufkommen, daß hinter dem lauten Tone ein kräftiges Gefühl vorhanden ist.
Eine kernige Natur ist Michael Georg Conrad. Das Gesund-Volkstümliche lebt in seinem Schaffen. Kraft mit Naivität gepaart findet sich bei ihm. Das einfache Lied gelingt ihm in vollendeter Weise. Er kann eindringlich zu den Herzen sprechen. Eine edle Begeisterung für wahrhaft Erhabenes und Schönes klingt aus seinen Schöpfungen. Seine eigentliche Bedeutung liegt allerdings auf dem Gebiete des Romans und in den mächtigen Impulsen, die er dem deutschen Geistesleben zu geben wußte, als es in traditionellen Formen zu versumpfen drohte. Der künftige Geschichtsschreiber unserer Literatur, der nicht nur die Erscheinungen nach ihrer vollendeten Äußerung ansehen, sondern der den wirkenden Ursachen nachspüren wird, muß Conrad einen breiten Raum zukommen lassen.
Ein Dichter, dessen Empfindungen wie ein unsicherer Faktor in der Welt umherschwirrt, ist Ludwig Scharf. Er weiß warme, ergreifende Töne anzuschlagen; man muß die Triebe seiner irrenden Seele achten; man kommt ihm gegenüber aber von dem Gefühle nicht los, daß er sich selbst in den Irrgängen wohl befindet, daß er gerne im Labyrinthe umherwandelt und gar nicht den rettenden Faden zum Ausgange
#SE033-161
wünscht. Ein Sonderling des Empfindungslebens ist Scharf. Er fühlt sich als Einsamen; aber seinen Schöpfungen fehlt, was die Einsamkeit rechtfertigen könnte: die Größe einer in sich selbst gegründeten Persönlichkeit.
Zu den hohen Gesichtspunkten, von denen alle kleinen Eigenheiten der Dinge verschwinden und nur noch die bedeutungsvollen Merkmale sichtbar sind, strebt Christian Morgenstern. Vielsagende Bilder, inhaltvollen Ausdruck, gesättigte Töne sucht seine Phantasie. Wo die Welt von ihrer Würde spricht, wo der Mensch sein Selbst durch erhebende Empfindungen erhöht fühlt: da weilt diese Phantasie gerne. Morgenstern sucht nach der scharfen, eindrucksvollen Charakteristik des Gefühles. Das Einfache findet man selten bei ihm; er braucht klingende Worte, um zu sagen, was er will.
Wenig ausgeprägt sind die dichterischen Physiognomien Franz Evers', Hans Benzmanns und Max Bruns'. Franz Evers entbehrt noch des eigenen Inhalts und auch der eigenen Form. Aus vielen seiner Schöpfungen geht hervor, daß er nach den Tiefen des Daseins und nach einer stolzen, selbstbewußten Freiheit der Persönlichkeit strebt. Doch bleibt alles im Nebelhaften und Unklaren stecken. Aber er fühlt sich als Suchenden und Ringenden und er trägt die Überzeugung in sich, daß die Rätsel der Welt nur dem sich lösen, der ihnen mit heiliger Andacht naht. Max Bruns steckt noch in der Nachahmung fremder Formen. Deshalb können seine sinnigen und von einer schönen Naturempfindung zeugenden Dichtungen vorläufig einen bedeutenden Eindruck nicht machen, aber sie erregen nach vielen Seiten hin die besten Hoffnungen. Hans Benzmann ist keine selbständige Individualität, sondern ein Anempfinder, der das Einfache gern mit allerlei buntem Schmuck umgibt, und der nicht in
#SE033-162
dem Geraden, Schlichten, sondern in dem Umständlichen das Poetische sucht. Manches schöne Bild gelingt ihm, aber ohne Überflüssiges und Triviales vermag er sich fast nie auszusprechen.
#TI
V
#TX
John Henry Mackay wird mit dem Erscheinen seiner Gedichte «Sturm» im Jahre 1888 der «erste Sänger der Anarchie» genannt. Er betont in dem Buche, in dem er 1891 die Kulturströmungen unserer Zeit mit freiem Blicke und aus einer tiefen Kenntnis heraus geschildert hat, in den «Anarchisten», daß er auf diesen Namen stolz sei. Eines der unabhängigsten Bücher, die je geschrieben worden sind, ist diese lyrische Sammlung. Die Lebensansicht des Anarchismus, die viel geschmähte, aber wenig gekannte, hat in Mackay einen Dichter gefunden, dessen kraftvolle Empfindung ihren großen Ideen völlig ebenbürtig ist. «Auf keinem Gebiete des sozialen Lebens» - sagt er selbst in den «Anarchisten» - «herrscht heute eine heillosere Verworrenheit, eine naivere Oberflächlichkeit, eine gefahrdrohendere Unkenntnis, als auf dem des Anarchismus. Die Aussprache des Wortes schon ist wie das Schwenken eines roten Tuches - in blinder Wut stürzen die meisten auf dasselbe los, ohne sich Zeit zu ruhiger Prüfung und Überlegung zu lassen.» Die Ansicht des wahren Anarchisten ist die, daß ein Mensch nicht über das Handeln des anderen herrschen kann, sondern daß nur ein Zustand des Gesellschaftslebens fruchtbar ist, in dem sich jeder einzelne selbst Ziel und Richtung seines Tuns vorzeichnet. Gewöhnlich glaubt jedermann zu wissen,
#SE033-163
was allen Menschen in gleicher Weise frommt. Man hält Formen des Gemeinschaftslebens - unsere Staaten - für berechtigt, die ihre Aufgabe darin suchen, die Wege der Menschen zu beaufsichtigen und zu lenken. Religion, Staat, Gesetze, Pflicht, Recht und so weiter sind Begriffe, die unter dem Einfluß der Anschauung entstanden sind, daß der eine dem anderen die Ziele bestimmen solle. Die Sorge für den «Nächsten» erstreckt sich auf alles; nur das eine bleibt völlig unberücksichtigt, daß, wenn einer dem anderen die Wege zu dessen Glück vorzeichnet, er diesem die Möglichkeit nimmt, selbst für sein Glück zu sorgen. Dieses eine ist es nun, was der Anarchismus als sein Ziel ansieht. Nichts soll für den einzelnen verbindlich sein, als was er sich selbst als Verpflichtung auferlegt. Es ist traurig, daß der Name für die edelste der Weltanschauungen mißbraucht wird, um das Gebaren der gelehrigsten Schüler des gewalttätigen Herrschertums zu bezeichnen, jener Gesellen, die soziale Ideale zu verwirklichen glauben, wenn sie die sogenannte «Propaganda der Tat» pflegen. Der Anhänger dieser Richtung steht genau auf dem Boden, auf dem diejenigen sich befinden, die durch Inquisition, Kanone und Zuchthaus ihren Mitmenschen begreiflich zu machen suchen, was sie zu tun haben. Der wahre Anarchist bekämpft die «Propaganda der Tat» aus demselben Grunde, aus dem er die auf den gewaltsamen Eingriff in den Kreis des einzelnen gebauten Gemeinschaftsordnungen bekämpft. Als persönliches Bedürfnis lebt in Mackays Empfindungsleben die freie, anarchistische Vorstellungsart. Dieses Bedürfnis strömt als Stimmung von seinen lyrischen Schöpfungen aus. Mackays vornehmes Fühlen wurzelt in der Grundempfindung, daß die Persönlichkeit eine große Verantwortlichkeit sich selbst gegenüber hat.
#SE033-164
Demütige, hingebende Naturen suchen nach einer Gottheit, nach einem Ideale, das sie verehren, anbeten können. Sie können sich ihren Wert nicht selbst geben und möchten ihn daher von außen empfangen. Stolze Naturen erkennen in sich nur dasjenige an, was sie selbst aus sich gemacht haben. Die Selbstachtung ist ein Grundzug vornehmer Naturen. Sie wollen nur dadurch zum allgemeinen Werte der Welt beitragen, daß sie ihren Wert als einzelne erhöhen. Sie sind deshalb empfindlich gegen jeden fremden Eingriff in ihr Leben. Ihr eigenes Ich will eine Welt für sich sein, damit es sich ungehindert entfalten könne. Nur aus dieser Heilighaltung der eigenen Person kann die Schätzung des fremden Ich hervorgehen. Wer für sich völlige Freiheit in Anspruch nimmt, kann gar nicht daran denken, in die Welt eines anderen einzugreifen. Man darf deshalb behaupten, daß dieser Anarchismus die Denkart ist, die notwendig aus dem Wesen der vornehmen Seele fließt. Wer die Welt schätzt, muß, wenn er sich selbst versteht, auch das Stück Dasein schätzen, an dem er unmittelbar in die Welt eingreift, das eigene Ich. Eine vornehme, selbstsichere Natur ist Mackay. Und wer mit solchem Ernst wie er in die Abgründe der eigenen Seele hinuntersteigt, in dem erwachen Leidenschaften und Wünsche, von denen der Unfreie keine Vorstellung hat. Von dem einsamen Gesichtspunkte der freien Seele aus erweitert sich das Weltbild des Menschen. «Da erhebt sich die Seele aus brütenden Träumen, als Erwählte zu wandern die Wege der Welt.» Wenn der Blick tief nach innen dringt, dann wird ihm zugleich die Gabe eigen, über die unendlichen Räume hinzuschweifen, und der Mensch kommt in die Stimmung, die Mackay in seinem Gedicht «Weltgang der Seele» in den Worten ausdrückt, der Seele «wurden zum Flug in
#SE033-165
den ewigen Räumen vom Mut die erzitternden Flügel geschwellt».
Wie tief Mackay mit jeder menschlichen Persönlichkeit zu fühlen vermag, das beweist seine ergreifende Dichtung «Helene». Die Liebe eines Mannes zu einem gefallenen Mädchen wird hier geschildert von einem Dichter, dem sein Fühlen und Vorstellen die Wärme des Ausdruckes verliehen hat, die ihren Ursprung nur in der vollkommenen Freiheit der Seele haben kann. Wenn man das menschliche Ich in solche Abgründe verfolgt, dann gewinnt man auch die Sicherheit, es auf den Höhen zu finden.
Man hat Mackay einen Tendenzdichter genannt. Die das tun, zeigen, daß sie weder das Wesen der Tendenzdichtung richtig beurteilen, noch das Verhältnis des Dichters Mackay zu der von ihm vertretenen Weltanschauung kennen. Seine Freiheitsideale bilden so die Grundstimmung seiner Seele, daß sie als individueller Ausdruck seines Innern erscheinen, wie bei anderen die Klänge der Liebe oder die Verherrlichung der Naturschönheiten. Und es ist gewiß nicht weniger poetisch, des Menschen tiefstem Denken Worte zu verleihen, als der Neigung zum Weibe oder der Freude am grünen Wald und am Vogelgesang. Den Lobrednern des sogenannten «absichtlosen Schaffens», die mit ihren doktrinären Einwänden flink zur Stelle sind, wenn sie in der Lyrik etwas wie einen Gedanken wittern, sei zu bedenken gegeben, daß das kostbarste Gut des Menschen, die Freiheit, nicht in der Dumpfheit des Unbewußten, sondern auf den lichten Höhen des entwickelten Bewußtseins entsteht.
Aus dem stürmischen Feuer einer idealistisch gestimmten Seele heraus machte vor rund fünfzehn Jahren Karl Henckell die große Lebensfrage der Gegenwart, die soziale, zum
#SE033-166
Grundmotiv seiner Lyrik. Einen «Morgenweckruf der siegenden und befreienden Zukunft» wollte er den Dichtungen entgegenstellen, die in den siebziger Jahren behaglich die ererbten Vorstellungen in neuen Weisen kundtaten. Ein hoffnungtrunkener Idealismus leuchtet aus den trüben Empfindungen heraus, die das Mitleid mit dem Sehnen, Streben und Kämpfen seiner Zeit in Henckell ausgebildet hat. Nicht der verlogenen «alten Schönheit» wollte er dienen, sondern der neuen Wahrheit, die ein Abbild schafft von den Leiden des ringenden Gegenwartsmenschen. Plastik des Ausdruckes, Harmonie der Töne kann nicht der Charakter dieser Poesie sein, die zwischen Entrüstung über die sozialen Erlebnisse der Gegenwart und zwischen unbestimmten Zukunftserwartungen hin- und herschwankt. Die übertreibende Hyperbe] tritt an die Stelle der ruhig-schönen Metapher. Stechende Glut sprüht aus den Versen, nicht beseligende Wärme. Die Freiheit in allen Formen wird der Abgott, dem der Dichtet huldigt. Die Wissenschaft, die das Geistige aus dem Materiellen entstehen läßt, nimmt er in seine Vorstellungsart auf, damit sie ihn erlöse aus den Banden der religiösen Unfreiheit, der mythologischen Anschauungsweise. Aber auch die Freiheitsidee kann zur Tyrannin werden. Wenn sie scharf abgezirkelte Lebensziele prägt, ertötet sie das wirklich unabhängige Leben der Natur. Ein Herz, das fortwährend nach Freiheit schreit, kann vielleicht nichts anderes meinen als neue Fesseln statt der alten. Es ist eine Höherentwickelung in Henckells Individualität, daß er sich auch von der Freiheit wieder befreien wollte. Er hat den Weg gefunden zu der inneren Freiheit, die sich sagt: «Laß Schulen und Partei'n lehren und schrei'n, du kannst nur gedeih'n zum Künstler und Frei'n für dich allein.»
#SE033-167
Der «Tambour», der mit lautem Trommelschlag dem freien Geiste dienen wollte, hat sich verwandelt in den Geigenspieler, der die Schönheit gefunden hat und von ihr singt. Und damit ist Henckell auch das Glück zuteil geworden, das Naturen genießen können, die stark genug sind, aus ihrem Innern heraus sich den Lebensinhalt zu schaffen, der dem stürmischen Verlangen, den heißersehnten Idealen entgegenkommt. Es ist das nicht jenes triviale Glück, das von den oberflächlichen Genüssen des Lebens ein flüchtiges Dasein nährt; es ist das herbe Glück, das sich wie eine stolze Burg über den steilen Felsen schmerzlicher Erfahrungen erhebt, jenes Glück, das Goethe meinte, als er Tasso sagen ließ: «Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide.»
«Einsiedelkunst aus der Kiefernheide» hat Bruno Wille seine 1897 erschienene lyrische Sammlung genannt. Er hat mit diesem Titel bedeutsam auf den Grundcharakter seiner Persönlichkeit hingewiesen. Er hat bei den Menschen gesucht, wonach seine Seele dürstete: das Glück und die Vollkommenheit. Aber er konnte sie da nicht finden. Deshalb ist er wieder zurückgekehrt, woher er gekommen, in die Einsiedelei seiner Seele und hat sich zum Genossen die Natur gewählt, welche die Treue hält, von der die Menschen zwar soviel sprechen, die sie einander gegenüber doch nicht zu halten wissen. Was er im Bunde mit Menschen vergebens erstrebt hat, das wird ihm zuteil durch die Freundschaft der Natur. Es ist bei Wille nicht ein eingeborener Grundzug seines Gemütes, der ihn zur Einsiedelei trieb. Seine Seele hätte nicht von vornherein ihm zugerufen wie einem Nietzsche die seinige: «Fliehe in deine Einsamkeit! Du lebst den Kleinen und Erbärmlichen zu
#SE033-168
nahe. Fliehe vor ihrer unsichtbaren Rache! Gegen dich sind sie nichts als Rache.» Obwohl ein reiches Innenleben und ein entwickelter Natursinn in Wille immer vorhanden waren und er eine gewisse Selbstgenügsamkeit in sich ausgebildet hatte, stürzte er sich hinein in das volle Treiben sozialen Gemeinlebens. Was bei Nietzsche aus der Über-empfindlichkeit des Organismus stammt, aus seiner Eigenheit, die viele Unreinheit auf dem Seelengrunde der Menschen gleichsam zu riechen: das wurde bei Wille durch reiche Erfahrung innerhalb des Getriebes mit den «Fliegen des Marktes» gezeitigt. Aus dieser Erfahrung bildete sich eine Begierde, die bei Nietzsche wie ein Vorurteil erscheint: «Würdig wissen Wald und Fels mit dir zu schweigen. Gleiche wieder dem Baume, den du liebst, dem breit ästigen: still und aufhorchend hängt er über dem Meere.» Und nicht nur mit Wald und Fels zu schweigen, versteht Bruno Wille, sondern auch mit ihnen vertrauliche Zwiesprache zu halten. Der Natur weiß er die Zunge zu lösen. Die stillen Pflanzen, das mystische Wehen des Windes, sie verraten ihm die intimen Geheimnisse der Natur, und die fernen Sterne vertrauen ihln die großen Offenbarungen an. Sein Blick erhebt sich zu dem roten Mars, dessen Oberfläche nicht naiver Volksglaube, sondern die ernste Wissenschaft mit sagenhaften Bewohnern bedeckt, um dort zu erspähen, wo die armen, unvollkommenen Erdenkinder die Erlösung finden können von dem alten Weh. Die Sehnsucht seiner Seele saugt die erhabenen Laute der ewigen Natur ein, um mitzuleben mit dem All, um das eigene Selbst hineinzuweben in die unendliche Weltseele. «Endlose Weltenscharen, sollst Seele, du, befahren... » Und dieses eigene Selbst ist nicht das leere, inhaltlose des Schwärmers, der
#SE033-169
außen sucht, was er in sich nicht finden kann; es ist das volle Selbst, das nach einer Erfüllung begehrt, die ihm eben solchen Reichtunä bringt, wie es in sich birgt. Das arme Selbst verschenkt sich, weil es bedürftig ist; das reiche Selbst strömt seine Überfülle in die Umgebung aus. Ein dichterischer Pantheismus spricht aus Willes Dichtung zu uns. Was Goethe in «Künstlers Abendlied» begehrt und ausspricht: «Wie sehn' ich mich, Natur, nach dir, dich treu und lieb zu fühlen! ... Wirst alle meine Kräfte mir in meinem Sinn erheitern, und dieses enge Dasein mir zur Ewigkeit erweitern», das lebt als Grundton in der Poesie Willes.
Auch in Julius Harts Seele vermählt sich wie in der Bruno Willes der Einzelgeist mit dem Allgeist. Aber dieser Allgeist ist nicht der selig in sich ruhende Naturgeist; er ist ein von allen Stürmen menschlicher Leidenschaft durchtobter Weltgeist. Sein Fühlen schwebt hin und her zwischen trunkenem Genießen, stolzer Freude am ewigen Werden und dumpfem Entsagen. Geburt und Tod, die die Natur nur in ihrer äußeren Hülle zeigt, die sich um das tiefe, ewige, nie sterbende Leben legt: ihnen begegnen wir in Harts Dichtungen immer wieder. Ein Naturempfinden, das nicht die hehre Götterharmonie aus den Tiefen der Dinge heraufholt, dafür aber die eigenen Seelenstimmungen in den Vorgängen der Außenwelt verkörpert sieht, findet man bei diesem Dichter. Was in seinem Herzen vorgeht, das verkündet ihm die Natur in großangelegter Symbolik. Und hinreißend sind die Rhythmen, mit denen er diese Symbolik besingt. Das Ursprüngliche im Menschenwesen, das große, gigantische Schicksal, das nicht von außen wirkt, sondern das aus den Abgründen der Seele herauf die Individualität
#SE033-170
dämonisch forttreibt durch Gut und Bös, durch Wahrheit und Irrtum, durch Freuden und Schmerzen: für das findet Hart Worte, die voll ertönen und sich uns schwer auf die Seele legen. Begreiflicherweise mußte ein solcher Dichter auch Töne finden für das Empfinden, das aus derjenigen Seelenregion kommt, die bei dem modernen Menschen am entwickeltsten ist, für das soziale. Dieses soziale Empfinden hat in seinem eigenen Herzen Gefühle erweckt, wie sie in seiner Dichtung «Auf der Fahrt nach Berlin» zum Vorschein kommen, die ein Reflexbild liefert von dem schonungslosen, großen Weltgetriebe der Gegenwart aus einer starken, tief erregbaren Seele heraus. Ein philosophischer Zug ist in Harts Persönlichkeit vorhanden. Er verleiht seinen Dichtungen den Ernst und die Tiefe. Und dieser Zug wirkt durchaus lyrisch. Auch wo er philosophisch sein könnte, wird Hart lyrisch. Das zeigt sich in seinem Buche «Der neue Gott», in dem er seine Weltanschauung darlegt. Was ihm als solche vorschwebt, das legt sich nicht in Gedanken auseinander, sondern es klingt aus einer lyrischen Grundstimmung heraus.
Ein Recht, den sozialen Dichtern beigezählt zu werden, hat sich Clara Müller mit ihrer Sammlung «Mit roten Kressen» erworben. Das Sympathische an diesen Dichtungen ist, daß sich das soziale Vorstellen und Denken durchaus persönlich gibt. Die eigenen Leiden und Entsagungen haben der Dichterin die Augen geöffnet für diejenigen der anderen. Und wie reich ihr Leben an lehrenden Erfahrungen war, auch davon geben die in der Form mit edler Einfachheit auftretenden Poesien ein schönes Zeugnis.
Gustav Renner und Paul Bornstein dürfen genannt werden, wenn von den Persönlichkeiten gesprochen wird, auf
#SE033-171
die man für die Zukunft Hoffnungen setzt. Die einfachen, natürlichen Töne des ersten und die mit einem wie Wahrheit wirkenden Pathos versetzte Wärme des anderen erwecken durchaus solche Hoffnungen.
Mehr Reife tritt uns gleich in seinen ersten Dichtungen bei Emanuel von Bodman entgegen. Seine Art ruft einen Eindruck hervor, der an den erinnert, den man bei Rembrandtschen Gemälden hat Er liebt, bedeutsame Wahrnehmungen, die scharfe Kontraste bilden, nebeneinander-zustellen, so daß sie in ihrem Zusammen eine große Ausdrucksfähigkeit haben. Die epigrammatische Kürze, die ihm eigen ist, wird in ihrer Wirkung durch solches Nebeneinander erhöht.
#TI
VI
#TX
«In einem wahrhaft schönen Kunstwerk soll der Inhalt nichts, die Form aber alles tun; denn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt. Der Inhalt, wie erhaben und weitumfassend er auch sei, wirkt also jederzeit einschränkend auf den Geist, und nur von der Form ist wahre ästhetische Freiheit zu erwarten. Darin also besteht das eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, daß er den Stoff durch die Form vertilgt; und je imposanter, anmaßender, verführerischer der Stoff an sich selbst ist, je eigenmächtiger derselbe mit seiner Wirkung sich vordrangt, oder je mehr der Betrachter geneigt ist, sich unmittelbar mit dem Stoff einzulassen, desto triumphierender ist die Kunst, welche jenen zurückzwingt und über diesen die Herrschaff behauptet.» Mit diesen Worten hat Schiller in
#SE033-172
seinen Briefen «Über die ästhetische Erziehung des Menschen» ein künstlerisches Ziel beschrieben, wie es dem Lyriker Stefan George vorschwebt. Die Empfindung, das Gefühl, das Bild, die in der Seele des Künstlers erzittern, müssen erst geprägt, gestaltet werden, wenn sie Kunstwert haben sollen. Jede Faser dieser Urelemente des Seelenlebens muß von der Gestaltungskraft ergriffen worden sein, und zu etwas anderem gemacht, als ihr Naturzustand ist. Denn dieser erregt nur den Menschen, den Künstler geht er nichts an. Nicht um die einzelnen Farben, die einzelnen Töne, die einzelnen Vorstellungen ist es diesem zu tun, sondern um die Art und Weise, wie sie in dem Werke zusammengestellt sind, das wir ästhetisch genießen. Schiller hat offenbar in diesem Kultus der Form ein Ideal gesehen, aber doch gefühlt, daß dieses leicht der Einsamkeit verfallen kann, und deshalb den Zusatz gemacht, daß die Form um so mehr wert sei, je imposanter, gewaltiger der Inhalt, der Stoff sei und je kräftiger daher die Form auch sein muß, die diesen zu bewältigen hat. Je hinreißender das ist, was man zu sagen hat, ein um so größeres Können gehört dazu, es auch auf eine Art zu sagen, die als solche gefällt. In der Lyrik hat es der Künstler mit der eigenen Seele zu tun; seine Empfindungen, seine Gefühle sind der Stoff. Die Kunst wird nicht darin liegen, daß diese Empfindungen und Gefühle Größe haben, sondern daß groß erscheint, wie diese Seelenregungen zum Ausdruck gelangen. Wer innerhalb der Vorstellungsart Schillers stehenbleibt, wird aber doch zugeben müssen, daß die Art des Ausdruckes, wie kunstvoll sie auch sein mag, um so höher zu schätzen ist, je bedeutender der Inhalt ist, der ausgedrückt wird. In der Lyrik ist es die eigene Seele des
#SE033-173
Künstlers, die diesen Inhalt hergibt, die Persönlichkeit. Je größer die Persönlichkeit ist, auf die wir durch das lyrische Kunstwerk blicken, um so wertvoller wird uns dieses selbst erscheinen. Robert Zimmermann, der als Ästhetiker die Anschauung radikal durchgeführt hat, daß die Form allein es sei, die das künstlerische Wohlgefallen hervorruft, hat, um sich zu verdeutlichen, gesagt: Ein und dasselbe Ding, zum Beispiel eine Statue, ist dem Naturforscher, speziell dem Mineralogen ein Stein, dem Ästhetiker ein Halbgott. Der erste soll es bloß mit dem Stoff zu tun haben, der zweite mit dem, was künstlerisch aus dem Stoffe gemacht worden ist. Mit Bezug auf die Lyrik müßte man im Sinne dieser Anschauung sagen: die Seelenregungen eines anderen mögen dem Menschen anziehend oder abstoßend sein, sie mögen seine Teilnahme bewirken oder seine Antipathie; dem ästhetisch Genießenden können sie nur harmonisch oder unharmonisch, rhythmisch oder unrhythmisch sein.
Stefan George lebt nun ganz im Elemente des künstlerischen Ausdruckes, der Form. Wenn seine Seelenschwingungen zutage treten, soll ihnen nichts mehr anhaften, was bloß den Menschen interessiert, sie sollen ganz aufgegangen sein im künstlerischen Elemente der Form. Die Welt gewinnt für diese Persönlichkeit nur Wert, insofern sie rhythmisch bewegt, harmonisch gestaltet ist, insofern sie schön ist. Und wenn andere das Schöne darin sehen, daß uns in einem Vergänglichen das Ewige, die Urkräfte des Daseins erscheinen, so bestreitet Stefan George den ewigen Wesenheiten jeden Wert, wenn sie nicht schön sind. Seine drei Gedichtsammlungen: «Hymnen, Pilgerfahrten, Algabal» - «Bücher der Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und
#SE033-174
Sänge der hängenden Gärten» - das «Jahr der Seele», sie sind die Welt als Rhythmus und Harmonie. Die Welt ist mein Rhythmus und meine Harmonie, und was nicht einfließt in dies goldene Reich, das lasse ich liegen im Chaos des Wertlosen: das ist Georges Grundstimmung.
Schönheitstrunkenheit möchte man diese Grundstimmung nennen. Und schönheitstrunken ist auch Hugo von Hofmannsthal. Wenn man aber von Stefan George sagen darf: er zwingt das Schöne herbei, so muß man von Hofmannsthal behaupten: ihn zwingt dieses Schöne zu sich. Wie eine Biene durchfliegt er die Welt; und da hält er an, wo es den Honig des Geistes, die Schönheit, zu sammeln gibt. Und wie der Honig nicht die Blüte und Frucht selbst ist, sondern nur der Saft aus derselben, so ist Hofmannsthals Kunst nicht eine Offenbarung der ewigen Welt-geheimnisse, sondern nur ein Teil dieses Ganzen. Man nimmt diesen Teil gerne hin und genießt ihn in einsamen Stunden, wie die Biene sich im Winter von dem eingesammelten Honig nährt. Süß wie der Honig ist diese Kunst des Wiener Dichters. Doch die Kraft, die gigantisch die Dinge der Welt erschafft und sie belebt, fehlt in dieser Kunst. Es stürmt in ihr nicht der Elemente Macht und Leidenschaft; es weht in ihr und webt eine Sphärenharmo-nie, die auf dem Grunde der Weltseele erklingt. Und es muß ganz still und schweigsam um uns werden, der Sturm des Weltgeschehens muß aufhören, das wilde Wollen muß für Augenblicke ersterben, wenn wir die leise Musik dieses Dichters hören wollen. Die seltsamen Gleichnisse dieses Lyrikers, seine sonderbaren Umschreibungen und Wort-zusammenstellungen drängen sich nur dem Geiste auf, der nach auserlesenen Schönheiten sucht. Wer die ewigen Kräffe
#SE033-175
der Natur in ihren charakteristischen Erscheinungsformen sucht, der geht an diesen Schönheiten vorüber. Denn sie sind wie die Offenbarungen des Ewigen im Luxus der Natur. Und doch empfindet man auch in den Seltsamkeiten Hofmannsthals das Notwendige der Welterscheinungen. Man wird den Vorwurf einer banausischen Vorstellungsart nicht abwehren können, wenn man diese Luxuskunst von sich weist; aber es muß zugestanden werden, daß wenige menschliche Schöpfungen solche Verführer zum Banausentum sind, wie die Dichtungen Hugo von Hofmannsthals.
Die Stimmung der Andacht, die anbetend vor den ewigen Rätseln der Natur steht, tönt uns aus den lyrischen Dichtungen Johannes Schlafs entgegen. So groß, so hehr, so geheimnisvoll stehen vor ihm die Rätsel, daß er mit halbgeöffnetem Auge nur hinblicken mag, weil es ihn ängstigt, die Fülle des Daseienden auf sich eindringen zu lassen. Das Ahnen gießt genug des seligen Entzückens über die Herrlichkeiten der Welt in seine Seele; er will das volle Schauen, die Helligkeit der Wahrnehmung vermeiden. Auch er greift zu seltenen Vorstellungsgebilden, um das Erahnte in Worte zu kleiden; aber nicht als schönheitstrunkener Geist, sondern wegen seiner leidenschaftlichen Hingabe an die Wahrheit, deren Majestät er nicht durch das Kleid der Alltäglichkeit dem nüchternen Sinne allzu nahebringen will. Dieser Dichter, der einer der Propheten des radikalen Naturalismus auf dem Felde der Dramatik ist: er hat sich als Lyriker zum Sänger der ewigen Wesenheiten durchgerungen, die tief in den Dingen verborgen sind.
Einen anderen Entwickelungsgang ist Arno Holz gegangen. Von der formschönen, von natürlichem Schwunge
#SE033-176
getragenen Dichtung, der er im Anfang seiner Laufbahn zugetan war, hat er sich abgewandt. Die naturalistische Doktrin hat die Oberhand gewonnen über die Natürlichkeit. Denn natürlich ist, daß das Gefühl in der Kunst sich erhebt über das unmittelbare Erlebnis. Der Stil, der den Wahrnehmungen eine höhere Gestalt gibt: er entspringt aus einer natürlichen Sehnsucht. Aus derjenigen, die sich am meisten befriedigt fühlt, wenn der Mensch Kunstmittel findet, die ohne Vorbild im Leben dastehen, welche eine eigene, freie Schöpfung der Seele und doch Offenbarungen der ewigen Urkräfte sind. Goethe schildert diese Befriedigung, indem er den Eindruck der Musik charakterisiert. «Die Würde der Kunst erscheint bei der Musik vielleicht am eminentesten, weil sie keinen Stoff hat, der abgerechnet werden müßte. Sie ist ganz Form und Gehalt und erhöht und veredelt alles, was sie ausdrückt.» Denn jedes innere Erlebnis, wenn es aus den Tiefen der Seele hervorgeht, soll, nach Holz' Meinung, seine eigene, individuelle Form mit zur Welt bringen; und nur diese mit dem Inhalt zugleich geborene Form soll die natürliche sein. Den Weg von dem Erlebnis zu der vollendeten künstlerischen Ausgestaltung will Holz nicht gelten lassen. Nicht, wie Schiller sagt, in der Besiegung des Stoffes durch die Form liege das wahre Kunstgeheimnis des Meisters; sondern der ist Meister, der dem Stoffe die in ihm liegende Form abzulauschen vermag. Auf diese Weise ist Holz aus dem begeisternden Sänger, der hinriß, wenn er das Los des Elends, die Sehnsucht nach besserer Zukunft zum Ausdrucke brachte, der sorgsame Aufzeichner unmittelbarer Eindrücke geworden, die dem ästhetischen Gefühle nur dann Befriedigung gewähren, wenn sie zufällig künstlerisch sind. Sie sind das
#SE033-177
allerdings sehr oft, weil in Holz der Dichtergeist lebt trotz seiner der dichterischen Kunst im höheren Sinne feindlichen Theorie.
Die Dichtungen Cäsar Flaischlens wirken durch die tiefe, gemütvolle Persönlichkeit, die sich in ihnen ausspricht. Er ist eine Persönlichkeit, die das Leben nicht leicht zu nehmen vermag. Sie hat Kämpfe zu bestehen gegenüber den leidenschaftlichen Strebungen der Seele. Sie dürstet nach Befriedigung. Stolz möchte sie bezwingen, was sie fernhält von ihren Zielen. Aber letzten Endes ist es nicht die unbegrenzte Kraft, der sie sich vertraut, sondern ein Stück Bescheidenheit, die sich nahe Ziele männlich setzt, wenn sie sieht, daß die fernen nicht erreichbar sind. Denn lieber ist Flaischlen innerhalb des engeren Kreises ein voller Mensch, als innerhalb des weiteren ein halber. Ganz zu sein nach Maßgabe des eigenen Seelenfonds, innerlich harmonisch auf sich selbst beruhend: das ist der Grundcharakter seiner Persönlichkeit. Jn würdiger Einfachheit ziehen die Dinge der Welt vor seinen Augen vorüber, und ebenso einfach, oft allzu anspruchslos, fließen seine Verse und seine besonders reizvollen Gedichte in Prosa dahin.
Richard Schaukal hat eine auf das Ausdrucksvolle in der Welt gehende Beobachtungsgabe. Für seinen Blick stilisieren sich die Dinge und Ereignisse. Das Erhabene bildet sich für seine Anschauung zum Hehren um, und das Schöne gestaltet sich zum Einfach-Schmuckvollen. Das Schlanke dehnt sich für sein Auge vollends zur geraden Linie; die Übergänge von einem Ding zum anderen hören auf, und schroff löst Gegensatz den Gegensatz ab. Das alles aber in einer Weise, daß wir den Eindruck haben: in seiner Kunst klären die Dinge durch scharfe Umrisse und
#SE033-178
Kontraste über sich selbst auf; sie lassen ihr Unbestimmtes verschwinden und heben ihr Charakteristisches hervor. Eine farbenreiche Sprache ist dieser Anschauungsweise ebenbürtig. Er vermag bedeutsam zu sagen, was er bedeutsam gesehen hat. Er ist im Beginne seiner künstlerischen Laufbahn. Ein vielsagender Beginn scheint das zu sein.
Von wunderbar zarter Empfänglichkeit für die intimen Beziehungen der Naturwesen und der Menschenerlebnisse ist die Phantasie Rainer Maria Rilkes. Und dabei hat er eine Treffsicherheit im Ausdrucke, die alle die feinen Verhältnisse zwischen den Dingen, die sich dem Dichter entdecken, mit vollen, satten Tönen vor uns hinzustellen vermag. Das ist nicht die Treffsicherheit des großen Charakteristikers, das ist diejenige des naturkundigen Wanderers, der die . Dinge liebt, denen er auf seinen Wanderungen begegnet, und dem sie viel vorplaudern von ihren stillen Geheimnissen, weil auch sie ihn lieben und Vertrauen zu ihm gewonnen haben.
Klangvolle Farben des Ausdrucks und eine große Eindrucksfähigkeit für die feierlichen Töne der Außenwelt hat Hans Bethge. Beides weckt allerdings nicht das Gefühl, als ob es aus der ureigenen Seele des Dichters käme, sondern erscheint als Ausdruck des Anempfundenen. Dieser Eindruck wird noch erhöht durch die Koketterie, mit der diese Lyrik an uns herantritt. Wahrscheinlich ist jedoch, daß dieses Fremdartige in des Dichters Persönlichkeit nur eine Vorstufe zu schönen Eigenleistungen ist, deren Vorklänge aus seinen gegenwärtigen Schöpfungen doch herauszuhören sind.
LUDWIG JACOBOWSKI
#G033-1967-SE179 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
LUDWIG JACOBOWSKI
EIN LEBENS- UND CHARAKTERBILD DES DICHTERS
#TX
Ein jäher Tod hat am 2. Dezember 1900 Ludwig Jacobowski aus einem arbeitsreichen und hoffnungsvollen Leben gerissen. Was mit ihm zu Grabe getragen worden ist, davon dürften nur diejenigen eine rechte Vorstellung haben, die ihm so nahestanden, daß er in den letzten Zeiten seines Lebens von seinen Ideen und Plänen mit ihnen sprach. Denn man mußte bei allem, was er geleistet hatte, stets einen Zusatz machen. Er machte ihn selbst. Er war nur mit sich zufrieden, wenn er große Aufgaben vor sich sah. Ein zweifacher Glaube beseelte ihn. Der eine bestand darin, daß das Leben nur lebenswert ist, wenn man seine Persönlichkeit in ihrer Leistungsfähigkeit rastlos steigert; der andere, daß der Mensch nicht bloß sich selbst gehört, sondern der Gemeinschaft, und daß nur der sein Dasein verdient, der den anderen so nützlich ist, wie er es nur sein kann. Unter dem Einflusse solcher Empfindungen erweiterte er die Kreise seiner Tätigkeit fortwährend. Es waren für ihn und für andere schöne Augenblicke, wenn er von dem sprach, was er vorhatte. Die Art, wie er sprach, erweckte immer den Glauben, er werde erreichen, was er wollte. Er schreckte vor keinen Hindernissen zurück. Nicht vor solchen, die in ihm lagen, und auch nicht vor denen, die ihm auf dem Wege begegneten. Menschen, die so viel an sich arbeiten, um sich zu ihren Aufgaben zu befähigen, gibt es wenige. Er hatte zum Grund seines Wesens das höchste Vertrauen. Aber er glaubte nie, daß es ihm leicht sein werde, diesen Grund aus sich herauszuarbeiten.
#SE033-180
Er durfte mit tiefster Befriedigung zurückblicken auf die Arbeit, die er getan hatte, um sich zu dem emporzuarbeiten, zu dem er geworden ist. Aber er hat diese Befriedigung wohl nie an sich, sondern nur deshalb empfunden, weil aus ihr das Gefühl entsprang, daß seine Arbeitskraft auch in der Zukunft jedem Hindernisse gewachsen sein werde. Über seinem Schreibtisch hing ein Zettel mit Kernsprüchen. Darauf standen auch die Goetheschen Sätze:
Kaum bist du sidier vor dem gröbsten Trug,
Kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen,
So glaubst du dich schon Übermensdi genug,
Versäumst die Pflicht des Mannes zu erfüllen!
Wieviel bist du von andern unterschieden?
Erkenne dich, leb mit der Welt in Frieden!
Das Wesen seines Denkens und Fühlens ist in diesen Sätzen ausgesprochen. Das Leben als Pflicht aufzufassen, gehörte zum Innersten seiner Natur. Denn mit dieser Gesinnung lebte er von Kindheit an. Es ist, als ob er schon als Knabe die Empfindung gehabt hätte: scheue keine Arbeit an dir, denn du wirst einst als Mann viel von dir selbst fordern, und wehe, wenn du dich nicht widerstandsfähig gemacht hast!
Ludwig Jacobowski wurde am 21. Januar 1868 zu Strelno in der Provinz Posen als der dritte Sohn eines Kaufmanns geboren. In dem kleinen Kreisstädtchen, ein paar Meilen von der russischen Grenze entfernt, verlebte er seine ersten fünf Kinderjahre. Im April 1874 siedelten seine Eltern nach Berlin über. Der Knabe besuchte hier zunächst die Luthersche Knabenschule. Da war er ein fleißiger, strebsamer Schüler. Das blieb auch so, als er die Sexta der Louisenstädtischen
#SE033-181
Oberrealschule bezog. Von der Quinta ab wurde das anders. Der Fleiß hatte nachgelassen, und die Freude am Unterrichte war keine große. Er mußte wieder in die Luthersche Knabenschule zurückgebracht werden. Eine Augenoperation, die damals an ihm vorgenommen werden mußte, und der Umstand, daß er wegen eines Sprachfehlers eine Sprach-schule besuchen mußte, sind auf die Grundstimmung des Knaben von tiefem Einflusse gewesen. Die Empfindung, daß er sein Inneres durch eine rauhe, spröde Oberfläche durcharbeiten müsse, fand in dieser Zeit reiche Nahrung. Solche Empfindungen haben ihm unzählige trübe Stunden bereitet. Ein Niederschlag dieser Stunden ist wohl nie aus seiner Seele gewichen. Aber stets stellte sich zu solchen Gefühlen der Gegenpol ein: du mußt deinen Willen stählen, du mußt aus dir heraus ersetzen, was dir das Schicksal versagt hat. Die Niedergeschlagenheit war bei ihm immer nur der Boden, aus dem seine schier unbegrenzte Energie hervorwuchs. Als er zwölf Jahre zählte, verlor er die Mutter. Das Schicksal sorgte dafür, daß sich sein Leben auf einem ernsten Untergrund erbaute. In seinem zwanzigsten Lebensjahre mußte er auch seinem Vater zum Grabe folgen; zwei Brüder sah er in der Blüte der Jahre dahinsterben. Sein zielsicherer Wille und sein Lebensmut wuchsen immer wieder aus den düsteren Erlebnissen heraus. Das Goethesche Wort «Über Gräber vorwärts» gehörte auch zu denen, die man auf dem Zettel über seinem Schreibtisch lesen konnte.
Eine völlige Umwandlung ging in dem Knaben vor sich, als er, etwa von seinem dreizehnten Jahre an, sich in die Schätze des deutschen Geisteslebens zu vertiefen begann. Für den idealistischen Zug seiner Seele ist es bezeichnend, daß er sich in dieser Zeit mit wahrer Inbrunst zu Schillers Schöpfungen
#SE033-182
hingezogen fühlte. So schuf er sich selbst die Gegenstände seines Interesses, die er in der Schule zunächst nicht hatte finden können. Als er dann wieder in die Louisenstädtische Oberrealschule zurückkehrte, reihte er sich den guten Schülern immer mehr ein. Er hatte nunmehr von sich aus den Weg gefunden, auf dem ihm die Außenwelt Verständnis abrang. In der obersten Klasse war er so weit, daß er auf Grund guter schriftlicher Arbeiten von dem mündlichen Abiturientenexamen dispensiert wurde. Er bestand dieses Examen am 30. September 1887.
Großen Einfluß hatte auf Ludwig Jacobowskis Entwickelung die Freundschaft mit einem Knaben, der als Obersekundaner starb. Das war ein begabter Knabe, der insbesondere für Mathematisches bedeutende Fähigkeiten entwickelte. Diese Freundschaft war ein gutes Gegengewicht gegenüber Jacobowskis mehr auf das rein Literarische gerichteten geistigen Interessen. Ein Verständnis für echte, ja exakte wissenschaftliche Strenge, die ihm dann für das Leben blieb, wurde damals in Jacobowski gepflanzt. Das bewirkte, daß er stets einen offenen Sinn hatte für die großen Errungenschaften der Naturforschung und deren weittragende Bedeutung für das ganze Denken und Fühlen der modernen Menschheit. In hingebender Treue dachte er denn auch sein ganzes späteres Leben hindurch des frühverstorbenen Jugendfreundes. «Dem setze ich noch einmal ein dichterisches Denkmal», waren die Worte, die ich von ihm hörte und die begleitet waren von einem unbeschreiblichen Blick der Dankbarkeit.
Wie weitgehend Ludwig Jacobowskis Interessen waren, das bezeugt der Gang seiner Universitätsstudien. Er war vom Oktober 1887 bis Oktober 1889 in Berlin, dann in Freiburg i.
#SE033-183
Br. bis Ostern 1890 inskribiert. Philosophische, historische und literaturgeschichtliche Vorlesungen besucht er zunächst. Bald erweitert sich der Kreis. Die Kulturgeschichte, die Psychologie und die Nationalökonomie treten hinzu. Man sieht, wie sich eine Hauptneigung immer mehr heraus-bildet. Er will die Entwickelung der menschlichen Phantasie verstehen. Alles wird um dieses Grundinteresses willen getrieben. Im Jahre 1891 erwirbt er sich den Doktor in Freiburg mit einer Abhandlung: «Klinger und Shakespeare, ein Beitrag zur Shakespeareomanie der Sturm- und Drangperiode.» Aus den Schlußsätzen geht klar hervor, welche Gestalt seine Vorstellungen angenommen haben. «Die Literaturgeschichte sollte mit Lob und Tadel endlich aufhören. Beides gehört einer romantischen Periode der Kritik an. Eine moderne Kritik - von der erste Spuren in Frankreich bei Sainte-Beuve, Taine u. a. zu entdecken sind - hat jenseits zu wohnen von , von . Psychologisches Verständnis ist das einzige und erste, was die Kritik erreichen kann. Deshalb hat man Klingers Abhängigkeit von dem großen Briten, psychologisch zu begreifen, als etwas Naturnotwendiges aufzufassen. Und Urteile gegen Notwendigkeiten psychologischer Art sind entschieden überflüssig und falsch. Wenn daher Hettner sagt, Klinger habe in Shakespeare , so ist dieses Urteil durchaus abzulehnen. Klinger hat in Shakespeare nur ein geniales Vorbild gesehen. Seine impressionable, empfängliche Natur, die unterstützt wurde durch ein ausgezeichnetes Gedächtnis, mußte eine große Anzahl Shakespearescher Motive in sich aufspeichern, verarbeiten und reproduzieren. In diesem psychologischen liegt eine
#SE033-184
ästhetische Rechtfertigung seiner Abhängigkeit von Shakespeare.»
Auf die Gesetzmäßigkeiten in der Entwickelung des Menschengeistes war Jacobowskis Denken fortan gerichtet. Er trug auch die Überzeugung in sich, daß die Dichtung aus einer tief in die Menschenseele gelegten Notwendigkeit erwächst. Das zog ihn zum Studium der Volkspoesie hin. Überall hielt er bei den primitiven Kulturen der Urvölker und Wilden Umschau, um zu sehen, wie aus dem Vorstellungs- und Empfindungsleben des Menschen mit Notwendigkeit die Dichtung erwächst. Er hat sich aus solchen Studien heraus ein tiefes Verständnis dafür geholt, was wahrhaft den Namen Poesie verdient. Es gehört zu seinen Eigentümlichkeiten, daß alsbald alles, was er sich wissenschaftlich erarbeitete, in sein Gefühl eindrang und ihm ein sicheres Urteil gab. Es war im höchsten Grade genußreich, ihm zuzuhören, wenn er an den geringsten Einzelheiten eines Gedichtes zeigte, inwiefern etwas wirklich poetisch ist oder nicht. Daß sich in der entwickeltsten Kunstdichtung die Kennzeichen wiederholen, die an der primitivsten Poesie wahrzunehmen sind, davon ging er aus. Damit soll aber durchaus nicht gesagt werden, daß Jacobowski bei seinem eigenen künstlerischen Schaffen oder auch nur in seinem ästhetischen Urteil von der Reflexion ausging. Die Erkenntnis vertrug sich bei ihm völlig mit der Ursprünglichkeit, ja Naivität des Schaffens und Empfindens.
In seinem einundzwanzigsten Lebensjahre konnte Ludwig Jacobowski bereits ein Bändchen Gedichte «Aus bewegten Stunden» erscheinen lassen (Pierson, Dresden und Leipzig 1889). Es ist der Niederschlag eines Jugendlebens, das reichlich mit Schmerzen und Entbehrungen gerungen, das
#SE033-185
zwischen trüben Stimmungen und frohen Hoffnungen hin und her getrieben worden ist. Ein großes Streben, ein Leben in schönen Idealen, das unsicher und ängstlich nach Form und Sprache ringt. Echte Jugenddichtungen, die aber aus einer ernsten Grundstimmung hervorbrechen. Eines fällt an diesen Gedichten auf, was tief charakteristisch ist für den Dichter. Er ist von den vorübergehenden Zeitströmungen seiner Umgebung fast ganz frei. Der Tag mit seinen Schlagworten, die herrschenden Richtungen der Literaturcliquen haben keinen Einfluß auf ihn. Wenn er es auch auf noch jugendliche Art tut: er ringt mit Idealen, die höher sind als die seiner Zeitgenossen. Zu den Stürmern, die, auf nichts gestützt, von sich aus sogleich eine neue Epoche des Geisteslebens zählen, gehört er nicht.
Es waren schwere Zeiten, die der junge Mann vor und nach dem Abschluß seiner Universitätsstudien durchlebte. Er war damals auch in der Schuhwarenfabrik der Familie tätig. Zwischen geschäftlichen Verrichtungen lagen die Stunden, in denen er seine Verse schrieb, in denen er seinen Studien über die Entstehung und den Entwickelungsgang der Poesie oblag. Dennoch folgte auf seinen ersten Gedichtband nach einem Jahre ein zweiter, «Funken» (Pierson, Dresden 1890), und in demselben Jahre erschien eine prächtige Arbeit über «Die Anfänge der Poesie, Grundlegung zu einer realistischen Entwickelungsgeschichte der Poesie» (Dresden 1890). Die Arbeiten Gustav Theodor Fechners auf dem Gebiete der Ästhetik hatten auf Jacobowski einen tiefen Eindruck gemacht. In der «Vorschule der Ästhetik» dieses Denkers sah er ein grundlegendes Werk für alle zukünftigen ästhetischen Studien. Fechner hatte, nach seiner Meinung, diese Studien aus der Sphäre willkürlicher Vorstellungen auf den
#SE033-186
sicheren Boden der Wirklichkeit gestellt. Nicht aus der Spekulation heraus sollten die Gesetze des künstlerischen Schaffens gewonnen werden, sondern aus der naturwissenschaftlichen und psychologischen Betrachtung der Menschennatur müssen sie hergeleitet werden. In einem Aufsatz «Primitive Erzählungskunst» hat sich Jacobowski mit folgenden Sätzen über seine Anschauungen in dieser Beziehung ausgesprochen: «Erst in jüngster Zeit hat die Psychologie gelernt, sich bei wilden Stämmen und bei Kindern umzusehen. Hoffen wir, daß die Ästhetik und Poetik ihr folgen werden. Die An-fänge sind bereits gemacht, aber für die Erkenntnis der ästhetischen Funktionen des Kindes ist noch viel zu tun. Hoffen wir, daß die Zeit uns auch auf diesem Gebiete reife Früchte bringt. Dann erst wird es möglich sein, die gesamten Keime der Poesie klarzulegen, aus der der herrlichste Baum erwuchs, der im Paradies der Erde gewachsen . . . Für eine Entwickelungsgeschichte der Poesie ist es stets von Wert, neben dem Studium der primitiven Völker auch die Erzeugnisse der kindlichen Seele aufmerksam zu verfolgen.» Von solchen Gesichtspunkten ausgehend, hat Jacobowski eine Reihe von Aufsätzen über Entwickelungsgeschichte der Poesie geschrieben. Es seien genannt: Märchen und Faheln der Basuto-Neger. Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung, 11. März 1896. Arabische Volkspoesie in Nordafrika. Beilage der Vossischen Zeitung, 10. März 1895. Geschichten und Lieder der Afrikaner. Magazin für Literatur, 1896, Nr.30 und Münchener Allgemeine Zeitung, 24. Juli 1896, sowie Beilage der Vossischen Zeitung, 11.Oktober 1896. Das Weib in der Poesie der Hottentotten. Globus, Band 70, 1896, Nr.11 u. f. - Als dann Karl Büchers «Arbeit und Rhythmus» erschien, begrüßte Jacobowski in diesem Buche
#SE033-187
eine schöne Frucht desjenigen Standpunktes, den er selbst in der Entwickelungsgeschichte der Poesie zu dem seinigen gemacht hatte.
Alles, was Jacobowski auf diesem Gebiete unternahm, sah er als Vorarbeit zu einem großen Werke über eine realistische Entwickelungsgeschichte der Poesie an. Unermüdlich war er im Zusammentragen von Material für diese Arbeit. Eingehend beschäftigte er sich mit kulturgeschichtlichen Studien, aus denen ihm die Genesis des poetischen Schaffens vor Augen treten sollte. Er war namentlich mit den kulturgeschichtlichen Forschungen der Engländer gründlich vertraut. Eine Fülle von Aufzeichnungen über das Leben primitiver Menschen hat er hinterlassen. In solchen Arbeiten entwickelte er einen unvergleichlichen Fleiß, und in der Verarbeitung des Stoffes zeichnete ihn ein umfassender Sinn und ein treffsicheres Urteil aus. Die Freunde, die er im Beginne der neunziger Jahre hatte, waren der Ansicht, daß auf diesem Gebiete seine eigentliche Begabung liege und daß er als Gelehrter einstmals Großes leisten werde. - Er selbst verfolgte mit hingebender Liebe und Ausdauer diese Dinge, in der Absicht, ein grundlegendes Werk über «Entwicklungsgeschichte der Poesie» dereinst zu versuchen. Den Mittelpunkt seines Schaffens bildete aber diese gelehrte Tätigkeit zunächst nicht.
In diesem Mittelpunkte standen seine eigenen dichterischen Leistungen. Um ihretwillen wollte er in erster Linie leben. Daß er im Kerne seines Wesens ein Dichter war, daran zweifelte er wohl keinen Augenblick. Ob dieser Kern durch eine harte Schale durchdringen werde, das mag ihm aber wohl oft als eine bange Frage an sich selbst vor die Seele getreten sein.
#SE033-188
Zwischen zwei Extremen wurde Jacobowskis Seele hin und her bewegt. Ein starker, unbeugsamer Wille war in ihm neben einem weichen, sensitiven Gemüt, in dem die Vorgänge der Außenwelt, mit denen er in Berührung kam, scharfe Spuren hinterließen. Und es war ihm Lebensbedürfnis, im vornehmsten Sinne des Wortes, den Wert seiner Persönlichkeit zu fühlen. Alles, was ihm in dieser Richtung störend in den Weg trat, versetzte ihn in die tiefste Verstimmung. Man denke sich ihn mit einer solchen Gemüts-anlage in den neunziger Jahren inmitten der brutalen Äußerungen eines für feinere Naturen einfach unverständlichen Antisemitismus. Und man denke sich seine idealistische Denkweise in einer Zeit, in der er Strebertum, rohen Kampf um niedere Güter, frivoles Spiel mit heiligen Gefühlen Tag für Tag frecher überhandnehmen sah. Welche Stimmungen durch den Anblick solchen Treihens in ihm aufgerüttelt wurden, davon erzählt mit kräftigen Worten sein Erstlingsroman «Werther, der Jude», der 1892 erschienen ist (Pierson, Dresden). Er hat ihn in Entbehrungen und wahren Seelenqualen geschrieben.
Unter den ethischen Anschauungen des Vaters und unter den Vorurteilen, die sich gegen den jungen Juden richten, leidet Wolff. Die Geldspekulationen des Vaters bringen den Lehrer des Sohnes, an dem dieser mit wahrer Verehrung hängt, um sein Vermögen. Die Leidenschaft, die Wolff zu der Frau dieses Lehrers faßt, macht den jungen Mann zum Betrüger an dem väterlichen Freunde. Dabei zerstört ihm dieselbe Leidenschaft zugleich sein schönes Liebesband zu einem Kinde aus dem Volke, das in freiwilligem Tod Erlösung sucht von den Qualen, die ihm die Neigung zu dem Studenten gebracht hat. Die Willenskraft des jungen Mannes
#SE033-189
ist nicht stark genug, um ihm einen Weg zu weisen durch die Kontraste, in die ihn das Leben wirft, und durch die Wirrnisse, in die ihn seine eigenen Leidenschaften versetzten. Sein humaner Sinn entfremdet ihn den Menschen, an die ihn die natürlichen Lebensbande knüpfen. Gleichzeitig lasten diese Bande schwer auf ihm. Die Welt stößt ihn zurück wegen seiner Zugehörigkeit zu Menschen, deren Fehler er selbst tief verabscheut. - In diesem Einzelschicksal läßt jacobowski das Schicksal des modernen Juden sich spiegeln. Mit Herz-blut ist der Roman geschrieben. Es ist eine Psychologie darin, deren Studienobjekt die eigene blutende Seele war. Man mag dem Roman vorwerfen, daß ihn ein junger Mann geschrieben hat der nicht Ruhe und Zeit zur objektiven Seelen-beobachtung gefunden hat, weil die Erlebnisse der eigenen Seele noch zu sehr danach streben, einen Ausdruck zu finden. Man mag auch sagen, das künstlerische Kompositionstalent Jacobowskis war damals noch nicht groß. Eines wird man zugestehen müssen: man hat es mit dem Dokument einer Menschenseele zu tun deren tragische Grundtöne zu jedem Herzen sprechen müssen, das nicht verhärtet ist gegen die Leiden eines idealistisch gestimmten Gemütes. Ein solches Herz wird für alle Fehler der Erzählung entschädigt durch die tiefe Wahrheit, mit der sich eine Persönlichkeit nach einer Seite ihres Wesens rückhaltos ausspricht. - Wer Jacobowski nahegestanden hat, kennt diese Seite seines Wesens. Es war diejenige, gegen welche die Energie seines Willens immer wieder ankämpfen mußte. Man darf bei ihm von einer hochgesteigerten Empfindlichkeit sprechen gegenüber allem, was wider die berechtigten Ansprüche seiner Persönlichkeit auf volle Achtung und Geltung bei der Mitwelt ge-richtet war. Und daneben lebte in ihm ein seltenes Bedürfnis
#SE033-190
nach Anteilnahme an allem, was lebenswert ist. Seine Hingabe an Personen, sein Aufgehen in der Außenwelt flößten ihm eine fortwährende Furcht ein, er könne sich verlieren. Jacobowski ist nicht Werther. Aber das Wertherschicksal ist ein solches, gegen das sich Jacobowski in sich selbst fortwährend schützen müßte. Es stand ihm damals, als er den «Werther» schrieb, wohl klar die Möglichkeit vor Aügen, ein Werther zu werden. Deshalb ist der Roman eine Aüseinandersetzung mit sich selbst.
Wer so viel in ein Werk gelegt hat wie Jacobowski in seinen «Werther», dem kann es wohl nicht gleichgültig sein, wenn er auf eine taube Mitwelt stößt. Nichts war zu bemerken von einer Anerkennung des ohne Zweifel ehrlichen Wollens und der ebenso zweifellosen Begabung. Man kann den Druck, den diese Erfolglosigkeit auf den jüngen Dichter ausübte, ihm nachfühlen. Er gestand es später, wenn er von diesen Tagen sprach, ehrlich zü, wie er unter dieser Erfolglosigkeit gelitten hat. Zu den unbescheidenen Naturen, denen gar keine Zweifel aufstoßen an der eigenen Begabung, gehörte er eben nicht. Eine aufmunternde Anerkennung wäre ihm in dieser Zeit sehr wertvoll gewesen. Man darf die Tatsache, daß nunmehr kurze Zeit sein dichterisches Schaffen zurücktrat hinter einer starken Beschäftigung mit politischen Fragen, dem Umstande zuschreiben, daß ihm eine solche Anerkennung fehlte. Sein Anteil an politischen Fragen war aber kein solcher, der sich in den Interessen des Tages verliert. Das Politische wurde von ihm stets in Verbindung mit der Külturentwickelung betrachtet. Das letzte Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts war nur zu geeignet, scharfen Köpfen mit weitem Horizont die mannigfaltigsten Fragen vorzulegen. Die Aufhebung des Sozialistengesetzes
#SE033-191
hat die soziale Bewegung in ihrer kulturellen Bedeutung auch äußerlich zur machtvollen Erscheinung werden lassen. Die alten Parteien waren in sich zerfallen, ihre Ideen, ihre Schwungkraft erwiesen sich der immer fortschreitenden Entwickelung nicht mehr gewachsen. Alte, reaktionäre Mächte glaubten ihre Zeit neuerdings gekommen. Schlagworte und dunkle Instinkte fingen an, auf breitere Massen eine Wirkung auszuüben, die man ihnen seit langem nicht mehr zugetraut hätte. Von einem dieser dunklen Instinkte, dem antisemitischen, wurde Jacobowskis Aufmerksamkeit besonders erregt. Er verletzte ihn tief in seinen persönlichsten Empfindungen. Nicht etwa deshalb, weil er mit diesen Empfindungen an dem Judentume hing. Das war durchaus nicht der Fall. Jacobowski gehörte vielmehr zu denen, die mit ihrer inneren Entwickelung längst über das Judentum hinausgewachsen waren. Er gehörte aber auch zu denen, die in tragischer Weise fühlen müßten, welche Zweifel man einem solchen Hinauswachsen aus blinden Vorurteilen heraus entgegenbrachte.
Diese blinden Vorurteile waren aber nur eine Teilerscheinung. Sie gehörten der mächtigen Strömung an, zu der sich eine Summe von reaktionären Ideen immer mehr heraus-gestaltete. Man glaubte, dieser Strömung eine ideale Grundlage zu schaffen, wenn man die herrschenden Weltanschauungen von neuem mit christlichen Ideen durchdrang. Das Schlagwort «Praktisches Christentum» beherrschte die Köpfe. Und der Gedanke, daß der Staat auf christlichen Grundfesten erbaut werden müsse, schien weithin eine mächtige Anziehungskraft zu üben. - Das veranlaßte Jacobowski, sich mit solchen Anschauungen auseinanderzusetzen. Seine umfangreiche «Studie» über den «Christlichen
#SE033-192
Staat und seine Zukunft» (Berlin 1894, Verlag von Carl Duncker) ist ein Ergebnis dieser Auseinandersetzungen. Die Beschäftigung mit kulturhistorischen Problemen gab der «Studie» eine gediegene Unterlage. Er untersucht sorgfältig den Einfluß der Kirche auf die Staaten. Er läßt die Geschichte ihr bedeutsames Urteil darüber sprechen, inwiefern die Kirche in den Entwickelungsgang der abendländischen Menschheit eingegriffen hat. Und um die sittlichen Grundlagen des Staates zu erkennen, beschäftigt er sich mit den Wandlungen der sittlichen Vorstellungen verschiedener Völker. Das Ergebnis, zu dem er kommt, wird von Einsichtigen sich kaum bezweifeln lassen: «Das Ende des christlichen Staates ist für die einsichtigen Parteien Deutschlands eine Tatsache, gegen welche dessen berufene Vertreterin, die konservative Partei, vergebens Sturm laufen wird. Die zwingende Logik der Geschichte war bisher immer stärker als die beschränkten Einzelwünsche und Sonderinteressen politischer Parteien. Und so ist es Tatsache, daß der christliche Staat in allen europäischen Staaten immer mehr und mehr zerbröckelt.» Im zweiten Teile der «Studie» verfolgt Jacobowski die in der Gegenwart liegenden Ansätze zu neuen Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung: den nationalen, den ethischen Staat, die freie christliche Gemeinschaft, die freie ethische Gemeinschaft. Eine anregende Untersuchung stellt er an über die Lebensfähigkeit der verschiedenen jungen Zukunftsideale. - Ein wirkliches Resultat kann eine solche Auseinandersetzung wegen der Jugend dieser Ideale nicht liefern. «Niemand weiß, wer den ersetzen, niemand, ob diese Ablösung unter friedlichen Bedingungen vor sich gehen wird.» Für Jacobowski selbst aber hatte die Studie eine große Bedeutung. Er hatte
#SE033-193
durch sie erlangt, ohne was er, seiner ganzen Anlage nach, nicht hätte leben können: er hatte sich das Verständnis der Mitwelt angeeignet.
Der Kampf mit der Umwelt ist auch das Problem, das er im Jahre 1894 zum Gegenstande einer dramatischen Arbeit macht. Er schreibt in kurzer Zeit, von April bis Juni des genannten Jahres, «Diyab, der Narr, Komödie in drei Akten». Wie der «Werther» die eine Seite in Jacobowskis Wesen, seine Gefühlswelt, darstellt, so der «Diyab» seine gegen alle Strömungen sich immer wieder behauptende Willenskraft. Beim «Werther» liegt die mehr oder weniger unbewußte Empfindung zugrunde: gegen diese Äußerungen in meiner Natur habe ich mich zu wehren; beim «Diyab> dürfte in ebensolcher Weise das Gefühl sprechen: so muß ich zur Außenwelt stehen, wenn ich meinen Weg machen will. -Der Sohn des Scheikhs, Diyab, ist von einer weißen Mutter geboren und wird deshalb als ein Ausgestoßener betrachtet. Der Hohn der ganzen Umgebung verfolgt ihn. Er rettet sich vor diesem Spotte, indem er sich in die Einsamkeit seines Innern flüchtet und sich dadurch über allen Spott der Mitwelt erhebt. Er wird denen überlegen, die ihn verspotten. Sie wissen nichts von seinem innersten Selbst. Er verbirgt ihnen das und spielt den Narren. Sie mögen ihn in dieser Maske verhöhnen. Sein eigenes Selbst aber wächst draußen in der Einsamkeit, wo die Palmen sind. Da liegt er zwischen den Bäumen des Waldes, nur sich lebend und seinen Plänen. Er pflegt seine Kräfte bis zu einer Stärke, die ihn später zum Retter seines Stammes macht. Die ihn früher verspottet haben, schrecken dann vor der Feindesmacht zurück, und er, der Ausgestoßene, überwindet diese. Der Willensstarke setzte die Maske des Narren nur auf, um unerkannt
#SE033-194
von den anderen sich züm Schmied seines Glückes machen zu können. Hinter der Narrenmaske reift die Persönlichkeit heran, die Rache nimmt für die Behandlung, die ihr und ihrer Mutter zuteil geworden ist, die Persönlichkeit, die sich durch Kühnheit und Kraft den Thron des Scheikhs und die Geliebte erobert.
Nicht wie «Werther» mit blutendem, dafür aber mit hochkiopfendem Herzen ist «Diyab» geschrieben. Er ist in der Zeit entstanden, in welcher Jacobowski sich erst völlig selbst fand. Eine innere Sicherheit bricht sich durch, die ihn vor Verstimmungen, wie sie nach dem geringen äußeren Erfolg seines «Werther» eintraten, bewahrt. - Man darf von dieser Zeit an eine neue Periode in Jacobowskis Streben ansetzen. Auch in seiner Lebensführung tritt eine Änderung ein. Es erfolgt die Loslösung von einem Freunde, einem Lyriker, der sogleich bei seinem Auftreten viel Erfolg hatte. Zweifellos hat Jacobowski dieser Freundschaft viel verdankt. Die Kritik, die allen seinen Leistungen von dieser Seite entgegengebracht worden ist, war ein fortwährender Ansporn zur Selbstzucht. Er gedachte immer nur in Dankbarkeit dieser Jugendfreundschaft Aber sie mußte aufhören, wenn Jacobowski sich vollends selbst finden wollte. Das Gefühl, daß er geistige Einsamkeit, völliges Angewiesensein auf sich selbst brauche, hat auf seiten Jacobowskis die Entfremdung von dem Freunde herbeigeführt.
Eine Art Abschluß seiner ersten Schaffensperiode bildet die Gedichtsammlung «Aus Tag und Traum» (Verlag S. Calvary, Berlin 1895). Ein treues Spiegelbild aller der Kämpfe seines dritten Lebensjahrzehntes sind die drei lyrischen Sammlungen Jacobowskis. Das Streben nach Schlichtheit, nach Volkstümlichkeit in der Kunstform ist ein Grundzug
#SE033-195
seiner Dichtungen. Ein echter Idealismus lebt sich in Stimmungsbildern aus, die Anschaulichkeit und Plastik suchen. Eine gewisse symbolische Vorstellüngsweise dringt vielfach durch. Vorgänge der eigenen Seele werden durch Ereignisse der Natur versinnlicht. Während in den ersten Jugendgedichten das Gedankliche noch überwiegt, tritt später eine volle Wirklichkeitsanschauung immer mehr in den Vordergrund. Zunächst ist es das eigene Innere, das den Dichter beschäftigt:
Aus des Tages Lust und Schmerzen
Webt das All ein Sdilummerlied,
Das in müde Menschenherzen,
Süßen Frieden bringend, zieht,
Wenn die Seele nimmer nahet
Sich der Wahrheit Götterbild
Nachtumhüllt.
Nachher ringt sich unser Dichter durch zur Gestaltung der Außenwelt. Er bringt die Natur zum Sprechen. Er personifiziert die Wirklichkeit. Er hält mit ihr Zwiesprache. Ineinander schlingen sich die Geheimnisse des Naturwirkens und die eigene Empfindungswelt. Aus solchem Ineinanderwirken stammen Dichtungen wie die zarten «Waldesträume» in «Aus Tag und Traum»:
Die Sonne breitet ihren Segen
Wie einen gold'nen Teppich aus.
Waldmeister duftet in den Wegen,
Und Rotdorn streut die Blüten aus.
Nur Sonnenglanz und Himmelsbläue
Durdiflirrt das kühle Blätterdach.
Der Wanderfalk mit hellem Schreie
Hält mich auf weichem Moose wach.
#SE033-196
Nun er verstummt ist in der Schwüle,
Träum' ich verschlafen vor mich hin
Und träume, daß im duft'gen Pfühle
Ich selber Halm und Blüte bin . . .
Tief gegründet in Jacobowskis Wesen war stets ein fester Glaube an die Harmonie des All, an eine Sonne in dem Ablauf jedes Menschenschicksals. Über manches Trübe in seinen persönlichen Geschicken hat ihm wohl nur dieser Glaube im Mittelpunkte seiner Seele hinweggeholfen. Er litt schwer an diesen persönlichen Erlebnissen, aber in seiner Lebensauffassung war etwas, was doch immer wieder wie Licht wirkte. Er hätte sich nicht so schätzen können, wie er es wollte, wenn er in sich nicht die Kraft gefühlt hätte, selbst Licht in sein Dunkel zu bringen. So stählt er denn diese Kraft, so arbeitet er unablässig an sich selbst. Und dieses Arbeiten gebiert ihm stets neue Hoffnungen, hebt ihn hinweg über Stimmungen, wie sich eine ausspricht in dem ergreifenden «Warum?» in «Aus Tag und Traum»:
. . . Als ich zum ersten Sommertag erwacht,
Da harrte draußen schon die finstre Nacht.
Sah ich zum goldenen Sonnenlicht empor,
Schob grau die Regenwolke sich davor;
Und streckt' ich jauchzend meine Kinderhand
Zum Rosenstrauch, der ganz in Blüten stand,
Da wehrten Dornen meinen Übermut,
Und aus der Freude rann das rote Blut . . .
Tief in des Dichters Seele weist der schwermütige Zyklus «Martha» in «Aus Tag und Traum». Er umschließt einen elegischen Grundton, der bis zu Jacobowskis Tode in seinem Herzen nachzitterte. Ein jäher Tod hatte ihm 1891 die Jugendgeliebte entrissen. Die Erinnerung an sie gehörte fortan
#SE033-197
zu den Vorstellungen, zu denen er immer wieder zurückkehrte. Die Abgeschiedene lebte in seinem Herzen auf die zarteste Weise fort. In Weihestunden trüber und freudiger Art war sie ihm wie eine Gegenwärtige. Es war eine fortwirkende Treue ganz eigener Art, die er ihr bewahrte. Wenn er von ihr sprach, veränderte sich seine Stimme. Man hatte das Gefühl, als ob er ihre Gegenwart spüre. Man war dann nicht mit ihm allein. Das machte alle Dichtungen, die sich auf die Jugendgeliebte beziehen, zu so innigen.
Seine Beschäftigung mit politischen Fragen hatte Jacobowski eine Stellung bei einem Blatte und in einer Vereinigung eingebracht, die materielle Sorgen in den letzten Jahren seines kurzen Lebens fernhielt. Die mit ihm zu tun hatten, konnten seinen Pflichteifer und seine Arbeitskraft innerhalb dieser Stellung immer nur rühmen. Wenn man bedenkt, daß die Beschäftigung in dieser Stellung ihn täglich wieder von neuem herausriß aus seinen literarischen Arbeiten, dann kann man nicht genug staunen über die Summe dessen, was er trotzdem auf literarischem Gebiete geleistet hat. Die Zahl der novellistischen Skizzen, die er geschrieben hat, ist eine große, und seine Betätigung als Kritiker war eine ausgebreitete. Charakteristisch für ihn ist die Stellung, die er seinen kürzeren novellistischen Arbeiten gegenüber einnahm. Er verfaßte solche Skizzen in größerer Zahl in der Mitte der neunziger Jahre. Er sah sie an als Arbeiten, an denen er seinen Stil als Erzähler heranbildete. In dem Augenblicke, wo er so weit war, daß er sich größere Arbeiten vornehmen durfte, verlor die Arbeit an solchen Skizzen für ihn ihren Reiz.
Als Kritiker zeichnet Jacobowski in hervorragendem Maße die Gabe aus, sich in fremde Leistungen ganz einzuleben,
#SE033-198
den Kern einer fremden Persönlichkeit aus deren Schöpfungen sofort herauszufühlen. Alles Doktrinäre liegt ihm als Kritiker fern. Seine Urteile entstammen stets einem frischen, ursprünglichen Gefühle. Man sieht es ihnen überall an, daß er mit ganzem Anteil bei der Sache ist, über die er spricht. Letzten Endes will er überhaupt nicht richten, sondern nur verstehen. Seine Freude ist nicht das Verdammen, sondern das Anerkennen. Man liest mit besonderem Genusse die Ausführungen, in denen er mit der ihm eigenen Wärme seine zustimmenden Urteile begründet. - Wer Jacobowskis Tätigkeit als Kritiker aufmerksam verfolgen wollte, würde sehen, wie dieser Mann das geistige Leben seiner Zeit intensiv mitlebte, wie er seine Interessenkreise nach allen Seiten zog.
In Jacobowskis Nachlaß hat sich eine Sammlung von Skizzen gefunden, deren Ausgabe in Buchform er 1898 vorbereitete. Sie sollten den Titel tragen: «Stumme Welt. Symbole». Die Sammlung ist bezeichnend für seine Vorstellungs-art und sein ganzes inneres Leben in dieser Zeit. Wenn man die Skizzen durchliest, hat man die Empfindung: Jacobowski war berufen zum Dichter der modernen naturalistischen Weltanschauung. Die neue Naturerkenntnis scheint zunächst etwas Unpoetisches, Nüchternes zu haben. Ihr Eindringen in die rein natürlichen Vorgänge, ihr Bekenntnis zur bloßen, ungeschminkten Wirklichkeit scheint die dichterische Phantasie zu verscheuchen. Jacobowskis «Stumme Welt» beweist das Gegenteil. Er hatte sich völlig in das naturwissenschaftliche Bekenntnis eingelebt. Er war durchdrungen von der Größe der Anschauung, die aus der Vertiefung in die ewigen, ehernen Gesetze des Alls hervorsprießt. Darwinismus und Entwickelungslehre waren ihm liebe Gedankenkreise.
#SE033-199
Es ist wahr, sie zerreißen den Schleier, der ehedem die Natur umhüllt hat. Aber was hinter diesem Schleier hervordringt, ist für den, der zu sehen vermag, nicht so bar der Poesie, wie urkonservativ gestimmte Menschen behaupten wollen. Die wunderbaren Gesetze des Stoffes und der Kräfte gebären poetische Vorstellungen, die an Großartigkeit nichts nachgeben den aus der Menschenseele in die Natur versetzten Bildern früherer Vorstellungswelten. Der moderne Mensch will die Natur nicht mehr auf menschliche Art sprechen lassen. Die ganze mythische Geisterwelt schweigt, wenn das an dem Naturalismus erzogene Ohr auf die Erscheinungen der Natur hinhorcht. Der ewige Kreislauf des Stoffes und der Kräfte scheint eine «stumme Welt» zu sein. Wer aber diese «stumme Welt» zum Sprechen zu bringen versteht, der kann ganz neue, herrliche Geheimnisse erlauschen, Mysterien der Natur, deren harmonische Musik übertönt würde von den einstigen lauten Stimmen anthropomorphistischer Weltanschauungen. Diese Musik der «stummen Welt» wollte Jacobowski in seiner Skizzensammlung zur Darstellung bringen.
Die neue Naturanschauung beruft sich mit Recht auf Goethe als den Stammvater ihrer Ideen. Und wer in Goethes naturwissenschaftliche Schriften sich vertieft, für den werden die Erscheinungen der Welt Buchstaben, aus denen er den Plan des Kosmos in einer neuen Weise lesen und verstehen lernt. Goethe wird von vielen viel zu oberflächlich gelesen. Jacobowski gehörte zu den wenigen, die Goethe gegenüber einen rechten Standort zu gewinnen suchen. Mit einer heiligen Scheu behandelte er alles, was sich auf Goethe bezieht. Er wußte, daß man wächst, wenn man sich den Glauben bewahrt, daß man an Goethe immer Neues lernen könne. Er
#SE033-200
vertiefte sich früh in die Naturanschauung Goethes. Aber noch in den letzten Tagen seines Lebens konnte man ihn sagen hören: jetzt fange ich an, Goethe zu verstehen. Er sah ein, wie Goethe Führer sein kann, wenn es sich darum handelt, die «stumme Welt» zum Sprechen zu bringen. Er hat das Bändchen dann nicht erscheinen lassen. Aus der Grund-vorstellung, die die Skizzen zusammenhält, erstanden neue Ansätze. Eine kosmische Dichtung sollte daraus erwachsen. Er wollte seinen Geist ausreifen lassen, um die scheinbar entgötterte Welt mit neuem Leben zu durchdringen, um neue Mysterien aus den kosmischen Vorgängen hervorzuzaubern. «Erde» sollte das Epos von dem geheimnisvoll-offenbaren Walten der ewigen Naturkräfte heißen. Es steht dem Herausgeber des Nachlasses nicht zu, ein Urteil über die als «Stumme Welt» (2. Band des Nachlasses) zu veröffentlichenden keimartigen Skizzen eines umfassenden Gedankens zu fällen. Nur die Absichten des Dichters mitzuteilen, betrachtete ich als meine Aufgabe.
Es scheint, daß Jacobowski zunächst seinen Dichterberuf in der Entwickelung seiner Phantasie nach der Richtung hin sah, die er in der «Stummen Welt» eingeschlagen hatte. Darin ist wohl auch der Grund zu suchen, warum er das Gebiet des Dramatischen, das er im «Diyab» so verheißungsvoll betreten hatte, vorläufig nicht als ein solches betrachtete, auf dem seine Eigenart voll zur Geltung kommen könne. Gewiß hat auch er wie andere daran gedacht, letzten Endes seine künstlerischen Absichten in dramatischen Gestalten ausleben zu lassen. Seine strenge Selbstkritik forderte von ihm aber Zurückhaltung auf jedem Gebiete bis zu dem Augenblicke, in dem er sich zu dem nach seinem Ideale Höchsten in der betreffenden Sphäre gewachsen fühlte. Er
#SE033-201
hat im Jahre 1896 ein Drama in vier Akten vollendet: «Heimkehr». Das spielt in der Zeit der Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges in Mitteldeutschland. Ein Zeit-gemälde im großen Stile ist beabsichtigt. Der Dichter hat nach der Beendigung des Werkes die verschiedensten Urteile von denen gehört, denen er es mitgeteilt hat. Von heller, rückhaltloser Begeisterung bis zum völligen Absprechen sind diese Urteile auseinandergegangen. Jacobowski ließ das Drama zunächst in seinem Pulte liegen. Er wartete ab, was er selbst in einem späteren Punkte seiner Entwickelung dazu sagen würde. In den Monaten vor seinem Tode wurde ihm das Werk wieder wert. Er hätte es wohl noch umgearbeitet. Da ihm das nicht mehr beschieden war, muß es in der ursprünglichen Gestalt einen Teil seines Nachlasses bilden. Man lernt den Dichter zu einer gewissen Zeit seines Lebens daraus kennen. Von diesem Gesichtspunkte wird man es beurteilen müssen.
Die Erzählungen «Anne-Marie, ein Berliner Idyll» (S. Schottländer, Breslau 1896) und «Der kluge Scheikh, ein Sittenbild» (S. Schottländer, Breslau 1897) gehören einer Übergangsstufe in der Entwickelung Jacobowskis an. Sie zeigen ihn in seinem Streben nach Plastik, nach Anschaulichkeit der Gestalten. Es ist, wenn man sie liest, als ob man die Resignation spürte, die er sich dabei auferlegt hat. Seine größeren Ideen lebten schon damals in seiner Seele. Um ihnen Gestalt zu geben, um sich bei ihnen nicht ins Schemen-hafte zu verlieren, mußte er seinem epischen Stile Saft und Kraft geben. Er tat es an mehr oder minder anspruchslosen Erzählungen.
Das Symbolisierende seiner Kunst tritt dann deutlich zutage in der Sammlung von Erzählungen «Satan lachte, und
#SE033-202
andere Geschichten» (Franz Wunder, Berlin 1897). Man braucht sich nur den Grundgedanken der ersten Erzählung, die dem Ganzen den Namen gegeben hat, vorzuhalten, und man vergegenwärtigt sich, was den Grundzug hier ausmacht. Gott hat dem Teufel die Herrschaft über die Erde genommen, indem er den Menschen geschaffen hat. Der Teufel sichert sich doch seinen Einfluß dadurch, daß er sich des Weibes bemächtigt. In wenigen charakteristischen Strichen werden die dämonischen Mächte des Geschlechtslebens symbolisch hingezeichnet.
Im Jahre 1899 trat nun der Dichter mit dem Kunstwerk auf, das ganz von diesem symbolisierenden Grundzug getragen ist, mit seinem «Roman eines Gottes: Loki» (J. C.C. Bruns' Verlag, Minden in Westf.). Man darf sagen, daß die verschiedenen Neigungen Jacobowskis bei der Schöpfung dieses Werkes wie Zweigflüsse zu einem großen Strome zusammenfließen. Sein Drang, die Volksphantasie zu belauschen und ihr leises Weben zu verstehen, führte ihn dazu, die äußere Handlung von den Gestalten und Vorgängen det germanischen Mythologie herzunehmen. Die Beobachtung des sozialen Lebens veranlaßte ihn, Loki, den «enterbten Gott», den Revolutionär der Götterwelt, in den Mittelpunkt zu stellen. Die Psychologie des Menschen, der sich nur durch die Kraft seines Innern, durch seinen starken Willen seine Geltung verschafft, und zwar gegen Widerwärtigkeiten von allen Seiten, legte Jacobowski die Loki-Figur besonders nahe. Werther und Diyab in einer Person, doch mehr Diyab ist Loki. Er ist dies, wie Jacobowski selbst Diyab sein wollte.
Kein wirklicher Vorgang, auch wenn er in idealistischer Kunstform gegeben wäre, hätte zum Ausdrucke bringen
#SE033-203
können, was der Dichter hat sagen wollen. Die ewigen Kämpfe der menschlichen Seele stehen ihm vor Augen. Die Kämpfe, die sich in den tiefsten Gründen des Gemütes abspielen. Ort und Zeit, alle begleitenden Erscheinungen sind hier fast gleichgültig. Die Handlung muß in eine höhere Sphäre gehoben werden. Mögen die einzelnen Ereignisse, die das Leben dem Menschen bringt, diesen oder jenen tragischen oder freudigen Ausgang nehmen: sie tragen alle das Geprage eines ewigen Kampfes. «Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das heißt vermutlich, der Mensch schuf Gott nach dem seinigen.» Dies ist ein berühmter Ausspruch Ludwig Feuerbachs. Man könnte ihn erweitern und sagen: Wenn der Mensch die tiefsten Vorgänge seines Innern darstellen will, dann muß er das Seelenleben in Götterleben umwandeln; die Urkämpfe in der Tiefe der Brust verkörpern sich zu Götterkämpfen. Weil Jacobowski solche Urkämpfe darstellen wollte, deshalb wurde sein Roman derjenige eines Gottes. Zwischen den zwei Seelen, die in jeder Brust wohnen, spielen sich diese Urkämpfe ab, zwischen der Seele, die Güte, Liebe, Geduld, Freundlichkeit und Schönheit aus sich entspringen läßt, und zwischen der anderen, von der Haß, Feindschaft, Jähzorn kommen. Balder und Loki stehen sich in unaufhörlichem Kriege in jedem Menschengemüte gegenüber. Hamerling hat den Gedanken, der schildert, was in ihm lebte, als er seinen «Ahasver» schrieb, so ausgesprochen: «Ubergreifend, überragend, geheimnisvoll spornend und treibend, die Krisen beschleunigend, als die Verkörperung des ausgleichenden allgemeinen Lebens hinter den strebenden und ringenden Individuen stehend so dachte ich mir die Gestalt des Ahasver». Daß er sich seinen «Loki» so «übergreifend», so «überragend», so «als die Verkörperung
#SE033-204
des ausgleichenden allgemeinen Lebens hinter den strebenden und ringenden Individuen stehend» gedacht hat, das hat Jacobowski in seinen Gesprächen oft betont.
Am offenbarsten werden des Dichters Absichten durch einen Zug in Lokis Wesen. Jacobowski hat im Gespräche immer versichert, daß man ihn erst voll verstehe, wenn man diesen Zug im Wesen seines Götterhelden zu deuten wisse. Loki, der fern von Walhall geborene Gott, das Kind der Göttersünde, das unter Schmerzen und Entbehrungen heran-wächst, das nicht seine Mutter und auch nicht seinen Vater kennt: er hat vor allen anderen Göttern etwas voraus. Ihnen eignet Glück und ewige Freude. Ihm Schmerz und Qual. Er aber hat vor ihnen die Gabe der Weisheit voraus. Er kennt die Zukunft der anderen Götter, die ihnen selbst verborgen ist. Sie leben, aber sie kümmern sich nicht um die Triebkräfte, von denen ihr Leben abhängt. Sie wissen nicht, wohin sie diese Triebkräfte steuern. Nicht das Glück öffnet das geistige Auge, nicht die Freude macht hellsehend, sondern der Schmerz. Deshalb sieht Loki in die Zukunft. Aber eines weiß Loki nicht. Er muß Balder, den Gott der Liebe, hassen. Davon kennt er nicht den Grund. Denn darin ist sein eigenes Schicksal eingeschlossen. Das bleibt auch ihm verborgen. Hier liegt der Zug, an dem die geheimsten Absichten Jacobowskis offenbar werden. Vor der Frage: warum muß der wissende Loki den unwissenden, aber liebeerfüllten Balder hassen, vor ihr endet Lokis Weisheit. Damit ist aber auf das Schicksal des Wissens hingedeutet. Es ist sich selbst das größte Rätsel.
Nicht eine Inhaltsangabe oder gar ein Urteil soll hier über «Loki» gegeben werden. Lediglich des Dichters Absichten sollen erzählt werden, wie er sie im Gespräch über das ihm
#SE033-205
so sehr liebe Werk gern mitgeteilt hat. Er fühlte, daß er mit dem «Loki» auf seinem Entwickelungswege einen gewaltigen Ruck vorwärts gemacht hatte. Er hatte sich zu dem Glauben durchgerungen, daß die bejahenden Kräfte in seinem Innern siegen werden. Klarheit über alles Verneinende im Menschenschicksal war es vor allen Dingen, was er gesucht hat, und was er durch seine «Loki »-Dichtung bei sich selbst erreicht hatte. Schönheit, Güte, Liebe sind das Vollkommene in der Welt. Aber das Vollkommene bedarf der zerstörenden Kräfte, wenn es selbst seine volle Aufgabe erfüllen will. Loki ist der ewige Vernichter, der notwendig ist, damit die guten Elemente sich erneuern, der Dämon des Unglücks, den das Glück braucht, der böse Geist des Hasses, von dem die Liebe sich abhebt. Der Schöpfer, der nie seiner Schöpfungen Früchte genießen darf, der Haß, der aller Liebe den Boden schafft: das ist Loki. - Der Mensch, der die Wahrheit sucht, findet auf dem Grunde seiner Seele die zerstörende Triebe des Lebens. Die dämonischen Loki-Gewalten bedrängen ihn. Sie trüben ihm die leuchtenden Tage des Lebens, die Augenblicke des Glücks. Aber man versteht, man empfindet die leuchtenden Tage nur in ihrer rechten Kraft, wenn sie sich abheben von der Loki-Stimmung. Mit solchen Gefühlen im Hintergrunde hat Jacobowski seine Gedichte aus den Jahren 1896 bis 1898 unter dem Titel «Leuchtende Tage» (J. C.C. Bruns' Verlag, Minden in Westf. 1900) vereinigt. Es wohnt ihnen eine Leuchtkraft inne, die zwar aus dunklem Grunde erwächst, die aber gerade darum ein um so besseres Leben schafft.
Daß er mit «Loki» und den «Leuchtenden Tagen» vor die Mitwelt treten konnte, rief in Jacobowski eine innere Umwandlung hervor. Jetzt hatte er erst das Gefühl, daß er
#SE033-206
sich selbst zustimmend verhalten dürfe zu seinen Leistungen. Er hatte zu sich nunmehr das Vertrauen, daß sich die strenge Selbstkritik mit den eigenen Schöpfungen in einigem Einklang befinde. Eine innere Ausgeglichenheit kam über ihn. Die Zukunft wurde ihm immer sonniger. Er hatte sich gefunden und seinen Glauben, daß «unsere Sterne» erlösen. Wenn man die Bilder des Dichters aus den aufeinanderfolgenden Lebensabschnitten ansieht, so merkt man den Ausdruck der inneren Wandlung auch an den Gesichtszügen. Ein Zug von Sicherheit, von Harmonie tritt immer mehr auf. Jacobowski hatte eben erst so manchen Strauß mit dem Leben auszufechten, bevor er sich so recht mit ihm versöhnte.
Die Sicherheit, die Geschlossenheit des Charakters hat bei ihm zugleich den Tätigkeitsdrang angeeifert. Er war ein Mann, der sich nur im Wirken glücklich wußte. Das Beschauliche, die einsame, sinnende Betrachtung sparte er sich doch nur für die Feieraugenblicke des Lebens. Seinen «Loki» hat er in wenigen Wochen, im Jahre 1898, in Tirol geschrieben, da er losgetrennt war von den Zusammenhängen, in die ihn das Leben stellte. Seine Dichtungen entstanden nur, wenn ihn sein Inneres hinweghob über die Wirklichkeit. Innerhalb dieser Wirklichkeit selbst drängte es ihn aber, nach Kräften am geistigen Leben seiner Zeit mitzuarbeiten. Diesem Drang ist seine Tätigkeit am «Zeitgenossen» entsprungen, den er 1891 mit Richard Zoozmann zusammen herausgab und dem allerdings nur ein kurzes Dasein beschieden war. Ein Feld fand er für diesen Drang, als er 1897 die «Gesellschaft» übernehmen konnte, die Zeitschrift, welche seit der Mitte der achtziger Jahre den Geistern gedient hatte, die nach einer neuen Zeit des literarischen
#SE033-207
Lebens sich sehnten. Jacobowskis Bedürfnis nach einer allseitigen Pflege der geistigen Interessen gab den Jahrgängen, die unter seiner Redaktion erschienen, das Gepräge. Er wollte mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln ehrlich dem wahren Kulturfortschritt dienen. Nichts wurde ausgeschlossen, was zu diesem Ziele beitragen konnte. Es ist natürlich, daß eine ausgeprägte Individualität, wie es Jacobowski eine war, einer von ihr redigierten Zeitschrift auch einen stark persönlichen Zug geben mußte. Aber er kannte zugleich die Pflicht des Redakteurs, persönliche Neigungen entsprechend in den Hintergrund treten zu lassen. Und er kannte vor allem die Pflicht, jungen Talenten den Weg in die Öffentlichkeit zu bahnen. Er hatte den Mut, auch das zu bewerten, was noch nicht anerkannt war. Er war in solcher Bewertung und Anerkennung selbstlos und von großer Sicherheit des Urteils. In seinem Entgegenkommen gegenüber jedem berechtigten Streben war er einzig. So viele auch seinen Rat, seine Beihilfe suchten: alle fanden ihn hilfsbereit. Er hat unsagbar vieles ganz im stillen gewirkt. Und er wußte alles mit Vornehmheit zu tun. - An kleinen Zügen lernte man ihn in der ganzen Güte seines Wesens kennen.
Ein solch kleiner Zug sei hier verzeichnet. Er war kurze Zeit Vorsitzender der «Neuen Freien Volksbühne». Es war bei einem Sommerausflug der Mitglieder dieses Vereins. Jacobowski leitete die Spiele, die im Freien veranstaltet wurden. Es war herzerhebend zuzusehen, wie er da mit den Kindern tollte, sprang, wie er sich am Wettlauf beteiligte und wie er sogar als der erste am Ziel anlangte, trotzdem offenbar ganz gute Läufer mittaten. Und wie er dann den rechten Weg fand, die kleinen Preise an die Kinder zu verteilen.
#SE033-208
Innige Befriedigung fand Jacobowski durch ein Unternehmen, das er 1899 mit seinen «Neuen Liedern der besten neueren Dichter fürs Volk» ins Leben rief. In einem Heftchen für zehn Pfennige bot er eine Auswahl der besten Schöpfungen der gegenwärtigen Lyrik. Von allen Seiten vernahm er bald den Beweis für die Nützlichkeit seines Unternehmens. Das kleine Heftchen fand überall Eingang. Mit Freuden erzählte er stets, wieviel Glück er mit dieser Sache habe. Er sammelte sorgfältig alles, was er über die Wirkung hörte. Er wollte über das Interesse, das in den weitesten Kreisen des Volkes für wahre Dichtung herrscht, eine Broschüre auf Grund seiner Erfahrungen schreiben. Denn bei alledem hatte er eine große Perspektive. Er wollte dem Ungeschmack, der Roheit und Verwilderung des Volkes steuern. Der blöde Gassenhauer, die dumme Zote sollten durch wahre Poesie ersetzt werden. Er sagte wiederholt: «Ich habe den Versuch gemacht. Ich hätte vor der Öffentlichkeit rückhaltlos das Geständnis abgelegt, daß der erste Schritt mißlungen sei, wenn das der Fall gewesen wäre.» Aber er durfte diesen ersten Schritt als einen durchaus gelungenen bezeichnen. Dem gleichen Ziele sollten dann die fortlaufenden Heftchen dienen, die er unter dem Titel «Deutsche Dichter in Auswahl fürs Volk», ebenfalls zu zehn Pfennig (in Kitzlers Verlag, Berlin) herauszugeben begonnen hatte. Zwei Hefte, «Goethe» und «Heine», sind vor längerer Zeit erschienen, das dritte, «Grimms Märchen», lag bei seinem Tode fertig vor und konnte wenige Wochen nach seinem Heimgange erscheinen. Unermüdlich war er, nach jeder Richtung hin, den Gedanken, der sich in diesen Veröffentlichungen auslebte, fruchtbar zu machen. Er gedachte auch eine Sammlung von Dichtungen für die Armee herauszugeben.
#SE033-209
In einem interessanten Aufsatze, den er in der «Nation» veröffentlichte, hat er sich über die gegenwärtige Art der Dichtungen und Gesänge, die im Soldatenleben herrschend sind, ausgesprochen. In solchen Plänen, die im idealen Sinne gemeinnützigen Zielen dienten, eignete ihm eine bewundernswerte Kraft und eine glückliche Handhabung.
Im Zusammenhange mit seinen volkstümlichen Studien und seinen Bestrebungen für die Förderung der Volkskultur steht auch die Veröffentlichung seiner Sammlung «Aus deutscher Seele. Ein Buch Volkslieder» im Jahre 1899 (J. C.C. Bruns' Verlag, Minden in Westf.). Er wollte die in zahlreichen Büchern in Bibliotheken aufgestapelten volkspoetischen Schätze dem Leben zuführen. Er sagt von diesen Schätzen in seinem Geleitwort: «Ihr Inhalt, da er ungenügend verbreitet wird, macht den platten Gassenhauern der Großstädte und den elenden Sentimentalitäten dummer Operetten Platz. Da schien es mir an der Zeit, soweit die Kraft eines Einzelnen und das Verständnis meines dichterischen Vermögens reichen, eine Sammlung herauszugeben, die, nach ästhetischen Gesichtspunkten geordnet, aus dem Wust und Wirrwarr des angehäuften Liederberges einen Teil des wirklich Wertvollen und Herrlichen von neuem dem deutschen Volke darbietet.» - «Aus deutscher Seele» durfte Jacobowski bezeichnen als «das Ergebnis dieser Erwägungen und die Frucht vieljähriger, innigster Beschäftigung mit den Wundern der deutschen Volksseele und Volkspoesie».
Dem Gedanken, wichtige «Fragen der Gegenwart und hervorragende Erscheinungen moderner Kultur» weiteren Kreisen in ihnen sympathischer Form zugänglich zu machen,
#SE033-210
entstammt Jacobowskis Plan, eine Sammlung von kleinen Schriften - in Heften von 32 bis 80 Seiten - in zwangloser Folge zu veröffentlichen. Unter dem Titel «Freie Warte, Sammlung moderner Flugschriften» sind 1900 drei solcher Hefte erschienen (J. C. C. Bruns' Verlag, Minden in Westf.). Es sind: «Haeckel und seine Gegner» (von Dr. Rudolf Steiner), «Sittlichkeit!?!» (von Dr. Matthieu Schwann), «Die Zukunft Englands, eine kulturpolitische Studie» (von Leo Frobenius). Diese und die Titel der Schriften, die in nächster Zeit erscheinen sollten, zeugen davon, wie umfassend sich Jacobowski die Aufgabe dachte, die er sich damit gestellt hatte. Es waren noch angekündigt: «Das moderne Lied», «Die Erziehung der Jugend zur Freude», «Schiller contra Nietzsche», «Hat das deutsche Volk eine Literatur?», «Der Ursprung der Moral». Die Schrift «Hat das deutsche Volk eine Literatur?» sollte von Jacobowski selbst herrühren. Er wollte sich darin über die Erfahrungen aussprechen, die zu seinen Volksheften und ähnlichen Bestrebungen geführt haben, und auch über die Ergebnisse solcher Unternehmungen.
Ein weiteres Glied in Jacobowskis Streben, seiner Zeit zu dienen, war die Herausgabe einer «Anthologie romantischer Lyrik» unter dem Titel «Die blaue Blume». Mit Friedrich von Oppeln-Bronikowski zusammen gab er 1900 diese Sammlung mit romantischen Dichtungen aus der Zeit vom Ende des achtzehnten bis zum ausgehenden neunzehnten Jahrhundert heraus. Der über 400 Seiten starke Band beginnt mit Schöpfungen Herders und endet mit einer solchen des Prinzen zu Schönaich-Carolath. Jacobowski hat einen Aufsatz «Zur Psychologie der romantischen Lyrik» der von Fr. von Oppeln - Bronikowski gearbeiteten «Einleitung»
#SE033-211
hinzugefügt. Er glaubte, dem Drange der Zeit, aus dem Naturalismus zu einer Art Neuromantik zu kommen, den besten Dienst durch Sammlung der Perlen romantischer Kunst zu leisten.
Die Eigenschaften Jacobowskis, durch die er unmittelbar von Mensch zu Mensch wirkte, die Anregungen, die so von ihm ausgehen konnten, kamen zur Geltung in einer literarischen Gesellschaft, die er in der letzten Zeit seines Lebens mit einigen Freunden gegründet hatte. Jeden Donnerstag versammelte er im «Nollendorf-Kasino» in der Kleiststraße einen künstlerisch und literarisch angeregten Kreis unter dem Namen «Die Kommenden» um sich. Jüngere Dichter fanden hier Gelegenheit, ihre Schöpfungen vorzubringen, wichtige Fragen der Kunst oder Erkenntnis wurden in Vorträgen und Diskussionen behandelt. Künstler aller Art besuchten die Gesellschaft, die sich hier allwöchentlich zwanglos zusammenfand, und Ludwig Jacobowski war unablässig bemüht, immer Neues zu ersinnen, um den Gästen die paar Abendstunden sympathisch zu machen, die sie hier zubrachten. Er hatte auch den Plan gefaßt, mit den Darbietungen dieser Abende Hefte in künstlerischer Ausstattung zusammenzustellen. Das erste war in Arbeit, als er starb. Es wurde von seinen Freunden nach seinem Tode fertiggestellt und mit Beiträgen aus seinem Nachlaß zu seinem Gedächtnis herausgegeben. Die «Kommenden», die sich noch immer allwöchentlich versammeln, pflegen treu das Andenken an ihren Begründer.
Eine äußere Veranlassung führte Jacobowski Ende 1899 dazu, ein kleines soziales Drama in einem Akte, «Arbeit», zu schreiben. Axel Delmar hatte den Plan gefaßt, in einem Jahrhundertfestspiel, das fünf Einakter umfaßte und am
#SE033-212
«Berliner Theater» aufgeführt wurde, die wichtigeren Wendepunkte in der Entwickelung Deutschlands dramatisch darzustellen. Wichert, Ompteda, G. Engel, Lauff und Jacobowski waren die fünf Dichter. Dem letzteren fiel die Aufgabe zu, das soziale Denken und Fühlen der Gegenwart, die wichtigsten Kulturerscheinungen am Jahrhundertende zu dramatisieren. Man tut der «Arbeit» unrecht, wenn man ihr eine Tendenz unterschiebt und sie darnach beurteilt. Es sollte lediglich zur Anschauung gebracht werden, wie die sozialen Strömungen sich in verschiedenen Ständen und Menschen spiegeln.
In den letzten Monaten seines Lebens hat ein schmerzliches Erlebnis, das Jacobowski in den tiefsten Tiefen seines Gemütes erschüttert hat, seinen poetischen Ausdruck in einem einaktigen Versdrama «Glück» gefunden (J. C.C. Bruns' Verlag, Minden in Westf. 1901). Über dieses Erlebnis zu sprechen wird erst in einer späteren Zeit möglich sein. Die Stimmung, aus der heraus das Drama geschrieben ist, hat er selbst in den «Zum Eingang» vorangestellten Versen angedeutet:
Es war wie Sterben, als ich's lebte!
Es war mir Tröstung, als ich's schrieb!
Wer je in gleicher Bängnis bebte,
Der nehm' es hin und hab' es lieb!
Der gleichen Stimmung entstammen manche von den Gedichten, die dieser Nachlaß bringt. «Glück» in dramatischer Form hat sich wie von selbst dem Dichter aus den lyrischen Gedichten zusammengefügt, in denen er die Momente eines tragischen Erlebnisses niedergelegt hat. Diese lyrischen Gedichte aus der letzten Zeit, vereinigt mit allem, was er seit dem Erscheinen seiner «Leuchtenden Tage» an Lyrik hervorgebracht
#SE033-213
hat, erscheinen hier als Nachlaß. In bezug auf die Zusammenstellung der Gedichte wurden die Gesichtspunkte festgehalten, die der Dichter selbst bei seinen «Leuchtenden Tagen» beobachtet hat. Man findet daher die gleichen Überschriften der einzelnen Teile des Gedichtbandes wie in den «Leuchtenden Tagen». Das scharfe Gepräge, das Jacobowskis Seelenleben in den letzten Jahren angenommen hat, machte diese Abteilung wünschenswert. Ein zweiter Band wird alle von ihm selbst noch zu einem Bücheichen «Stumme Welt» vereinigten Skizzen bringen. Er hat es nicht selbständig erscheinen lassen, weil er den Plan in größerer Art später ausgestalten und unter dem Titel «Erde» die Ideen, die der «StummenWelt» zugrunde lagen, zu einer kosmischen Dichtung großen Stils verarbeiten wollte. Er hielt ein tiefes Einleben in die Naturerkenntnis der neuen Zeit für sich für notwendig, bevor er an die große Arbeit gehen konnte. Eine tiefe innere Gewissenhaftigkeit und Scheu hielt ihn vorläufig davon ab, die fruchtbare Idee zu frühzeitig in Angriff zu nehmen. Es ist ihm nicht beschieden gewesen, das Vorhaben, das wahrscheinlich erst gezeigt hätte, was Jacobowskis tiefstes Innere barg, auszuführen. Ein dritter Band soll das oben erwähnte Drama «Heimkehr» bringen. Eine Reihe von «Einfällen», die für Jacobowskis Denken und für seine Persönlichkeit charakteristisch sind, werden dem zweiten Bande als «Anhang» hinzugefügt. So gering ihre Zahl ist: sie zeigen deutlich ebenso die Tiefe seiner Lebensauffassung und den Humor, wie auch die Leichtigkeit des Urteils, die ihm gewissen Dingen gegenüber eigen waren. Sie beweisen, daß er zu den Menschen gehörte, die wissen, daß nicht alles mit demselben, sondern verschiedenes mit verschiedenen Maßen gemessen werden muß.
FRIEDRICH SCHILLER
#G033-1967-SE214 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
FRIEDRICH SCHILLER
EINFÜHRUNG ZU «SCHILLER», AUSWAHL AUS SEINEN WERKEN
#TX
Das Leben schafft Mühen und Sorgen; es fordert Pflichten und Arbeiten. Es beschert uns aber auch Freuden und schöne Stunden. Zu den größten Freuden gehören die, welche uns denkende und dichtende große Menschen durch ihre Werke gewähren; zu den schönsten Stunden müssen wir diejenigen rechnen, in welchen wir uns durch solche Werke geistige Nahrung verschaffen. Wir stärken uns durch diese Werke für den Lebenskampf. Sowenig unser Leib ohne körperliche Nahrung sein kann, ebensowenig kann unsere Seele ohne geistige Speise sein. Ein Mensch, der sich um die Werke der Dichter und Denker nicht kümmert, kann nur einen rohen und armseligen Geist haben. Er wird aber oft ein viel härteres Los haben als derjenige, welcher die geistigen Schöpfungen kennt. Denn über manche traurige Stunde kann ihm eine Dichtung hinweghelfen; manchen Trost kann uns geben, was ein bedeutender Mensch gesagt hat. Ohne daß wir es merken, wird unser Charakter veredelt, wenn wir die Schöpfungen der Dichter in uns aufnehmen.
Friedrich Schiller ist ein Dichter, von dem jedes Wort uns tief ins Herz dringen muß. Denn es ist alles aus dem tiefsten Herzen heraus gesprochen, was er uns geschenkt hat. Je mehr man ihn kennenlernt, desto mehr wird man nicht nur seinen hohen Geist bewundern, sondern seine edle Seele lieben und sich durch Betrachten seines herrlichen Charakters stärken. Er hat ein schweres Leben gehabt und das Leiden kennengelernt. In einem schwächlichen Körper wohnte
#SE033-215
ein starker Geist, der nur auf Erhabenes und Ideales gerichtet war. Er ist am 10. November 1759 in dem württembergischen Städtchen Marbach geboren. Sein Vater war erst Wundarzt, dann Aufseher der Gärten und Baumpfianzungen auf dem Lustschloß Solitude. Seine Mutter, die Tochter eines Gastwirtes, war eine fromme Frau, eine echte Freundin der Dichtkunst. Diese Neigung hat sie auch in den Sohn gepflanzt. Der Vater gab dem Knaben den ersten Unterricht. Später wurde der Pastor Moser im Dorf Friedrich Schillers Lehrer. Den weiteren Unterricht erhielt dieser auf der lateinischen Schule in Ludwigsburg. Sein Hang zu edler geistiger Tätigkeit zeigte sich schon in frühester Jugend. Die Psalmen und die Lehren der Propheten, geistliche Lieder und Dichtungen regten seinen auf alles Ernste gerichteten Geist an. Er wäre am liebsten Geistlicher geworden.
Auf Veranlassung des Herzogs Karl Eugen von Württemberg (1728-1793) wurde er aber in die Reihe der Zöglinge in der Karls-Schule aufgenommen, die zuerst auf dem Lustschlosse Solitude, dann in Stuttgart war. Er war in dieser Anstalt vom Jahre 1773 bis 1780. Zuerst sollte er Rechtswissenschaft studieren. Später vertauschte er diese Wissenschaft mit der Medizin. Er gebrauchte alle Zeit, die ihm die strenge militärische Zucht der Schule ließ, dazu, um sich in ernste Werke der Dichtkunst zu vertiefen. Schon da-mals faßte er den Entschluß, selbst eine ernste Dichtung zu schaffen, deren Held Moses sein sollte. Bald aber begeisterte ihn ein anderer Gegenstand. Noch auf der Schule dichtete er an seinem Schauspiel «Die Räuber», das er dann, nachdem er Regimentsarzt in Stuttgart geworden war, vollendete.
Der Herzog Karl Eugen sah mit Unzufriedenheit, daß sein Militärarzt sich in solcher Weise beschäftigte. Er verbot
#SE033-216
diesem, etwas anderes als Medizinisches drucken zu lassen. Das nötigte Schiller, sein Amt und seine Heimat zu verlassen und sich aus eigener Kraft eine Stellung in der Welt zu schaffen. Er floh mit seinem Freunde, dem Musiker Streicher, am 22. September 1782 nach Mannheim, wo seine «Räuber» bereits aufgeführt worden waren und den größten Beifall gefunden hatten. Doch konnte er hier keine Gönner finden. Dafür gewährte ihm eine hochsinnige Frau, Henriette von Wolzogen, auf ihrem Landgute Bauerbach in der Nähe von Meiningen eine Zufluchtsstätte. Hier konnte er in Ruhe an sein zweites Drama «Die Verschwörung des Fiesko in Genua» gehen, das 1783 erschienen ist. Auch sein drittes Drama «Kabale und Liebe» konnte er hier vollenden und im Jahre 1784 erscheinen lassen. Der Kampf gegen die Unmoral seiner Zeit und die Begeisterung für die Freiheit, die aus diesen Werken sprechen, eroberten dem Dichter die Herzen seiner Zeitgenossen. Ebenso riß er diese hin durch seine von dem edelsten Schwunge getragenen Gedichte, die in seiner «Anthologie» erschienen. Freiherr von Dalberg, der Leiter des Theaters in Mannheim, der früher nicht gewagt hatte, dem Dichter in Mannheim eine Stellung zu gewähren, weil er den Zorn des Herzogs von Württemberg fürchtete, machte jetzt Schiller zum Theater-Dichter. Dieser gründete eine Zeitschrift, die «Rheinische Thalia». Der Ernst, mit dem er die Stellung der Schauspielkunst auffaßte, kam gleich in dem ersten Aufsatz zum Vorschein, in dem er «Die Schaubühne als moralische Anstalt» beschrieb. Ein großes geschichtliches Schauspiel «Don Carlos» war seine nächste dichterische Arbeit. Der ganze Drang nach politischer Freiheit, der die besten Geister der damaligen Zeit beseelte, kam in diesem Werk zum Ausdruck. Der Dichter
#SE033-217
konnte den Anfang im Jahre 1784 dem Herzog Karl August von Weimar, dem Freunde Goethes, vorlesen, in dem er später einen Gönner finden sollte.
Im April 1785 luden zwei junge Verehrer Schillers in Leipzig, Huber und Körner (der Vater des Freiheitssängers und Freiheitsdichters Theodor Körner), den Dichter zu sich ein. Dieser folgte dem Rufe und brachte die nächste Zeit in Gohlis bei Huber zu, um dann zu Körner zu gehen, der mittlerweile nach Dresden übergesiedelt war. Schiller konnte sich nun in völliger Ungestörtheit seinen Arbeiten hingeben. Auf Körners Besitztum in Loschwitz bei Dresden vollendete er den «Don Carlos». Er blieb bis zum Sommer 1787. Hierauf verweilte er einige Monate in Weimar und begab sich dann nach Volkstedt bei Rudolstadt, um in der Nähe der dort wohnenden Familie Lengefeld zu sein, mit der er sich auf einer Reise in Rudolstadt innig befreundet hatte. Am 9. September 1788 sah Schiller im Lengefeldschen Hause zum erstenmal Goethe. Sie konnten sich damals noch nicht miteinander befreunden. Doch sagte sich Goethe, daß für Schiller etwas getan werden müsse, um ihm zu einer äußeren Stellung zu verhelfen. Daß Schiller bald darauf eine Professur für Geschichte an der Universität Jena erhielt, war Goethes Werk. In dieser Zeit trat eine Pause in Schillers poetischem Schaffen ein. Er vertiefte sich in die Geschichte und in die Philosophie. Schon früher, in Dresden, hatte er ein glänzendes geschichtliches Werk angefangen, die «Geschichte des Abfalls der Niederlande». Es war schon in Weimar fertiggeworden und schilderte den großen Freiheitskampf der Niederländer im sechzehnten Jahrhundert. Nach Übernahme seines Lehramtes schrieb er die «Geschichte des Dreißigjährigen Krieges», indem er den furchtbaren Glaubenskrieg
#SE033-218
darstellte, der über Deutschland vom Jahre 1618 bis 1648 seine verheerenden Wirkungen ausgebreitet hatte, Eine Frucht seiner philosophischen Studien sind die herrlichen «Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen», in denen er die Erziehung des Menschen durch die Kunst zur Anschauung brachte. Das letztere Werk hat er als Dank für den Erbprinzen Christian Friedrich von Holstein-Augusten-burg geschrieben, der ihm im Verein mit dem dänischen Minister Graf Schimmelmann ein Jahresgehalt von 1000 Talern für drei Jahre zum Geschenk machte, als er hörte, daß Schiller in bedrängter Lage sei. Wegen seiner schwächlichen Gesundheit konnte Schiller sein Lehramt nur kurze Zeit ausüben. Es bot ihm auch, trotz ungeheurer Arbeit, die es ihm auferlegte, nur das kärgliche Honorar von 200 Talern. Er widmete bald wieder seine ganze Zeit der Tätigkeit als Schriftsteller.
Die Gründung einer neuen Zeitschrift «Die Horen», an welcher die besten Geister der Zeit mitarbeiten sollten, brachte Schiller mit Goethe zusammen. Die beiden größten Dichter des deutschen Volkes schlossen bald einen innigen Freundschaftsbund, der bis zu Schillers frühem Tode dauerte. In der schönsten Weise arbeiteten die beiden jetzt Hand in Hand. Sie gaben sich Ratschläge für ihre Werke, ermunterten sich und förderten sich in jeder Art. Schillers prächtige Gedichte «Die Bürgschaft», «Das Lied von der Glocke», «Der Taucher», «Der Graf von Habsburg», «Die Kraniche des Ibykus», «Der Alpenjäger», «Der Ring des Polykrates» und viele andere sind in dieser Zeit entstanden. Durch Goethes Einfluß wurde Schiller auch wieder angeregt, zu dem Gebiete der Dichtung zurückzukehren, in welchem er gleich von Anfang an seine Zeitgenossen begeistert hatte,
#SE033-219
zum Drama. Der große Feldherr, der im Dreißigjährigen Kriege eine so bedeutende Rolle spielte, hatte ihn schon im höchsten Grade angezogen, als er die Geschichte dieses Krieges schrieb. Ihn machte er deshalb zum Helden eines Dramas «Wallenstein». Nach Vollendung dieses Werkes übersiedelte Schiller nach Weimar. «Maria Stuart», «Die Jungfrau von Orleans», «Die Braut von Messina», «Wilhelm Tell» entstanden rasch hintereinander. Sein letztes Trauerspiel «Demetrius» war unvollendet, als am 9. Mai 1805 ein früher Tod den schwachen Körper dahinraffte.
Mit seinen Dichtungen und Dramen hat Schiller seinem Volke ein teures Gut hinterlassen. Wenige Dichter können mit ihm verglichen werden in bezug auf das Schwungvolle der Sprache. Und was bei allen seinen Werken tief in die Seele dringt, das ist sein Hochhalten der Ideale. Immer ist sein Blick auf die höchsten Güter der Menschheit gerichtet. Er ist als Mensch ebenso groß wie als Dichter. Sein Familienleben war ein musterhaftes. Im Jahre 1790 heiratete er Charlotte von Lengefeld. Er fand in dieser Ehe alles, was sein hoher Geist begehrte. Wenn man liest, was Charlotte Schiller nach dem Tode des Gatten über diesen geschrieben hat, dann bewundert man den Bund, der hier zwei Seelen verband, von der eine jede einzig in ihrer Art war.
Schiller war sich selbst der strengste Richter. Was uns an seinen Dichtungen entzückt, ist durch harte Mühen von ihm errungen worden, und er arbeitete immerfort an sich selbst. Er hatte über seinen «Don Carlos» eine Reihe von Aufsätzen «Briefe über Don Carlos» geschrieben, in denen er die Fehler dieser Dichtung in der schonungslosesten Weise auf-deckte. Sein unablässiges Bestreben war, mit jedem Werke einen höheren Grad von Vollkommenheit als Dichter zu
#SE033-220
erreichen. In seinen Dramen zeigt er sich als Meister in der Darstellung der menschlichen Charaktere: menschliche Schlechtigkeit und menschliche Güte schildert er in gleich anschaulicher Art. Er war deshalb der geborene Theaterdichter im höchsten Sinne des Wortes. Wie einen Tempel betrachtete er das Theater, in dem der Zuschauer nicht bloß unterhalten, sondern erbaut werden soll. Er fühlte sich als Priester der Kunst, dem das Schaffen etwas Heiliges war. Das fühlen wir, wenn wir als Zuschauer im Theater sitzen und seine Gestalten vor uns erscheinen. Goethe konnte dem Freunde kein schöneres Denkmal setzen als den «Epilog zu Schillers Glocke», den er nach dessen Tod dichtete, und in dem er von ihm sagt: «Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine, lag, was uns alle bändigt, das Gemeine».
#TI
EINLEITUNG ZU «MARIA STUART»
#TX
Das erste große Werk, das Schiller nach seiner Übersiedlung nach Weimar vollendete, ist das Trauerspiel «Maria Stuart». Er studierte damals englische und schottische Geschichtswerke, um sich mit dem Leben der schottischen Königin bekannt zu machen, deren Geschick ihn im höchsten Grade fesselte. Sie ist im Jahre 1542 als die Tochter Jacob des Fünften geboren, der noch in demselben Jahre starb. Während die Mutter die Regentschaft führte, wurde Maria in Frankreich erzogen und mit dem Thronfolger Frankreichs, der später als Franz II. König wurde, vermählt. Nachdem ihre Mutter und auch ihr Gemahl gestorben waren, ging sie im Jahre 1561 nach Schottland zurück, um die Regierung anzutreten. Sie verheiratete sich mit ihrem Vetter Darnley,
#SE033-221
der sie mißhandelte und der sogar ihren Geheimschreiber Rizzio, welcher das Vertrauen Marias genoß, tötete. In ihr setzte sich die tiefste Abneigung gegen Darnley fest. Das gab die Veranlassung, daß man sie der Mitwissenschaft beschuldigte, als Darnley ermordet wurde. Dieser Verdacht schien begründet, weil sie den Grafen Bothwell, den man für Darnleys Mörder hielt, hinterher heiratete. Immer mehr steigerte sich der Haß der Schotten gegen ihre Königin, die sich auch dadurch noch besonders mißliebig machte, daß sie streng im Sinne des Katholizismus regierte. Sie mußte der Krone entsagen und nach England fliehen. Dort herrschte die Königin Elisabeth. Diese haßte Maria, weil diese nach gewissen Rechtsverhältnissen viel eher den Thron von England hätte beanspruchen können als Elisabeth selbst. Wie Elisabeth ihre Gegnerin als Gefangene in dem Schloß Fotheringhay behandeln läßt, damit beginnt Schillers Trauerspiel.
Maria wird, trotzdem sie behauptet, als Königin nur von ihresgleichen gerichtet werden zu können, vor einen englischen Gerichtshof gestellt und beschuldigt, nach der Krone Englands gestrebt zu haben. Man verurteilte sie, trotzdem man ihr ihre Geheimschreiber Kurl und Nau, auf deren Zeugnis man sich berief, gar nicht einmal gegenübergestellt hatte. Elisabeth ist anfänglich doch nicht mutig genug, das Todesurteil für ihre verhaßte Feindin zu unterzeichnen. Die Zeit, in der sie zögert, benutzen zwei Männer, um Mittel und Wege zu finden, Maria zu retten. Der eine ist Graf Leicester, ein Vertrauter der Elisabeth, der aber zugleich von den Reizen der Maria bezaubert ist. Er vermittelt eine Begegnung der beiden Königinnen. Dieses Zusammentreffen der feindlichen Frauen bildet den Höhepunkt des Trauerspieles.
#SE033-222
Maria überwindet sich zuerst und will ihre Gegnerin um Gnade bitten. Als sie aber bei dieser nur auf Kälte und Hohn stößt, da hält sie ihr all ihre Laster und Schwächen schonungslos vor. Nun ist Marias Tod entschieden. Der andere Mann, der Maria retten will, ist eine junge, leidenschaftliche Persönlichkeit, Mortimer, der eine Verschwörung plant, die aber mißlingt. Er stürzt die Unglückliche, die er leidenschaftlich verehrt, durch seinen Plan noch mehr ins Verderben. Man hat durch ihn noch einen Vorwand für das Todesurteil, das Elisabeth nunmehr unterzeichnet und das Burleigh, der schlaue Staatsmann, rasch vollziehen läßt. Schiller hat Maria Stuart als ein Weib gekennzeichnet, welches, trotz mancher Schuld, die es auf sich geladen hat, unser tiefstes Mitgefühl erregt. Sie gewinnt unser Herz, trotzdem wir sie vor unserem sittlichen Urteil nicht freisprechen können. Schiller wußte das Leiden der Frau so zu schildern, daß wir vor allem auf dieses Leiden und weniger auf die Schattenseiten ihres Charakters sehen.
#TI
EINLEITUNG ZU «DIE RÄUBER»
#TX
Die «Räuber» sind Schillers Erstlingswerk. Der ganze Freiheitsdurst des jungen Mannes tobt sich darin aus. Er hat zwei Persönlichkeiten einander gegenübergestellt, eine edle, Karl Moor, die aber durch die Schlechtigkeit der Welt bis zum Verbrechen getrieben wird, und eine abscheuliche, Karls Bruder Franz, der ein Beispiel für alle möglichen Schlechtigkeiten ist. Karl hat sich auf der Universität manches zuschulden kommen lassen, was aber bei seiner Jugend und seinem Freiheitsdrang verzeihlich ist. Er bittet auch in
#SE033-223
einem Briefe reumütig den Vater um Verzeihung. Franz benutzt das, um seinen Bruder zu verderben. Er täuscht sowohl den Vater wie den Bruder, um sich das Erbe zu er-schleichen, das eigentlich Karl, dem älteren Bruder, zufallen sollte. Dem Vater redet er ein, daß Karl Furchtbares begangen habe, und diesem schreibt er, daß der Vater ihn verfluche. Karl, der gehofft hatte, des Vaters Verzeihung zu erlangen, und mit seiner Geliebten, Amalia, ein ruhiges Leben in seinem Heim führen zu können, sieht sich bitter getäuscht. Er verzweifelt an der Menschheit und wird jetzt durch diese Verzweiflung erst wirklich auf die Bahn des Verbrechens getrieben. Er stellt sich an die Spitze einer Räuberbande und will so Verbrechen durch Verbrechen aus der Welt schaffen. Es ist klar, daß ein solcher Plan nicht gelingen kann. Obwohl er selbst auf der Bahn der Schuld seinen edlen Charakter bewahrt und es ihm sogar gelingt, seinen Vater zu befreien, den der teuflische Franz in einen Turm gesperrt hat, um ihn von dem Schlosse wegzuschaffen, über das er allein herrschen will, muß sich Karl doch zuletzt gestehen, daß es eine Torheit war, die Ungerechtigkeit durch zügellose Willkür bekämpfen zu wollen. Er liefert sich deshalb selbst dem Arm der Gerichte aus.
#TI
EINLEITUNG ZU «KABALE UND LIEBE»
#TX
Unter den drückendsten Verhältnissen hat Schiller den Plan zu seinem Trauerspiel «Kabale und Liebe» entworfen und ausgeführt. Der Herzog Karl Engen hat ihn sogar mit einem vierzehntägigen Arrest bestraft, als er ohne Urlaub nach Mannheim zu der ersten Aufführung seiner «Räuber» gereist
#SE033-224
war. Während dieser Arrestzeit und im folgenden Wanderleben hat er dieses Trauerspiel geschrieben. Es ist hervorgegangen aus Schillers bitterem Gefühl über die unmoralischen Verhältnisse in den höchsten Ständen. Für ihn, der in jedem Menschen nichts als den Träger der Menschenwürde sehen wollte, war es gräßlich, wenn er sehen mußte, wie der Adelige auf den Bürger herabsah und ihn nicht als seinesgleichen gelten lassen wollte. Deshalb stellte er eine Handlung dar, in welcher diese Verhältnisse besonders stark zur Anschauung kommen. Ferdinand, der Sohn des Prasldenten von Walter, liebt Louise Miller, die Tochter eines Stadtmusikanten. Der Vater Ferdinands hat bestimmt, daß sein Sohn Lady Milford, die verlassene Geliebte des Fürsten, heiraten müsse. Der Sohn unterscheidet sich von seinen Standesgenossen dadurch, daß er keinen Unterschied zwischen Mensch und Mensch anerkennen will. Von Walter bietet alles auf, um seinen Sohn von dem Verhältnis zu Louise abzubringen, das er natürlich im höchsten Grade mißbilligt. Man greift zu einer List. Der Sekretär des Präsidenten, Wurm, bringt Louise dahin, einen Brief sich diktieren zu lassen, der bestimmt ist, Ferdinand das Vertrauen zu rauben, das er zu seiner Geliebten hat. Ferdinand wird dieser Brief dann zugesteckt. Der Brief ist ein Liebesbrief an den Hofmarschall von Kalb. Der teuflische Plan gelingt. Ferdinand muß glauben, daß ihn seine Geliebte betrogen hat. Er kann nicht mehr leben, da er an Liebe und Treue nicht mehr glauben kann. Er geht mit seiner Verlobten in den Tod. Zu spät, erst als die beiden Liebenden schon im Sterben liegen, teilt Louise dem Geliebten mit, in welch ein furchtbares Lügennetz er verstrickt worden ist.
In hinreißender Weise hat Schiller seinen ganzen Groll
#SE033-225
gegen Zustände, die er verabscheute, in dem Trauerspiel zum Ausdrucke gebracht. Deshalb hat dies auch bei seiner Aufführung einen ungemeinen Erfolg gehabt. Man war ergriffen von der herrlichen Gestalt des biederen Stadtmusikus Miller, einem ehrlichen geraden Mann, der sich nicht dazu herabläßt, vor den Höherstehenden sich zu bükken, und der durch die Ränke von solchen verächtlichen Persönlichkeiten, wie der Präsident von Walter und sein Sekretär Wurm sind, in seiner Stellung und in seinem Familienglück zugrunde gerichtet wird.
#TI
EINLEITUNG ZUM «WALLENSTEIN»
#TX
Als Schiller in Jena die «Geschichte des Dreißigjährigen Krieges» schrieb, war es vorzüglich die Persönlichkeit des großen Feldherrn Wallenstein, die ihn interessierte. Dieser war es daher auch, den er sich zum Helden wählte, als er zur dichterischen Tätigkeit wieder zurückkehrte. Das Schicksal dieses Mannes, der erst seinem Kaiser die größten Dienste geleistet hat, dann, als er seinen Ehrgeiz nicht befriedigt sah, Partei gegen den Herrn ergriff, ließ sich nicht in ein einziges Drama bringen. Schiller stellte es daher in drei zusammengehörigen Dichtungen, in einer sogenannten Trilogie, dar. Der erste Teil, «Wallensteins Lager», schildert das Lagerleben des Dreißigjährigen Krieges. Es wird gezeigt, wie die Soldaten dem Feldherrn unbedingt ergeben sind. Alle Arten von Charakteren werden gezeichnet. Der echte damalige Soldat, der seinem Glücksstern folgt und sonst nichts kennt als diesen, in Buttler und dem Dragoner; der edle Soldat, der seinen Beruf ideal auffaßt, in Max Piccolomini;
#SE033-226
der Glücksritter, der bald da, bald dort dient, in dem ersten Jäger und so weiter. Alle diese verschiedenen Soldatencharaktere sind darin einig, in jeder Lage bei Wallenstein auszuharren, auch wenn sich ein Zwiespalt zwischen ihrem Abgott und dem Kaiser herausstellen sollte. Sie fassen den Entschluß, in einem Schriftstück ihrem Feldherrn zu erklären, daß sie nicht von ihm lassen werden, was auch eintreten möge. In trefflicher Weise werden die Begebenheiten des Soldatenlebens unterbrochen durch eine Sitten-predigt, die ein Kapuziner im Lager hält über die Ruchlosigkeit der Soldaten und über die Sittenlosigkeit der ganzen Zeit. - Der zweite Teil «Die Piccolomini» schildert erst Wallenstein, wie er sich auf dem Gipfel dessen angelangt fühlt, was sein Ehrgeiz verlangt. Er strebt, da er seinem Glück unbedingt vertraut, sogar nach der Krone Böhmens. Solche Ziele kann er nur erreichen, wenn er einen Bund mit den Feinden des Kaisers eingeht. Er zögert mit diesem Plane zuerst aus zwei Gründen. Erstens kann er sich doch nicht sogleich entschließen, seinen Kaiser zu verraten, wenn er auch weiß, daß dieser schon lange den Ehrgeiz seines Feldherrn mit Mißtrauen verfolgt. Und zweitens ist Wallenstein abergläubisch. Er läßt sich durch einen Sterndeuter die Zukunft vorhersagen. Und er will so lange nichts unternehmen, bis ihm dieser Sterndeuter den richtigen Zeit-punkt bezeichnet. Die Generale Illo und Terzky erschleichen nun von den anderen Feldherren die Unterschriften für ein Schriftstück, in dem sie sich verpflichten, Wallenstein treu zu bleiben, auch wenn dieser den Kaiser verläßt. Das bemerkt Octavio Piccolomini, der vom Kaiser den Auftrag hat, Wallenstein zu überwachen. Durch ihn kommt Wallenstein zu Fall. Der Sohn Octavios, Max Piccolomini, liebt
#SE033-227
Wallensteins Tochter Thekla und steht daher vor der schwierigen Wahl zwischen seinem Vater und dem seiner Verlobten. Den Ausgang stellt der dritte Teil des Dramas «Wallensteins Tod» dar. Wallenstein verbindet sich wirklich mit den Schweden. Max Piccolomini, der bis dahin nicht glauben konnte, daß der große Mann einen Verrat begehen könne, sagt sich nun auch von ihm los und findet im Kampfe den Tod. Octavio Piccolomini macht dem Wallenstein seine treuesten Anhänger abspenstig. Dieser sieht sich von allen verlassen. Er muß sich in die Festung Eger zurückziehen. Dort wird er ermordet.
ARTHUR SCHOPENHAUER
#G033-1967-SE229 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
VIER BIOGRAPHIEN
#G033-SE230
ARTHUR SCHOPENHAUER
Die deutsche Philosophie vor Schopenhauer
#TX
Die Jahre 1781 und 1807 schließen ein Zeitalter harter Kämpfe innerhalb der deutsdien Wissenschaftsentwickelung ein. 1781 weckte Kant mit der «Kritik der reinen Vernunft» seine Zeitgenossen aus dem philosophischen Schlummer und gab ihnen Rätsel auf, um deren Lösung sich die Erkenntniskraft der besten Geister der Nation während des folgenden Vierteljahrhunderts bemühte. Es ist eine philosophische Erregung höchsten Grades bei den an diesen Geisteskämpfen Beteiligten zu bemerken. In rascher Folge löste eine Ideenrichtung die andere ab. An die Stelle der seichten Verstandesklarheit, wie sie vor Kant in den Büchern der philosophischen Literatur geherrscht hatte, trat wissenschaftliche Wärme, die sich allmählich steigerte zur hinreißenden Beredsamkeit Fichtes und zu dem poetischen Schwung, mit dem Schelling die wissenschaftlichen Ideen zum Ausdruck zu bringen wußte. Die Betrachtung dieser geistigen Bewegung ergibt das Bild eines unvergleichlichen geistigen Reichtums, aber auch das eines unruhigen hastigen Vorwärtsstürmens. Manches Ideengebilde trat vorzeitig in die Öffentlichkeit. Die Denker hatten nicht die Geduld, ihre Ideen ausreifen zu lassen. Diese unruhige Entwickelung endigte mit dem Erscheinen von Georg Wilh. Friedr. Hegels erstem Hauptwerke, der «Phänomenologie des Geistes», im Jahre 1807. Hegel hat in Jena die letzte Arbeit an diesem Buche in den Tagen getan, als die furchtbaren Kriegswirrnisse des Jahre 1806 über diese Stadt hereinbrachen. Die
#SE033-231
Ereignisse der folgenden Jahre waren nicht geeignet zu philosophischen Kämpfen. Hegels Buch machte unmittelbar nicht einen solch starken, die Geister zur Mitarbeit herausfordernden Eindruck, wie ihn Fichte und Schelling bei ihrem ersten Auftreten hervorriefen. Aber auch deren Einfluß verlor sich allmählich. Für beide ist die Zeit ihrer Wirksamkeit an der Jenenser Universität die glänzendste ihres Lebens. Fichte lehrte an dieser Hochschule von ,794 bis 1799, Schelling von 1798 bis 1803. Der erstere siedelte von Jena nach Berlin über, weil ihn die von Neidern und Unverständigen erhobene Anklage wegen Atheismus mit der Weimarischen Regierung in Konflikt gebracht hatte. Im Winter 1804/5 hielt er in Berlin seine Vorlesungen über die «Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters», in denen er für idealistische Denkungsweise wirkungsvoll eintrat, und im Winter 1807/8 seine berülimten «Reden an die deutsche Nation», die auf die Erstarkung des nationalen Gefühles einen mächtigen Einfluß übten. Als Vorkämpfer nationaler und frei-heitlicher Ideen, in deren Dienst er sein Denken und seine Beredsamkeit stellte, erzielte er in dieser Zeit eine kräftigere Wirkung als durch die philosophischen Vorlesungen, die er an der Berliner Universität von deren Errichtung im Jahre 1810 bis zu seinem 1814 erfolgten Tode hielt. Schelling, der nicht den Übergang von der philosophischen zur politischen Wirksamkeit fand, geriet nach seiner Jenenser Zeit bald völlig in Vergessenheit. Er ging 1803 nach Würzburg, 1806 nach München, wo er an dem Ausbau seiner Ideen arbeitete, für die nur wenige noch Interesse zeigten. Am Ende des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts ist von der Lebhaftigkeit der philosophischen Diskussion, die Kants revolutionäre Tat hervorgerufen, nichts mehr zu verspüren:
#SE033-232
Fichtes und Sdiellings Zeit ist vorüber, Hegels Epoche noch nicht angebrochen. Dieser führt von 1806 bis 1808 als Redakteur einer Bamberger Zeitung und dann bis 1816 als Rektor des Nürnberger Gymnasiums ein stilles Dasein. Erst mit seiner Berufung nach Berlin im Jahre 1818 beginnt sein gewaltiger Einfluß auf das deutsche Geistesleben.
Damit sind die Verhältnisse gekennzeichnet, die Arthur Schopenhauer vorfand, als er, nach einem wechselvollen Jugendleben, im Jahre 1810 seine philosophischen Lehrjahre begann. Nachklänge Fichtescher, Schellingscher und vor allem Kantscher Anschauungen vernahm er von den Lehr-kanzeln herunter und aus den Werken zeitgenössischer Philosophen. Die Art, wie Schopenhauer die Ansichten seiner großen Vorgänger, besonders Kants und Fichtes, zu Elementen seines eigenen Ideengebäudes machte, wird durch die Betrachtung des vor seiner Beschäftigung mit Philosophie gelegenen Abschnittes seines Lebens begreiflich.
#TI
Schopenhauers Jugendleben
#TX
Arthur Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 zu Danzig geboren. In dieser Stadt lebte der Vater, Heinrich Floris Schopenhauer, als wohlhabender Kaufmann. Dieser war ein Mann von gründlicher Berufsbildung, großer Welterfahrung, seltener Charakterstärke und einem durch nichts zu überwindenden Unabhängigkeitssinne. Die Mutter Johanna Henriette geb. Trosiener war eine lebenslustige, geistigen Genüssen ungemein zugängliche, künstlerisch veranlagte Frau mit einem starken Hang zu geselligem Verkehr, den sie bei ihrer Klugheit und geistigen Regsamkeit leicht befriedigen konnte. Heinrich Floris Schopenhauer war 41,
#SE033-233
Johanna 22 Jahre alt, als aus ihrer 1785 geschlossenen Ehe Arthur, das erste Kind, hervorging. Ihm folgte 1797 das zweite und letzte, Adele. Die Eltern des Philosophen hatte nicht schwärmerische Leidenschaft zur Ehe getrieben. Aber das auf gegenseitiger Achtung begründete Verhältnis muß ein sehr glückliches gewesen sein. Johanna spricht sich darüber mit den Worten aus: «Ich durfte stolz darauf sein, diesem Manne anzugehören und war es auch. Glühende Liebe heuchelte ich illrn ebensowenig, als er Anspruch darauf machte.»
Im Jahre ,793 wurde die bis dahin freie Stadt Danzig dem preußischen Staate einverleibt. Es widerstrebte der Gesinnung Heinrich Floris Schopenhauers, preußischer Untertan zu werden. Deshalb wanderte er mit Frau und Kind nach Hamburg aus. In den folgenden Jahren finden wir die kleine Familie häufig auf Reisen. Die Veranlassung dazu waren Sehnsucht Johannas nach Abwechselung in den Lebensverhältnissen, nach immer neuen Eindrücken, und die Absicht des Gatten, dem Sohne eine möglichst weitgehende, auf eigener Anschauung beruhende Weltkenntnis zu vermitteln. Arthur sollte, das hatte der Vater beschlossen, ein tüchtiger Kaufmann und ein weltmännisch gebildeter Kopf werden. Alle Erziehungsmaßnahmen wurden von diesen Gesichtspunkten aus unternommen. Den ersten Unterricht erhielt der Knabe in einem Hamburger Privatinstitut. Und schon im zehnten Lebensjahre trat er mit dem Vater eine große Reise nach Frankreich an, in welchem Lande er die folgenden zwei Jahre seines Lebens zubrachte. Nachdem Heinrich Floris Schopenhauer seinem Sohne Paris gezeigt hatte, führte er ihn nach Havre, um ihn bei einem Geschäftsfreunde, Grégoire de Blésimaire, zurückzulassen. Dieser ließ den jungen Schopenhauer gemeinsam mit dem eigenen
#SE033-234
Sohne erziehen. Das Ergebnis dieser Erziehung war, daß Arthur, zur größten Freude seines Vaters, als vollkommener junger Franzose zurückkehrte, der eine Menge angemessener Kenntnisse sich angeeignet und die Muttersprache dermaßen verlernt hatte, daß er sich nur schwer in ihr verständlich machen konnte. Aber auch die angenehmsten Erinnerungen brachte der zwölfjährige Knabe aus Frankreich mit. In seinem 31. Jahre sagt er über diesen Aufenthalt: «In jener freundlichen, an der Seinemündung und der Meeresküste gelegenen Stadt verlebte ich den weitaus frohesten Teil meiner Kindheit.» Nach der Rückkehr ins Elternhaus kam Arthur Schopenhauer in eine von den Söhnen der vermögenden Hamburger besuchte Privaterziehungsanstalt, deren Leiter Dr. Runge war. In dieser wurde gelehrt, was geeignet ist, aus den Zöglingen tüchtige und gesellschaftlich gebildete Kaufleute zu machen. Das Lateinische wurde, nur des Scheines halber, eine Stunde in der Woche getrieben. Diesen Unterricht genoß Arthur Schopenhauer fast vier Jahre. Was ihm hier von Wissenschaften überliefert wurde, trat in der für die praktischen Ziele des künftigen Kauf-mannes gemäßen Form an ihn heran. Aber es genügte, um in ihm eine mächtige Neigung zur Gelehrtenlaufbahn zu erwecken. Das gefiel dem Vater durchaus nicht. Der kam, nach seiner Ansicht, in die peinliche Lage, zwischen zwei Dingen wählen zu sollen: den gegenwartigen Wünschen des geliebten Sohnes und dessen zukünftigem Lebensglück. Denn nur Armut und Sorgen, nicht Glück und Zufriedenheit, dachte Heinrich Floris Schopenhauer, könne der Gelehrtenberuf einem Manne bringen. Gewaltsam den Sohn in einen Beruf zu drängen, widerstrebte der Natur des Vaters, dem die Freiheit als eines der höchsten Güter des Menschen galt. Eine
#SE033-235
List aber hielt er für statthaft und zweckmäßig, um den Jüngling von seiner Neigung abzubringen. Arthur sollte sich rasch entscheiden: entweder eine länger dauernde Vergnügungsreise durch einen großen Teil von Europa, die die Eltern unternehmen wollten, mitzumachen und nach der Rückkehr sich endgültig dem kaufmännischen Berufe zu widmen, oder in Hamburg zurückzubleiben, um sofort die lateinischen Studien zu beginnen und sich für den gelehrten Beruf vorzubereiten. Die herrlichen Erwartungen, die der Gedanke der Reise in dem jungen Schopenhauer hervorrief, bewirkten, daß er die Liebe zur Wissenschaft zurückdrängte und den dem Vater zusagenden Beruf wählte. Das war eine Entscheidung, die der Vater voraussah, da er des Sohnes Begierde, die Welt zu sehen, wohl kannte. Arthur Schopenhauer verließ im Frühjahr 1803 mit den Eltern Hamburg. Das nächste Ziel war Holland, dann wurde die Reise nach England fortgesetzt. Nach einem Aufenthalt von sechs Wochen in London wurde Arthur drei Monate zu Wimbledon zurückgelassen, um bei Mr. Lancaster die englische Sprache gründlich zu erlernen. Die Eltern bereisten in dieser Zeit England und Schottland. Der Aufenthalt in England erzeugte in Schopenhauer den Haß gegen die englische Bigottenrie, der dem Philosophen durch das ganze Leben hindurch geblieben ist, aber er legte auch den Grund zu jener gründlichen Beherrschung der englischen Sprache, die ihn später im Gespräche mit Engländern selbst als solchen erscheinen ließ. Das Leben in der Pension Lancasters sagte Schopenhauer wenig zu. Er klagte in Briefen an die Eltern über Langeweile und über das steife, zeremonielle Wesen der Engländer. Eine allgemeine Verstimmung bemächtigte sich seiner, die, wie es scheint. nur die Beschäftigung mit der
#SE033-236
schönen Literatur, namentlich mit den Werken Schillenrs, zu verscheuchen vermochte. Aus Briefen der Mutter ersehen wir, daß sie besorgt war, den Sohn könne die Vorliebe für poetische Lektüre für den Ernst des Lebens abstumpfen. «Glaube mir», schreibt sie ihm am 19. Juli 1803, «Schiller selbst wäre nie, was er ist, wenn er in seiner Jugend nur Dichter gelesen hätte.» Von England begab sich die Schopenhauersche Familie über Holland und Belgien nach Frankreich. Es wurde Havnre wieder besucht und in Paris längerer Aufenthalt genommen. Im Januar 1804 wurde die Reise nach Südfrankreich fortgesetzt. Schopenhauer lernte die Orte Bordeaux, Montpellier, Nîmes, Marseille, Toulon, die Hyérischen Inseln und Lyon kennen. Von Lyon aus wandten sich die Reisenden nach der Schweiz, dann nach Schwaben, Bayern, Wien, Dresden und Berlin. Tiefgehend waren die Eindrücke, die Schopenhauer im Verlauf der Reise empfing. In Paris sah er Napoleon, kurz bevor dieser sich die Kaiserkrone (18. Mai 1804) erzwang. In Lyon erregte sein Gemüt der Anblick einiger Plätze, die an die Gnreuelszenen der Revolution erinnerten. Und überall waren es besonders die Schauplätze des menschlichen Elends, die er mit tiefem Anteil für die Unglücklichen und Bedrängten betrachtete. Ein unnennbares Wehgefühl befiel ihn zum Beispiel, als er im Bagno von Toulon das schreckliche Los von sechstausend Galeenrensklaven sah. Er glaubte in einen Abgrund menschlichen Unglücks zu schauen. Mit Freude erfüllte ihn aber auch die Anschauung der herrlichen Natur-werke während seiner Reise, ein Gefühl, das sich in der Schweiz beim Anblick des Montblanc oder des Rheinfalls bei Schaffhausen bis zum Entzücken über die Erhabenheit des Naturwirkens steigerte. Vergleicht er doch später im
#SE033-237
3. Buch des II. Bandes seines Hauptwerkes das Genie mit dem mächtigen Alpenbenrg, weil ihn die so häufig bemerkte trübe Stimmung hochbegabter Geister an den meistens von einem Wolkenschleier eingehüllten Gipfel erinnert und die aus der allgemeinen düsteren Grundstimmung des Genies zuweilen hervorbrechende eigentümliche Heiterkeit an den zauberhaften Lichtglanz, der sichtbar wird, wenn einmal frühmorgens der Wolkenschleier reißt und der Gipfel frei wird. Einen bedeutenden Eindruck machte auf Schopenhauer auch das Riesengebirge in Böhmen, das auf dem Wege von Wien nach Dresden aufgesucht wurde. Von Berlin aus trat Heinrich Floris Schopenhauer die Heimreise an, Arthur fuhr mit der Mutter noch nach seiner Geburtsstadt Danzig, wo er konfirmiert wurde. In den ersten Tagen des Jahres 1805 traf der nunmehr siebzehnjährige Jüngling wieder in Hamburg ein. Er mußte dem Vater nun Wort halten und sich ohne Weigerung dem Handelsstande widmen. Er trat bei dem Senator Jenisch in Hamburg in die Lehre. Die einmal erwachte Liebe zu den Wissenschaften ließ sich nicht ersticken. Der Handlungslehrling fühlte sich unglücklich. Nach der langen Reise, auf der täglich neue Bilder dem schaulustigen Auge geboten worden waren, konnte er die Einförmigkeit der Berufsarbeiten nicht ertragen, nach der zwanglosen Lebensführung der verflossenen Jahre erschien ihm die not-wendige Regelmäßigkeit in seinem Tun wie Knechtschaft. Ohne inneren Anteil an den Obliegenheiten seines Berufes leistete er nur das Notwendigste. Dafür aber benützte er jeden freien Augenblick, um zu lesen oder sich seinen eigenen Gedanken und Träumereien hinzugeben. Ja er nahm sogar zu listigen Vorspiegelungen seinem Lehrhenrrn gegenüber Zuflucht, als er zum Besuche der Vorlesungen des damals
#SE033-238
in Hamburg weilenden Doktor Gall über Schädellehre einige freie Stunden haben wollte.
In dieser Lage war Arthur Schopenhauer, als im April 1805 des Vaters Leben durch einen Sturz von einem Speicher plötzlich endigte. Ob der in seinen letzten Wochen an Gedächtnisschwäche leidende Mann selbst den Tod gesucht oder durch einen Zufall gefunden hat, ist bis heute nicht klargestellt. Die düstere Stimmung des Sohnes erfuhr durch dieses Ereignis eine solche Steigerung, daß sie von wahrer Melancholie wenig entfernt war. Die Mutter siedelte mit der Tochter im Jahre 1806, nach der Liquidation des Geschäftes, nach Weimar über. Sie dürstete nach den geistigen Anregungen dieser Kunststadt. Arthunrs Streben nach Befreiung aus qualvollen Verhältnissen fand nunmehr keinen äußeren Widerstand. Er war sein eigener Herr. Die Mutter übte keinen Zwang aus. Dennoch gab es Gründe, die ihn ab-hielten, sogleich nach des Vaters Tode die verhaßten Fesseln abzuwerfen. Er liebte den Vater abgöttisch. Es widerstrebte seinem Gefühle, einen Schritt zu tun, den der Verstorbene nie gebilligt hätte. Auch hatte der übergroße Schmerz über den plötzlichen Verlust seine Tatkraft so sehr gelähmt, daß er sich zu keinem raschen Entschlusse aufraffen konnte. Zu alledem kam, daß er sich zu alt glaubte, um die zum Gelehrtenberuf notwendigen Vorstudien noch machen zu können. Die stets sich steigernde Abneigung gegen den kaufmännischen Beruf und der Glaube, daß er seine Lebenskräfte nutzlos verschwende, füllten die an seine Mutter nach Weimar gerichteten Briefe mit jämmerlichen Klagen, so daß es diese für ihre Pflicht erachtete, ihren Freund, den berühmten Kunstschriftsteller Fernow, um Rat zu fragen, was im Interesse des künftigen Lebensglückes ihres Sohnes zu tun
#SE033-239
sei. Fernow übermittelte der Freundin schriftlich seine Meinung. Er hielt ein Alter von achtzehn Jahren für kein Hindernis, sich den Wissenschaften zu widmen, ja er behauptete sogar, daß es diese glückliche Altersstufe sei, auf der sich «Gedächtnis und Urteil in der reifenden Kraft des Geistes vereinigen, um das, was mit fester Entschließung unternommen sei, leichter und schneller auszuführen, sich einer Kenntnis eher zu bemächtigen, als in einer frühern oder spätern Lebenspenriode». Schopenhauer, dem die Mutter Fenrnows Brief übersandte, war von dessen Inhalt so erschüttert, daß er in Tränen ausbrach, als er ihn gelesen hatte. Was sonst gar nicht in seiner Natur lag: rasch einen Entschluß zu fassen, das bewirkten Fernows Zeilen. Die Zeit vom Frühling 1807 bis zum Herbst 1809 genügte Schopenhauer, um sich die zum Besuche der Universität notwendigen Kenntnisse zu erwerben. Bis zum Beginn des Jahres 1808 lebte er in Gotha, wo Döring den Unterricht des Lateinischen, Jacobs den des Deutschen besorgten. Die übrige Zeit verbrachte er in Weimar, wo Fernow ihn in das Verständnis der italienischen Literatur einführte. Neben den alten Sprachen, in denen der Philologe Passow und der Gymnasialdirektor Lenz seine Lehrer waren, trieb er Mathematik und Geschichte. Am 9. Oktober bezog er die Universität Göttingen, um Medizin zu studieren. Ein Jahr später vertauschte er die Medizin mit der Philosophie.
#TI
Die Studienzeit. Verhältnis zu Kant und Fichte
#TX
Als Persönlichkeit, deren Charaktereigentümlichkeiten bereits scharf ausgeprägt waren, die sich auf Grund inhaltsvoller Erlebnisse und einer reichen Weltkenntnis über viele
#SE033-240
Dinge bereits feste Ansichten gebildet hatte, trat Schopenhauer in das Studium der Philosophie ein. Im Beginne seiner Univenrsitätszeit äußerte er einmal zu Wieland: «Das Leben ist eine mißliche Sache; ich habe mir vorgenommen, das meinige damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken.» Das Leben hat ihn zum Philosophen gemacht. Es hat auch die philosophischen Aufgaben bestimmt, deren Lösung er sich widmete. Hierin unterscheidet er sich von seinen Vorgängern: Kant, Fichte und Schelling, wie auch von seinem Antipoden Hegel. Das sind Philosophen, denen ihre Aufgaben aus der Betrachtung fremder Anschauungen erwuchsen. Kants Denken bekam den entscheidenden Stoß durch Vertiefung in Humes Schriften, Fichtes und Schellings Wirken erhielt durch Kants Kritiken die Richtung, Hegeis Gedanken entwickelten sich gleichfalls aus denen seiner Vorgänger. Daher sind die Ideen dieser Denker Glieder einer fortlaufenden Entwickelungsreihe. Wenn auch jeder der genannten Philosophen in den ihn anregenden fremden Gedankensystemen jene Keime suchte, deren Weiterentwickelung gerade seiner Individualität gemäß war, so ist doch die Möglichkeit vorhanden, die bezeichnete Entwickelungsreihe rein logisch nachzuzeichnen, ohne auf die persönlichen Träger der Ideen Rücksicht zu nehmen. Es ist, als ob ein Gedanke den andern hervorgebracht hätte, ohne daß ein Mensch dabei tätig gewesen wäre. Schopenhauer dagegen erwuchsen aus seinen Erfahrungen, aus der unmittelbaren Anschauung menschlicher Verhältnisse und natürlicher Ereignisse, zu der seine Reisen Gelegenheit gaben, eine große Zahl einzelner Zweifel und Rätsel, bevor er wußte, was andre über das Leben des Geistes und das Wirken der Natur gedacht haben. Die Fragen, die ihm durch seine Erlebnisse
#SE033-241
gestellt wurden, hatten ein durchaus individuelles und oft von Zufälligkeiten abhängiges Gepräge. Deswegen nimmt er auch in der deutschen Philosophie eine isolierte Stellung ein. Er nimmt die Elemente zur Lösung seiner Aufgaben überall her: von Zeitgenossen und von Philosophen der Vergangenheit. Die Frage, warum diese Elemente Glieder eines Gedankengebäudes geworden sind, läßt sich nur durch Betrachtung von Schopenhauers individueller Persönlichkeit beantworten. Fichtes, Schellings, Hegels philosophische Systeme erwecken das Gefühl, daß sie auf das Kantische folgen mußten, weil sie logisch durch dieses gefordert wurden; von dem Schopenhauerschen dagegen kann man sich ganz gut denken, daß es uns in der Geschichte der Philosophie ganz fehlte, wenn das Leben des Schöpfers vor seiner produktiven Zeit durch irgendeinen Zufall eine andre Wendung genommen hätte. Durch diesen Charakter der Schopenhauerschen Ideenwelt ist deren eigentümlicher Reiz bedingt. Weil sie ihre Quellen im individuellen Leben hat, entspricht sie den philosophischen Bedürfnissen vieler Menschen, die, ohne ein besonderes Fachwissen zu suchen, doch über die wichtigsten Lebensfragen eine Ansicht vernehmen wollen.
Manche der philosophischen Ausführungen Schopenhauenrs sind nur die in ein wissenschaftliches Gewand gehüllten Ansichten, die das Leben vor der philosophischen Studienzeit in ihm erzeugt hat. Nicht ein Grundsatz, aus dem sich alle philosophische Wissenschaft ableiten läßt, ist sein Ausgangspunkt, sondern aus dem Ganzen seiner Persönlichkeit entstehen einzelne Grundansichten über verschiedene Seiten des Weltgeschehens, die sich erst später zu einer Einheit zusammenschließen. Schopenhauer vergleicht deshalb seine Gedankenwelt
#SE033-242
mit einem Kristall, dessen Teile von allen Seiten zu einem Ganzen zusammenschießen.
Eine dieser Grundansichten entwickelte sich in Schopenhauer infolge des Einflusses, den sein Göttinger Lehrer Gottlob Ernst Schulze auf ihn genommen hat. Dieser bezeichnete dem jungen Philosophen Kant und Plato als die Denker, an die er sich in erster Linie halten solle. Schulze selbst war in seiner 1792 erschienenen Schrift «Aenesidernus» als Gegner Kants aufgetreten. Schopenhauer hatte das Glück, von einem Manne auf Kant hingewiesen zu werden, der zugleich die Fähigkeit hatte, auf die Widersprüche dieses Philosophen aufmerksam zu machen.
Kant war bestrebt, die Bedingungen aufzusuchen, unter denen das menschliche Erkenntnisstreben zu Wahrheiten von unbedingter und notwendiger Gewißheit kommen kann. Die Leibniz -Wolffsche Philosophie, deren Anhänger Kant bis zu seiner eingehenden Beschäftigung mit Humes Schriften war, glaubte solche Wahrheiten durch rein begriffliches Denken aus der bloßen Vernunft herausspinnen zu können. Sie stellte diese reinen Vernunftwahrheiten den Erfahrungserkenntnissen gegenüber, die durch Beobachtung des äußeren Natur- und des inneren Seelenlebens gewonnen werden. Die letzteren setzen sich, nach dieser Ansicht, nicht aus klaren, durchsichtigen Begriffen zusammen, sondern aus verworrenen und dunklen Vorstellungen. Daher wollte diese philosophische Denkart die wertvollsten Einsichten über den tieferen Zusammenhang der Naturereignisse, uber das Wesen der Seele und die Existenz Gottes aus reinen Vernunftbegriffen entwickeln. Kant bekannte sich zu diesen Ansichten, bis er durch Humes Bemerkungen über die Begriffe von Ursache und Wirkung in seinen Überzeugungen
#SE033-243
vollständig erschüttert wurde. Hume (,7" bis 1776) suchte den Nachweis zu führen, daß wir durch die bloße Vernunft niemals Einsicht in den Zusammenhang von Ursache und Wirkung gewinnen können. Der Begriff der Verursachung stammt, nach Humes Meinung, aus der Erfahrung. Wir nehmen das Entstehen des Feuers wahr und darauf die Erwärmung der es umgebenden Luft. Unzähligemal beobachteten wir die gleiche Folge dieser Wahrnehmungen. Wir gewöhnen uns daran und setzen voraus, daß wir immer dasselbe beobachten werden, sobald dieselben Voraussetzungen gegeben sind. Eine objektive Gewißheit darüber können wir aber niemals gewinnen, denn es ist mit Hilfe bloßer Begriffe nicht einzusehen, daß etwas deshalb notwendig folgen müsse, weil etwas andres vorhergeht. Die Erfahrung sagt uns nur, daß bis zu irgendeinem Zeitpunkte ein gewisses Ereignis immer ein bestimmtes andres zur Folge gehabt hat, nicht aber, daß das eine das andre zur Folge haben muß, also es auch in der Zukunft nicht anders sein werde. All unser Wissen über die Natur und über unser Seelenleben setzt sich aus Vorstellungskomplexen zusammen, die sich in unsrer Seele auf Grund beobachteter Zusammenhänge von Dingen und Ereignissen gebildet haben. In sich selbst kann die Vernunft nichts finden, was ihr ein Recht gebe, eine Vorstellung mit einer andern zu verbinden, also ein Erkenntnisurteil zu fällen. Von dem Zeitpunkte an, in dem Kant die Bedeutung der Humeschen Untersuchungen erkannte, bekam sein Denken eine ganz neue Richtung. Aber er gelangte durch die Humeschen Erwägungen zu andern Folgerungen als dieser selbst. Er gab Hume darin recht, daß wir über einen in den Dingen liegenden Zusammenhang aus der bloßen Vernunft heraus keinen Aufschluß gewinnen können. Welche Gesetze
#SE033-244
die Dinge in sich haben, darüber kann nicht unsre Vernunft entscheiden; darüber können nur die Dinge selbst uns belehren. Auch darüber war er mit Hume einig, daß den Aus-künften, die uns die Erfahrung über den Zusammenhang der Dinge gibt, keine unbedingte und notwendige Gewißheit innewohnt. Darüber aber, behauptete Kant, haben wir vollkommene Gewißheit, daß die Dinge in dem Zusammen-hange von Ursache und Wirkung und in andern ähnlichen Verhältnissen stehen müssen. Den Glauben an absolut notwendige Erkenntnisse über die Wirklichkeit verlor Kant auch durch Humes Ausführungen nicht. Es entstand für ihn die Frage: Wie können wir über den Zusammenhang der Dinge und Ereignisse der Wirklichkeit etwas absolut Sicheres wissen, trotzdem die Vernunft nicht darüber entscheiden kann, wie die Dinge sich durch ihr ureigenes Wesen zueinander verhalten und die Erfahrung keine unbedingt gewissen Aufschlüsse erteilt? Kants Antwort auf diese Frage lautete: Der notwendige Zusammenhang, in dem wir die von uns wahrgenommenen Dinge und Phänomene erblicken, liegt gar nicht in diesen selbst, sondern in unsrer Organisation. Nicht weil ein Ereignis aus dem andern mit Notwendigkeit hervorgeht, bemerken wir einen solchen Zusammenhang, sondern weil unser Verstand so eingerichtet ist, daß er die Dinge nach den Begriffen von Ursache und Wirkung verknüpfen muß. Es hängt also gar nicht von den Dingen, sondern von uns ab, in welchen Verhältnissen sie uns erscheinen. Von einer fremden Macht gegeben sein, läßt Kant nur die Empfindungen. Ihre Anordnung in Raum und Zeit und ihre Verbindung durch Begriffe, wie Ursache und Wirkung, Einheit und Vielheit, Möglichkeit und Wirklichkeit, vollzieht, nach seiner Ansicht, erst unser geistiger Organismus. Unsre
#SE033-245
Sinnlichkeit ist so beschaffen, daß sie die Empfindungen nur in Raum und Zeit anschauen, unser Verstand so, daß er sie nur in bestimmten Begriffsverhältnissen denken kann. Kant ist also der Meinung, daß unsre Sinnlichkeit und unser Verstand den Dingen und Ereignissen die Gesetze ihres Zusammenhangs vorschreiben. Was Gegenstand unsrer Erfahrung werden soll, muß sich diesen Gesetzen fügen. Eine Untersuchung unsrer Organisation ergibt die Bedingungen, unter denen notwendig alle Erfahrungsobjekte erscheinen müssen. Aus dieser Anschauung ergab sich für Kant die Notwendigkeit, der Erfahrung einen von dem menschlichen Erkenntnisvermögen abhängigen Charakter zuzuschreiben Wir erkennen die Dinge nicht, wie sie an sich sind, sondern so, wie sie unsre Organisation uns erscheinen läßt. Unsre Erfahrung enthält also nur Erscheinungen, nicht Dinge an sich. Zu dieser Überzeugung wurde Kant durch den Ideen-gang geführt, den Hume in ihm angeregt hat.
Schopenhauer bezeichnet die Veränderung, die durch diese Gedanken in seinem Kopfe hervorgebracht wurde, als eine geistige Wiedergeburt. Sie erfüllen ihn mit um so größerer Befriedigung, als er sie in voller Übereinstimmung findet mit den Ansichten des andern Philosophen, auf den ihn Schulze hingewiesen hat, mit denen Platos. Dieser sagt: Solange wir uns zur Welt bloß wahrnehmend verhalten, sind wir wie Menschen, die in einer finsteren Höhle so festgebunden sitzen, daß sie den Kopf nicht drehen können, und nichts sehen, als beim Lichte eines hinter ihnen brennenden Feuers, an der ihnen gegenüberliegenden Wand, die Schattenbilder wirklicher Dinge, die zwischen ihnen und dem Feuer vorübergeführt werden, ja auch voneinander und jeder von sich selbst nur die Schatten. Wie diese Schatten zu
#SE033-246
den wirklichen Dingen, so verhalten sich unsre Wahrnehmungsobjekte, nach Platos Überzeugung, zu den Ideen, die das Wahrhaftseiende sind. Die Wahrnehmungsobjekte entstehen und vergehen, die Ideen sind ewig. Bei Kant sowohl wie bei Plato fand Schopenhauer die gleiche Anschauung: daß der sichtbaren Welt kein wahrhaftes Sein zukommt. Schopenhauer galt dies bald als eine unumstößliche, ja als die erste und allgemeinste Wahrheit. Sie nahm bei ihm folgende Form an: Ich erhalte von den Dingen Kenntnis, insofern ich sie sehe, höre, fühle usw., mit einem Worte: insofern ich sie vorstelle. Ein Gegenstand wird mein Erkenntnisobjekt heißt: er wird meine Vorstellung. Himmel, Erde usw. sind also meine Vorstellungen, denn das Ding an sich, das ihnen entspricht, ist nur dadurch mein Objekt geworden, daß es den Charakter der Vorstellung angenommen hat. Aus den Gedankenwelten Kants und Platos entnahm Schopenhauer den Keim zu denjenigen Teilen seines philosophischen Systems, in denen er die Welt als Vorstellung behandelt.
Die Unterscheidung von Erscheinung und «Ding an sich» hielt Schopenhauer für Kants größtes Verdienst; dessen Bemerkungen über das «Ding an sich» selbst aber fand er völlig verfehlt. Dieser Fehler gab auch die Veranlassung zu Schulzes Kampf gegen Kant. Die Dinge an sich sind, nach Kants Ansicht, die äußeren Ursachen der in unsern Sinnes-Organen auftretenden Empfindungen. Wie kommen wir aber zur Annahme solcher Ursachen, fragt Schulze und mit ihm Schopenhauer. Ursache und Wirkung hängen bloß zusammen, weil unsere Organisation es so fordert, und dennoch sollen diese Begriffe auf ein Gebiet angewendet werden, das jenseits unsres Organismus ist? Können denn die Gesetze
#SE033-247
unsres Organismus auch über diesen hinaus maßgebend sein? Diese Erwägungen führten Schopenhauer dazu, einen andern als den von Kant eingeschlagenen Weg zum «Ding an sich» zu suchen.
Ein solcher Weg ist vorgezeichnet in der Wissenschaftslehre J. G. Fichtes. Die reifste Form hat diese in den Vorlesungen angenommen, die Fichte in den Jahren 1810 bis 1814 an der Berliner Universität gehalten hat. Schopenhauer ging im Herbst 1811 nach Berlin, um da seine Studien fort-zusetzen. «Er hörte dem seine Philosophie vortragenden Fichte sehr aufmerksam zu», sagt er später in der Beschreibung seines Lebenslaufes, die er der philosophischen Fakultät in Berlin vorlegt, als er Privatdozent werden will. Den Inhalt von Fichtes Vorträgen erfahren wir aus dessen «Sämtlichen Werken Bd. 2 und aus seinem Nachlaß Bd. 1». Die Wissenschaftslehnre geht aus von dem Begriffe des Wissens, nicht von dem des Seins. Denn über das Sein kann der Mensch nur durch sein Wissen etwas erfahren. Das Wissen ist kein Totes, Fertiges, sondern lebendiges Werden. Die Gegenstände des Wissens entstehen durch dessen Tätigkeit. Es ist nun für das alltägliche Bewußtsein charakteristisch, daß es zwar die Gegenstände des Wissens bemerkt, nicht aber deren Entstehung. Die Einsicht in diese Entstehung geht dem auf, der auf sein eigenes Tun sich besinnt. Ein solcher sieht, wie er die ganze in Raum und Zeit vorhandene Welt selbst erschafft. Dieses Schaffen ist, nach Fichtes Ansicht, eine Tatsache, die man bemerkt, sobald man darauf achtet. Allerdings muß man ein Organ haben, welches fähig ist, das Wissen bei seinem Hervorbringen zu belauschen, wie man ein Auge haben muß, um die Farben zu sehen. Wer dieses Organ hat, dem erscheint die wahrnehmbare Welt als
#SE033-248
Geschöpf des Wissens, entstehend und vergehend mit dem Wissen. Ihnre Gegenstände sind kein bleibendes Sein, sondern vorübenreilende Bilder. Das Hervorbringen dieser Bilder kann jeder nur an sich selbst beobachten. Jeder Mensch erkennt durch Selbstanschauung in den seinem Wissen gegebenen Dingen eine von ihm selbst erzeugte Bilderwelt. Diese ist nur ein subjektiver Schein, dessen Bedeutung nicht über das einzelne menschliche Individuum hinausreicht. Es entsteht die Frage: Sind diese Bilder das einzige Seiende? Sind wir selbst nichts als diese den Schein erzeugende Tätigkeit? Die Frage kann beantwortet werden durch Besinnung des Menschen auf seine sittlichen Ideale. Von diesen ist ohne weiteres klar, daß sie verwirklicht werden sollen. Und es ist auch unbedingt gewiß, daß sie nicht bloß durch dieses oder jenes menschliche Individuum, sondern durch alle Menschen verwirklicht werden müssen. Diese Notwendigkeit führt der Inhalt dieser Ideale mit sich. Sie sind eine alle Individuen umspannende Einheit. Jeder Mensch empfindet sie als Sollen. Verwirklicht können sie nur werden durch das Wollen. Sollen aber die Ausdrücke des Wollens der Individuen zu einer einheitlichen Weltordnung zusammenstimmen, so müssen sie in einem einzigen Universalwillen begründet sein. Was in irgendeinem Individuum will, ist seinem Wesen nach dasselbe wie das in allen andern Wollende. Was der Wille vollbringt, muß in der Körperwelt erscheinen; sie ist der Schauplatz seines Wirkens. Das ist nur dann möglich, wenn ihre Gesetze solche sind, daß sie die Tätigkeit des Willens in sich aufnehmen kann. Es muß eine ursprüngliche Übereinstimmung sein zwischen den Triebkräften der Körperwelt und dem Willen. Die Wissenschaftslehre führt somit zu einem einheitlichen Weltprinzip, das sich in der Körperwelt
#SE033-249
als Kraft, in der sittlichen Ordnung als Wille kundgibt. Sobald der Mensch den Willen in sich vorfindet, gewinnt er die Überzeugung, daß es eine von seinem Individuum unabhängige Welt gibt. Der Wille ist nicht Wissen des Individuums, sondern Form des Seins. Die Welt ist Wissen und Wille. In der Verwirklichung der sittlichen Ideale hat der Wille einen Inhalt, und insofern das menschliche Leben an dieser Verwirklichung teilnimmt, erhält es einen absoluten Wert, den es nicht hätte, wenn es bloß in den Bildern des Wissens bestände. Fichte sieht in dem Willen das vom Wissen unabhängige «Ding an sich». Alles, was wir von der Welt des Seins erkennen, ist, daß sie Wille ist.
Die Ansicht, daß der Wille, den der Mensch in sich antrifft, «Ding an sich» ist, macht auch Schopenhauer zu der seinigen. Auch er ist der Meinung, daß wir in unserm Wissen nur die von uns erzeugten Bilder, in unserm Wollen aber ein von uns unabhängiges Sein gegeben haben. Der Wille muß übrig bleiben, wenn das Wissen ausgelöscht wird. Der tätige Wille zeigt sich durch die Handlungen meines Leibes. Wenn der Organismus etwas verrichtet, so ist es der Wille, der ihn dazu antreibt. Nun erfahre ich von den Handlungen meines Leibes auch durch mein Wissen, das mir ein Bild davon entwirft. Schopenhauer sagt, gemäß dem Ausdrucke, in den er Kants Grundansicht gebracht hat (vgl. S.245): ich stelle diese Handlungen vor. Dieser meiner Vorstellung entspricht ein von mir unabhängiges Sein, das Wille ist. Was wir von dem Wirken im eigenen Leibe wissen, sucht Schopenhauer auch von dem der übrigen Natur nachzuweisen: daß es, seinem Sein nach, Wille ist. Diese Anschauung vom Willen ist das zweite der Glieder, aus denen sich Schopenhauers Philosophie zusammensetzt.
#SE033-250
Wie viel von Schopenhauenrs Willensiehre durch Einfluß Fichtes entstanden ist, läßt sich bei dem Mangel historischer Zeugnisse nicht feststellen. Schopenhauer selbst hat jede Beeinflussung von seiten seines Berliner Lehrers in Abrede gestellt. Die Art, wie Fichte lehrte und schrieb, war ihm zu-wider. Bei der auffallenden Übereinstimmung der Ansichten beider Philosophen und bei dem Umstande, daß Schopenhauer Fichtes Vorträge «aufmerksam» angehört, ja einmal in einer Sprechstunde lebhaft mit ihm disputiert hat, ist es schwer, den Gedanken an eine solche Beeinflussung zurück-zuweisen. In Göttingen und in Berlin sind also die ersten Anregungen zu suchen, denen Schopenhauer folgte, als er sein Gedankensystem auf die zwei Grundsätze aufbaute: «Die Welt ist meine Vorstellung» und «Die Welt ist Wille.»
#TI
Einfluß Goethes
#TX
Im Frühling 1813 verließ Schopenhauer Berlin wegen der Kriegsunruhen und ging über Dresden nach Weimar. Die Verhältnisse im Hause seiner Mutter gefielen ihm nicht; deshalb ließ er sich zunächst in Rudolstadt nieder. Im Sommer des Jahres 1813 arbeitete er einen Teil der Vorstellungs-lehre aus. Alle unsre Vorstellungen sind Objekte unsres erkennenden Subjekts. Aber nichts für sich Bestehendes und Unabhängiges, auch nichts Einzelnes und Abgerissenes kann Objekt für uns werden. Die Vorstellungen stehen in einer gesetzmäßigen Verbindung, die ihnen von unsrem Erkenntnisvermögen gegeben wird und die der Form nach aus dessen Natur erkannt werden kann. Die Vorstellungen müssen zueinander in einem solchen Verhältnis stehen, daß wir sagen können: die eine ist in der andern begründet. Grund und
#SE033-251
Folge ist die allgemeine Form des Zusammenhangs sämtlicher Vorstellungen. Es gibt vier Arten der Begründung: den Grund des Werdens, des Erkennens, des Seins und des Wollens. Beim Werden wird eine Veränderung durch eine andre in der Zeit begründet; beim Erkennen ein Urteil durch ein andres, oder durch eine Erfahrung; beim Sein die Lage eines Zeit- oder Raumteils durch einen andern; beim Wollen eine Handlung durch ein Motiv. Die ausführliche Darstellung dessen, was Schopenhauer über diese Sätze zu sagen hatte, gab er in seiner Schrift «Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde», durch die er sich am 2.0k-tober 1813 den Grad eines Doktors der Philosophie bei der Universität Jena erwarb. Im November dieses Jahres kehrte er nach Weimar zurück, wo er bis zum Mai 1814 verblieb und in vertrautem Umgange mit Goethe lebte. Dieser hatte Schopenhauenrs Erstlingsschrift gelesen und interessierte sich für den Verfasser in dem Grade, daß er ihn persönlich in die Farbenlehre einführte. Schopenhauer fand, daß zwischen seiner philosophischen Überzeugung und der Goetheschen Farbenlehre die vollkommenste Übereinstimmung bestehe. Er beschloß, dies in einer besonderen Schrift zu begründen, deren Ausarbeitung er, nach seiner Übersiedlung nach Dresden, im Mai 1814, in Angriff nahm. Dabei bildeten sich auch seine Gedanken über die Natur der Sinnesanschauung aus. Kant war der Ansicht, daß durch Erregung der Sinne von seiten der «Dinge an sich» die Empfindungen entstehen; das sind die einfachen Farben-, Licht-, Schalleindrücke usw. Wie diese von außen kommen, sind sie noch nicht in Raum und Zeit angeordnet. Denn diese Ordnung beruht auf einer Einrichtung der Sinne. Die äußeren Sinne ordnen die Empfindungen im Raume, der innere Sinn in der Zeit an. Dadurch
#SE033-252
entsteht Anschauung. Die Anschauungen ordnet dann der Verstand, seiner Natur gemäß, nach den Begriffen: Ursache und Wirkung, Einheit, Vielheit usw. Dadurch bildet sich aus den Einzelanschauungen die in sich zusammenhängende Erfahrung. Schopenhauer findet die Sinne ganz ungeeignet zur Erzeugung der Anschauung. In den Sinnen ist nichts als die Empfindung enthalten. Die Farbenempfindungen zum Beispiel entstehen durch eine Wirkung auf die Netzhaut im Auge. Sie sind Vorgänge innerhalb des Organismus. Sie können daher auch unmittelbar nur als Zustände des Leibes und in diesem wahrgenommen werden. Der innere Sinn ordnet die Empfindungen zunächst in der Zeit an, so daß sie nach und nach ins Bewußtsein gelangen. Räumliche Beziehungen erhalten sie erst, wenn sie als Wirkungen aufgefaßt und von ihnen auf eine äußere Ursache geschlossen wird. Die Anordnung nach Ursache und Wirkung ist Sache des Verstandes. Dieser betrachtet die Empfindungen als Wirkungen und verlegt ihre Ursachen in den Raum. Er bemächtigt sich des Empfindungsmateriales und baut die Anschauungen im Raume daraus auf. Diese sind somit durchaus das Werk des Verstandes und nicht der Sinne*. Da die Gegenstände, die im Raume gesehen und getastet werden, aus den Sinnesempfindungen erst aufgebaut werden, können diese nicht aus jenen abgeleitet werden. Man kann daher die Farben, die doch Empfindungen sind, nicht aus den Gegenständen ableiten, wie es Newton tut. Sie entstehen durch das Auge und müssen aus der Einrichtung des Auges begründet werden. Es muß gezeigt werden, wie die Netzhaut Farben
- - -
* Eine Kritik dieser Ansicht habe ich geliefert in meinem Buche «Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Welt-anschauung». 1894.
#SE033-253
erzeugt. Nach außen kann bloß die Ursache der Farben, das Licht, verlegt werden, das noch durchaus ungefärbt ist. Von dem ungefärbten Lichte geht auch Goethe in der Farbenlehre aus. Schopenhauers Schrift «Über das Sehn und die Farben» erschien 1816. Goethe hatte das Manuskript bereits 1815 von dem Verfasser zur Ansicht erhalten.
#TI
Das Hauptwerk
#TX
In Dresden verweilte Schopenhauer bis September 1818. Diese Zeit war der Ausführung seines Hauptwerkes «Die Welt als Wille und Vorstellung» gewidmet. An die in Göttingen, Berlin und Weimar ausgebildeten Gedanken wurden neue angegliedert und zunächst in kurzen Aphorismen aufgezeichnet. Fnrauenstädt hat in seinem Buche «Aus Schopenhauers Nachlaß» eine Anzahl dieser Aphorismen herausgegeben. Schopenhauer lebte in besonders glücklichen Lebensverhältnissen, während er sie abfaßte. Der Umgang mit literarisch tätigen Männern, die ihm wegen seiner Fähigkeiten hohe Achtung zollten, regte seine Schaffenskraft an. Die Gemäldegalerie und die Sammlung antiker Statuen befriedigten sein ästhetisches Bedürfnis. Sie belebten sein Nachdenken über die Kunst und das künstlerische Hervorbringen. Vom März 1817 bis März ,8i 8 faßte er die einzelnen Gedanken seiner Philosophie zu einem Ganzen zusammen. Die Ausführungen über die Anschauung, die schon in dem Werke über die Farben enthalten waren, bilden auch den Anfang der «Welt als Wille und Vorstellung». Der Verstand erschafft die Außenwelt und bringt deren Erscheinungen in einen Zusammenhang nach dem Gesetze von Grund und Folge, das die angegebenen vier Gestalten hat.
#SE033-254
Kant hat dem Venrstande zwölf Venrbindungsweisen (Kategonrien) zugeschnrieben; Schopenhauer kann nun die von Grund und Folge (Kausalität) anenrkennen. Durch den Verstand haben wir die anschauliche Welt gegeben. Neben dem Verstande ist im Menschen auch die Vernunft tätig. Sie bildet aus den Anschauungen Begriffe. Sie sucht das Gemeinsame verschiedener Anschauungen auf und bildet daraus abstrakte Einheiten. Dadurch bringt sie größere Teile der Erfahrung unter einen Gedanken. Der Mensch lebt dadurch nicht bloß in seiner unmittelbar gegenwärtigen Anschauung, sondern er kann von vergangenen und gegenwärtigem Geschehen Schlüsse auf die Zukunft machen. Er gewinnt eine Übersicht des Lebens und kann danach auch sein Handeln einrichten. Dadurch unterscheidet er sich vom Tiere. Dieses hat wohl Anschauungen, aber keine Vernunftbegriffe. Es wird zu seinem Tun durch die Eindrücke der unmittelbaren Gegenwart bestimmt. Der Mensch richtet sich nach seiner Vernunft. Aber die Vernunft kann aus sich heraus keinen Inhalt erzeugen. Sie ist nur der Widerschein der Anschauungswelt. Sie kann deshalb auch keine von der Erfahrung unabhängigen sittlichen Ideale hervorbringen, die als unbedingt gebietendes Soll dem Handeln vorleuchten, wie Kant und Fichte behaupten. Die Regeln, nach denen der Mensch sein Handeln einrichtet, sind aus seinen Lebenserfahrungen entnommen. Verstand und Vernunft haben ihr Organ im Gehirne. Ohne Gehirn gibt es keine Anschauungen und keine Begriffe. Die ganze Vorstellungswelt ist eine Erscheinung des Gehirnes. An sich ist nur der Wille. Dieser enthält keine sittlichen Ideale; wir kennen ihn bloß als dunklen Drang, als ewiges Streben. Er bringt das Gehirn und damit Verstand und Vernunft hervor. Das Gehirn
#SE033-255
schafft die objektive Welt, die der Mensch als dem Satze des Grundes unterworfene Erfahrung überblickt. Die Vorstellungen sind räumlich und zeitlich angeordnet. Sie bilden in dieser Ordnung die Natur. Der Wille ist unräumlich und unzeitlich, denn Raum und Zeit sind durch das erkennende Bewußtsein geschaffen. Der Wille ist daher eine Einheit in sich; er ist ein und derselbe in allen Erscheinungen. Als Erscheinung besteht die Welt aus einer Vielheit von Dingen oder Individuen. Als Ding an sich ist sie eine Ganzheit. Die Individuen entstehen, wenn sich das Bewußtsein als Subjekt dem Objekt gegenüberstellt und es dem Satze vom Grunde gemäß betrachtet. Es gibt aber noch eine andre Betrachtung. Der Mensch kann über das bloße Individuum hinausgehen. Er kann in dem Einzeldinge das suchen, was unabhängig von Raum, Zeit und Ursachlichkeit ist. In jedem Individuum ist ein Bleibendes, das nicht auf das einzelne Objekt beschränkt ist. Ein bestimmtes Pferd ist bedingt durch die Ursachen, aus denen es hervorgegangen ist. Aber es ist etwas in dem Pferde, das bleibt, auch wenn das Pferd wieder vernichtet wird. Dieses Bleibende ist nicht bloß in diesem bestimmten Pferde, sondern in jedem Pferde enthalten. Es kann nicht durch die Ursachen hervorgebracht sein, die nur bewirken, daß dieses eine, bestimmte Pferd entsteht. Das Bleibende ist die Idee des Pferdes. Die Ursachen verkörpern diese Idee nur in einem einzelnen Individuum. Die Idee ist also dem Raum, der Zeit und der Ursachlichkeit nicht unterworfen. Sie steht daher dem Willen näher als das Individuum. In der Natur ist die Idee nirgends unmittelbar enthalten. Der Mensch erblickt sie erst, wenn er von dem Individuellen der Dinge absieht. Das geschieht durch die Phantasie. Die stoffliche Verkörperung der Ideen ist die
#SE033-256
Kunst. Der Künstler kopiert nicht die Natur, sondern er prägt der Materie das ein, was seine Phantasie erschaut. Eine Ausnahme bildet die Musik. Diese verkörpert keine Ideen. Denn wenn auch die Ideen nicht unmittelbar in der Natur enthalten sind, so kann sie die Phantasie doch nur aus der Natur herausholen durch Aufsuchen des Bleibenden in den Individuen. Diese sind die Vorbilder der Kunst. Die Musik hat aber kein Vorbild in der Natur. Die musikalischen Kunstwerke bilden nichts in der Natur ab. Der Mensch erzeugt sie aus sich selbst heraus. Da außer den Vorstellungen und Ideen in ihm aber nichts ist, was er abbilden könnte, als der Wille: so ist die Musik das unmittelbare Abbild des Willens. Sie spricht deshalb so sehr zum Gemüte des Menschen, weil sie die Verkörperung dessen ist, was das innerste Wesen, das wahre Sein des Menschen ausmacht. Diese Anschauung über die Musik wurzelt in Vorstellungen, die wir bei Schopenhauer lange vor seiner Beschäftigung mit Philosophie antreffen. Als Hamburger Kaufmannslehrling schreibt er an seine Mutter: «Wie fand das himmlische Samenkorn Raum auf unserm harten Boden, auf welchem Notwendigkeit und Mängel um jedes Plätzchen streiten? Wir sind verbannt vom Urgeist und sollen nicht zu ihm empordringen... Und doch hat ein mitleidiger Engel die himmlische Blume für uns erfleht und sie prangt hoch in voller Herrlichkeit auf diesem Boden des Jammers gewurzelt. - Die Pulsschläge der göttlichen Tonkunst haben nicht aufgehört zu schlagen durch die Jahrhunderte der Barbarei und ein unmittelbarer Widerhall des Ewigen ist uns in ihr geblieben, jedem Sinn verständlich und selbst über Laster und Tugend erhaben.» Diese Jugendvorstellung tritt uns in philosophischer Form in Schopenhauers Hauptwerk entgegen.
#SE033-257
Dieselbe Briefstelle enthält zugleich einen Gedanken, der im letzten Abschnitt des Buches «Die Welt als Wille und Vorstellung» wissenschaftliche Gestalt angenommen hat: den von einem allgemeinen Weltelend und von der Nichtigkeit des Daseins. Der Wille ist ewiges Streben. Es liegt in seiner Natur, daß er niemals befriedigt werden kann. Denn erreicht er ein Ziel, so muß er sofort zu einem neuen forteilen. Hörte er als Streben auf, so wäre er nicht mehr Wille. Da das menschliche Leben seinem Wesen nach Wille ist, so gibt es in demselben keine Befriedigung, sondern nur ewiges Lechzen nach einer solchen. Die Entbehrung bereitet Schmerz. Dieser ist also notwendig mit dem Leben verbunden. Alle Freude und alles Glück kann nur auf Täuschung beruhen. Zufriedenheit ist nur durch Illusion möglich, die durch Besinnen auf das wahre Wesen der Welt vernichtet wird. Die Welt ist nichtig. Ein Weiser ist nur, wer das im vollen Umfange einsieht. Das Anschauen der ewigen Ideen und deren Verkörperung in der Kunst kann für Augenblicke über das Elend der Welt hinwegführen, denn der ästhetisch Genießende versenkt sich in die ewigen Ideen und weiß nichts von den besonderen Leiden seines Individuums. Er verhält sich rein erkennend, nicht wollend, also auch nicht leidend. Das Leiden tritt aber sofort wieder ein, wenn er in das alltägliche Leben zurückgeworfen wird. Die einzige Rettung aus dem Elend ist, gar nicht zu wollen, das Wollen in sich zu ertöten. Das geschieht durch Unterdrükkung aller Wünsche, durch Askese. Der Weise wird alle Wünsche in sich auslöschen, seinen Willen vollständig verneinen. Er kennt kein Motiv, das ihn zum Wollen nötigen könnte. Sein Streben geht nur noch auf das eine: Erlösung vom Leben. Das ist kein Motiv mehr, sondern ein Quietiv.
#SE033-258
Jedes einzelne Wollen ist durch das allgemeine Wollen bestimmt, daher unfrei; nur der Univenrsalwille ist durch nichts bestimmt, also frei. Nur die Verneinung des Willens ist eine Tat der Freiheit, weil sie nicht durch einen einzelnen Willensakt, sondern durch den einen Willen selbst hervorgerufen wenrden kann. Alles einzelne Wollen ist Wollen eines Motivs, daher Willensbejahung.
Durch den Selbstmord wird keine Verneinung des Willens herbeigeführt. Der Selbstmörder vernichtet nur sein besonderes Individuum; nicht den Willen, sondern nur eine Erscheinung des Willens. Die Askese aber vertilgt nicht bloß das Individuum, sondern den Willen selbst innerhalb des Individuums. Sie muß zuletzt zur völligen Erlöschung alles Seins, zur Erlösung von allem Leiden führen. Verschwindet der Wille, so ist damit auch jede Erscheinung vernichtet. Die Welt ist dann eingegangen in twige Ruhe, in das Nichts, in dem allein kein Leiden, somit Seligkeit ist.
Der Wille ist eine Einheit. Er ist in allen Wesen ein und derselbe. Der Mensch ist nur als Erscheinung ein Individuum, dem Sein nach nur der Ausdruck des allgemeinen Weltwillens. Der eine Mensch ist nicht in Wahrheit von dem andern geschieden. Was dieser leidet, muß jener auch als sein eigenes Leiden ansehen, er muß es mitleiden. Das Mitleid ist der Ausdruck dafür, daß niemand ein besonderes Leiden hat, sondern jeder das allgemeine Leid empfindet. Das Mitleid ist die Grundlage der Moral. Es vernichtet den Egoismus, der nur darauf ausgeht, das eigene Leiden zu mildern. Das Mitleid bewirkt eine Handlungsweise des Menschen, die auf Beseitigung fremden Leidens geht. Nicht auf Grundsätze, die die Vernunft sich gibt, baut sich die Moral auf, sondern auf das Mitleid. also auf ein Gefühl. Alle Vernunftmoral
#SE033-259
verwirft Schopenhauer. Ihre Grundsätze sind Abstraktionen, die zum moralischen, unegoistischen Handeln nur durch Verbindung mit einer realen Tnriebknraft führen:
mit dem Mitleid.
Die Erlösungs- und Mitleidslehnre Schopenhauers sind hervorgegangen aus seiner Willenslehnre unter dem Einflusse indischer Anschauungen: dem Brahmanismus und Buddhismus. Mit indischen Religionsvorstellungen beschäftigte sich Schopenhauer schon 1813 in Weimar unter der Leitung des Orientalisten Friedrich Majer. Er setzte diese Studien in Dresden fort. Er las das Werk «Oupnek' hat», das ein persischer Fürst im Jahre 1640 aus dem Indischen ins Persische übersetzt hat und von dem 1 801 bis 1802 eine lateinische Übersetzung von dem Franzosen Anquetil Duperron erschienen ist. Nach dem Brahmanismus sind alle Einzelwesen aus einem Urwesen hervorgegangen, zu dem sie im Verlauf des Weltprozesses wieder zurückkehren. Durch die Individualisierung sind die Übel und das Weltelend entstanden, das vernichtet sein wird, sobald das Sein der Einzelwesen aufgehört haben wird und nur das Urwesen noch existieren wird. Nach dem Buddhismus ist alles Sein mit Schmerz verknüpft. Dieser wäre auch dann nicht vernichtet, wenn es bloß ein einziges Urwesen gäbe. Nur die Vernichtung alles Seins durch Entsagung und Unterdrückung der Leidenschaften kann zur Erlösung, zum Nirwana, das heißt zur Vernichtung alles Daseins führen.
Ende 1818 (mit der Jahreszahl 1819) erschien «Die Welt als Wille und Vorstellung» in Leipzig bei Brockhaus. In demselben Jahre wurde Hegel nach Berlin berufen. Hegel vertrat eine der Schopenhauerschen völlig entgegengesetzte Anschauung. Was für Schopenhauer nur einen Widerschein
#SE033-260
des Wirklichen schaffen kann, die Vernunft, ist fünr Hegel die Quelle aller Erkenntnis. Durch die Vernunft ergreift der Mensch das Sein in seiner wahren Gestalt, der Inhalt der Vernunft ist Inhalt des Seins; die Welt ist die Erscheinung des Vernünftigen, und das Leben deshalb unendlich wertvoll, weil es Darstellung der Vernunft ist. Diese Lehre wurde bald die Zeitphilosophie und blieb es, bis sie um die Mitte des Jahrhunderts der Herrschaft der Naturwissenschaften weichen mußte. Diese wollen nichts aus der Vernunft, sondern alles aus der Erfahrung begründen. Das Aufblühen der Hegelschen Philosophie verhinderte jeden Einfluß der Schopenhauerschen. Diese blieb völlig unbeachtet. Im Jahre 1835 erhielt Schopenhauer von Brockhaus auf eine Anfrage wegen des Absatzes seines Hauptwerkes die Auskunft: das Werk habe gar keine Verbreitung gefunden. Ein großer Teil habe zu Makulatur gemacht werden müssen.
#TI
Aufenthalt in Berlin
#TX
Nach Vollendung der «Welt als Wille und Vorstellung» verließ Schopenhauer Dresden und begab sich nach Italien. Er sah Florenz, Bologna, Rom, Neapel. Auf der Rückreise erhielt er in Mailand die Nachricht von seiner Schwester, daß das Hamburger Handelshaus, in dem Mutter und Schwester ihr ganzes, Schopenhauer selbst nur einen Teil seines Vermögens angelegt hatten, die Zahlungen eingestellt habe. Diese Erfahrung ließ es ihm geraten erscheinen, sich nach Erwerb umzusehen, da er nicht von dem doch unsicheren Vermögensbesitz abhängen wollte. Er kehrte nach Deutschland zurück und habilitierte sich an der Universität Berlin. Für das Sommersemester 1820 kündigte er folgende
#SE033-261
Vorlesung an: «Die gesamte Philosopie, das ist die Lehre vom Wesen der Welt und von dem menschlichen Geiste». Er konnte als akademischer Lehrer ebensowenig wie als Schriftsteller neben Hegel irgendeinen Einfluß ausüben. Deshalb hielt er in der Folgezeit keine Vorlesungen mehr, obwohl er solche noch bis zum Jahre 1831 im Lektionskatalog ankündigte. In Berlin fühlte er sich unglücklich; Lage, Klima, Umgebung, Lebensweise, soziale Zustände: alles war ihm unsympathisch. Dazu kam, daß er durch die Vermögensangelegenheit mit Mutter und Schwester vollständig zerfiel. Er selbst hatte durch geschicktes Auftreten nichts verloren; Mutter und Schwester dagegen 70 Prozent ihres Vermögens. Durch den Mangel an Anerkennung, durch Vereinsamung und das Zerwürfnis mit den Angehörigen verbittert, verließ er im Mai 1822 Berlin und brachte mehrere Jahre auf Reisen zu. Er ging durch die Schweiz nach Italien, verlebte einen Winter in Trier, ein ganzes Jahr in München und kam erst im Mai 1825 wieder nach Berlin. Im Jahre 1831 übersiedelte er nach Frankfurt am Main. Er floh vor der Cholera, die damals in Berlin herrschte, und vor der er sich besonders deshalb fürchtete, weil er in der Neujahrs-nacht von 1830 auf 1831 einen Traum hatte, der ihm auf seinen baldigen Tod hinzudeuten schien.
#TI
Die Entstehung der letzten Schriften und der wachsende Ruhm
#TX
Mit Ausnahme der Zeit vom Juli 1832 bis Juni 1833, in der Schopenhauer in Mannheim Erholung von einer Krankheit suchte, verbrachte er den Rest seines Lebens in Frankfurt in völliger Einsamkeit, von tiefem Groll erfüllt über sein Zeitalter, das für seine Schöpfungen so wenig Verständnis
#SE033-262
zeigte. Er lebte nur noch seiner Gedankenwelt und seiner Arbeit, in dem Bewußtsein, daß enr nicht fünr seine Zeitgenossen, sondenrn fünr ein kommendes Geschlecht wirke. Im Jahre 1833 schrieb er in sein Manusknriptbuch: «Es dürfen meine Zeitgenossen nicht glauben, daß ich jetzt für sie arbeite: wir haben nichts miteinander zu thun; wir kennen einander nicht; wir gehen fremd aneinander vorüber. - Ich schreibe für die einzelnen, mir gleichen, die hie und da im Laufe der Zeit leben und denken, nur durch die zurückgelassenen Werke miteinander kommunizieren und dadurch einer der Trost des andern sind.»
Mit dem Erscheinen der «Welt als Wille und Vorstellung» ist Schopenhauenrs Ideenproduktion abgeschlossen. Was er später noch veröffentlichte, enthält keinen neuen Grundgedanken, sondern nur Erweiterungen dessen, was im Hauptwerke bereits enthalten ist, sowie Auseinandersetzungen über seine Stellung zu andern Philosophen und Ansichten über besondere Fragen der Wissenschaften und des Lebens, vom Standpunkte seiner Weltanschauung aus.
Einen Bundesgenossen im Kampfe für seine Ideen glaubte Schopenhauer in den Naturwissenschaften zu erkennen. Er hat sich auf den Universitäten Göttingen und Berlin neben der philosophischen eine gründliche naturwissenschaftliche Bildung angeeignet und später sich über alle Fortschritte des Natunrerkennens eingehend unterrichtet. Auf Grund dieser Studien bildete er sich die Anschauung, die Naturforschung bewege sich in einer solchen Richtung, daß sie einmal bei den Ergebnissen ankommen müsse, die er selbst durch philosophisches Denken gefunden hat. Den Beweis davon versuchte er in der 1836 erschienenen Schrift «Der Wille in der Natur» zu liefern. Alle Naturforschung setzt sich aus zwei
#SE033-263
Teilen zusammen, aus der Beschreibung der Naturkräfte und aus der Erklärung der Naturgesetze. Die Naturgesetze aber sind nichts anderes als die Vorschriften, die das Vorstellungsvermögen den Erscheinungen gibt. Diese Gesetze können erklärt werden, weil sie nichts sind als die Formen des Raumes, der Zeit und der Ursachlichkeit, die aus dem Wesen des erkennenden Subj ektes stammen. DieNaturkräfte können nicht erklärt, sondern nur beschrieben werden, wie sie sich der Beobachtung darbieten. Verfolgt man die Beschreibungen, die die Naturforscher von den Naturkräften: Schwer-kraft, Magnetismus, Wärme, Elektrizität usw. geben, so sieht man, daß diese Kräfte nichts weiter sind als die Wirkungsformen des Willens auf verschiedenen Stufen.
In gleichem Sinne wie Schopenhauer im «Willen in der Natur» eine eingehendere Ausführung der Willenslehre gab, so in der Schrift «Die beiden Grundprobleme der Ethik» eine Erweiterung der im Hauptwerke enthaltenen Ansichten über die Freiheit des Willens und die Grundlage der Moral. Das Buch ist aus zwei Preisschriften zusammengesetzt: aus der über die «Freiheit des Willens», die 1839 von der norwegischen Akademie der Wissenschaften gekrönt, und aus der andern über die «Grundlage der Moral», die auf Veranlassung der dänischen Akademie ausgeführt, aber von dieser nicht gekrönt worden ist.
Was nun Schopenhauer der Welt noch zu sagen hatte, enthält sein letztes Buch «Parerga und Paralipomena», das im Jahre 1851 erschien. Es brachte eine Reihe von Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, Anthropologie, Religion und Lebensweisheit in einer Darstellung, die den Leser gefangen nimmt, weil er nicht bloß Behauptungen und abstrakte Beweise liest, sondern überall auf eine Persönlichkeit
#SE033-264
durchblickt, deren Gedanken nicht bloß aus dem Kopfe, sondenrn aus dem ganzen Menschen entspringen und die nicht bloß durch Logik, sondern auch durch Gefühl und Leidenschaft ihre Ansichten zu beweisen sucht. Dieser Charakter von Schopenhauers letztem Werke und die Arbeit einiger Anhänger, die der Philosoph schon in den vierziger Jahren gewonnen hatte, bewirkten es, daß er am Abend seines Lebens von sich sagen konnte: Meine Zeit ist gekommen. Der jahrzehntelang Unbeachtete wurde in der zweiten Hälife des Jahrhunderts ein vielgelesener Schriftsteller. Schon i 843 veröffentlichte F. Dorguth eine Schrift: «Die falsche Wurzel des Idealrealismus», worin er Schopenhauer «den ersten realen systematischen Denker der ganzen Literaturgeschichte» nannte. Ihr folgte 1845 eine andere von demselben Verfasser: «Schopenhauer in seiner Wahrheit». Auch Frauenstädt wirkte als Schriftsteller für die Verbreitung der Schopenhauerschen Lehre. Er ließ ,854 «Briefe über die Schopenhauersche Philosophie» erscheinen.Besonderen Eindruck aber machte ein Artikel John Oxenfords in der «Westminster Review» vom April 1853, den Otto Lindner übersetzen ließ und in der Vossischen Zeitung unter dem Titel «Deutsche Philosophie im Auslande» veröffentlichte. Schopenhauer wird darin als philosophisches Genie ersten Ranges bezeichnet; seine Tiefe und sein Ideenreichtum werden durch Abdruck einzelner Stellen seiner Werke zu beweisen gesucht. Lindner selbst wurde durch die «Parerga und Paralipomena» ein begeisterter Apostel der Schopenhauerschen Lehre, der er durch seine Stellung als Redakteur der Vossischen Zeitung große Dienste leisten konnte. Das Verständnis von Schopen-bauers Ideen über Musik förderte besonders David Asher durch Aufsätze in deutschen und englischen Zeitschriften. Und
#SE033-265
diese Ideen über Musik waren es auch, die denjenigen Mann zu einem von Schopenhauers glühendsten Verehrern machten, der der Tonkunst neue Wege wies: Richard Wagner. Auf ihn wirkten diese Ideen wie ein neues Evangelium. Er sah in ihnen die tiefsinnigste Philosophie der Musik. Der Künstler, der in musikalischer Sprache die tiefsten Geheimnisse des Daseins ausdrücken wollte, fühlte sich geistesverwandt mit dem der die Musik für das Abbild des Weltwillens erklärte. Im Dezember 1854 übersandte der Tondichter dem Denker in Frankfurt den Text seines «Ring der Nibelungen» mit der handschriftlichen Widmung: «Aus Verehrung und Dankbarkeit», nachdem Schopenhauer kurz vorher es abgelehnt hatte, in Zürich Wagner zu besuchen.
Ungefähr ein Jahrzehnt konnte Schopenhauer das Wachsen seines Ruhmes noch mit ansehen. Am 21.September 1860 starb er plötzlich infolge eines Lungenschlages.
#TI
Bibliographisches und Textbehandlung
#TX
Die letzten zu Schopenhauers Lebzeiten erschienenen Auflagen seiner Werke sind: Die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, 2.Auflage 1847; Die Welt als Wille und Vorstellung, 3. Auflage 1859; Der Wille in der Natur, 2. Auflage 1854; Die beiden Grundprobleme der Ethik, 2. Auflage 1860; Parerga und Paralipomena, 1. Auflage 1851; Das Sehn und die Farben, 2. Auflage 1854. Von letzter Schrift hat Schopenhauer im Jahre 1829 für die « Scriptores ophthalmologici minores » eine lateinische Übersetzung angefertigt, die im dritten Bande dieser Zeitschrift unter dem Titel «Theoria colorum physiologica» 1830 erschienen
#SE033-266
ist. Nach Schopenhauenrs Tode hat Julius Fnrauenstädt, der letztwilligen Bestimmung des Philosophen entsprechend, neue Auflagen der Werke besorgt, zu denen er den handschriftlichen Nachlaß benutzt hat. Dieser besteht aus Manusknriptbüchern und dunrchschossenen Handexemplanren der Werke. Die Manuskriptbüchenr sind: Reisebuch (angefangen September 1818), Foliant (angefangen Januar 1821), Brieftasche (angefangen Mai 1822), Quartant (angefangen November 1824), Adversaria (angefangen März 1828), Cholerabuch (auf der Flucht vor der Cholera geschrieben, angefangen September 1831), Cogitata (angefangen Februar 1830), Pandektä (angefangen September 1832), Spicilegia (angefangen April 1837), Senilia (angefangen April 1852) und die in Berlin gehaltenen Vorlesungen Schopenhauers. In diesen Manuskriptbüchern, sowie auf den Durchschußblättern der Handexemplare befinden sich Zusätze Schopenhauers, die er späteren Auflagen seiner Werke einfügen wollte, und außerdem noch Bemerkungen über philosophische Werke, Aphorismen usw. Was sich davon nicht für die neuen Auflagen der Werke verwerten ließ, hat Fnrauenstädt im Jahre 1864 herausgegeben unter dem Titel: «Aus Arthur Schopenhauers handschriftlichem Nachlaß. Abhandlungen, Anmerkungen, Aphorismen und Fragmente». Nach Frauenstädts im Jahre 1879 erfolgtem Tode gingen die Manuskriptbücher in den Besitz der Königlichen Bibliothek in Berlin, die durchschossenen Handexemplanre in Privathände über. Für jede Gesamtausgabe der Schopen-hauerschen Werke muß Frauenstädts Grundsatz im allgerneinen befolgt werden: «Ich bin ... so verfahren, daß ich die Zusätze, mochten es fertig hingeschriebene oder aus den Manuskriptbüchern zitierte sein, nur dann in den Text aufgenommen
#SE033-267
habe, wenn ich nach reiflicher Erwägung einen Ort für sie fand, wo sie nicht bloß ihrem Inhalt, sondern auch der Form, das ist der Diktion nach, ungezwungen hineinpaßten; in allen anderen Fällen hingegen, wo entweder die strenge Gedankenfolge oder der wohlgefällige Satzbau des Textes ihre Aufnahme in denselben nicht zuließ, habe ich sie an der geeignetsten Stelle entweder als Anmerkungen unter oder als Anhänge hinter den Text gesetzt.» Frauenstädt hat jedoch manchmal diesen Grundsatz nicht streng genug durchgeführt. Daher sind in der vorliegenden Gesamtausgabe alle diejenigen von Frauenstädt in den Text aufgenommenen Zusätze wieder aus dem Text herausgenommen und in die Anmerkungen verwiesen worden, von denen sich annehmen läßt, daß sie Schopenhauer, nach den strengen Forderungen, die er an den Stil stellte, nie in der ersten hingeworfenen Fassung, sondern erst nach vollständiger Umarbeitung seinen Werken eingefügt hätte. Was die Anordnung der Schriften in einer Gesamtausgabe betrifft, so sind dafür mehrere Aussprüche Schopenhauers in Betracht zu ziehen: Ein Brief an Brockhaus vom 8. August 1858, worin er, falls eine Gesamtausgabe nötig werden sollte, von folgender Reihenfolge spricht: 1. Welt als Wille und Vorstellung. 2. Parerga. 3. Vierfache Wurzel; Wille in der Natur; Grundprobleme der Ethik; Sehn und Farben. Schon am 22. September desselben Jahres ist er anderer Meinung. Er will die Parerga ans Ende stellen und die früher unter 3. angeführten Schriften vorangehen lassen. Man sieht, Schopenhauer war in bezug auf die Anordnung schwankend. Die vorliegende Gesamtausgabe folgt daher der Angabe, die er in dem Entwurf einer Vorrede zur Gesamtausgabe über die Reihenfolge machte, in der seine Werke gelesen werden
#SE033-268
sollen. Dieser Angabe entspricht die folgende Anordnung: 1. Vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. 2. Welt als Wille und Vorstellung. 3. Wille in der Natur. 4. Grundprobleme der Ethik. 5. Parerga und Paralipomena. An diese Schriften schließt sich dann die Schrift über «Sehn und Farben», von der Schopenhauer an der gleichen Stelle sagt, sie «geht für sich». Das Nächste ist die erwähnte lateinische Übersetzung dieser Schrift, dann kommt das aus dem Nachlaß Veröffentlichte. Den Schluß der Ausgabe bilden die vier von Schopenhauer selbst verfaßten kurzen Beschreibungen seines Lebens: 1. Die seiner Bewerbung um die Doktorwürde beigelegte. 2. Das Curriculum vitae, das er zum Zweck der Habilitation nach Berlin sandte. 3. Der Lebens-abriß, den er April 1851 Eduard Erdmann zur Benützung in dessen Geschichte der Philosophie, 4. der, den er im Mai des gleichen Jahres für das Meyersche Konversationslexikon lieferte.
Eine Lebensbeschreibung des Philosophen hat Gwinner 1862 geliefert: «Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgange» dargestellt, die 1878 unter dem Titel «Schopenhauers Leben» in zweiter, umgearbeiteter und vielfach vermehrter Auflage erschienen ist. Diese Biographie ist durch die Fülle der mitgeteilten Materialien und durch die, trotz der hervortretenden Differenz in den Anschauungen Gwinners und Schopenhauers, anschauliche Schilderung der Persönlichkeit Schopenhauers ein unschätzbares Denkmal. 1893 hat Kuno Fischer eine Darstellung des Lebens, Charakters und der Lehre Schopenhauers als achten Band seiner «Geschichte der neueren Philosophie» erscheinen lassen.
JEAN PAUL
#G033-1967-SE269 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
JEAN PAUL
Jean Pauls Persönlichkeit
#TX
Es gibt Geisteswerke, die ein solches selbständiges Dasein führen, daß man sich ihnen hingeben kann, ohne einen Augenblick an ihren Urheber zu denken. Man kann die Ilias, den Hamlet und Othello, die Iphigenie von Anfang bis zu Ende verfolgen, ohne an diepersönlichkeit Homers, Shakespeares oder Goethes erinnert zu werden. Diese Werke stehen vor dem Betrachter wie Wesen mit völlig eigenem Leben, wie entwickelte Menschen, die wir für sich hinnehmen, ohne um den Vater zu fragen. Solcher Art sind Jean Pauls Werke nicht. Bei ihnen steht fortwährend nicht nur der Geist der Schöpfung, sondern auch der des Schöpfers vor uns. Agamemnon, Achilles, Othello, Jago, Iphigenie treten vor uns hin als Individuen, die aus sich handeln und sprechen. Die Gestalten Jean Pauls, dieser Siebenkäs und Leibgeber, dieser Albano und Schoppe, Walt und Vult haben stets einen Begleiter, der mitspricht, der ihnen über die Schulter blickt. Es ist Jean Paul selbst.Wohl spricht auch aus Goethes Faust der Dichter selbst. Aber dies geschieht in ganz anderer Art als bei Jean Paul. Was von Goethes Natur in die Gestalt des Faust eingeflossen ist, hat sich völlig von dem Dichter losgelöst; es ist ganz zu Fausts eigener Wesenheit geworden und der Dichter tritt ab von der Bühne, nachdem er seinen Doppelgänger auf sie gestellt hat. Jean Paul bleibt immer neben seinen Gestalten stehen. Beim Versenken in eines seiner Werke springen unsre Empfindungen, unsre Gedanken stets von dem Werke ab und zum Schöpfer hin. Ein Ähnliches ist auch bei seinen satirischen,
#SE033-270
philosophischen und pädagogischen Schriften denr Fall. Wohl sind wir heute darüber hinaus, ein philosophisches Lehrgebäude für sich, ohne Bezug auf seinen Urheber zu betrachten. Wir blicken durch die philosophischen Gedanken hindurch auf die philosophischen Persönlichkeiten. In den Schriften des Plato, Aristoteles, Leibniz bleiben wir nicht mehr innerhalb des logischen Gedankengespinstes stehen. Wir suchen das Bild des Philosophen. Wir suchen hinter den Werken den mit den höchsten Aufgaben ringenden Menschen und sehen zu, wie dieser sich nach seiner Eigenart mit den Geheimnissen und Rätseln der Welt abgefunden hat. Aber diese Eigenart hat sich in den Werken vollständig ausgelebt. Eine Persönlichkeit spricht durch die Werke zu uns. Jean Paul hingegen stellt sich in seinen philosophischen Schriften immer in zweifacher Gestalt vor uns hin. Wir glauben, er redet aus dem Buche zu uns; aber außerdem spreche noch ein Mensch neben uns, der uns etwas sagt, das wir aus dem Buche nie erraten können. Und dieser zweite Mensch hat uns stets etwas zu sagen, was an Bedeutung nie hinter seinen Schöpfungen zurückbleibt.
Man mag diese Eigenart Jean Pauls als einen Mangel seiner Natur hinstellen. Wer dazu die Neigung hat, dem möchte ich Jean Pauls eigene Worte in einiger Veränderung entgegenhalten: Jede Natur ist gut, sobald sie eine einsame bleibt und keine allgemeine wird; denn selber die Naturen eines Homer, Plato, Goethe dürfen nicht allgemeine und einzige werden und mit ihren Werken «alle Büchersäle füllen, von der alten Welt bis in die neue hinab, oder wir würden vor Übersättigung verhungern und abmagern; sowie ein Menschengeschlecht, dessen Völker und Zeiten aus lauter frommen Herrnhutern und Spenern oder Antoninen oder
#SE033-271
Luthern beständen, zuletzt etwas von matter Langeweile und träger Vorrückung darbieten würde».
Es ist wahr: Jean Pauls Eigenart ließ ihn nie zur Schöpfung von Werken kommen, die durch das Geschlossene und Gerundete der Form, durch naturgemäße, objektive Entwickelung der Charaktere und der Handlung, durch ideengemäße Darstellung seiner Anschauungen den Charakter der Vollendung haben. Er fand niemals für seinen großen geistigen Gehalt die vollkommene Stilform. Aber er drang in die Tiefen und Abgründe der Menschenseele und erstieg Höhen des Gedankens wie wenige.
Zu einem Leben im größten Stile ist Jean Paul veranlagt. Nichts ist seiner feinen Beobachtungsgabe, seinem hohen Gedankenflug unzugänglich. Es ist denkbar, daß er den Gipfel der Meisterschaft erreicht hätte, wenn er die Geheimnisse der Kunstformen gleich Goethe studiert hätte; oder daß er einer der größten Philosophen aller Zeiten geworden wäre, wenn er seine so entschiedene Fähigkeit in dem Reiche der Ideen zu leben, zu größerer Vollkommenheit ausgebildet hätte. Ein unbegrenzter Drang nach Freiheit in allem seinem Schaffen verhindert Jean Paul, sich irgend welchen formalen Fesseln zu fügen. Seine kühne Phantasie will sich nicht in der Fortsetzung einer Erzählung durch die Kunstform bestimmen lassen, die sie sich selbst für den Anfang geschaffen hat. Sie hat auch nicht die Selbstlosigkeit, zuströmende Empfindungen und Gedanken zu unterdrücken, wenn diese sich nicht in den Rahmen des zu schaffenden Werkes fügen. Als souveräner Herrscher, der mit seinen Phantasieschöpfungen ein freies Spiel treibt, erscheint Jean Paul, unbekümmert um Kunstprinzipien, unbekümmert um logische Bedenken. Strömt der Gang einer Erzählung, eine Folge
#SE033-272
von Gedanken eine Zeit lang fort, stets fordert der schaffende Genius Jean Pauls seine Freiheit wieder zurück und führt den Leser auf Seitenwege, beschäftigt ihn mit Dingen, die mit der Hauptsache gar nichts zu tun haben, sondern sich nur im Geiste des Schöpfers zu ihr gesellen. In jedem Augenblicke sagt Jean Paul, was er sagen will, auch wenn der objektive Gang der Ereignisse etwas ganz andres fordert. In diesem freien Spiel liegt der große Stil Jean Pauls Aber es ist ein Unterschied, ob gespielt wird bei völliger Beherrschung des Gebietes, in dem man sich bewegt, oder ob die Laune des Spielenden Gebilde schafft, die auf denjenigen, der die Dinge gemäß der in ihnen selbst liegenden Gesetzmäßigkeit anschaut, den Eindruck machen, daß ein Teil des Gebildes nicht mit dem andern stimmt. Den griechischen Kunstwerken gegenüber bricht Goethe in die Worte aus: «Ich habe die Vermutung, daß die Griechen nach eben den Gesetzen verfuhren, nach welchen die Natur verfährt und denen ich auf der Spur bin», und: «Die hohen Kunstwerke sind zugleich die höchsten Naturwerke, die von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. Alles Willkürliche, Eingebildete fällt zusammen; da ist Notwendigkeit, da ist Gott.» Jean Pauls Schöpfungen gegenüber möchte man sagen: Hier hat sich die Natur ein isoliertes Gebiet geschaffen, auf dem sie zeigt, daß sie ihren eigenen Gesetzen einmal Hohn sprechen und doch groß sein kann. Goethe sucht zur Freiheit des Schaffens zu kommen durch Einverleibung der Naturgesetze in seine eigene Wesenheit. Er will schaffen, wie die Natur selber schafft. Jean Paul will sich seine Freiheit dadurch bewahren, daß er auf die Gesetzmäßigkeit der Dinge nicht achtet und seiner Welt die Gesetze der eigenen Persönlichkeit einbildet.
#SE033-273
Wäre Jean Paul eine wenig gemütstiefe Natur, sein freies Spiel mit den Dingen und Empfindungen müßte abstoßend wirken. Aber sein Anteil an der Natur und den Menschen ist nicht geringer als der Goethes und seine Liebe zu allen Wesen hat keine Schranken. Und anziehend ist es, zu sehen, wie er untertaucht in die Dinge mit seinen Gefühlen, mit seiner schwärmerischen Phantasie, mit seinem hohen Gedankenflug, ohne doch die diesen Dingen eingeborene Wesenheit selbst zu durchschauen. Das Sprichwort «die Liebe ist blind» möchte man auf die Gemütsinnigkeit, mit der Jean Paul Natur und Menschen schildert, anwenden.
Und nicht deshalb spielt Jean Paul, weil er zu wenig, sondern weil er zu viel Ernst hat. Der Traum, den seine Phantasie von der Welt träumt, ist so hoheitsvoll, daß ihm gegenüber das, was die Sinne wirklich wahrnehmen, klein und unbedeutend erscheint. Das verführt ihn dazu, den Widerspruch seiner Träume und der Wirklichkeit zu verkörpern. Die Wirklichkeit scheint ihm nicht ernst genug, um seinen Ernst an sie zu verschwenden. Er macht sich über die Kleinheit der Wirklichkeit lustig, aber er tut es nie, ohne die Bitterkeit zu empfinden, daß er sich nicht lieber an dieser Wirklichkeit erbauen kann. Aus dieser Grundstimmung seines Charakters entspringt Jean Pauls Humor. Sie ließ ihn Dinge und Charaktere sehen, die er bei einer andern Grund-stimmung nicht gesehen hätte. Es gibt eine Möglichkeit, sich über die Widersprüche der Wirklichkeit zu erheben und die große Harmonie alles Weltgeschehens zu empfinden. Goethe suchte sich auf diese Höhe zu erheben. Jean Paul lebte mehr in den Regionen, in denen sich die Natur selbst widerspricht und im einzelnen dem untreu wird, was aus ihrem Ganzen als Wahrheit und Natürlichkeit spricht. Erscheinen deshalb
#SE033-274
Jean Pauls Schöpfungen an dem Ganzen der Natur gemessen als eingebildet, willkürlich, kann man ihnen gegenüber nicht sagen: «da ist Notwendigkeit, da ist Gott»; dem Einzelnen, dem Individuellen gegenüber erscheinen seine Empfindungen als durchaus wahr. Er hat die Harmonie des Ganzen nicht zu schildern vermocht, weil er sie nie in klaren Umrissen vor seiner Phantasie geschaut hat; aber er hat von dieser Harmonie geträumt und den Widerspruch des Einzelnen mit ihr wunderbar empfunden und geschildert. Hätte sein Geist die innere Einheit alles Geschehens plastisch zu gestalten vermocht, er wäre ein pathetischer Dichter geworden. Da er aber nur das Widerspruchsvolle, Kleinliche der Wirklichkeit empfand, machte er sich durch humoristische Schilderung derselben Luft.
Jean Paul fragt nicht: was vermag die Wirklichkeit? Dazu kommt er gar nicht. Denn diese Frage wird jedem Erlebnis gegenüber sogleich übertönt von der andern: wie wenig entspricht doch diese Wirklichkeit dem Ideale. Aber Ideale, die so wenig die Vermählung mit der derben Wirklichkeit vertragen, haben selbst etwas Weichliches. Es fehlt ihnen die Kraft zum vollen frischen Leben. Wer von ihnen beherrscht wird, den machen sie sentimental. Und Sentimentalität gehört zu Jean Pauls Charakteranlagen. Wenn er der Meinung ist, mit dem ersten Kusse, oder doch wenigstens mit dem zweiten sterbe die wahre Liebe, so ist das ein Beweis dafür, daß sein sentimentales Liebesideal nicht dazu geschaffen war, Fleisch und Blut zu gewinnen. Es behält stets etwas Ätherisches. So schwebt denn Jean Paul zwischen einer schattenhaften Idealwelt, an der seine schwärmerische Sehnsucht hängt, und einer Wirklichkeit, die jener Idealwelt gegenüber toll und närrisch erscheint. Er sagt an sich selbst
#SE033-275
denkend von dem Humor: «Der Humor, als das umgekehrte Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den Kontrast mit der Idee. Es gibt für ihn keine einzelne Torheit, keine Toren, sondern nur Torheit und eine tolle Welt; er hebt - ungleich dem gemeinen Spaßmacher mit seinen Seitenhieben - keine einzelne Narrheit heraus, sondern er erniedrigt das Große, aber ungleich der Parodie - um ihm das Kleine, und erhöhet das Kleine, aber ungleich der Ironie - um ihm das Große an die Seite zusetzen und so beide zu vernichten, weil vor der Unendlichkeit alles gleich ist und nichts.» Jean Paul vermochte nicht die Widersprüche der Welt auszugleichen, deshalb war er auch denen in seiner eigenen Persönlichkeit gegenüber hilflos. Er fand nicht die Harmonie der Seelenkräfte, die in ihm walteten. Aber diese Seelenkräfte wirken so gewaltig, daß man sagen muß, Jean Paulsche Unvollkommenheit ist größer als manche Vollkommenheit niederer Gattung. Mag immerhin Jean Pauls Können hinter seinem Wollen zurückbleiben; dieses Wollen tritt einem deshalb doch so deutlich vor die Seele, daß man Blicke in unbekannte Gebiete zu tun glaubt, wenn man seine Schriften liest.
#TI
Knabenalter und Gymnasialzeit
#TX
Seine Kindheit, vom zweiten bis zum zwölften Jahre, ver-lebte Jean Paul in Joditz an der Saale, unweit Hof. Ge-boren ist er in Wunsiedel als Sohn des Tertius und Organisten Johann Christian Christoph Richter am 21. März 1763. Dieser hatte sich am 16. Oktober 1761 mit Sophia Rosina Kuhn, der Tochter des Tuchmachers Johann Paul Kuhn in Hof, vermählt. Unser Dichter erhielt in der Taufe den
#SE033-276
Namen Johann Paul Friedrich. Aus den beiden ersten Vornamen bildete er durch Französierung später seinen Schriftstellernamen Jean Paul. Am 1. August 1765 siedelten die Eltern nach Joditz über. Der Vater wurde dort zum Pfarrer ernannt. Die Familie war in Wunsiedel um einen Sohn, Adam, vermehrt worden. In Joditz kamen noch zwei Mädchen, die früh starben, und zwei Söhne, Gottlieb und Heinrich, dazu. Ein letzter Sohn, Samuel, wurde später, als die Familie bereits in Schwarzenbach war, geboren. Jean Paul schildert in hinreißender Weise in seiner leider nur bis zum Jahre ,779 reichenden Autobiographie seine Kindheit. Alle Züge, die später in dem Manne hervortreten, kündigen sich in dem Knaben bereits an. Die schwärmerische Phantasie, die auf ein ideales Reich gerichtet ist und welche die Wirklichkeit geringer schätzt als dieses Reich, zeigte sich im frühen Alter in Gestalt einer ihn oft quälenden Gespensterfurcht. Er schlief mit seinem Vater zusammen in einer Gaststube des Joditzer Pfarrhaüses, abgesondert von der übrigen Familie. Die Kinder mußten sich um neun Uhr zu Bett begeben. Der fleißige Vater kam aber erst zwei Stunden später zu Jean Paul in die Stube, nachdem er sein Nachtlesen vollendet hatte. Das waren zwei schwere Stunden für den Knaben. «Ich lag mit dem Kopfe unter dem Deckbette im Schweiße der Gespensterfurcht und sah im Finstern das Wetterleuchten des bewölkten Geisterhimmels, und mir war, als würde der Mensch selber eingesponnen von Geisterraupen. So litt ich nächtlich hilflos zwei Stunden lang, bis endlich der Vater heraufkam und gleich einer Morgensonne Gespenster wie Träume ver-jagte.» Der Autobiograph deutet vorzüglich diese Eigenheit seines Kindesalters. «Manches Kind voll Körperfureht zeigt gleichwohl Geistesmut, aber bloß aus Mangel an Phantasie;
#SE033-277
ein andres hingegen - wie ich - bebt vor der unsichtbaren Welt, weil die Phantasie sie sichtbar macht und gestaltet, und ermannt sich leicht vor der sichtbaren, weil diese die Tiefen und Größen der unsichtbaren nie erreicht. So machte mich eine auch schnelle körperliche Gefahrerscheinung - zum Beispiel ein herrennendes Pferd, ein Donnerschlag, ein Krieg, ein Feuerlärm - nur ruhig und gefaßt, weil ich nur mit der Phantasie, nicht mit den Sinnen fürchte.» Und auch die andre Seite in Jean Pauls Natur ist schon an dem Knaben zu bemerken; jene liebevolle Hingebung an die Kleinheiten der Wirklichkeit. Er hatte «von jeher eine Vorliebe zum Häuslichen, zum Stilleben, zum geistigen Nestmachen in sich getragen. Er ist ein häusliches Schaltier, das sich recht behaglich in die engsten Windungen des Gehäuses zurück-schiebt und verliebt, nur daß es jedesmal die Schnecken-schale weit offen haben will, um dann die vier Fühlfäden nicht etwa so weit als vier Schmetterlingsflügel in die Lüfte zu erheben, sondern noch zehnmal weiter bis an den Himmel hinauf strecken will; wenigstens mit jedem Fühlfaden an einen der vier Trabanten Jupiters.» Er nennt diese seine Eigenheit einen «närrischen Bund zwischen Fernsuchen und Nahesuchen - dem Fernglas ähnlich, das durch bloßes Umkehren die Nähe verdoppelt oder die Ferne». Besonders bedeutsam für Jean Pauls Wesen ist des Knaben Verhalten gegenüber dem Weihnachtsfeste. Die Freuden, die ihm die nahe Wirklichkeit bot, konnten seine Seele nicht ausfüllen, wie groß auch das Maß war, in dem sie sich einstellten. «Wenn Paul nämlich am Weihnachtsmorgen vor dem Lichterbaum und Lichtertische stand und nun die neue Welt voll Glanz und Gold und Gaben aufgedeckt vor ihm lag und er Neues und Neues und Reiches fand und bekam: so war das
#SE033-278
erste, was in ihm aufstieg, nicht eine Träne - nämlich der Freude , sondern ein Seufzer - nämlich über das Leben -, mit einem Worte, schon dem Knaben bezeichnete der Über-tritt oder Übersprung oder Überflug aus dem wogenden, spielenden, unabsehlichen Meere der Phantasie auf die begrenzte und begrenzende feste Küste sich mit einem Seufzer nach einem größeren, schöneren Lande. Aber ehe dieser Seufzer aufgeatmet war und ehe die glückliche Wirklichkeit ihre Kräfte zeigte, fühlte Paul aus Dankbarkeit, daß er sich im höchsten Grade freudig zeigen müsse vor seiner Mutter; -und diesen Schein nahm er sofort an, und auch auf kurze Zeit, weil sogleich darauf die angebrochenen Morgenstrahlen der Wirklichkeit das Mondlicht der Phantasie auslöschten und entfernten.» Nicht als Kind, auch nicht im späteren Alter konnte Jean Paul die Brücke finden zwischen dem Lande seiner Sehnsucht, das ihm seine Phantasie in unbegrenzter Vollkommenheit vorspiegelte, und der Wirklichkeit, die er liebte, die ihn aber niemals befriedigte, weil er sie nicht im großen Ganzen überschauen konnte, sondern nur im Einzelnen, Individuellen, im Unvollkommenen.
Im Auftrage der Mutter besuchte Jean Paul öfter die Großeltern in Hof. Eines Sommertages beschlich ihn auf dem Heimwege, als er gegen zwei Uhr die sonnigen, beglänzten Bergabhänge und die ziehenden Wolken betrachtete, ein «gegenstandsloses Sehnen, das aus mehr Pein und wenig Lust gemischt und ein Wünschen ohne Erinnern war. Ach, es war der ganze Mensch, der sich nach den himmlischen Gütern des Lebens sehnte, die noch unbezeichnet und farblos im tiefen Dunkel des Herzens lagen und welche sich unter den einfallenden Sonnenstrahlen flüchtig erleuchteten.»
#SE033-279
Diese Sehnsucht hat Jean Paul durchs Leben begleitet; nie ist ihm die Gunst zuteil geworden, die Gegenstände seiner Sehnsucht auch in der Wirklichkeit zu schauen.
Es gab für Jean Paul Zeiten, in denen er schwankte, ob er mehr zum Philosophen oder zum Dichter geboren sei. Jedenfalls ist ein ausgesprochener philosophischer Zug in seiner Persönlichkeit. Der Philosoph hat vor allen andern Dingen Selbstbesinnung nötig. Die philosophischen Früchte reifen im intimsten Innern des Menschen. Auf diese muß sich der Philosoph zurückziehen können. Von hier aus muß er den Anschluß an das Weltgeschehen, an die Geheimnisse des Daseins finden können. Auch die Anlage der Selbstbesinnung findet man bei dem jungen Jean Paul knospenhaft vorgebildet. Er erzählt uns: «Nie vergeß ich die noch keinem Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich bei der Geburt meines Selbstbewußtseins stand, von der ich Ort und Zeit genau anzugeben weiß. An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustüre und sah links nach der Holzlage, als auf einmal das innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mich fuhr, und seitdem leuchtend stehen blieb: da hatte mein Ich zum ersten Male sich selber gesehen und auf ewig.» Man findet die sämtlichen Eigentümlichkeiten von Jean Pauls Charakter und die seiner Schöpfungen bereits in den ersten Anlagen seines Wesens. Es ist verfehlt, wenn man in dem Herauswachsen aus den beschränkten Verhältnissen seines Erziehungsortes die Ursache für die Physiognomie seiner geistigen Persönlichkeit sucht. Er selbst betrachtet es als einen glücklichen Zufall, wenn der Dichter nicht in einer Großstadt, sondern auf dem Dorfe seine Kindheit verlebt hat. Diese Verallgemeinerung ist gewiß gewagt. Für Jean Paul war es
#SE033-280
wegen seiner individuellen Natur ein Glück, daß er in der Joditzer Idylle seine ersten Eindrücke empfing. Für andre Naturen ist gewiß ein andres das Naturgemäße. Jean Paul meint: «Lasse sich doch kein Dichter in einer Hauptstadt gebären und erziehen, sondern wo möglich in einem Dorfe, höchstens in einem Städtchen. Die Überfülle und die Überreize einer großen Stadt sind für die erregbare Kinderseele ein Essen an einem Nachtisch und Trinken gebrannter Wasser und Baden in Glühwein. Das Leben erschöpft sich in ihm in der Knabenzeit, und er hat nun auch dem Größten nichts mehr zu wünschen als höchstens das Kleinere, die Dorfschaften.Denk ich vollends an das Wichtigste für den Dichter, an das Lieben: so muß er in der Stadt um den warmen Erdgürtel seiner elterlichen Freunde und Bekanntschaften die größeren kaltenwende- und Eiszonen der ungeliebten Menschen sehen, welche ihm unbekannt begegnen und für die er sich so wenig liebend entfiammen oder erwärmen kann als ein Schiffsvolk, das vor einem andern fremden Schiffsvolk begegnend vorübersegelt. Aber im Dorfe liebt man das ganze Dorf, und kein Säugling wird da begraben, ohne daß jeder dessen Namen und Krankheit und Trauer weiß; - und dieses herrliche Teilnehmen an jedem, der wie ein Mensch aussieht, welches daher sogar auf den Fremden und den Bettler überzieht, brütet eine verdichtete Menschenliebe aus und die rechte Schlagkraft des Herzens.»
Eine wahre Wut nach Kenntnissen steckte in dem Knaben Jean Paul. «Alles Lernen war mir Leben, und ich hätte mit Freuden wie ein Prinz von einem Halbdutzend Lehrer auf einmal mich unterweisen lassen, aber ich hatte kaum einen rechten.» Diese Begierde zu stillen, war der Vater, der den Elementarunterricht besorgte, freilich nicht der rechte
#SE033-281
Mann. In seiner Art war Johann Christoph Christian Richter eine ausgezeichnete Persönlichkeit. Er versetzte seine kleine Pfarrgemeinde, deren Glieder mit ihm wie eine große Familie verbunden waren, durch seine Predigten in Begeisterung. Er war ein vorzüglicher Musiker und sogar ein beliebter Komponist geistlicher Musik. Wohlwollen gegen jedermann war eine seiner hervorstechenden Charakter-eigenschaften. Er besorgte die Arbeiten seines Ackers und Gartens zum Teil mit eigener Hand. Der Unterricht, den er dem Sohn gab, bestand darin, daß er ihn «bloß auswendig lernen ließ, Sprüche, Katechismus, lateinische Wörter und Langens Grammatik». Dem nach wirklicher geistiger Nahrung dürstenden Knaben fruchtete das wenig. Schon damals suchte er auf selbständigen Wegen das zu erlangen, was ihm von außen her nicht entgegengebracht wurde. Er legte sich eine Schachtel an, in der er eine «Etuibibliothek» aufstellte «aus lauter eigenen Sedezwerkchen, die er aus den bandbreiten Papierabschnitzeln von den Oktavpredigten seines Vaters zusammennähte und zurechtschnitt».
Am 9. Januar 1776 siedelte Jean Paul mit seinen Eltern nach Schwarzenbach über. Sein Vater wurde durch eine Gönnerin, die Freifrau von Plotho, zum Pfarrer daselbst ernannt. Nun kam Jean Paul in eine öffentliche Schule. Der Unterricht an derselben entsprach seinen geistigen Bedürfnissen ebensowenig wie der bei seinem Vater. Der Rektor Karl August Werner betrieb mit den Schülern eine Lektüre, der alle Gründlichkeit und Vertiefung in den Geist der Schriftsteller abging. Einen Ersatz bot dem Wissensbedürftigen der Kaplan Völkel, der ihm in Geographie und Philosophie Privatstunden gab. Besonders durch die Philosophie empfing Jean Paul mannigfache Anregungen. Doch trat gerade
#SE033-282
diesem Manne gegenüber die fest ausgeprägte, starre Individualität des jungen Geistes in schroffer Weise zutage. Völkel hatte ihm versprochen, eines Tages mit ihm eine Partie Schach zu spielen, und es dann vergessen. Darüber war Jean Paul so erbost, daß er des ihm lieben philosophischen Unterrichtes nicht achtete und seinen Lehrer nie wieder aufsuchte. Zu Ostern 1779 kam Jean Paul nach Hof aufs Gymnasium. Eine ungewöhnliche Geistesreife trat bei seiner Aufnahmeprüfung zutage. Er wurde sogleich in die mittlere Abteilung der Prima versetzt. Bald darnach, am 15. April, starb der Vater. Mit den Lehrern hatte Jean Paul auch in Hof kein rechtes Glück. Weder der Rektor Kirseh noch der Konrektor Remebaum, die Lehrer der Prima, machten sonderlichen Eindruck auf Jean Paul. Und wieder sah er sich genötigt, seinen Geist auf eigenen Wegen zu befriedigen. Zum Glück bot sich ihm dazu Gelegenheit durch seine Beziehungen zu dem aufgeklärten Pfarrer Vogel in Rehau. Dieser stellte ihm seine ganze Bibliothek zur Verfügung, und Jean Paul konnte sich in die Werke von Helvetius, Hippel, Goethe, Lavater und Lessing vertiefen. Schon jetzt regte sich in ihm der Drang, das Gelesene sich persönlich ganz einzuverleiben und für seine Lebensführung nutzbar zu machen. Ganze Bände füllte er mit Exzerpten des Gelesenen an. Und eine Reihe von Aufsätzen gingen als Früchte aus dieser Lektüre hervor. An bedeutsame Dinge machte sich der Gymnasiast. Wie unser Begriff von Gott beschaffen ist; über die Religionen der Welt; die Vergleichung des Narren und des Weisen, des Dummkopfs und des Genies; über den Wert des frühzeitigen Studiums der Philosophie; über die Bedeutung der Erfindung neuer Wahrheiten: dies waren die Aufgaben, die er sich stellte. Und er hatte schon viel über
#SE033-283
diese Dinge zu sagen. In selbständiger Weise setzte er sich bereits mit der Natur Gottes, mit den Fragen des Christentums, mit dem geistigen Fortschritte der Menschheit auseinander. Kühnheit und auch Reife des Urteils begegnen uns in diesen Arbeiten. Auch an eine Dichtung, den Roman «Abelard und Heloise», wagte er sich bereits. Hier erscheint er in Stil und Inhalt als Nachahmer Millers, des Sigwartdichters. Seine Sehnsucht nach einer über alle Wirklichkeit erhabenen vollkommenen Welt hat ihn in die Bahn dieses Dichters gebracht, für den es auf Erden nur Tränen über gebrochene Herzen und versiegte Hoffnungen gab und für den das Glück nur jenseits des Todes liegt. Das Motto auf Jean Pauls Roman schon zeigt, daß diese Stimmung ihn ergriffen hat: «Der Empfindsame ist zu gut für diese Erde, wo kalte Spötter sind - in jener Welt nur, die mitweinende Engel trägt, findet er seiner Tränen Belohnung.»
In Hof fand Jean Paul bereits das, was sein Herz am meisten brauchte, teilnehmende Freunde: Christian Otto, den Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns, der später der Vertraute seiner literarischen Arbeiten wurde; Johann Richard Hermann, den Sohn eines Zeugmachers, einen genialen Menschen voll Tatkraft und Wissen, der leider schon im Jahre 1790 den Anstrengungen eines an Entbehrungen und Not reichen Lebens erlag. Ferner Adolf Lorenz von Oerthel, den ältesten Sohn eines reichen Kaufmanns aus Töpen bei Hof. Letzterer war im Gegensatze zu Hermann eine weiche, gefühlsinnige Natur voll Sentimentalität und Schwärmerei. Hermann war realistisch veranlagt und vereinigte mit wissenschaftlichem Sinn praktische Lebensklugheit. In diesen zwei Charakteren traten Jean Paul bereits die Typen entgegen, die er später in seinen Dichtungen in
#SE033-284
mannigfachen Abänderungen verkörperte, als idealistischen Siebenkäs gegenüber dem realistischen Leibgeber; als Walt gegenüber dem Vult. Am 19. Mai 1781 wurde Jean Paul als Student der Theologie in Leipzig immatrikuliert.
#TI
Universitätsleben
#TX
Entgegengesetzte Gedanken und Empfindungen führten in Jean Pauls Seele einen wilden Kampf, als er die Lehrsäle der hohen Schule betrat. Meinungen und Anschauungen hatte er durch eifrige Lektüre eingesogen; aber weder seine künstlerische noch seine philosophische Phantasie wollte sich so entfalten, daß das von außen Aufgenommene eine fest-bestimmte, individuelle Struktur angenommen hätte. Die Grundkräfte seiner Persönlichkeit wirkten stark, aber unbestimmt; die Energie war groß, die Gestaltungskraft schwerfällig. Die Eindrücke, die er empfing, erregten in ihm mächtige Empfindungen, trieben ihn zu entschiedenen Werturteilen; aber sie wollten sich in seiner Phantasie nicht zu plastischen Bildern und Gedanken formen.
Auf der Universität suchte Jean Paul nur vielseitige Anregung. Es gehörte zu den Selbstverständlichkeiten der Familientradition, daß er als ältester Sohn eines Geistlichen Theologie studierte. Wenn die Absicht, Theologe zu werden, bei ihm je eine Rolle gespielt hat, so dauerte das jedenfalls nicht lange. An seinen Freund Vogel schreibt er: «Ich habe mir die Regel in meinen Studien gemacht, nur das zu treiben, was mir am angenehmsten ist, für was ich am wenigsten ungeschickt bin und was ich jetzt schon nützlich finde und dafür halte. Ich habe mich oft betrogen, wenn ich dieser Regel gefolgt bin, allein ich habe diesen Irrtum nie bereut. -
#SE033-285
Das studieren, was man nicht liebt, heißt mit dem Ekel, mit der Langeweile und dem Überdruß kämpfen, um ein Gut zu erhalten, das man nicht begehrt; das heißt die Kräfte, die sich zu etwas anderm geschaffen fühlen, umsonst an eine Sache verschwenden, wo man nicht weiter kommt, und sie der Sache entziehen, in der man Fortgang machen würde.» Als geistiger Genußmensch, der nur das sucht, was die in ihm schlummernden Kräfte zur Entwickelung bringt, lebt er an der Universität. Er hört Kollegien über den Johannes bei Magister Weber, über Apostelgeschichte bei Morus; über Logik, Metaphysik und Asthetik bei Platner, über Moral bei Wieland, über Mathematik bei Gehler; über lateinische Philologie bei Rogler. Daneben liest er Voltaire, Rousseau, Helvetius, Pope, Swift, Young, Cicero, Horaz, Ovid und Seneca. Die Tagebuchblätter und Studien, in denen er Gehörtes und Gelesenes sammelt und verarbeitet, wachsen zu dicken Bänden an. Eine fast übermenschliche Arbeitskraft und Arbeitslust entwickelt er. Seine Ansichten legt er in Abhandlungen nieder, aus denen das Ringen nach einer freien, von religiösen und gelehrten Vorurteilen unabhängigen Weltanschauung spricht.
Die Unsicherheit seines Geistes, die Jean Paul hinderte, gegenüber der Betrachtung und Aneignung des Fremden, einen eigenen Weg zu finden, hätte ihn wahrscheinlich noch lange zurückgehalten, mit seinen schriftstellerischen Versuchen vor die Öffentlichkeit zu treten, wenn ihn nicht die bitterste Armut zu dem Entsehlusse getrieben hätte: «Bücher zu schreiben, um Bücher kaufen zu können.» Jean Paul hatte nicht Zeit zu warten, bis sich die Bitterkeit, die er als Leipziger Student über die Mißstände des Lebens und der Kultur empfand, zum heiteren, überlegenen Humor abgeklärt
#SE033-286
hatte. Frühreife Erzeugnisse entstanden, Satiren, in denen der grollende, kritisierende Mensch und nicht der Dichter und Philosoph aus Jean Paul spricht. Durch des Erasmus «Encomium moriae» angeregt, schrieb er 1782 sein «Lob der Dummheit», für das er keinen Verleger fand, und in demselben Jahre die «Grönländischen Prozesse», mit denen er zum erstenmal 1783 an die Öffentlichkeit trat. Man hat wenn man diese Schriften liest, das Gefühl: hier spricht ein Mensch, der nicht bloß an dem, was ihm Verkehrtes begegnet, seinen Groll ausläßt, sondern der alle Schwächen und Schattenseiten, alle Dummheiten und Narrheiten, alle Verlogenheiten und Feigheiten des Lebens mühsam zusammen-sucht, um sie mit seinem Witz verfolgen zu können. Die Wurzeln, durch die Jean Paul mit der Wirklichkeit zusammenhing, waren kurz und dünn. Hatte er irgendwo einen Halt gefaßt, so konnte er ihn leicht wieder lösen und seine Wurzeln in andres Erdreich verpflanzen. Sein Leben ging in die Breite, aber nicht in die Tiefe. Am deutlichsten wird das aus seinem Verhältnisse zu den Frauen. Er liebte nicht mit der ganzen elementaren Wucht des Herzens. Seine Liebe war ein Spiel mit den Empfindungen der Liebe. Er liebte nicht das Weib. Er liebte die Liebe. Im Jahre 1783 hatte er ein Liebesverhältnis zu einem schönen Lan dmädchen, Sophie Ellrodt in Helmbrechts. Er schreibt ihr eines Tages, daß ihn ihre Liebe glücklich mache; er versichert ihr, daß ihre Küsse bei ihm die Sehnsucht befriedigt haben, die die Augen bei ihm hervorgerufen haben. Aber er schreibt auch bald darauf, daß er in Hof nur deshalb etwas länger geblieben sei, weil er an diesem Orte noch einige Zeit glücklich sein wollte , bevor er es in Leipzig werde (vgl. Paul Nerrlich, Jean Paul, S. 138 f.). Kaum ist er in Leipzig, so ist der ganze Liebestraum
#SE033-287
verblaßt. Ebenso spielend mit den Empfindungen der Liebe waren seine späteren Verhältnisse zu den Frauen; auch das zu seiner Gattin. Seine Liebe hatte etwas Geisterhaftes; der Zusatz von Sinnlichkeit und Leidenschaft hatte zu wenig Wahlverwandtschaft zu dem idealen Elemente seines Liebens.
Die Unsicherheit des Geistes, der geringe Zusammenhang seines Wesens mit den wirklichen Verhältnissen des Lebens machte Jean Paul zuzeiten zum Selbstquäler. Er huschte über die Wirklichkeit nur so hin; deswegen mußte er oft an sich selbst irre werden und Einkehr in die eigene Persönlichkeit halten. Eine bis zur Askese gehende Selbst-quälerei lesen wir aus Jean Pauls Andachtsbüchlein, das er 1784 niederschrieb. Aber auch diese Askese hat etwas Spielendes. Sie bleibt in idealer Träumerei stecken. Wie tief auch die einzelnen Bemerkungen sind, die er sich aufsehreibt, über Schmerz, Tugend, Ruhmsucht, Zorn: man hat immer die Empfindung, Jean Paul wolle sich bloß an der Schönheit seiner Lebensregeln berauschen. Es war ihm ein Labsal, Gedanken wie den folgenden niederzuschreiben: «Der Haß richtet sich nicht nach der moralischen Häßlichkeit, sondern nach deiner Laune, Empfindlichkeit, Gesundheit; kann aber der andre dafür, daß du krank bist. ... Der verletzende Mensch, nicht der verletzende Stein ärgert dich; denke dir also jedes Übel als die Wirkung einer physikalischen Ursache oder als käme es vom Schöpfer, der diese Verkettung auch zuließ.» Wer kann dem glauben, daß es ihm mit solchen Gedanken ernst ist, der fast zu gleicher Zeit die «Grönländischen Prozesse» schrieb, in denen er seine Geißel gegen die Schriftstellerei, gegen das Pfaffentum, gegen den Ahnen-stolz schwang in einer Weise, die durchaus nicht verrät, daß
#SE033-288
er die Verkehrtheiten des Lebens wie die Wirkung einer physikalischen Ursache ansieht.
Die bitterste Not veranlaßte Jean Paul am 27. Oktober 1784, Leipzig wie ein Flüchtling zu verlassen. Er mußte sich seinen Gläubigern heimlich entziehen. Am ,6. November trifft er in Hof bei der ebenfalls völlig verarmten Mutter ein.
#TI
Erziehertätigkeit und Wanderjahre
#TX
Zwei Jahre verlebte Jean Paul in Hof in der Umgebung einer hausbackenen Mutter und inmitten der drückendsten Familienverhältnisse. Neben dem geräuschvollen Treiben der Mutter, dem Waschen und Scheuern, dem Kochen und Plätten, dem Schnurren des Spinnrades träumte er von seinen Idealen. Erst das Neujahr 1787 brachte teilweise Erlösung. Er wurde Hauslehrer bei dem jüngeren Bruder seines Freundes Oerthel in Töpen bei Hof. Hier im Hause des Kammerrats Oerthel gab es wenigstens ein Wesen, das dem idealistischen Träumer, der leicht zur Empfindsamkeit neigte, mit Verständnis entgegenkam. Es war die Frau des Hauses. Sein ganzes Leben hindurch erinnerte Jean Paul sich ihrer in Dankbarkeit. Ihre liebevolle Art machte manches gut, was die Starrheit und Rauheit ihres Gatten bei Jean Paul verdorben. Und wenn der Knabe, den er zu erziehen hatte, durch seinen mißtrauischen Charakter dem Lehrer auch manche Sorge machte, so scheint dieser doch mit einer gewissen Liebe an seinem Zögling gehangen zu haben, denn er sagt später von dem früh Dahingegangenen, daß er das schönste Herz gehabt habe und daß in seinem Kopfe und Herzen die besten Keime von Tugenden und Kenntnissen
#SE033-289
gelegen haben. Nach zwei Jahren schied Jean Paul aus dem Oerthelschen Hause. Wir sind über die Ursachen dieses Ausscheidens nicht unterrichtet. Bald zwang ihn die Not, das alte Schulmeisteramt mit einem neuen zu vertauschen. Er zog nach Schwarzenbach, um den Kindern seiner alten Freunde, des Pfarrers Völkel, des Amtsverwalters Clöter und des Kommissionsrats Vogel, Elementarunterricht zu geben.
In der Hofer und Töpener Zeit trieb das Freundschaftsbedürfnis Jean Pauls die schönsten Früchte. Fehlte Jean Paul zur hingebenden Liebe die Ausdauer in der Leidenschaft, zu der mehr im geistigen Elemente lebenden Freundschaft war er geschaffen. Mit Oerthel und Hermann wurde in dieser Zeit der Freundschaftsbund vertieft. Und als ihm die beiden kurz nacheinander, 1789 und 1790, durch den Tod entrissen wurden, da errichtete er ihnen Denkmäler in seiner Seele, deren Anblick ihn das ganze Leben hindurch zu immer neuem Schaffen anspornte. Die tiefen Blicke, die Jean Paul in Freundesseelen gegönnt waren, bilden starke Miterreger seines dichterischen Schaffens. Jean Paul bedurfte der Anlehnung an Menschen, die mit ganzer Seele an ihm hingen. Der Drang, seine Empfindungen, seine Ideen unmittelbar in eine andere Menschenseele überzuleiten, war groß. Als Glück konnte er es bezeichnen, daß kurz, nachdem ihm Oerthel und Hermann dahingestorben waren, ein anderer Freund sich ihm in treuer Liebe ergab. Es war Christian Otto, der vom Jahre 1790 an in selbstloser Anteilnahme bis zum Tode Jean Pauls dessen geistiges Leben mitlebte.
Wie er die Zeit von 1783 bis 1790 verbrachte, schildert Jean Paul selbst. «Ich genoß täglich während der ganzen Zeit die schönsten Gegenstände des Lebens, den Herbst, den
#SE033-290
Sommer, den Frühling mit ihren Landschaften auf der Erde und im Himmel, aber ich hatte nichts zu essen und anzuziehen, sondern blieb in Hof im Voigtlande blutarm und wenig geachtet.» In dieser Zeit entstand seine «Auswahl aus des Teufels Papieren nebst einem nötigen Aviso vom Juden Mendel». In diesem Buche tritt neben dem polemischen der gestaltende Satiriker auf. Die Kritik hat sich zum Teil in Erzählung verwandelt. Personen treten auf statt der früheren abstrakten Vorstellungen. Was aber hier noch mühsam nach Verkörperung ringt, das ersteht in vollendeterer Form in den drei Erzählungen, die 1790 entstanden sind: «Des Amtsvogts Freudel Klaglibell gegen seinen verfluchten Dämon»; «Des Rektors Fälbel und seiner Primaner Reise nach dem Fichtelberg» und in dem «Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Wuz in Auenthal». In diesen drei Dichtungen gelingt es Jean Paul Charaktere zu zeichnen, in denen die Menschlichkeit zur Karikatur wird. Freudel, Fälbel und Wuz erscheinen so, wie wenn Jean Paul sein Idealbild des Menschen in Spiegeln ansähe, die alle Züge verkleinert und noch dazu verzerrt erscheinen lassen. Aber er schafft dabei doch Nachbilder der Wirklichkeit. In Freudel ist der Typus des Menschen dargestellt, der in Augenblicken, wo ihm der größte Ernst und feierliche Würde nötig ist, durch die Tücke seiner Zerstreutheit oder des Zufalls lächerlich wird. Eine andere Art Menschenkarikatur, welche die ganze Welt aus dem engsten Gesichtswinkel des eigenen Berufes beurteilt, ist in Fälbel charakterisiert. Ein Schulmeister, der glaubt, die große französische Gesellschaftsumwälzung wäre unmöglich gewesen, wenn die Revolutionshelden, statt die bösen Philosophen zu lesen, die alten Klassiker kommentiert hätten. Ein herrliches Bild verkümmerten Menschentums
#SE033-291
ist der Auenthaler Schulmeister Maria Wuz. Er lebt in seiner Dorfidylle das menschliche Leben in mikroskopischer Kleinheit, aber er ist so vergnügt und zufrieden dabei, wie es keiner der größten Weisen sein kann.
Ob Jean Paul ein guter Schulmeister war, ist schwer zu entscheiden. Wenn er die Grundsätze, die er sich in seine Tagebücher geschrieben hat, auch zu befolgen imstande war, dann hat er jedenfalls aus seinen Zöglingen das gemacht, was sie ihren Anlagen nach werden konnten. Fruchtbarer aber als für seine Schüler ist die Schulmeisterei gewiß für ihn selbst gewesen. Denn er hat tiefe Einsichten in die junge Menschennatur gewonnen, die ihn zu den großen pädagogischen Ideen führte, die er später in seiner «Levana» ausgeführt hat. Die Enge des Amtes hätte er aber kaum drei Jahre lang ertragen, wenn er in seinen Besuchen in Hof nicht einen Ableiter gefunden hätte, der ganz seiner Natur entsprach. Er war ein Feinschmecker in den geistigen Genüssen, die sich aus den Verhältnissen zu begabten und erregbaren Menschen ergeben. Er ist in Hof stets umringt von einer Schar von jungen Mädchen, die ihn anschwärmen und die seine Phantasie beleben. Er betrachtete sie als seine «erotische Akademie». Er verliebte sich, soweit er lieben konnte, in eine jede der Akademikerinnen, und stets war der Rausch des einen Liebesverhältnisses noch nicht verflogen, als wieder ein neuer begann.
Aus dieser Stimmung heraus erwuchsen die beiden Romane: die «Unsichtbare Loge» und der «Hesperus». Gustav, die Hauptfigur der «Unsichtbaren Loge», ist eine Natur wie Wuz, die nur über das Wuz-Dasein hinauswächst und genötigt ist, ihr zartes Herz, das im engumgrenzten Kreise zufrieden sein könnte, von der rauhen Wirklichkeit foltern
#SE033-292
zu lassen. Der Gegensatz von idealer Sinnesweise und dem, was im Leben wirklich Geltung hat, bildet das Grundmotiv des Romans. Und dieses Motiv wird Jean Pauls großes Lebensproblem. In immer neuen Gestaltungen tritt es in seinen Schöpfungen auf. In der «Unsichtbaren Loge» hat die ideale Sinnesweise den Charakter tiefer Gemütsinnigkeit, die zur Gefühlsduselei neigt; im «Hesperus» nimmt sie eine vernunftgemäßere Form an. Die Hauptperson, Viktor, schwärmt nicht mehr bloß mit dem Herzen wie Gustav, sondern auch mit dem Verstande und der Vernunft. Viktor greift aktiv in die Lebensverhältnisse ein, während Gustav sie passiv auf sich wirken läßt. Die Empfindung, die sich durch die beiden Romane durchzieht, ist diese: die Welt ist nicht gemacht für die guten und großen Menschen. Diese müssen sich auf eine ideale Insel ihres Innern zurückziehen und ein Dasein noch außer und über der Welt führen, um mit deren Jämmerlichkeit auszukommen. Der große Mensch mit edlem Wesen, genialem Geist und energischem Wollen, der über die Welt weint oder lacht, niemals aber das Wohlgefühl der Zufriedenheit aus ihr saugt, ist das eine der Extreme, zwischen die alle Jean Paulsehen Charaktere zu stellen sind. Das andere ist der kleine, beschränkte Mensch mit subalterner Gesinnung, der mit der Welt zufrieden ist, weil ihm sein leerer Geist keine Träume von einer größeren vorzaubert. Dem letzteren Extrem nähert sich die Gestalt des Quintus Fixlein in der 1794 entstandenen Erzählung «Leben des Quintus Fixlein aus fünfzehn Zettelkästen gezogen»; dem ersteren die folgende in demselben Jahr geschriebene Dichtung «Jean Pauls biographische Belustigungen unter der Gehirnschale einer Riesin». Fixlein ist glücklich bei bescheidenen Zukunftsplänen und kleinlichster Gelehrtenarbeit;
#SE033-293
Lismore, die Hauptperson der «Belustigungen», leidet an der Disharmonie seines energischen Wollens und schwächeren Könnens und an der anderen zwischen seinen idealistisch-hohen Vorstellungen von der Menschennatur und denen seiner Mitmenschen. Der Kampf, der entsteht, wenn starkes, die Grenzen des Wirklichen überfliegendes Wollen und aus den beschränkten Bedingungen eines kleinliehen Daseins herauswachsende menschliche Gesinnung aufeinander stoßen, ist von Jean Paul in dem Ostern 1795 erschienenen Buche «Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschn appel» dargestellt worden. Zwei Menschen sind es hier, die sich wegen ihrer höheren Natur nicht mit der Welt abzufinden wissen. Der eine, Siebenkäs, glaubt an ein höheres Dasein und leidet darunter, daß dieses in der Welt nicht zu treffen ist; der andere, Leibgeber, durchschaut zwar die Nichtigkeit des Weltwesens, glaubt aber nicht an die Möglichkeit eines irgendwie gearteten Besseren. Er ist Humorist, der von dem Leben nichts hält und über die Wirklichkeit lacht; aber er ist zugleich Zyniker, den nicht Höheres kümmert und der alle idealistischen Träume für Schaumblasen hält, die der Menschheit zum Hohne aus dem Schmutze der Gemeinheit als Dunst emporsteigen. Siebenkäs leidet durch seine Gattin Lenette, in der die philiströse, bornierte Wirklichkeit verkörpert ist; und Leibgeber leidet an seiner Glaubens- und Hoffnungslosigkeit. Aber er erhebt sich stets mit Humor über dieselbe. Er fordert von dem Leben nichts Außerordentliches; deshalb sind seine Enttäuschungen nicht groß und deshalb hält er es auch nicht für notwendig, an sich selbst höhere Forderungen zu stellen.
#SE033-294
Noch vor Beendigung des «Hesperus» hatte Jean Paul die Lehr- und Erziehertätigkeit in Schwarzenbach mit einer solchen in Hof vertauscht. Im Sommer 1796 unternahm er eine Reise nach Weimar. So wie die Helden seiner Romane inmitten einer sie nicht befriedigenden Wirklichkeit, fühlt sich Jean Paul in der Musenstadt. In diesem kleinen Orte hätte nach seiner Meinung alles zusammengedrängt sein müssen, was die Wirklichkeit an Größe und Erhabenheit enthalten kann. Riesen und Titanen an Geist und Phantasie hatte er zu begegnen gehofft, wie er sich solche in seinen Träumen bis zur Übermenschlichkeit vorgegaukelt hatte. Und er fand zwar Genies, aber doch nur Menschen. Weder zu Goethe noch zu Schiller fand er sich hingezogen. Beide hatten damals schon ihren Frieden mit der Welt gemacht; beiden hatte sich die Erkenntnis der großen Weltharmonie eröffnet, die nach langem Kampfe den Menschen Frieden mit der Wirklichkeit schließen läßt. Jean Paul durfte diesen Frieden nicht finden. Seine Seele war für die Wollust des Kampfes zwischen Ideal und Wirklichkeit geschaffen. Goethe erschien ihm steif, kalt, stolz, zugefroren gegen alle Menschen; Schiller felsicht und hart, so daß fremde Begeisterung an ihm abprallt. Nur mit Herder entwickelte sich ein schöner Freundschaftsbund. Der Theologe, der das Heil jenseits der wirklichen Welt suchte, konnte Jean Paul ein Genosse sein, nicht aber die Weltmenschen Goethe und Schiller, die Vergötterer des Wirklichen. Ein gleiches Gefühl wie zu Herder zog Jean Paul zu Jacobi, dem philosophischen Fischer im Trüben. Der Verstand und die Vernunft durchdringen die Wirklichkeit und erhellen sie mit dem Lichte der Idee; das Gefühl hält sich an das Dunkle, Unerkennbare, an die Welt des Glaubens. Und in der Welt des Glaubens schwelgte
#SE033-295
Jacobi und schwelgte auch Jean Paul. Dieser Zug seines Geistes eroberte ihm die Herzen der Frauen. Karoline Herder schwärmte für den Dichter der Gefühlsinnigkeit, und Charlotte von Kalb verehrte in ihm das Ideal eines Menschen.
Ganz in die Unbestimmtheit der Gefühlsschwelgerei und in eine weltfremde Denkweise und Gesinnung verlor sich Jean Pauls Dichtung nach seiner Rückkehr aus Weimar in dem «Jubelsenior» und in dem «Kampanerthal oder über die Unsterblichkeit der Seele» (1797). Hatte ihm die Reise nach Weimar die Augen für eine unbefangene Betrachtung des Lebens nicht gekräftigt, so konnte es noch weniger die wechselreiche Wanderung, die von 1797 bis 1804 dauerte. Nacheinander lebte er jetzt in Leipzig, Weimar, Berlin, Meiningen und Koburg. Überall knüpfte er Beziehungen zu Menschen, namentlich zu Frauen an; überall wurde er mit offenen Armen empfangen. Die Menschen berauschten sich an seinen aus den Tiefen der Gefühlswelt strömenden Ideen. Aber die Anziehungskraft, die sie auf ihn ausübten, stumpfte sich zumeist bald ab. Mit dicken Fangarmen umspann er die Personen, die er kennen lernte; aber bald zog er diese Arme wieder ein. In Weimar verlebte Jean Paul glückliche Tage im Umgang mit Frau von Kalb, der Herzogin Amalia, Knebel, Böttiger u. a.; in Hildburghausen trieb er sein Liebesspiel so weit, daß er sich mit Caroline von Feuchtersleben verlobte, um sich bald darauf wieder von ihr zu trennen. Aus Berlin holte er sich das weibliche Wesen, das wirklich seine Frau wurde, Karoline, die zweite Tochter des Obertribunalrats Maier. Mit ihr ging er eine Ehe ein, die ihn anfänglich auf die höchsten Höhen des Glücksgefühles hob, die ein Mensch erklimmen kann, und aus der dann so sehr alles Glück entschwand, daß Jean Paul nur aus Pflicht an
#SE033-296
ihr festhielt und Karoline mit Ergebung und Selbstentäußerung sie ertrug. Bei der Verbindung mit Jean Paul schrieb diese Frau an ihren Vater: «So glücklich als ich bin, glaubte ich nie zu werden. Sonderbar wird es Ihnen klingen, wenn ich Ihnen sage, daß der hohe Enthusiasmus, der mich bei Richters Bekanntschaft hinriß, der aber hernach durch das Hinabsteigen in das reellere Leben verging, jeden Tag von neuem auflebt.» Und im Juli 1820 gesteht sie, daß sie kein Recht mehr auf sein Herz habe, daß sie armselig und elend sich gegen ihn vorkomme.
In Meiningen und Koburg konnte Jean Paul die Gipfel kennen lernen, von denen aus die Welt regiert wird. Die Herzoge an beiden Orten standen in dem freundschaftlichsten Verhältnisse zu ihm. Er durfte bei keinem Hoffeste fehlen. Wer geistvolle Unterhaltung und Anregung suchte, schloß sich ihm an.
Die beiden bedeutendsten Dichtungen Jean Pauls, der «Titan» und die «Flegeljahre», entstanden in den Jahren der Wanderschaft. Gesteigert erscheint seine dichterische Kraft, in schärferen Umrissen arbeitet seine Phantasie in diesen Werken. Die Personen derselben sind denen verwandt, die uns in seinen früheren Schöpfungen begegnen; aber der Künstler hat größere Sicherheit in der Zeichnung und lebensvollere Farbengebung gewonnen. Er ist auch von der Schilderung der Außenseite des Menschen in die Tiefen der Seelen hinabgestiegen. Erscheinen Siebenkäs, Wuz, Fälbel wie Silhouetten, so zeigen sich der Albano und Schoppe des «Titan», die Walt und Vult der «Flegeljahre» als vollendet gemalte Figuren. Albano ist der Mensch des starken Willens. Er will Großes, ohne zu fragen, woher ihm die Kräfte der Ausführung kommen sollen. Er hat eine Sucht,
#SE033-297
alle Fesseln des Menschlichen zu sprengen. Leider ist gerade dieses Menschliche bei ihm in enge Grenzen eingeschlossen. Ein weiches Herz, eine überzarte Empfindsamkeit stumpfen die Kraft seiner Phantasie ab. Weder die schwärmerische Liana mit den feinen Nerven und der grenzenlosen Selbst-losigkeit vermag er wirklich zu lieben, noch die übergeniale freigeistige Linda. Er kann überhaupt nicht lieben, weil seine Ideale ihn mehr von der Liebe verlangen lassen, als diese bieten kann. Linda will Hingebung und nichts als Hingebung von Albano; er aber findet, daß er ihre Liebe durch große Taten, durch Teilnahme an dem großen Freiheitskrieg erst erringen müsse. Er will erst erwerben, was er mühelos haben könnte. Die Wirklichkeit an sich ist ihm nichts; erst wenn er ein Ideal mit ihr verbinden kann, wird sie ihm etwas. Angesichts der großen Kunstwerke in Rom gehen ihm nicht die Geheimnisse der Kunst auf, sondern sein Tatendrang erwacht. «Wie in Rom ein Mensch nur genießen und an dem Feuer der Kunst weich zerschmelzen kann, anstatt sich schamrot aufzumachen und nach Kräften und Taten zu ringen», das begreift er nicht. Aber dieser Tatendrang findet zuletzt doch nur dadurch Nahrung, daß sich herausstellt, Albano ist ein Fürstensohn und daß ihm der Thron erblich zufällt. Und sein Liebesbedürfnis wird gestillt durch die bornierte, jedes höheren Schwunges bare Idoine. Dem Albano steht Schoppe gegenüber, der ein Leibgeber in gesteigerter Form ist. Er macht sich keine Gedanken über die Nichtigkeit der Welt, denn er weiß, daß sie nicht anders sein kann. Wertlos erscheint ihm das Leben; nichts hat für ihn Wert als die persönliche Freiheit und grenzenlose Unabhängigkeit. Nur ein Kampf könnte für ihn Wert erhalten, der um die unbedingte Freiheit des Individuums. Alles sonstige
#SE033-298
Treiben verlacht er. Nichts ängstigt ihn als sein eigenes Ich. Alles übrige scheint ihm nicht des Nachdenkens wert , nicht der Begeisterung und nicht des Hasses; aber sein Ich fürchtet er. Es ist ihm das einzige große Rätsel, das ihn verfolgt. Es treibt ihn zuletzt in den Wahnsinn, weil es ihn verfolgt als ein einziges Wesen inmitten einer schauerlichen Leere.
Etwas von dieser Furcht vor dem Ich lebte in Jean Paul selbst. Es war ihm ein unheimlicher Gedanke, in die Untiefen des Geistes hinabzusteigen und zu schauen, wie das menschliche Ich am Werke ist, um all das hervorzubringen, was aus der Persönlichkeit hervorquillt. Deshalb haßte er den Philosophen, der dieses Ich in seiner Nacktheit gezeigt hatte, Fichte. Er verspottete ihn in seiner «Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana» (1801).
Und Jean Paul hatte Grund, den Einblick in sein tiefstes Innere zu scheuen. Denn darin führten zwei Ichs eine Zwiesprache, die ihn manchmal zur Verzweiflung trieb. Da war das Ich mit den goldenen Träumen einer höheren Weltordnung, das über die gemeine Wirklichkeit trauerte und in sentimentaler Hingabe an ein unbestimmtes Jenseits sich verzehrte; und da war das zweite Ich, welches das erste verspottete ob seiner Schwärmerei, welches ganz gut wußte, daß die unbestimmte Idealwelt von keiner Wirklichkeit je erreicht werden kann. Das erste Ich hob Jean Paul über die Wirklichkeit hinweg in die Welt seiner Ideale; das zweite war sein praktischer Ratgeber, der ihn immer wieder daran erinnerte, daß der sich mit den Bedingungen des Lebens abfinden muß, der leben will. Diese zwei Naturen in seiner eigenen Persönlichkeit hat er auf zwei Menschen, auf die Zwillingsbrüder Walt und Vult, verteilt und ihr gegenseitiges
#SE033-299
Verhältnis in den «Flegeljahren» dargestellt. Wie wenig Jean Pauls Idealismus in der Wirklichkeit wurzelt, zeigt am besten die Einleitung des Romans. Nicht die Verkettungen des Lebens sind es, die den Schwärmer Walt zu einem für die Wirklichkeit brauchbaren Menschen machen sollen, sondern die Willkür eines Sonderlings, der sein ganzes Vermögen dem phantasievollen Jüngling vererbt hat, aber unter der Bedingung, daß diesem verschiedene praktische Verpflichtungen auferlegt werden. Jedes Mißlingen einer solchen praktischen Betätigung zieht sofort den Verlust eines Teils der Erbschaft nach sich. Walt ist nur mit Hilfe seines Bruders Vult fähig, sich durch die Aufgaben des Lebens durchzufinden. Vult greift mit derben Händen und starkem Wirklichkeitssinn alles an, was er beginnt. Zu schönem harmonischen Streben ergänzen sich erst die Naturen der beiden Brüder eine Zeitlang, um sich später doch zu trennen. Dieser Schluß deutet wieder auf Jean Pauls eigenes Wesen hin. Nur zeitweilig bewirkten seine zwei Naturen ein harmonisches Ganzes; immer wieder litt er durch ihr Auseinanderstreben, durch ihren unversöhnlichen Gegensatz.
Niemals gelang es Jean Paul wieder, in solcher Vollendung dichterisch darzustellen, was ihn selbst am tiefsten bewegte, wie in den «Flegeljahren». Im Jahre 1803 begann er die philosophischen Gedanken aufzuzeichnen, die er sich im Laufe des Lebens über die Kunst gebildet hatte. Daraus entstand seine «VQrschule der Ästhetik». Kühn sind diese Gedanken, und ein helles Licht werfen sie auf das Wesen der Kunst und des künstlerischen Schaffens. Intuitionen eines Mannes sind sie, der alle Geheimnisse dieses Schaffens in eigener Produktion erfahren hatte. Was der Genießende aus dem Kunstwerke saugt, was der Schaffende in dasselbe
#SE033-300
hineinlegt: es ist hier mit unendlicher Schönheit gesagt. Die Psychologie des Humors wird in tiefinnigster Weise aufgedeckt: das Schweben des Humoristen in den Sphären des Erhabenen, sein Gelächter über die Wirklichkeit, die so wenig von diesem Erhabenen hat, und der Ernst dieses Gelächters, der nur deshalb über die Unvollkommenheiten des Lebens nicht weint, weil er aus der menschlichen Größe stammt.
Nicht weniger bedeutend sind Jean Pauls Ideen über Erziehung, die er in seiner «Levana» (1806) niedergelegt hat. Sein Sinn für das Ideale kommt diesem wie keinem anderen seiner Werke zugute. Nur dem Erzieher ziemt es wirklich, Idealist zu sein. Er wirkt um so fruchtbarer, je mehr er an das Unbekannte in der Menschennatur glaubt. Ein Rätsel, das zu lösen ist, soll dem Erzieher jeder Zögling sein. Das Wirkliche, Ausgebildete soll ihm nur dazu dienen, ein Mögliches, noch zu Bildendes zu entdecken. Was wir oft als Mangel bei Jean Paul dem Dichter empfinden, daß es ihm nicht gelingt, den Einklang zu finden zwischen dem, was er mit seinen Gestalten will, und dem, was sie wirklich sind: bei Jean Paul, dem Lehrer der Erziehungskunst, wirkt dies als großer Zug. Und der Sinn für menschliche Schwächen, der ihn zum Satiriker und Humoristen machte, ermöglichte es ihm, dem Erzieher bedeutsame Winke zu geben, diesen Schwächen entgegenzuarbeiten.
#TI
Bayreuth
#TX
Im Jahre 1804 siedelte Jean Paul nach Bayreuth über, um diese Stadt bis zum Ende seines Lebens zum dauernden Aufenthalte zu machen. Er fühlte sich wieder glücklich, die Berge
#SE033-301
seiner Heimat um sich zu sehen und in ruhigen, kleinen Verhältnissen seinen poetischen Träumen nachzuhängen. Etwas gleich Vollkommenes wie den «Titan», die «Flegeljahre», die «Vorschule» und die «Levana» hat er nicht mehr geschaffen, obwohl sein Tätigkeitsdrang einen fieberhaften Charakter annahm. Verstimmungen über die Zeitereignisse, über die elenden Zustände des Deutschen Reiches, eine innere nervöse Unruhe, die ihn stets wieder auf Reisen trieb, unterbrechen den regelmäßigen Gang seines Lebens. Eine halbe Stunde von Bayreuth entfernt hatte er sich für eine Zeitlang ein stilles Heim im Hause der für ihn mütterlich sorgenden und durch ihn berühmt gewordenen Frau Rollwenzel eingerichtet. Er brauchte den Wechsel des Ortes, um schaffen zu können. Hatte es ihm erst genügt, sein Familien-heim jeden Tag für Stunden zu verlassen und die «Rollwenzelei» zum Schauplatz seiner Tätigkeit zu machen, so wurde später auch das anders. Er machte Reisen nach verschiedenen Orten: nach Erlangen (1811), Nürnberg (1812), Regensburg (1816), Heidelberg (1817), Frankfurt (1818), Stuttgart, Löbichau (1819), München (1820). In Nürnberg hatte er die Freude, den geliebten Jacobi, mit dem er bis dahin nur brieflich verkehrt hatte, auch persönlich kennen zu lernen. In Heidelberg wurde von alt und jung sein Genius gefeiert. In Stuttgart trat er zu dem Herzog Wilhelm von Württemberg und zu dessen begabter Frau in ein nahes Verhältnis. In Löbichau verlebte er im Hause der Herzogin Dorothea von Kurland die schönsten Tage. Eine Gesellschaft auserlesener Frauen umgab ihn hier, so daß er sich wie auf einer romantischen Insel zu befinden glaubte.
Der faszinierende Einfluß, den Jean Paul auf die Frauen übte und der sich bei Karoline Herder und Charlotte von
#SE033-302
Kalb und vielen anderen zeigte, führte 1813 zu einer Tragödie. Maria Lux, die Tochter eines Mainzer Republikaners der in der Katastrophe der Charlotte Corday eine Rolle gespielt hat, faßte eine heftige Leidenschaft zu Jean Pauls Schriften, die bald in eine glühende Liebe zu dem von ihr persönlich nicht gekannten Dichter überging. Das unglückliche Mädchen war bestürzt, als sie sah, daß das Gefühl der Verehrung für den Genius bei ihr immer stürmischer in leidenschaftliche Neigung für den Menschen sich verwandelte, und gab sich selbst den Tod. Wenn auch nicht einen gleich erschütternden, doch einen tief ergreifenden Eindruck macht die Neigung von Sophie Paulus in Heidelberg. In fortwährendem Hin- und Herschwanken zwischen Stimmungen der feurigen Liebe und bewunderungswürdiger Entsagung und Selbstbeherrschung zehrt sich dieses Mädchen auf, bis sie, unsicher über sich selbst geworden, fünfundzwanzigjährig dem alten A. W. Schlegel die Hand reicht zu einem Bunde, den die Gegensätzlichkeit der Naturen bald zersprengt.
Die heitere Überlegenheit, die ihn befähigte, humorvolle Bilder des Lebens zu schaffen, hat Jean Paul in Bayreuth völlig verlassen. Was er noch produziert, trägt einen ernsteren Grundton. Er vermag zwar noch immer nicht Gestalten zu schaffen, die ein der idealen Menschennatur, die ihm vorschwebt, angemessenes Dasein führen; aber er schafft solche, die ihren Frieden mit der Wirklichkeit gemacht haben. Selbstzufriedene Charaktere sind Katzenberger in «Katzenbergers Badereise» (1808) und Fibel im «Leben Fibels» (1811). Glücklich ist Fibel, trotzdem er es nur zu der bescheidenen Abfassung eines Abcbuches bringt, und glücklich ist Katzenberger in seinem Studium von Mißgeburten. Beide
#SE033-303
sind Zerrbilder des Menschentums, aber man hat weder Ursache über sie zu spotten, noch wie bei Wuz auf ihre beschränkte Glückseligkeit mit Rührung zu blicken. Von ihnen unterscheidet sich der vor ihnen (1807) entstandene Schmelzle in «Des Feldprediger Schmelzles Reise nach Flätz». Fibel und Katzenberger sind zufrieden in ihrem gleichgültigen nichtigen Dasein; Schmelzle ist ein unzufriedener Hasenfuß, der sich vor eingebildeten Gefahren ängstigt. Aber auch in dieser Dichtung findet sich nichts mehr von Jean Pauls großem Problem, von dem Zusammenstoße der idealen, phantastischen Traumwelt mit der realen Wirklichkeit. Ebensowenig verspürt man etwas von einem Kampf der beiden Welten in der letzten großen Dichtung Jean Pauls, im «Komet», an dem er viele Jahre (1815 bis 1820) arbeitete. Nikolaus Marggraf möchte die Welt beglücken. Seine Pläne sind zwar phantastisch. Aber er empfindet niemals, daß sie nur ein Traum sind. Er glaubt an sich und seine Ideale und ist in diesem Glauben glücklich. Aufsätze, die mit Beziehung auf die politischen Verhältnisse in Deutschland geschrieben sind, und solche, in denen Jean Paul sich über allgemeine Fragen der Wissenschaft und des Lebens ausspricht, entstanden zwischen den größeren Arbeiten. Sie sind zum Teil gesammelt in «Herbstblumine» (1810, 1815, 1820) und in seinem «Museum» (1812). Als Patriot tritt der Dichter auf in seinem «Freiheitsbüchlein» (1805), in der «Friedenspredigt» (1808) und in den «Dämmerungen für Deutschland» (1809).
In seiner Bayreuther Zeit sieht man die humoristische Stimmung Jean Pauls immer mehr einer solchen weichen, welche die Welt und die Menschen nimmt wie sie sind, trotzdem er überall nur Unvollkommenes und Kleines sieht.
#SE033-304
Er ist verstimmt über die Wirklichkeit, aber er erträgt die Verstimmung.
Kein heiterer Lebensabend war dem großen Humoristen beschieden. Drei Jahre vor seinem Ende mußte er seinen Sohn Max hinsterben sehen, mit dem er eine Fülle von Zukunftshoffnungen und den größten Teil seines persönlichen Glückes zu Grabe trug. Ein Augenleiden, das den Dichter befiel, steigerte sich in den letzten Jahren bis zur völligen Erblindung. Ganz in sein Inneres vertiefte sich der Greis nun, der die Außenwelt nicht mehr sehen konnte. Er lebte nun das Leben, von dem er meinte, daß es nicht mehr dieser Welt angehörte, schon vor dem Tode und holte aus dem Schachte dieser inneren Erlebnisse die Gedanken zu seiner «Selina» oder «Über die Unsterblichkeit der Seele», in der er wie ein Verklärter spricht, und wirklich zu sehen glaubt, wovon er sein ganzes Leben hindurch geträumt hat. Am 14. November 1825 starb Jean Paul. Die «Selina» erschien erst nach seinem Tode.
LUDWIG UHLAND
#G033-1967-SE305 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
LUDWIG UHLAND
Uhland und Goethe
#TX
Am 3. September 1786 trat Goethe, von Karlsbad aus, seine italienische Reise an. Sie brachte ihm eine Wiedergeburt seines geistigen Lebens. Italien gab seinem Erkenntnisdrang, seinen künstlerischen Bedürfnissen die Befriedigung. Bewundernd stand er vor den Kunstwerken, die ihn einen tiefen Blick in das Vorstellungsleben der Griechen tun ließen. Das Gefühl, das diese Kunstwerke in seiner Seele wachriefen, beschreibt er in seiner «Italienischen Reise». «Jeden Augenblick» fühlt er sich zu der Betrachtung aufgefordert, um «aus der menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist, und worin kein Hauptcharakter so wenig als die Übergänge und Vermittelungen fehlen.» Er hat «eine Vermutung, daß die Griechen nach eben den Gesetzen verfuhren, nach welchen die Natur verfährt, und denen er auf der Spur ist».
Wie er diese Erkenntnis als geistige Wiedergeburt empfindet, das spricht er mit den Worten aus: « Ich habe viel gesehen und noch mehr gedacht: die Welt eröffnet sich mehr und mehr; auch alles, was ich schon lange weiß, wird mir erst eigen. Welch ein früh wissendes und spät übendes Ge-schöpf ist doch der Mensch!» - Bis zu religiöser Inbrunst steigert sich sein Gefühl gegenüber den Schöpfungen der alten Kunst: «Diese hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natür-lichen Gesetzen hervorgebracht worden. Alles Willkürliche,
#SE033-306
Eingebildete fällt zusammen: da ist Notwendigkeit, da ist Gott.»
Alles sieht Goethe, seit er sich in solcher Art in ein Kunstideal versenkt hat, in einem neuen Lichte. Dieses Ideal wird für ihn Maßstab bei Beurteilung einer jeglichen Erscheinung. Man kann das selbst an Kleinigkeiten beobachten. Als er am 26. April 1787 in Girgenti weilt, beschreibt er seine Empfindung mit den Worten: «In dem weiten Raume zwischen den Mauern und dem Meere finden sich noch die Reste eines kleinen Tempels, als christliche Kapelle erhalten. Auch hier sind Halbsäulen mit den Quaderstücken der Mauer aufs schönste verbunden, und beides ineinander gearbeitet, höchst erfreulich dem Auge. Man glaubt genau den Punkt zu fühlen, wo die dorische Ordnung ihr vollendetes Maß erhalten hat. »
Der Zufall fügte es, daß an dem Tage, an dem Goethe durch Anknüpfung solcher Worte an eine untergeordnete Erscheinung seine Überzeugung von der hohen Bedeutung der alten Kunst zum Ausdruck brachte, ein Mann geboren wurde, der sein fast entgegengesetztes Glaubensbekenntnis in den Satz zusammenfaßte:
Nicht in kalten Marmorsteinen,
Nicht in Tempeln, dumpf und tot,
In den frischen Eichenhainen,
Webt und rauscht der deutsche Gott.
#TI
Uhlands Knahenzeit
#TX
Dieser Mann ist Ludwig Uhland, der am 26. April 1787 in Tübingen geboren wurde. Als er am 24. Mai 1812 sein Gedicht «Freie Kunst» mit den obigen Worten schloß, dachte
#SE033-307
er sicherlich nicht daran, etwas gegen Goethes Weltauffas-sung zu sagen. Sie dürfen auch nicht in dem Sinne angeführt werden, um einen Gegensatz zwischen Goethe und Uhland vor Augen zu stellen. Aber sie sind doch bezeichnend für Uhlands ganze Eigenart. Sein Lebensweg mußte ein anderer werden als der Goethes. Wie dessen ganzes Innere auflebte vor den «hohen Kunstwerken» der Alten, so dasjenige Uhlands, wenn er sich in die Tiefen der deutschen Volksseele versenkte. Dieser Volksseele gegenüber hätte er aus-rufen können: «Da ist Notwendigkeit, da ist Gott.» Er hat diese Empfindung, wenn er, durch den Wald schweifend, die heimische Natur bewundert:
Kein' bess're Lust in dieser Zeit,
Als durch den Wald zu dringen,
Wo Drossel singt und Habicht schreit,
Wo Hirsch und Rehe springen.
Er hat das gleiche Gefühl, wenn er, die Kunst der deutschen Vorzeit betrachtend, über Walther von der Vogelweide schreibt: «Ihm gebührt unter den altdeutschen Sängern vorzugsweise der Name des vaterländischen. Keiner hat, wie er, die Eigentümlichkeit seines Volkes erkannt und empfunden. Wie bitter wir ihn klagen und tadeln hören, mit stolzer Begeisterung singt er anderswo den Preis des deutschen Landes, vor allen andern, deren er viele durchwandert:
Ihr sollt sprechen: willekommen!
Uhlands Abstammung und Jugendentwickelung waren der Ausbildung seines Zuges zum Volkstümlichen im höchsten Grade förderlich. Die Familie des Vaters war eine alt-württembergische, die mit allen Gesinnungen und Gewohnheiten
#SE033-308
in dem Landesteile wurzelte, dem sie angehörte. Der Großvater war eine Zierde der Tübinger Universität als Theologieprofessor, der Vater wirkte als Sekretär an dieser Hochschule. Die zartsinnige, phantasievolle Mutter stammte aus Eßlingen. Es waren günstige Verhältnisse, in denen der stille, in sich gekehrte, äußerlich unbeholfene, ja linkische, im Innern aber heitere und für alles Große und Schöne begeisterungsfähige Knabe heranwuchs. Er konnte viele Zeit in der Bibliothek des Großvaters zubringen und seinen Wissensdrang in den verschiedenen Richtungen befriedigen. Er vertiefte sich ebenso gern in die Schilderung bedeutender Persönlichkeiten und in die Erzählungen großer weltgeschichtlicher Ereignisse wie in die Beschreibungen der Natur. Ernste Dichtungen, in denen sich das Seelenleben tiefer Menschen aussprach, wie diejenigen Ossians und Höltys, machten frühzeitig auf ihn einen großen Eindruck. Dieser frühe Ernst Ludwig Uhlands war weit entfernt von jeder Duckmäuserei. Deutete seine hohe Stirne auf sein sinnvolles Gemüt, so verriet sein schönes blaues Auge und sein heiterer Sinn die innigste Lebensfreude und den Anteil, den er an den kleinsten Lustbarkeiten des Daseins nehmen konnte. Er war stets bei allen frohen Spielen, bei Springen, Klettern, Schlittschuhlaufen dabei. Er konnte nicht nur stundenlang, in einem Winkel sitzend, sich in ein Buch vertiefen, sondern auch durch Wald und Feld schweifen und sich ganz den Schönheiten des Naturlebens hingeben. Alles Lernen wurde ihm, bei solchen Anlagen, leicht. Frühzeitig kündigte sich bei Uhland die Fähigkeit an, die äußeren Mittel der Dichtkunst zu beherrschen. Die Gelegenheitsgedichte, die er an Eltern oder Verwandte bei Festen richtete, zeigen, wie leicht ihm Vers und Strophenform wurden.
#SE033-309
#TI
Studium und Neigung. Uhland und die Romantik
#TX
Der äußere Studiengang wurde Uhland durch die Verhältnisse aufgezwungen. Er war erst vierzehn Jahre alt, als dem Vater ein Familienstipendium für den Sohn in Aussicht gestellt wurde, falls dieser die Rechtswissenschaft studiere. Ohne Neigung zu diesem Studium zu haben, ergriff er es. Die Art, wie er die Lehrzeit verbrachte, ist für sein ganzes Wesen bezeichnend. Er spaltete sich förmlich in zwei Persönlichkeiten. Ihren dichterischen Neigungen, ihrer phantasievollen, gemütstiefen Weltanschauung, ihrer Versenkung in Geschichte, Sage und Dichtung des Mittelalters lebte die eine Persönlichkeit; dem gewissenhaften Studium der Rechtswissenschaft die andere. Der Tübinger Student lebt einerseits in einer anregenden Hingabe an alles, wonach ihn seines «Herzens Drang» zieht, andrerseits eignet er sich die Gegenstände seines Berufsstudiums so vollendet an, daß er dieses mit einer Doktorarbeit beschließen kann, welche den Beifall der tüchtigsten Fachgelehrten gefunden hat. -Die ersten Gedichte, die Uhland seinen Werken einverleibte, stammen aus dem Jahre 1804. Einen Grundzug seiner Persönlichkeit verraten die beiden Balladen: «Die sterbenden Helden» und «Der blinde Konig ». Hier schon lebt er in einer Vorstellungswelt, die der germanischen Vorzeit entnommen ist. Die Liebe zu dieser Welt hat die schönsten Früchte bei ihm getragen. Die Quellen echter Volkstümlichkeit, das Wesen der Volksseele haben sich ihm durch diese Liebe erschlossen. Als Dichter wie als Gelehrter zog er die besten Kräfte aus dieser Liebe. Und sie war ihm geradezu angeboren. Er durfte von sich sagen, daß sich ihm nicht erst durch Studium die deutsche Vorzeit erschlossen habe, sondern
#SE033-310
daß er sie vorfühlte, wenn er die Blicke auf die hohen Münster der alten Städte richtete. Die Gelehrsamkeit hat ihm nur klare, deutliche Vorstellungen über das gebracht, woran er mit seinem Gefühl von Jugend an hing. - Die Vertiefung in das deutsche Mittelalter war eine der Eigenheiten der als Romantik bezeichneten literarischen Strömung vom Anfange des neunzehnten Jahrhunderts. Ludwig Tieck, de la Motte Fouqué, Clemens Brentano, Achim von Arnim und andere waren Träger dieser Strömung. Sie suchten in der Frömmigkeit und Gemütstiefe Heilung gegen die Schäden, welche die trockene und oft seichte «Aufklärung» des achtzehnten Jahrhunderts in den Geistern angerichtet hatte. So gewiß es ist, daß das Streben nach Aufklärung, die Zuflucht zum eigenen Verstande und der eigenen Vernunft in Dingen der Religion und Lebensauffassung auf der einen Seite segensreich gewirkt haben, so gewiß ist auch, daß auf der anderen Seite die kritische Stellung gegenüber allem religiösen Herkommen und allen alten Überlieferungen eine gewisse Nüchternheit herbeigeführt haben. Das empfanden die Romantiker. Deshalb wollten sie dem ins Extrem gehenden, allzu einseitig-verständigen Zeitgeiste durch Vertiefung in das vorzeitliche Seelenleben aufhelfen. Auch erschien ihnen die Kunstanschauung, die in der alten griechischen Welt ihr Ideal sah, und welche in Goethe und Schiller ihren Höhepunkt erreicht hatte, dann als eine Gefahr, wenn sie über dem fremden Altertum das eigene Volkstum vergißt. Deshalb bestrebten sie sich, das Interesse für echtes deutsches Volkstum zu beleben.
Eine solche Zeitströmung mußte in Uhlands Herzen einen Widerhall finden. Er mußte sich glücklich fühlen, während seiner Universitätszeit in einem Kreise von Freunden zu
#SE033-311
leben, die seine Neigungen nach dieser Richtung hin teilten. Wer in einer ausgesprochenen Weltauffassung lebt, der sieht in einer entgegengesetzten leicht nur die Schattenseiten. So kam es denn auch, daß Uhland und seine Jugendfreunde in Tübingen in ihrer Art den Kampf führten gegen die Auswüchse der aufklärerischen und altertümelnden Anschauung, die ihnen der deutschen Volkstümlichkeit zu widersprechen schienen. Sie gaben ihrem Groll gegen diese in einem «Sonntagsblatt», das sie allerdings nur handschriftlich erscheinen lassen konnten, Ausdruck. Alles, was sie gegen die Kunstrichtung, die im Stuttgarter «Morgenblatt für gebildete Stände» ihre Vertretung hatte, zu sagen hatten, brachten sie zu Papier. Über Uhlands Gesinnung gibt ein Aufsatz des Sonntagsblattes «Über das Romantische» Klarheit. Gewisse Charakterzüge seiner Seele, die man schon hier findet, sind ihm dann das ganze Leben hindurch geblieben. «Das Unendliche umgibt den Menschen, das Geheimnis der Gottheit und der Welt. Was er selbst war, ist und sein wird, ist ihm verhüllt. Süß und furchtbar sind diese Geheimnisse.» Er wollte nicht mit nüchternem Verstande über die Rätsel des Daseins sprechen; er wollte die Urgründe des Daseins als Geheimnisse stehen lassen, denen sich das Gefühl in unbestimmter Ahnung hin geben kann, von denen sich nur die sinnende Phantasie in freien Bildern eine Vorstellung, nicht die klügelnde Vernunft scharf umrissene Ideen machen soll. Die Dichtung wollte er lieber in der unergründlichen Tiefe der Volksseele, als in den hohen Kunst-gesetzen der Griechen suchen. «Die Romantik ist nicht bloß ein phantastischer Wahn des Mittelalters; sie ist hohe, ewige Poesie, die im Bilde darstellt, was Worte dürftig oder nimmer aussprechen, sie ist ein Buch voll seltsamer Zauberbilder,
#SE033-312
die uns im Verkehr erhalten mit der dunklen Geister-welt.» Durch etwas anderes, als durch Bilder der Phantasie die Geheimnisse der Welt auszudrücken, schien ihm wie Entweihung dieser Geheimnisse. Das ist die Gesinnung des zwanzigjährigen Uhland. Er hat sie sich das Leben hindurch bewahrt. Sie ist deutlich auch in dem Schreiben enthalten, das er an Justinus Kerner am 29. Juni 1829 sendet, als dieser ihm sein Buch über die «Seherin von Prevorst» vorgelegt hatte: «Erlaubst du mir, den Eindruck wiederzugeben, den unsere letzten Gespräche mir zurückgelassen, so ist es dieser: was in diesen Arbeiten Dein ist, was rein und ungetrübt aus Deiner Beobachtung und Naturanschauung hervorgeht, davon bin ich des schönsten Gewinnes für alle versichert, denen klar ist, daß man in die wunderbaren Tiefen der Menschen-natur und des Weltlebens ohne die lebendige Phantasie niemals eindringen werde... »
#TI
Freundeskreis
#TX
Die Zeiten, die Uhland im Kreise seiner Universitätsfreunde verlebte, waren solche, die er selbst als «schöne, frohe» bezeichnete. Justinus Kerner, der schwärmerische schwäbische Dichter, Karl Mayer, Heinrich Köstlin, ein Mediziner, Georg Jäger, ein Naturforscher, und Karl Roser, Uhlands späterer Schwager, gehörten zu dem Kreise. 1808 kam Karl August Varnhagen von Ense dazu, der einer Anzahl von Romantikern persönlich nahe stand, und der ganz in deren Anschauungen lebte. Uhlands Dichtungen in dieser Zeit tragen in vieler Beziehung das Gepräge romantischen Geistes. Gestalten und Verhältnisse aus der mittelalterlichen Sagenwelt und Geschichte besingt er; er lebt sich in die
#SE033-313
Empfindungswelten dieser Vorzeit ein und gibt sie charakteristisch wieder. Auch in den Gedichten, die nicht an Mittelalterliches anknüpfen, herrscht ein romantischer Ton als Grundstimmung. Dieser Ton nimmt hier zuweilen ein schwärmerisches, sentimentales Wesen an. Er kommt zum Beispiel in dem Liede «Des Dichters Abendgang» zum Ausdruck. Der Dichter gibt sich den Wonnen des Sonnenunterganges bei einem Spaziergange hin und trägt dann den Eindruck davon mit nach Hause:
Wann aber um das Heiligtum,
Die dunklen Wolken niederrollen,
Dann ist's vollbracht, du kehrest um,
Beseligt von dem Wundervollen.
In stiller Rührung wirst du gehn,
Du trägst in dir des Liedes Segen;
Das Lichte, das du dort gesehn,
Uniglänzt dich mild auf finstern Wegen.
Stimmungen, aus ähnlich romantischem Geist heraus, kommen in den Liedern: «An den Tod», «Der König auf dem Turme», «Maiklage», «Lied eines Armen», «Wunder», «Mein Gesang», «Lauf der Welt», «Hohe Liebe», und anderen, die aus Uhlands Studentenzeit stammen, zum Ausdruck. Und dieselbe romantische Vorstellungsart herrscht in den Romanzen und Balladen, die Uhland damals schrieb:
«Der Sänger», «Das Schloß am Meere», «Vom treuen Walter», «Der Pilger», «Die Lieder der Vorzeit» u. a.
Und dennoch: bei aller romantischen Grundstimmung in Uhlands Wesen und bei aller Sympathie, die er der romantischen Zeitströmung entgegenbrachte, ist ein Gegensatz zwischen ihm und der eigentlichen Romantik vorhanden. Diese ist aus einer Art Widerspruchsgeist erwachsen. Ihre Hauptträger
#SE033-314
wollten der Kunstdichtung, wie sie in Schiller ihren Vertreter fand, und der Aufklärung etwas entgegenstellen, was tief im Volksleben und im Gemüt wurzelte. Sie kamen durch Studium und Gelehrsamkeit zu den Zeiten, in denen, nach ihrer Meinung, Volksgeist und natürliche Herzensfrömmigkeit herrschten. Bei Uhland war das Volkstümliche und Gemütstiefe von vornherein als ein Grundzug seiner Natur vorhanden. Findet man deshalb bei vielen Romantikern, zum Beispiel bei de la Motte Fouqué, bei Clemens Brentano, daß ihr Streben nach dem Mittelalter, nach dem ursprünglichen Volkstum, etwas Gesuchtes hat, daß es sogar vielfach nur wie eine äußere Maske ihres Wesens erscheint: so sind diese Züge bei Uhland etwas durchaus Natürliches. Er hatte sich nie mit seinem Denken und Empfinden von der Einfachheit des Volksgeistes entfernt; deshalb brauchte er sie auch nie zu suchen. Er fühlte sich wohl und heimisch im Mittelalter, weil die besten Seiten desselben zusammenfielen mit seinen Neigungen und Gefühlen. Bei solchen Anlagen mußte es für ihn geradezu ein Erlebnis bedeuten, als in Heidelberg Achim von Arnim und Clemens Brentano «Des Knaben Wunderhorn» (1805) herausgaben, in dem sie die schönsten Blüten der Volksdichtung sammelten.
#TI
Reise nach Paris. Tagebuch
#TX
Im Jahre 1810 hatte der Dichter seine Studien vollendet, Staats- und Doktorexamen lagen hinter ihm. Er konnte daran denken, sich in der Welt umzusehen und nach der Nahrung für seinen Geist zu suchen, nach der er lechzte. Paris mußte ihn anziehen. Da waren die Handschriftensätze alter Volks- und Heldendichtung, die ihm den tiefsten Einblick
#SE033-315
in die Zusammenhänge von Leben und Schaffen der Vorzeit gewähren konnten. Die Reise nach der französischen Hauptstadt und der Aufenthalt dort haben eine bleibende Wirkung auf sein ganzes Leben ausgeübt. Er reiste am 6. Mai 1810 von Tübingen ab und langte am 14. Februar des folgenden Jahres wieder in der Heimat an. Von den Jahren 1810 bis 1820 hat Uhland ein ausführliches Tage-buch geführt, das von J. Hartmann herausgegeben worden ist. Von unschätzbarem Werte für die Erkenntnis seiner Persönlichkeit sind diese Aufzeichnungen; vor allem die, welche von der Pariser Reise handeln. Schweigsam, wie Uhland überhaupt ist erweist er sich allerdings auch in diesem Tagebuche Nur spärlich sind Empfindungen und Ge-danken zwischen das rein Tatsächliche, das verzeichnet wird, eingestreut. Um so bedeutungsvoller sind diese. Sie lassen uns tiefe Blicke in seine Seele tun. Er reiste über Karlsruhe Heidelberg, Frankfurt, Mainz, Koblenz, Trier, Luxemburg, Metz, Verdun Charlons. Er schreibt: «Mein Aufenthalt in Karlsruhe, der vom Montag bis Sonntag (7. bis 13. Mai) dauerte, wird mir immer eine teure Erinnerung sein.» Da lernte er den Dichter der «alemannischen Gedichte», Johann Peter Hebel kennen. Diese echt volkstümliche persönlichkeit zog Uhland ungemein an. Über diesen Karlsruher Aufenthalt drückt er sich später, als er in Koblenz weilt, aus: «Abends Erinnerung mit Tränen an Karlsruhe.» Eine Tagebucheintragung die sich auf die Rheinfahrt bezieht, zeigt, wie Uhland gerne geheimnisvollen Zusammenhängen im Leben nachgeht und seine sinnende Phantasie daran erbaut:
«Altes Ansehen von Bacharach. Der lustige unbekannte Geselle mit dem posthorn, das er zwar schlecht blies, wovon sich jedoch die Töne im Widerhall verklärten. Der Breslauer
#SE033-316
Reisende, der auf einmal mit der Flöte hervorkam. Gesang und Musik auf dem Schiffe. Sonderbares Zusammentreffen mit meinem Liede: das Schi ifflein.» Er hatte drei Monate vorher das Gedicht «Das Schifflein» gedichtet, in dem er das Erlebnis, das ihm jetzt wirklich vor Augen trat, aus der Phantasie geschildert hatte. Das Tagebuch zeigt uns an mancher Stelle, daß Uhland auch im späteren Leben solchen Dingen nachging, die auf die Phantasie einen geheimnisvollen Zauber ausüben, obwohl sie der verständigen Betrachtung zu spotten scheinen. So schreibt er sich am 3. April 1813 einen Traum auf, den er gehabt hat. Ein Mädchen wurde durch einen leichtsinnigen Geliebten verleitet, die Bodenkammer eines Hauses zu betreten und sich auf einem Klavier vorspielen zu lassen, auf dem, einer alten Sage zufolge, niemals gespielt werden darf, weil der Spieler und der, welcher die Töne hört, sogleich altern und dem Tode verfallen. Uhland sieht sich selbst in Gesellschaft der Ge-liebten. Er fühlt in sich das Alter; und die Szene geht furchtbar aus. Uhland schreibt dazu: «Man könnte diesen Traum so erklären: das Klavier ist die Sünde, welche auch im frömmsten Hause irgendwo verborgen lauert und auf Anklang wartet. Der Geliebte des Mädchens ist der Teufel, er weiß die Sünde zu handhaben, daß sie erst ganz unverfänglich, gewöhnlich tönt. Der Klang wird immer süßer, locken-der, hält mit Zaubergewalt fest, dann wird er fürchterlich, und in wilden Stürmen geht das einst fromme und friedliche Haus unter.» Besonders charakteristisch in dieser Beziehung ist aber eine Aufzeichnung vom 1. März 1810. «Nachts Idee zu einer Ballade: die Sage, daß die dem Tode Nahen Musik zu hören glauben, könnte so benutzt werden, daß ein krankes Mädchen vor ihrem Fenster gleichsam ein geistiges, überirdisches
#SE033-317
Ständchen zu hören meinte.» Diese Idee haftey so fest in seinem Geiste, daß er sie am 4. Oktober in Paris in einem Gedicht: «Ständchen» zum Ausdruck bringt. In diesem Gedichte wird ein Mädchen geschildert, das sterbend «nicht irdische Musik» hört sondern das vermeint: «mich rufen Engel mit Musik» Man vergleiche damit, was Uhland am 8. Juni 1828 mit Bezug auf einen Traum niederschrieb, und man wird erkennen, wie in solchen Zügen sich ein Bleibendes in seinem Charakter verrät: «Unter den überraschenden Erscheinungen einer künftigen Welt wird auch die sein, daß, sowie wir himmlische Gedanken und Empfindungen haben werden, so auch für die Außerung derselben sich uns ein neues Organ erschließen aus der irdischen Sprache eine himmlische hervorbreche'n wird. Eine Ahnung von dieser kann uns nicht sowohl der Glanz und Pomp der jetzigen Sprache, als die Ruhe und (belebte) Stille der Sprache der ältern deutschen Dichter geben, wie in meinem Liede in der Stille des Sonntagsmorgens der Himmel sich öffnen will, wie nur, wenn es ganz stille ist, die Töne der Aolsharfe oder der Mundharmonika vernommen werden.» Zugleich zeigt sich hier, wie Uhlands ganze Vorstellungsart ihn zu der «Stille und Sprache der älteren deutschen Dichter» hinführen mußte, mit denen er sich so innig verwandt fühlte.
In Paris findet Uhland, was er gesucht. Er vertieft sich in die altfranzösische, in die spanische Literatur. Die inhalt volle Schrift «Das altfranzösische Epos», die dann 1812 in der Zeitschrift «Die Musen» erschien, ist ein erstes Ergebnis dieser Studien Er faßte die Idee zu einer Dichtung: «Das Märchenbuch des Königs von Frankreich», die allerdings nicht ausgeführt worden ist. Er lernt den Dichter Chamisso kennen und verlebt mit diesem schöne Tage. Auch Varnhagen
#SE033-318
trifft er wieder. Einer Aufzeichnung vom 1 7. November 1810 kann man entnehmen, was Uhland in Paris mit seinen Studien verfolgte: «Bestimmte Auffassung der Tendenz meiner Sammlung altfranzösischer Poesien: hauptsächlich Sage, Heldensage, Nationalsage, lebendige Stimme, mit Hintansetzung des Künstlerischen, Bürgerlichen usw.» Beharrlich ist er im Abschreiben von Manuskripten. Man kann kaum sagen, welche Früchte Uhland noch aus seinem Pariser Aufenthalte gewonnen hätte, wenn er ihm nicht von außen her verkürzt worden wäre. Er brauchte zum Aufenthalt im Auslande die Erlaubnis des Königs von Württemberg. Leider mußte ihm der Vater im Dezember mitteilen, daß die königliche Erlaubnis für einen weiteren Aufenthalt nicht gegeben werde. Der Dichter lernte aber nicht nur die Schätze der Pariser Bibliothek kennen, sondern auch die andern Schätze und Schönheiten der großen Weltstadt. Aus seinen Aufzeichnungen und Briefen kann man ersehen, wie er es sich angelegen sein läßt, Leben und Kunst zu studieren, und wie sich sein Blick erweitert. - Was ihm Paris bedeutete, das geht aus der trübseligen Stimmung hervor, die ihn zunächst nach seiner Rückkehr befällt. Die Aussicht, daß er nun in irgendeine juristische Stellung eintreten müsse, trug nicht weniges noch zu dieser Stimmung bei. Einen Lichtpunkt bildete allerdings die Bekanntschaft mit Gustav Schwab, dem Dichter volkstümlicher Romanzen und Lieder und prächtiger Jugendschriften, der damals in Tübingen studierte. Er ist Uhland ein treuer, hingebender Freund geworden. Zu welcher Stufe des dichterischen Schaffens sich Uhland damals hindurchgearbeitet hatte, zeigen die Schöpfungen: «Rolands Schildträger», «St. Georgs Ritter» und das herrliche: «Der weiße Hirsch», nebst vielen
#SE033-319
anderen, die dieser Zeit entstammen. Die hohe Formvollendung, die uns hier entgegentritt, hatte er allerdings schon früher erreicht, wie aus einer seiner populärsten Balladen: «Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein», die im Jahre 1809 entstanden ist, hervorgeht. Dagegen klingt aus den Dichtungen, die nach der Pariser Zeit geschrieben sind, deutlich durch, wie sich seine Vorstellungswelt durch die Versenkung in die Vorzeit bereichert hat. Er ist jetzt nicht nur imstande, fremde Stoffe anschaulich zu gestalten, sondern auch in allen Außerlichkeiten des Versmaßes und des Rhythmus einen vollständigen Einklang von Inhalt und Art der Darstellung zu geben.
#TI
Uhland als Beamter
#TX
Nach der Rückkehr aus Paris mußte Uhland sich nach einer Lebensstellung umsehen. Er hatte Gelegenheit, sich dadurch ein wenig in den praktischen Beruf hineinzuarbeiten, daß ihm in den Jahren 1811 und 1812 eine Reihe von Verteidigungen in Strafsachen und auch die Führung in Zivilprozessen übertragen wurde. Die Erfahrungen, die dabei gemacht wurden, ließen ihm den Beruf eines Anwalts nicht gerade wünschenswert erscheinen. Deshalb war er zufrieden, als sich ihm die Möglichkeit bot, als unbesoldeter Sekretär beim Justizministerium einzutreten, jedoch mit der bestimmten Versicherung, daß er vor Ablauf eines Jahres Besoldung erhalten werde. Er trat am 22. Dezember sein Amt in Stuttgart an. - Das Leben, in das er nun eintrat, hatte für ihn manche Schattenseiten. Die amtliche Tätigkeit brachte manche Schwierigkeiten mit sich. Er hatte die Aufgabe, die Vorträge zu bearbeiten, welche der Minister über die Gerichte
#SE033-320
dem König hielt. Der selbständige und gerade Sinn, mit dem Uhland die Abfassung dieser Vorträge besorgte, erregte dem Minister manche Bedenken. Dieser war ja vor allem darauf bedacht, mit seinen Berichten einen möglichst günstigen Eindruck hervorzurufen. Dazu kam, daß Uhland es recht schwer wurde, sich an andere Menschen anzuschließen. So geschah es, daß er in einem Kreis von Freunden, der sich jeden Montag und Freitag abends unter dem Namen «Schatten-Geselischaft» in einer Wirtschaft versammelte, erst vom September 1813 an als Mitglied aufgenommen wurde, obgleich er schon am 18. Dezember, wenige Tage nach seiner Ankunft, an einem der Abende teilgenommen hatte. Es gehörten zu diesem Kreise Köstlin, Roser u. a. Die anstrengende Arbeit im Amte und das wenig reizvolle Leben bewirkten, daß sich Uhland im Anfang seines Stuttgarter Aufenthaltes zu schöpferischer Tätigkeit nicht sehr ermuntert fühlte. Wie er sich innerlich aber trotzdem zurechtfand, und welchen Entwickelungsgang seine Persönlichkeit nahm, das kann man aus Außerungen entnehmen, wie die aus einem Briefe an Mayer vom 20. Januar 1813 ist: «Gedichtet habe ich freilich noch nichts, doch wird mir die Poesie in dieser äußeren Abgeschiedenheit von ihr gewissermaßen innerlich klarer und lebendiger, wie es oft bei entfernteren Freunden der Fall ist.»
Äußere Ereignisse konnten die Dichterkraft Uhlands nur in geringem Maße erregen. Ihnen konnte er sich als Charakter, als Tatenmensch ganz hingeben. Das zeigt seine spätere aufopfernde Tätigkeit als Politiker. Die Dichtung wurde in ihm, da wo sie die schönsten Früchte zeitigte, durch eine innere geistige Veranlassung erweckt. Deshalb hat auch der große Freiheitskampf, an dem sein Herz in vollstem Maße
#SE033-321
Anteil nahm, ihn nur zu wenigen Gesängen begeistert. Sie zeigen allerdings, wie seine Persönlichkeit mit dem Freiheitsstreben seines Volkes verwachsen war. Das «Lied eines deutschen Sängers», «Vorwärts», «Die Siegesbotschaft» und «An mein Vaterland» sind Lieder, mit denen er in den Chor der Freiheitssänger einstimmte. - Die Besoldung, welche man Uhland in Aussicht gestellt hatte, blieb lange aus. Er wurde des Wartens müde, und war auch sonst in seiner Stellung wenig zufrieden. Aus diesen Gründen trat er im Mai 1814 aus dem Dienst des Staates. Er ließ sich nun als Rechtsanwalt in Stuttgart nieder. Obwohl auch dieser Beruf ihn wenig befriedigte, so fühlte er sich bei der äußeren Unabhängigkeit, in der er nun war, doch glücklicher. Auch der Quell der Dichtung floß wieder reichlicher. Entstanden doch im Jahre 1814 das «Metzelsuppenlied» und die Balladen: «Graf Eberstein», «Schwäbische Kunde» und «Des Sängers Fluch».
#TI
Herausgabe der und der
#TX
Im Herbst ,8i 5 konnte Uhland die Sammlung seiner Gedichte erscheinen lassen. Cotta, der auf ein erstes Anerbieten im Jahre 1809 den Verlag wegen der «Zeitumstände» abgelehnt hatte, erklärte sich nun zur Übernahme derselben bereit. Lernte man durch diese Veröffentlichung den Dichter Uhland in weiteren Kreisen kennen, so sollte sich dazu auch bald Gelegenheit in bezug auf seine persönliche Charakter-festigkeit und Seelenstärke bieten. Er griff von jetzt ab tätig in die politischen Angelegenheiten seines Heimatlandes ein. - Im Jahre 1805 waren in Württemberg bedeutsame Verfassungsänderungen eingeleitet worden. Der Herzog
#SE033-322
Friedrich II. hatte es im Verlaufe der durch Napoleon verursachten Wirren in Deutschland dahin gebracht, daß Württemberg ein unabhängiger Staat und im Jahre 1806 ihm die Königswürde beigelegt wurde. In dieser Zeit hatte das Land auch bedeutende Gebietserweiterungen erreicht. Zu gleicher Zeit aber nahm der Regent dem Lande seine alte, auf mittelalterlichen Einrichtungen beruhende Verfassung. Wenn auch vieles in dieser ständischen Verfassung der neuen Zeit nicht mehr entsprach, so hing doch das schwäbische Volk mit Zähigkeit an seinen ererbten Rechten; es wollte sich wenigstens nicht einseitig von der Regierung neue Gesetze aufdrängen lassen. Es bildete sich ein Gegensatz heraus zwischen dem König und dem Volke, der sich durch die Jahre der Aufregung bis zum Wiener Kongreß im Jahre I 815 hinzog. Nach den Verhandlungen dieses Kongresses hoffte das Volk auf eine Neugestaltung seiner politischen Zustände im freiheitlichen Sinne. Der König legte dann auch schon 1815 einer einberufenen Versammlung einen Verfassungsentwurf vor. Er fand aber weder bei dem Adel noch bei dem Volke Zustimmung. Das letztere verlangte, daß nicht in willkürlicher Weise ganz neue Zustände geschaffen werden, sondern daß unter voller Anerkennung der 1805 aufgehobenen ständischen Rechte die alten Verhältnisse auf Grund von Unterhandlungen in neue übergeführt werden. An dem Wider-stande des Volkes scheiterte auch ein zweiter von dem König 1816 vorgelegter Verfassungsentwurf. In diesem Jahre starb der König; seine Bemühungen, mit Außerachtlassung der alten Rechte, im Lande neue Verhältnisse zu schaffen, wurden von seinem Nachfolger, Wilhelm II., zunächst fortgesetzt. - Uhlands politische Überzeugung stimmte mit derjenigen des Volkes überein. Wie er innerhalb des Geisteslebens
#SE033-323
mit Ehrfurcht an den Erzeugnissen des Mittelalters hing, so hatten auch im öffentlichen Leben die althergebrachten Einrichtungen für ihn etwas so tief Berechtigtes, daß sich sein Innerstes empörte, wenn in willkürlicher Weise einseitig an ihnen gerüttelt wurde. Er stellte sich auf den Standpunkt, daß niemand befugt sei, dem Volke ein neues Recht zu schenken, sondern daß den Besitzern des «alten, guten Rechtes» dieses gewahrt bleiben müsse, bis sie auf Grund desselben selbst sich Neuerungen schaffen. In diesem Sinne sprach er sich 1816 in dem Gedichte: «Das alte, gute Recht» aus; er wollte dieses «Recht», des «wohlverdienten Ruhm Jahrhunderte bewährt, das jeder wie sein Christentum von Herzen liebt und ehrt». So wie in diesem bringt er seine Überzeugung noch in einer Reihe von anderen Gedichten zum Ausdruck. Sie erschienen von 1815 bis 1817 in kleinen Broschüren als «Vaterländische Gedichte». Er hat durch sie auf seine Landesgenossen eine starke Wirkung hervorgebracht. Man wußte den im tiefsten Herzen freisinnig, demokratisch gesinnten Mann zu schätzen und verehrte in ihm immer mehr einen der besten Hüter der württembergischen Volksrechte. Die Folge war, daß man sich nach der Zeit sehnte, in der er das nötige Alter zum Landtagsabgeordneten erreicht haben würde. Bis dahin, nämlich bis zu seinem dreißigsten Jahre, konnte er nur als Schriftsteller für Recht und Freiheit seines Landes wirken.
#SE033-324
#TI
#TX
Noch vor dieser Zeit lernte die Welt Uhland auch als Dramatiker kennen. Im Jahre 1817 vollendete er sein Trauerspiel «Herzog Ernst», das er im September des vorhergehenden Jahres begonnen hatte. Es behandelt das Schicksal des Schwabenherzogs Ernst, der gegen seinen Stiefvater, den Kaiser Konrad II. von Franken (1024-1039) wiederholt die Waffen ergriffen, und der im Jahre Io3omitseinem Freunde Werner von Kyburg den Tod bei Verteidigung seines vermeintlichen Rechtes gegen den Kaiser gefunden hat. In das Drama hat Uhland seine ganze Begeisterung für das deutsche Mittelalter und für sein schwäbisches Heimatland gelegt. Wenn auch die dramatische Lebendigkeit mit Recht an dem Werke vermißt wird, so ist doch stets die Wärme der Darstellung und die lyrische Kraft desselben bewundert worden. Es wurde im Mai 1819 im Stuttgarter Hofiheater zum ersten Male aufgeführt und erzielte einen großen Erfolg. - Die größte dramatische Kraft hat Uhland im ersten Akt entfaltet, der ein Bild von erschütternden Verwickelungen gibt. Gisela, des Kaisers Gemahlin, die diesem aus ihrer ersten Ehe die Söhne Ernst und Hermann zugeführt hat, bittet den Gatten, am Tag der Krönung zum römischen König, wo jeder sich eine Gunst erflehen darf, um die Freigabe ihres seit zwei Jahren auf Gibichenstein gefangen gehaltenen Sohnes Ernst. Ihr Sohn hätte sich durch jugendlichen Übermut, und da er ein Recht auf das burgundische Königstum zu haben glaubte, empört, weil der Kaiser dies Land für das Reich in Anspruch genommen habe. Gisela bittet um Begnadigung des Schwergeprüften, der einen «Schein des Rechtes» für sich hatte, und dessen junges Herz
#SE033-325
sich leicht empören konnte. Der Kaiser will die Bitte gewähren, wenn Ernst sich fügt und von Burgund ablasse. Ergreifend ist die Szene, in der Ernst auftritt, hager, bleich und gealtert. Er soll mit Schwaben belehnt werden, wenn er auf Burgund verzichte und den getreuen Freund Werner, der ihm stets beigestanden, ausliefere. Auf die erstere Bedingung will er eingehen; an Werner will er auf keinen Fall zum Verräter werden. Der Kaiser läßt ebensowenig wie Ernst von dem einmal eingenommenen Standpunkt. Ernst und Werner bleiben einander treu. Die Reichsacht und der Kirchenbann treffen beide. Sie sind aufs neue dem Unglück ausgeliefert. Mit eiserner Folgerichtigkeit entwickelt sich nun alles Weitere bis zum Untergang Ernsts und Werners, wenn auch das dramatische Leben sich zu der im ersten Aufzug erreichten Höhe nicht mehr erhebt.
«Herzog Ernst» war nicht Uhlands erste dramatische Arbeit, wenn auch die erste, die er zum Abschlusse gebracht hat. Wenn man seine dramatischen Entwürfe verfolgt, so sieht man, wie beharrlich er an seiner Vervollkommnung auf diesem Gebiete der Dichtung arbeitete, und wie er immer neue Ansätze in dieser Richtung machte. Man darf deswegen den «Herzog Ernst» als die reiche Frucht jahrelangen Strebens bezeichnen. Zur Zeit seiner Universitätsstudien hat er sich in der freien Bearbeitung des Seneca'schen Stückes «Thyestes» versucht, die erhalten ist. (Vgl. Adalbert von Keller, Uhland als Dramatiker, S. 15 ff.) - In das Jahr 1805 fällt der Plan zu einer Achilleus-Tragödie. Was Uhland darüber am 6. März 1807 an Leo Freiherrn von Seckendorf schrieb, zeigt, wie tief er mit diesem Drama in die Geheimnisse von Leben und Schicksal führen wollte: «Vor etwa zwei Jahren begann ich, eine Tragödie zu entwerfen,
#SE033-326
Achilleus Tod. Sie sollte die Idee darstellen: wenn auch das Schicksal die Ausführung unserer Entschlüsse hindert, haben wir sie nur ganz und fest in uns gefaßt, so sind sie doch vollendet. Was in der Wirklichkeit Bruchstück bleibt, kann in der Idee ein großes Ganzes sein. Die Idee bleibt unberührt vom Schicksal. Verschiedene Ursachen, besonders aber meine Vorliebe für das Romantische, dem der griechische Boden nicht gewachsen war, hielten mich von der Ausführung ab.» Es ist schade, daß sich von dem Entwurfe nichts erhalten hat, denn man könnte aus demselben Aufschluß gewinnen, in welcher Beziehung sich die romantische Geistesart Uhlands dem griechischen Kulturelement fremd fühlte. - Nach weniger bedeutsamen dramatischen Versuchen fing im Jahre 1807 Uhland die Geschichte der Franceska von Rimini zu interessieren an. Er las damals Dantes «Göttliche Komödie» und wurde dadurch mit dem Stoffe bekannt. Das Trauerspiel, das er aus demselben her-ausarbeiten wollte, beschäftigt ihn mehrere Jahre. Er gibt den Plan 1810 auf, aus einem Grunde, über den wir durch einen Brief vom 6. Februar 1810 an Karl Mayer Näheres erfahren: «Zu Größerem, zum Beispiel der Franceska, fehlt mir Muße, innere Ruhe, Lebensanregung; ich kann alles nur fragmentarisch treiben.» Der Plan und einzelne Szenen haben sich erhalten (vgl. Keller, Uhland als Dramatiker, S. 91 ff.) - Aus einem alten Volksbuche erhielt Uhland die Anregung zu einem Drama «König Eginhard». Er machte sich 1809 - wie ein Exzerptenbuch zeigt - Auszüge aus diesem Volksbuche. Auch Justinus Kerner zog die Eginhard-Sage an. Dieser bearbeitete sie in einem chinesischen Schattenspiel, das 1811 in Karlsruhe erschienen ist. Das Buch, aus dem Uhland die Sage entnommen, heißt: «Riesengeschichte
#SE033-327
oder kurzweilige und nützliche Historie von König Eginhard aus Böhmen, wie er des Kaisers Otto Tochter aus dem Kloster bringen lassen usw. Item, wie die großen Riesen dasselbe Königreich überfallen usw. Alles sehr nützlich und lehrreich beschrieben von Leopold Richtern, gebürtig zu Lambach in Ober-Österreich.» Ein Teil des Eginhard-Dramas ist das dramatische Märchen «Schildeis», das Uhland 1812 veröffentlicht hat. - Auch scherzhafte Stücke versuchte Uhland während seiner Studentenzeit zu schreiben. «Die unbewohnte Insel» und »Der Bär» sind solche. Das letztere ist eine Posse, die in Spanien spielt, und welche Uhland gemeinsam mit Justinus Kerner im Jahre 1809 geschrieben hat. In das Jahr 1809 fällt ferner die Dichtung eines kleinen Lustspiels: «Die Serenade», das ebenfalls in Spanien spielt. -Am 21. Januar 1810 gibt Uhland in einem Briefe an Kerner Nachricht, daß er mit einem Drama «Tamlan und Jannet» beschäftigt sei. Es sollte ein nach einer schottischen Ballade dramatisiertes Elfenmärchen werden. Eine Andeutung des Briefes verrät zugleich, warum auch dieser Plan nicht zur Ausführung gekommen ist. Uhland schreibt: «Zum Tamlan hab' ich den ersten Akt und noch eine weitere Szene ausgearbeitet. Drei Akte sollen es werden. Du erhälst hiebei einige Szenen daraus. Junker David ist ein von den Elfen statt des geraubten Tamlans ausgesetzter Wechselbalg. Sowie Tamlan zurückkommt, verschwindet jener. Die Mißtdne lösen sich in Harmonie auf, Absalon findet die gewünschte Musik.» Zu den beiden Gedichten «Harald» und «Die Elfen» hat Uhland die Anregung aus diesem Stoffe empfangen. -
Es ist begreiflich, daß Uhland nach dem Scheitern so vieler dramatischer Versuche Zweifel an seiner dramatischen
#SE033-328
Begabung aufstoßen konnten. Man erfährt von soldien aus einem Briefe an J. Kerner vom 21. Januar 1810: «Bei meiner inneren Unruhe, bei meiner sonstigen, so verschieden-artigen Besdiäftigung war mir bisher nichts Größeres, Ausgeführteres möglich. Und mein Talent zum Drama?» Diese Worte stehen nach der Erwähnung einer Trauerspielskizze, «Benno», die Uhland Ende Dezember 1809 in zwei Tagen niedergeschrieben hat (vgl. Keller, Uhland als Dramatiker, S. 289 if.) - Ein echt romantisches Drama wollte Uhland mit seinem «Eifersüchtigen König» liefern, über dessen Idee er dem Freunde Kerner am 21. Januar 1810 die folgende Mitteilung macht: «Endlich hab' ich eine schottische Ball ade (in Herders Volksliedern) zu einem Drama, wiewohl erst leicht, skizziert. Die Idee ist: Auflösung des Helden mit seiner Geschichte in Poesie, in Sage, gerade in die zugrundeliegende Ballade. Junker Waters verläßt das väterliche Haus, zieht zu Hofe; ein Minstrel gesellt sich zu ihm, als der ritterlichem Tatenleben nachtretende Gesang. Waters gefällt der Königin. Der eifersüchtige König wirft ihn ins Gefängnis, läßt ihn hinrichten; das blühende Leben ist untergegangen. Der Minstrel verläßt den Hof, der Gesang geht ins Land aus. Waters Eltern und Geschwister sitzen daheim nächtlich am Kamin. Es befällt sie ein Gelüste nach schaurigen Märchen. Der verirrte Minstrel tritt herein und singt die Ballade von Waters Tode. Die Liebe der Königin zu Waters soll so behandelt werden, daß sie ihres liebsten Hoffräuleins Neigung zu Waters begünstigt, gleichsam um ihn unmittelbar zu lieben.» Von der Ausführung des Planes, der ganz in Uhlands romantischer Sinnesart wurzelt, hat sich leider nichts erhalten. - In den Jahren 1814 und 1815 hat Uhland das kurze Drama «Normännischer
#SE033-329
Brauch» ausgeführt. Die Anregung dazu hat er aus der altfranzösischen Dichtung empfangen. Der Grundgedanke ist durch den «Normännischen Brauch» gegeben, daß Bewirtung belohnt wird. - Ein Fragment: «Karl der Große in Jerusalem» dürfte 1814 niedergeschrieben sein. -Aus einem Briefe Uhlands an J. Kerner vom 28. März geht hervor, daß sich der Dichter in dieser Zeit mit einer dramatischen Bearbeitung des Hohenstaufenfürsten Konradin beschäftigt hat. Aus dern Tagebuche ersieht man, daß er im Juli 1818 «Hahns Reichsgeschichte über Otto von Wittels-bach und Konradin» las, um Stoff für sein Drama zu gewinnen. Am 14. Juli ist sogar verzeichnet: «Lebendigere Auffassung des Konradin». Dennoch ist nur eine Szene zur Ausführung gekommen. Er hat sich zuletzt wohl überzeugt, daß der Stoff zur dramatischen Bearbeitung nicht geeignet ist. Man kann das aus einem am 30. September 1854 an den Oberjustizrat Hein in Ulm geschriebenen Briefe entnehmen, in dern er sich darüber ausspricht: «Weil ich selbst einmal, gleich vielen andern, mich an einem Konradin versucht habe, weiß ich aus Erfahrung, daß dieser geschichtliche Gegenstand für das Drama günstiger zu sein scheint, als er wirklich ist.» - Nach so vielen vergeblichen Ansätzen auf dern Felde der dramatischen Kunst mußte es Uhland mit tiefer Befriedigung erfüllen, als er am ,4. Juli 1817 die letzte Szene seines «Herzog Ernst» niedergeschrieben hatte. Hatte er doch noch am 7. November 1816 in einem Briefe an Varnhagen von Ense zu klagen gehabt: «Zwei Gedichte beschäftigen mich, ein erzählendes in Stanzen, Fortunat und seine Söhne, woran ich aber seit zwei Jahren nicht mehr als zwei Gesänge zustande gebracht habe, und ein Trauerspiel, Herzog Ernst von Schwaben, mit dessen Ausführung ich aber
#SE033-330
nicht anfangen kann, wenn ich nicht hoffen kann, es in einem Stück wegzuarbeiten. Das will aber meine Lage fortwährend nicht gestatten.» - Die Sage der «Weiber von Weinsberg» beschäftigte Uhland 1816. Er wollte sie in einem dramatischen Schwank verarbeiten, doch ist auch dieser Fragment geblieben. Ebensowenig kam sein geplantes Nibelungen-Drama zur Ausführung, dessen Entwurf aus dem Jahre 1817 stammt. Dagegen konnte er am 24. Mai 1818 die vollendete Handschrift des geschichtlichen Schauspiels «Ludwig der Bayer» nach München absenden. Der König Max Joseph hatte einen Preis für ein Drama aus der bayerischen Geschichte ausgesetzt, und Uhland hatte sich mit seinem Werke um denselben beworben. Der Dichter spricht sich über dieses Drama am 25. Mai in einem Briefe an seine Eltern aus: « Ich habe mich hierin treu an die Geschichte gehalten und die noch vorhandenen Urkunden getreulich benutzt. Auch sind, da ausdrücklich ein Stück aus der bayerischen Geschichte verlangt wurde, bei der Kommission ohne Zweifel Historiker, welche dieses wohl beurteilen können.» Uhland wollte ein «Symbol der deutschen Stammeseinheit» in dem Stücke zum Ausdruck bringen. Der Kampf des Herzogs Ludwig von Bayern mit Friedrich dem Schönen von Österreich vom Jahre 1322 kommt darin zur Darstellung. Der Dichter hat ein herrliches Bild deutscher Treue und Charakterstärke in der Persönlichkeit Friedrichs geschildert, der von Ludwig gefangen genommen und freigelassen wird zum Zwecke, in seiner Heimat für den Frieden zu wirken, und der, treu seinem Versprechen, wieder in die Gefangenschaft freiwillig zurückkehrt, als ihm die Vermittelung nicht gelingt. Das Drama hat den Preis nicht erhalten. Daß aber Uhland von demselben selbst befriedigt war, geht daraus
#SE033-331
hervor, daß er sich nach dessen Ausführung neuen dramatischen Plänen hingab. Einer derselben ist ein kleines Stück: «Welf», von dem nur der Anfang im Jahre 1818 niedergeschrieben wurde, ein anderer: «Der arme Heinrich», von dem nur weniges ebenfalls im Jahre 1818 aufgezeichnet wurde. Im Jahre 1819 beschäftigten den Dichter ein «Otto von Wittelsbach» und «Bernardo del Carpio», zu dem er den Stoff aus der spanischen Geschichte entnommen hat. Die Heldentaten einer der volkstümlichsten Persönlichkeiten in Spanien wollte er verarbeiten. Von «Otto von Wittelsbach» gedieh nur eine Prosaskizze, von «Bernardo» ein Entwurf und zwei Fragmente in Versen. Der letzte dramatische Plan, der Uhland beschäftigte, fällt in das Jahr 1820. Er wollte die Geschichte des Johannes Parricida behandeln. Aus einer Andeutung, die er Gustav Schwab machte, erfahren wir, daß Uhland in dieses Stück viel von seinem eigenen Geschick legen wollte. Er sagte: «Es war mit ihm, wie mit mir. Er hat in allem Unglück gehabt.» Von einer Ausführung dieser Idee ist nichts bekannt. Sie war die letzte, die Uhland zum Schaffen auf dramatischem Gebiete begeisterte. Die Muse dieser Kunst besuchte fortan den Dichter nicht wieder.
#TI
Vermählung
Uhland als Volksvertreter
Walther von der Vogelweide
#TX
Die oben angeführten Worte über den Plan zum «Johannes Parricida» zeigen, wie tief die Verstimmung in Uhlands Seele über das Scheitern so manches Lebensplanes war. Aber gerade in der Zeit, in der diese Verstimmung am stärksten des Dichters Seele ergriffen zu haben scheint, tritt eine
#SE033-332
glückliche Wendung in seinem Leben ein. Er verlobt sich am 16. Januar 1820 mit Emilie Vischer, der Schwägerin seines Freundes Karl Roser. Die Vermählung erfolgte am 29. Mai desselben Jahres. Mit derselben beginnt eine zweiunddreißigjährige Ehe, die Uhland in jeder Beziehung beglückt hat. Man braucht nur das herrliche Werk: «Ludwig Uhlands Leben. Aus dessen Nachlaß und aus eigener Erinnerung zusammengestellt von seiner Witwe» zu lesen, um eine Vorstellung des seltensten, auf innigem gegenseitigen Verständnisse beruhenden Seelenbundes zu erhalten.
Wer Uhlands Charakter beurteilen will, der braucht sich nur mit seinem Verhalten am Hochzeitstage bekannt zu machen. Um drei Uhr war die Trauung. Der Bräutigam verbrachte den Vormittag im Ständehause; und dorthin kehrte er auch nach der Trauung wieder zurück. Der pflichttreue Mann wollte sich nicht einen freien Tag gönnen, den er seiner Tätigkeit als Abgeordneter für den Landtag hätte entziehen müssen. Denn zu dieser Zeit stand der Dichter schon voll im politischen Leben. Er ist im Jahre 1819 als Abgeordneter von Eßlingen in die Versammlung der Landstände gewählt worden, die einberufen worden war, um über das Zustandekommen einer Verfassung zu beraten. Auch in die Kommission ist er berufen worden, welche die Dankadresse an den König zu bearbeiten hatte. Diese Adresse ist sogar im wesentlichen eine Arbeit Uhlands. Sie trägt das Gepräge seines Wesens. Männlich, Freiheit und Recht betonend, aber mit Schonung aller Vorurteile der Regierenden ist sie verfaßt. Uhland gehörte der Deputation an, die sie zu überreichen hatte. Zur Feier der am 24. September unterzeichneten Verfassung wurde am 29. Oktober in Stuttgart der «Herzog Ernst» aufgeführt. Uhland dichtete dazu einen
#SE033-333
Prolog, in dem er schlagend und schwungvoll sein Verhältnis zu den politischen Angelegenheiten kennzeichnete. Er brachte in der Vorstellung die Ereignisse der Gegenwart in bedeutungsvolle Beziehung mit den Tatsachen seines Dramas. Er charakterisiert die Zeit, in der sein Held lebte: «Das ist der Fluch des unglückseligen Landes, wo Freiheit und Gesetz darniederliegt, daß sich die Besten und die Edelsten verzehren müssen in fruchtlosem Harm.. .» «Wie anders, wenn aus sturmbewegter Zeit Gesetz und Ordnung, Freiheit sich und Recht emporgerungen und sich festgepflanzt!» ... Auch in den ersten Landtag, der im Januar 1820 zusammen-trat, ist Uhland gewählt worden, und zwar als Abgeordneter seiner Vaterstadt Tübingen. Sechs Jahre lang versah er dieses Amt mit der Gewissenhaftigkeit, die der Verlauf seines Hochzeitstages kennzeichnet
Neben seinen politischen Arbeiten widmete sich Uhland dem Studium der deutschen Vorzeit. Sein Interesse war in diesen Jahren dem großen mittelalterlichen Dichter Walther von der Vogeiweide zugewendet. Der Natur Walthers fühlte er sich tief verwandt. Denn auch dieser war, wie Uhland selbst, eine dichterische und politische Persönlichkeit. Aus den deutschen Zuständen seiner Zeit, des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, charakterisierte er den großen Sänger. Aber Uhland war selbst eine zu kernige Natur, um nicht zu wissen und überall zu durchschauen, wie nur auf eine Persönlichkeit von ganz entschiedener Eigenart die Zeitverhältnisse so wirken können, wie auf Walther. Er wußte, was der Zeit, und auch, was der eigenen Seele des Menschen angehört. Und er hat tiefe Blicke in die Seele seines Helden getan. Er hat in schwer zu erreichender Anschaulichkeit dessen Wesen gezeichnet wie dies gelitten, und was
#SE033-334
es gewollt hat. Wie Walther in der Dichtung die Schmerzensschreie ausstößt, die ihm seine Zeit verursacht, wie er Trost und Heilung in seiner Kunst findet: das hat Uhland mit zarten, aber entschiedenen Linien hingezeichnet. Es sind weiche Umrisse, durch die sich das Bild der Persönlichkeit in Uhlands Werk vor unsere Seele hinstellt, aber es sind Umrisse, die in jedem Punkte den Meister der biographischen Kunst verraten, der genau die Grenze zu finden weiß, wo allzu scharfe Linien die Charakterzeichnung zu einer willkürlichen, wenn nicht gar zur Karikatur verzerren. Und die Gestalt Walthers wird in Uhlands Zeichnung zugleich zum Sinnbild des deutschen Volkstums. So eigenartig audi die Seele der Einzelpersönlichkeit hingemalt ist, überall sehen wir die Fäden, durch die sie mit dem Wesen der deutschen Volksseele zusammenhängt. - So konnte Uhland Walther von der Vogelweide nur schildern, weil seine Studien nicht auf den engen Kreis desselben beschränkt waren. Der ganzen deutschen Vorzeit brachte er das gleiche Interesse entgegen. Er arbeitete in dieser Zeit auch an einer «Darstellung der Poesie des Mittelalters». Fertig geworden ist von dieser allerdings nur der Abschnitt über «Minnegesang», der nach Uhlands Tod seiner Sammlung: «Schriften zur Geschichte und Dichtung» eingefügt worden ist. Das Werk über «Walther von der Vogelweide» erschien im Jahre 1822.
Wie wenig Uhland diese Studien als bloßer Gelehrter trieb, das zeigt sein Verhalten auf seinen Reisen, besonders seiner Hochzeitsreise, die er nach Erledigung seiner Arbeiten für den Landtag am 8. Juli 1820 antreten konnte. Das Ehepaar bereiste die Schweiz. Überall finden wir Uhland eifrig bemüht, die Sitten, die Vorstellungen und Anschauungen des Volkes kennen zu lernen, überall verfolgt er die Phantasie
#SE033-335
des Landvolkes in dessen Dichtung und Sage. Was er aus dem Munde des Volkes selbst hört, das belebt ihm die eifrigen Studien, denen er überall obliegt, wo er in Bibliotheken für seinen Zweck Geeignetes vorfindet. - Im höchsten Maße geschätzt wurden Uhlands Forschungen von seinen gelehrten Zeitgenossen. Der Erforscher deutschen Volks-tums, Joseph von Laßberg, besuchte ihn 1820 und wurde sein eifriger Verehrer. Das war für Uhland wichtig; denn Laßberg stand mit den bedeutendsten deutschen Altertums-forschern der damaligen Zeit in Verbindung und konnte auch für Uhland einen schriftlichen oder persönlichen Verkehr mit diesen vermitteln.
#TI
Politik und Forschung. Universitätsprofessor
#TX
Neben strengster Auffassung seiner Pflichten war Uhland auch ein weises Maßhalten in allen seinen Handlungen eigen. Das läßt seine Persönlichkeit als eine im besten Sinne harmonische erscheinen. Hatte er etwas übernommen, so gab er sich diesem mit ganzer Seele hin. Er setzte alle seine Kräfte dafür ein. Aber er wollte niemals die eine Seite seines Berufes durch die andere beeinträchtigen lassen. Er lebte in seinen Forschungen und leistete zugleich als Politiker vom Jahre 1819 bis Ende 1826 das Außerordentlichste. In letzterem Jahre aber fühlte er, daß der Politiker den Forscher in ihm nicht weiter zurückdrängen dürfe. Deshalb wollte er sich in der folgenden Zeit nicht wieder für den Landtag wählen lassen. Er schrieb 1825 an den Vater: «Es ist mein überlegter Entschluß, diesmal keine Wahl anzunehmen. Indem ich die sieben unruhigen Jahre ausgehalten habe, glaube ich, meine Bürgerpflicht in dieser Hinsicht erfüllt zu haben.
#SE033-336
Auf noch einmal sechs Jahre mich von jedem andern Beruf und Bestimmung auszuschließen, kann nicht von mir verlangt werden, abgesehen, daß mir sonst die Lust und Liebe fehlt, die vor allem zu solchem Wirkungskreise erforde4ich ist.» Er hat sich denn auch vorläufig nicht wieder wählen lassen. Um so mehr mußte durch seine Forschungen die Lust zum Lehrberuf in ihm immer größer und größer werden. Lange blieben alle seine Hoffnungen nach dieser Richtung unerfüllt. Im Jahre 1829 entschloß sich endlich die württembergische Regierung auf den Vorschlag des akademischen Senates der Tübinger Universität Uhland zum außerordentlichen Professor der deutschen Sprache und Literatur in seiner Vaterstadt zu ernennen. Er konnte nun in letztere übersiedeln. Seine Vorlesungen gehörten zu den denkbar anregendsten. Alle, die sie gehört haben, waren des Lobes und der Begeisterung voll. Uhland war kein glänzender Redner; er las seine auf den gründlichsten Forschungen beruhenden, wohldurchdachten Ausführungen aus den Handschriften vor. Trotz dieser anspruchslosen Art übte er die tiefste Wirkung. Er hat seinen Zuhörern die Geschichte der deutschen Dichtung im Mittelalter, im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, ferner die Geschichte der Sage und des Mythus bei den germanischen und romanischen Völkern dargeboten. Besonders nutzbringend für seine Schüler wurden «Übungen im mündlichen Vortrag und schriftlicher Darstellung», die er einrichtete. Jeder Teilnehmer an denselben konnte sich im Vortrage selbstverfaßter Reden, oder auch im Deklamieren von Gedichten unter Uhlands sorgfältiger Leitung üben oder konnte Aufsätze liefern, die von dein Lehrer einer eingehenden Kritik unterzogen wurden. - Uhlands Vorlesungen sind nach seinem Tode in seinen gesammelten
#SE033-337
Schriften erschienen. Sie bieten ein vollkommenes Bild seines akademischen Wirkens. Merkwürdigerweise hat er seine Antrittsvorlesung erst im dritten Jahre seines Lehramtes, am 22. November 1832, gehalten. Auch sie findet sich in seinen Schriften. Er behandelt die Sage vom Herzog Ernst, den er damals als Gelehrter ebenso klar und anschaulich zu schildern wußte, wie er ihn früher als Dichter dramatisch dargestellt hat.
#TI
Tod der Eltern
#TX
Groß war die Freude, welche Uhlands Eltern hatten, als der Sohn wieder in ihre Nähe kam. Doch war diese Freude nur kurz. Im Frühling 1831 erkrankte die Mutter und starb schon am 1. Juni desselben Jahres. Kurz darauf, am 29.August, folgte der Vater. Das herzliche Verhältnis, das den Sohn mit den Eltern verband, kommt in dem Gedichte: «Nachruf» zum Ausdruck, das er ihnen ins Grab nachsandte. Es enthielt die einfachen, aber tiefen Schmerz aussprechenden Zeilen: «Verwehn, verhallen ließen sie den frommen Grabgesang; in meiner Brust verstummet nie von dir ein sanfter Klang.» Und selten hat wohl jemand sein Leid in so eindringliche Worte gebracht, wie diejenigen sind, in welche der Nachruf ausklingt: «Die Totenglocke tönte mir so traurig sonst, so bang; seit euch geläutet ward von ihr, ist sie mir Heimatsklang.»
#TI
Neue politische Tätigkeit. Entlassung aus dem Lehramte.
#TX
Nicht lange war es Uhland vergönnt, in einem Berufe zu verbleiben, der wie kein anderer seinem innersten Bedürfnisse
#SE033-338
entsprochen hätte. Das Volk, dessen Anwalt er in so hingebender Weise jahrelang gewesen ist, forderte aufs neue seine Kraft, als 1832 die Wahl für die im folgenden Jahre einzuberufende Ständeversammlung stattfand. Er wurde zum Abgeordneten für die Landeshauptstadt gewählt und konnte es nicht mit seinem Gewissen vereinen, sich den Forderungen seines Landes zu versagen. Die französische Juli-revolution hatte auch in Deutschland die Gemüter tief erregt. Für einen Mann, der, wie Uhland, bereit war, jederzeit für Recht und Freiheit das Leben zu geben, waren wieder wichtige politische Aufgaben vorhanden. Er gehörte in der Kammer zu den Persönlichkeiten, welche sich der gefährlichen Maßregel entschieden widersetzten, durch die der Regierung besondere Befugnisse erteilt werden sollten für Aufrechterhaltung der Ordnung. Da in der Art, wie diese Befugnisse erteilt werden sollten, nach Uhlands und seiner Freunde Meinung in die Rechte des Volkes verletzend eingegriffen wurde, stimmten sie gegen dieselben. Die Folge war eine Auflösung der Kammer und neue Wahlen. Uhland wurde neuerdings in die Volksvertretung berufen. Die Regierung empfand sein Wirken bald unbequem. Man wollte sich des Abgeordneten dadurch entledigen, daß man sagte:
er sei an der Universität unentbehrlich und könne deshalb keinen Urlaub zur Erfüllung seiner Abgeordnetenpflichten erhalten. Trotzdem er an seinem Lehramt mit wahrer Liebe hing, war in einem solchen Falle für ihn kein Zweifel, daß er die Neigung den Pflichten gegenüber dem Lande zurücktreten lassen und deshalb seinen Abschied als Professor nehmen müsse. Die Entlassung wurde ihm schon im Mai «sehr gerne» gewährt. Er gab sich nun mit aller Kraft dem Amte des Volksvertreters hin. Eine Reihe wichtiger Gesetzesvorlagen
#SE033-339
wurde auf seine Anregung eingebracht. Erst im Jahre 1838 zog er sich wieder von diesem Amte zurück.
In den Verfolg seiner Forscherarbeiten hatte die Entlassung aus dem Lehramte keine Unterbrechung gebracht. Er konnte bereits 1836 der Welt seine Studien über den «Mythus von Thor» vorlegen. In der nächsten Zeit wollte er den «Mythus von Odin» in der gleichen Art behandeln, doch ließ er die Handschrift liegen. Sie wurde erst nach seinem Tode veröffentlicht. Beide Arbeiten sind ebenso scharfsinnig wie seelenvoll. Uhland deutete auf die Eigentümlichkeiten der schaffenden Volksphantasie, die eine sinnige Naturanschauung und ein religiös vertieftes Geistesleben in Form des Mythus zum Ausdruck bringt. Ergänzend zu diesen Arbeiten trat die Sammlung deutscher Volkslieder, die ihn bis in die vierziger Jahre hinein beschäftigte. 1844 und 1845 konnte er eine große Anzahl gesammelter Volkslieder veröffentlichen. Er hat dazu eine das Wesen des Volksliedes erklärende Abhandlung geschrieben, die erst aus seinem Nachlaß herausgegeben worden ist.
#TI
Der Zauber Uhlandscher Dichtung
#TX
In der Zeit von 1816 bis 1834 hat Uhland nur sehr wenige Gedichte geschrieben. Wenn nicht eine starke innere Nötigung vorhanden war, dann entsagte er jeder dichterischen Tätigkeit. Er gehört zu den Persönlichkeiten, die im strengsten Sinne des Wortes wahr gegen sich selber sind. Er hat sich wohl nie zu einem Gedichte gezwungen. Und da zu ihm die Muse nur zu gewissen Zeiten sprach, so liegen zwischen den Epochen seiner dichterischen Produktion große Zwischenräume. Das Jahr 1834 war nun wieder eine fruchtbare
#SE033-340
Epoche. Herrliche Balladen und Romanzen gehören dieser Zeit an. «Die Geisterkelter», «Das Glück von Edenhall», «Das Singental», «Die versunkene Krone», «Die Glockenhöhle», «Das versunkene Kloster» sind damals entstanden. Daneben dichtete er die Lieder: «Abendwolken», «Die Lerchen», «Dichtersegen», «Maientau», «Wein und Brot», «Sonnenwende», «Die Malve», «Reisen».
Die Eigenart Uhland'scher Lyrik erscheint in diesen Dichtungen in abgeklärter Weise. Der gemütvolle Ton der Lieder, die sinnige Anschaulichkeit, der Ausdruck eines reinen, liebevollen Naturempfindens treten in einer äußeren Form auf, die sich bis zur höchsten Künstierschaft gesteigert hat. Die Balladen sind durchflossen von dem hohen ethischen Kern der Persönlichkeit des Dichters. Das gehört überhaupt zum Wesen von Uhlands Balladen- und Romanzendichtung, daß man immer sein Herz mitschiagen, seine Seele sich freuen und leiden fühlt, wenn er in seiner einfachen, wahren Weise Tatsachen erzählt. Es liegt darin geradezu der Zauber Uhland'scher Dichtung. Er legt auch in seine erzählenden Gedichte sein Innerstes; er sagt immer, was er gegenüber den Dingen und Menschen empfindet. Aber er weiß, indem er seine ureigensten Empfindungen gibt, zugleich doch seine Persönlichkeit hinter der Darstellung zurücktreten zu lassen. Die vollkommene Anspruchslosigkeit eines hochsinnigen Menschen spricht aus seinen Schöpfungen, der sich ganz ausleben darf, weil seine Art immer im höchsten Maße bescheiden und natürlich wirkt. Wenn er über die Dinge redet, so erscheint es, als ob nur die Dinge allein sprächen. Er fühlt so mit der Natur und dem Herzen des Mitmenschen, daß man seinen Empfindungen immer folgt, auch wenn er ganz von seinem persönlichen Standpunkte aus spricht. Es ist
#SE033-341
nicht zu leugnen, daß durch den Ausdruck der Empfindungen des Dichters die dramatische Lebendigkeit der Erzählung beeinträchtigt wird; aber Uhland spricht sich eben in einer so einfach-wahren, durchaus natürlich wirkenden Art aus, daß man bei seinen Balladen und Romanzen das Aus-leben seiner Persönlichkeit nicht als Mangel empfindet. -Und ebenso einfach und groß wie sein Empfinden gegenüber menschlichen Schicksalen und Handlungen ist sein Naturempfinden. Sein Auge blickt mit ernster Lebensfreude auf die Schöpfungen der Welt. Nur selten trifft man bei ihm auf einen Ton des Übermutes oder der ausgelassenen Fröhlichkeit. Seine Lebensauffassung ist immer darauf gerichtet, das Hoheitsvolle und Harmonische in den Dingen zu sehen. Die Stimmungen der Tages- und Jahreszeiten, die anmutigen und schaudererregenden Seiten in den Naturwerken und Vorgängen entlocken ihm die gleichen anschaulichen Bilder und in die Seele dringenden Töne. Es mischt sich nur selten etwas Sentimentales in seine Gefühle, obwohl diesen eine Weichheit und Milde immer eigen ist. Auch in den Dichtungen, in denen er sein Naturempfinden zum Ausdruck bringt, fließen die Anschauung und der Empfindungsgehalt in ungezwungener Weise ineinander.
#TI
In die Nationalversammlung gewählt. Das Revolu tions jahr.
Letzte Lebensjahre. Schreiben an Wilhelm von Humboldt
#TX
Immer geringer wurde die Befriedigung, die dem Dichter aus der politischen Tätigkeit floß. Und er mag es wohl wie eine Erlösung empfunden haben, als er den bestimmten Entschluß gefaßt hatte, im Jahre 1838 nicht wieder eine Wahl zum Abgeordneten anzunehmen. Er lebte nun still, zurückgezogen,
#SE033-342
ganz seinen Forschungen hingegeben, in seiner Vaterstadt. Da hatte er sich 1836 ein eigenes Haus mit einem Garten erworben, von dem ihm ein reizender Blick auf das wunderbare Neckartal vergönnt war. Eine Anzahl von Reisen, nach Österreich, nach Süd- und Norddeutschland, brachte Abwechslung in das anspruchslose Gelehrtenleben. Im Jahre 1846 lernte er in Frankfurt am Main Jakob und Wilhelm Grimm, die großen deutschen Sprach-und Sagenforscher, persönlich kennen. - Da kamen die Wirren des Revolutionsjahres 1848. Uhland gehörte in die erste Reihe derjenigen, denen die Brust bebte vor Hoffnungen für eine neue Zeit der Freiheit und des Volksglückes. Auch sein Vaterland wurde von dem Freiheitsdrange ergriffen. Uhlands Freund und politischer Gesinnungsgenosse, Paul Pfltzer, mit dem er manchen Sturln im Landtage gemeinsam durchgekämpft hatte, gehörte dem freisinnigen Ministerium an, das eingesetzt wurde. Daher kam es, daß Uhland aufgefordert wurde, dem Ausschuß beizutreten, der in Frankfurt eine neue Bundesverfassung vorbereiten sollte. Bald darauf wurde er von den Bezirken Tübingen und Rottenburg in die deutsche Nationalversammlung gewählt. Weil er nicht zugleich Abgeordneter des Volkes und Vertreter der Regierung sein wollte, trat er aus dem Ausschuß aus und widmete sich ganz den Verhandlungen der Volksversammlung. Er gehörte der freisinnigen Mittelpartei an. Für einen Mann wie Uhland, der die Lage der Dinge klarer als andere zu überschauen vermochte, mußten die gehegten Erwartungen bald bitteren Enttäuschungen weichen. Er brauchte nicht lange Zeit, um einzusehen, daß die verschiedenen Vorschläge, die zu einer Einigung Deutschlands auf freiheitlicher Grundlage gemacht wurden, nicht viel Aussicht auf Verwirklichung
#SE033-343
hatten. Bunt durcheinander schwirrten diese Vorschläge:
Preußischer Erbkaiser, Direktorium, Wahlkaiser, republikanische Verfassung. Aus all dem, was damals gesprochen wurde, konnte Uhland wenig Mut zum Eingreifen in die Verhandlungen schöpfen. Eine Persönlichkeit, die sich in aussichtslosem Radikalismus gefiel, war er nicht. In ihm lebte neben einem entschiedenen Unabhängigkeitssinn und einer edlen Begeisterung für die Freiheit doch auch der entschiedene Wille, nur das anzustreben, was nach der Lage der Dinge möglich war. Innerhalb dieses Möglichen trat er allerdings immer für das ein, was seinem Freiheitssinne am meisten entsprach. So gab er am 29. Juni 1848 seine Stimme nicht dem Erzherzog Johann, sondern dem Freiherrn von Gagern für die Würde des Reichsverwesers. Nur selten fühlte er sich gedrängt, als Redner aufzutreten. Wenn er es tat, dann sprach er gewichtige Worte. Sein ganzes Fühlen und Denken prägt sich in den Worten aus, die er am 22. Januar 1849 im Verlauf einer Rede gegen einen Erbkaiser gehalten hat: «Es wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem Tropfen demokratischen Öles gesaibt ist.» Nach der Zurückweisung der deutschen Kaiserwürde durch den König von Preußen traten die Mitglieder aus der Volksvertretung aus, die an dieser Idee hingen. Der Rest der Volksvertreter siedelte nach Stuttgart über. Uhland harrte im Rumpfparlament aus, trotzdem er gegen dessen Verle-gung nach Stuttgart war. Er hielt es doch für seine Pflicht, in der Reihe der Männer zu bleiben, die auch weiter für ihre Ideale kämpfen wollten. In Stuttgart war die Lage von Anfang an die denkbar schwierigste. Die Majorität des Rumpf-parlamentes war für die Wahl einer Regentschaft aus fünf Personen zur Leitung des Reiches. Uhland war der Führer
#SE033-344
der Gegner dieses Beschlusses. Er hatte dabei nur fünf Gesinnungsgenossen. Er versprach sich von einer solchen Form der Regierung nichts. In den folgenden Tagen versuchte die württembergische Regierung, die Sitzungen der Volksvertreter mit militärischer Gewalt zu verhindern, weil diese fünf Millionen als Umlage für die Bildung eines Volksheeres auszuschreiben beschlossen hatten. Uhland wollte sich mit seinen Freunden dennoch zur Sitzung am 18. Juni begeben. Das Militär hinderte sie daran. Sie mußten weichen. Uhland war also einer derjenigen, die den parlamentarischen Kampf in den denkwürdigen Tagen bis zuletzt geführt haben, und die sich sagen konnten, daß sie nur der Gewalt gewichen sind. - Nur noch einmal wurde Uhland, für ganz kurze Zeit, auf den politischen Schauplatz gerufen. Er mußte 1850 an dem Staatsgerichtshof teilnehmen, der über die Regierungs-handlungen der Revolutionszeit zu urteilen hatte. Vergeblich ist er auch hier noch einmal für die Rechte des Volkes eingetreten, indem er für die Verurteilung des Ministers des Auswärtigen, Freiherrn von Wächter, eintrat, der wichtige politische Beschlüsse nicht verfassungsgemäß den Ständen vorgelegt hatte.
Von jetzt an lebte Uhland nur mehr seinen wissenschaftlichen und schriftstellerischen Arbeiten. Er gab sich seinen Forschungen über die Sagengeschichte hin und sammelte neuerdings Volkslieder. Dazu kam ein neues Gebiet. Er wollte die Sagen seines eigenen Heimatlandes durcharbeiten. Nur weniges ist ihm gelungen, von diesem Plane auszuführen.
Bis in seine letzten Lebenstage hinein hat sich Uhland die volle Rüstigkeit erhalten, die ihm immer eigen war. Sein häusliches Glück war stets ein ungetrübtes; viele Freude
#SE033-345
machte ihm die Erziehung zweier Pflegesöhne. Der eine war Wilhelm Steudel, den er als fünfzehnjährigen Knaben in sein Haus aufnahm. Der Vater des früh verwaisten Kindes war Uhlands Freund, der Dekan Steudel in Tübingen. Im Jahre 1848 verlor der Sohn von Uhlands Schwester, die schon 1836 verstorben war, den Vater. Auch der Erziehung dieses Knaben widmete sich Uhland. - Tiefschmerzlich war dem Dichter der im Februar 1862 erfolgte Tod seines alten treuen Freundes Justinus Kerner. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß er beim Begräbnisse den Grund zu seiner tödlichen Krankheit durch eine Erkältung gelegt hat. Er konnte sich nach derselben nicht mehr recht erholen und starb am 1 3. No-vember 1862.- Die in vielen Orten begangenen Trauerfeiern bewiesen, daß man Uhlands Wirken allmählich voll schätzen gelernt hatte. Der Dichter war in den weitesten Kreisen des Volkes geliebt, der Sagen- und Mythenforscher bei den Fachgenossen hochgeschätzt, der Politiker mit dem echt männlichen Unabhängigkeitssinn als ein Vorbild verehrt. Er hatte noch in der letzten Zeit seines Lebens diesen Sinn in seltener Weise bewährt. Im Dezember 1853 wurde er zum Ritter des Ordens pour le mérite ernannt. Er wies die Würde mit den bedeutsamen Worten zurück: «Ich würde mit literarischen und politischen Grundsätzen, die ich nicht zur Schau trage, aber auch niemals verleugnet habe, in unlösbaren Widerspruch geraten, wenn ich die mir zugedachte, zugleich mit einer Standeserhöhung verbundene Ehrenstelle annehmen wollte. Dieser Widerspruch wäre um so schneidender, als nach dem Schiffbruch nationaler Hoffnungen, auf dessen Planken ich geschwommen bin, es mir nicht gut anstände, mit Ehrenzeichen geschmückt zu sein, während solche, mit denen ich in vielem und wichtigem zusammengegangen
#SE033-346
bin, weil sie in der letzten Zerrüttung weiterschritten, dem Verluste der Heimat, Freiheit und bürgerlichen Ehre, selbst dem Todesurteil verfallen sind.» Diese stolzen Worte richtete er an Wilhelm von Humboldt, der ihm die Mitteilung von der Auszeichnung machte. Humboldt wandte alles an, um den Dichter doch zur Annahme zu bewegen. Dieser blieb unbeugsam. Auch den vom bayrischen Könige ihm zugedachten Orden für Wissenschaft und Kunst wies er zurück.
CHRISTOPH MARTIN WIELAND
#G033-1967-SE347 - Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905
#TI
CHRISTOPH MARTIN WIELAND
Wielands Bedeutung
#TX
Es gibt geschichtliche Persönlichkeiten, denen die Nachwelt nicht ganz gerecht werden kann. Sie scheinen vom Schicksale dazu ausersehen zu sein, andern die Wege zu bereiten. Diese andern werden die Führer der Menschheit. Ihre Namen werden mit goldenen Lettern in die Bücher der Geschichte eingetragen. Was sie hervorgebracht haben, wird in dankbarer Erinnerung bewahrt und lebt von Geschlecht zu Geschlecht fort. Aber diese Führer der Menschheit haben Lehrer. Und die Namen der Lehrer werden häufig von den Schülern verdunkelt. Und das ist schließlich nur naturgemäß. Denn die Lehrer großer Schüler brauchen nicht groß zu sein. Aber auch wenn sie selbst Größe haben, so verfallen sie leicht dem allgemeinen Schicksal. - In der großen Zeit der deutschen Dichtung vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts ist es drei Persönlichkeiten so gegangen: Klopstock, Herder und Wie land. Durch das große Dreigestirn: Lessing, Schiller, Goethe wurden sie völlig in den Schatten gestellt. Und ihnen verdankt nicht nur ihr Zeitalter, sondern verdanken auch Schiller und Goethe selbst unermeßlich viel. Herder war im besten Sinne des Wortes Goethes Lehrer. Und wie Klopstock zum deutschen Volke und seiner Bildung steht, hat Goethe selbst schön ausgesprochen: «Unsere Literatur wäre ohne diese gewaltigen Vorgänger nicht das geworden, was sie jetzt ist. Mit ihrem Auftreten waren sie der Zeit voran und haben sie gleichsam nach sich gerissen» (Gespräche mit Eckermann:
#SE033-348
9. November I 824). Und auch über Wielands Bedeutung hat Goethe die richtigen Worte gefunden. «Wielanden verdankt das ganze obere Deutschland seinen Stil. Es hat viel von ihm gelernt, und die Fähigkeit, sich gehörig auszudrücken, ist nicht das geringste» (Gespräche mit Eckermann: 18. Januar 1825). Dies wird noch ergänzt durch Goethes Worte in «Dichtung und Wahrheit». Da spricht er auch von dem Einfluß, den er selbst durch Wieland erfahren hat. «Wie manche seiner glänzenden Produktionen fallen in die Zeit meiner akademischen Jahre. Musarion wirkte am meisten auf mich, und ich kann mich noch des Ortes und der Stelle erinnern, wo ich den ersten Aushängebogen zu Gesicht bekam, welchen mir Oeser mitteilte. Hier war es, wo ich das Antike lebendig und neu wiederzusehen glaubte. Alles, was in Wielands Genie plastisch ist, zeigte sich hier aufs vollkommenste.» - Durch solche Worte wird Wielands Stellung im deutschen Geistesleben klar bezeichnet. Und niemand kann ein Urteil haben über das, was in diesem Geistesleben während der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts vorging, der sich nicht wenigstens mit den wichtigsten Schöpfungen Wielands bekannt macht. Geht man näher auf sie ein, so findet man, wie wunderbar sie zu denen Klopstocks, Lessings und Herders die Ergänzung bilden. Zu Klopstocks gemütstiefer Religiosität, Lessings kritischer Strenge und Herders philosophischer Höhe tritt durch Wieland die Anmut und Grazie. Und dadurch war der letztere den unmittelbaren Menschenbedürfnissen noch näher als die andern. Er holte in einer gewissen Beziehung die Ideen, welche jene auf der Menschheit Höhen vertraten, herunter in das bürgerliche Denken und Empfinden. Was jene im Feiertags-kleide zeigten, dem zog er den Alltagsrock an. Es wäre ungerecht,
#SE033-349
über dem leichteren Kleide bei ihm den Wesenskern zu vergessen. Eine unbefangene Betrachtung seines Lebens und seiner Schöpfungen kann das lehren.
#TI
Knabenzeit
#TX
Herausgewachsen ist Wieland aus einer in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in protestantischen Gegenden weit verbreiteten Geistesrichtung. Diese drückte sich aus in einer gewissen anspruchsiosen Frömmigkeit, die weniger auf die Erfassung hoher religiöser Wahrheiten als vielmehr auf die Pflege des Gemütes und der herzlichen Innigkeit ging. Ein «guter Mensch» muß in seinem Herzen den Weg zur redlichen, aufrichtigen Frömmigkeit finden, so sagte sich diese Richtung. Nicht hohe Lehren, sondern die reine Seele suchte sie. Man nennt diese Strömung Pietismus. Man darf sich weder vor ihren Licht- noch vor ihren Schattenseiten verschließen wenn man das Hervorgehen eines Geistes, wie Wieland aus ihr begreifen will. Sie fördert in Kreisen, die nicht bis zu beson deren geistigen Höhen aufsteigen können, eine wahre und gesunde Idealität und ein unmittelbares Urteil in den Fragen welche über das Alltägliche hinausgehen. Aber sie hat auch' eine gewisse Engherzigkeit im Gefolge. Der Pietist ringt sich zwar zu einem ehrlichen Urteil durch; aber er betrachtet auch leicht dieses, sein Urteil, als das aUein maßgebliche, und wird - ohne es eigentlich zu wollen - unduldsam gegen andere.- Und damit ist auch das pietistische Haus gekennzeichnet, aus dem Christoph Martin Wieland herausgewachsen ist. - Er ist am 5. September 1733 als zweiter Sohn des protestantischen Predigers von Oberh4zheim in Oberschwaben, Thomas Adam Wieland geboren. Sowohl
#SE033-350
der Vater wie die Mutter, Regina Katharina, waren vortreffliche Menschen. Als Christoph Martin drei Jahre alt war, wurde der Vater nach dem nahen Biberach versetzt. Dort verlebte der Knabe die erste Kinderzeit bis zum vierzehnten Jahre. Ein sinniger, frühreifer Knabe wächst in einem kleinen Bürgerhause, dessen Haupt vorzüglich mit dem Seelenleben der Mitmenschen beschäftigt ist, unter Bedingungen heran, die man vielleicht damit gut bezeichnen kann, daß man sagt: er lernt die Größe der Menschheit aus einem kleinen Spiegel, weniger in der Wirklichkeit kennen. Der kleine Spiegel sind die Bücher. Und ein kleiner Bücherwurm war der Knabe Wieland Er sog in sich die Schriften des Cornelius Nepos und des Horaz und war schon im zwölften Jahre damit beschäftigt, lange lateinische Gedichte und auch deutsche Verse zu drechseln. Unter seinen Arbeiten befand sich auch ein Heldengedicht über die Zerstörung Jerusalems.
Mit vierzehn Jahren konnte Wieland die pietistische Luft des Vaterhauses mit der gleichgearteten in der Schule zu Kloster-Bergen (bei Magdeburg) vertauschen. Der fromme Abt Steinmetz leitete diese Schule. Es lag bei dem bisherigen Erziehungsgange des Knaben wohl in der Natur der Sache, daß er hier die reichlichere Gelegenheit benutzte, durch Lektüre die Welt kennen zu lernen. Horaz, Xenophon, Cicero, Lucrez, der materialistische Schriftsteller des Altertums, Bayle, der einflußreiche Zweifler der damaligen Zeit, auch Wolff, der tonangebende Philosoph, und der gewaltige Aufklärer Voltaire beschäftigten sein reges Gedankenleben. Unter solchen Einflüssen konnte es nicht ausbleiben, daß manche Vorstellung, die er im frommen Vaterhause empfangen oder die ihm in der Schule entgegentrat, ins Wanken kam.
#SE033-351
Zweifel über das Christentum, wie er es bisher hatte kennen gelernt, senkten sich in seine Seele. Und es bedurfte der ganzen inbrünstigen Kraft von Klopstocks «Messias», um seinem Gemüte den damals notwendigen Halt zu geben. Von dieser Dichtung waren ja in dieser Zeit gerade die ersten drei Gesänge erschienen. Wieland las sie, wie so viele, mit Entzücken. Die Kraft des frommen Empfindens, die aus ihnen strömte, war stärker als alle Vorstellungen, die von Zweiflern und Aufklärern erregt werden konnten. - Aber es stürmte viel ein auf den Jüngling, der doch nicht in der Lage war, den aufgenommenen Bücherstoff durch irgendwelche Lebenserfahrung zu einem sicheren eigenen Urteile umzubilden. Er wurde bald auch bekannt mit den Gedichten Hallers, der auf der Grundlage der damaligen Naturanschauung baute, und mit Breitingers kritischen Studien, durch welche ganz neue Maßstäbe in der Beurteilung künstlerischer Werke geltend gemacht wurden. Dazu kam, daß er 1749 vorübergehend sich bei seinem Verwandten in Erfurt, Wilhelm Baumer, aufhalten durfte, der Arzt und Philosophie-professor war. Dieser machte ihn mit den wichtigsten philosophischen Lehrsystemen und mit dem «Don Quijote» von Cervantes bekannt. So wurde der junge Wieland zugleich eingeführt in die Gedankengebäude, durch welche die Menschheit ihre großen Rätself ragen zu lösen suchte, und in die humoristische Behandlung eines schwärmerischen Idealismus im «Don Quijote».
#TI
Studentenzeit
#TX
Durch diese Verhältnisse war die Geistesverfassung bestimmt, in welcher Wieland 1750 wieder ins Vaterhaus zurückkam
#SE033-352
und in der er bald darauf zur Universität nach Tübingen ging. Es hieße Wielands Innenleben ganz verkennen, wenn man einem Liebesverhältnis, das damals in sein Leben eintrat, eine zu große Bedeutung beilegen wollte. Es war das zu Sophie von Gutermann aus Augsburg, die um diese Zeit zum Verwandtenbesuch sich in Biberach aufhielt. Zwar war die Neigung eine innige; aber eine wesentliche Rolle im Entwickelungsgange Wielands hat sie ebenso wenig gespielt, wie einige spätere. Übrigens löste sie sich dann von selbst auf, als Sophie sich 1753 mit la Roche, dem kurmainzischen Hofrat verheiratete. Wenn er auch eine Zeitlang durch diese «Untreue» in eine trübselige Stimmung kam, so war diese doch nicht von einer tieferen Wirkung auf seinen Entwickelungsgang. Besonders darf es nicht dieser Stimmung zugeschrieben werden, daß er in den nächsten Jahren in eine frömmelnde, moralisierende Richtung hineinkam.
Diese hat vielmehr einen ganz anderen Ursprung. Als er in Tübingen war, interessierte ihn die gewählte Rechtswissenschaft wenig. Er vertiefte sich vielmehr neuerdings in Klopstocks «Messias» und fügte dazu das Studium des platonischen Idealismus. Auch mit Leibnizens philosophischen Schriften wurde er bekannt. Aus all dem schöpfte er für sich selbst eine idealistische Weltanschauung, die er in der Dichtung «Die Natur der Dinge» zum Ausdruck brachte. Sogleich enthüllte sich dabei sein wunderbares Formtalent, das er sich an Klopstock herangebildet hatte. Dem Hallenser Philosophen Meier, dem Wieland, ohne sich zu nennen, das Gedicht übersandte, gefiel es so, daß er es sogleich zum Druck beförderte. Sollte solche Anerkennung nicht den wenig gefestigten jungen Mann ganz in die Richtung hineinbringen, die sich damals an Klopstock angeschlossen
#SE033-353
hatte? So kam es, daß die weiteren Dichtungen «Lobgesang auf die Liebe» und «Hermann» ganz in Klopstockschen Bahnen liefen. - Und das war es, was für Wieland eine unmittelbare persönliche Beziehung zu dem Kritiker der Klopstockschen Schule, zu Bodmer knüpfte.
#TI
Eintritt in das Literatenleben. Wieland und Bodmer
#TX
Dadurch wurde Wieland in eine Geistesrichtung hineingeführt, die damals für das deutsche Bildungsleben besonders ausschlaggebend war. Sie knüpfte sich neben anderen Namen auch an den Bodmers. Und sie bedeutete eine Art geistigen Umschwunges in Deutschland. Bis in die Mitte des Jahrhunderts war der in Leipzig wirkende Gottsched der richtunggebende Geist in der Literatur gewesen. Sein Wirken war ein umfassendes. Was er über irgendeine Zeiterscheinung gesprochen hatte, galt als maßgebend. Erschüttert wurde seine Stellung durch zwei Ereignisse. Das eine war, daß er Klopstock nicht anerkennen wollte. Das zweite die Zurückweisung seiner Franzosenverehrung durch Lessing. In bezug auf Wieland kommt das erste Ereignis zunächst in Betracht. Bodmer hatte als Kritiker gegenüber Gottsched die Oberhand bekommen. Er trat für Klopstock ein; und diejenigen, die mit Klopstock als Dichter gingen, schlugen sich naturgemäß zu der neuen kritischen Richtung, die in Bodmer und seinen Anhängern für den Messiasdichter begeistert eintrat. - Es war daher eine große Förderung Wielands, als Bodmer über des ersteren «Hermann» in der günstigsten Weise urteilte. Er stellte den jungen Mann geradezu als einen Nebenbuhler Klopstocks hin und forderte dadurch Dankesgefühle in der denkbar stärksten Weise heraus.
#SE033-354
Das hatte zur Folge, daß Wieland nicht nur wacker in Klopstockscher Art weiter dichtete, sondern daß er auch, nach seiner 1752 erfolgten Rückkehr nach Biberach, eine Abhandlung schrieb über Bodmers epische Dichtung «Noah», in welcher er den verehrten Mann neben Milton und Klopstock als ebenbürtig hinstellte. Wie viel Bodmers Dichtung wirklich wert ist, und wie sehr Wieland in Voreingenommenheit urteilte, das kann in einer Betrachtung von des letzteren Entwickelungsgang nicht interessieren. Worauf es ankommt, ist, daß durch diesen Vorgang der junge Wieland 1752, auf Bodmers Einladung hin, zu diesem nach Zürich übersiedelt, und daß dieser Aufenthalt für ihn unermeßlich wichtig geworden ist. Er hat ein volles Jahr bei Bodmer als Gast im Hause gewohnt. Das war doch für ihn die erste unmittelbare Berührung mit dem Leben. Wie man auch über Bodmer urteilen mag: er war in einem gewissen Sinne eine mächtige Persönlichkeit, ein ganzer Mann. Für jemand, der große Menschen bisher nur aus Büchern kennen gelernt hatte, bedeutete die Bekanntschaft mit einer solchen Persönlichkeit viel. Es ist etwas anderes, über wichtige Dinge zu lesen, oder sie unmittelbar aus einer Seele lebendig hervor-quellen zu sehen. - Es kommt auf diese Lebendigkeit und Unmittelbarkeit viel mehr an, als darauf, ob der eine oder der andere findet, daß die betreffende Persönlichkeit doch im Grunde keine wahrhaft große war. - Bodmer war aber eine charakteristische Figur. Allmählich war er dazu gekommen, in der moralischen Weltanschauung die tiefere Grundlage der Kunst zu sehen. Die Forinen der Dichtung sollen den Menschen zu seinen höchsten Ideen hinleiten. Die Schönheit soll ein Ausdruck der höchsten Wahrheit sein. Diese Anschauungen lebten sich in Wielands Seele ein. Und er kam
#SE033-355
immer mehr dazu, sie auch selbst ganz energisch zu vertreten. Es mag nun manchem gefallen, über diese Übergangsstufe in Wielands Entwickelung gering zu denken. Man hat auch herausfinden wollen, daß die gerade damals erfolgte Heirat seiner geliebten Sophie ihn weltschmerzlich gemacht und in diese moralisierende Art hineingetrieben habe. Allein man mag selbst spotten darüber, daß er damals in bezug auf den Dichter Uz sagte, man «sollte auch die schlechtesten Kirchenlieder dem reizendsten Liede eines Uz unendliche Male vorziehen»; gerade bei der Richtung, welche Wielands Schöpfungen später genommen haben, war dieser Durchgangspunkt seiner Entwickelung unendlich wichtig. Er machte sich in der Folge ganz frei von jeglicher moralisierenden Richtung und wurde Meister in einem rein den schönen Formen gewidmeten Stil. Anmut und Grazie in der Schilderung des Sinnlichen wurde eines seiner Elemente. Daß er sich Hoheit und Festigkeit stets bewahrte, das rührt davon her, daß er aus dem eigenen Leben die moralisierende Beurteilung wirklich kennen gelernt hatte. Er hat sie dadurch in berechtigter Weise als Einseitigkeit kennen gelernt. Man muß gewisse Dinge selbst durchgemacht haben, wenn man zu ihnen ein richtiges Verhältnis gewinnen will.
1754 nimmt Wieland eine Hofmeisterstelle an. Er macht sich nun auch allmählich von Bodmer frei. Von besonderem Einflusse wird auf ihn die Lektüre des Engländers Shaftesbury, der in dem moralisch Guten einen Schwesterbegriff des Schönen sah. Schön ist, was dem Menschen gefällt; und das Gute ist das Schöne im Handeln. Daß Wieland von einer solchen Weltanschauung einen Eindruck empfangen konnte, zeigt, in welcher Richtung das Einleben in Bodmers Auf-fassung gegangen war. Fruchtbar hatte sich dieses Einleben
#SE033-356
besonders für die Ausbildung sehr beachtenswerter pädagogischer Ideen bei Wieland erwiesen. Sein 1753 veröffentlichter «Plan von einer neuen Art von Privatunterweisung» hatte ihm die oben bezeichnete Hauslehrerstelle gebracht. 1758 kam dazu noch ein «Plan einer Akademie zur Bildung des Verstandes und Herzens junger Leute».
Immer freier wird Wielands Denken und Lebensauffassung. 1759 erschien (als Fragment) sein Epos «Cyrus». Die damals immer mehr auftauchenden Aufklärungsideen hatten ihn in einer besonderen Form ergriffen. Er idealisiert den Perserkönig zu einem Helden der Freiheit. Es handelte sich für ihn weniger um eine Darstellung des historischen Cyrus, als vielmehr um die Idee, die sich ein aufgeklärter Mensch von einem Herrscher macht, der im Sinne eines nach Freiheit dürstenden Zeitalters regiert. Auch im Drama versuchte sich Wieland Sein Trauerspiel «Lady Johanna Gray» wurde 1758 in Winterthur mit Beifall aufgeführt und fand sogar in den Augen des kritischen Lessing Gnade. - Wieland war in dieser Zeit bereits in weiteren Kreisen als Schriftsteller bekannt geworden. In seinem äußeren Leben trat 1759 dadurch eine Veränderung ein, daß er seine Züricher Hauslehrerstelle mit einer solchen in Bern vertauschte. Doch gab er diese nach kurzer Zeit auf und brachte sich eine Zeit-lang durch freien Unterricht in verschiedenen Fächern durch.
#TI
Wieland in der Schweiz
#TX
In Bern lernt er eine geistvolle Dame, Mademoiselle Bondeli, kennen. Sie ist auch als Rousseaus Freundin berühmt geworden. Daß sich Wieland mit ihr verlobt hat, ist von geringerer Bedeutung, denn das Leben löste dieses Verlöbnis wieder.
#SE033-357
Wohl aber hat es für ihn Wichtigkeit gehabt, daß er in Bern die Möglichkeit hatte, sich mit einer geistvollen Persönlichkeit angeregt zu unterhalten, die in fast allen Gebieten des menschlichen Wissens zu Hause war, und welche die Welt von einem hohen Standpunkt aus zu beurteilen vermochte. Ihr Bild begleitete Wieland durchs Leben; mancher ihrer Züge findet sich in den Frauengestalten seiner Dichtungen, und als Greis gab er über sie das schöne Urteil ab, «daß sie der schönste, hellste, ausgebildetste und in jeder Rücksicht vollkommenste weibliche Geist sei, der mit einem so regelmäßigen, zugleich so zarten und starken, so liebevollen und dazu von aller Schwachheit so gänzlich freien Herzen verbunden war».
Die Zeit war gekommen, in der Wieland daran denken mußte, sich eine festere Lebensstellung zu gewinnen. Die Verwandten und Freunde in der Heimat kamen ihm darin entgegen. Sie haben es bewirkt, daß er am 30. April 1760 zum Senator in Biberach ernannt worden ist. Ein solcher hatte Anwartschaft auf gewisse Stellen im Gemeindeamt, die eine Brotversorgung bildeten. Wieland erhielt eine solche im Juli desselben Jahres als Kanzleidirektor. Allerdings blieb die Anstellung vier Jahre hindurch eine provisorische. Biberach war in religiöser Beziehung gespalten. Bei der Besetzung der Stellen stritten sich eine katholische und eine protestantische Partei, und Wieland wurde erst später definitiver Stadtschreiber. 1765 verheiratete er sich mit Dorothea von Hillenbrand aus Augsburg, die ihm durch die Bemühungen der Verwandten zugeführt worden war. Es war eine Eheschließung ohne Enthusiasmus, aber der Grund zu einem dauernden Lebensglück, zu stiller, zufriedener Gemeinschaft, welche bis zum Tode der Gattin, 1801, ungetrübt dauerte.
#SE033-358
Den Grundton dieser Gemeinschaft mag man in den Worten finden, die Wieland über die Frau schrieb: «Meine Frau ist eines der vortrefflichsten Geschöpfe Gottes in der Welt, ein Muster jeder weiblichen und häuslichen Tugend, frei von jedem Fehler ihres Geschlechtes, mit einem Kopf ohne Vorurteile und mit einem moralischen Charakter, der einer Heiligen Ehre machen würde. Die zweiundzwanzig Jahre, die ich nun mit ihr lebe, sind vorbeigekommen, ohne daß ich nur ein einziges Mal gewünscht hätte, nicht verheiratet zu sein; im Gegenteil ist sie und ihre Existenz mit der meinigen so verwebt, daß ich nicht acht Tage von ihr entfernt sein kann, ohne etwas dem Schweizer Heimweh Ähnliches zu erfahren. Von dreizehn Kindern, die sie mir geboren hat, leben zehn liebenswürdige, gutartige, an Seele und Leib gesunde Geschöpfe, die nebst ihrer Mutter das Glück meines Lebens ausmachen. »
#TI
Shakespeare-Übersetzung
#TX
In die Biberacher Zeit fällt eine Tat Wielands, die zu den bedeutendsten und einflußreichsten seines Lebens gezählt werden muß. Er begann 1762 mit einer Übersetzung von Shakespeares Dramen. Bis 1766 war es ihm gelungen, zweiundzwanzig dieser Dramen dem deutschen Publikum zugänglich zu machen. Bedenkt man, daß bis dahin Shakespeare in Deutschland so gut wie unbekannt war und daß er seit jener Zeit auf das deutsche Geistesleben einen Einfluß gewonnen hat, der sich nur mit dem Schillers oder Goethes selbst vergleichen läßt, so wird man die grundlegende Bedeutung von Wielands Tat im richtigen Lichte sehen. Lessing würdigte dieselbe daher sogleich in richtiger Art. Und
#SE033-359
Goethe wie Schiller sind in dieser Richtung Wieland Dank schuldig, denn auch ihnen wurde Shakespeare vorzüglich durch ihn vermittelt.
#TI
Neuer künstlerischer Stil
#TX
Die kleinlichen Verhältnisse in Biberach wurden für Wieland dadurch etwas erträglicher gemacht, daß sich in dem benachbarten Schlosse Warthausen 1761 der ehemalige Kurmainzische Minister Graf Stadion niedergelassen hatte, bei dem auch der Regierungsrat la Roche mit seiner Gattin Sophie lebte. Sie war ja die ehemalige Freundin Wielands In dieses Haus trat Wieland als guter Freund und immer gern gesehener Gast ein. Französischer Geschmack, eine gewisse freie, ja leichte Lebensauffassung und Welterfahrung war hier heimisch. Für den Dichter, dem auch Sophie la Roche in herzlicher Freundschaft entgegenkam, gab es da die aller-schönste Anregung. Was gesprochen wurde, stand ganz im Zeichen der Aufklärung, trug in vieler Beziehung den Charakter der Zweifelsucht und lehnte sich an Voltaire, Rousseau, an die französischen Enzyklopädisten d'Alem-bert, Diderot und andere an. - Durch alles dieses verlor sich bei Wieland selbst die Schwere, die sein Lebensstil durch die früheren Verhältnisse noch gehabt hatte. Eine rein künstlerische Weltauffassung stellte sich immer mehr ein. Nüchternheit, getaucht in Grazie und anmutige Schönheit, wurden ihm mehr wert als der Blick in übernatürliche Höhen des Ideals. Eine solche Gesinnung stellt das Leben höher als alles Nachdenken und Nachsinnen über das Leben. Mag des Menschen Vernunft auch nicht ausreichen, die eigentlichen Tiefen das Daseins auszuschöpfen; diese Vernunft ist nun
#SE033-360
einmal da, und man halte sich an sie. Mag die Sinnlichkeit auch trügerisch sein: diese Sinnlichkeit ist dem Menschen gegeben, er soll sich ihrer freuen. In solche Worte etwa läßt sich das Bekenntnis fassen, welches als Hintergrund hinter den Schöpfungen Wielands in seiner Biberacher Zeit erscheint. 1764 veröffentlichte er den Roman «Der Sieg der Natur über die Schwärmerei, oder die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva». 1765 seine «Komischen Erzählungen», und 1766 und 1767, in zwei Bänden, die «Geschichte des Agathon». Durch den «Don Sylvio» und die «Komischen Erzählungen» zog er sich nunmehr ebenso den Abscheu der Klopstockianer zu, wie er vorher mit Freuden in ihren Kreis aufgenommen worden war. - Und es konnte nicht ausbleiben, daß die neue Art seines Schaffens bald unberufene Nachahmer fand, denen es nicht um eine Darstellung des Sinnlichen in künstlerischer Form, sondern einfach um die Schilderung des Niedrigen selbst zu tun war. Wieland mußte ausdrücklich betonen, daß er mit solch unkünstlerischem Beginnen nichts zu schaffen habe. - Man kann nun nicht behaupten, daß der Dichter in den beiden genannten Werken schon das erreicht hat, was ihm offenbar vorschwebte. Zum «Don Sylvio» schwebte ihm der Stil des «Don Quijote» vor. Er wollte in diesem Stile gegen Aberglaube und falschen Idealismus zugunsten emes gesunden natürlichen Sinnes protestieren. In den «Komischen Erzählungen» werden Stoffe der griechischen Mythologie zu allerdings graziösen, aber immerhin recht fragwürdigen Schilderungen benützt.
#SE033-361
#TI
Wielands Eigenart
#TX
Nur eine volle Unbefangenheit, die nicht richten, sondern verstehend in eines Menschen Seele sehen will, kann Wieland in diesem Punkte seiner künstlerischen Entwickelung gerecht werden. Die Art, wie er sich eine Lebensauffassung erwerben mußte, war nicht geeignet, einen festen Mittel-punkt in der eigenen Persönlichkeit zu schaffen. Die Gedanken vieler Menschen hatte er im Spiegel der Bücher in sich aufgenommen. Eine solche Art bringt gerade bei großer, zu künstlerischer Auffassung neigender Begabung eigentümliche Wirkungen hervor. Der Mensch läßt die verschiedenen Meinungen seiner Mitmenschen mehr wie Bilder an seinem Geiste vorbeiziehen. So starke Neigungen, so feste Urteile bilden sich nicht, als der Fall ist, wenn das Leben selbst den Lehrmeister abgibt. Man ist für das eine mehr, für das andere weniger eingenommen; aber man gibt an keines die ganze Persönlichkeit dahin. Diese bleibt schwankend. Menschen, die nicht viel auf solche Art kennen lernen, kommen verhältnismäßig schnell zu einer gefestigten Lebensansicht. Das Leben zwingt ihnen eine solche auf. Denn das Leben ergreift den Menschen in der Regel doch nur von einer Seite. Es macht dann einseitig, aber fest. Anders geht es Menschen, die wie Wieland sich entwickeln. Sie lernen das Leben durch seine Spiegelbilder in vieler Leute Köpfe kennen. Und eine gewisse Berechtigung hat doch jedes Weltbild. Wenige können etwas erdenken, was nicht doch innerhalb gewisser Grenzen eine Berechtigung hätte. Wer sich so mit den Meinungen über die Dinge, statt mit den Dingen selbst zu befassen hat, wird leicht die Festigkeit auf Kosten der Vielseitigkeit zurücktreten lassen müssen. Schlimmer wäre nur, wenn er darüber
#SE033-362
allen inneren Halt verlöre. Das war aber bei Wieland auch nicht im entferntesten der Fall. Sein Wesenskern wurzelte in den edlen Zügen des deutschen Bürgertums. - Ja, in einer gewissen Hinsicht beruht gerade darauf seine ganze Bedeutung. Er konnte durch die leichte Beweglichkeit seines Stiles die Feinheit des französischen Geschmackes und die künstlerische Verklärung der Sinnlichkeit im Sinne der griechischen Weltauffassung für das deutsche Geistesleben erobern, und blieb dennoch diesem Geistesleben in seiner volkstümlichen Eigenart durch seinen eigenen Wesenskern verwandt. Nie ging ihm über französischer Anmut und griechischer Grazie das deutsche Gemüt verloren.
Aber als «Büchermensch» war er in den beiden Fällen, in denen ihm eine feste Weltanschauung durch lebendige Menschen entgegentrat, dem Anprall schonungslos ausgesetzt. So war es in Zürich bei Bodmer, so war es in Warthausen bei Stadion und den la Roches. Dort floß der Moralismus, hier die weltmännische Art in das eigene Blut über.
Es war nun Wieland Bedürfnis, sich selbst über seinen Wandel aufzuklären. Der Dichter tut das durch eine Dichtung. Es wird daraus der Roman, die «Geschichte des Agathon». Allerdings stellt er die eigene Entwickelung im Kleide eines Vorganges aus der alten griechischen Welt vom vierten vorchristlichen Jahrhundert dar. Der Idealist Agathon, welcher zunächst ganz in platonischen höheren Welten lebt, wird gegenübergestellt dem Weltkinde Hippias. Hippias steht auf dem Boden einer Weltauffassung, die sich rein auf die Befriedigung der menschlichen Selbstsucht und des materiellen Wohles gründet. Obgleich Agathon sich abgestoßen fühlt von solcher Auffassung, bleibt die Berührung mit derselben doch nicht ohne Folgen für seine Entwickelung. Er
#SE033-363
macht die Wandlung durch vom weltabgewandten Idealisten zu einem Menschen, der sich der unmittelbaren Wirk-lichkeit ergibt. - Wieland hatte bei seinem Suchen nach der Wirklichkeit den Sinn auf das Griechentum gerichtet. Nicht auf eine gemeine Wirklichkeit war es bei seiner Wandlung abgesehen, sondern auf eine künstlerisch veredelte, auf eine mit Geist erfüllte. So ist es nicht willkürlich, daß er den eigenen Entwickelungsweg in griechisches Gewand kleidete. Gewiß haben andere das Griechentum anders gesehen. Die Art, in der es Wieland sah, entsprach zu seiner Zeit einer Notwendigkeit. Und Goethe hat ja in dieser Beziehung, nach seinem eigenen Geständnis, viel von Wieland gelernt. -Er hat es noch in anderer Hinsicht. Durch den «Agathon» war ein neuer Romanstil geschaffen. Und wozu durch ihn der Keim gelegt worden ist, das entfaltete sich später in Goethes Stil des «Wilhelm Meister». Auf solche Dinge deutet Goethe auch, wenn er davon spricht, daß Wieland den deutschen Gebildeten einen Stil gegeben habe. In solcher Art wurde Wieland ein Pfadfinder. Bei ihm selbst ging die Frucht seines Strebens im schönen Sinne auf, als er 1764 den Plan faßte zu dem Werke, das dann 1768 gedruckt worden ist: «Musarion, oder die Philosophie der Grazien», ein Gedicht in drei Büchern. Wie Goethe dieses Werk beurteilte, ist oben bereits gesagt. Mit Recht trägt es den bezeichnenden Neben-titel «Philosophie der Grazien».
#TI
«Musarion»
#TX
Eine wichtige Lebensfrage trat Wieland immer mehr vor die Seele: hat Idealismus irgendeinen Wert, wenn er nicht aus dem innersten Wesenscharakter des Menschen kommt? Und
#SE033-364
mit diesem Hauptpunkte verbanden sich ganz naturgemäß eine Reihe von Nebenfragen: Tritt der Idealismus nicht oft nur als eine innerlich unwahre Schwärmerei auf? Hat man dem unwahren Idealismus nicht den in niederen Regionen sich bewegenden, mehr oder weniger sinnlichen, aber wahren Lebensgenuß vorzuziehen? Das sind die Fragen, welche der «Musarion» zugrunde liegen. Deshalb stellt Wieland den Stoiker Kleanth und den Pythagoreer Theophron gegenüber der Musarion, welche dem graziösen Lebensgenuß ergeben ist. Jene sind unwahr und phrasenhaft; diese wahr, wenn sie sich auch nicht in übersinnliche Höhen erhebt. Über das Ganze ist die Anmut einer freien Versbehandlung ausgegossen. In einer spielenden Art philosophiert Wieland aber das Spiel ist Kunst, und die Philosophie ist wie ein geistreiches Gespräch. Doch ist das Gespräch ein solches, das eine Persönlichkeit führt, die auf der vollen Höhe der Situation steht. - Man darf keinen Augenblick außer acht lassen, daß weder gegen einen wahren Idealismus, noch für eine rohe Sinnlichkeit in der «Musarion» irgend etwas vorgebracht wird. Wer beides unbefangen beachten kann, der wird sein Gefühl nach keiner Richtung hin verletzt fühlen.
#TI
Das Sinnliche bei Wieland
#TX
Eine ähnliche Frage und eine ähnliche Gesinnung spricht aus dem 1766 bis 1767 gedichteten, unvollendeten Gedicht «Idris und Zenide». Hier wird ebenfalls in künstlerisch anmutiger Weise die geistig verfeinerte Liebe der ins Übersinnliche fliegenden Schwärmerei auf der einen Seite und der rohen Sinnlichkeit auf der andern Seite gegenübergestellt. Daß der Dichter zuweilen durch die Wahl des Stoffes
#SE033-365
wie in «Nadine» den Eindruck des Lüsternen nicht hat zu vermeiden vermocht, muß durchaus zugegeben werden. Es darf aber nicht vorausgesetzt werden, daß der Dichter zu dem in sinnliche Formen gekleideten griechischen Heidentum aus dem Grunde gegriffen habe, um seinen Lesern einen frivolen Unterhaltungskitzel zu bieten. Ihm war es vielmehr um eine ernste Lebensfrage zu tun, nämlich um die: welche Rolle spielt und darf spielen das Sinnliche im Menschendasein? Wie sich dieser oder jener zu einer solchen Frage stellt, davon darf nicht die Beurteilung des Dichters abhängen. - Derselben Zeit und Seelenrichtung gehören auch noch einige später erschienene Werke Wielands an: «Grazien» (erschienen 1770), der «Neue Amadis» (1771) und «Aspasia» (1773); sie sind dem Plane nach und auch in denwesentlichen Partien schon einige Zeit vor ihrer Veröffentlichung entstanden.
Eine Veränderung in der Lebenslage war für Wieland durch den Wegzug des Grafen Stadion von Warthausen eingetreten. Was dem Dichter seine Biberacher Amtswirksamkeit erträglich gemacht hatte, fiel damit weg. Auch starb der Graf bald darauf 1768.
#TI
Universitätslehrer. Tätigkeit in Erfurt
#TX
Eben als den sechsunddreißigjährigen Wieland seine Tätigkeit und Umgebung anfangen mußte, recht öde anzumuten, trat eine Wendung in seinem Leben ein. Man hatte am Kur-mainzer Hofe seit lange das Augenmerk auf den Schriftsteller gelenkt, der mit solch hoher Begabung die Dinge behandelte, welche damals gerade die weltmännischen Kreise interessierten. In Mainz herrschte der Kurfürst Emmerich
#SE033-366
Joseph. Er sah in Wieland den rechten Mann, der seine im Niedergange begriffene Universität Erfurt wieder in die Höhe bringen konnte, und berief ihn als Professor an dieselbe. Für Wieland konnte die Annahme dieses Rufes nicht zweifelhaft sein. Pädagogische Neigungen hatte er seit langem. Dies war in den beiden bei Gelegenheit seines Schweizer Aufenthaltes erwähnten Schriften zutage getreten. So kam es denn, daß unser Dichter im Juli 1769 als Philosophieprofessor in Erfurt eintraf. - Für die Universität war seine Wirksamkeit eine außerordentlich bedeutsame. War Wieland auch kein Bahnbrecher auf dem philosophischen Gebiete, er hatte sich doch innerhalb der Grenzen, die ihm einmal gesteckt waren, eine umfassende Kenntnis der großen Weltfragen und der Geistesheroen angeeignet. Und es wirkt ja immer belebend, wenn jemand von diesen Dingen so zu seinen Zuhörern zu sprechen vermag, daß diese etwas davon verspüren, wie die Welträtsel nicht bloß Schul-, sondern Lebensfragen sein können. Es ging ein neuer, frischer Zug von Wielands Vorträgen für die Universität aus. Er sprach über philosophische, literarische, geschichtliche Dinge. - Und wesentlich ist, daß die ganze Sache auf Wielands eigene Art zurückwirkte. Er mußte Dinge noch einmal im systematischen Zusammenhange durchdenken, die vorher mehr fragmentarisch durch seine Seele gezogen waren. Dazu kam, daß die damalige Zeit gewisse Anforderungen nach dieser Richtung hin an jeden Denkenden stellte. Es war die Hochflut der Aufklärung. Die Wirkungen, welche von Rousseau, von den französischen Aufklärern und wissenschaftlichen Materialisten, von der deutschen freigeistigen Philosophie ausgegangen waren, hatten das Nachdenken in Fluß gebracht. Wielands Berufung auf einen philosophischen Lehrstuhl fiel
#SE033-367
gerade in eine Epoche hinein, in welcher die Menschheit über ihre Aufgaben, über ihr Ziel, ihre Freiheit und Selbstbestimmung intensiv nachdachte. Es war selbstverständlich, daß Wieland sich mit all dem auseinandersetzen mußte. Rousseau hatte ja in dem Naturzustande die einzige Glücksmöglichkeit gesehen und in aller Zivilisation nur eine Entwickelung zu unseligen Zuständen. Wer sich nicht der Verzweiflung an dem Fortschritte der Menschheit oder der Gleichgültigkeit gegenüber demselben ergeben wollte, der mußte sich nach den Wegen fragen, auf denen eine Höherentwickelung mög-lich ist. Ein Gefühl machte sich allenthalben geltend, daß die Menschheit aus einer Art unmündigem Zustand zur Mündigkeit vorgeschritten sei. Uralte Glaubensvorstellungen waren ins Wanken gekommen. Kant hat ja aus solchen Zeitforderungen heraus in einem Aufsatze über die Aufklärung die Frage: «Was ist Aufklärung?» beantwortet mit den Worten: «Mensch, erkühne Dich, Dich Deiner Vernunft zu bedienen». Alle diese Fragen spielten in Wielands Nachdenken hinein, wenn er sich zurechtlegte, was er seinen Erfurter Hörern zu sagen hatte. Und sie nahmen zunächst Gestalt an, die seiner Neigung zu pädagogischen Aufgaben entsprach. So entstand ein Roman «Der goldene Spiegel, oder die Könige von Scheschian», der 1772 in vier Bänden erschienen ist. In dem Kleide einer morgenländischen Erzählung stellt er seine Gedanken über die beste Staatsform und Volkserziehung hin. Er zeigt, was einem Staat zum Verderben, was zum Segen gereichen könne. In der Persönlichkeit des Danischmend verkörpert er einen Staatsmann, der seinen Fürsten zugleich erzieht. - Wieland hat damit ein durchaus zeitgemäßes Buch schaffen wollen. Und es ist ihm gelungen. Denn er hat auf viele einen großen Eindruck damit
#SE033-368
gemacht. Die Zeitideen spielen auch eine Rolle in den 1770 gedruckten «Beiträgen zur geheimen Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens. Aus den Archiven der Natur gezogen». Da liegt der Gedanke zugrunde, daß der von Rousseau gemalte glückliche Naturzustand eine Illusion sei. Die Menschheit solle nicht von einer Seligkeit träumen, die sie einmal besessen und verloren habe, sondern sie solle in der Fortentwickelung in die Zukunft hinein ihre Aufgabe sehen.
Der ganze Reichtum Wielandschen Humors kam in der Prosaschrift «Socrates mainomenos, oder die Dialoge des Diogenes von Sinope» heraus, die 1770 erschienen ist. Er unternimmt es hier, den zynischen Philosophen Diogenes in einem unbefangeneren Lichte darzustellen, als dies gewöhnlich geschieht. In Erfurt legte er auch die letzte Hand an die Dichtung «Die Grazien», die in einer gewissen Beziehung ein Glaubensbekenntnis Wielands enthält. Die Grazien werden als Schöpferinnen des sinnlichen und vergeistigten Schönheitslebens hingestellt. Uber dem Ganzen schwebt da mehr ein Gefühl als ein Gedanke. Alle schweren Lebensfragen sollen ihre Verklärung finden in der durch Schönheit veredelten und leichtgemachten Lebensführung. Und dasselbe Gefühl ist ausgegossen über den «Neuen Amadis», der ebenfalls in Biberach begonnen und hier vollendet worden ist. Die Charaktere der Helden werden hier ins Närrische, die der Heldinnen ins Abgesdimackte verzerrt, um im leichten künstlerischen Spiel den Wert der vergeistigten gegenüber der bloß sinnlichen Schönheit zu zeigen.
#SE033-369
#TI
Berujung nach Weimar
#TX
So segensvoll Wielands Erfurter Wirken für die Universität auch war: er fand für sich dort wenig Anregung. Unter den anderen Professoren war wenig geistige Regsamkeit zu finden, auch hatten sie Wieland nicht gerade mit Freuden begrüßt, da er doch «nicht zum Fach gehörte». Es waren daher wieder Lichtblicke in seinem Leben, als er auf einer Reise 1771 die Familie la Roche in Ehrenbreitstein bei Koblenz besuchen und da auch die Bekanntschaft von Georg und Fritz Jacobi machen konnte sowie in Darmstadt diejenige von Johann Heinrich Merck. Alle diese Persönlichkeiten traten ja später auch in Goethes Freundeskreis ein. Insbesondere war der sehr urteilsfähige und in Wissenschaft und Leben bewanderte Merck ein guter Ratgeber nicht nur für Wieland, sondern auch für Goethe. Von besonderer Bedeutung aber war, daß Wieland im November 1771 der Herzogin Anna Amalie von Weimar bei einem seiner Ausflüge dahin vorgestellt werden konnte. Sie führte für den noch nicht groß-jährigen Sohn Karl August die Regierung. Mit dem offenen Blick, der ihr eigen war, erkannte sie die Bedeutung Wie-lands. Ihrer schöngeistigen, feingebildeten Art entsprach es, einen solchen Mann in ihrer Nähe zu haben. Sie machte ihm daher bald den Vorschlag, die Erziehung des Erbprinzen zu übernehmen. Und durch Wielands Einwilligung war denn auch die erste der vier großen Persönlichkeiten an den Weimarer Fürstenhof gezogen, die dann durch Jahrzehnte hindurch diese Stadt zum Mittelpunkt des deutschen Geisteslebens machten. 1775 kam Goethe, bald darauf Herder, und zuletzt Schiller hinzu. Von 1772 bis ,775 führte Wieland Karl Augusts Erziehung. Von da ab lebte er mit einer Pension
#SE033-370
als Freund des Hofes und der Weimarischen Geistesgrößen, von allen geschätzt und geliebt. Seine Fürstin hatte m ihm gefunden, was sie suchte und brauchte, einen treuen Freund und Ratgeber, der auch durch die leichte Art seiner Kunst ihrem Schönheitssinn und ihrem Bedürfnis nach vergeistigter Unterhaltung entgegenkam. Der junge Erbprinz gewann volles Vertrauen zu seinem Lehrer und bewahrte es ihm auch in der freundschaftlichsten und liberalsten Art, als er der Erziehung entwachsen und zur Regierung gekommen war.
Aus dem Zusammenwirken der graziösen Kunst Wielands und dem Unterhaltungsbedürfnis des Hofes entstanden durch den Dichter eine Reihe von Gelegenheitsdichtungen zu festlichen Anlässen. Dadurch wurde seine anmutige Muse in einen durchaus nicht unwürdigen Dienst gestellt; und es ging daraus sogar etwas hervor, was in einer gewissen Richtung bedeutsam war: Wielands Singspiel. In «Aurora», «Alceste» lieferte Wieland feine Texte, die dann der begabte Komponist Schweitzer mit der Musik versah. Bedeutsam ist, was da angestrebt worden ist, deshalb, weil als ein Ideal vorschwebte, einen harmonischen Zusammenklang von Dichtung und Musik zu erstreben, ein Bestreben, das ja dann viel später zu so großen Erfolgen auf dem Gebiete der musikalischen Dramatik geführt hat.
Wieland benutzte seine Muse, um das zu vollführen, wozu er durch alle seine Begabungen geradezu vorherbestimmt war: er gründete der deutschen Bildung eine Zeitschrift in dem «Teutschen Mercur». Wenn irgend jemand, so war er jetzt dazu berufen, einen solchen Mittelpunkt des deutschen Geistesstrebens zu schaffen. Die Art, wie er wirkte, entsprach ja gerade dem, was weiteste Kreise nötig hatten. Er
#SE033-371
war kein Weltenstürmer, aber ein auf der Bildungshöhe lebender Mann, der durch seinen eigenen Charakter in der aufstrebenden deutschen Bildung wurzelte, und der durch sein Einleben in französischen Geschmack und in das Schönheitsleben der alten Welt geeignet war, die Gesichtskreise der Menschen zu erweitern. So mochte er wohl Goethe mit den ersten Heften des «Mercur» ärgern, der Großes erwartet hatte in seinem jugendlichen Drange, und nun nur mittleres Bildungsniveau vor sich zu sehen glaubte; den Bedürfnissen seiner Zeit ist aber Wieland doch entgegengekommen und hat ihnen entsprochen.
#TI
«Geschichte der Abderiten»
#TX
Dabei war Wieland allerdings nicht der Mann, der etwa den Schwächen der Menschen schmeichelte. Das zeigte er am klarsten, als er im zweiten Jahrgang des «Mercur» mit seinem Roman «Geschichte der Abderiten» begann, dessen Vollendung sich allerdings bis 1780 hinauszog. - Die Handlung ist auch da an einen fernen Ort und in eine ferne Zeit verlegt. Es wird das Treiben in dem thrakischen Städtchen Abdera geschildert. Der weitgereiste, vielkundige Demokrit wird mitten hineingestellt in eine Bevölkerung, die in ihrer Torheit gar nichts von dessen Größe versteht, und die doch in ihrem naiven Hochmut über alles urteilt, was der Weise spricht und tut. Die «Abderiten» sind allein geeignet, Wieland einen bleibenden Platz in der deutschen Literaturgeschichte anzuweisen. Mit der köstlichsten Satire wird hier menschliche Engherzigkeit, Albernheit, Dünkel, Urteilslosigkeit, Naseweisheit usw. geschildert. Von Abdera wird gesprochen, doch «alle Welt» ist gemeint. In seiner Art hatte
#SE033-372
ja Wieland in Biberach, in Erfurt genug des Abderitentums erlebt. Es wird nicht nur derjenige in diesem Roman glänzend gezeichnet, der in engster Kirchturmpolitik von nichts etwas versteht und an allem mittut, um dabei die dümmsten Dinge zu vollbringen, sondern auch solche werden köstlich getroffen, die es am allerwenigsten merken. Denn diese ziehen oft ja selbst über Spießbürgertum und Philistrosität her, die bis über den Kopf darin stecken. Sie sehen den Philister in jedem andern; um ihn vor allem im eigenen Wesen zu entdecken, schützt sie ihr Hochmut, ihre Selbstverblen dung. Dieser Typus ist gerade durch Wieland mit unversieglichem Humor gezeichnet. Und die Schilderung ist wirklich so, daß sie auf alle Zeiten und Länder paßt. Alles Schelten auf die Unebenheiten dieses Romans, alles Kritisieren der mangelhaften Komposition an dieser oder jener Stelle sollte verstummen gegenüber dem köstlichen Humor, von dem das Ganze durchdrungen ist, und vor allem auch gegenüber der Universalität, mit der alle Seiten gerade des mehr oder weniger offenen oder geheimen Philistertums zu ihrem satirischen Rechte kommen.
Eine Reihe anderer Leistungen fallen noch in die erste Weimarer Zeit Wielands Das später «Die erste Liebe» genannte Gedicht «An Psyche», sowie die Erzählung «Der Mönch und die Nonne auf dem Mittelstein», die später den Namen «Sixt und Klärchen» erhielt, sind hier zu nennen. «Die erste Liebe» ist 1774 zur Hochzeit des weimarischen Hoffräuleins Julie von Keller mit dem gothaischen Oberamtshauptmann von Bechtolsheim gedichtet. Die junge Dame, die selbst dichtete, galt allgemein als eine außerordentlich liebreizende Erscheinung. Wieland aber legte in das Gedicht noch besonders die Empfindungen hinein, die
#SE033-373
ihm für die in der Jugend von ihm geliebte Sophie la Roche geblieben waren. Er selbst hielt das Gedicht für eines seiner besten. (Vgl. seinen Brief an Sophie la Roche vom 10. August
1806.)
In der erzählenden Dichtung «Sixt und Klarchen»,welche 1775 im «Teutschen Mercur» erschienen ist, lehnt sich Wieland an eine Sage an, die sich an die beiden Felsspitzen am Mittelstein (oder Mädelstein) in der Nähe von Eisenach knüpft. In diesen Felsspitzen vermag die Phantasie zwei Menschen zu sehen, die sich umarmen. Es ist die Sage entstanden, das seien ein entsprungener Mönch und eine Nonne, die zur Strafe für ihre Umarmung hier an dieser Stelle versteinert wurden. Es ist das einzige Mal, daß Wieland einen deutschen Stoff behandelt. Sonst sind es solche der alten Welt, oder neue, aber ausländische, die er bearbeitet. - Die Herzogin Amalie fand an dieser Schöpfung Wielands solchen Gefallen, daß dieser die Sache ihr zuliebe noch einmal in der Kantate «Seraphina» behandelte, zu welcher der weimarische Komponist Ernst Wilhelm Wolf die Musik lieferte. - 1776 erschien die poetische Erzählung «Gandalin, oder Liebe um Liebe», deren fein ironischer Ton im Freundeskreise Wielands außerordentlich gefiel.
#TI
Goethe in Weimar
#TX
Während sich durch alle diese Arbeiten Wieland die Liebe und Schätzung in weiteren Kreisen, insbesondere in seinem engeren Weimarischen erwarb, erschien 1775 (7. November) auf die Einladung Karl Augusts Goethe in Weimar. Dem ersten Zusammentreffen der beiden Männer in der Stadt, in der sie fortan lange freundschaftlich verbunden leben
#SE033-374
sollten, ging etwas voran, was Wieland vor eine harte Probe stellte und seinen Charakter und Wesenskern in dem schönsten Lichte zeigt. Goethe hatte doch kurz vorher die böse Farce «Götter, Helden und Wieland» geschrieben, in welcher Wieland auf das allerärgste verspottet worden war. Wohl hatte Goethe ursprünglich nicht an eine Veröffentlichung des Spottgedichtes gedacht, sie aber dann doch gestattet. Herausgefordert war der Spott durch eine Unbesonnenheit Wielands Dieser hatte 1773 Briefe an einen Freund über das deutsche Singspiel «Alceste» geschrieben, in denen er seine Alceste in gewisser Beziehung über diejenige des Euripides stellte. Mit bitterem Hohn wies Goethe in der genannten Farce das zurück, was ihn an dieser Sache naive Eitelkeit dünkte. Schon hatte Wieland darin Charak-tergröße bewiesen, daß er die Farce ganz objektiv und indem er ihre guten Eigenschaften voll anerkannte, zur Anzeige im «Mercur» brachte. Er ließ sich durch sie so wenig gegen Goethe einnehmen, daß er die Meinung, die er sich vorher über dessen dichterische Genialität gebildet hatte, nicht im geringsten änderte. Dennoch war es ein Meister-stück von Seelenstärke, wie sich Wieland bei der ersten Begegnung mit Goethe in Weimar innerlich und äußerlich verhielt. Das Ganze dieses Verhaltens wird mit einem hellen Strahl beleuchtet, wenn man sich den Brief vorhält, den der kurz vorher so schwer Mitgenommene am 10. November 1775 an Jacobi schreibt: «Dienstag, den 7. d. M. morgens um 5 Uhr ist Goethe in Weimar angelangt. 0, bester Bruder, was soll ich Dir sagen? Wie ganz der Mensch beim ersten Anblick nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in ihn wurde, da ich am nämlichen Tage an der Seite des herrlichen Jünglings zu Tische saß! Alles, was ich Ihnen, nach mehr als
#SE033-375
einer Krisis, die in mir diese Tage über vorging, jetzt von der Sache sagen kann, ist dies: seit dem heutigen Morgen ist meine Seele voll von Goethe, wie ein Tautropfen von der Morgensonne.» An Zimmermann schreibt Wieland bald darauf über Goethe: «Es ist in allen Betrachtungen und von allen Seiten das größte, beste, herrlichste menschliche Wesen, das Gott geschaffen hat.» - Eine schöne, auf voller gegenseitiger Anerkennung, Achtung und Liebe begründete Freundschaft der beiden Persönlichkeiten entstand, die sich dauernd hielt. Goethe schätzte Wieland nicht nur als Mensch und als Dichter; er hielt sich auch gerne in seinem Hause auf, und konnte immerfort Freunden gegenüber betonen, welche schöne Zeiten er mit Wieland und den Seinigen erlebte. Wieland aber entwirft in seinem 1776 entstandenen Gedichte «An Psyche» ein glänzendes Bild von Goethe, ganz durchdrungen von wahrem Verständnisse, von hingebendster Verehrung. Sowohl Wieland, wie auch Goethe waren im Beginne des Jahres 1776 mit der bereits erwähnten Frau Julie von Bechtolsheim auf dem Gute der Frau von Keller in der Nähe von Erfurt zu Besuch. Durch diesen Besuch, bei dem wohl Goethe Szenen aus seinem «Faust» vorgelesen hat, ist Wieland zu dem genannten Gedicht angeregt worden.
#TI
Poetische Erzählungen
#TX
Da Goethe den poetischen Erzählungen Wielands besonderen Beifall spendete, fühlte sich dieser zu weiteren Schöpfungen dieser Art ermutigt. Durch das 1776 entstandene «Wintermärchen» fand Art und Stimmung des orientalischen Märchens von «Tausend und eine Nacht» Eingang
#SE033-376
in die deutsche Dichtkunst. Dagegen ist das ein wenig später (1777) entstandene «Sommermärchen» dem Sagenkreise von König Artus und seiner Tafelrunde entlehnt. Wieland fand den Stoff in der «Bibliothéque universelle des Romans». Im Tone leichten künstlerischen Spieles ist dieses Märchen geschrieben, durch das Wieland das deutsche Publikum mit einem seit dem Mittelalter fast vergessenen Sagenkreise bekannt machte. Goethe und Merck sowie auch andere schätzten es sehr. Ziemlich genau einer morgenländischen Erzählung nachgebildet ist die 1778 geschriebene kleine Dichtung «Hann und Gulpenheh, oder: Zuviel gesagt, ist nichts gesagt». Die Geschichte stammt aus einer türkischen Novellen-sammlung «Die vierzig Wesire»; und Wieland hat sie in der «Bibliothéque universelle des Romans» gefunden. - Ferner ist aus derselben Zeit das Gedicht «Der Vogelsang, oder die drei Lehren». Der Stoff ist einer Übersetzung von «Tau-send und einer Nacht» entlehnt, die Galland unter dem Titel «Contes Arabes» herausgegeben hatte. Wieland hat hier Gelegenheit, einen König zu zeichnen, wie er nicht sein soll. Der Inhalt der Erzählung steht nicht ohne Zusammenhang mit einem Aufsatz, den Wieland kurz vorher im «Mercur» über «Das göttliche Recht der Obrigkeit» hatte erscheinen lassen. Er trat darinnen gegen die nach seiner Meinung einseitige Anschauung auf, daß keine Gewalt von oben einem Volke ein Recht aufdrücken dürfe, sondern daß alle Rechte vom Volke selbst ausgehen müssen. Wieland machte dagegen geltend, daß die Verhältnisse des Lebens sich nicht nach solchen abstrakten Forderungen richten könnten, sondern daß durch den geschichtlichen Verlauf dem oder jenem die Regierung zufalle. - Einem italienischen Volksmärchen ist nachgedichtet: «Pervonte, oder die Wünsche».
#SE033-377
Die zwei ersten Teile sind im Frühling 1778 entstanden, der dritte jedoch erst 1795 hinzugefügt. Auch diesen Stoff fand Wieland in der «Bibliothéque universelle des Romans». Doch zeigt sich gerade an dieser Dichtung Wielands, was freie, reiche Phantasie und völlige Beherrschung der Form aus einem gegebenen Stoffe machen kann. Noch bei Wielands Begräbnis (1813) äußerte Goethe zu Falk über diese Schöpfung: «Die Plastik, der Mutwillen des Gedichtes sind einzig, musterhaft, ja völlig unschätzbar. In diesen und ähnlichen Produkten ist es Wielands eigentliche Natur, ich möchte sogar sagen, aufs allerbeste, was uns Vergnügen macht. »
#TI
«Oberon»
#TX
Einen Höhepunkt seines Schaffens hat Wieland in seinem «Oberon» erreicht. Dieses romantische Epos ist vom November 1778 bis zum Februar 1780 entstanden und in den ersten Monaten 1780 im «Mercur» erschienen. Zwei geistige Ströme flossen in dieser Dichtungsarbeit zusammen. Der eine ist aus dem Interesse entsprungen, das Wieland an dem Charakter des Oberon, des Feen- oder Elfenkönigs in Shakespeares Sommernachtstraum genommen hat. Der zweite entstammte wieder der von unserem Dichter so oft benutzten «Bibliothéque universelle des Romans». Es ist die Geschichte eines Ritters aus der Zeit Karls des Großen, Huon von Bordeaux. Sie ist nach einem alten Ritterbuche durch einen vom Grafen Tressan gearbeiteten Auszug der genannten französischen Bibliothek einverleibt worden. -Den Streit und die Versöhnung des Geisterkönigs Oberon mit seiner Gemahlin Titania hat nun Wieland verwoben
#SE033-378
mit dem Liebes- und Ritterabenteuer des altfränkischen Helden, der nach dem Morgenlande zieht, um sich unter den größten Gefahren und Kämpfen seine Gattin zu erobern, und der sich mit letzterer dann den stärksten Proben des Mutes, der Entbehrung und Treue unterziehen muß, bevor er zu seinem Glücke gelangt. Diese Proben sind ihm durch Oberon selbst auferlegt. Denn aus der Bewährung seiner und seines Weibes Treue muß auch die Wendung zum Guten im Schicksal Oberons und Titanias eintreten. - In der schönsten Art gestaltet unser Dichter diese halb im Irdischen, halb im Übersinnlichen sich spinnenden Fäden in echtem romantischem Stile aus. Wie einer großartig sich abspielenden Traumhandlung kann man dem Ganzen folgen. Denn wie der Traum Konflikte knüpft und löst, so geschieht es hier. Aber dem Fortgang liegt doch immer, wenn auch nicht eine äußere, so doch um so mehr eine innere seelische Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit zugrunde. Und diese Gesetzmäßigkeit ist durch lange zwölf Gesänge hindurch vollkommen dramatisch. Dabei ist die Behandlung des Verses und der Sprache in jeder Hinsicht meisterhaft. Das alles hat Goethe voll eingesehen und deshalb nach Erscheinen des Gedichtes an Lavater geschrieben: «Oberon wird, solange Poesie Poesie, Gold Gold und Kristall Kristall bleiben, als ein Meisterstück poetischer Kunst geliebt und bewundert werden.» - Man hat vielfach Einwendungen gegen die Komposition des Gedichtes gemacht und geglaubt, daß es dem Dichter nicht vollkommen gelungen sei, die beiden Handlungen, die sich an das Paar Huon und Rezia auf der einen und Oberon auf der andern Seite knüpfen, zu vereinigen. Wer in den romantischen Grundcharakter des Ganzen eindringt, kann eine solche Behauptung nicht tun.
#SE033-379
Bei einem solchen Stil ist das freie Ineinanderspielen der Motive, das Weben in traumhaftem Dämmerdunkel nicht nur möglich, sondern durchaus reizvoll. Und unstatthaft ist es bei solchem Stil eine streng realistische Motivierung, eine verstandesmäßige, trockene Klarheit zu verlangen. Wieland fühlte sich auch während dieser Arbeit ganz in seinem Element. Er schrieb am 19. August 1779 an Merck: «Mein fünfter und sechster Gesang dünken mich, entre nous, so gut, daß mich's nur ärgert, so ein Werk nicht bis nach meinem Tode aufbehalten zu können. Dann, das bin ich gewiß, würde es eine Sensation machen vom Aufgang bis zum Niedergang.» In einem Brief an einen Züricher Freund nennt er den Oberon das Beste, was sein Kopf und sein Herz zusammen geboren haben, seitdem jener reif und dieses ruhiger geworden sind. Goethe erfreute beim Erscheinen des Werkes den Freund sogar mit einem Lorbeerkranze, dem er folgende bezeichnende Zeilen beifügte: «Unter Lesung Deines Oberons hätte ich oft gewünscht, Dir meinen Beifall und Vergnügen recht lebhaft zu bezeugen; es ist so mancherlei, was ich Dir zu sagen habe, daß ich Dir's wohl nie sagen werde. Indessen, weißt Du, fällt die Seele bei langem Denken aus dem Mannigfaltigen ins Einfache; darum schick ich Dir hier statt alles ein Zeichen, das ich Dich bitte, in seinem primitiven Sinne zu nehmen, da es viel bedeutend ist. Empfange aus den Händen der Freundschaft, was Dir Mit- und Nachwelt gern bestätigen wird.» Es ist durchaus nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, daß sich viele der Besten seines Zeitalters in ihrem Urteile ganz im Sinne Goethes zum «Oberon» verhalten haben.
In einem ähnlichen Stile wie den Oberon bearbeitete Wieland dann eine Erzählung, deren Grundstock einem italienischen
#SE033-380
Roman des sechzehnten Jahrhunderts entnommen ist: «Clelia und Sinibald, eine Legende aus dem zwölften Jahrhundert.» Die Höhe des ersteren Werkes konnte er da allerdings nicht wieder erreichen. - Auch ist damals die kleine Erzählung «Die Wasserkufe» begonnen worden, deren Vollendung wohl erst in das Jahr ,795 fällt.
Durch die letzteren Schöpfungen ist Wieland der Vater jener bedeutsamen Geistesströmung geworden, die man als die «Deutsche Romantik» bezeichnet. Wenn man ihn auch in diesem Zusammenhange weniger nennt; dem Wesen nach gehört er mit einigen seiner schönsten Leistungen durchaus in diese Richtung hinein.
Zwischen allen diesen Arbeiten liegt diejenige von dem dreiaktigen Singspiel «Rosamund», das 1777 für die Bühne von Mannheim zur Aufführung bestimmt war. Um der letzteren beizuwohnen, reiste Wieland im Winter 1777 bis 1778 nach Mannheim und konnte dabei zu seiner tiefsten Befriedigung die ihm befreundete Verehrerin seiner Muse, Goethes Mutter, die Frau Rat in Frankfurt am Main persönlich kennen lernen. - Es war gerade damals eine recht fruchtbare Zeit für Wielands Schaffen. Auch die leichten dramatischen Arbeiten «La Philosophie endormie» und «Pandora» sind in diesen Jahren entstanden. Dem Verkehr mit Goethe entstammt die Anregung zu dem Aufsatz: «Einige Lebensumstände Hans Sachsens», der 1776 entstanden ist.
#TI
Wieland und ältere Geistesrichtun gen
#TX
Durch Lavaters «Physiognomik» wurde Wieland veranlaßt, 1777 «Gedanken über die Ideale der Alten» zu schreiben. In solchen Prosaschriften zeigte sich der Reichtum, die
#SE033-381
Mannigfaltigkeit und das Stilvolle seines Geistes. Was von diesen «Idealen» nach dieser Richtung behauptet werden darf, das gilt auch von den 1780 entstandenen «Dialogen im Elysium», den «Gesprächen über einige neueste Weltbegebenheiten» (1782), den «Göttergesprächen» (1789 bis ,793) und insbesondere von der «Einleitung zum siebenten Briefe des Horaz» (1781 bis 1782), dem «Sendschreiben an einen jungen Dichter» (1782). In dem letzteren wendet er sich gegen unreife junge Dichter, die sich in dem Glauben, besondere Genies zu sein, an berühmte Persönlichkeiten wenden, und diesen dadurch oft recht unbehaglich werden. Als Herausgeber des «Mercur» hat Wieland natürlich solchen Ansturm ganz besonders auszuhalten gehabt. - Dem Jahre 1782 gehört der Aufsatz «Was ist Hochteutsch» an. Auch als Übersetzer beschäftigte sich Wieland in dieser Zeit. Er gab «Horazens Briefe» (1781 bis 1782), dessen «Satiren» (1784 bis 1786) und «Lucians von Samosata sämtliche Werke» (bis 1789) heraus. - In seiner leichten, geistreichen Art behandelte er den viel verschrienen Zyniker Peregrinus Proteus (in der «Geheimen Geschichte des Philosophen pp.») 1789 bis 1791, für den er ebenso als Anwalt auftrat, wie einige Jahre später für den oft angegriffenen Apollonius von Tyana in dem Roman «Agathodämon». In diesem letzten Werke hatte er Gelegenheit, auf die Kulturverhältnisse zur Zeit der Entstehung des Christentums und auf dessen erste Gestalt selbst einzugehen. Er wußte den schwierigen Gegenstand mit Geist und Würde, in seiner Art, zu behandeln. Nicht minder gelang ihm dieses für die Verhältnisse in Griechenland zur Zeit des vierten Jahrhunderts vor Christus in dem Roman «Aristipp und einige seiner Zeitgenossen» (1800). Das Werk ist in Briefform abgefaßt und
#SE033-382
zeigt eine eingehende Kenntnis der Zeit, aus welcher der Stoff stammt. Und es ist durchaus diese Kenntnis künstlerisch verarbeitet in freier, kluger Zeichnung der Persönlichkeiten und Vorgänge. - Auch für zwei andere Erzählungen, die sich in ähnlicher Art, mit einer etwas späteren Kultur befassen, hat der Dichter die Briefform gewählt:
«Menander und Glycerion» (1802) und «Krates und Hipparchia» (1804). In dem ersten Werke will Wieland ein ungeschminktes Bild des griechischen Liebeslebens geben, in dem zweiten soll gezeigt werden, daß diesem Leben die Vorstellung einer vergeistigten Auffassung der Liebe durchaus nicht fremd war. - Eine Anzahl novellistischer Erzählungen findet man unter dem Gesamttitel «Das Hexameron von Rosenhain» verbunden. #TI Wielands letzte Arbeiten #TX Aus ernstem Problem heraus erwachsen ist 1804 «Euthanasia. Gespräche über das Leben nach dem Tode». Wieland wandte sich da gegen den engherzigen Begriff, als ob die Tugend nur ihren Wert erhalte durch ihre Belohnung in einem künftigen Leben, ihn nicht vielmehr selbst in sich trage. Von Gelegenheitsdichtungen machen durch die Schönheit ihrer Sprache und die Wärme ihres Inhalts noch die folgenden Anspruch auf Beachtung: «An Olympia» und «Am 24. Oktober 1784». Sie sind an die Herzogin Amalia, seine «olympische Schutzkönigin», «Merlins weissagende Stimme» ist an die Erbprinzessin Maria Pawlowna gerichtet. Mit dem letzteren Gedicht schließt Wielands dichterische Laufbahn ab. #SE033-383 In seinem Freundeskreise wurde die patriarchalische Art Wielands oft hervorgehoben. Und für die ruhige Art seines teilnehmend an allem Menschlichen hinfließenden Weimarer Lebens hat diese Bezeichnung durchaus etwas Treffendes. Sein persönliches Dasein steht im Zeichen dieser Ruhe und einer in bestimmten Grenzen durchaus sympathischen Seelenharmome, und das spiegelt sich auch in allen seinen späteren Schöpfungen. Nur einer solchen Art war es möglich, die Töne zu finden, denen wir im «Aristipp» begegnen, nur solcher inneren Geschlossenheit kann die geistvolle Ironie entstammen, mit denen da athenisches Leben zur Zeit des Perikles bilderreich entfaltet wird. Auch die Charakterschilderung des Sokrates in diesem Briefroman entstammt derselben Lebensanschauung und Gesinnung. - Bei aller Anspruchslosigkeit seines Wesens hat doch Wieland allen seinen Arbeiten seine Eigenart aufgedrückt. Es hat sich gezeigt, daß er seine Stoffe entweder anderen literarischen Schöpfungen, oder der Kultur- und Geistesgeschichte entlehnt hat. Als ein solcher, der dem Fremden, Angeeigneten sein Gepräge kräftig aufzudrücken wußte. Seine Bedeutung liegt in der Art der Behandlung. Und diese Form Wielandscher Selbständigkeit zeigt sich sogar in seinen Übersetzungen Lucians, Horazens, Ciceros. Wohl nirgends sind diese seine Übertragungen wörtlich, dafür aber immer wirkliche Eroberungen des Fremden für das deutsche Geistesleben. #SE033-384 #TI Wielands letzte Jahre #TX Die Wirkung, die Wieland erzielt hat, drückt sich wohl am besten darin aus, daß im Verlage Göschen in Leipzig 1794 mit einer Gesamtausgabe seiner Werke, sogar in vier verschiedenen Ausstattungen begonnen werden konnte. Dieselbe war 1802 auf 36 Bände angewachsen. - Vom Jahre 1797 an konnte der Dichter das Landgut Osmannstedt bewohnen, das er sich käuflich erworben hatte. Die lang gewünschte, stille Einsamkeit wurde Wieland dadurch getrübt, daß er im September 1800 die ihm sehr lieb gewordene Sophie Brentano, die Enkelin seiner Jugendfreundin la Roche, im schönsten Alter dahinsterben sehen mußte. Dieselbe war zweimal, 1799 und 1800, das erste Mal mit ihrer Großmutter in Osmannstedt zu Besuch. Der andere Verlust, der Wieland traf, war der im November 1801 erfolgte Tod seiner Frau. - Allein mochte er nun auch nicht mehr auf seinem Landgute weilen; er verkaufte dasselbe und verbrachte dann den Rest seines Lebens wieder in Weimar. - Noch öfter mußte er geliebte Persönlichkeiten betrauern, so 1803 Herder, dem er sich tief freundschaftlich verbunden hielt, im Februar 1807 Sophie la Roche und im April desselben Jahres die edle Frau, der er so vieles verdankte, die Herzogin Amalie 1806 hat er auch den über Deutschland hinwehenden Kriegssturm miterlebt und, gleich Goethe, Napoleon persönlich kennen gelernt. Dieser hat ihn sogar besonders durch den Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet. Noch stiller war es in der Folgezeit um Wieland geworden, als früher, da die genannten Freunde lebten. Er wußte auch diese Ruhe zu genießen und zu nützen. Und still und ruhig erlosch am 20. Januar 1813 das Leben des #SE033-385 Achtzigjährigen. Er wurde am 25. im Osmannstedter Gar-ten begraben, der früher sein Eigentum war und in dem sich auch die Gräber Sophie Brentanos und seiner Gattin befinden. Auf dem Grabe befindet sich ein kleines Denkmal mit der Inschrift: «Liebe und Freundschaft umschlang die verwandten Seelen im Leben / Und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein.» - Goethe hielt eine den Freund in der schönsten Weise ehrende Trauerrede in der Loge «Amalia» der Freimaurer, denen Wieland sich 1809 angeschlossen hatte. Hat Wielands Nachruhm durch das große Gestirn Lessing, Schiller und Goethe sich nicht voll ausleben können, der größte von den dreien, Goethe selbst, hat vieles getan, um den geschätzten Mitarbeiter an der Entwickelung des deutschen Geisteslebens zu seinem Rechte gelangen zu lassen.
Literatur
- Rudolf Steiner: Biographien und biographische Skizzen 1894 – 1905, GA 33 (1992), ISBN 3-7274-0330-6 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |