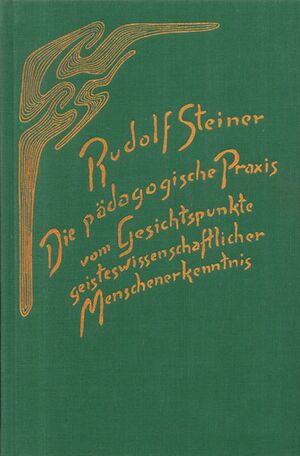Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 306
RUDOLF STEINERVORTRÄGEVORTRÄGE ÜBER ERZIEHUNGDie pädagogische Praxis
|
Inhaltsverzeichnis
- ERSTER VORTRAG Dornach, 15. April 1923
- ZWEITER VORTRAG Dornach, 16. April 1923
- DRITTER VORTRAG Dornach, 17. April 1923
- VIERTER VORTRAG Dornach, 18. April 1923
- FÜNFTER VORTRAG Dornach, 19. April 1923
- SECHSTER VORTRAG Dornach, 20. April 1923
- SIEBENTER VORTRAG Dornach, 21. April 1923
- ACHTER VORTRAG Dornach, 22. April 1928
- DREI FRAGENBEANTWORTUNGEN
- EINLEITENDE WORTE ZUR EURYTHMIE-AUFFÜHRUNG Dornach, 15. April 1923
- HINWEISE
- Literatur
ERSTER VORTRAG Dornach, 15. April 1923
Sehr verehrte Anwesende und liebe Freunde!
Lassen Sie mich Ihnen am Beginn dieser Veranstaltung meinen herzlichsten Gruß entgegenbringen. Wären Sie noch vor 4 oder 5 Monaten hier in für uns so erfreulicher Weise erschienen, dann würde ich Sie noch haben begrüßen können in jenem Bau drüben, den wir das Goetheanum genannt haben, und der Sie in seinen Formen, in seiner ganzen künstlerischen Ausgestaltung erinnert haben würde an dasjenige, was hier von Dornach aus, vom Goetheanum aus gewollt wird. Der Unglücksfall, der für viele, die das Goetheanum so lieb gehabt haben, so ungeheuer schmerzlich ist, der Unglücksfall der Silvesternacht hat uns dieses Goetheanum genommen, und wir werden vorläufig dasjenige, was als Geist walten wollte innerhalb dieser künstlerischen Stoffeshülle, ohne eine solche zu treiben haben.
Insbesondere darf ich herzlich begrüßen diejenigen Persönlichkei-ten, welche aus der Schweiz hier erschienen sind, und die damit bekräftigen, wie sie trotz aller Anfeindungen, die ja gerade auf diesem Boden in der letzten Zeit uns betroffen haben, ein gewisses Interesse für unsere Sache nach der pädagogischen Seite hin gefaßt haben. Mit einer besonderen Befriedigung begrüßen darf ich auch die Freunde der anthroposophischen Pädagogik, oder solche, die denken, es hier werden zu können, die aus der Tschechoslowakei in so großer Zahl erschienen sind. Sie bekräftigen ja damit, daß die pädagogische Frage gegenwärtig unter den allgemeinen Menschheitsfragen durchaus in hervorragender Weise mitgezählt werden muß. Zu der großen sozialen Bedeutung, zu der die pädagogische Frage kommen muß, kann sie ja doch nur kommen, wenn sie von den Lehrerpersönlichkeiten selbst in diesem Stile aufgefaßt wird. Dann begrüße ich auch diejenigen Persönlichkeiten, die auch aus anderen Ländern sich eingefunden haben, womit ja schon gesagt ist, wie dasjenige, was hier gesucht
wird, eine in Wahrheit internationale Sache sein soll, eine allgemeine Menschheitssache.
Und begrüßen darf ich auch unsere Freunde, die Lehrer der Stuttgarter Waldorfschule, die ja hauptsächlich deshalb erschienen sind, um hier aus ihrer pädagogischen Praxis an der Waldorfschule mitzuwirken, die vor allen Dingen deshalb hier uns so wertvoll sind, weil sie, als in unserer Sache tief drinnenstehend, diese Veranstaltung haben mitmachen wollen.
Heute wird es sich darum handeln, daß ich in einer Art von Einleitung dasjenige vorbereite, was wir in den nächsten Tagen miteinander behandeln wollen.
Über Pädagogik und Erziehungswesen wird ja heute allerdings ungeheuer viel gesprochen. Unzählige Menschen aus dem Kreise derjenigen, die Kinder zu erziehen und zu unterrichten haben, sprechen von notwendigen Reformimpulsen gerade mit Bezug auf das Erziehungs- und Unterrichtswesen. Und man darf schon sagen: es gibt der Standpunkte ungeheuer viele, von denen aus da gesprochen wird. Wenn man auf alle diese Standpunkte und auf dasjenige hinblickt, was von diesen Standpunkten aus gesprochen wird, manchmal mit einem ungeheuren Enthusiasmus für eine Neugestaltung und Reform des Erziehungs- und Unterrichtswesen, da könnte einem schon angst und bange werden. Nicht nur deshalb, weil man ja zunächst wirklich schwer absehen kann, wie sich eine gewisse Einheitlichkeit ergeben soll aus diesen allermannigfaltigsten Standpunkten, von denen natürlich jeder behauptet, daß er einzig und allein recht haben kann; sondem noch von einer ganz anderen Seite her könnte einem, möchte man sagen, angst und bange werden. Die Standpunkte, die da geltend gemacht werden, die machen mir weniger bange, denn die Notwendigkeiten des Lebens ergeben ja vielfach Ausgleichungen, Abrundungen desjenigen, was von solchen Standpunkten aus gesagt wird. Aber etwas anderes ist es, was immer wieder und wiederum aus meiner Seele heraufzieht, wenn man heute, man kann schon sagen, fast jeden Menschen, dem man begegnet, von der Neugestaltung des Erziehungs- und Unterrichtswesens reden hört. Und woraus gehen denn eigentlich diese mit solch löblichem Enthusiasmus vorgebrachten
Reformgedanken hervor? Sie gehen hervor aus der Erinnerung an die eigene Jugend und aus der Erinnerung an die eigene Erziehung. Man hat so in den Tiefen seiner Seele eine ungeheuer tiefe Unzufriedenheit mit seiner eigenen Erziehung, seinem eigenen genossenen Unterricht. Ja, aber - indem man dieses Gefühl hat, gibt man etwas höchst Eigentümliches zu: Man gibt nämlich zu, daß man furchtbar schlecht erzogen ist. Man muß sich eigentlich, indem man aus diesen Untergründen heraus die Reformgedanken aufwirft, sagen: man ist ein furchtbar schlecht erzogener Mensch. Und eigentlich steckt dieses Urteil, wenn die Leute es sich auch nicht eingestehen und es den anderen nicht eingestehen, wirklich so richtig drin in der besonderen Nuancierung der Worte, der Sätze ihrer Reformimpulse, die ausgesprochen werden. Wie mancher denkt da: Wie schlecht war doch meine Erziehung; das muß anders werden! - Ja, aber da treten einem zwei Dinge vor die Seele, die gar nicht tröstlich sind. Denn erstens, wenn man so furchtbar schlecht erzogen ist, wenn alles mögliche Schlimme während der eigenen Erziehung auf einen eingestürmt ist, wie soll man denn jetzt wissen, wie gut erzogen wird? Woher soll man denn das eigentlich gelernt haben? - Also, wenn man sich für die Berechtigung von Erziehungsreformgedanken auf seine eigene schlechte Erziehung beruft, so geht das eigentlich nicht recht.
Und das zweite tritt einem entgegen, wenn man hinhorcht auch auf die Art und Weise, wie manche Menschen von ihrer eigenen Erziehung und ihrem eigenen Unterricht sprechen. Ich möchte Ihnen da ein praktisches Beispiel anführen, denn ich möchte die ganzen acht Tage durchaus nicht aus der Theorie heraus, sondern überall aus praktischen Untergründen heraus sprechen. Sehen Sie, da ist eben vor einigen Tagen ein Buch erschienen, das eigentlich mich sonst nicht besonders interessiert, das aber interessant ist dadurch, daß nämlich in den ersten Kapiteln auch recht viel von einer Persönlichkeit über die eigene Erziehung und den eigenen Unterricht gesprcchen wird, von einer sehr merkwürdigen, heute außerordentlich be-rühmten Persönlichkeit. Es sind ja die «Lebenserinnerungen» jetzt erschienen von Rabindranath Tagore. Nun, da ich nicht das selbe Interesse für ihn habe wie andere Menschen heute in Europa, so darf
ich sagen, daß mich ja die «Lebenserinnerungen» nicht so außerordentlich sonst interessieren, aber mit Bezug auf das Erziehungswesen bieten sie doch ganz interessante Einzelheiten.
Sie werden mir zugeben, daß dasjenige, was wir ins Leben hinüber-tragen aus unseren Kindheitstagen, als Schönstes wirklich nicht enthält - selbst wenn Unterricht und Erziehung ganz außerordentlich großartig gewesen sind - die Erinnerung an die Einzelheiten, die uns in dieser oder jener Unterrichtsstunde geboten worden sind. Das wäre auch traurig. Denn es muß dasjenige, wodurch wir erzogen werden und in dem wir unterrichtet werden, übergehen in eine Art Lebensgewohnheiten, Lebensgeschicklichkeiten. Wir dürfen im späteren Leben nicht mehr von den Einzelheiten geplagt werden; das muß zusammenfiießen in einen großen Strom der Lebenspraxis. Dasjenige aber, was wir als Schönstes hinübertragen aus den Tagen, in denen wir erzogen und unterrichtet worden sind, das ist eigentlich die Erinnerung an die einzelnen Lehrer- und Erzieherpersönlichkeiten. Und da muß es schon als ein Glück gelten, wenn man mit einer innigen Befriedigung im spätesten Alter noch hinschauen kann auf diese oder jene verehrte Lehrerpersönlichkeit. Das ist Gewinn des Lebens. Das gehört auch durchaus zur Erziehungskunst und Erziehungspraxis, daß dies fürs Leben möglich werde.
Nun, wenn wir nach dieser Richtung hin einmal die entsprechenden Stellen in Tagores Lebenserinnerungen aufschlagen und die Art sehen, wie er über die Lehrerpersönlichkeiten spricht, so ist das nicht gerade so, daß er mit einer innigen Erhebung zu diesen Lehrerpersönlichkeiten zurückblickt, indem er zum Beispiel sagt: «Einer von den Lehrern der Normalschule gab uns auch Privatunterricht im Hause. Sein Körper war mager, sein Gesicht wie ausgedörrt, seine Stimme scharf. Er sah aus wie ein leibhaftiger Rohrstock.» - Man könnte die Meinung haben, daß man von demjenigen, was in Erziehungs und Unterrichtsdingen notwendig sei, bloß in unserer, von den Asiaten ja so vielfach angefochtenen europäischen Kultur so viel zu sprechen habe. Aber Sie sehen daraus, daß ein Mann, der es schon zu einer Berühmtheit gebracht hat, in einer solchen Weise auf seine indische Schule zurückschaut. Also - ich gebrauche einen Ausdruck,
den Tagore auch gerade gebraucht - dasjenige, was Schulmisere ist, scheint allerdings schon nicht mehr bloß in Europa international zu sein, sondern das scheint heute schon die ausgebreitetste Kulturfrage zu sein. Und wir werden viel darüber zu sprechen haben, wie man es dahin bringt, daß der Lehrende, der Erziehende, Interesse zu erwecken versteht für dasjenige, was er vorzubringen hat. - Nun möchte ich Ihnen auch ein Beispiel zeigen aus Tagores Lebenserinnerungen, wie er zurückblickt auf das Interesse, das ihm in Indien drüben sein Sprachlehrer im Englischen hat beibringen können. Er sagt: «Wenn ich an seinen Unterricht im ganzen zurückdenke, so kann ich nicht sagen, daß Aghor Babu ein harter Lehrer war. Er regierte uns nicht mit dem Rohrstock.» Also das weist bei uns natürlich in ältere, überwundene Zeiten zurück. Daß gerade Tagore - wenn Sie die «Lebens-erinnerungen)> vornehmen, so werden Sie das sehen - so außerordentlich viel vom Rohrstock spricht, das muß noch auf eine primitive Kultur hinweisen. Es ist schon berechtigt, dies anzunehmen, wenn er von einem Lehrer nicht nur sagt, er sei ein leibhaftiger Rohrstock, sondern daß er sich des Rohrstockes nicht bediene. Er sagt dann weiter: «Selbst seine Vorwürfe wurden nie zu einem Schelten. Doch was auch seine persönlichen Vorzüge gewesen sein mögen, seine Zeit war Abend und sein Gegenstand Englisch! Ich bin sicher, daß selbst ein Engel einem jeden Bengalenknaben als ein wahrer Bote Jamas (Gott des Todes) erscheinen würde, käme er nach all dem Schulelend des Tages am Abend zu ihm und zündete eine trostlos trübe Lampe an, um ihn Englisch zu lehren.»
Na, Sie sehen ein Beispiel dafür, wie eine Zelebrität von heute davon redet, wie sie erzogen worden ist! Aber Tagore redet auch davon, wie das Kind schon gewisse Bedürfnisse für die Erziehung und den Unterricht mitbringe, und er deutet damit in einer ganz lebens-wirklichen Weise darauf hin, wie man demjenigen entgegenkommen soll, was eigentlich das Kind von einem verlangt, und wie das bei seiner Erziehung nicht der Fall war. Ich will es Ihnen überlassen, diese Dinge auf europäische Verhältnisse anzuwenden. Denn mir erscheint es ganz sympathisch, diese Dinge, die vielleicht da oder dort Anstoß erregen könnten, wenn man sie aus europäischen Verhältnissen her
erzählt, nun einmal aus asiatischen Verhältnissen heraus anzudeuten. Die europäische Anwendung kann dann jeder selber machen.
Tagore erzählt also: «Aghor Babu versuchte bisweilen, den Zephyr der Wissenschaft von draußen mit hereinzubringen, daß er über das dürre Einerlei unseres Schulzimmers hinstriche. Eines Tages zog er ein in Papier gewickeltes Paket aus der Tasche und sagte: ,Heute will ich euch ein wunderbares Kunstwerk des Schöpfers zeigen.' Dabei wickelte er das Papier auf und brachte einen menschlichen Kehlkopf zum Vorschein, woran er uns die Wunder dieses Mechanismus auseinandersetzte.
Ich weiß noch, welchen Stoß es mir damals gab. Ich hatte immer geglaubt, der ganze Mensch spreche - hatte nie die leiseste Ahnung davon gehabt, daß man den Vorgang des Sprechens so abgetrennt betrachten könne. Wie wunderbar auch der Mechanismus eines einzelnen Teiles sein mag, er ist es sicher weniger als der ganze Mensch. Nicht daß ich mir dies damals so klargemacht hätte, doch es lag meinem ablehnenden Gefühl zugrunde. Daß der Lehrer diese Wahrheit aus den Augen verloren hatte, war wohl der Grund, weswegen der Schüler die Begeisterung nicht teilen konnte, mit der er sich über den Gegenstand erging.»
Nun, das war der erste Stoß in bezug auf die Einführung in das menschliche Wesen selber. Es kam aber noch ein zweiter, der ärger war: «Ein andermal nahm er uns mit sich in den Seziersaal der Medizinschule.» Man darf schon überzeugt sein, daß da der Aghor Babu den Jungen einen ganz besonders feierlichen Tag bereiten wollte. «Die Leiche einer alten Frau lag auf dem Tische ausgestreckt. Dies störte mich nicht so sehr. Doch ein abgenommenes Bein, das auf dem Fußboden lag, brachte mich ganz aus der Fassung. Der Anblick eines Menschen in diesem fragmentarischen Zustand erschien mir so entsetzlich, so widersinnig, daß ich den Eindruck von diesem dunklen, ausdruckslosen Bein tagelang nicht loswerden konnte.»
Sie sehen gerade an einem solchen Beispiel, wie es dem jungen Menschen ergeht, wenn er heute an den Menschen selber herangebracht wird. Denn im Grunde genommen wird ja solches nur in die Erziehung aufgenommen, weil es eben scheint, daß es in richtiger
Weise aus dem Wissenschaftsbetrieb von heute hervorgehe. Man denkt ja selbstverständlich so aus dem Wissenschaftsbe trieb heraus, den man - Gott sei Dank, muß man schon sagen - als Lehrer aufgenommen hat, daß es ja ganz großartig ist, wenn man nun das Sprechen an einem Kehlkopfmodell erklären kann, oder wenn man erklären kann, wie die besondere innere anatomisch-physiologische Eigentümlichkeit eines Beines ist. Denn im Sinne des heutigen wissenschaftlichen Denkens und Anschauens braucht man ja den ganzen Menschen durchaus nicht. - Aber dies alles sind ja vorläufig noch nicht die Gesichtspunkte, die mich veranlassen, gerade diese Stellen aus Tagores Lebenserinnerungen anzuführen. Darüber werden wir im Laufe dieser Woche noch sprechen, nicht in Anknüpfung an Tagore, sondern in Anknüpfung an die Sache selbst. Aber etwas anderes veranlaßt mich dazu. Das ist: wer heute Tagore betrachtet als Schriftsteller, als Dichter, der sagt sich: das ist ein hervorragender Mensch
- und mit Recht. Und dieser Mann erzählt jetzt seine Lebensgeschichte und weist auf ganz schreckliche Erziehungs- und Unterrichtskunst für seine Kindheit hin. Ja, da geht einem ja ein ganz merkwürdiger Gedanke auf, der Gedanke nämlich, daß es ja dem Tagore gar nichts geschadet hat, daß er schlecht erzogen und unterrichtet worden ist. Und man könnte nun meinen: es schadet ja gar nichts, wenn die Erziehung noch so schlecht ist; denn man kann ja nicht nur ein ganz leidlicher Mensch dabei werden, sondern sogar ein berühmter Tagore. Und so fühlt man sich in doppelter Beziehung eigentlich heute recht bedrängt, wenn man alles dasjenige hört, was als Reformerziehungsimpulse gegeben wird. Auf der einen Seite sagt man sich:
Wenn man zurückblicken muß, wie man selbst so furchtbar unerzcgen ist, woher weiß man denn, wie man es besser machen soll? Auf der anderen Seite sagt man sich: Wenn man aber doch nicht nur ein leidlicher Mensch, sondern ein berühmter Mensch werden kann, so hat doch eine solche Erziehung eigentlich nichts geschadet! Warum soll man denn soviel Mühe darauf verwenden, daß die Erziehung gut werden soll?
Sie sehen, wenn man nur so auf das Äußerliche hinsieht, so könnte es einem scheinen, daß man sich heute eigentlich doch vielleicht mit
anderen Dingen befassen sollte als mit Reformgedanken über Erziehungs- und Unterrichtswesen. Denn erstens geht einem so ein Licht darüber auf aus der eigenen schlechten Erziehung, daß man ja nichts Gescheites wissen kann, und auf der anderen Seite - die Beispiele des Tagore könnten natürlich verhundertfacht werden, wenn auch nicht in so außerordentlich stilvollem Format-, auf der anderen Seite wird man wiederum bedrängt von der Frage: Ja, ist es denn so außerordentlich notwendig, daß man soviel Mühe verwendet, um ein Erziehungsideal herauszufinden, da doch ein Mensch, der soviel zu schimpfen hat über seine eigene Erziehung, eben doch der Tagore geworden ist?
Wenn Anthroposophie, diese viel angefeindete Anthroposophie, auch nur so - wie manchmal Reformgedanken heute aufgenommen werden - Reformgedanken prägen würde, ich würde eigentlich gerade von dem Gesichtspunkte der Anthroposophie aus es gar nicht für so erheblich finden, daß nun auch Versuche unternommen werden in Erziehungs- und Unterrichtskunst. Aber Anthroposophie ist ja doch im Grunde genommen etwas ganz anderes als dasjenige, was sich die meisten Menschen heute noch von ihr vorstellen. Anthroposophie geht wirklich heute hervor aus den tiefsten Kulturbedürfnissen. Und Aiithroposophie macht es nicht so wie ihre Gegner, daß sie dasjenige, was nicht gleich zu ihr gehört, in der furchtbarsten Weise verschimpft, sondern Anthroposophie will das Gute überall, wo es in der Welt vorhanden ist, anerkennen, und gründlich anerkennen. -Wie gesagt, ich will heute nur einleitungsweise zu Ihnen sprechen; dasjenige, was ich da an Behauptungen vorausnehme, das werden wir in den nächsten Tagen schon belegt finden. - Anthroposophie macht aufmerksam darauf, wie großartig die Leistungen der Wissenschaft seit drei bis vier Jahrhunderten waren, wie großartig sie besonders geworden sind im Laufe des 19. Jahrhunderts. Sie erkennt diese Leistungen der Naturwissenschaft voll an.
Aber Anthroposophie muß nicht nur zu den einzelnen Leistungen der Naturwissenschaft hinblicken, sondern sie muß hinblicken zu der menschlichen Seelenverfassung, die aus der naturwissenschaftlichen Strömung der neueren Zeit sich ergibt. Da können wir nicht sagen:
Ja, was geht uns dasjenige an, was einzelne naturwissenschaftlichGebildete heute denken; das hat ja doch für die allgemeine Menschheit keine große Bedeutung. - So können wir nicht sagen. Denn auch diejenigen, die gar nichts von Naturwissenschaft wissen, bekommen heute die wichtigsten Grundlagen für ihre Seelenverfassung und ihre Orientierung in der Welt von den Ergebnissen der Naturwissenschaft her. Man kann geradezu behaupten: die in dieser oder jener religiösen Richtung orthodoxesten Menschen haben ein orthodoxes Bekenntnis aus Tradition, aus Gewohnheit, aber ihre Orientierung in der Welt, die haben sie aus den Ergebnissen der Naturwissenschaft heraus. Die Seelenverfassung der modernen Menschheit nimmt immer mehr und mehr einen solchen Charakter an, der eben von der Naturwissenschaft und ihren großartigen, nicht genug zu rühmenden Erfolgen herkommt.
Aber für diese Seelenverfas sung hat eben die Naturwissenschaft etwas Eigentümliches hervorgebracht. Sie hat den Menschen immer mehr und mehr bekanntgemacht mit der äußeren Natur, aber sie hat ihn immer mehr und mehr entfremdet seiner eigenen menschlichen Wesenheit. Denn was tun wir denn, wenn wir naturwissenschaftlich an den Menschen herangehen? Wir lernen zunächst heute in einer schon vollendeten Weise, möchte man sagen, die Grundgesetze der leblosen, der unorganischen Welt kennen. Dann zergliedern wir den Menschen, schauen, wie es in ihm physiologisch, chemisch zugeht, und wenden dasjenige, was wir aus dem Laboratorium wissen, auf den Menschen an. Oder aber wir betrachten andere Reiche der Natur, das pflanzliche, das tierische Reich. Da ist die Naturwissenschaft sich ja selbst klar darüber, daß sie keine so befriedigenden Gesetzmäßigkeiten noch hat wie für das anorganische Reich; aber - wenigstens in bezug auf das Tierische - wird dasjenige, was man da gelernt hat, auch auf den Menschen angewendet. Dadurch ist der Mensch, man kann heute schon sagen, für das populäre Bewußtsein auch nicht geworden der Mensch, der dasteht als die Krone der Erdenschöpfung, sondern er ist geworden der Schlußpunkt der Tierreihe. Man betrachtet die Tierreihe in ihren Vollkommenheitsgraden bis hinauf zum Menschen. Man versteht bis zu einem gewissen Grade die Tiere,
orientiert dann dasjenige um, was die Tiere haben, Knochenbau, Muskelbau, und bekommt als Schlußpunkt heraus als das höchststehende Tier - den Menschen.
Aber eine wirkliche Betrachtung der Menschenwesenheit ist daraus ja bisher noch nicht hervorgegangen. Das werden wir insbesondere für Einzelheiten, die uns gerade pädagogisch interessieren, einzusehen haben. Und man kann sagen: während für frühere Weltanschauungen vor allen Dingen der Mensch in dem Mittelpunkt aller Anschauung gestanden hat, ist er jetzt herausgerückt, er steht nicht mehr drinnen. Er wird ja erdrückt von den geologischen Perioden, er wird erdrückt von demjenigen, was man als Evolutionslehre für die Tierreihe sagen kann. Man ist schon froh, wenn man, sagen wir, ein Gehörkn&helchen zurückführen kann auf das Quadratbein eines niedrigerstehenden, eines noch tierischen Wesens. Es ist dies nur ein Beispiel; aber die Art und Weise, wie aus dem Menschlichen heraus seelisch-geistig des Menschen physisches Wesen organisiert wird:
das ist aus dem Gesichtsfelde herausgerückt, das ist nicht mehr da.
Und das beachtet man deshalb viel zu wenig, weil man immer ein solches Vorgehen, wie ich es gerade charakterisiert habe, als etwas ganz Selbstverständliches betrachtet. Es hat dies eben die moderne Kultur heraufgebracht. Und es wäre traurig, wenn sie es nicht her-aufgebracht hätte; es ist sogar gut, daß sie es heraufgebracht hat, denn die Menschheit konnte in den früheren Vorstellungen, die vor dem naturwissenschaftlichen Zeitalter da waren, nicht fortfahren. Aber heute brauchen wir gerade im Sinne des naturwissenschaftlichen Denkens wiederum eine neue Einsicht in das Menschenwesen. Gerade dadurch gewinnen wir auch Einsichten in das Weltenwesen.
Ich habe oftmals versucht, klarzumachen, wie gerade vom heutigen, wie gesagt nicht genug zu rühmenden naturwissenschaftlichen Standpunkte aus die stärksten Illusionen dadurch hervorgerufen werden, daß ja dieser naturwissenschaftliche Standpunkt immer recht hat. Können wir irgendwo nachweisen, daß er unrecht hat, dann ist die Sache verhältnismäßig leicht; aber das schwierigste ist, da zurechtzukommen, wo er recht hat. Ich will Ihnen einmal eine Andeutung darüber geben. Wie bekommt man heute jene Theorie heraus, die ja
schon Allgemeingut der gebildeten Menschen geworden ist - jene Theorie, die dann zurückführt zu der Erdenentstehung, zu der Entstehung des Planetensystems, nach der berühmten, heute ja modifizierten Kant-Laplaceschen Theorie? Man geht zurück durch lange Perioden. Wenn einer von 20 Millionen Jahren spricbt, so ist er eigentlich schon ein Waisenknabe, denn andere sprechen von 200 Millionen usw. Man berechnet die Vorgänge, die gegenwärtig sich abspielen auf Erden, mit Recht -physisch kann man nichts anderes betrachten -, man betrachtet etwa, wie da oder dort sich eine Ablagerung bildet, wie eine Umwandlung oder Metamorphose sich bildet, und jetzt bildet man sich eine Vorstellung über dasjenige, was nun in einer starken Weise umgewandelt ist, rechnet aus, wie lange das gebraucht haben muß. Zum Beispiel: wenn der Niagara soundso lange über die unter ihm liegenden Steine fällt und man berechnen kann, wieviel er abschabt, so kann man an einer anderen Stelle, wo mehr abgeschabt ist, durch eine bloße Multiplikation, die ganz richtig ist, 20 Millionen Jahre herausbekommen. Und so kann man von dem jetzigen Gesichtspunkte ausgehen und kann so für die Zukunft ausrechnen, wann die Erde in den berühmten Wärmetod übergehen wird, usw. Ja, aber sehen Sie, dieselbe Rechnung könnten Sie nämlich auch anders anstellen. Beobachten Sie einmal von Jahr zu Jahr das menschliche Herz, wie es sich verändert. Notieren Sie diese Veränderung, und Sie können, indem Sie richtig ausrechnen, nun sich die Frage stellen, die ganz und gar einer richtigen Methode entspricht und nach dem Muster der geologischen Methode gebaut sein könnte, wie das menschliche Herz vor 300 Jahren ausgesehen hat und wie es nach 300 Jahren aussehen wird. Die Rechnung wird absolut stimmen, es ist nichts dagegen zu sagen. Wenn man eine mittlere Zeit des Menschen, so um das 85. Jahr, nimmt, wird man einen langen Zeitraum gewinnen, durch den das menschliche Herz gegangen sein könnte. Nur eine Kleinigkeit ist übersehen worden: das menschliche Herz hat vor 300 Jahren noch nicht bestanden und wird nach 800 Jahren auch nicht mehr bestehen. Also die Rechnung ist absolut richtig, aber wirklichkeitsgemäß ist die Sache nicht. - Wir sind eben heute in unserem intellektualistischen Zeitalter zu sehr aus auf das Richtige und haben
uns ganz abgewöhnt, daß alles dasjenige, was wir im Leben erfassen müssen, nicht nur logisch richtig sein muß, sondern auch wirklichkeitsgemäß sein muß.
Dieser Begriff wird uns noch manchmal auftauchen im Laufe dieser Woche. Aber manchmal ist es auch so, daß mancherlei ganz aus den Augen verloren wird, wenn man heute richtige Theorien aufbaut. Haben Sie es denn nicht erlebt - ich will nicht sagen, daß Sie es selber gemacht haben, denn die Anwesenden sind ja immer ausgeschlossen von den Dingen, die man nicht gerade in sympathischerWeise sagt-, haben Sie es nicht erlebt, daß die Umdrehung der Planeten um ihren Zentralkörper, die Sonne, recht anschaulich vorgeführt wird schon in der Schule, dadurch daß man ein Kartenblättchen nimmt, es kreisförmig zuschneidet, es durchschiebt durch einen Öltropfen, eine Stecknadel hindurchsteckt, es vom Wasser tragen läßt und das ins Rotieren bringt. Dann spalten sich die kleinen Planetchen, die Ölplanetchen, ab, und man fabriziert ein wunderschönes Miniaturplanetensystem. Die Sache ist jetzt «bewiesen», selbstverständlich. Nun, es ist bei Dingen der moralischen Weltordnung sehr schön, wenn der Mensch sich selbst vergißt, aber bei wissenschaftlichen Versuchen ist eben die erste Grundlage zum Schaffen eines Wirklichkeitsgemäßen, daß man keine Bedingung vergißt - und die wichtigste Bedingung dazu, daß da etwas geworden ist, ist doch der Herr Lehrer, der die Stecknadel umdreht! Sie dürfen also dies nur dann zur Hypothese ausgestalten, wenn Sie annehmen, daß ein riesiger Herr Lehrer an einer großen Weltenstecknadel die Geschichte herumgedreht hat; sonst dürfen Sie die Hypothese gar nicht ausführen.
Und so stecken gerade in dem Richtigsten, was heute aus der naturwissenschaftlichen Weltanschauung herauskommt, was in sich, in seiner eigenen Methode gar nicht anfechtbar ist, ungeheuer viele Elemente einer unwirklichkeitsgemäßen Seelenverfassung, die eben einfach in die Schule hineingetragen werden. Denn wie könnte man denn anders? Man geht ja natürlich durch die Bildung der Zeit hindurch! Das ist ja auch ganz richtig. Aber setzt man sich nun her über eine solche geologische Rechnung, über einen solchen astronomischen Vergleich, studiert man die Sache, ja, dann stimmt alles. Man staunt
manchmal nur über das ungeheuer Geistreiche; es ist alles richtig, was man da tut - aber es führt von der Wirklichkeit ab! Wenn wir aber Menschen erziehen wollen, so dürfen wir nicht von der Wirklichkeit abkommen; denn dann steht ja die Wirklichkeit vor uns, dann müssen wir an den Menschen selber herankommen. Aber in einem gewissen Sinne ist auch schon in das Denken über Erziehungs- und Unterrichtspraxis dieses Nichtherankommenkönnen an den Menschen eingedrungen. Ich möchte es Ihnen an einem Beispiel zeigen. Sehen Sie, wenn man einen Jungen oder ein Mädchen zu erziehen hat, so ergibt sich ja: eines ist für das eine besonders begabt, für das andere weniger begabt. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Dinge, die heute über diese Sache in der Pädagogik gelehrt werden, ich führe sie nur an, damit wir uns verständigen können. Man findet also verschiedene Begabungen. Nun, wie nähert man sich heute diesen Begabungen gerade da, wo, möchte ich sagen, das wissenschaftliche Denken am meisten vorgeschritten ist? Sie wissen ja alle aus Ihrer Lektüre der pädagogischen Literatur: man nähert sich ihnen durch die sogenannte Korrelationsmethode. Man bildet sich da den Korrelationskoeffizienten, wie man sagt. Nämlich man setzt, wenn zwei Begabungen sich immer zusammenfinden, was nie eine Ausnahme ist, den Korrelationskoeffizienten für diese zwei Begabungen mit 1 an. Eigentlich gibt es ja das nicht, aber es ist eben eine Annahme. Wenn zwei Begabungen ganz unverträglich miteinander wären, dann setzt man diese Tatsache an mit dem Korrelationskoeffizienten Null. Und nach dieser Methode prüft man nun, wie die einzelnen Begabungen der Kinder zusammenstimmen. Man findet zum Beispiel, daß Zeichnen und Schreiben den Korrelationskoeffizienten, sagen wir 0' 70 haben. Das heißt, es kommt bei weit über die Hälfte der Kinder hinaus vor, daß, wenn eins unter ihnen Begabungen für das Zeichnen hat, es auch Begabung für das Schreiben hat. Man sucht solche Korrelationskoeffizienten für andere Verhältnisse zwischen den Begabungen - sagen wir für den Schreibunterricht und den Unterricht in der Muttersprache; da ist der Korrelationskoeffizient 0' 54. Dann sucht man den Korrelationskoeffizienten, sagen wir für Rechnen und Schreiben, und findet 0' 20, für Rechnen und Zeichnen 0' 19 usw. Also Rechnen und
Zeichnen ist am wenigsten beieinander, Schreiben und Zeichnen ist am meisten beieinander. Die Begabung für die Muttersprache, für das Zeichnen, die ist ungefähr bei der Hälfte der Schüler, die man hat, beieinander.
Ja, sehen Sie, es soll hier gar nicht das geringste eingewendet werden gegen die Berechtigung solcher Untersuchungen auf dem Felde der Wissenschaft. Man wäre selbstverständlich auf ganz falscher Fährte, wenn man etwa jetzt sagen würde: so etwas solle nicht untersucht werden. Diese Dinge sind ja natürlich außerordentlich interessant. Und ich richte mich nicht im mindesten gegen experimentelle oder statistische Methoden in der Psychologie. Aber wenn nun das angewendet werden soll unmittelbar in der Erziehungs und Unterrichtspraxis, so kommt das einem doch gerade so vor, wie wenn man einen zum Maler machen will und ihn nicht darauf verweist, daß er nun mit Farben hantiert, und ihn je nach seiner Individualität in das Behandeln der Farben hineinbringt, sondern ihm sagt: Sieh einmal, da hast du ein schönes Lehrbuch der Ästhetik, lies da das Kapitel über das Malen durch, dann wirst du schon ein Maler werden. - Mir hat einmal ein ganz berühmter Maler in München etwas erzählt, ich habe das bei anderen Gelegenheiten öfter erwähnt: Er war eben in der Malschule; da war der berühmte Ästhetiker Carriere, der in München Ästhetik vortrug. Die Mal schüler gingen einmal zu diesem Wissenschafter, der auch über Malerei sprach. Aber nicht öfter als einmal gingen sie hin, denn sie sagten von diesem berühmten Ästheten, er wäre «der ästhetische Wonnegrunzer ». - So kommt es einem auch vor, wenn man aus den vorerwähnten Angaben nun irgend etwas für die Erziehungs- und Unterrichtspraxis gewinnen soll. Als wissenschaftliches Resultat ist das ja alles ganz interessant, aber für die Handhabung der Erziehung und des Unterrichts ist doch etwas anderes notwendig. Da ist zum Beispiel notwendig, daß man in das menschliche Wesen so tief eindringt, daß man weiß, aus welchen inneren Funktionen die Zeichnen-Geschicklichkeit und die Schreib-Ge-schicklichkeit herauskommt, und aus welchen wiederum die Geschicklichkeit, die Fähigkeit für die Muttersprache herauskommt. Es gehört die lebendige Anschauung des Menschenwesens dazu, um darauf
zu kommen, wie aus dem Kinde herausfiießt diese besondere Fähigkeit zum Zeichnen, die besondere Fähigkeit, sich in die Muttersprache hineinzufinden usw. Dann braucht man solche Zahlen nicht, sondern dann hält man sich an dasjenige, was einem das Kind selber gibt. Dann sind einem höchstens solche Zahlen hinterher eine ganz interessante Bestätigung. Sie haben daher auch durchaus ihren Wert, aber aus ihnen unterrichten und erziehen lernen wollen, das weist bloß darauf hin, wie weit wir uns vom Menschenwesen in der Erkenntnis entfernt haben.
Wir wollen das Menschenwesen statistisch fassen. Das hat auf gewissen Gebieten sein Gutes. Wir können das Menschenwesen wissenschaftlich statistisch fassen, aber in das Wesen dringen wir dadurch nicht hinein. Denken Sie nur einmal, wieviel die Statistik hilft auf einem gewissen Gebiet, wo sie ganz lebensvoll angewendet werden kann: dem Versicherungswesen. Wenn ich mich heute versichern will, werde ich nach meinem Alter gefragt, auf meine Gesundheit geprüft. Da kann man sehr schön ausrechnen, wieviel man an Versicherungsquote zu zahlen hat, wenn man noch jung ist oder ein alter Kerl ist. Da rechnet man ja die wahrscheinliche Lebensdauer, und diese Lebensdauer stimmt durchaus ganz richtig für die Bedürfnisse des Versicherungswesens. Aber wenn Sie sich nun versichert haben, sagen wir für 20 Jahre noch im 37. Jahre, werden Sie sich jetzt verpflichtet fühlen, mit 57 Jahren zu sterben, weil das Ausgerechnete ganz richtig ist? Es ist eben durchaus etwas anderes, ans Leben unmittelbar heranzutreten, oder logisch richtige Erwägungen anzustellen, die für ein gewisses Gebiet sehr segensreich sein können.
Beim Schreiben und Zeichnen handelt es sich zum Beispiel darum:
Wenn man die Versuche anstellt gerade bei Kindern, die ins schulpflichtige Alter gekommen sind, so sind diese Kinder - wir werden dann von den Lebensaltern eben zu sprechen haben im Verlauf dieser Vorträge - eingetreten in das Alter ungefähr, in dem sie den Zahn-wechsel durchmachen. Nun werden wir im weiteren Verlauf der Vorträge hören, daß wir alle Erziehung gliedern müssen nach den hauptsächlichsten drei Lebensaltern des heranwachsenden Menschen: dem Lebensalter von der Geburt bis zum Zahnwechsel, dem Lebensalter
vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife und dem Lebensalter nach der Geschlechtsreife, und daß wir studieren mussen im einzelnen, wie sich der Mensch in diesen drei Lebensepochen verhält.
Nehmen wir diesen Fall mit dem Schreiben und Zeichnen. Ja, weil man so gut die drei Reiche der Natur studiert hat und alles, was man dort studiert hat, auf den Menschen anwendet, so kommt es einem vor: man begreift den Menschen, wenn man das alles anwenden kann, wenn man gewissermaßen über den Menschen ebenso denken kann, wie man es gelernt hat zu denken über die drei Reiche der Natur. Aber wenn man direkt an den Menschen herangeht, so findet man folgendes. - Man muß nur den Mut haben, den Menschen wirklich ebenso zu betrachten, wie man die äußere Natur betrachtet; die gegenwärtige Weltauffassung hat eben nur den Mut, die äußere Natur zu betrachten, aber sie hat nicht den Mut, den Menschen ebenso zu betrachten, wie sie die äußere Natur betrachtet.
Schauen wir uns einmal an, wie das Kind sich entwickelt bis zum Zahnwech sel hin: es wechselt die Zähne. Sie wissen, es ist das WechseIn der Zähne - ein folgendes Wechseln der einzelnen Zähne kommt ja nicht in Betracht - im normalen Menschenleben das letzte Ereignis im irdischen Dasein; ein gleiches findet sich nicht mehr bis zum Tode. Nun werden Sie, wenn Sie eine ebensolche Empfindung haben, wie sie da der Tagore gegenüber dem abgeschnittenen Bein des Menschen hat, sich sagen: Dasjenige, was da die zweiten Zähne heraus-arbeitet, das sitzt nicht etwa bloß in den Kiefern, sondern das sitzt im ganzen Menschen. Im ganzen Menschen ist bis ungefähr zum 7. Jahre etwas, was in ihm drinnensitzt, und was sich wie in einem Schluß-punkt äußert, möchte man sagen, beim Wechseln der Zähne. In der ursprünglichen Form, in der es vorhanden ist im menschlichen Organismus, ist es bis zum 7. Jahre da; später ist es so nicht mehr vorhanden.
Nun haben wir heute den Mut, zum Beispiel in der Physik zu sagen: Es gibt latente Wärme, es gibt freie Wärme. Irgendeine Wärme ist gebunden, man kann dieselbe nicht mit dem Thermometer bestimmen; durch irgendeinen Vorgang wird sie frei, nun kann man sie mit dem Thermometer bestimmen. - Diesen Mut haben wir gegenüber
den äußeren Naturerscheinungen. Gegenüber dem Menschen haben wir diesen Mut nicht, sonst würden wir sagen: Dasjenige, was da im Menschen war bis zum 7. Jahr, was dann im Zahnwechsel herausgekommen ist, das war gebunden an seinen Organismus - es kommt ja auch in der anderen Knochenbildung zum Ausdruck -, dann wird es frei und erscheint in einer anderen Gestalt, als innere, als seelische Eigenschaften des Kindes. Es sind dieselben Kräfte, mit denen das Kind an seinem Organismus gearbeitet hat. - Man muß den Mut haben, den Menschen erkenntnismäßig ebenso zu betrachten, wie man die Natur erkenntnismäßig betrachtet. Die heutige Naturwissenschaft betrachtet den Menschen nicht so wie die Natur, sondern sie betrachtet die Natur, getraut sich aber an den Menschen nicht heran mit denselben Methoden. Wenn wir uns aber nun das sagen, dann werden wir hingelenkt auf alles das, was Knochiges im Menschen ist, was gewissermaßen die menschliche Gestalt erhärtet und ihr Halt gibt. - Nun, so weit könnte ja zur Not auch noch die gewöhnliche Physiologie gehen, und sie wird so weit gehen, wenn sie es auch heute iioch nicht will. Gerade die wichtigsten Wissenschaften sind heute in Umbildung begriffen, und sie werden noch Wege gehen, wie ich sie eben angedeutet habe. Aber es kommt jetzt etwas anderes
#Bild s. 25
dazu. Sehen Sie, wir treiben im späteren Leben auch seelisch mancherlei. Wir treiben zum Beispiel die Geometrie. Man hat heute in unserem abstrakt-intellektualistischen Zeitalter die Vorstellung: - nehmen wir etwas ganz Einfaches - die drei Raumesdimensionen, die schweben so irgendwo in der Luft. Es sind halt drei aufeinander senkrecht
stehende Linien, die bis ins Unendliche gedacht werden. Das kann man natürlich durch Abstraktion nach und nach so gewinnen, aber erlebt ist das nicht. Erlebt will die Dreidimensionalität aber auch werden; und sie wird erlebt noch im Unbewußten, wenn das Kind lernt aus dem ungeschickt kriechenden Zustand, wo es überall die Balance verliert, sich aufzurichten und mit der Welt ins Gleichgewicht zu kommen. Da ist konkret die Dreidimensionalität vorhanden. Da können wir nicht drei Linien in den Raum zeichnen, sondern da ist eine Linie, die mit der aufrechten Körperachse zusammenfällt, die wir prüfen, wenn wir schlafen und liegen und nicht drin sind, die wir auch als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal vom Tier haben, das ja seine Rückenmarkslinie parallel der Erde hat, während wir eine aufrechte Rückenmarkslinie haben. Die zweite Dimension ist diejenige, die wir unbewußt gewinnen, wenn wir die Arme ausstrecken. Die dritte Dimension ist die, die von vorne nach hinten geht. In Wahrheit sind die drei Dimensionen konkret erlebt: oben, unten; rechts, links; vorne, hinten. Und was in der Geometrie angewendet wird, ist Abstraktion. Der Mensch erlebt das, was er in den geometrischen Figuren darstellt, an sich, aber nur in dem Lebensalter, das noch viel Unbewußtes, halb Träumerisches hat; dann wird es später heraufgehoben, und es nimmt sich abstrakt aus.
Nun ist mit dem Zahnwechsel gerade dasjenige befestigt, was dem Menschen Halt gibt, innerlichen Halt. Von dem Lebenspunkte an, wo das Kind sich aufrichtet, bis zu dem Lebenspunkte, wo es jene innere Verhärtung durchmacht, die im Zahnwechsel liegt, probiert das Kind im Unbewußten an seinem eigenen Körper die Geometrie, das Zeichnen. Jetzt wird das seelisch; gerade mit dem Zahnwechsel wird es seelisch. Und wir haben auf der einen Seite das Physiologische, haben gewissermaßen - wie sich bei einer Lösung, wenn wir sie erkalten, ein Bodensatz bilden kann und das andere dadurch um so heller wird - das Harte in uns gebildet, unser eigenes verstärktes Knochensystein, wie den Bodensatz; auf der anderen Seite ist das Seelische zurückgeblieben und ist Geometrie, Zeichnen usw. geworden. Wir sehen herausströmen aus dem Menschen die seelischen Eigenschaften. Und denken Sie doch nur, was das für ein Interesse an dem
Menschen gibt. Wir werden sehen, wie das alles im einzelnen herausströmt, und wie das Seelische wieder zurückwirkt auf den Menschen.
#Bild s. 27
In dieser Beziehung hängt ja das ganze Leben des Menschen zusammen. Was wir an dem Kinde tun, das tun wir nicht bloß für den Augenblick, sondern für das ganze Leben. Für das ganze Leben Beobachtung entwickeln, das tun ja die meisten Menschen nicht, weil sie die Beobachtung nur aus der Gegenwart heraus nehmen wollen; zum Beispiel aus dem Experiment. Beim Experiment hat man die Gegenwart vor sich. Aber beobachten Sie einmal, wie es zum Beispiel Menschen gibt, die, wenn sie in einem ziemlich hohen Alter unter andere Menschen kommen, wie segensreich wirken. Sie brauchen gar nichts zu sagen, bloß durch die Art und Weise, wie sie da sind, wirken sie segensreich. Sie begnaden gewissermaßen, sie können segnen. Und gehen Sie dem Lebenslauf solcher Menschen nach, dann finden Sie, daß sie als Kinder nicht in einer zwangsmäßigen, sondern in einer richtigen Weise haben verehren gelernt, ich könnte auch sagen, beten gelernt, wobei ich unter beten im umfassenden Sinne auch die Verehrung eines anderen Menschen verstehe. Ich möchte es durch ein Bild ausdrücken, das ich schon öfter gebraucht habe: Wer nicht in der Jugend gelernt hat die Hände zu falten, kann sie im späteren Alter nicht zum Segnen ausbreiten.
Es hängen eben die Lebensalter des Menschen zusammen, und wenn wir das beachten, wie die verschiedenen Lebensalter des Menschen zusammenhängen, dann wird es uns ungeheuer wichtig, den ganzen menschlichen Lebenslauf für die Erziehungs- und Unterrichtspraxis ins Auge zu fassen. Für das Kind lernen wir viel, indem wir lernen, wie herausquillt das Seelische, nachdem es in der ersten Lebensepoche im Körper drinnen gearbeitet hat. Die Psychologen denken
heute in den kuriosesten Hypothesen nach, wie das Wechselverhältnjs zwischen Seele und Körper ist. Eine Lebensepoche klärt uns über die andere auf. Kennen wir das Verhältnis beim Kinde zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, dann klärt uns das auf über dasjenige, was im Körper vorgegangen ist durch die Seele bis zum Zahnwechsel hin. Die Tatsachen müssen einander aufklären. Denken Sie, wie da das Interesse wächst! Und das Interesse für das Menschenwesen brauchen wir für die Erziehungs und Unterrichtspraxis. Aber die Menschen denken eben heute in abstrakter Weise nach über das Verhältnis von Seele und Leib oder Seele und Körper. Und weil sie durch ihr Nachdenken so. wenig haben herauskriegen können, ist ja heute schon eine gar sehr spaßige Theorie aufgekommen, die Theorie des sogenannten psyche-physischen Parallelismus. Da gehen die seelischen und körperlichen Vorgänge parallel, um Schnittpunkte brauchen wir uns nicht zu kümmern. Der psyche-physische Parallelismus braucht sich nicht mehr zu kümmern um dasVerhältnis zwischen Seele und Leib, sie schneiden sich in unendlicher Entfernung. Deshalb ist die Theorie geradezu spaßig. Aber läßt man sich ein auf dasjenige, was sich aus der Erfahrung wirklich ergibt, dann findet man diese Zusammenhänge. Man muß nur über das ganze menschliche Leben hinschauen. Schauen wir einmal einen Menschen an, der, sagen wir, in einem bestimmten Lebensalter Diabetes bekommt oder Rheumatismus. Die Menschen beachten ja immer nur die Gegenwart: man denkt also über ein Heilmittel nach für diese Krankheiten. Das ist ja ganz richtig, es soll nichts dagegen gesagt werden, daß man darüber nachdenkt, wie man da heilen kann. Sehr schön. Aber wer nun den ganzen menschlichen Lebenslauf überblickt, der findet, daß manche Diabetes davon herkommt, daß das Gedächtnis in unrichtiger Weise zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife entweder belastet worden ist oder sonst in unrichtiger Weise behandelt worden ist. Die Gesundheit der älteren Menschen auf Erden ist abhängig von der Art und Weise, wie man sich verhält im kindlichen Lebensalter zur Seele. Wie du das Gedächtnis ausbildest, so wirkst du nach einer gewissen Periode auf den Stoffwechsel. Läßt du zwischen dem 7. und 14. Jahre Gedächtnisreste, die nicht verarbeitet
werden von der Seele des Kindes, so läßt der Körper dieses Menschen, zwischen dem 85. und 45. Jahre ungefähr, Körperreste, die sich einlagern, und die Rheumatismus oder Diabetes bewirken.
Man kann schon sagen: die Lehrer sollten auch von Medizin wissen. Es ist kein richtiges Verhältnis, wenn auf der einen Seite der Lehrer steht, und wenn er für alles das, was die kindliche Gesundheit erfordert, sich an den Schularzt wenden muß, der die Kinder im übrigen gar nicht kennt. Wenn schon vieles in unserer Zeit eine Universalität der Bildung erfordert - die Pädagogik und die Unterrichtspraxis erfordern diese Universalität am allermeisten.
Das ist dasjenige, was ich Ihnen als eine Einleitung geben wollte, um Sie hinzuweisen, wo das wirklich liegt, durch welches sich Anthroposophie tröstet, wenn sie nun nach Ansicht mancher Leute «auch in die Pädagogik hinempfuscht», nach Ansicht anderer etwas zu sagen hat. Man wird nicht berührt davon, daß Erziehung und Unterricht auch unnötig sein könnten, oder daß sie nicht besprochen werden könnten, weil man ja selbst schlecht erzogen ist; man geht zunächst in der Anthroposophie von etwas ganz anderem aus, nicht von der Korrektur der alten Ideen, sondern von einer Menschenerkenntnis, die heute einfach durch den Menschheitsfortschritt notwendig geworden ist.
Gehen Sie zurück auf die alten Erziehungssysteme: sie sind überall aus der allgemeinen Menschenkultur hervorgegangen, aus dem Universellen, das der Mensch in sich fühlte und empfand. Wir müssen wiederum zu so etwas kommen, was als Universelles aus dem Menschen herausfließt. Mir wäre es am liebsten, wenn ich die Anthroposophie jeden Tag anders nennen könnte, damit nicht die Leute am Worte festhalten, das Wort aus dem Griechischen übersetzen und darnach sich ihr Urteil bilden. Es ist ganz gleichgültig, wie man das benennt, was hier getrieben wird. Darauf kommt es nur an, daß das, was hier getrieben wird, überall auf die Wirklichkeit losgehen will und die Wirklichkeit streng ins Auge faßt, nicht eine sektiererische Idee verwirklichen will.
Und so, möchte man sagen, steht auf der einen Seite heute dasjenige, was einem vielfach entgegentritt. Was ist denn das? Die Leute
sagen: Ach, Erziehungssysteme, die schön reinlich richtig ausgedacht sind, haben wir viele gehabt! Wir leiden ja so sehr an dem Intellektualismus; mindestens aus dem Erziehungssystem muß er heraus! -Das ist richtig. Aber dann kommen sie dazu, sich zu sagen: Also dürfen wir keine wissenschaftliche Pädagogik haben, sondern wir müssen wiederum an die pädagogischen Instinkte appellieren! Ja, das ist ja recht schön, aber es geht leider nicht, denn die Menschheit hat eben einen Fortschritt durchgemacht. Die Instinkte, die vor Zeiten vorhanden waren, sind heute nicht mehr vorhanden, und man muß sich die Naivität wiederum erringen auf erkenntnismäßige Weise. Das kann nur getan werden, wenn man in das Wesen des Menschen wiederum hineindringt. Und das m&hte Anthroposophie.
Und noch etwas anderes kommt in Betracht. Man spürt überall den Intellektualismus und die Abstraktbeit, und man sagt: Kinder müssen nicht bloß so erzogen werden, daß man wiederum bloß ihren Intellekt erziehen will; das Herz der Kinder muß man erziehen! - Das ist sehr richtig. Aber man merkt manchmal in der pädagogischen Literatur und in der pädagogischen Praxis, daß man mit der Formulierung der Forderung nicht ausreicht. Man fordert wiederum theoretisch-abstrakt, daß das Herz zu erziehen sei. Noch weniger aber be-achtet man, daß man nicht nur die Forderung an das Kind stellen soll, das Kind solle dem Herzen nach erzogen werden, sondern daß man die Forderung an den Lehrer stellen soll und vor allen Dingen an die Pädagogik selbst. Das möchte ich, daß wir bei unserem Zusammensein darüber reden, daß wir nicht nur die Forderung atifstellen: Du sollst das Herz des Kindes und nicht bloß seinen Verstand erziehen, sondern wie man die Forderung erfüllen kann: Was muß geschehen, damit die Pädagogik wiederum Herz bekommt?
ZWEITER VORTRAG Dornach, 16. April 1923
Wir wollen zunächst versuchen, einzudringen in das Wesen des heranwachsenden Menschen mit Rücksicht auf die späteren Lebensalter, um dann daraus die pädagogisch-didaktischen Konsequenzen zu ziehen.
Jene Menschenerkenntnis, auf die ich gestern hingedeutet habe, und die durch anthroposophische Forschung möglich ist, sie unterscheidet sich doch ganz wesentlich von dem, was man aus heutigen wissenschaftlichen und sonstigen Bildungsvoraussetzungen über den Menschen wissen kann. Man möchte sagen: diese Menschenerkenntnis, die aus dem heutigen Zivilisationsleben hervorgeht, stützt sich ja zumeist auf dasjenige, was am Menschen ist, wenn man von dem Geistigen und von einem Teil des Seelischen absieht. Sie stützt sich auf das Anatomische und auf das Physiologische, das gewonnen werden kann über den Menschen, wenn man ihn als Leiche hat. Sie stützt sich ferner auf das, was man über den Menschen wissen kann, wenn man zu Rate zieht die pathologischen Veränderungen, die am Menschen durch Krankheit oder sonst vorgehen können, und was man daraus erschließen kann für das Wesen des gesunden Menschen. Man hat dann in seiner ganzen Seelenverfassung drinnen dasjenige, was man auf diese Weise gewinnen kann, und zieht dann seine Schlüsse auch für den im vollen Leben, in voller Lebens bewegung begriffenen Menschen.
Anthroposophische Forschung geht von vorneherein darauf aus, den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen, nach seinem leiblichen, seelischen und geistigen Wesen. Sie geht darauf aus, den Menschen sozusagen nicht durch eine innerlich abstrakte und tote Betrachtungsweise zu erfassen, sondern durch eine lebendige Betrachtungsweise, die dem Menschen auch folgen kann, die durch lebendige Begriffe den Menschen in seiner von Geist und Seele und Leib gebildeten Wesenheit auch in voller Lebendigkeit erfassen kann. Und dadurch kommt
man in die Lage, auch jene Metamorphosen des Menschlichen wirklich richtig anzusehen, die im Laufe des Lebens auftreten. Der Mensch ist ja sozusagen ein ganz anderer, je nachdem er die kindliche Entwickelung von der Geburt bis zum Zahnwechsel durchmacht, oder die Entwickelung von dem Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife -das ist diejenige, vor der wir gerade stehen, wenn wir das Kind in der Volksschule haben - und dann diejenige Entwickelung, welche auf die Geschlechtsreife folgt. Der Mensch ist in diesen drei Entwickelungen eigentlich ein ganz anderes Wesen. Aber die Unterschiede liegen so tief, daß man durch eine äußerliche Betrachtungsweise auf diese Unterschiede eben nicht kommt. Und vor allen Dingen kommt man nicht darauf, jene innige Durchdringung von Leib, Seele und Geist, wie sie in den drei genannten Lebensaltern ganz verschieden ist, wirklich richtig zu beurteilen.
Der Lehrende, der Erziehende darf ja nicht zuerst etwas theoretisch lernen und sich dann sagen: Was ich theoretisch gelernt habe, das wende ich jetzt auf das Kind in dieser oder jener Weise an. Dadurch entfernt er sich von dem Kinde, er nähert sich nicht dem Kinde. Der Lehrer muß das, was er über den Menschen weiß, in eine Art höheren Instinkt hineinbekommen, so daß er in einer gewissen Weise instinktiv jeder Regung des einzelnen individuellen Kindeslebens gegenübersteht. Dadurch unterscheidet sich eben anthroposophische Menschenerkenntnis von jener, die heute üblich ist. Diejenige Menschenerkenntnis, die heute üblich ist, führt h&hstens zur Erziehungsroutine, nicht aber zur wirklichen Erziehergesinnung und zur wirklichen Erzieherpraxis. Denn einer wirklichen Erzieherpraxis muß eine solche Menschenerkenntnis zugrunde liegen, die dem Kinde gegenüber in jedem Augenblick instinktiv wird, so daß man aus der ganzen Fülle dessen, was einem am Kinde entgegentritt, dem einzelnen Falle gegenüber weiß, was man zu tun hat. Wenn ich einen Vergleich gebrauchen darf, möchte ich so sagen: Nicht wahr, wir haben allerlei Theorien über das Essen und Trinken, aber wir richten uns im Leben im allgemeinen nicht nach dem, was theoretisch ersonnen werden kann darüber, wann man essen soll, wann man trinken soll. Man trinkt, wenn man durstig ist - das ergibt sich aus der ganzen
Konstitution des Organismus heraus -, man ißt, wenn man hungrig ist. Daß das in einen gewissen Lebensrhythmus eingeschaltet ist, hat natürlich seine guten Gründe, aber der Mensch ißt und trinkt, wenn er hungrig und durstig ist; das ergibt das Leben selber. Nun muß eine Menschenerkenntnis, welche einer wirklichen Erziehungspraxis zugrunde liegt, im Menschen, wenn er einem Kinde gegenübersteht, so etwas erzeugen, wie etwa erzeugt wird das Verhältnis vom Hunger zum Essen. Es muß so natürlich sein, wie daß ich durch den Hunger ein gewisses Verhältnis zu den Speisen bekomme. So muß es ganz natürlich werden durch eine wirkliche, nicht nur in Fleisch und Blut, sondern auch in Seele und Geist eindringende Menschenerkenntnis, daß ich, wenn das Kind auftritt vor mir, etwas bekomme wie Hunger: Das hast du jetzt zu tun, jenes hast du jetzt zu tun! Nur wenn in dieser Weise Menschenerkenntnis eine solche innere Fülle hat, daß sie instinktiv werden kann, dann kann sie zur Erzieherpraxis führen; nicht wenn man nach Versuchen eine Theorie darüber ausbildet, wie sich etwa die Leistungen in Gedächtnis, Aufmerksamkeit usw. verhalten. Dadurch wird erst gedanklich intellektualistisch vermittelt zwischen den Theorien und der Praxis. Das kann aber durchaus. nicht stattfinden; dadurch veräußerlicht man alle Methodik, alle Erziehungspraxis. Dasjenige also, was wir zunächst als Menschenerkenntnis gewinnen wollen, das soll sein ein Erfassen des Kindes in seiner lebendigen Lebensregung.
Sehen wir da zunächst auf das in die Welt hineinwachsende Kind. Beobachten wir es zunächst ganz primitiv. Wir finden, daß das Kind dreierlei bald nach seinem Lebenseintritt sich aneignen muß, was für das ganze spätere Leben entscheidend ist. Das sind die Betätigungen, die das Kind sich aneignet für dasjenige, was wir so populär nennen: Gehen, Sprechen, Denken.
Sehen Sie, der deutsche Dichter Jean Paul - so nannte er sich selber - sagte einmal: Der Mensch lernt in seinen drei ersten Lebensjahren mehr für das Leben als in seinen drei akademischen Jahren. -Das gilt durchaus. Das ist so. Denn selbst wenn die akademische Lehrzeit noch so verlängert wird, so ist das Fazit für das Leben von dem, was man während der drei akademischen Jahre lernt, ein geringeres
als dasjenige, was für das Leben erworben wird, während das Kind in der Betätigung ist, in der lernenden Betätigung für Gehen, Sprechen und Denken. Denn was heißt denn das nur: das Kind lernt Gehen, Sprechen und Denken? Sehen Sie, Gehen ist zunächst etwas, was wir im Leben so populär zusammenfassen. Es liegt aber darin unendlich viel mehr, als daß das Kind bloß vom Fortkriechen sich aufrichtet zu derjenigen Art von Gehen, die es sich später aneignet für das ganze Leben. In diesem Gehenlernen liegt das Einstellen des Menschen, das Orientieren des Menschen in der Weise, daß sich das ganze Gleichgewicht des eigenen Organismus und aller seiner Bewe-gungsmöglichkeiten einordnet in das Gleichgewicht und in die Bewegungsmöglichkeiten des Weltenalls, soweit wir drinnenstehen. Wir suchen, während wir gehen lernen, die dem Menschen entsprechende Gleichgewichtslage zum Weltenall. Wir suchen, während wir gehen lernen, jene eigentümlichen, nur beim Menschen auftretenden Verhältnisse zwischen der Betätigung der Arme und Hände und der Betätigung der anderen Gliedmaßen. Jenes Zugeteiltwerden der Arme und Hände zu dem seelischen Leben, während die Beine zurückbleiben und dem körperlichen Bewegen weiter dienen, das ist etwas ungeheuer Bedeutungsvolles für das ganze spätere Leben. Denn die Differenzierung in die Tätigkeiten der Beine und Füße und in die Tätigkeiten der Arme und Hände ist das Aufsuchen des seelischen Gleichgewichts für das Leben.. - Zunächst suchen wir das physische Gleichgewicht im Aufrichten - aber im Freiwerden der Betätigung der Arme und Hände suchen wir das seelische Gleichgewicht. Und noch unendlich viel mehr - was Sie ja nun selber sich ausführen können - liegt in diesem Gehenlernen, wobei wir, wenn wir diesen Namen Gehenlernen gebrauchen, nur auf das Allerwichtigste sehen, und nicht einmal darauf im Grunde, sondern auf das, was für die Sinne äußerlich am Kinde hervortritt. Nun betrachten Sie dieses, was ich nun auch populär zusammenfasse in dem Namen Gehenlernen, man müßte eigentlich sagen: Die Statik und Dynamik des inneren Menschen in bezug auf das Weltenall lernen: das ist Gehenlernen. Und sogar: Die physische und die seelische Statik und Dynamnik des Menschen in bezug auf das Weltenall lernen, das ist Gehenlernen. Aber
sehen Sie, indem sich auf diese Weise die Arme und Hände für das Menschliche von den Beinen und Füßen emanzipieren, tritt etwas anderes auf: damit ist eine Grundlage geschaffen für die ganze menschliche Entwickelung. Diese Grundlage tritt äußerlich dadurch hervor, daß mit dem Gehenlernen der Mensch mit seinem inneren Rhythmus und Takt und auch mit dem ganzen Innern seines Wesens sich einfügt in die äußerlich sichtbare Welt.
Und so gliedert sich ein in die Entwickelung der menschlichen Wesenheit ein sehr Merkwürdiges. Dasjenige, was mit den Beinen ausgeführt wird, das wirkt in einer gewissen Weise so, daß es in das ganze physisch-seelische Leben des Menschen den stärkeren Zusammenhang mit dem Taktmäßigen, mit den Einschnitten des Lebens hervorbringt. Wir lernen in dem eigentümlichen Zusammenstimmen zwischen der Bewegung des rechten und linken Beines uns ins Verhältnis setzen, möchte man sagen, mit dem, was unter uns ist. Dann lösen wir dasjenige, was in den Armen sich emanzipiert, eben von der Bewegungsbetätigung durch die Beine los: damit kommt in das Taktmäßige und Rhythmische des Lebens ein musikalisch-melodiöses Element hinein. Die Themen des Lebens, möchte man sagen, der Inhalt des Lebens, er tritt auf in der Armbewegung. Und das wiederum bildet die Grundlage für dasjenige, was sich ausbildet im Sprechen-lernen; was äußerlich schon dadurch charakterisiert ist, daß der bei den meisten Menschen stärkeren Betätigung des rechten Armes die Ausbildung des linken Sprachorgans eben entspricht. Aus demjenigen, was Sie da sehen können beim lebendig bewegten Menschen an Verhältnissen eintreten zwischen der Beinbetätigung und der Armbetätigung, aus dem bildet sich heraus das Verhältnis, das der Mensch zur Außenwelt gewinnt dadurch, daß er das Sprechen lernt.
Wenn Sie hineinsehen in diesen ganzen Zusammenhang, wenn Sie hineinsehen, wie in dem Satzbildungsprozeß von unten herauf die Beine in das Sprechen wirken, wie in den Lautbildungsprozeß, also in das innere Erfühlen der Satzstruktur die Wortinhalte hineinsteigen, so haben Sie darin einen Abdruck dessen, wie das Taktmäßig-Rhythmische der Beinbewegungen wirkt auf das mehr Thematisch-Innerliche der Arm- und Handbewegungen. Wenn daher ein Kind vorzugsweise
stramm ist im regelmäßigen Gehen, wenn es nicht schlampig wird im regelmäßigen Gehen, sondern stramm sich hineinzulegen vermag ins regelmäßige Gehen, so haben Sie darin eine körperliche Unterlage, die ja natürlich, wie wir später sehen werden, schon aus dem Geiste herauskommt, aber als körperliche Unterlage in Erscheinung tritt: die Unterlage für ein richtiges Abteilen auch im Sprechen. So daß das Kind mit der Bewegung der Beine lernt, richtige Sätze zu bilden. Sie werden sehen: wenn ein Kind schlampig geht, so führt es auch nicht richtige Intervalle zwischen Satz und Satz herbei, sondern alles verschwimmt in den Sätzen. Und wenn ein Kind nicht ordentlich lernt harmonische Bewegungen mit den Armen zu machen, dann ist seine Sprache krächzend und nicht wohllautend. Ebenso wenn Sie ein Kind gar nicht dazu bringen, das Leben zu fühlen in seinen Fingern, dann wird es keinen Sinn bekommen für die Modulation in der Sprache.
Das alles bezieht sich auf die Zeit, während das Kind gehen und sprechen lernt. Aber Sie sehen noch etwas ganz anderes daraus. Sie sehen, wie sich im Leben manches durcheinandermischt, wie manches später auftritt, als es eigentlich dem inneren Zusammenhang nach auftreten sollte. Sie sehen aber aus diesem inneren Zusammenhang, daß das richtige Verhältnis beim Menschen dadurch herauskommt, daß man zuerst auf das Gehenlernen sieht, und daß man womöglich versucht zu vermeiden, daß das Kind das Sprechen vor dem Gehen lernt. Es muß sich auf der Basis des Gehenlernens, des Armbewegen-lernens in einer geordneten Weise das Sprechenlernen entwickeln, sonst wird die Sprache des Kindes nicht eine im ganzen Menschen fundierte Betätigung, sondern eine Betätigung, die bloß eben herauslallt. Bei denjenigen Menschen, die zum Beispiel statt zu sprechen meckern, was ja sehr häufig vorkommt, ist eben nicht acht gegeben worden auf solche Verhältnisse, wie ich sie eben jetzt charakterisiert habe.
Das dritte nun, was das Kind dann auf Grundlage von Gehen und Sprechen zu lernen hat, das ist das immer mehr und mehr bewußte Denken. Das muß aber eigentlich zuletzt kommen. Das Kind kann nämlich nicht seiner Wesenheit nach das Denken an etwas anderem
lernen als an dem Sprechen. Das Sprechen ist zunächst ein Nachahmen des gehörten Lautes: indem der gehörte Laut von dem Kinde aufgenommen wird und das Kind zugrunde liegend hat jenes eigentümliche Verhältnis zwischen den Bewegungen der Arme und den Bewegungen der Beine, findet es Verständnis für diese Laute und ahmt sie nach, ohne zunächst mit den Lauten noch Gedanken zu verbinden. Zunächst verbindet das Kind mit den Lauten nur Gefühle; das Denken, das dann auftritt, muß sich erst aus der Sprache heraus entwickeln. Die richtige Folge, auf die wir also sehen müssen bei dem heranwachsenden Kinde, ist: Gehenlernen, Sprechenlernen, Denken-lernen.
Nun muß man aber weiter eindringen in diese drei wichtigen Entwickelungsvorgänge beim Kinde. Das Denken, das am spätesten gelernt wird oder wenigstens werden soll, das Denken wirkt sich beim Menschen so aus, daß er eigentlich im Denken immer nur etwas hat wie Spiegelbilder der äußeren Naturwesen und äußeren Naturvorgänge. Sie wissen ja schon, daß dasjenige, was der Mensch dann in seinem Leben zum Beispiel als moralische Impulse aufnimmt, nicht aus dem Denken kommt; das kommt aus jenem Kräftesystem, sagen wir des inneren Menschen, das wir als Gewissen bezeichnen. Wir werden später vom Gewissen noch zu sprechen haben. Es kommt jedenfalls aus seelischen Tiefen herauf und erfüllt erst das Denken aus seelischen Tiefen heraus; während das Denken, das wir uns als Kind aneignen, ganz deutlich zeigt, wie es eigentlich nur abgestimmt ist auf das Erfassen der äußeren Naturwesen und äußeren Naturvorgänge, wie es bloß Bilder liefern will von Naturwesen und Naturvorgängen.
Dagegen in dasjenige, was mit dem Sprechenlernen auftritt, fließt noch etwas ganz anderes hinein. Mit dem Sprechenlernen ist im Grunde genommen die heutige Wissenschaft ja noch auf einem recht gespannten Fuße. Die heutige Wissenschaft hat ganz Großartiges zum Beispiel in bezug auf die Tierentwickelung gelernt, und dann vergleicht sie die Tierentwickelung mit dem Menschen und bekommt allerlei heraus, das sehr anerkennenswert ist; aber mit Bezug auf das, was im Menschen als Sprechenlernen auftritt, weiß die heutige Wissenschaft
auch mit Bezug auf die Tiere noch nicht richtig Bescheid. Denn es muß ja dabei eine bestimmte Frage vor allen Dingen beantwortet werden. Der Mensch benutzt seinen Kehlkopf und die anderen Sprachorgane zum Sprechen. Die höheren Tiere haben auch diese Organe, wenn auch in einer primitiveren Weise. Wenn wir absehen von denjenigen Tieren, die nun zu gewissen Lauten kommen, die aber sehr primitiv sind, die sich nur bei einigen Tieren zu einer Art von Gesang dann entwickeln, wenn wir davon absehen, so kommen wirja doch zu der Frage: Wozu sind eigentlich - ich frage nicht in einer schlecht teleologischen Weise, sondern in kausaler Weise-, wozu sind eigentlich der Kehlkopf und seine Nachbarorgane bei den Tieren ausgebildet, da dieserja deutlich zeigt, daß erst der Mensch diese Organe zum Sprechen verwendet? Beim Tiere sind sie ja noch nicht zum Sprechen verwendet, sie sind aber da - und sie sind sogar sehr deutlich da. Wenn man vergleichende Anatomie treibt, so sieht man, wie auch schon in dem verhältnismäßig - in bezug auf den Menschen verhältnismäßig - stummen Tiere Organe nach dieser Richtung hin sich finden. Das ist durchaus schon so, daß es in einer gewissen Weise vorbestimmt das Menschliche enthält, und doch kommt das Tier nicht zum Sprechen. Was bedeuten also beim Tier der Kehlkopf und seine Nachbarorgane? Da wird eben eine ausgebildetere Physiologie einmal darauf kommen, daß die ganze tierische Form abhängt von der Bildung des Kehlkopfes und seiner Nachbarorgane. Wenn also ein Tier ein Löwe wird, so ist die Ursache davon in seinen oberen Brustorganen zu suchen; von da strahlen die Kräfte aus, die es zur Löwenform machen. Wenn ein Tier eine Kuh wird, so ist die Ursache zu dieser Kuhform gerade in dem enthalten, was beim Menschen Sprachorgan wird. Von diesen Organen strahlt die tierische Form aus. Es muß einmal studiert werden, damit man verstehen wird, wie die Morphologie eigentlich in Wirklichkeit zu gestalten ist, wie man die tierische Gestalt erfassen muß, wie gerade diese oberen Brustorgane, auch indem sie in die Organe des Mundes übergehen, gestaltet sind. Denn von da aus strahlt.die ganze Form des Tieres.
Der Mensch gestaltet diese Organe auf der Grundlage seines aufrecht gehenden und mit den Armen agierenden Wesens zu Sprachorganen
aus. Er nimmt, wenn wir bei der Gegenwart bleiben, dasjenige auf, was an Laut und Sprache aus seiner Umgebung wirkt. Was nimmt der Mensch damit auf? Denken Sie, daß in diesen Organen die Tendenz liegt, den ganzen Organismus der Form nach zu bilden. Indem der Mensch also eine Sprache hört, die zum Beispiel leidenschaftli ich und zornig, jähzornig dahinpoltert, so nimmt er etwas auf, was das Tier nicht einläßt. Das Tier läßt sich nur formen vom Kehlkopf und seinen Nachbarorganen; der Mensch aber nimmt das Zornige, Leidenschaftliche seiner Umgebung in sich hinein, es fließt ein in die Formen, bis in die äußersten Gewebestrukturen hinein. Wenn der Mensch nur Sanftes hört in seiner Umgebung, so fließt es bis in die Struktur seiner feinsten Gewebe, es fließt in seine Formen hinein. Gerade in die feinere Organisation fließt es hinein. Die gröbere macht der Mensch auch so ab wie das Tier, aber in die feinere fließt alles ein, was der Mensch mit der Sprache aufnimmt. Dadurch sind ja auch die feineren Organisationen der Völker gegeben: sie fließen aus der Sprache heraus. Der Mensch ist ein Abdruck der Sprache. Sie werden daher begreifen, was es bedeutet, daß in der Entwickelung die Menschen allmählich dazu gekommen sind, verschiedene Sprachen zu lernen: dadurch wird der Mensch universeller. Diese Dinge haben ja eine ungeheure Bedeutung für die Entwickelung des Menschen.
Nun, so sehen wir, wie während seiner ersten Kindheitszeit der Mensch ganz und gar innerlich bis in seine Blutzirkulation hinein gerichtet, orientiert wird nach demjenigen, was in seiner Umgebung vorgeht - und daraus fließt dann das, was er als die Gedankenrichtungen aufnimmt. Sehen Sie, was da beim Menschen geschieht durch das Sprechenlernen, möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen zu beachten. Ich möchte es Ihnen daher in zwei Sätze prägen, die gewissermaßen diesen Unterschied von Mensch und Tier angeben. -Wenn das Tier zum Ausdruck bringen könnte das, was sein Formen betrifft, sein Gestalten betrifft mit Bezug auf die oberen Brustorgane, dann müßte es sagen: Ich bilde mich in Gemäßheit der oberen Brust-und Mundorgane zu meiner Gestalt und lasse in mein Wesen nichts ein, was die Gestalt modifiziert. - So müßte das Tier sagen, wenn es ausdrücken wollte, wie dieses Verhältnis ist. Der Mensch dagegen
würde sagen: Ich passe meine oberen Brust- und Mund-organe den Weltvorgängen an, welche in der Sprache ablaufen, und richte darnach die Struktur meiner innersten Organisation. - Also nicht der äußeren Organisation, die entwickelt sich tierähnl ich; aber der Mensch paßt gerade die innerste physische Organisation an dasjenige an, was in seiner Umgebung in der Sprache verläuft. Das ist von ungeheurer Bedeutung für das ganze Verständnis des Menschen-wesens. Denn aus der Sprache heraus entwickelt sich wieder die Denk richtung, und der Mensch wird dadurch eben ein Wesen, das in diesen ersten Jahren des kindlichen Lebens hingegeben ist an die Außenwelt, während das Tier in sich krampfhaft abgeschlossen ist.
Nun sehen Sie, dadurch wird ja für den Menschen ungeheuer wichtig die Art und Weise, wie er zuerst Statik und Dynamik, dann die Sprache, dann das Denken während der ersten Kindesjahre findet. Es wird ja ungeheuer wichtig. Das muß sich in der richtigen Weise ausbilden. Sie wissen ja alle, daß das in verschiedenster Weise sich bei den Menschen ausbildet. Und wir müssen fragen: Wovon hängt denn das ab, daß diese Dinge in der richtigen Weise sich ausbilden? Ja, es hängt von mancherlei ab. Aber für dieses erste kindliche Alter ist das allerwichtigste, von dem es abhängt, daß das richtige Verhältnis besteht zwischen Schlafens- und Wachens zeit; daß wir also allmählich eine instinktive Erkenntnis gewinnen darüber, wie lange ein Kind schlafen und wie lange es wachen muß. Denn nehmen wir an: ein Kind schläft für seine Verhältnisse zuviel. Wenn ein Kind für seine Verhältnisse zuviel schläft, dann entwickelt sich - ich will Beispiele anführen -, es entwickelt sich in seiner Betätigung der Beine eine Art inneres Ansichhalten. Das Kind wird innerlich unwillig zu gehen, wenn es zuviel schläft. Es wird gewissermaßen träge in bezug auf das Gehen, und es wird dadurch auch träge in bezug auf das Sprechen. Das Kind entwickelt nicht die ordentliche Aufeinanderfolge, der Zeit nach, im Sprechen. Es spricht langsamer, als es nach seiner Organisation eigentlich sprechen sollte. Wenn wir dann im späteren Leben einem Menschen begegnen, bei dem das durch die Schule nicht ausgeglichen worden ist, so werden wir manchmal verzweifeln, weil er uns immer zwischen zwei Worten die Gelegenheit gibt - nun, einen
kleinen Spaziergang zu machen. Solche Menschen gibt es ja, die von einem Wort zum andern nur sehr schwer hinüberfinden. Wenn wir einen solchen treffen, dann können wir zurückschauen in seine Kindheit, und wir werden finden: den haben seine Erzieher oder seine Eltern zuviel schlafen lassen in der Zeit, in der sich gerade das Gehen ausgebildet hat. - Aber nehmen wir an, das Kind schläft zuwenig; es wird also nicht in der richtigen Weise dafür gesorgt, daß das Kind seinen, für das Kind notwendigen, verhältnismäßig langen Schlaf hat. Dann bildet sich das im Innern so eigentümlich aus, daß das Kind seine Beine nicht ganz in seiner Gewalt hat. Statt zu gehen, schlenkert es. Statt die Worte wirklich mit der Seele in ihrer Aufeinanderfolge zu beherrschen, entfallen sie ihm; die Sätze werden so, daß die Worte auseinanderfallen. Es ist das etwas anderes wie das Nichtfin-den des Wortes; da hat man zuviel Kraft, man kann nicht an das nächste Wort heran. Bei dem, was ich jetzt meine, hat man zuwenig Kraft; das nächste Wort wird gewissermaßen nicht mit dem fortlaufenden Strom der Seele erfaßt, sondern man wartet und will in das nächste Wort einschnappen. Und wenn das zum besonderen Extrem führt, dann drückt sich das in einer stotternden Sprache aus. Wenn man bei Menschen Anlagen zum Stottern findet, namentlich so in den Zwanziger, Dreißiger Jahren, dann kann man sicher sein: diese Kinder sind, während sie sprechen gelernt haben, nicht in der richtigen Weise angehalten worden, genügend zu schlafen.
Daraus sehen Sie, wie durch Menschenerkenntnis die Grundlagen gegeben werden für das, was man zu tun hat.
Nun sehen Sie hinein in diesen ganzen Menschenorganismus, wie er sich in den drei ersten Jahren der Welt anpaßt, wie er gewissermaßen einfließen läßt die Statik und Dynamik seiner eigenen Bewegungsfähigkeit in dasjenige, was er durch'die Gestaltung der Luft hervorbringt im Sprechen - und damit hängt noch vieles andere zusammen, was dann sich als eine Folge davon ergibt für das Denken. Sehen Sie sich das alles an und betrachten Sie nun in bezug auf das alles das Kind im Verhältnis zum erwachsenen Menschen, dann sehen Sie, daß in dem Kinde ein viel stärkeres Zusammenwirken stattfindet zwischen dieser inneren Dynamik, zwischen Gehen, Zappeln, Armebewegen,
Vorstellungen bilden. Das alles fließt beim Kinde viel mehr in eins zusammen als beim erwachsenen Menschen. Das Kind ist in dieser Beziehung noch im wesentlichen eine Einheit. Und das Kind ist auch in anderer Beziehung im wesentlichen mehr eine Einheit als der spätere erwachsene Mensch. Wenn wir zum Beispiel als erwachsener Mensch Zuckerl lutschen, was wir ja eigentlich nicht sollten, dann bedeutet das eigentlich nur eine Annehmlichkeit für die Zunge, für den Gaumen; weiter nach dem Körper hinein hört es auf. Das Kind ist in einer anderen Lage; da setzt sich der Geschmack viel weiter fort. Die Kinder sagen uns das nur nicht, und wir geben nicht acht darauf, aber da wirkt der Geschmack weiter fort. Viele von Ihnen werden gewiß schon einmal Kinder beobachtet haben, die besonders ihrem ganzen Organismus nach durchseelt, durchgeistigt sind - wie bei ihnen dieses Durchseeltsein und Durchgeistigtsein zum Ausdruck kommt. Es ist viel interessanter, bei einem lebhaften Kind, wenn es ein bißchen weiter weg ist von einem Tisch, auf dem etwas Süßes steht, die Arme und Beine anzusehen als etwa den Mund. Was der Mund sagt, ist ja schon mehr oder weniger selbstverständlich, aber wie das Kind die Begierde zum Beispiel in den Zehen entwickelt, in den Armen, wenn es so hinrudert zum Zucker, da können Sie deutlich sehen: da geht nicht nur eine Veränderung auf der Zunge vor sich, sondern im ganzen Menschen. Da fließt das Schmecken in den ganzen Menschen hinein. Gehen Sie in alle diese Dinge wirklich unbefangen hinein, dann kommen Sie dazu, zu erkennen, daß das Kind
- allerdings in den vorgerückten Jahren immer weniger, im ersten Erdenleben am meisten, aber im wesentlichen von der Geburt bis zum Zahnwechsel - in einem gewissen Sinne ganz Sinnesorgan ist, Sinnesorgarlisation ist. Was sich später in unsere Sinne geflüchtet hat an unserer Körperoberfläche, das lebt im Kinde im ganzen Organismus. Natürlich müssen Sie diese Dinge nicht grob nehmen, aber im wesentlichen sind sie schon vorhanden. Und sie sind so vorhanden, daß sie auch die äußere Physiologie einmal bei dem zunächst anschaulichsten Sinnesorgan, bei dem Auge, wird nachweisen können.
Sehen Sie, es kommen zu mir öfters Leute, die fragen: Was kann man aus der jetzigen Wissenschaft heraus, sagen wir zu einer Dissertation
- Dissertationen gehören ja auch zum Schulelend -, was kann man zu diesem Zweck besonders verarbeiten? Und denjenigen, die etwa Physiologen sind, rate ich heute etwas, was sozusagen in der Physiologie geradezu in der Luft liegt: sie sollen einmal beobachten die Entwickelung des menschlichen Auges, wie es am Embryo auftritt und weitergeht, und dann sollen sie beobachten in dem entsprechenden Stadium den ganzen Embryo, wie er sich aus dem Keim heraus entwickelt. Sie werden einen merkwürdigen Parallelismus gerade zwischen dem Auge und dem ganzen menschlichen Keim, wie er embryonal vorschreitet, finden. Nur wird man herausbekommen: das Auge setzt gewissermaßen später ein, überspringt die ersten Stadien, und der ganze Embryo kommt nicht bis zu dem Ende, zu welchem das Auge hinkommt, sondern hört früher auf. So daß sich da für die Embryonalphysiologie etwas ungeheuer Bedeutungsvolles ergeben wird. Man wird dazu kommen, wenn man die embryonale Entwickelung, so wie sie dann weiter vor sich geht, verfolgt, dieses Anfängliche als ideale Stadien zu betrachten, die ganz nur im Ansatz vorhanden sind im Keim und im Auge beim Embryo. Das Auge geht nur weiter, wird zum vollkommenen Sinn; der Embryo bleibt zurück und geht später zur Körperbildung über.
Aber beim Kinde liegt das noch vor, daß es in seiner ganzen seelisch-geistigen Entwickelung dieses Ausgegossensein des Sinnenhaften über den ganzen Körper hat. Das Kind ist in einem gewissen Sinne ganz Sinnesorgan, steht als solches der Welt gegenüber. Auf das muß fortwährend Rücksicht genommen werden bei der Erziehung und bei demjenigen, was überhaupt in der Umgebung des Kindes gemacht wird vor dem Zahnwechsel. Das mehr pädagogisch-didaktische Element werden wir ja noch zu besprechen haben. Erst wenn man da in der richtigen Weise hineinschaut, wird man sich gewisse Fragen, die sich an das Menschenwesen anknüpfen, recht beantworten können. Denn sehen Sie, es liegt eine Frage vor, die für den, der nun nicht nur äußerlich nach der bekannten Geschichte die Entwickelung der Menschheit betrachtet, außerordentlich bedeutungsvoll ist. Sie wissen ja, in früheren historischen Epochen der Menschheitsentwickelung hat man viel mehr von Sünde und von Erbsünde geredet, als
man das heute tut. Nun möchte ich Ihnen jetzt keine historische Abhandlung geben, aber ich möchte auf das hinweisen, was - nun nicht im populären Bewußtsein, da haben sich ja die Dinge manchmal etwas vergröbert-, aber was bei denjenigen, die diese Dinge so gelernt haben wie wir heute, wenn wir eben irgend etwas mehr wissenschaftlich anschauen lernen, uns das für unsere heutigen Verhältnisse aneignen. Für diese war Erbsünde im Menschen alles das, was aus den vererbten Eigenschaften kam. Was der Mensch also von seinen Vorfahren hatte, das war die Erbsünde. Das ist der wirkliche Begriff der Erbsünde. Man hat diesen Begriff später sehr verändert nach denVorstellungen, die man später gewonnen hat. Aber das direkt physisch Vererbte gibt in dem Menschen Anlagen, die zugrunde liegen dem, daß er sündhaft ist - so sagte man früher. Was sagt man heute? Heute sagt man: Man muß die vererbten Anlagen am meisten beobachten, und man muß den Menschen so entwickeln, daß diese Anlagen vorzugsweise in Betracht kommen. Ja, wenn eine ältere Wissenschaft dafür ein Urteil abgeben sollte, so würde sie sagen: Na, ihr habt was Schönes gelernt durch den Menschheitsfortschritt; ihr habt gelernt den Grundsatz zu verfolgen, gerade das Sündhafte im Menschen heranzubilden. - So müßten wir eigentlich im Sinne einer älteren Wissenschaft sagen. Wiir beobachten nur die historischen Vorgänge nach dem, was eben nun leider recht oberflächlich in den Geschichtsbüchern verzeichnet ist; daher kommen wir nicht auf solche Sachen.
Derjenige, der nun hineinsieht in das, was ich heute geschildert habe: wie der Mensch sich in der Dynamik und Statik seines Wesens, im Sprechen, im Denken der Umgebung anpaßt, der wird auch eine richtige Einsicht bekommen, wieviel rein physisch vererbt ist, und wieviel von demjenigen abhängt, was in der menschlichen Umgebung sich abspielt, was viel mehr einfließt in den Menschen, als man gewöhnlich glaubt. Von manchem sagt man heute, der Mensch habe es von seinem Vater oder seiner Mutter geerbt, während er es in Wirklichkeit dadurch sich angeeignet hat, daß er die besondere Gehweise seiner Umgebung oder die Bewegung der Hände oder das Sprechen eben in der ersten Lebensperiode nachahmte. Die Hingabe an die Umgebung ist es, die vorzugsweise in Betracht kommt in der ersten
Lebensperiode, nicht die Vererbung. Die Vererbungstheorien haben ja auf ihrem Gebiet ganz recht, aber das muß eben auch so angesehen werden wie dasjenige, was ich gestern gesagt habe. Ich sagte: Wir gehen hinaus auf den Weg, er ist jetzt weich; wir drücken unsere Fußspuren ein. Jetzt kommt einer, der irdische Menschen nicht kennt,
#Bild s. 45
vom Mars herunter, und der erklärt jetzt: Nun ja, diese Fußspuren sind dadurch bewirkt, daß da unten in der Erde Kräfte sind; die drücken an einer Stelle den Boden etwas stärker, an einer anderen Stelle etwas weniger, dann konfigurieren sich die Spuren, so daß genau so etwas entsteht wie ein Fußabdruck. - So etwa erklären aus vererbten Anlagen heraus und aus dem Gehirn heraus die Menschen das Seelenwesen. Gerade so wie die Fußspuren von außen eingedrückt sind, so sind in den Körper, besonders in das Gehirn und in die Nervenorganisation eingedrückt diejenigen Dinge, die aus der Umgebung herein im nachahmenden Leben erlebt werden im Gehen-lernen, Sprechenlernen, Denkenlernen. Es ist ja alles richtig, was die äußere, physische Psychologie sagt: das Gehirn ist ein deutlicher Abdruck dessen, was der Mensch seelisch ist; aber man muß eben wissen, daß es nicht der Erzeuger des Seelischen ist, sondern der Boden, auf dem sich das Seelische entwickelt. Gerade so wenig wie ich gehen kann ohne Boden unter den Füßen, ebensowenig kann ich als irdischer Mensch ohne Gehirn denken, selbstverständlich. Aber das Gehirn ist nichts anderes als der Boden, in den das Denken und Sprechen hineinkonfiguriert dasjenige, was Sie gerade aus der Welt heraus, aus der Welt Ihrer Umgebung bekommen, nicht aus den vererbten Anlagen heraus.
Nun sehen Sie aber daraus, daß vor dem heutigen Menschen es in einer sehr starken Undeutlichkeit liegt, was da eigentlich vorgeht während dieser drei ersten nicht «akademischen» Lebensjahre. Da wird ja in einem höheren Maße der ganze Mensch konfiguriert und
verinnerlicht. Nun sagte ich schon: das Denken, das dann später auf-tritt, es wendet sich gegen die Außenwelt, es bildet Abbilder der Natur, der Naturdinge und Naturvorgänge. Aber dasjenige, was sich früher bildet, das Sprechen, das nimm? schon temperiert, nuanciert alles dasjenige auf, was geistig in der Sprache liegt, die auf den Menschen wirkt, was seelisch auf den Menschen aus der Umgebung wirkt. Mit der Sprache nehmen wir auf, was wir uns seelisch aneignen aus der Umgebung. Die Seele des ganzen Milieus dringt in uns ein auf dem Umwege durch die Sprache. Und wir wissen, daß das Kind ganz Sinnesorgan ist, daß wirklich sich innere Vorgänge abspielen, indem diese Dinge als seelische Eindrücke da sind. So daß zum Beispiel, sagen wir, wenn das Kind in der Umgebung eines jähzornigen Vaters ist, der seine Worte immer ausstößt wie ein Jähzorniger, dann erlebt das Kind im Innern diese ganze seelische Eigentümlichkeit, die in der Formung der Worte durch den Jähzorn liegen; und das prägt sich in dem Kinde jetzt nicht nur dadurch aus, daß es auch seelisch wird, sondern das Kind sondert dadurch, daß es jähzornige Ereignisse in der Umgebung hat, aus feinen Drüsen mehr Stoff ab, als es in einer nicht jähzornigen Umgebung absondern würde. Und seine Drüsen gewöhnen sich an eine starke Stoffabsonderung. Das wirkt dann im ganzen Leben weiter, ob die Drüsen gewohnt worden sind, mehr oder weniger Stoff abzusondern. Dadurch kann der Mensch, wenn das die Schule später nicht zurechtrichtet, dazu veranlagt werden, gerade, wie man heute sagt, nervös zu werden für alles dasjenige, was in der Umgebung jähzorniger Äußerungen liegt. Sie sehen, da dringt in das Physische Seelisches unmittelbar ein. Sonst suchen wir überall in der Welt das Verhältnis des Seelischen und Physischen zu begreifen; aber auf die Tatsache, wo das Physische in der ersten Periode des Lebens unmittelbar in seelischen Tatsachen sich äußert, darauf schauen wir gar nicht hin.
Indem nun das Kind in die Statik und Dynamik seiner Umgebung hineinkommt, tut es unbewußt etwas außerordentlich Bedeutsames. Denken Sie nur einmal, wieviel Mühe es manche Menschen kostet, später in der Schule Statik und Dynamik zu lernen und sie anzuwenden nur soweit man sie anwendet auf das Maschinelle! Das Kind tut
das unbewußt. Es gliedert wirklich Statik und Dynamik in sein ganzes Menschenwesen ein. Und gerade aus anthroposophischer Forschung kann man ersehen, daß selbst das, was die gelehrtesten Statiker und Dynamiker ausdenken für die äußere Welt, ein Kinderspiel ist gegen dasjenige einer so komplizierten Statik und Dynamik, wie sie das Kind sich im Gehenlernen eingliedert. Das tut es durch Nachahmung. Daher werden Sie sehen, wie merkwürdig gerade auf diese Verhältnisse die Nachahmung wirkt. Dergleichen Beispiele können Sie viele im Leben sehen; ein Beispiel möchte ich Ihnen anführen. Da waren zwei Mädchen, sehr wenig im Alter unterschieden, die gingen nebeneinander. Der Fall trug sich in einer mitteldeutschen Stadt zu vor vielen Jahren. Wenn man sie nebeneinander gehen sah, dann traten sie beide so auf, daß das eine Bein hinkte und unregelmäßig ging. Bei ganz gleichen Bewegungen hatten sie einen eigentümlich konfigurierten Unterschied zwischen einer lebendigeren Art des rechten Armes und der rechten Finger, und einem etwas abgelähmten Tragen des linken Armes und der linken Finger. Beide Kinder waren genaue Kopien voneinander; das jüngere Kind war richtig eine Kopie vom älteren Kinde. Aber nur das ältere Kind hatte nämlich einen Beinschaden an der linken Seite; das jüngere war ein ganz gesundes Kind, das sich das alles nur angeeignet hatte, indem es nachahmend die falsche Dynamik des Schwesterchens aufnahm. - Solche Fälle können Sie überall im Leben finden, nur treten sie einem nicht in solchen extremen und groben Dingen entgegen, so daß man sie gleich sieht. In feineren Gestaltungen ist es überall im Leben vorhanden. Da wo Gehen gelernt, wo Dynamik und Statik angeeignet wird, da nimmt der Mensch aus seiner Umgebung den Geist auf. So daß man sagen kann: Im Denkenlernen eignen wir uns Dinge der äußeren Natur an. Im Sprechenlernen eignen wir uns das Seelische des Milieus an. Und in dem, was eigentlich zuerst der Mensch machen soll, indem er ins Erdenleben eintritt, eignet man sich aus der Umgebung den Geist an.
Geist, Seele, Leib - Geist, Seele, Natur, das ist die Reihenfolge, wie die Welt des umliegenden Erdenlebens an den Menschen herantritt. Aber wenn wir aufnehmen das Seelische, so eignen wir uns mit diesem Seelischen zu gleicher Zeit im wesentlichen an unsere Sympathien
und Antipathien im Leben. Sie fließen ganz unvermerkt ein. Die Art und Weise, wie wir sprechen lernen, ist zu gleicher Zeit die Art und Weise des Aneignens bestimmter Sympathien und Antipathien. Und das Kuriose ist: derjenige, der sich dafür ein richtiges Auge anschafft, ein Seelenauge natürlich, der findet in der Art und Weise, wie das Kind auftritt, ob es mehr mit den Hacken oder mehr mit den Fußspitzen auftritt, ob es stramm auftritt oder schleicht, er findet in diesem Äußerlich-Physischen den ganzen moralischen Charakter des Menschen für das spätere Leben vorbereitet. So daß wir sagen können: Mit jenem Geistigen, das wir aufnehinen, indem wir gehen lernen, fließt auch aus der Umgebung das Moralische ein. Und es ist gut, wenn man sich ein Auge dafür aneignet, wie ein Kind die Beine bewegt, das dann ein gutes Kind wird, und wie ein Kind die Beine bewegt, das dann ein böses wird. Denn am meisten naturalistisch ist dasjenige, was wir durch das Denken in der Kindheit aufnehmen. Schon seelisch durchsetzt ist, was wir durch die Sprache aufnehmen. Und moralisch-geistig durchsetzt ist dasjenige, was wir durch die Statik und Dynamik aufnehmen. Das ist eben keine bloße Statik und Dynamik, wie wir sie in der Schule lernen, das ist eine aus dem Geiste heraus geborene Statik und Dynamik.
Es ist so ungeheuer wichtig, richtig auf diese Dinge hinzuschauen, um bei diesen Dingen nun nicht jene Psychologien zu bekommen, die zuerst auf das Körperliche begründet sind - wo man auf den ersten 30 Seiten das wieder abdruckt, was der Physiologe in ausführlichen Physiologien hat und dann die seelischen Erscheinungen daran anleimt, also das Seelische bezieht auf das Körperliche. Vom Geiste darf man ja nicht mehr sprechen, seitdem ein Konzil den Geist abgeschafft hat, seitdem gesagt worden ist: der Mensch besteht nicht aus Leib, Seele und Geist, sondern nur aus Leib und Seele, die Seele hat nur geistige Eigenschaften. Die Trichotomie wurde ja dogmatisch im Mittelalter verboten, aber die heutige «voraussetzungslose»Wissenschaft treibt Psychologie, indem sie gleich damit beginnt: Der Mensch besteht aus Leib und Seele. Sie weiß nicht, wie wenig voraussetzungslos sie ist, indem sie nur folgt der mittelalterlichen Dogmatik! Die erleuchtetsten Universitätsprofessoren folgen derselben, ohne eine Ahnung
davon zu haben. Man muß, um richtig in den Menschen hineinzusehen, den Menschen betrachten können nach Leib, Seele und Geist. Der Materialist begreift nur das Denken - das ist nämlich seine Tragik. Der Materialismus begreift am wenigsten die Materie, weil er am wenigsten den Geist darin sieht. Er dogmatisiert bloß: es gibt nur Materie und ihre Wirkungen; aber er versteht nichts davon, daß überall der Geist darinnen ist. Es ist das Eigentümliche, man muß, wenn man den Materialismus schildern will, die Definition aufstellen: Der Materialismus ist diejenige Weltanschauung, die nichts von der Materie versteht.
Nun handelt es sich darum, daß man eben genau die Grenzen kennen muß, wo die körperlichen Erscheinungen sind, wo die seelischen Erscheinungen sind, wo die geistigen Erscheinungen sind, und wie eins in das andere überleitet. Und das ist ganz besonders notwendig gegenüber der kindlichen Entwickelung in der ersten Lebensperiode.
DRITTER VORTRAG Dornach, 17. April 1923
Ich habe schon gestern darauf aufmerksam gemacht, wie eigentlich in diesen drei bedeutsamsten Betätigungsweisen des kindlichen Lebens, in dem Aneignen des Gehens, des Sprechens und des Denkens, noch anderes darinnen liegt. Und man kann nicht den Menschen beobachten, wenn man seine Außenseite von seiner Innenseite nicht unterscheiden kann. Man muß gerade mit Bezug auf das, was im ganzen Menschen nach Leib, Seele und Geist steckt, sich ein feines Unterscheidungsvermögen aneignen, wenn man den Menschen pädagogisch-didaktisch behandeln will.
Gehen wir zunächst heran an dasjenige, was man so populär als das Gehenlernen bezeichnet. Ich habe schon gesagt: eigentlich ist darin enthalten die ganze Art, wie sich der Mensch mit der physischen Außenwelt, die ihn auf der Erde umgibt, ins Gleichgewicht versetzt. Es ist eine ganze Statik und Dynamik des Lebens darin enthalten. Und wir haben ja auch gesehen, wie dieses Suchen des Gleichgewichts, dieses Emanzipieren der Hand- und Armgliedmaßen von den Bein- und Fußgliedmaßen, wiederum die Grundlage bildet für die Sprachfähigkeit des Menschen; und wie aus der Sprachfähigkeit die Denkfähigkeit eigentlich erst herausgeboren wird. Nun liegt aber in diesem dynamisch-statischen System, das sich der Mensch mit dem Gehen aneignet, noch etwas wesentlich anderes. Ich habe auch darauf schon gestern wenigstens etwas hingedeutet, aber wir müssen das noch ausführlicher betrachten. Bedenken Sie nur, daß eben der Mensch eigentlich, am meisten im ersten Kindesalter, dann aber bis zum Zahnwechsel hin, ganz Sinnesorgan ist. Dadurch ist er erstens als ganzer Mensch empfänglich für alles dasjenige, was aus seiner Umgebung wirkt; aber er ist auch auf der anderen Seite veranlaßt, nachzubilden durch sich selbst dasjenige, was in seiner Umgebung wirkt. Er ist gewissermaßen - sagen wir, wenn wir ein Sinnesorgan herausgreifen -, er ist ganz Auge. Wie das Auge die Eindrücke von der Außenwelt
empfängt, wie das Auge aber gerade durch seine eigene Organisation nachbildet dasjenige, was in seiner Umgebung auftritt, so bildet der ganze Mensch in der ersten Lebensperiode innerlich dasjenige nach, was in seiner Umgebung geschieht. Aber er nimmt dasjenige, was in seiner Umgebung geschieht, mit einer eigentümlichen inneren Erlebnisform auf. Es ist ja, wenn wir als Kind den Vater oder die Mutter die Hand bewegen sehen, den Arm bewegen sehen, sogleich im Kinde der innere Trieb, auch solch eine Bewegung zu machen. Und von den allgemeinen zappelnden, irregulären Bewegungen geht es über zu bestimmten Bewegungen, indem es die Bewegungen seiner Umgebung nachahmt. So lernt das Kind auch das Gehen. Wir müssen im Gehen auch nicht in demselben Grade ein Vererbungselement sehen, wie man das aus der heutigen naturwissenschaftlichen Zeitmode heraus tut - es ist nur eine Mode, dieses überall Appellieren an die Vererbung -, sondern das Auftreten bei dem einen Kinde mit der Ferse, bei dem anderen Kinde mit den Zehenspitzen, auch das rührt von der Nachahmung von Vater oder Mutter oder sonst jemand her. Und entscheidend für diese Wahl, möchte man sagen, des Kindes, ob es sich mehr nach dem Vater oder mehr nach der Mutter richtet, ist die - wenn ich es so ausdrücken darf - zwischen den Zeilen des Lebens auftretende Zuneigung zu dem betreffenden Wesen, welches das Kind nachahmt. Hier liegt wirklich ein feiner psychologisch-physio-logischer Prozeß, der sich mit den groben Mitteln der heutigen naturwissenschaftlichen Vererbungstheorie eben wirklich gar nicht an-fassen läßt. Ich möchte sagen: Wie die feineren Körper durch das Sieb herunterfallen und nur die gröberen übrigbleiben, so fällt einem sogleich durch das Sieb der heutigen Weltanschauungen dasjenige durch, was da eigentlich stattfindet, und es bleibt einem nur das Grobe der Ähnlichkeit zwischen dem Kinde Ynit dem Vater oder der Mutter usw. Aber das sind die Grobheiten des Lebens, die da zurückbleiben, nicht die Feinheiten. Und der Lehrer, der Erzieher braucht eben ein feines Beobachtungsvermögen für das spezifisch Menschliche.
Nun könnte man sagen: Gewiß, da muß die Liebe walten gerade zu dem einen besonderen Wesen, nach dem sich das Kind richtet. Aber wenn man die Erscheinungen der Liebe im späteren Leben des Menschen
betrachtet, auch dann, wenn der Mensch ein sehr liebevoller geworden ist, so kommt man darauf, daß man noch nicht einmal den besonderen Eigentümlichkeiten, die da walten im Kinde, genug tut, wenn man bloß sagt: das Kind wählt nach Liebe. Es wählt nämlich nach etwas noch Höherem als nach Liebe. Es wählt nach dem, was, wenn wir es im späteren Leben beim Menschen aufsuchen, die religiöse Hingebung ist. Das scheint sehr paradox zu sein, aber es ist so. Das ganze sinnlich-physische Verhalten des Kindes, indem es alles nachahmt, ist ein Ausfluß dessen, daß der Leib des Menschen bis zum Zahnwechsel - natürlich allmählich abnehmend, besonders stark im ersten Kindesalter, aber doch bis zum Zahnwechsel hin - strebt nach einem Durchlebtwerden mit solchen Gefühlen, wie sie später nur in der religiösen Hingebung oder in der Teilnahme an Kultushandlungen zum Ausdruck kommen. Der Leib des Menschen, wenn er in das physische Leben hereintritt, ist nämlich ganz in religiöse Bedürfnisse getaucht, und die Liebe ist später eine Abschwächung desjenigen, was eigentlich religiöses Hingebungsgefühl ist. Wir können sagen: das Kind ist bis zum Zahnwechsel im wesentlichen ein nachahmendes Wesen, aber jene Erlebnisform, welche durch diese Nachahmung hindurch wie das Blut des Lebens geht, ist - Sie werden den Ausdruck nicht mißverstehen, man muß, um etwas zu bezeichnen, das der Gegenwartskultur so fremd ist, manchmal auch fremdartige Ausdrücke gebrauchen -, es ist leibliche Religion. Das Kind lebt bis zum Zahn-wechsel in leiblicher Religion. Man soll ja nicht unterschätzen jene ganz feinen, man könnte sagen imponderablen Einflüsse, die von der Umgebung des Kindes durch die bloße Anschauung im nachahmenden Bedürfnis ausgehen. Man soll das ja nicht unterschätzen, denn das ist das Allerwichtigste für das kindliche Lebensalter. Wir werden noch sehen, welche ungeheuer bedeutsamen pädagogisch-didaktischen Ergebnisse gerade daraus hervorgehen.
Nun, nicht wahr, wenn die heutige Naturwissenschaft an solche Dinge herangeht, so wirken sie ja ungeheuer grob. Ich möchte auch diesmal jene Tatsache anführen, die man bei dieser Gelegenheit sehr gut verstehen kann: das sind nämlich die mathematisierenden Pferde, die eine Zeitlang ein solches Aufsehen gemacht haben. Ich habe die
Düsseldorfer Pferde nicht gesehen, aber ich habe gut studieren können das Pferd des Herrn von Osten, der ja in Berlin eine bestimmte Zeit hindurch eine große Rolle gespielt hat. Es war wirklich etwas Erstaunliches, wie gut dieses Pferd rechnen konnte. Nun, die Sache hat ja viel Aufsehen gemacht, und es erschien auch eine sehr ausführliche Abhandlung von einem Privatdozenten, der zu dem Schluß gekommen war: Dieses Pferd hat die Eigentümlichkeit, daß es die ganz feinen Mienen, die der Mensch nicht wahrnehmen kann, diese ganz feinen Mienen, die der Herr von Osten hat, während er rieben dem Pferd steht, wahrnehmen kann. Und wenn der Herr von Osten ihm dann eine Rechnungsaufgabe gibt, so hat er selbst ja schon das Resultat im Kopfe und macht dazu eine ganz besonders feine Miene; das nimmt das Pferd wahr, und da tritt es mit dem Fuße auf, wenn es diese Miene wahrnimmt. Man konnte allerdings, wenn man noch exakter dachte als die exakte Naturwissenschaft von heute, jetzt diesen Privatdozenten fragen, wie er denn das beweisen will. Er könnte es nicht beweisen. - Aber sehen Sie, meine Beobachtungen gingen dahin, daß etwas ganz anderes eine Bedeutung hatte für den ganzen Verlaufder Sache. Der Herr von Osten hatte nämlich in seinem braun-grauen Mantel große Säcke, und fortwährend, während er demonstrierte, schob er dem Pferd Zuckerln, kleine Bonbons in den Mund. Dadurch wurde ein besonders intimes, leiblich intimes Verhältnis zwischen dem Roß und Herrn von Osten hergestellt, und auf diesem intimen leiblichen Verhältnis, auf dieser fortwährend unterhaltenen innigen Zuneigung beruhte jenes seelische Verhältnis zwischen dem Manne und seinem Pferd. Und es ist ein viel intimerer Vorgang als das äußerliche, intellektuelle Beobachten von Mienen: es ist tatsächlich eine seelische Kommunikation.
Wenn man das schon in der Tierheit in einem solchen Falle beob-achten kann, dann müssen Sie sicli klar sein, welche seelische Kommunikation, wenn sie noch durchstrahlt sein kann von dieser religiö-sen Hingabe, im kindlichen Lebensalter vorhanden ist - wie da alles, was das Kind sich aneignet, aus dieser religiösen Seelenorientierung hervorgeht, die noch ganz im Leibe sitzt. Und derjenige, der nun beobachten kann, wie das Kind sich von außen beeinflussen läßt durch
diese religiöse Hingabe an die Umgebung, und wer unterscheiden kann von dem, was auf diese Art geschieht, dasjenige, was das Kind noch individuell gerade in diese Statik und Dynamik hineingießt, der findet dann schon veranlagt gerade in dieser leiblichen Äußerung des Kindes die Impulse des späteren Schicksals. Sehen Sie, es ist sehr merkwürdig, aber durchaus wahr, was zum Beispiel solch ein Mensch wie Goethes Freund Knebel im hohen Alter zu Goethe gesagt hat: Wer zurückblickt auf das Leben, der findet sehr leicht, daß, wenn wir ein entscheidendes Ereignis im Leben haben und wenn wir dasjenige, was vorangegangen ist, verfolgen, es so ist, wie wenn wir hingesteuert wären zu diesem entscheidenden Ereignis, wie wenn nicht nur der vorhergehende Schritt, sondern viele vorhergehende Schritte so gewesen wären, daß wir aus innerem Seelentrieb heraus gerade dahin gestrebt haben.
Ist das betreffende Ereignis so, daß es mit einer Persönlichkeit zusammenhängt, dann wird der Mensch, wenn er wirklich sich herauslösen kann aus dem Getöse des Lebens und auf die feineren Empfindungen hinschauen kann, sich auch sagen: Es ist nicht bloß eine Illusion, ein Erträumtes, sondern hast du einen Menschen gefunden bei einer bestimmten Lebensstation, mit dem du inniger verbunden sein willst als mit anderen Menschen, so hast du ihn eigentlich gesucht. Du hast ihn ja schon gekannt, bevor du ihn das erstemal gesehen hast. - Die intimsten Dinge des Lebens stehen gerade neben diesem Sichhineinfinden in die Statik und Dynamik. Und wer sich ein Beobachtungsvermögen nach dieser Richtung aneignet, der wird finden, daß die Lebensschicksale sich in einer merkwürdig bildhaften Form ausdrücken in der Art und Weise, wie das Kind beginnt aufzutreten, wie das Kind beginnt, die Knie zu beugen, wie es beginnt, sich seiner Finger zu bedienen. Das alles ist ja nicht bloß etwas materiell Äußerliches, das alles istja das Bild gerade für das Geistigste des Menschen.
Und wenn das Kind zu sprechen beginnt, dann ist es ein größerer Kreis, dem es sich anpaßt. Es ist zunächst, wenn es nur seine Muttersprache lernt, der Kreis des Volkstums, nicht mehrjener engere Kreis derjenigen Persönlichkeiten, die ein mehr intimes soziales Milieu ausmachen. Der Kreis hat sich erweitert. Indem das Kind sich in die
Sprache hineinlebt, paßt es sich schon an etwas an, was nicht mehr so eng ist wie das, an was es sich anpaßt mit Statik und Dynamik. Daher können wir sagen: das Kind lebt sich mit dem Sprechen hinein in den Volksgenius, den Sprachgenius. Und indem die Sprache durch und durch ein Geistiges ist, lebt sich das Kind noch in ein Geistiges hinein, aber nicht mehr in das individuell Geistige, das für es dann schicksalmäßig, unmittelbar persönlich schicksalmäßig wird, sondern in etwas, was das Kind aufnimmt in einen größeren Lebenskreis.
Und lernt das Kind dann denken -ja, im Denken sind wir gar nicht mehr individuell darinnen. In Neuseeland denken die Menschen gerade so, wie wir heute hier denken. Da ist es der ganze Erdenkreis, dem man sich anpaßt, indem man das Denken herausentwickelt aus der Sprache. Also mit der Sprache stehen wir noch in einem kleineren Lebenskreise drinnen; im Denken stehen wir in der ganzen Menschheit drinnen. So erweitern wir unseren Lebenskreis im Gehen, Sprechen, Denken. Und hat man ein Unterscheidungsvermögen, dann findet man schon die durchgreifenden spezifischen Unterschiede zwischen jenen menschlichen Lebensäußerungen heraus, die in der An-eignung der Statik und Dynamik mit dem Schicksal liegen. Und wir schauen darinnen dasjenige wirksam, was wir in der Anthroposophie gewöhnt worden sind, die Ichwesenheit des Menschen zu nennen. Nicht eine abstrakte Unterscheidung wollen wir pflegen, sondern nur das Spezifische, das im Menschen wirkt, eben damit fixieren. Ebenso sehen wir, daß etwas ganz anderes als diese ganz individuelle Menschennatur in der Sprache herauskommt. Deshalb sagen wir: In der Sprache wirkt mit des Menschen astralischer Leib. Dieser astralische Leib kann zwar auch beim Tier beobachtet werden; aber beim Tier wirkt er nicht nach außen, sondern mehr nach innen und bewirkt die Gestalt des Tieres. Wir bilden auch die Gestalt, aber wir nehmen gewissermaßen ein wenig weg von diesem gestaltbildenden Elemente und verwenden es dazu, die Sprache auszubilden. Da wirkt also der astralische Leib mit. Und im Denken, was dann ganz allgemein ist, was wiederum etwas spezifisch von dem anderen Verschiedenes ist, im Denken bilden wir dasjenige aus, was wir so abgrenzen, daß wir sagen: da wirkt der Ätherleib des Menschen mit. Und erst bei den
Sinneswahrnehmungen wirkt der ganze physische Leib des Menschen mit.
Nehmen Sie diese Dinge zunächst meinetwillen wie die Festlegung einer Terminologie; darauf kommt es jetzt nicht an, es handelt sich wirklich nicht um allerlei philosophische Spintisierereien, sondern um eine starke Hindeutung auf das Leben selber. Diese muß zugrunde liegen jener Menschenerkenntnis, die wiederum zu einer wahren Pädagogik und Didaktik führen kann.
So sehen wir gewissermaßen in einer solchen Reihenfolge, daß das Höchste zuerst herauskommt, das Ich, dann der astralische Leib, dann der Ätherleib. Und das ganze Geistig-Seelische, das im Ich, Astral-leib und Ätherleib wirkt, das sehen wir dann auf den physischen Leib weiter bis zum Zahnwechsel hin wirken. Es wirkt im physischenLeibe das alles drinnen.
Mit dem Zahnwechsel tritt eine große Veränderung im ganzen Leben des Kindes ein. Diese Veränderung, wir können sie zunächst an einem bestimmten Element beobachten. Sehen Sie, was ist denn eigentlich beim Kinde dasjenige, was das Ausschlaggebende ist? Es ist wirklich das, was ich eben charakterisiert habe, diese leiblich-religiöse Hingabe an die Umgebung. Das ist wirklich das Ausschlaggebende. Nun geht das Kind durch den Zahnwechsel durch, bekommt dann eine gewisse seelisch-geistige Konstitution gerade im volksschu]mäßigen Alter zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Nun sehen Sie: was da leiblich wirkt im Menschen in der ersten Lebensperiode, es kommt erst im späteren Lebensalter, wenn der Mensch die Geschlechtsreife schon durchgemacht hat, als Gedanken zum Vorschein. Es ist gar nicht so, daß das Kind schon ein solches Denken hat, welches sich im Kinde verbinden könnte mit dem Erleben der religiö-sen Hingabe. Diese zwei Dinge stehen im kindlichen Alter-zunächst bis zum Zahnwechsel, aber noch bis zur Geschlechtsreife - in einer solchen Weise zueinander, daß sie sich, möchte ich sagen, gegenseitig fernhalten. Das Denken des Kindes ergreift selbst zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife noch nicht das religiöse Element. Es ist so wie bei jenen Alpenflüssen, die da oben entspringen und dann in den Höhlen des Gebirges scheinbar verschwinden, indem
sie da unten weiterfiießen und dann wieder hervorkommen und oben weiterfließen. Dasjenige, was im kindlichen Lebensalter bis zum Zahn-wechsel hin als diese religiöse Hingabe erscheint, es tritt in das Innere des Menschen zurück und wird ganz seelisch, so daß man es wie verschwinden sieht, und erst später, wenn der Mensch dann wirklich ein religiös empfindendes Wesen wird, dann tritt es wiederum hervor, und zwar ergreift es jetzt das Vorstellen, das Denken.
Wenn man so etwas beobachten kann, dann wird ja erst die äußerliche Beobachtung - die ich durchaus nicht tadle, die ich durchaus, wie ich schon im ersten Vortrage sagte, berechtigt finde, aber die nicht unmittelbar die Grundlage für die pädagogische Kunst bilden kann -, diese Beobachtung wird dadurch erst bedeutungsvoll. Sehen Sie, da hat wiederum die experimentelle pädagogische Psychologie festgestellt, daß es ja sehr merkwürdig ist, wie Kinder von solchen Eltern, die fortwährend mit religiöser Gesinnung in der Umgebung wirken, die fortwährend die religiöse Gesinnung in Worten zum Ausdruck bringen und dem Kinde die Religion sozusagen einbläuen möchten - wie Kinder von solchen Eltern in ihren eigenen Schulleistungen in der Religion schwach sind; wie der geringste Korrelationskoeffizient zwischen der religiösen Schulleistung der Kinder im volksschulpflichtigen Alter und der religiösen Gesinnung der Eltern besteht. Diese Korrelationskoeffizienten sind sehr gering.
Ja, sehen Sie, wenn man nun hineinschaut in die menschliche Wesenheit, dann sieht man die Gründe für diese Erscheinung. Die Eltern mögen nämlich noch soviel reden von ihrer religiösen Gesinnung, sie mögen noch soviel Schönes dem Kinde sagen, das hat ja gar keine Bedeutung für das Kind; daran geht das Kind vorbei. An allem geht das Kind vorbei, was auf den Verstand wirken soll, selbst noch an dem, was auf das Gemüt wirken soll, geht es vorbei bis zumZahnwechsel. Es geht nur daran nicht vorbei, wenn diejenigen Persönlichkeiten, die in der Umgebung des Kindes sind, in ihren Handlungen, schon durch ihre Gesten, durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten, dem Kinde die Möglichkeit geben, in religiöser Hingebung nachzuahmen und bis in die feinsten Gliederungen des Gefäßsystems hinein das Religiöse aufzunehmen. Dann wird das im Innern des Menschen
verarbeitet zwischen ungefähr dem siebenten und dem vierzehnten Lebensjahr; es geht wieder da unten weiter, wie der Fluß unten weitergeht, und kommt erst wiederum, wenn das Kind geschlechtsreif ist, im Vorstellungsvermögen zum Vorschein. Wir dürfen uns also nicht wundern, daß, wenn noch soviel äußere Frömmigkeitsformeln und noch soviel religiöse Gesinnung an das Kind heran-treten, das alles nicht wirkt. Wirkend sehen wir nur dasjenige, was in den Handlungen liegt, die das Kind umgeben - das andere geht alles an dem Kinde vorüber. Das Kind geht, paradox ausgedrückt, an den Worten und an den Ermahnungen, selbst an den Gesinnungen der Eltern gerade so unbeteiligt vorbei, wie das Auge vorbeigeht an allem, was nicht Farbe ist. Das Kind ist eben durch und durch ein nachahmendes Wesen bis zum Zahnwechsel.
Mit dem Zahnwechsel tritt dann eben die große Veränderung bei dem Kinde ein. Diese leiblich-religiöse Hingabe hört auf. Wir brauchen uns jetzt nicht zu verwundern, wenn das Kind, das ja gar nichts gemerkt hat von all der religiösen Gesinnung, nun sich ganz anders erweist zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Aber gerade das, was ich gesagt habe, beweist uns, daß das Kind zu dem intellektualistischen Verstehen eigentlich erst mit der Geschlechts-reife kommt. Das Denken des Kindes erfaßt noch gar nicht das Intellektuelle, sondern das Denken des Kindes vom Zahriwechsel bis zur Geschlechtsreife steht durchaus mit alledem nur in Verbindung, was bildhaft auf das Kind wirkt. Auf die Sinne wirken Bilder. In der ersten Lebensperiode bis zum Zahnwechsel wirken überhaupt nur die Bilder des Geschehens, des Tuns der Umgebung. Dann fängt das Kind an, mit dem Zahnwechsel auch dasjenige aufzunehmen, was bildhaft ist. Und dieses Bildhafte, das müssen wir vor allen Dingen in all das gießen, wodurch wir jetzt in vorzüglicher Weise an das Kind heranbringen dasjenige, was eben herangebracht werden muß, das ist:
durch die Sprache.
Ich habe Ihnen jetzt ja charakterisiert, was alles an das Kind herankommt durch das statisch-dynamische Element. Aber mit dem Sprachlichen kommt weiteres, kommt ungeheuer vieles an das Kind heran. Die Sprache ist ja nur ein Glied in einer umfangreichen Kette von
Seelenerlebnissen. Und alle diejenigen See lenerlehnisse, welche zu dem Kreis der Sprache gehören, sind die künstlerischen Seelenerlebnisse. Die Sprache selbst ist ein künstlerisches Element. Und das künstlerische Element, das ist dasjenige, was wir vorzugsweise berücksichtigen müssen gerade für das volksschulmäßige Zeitalter, für das Zeitalter des Kindes vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.
Glauben Sie ja nicht, daß ich jetzt in diesem Augenblicke eintreten will für eine ästhetisierende Erziehung, für ein Ersetzen der ersten Unterrichtselemente durch allerlei Erkünsteltes und Künstlerisches, vielleicht auch berechtigt Künstlerisches. Das will ich durchaus nicht. Ich will durchaus nicht das Philisterelement, das in unserer gegenwärtigen Zivilisation ja ausschlaggebend ist, durch das Bohéme-Element ersetzen. - Für unsere tschechischen Freunde möchte ich bemerken, daß mit Bohéme-Element natürlich kein Völker-Element gemeint ist, nichts Landschaftliches, sondern was im Leben so schlampig dahinlebt, ohne Pflichtgefühl, ohne Regelung, ohne Ernst. - Also darum handelt es sich nicht, daß das Ungeregelte, das Unernste, an die Stelle treten soll des philiströsen Elementes, das in unsere Zivilisation hineingekommen ist, sondern es handelt sich um etwas ganz anderes für das Zeitalter von dem Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. Da muß man eben darauf hinschauen, wie das ganze Denken noch kein logisches ist beim Kinde, sondern wie das ganze Denken beim Kinde ein bildhaftes ist. Und durch seine innerliche Natur lehnt das Kind das Logische zunächst ab; es will Bildhaftes haben. Die gescheiten Menschen, die machen noch nicht einen sehr starken Eindruck auf das siebenjährige, neunjährige, elfjährige, selbst noch dreizehnjährige Kind. Die Gescheitheit der Menschen ist diesen Kindern noch ziemlich gleichgültig. Aber einen starken Eindruck machen die frischen Menschen, die liebenswürdigen Menschen; diejenigen, die so sprechen, daß sie auch schon mit ihren Worten - nun, es ist etwas extrem ausgedrückt - sozusagen Zärtlichkeiten austeilen, diejenigen, die mit Worten streicheln können, die mit Wortbetonungen loben können. Diese Menschen, die in Frische, aber ohne Unbesonnenheit durch das Leben gehen, diese sind es, welche auf die Kinder in diesem Lebensalter ganz besonders wirken. Und auf diese persönliche Wirkung
kommt es an. Denn es erwacht mit dem Zahnwechsel gerade das Hingegebensein des Kindes jetzt nicht mehr an die Taten allein der Umgebung, sondern an dasjenige, was die Menschen sagen. In dem, was die Menschen sagen, in dem, was man durch eine selbstverständliche Autorität sich aneignet, in dem liegt das wesentlichste Element des kindlichen Lebens vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.
Sie werden mir, der ich die «Philosophie der Freiheit>) geschrieben habe vor mehr als 30 Jahren, nicht zutrauen, daß ich für die Autorität in unziemlicher Weise eintrete; aber für das Kind vom Zahn-wechsel bis zur Geschlechtsreife ist das Leben unter der selbstverständlichen Autorität eben ein seelisches Naturgesetz. Und derjenige, der nie in diesem Lebensalter gelernt hat, als zu einer selbstverständlichen Autorität zu seiner ihn erziehenden und lehrenden Umgebung aufzusehen, der kann auch niemals frei werden, kann auch niemals ein freier Mensch werden. Die Freiheit erwirbt man sich eben gerade durch die Hingabe an die Autorität in diesem Lebensalter.
Gerade so wie das Kind in der ersten Lebensepoche dasjenige nachahmt, was in der Umgebung getan wird, so folgt es in der zweiten Lebensepoche dem, was in der Umgebung gesagt wird - natürlich im umfassenden Sinne gesagt wird. Und Ungeheures fließt durch die Sprache, die aber aus dem Kinde heraus durchaus nach Bildlichkeit verlangt, in das Kind ein. Sehen Sie: wenn man beobachtet, wie das, was veranlagt wird beim ersten Sprechenlernen, man möchte sagen traumhaft vom Kinde verfolgt wird bis zum Zahnwechsel und dann erst aufwacht - gerade dann hat man eine Vorstellung davon, was da alles mit unserer Handhabung der Sprache in der Umgebung desKindes in der zweiten Lebensepoche an es herantritt. Daher muß gerade für dieses Lebensalter ganz besonders berücksichtigt werden, wie auf das Kind gewirkt werden kann durch das, wofür die Sprache tonangebend ist. Alles muß gewissermaßen sprechend an das Kind herangebracht werden - und dasjenige, was nicht sprechend an das Kind her-angebracht wird, das begreift das Kind nicht. Wenn man dem Kinde eine Pflanze beschreibt, da ist es gerade so, wie wenn man vom Auge verlangt, daß es das Wort Rot verstehen soll; es versteht nur die rote
Farbe. Das Kind versteht nichts von der Beschreibung einer Pflanze; es fängt aber sofort an zu verstehen, wenn man ihm erzählt, wie die Pflanze spricht und handelt. Man muß eben das Kind auch nach der Menschenerkenntnis behandeln. Das werden wir aber mehr im pädagogisch-didaktischen Teil sehen; dasjenige, was ich jetzt sage, soll mehr eine Grundlage sein.
Wir sehen also das, was uns in der Dreiheit Gehen, Sprechen, Denken im Kinde veranlagt entgegentritt, wie in dem bildhaften Element vereinigt. Auch das, was das Kind zuerst im Sinnlichen träumend aufgenommen hat von den Taten der Umgebung, wird merkwürdigerweise in diesem zweiten Lebensalter vom Zahnwechsel bis zu derGeschlechtsreife in Bilder verwandelt. Das Kind fängt an, möchte man sagen, zu träumen von dem, was seine Umgebung tut, während es in der ersten Lebensperiode das ganz nüchtern aufgefaßt hat, in seiner Art nüchtern, indem es innerlich es nachahmt. Jetzt fängt es an zu träumen von demjenigen, was die Umgebung tut. Und die Gedanken des kindlichen Denkens sind noch nicht abstrakte, noch nicht logische Gedanken, sie sind auch noch Bilder. In demjenigen, wofür die Sprache tonangebend ist, in diesem künstlerischen Element, diesem ästhetischen Element, diesem bildhaften Element lebt das Kind vom Zahn-wechsel bis zur Geschlechtsreife, und nur dasjenige kommt von uns als Erwachsene zu ihm, was in diese Bildlichkeit getaucht ist. Daher entwickelt sich besonders für dieses Lebensalter das Gedächtnis des Kindes.
Nun sage ich wiederum etwas, vor dem die gelehrten Psychologen heute selbstverständlich ein leichtes Gruseln, eine Art Gänsehaut bekommen, wenn ich sage: das Kind bekommt das Gedächtnis erst mit dem Zahnwechsel. Aber daß man dieses leise Gruseln, diese Gänse-haut bekommt, das rührt nur davon her, daß man die Dinge eben nicht beobachten kann. Sehen Sie, wenn einer sagt: das, was als Gedächtnis beim Kinde auftritt vom Zahnwechsel an, das war ja früher sogar stärker da, denn das Kind, das hat ein naturgemäßes Gedächtnis, es erinnert sich viel leichter an alles mögliche, als man sich später daran erinnert - ja, das ist zwar richtig, aber es ist in der Art richtig, wie wenn einer sagt: ein Hund ist ja doch ein Wolf, er unterscheidet
sich nicht von einem Wolf. Und wenn man ihm dann sagt: ein Hund ist eben durch andere Lebensverhältnisse hindurchgegan-gen, er ist zwar aus dem Wolf geworden, aber er ist keiner mehr, dann sagt er: ja, was beim Hund in zahmer Weise vorhanden ist, das ist beim Wolf eben mehr vorhanden, der Wolf beißt mehr als der Hund. - So ist es, wenn man sagt, das Gedächtnis ist beim Kinde stärker vorhanden als im späteren Leben, nach dem Zahnwechsel. Man muß eben wirklich eingehen können auf das Beobachten desTatsächlichen, des Wirklichen.
Was ist diese besondere Art von Gedächtnis, von dem das spätere Gedächtnis abs tammt, beim Kinde? Das ist ja beim Kinde noch Gewohnheit. Beim Kinde, das alles durch Nachahmung sich einverleibt, entsteht eine innere, feine Gewohnheit, wenn es das Wort wahrnimmt, und aus der Gewohnheit, dem, was später als Gewohnheit auftritt, aus einer besonders ausgebildeten Gewohnheit, die noch eine mehr körperliche Eigenschaft ist, geht das hervor, was später, vom Zahnwechsel an, die seelisch gewordene Gewohnheit, das Gedächtnis ist. Man muß die seelisch gewordene Gewohnheit von der bloß physischen Gewohnheit unterscheiden, wie man den Hund vom Wolfe unterscheidet, sonst kommt man nicht zurecht.
Und nun wird man auch den Zusammenhang empfinden zwischen der bildhaften Natur, in der das ganze kindliche Seelenleben ist, und dem Heraufkommen der durchseelten Gewohnheit, dem eigentlichen Gedächtnis, das ja vorzugsweise in Bildern wirkt.
Es kommt bei allen Dingen überall darauf an, daß man sich eben eine feine Menschenbeobachtung aneignet. Dann merkt man schon auch den großen Einschnitt zwischen dem Lebensalter, das beim Kinde dem Zahnwechsel vorangeht, und dem Lebensalter, das dann folgt. Man merkt diesen Einschnitt ja auch ganz besonders an den pathologischen Zuständen, die auftreten. Wer dafür ein Auge hat, der weiß, daß Kinderkrankheiten ganz anders ausschauen als Krankheiten der Erwachsenen. In der Regel hat sogar derselbe äußere Symptomkomplex beim Kinde einen ganz anderen Ursprung, als er beim Erwachsenen hat, wo er zwar nicht ganz dasselbe, aber ähnlich ist. Beim Kinde entstehen nämlich die charakteristischen Krankheitsformen eigentlich
alle vom Kopf herunter nach dem übrigen Organismus, durch eine Art Übererregung des Nerven-Sinnessystems. Bis in die kindlichen Masern und Scharlach hinein ist das so. Und wenn man nun beobachten kann, so findet man: in diesem kindlichen Leben, in dem nun getrennt voneinander wirken Gehen, Sprechen, Denken - alle diese Tätigkeiten wirken beim Kinde vom Kopfe aus. Der Kopf ist ja mit dem Zahnwechsel am meisten innerlich plastisch ausgebildet. Er verbreitet dann dasjenige, was innere Kräfte sind, auf den übrigen Organismus. Daher strahlen eben die Kinderkrankheiten auch vom Kopfe aus. Man wird sehen an der Art und Weise, wie Kinderkrankheiten auftreten, daß sie eine Reaktion sind auf Erregungszustände des Nerven-Sinnessysteins in erster Linie. Nur dann findet man eine richtige Pathologie der Kinderkrankheiten, wenn man das weiß. Gehen Sie an den Erwachsenen heran, dann werden Sie sehen, daß seine Krankheiten vorzugsweise ausstrahlen vom Unterleibs- und Bewegungssystem, also gerade vom entgegengesetzten Pol des Menschen.
Zwischendrinnen, zwischen dem kindlichen Alter, das eigentlich an einer Übererregung des Nerven-Sinnessystems leiden kann, und dem erwachsenen Alter nach der Geschlechtsreife liegt eben gerade das schulpflichtige Alter - vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. Da steht mitten drinnen das alles, was ich Ihnen geschildert habe, dieses bildhafte Seelenleben. Das hat zu seiner Außenseite das rhythmische System des Menschen, das Ineinanderwirken von Atmung und Blutzirkulation. Wie Atmung und Blutzirkulation sich innerlich harmonisieren, wie das Kind atmet in der Schule, wie sich die Atmung allmählich der Blutzirkulation anpaßt, das geschieht in der Regel zwischen dem 9. und 10. Jahr. Während zuerst bis zum 9. Jahr die Atmung präponderierend ist, wie dann durch ein innerliches Kämpfen im Organismus sich eine Art Harmonie herausstellt zwischen dem Pulsschlag und den Atemzügen, wie dann die Blutzirkulation präponderierend wird, das ist leiblich auf der einen Seite vorhanden, das ist seelisch auf der anderen Seite vorhanden.
Alle Kräfte des Kindes, indem es durch den Zahnwechsel durchgegangen ist, streben nach einer innerlich plastischen Bildhaftigkeit. Und wir unterstützen diese Bildhaftigkeit, wenn wir selbst mit alledem,
was wir dem Kinde überliefern, bildhaft an das Kind herantreten. Dann, zwischen dem 9. und 10. Jahr, tritt etwas Merkwürdiges auf. Da will das Kind viel mehr als früher musikalisch gepackt werden, in Rhythmen gepackt werden. Wenn wir das Kind beobachten in bezug auf das musikalische Aufnehmen bis zu diesem Lebenspunkte zwischen dem 9. und 10. Jahr - beobachten, wie auch das Musikalische in dem Kinde eigentlich plastisch lebt, wie es selbstverständlich zur inneren Plastik des Leibes wird, wie auch das Musikalische beim Kinde außerordentlich leicht in das Tanzartige, in die Bewegung übergeht: da müssen wir erkennen, wie das eigentliche innere Erfassen des Musikalischen gerade erst zwischen dem 9. und 10. Jahr auftritt. Das wird ganz deutlich bemerkbar sein. Natürlich sind die Dinge nicht so streng voneinander unterschieden, und wer diese Dinge durchschaut, wird das Musikalische vor dem 9. Jahre pflegen, aber in richtiger Weise - mehr nach der Seite hin tendierend, wie ich es eben charakterisiert habe; sonst würde das Kind zwischen dem 9. und 10. Jahr einen Schock bekommen, wenn das musikalische Element plötzlich an es herantreten und es nun innerlich ergreifen würde, während es ganz ungewohnt war, überhaupt in dieser starken Weise innerlich ergriffen zu werden.
Und so sehen wir, wie das Kind aus seiner inneren Wesenheit heraus ganz bestimmten Manifestationen, Offenbarungen der Außenwelt - innere Forderungen, innere Bedürfnisse entgegenstellt. Wenn man diese inneren Forderungen und inneren Bedürfnisse so kennen-lernt, wie ich es jetzt geschildert habe, dann lernt man sie nicht bloß theoretisch kennen, sondern man lernt am Kinde selbst erkennen: jetzt sprießt das aus ihm heraus, jetzt etwas anderes. Da wird wirklich eine solche Lebenserkenntnis nicht Theorie, sie wird Instinkt. Ein instinktives Beobachten des Kindes tritt dadurch zutage, währenddem sonst alles Beobachten eben nur zu Theorien führt - und man muß die Theorien äußerlich anwenden und bleibt im Grunde genommen dem Kinde ganz fremd. Man braucht ja nicht dem Kinde Bonbons zu geben, um die Intimität herzustellen, man muß das eben durch seelische Bedingungen herbeiführen. Aber das allerwichtigste Element ist eben die seelische Verbindung zwischen dem Lehrenden
und dem zu Erziehenden im volksschulmäßigen Lebensalter. Das ist es, worauf es besonders ankommt.
Nun muß man ja sagen: Dasjenige, was da aus dem Kinde herauswill, das kommt eigentlich mit einer großen inneren Notwendigkeit aus dem Kinde heraus. Und der Erzieher und Lehrer, der das Kind durchschauen kann aus all den Quellen heraus, die ich charakterisiert habe, wird eigentlich nach und nach recht sehr bescheiden, weil er allmählich kennenlernt, wie wenig man im Grunde genommen mit leichten Mitteln herankommt an das Kind. Wir werden aber sehen, daß Erziehung und Unterricht dennoch ihre gute Begründung haben und uns schon, wenn wir sie in der richtigen Weise als Praxis pflegen, in die Lage versetzen, an das Kind heranzukommen - gerade weil die meiste Erziehung doch Selbsterziehung ist. Aber wir müssen auch einsehen, daß eben das Kind etwas ganz Spezifisches, sogar in jedem Lebenspunkte etwas ganz Spezifisches, der Außenwelt, also uns selbst als Erziehern und Lehrern, entgegenbringt. Und wir müssen uns dann nicht wundern, wenn wir etwas an das Kind heranbringen und das Kind - nicht bewußt, denn das bewußte Leben ist ja da noch nicht so sehr ausgebildet - unbewußt uns eine bestimmte Opposition entgegenbringt.
Das Kind verlangt durch seine innere Natur, wenn es den Zahn-wechsel durchgemacht hat, daß wir ihm in äußeren Formen und Farben dasjenige entgegenbringen, was aus der Organisation selbst herausquillt. Darüber werde ich dann später noch sprechen. Aber was das Kind nicht verlangt, was das Kind ganz gewiß im Zahnwechsel-Lebensalter zunächst nicht verlangt, was es innerlich mit starker Opposition zurückweist, das ist, daß es, wenn es gelernt hat, als menschlichen Ausdruck für Verwunderung A zu sagen, dann für dieses A solch ein komisches Zeichen auf die Tafel oder auf Papier schreiben soll! Das hat ja nicht das geringste zu tun mit dem, was das Kind eigentlich erlebt.Wenn das Kind eine Farbenzusammenstellung sieht, dann lebt es innerlich auf. Wenn man aber dem Kinde so etwas vor-hält: VATER, und dann soll es das, was sein Vater ist, irgendwie mit dem in Zusammenhang bringen - da macht natürlich das innere Menschenwesen Opposition.
Diese Dinge, wodurch sind sie denn entstanden? Denken Sie doch nur einmal, die alten Ägypter haben noch eine Bilderschrift gehabt. Da haben sie in dem, was sie bildhaft fixiert haben, eine Ähnlichkeit gehabt mit dem, was das bedeutet hat. Diese Bilderschrift hatte noch eine bestimmte Bedeutung - auch die Keilschrift hatte noch eine bestimmte Bedeutung, nur drückte diese mehr das willkürliche Element aus, während das gemüthafte Element mehr in der Bilderschrift ausgedrückt wurde - ja, bei diesen älteren Schriftformen, namentlich wenn man sie lesen sollte, kam einem das zum Bewußtsein: die hatten noch etwas zu tun mit dem, was dem Menschen in der Außenwelt gegeben ist. Aber diese Schnörkel da an der Tafel, die haben nichts zu tun mit dem «Vater», und just damit soll nun das Kind anfangen sich zu beschäftigen. Es ist gar kein Wunder, daß es das ablehnt.
Nämlich mit dem Schreiben und Lesen ist im Zahnwechselalter die menschliche Natur am wenigsten verwandt, mit jenem Schreiben und Lesen, wie wir es jetzt in der Zivilisation haben - denn das hat sich entwickelt dadurch, daß die Erwachsenen das Ursprüngliche fortgebildet haben. Nun soll das Kind, das erst jetzt in die Welt gekommen ist, das aufmehmen. Noch trat an das Kind nichts heran von all den Kulturfortschritten, und es soll sich jetzt plötzlich in ein späteres Stadium hineinfinden, das nichts damit zu tun hat, wo alles ausgelassen ist, was zwischen heute und Ägypten liegt. Ist es zu verwundern, daß das Kind sich da nicht hineinfinden kann? Bringen Sie dagegen das Rechnen in einer menschenmöglichen Form an das Kind heran, so werden Sie sehen, daß das Kind sich da hineinfindet; auch in geometrische einfache Formen findet es sich hinein. Schon im ersten Vor-trage habe ich darauf hingedeutet, daß die Formen seelisch frei werden, und auch die Zahlen werden seelisch frei, indem wir mit dem Zahnwechsel überhaupt unser inneres System erhärten - und dadurch setzt sich seelisch ab, was dann im Rechnen und Zeichnen usw. zum Ausdruck kommt. Aber das Lesen und Schreiben ist zunächst um das 7. Jahr herum etwas der Menschennatur ganz Fremdes. Bitte ziehen Sie jetzt nicht den Schluß, daß ich behauptet hätte, man solle die Kinder nicht lesen und schreiben lehren. Ich werde die wirklichen Konsequenzen des Gesagten in den nächsten Tagen ziehen, um dann
die Fragen sich beantworten zu lassen, wie man die Kinder schreiben und lesen lehrt. Denn man erzieht die Kinder ja nicht für sich, sondern für das Leben; sie müssen schreiben und lesen lernen. Es handelt sich bloß darum, wie man sie lehren soll, damit das der Menschennatur nicht widerspricht. Aber es ist im allgemeinen recht gut, wenn man sich gerade als Lehrender und Erziehender klarmacht, wie fremd das ist, was man aus der allgemeinen sozialen Kultur an das Kind heranzubringen nötig hat. Wie fremd das der kindlichen Natur ist, das soll man wissen und sich klar vor die Seele stellen. Das ist sehr notwendig.
Natürlich wird man dadurch nicht in den Fehler verfallen dürfen, eine ästhetisierende Erziehung zu schaffen, indem man sagt: das Kind soll spielend lernen. Das ist eine der schlimmsten Redensarten, denn dadurch würde ein solcher Mensch nur zum Spieler werden im Leben. Das sagen nur Dilettanten der Pädagogik. Es handelt sich nicht darum, daß man vom Spiel dasjenige nimmt, was einem als Erwachsenem angenehm ist, sondern das, was gerade aus dem kindlichen Lebensalter beim Spiel herauskommt. Und da frage ich Sie: Ist dem Kinde das Spiel Spaß oder Ernst? Das Spiel ist dem gesunden Kinde durchaus nicht spaßhaft, sondern sehr ernst. Es fließt in wirklichem Ernst aus der menschlichen Organisation das Spiel heraus im kindlichen Alter. Treffen Sie nur diesen Ernst des Spiels für das schulpflichtige Alter, dann unterrichten Sie das Kind nicht spielend in dem Sinne, wie man es meint, sondern mit dem Ernste, den das Kind selber bei seinem Spiel hat. Es kommt überall auf die richtige Lebens-beobachtung an. Deshalb ist es ja auch zum Teil etwas bedauerlich, daß heute von allen Seiten her die Leute in dasjenige, was die feinste Lebensbeobachtung fordert, in das Erziehungs- und Unterrichtswesen, mit ihren dilettantischen Forderungen hereinkommen. Das ist sehr bedauerlich. Denn wir sind durch unsere intellektualistische Kultur endlich in ein solches Zeitalter hineingekommen, daß die Erwachsenen das Kind überhaupt nicht mehr verstehen, weil das Kind eine ganz andere Seele hat als der Erwachsene heute, der durchintellektualisiert ist. Wir müssen erst wiederum den Anschluß finden an die kindliche Natur. Und da handelt es sich darum, sich wirklich mit so
etwas zu durchdringen, daß im ersten Lebensalter des Kindes bis zum Zahnwechsel hin das ganze Verhalten des Kindes einen leiblich-religiösen Zug hat; daß dann das ganze Verhalten des Kindes vom Zahn-wechsel bis zur Geschlechtsreife ein Seelenleben hat, das aufs Bildhafte geht und das sich in bezug auf seine Bildhaftigkeit, auf ein gewisses Künstlerisch-Ästhetisches auch im Laufe dieser Lebensperiode wiederum mannigfaltig ändert.
Ist dann der Mensch bei der Geschlechtsreife angelangt, dannwird, was in der Sprache gewirkt hat, der astralische Leib in ihm frei, frei wirksam. Vorher hat er das, was hei der Sprache wirkt, zur Organisation des Leibes innerlich nötig. Dasjenige, was in der Sprache wirkt, auch in vielem anderen wirkt, in allem Formen, dem plastischen und musikalischen Formen wirkt, das wird jetzt frei. Das lernt der Mensch dann anwenden auf das Denken von der Geschlechtsreife ab; da wird er erst ein intellektualisierendes, logisches Wesen.
Und man kann ja sehen, wie dasjenige, was das Sprechen durch-zuckt und durchströmt und durchwellt, noch einen letzten Ruck in den Körper hinein macht und dann frei wird. Schauen Sie sich den Knaben an, hören Sie ihm zu, wie verwandelt in dem Alter die Sprache durch die Geschlechtsreife wird. Das ist ebenso wie das Verwandeln beinn Zahn wechsel um das 7. Jahr herum. Da ist noch der letzte Ruck, den der Astralleib hinein in den Körper macht, den also das, was inn Sprechen zuckt und wirkt, in den Körper macht, wenn der Keinlkopf aus einem anderen Sprachunterton heraus zu sprechen beginnt. Beim Weiblichen ist es entsprechend auch so, nur in anderer Weise, nicht durch den Kehlkopf; sondern durch andere Organe. Der Mensch ist dann geschlechtsreif geworden.
Dann tritt er eben in dasjenige Lebensalter ein, wo maßgebend, aus schlaggebend für ihn jetzt nicht das ist, was vom Nerven-Sinnes-System in den ganzen Körper ausstrahlt, sondern maßgebend wird jetzt für ihn das Bewegungssystem, das Willenssystemmn, das innig zusammenhängt mit dem Stoffwechselsystem. Der Stoffweclnsel lebt sich in der Bewegung aus. Und jetzt können wir auch an der Pathologie eben sehen, wie beim Erwachsenen vorzugsweise vom Stoff-wechselsystem die Krankheit ausstrahlt - sogar die Migräne ist eine
Stoflwecbselkrankheit -, wie die Krankheiten nicht vomn Kopf ausstrahlen, während beimni Kinde alles vom Kopf ausstrahlt. Es ist einerlei, Wo nian die Krankheit bekommt, wissen muß man, von wo die Krankheit ausstrahlt.
Aber im volksschulmäßigen Mter ist das rhythmische System besonders engagiert; da gleicht sich alles aus, was zwischen dem Nerven-Sinnessystem und dem Stoffwechsel-Bewegungssystem drinnen lebt: dasjenige, was durch die Bewegung wirkt, wo fortwährend Verbrennungsprozesse stattfinden, die wiederum durch den Stoffwechsel ausgeglichen werden; dann, was im Stoffwechsel allmählich sich bereitet, um in das Blut überzugehen, die Form der Blutzirkulation an-zunehmen - und wie das mit dem Atmungsprozeß, der rhythmisch ist, zusammenkommt, um dadurch erst wiederum in den NervenSinnesprozeß hineinzuwirken. Wir haben diese zwei Pole der Menschennatur das Nerven-Sinnessystem auf der einen Seite, das Stoffwechsel~Bewegungssystem auf der anderen Seite, zwischendrinnen das rhythmische System.
Und sehen Sie, auf dieses rhythmische System müssen wir besonders hinschauen, wenn wir eben im menschlichen Lebenslaufe die Zeit haben zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Da kommt das rhythmische System zum Ausdruck - und dieses rhythmische System, das ist das Gesündeste inn Menschen. Man muß es schon von außen krank machen, wenn es krank werden soll!
In dieser Beziehung gibt sich wiederum die heutige Beobachtungs-weise ganz falschen Vorstellungen hin. Denken Sie doch nur einmal, daß man heute wiederum wissenschaftlich feststellt - womit nichts gegen die Wissenschaft gesagt sein soll, es ist in einer gewissen Art ganz richtig, ich betone das immer wiederum, sonst könnten Sie ja sehr leicht sagein: da wird die Wissenschaft verhöhnt. Gar nicht soll die Wissenschaft verhöhnt werden, sie soll durchaus anerkannt werden -, also die Wissenschaft stellt fest die Ermüdungskoeffizienten. Man stellt fest, wie stark das Kind beim Turnen ermüdet, wie stark das Kind beim Rechnen ermüdet usw. Das ist ganz gut, ganz verdienstlich, wenn man das feststellt, aber man kann nicht den Unterricht darnach einrichten. Man kann nicht den Stundenplan darnach
einrichten, wie stark das Kind ermüdet, denn man hat eine ganz an dere Aufgabe: man soll nämlich wirken auf dasjenige System, das überhaupt im ganzen Leben nicht ermüdet. Ermüden kann eigentlich nur das Stoffwechsel-Bewegungssystem. Das ermüdet, und das überträgt seine Ermüdung auf die anderen Systeme. Aber kann denn das rhythmische System ermüden? Nein, es kann nicht ermüden, denn wenn das Herz nicht das ganze Leben hindurch schlüge, unermüdet, ohne jede Ermüdung, wenn der Atem nicht das ganze Leben hindurch ginge, unermüdet, ohne jede Ermüdung, so könnten wir nicht leben. Das rhythmische System ermüdet nicht.
Ermüden wir unsere Schüler durch irgend etwas zu stark, so beweist das nur, daß wir uns im richtigen Lebensalter, zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr, zuwenig an das rhythmische System, das ganz im Bildhaften wiederum lebt und Ausdruck des Bildhaften ist, wenden. Wenn Sie den Rechenunterricht, den Schreibunterricht nicht bildhaft gestalten, so ermüden Sie die Kinder. Wenn Sie imstande sind, durch innerliche Frische im Momente entstehen zu lassen das Bildhafte im Kinde, dann ermüden Sie das Kind eben gerade nicht. Es ermüdet dann nur durch dasjenige, was im Bewegungssystem liegt, durch die Art und Weise, wie der Stuhl drückt, auf dem es sitzt, ob eine Schreibfeder ungeschickt eingerichtet ist, mit der es schreibt, usw. Es handelt sich nicht darum, wie wir eine psychologische Pädagogik vorangehen lassen, um zu wissen, wie lange das Kind rechnen darf, damit es nicht zu stark ermüdet, sondern es handelt sich darum, wie wir richtig die verschiedenen Schulgegenstände an das rhythmische System heranbringen; wie wir aus der Erkenntnis des Menschenwesens heraus dasjenige, was wir an das Kind heranbringen sollen, eben wirklich heranbringen.
Und dazu müssen wir eben wissen, wie der Mensch eigentlich für das intellektualistische Leben, für das eigentliche Verstehen, mit der Geschlechtsreife erst erwacht, wie es ein persönlich vorbildhaftes Wirken sein muß, was eintreten muß zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, was der Lehrende, der Erziehende für seine Jugend entwickelt. Daher ist diejenige Pädagogik, die aus wirklicher Menschenerkenntnis hervorgeht, so stark eine Gesinnungspädagogik,
eine Pädagogik, die auf die Gesinnung des Lehrers vor allen Dingen wirken soll. Etwas extrem ausgesprochen möchte man sagen: die Kinder sind ja schon recht, aber die Erwachsenen sind nur so wenig recht! Wir brauchen tatsächlich das, was ich schon am Schluß des ersten Vortrages gesagt habe: wir brauchen gar nicht ein Herumreden, wie wir die Kinder behandeln sollen, sondern wir brauchen vor allen Dingen eine Erkenntnis, wie wir uns selber verhalten sollen als Lehrender und Erziehender. Wir brauchen Herz. Aber nicht bloß so, daß wir sagen: wir sollen nicht den Verstand, sondern das Herz des Kindes behandeln, pädagogisch und didaktisch, sondern wir brauchen eben - das möchte ich noch einmal betonen -, wir brauchen Herz für die Pädagogik selber.
VIERTER VORTRAG Dornach, 18. April 1923
In den vorangehenden Betrachtungen habe ich versucht, hineinzuführen in dasjenige, was hier Menschenerkenntnis genannt wird. Einiges von dem, was noch fehlt, wird sich ja im Laufe der Betrachtungen noch ergeben. Und ich habe gesagt, daß diese Menschenerkenntnis eine solche ist, die nicht zur Theorie bloß führt, sondern die Instinkt des Menschen, allerdings durchseelter, durchgeistigter Instinkt des Menschen werden kann, so daß das in der Tat dann hineinführt auch in die lebendige Erziehungs- und Unterrichtspraxis. Man muß natUrlich berücksichtigen, daß ja in Vorträgen gewissermaßen nur in einer Art von Gesten auf dasjenige hingedeutet werden kann, was dann diese Menschenerkenntnis für Unterrichts- und Erziehungspraxis wird. Aber es muß deshalb, weil diese Dinge gerade auf die Praxis abzielen, hier viel mehr in einer Art andeutender Weise gesprochen werden, als das heute sonst beliebt ist. Wenigstens ist man sich ja heute nicht bewußt, wie sehr dasjenige, was man in Worten schildern kann, überhaupt nur eine Art Andeutung bleibt, eine Art von Hinweis auf das, was dann im Leben viel vielseitiger ist, als man es in Worten andeuten kann.
Wenn wir beachten, wie das Kind im wesentlichen ein nachahmendes Wesel] ist, wie das Kind gewissermaßen ein seelisches Sinnesorgan ist, das an seine Umgebung in einer leiblich-religiösen Weise hingegeben ist, so wird man für diesen Lebensabschnitt, also bis zum Zahnwechsel hin, im wesentlichen darauf zu sehen haben, daß alles in der Umgebung des Kindes wirklich so wirkt, daß das Kind es sinngemäß aufnehmen und in sich verarbeiten kann. Es wird daher vor allen Dingen auch darauf gesehen werden müssen, daß das Kind mit dem, was es sinngemäß aus seiner Umgebung sich aneignet, immer das Moralische seelisch-geistig sich mit aneignet; so daß wir bei dem Kinde, das an das Lebensalter des Zahnwechsels herantritt, eigentlich schon in bezug auf die wichtigsten Impulse des Lebens alles wie vorbereitet haben.
Wenn man also das Kind ungefähr in der Zeit des Zahnwechsels in die Schule hereinbringt, dann hat man nicht etwa ein leeres, sondern ein vielbeschriebenes Blatt vor sich. Und wir werden ja gerade bei dieser mehr pädagogisch-idakti schen Betrachtung, die wir jetzt werden anzustellen haben, darauf zu sehen haben, wie nicht etwas Ursprüngliches in das Kind hereingebracht werden kann in der Zeit zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, sondern wie man überall die Impulse, die in den ersten sieben Lebensjahren in das Kind hereingebracht worden sind, wird erkennen müssen, und wie man ihnen diejenige Richtung wird geben müssen, welche das spätere Leben dann von dem Menschen verlangt. Deshalb wird es so stark darauf ankommen, daß gerade der Lehrende und Erziehende in einer feinsinnigen Weise hinzuschauen vermag auf alle Lebensregungen der Kinder. Denn in diesen Lebensregungen steckt schon sehr viel, wenn er die Kinder in die Schule bekommt. Und er muß dann diese Lebensregungen leiten und lenken; er muß sich nicht einfach vorsetzen: das ist richtig, das ist falsch, das sollst du tun, jenes sollst du tun; sondern er ist darauf angewiesen, die Kinder zu erkennen und ihre Lebensregungen weiterzuführen.
Natürlich entsteht jetzt jene Frage, die wir in der Waldorfschule nicht praktisch in der Weise haben erproben können wie das, was für das kindliche Alter vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife zu tun ist. Die erste Zeit bis zum Zahnwechsel hin, von der Geburt ab, ist ja gewiß die allerwichtigste Erziehungsarbeit; allein da wir schon die allergrößte Schwierigkeit haben, Einrichtungen zu schaffen, welche für die Kinder taugen, nachdem sie das schulpflichtige Alter erreicht haben, können wir jetzt an einen Kindergarten noch nicht einmal denken - da wir jedes Jahr an die unteren Klassen eine neue Klasse für die älteren Kinder anzubauen haben; wir haben mit einem AchtklassenSchulunterricbt in der Waldorfschule begonnen - wir können nicht einmal daran denken, so etwas wie einen Kindergarten oder dergleichen als Vorbereitungsstufe für die Volksschule zu errichten. Diejenigen Menschen, die über solche Dinge oberflächlich denken, sind ja allerdings der Meinung, man brauche einen solchen Kindergarten nur zu errichten, dann könne es losgehen. So ist die Sache aber nicht. Was
dazu notwendig ist, das ist eine außerordentlich ausführliche Gestaltung bis in alle Einzelheiten nun auch der Pädagogik und Didaktik für den Kindergarten. Und dem sich zu widmen ist gar nicht möglich, solange jedes Jahr eine neue Klasse an die Waldorfschule anzustükkeIn ist.
Der Ernst, der heute mit sogenannten Reformbewegungen verknüpft ist, der wird nur leider von den allerwenigsten Menschen in der richtigen Weise aufgefaßt. Denn die Reformbewegungen der Laien bestehen ja hauptsächlich darin, daß sie Forderungen aufstellen, Forderungen, die man ja sehr leicht aufstellen kann ; es gibt nichts Leichteres heute, wo ja alle Menschen gescheit sind - ich meine das durchaus nicht ironisch, sondern im Ernst-, als Forderungen auf-zustellen. Ja, eine tadellose Schulreform als Programm aufzustellen, dazu ist heute nur nötig, daß sich innerhalb unserer Zivilisation, die ja von Gescheitheit nur so strotzt, elf, zwölf Menschen finden, auch drei oder vier würden schon gescheit genug sein, die dann die Forderungen aufstellen, was zu geschehen hat: erstens, zweitens, drittens usw. Da wird etwas außerordentlich Gescheites herauskommen, ich zweifle nicht daran. Die abstrakten Programme, die überall aufge-stellt werden, sind außerordentlich gescheit. Man kann nämlich heute, weil die Menschen so intellektualistisch sind, sehr Gutes auf diese Weise - abstrakt äußerlich Gutes meine ich - in außerordentlicher Art zustande bringen. Aber für den, der die Dinge vom Leben aus beurteilt und nicht vom Standpunkte des intellektualistischen Denkens, nimmt sich das alles so aus, als wenn irgendwie Menschen nachdenken darüber, was ein ordentlicher Ofen in einem Zimmer zu leisten hat. Da werden sie natürlich eine ganze Reihe von kategorischen Imperativen anführen können, die der Ofen zu leisten hat: er muß das Zimmer warm machen, er darf nicht rauchig sein usw. Die Paragraphen 1, 2 und 3 können sehr schön sein, aber wenn man nun das alles weiß: der Ofen soll warm sein, der Ofen soll nicht rauchen usw., so kann man doch noch nicht das Einheizen eines Ofens handhaben ; da muß man andere Dinge dazu lernen. Und je nach Lage des Zimmers und nach Lage vielleicht noch anderer Dinge wird es sich gar nicht möglich machen, in tadelloser Weise alle diese Forderungen zu erfüllen,
die sehr gescheit aufgestellt werden können. Und so sind zumeist die Programme, die heute von den Reformbewegungen ausgehen ; ungefähr so abstrakt sind sie wie das, was ich über den Ofen gesagt habe. Deshalb sind sie durchaus nicht zu bekämpfen, sie enthalten zweifellos viel Richtiges, aber, etwas anderes als ideal richtige Schulforderungen ist die Praxis einer wirklichen Schule. Da hat man es nicht zu tun mit etwas, was sein soll, sondern da hat man es zu tun mit einer bestimmten Anzahl von Kindern ; da hat man es zu tun mit einer bestimmten Anzahl von - gestatten Sie mir, daß ich auch das erwähne, denn es kommt in Betracht - mit einer bestimmten Anzahl von so und so begabten Lehrern. Mit alledem muß gerechnet werden. Im Abstrakten kann ein Reformprogramm aufgestellt werden ; im Konkreten hat man nur eine Anzahl von bestimmt begabten Lehrern, für die sich vielleicht gar nicht die Möglichkeit ergibt, diese abstrakten Forderungen unbedingt zu erfüllen.
Diesen durchgreifenden Unterschied zwischen dem Leben und zwischen dem Intellektualismus, den begreift unsere Gegenwart aus einem ganz bestimmten Grunde nicht. Sie begreift ihn deshalb nicht, weil unsere Gegenwart tatsächlich sich daran gewöhnt hat, das Intellektualistische gar nicht mehr zu spüren, und es am wenigsten dort zu spüren, wo es sich am allerintensivsten geltend macht. Derjenige, der wirklich heute weiß, wie groß der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, der findet die schauderhaftesten, unpraktischsten Theorien im heutigen Geschäftsleben. Die heutige Struktur des Geschäftslebens ist in Wirklichkeit so theoretisch wie möglich eingerichtet. Nur greifen die Leute, die im Geschäftsleben drinnenstehen, mit robusten Händen zu ; sie machen sich die Ellenbogen frei und setzen nur ihre tbec» retischen Dinge mit Brutalität oftmals durch. Da geht es dann eben so lange, bis das Geschäft zugrunde geht. Da kann man intellektualistisch sein. Aber da, wo das Leben anfängt wirkliches Leben zu sein, wo einem etwas entgegengebracht wird wie in der Schule, dem gegenüber man nicht einfach zugreifen kann, sondern bei dem man gegebene Impulse hat, die weiterentwickelt werden müssen, da helfen einem die aller-schönsten Theorien nichts, wenn nicht aus wirklich individuellster Menschenerkenntnis heraus praktisch geschaffen werden kann. Daher
sind solche Köpfe, die so angefüllt sind mit allem möglichen theoretischen pädagogi schen Wissen, wirklich am allerwenigsten für den praktischen Schulunterricht tauglich. Viel tauglicher sind da eigentlich noch die Instinktmenschen, die aus sich heraus, aus einer natürlichen Liebe heraus die Kinder erkennen können. Aber heute sind eben die Instinkte nicht mehr so sicher, daß man, ohne eine Leitung dieser Instinkte aus dem Geiste heraus gelten zu lassen, mit diesen Instinkten sehr weit kommt. Das Menschenleben ist heute kompliziert geworden, und das Instinktleben verlangt ein einfaches Menschenleben, ein Menschenleben, das fast hinunterreicht zur Einfachheit des tierischen Lebens. Das muß alles berücksichtigt werden, dann erst wird man in der richtigen Weise auf das hin sehen können, was hier als wirklich praktisch gemeinte Pädagogik und Didaktik angeschlagen wird.
Es ist ja in dieser Beziehung das Erziehungswesen mitgegangen mit dem allmählichen Hereintreten des Materialismus in unsere moderne Zivilisation. Das zeigt sich ja insbesondere dadurch, daß man gerade für das Alter bis zum Zahnwechsel hin, das eigentlich das allerwichtigste im Menschenleben ist, vielfach mechanische Methoden statt organischer Methoden eingeführt hat. Aber man muß sich klarmachen: das Kind ist bis zum Zahnwechsel darauf angelegt, nachzuahmen. Dasjenige, was der spätere Ernst des Lebens fordert und der spätere Ernst des Lebens in Arbeit hineinverwebt, das wird beim Kinde, wie ich schon gestern erwähnte, als Spiel betätigt, aber als Spiel, das zunächst dem Kinde voller Ernst ist. Und der Unterschied zwischen dem Spiel des Kindes und der Arbeit des Lebens besteht lediglich darin, daß bei der Arbeit des Lebens zunächst das Einfügen in die äußere Zweckmäßigkeit der Welt in Betracht kommt, daß wir da hingegeben sein müssen an die äußere Zweckmäßigkeit der Welt. Und das Kind will dasjenige, was es in Betätigung umsetzt, aus seiner eigenen Natur heraus entwickeln, aus seinem Menschenleben heraus entwickeln. Das Spiel wirkt von innen nach außen ; die Arbeit wirkt von außen nach innen. Darin besteht ja gerade die ungeheuer bedeutungsvolle Aufgabe der Volksschule, daß das Spiel allmählich in Arbeit übergeführt wird. Und kann man praktisch die große Frage beantworten: Wie wird das Spielen in Arbeiten umgewandelt? dann
beantwortet man eigentlich die Grundfrage der Volksschulerziehung.
Aber das Kind spielt im Nachahmen und will spielen im Nachahmen. Weil man sich nicht hineingefunden hat durch eine wirkliche, wahre Menschenerkenntnis in das kindliche Lebensalter, hat man aus den intellektualistischen Überlegungen der Erwachsenen heraus allerlei Spielartiges für die Kinder im Kindergarten ersonnen, das aber von den Erwachsenen eigentlich ausgedacht ist. Während die Kinder nachahmen wollen die Arbeit der Erwachsenen, erfindet man vielfach durch Stäbehenlegen, oder wie dergleichen Dinge heißen, besondere Dinge, für die Kinder, die sie dann vollführen sollen und wodurch sie ganz abgebracht werden von demjenigen, was lebendig aus ihnen herausfließt, und was die Arbeit der Erwachsenen eben nur nachahmen will. Sie werden daraus herausgeführt und werden durch allerlei mechanisch Ausgedachtes in Tätigkeitsfelder hineingebracht, die nicht für das kindliche Lebensalter sind. Besonders das 19.Jahr-hundert war sehr beziehungsreich im Ausdenken von allen möglichen Kinderarbeiten für den Kindergarten, die man eigentlich nicht ausführen lassen sollte. Denn im Kindergarten kann es eigentlich nur darauf ankommen, daß das Kind sich anpaßt den paar Leuten, die den Kindergarten leiten, daß diese paar Leute naturgemäß sich benehmen, und daß das Kind die Anregungen empfängt, das nachzuahmen, was diese paar Leute tun - daß man nicht extra von dem einen zum anderen Kinde geht und ihm vormacht: das oder jenes soll es tun. Denn das will es noch nicht befolgen, wovon man ihm sagt: Das sollst du tun. Es will nachahmen, was der Erwachsene tut. So ist es eben die Aufgabe für den Kindergarten, dasjenige, was die Arbeiten des Lebens sind, in solche Formen hineinzubringen, daß sie aus der Betätigung des Kindes ins Spiel fließen können. Man hat das Leben, die Arbeiten des Lebens hineinzuleiten in die Arbeiten des Kindergartens. Man hat nicht auszudenken Dinge, die eigentlich im Leben nur ausnahmsweise mal vorkommen und die eigentlich richtig nur angeeignet werden, wenn man sie dann im späteren Leben zu dem, was man in normaler Weise sich angeeignet hat, hinzulernen muß. So zum Beispiel kann man sehen, wie die Kinder dazu angehalten werden,
in Papierblätter Schnitte hineinzumachen, dann allerlei rotes und blaues und gel bes Zeug da hindurchzustecken, so daß da drinnen aus buntem Papier Gewobenes entsteht. Was man damit erreicht, ist, daß man das Kind durch eine mechanisierende Tätigkeit abhält davon, in die normale Lebenstätigkeit hineinzukommen. Denn was man da mit den Fingern unmittelbar machen soll, das macht die normale Tätigkeit, indem man irgendeine Näh- oder Stickarbeit in primitiver Weise ausführen läßt. Die Dinge, die vom Kinde ausgeführt werden, müssen unmittelbar aus dem Leben genommen werden ; sie dürfen nicht ersonnen werden von der intellektualistischen Kultur der Erwachsenen. Worauf es beim Kindergarten gerade ankommt, das ist, daß das Kind nachahmen muß das Leben.
Diese Arbeit, das Leben so zu gestalten, daß man vor dem Kinde dasjenige in richtiger Weise ausführt, was im Leben den Zwecken angepaßt ist, was beim Kinde angepaßt ist dem Hervorgehen aus dem Betätigtseinwollen des eigenen Organismus, das ist eine große Arbeit, eine ungeheuer bedeutungsvolle pädagogische Arbeit. Die Arbeit, Stäbehenlegen auszudenken oder solche Papierflechtarbeiten zu machen, die ist leicht zu machen. Aber die Arbeit, unser kompliziertes Leben nun wirklich so zu gestalten, wie das Kind es schon selber macht, indem der Knabe mit irgendwelchen Spaten oder dergleichen spielt und das Mädchen mit der Puppe spielt - richtig die menschliche Betätigung ins kindliche Spiel umsetzen, und dies auch für die komplizierteren Betätigungen des Lebens zu finden: das ist es, was geleistet werden muß, und das ist eine lange Arbeit, für die heute noch fast gar keine Vorarbeiten da sind. Denn man muß sich klar sein darüber, daß in diesem Nachahmen, in dieser sinngemäßen Betätigung des Kindes, das Moralische und Geistige mit drinnensteckt, und die künstlerische Anschauung mit drinnensteckt, aber ganz subjektiv, ganz im Kinde. Geben Sie dem Kinde ein Taschentuch oder einen Lappen, und knüpfen Sie diesen so, daß er oben einen Kopf hat, unten ein Paar Beine, dann haben Sie ihm einen Bajazzo oder eine Puppe gemacht. Sie können dann noch mit Tintenklecksen Augen und Nase und Mund daranmachen, oder besser das Kind selber machen lassen, und Sie werden sehen: ein gesundes Kind hat mit dieser
Puppe seine große Freude. Denn dann kann es das, was sonst an der Puppe dran sein soll, ergänzen durch bildhaft nachahmende Seelen-tätigkeit. Es ist viel besser, wenn Sie aus einem Leinwandfetzen einem Kind eine Puppe machen, als wenn Sie ihm eine schöne Puppe geben, die womöglich noch mit der unmöglichsten Farbe die Backen angestrichen hat, die schön angezogen ist, die sogar, wenn man sie niederlegt, die Augen zumachen kann und dergleichen. Was tun Sie denn, wenn Sie dem Kind eine solche Puppe geben? Sie verhindern es, seine Seelentätigkeit zu entfalten ; denn es muß seine Seelentätig-keit, diese wunderbar zarte, erwachende Phantasie, überall absperren, um ganz Bestimmtes, Schön-Geformtes ins Auge zu fassen. Sie trennen das Kind ganz von dem Leben, weil Sie seine Eigentätigkeit zurückhalten. Das ist dasjenige, was insbesondere für das Kind bis zum Zahnwechsel in Betracht kommt.
Und wenn das Kind dann in die Schule hineinkommt, dann tritt einem eben das entgegen, daß das Kind am meisten Opposition hat gegen Lesen und Schreiben, wie ich es gestern gesagt habe. Denn nicht wahr, da ist ein Mann: er hat schwarze oder blonde Haare, er hat eine Stirne, Nase, Augen, hat Beine ; er geht, greift, sagt etwas, er hat diese oder jene Gedankenkreise - das ist der Vater. Nun soll das Kind aber das Zeichen da - VATER - für den Vater halten. Es ist gar keine Veranlassung, daß das Kind das für den Vater hält. Nicht die geringste Veranlassung ist dazu da. Das Kind bringt Bildekräfte mit, die aus seinem Organismus herauswollen, mit denen es sich gebracht hat innerlich bis zur wunderbaren Formung des Gehirnes und dessen, was im Nervensystem sonst sich daranschließt ; mit denen es sich gebracht hat bis zu jener wunderbaren Ausbildung der zweiten Zähne. Der Mensch sollte bescheiden werden und sollte sich fragen, was er da alles verstehen müßte, wenn er nur auf Grundlage der ersten Zähne die zweiten Zähne aus seiner Kunst heraus bilden sollte ; was da für unbewußte Weisheit in alledem waltet! An diese unbewußte Weisheit in den Bildekräften war das Kind hingegeben. Das Kind lebt in Raum und Zeit - nun soll man das Kind zu Bedeutungen führen, wie sie im Lesen und Schreiben zutage treten. Man muß nicht das Kind einfach hinführen zu dem, was die vorgerückte Kultur in dieser
Beziehung ausgebildet hat, man muß das Kind hinführen zu dem, was es selber aus seiner Wesenheit heraus will. Man muß es so an das Lesen und Schreiben heranführen, daß seine Bildekräfte, die bis zum 7. Jahr in ihm selbst gearbeitet haben, die sich jetzt freimachen und äußerliche seelische Betätigung werden, daß diese Bildekräfte eben sich betätigen.
Wenn Sie einem Kinde zunächst nicht Buchstaben oder selbst Worte hinschreiben, sondern ihm aus den auch in seiner Seele existierenden Bildekräften heraus dasjenige hinzeichnen, was hier so aussieht,
#Bild s. 80a
dann werden Sie sehen, daß das Kind sich noch erinnert an etwas, was wirklich da ist, was es mit seinen Bildekräften schon erfaßt hat. Das Kind wird Ihnen sagen: Das ist ein Mund! Und jetzt können Sie das Kind nach und nach dazu führen, daß Sie ihm sagen: Nun sprich einmal Mmmund ; laß das letzte weg. Sie führen das Kind dazu, nach und nach zu sagen mmm... Und jetzt sagen Sie ihm: Nun wollen wir einmal dasjenige aufmalen, was du da gemacht hast. Wir haben was weggelassen:
#Bild s. 80b
haben wir gemalt. Und nun machen wir es einfacher:
#Bild s. 80c
Es ist ein M draus geworden.
Oder wir zeichnen dem Kinde so etwas auf (es wird gezeichnet>. Das Kind wird sagen: Fisch... Man wird dazu übergehen, F zu sagen.
Machen wir das nun einfacher, diesen Fisch! Dann wird ein F daraus. Wir kriegen die abstrakten sogenannten Buchstaben überall aus den Bildern heraus.
#Bild s. 81
Da ist es nicht nötig, daß wir nun immer historisch zurückgeben, wie aus der Bilderschrift wirklich in solcher Weise unsere heutige Schrift entstanden ist. Das ist gar nicht nötig, wir brauchen nicht kulturhistorische Pädagogik zu treiben. Wir brauchen nur selber uns hineinzufinden, etwas durch die Phantasie beflügelt, dann werden wir in allen Sprachen die Möglichkeit finden, von charakteristischenWorten auszugehen, die wir ins Bild verwandeln können und aus denen heraus wir dann erst die Buchstaben gewinnen. So wenden wir uns an dasjenige, was das Kind will gerade im Zahnwechselalter und unmittelbar darnach. Und schon daraus ergibt sich für Sie, daß man zuerst aus dem zeichnenden Malen und dem malenden Zeichnen - denn für das Kind ist es gut, wenn es gleich Farben verwendet, es lebt ja in der Farbe, das weiß jeder, der das Kind kennt -, wenn man aus dem malenden Zeichnen zum Schreiben übergeht und erst aus dem Schreiben das Lesen gewinnt. Denn das Schreiben ist eine Betätigung des ganzen Menschen. Da muß die Hand in Betracht kommen, da muß sich der ganze Leib in irgendeiner Weise, wenn auch fein, einfügen, da ist der ganze Mensch daran beteiligt. Das hat noch etwas Konkretes, das Schreiben, das aus dem malenden Zeichnen herausgeholt wird. Das Lesen, nun, da sitzt man schon dabei, da ist man schon ein richtiger Duckmäuser, da strengt sich nur noch ein Teil des Menschen an, der Kopf. Das Lesen ist schon abstrakt geworden. Das muß nach und nach als eine Teilerscheinung aus dem Ganzen heraus entwickelt werden.
Bei diesen Dingen ist es heute außerordentlich schwer, im rein Naturgemäßen standzuhalten gegen die Vorurteile der Gegenwart.
Denn wenn man anfängt, in einer solch ganz naturgemäßen Weise die Kinder zu unterrichten, dann lernen sie etwas später lesen, als man es heute verlangt. Wenn dann die Kinder von einer solchen Schule übertreten in eine andere Schule, dann können sie noch nicht soviel wie die Kinder der anderen Schule. Ja, aber es kommt doch gar nicht darauf an, was man sich aus dem materialistischen Kulturzeitalter für eine Vorstellung darüber gebildet hat, was das Kind mit acht Jahren können soll. Sondern es kommt darauf an, daß es vielleicht gar nicht gut ist für das Kind, wenn es zu früh lesen lernt. Denn da sperrt man auch wiederum für das spätere Leben etwas zu, wenn das Kind zu früh lesen lernt. Lernt das Kind zu früh lesen, dann führt man es zu früh in die Abstraktheit hinein. Und Sie würden unzählige spätere Sklerotiker beglücken für ihr Leben, wenn Sie ihnen nicht zu früh das Lesen bei brächten als Kinder. Denn diese Verhärtung des ganzen Organismus - ich nenne es populär so -, die in der mannigfaltigsten Form der Sklerose später auftritt, die kann man zurückverfolgen zu einer falschen Art, das Lesen beizubringen. Natürlich kommen diese Dinge auch noch von vielen anderen Sachen, aber darum handelt es sich, daß es diese Dinge durchaus gibt, daß ein naturgemäßer Unterricht vom Seelisch-Geistigen aus überall hygienisch auf den Leib wirkt. Erfassen Sie, wie Sie den Unterricht und die Erziehung gestalten sollen, so erfassen Sie zu gleicher Zeit, wie Sie dem Kinde die beste Gesundheit fürs Leben geben. Und Sie können ganz sicher sein: würden gesündere Methoden im heutigen Schulwesen herrschen, dann würde gar mancher vom männlichen Geschlecht nicht so früh mit einem Glatzkopf herumgehen, wie das sehr häufig der Fall ist!
Diese Dinge, die eben darauf beruhen, daß man das Seelisch-Geistige überall fortwirken sieht im Leiblich-Physischen, werden eben gerade vom materialistischen Standpunkte aus viel zu wenig berücksichtigt. Und ich .möchte es immer wieder betonen: die Tragik des Materialismus besteht darin, daß er von den materiellen Vorgängen gar nichts mehr weiß, sondern sie nur ganz von außen betrachtet ; daß er gar nicht mehr weiß, wie ein Moralisches übergeht in ein Phy-sisches. Man gewöhnt sich ja heute schon durch die Art und Weise, wie der Mensch behandelt - man könnte fast sagen mißhandelt - wird
von der Wissenschaft, eine ganz falsche Vorstellung an. Denken Sie sich doch nur einmal: Wenn Sie heute Physiologie- oder Anatomiebücher aufschlagen, dann haben Sie gewisse Zeichnungen: das Kncchensystem wird aufgezeichnet, das Nervensystem wird aufgezeichnet, das Blutzirkulationssystem wird aufgezeichnet. Ganz suggestiv wirkt das ; man bekommt die Vorstellung, als ob der Mensch wirklich wiedergegeben wäre, wenn man das alles so aufzeichnet. Hier ist ja gar nicht das wiedergegeben, was der Mensch physisch4eiblich ist. Das ist ja h&hstens 10 Prozent davon, denn 90 Prozent vom Menschen ist ja eine Flüssigkeitssäule. Er besteht ja zu 90 Prozent aus Flüssigkeit, die in ihm fortwährend fluktuiert, die man gar nicht so mit festen Konturen zeichnen kann. Nun, Sie werden sagen: die Physiologen wissen das! Gewiß, aber es bleibt in der Physiologie, es geht nicht über in die Lebenspraxis, weil schon die Zeichnungen suggestiv nach einer anderen Seite leiten. Aber wessen man sich noch weniger bewußt wird, das ist, daß wir ja nicht bloß - zum kleinsten Teil - ein fester Mensch sind, zum größten Teil ein Flüssigkeits-mensch sind, sondern daß wir auch in jedem Momente ein Luftmensch sind. Die Luft draußen ist im nächsten Moment in uns drinnen, die Luft in uns ist im nächsten Moment draußen. Ich bin ein Teil der ganzen Luftumgebung. Das ist fortwährend fluktuierend in mir. Und erst die Wärmezustände! In Wirklichkeit müssen wir den Menschen unterscheiden in den festen Menschen, den Flüssigkeitsmenschen, den Luftmenschen, den Wärmemenschen - das kann noch weitergehen, aber darauf wollen wir uns zunächst beschränken.
Daß man über diese Dinge ganz unsinnige, falsche Ansichten hat, das zeigt sich an dem Folgenden. Wenn das wirklich so wäre, wie es aufgezeichnet wird als Knochensystem, Nervensystem usw., wo einfach alles in eine solche Zeichnung verwandelt wird, daß man immerfort versucht ist, den Menschen als bloßen festen Organismus vorzustellen - wenn das alles so wäre, wäre es kein Wunder, daß das moralische, das seelische Leben in diese festen Knochen, in diese starre Blutzirkulation nicht hineingehen kann: es hat gar nichts damit zu tun. Fangen Sie aber an, den Menschen wirklich jetzt auch als Flüssigkeitsmenschen, als Luftmenschen, zuletzt als Wärmemenschen vorzustellen,
dann haben Sie ein feines Agens, eine feine Entität - zum Beispiel in den Wärmezuständen -, und dann werden Sie darauf kommen, wie in den physischen Wärmeverlauf allerdings die moralische Konstitution des Menschen hinein verlaufen kann. Wenn Sie die Wirklichkeit vorstellen, dann kommen Sie zu jener Einheit des Physischen und Moralischen. Und die muß man dann vor sich haben, wenn man den Menschen in seiner Entwickelung behandeln will -die muß man durchaus vor sich haben.
Also es kommt tatsächlich darauf an, daß wir auf den Menschen hinzuschauen vermögen, daß wir aus einem ganz anderen physiologisch-psychologischen Untergrund heraus den Weg zu dem Menschen finden, und dann ergibt sich, wie man diesen Menschen zu behandeln hat. Sonst entwickelt er die innere Opposition gegen dasjenige, was er eigentlich lernen soll, während angestrebt werden muß, daß er selbst hineinwächst in dasjenige, was er lernen soll. Und indem er hineinwächst, beginnt er selbstverständlich auch das, was er lernen soll, liebzuhaben. Er kann es aber nur dadurch liebgewinnen, (laß er aus seinen eigenen Wesenskräften in die Sache hineinwächst.
Am meisten schaden - und zwar gerade diesem Lebensalter gegenüber so vom 7., 8., 9. Jahr - am meisten schaden die einseitigen Illusionen, diese fixen Ideen, die man sich macht: das oder jenes soll so oder so geschehen. Man ist zum Beispiel so ungeheuer stolz darauf, daß so im Laufe des 19. Jahrhunderts, aber schon im 18.Jahrhun-dert vorbereitet, die alte Buchstabiermethode übergegangen ist in die Lautiermethode und dann in die Normalwörtermethode beim Lesenlernen. Und weil sich die Leute heute schämen, das Alte irgend-wie noch zu respektieren, so wird man ja heute kaum noch einen Menschen finden, der schwärmen würde für die alte Buchstabiermethode. Er wäre ein dummer Kerl nach Ansicht der Gegenwart, das gibt esja nicht - also darf er nicht mehr schwärmen für die alteBuchstabiermethode. Die Lautiermethode, aber auch die Normalwörter-methode werden angewendet. Man ist sehr stolz auf die Lautiermethode, wo dem Kinde der Lautcharakter beigebracht wird. Das Kind lernt nicht: das ist ein P oder das ist ein N oder das ist ein R, sondern es lernt alles auszusprechen, so wie es im Worte drinnen lautet. Nun
ja, das ist ganz gut. Die Normaiwörtermethode ist auch gut, wo man manchmal von ganzen Sätzen ausgeht, wo man dem Kinde den Satz bildet, dann erst analysierend zu dem Worte und dem einzelnen Laut geht. Aber schlimm ist es, wenn diese Dinge schrullenhaft werden. Die Gründe für alle drei Methoden, sogar für die alte Buchstabiermethode, die Gründe sind alle gut, sind alle geistreich - es läßt sich nicht leugnen, daß die Dinge al]e geistreich sind. Aber woherkommt es, daß sie geistre ich sind? Das kommt von dem Folgenden. Denken Sie, Sie haben einen Menschen nach der Photographie gekannt und immer en face gesehen. Da haben Sie halt so irgendeine Vorstellung von dem Menschen. Jetzt kriegen Sie einmal ein Bild in die Hand, und es sagt einer: Das ist das Bild von dem Menschen. - Das Bild ist nun ein Profilbild. Sie werden sagen: Aber nein, das ist doch ein ganz falsches Bild! der Mensch schaut ja ganz anders aus: hier das Bild en face, das ist das richtige Bild, das andere ist ganz falsch. - Es ist das Bild desselben Menschen in diesem Falle, aber es ist von der anderen Seite aufgenommen. Und so ist es im Leben immer - die Dinge im Leben müssen überall von den verschiedensten Seiten betrachtet werden. Man kann sich ja zwar in irgendeinen einseitigen Standpunkt verlieben, weil er sehr geistreich sein kann, man kann seine guten Gründe haben, man kann die Buchstabiermethode, die Lautiermethode, die Normalwörtermethode verteidigen, und der Gegner wird einen nicht widerlegen können, weil man ja nur an seine eigenen Gründe selbstverständlich glaubt. Das ist gut möglich, daß die besten Gründe vorgebracht werden, aber: es sind Einseitigkeiten. In der Lebenspraxis müssen die Dinge eben immer von den verschiedensten Seiten angegriffen werden.
Wenn man schon einmal aus dem malenden Zeichnen, dem zeichnenden Malen heraus die Formen gewonnen hat, und wenn man dann übergegangen ist dazu, daß man allerdings jetzt ganz gut tut, eine Art Lautier- oder Wörtermethode zu pflegen, damit man das Kind nicht so sehr sich an die Einzelheiten verlieren läßt, sondern es hin-lenkt zum Ganzen, so ist doch wiederum dem materialistischen Zeitalter eines abhanden gekommen, und das ist das Folgende: der Laut als solcher, das einzelne M, das einzelne P, das ist eben auch etwas.
Und es kommt darauf an, daß, wenn der Laut im Wort drinnen ist, er schon den Weg nach der Außenwelt genommen hat, da ist er schon übergegangen in die materiell-physische Welt. Das, was wir in der Seele haben, sind nämlich die Laute als solche, und das hängt sehr stark ab von der Art und Weise, wie unsere Seele beschaffen ist. Indem wir buchstabieren, sprechen wir, wenn wir das M ausdrücken wollen, eigentlich EM. Der Grieche tat das nicht, der Grieche sprach MY. Das heißt: er setzte den Hilfsvokal nach dem Konsonanten, wir setzen ihn vorher. Wir bekommen den Laut heute in Mitteleuropa, indem wir vom Vokalischen zum Konsonantischen den Weg nehmen. Denselben Laut bekam man in Griechenland, indem man den umgekehrten Weg ging. Das weist hin auf die Seelenverfassung, die da zugrunde liegt.
Das ist außerordentlich wichtig und bedeutsam. Denn derjenige, der nun nicht bloß auf das Äußerliche der Sprache schaut, wie nun die Sprache schon einmal geworden ist als Bedeutungssprache - unsere Sprachen sind ja fast alle Bedeutungssprachen, wir haben in den Worten kaum mehr etwas anderes als Zeichen für das, was draußen ist -, derjenige, der von da zurückgeht auf das Seelische, das in den Worten lebt, das überhaupt in der Sprache lebt, der kommt schon zurück zu dem sogenannten Laut. Denn alles Konsonantische hat einen ganz anderen Charakter als alles Vokalische. - Sie wissen: In bezug auf die Entstehung der Sprache gibt esja die mannigfaltigsten Theorien. Es ist da wiederum so wie bei der Photographie. Unter anderem hat man ja zum Beispiel die «Wau-Wau» -Theorie. Sie besteht ja darin, daß man meint: dasjenige, was der Mensch sprachlich bildet, das ahmt er dem nach, was als Laut heraustönt aus Wesenheiten. Er ahmt nach dieses Wesenhafte. Er hört den Hund: Wau-Wau. Wenn er selbst glaubt, ein Ähnliches in seiner Seelenverfassung auszudrükken, so gebraucht er auch einen ähnlichen Laut. Es ist nichts dagegen einzuwenden. Es sind sehr viele Gründe für diese Wau-Wau-Theorie anzuführen, sehr geistreiche Gründe. Wenn man nur auf ihrem Boden stehenbleibt, sind sie nicht zu widerlegen. Aber das Leben besteht nicht in Begründung und Widerlegung, sondern das Leben besteht in lebendiger Bewegung, in Transformation, in lebendiger Metamorphose.
Was an einer Stelle richtig ist, ist von einer anderen Stelle aus falsch, und umgekehrt. Das Leben muß in seiner ganzen Beweglichkeit erfaßt werden. - Sie wissen: es gibt eine andere Theorie, die der Wau-Wau-Theorie gegenübersteht und sie bekämpft. Da leitet man das Entstehen der Sprache davon her, daß so, wie wenn eine Glocke angeschlagen wird, das Metall eine bestimmte innere Konstitution hat und dieser oder jener Laut dann herauskommt, so sich der Mensch den Dingen gegenüber verhält. Es ist mehr ein Sichhereinfühlen in die Dinge, nicht ein äußeres Nachahmen, bei dieser Bim-Bam-Theorie. Sie ist wiederum durchaus richtig für gewisse Dinge. Man kann sagen, diese Theorie hat viel für sich, die Wau-Wau-Theorie auch. Aber die wirkliche Sprache entsteht nämlich weder auf dem BimBam-Weg noch auf dem Wau-Wau-Weg, sondern auf beide Arten und noch auf manche andere Art. Es sind Einseitigkeiten. Manches in unserer Sprache ist wirklich so gebildet, daß das Bim-Bam erfühlt ist, manches ist so, daß es Wau-Wau oder Muh-Muh nachgebildet ist. Es ist durchaus so: es sind beide Theorien richtig und manche andere auch noch. Es kommt aber darauf an, daß man das Leben erfaßt. Erfaßt man das Leben, dann wird man finden, daß die WauWau-Theorie mehr paßt für die Vokale, die Bim-Bam-Theorie für die Konsonanten ; aber wieder nicht ganz, es sind wieder nur Einseitigkeiten. Doch zuletzt kommt man darauf, zu erkennen - wie ich es schon in der kleinen Schrift «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit»> angedeutet habe -, daß die Konsonanten in der Tat nachgebildet sind den äußeren Geschehnissen und den äußeren Formen der Dinge: sie bilden das F dem Fisch nach, das M dem Mund nach, oder das L dem Laufen nach usw. Die Konsonanten sind schon so entstanden, daß sie in einem gewissen Sinne zu der Bim-BamTheorie stimmen - aber nur feiner ausgestaltet müßte sie werden. Die Vokale aber sind Ausdrucksweisen, Offenbarungen für das Innere des Menschen. Da ahmt er nicht in der Form, die er dem Laut oder dem Buchstaben gibt, das Äußere nach, da ahmt er überhaupt zunächst nicht nach, sondern da drückt er seine Gefühle von Sympathie und Antipathie aus. Sein Gefühl von Freude oder Neugierde mit I; von Staunen oder Verwunderung: A, ich bin erstaunt ; E, ich will
etwas weg haben, was mich stört ; U, ich fürchte mich ; Ei, ich habe dich lieb. Alles dasjenige, was in den Vokalen liegt, das ist unmittelbare Offenbarung der seelischen Sympathien und Antipathien. Es entsteht zwar nicht durch Nachahmung, aber so: Der Mensch will sich äußern, will seine Sympathien und Antipathien äußern. Nun hört er an dem Hunde, wenn der Hund etwas Schreckhaftes erfassen will, Wau-Wau: da paßt er sich an, wenn sein Erlebnis ähnlich ist dem Wau-Wau des Hundes, und dergleichen. Es ist aber der Weg des Vokalisierens ein solcher von innen nach außen ; es ist der Weg des Konsonantierens von außen nach innen, von dem Nachbilden. Schon im Laute bildet man nach. Sie werden das nachweisen können, wenn Sie auf Einzelheiten eingehen.
Sie werden aber dann sehen, weil das nur für die Laute gilt, nicht für Worte - es hängt nicht an der Seele -, daß es schon ein Fortführen des Wortes ist zum ursprünglichen Seelenzustad, wenn man dann auch in der Analyse so weit kommt, daß man dem Kinde Buchstaben bei bringt. So daß man sagen kann: man muß nur richtig erfassen dasjenige, was das Kind in einem bestimmten Lebensalter selber fordert, man wird dann im Grunde genommen lauter Buchstaben durcheinander anwenden, so wie ein ordentlicher Photograph - der einem ja meistens gerade dadurch lästig werden kann - auch den Betreffenden sich drehen läßt und ihn von allen Seiten photographiert ; dann hat er ihn erst. So ist es auch notwendig, daß derjenige, der herankommen will an den Menschen, diesen Menschen eben von allen Seiten erfaßt. Mit der Normalwörtermethode erfaßt man nur das Körperlich-Leibliche. Mit der Lau tiermethode kommt man schon dem Seelischen nahe, und - horribile dictu -ja, es ist schrecklich zu sagen: mit der Buchstabiermethode kommt man ganz ins Seelische hinein. Das Letzte ist selbstverständlich heute noch Idiotismus, aber seelischer ist es zweifellos ; nur ist es nicht unmittelbar anzuwenden. Man muß es mit einer gewissen pädagogischen Geschicklichkeit und Praxis, mit künstlerischer Pädagogik an das Kind heranbringen, so daß das Kind nicht dressiert wird, den Buchstaben konventionell auszusprechen, sondern daß es das Entstehen des Buchstabens erlebt, was ja in seinen Bildekräften liegt, was es da wirklich hat. Darauf kommt
es an. Und dann werden wir sehen, daß es noch reichlich genügt, wenn wir auf diese Weise etwa bis nach dem 9. Jahr das Kind dazu bringen, daß es lesen kann. Es schadet nämlich gar nichts, wenn das Kind nicht früher lesen kann, denn es hat auf naturgemäße Weise das Lesen gelernt, wenn es in der eben geschilderten Art gelernt hat und etwa ein paar Monate über neun Jahre alt ist. Bei verschiedenen Kindern kann es etwas früher oder später sein.
Da beginnt nämlich für das Kind dann ein kleinerer Lebensabschnitt. Die großen Lebens abschnitte sind die mehrmals genannten: von der Geburt bis zum Zahnwechsel, vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, dann bis in die Zwanzigerjahre hinein. Aber da darf man dem heutigen Menschen ja überhaupt schon nicht mehr von Entwickelung reden! Heute geht es ja nicht, nicht wahr, daß man dann dem Menschen noch sagt: du machst auch noch eine Entwickelung durch bis zu einem besonderen Reifezustand nach dem 21. Jahr. Das verletzt den heutigen Menschen, da - entwickelt er sich nicht mehr, da schreibt er Feuilletons. Man muß also heute schon etwas zurückhaltender sein, wenn man von den späteren Lebensaltern spricht. Aber es ist notwendig, daß man die großen Lebensabschnitte erfaßt als Erzieher und Unterrichter, und dann auch die kleinen Abschnitte, die wiederum in den großen drinnenliegen. Da ist ein kleiner Ab-schnitt zwischen dem 9. und 10. Jahr, mehr gegen das 9. Jahr zu gelegen: da kommt das Kind dazu, sich immer mehr und mehr von seiner Umgebung zu unterscheiden. Da wird es eigentlich erst gewahr, daß es ein Ich ist. Vorher muß man daher dasjenige in der Erziehung und im Unterricht an das Kind heranbringen, wodurch es mit der Umgebung möglichst zusammenwächst ; das Kind kann sich bis zu diesem Lebensalter gar nicht als Ich von der Umgebung unterscheiden. In dieser Beziehung herrschen ja allerdings die kuriosesten Ansichten. So zum Beispiel - denken Sie daran, daß Sie oftmals die Bemerkung hören können -: Wenn das Kind sich an eine Ecke stößt, fängt es an, die Ecke zu schlagen. Da kommt der intellektualistische Mensch und erklärt das so: schlagen tut man doch bloß, wenn man mit Bewußtsein wahrgenommen hat, was einen wiederum mit Bewußtsein gestoßen hat. Das ist die Definition des Kasus zum Schlagen - ja, bei
solchen Definitionen m&hte man immer wieder erinnern an das griechische Beispiel von der Definition:Was ist ein Mensch? Ein Mensch ist ein lebendiges Wesen, das zwei Beine und keine Federn hat. Das ist eine ganz richtige Definition. Sie führt ins alte Griechenland zurück. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, daß unsere Physikdefinitionen heute nicht viel besser sind ; man lehrt da auch oft die Kinder, daß ein Mensch ein Wesen ist, das auf zwei Beinen geht und keine Federn hat. Ein Bube, der etwas aufgeweckter war, dachte weiter nach über die Geschichte. Er fing sich einen Hahn, rupfte dem die Federn aus und brachte ihn in die Schule mit. Er zeigte den gerupften Hahn vor und sagte: Das ist ein Mensch! Das ist ein Wesen, das auf zwei Beinen geht und keine Federn hat. - Nun ja, Definitionen sind ja sehr nützlich, aber auch fast immer sehr einseitig. Es kommt aber darauf an, daß man sich unmittelbar ins Leben hineinfindet. Ich muß das immer wiederholen. Es handelt sich darum, daß man vor allen Dingen erfaßt, wie das Kind bis nach dem 9. Jahr sich gar nicht von seiner Umgebung richtig unterscheidet. Man kann also eigentlich nicht sagen: das Kind stellt sich den Tisch als lebendig vor, wenn es ihn schlägt. Das fällt ihm gar nicht ein. Es schlägt aus dem Innern seines Wesens heraus. - Diesen Animismus gibt es gar nicht, dieses Beseelen von Unorganischem, das sich schon in die Kulturgeschichte eingeschlichen hat. Man ist ganz erstaunt, welche Phantasie die Gelehrten oft haben, wenn sie zum Beispiel glauben, daß der Mensch die Dinge beseele. Ganze Mythologien werden so erklärt. Es ist so, wie wenn diese Menschen, die so etwas sagen, noch keine primitiven Menschen kennengelernt hätten. Es fällt zum Beispiel keinem Bauer ein, der ja auch noch primitiv ist, die Naturerscheinungen zu beseelen. Es handelt sich darum, daß das Kind die Begriffe «Durchseelen, Beleben der Dinge»» nicht hat. So wie es lebt, lebt eben alles, es träumt aber nicht das Kind dies bewußt hinein. Daher müssen Sie auch keinen Unterschied machen in Ihrem Beschreiben und Reden, wenn Sie die Umgebung beschreiben: Sie müssen die Pflanzen leben lassen, Sie müssen alles leben lassen ; denn das Kind unterscheidet sich noch nicht als Ich von der Umgebung. Daher können Sie auch noch nicht in diesem kindlichen Lebensalter bis nach dem 9. Jahr mit
irgend etwas an das Kind herankommen, was zum Beispiel eine schon intellektualistische Beschreibung ist. Sie müssen in voller Frische alles ins Bild verwandeln. Wo das Bild aufhört und die Beschreibung beginnt, da erreicht man gar nichts im 8., 9. Lebensjahr. Erst nachher ist dies möglich. Und dann handelt es sich wieder darum, daß man in der richtigen Weise sich hineinfindet in diese einzelnen Lebensabschnitte. Nur für bildhafte Darstellungen hat das Kind bis zum 9. Jahr hin überhaupt Verständnis ; das andere geht so vorüber vor dem Auffassungsvermögen des Kindes wie vor dem Auge der Ton. Mit dem Zeitpunkte aber, der zwischen dem 9. und 10. Jahr liegt, können Sie dann anfangen, sagen wir, Pflanzen zu beschreiben. Da können Sie anfangen mit primitiven Beschreibungen des Pflanzen-wesens ; denn da unterscheidet sich das Kind allmählich von der Umgebung. Aber Sie können ihm noch nichts Mineralisches beschreiben ; denn so stark ist sein Unterscheidungsvermögen noch nicht, daß es die große Differenz zwischen dem, was es innerlich erlebt, und dem Mineral schon auffassen könnte. Es hat jetzt erst die Möglichkeit, den Unterschied zwischen sich und der Pflanze aufzufassen. Dann können Sie allmählich übergehen zur Tierbeschreibung.
Aber das muß eben so gemacht werden, daß das Ganze richtig drinnensteht im Leben. Wir haben heute die Botanik. Die sind wir geneigt, auch schon in die Schule hineinzutragen. Wir tun das aus einem gewissen Schlendrian heraus. Eigentlich ist es etwas Schreckliches, wenn wir das von der Botanik, was wir mit Recht haben als Erwachsener, in die Schule hineintragen. Denn was ist denn diese Bctanik, die wir da haben? Sie ist eine systematische Anordnung von den Pflanzen, die man nach gewissen Gesichtspunkten findet. Da werden erst die Pilze, die Algen, die Hahnenfüße usw. beschrieben, so richtig nebeneinander. Ja, wenn man aber eine solche Wissenschaft ausbildet, die ja als Wissenschaft ganz gut ist - nun, dann ist das ungefähr so, wie wenn Sie einem Menschen die Haare ausreißen und nun eine Systematik ausbilden derjenigen Haarformen, die da hinter den Ohren wachsen, die da oben wachsen, an den Beinen wachsen, wie wenn Sie das alles systematisch anordneten. Sie werden eine hübsche Systematik herauskriegen, aber Sie verstehen nicht das Haarwesen
dadurch. Man unterläßt daher, weil das einem zu nahe liegt, daß man das Haarwesen im Zusammenhang mit dem ganzen Menschen betrachten muß. Das Pflanzenwesen ist für sich auch nicht vorhanden, das Pflanzenwesen gehört zur Erde. Sie glauben, Sie könnten einen Goldregen, wenn Sie ihn betrachten, so wie er in der Botanik klassifiziert ist, verstehen! Ich habe nichts dagegen, daß er in der Botanik klassifiziert wird ; Sie können aber nur dann, wenn Sie ihn auf den sonnigen Abhängen sehen und wenn Sie die Erdschichtung betrachten, die darunter ist, verstehen, warum er gelb ist: daß das aus der Farbe der darunterliegenden Erde ist! Da wird Ihnen die Pflanze wie das Haar, das aus dem Menschen heraussprießt. Die zunächst dem Kinde bekannte Erde mit den darauf befindlichen Pflanzen wird so ein Ganzes. Sie dürfen nicht an das Kind herangehen direkt mit dem, was aus der heutigen Botanik stammt, und dies hineintragen in die Schule. Auch da muß man aus dem Leben heraus die Pflanze und die Erde so beschreiben, wie man das Haar beschreibt, das aus dem Menschen herauswächst. Und so können Sie auch gar nicht die Pflanze beschreiben, ohne über den Sonnenschein, über das Klima, über die Erdenkonfiguration zu sprechen, wie es dem Kinde angemessen ist.
Das Nebeneinanderbeschreiben der einzelnen Pflanzen, wie Sie es auch im Botanisieren haben, so daß man sagt: man muß auch dem Kinde Anschauungsunterricht bieten, das ist dem Kinde nicht ange-messen. Es handelt sich auch beim Anschauungsunterricht darum, was man es anschauen läßt. Das Kind hat ein instinktives Gefühl aus dem, was es in sich trägt für das Lebendige, das wahrhaft Wirkliche. Wenn Sie ihm mit dem Toten kommen, verletzen Sie dieses Lebendige, diesen Sinn für das wahrhaft Wirkliche im Kinde. Aber die Menschen haben heute wenig Sinn für die Differenzierungen des Seienden. Denken Sie nur einen Philosophen von heute, der über den Begriffdes Seins nachdenkt. Dem wird es einerlei sein, ob er eine Bergkristallform oder eine Blüte als Beispiel eines Seienden nimmt. Denn beides ist da, man kann es herlegen, das sind existierende Dinge. Aber das ist ja garnicht wahr! Die Dinge sind ja schon in bezug auf das Sein nicht gleichartig. Den Bergkristall können Sie in drei Jahren wieder nehmen: er ist durch seinen eigenen Bestand. Die Blüte ist ja
gar nicht so, wie sie ist. Eine Blüte für sich ist ja eine Naturlüge ; sie kann nur ein Sein haben auf der ganzen Pflanze. Sie müssen die ganze Pflanze beschreiben, wenn Sie die Berechtigung haben wollen, der Blüte ein Sein beizumessen. Die Blüte für sich genommen ist ein reales Abstraktum ; der Bergkristall nicht. Aber man hat heute ganz das Gefühl verloren für solche Differenzierungen der Wirklichkeit. Das Kind hat dies noch instinktiv. Wenn Sie an das Kind etwas heranbringen, was nicht ein Ganzes ist, dann ist es unheimlich berührt im Innern. Das geht dem Menschen dann noch nach bis ins spätere Leben hinein. Sonst hätte der Tagore nicht beschrieben, welch unheimlichen Eindruck ihm das abgeschnittene Bein gemacht hat in seiner Kindheit. Das ist ja keine Wirklichkeit, ein Menschenbein, das hat ja nichts mehr zu tun mit der Wirklichkeit. Denn das Bein ist nur so lange ein Bein, als es am ganzen Organismus ist; wird es abgeschnitten, so hört es auf, ein Bein zu sein.
Aber solche Dinge müssen einem gründlichst in Fleisch und Blut übergehen, damit wir alle Wirklichkeit so erfassen, daß wir überall ausgehen von der Totalität und nicht von dem Einzelnen. Das Einzelne könnten wir ja ganz falsch behandeln. So müssen wir bei der Botanik für das kindliche Alter von der ganzen Erde ausgehen und die Pflanzen gewissermaßen als die Haare betrachten, die da auf der Erde wachsen.
Und die Tiere -ja, zu den Tieren gewinnt das Kind überhaupt kein Verhältnis, wenn Sie ihm das Nebeneinander entwickeln. Sie können da dem Kinde schon etwas mehr zumuten, weil das Behandeln des Tierischenja erst eintritt im 10., 1 1. Lebensjahr. Dem Kinde dieTiere so nebeneinander beizubringen - gewiß, wissenschaftlich ist das ganz gut, aber wirklichkeitsgemäß ist es nicht. Wirklichkeitsgemäß ist nämlich, daß das ganze Tierreich ein ausgebreiteter Mensch ist. Nehmen Sie den Löwen: er ist die einseitige Ausbildung besonders der Brustorganisation. Nehmen Sie den Elefanten: die ganze Organisation ist auf die Verlängerung der Oberlippe hin ausgebildet ; die Giraffe: die ganze Organisation ist auf die Verlängerung des Halses hin ausgebildet. Wenn Sie jedes Tier so begreifen, daß irgendein Organ-system des Menschen vereinseitigt ist im Tier, und dann die ganze
Tierreihe überblicken bis zum Insekt, und noch weiter hinunter kann das durchgeführt werden bis zu den geologischen Tieren - Terebraten sind im Grunde genommen keine geologischen Tiere -, dann kommen Sie dazu, sich zu sagen: Das ganze Tierreich ist ein fächerförmig auseinandergefalteter Mensch, und der Mensch ist seiner physischen Organisation nach die Zusammenfaltung des ganzen Tierreiches. Da bringen Sie in die richtige Enifernung vom Menschen - und auch wiederum richtig mit dem Menschen zusammen - dasjenige, was das Tierreich ist. Natürlich sage ich hier mit ein paar Worten etwas Abstraktes. Das müssen Sie sich umsetzen in Lebendiges, so daß Sie wirklich jede Tierform schildern können als eine einseitige Ausbildung eines menschlichen Organsystemes. Wenn Sie die nötige Kraft finden, vor den Kindern das lebendig zu schildern, so werden Sie sehen, wie die Kinder das rasch auffassen. Denn das wollen sie haben. Die Pflanzen werden angeknüpft an die Erde, wie wenn sie das Haar der Erde wären. Das Tier wird angeknüpft an den Menschen so, wie wenn der Mensch sich vereinseitigen würde, wie wenn er bald Arme, bald Beine, bald Nase und dergleichen, bald Oberleib wäre, und dies dann Gestalt gewinnen wurde: dann bekommt man die Gestalt der Tiere, des ganzen Tierreiches. So gelangt man wirklich dazu, den Unterricht so zu gestalten, daß er verwandt ist demjenigen, was in dem werdenden Menschen, dem Kinde selber lebt.
FÜNFTER VORTRAG Dornach, 19. April 1923
Für die Unterrichts- und Erziehungspraxis zwischen dem 7. Jahr ungefähr und dem 14. Jahr kommt vor allen Dingen in Betracht, daß man sich richtig zu orientieren vermag zu dem Gefühlsleben des Kindes und innerhalb des Gefühislebens des Kindes. Da handelt es sich wirklich darum, daß man sich als Lehrer selbst die richtigen bildhaften Vorstellungen zu machen vermag, welche einen führen können durch die zarten Übergänge, welche gerade für diese Lebensperiode beim Kinde bestehen.
Wenn man das Kind in die Schule hereinbekommt, dann wirkt noch etwas nach die frühere leiblich-religiöse Stimmung - wie ich es genannt habe -, dann wirkt noch nach die Sehnsucht, alles, was in der Umgebung vor sich geht, wahrzunehmen, und es verbindet sich dann dieses Wahrnehmen, welches in Nachahmung übergeht, mit dem Hin-horchen auf das, wie von der selbstverständlichen Lehrer- und Erzieherautorität auf das Kind gewirkt wird. Es muß ja durchaus so sein für dieses kindliche Lebensalter, daß wahr nicht dasjenige ist, was man untersucht hat auf seine Wahrheit, sondern daß wahr dasjenige ist, wovon die selbstverständliche Autorität sagt, daß es wahr ist. Und ebenso muß etwas unwahr sein aus dem Grunde, weil es die selbstverständliche Autorität unwahr findet. Ebenso ist es bei schön und häßlich, ebenso bei gut und böse. Man kann erst zu einem richtig selbständigen, freien Urteil über richtig und unrichtig, gut und böse, schön und häßlich im späteren Leben kommen, wenn man in diesem Lebensalter so recht innig verehrungsvoll zu einer selbstverständlichen Autorität in bezug auf diese Dinge hat aufschauen können. Natürlich darf das nicht eine anbefohlene Autorität sein ; es darf nicht eine äußerlich festgestellte Autorität sein. Wenigstens darf wenn das der Fall sein muß aus äußeren sozialen Gründen, daß die Autorität eine anbefohlene und eine äußerlich festgestellte ist, das Kind nichts davon wissen. Das Kind muß durch die ganze Richtung seiner Gefühle
und Empfindungen von der Lehrer- und Erzieherpersönlichkeit eben den Eindruck bekommen, daß es zu ihr als zu der entsprechenden Autorität hinaufschaut. Und man muß alles in diesem zarten autoritativen Verhältnisse, insbesondere so zwischen dem 7. und 9. Lebensjahr, überhaupt zwischen dem Eintreten in die Volksschule und dem 9. Lebensjahr, erhalten. Man muß es noch lange erhalten, aber es modifiziert sich dann zwischen dem 9. und 10. Jahr von selber.
Nun trifft etwas anderes zusammen mit dem selbstverständlichen Sichhineinleben des Kindes in das Autoritative. Es trifft das zusammen, daß das Kind ja in der ersten Lebensepoche bis zum Zahnwechsel hin ein Sinneswesen war, gewissermaßen ein ganzes Sinnesorgan war ; aber ein Sinnesorgan, in dem bei jedem Schritt des Lebens der Wille gewirkt hat. Es kann Ihnen das vielleicht sonderbar erscheinen, daß ich sage: ein Sinnesorgan, in dem der Wille wirkt. Aber das erscheint Ihnen nur sonderbar, weil die heutige Physiologie und dasjenige, was sich als populäre Ansichten aus dieser Physiologie ergeben hat, eben etwas ganz Unzulängliches ist. Heute denkt man gewöhnlich nicht an den Willen, wenn man zum Beispiel ans Auge denkt. Aber auch beim Auge ist es so, daß das Willensartige das innere Bild zustande bringt und nicht etwas anderes. In jedem Sinnesorgan schafft das Willensmäßige das innere Bild. Das Sinnesorgan, passiv, hat zunächst nur die Aufgabe, sich oder den Menschen der Außenwelt zu exponieren, aber es findet in jedem Sinnesorgan eine innere Aktivität statt, und die ist willensartiger Natur. Und dieses Willensartige wirkt beim Kinde intensiv durch den ganzen Leib bis zum Zahnwechsel hin. Dann bleibt noch dieses Willensartige vorhanden. Und dieses Willensartige erträgt nämlich zwischen dem Eintritt in die Volksschule und ungefähr dem 9. Jahr zunächst nur, daß man es in einer ganz menschlich-bildhaften Weise an alle Dinge der Natur und des Menschen heranführt. Daher arbeiten wir zum Beispiel so, daß wir in der Tat nicht ein ästhetisierendes, aber ein künstlerisches Element gerade in den ersten Unterricht hineinbringen ; daß wir das Kind zum Beispiel auch schon ganz von Anfang an mit Farben hantieren lassen, trotzdem das manchmal in der Klasse recht unbequem wird. Aber wir lassen das Kind mit Farben hantieren, weil es damit
seinen eigenen Bildekräften folgt im Nebeneinandersetzen der Farben, in dem Sich-Befriedigen daran, Farbe neben Farbe zu setzen, nicht bedeutungsvoll, sondern instinktiv-sinnvoll Farbe neben Farbe zu setzen. Das Kind entwickelt nämlich eine wunderbare instinktive Art, die Farben nebeneinanderzusetzen. Und man kann dann schon sehen, wie man dirigieren kann dieses Farbennebeneinandersetzen in das Zeichnen, und wie man dann aus dem Zeichnen heraus das Schreiben gewinnen kann.
Aber ganz ohne Verständnis bleibt das Kind dafür, daß man ihm in diesen Jahren schon etwas erklären will. Dafür hat es gar kein Verständnis. Wenn man ihm in diesen Jahren etwas erklären will, dann wird es stumpf, dann geht das gar nicht. Aber es geht wunderbar, wenn man alles, was man an das Kind heranbringen will, nicht erklärt, sondern erzählt, wenn man auch mit Worten, mit Vorstellungen malen will, wenn man Rhythmus hineinbringt in die ganze Art und Weise, wie man dem Kinde die Dinge beibringt. Wenn man Musik nicht nur in der Musik hat, sondern das Musikalische auch in der ganzen Handlung des Unterrichts hat, wenn im Unterricht Takt, Rhythmus, ja sogar ein innerlich Musikalisches walten kann, so hat das Kind dafür ein feines Verständnis. Aber es würde zum Beispiel sich dagegen sträuben, wenn man das, was man gefühls- und willens-mäßig menschlich an das Kind heranbringt, nun selbst beschreiben wollte ; wenn man also dem Kinde zwischen dem Eintritt in die Volksschule und dem 9. Lebensjahr etwa den Menschen beschreiben wollte. Dagegen würde es sich furchtbar sträuben, das könnte es gar nicht aushalten. Jedoch alles, bis zu den unorganischen Naturwesen herunter, menschlich behandeln, das ist dasjenige, was es in dieser Zeit durch sein Inneres eigentlich fordert.
Nun bleibt dieser Horror, könnte man es nennen, vor dem Beschreiben des Menschen eigentlich sogar bestehen bis gegen das 12. Lebensjahr. Wir können ganz gut dasjenige ausführen, was ich gestern gesagt habe, zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr. Wir können so, wie ich es gestern auseinandergesetzt habe, die Pflanzenwelt dem Kinde beibringen als die Haare, die auf der Erde wachsen ; aber wir müssen bei der bildlichen Charakteristik bleiben. Wir können auch
die Tierwelt so dem Kinde nahebringen, daß wir in einer Art, die eben dem Kinde liegt, jede Tierform auffassen wie ein Stück Mensch, das einseitig ausgebildet ist. Wir dürfen aber ja nicht nun übergehen etwa zu der Beschreibung des Menschen selber in dieser Zeit. Wir können sogar ganz gut daraufhin das Kind lehrend beeinflussen, daß wir von den Gliedern des Menschen sprechen und diese Glieder in einseitiger Ausbildung auf diese oder jene Tierform anwenden, aber die Zusammenfassung zum Menschen, die versteht das Kind noch gar nicht. Erst gegen das 12. Jahr hin bekommt es dann auch die Sehnsucht, nun das ganze Tierreich zusammenzufassen zum Menschen. Und das kann man dann betreiben in denjenigen Klassen, die eben auf das Lebensalter zwischen dem Ii. und 12. Jahr folgen.
Darin liegt nun ein scheinbarer Widerspruch, aber das Leben ist eben widerspruchsvoll. Der scheinbare Widerspruch ist der, daß man erst sollte das ganze tierische Reich wie den ausgebreiteten Menschen beschreiben. Aber es ist doch richtig, es so zu machen, bevor man den Menschen nun als eine Raumesgestalt selbst in der Zusammenfassung beschreibt. Das Kind muß gewissermaßen zunächst ein Gefühl davon bekommen, daß alles Menschliche vereinseitigt die ganze Erde bewohnt, daß die Tierwelt die ganze Menschlichkeit ver-einseitigt in ihren einzelnen Exemplaren ist. Und dann muß das Kind den großen Moment erleben, wo man ihm zusammenfaßt, wie alles dasjenige, was ausgebreitet ist in der Tierwelt, im Menschen konzentriert ist. Darauf kommt es beim Unterrichten an, daß man das Kind die entscheidenden Lebensmomente wirklich erleben läßt. Daß man also dem Kinde einmal das durch die Seele ziehen läßt: Der Extrakt und die synthetische Zusammenfassung der ganzen Tierwelt ist auf einer höheren Stufe der Mensch als physischer Mensch.
Es kommt nicht darauf an in diesem Lebensalter, daß man von Stufe zu Stufe dem Kinde diese oder jene Kenntnisse bei bringt, sondern es kommt darauf an, daß man im entscheidenden Lebenspunkte es wirklich erleben läßt - daß man es gewisse, wenn ich so sagen darf, Berge des Menschenlebens, die eben im kindlichen Lebensalter liegen, wirklich übersteigen läßt. Das wirkt auf das ganze spätere Leben nach. Und es ist ja schon einmal so, daß unsere Zeit aus der
Art, wie sie sich wissenschaftlich entwickelt hat, wirklich recht wenig Begabung hat, so intim auf das Menschenleben und auf das Menschenwesen hinzuschauen. Sonst würden gar nicht die Dinge entstehen, die eben innerhalb der heutigen Zivilisation und insbesondere des heutigen Geisteslebens entstehen. Bedenken Sie nur einmal etwas, was ich in der allerersten Stunde betont habe: Bis zum 7. Lebensjahre arbeitet in all dem körperlichen Geschehen, das dann später im Zahn-wechsel sich auslebt, das Seelische. Und ich habe den Vergleich gebraucht: Wenn wir hier eine Lösung haben und da unten bildet sich
#Bild s. 99
ein Bodensatz, so ist dies das Dichtere: dann bleibt das Feinere oben übrig - und jedes ist jetzt für sich. Bis zum Zahnwechsel um das 7. Jahr waren eben die beiden beieinander. Wir sagen: der physische Leib und der Ätherleib, der gröbere Leib und der feinere Leib waren noch eins. Jetzt hat sich der physische Leib herausgesondert, und das ätherische Menschenwesen wird jetzt selbständig arbeitend.
Ja, aber da kann das eintreten, daß von dem Menschenwesen zuviel von dem Seelischen im physischen Leibe aufgenommen wird. Es muß ja immer Seelisches zurückbleiben, denn der Mensch muß das ganze Leben hindurch seinen physischen Leib beseelt und durchgeistigt haben. Es kann aber zuviel von dem Seelisch-Geistigen zurückbleiben, und da oben zu wenig sein: dann haben Sie ein Menschen-wesen, das in seinem physischen Leibe zu viel Seelisches und ein zu dünnes geistig-seelisches Wesen hat ; da ist etwas, was schon im Geistig-Seelischen sein sollte, im physischen Leibe zurückgeblieben. Und sehen Sie, das ist ein Tatbestand, der außerordentlich häufig vorkommt! Das aber liefert die wirkliche Erkenntnis, wie Seeleninhalte, die, sagen wir zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr als Seeleninhalte da sein sollten, im physischen Leibe unten sitzen. Da haben Sie eine
exakte Erkenntnis davon. Aber um diese exakte Erkenntnis zu erwerben, ist es eben notwendig, daß man den Menschen seinem gröberen und feineren Wesen nach wirklich kennt. Daß man also eine Physiologie hat, welche noch genügend Psychisches enthält, und eine Psychologie, die nicht abstrakte Psychologie ist, sondern genügend viel Physiologie enthält: das ist durchaus notwendig. Da muß man sehen, wie das Leiblich-Physische zum Seelischen steht, und wie das SeelischGeistige zum Leiblich-Physischen steht: das muß man durchschauen.
Durchschaut man das nicht, so hat man doch nur eine dilettantische Physiologie, keine wirkliche Physiologie, und man hat auch eine dilettantische Psychologie und keine wirkliche Psychologie. Und durch dieses Nichtdurchschauen des Menschen hat tatsächlich das heutige Wissenschaftsleben eine dilettantische Psychologie und eine dilettantische Physiologie. Das heißt, es hat so etwas, was sich zusammensetzen kann aus der Wechselwirkung zwischen dem psychologischen Dilettantismus und dem physiologischen Dilettantismus. Das gibt einen «Dilettantismus zum Quadrat», und das nennt man dann - Psychoanalyse. Das ist eben gerade das Geheimnis der Entstehung der Psychoanalyse, daß sie aus einer dilettantischen Physiologie und einer dilettantischen Psychologie hervorgeht, die miteinander so wirken wie zwei Zahlen, die man miteinander multipliziert und die das Quadrat geben. So kommt eben der «Dilettantismus zum Quadrat»> heraus. Dilettantische Psychologie multipliziert mit dilettantischer Physiologie = Psychoanalyse. Das sage ich wirklich nicht, um der Psychoanalyse etwas anzuhängen, denn die Dinge können ja nach den Wissenschaftsbedingungen der heutigen Zeit nicht anders sein, weil eben die Menschheit durch ein Zeitalter durchgegangen ist, wo die Psychologie zu dünn und die Physiologie zu dick geworden ist. Und wenn der Mensch die Dinge so betrachtet, so wird immer, statt daß eine echte Wissenschaft zustande kommt, die Physiologie chemisch herausgefällt aus demjenigen, was eine einheitliche Lösung sein sollte. Es ist ein Bild, aber Sie werden das Bild verstehen.
Nun, so ist es nun schon einmal, daß wir uns klar sein müssen darüber, wie das wirkliche Menschenwesen sich entwickelt und wie wir die Lebensstationen besonders beim Kinde zu beachten haben.
Gerade in diesem Lebensalter zwischen dem 9. und 12. Jahr, da ist das Kind empfänglich für alles das, was ihm nun von außen her als Bild entgegengebracht wird. Bis zum 9. Jahre ungefähr will es mittun an dem Bild ; da läßt es die Bilder nicht an sich herankommen. Da muß man immer so lebendig neben dem Kinde arbeiten, daß eigentlich das, was der Lehrer macht und das Kind macht, zusammen schon ein Bild ist. Das Arbeiten selber muß schon ein Bild sein. Es kommt nicht darauf an, ob man da BHder bearbeitet oder etwas anderes, die Arbeit selbst, der Unterricht muß ein Bild sein. So zwischen dem 9. und 10. Jahr tritt dann das auf, daß das Kind für die äußere Bildlichkeit einen besonderen Sinn hat. Die kann man jetzt heranbringen, und das gibt eben die Möglichkeit, in der richtigen Weise die Pflanzen- und Tierwelt an das Kind heranzubringen, insofern darinnen die Bildlichkeit lebt. Bildliches muß manheranbringen gerade in der Pflanzen- und Tierwelt. Und je mehr man imstande ist, bildlich darzustellen dasjenige, was in unseren botanischen Lehrbüchern bis zur dritten Potenz der Unbildlichkeit dargestellt wird, ein desto besserer Lehrer ist man gerade für die Kinder zwischen dem 9. und 12. Jahr. Alles ins Bild hereinbringen, das ist ja auch das, was so unendliche innere Befriedigung geben kann. Denn wenn man die Pflanzenwelt in ihren Formen in die Bilder hereinbringt, so muß man mitschöpferisch sein.
Dieses Mitschöpferische, das ist es ja, was überhaupt wiederum in unsere Zivilisation erst so recht hereinkommen will! Man erlebt es ja heute alle Augenblicke, wie Menschen, die im Leben stehen, voller Verzweiflung zu einem kommen, weil sie nichts Bildliches erfassen können. Das führt eben zurück darauf, daß die Kindheit dieser Menschen nicht in der richtigen Weise zugebracht worden ist. Die Welt hat ja leicht darüber lachen, daß wir sagen: Der Mensch besteht aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Die Welt hat leicht lachen darüber, denn wenn man alles das, was man heute aus der gangbaren Wissenschaft wissen kann, zusammen nimmt und dann solch eine Sache beurteilt, kann man ja nur über sie lachen. Wenn man nicht auf die Sache eingeht, kann man nur lachen - man versteht es ganz gut, daß die Menschen darüber lachen. Aber es sollte gerade aus den ernsten Verwickelungen der Kultur heraus doch der Drang
hervorgehen, dasjenige zu suchen, was man sonst nirgends findet ; das ist doch bei vielem der Fall, daß man es sonst nirgends findet. Und gar viel ist natürlich zu lachen, wenn man sagt: Der physische Leib wird mit der Geburt geboren, da entwickelt er sich in jener leib-lichen Religiositat, jenem Nachahmen bis zum Zahnwechsel hin ; der Ätherleib und alles übrige arbeitet da noch in ihm: das sind die Kräfte, die in ihm geistig-seelisch arbeiten. Mit dem Zahnwechsel wird der Ätherleib geboren ; der arbeitet dann selbständig in dem Menschen. Der Astralleib wird erst geboren mit der Geschlechtsreife ; dann arbeitet auch der Astralleib selbständig im Menschen. Und das Ich - das muß man nun schon mit einer gewissen Reserve heute sagen -, das Ich, das wird nämlich erst nach dem 20. Lebensjahre wirklich geboren. Das ist dasjenige, worüber man dann am besten weise schweigt, wenn man zu Menschen zu sprechen hat, die in ihren ersten akademischen Jahren stehen. Aber es ist eben doch eine Wahrheit. Es bleibt nichts anderes übrig: es ist eben so.
Nun, wenn man allerdings die Unterschiede nicht kennt zwischen den vier ganz voneinander verschiedenen Gliedern der menschlichen Wesenheit, dann wird man das zunächst als einen Unsinn betrachten oder wenigstens als etwas höchst Überflüssiges. Es ist aber nichts Überflüssiges, wenn man die volle Wesenheit kennt. Sehen Sie, das Physische hat zu seiner hauptsächlichsten Charakteristik, daß es drückt - ich könnte auch sagen, daß es den Raum ausfüllt. Daß es drückt. Es drückt auf die anderen Gegenstände, es schiebt sie weiter; es drückt auf uns selber: diesen Druck erleben wir mit dem Tastsinn. Das Physische drückt. - Das Ätherische -ja, mit diesem Ä therischen ist es etwas ganz Sonderbares. Der Äther ist ja eigentlich für die Wissenschaft in den letzten 40 bis 50 Jahren ein merkwürdiges Ding gewesen. Wenn man alle die Äthertheorien jetzt hersagen wollte, die aufgestellt worden sind über die Wesenheit des Äthers, ja, dann würden wir nicht so bald fertig werden - bis es zuletzt heute schon so ist, daß eine ganze Anzahl von Leuten behaupten: der Äther, der ist im Grunde eigentlich nur die im Raum wesende Mathematik und Mechanik, die eigentlich nur etwa als Linien da seien. Ja, im Grunde genommen ist für viele der Äther seinem Inhalte nach bestehend aus
herumfliegenden Differentialquotienten ; also Errechnetes jedenfalls. Nun, immerhin hat man über diesen Äther sehr viel nachgedacht. Das ist ja sehr löblich, aber auf diesem Wege kommt über den Äther nichts heraus. Da muß man schon wissen, daß der Äther die von dem Druck entgegengesetzte Eigenschaft hat: er saugt nämlich, der Äther ist der Saugende. Er will durch seine eigene Wesenheit immer die räumliche Materie aus dem Raume heraus vernichten. Das ist das Wesentliche des Äthers. Wo die physische Materie drückt, da saugt der Äther. Die physische Materie erfüllt den Raum ; der Äther schafft die Materie aus dem Raume heraus. Er ist nämlich die negative Materie, aber qualitativ negativ, nicht quantitativ negativ.
Das ist in bezug auf den menschlichen Ätherleib ebenso. Wir leben zwischen physischem Leib und Ätherleib so, daß wir uns fortwährend vernichten und wieder herstellen. Der Äther vernichtet fortwährend unsere Materie, der physische Leib stellt sie wieder her. Das widerspricht allerdings - das will ich nur in Parenthese erwähnen - dem heute so beliebten Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Aber die Tatsache ist, daß dieses Gesetz von der Erhaltung der Kraft der inneren Wesenheit des Menschen, der Wahrheit widerspricht. Es gilt nur für die unorganische Welt im strengen Sinne des Wortes. Für die organische gilt es nur so weit, als diese von Unorganischem ausgefüllt ist ; für die Eisenteilchen im Blutserum gilt dieses Gesetz, aber nicht für das ganze Menschenwesen. Da findet ein fortwährendes Oszillie-ren statt zwischen den aufsaugenden und uns vernichtenden Kräften des Äthers und der Wiederherstellung des physischen Leibes.
Beim Astralleibe ist es nun so, daß er nun nicht nur den Raum auf-saugt, sondern daß er kurioserweise die Zeit aufsaugt. Der hat nämlich etwas Rückführendes. Er ist rückführend, der Astralleib. Das kann ich Ihnen nun gleich am Beispiel des Menschen ganz klarmachen. Denken Sie sich einmal, Sie seien eine ältere Persönlichkeit von etwa 50 Jahren geworden. Ja, in Ihrem Astralleibe wirken nämlich fortwährend Kräfte, die Sie zurückführen in die Zeiten des verbrachten Erdenlaufes, die Sie zurückführen in die Zeit, die vor der Geschlechtsreife liegt. Sie erleben in Ihrem Astralleib gar nicht diesen Fünfzigjährigen. Sie erleben den Elf-, Zwölf-, Dreizehn-, Vierzehnjährigen
in Wirklichkeit. Der strahlt herein in Sie dadurch, daß der Astralleib zurückführt. Das ist das Geheimnis des Lebens. Wir werden nur in bezug auf den physischen Leib und den Ätherleib und seine Oszillationen eigentlich alt. Der Astralleib ist dasjenige, was uns immer wieder zurückführt zu den früheren Lebensstadien. Da sind wir noch immer reifere Kinder. Alle miteinander sind wir noch immer reifere Kinder durch unseren Astralleib. Wenn wir also unseren Lebenslauf durch eine Röhre symbolisch vorstellen, und wir sind hier 50 Jahre alt, dann strahlt unsere reifere Kindheit, weil eben der Astralleib uns zurückleitet, ihr Wesen bis in unsere Fünfzigerjahre
#Bild s. 104
hinein. Im Astralischen lebt man immer rücklaufend - aber selbständig wird dieses rücklaufende Leben eben erst mit der Geschlechts-reife. Siebt man das in seinem vollen Ernste ein, dann will man schon selbstverständlich den Kindern für ihr ganzes Leben das erhalten, was man ihnen im schulpflichtigen Alter angestaltet. Man will ihnen das erhalten. Denn das, was Sie dem Kinde da angestalten, das lebt mit ihm durch das ganze Leben, weil der Astralleib immer rückwirkend ist. Für alles, was Sie im volksschulpflichtigen Alter mit dem Kinde vollbringen, steht eigentlich vor Ihnen der ganze menschliche Lebenslauf - und wenn der Mensch 90 Jahre alt wird. Das gibt für die Gesinnungspädagogik die richtige Verantwortung. Denn auf diese Verantwortlichkeit kommt es an: daß man überhaupt wissen lernt, was man tut. Und man lernt das erst wissen, wenn man solche Zusammenhänge des Lebens wirklich kennenlernt.
Nun, wenn man das kennt, dann wird man nicht mehr bloß sagen: Bringe dem Kinde nur dasjenige bei, was es schon versteht. Das ist nämlich eigentlich in bezug auf das Wesen des Menschen etwas Schreckliches, dem Kinde nur das beizubringen, was es schon versteht. Und diejenigen Lehrbücher und auch pädagogischen Handbücher für Lehrer, die unter dem Einflusse dieser Art von besonderem
Anschauungsstreben entstanden sind, die sind zum Verzweifeln trivial. Da will man sich immer auf die Stufe des Kindes herunter versetzen und nur so die Dinge behandeln, daß das Kind schon alle Einzelheiten durchschauen kann. Da nimmt man dem Kinde etwas Ungeheueres ; das sieht derjenige ein, der den Zusammenhang des kindlichen Lebens mit dem ganzen Menschenwesen durchschaut. Nehmen Sie an, das Kind habe irgend etwas, was es im 8. Jahr noch gar nicht verstehen kann, deshalb aufgenommen, weil es seinen Lehrer und Erzieher liebt, weil ihm das wahr und schön und gut ist, was der Lehrer sagt. Die Liebe zum Lehrer, die Sympathie ist das Vehikel für das Aufnehmen ; reif ist man, sagen wir, erst mit 35 Jahren, diese Sache zu verstehen. - Es sagt sich so etwas zwardemmodernenMenschen schwer, weil er nicht zugibt, daß man für manche Sachen erst mit dem 35. Jahr reif wird, aber es ist doch so: reif wird man erst für irgend etwas, was man da in Liebe zum Lehrer aufgenommen hat, mit dem 35. Jahr. Da hat man dann wiederum ein Erlebnis durch die rückstrahlende Kraft des Astralleibes. Da dringt etwas wie aus dem Innern herauf, es schaut wie ein Spiegelbild aus: eigentlich ist es ein Hingehen zu der Kindlichkeit. Es ist wie ein Heraufkommen in der Anschauung. Da ist man 35 Jahre alt, ist reif geworden - aus den Tiefen der Seele taucht herauf: Jetzt verstehst du ja erst dasjenige, was du in deinem 8. Jahr dazumal in dich aufgenommen hast. Und dieses Verstehenkönnen von etwas, was lange in einem gelebt hat, auf die Liebe hin in einem gelebt hat, ist etwas ungeheuer Erfrischendes im Leben. Dieses Erfrischende im Leben können wir dem Kinde geben, wenn wir in ihm die Autorität so bewahren, daß das Vehikel zwischen ihm und uns die Liebe ist, die Sympathie ist - und wir dem Kinde dasjenige geben, was es noch nicht anschauen und verstehen kann, sondern was ihm erst heranwachsen muß im Laufe des Lebens.
Diese Zusammenhänge kennt eben derjenige gar nicht, der immer nur das an das Kind heranbringen will, was es versteht. Aber auch das Entgegengesetzte ist durchaus falsch und ungehörig. Derjenige, der das Menschenwesen versteht, wird als Erzieher oder Lehrer die Redensart nie im Munde führen: Das verstehst du noch nicht! - das darf es ja gar nicht geben, daß man jemals veranlaßt ist, zu dem Kinde in
irgendeinem Lebensalter zu sagen: Das verstehst du noch nicht. Denn es wird immer eine Form geben, in die man dasjenige kleiden kann, was das Kind wissen will, wenn man nur das richtige Verhältnis zum Kinde hat. Man muß diese Form nur finden. Und diese Form findet man, wenn man eine solche Pädagogik, wie sie hier gemeint ist, zum instinktiven Leben macht. Man findet eben die entsprechende Form in dem Augenblick, wo man sie braucht. Und man findet vor allen Dingen dann die Möglichkeit, dem Kinde keine scharf umrissenen Vorstellungen zu geben. Das ist nämlich schrecklich, wenn man dem Kinde gegenüber alle Vorstellungen bis zur Unbeweglichkeit deutlich ausarbeitet. Tut man das, dann ist es nämlich so, wie wenn man das kleine Händchen des Kindes in einen eisernen Handschuh einspannte, daß es nicht mehr wachsen kann. Wir dürfen dem Kinde nie fertige Vorstellungen beibringen, sondern nur solche, die wachsen können, sich wandeln können, Vorstellungen, die selber leben.
Wenn wir also beim Bildhaften, Gestaltenhaften bleiben bis gegen das 12.Jahr hin, so werden wir auch nicht versucht sein, dem Kinde scharf umrissene, gewissermaßen starre Begriffsfiguren vorzuführen. Denn da ist es, wie wenn wir dem kleinen Kind ein Händchen in einen Eisenhandschuh zwängen, daß es nicht mehr wachsen kann. Und das, was ich als Unterricht skizziert habe, das gibt gar nicht Veranlassung dazu, in scharfe Begriffsformen die Dinge einzuspannen, sondern zu gestalten mit Worten, mit der Hand, auf die Tafel oder was es sonst ist, mit dem Pinsel in der Farbe anschaulich zu malen, zu zeichnen usw. Aber immer ist das Bewußtsein da: das ist in sich beweglich, und es muß beweglich bleiben ; denn man muß wissen, daß sich etwas erst gegen das 12. Jahr, und zwar sehr nahe am 12. Jahr, in dem Kinde entwickelt, und das ist der Sinn für den Kausalitätsbegriff.
Den Kausalitäts begriff hat das Kind bis gegen das 12. Jahr hin überhaupt nicht. Es sieht dasjenige, was beweglich ist, was bewegliche Vorstellungen sind. Was als Bildhaftes, Musikalisches da ist, das schaut es, nimmt es wahr, aber es hat für den Kausalbegriff bis gegen das 12. Jahr hin keinen Sinn. Daher müssen wir dasjenige, was wir dem Kinde beibringen bis gegen das 12. Jahr hin, Pein sein lassen vom Kausalitäts begriff. Da erst können wir darauf rechnen, daß das
Kind die gemeiniglichen Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen ins Auge fassen kann. Von da an fängt das Kind eigentlich erst an, sich Gedanken zu machen ; bis dahin hat es Bildvorstellungen. Da leuchtet nämlich schon voran dasjenige, was dann mit der Geschlechtsreife vollständig auftritt: das gedankliche, das urteilende Leben, das an das Denken im engeren Sinne geknüpft ist - während das Leben zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife an das Fühlen geknüpft ist und das Leben vor dem Zahnwechsel an den innerlich sich entfaltenden Willen, der für dieses Lebensalter nicht unter Gedanken steht, sondern unter Nachahmung des dem Kinde körperhaft Entgegentretenden. Aber mit dem körperhaft dem Kinde Entgegentretenden setzt sich auch das Moralische, das Geistige beim Kinde fest im Körperhaften. Daher ist es auch unmöglich, im 10. bis ii. Lebensjahr, meistens sogar noch im ii. bis 12. Lebensjahr, dem Kinde etwas beizubringen, wo man auf Kausalität sehen muß. Man sollte daher anfangen mit dem Beibringen der mineralischen Welt erst gegen das 12. Jahr. Und physikalische Begriffe sollten auch erst gegen dieses Lebensjahrhin auftreten, nachdem sie vorher im Grunde genommen nur vorbereitet sind. Da wird das Kind erst reif für das Aufnehmen solcher Begriffe. Alles, was sich auf das Unorganische bezieht, kann das Kind im Sinne eines Kausalbegriffes erst gegen das 12. Jahr hin begreifen. Es muß natürlich alles vorher vorbereitet sein, aber nicht durch Kausalbegriffe ; sondern was später durch diese Kausalbegriffe erfaßt wird, das muß vorbereitet werden in Bildern ohne den Kausalitätsbegriff. Das Kind muß gewissermaßen einen Stoff haben, an dem es diese Kausalitätsbegriffe anwendet. Das auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite können Sie den Kindern vor diesem Lebensalter gegen das 12. Jahr hin nicht Zusammenhänge in der Geschichte begreiflich machen. Da sollen Sie vor die Kinder hinstellen einzelne Menschenbilder, die entweder das Gefallen erwecken durch ihre Güte, ihre Wahrhaffigkeit oder dergleichen, oder das Mißfallen erwecken durch das Gegenteil. Auf Gefallen und Mißfallen, auf das Gefühlsund Gemütsleben muß auch die Geschichte gestellt werden: geschlossene Bilder von Vorgängen und von Persönlichkeiten, aber Bilder, die in dem Sinne wieder beweglich gehalten werden, wie ich es angedeutet
habe. Dagegen kausale Zusammenhänge zwischen dem Früheren und dem Späteren, die können Sie dem Kinde erst beibringen, wenn in ihm voranleuchtet dieses Rückläufige des Astralleibes, das dann stärker auftritt nach dem 14. Jahr. So gegen das 12.Jahr hin kommt das Kind in dieses Rückläufige hinein, und man kann dann anfangen, an den Kausalitätsbegriff zu appellieren auch in der Geschichte.
Vorher bereitet man dem Kinde im Grunde genommen etwas recht Schlimmes für das Leben zu, wenn man auf den Kausalitätsbegriff und das damit verknüpfte Verstandesurteil sieht. Denn sehen Sie: da ist ja erst der Ätherleib da. Gegen das 12. Jahr hin Pängt langsam der Astralleib an, geboren zu werden ; er wird dann voll geboren mit der Geschlechtsreife - aber vorher ist ja nur der Ätherleib da. Wenn Sie da dem Kinde Urteile von Ja und Nein einprägen oder es sich Begriffe einprägen lassen, so gehen ja die Dinge statt in den Astralleib in den Ätherleib hinein. Aber von was ist denn der Astralleib noch der Träger? Bedenken Sie, Sie werden aus dem Faktum der Geschlechtsreife es entnehmen können: der Astralleib ist der Träger der menschlichen Liebe. Er arbeitet natürlich schon vorher im Kinde, aber er ist nicht selbständig geboren. Dadurch pflanzen Sie dann das Ja und Nein, das Kritikurteil, statt in den Astralleib in den Ätherleib hinein. Wenn Sie es in den Astralleib zur richtigen Zeit hinempflanzen, dann fügen Sie dem Urteil, auch der Kritik, die Kraft der Liebe bei, die Kraft des Wohlwollens. Fügen Sie dem Kinde die Untat zu, es zu früh kritisieren zu machen, es zu früh auf Ja und Nein abzustimmen, dann stopfen Sie dieses Ja und Nein, diese Kritik, in den Ä ther-leib hinein. Der ist nicht wohlwollend: der ist aufsaugend, der ist übelwollend eigentlich, der wirkt zerstörend. Das tun Sie dem Kinde an, wenn Sie zu früh das Ja- oder Nein-Urteil - und ein Ja- und Nein-Urteil ist auch immer in der Kausalitätsvorstellung gelegen - dem Kinde beibringen. Den geschlossenen Vorgang schaut man an ; die Persönlichkeit, die bildhaft geschildert wird, schaut man an. Wenn man in der Geschichte epochenweise das Spätere mit dem Früheren verbindet, da urteilt man, da weist man ab, da nimmt man an. Da ist immer das Ja und Nein drinnen, und man bekommt zuletzt eben dasjenige
heraus, was eigentlich ein Sichsträuben ist gegen das, was einem als Urteil in der Welt entgegentritt. Man nimmt die Urteile der anderen nicht mit Liebe auf, sondern mit einer in einem liegenden zerstörerischen Kraft, wenn man die Urteilskraft zu früh entwickelt. Aus solchen Dingen kann man wirklich sehen, wie sehr es darauf ankommt, zur richtigen Zeit das Richtige im schulpflichtigen Alter zu tun.
Und dann bedenken Sie doch nur einmal den Übergang in dieser Beziehung vom Tier zum Menschen. Das Tier sehen Sie nach seiner Gestalt an. In der Gestalt liegt schon das, was das Tier tut; man schaut an, was das Tier tut. Beim Menschen muß man die Causa, die Ursache, suchen. Ja, sehen Sie, weil das Kind erst gegen das 12. Jahr reif wird, die Causa zu suchen, muß auch da der Punkt eintreten, wo es die Tierwelt synthetisch zusammenfaßt in der Gesamtheit des Menschen. Da handelt es sich darum, daß man das dem Kinde entgegenbringt als ein Erlebnis, was die innere Natur verlangt, daß es Erlebnis werde in einer bestimmten Zeit.
Nun werden Sie aber zugeben: da liegt ein großartig gewaltiger Umschwung in der kindlichen Natur zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Das Kind geht gewissermaßen mit seiner Seele den Weg ganz von innen nach außen. Denken Sie nur, daß das Kind bis gegen das 12. Jahr hin gar nicht erträgt, daß man ihm den Menschen schildert. Da beginnt es dies zu ertragen, begriffsmäßig, vorstellungsmäßig sich in dem Spiegel der Welt zu schauen. Es kann sich selber aushalten, ausstehen, indem man schildert, was der Mensch ist. Es ist wirklich ein vollständiges Umwenden der menschlichen Natur vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.
Nun liegt innerhalb dieses Zeitraumes ein sehr wichtiger Lebens-übergang. Er liegt für die meisten Kinder so zwischen dem 9. und 10. Jahr ; es ist das individuell, bei manchem Kind liegt es über das
10. Jahr hinaus. Da tritt für jedes Kind etwas ein, wo das Kind instinktiv, unbewußt vor einer Art Lebensrätsel steht. Dieses Umwenden von innen nach außen, dieses Gewahrwerden, daß man ein Ich ist und draußen die Welt ist - was man bisher miteinander verflochten hat -, das ist etwas, was das Kind nicht bewußt erlebt, aber was
das Kind erlebt durch innere Zweifel und Unruhe, die auftreten. Im Leibe drückt sich das so aus, daß in diesem Lebenspunkt die Atmung sich eigentlich erst richtig einschaltet in die Blutzirkulation. Das gleicht sich da aus. Es wird das dem Menschen angemessene Verhältnis hergestellt zwischen Puls und Atemzügen. Das ist das leibliche Korrelat dafür; das seelisch-geistige ist, daß das Kind jetzt in diesem Lebenspunkte uns als Lehrer und Erzieher ganz besonders braucht. Es geschieht ein Appell, der nicht in einer Frage, sondern in einer Art von Verhalten liegt, an den Lehrer oder Erzieher gerade in diesem Lebenspunkt.
Man muß sich nun das pädagogische Geschick aneignen, aus der Art und Weise des Kindes die große Lebensfrage, die das Kind jetzt an uns stellen will, im individuellen Falle richtig zu wägen. Was ist denn eigentlich diese Lebensfrage ? Nun, sehen Sie, bis zu diesem Lebenspunkte hat sich das selbstverständliche Autoritätsverhältnis eigentlich so herausgebildet, daß man als Lehrer und Erzieher dem Kinde die Welt ist. Für das Kind bewegen sich die Sterne, weil es weiß, daß sein Erzieher weiß, daß sich die Sterne bewegen. Alles ist eben gut und böse, schön und häßlich, wahr und falsch, weil es der Lehrer und Erzieher so in sich hat. Es muß alles, was von der Welt kommt, in einem gewissen Sinne durch Lehrer und Erzieher durchgehen ; das ist das einzig gesunde Verhältnis. Zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr, manchmal etwas später, stellt sich, nicht in Begriffen und Vorstellungen, aber in Gefühl und Empfindung, vor die Seele des Kindes die Frage: Ja, woher hat denn der Lehrer und Erzieher das alles ? Da beginnt nämlich plötzlich, wenn ich mich bildlich ausdrükken darf, dieser Lehrer und Erzieher durchsichtig zu werden. Man will hinter ihm die Welt sehen, die hinter ihm lebt. Da muß er standhalten ; da muß er gegenüber dem, was das Kind heranbringt, in dem Kinde die Überzeugung erhalten, daß er richtig in das Rückwärts, in die Welt, eingeschaltet ist ; daß er Wahrheit, Schönheit und Güte wirklich in sich trägt. Da prüft die unbewußte Natur des Kindes den Lehrer in einer ganz unerhörten Weise, möchte ich sagen. Sie prüft ihn, ob er nun wirklich die Welt in sich trägt, ob er würdig war, bis-her ihm der Repräsentant des ganzen Kosmos zu sein.
Und wiederum kann das nicht ausgesprochen werden. Würde man das in irgendeiner Form auch nur leise theoretisch vorführen durch Gründe oder dergleichen, dann würde die unbewußte Natur des Kindes, weil sie für Kausalität keinen Sinn hat, das als Schwäche, nicht als Stärke des Lehrers empfinden ; lediglich als Schwäche. Denn alles das, was man erst beweisen muß, lebt schon schwach in der Seele ; dasjenige, was stark in der Seele lebt, muß man ja nicht erst beweisen. Das geht auch in der Kulturentwickelung so. Ich will jetzt nicht inhaltlich über die Sache entscheiden, aber ich möchte Sie auf das Dynamische der Sache führen: Bis zu einem gewissen Zeitpunkte des Mittelalters haben die Leute gewußt, was das Abendmahl bedeutet. Da war man noch nicht ergriffen von der Notwendigkeit des Beweisens. Nun fingen plötzlich die Leute an, die Notwendigkeit des Beweisens dem Abendmahl gegenüber zu empfinden. Für den, der die Sache durchschaut, ist das nur ein Beweis dafür, daß die Leute eben nichts mehr von dem Abendmahl wußten. - Denn man beweistja nicht, daß einer ein Dieb ist, wenn man ihn gesehen hat, sondern nur wenn man ihn nicht gesehen hat ; wenn man ihn gesehen hat, benennt man ihn nur als Dieb. Das Beweisen bezieht sich immer auf das, was man nicht weiß, niemals aber auf dasjenige, was man wirklich weiß durch die Tatsachen des Lebens selber. Daher ist es so drollig, wenn die Leute den Zusammenhang zwischen der formalen Logik und der Wirklichkeit suchen. Es ist ungefähr gerade so, wie wenn emer den inneren Zusammenhang zwischen dem Wege, der ihn zu einem Berge hinführt, und dem Berge sucht. Der Weg ist nämlich dazu da, daß ich bis zum Berge komme ; dann beginnt der Berg. Die Logik ist nur dazu da, daß man bis zur Wirklichkeit kommt ; da beginnt erst die Wirklichkeit, wo die Logik aufhört.
Ja, daß man diese Dinge selber weiß, ist eben von ganz fundamentaler Bedeutung. Nicht darf man also in den Fehler verfallen, in diesem wichtigen Lebenspunkt dem Kinde beweisen zu wollen, daß man der richtige Repräsentant der Welt ist. Sondern man muß nun durch neues Verhalten dem Kinde die unmittelbare Empfindungsüberzeugung beibringen: Ja, der weiß ja noch viel mehr, als man bisher gedacht hat! Wenn das Kind weiß: der Lehrer kann sich steigern, er hat
ihm bisher noch gar nicht alle Seiten gezeigt, er hat sich bisher nicht ausgegeben, jetzt sagt er vielleicht ganz vertraulich zu dem Kinde etwas, wovon das Kind überrascht ist, so daß das Kind es wieder unbewußt empfindet, aufhorcht auf das Neue, das es von dem Lehrer erfahren hat - dann ist jetzt das richtige Verhältnis hergestellt. Also man muß sich etwas bewahren, vor allen Dingen auch für diesen Zeitpunkt bewahren können, wodurch man sich als Lehrer dem Kinde gegenüber steigern kann. Denn das ist die Lösung eines wichtigen Lebensrätsels in diesem Lebenspunkte: daß man sich für das Kind, für die Wahrnehmung des Kindes steigern kann, daß man plötzlich über sich hinauswächst. Das ist der Trost und die Kraft, die man dem Kinde in diesem Punkte geben muß, weil es schon mit diesem Ansinnen herankommt an den Lehrer, zu dem es die nötige Sympathie und Liebe entwickelt hat. Die anderen Lehrer, die werden eben die bittere Erfahrung machen, daß die Autorität nach und nach, wenn das Kind zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr steht, ausraucht, verduftet ; daß sie dann nicht mehr da ist. Dann werden diese Lehrer eben das Schreckliche versuchen, alles dem Kinde beweisen zu wollen, und dergleichen.
Ja, und wenn man sich nun einmal einen Sinn angewöhnt hat für solche Lebensbetrachtungen, dann kommt man auch auf anderes. Sehen Sie, es müssen die einzelnen Dinge, die man heranbringt an das Kind, durchaus zusammenhängen. Nun sagte ich Ihnen: wir lassen das Kind aus seinen eigenen Bildekräften heraus irgendwie malen, natürlich nicht mit Stiften, sondern mit wirklichen Farben. Dann merke ich: das Kind lebt mit den Farben. Nach und nach wird für das Kind - man muß nur selber eine Empfindung dafür haben, daß es so ist - das Blau etwas, was weggeht, nach der Ferne geht; das Gelb und Rot etwas, was herankommt. Das ist etwas, was bei dem Kinde auch schon im 7., 8. Jahr stark hervortritt, wenn man es nur nicht in diesem Alter quält mit irgendwie dressiertem Zeichnerischem und Malerischem. Wenn man das Kind freilich Häuser und Bäume malen läßt, wie sie in Wirklichkeit sind, so geht das nicht. Aber wenn man das Kind folgen läßt, so daß es das Gefühl hat: wohin ich die Hand bewege, da geht die Farbe - der Stoffder Farbe ist nur Nebensache-,
da lebt die Farbe auf unter den Fingern, da will sie sich fortsetzen irgendwo - wenn man das erreicht, so bekommt man etwas sehr Sinnvolles in der Seele des Kindes: Farbenperspektive. Das Kind bekommt das Gefühl, daß das rötende Gelb näherkommt, daß das Blauviolett fern und ferner geht. Da arbeitet man aus dem Intensiven heraus das, was man dann später mit dem Kinde auch erarbeiten soll: die Perspektive, die man dann in Linien durchführt. Es ist etwas furchtbar Schädliches, die Perspektive einem Kinde im späteren Lebensalter beizubringen, dem man nicht vorher eine Art intensiver Farbenperspektive beigebracht hat. Dadurch wird ja der Mensch in furchtbarer Weise veräußerlicht, wenn er sich gewöhnt, die quantitative Perspektive sich anzueignen, ohne vorher die intensive, die qualitative Perspektive sich angeeignet zu haben, die in der Farbenperspektive liegt.
Und in diesem Zusammenhang liegen dann die weiteren Zusammenhänge. Wenn Sie dem Kinde verwehren, intensiv in der Farben-perspektive zu leben, so wird das Kind niemals mit der richtigen Schnelligkeit lesen lernen. Immer mit der Einschränkung, die ich gestern gesagt habe: es kommt ja nicht darauf an, daß man das Lesen so schnell als möglich am Anfange dem Kinde beibringt. Aber das Kind bekommt geschmeidige Vorstellungen, geschmeidige Empfindungen und geschmeidige Willensaktionen aus diesen Farbenempfindungen heraus. Alles Seelische wird geschmeidiger. Vielleicht müssen Sie durch das alles, was hier verlangt wird, aus dem malenden Zeichnen, dem zeichnenden Malen das Lesen zu entwickeln, länger brauchen, um das Lesen an das Kind heranzubringen. Aber in dem Lebensalter, wo es dann darankommt, ist es dann doch eben möglich, das Lesen wirklich richtig an das Kind heranzubringen, ohne daß es im Körper, im ganzen Menschen zu flüchtig sitzt - wie es auch sein kann - und ohne daß es zu tief im Menschen drinnen sitzt und ihm förmlich jeder Buchstabe einen Ritz macht in der menschlichen Wesenheit.
Daß man in der richtigen Sphäre dasjenige drinnen hat, was das Seelisch-Geistige begreift, das ist es auch, worauf es ankommt. Niemals darf nach dem Maßstab geurteilt Werden, daß man sagt: Was soll das Kind so malen lernen, es braucht es ja nie im Leben! Das heißt: nur auf das Äußerliche sehen. Es braucht es nämlich ganz gewaltig,
und man muß eben schon etwas vom geistigen Menschenwe-sen verstehen, wenn man die Zusammenhänge, die für das Kind notwendig sind, verstehen will. Ebensowenig wie der Ausspruch «das verstehst du nicht»» gebraucht werden sollte, ebensowenig sollte jemals ein Skeptizismus bestehen über das, was das Kind braucht oder nicht. Was das Kind braucht, soll aus der Gesetzmäßigkeit der Menschennatur fließen. Fließt es da heraus, dann tut man instinktiv das Richtige. Dann ist man auch gar nicht trostlos, wenn das Kind einiges vergißt von dem, was es in sich aufgenommen hat. Denn die Dinge gehen dann überaus dem Wissen in das Können. Und das ist so wichtig, daß wir die Dinge später im Können haben. Wir werden sie nicht im Können haben, wenn wir mit Wissen überladen sind. Es ist notwendig, diese Dinge zu wissen und sie wirklich einzuführen in die pädagogische Praxis: daß man dem Gedächtnis nur so viel einverleibt, als eben von dem sozialen Leben gefordert wird - daß es keinen Sinn hat, das Gedächtnis zu überladen.
Und da kommen wir dann auf diejenigen Fragen der Lebenspraxis, die sich vorzugsweise ergeben aus dem Verhältnis des einzelnen individuellen Menschen zu dem sozialen Wesen, das ringsherum ist, zu dem Volkswesen, dem sozialen Wesen der gesamten Menschheit usw. Denn da müssen wir auch durchaus darauf hinschauen, daß wir das Wesen der Menschennatur nicht verletzen, wenn wir die von außen herankommenden sozialen Forderungen in die Erziehungspraxis einführen wollen.
SECHSTER VORTRAG Dornach, 20. April 1923
Wenn man das Verhältnis des heranwachsenden Menschen zur allgemein menschlichen Umgebung ins Auge faßt, dann ergeben sich vorzugsweise die Grundsätze der sittlichen und der sozialen Erziehung. Und auf diese wollen wir heute zunächst, wenn das auch leider alles nur in skizzenhafter Weise geschehen kann, in KUrze einen Blick werfen. Auch da handelt es sich darum, daß man sich möglichst anzupassen weiß an die Individualität des heranwachsenden Menschen. Aber man wird auch zu berucksichtigen wissen, daß man ja als Erziehender, als Unterrichtender selber aus dem sozialen Leben der Umgebung heraus ist und eigentlich in Person dieses soziale Leben und die sittlichen Anschauungen der Umgebung an das heranwachsende Kind eben heranbringt. Auch da muß gerade dasjenige in pädagogisch-didaktischer Beziehung getan werden, was nun wirklich Aussicht bietet, daß es einströmt in die eigene Wesenheit des Menschen, die man eben dazu in der Art erkennen muß, wie das in den letzten Tagen hier angedeutet worden ist.
Es ist ja in der Tat so, daß außerordentlich viel abhängt von der Art und Weise, wie man gerade in einem bestimmten Lebensalter die Dinge an das Kind heranbringt. Nun gibt es drei Tugenden, die be-trachtet werden müssen, auf der einen Seite in bezug auf die Ent-wickelung des Kindes, aber auf der anderen Seite auch im Zusammenhang mit dem ganzen sozialen Menschenleben. Es sind die drei Grundtugenden. Und diese drei Grundtugenden sind erstens dasjenige, was leben kann in dem Dankbarkeitswillen, zweitens dasjenige, was leben kann in dem Liebewillen, drittens dasjenige, was leben kann in dem Pflichtwillen. Im Grunde genommen sind diese drei Tugenden doch die Urtugenden des Menschen. Alle anderen liegen in gewisser Weise darin beschlossen.
Nun ist der Blick der Menschheit viel zuwenig auf dasjenige gerichtet, was ich hier in diesem Zusammenhang die Dankbarkeit nennen
möchte. Dankbarkeit ist aber eine Tugend, die, wenn sie im vollen Sinne in der menschlichen Seele sich ausleben soll, etwas ist, was wachsen muß mit dem Menschen, was in den Menschen bereits einströmen muß in der Zeit, wo die Wachstumskräfte nach innen zu am allerlebendigsten und am allermeisten plastisch sind. Die Dankbarkeit ist gerade etwas, was sich entwickeln muß aus jenem Verhältnis des Leiblich-Religiösen, das ich in diesen Tagen angeführt habe als herrschend beim Kinde von der Geburt ab bis zum Zahnwechsel hin. Aber es ist auch diese Dankbarkeit etwas, was sich in diesem Lebens-abschnitt bei einer richtigen Behandlung des Kindes ganz von selbst ergibt. Strömt aus dem Innern des Kindes das, was da in der Nachahmung einfließt, in der richtigen Verehrung, in der richtigen Liebe zu demjenigen aus, was in der Umgebung des Kindes an Eltern oder sonstigen Erziehern lebt, so wird alles das, was da im Kinde von der Seele ausströmt, wirklich von Dankbarkeit durchflossen sein. Ich möchte sagen: wir müssen uns nur so benehmen, daß wir des Dankes wert und würdig sind, dann strömt uns schon von den Kindern dieser Dank auch zu - gerade in dem ersten Lebensabschnitt. Und dann entwickelt sich diese Dankbarkeit so, daß sie heranwächst; heranwächst, indem sie in die Wachstumskräfte hineinströmt, welche die Glieder groß werden lassen, welche selbst die chemische Zusammensetzung des Blutes und der anderen Säfte ändern. Im Leibe lebt diese Dankbarkeit, und sie muß im Leibe leben, sonst sitzt sie nicht gründlich genug im Menschen. Falsch wäre es, etwa das Kind zu ermahnen: du sollst dankbar sein für dasjenige, was dir deine Umgebung erweist. Dagegen sollte man in die Lebensformen wie selbstverständlich hereinbringen das Dankbarkeitsgefühl, indem man schon das Kind zu-schauen läßt, wie man selbst als Erwachsener für die Dinge, die einem der andere Mensch freiwillig gibt oder erweist, dankbar ist und das auch ausdrückt; indem man das Kind also auch da an die Nachahmung des Dankbarkeitsgetühls, das in der Umgebung herrscht, gewöhnt. Eignet das Kind sich von selbst, nicht durch Ermahnungen an, recht häufig zu sagen: «Ich danke» - nicht auf ein Gebot hin, sondern auf Nachahmung hin -, so ist das etwas, was außerordentlich günstig wirkt für die ganze Entwickelung des Menschen. Denn gerade
aus dem Dankbarkeitsgefühl, das man viel zuwenig berücksichtigt, das sich im ersten Lebensabschnitt im Kinde festlegt, entwickelt sich nämlich ein umfassendes, universelles Dankbarkeitsgefühl gegenüber der ganzen Welt. Und das ist so wichtig, daß der Mensch sich dieses Dankbarkeitsgefühl gegenüber der ganzen Welt aneignet. Das braucht nicht immer ins Bewußtsein heraufzusteigen, aber es kann unbewußt empfindungsgemäß im Menschen leben, daß er dankbar dafür ist, wenn er nach irgendeiner Anstrengung in eine Gegend kommt, wo ihm eine schöne Wiese begegnet mit vielen Blumen. Es kann im Menschen unbewußt empfindungsgemäß auftauchen ein Dankbarkeitsgefühl für alles, was er in der Natur sieht. Es kann auftauchen ein Dankbarkeitsgefühl jeden Morgen, wenn die Sonne neu heraufkommt. Es kann auftauchen ein Dankbarkeitsgefühl gegenüber allen Naturerscheinungen. Und in entsprechender Weise abgestuft entwickelt sich, wenn wir uns eben in der richtigen Weise den Kindern gegenüber verhalten, ein Dankbarkeitsgefühl gegenüber alledem, was einem die Menschen geben, was einem die Menschen erweisen, was sie einem sagen, wie sie einem zulächeln, wie sie einen behandeln usw. Dieses universelle Dankbarkeitsgefühl ist die Grundlage für die wahrhafte Religiosität des Menschen. Man weiß nämlich nicht immer im Leben, daß gerade dieses universelle Dankbarkeitsgefühl, wenn es den Menschen in seiner Ganzheit ergreift, dasjenige ist - und dazu muß es ihn schon im ersten Lebensabschnitt ergreifen-, was dann etwas ganz anderes noch erzeugt. Es ist nämlich im Menschenleben so, daß die Liebe selbst in alles einströmt, wenn nur durch das Leben die entsprechende Gelegenheit gegeben ist, diese Liebe entwickeln zu können. Für die intensivere Entwickelung der Liebe bis ins Physische hinein ist ja erst Gelegenheit im zweiten Lebensat» schnitt zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Aber gerade jene zarte Blüte Liebe, die noch ohne nach außen zu wirken tief im Innern des Kindes wurzelt, die setzt sich fest mit dem Heran-entwickeln der Dankbarkeit. Und die Liebe, die im ersten kindlichen Lebensabschnitt an der Dankbarkeit sich erzeugt, das ist die Gottes-liebe. Man soll sich klar sein darüber, daß, wie man einpflanzen muß die Wurzeln einer Pflanze in den Boden. damit man später die Blüte
hat, man auch einpflanzen muß die Dankbarkeit, weil diese die Wurzel der Gottesliebe ist. Denn die Gottesliebe wird sich eben als die Blüte gerade aus der Wurzel der universellen Dankbarkeit entwickeln.
Man muß auf solche Dinge aufmerksam sein, weil man ja abstrakt gewöhnlich weiß, was im Leben sein soll; aber konkret weiß man es nicht. Abstrakt kann man natürlich leicht die Forderung aufstellen:
die Menschen sollen die Gottesliebe in sich tragen. Das ist ja so richtig wie möglich. Aber abstrakte Forderungen haben das Eigentümliche, daß sie sich in ihrer Abstraktheit nicht verwirklichen.
Darf ich noch einmal auf etwas zurückkommen, was ich in den letzten Tagen gesagt habe. Man könne dem Ofen gut zusprechen: Sieh einmal, du bist ein Ofen; wir haben dich dahin gesetzt, damit du das Zimmer warm machst; dein kategorischer Imperativ, der richtige kategorische Ofen-Imperativ ist, daß du das Zimmer warm machst. -Das Zimmer wird davon nicht warm! Aber ich kann diese ganze Rede weglassen und den Ofen einheizen mit Holz, dann macht der Ofen, auch wenn ich ihn nicht auf seinen kategorischen Ofen-Imperativ hinweise, das Zimmer warm. Und so ist es auch, wenn wir das Richtige im richtigen Lebensalter an das Kind heranbringen. Bringen wir also Dankbarkeit im ersten Lebensabschnitt an das Kind heran, so wird sich, wenn wir später das andere vollbringen, was ich noch nachher sagen werde, aus der Dankbarkeit gegenüber der ganzen Welt, gegenüber dem Kosmos, zuletzt aus jenem Dankbarkeitsgefühl, das eigentlich alle Menschen beseelen müßte, dem Dankbarkeitsgefühl dafür, daß man überhaupt da ist in der Welt - es wird sich aus diesem Dankbarkeitsgefühl heraus dann entwickeln gerade die innerste, wärmste Frömmigkeit; jene Frömmigkeit, die nicht auf den Lippen, in den Gedanken sitzt, sondern die den ganzen Menschen erfüllt, die auch ehrlich und aufrichtig und ganz wahr ist. Aber die Dankbarkeit muß eben wachsen. Und wachsen kann Seelisch-Geistiges in so intensiver Weise, wie das geschehen muß mit der Dankbarkeit, nur wenn diese Dankbarkeit herausentwickelt wird aus den zarten Regungen des Kindes zwischen der Geburt und dem Zahnwechsel. Dann ist diese Dankbarkeit die Wurzel der Gottesliebe. Sie begründet die Gottesliebe.
Und wenn wir das Kind in die Volksschule hereinbekommen, dann werden wir als Lehrer oder Erzieher stark hingewiesen darauf, zu betrachten, wie der Lebenslauf bis zu diesem schulpflichtigen Alter war. Und eigentlich müßte immer ein inniger Kontakt da sein mit dem Elternhaus, mit dem, was vorangegangen ist. Dieser Kontakt müßte immer gesucht werden. Der Lehrende und Erziehende soll eine deutliche Vorstellung von dem haben, was - einfach durch die sozialen Verhältnisse entwickelt - da ist dadurch, daß das Kind in einer bestimmten Weise hereingestellt war in ein Milieu. Und man wird dann immer Gelegenheit haben, wenn man die Dinge nur erkennt, sie auch noch während des schulpflichtigen Alters in dieser oder jener Weise zu korrigieren. Aber - man muß sie eben in der richtigen Weise erkennen. Dazu ist der Kontakt mit dem Elternhause notwendig. Es ist notwendig, daß man in sorgfältiger Weise hin-schaut: was kann das Kind von dieser oder jener Mutter gesehen und nachahmend in sich erbildet haben? Das ist so ungeheuer wichtig zu beachten, wenn das Kind die Volksschule beginnt. Das gehört ebenso zur Pädagogik und Didaktik wie dasjenige, was ich in der Klasse vollbringe. Man darf diese Dinge von einer wirklichen Pädagogik und Didaktik eben nicht ausschließen.
Und nun haben wir gesehen, daß zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife eine selbstverständliche Autorität zwischen dem Lehrenden und Erziehenden und dem Kinde sich entwickeln muß. An dieser selbstverständlichen Autorität wächst nun heran die zweite Grundtugend, die Liebe. Denn der menschliche Organismus ist gerade in der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife eben als Organismus auch geneigt, sich zur Liebe hin zu entwickeln. Nun, man muß in unserem heutigen Zeitalter gerade die Tugend der Liebe im richtigen Lichte sehen. Denn der Materialismus hat allmählich tatsächlich die Liebe außerordentlich stark zu einer vereinseitigten Vorstellung gebracht. Und da dieser Materialismus vielfach die Liebe nur in der Geschlechtsliebe sehen will, so führt er alle anderen Liebesäußerungen eigentlich auf versteckte Geschlechtsliebe zurück. Und wir haben ja sogar in demjenigen, was ich vorgestern bezeichnete als Dilettantismus zum Quadrat - nicht bei allen, viele lehnen
das ab-, aber wir haben bei vielen Psychoanalytikern geradezu eine Zurückführung von sehr vielen Lebenserscheinungen, die damit gar nichts zu tun haben, auf das sexuelle Element. Demgegenüber muß gerade der Lehrende und Erziehende sich etwas angeeignet haben von dem Universellen der Liebe. Denn nicht nur die Geschlechtsliebe bildet sich aus in dem Zeitalter vom Zahnwechsel bis zur Geschlechts-reife, sondern überhaupt das Lieben, das Lieben für alles. Die Geschlechtsliebe ist nur ein Teil der Liebe, die sich heranbildet in diesem Lebensalter. Man kann in diesem Lebensalter sehen, wie sich die Naturliebe heranbildet, wie sich die allgemeine Menschenliebe heranbildet, und man muß eben einen starken Eindruck davon haben, wie die Geschlechtsliebe nur ein Spezialkapitel ist in diesem allgemeinen Buche des Lebens, das von der Liebe redet. Wenn man das versteht, so wird man auch die Geschlechtsliebe erst in der richtigen Weise ins Leben hinein orientieren können. Heute ist im Grunde genommen gerade für viele Theoretiker die Geschlechtsliebe der Mc-loch geworden, der alle Liebespflanzen eigentlich nach und nach aufgefressen hat.
Die Liebe entwickelt sich in der Seele in anderer Weise als die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit muß wachsen mit dem Menschen; daher muß sie eingepflanzt werden injenem Lebensalter, wo die Wachstumskräfte am stärksten sind. Die Liebe, die muß erwachen. Es ist tatsächlich in der Entwickelung der Liebe etwas wie ein Vorgang des Erwachens. Die Liebe muß auch in ihrer Entwickelung in seelische-ren Regionen gehalten werden. Dasjenige, in das der Mensch hineinwächst, indem er die Liebe in sich allmählich entwickelt, ist ein langsames, alimähliches Erwachen, bis zuletzt das letzte Stadium dieses Erwachens eintritt. Beobachten Sie einmal das gewöhnliche alltägliche Erwachen: zuerst noch sehr von Dumpfheit durchzogene Vorstellungen, vielleicht auftretende Empfindungen... die Augen entringen sich langsam dem Geschlossensein... ein Von-außen-zu-Hilfe-Kommen - zuletzt das Übergehen des Aufwache-Momentes in Physisches.
So ist es nämlich - nur eben, daß es beim Kinde durch ungefähr 7 Jahre hindurch dauert - mit dem Erwachen der Liebe. Zuerst regt
sich die Liebe in alledem, was ja so sympathisch gerade beim Kinde anzusprechen ist, wenn wir ihm die ersten Dinge in der Schule beibringen wollen. Wenn wir da anfangen mit dieser Bildhaftigkeit, die ich geschildert habe, an das Kind heranzutreten, dann sehen wir die Liebe gerade dieser Betätigung entgegenkommen. Und es muß alles in diese Liebe getaucht werden. Da hat die Liebe etwas ungemein Seelisches, etwas ungemein Zartes. Da ist man, wenn man sie mit dem gewöhnlichen Erwachungsakte vergleicht, eigentlich noch tief drinnen im Schlafe oder im schlafenden Träumen des Kindes - der Lehrer soll das natürlich nicht sein, obwohl es oftmals gerade er ist, der im schlafenden Träumen drinnen ist. Das weicht dann einem stärkeren Ruck ins wache Leben. Und bei alledem, was ich gestern und vorgestern geschildert habe für die Zeit zwischen dem 9. und 10. Jahr, dann insbesondere gegen das 12.Jahr hin, erwacht die Naturliebe. Wir werden sie erst da richtig herauskommen sehen.
Vorher ist etwas ganz anderes da gegenüber der Natur: die Liebe zu all dem feenhaft Belebten in der Natur, was bildhaft für das Kind geschaffen werden muß im Behandeln des Kindes. Dann erwacht die Liebe zu den Realitäten in der Natur. Und da haben wir eine ganz besonders schwere Aufgabe: in dasjenige, was nun in diesen Lebensabschnitt hineinfällt - die Kausalität, die Behandlung des Unlebendigen, die Behandlung der geschichtlichen Zusammenhänge, die ersten Anfangsgründe der Physik, der Chemie -, in all das haben wir als Lehrer die große Aufgabe -ja, ich mache keinen Scherz, ich sage das mit allertiefstem Ernst: Grazie hineinzubringen. Es ist für den Unterricht und für die Erziehung ganz besonders notwendig, daß wir zum Beispiel in die Geometrie, in den Physikunterricht Grazie hineinbringen, wirkliche Grazie; es muß der Unterricht graziös werden, er darf vor allen Dingen nicht sauer sein. Gerade daran leidet das Unterrichten und Erziehen in dem Lebensabschnitt so zwischen 1 1 1/2 oder 1 1 3/4 Jahren und dem 14. und 15.Jahr in diesen Fächern so sehr, daß er oftmals so sauer ist, daß, was gesagt werden muß über die Lichtbrechung, über die Lichtreflektion, über die Flächenberechnung der Kugelkalotte usw., nicht mit Grazie, sondern in Säuerlichkeit vorge-bracht wird.
Gerade für diesen Lebensabschnitt muß man eines berücksichti-gen: der Lehrer muß hineintragen in die Schu]e ein seelisches Atmen, das sich dann in einer ganz merkwürdigen Weise den Kindern mitteilt. Ein seelisches Atmen. Atmen besteht in Ein- und Ausatmen. Sehen Sie, meistens oder doch vielfach atmen die Lehrer bei dem Physik- und Geometrieunterricht seelisch bloß aus. Sie atmen nicht ein-und das Ausatmen erzeugt auch da das Säuerliche; das seelische Ausatmen meine ich, das in trockener Weise nur beschreibt, das alles durchwaltet mit einem persönlich angeeigneten Riesenernst. Der Ernst kann schon da sein, aber nicht der Riesenernst. Und das seelische Einatmen, das besteht nämlich in dem Humor, in dem Humor, zu dem alles Veranlassung gibt im Klassenzimmer und sonst, wo man Gelegenheit hat, mit dem zu Erziehenden und zu Unterrichtenden beisammen zu sein. Das einzige Hindernis, das da sein kann für die Humor-Entwickelung, das kann nur der Lehrer sein; die Kinder sind es ganz gewiß nicht, und ganz gewiß ist es auch nicht all das, was man zu lehren hat, wenn man es richtig hineinstellt in diesen Lebensabschnitt. Das einzige Hindernis kann wirklich nur der Lehrer sein. Wenn der Lehrer es wirklich dazu bringt, während des Unterrichts nicht selbst noch zu kauen an dem Inhalt des Unterrichts, dann kann er nach und nach sogar dazu aufrücken, daß tatsächlich das reflektierte Licht unter Umständen auch Witze macht, daß die Kugelka-lotte, wenn sie sich berechnen muß ihrem Flächeninhalte nach, lächelt. Das alles muß natürlich nicht in zwangsweise herbeigeholten Witzen geschehen. Die Dinge müssen in den Humor getaucht werden, sie müssen durchaus in die Sache selbst hineingestellt werden und aus der Sache herausgeholt werden. Das ist es, worauf es ankommt. Die Veranlassung muß in den Dingen selbst gesucht werden. Vor allen Dingen: man soll gar nicht nötig haben, sie zu suchen. Man soll höchstens als gut vorbereiteter Lehrer nötig haben, Disziplin hineinzubringen in dasjenige, was einem beim Unterricht alles ein-fällt. Es fällt einem nämlich, wenn man gut vorbereitet ist, alles mögliche ein. Aber das Gegenteil ist auch da: falls man nicht gut vorbereitet ist, fällt einem nichts ein, weil man da eben zu kauen hat an dem Unterrichtsstoff; Das verdirbt die Ausatmung und läßt die frische,
humorvolle Luft der Seele nicht herein. - Also das ist gerade auf dieser Unterrichtsstufe außerordentlich notwendig.
Wenn der Unterricht nun so verläuft, dann geschieht das Aufwachen so, daß die menschliche Seele und der menschliche Geist zuletzt die richtige Stellung haben, wenn der letzte Akt des Aufwachens, das Herankommen der Geschlechtsreife, wirklich auftritt. Das ist nämlich tatsächlich dann dasjenige, wo etwas, was sich zuerst in zarter, dann in stärkerer Weise in der Seele entwickelt hat, zuletzt die Körperlichkeit in der richtigen Weise ergreifen kann.
Nun werden Sie vielleicht sagen: Ja, wie muß man sich denn als Lehrer selber heranbilden, um in dieser Weise zu wirken? Sehen Sie, da kommt etwas in Betracht, was ich bezeichnen möchte als das Soziale der Lehrerbildung, auf das viel zu wenig gesehen wird. Es steckt noch viel zuviel in der Lehrerbildung von dem darinnen, was ein gewisses Zeitalter - nicht die alten Zeiten, aber ein gewisses Zeitalter-mit der Lehrerschaft verbunden hat. Die Lehrerschaft wurde doch nicht in dem Grade in der allgemeinen Menschensozietät drinnen geachtet und verehrt, wie sie das sein sollte. Und nur wenn die menschliche Gesellschaft der Lehrerschaft die richtige Achtung entgegenbringt, nur wenn sie in dem Lehrer wirklich sieht - ich meine nicht nur dann sieht, wenn man eine politische Rede hält -, sondern mit dem Gefühl wirklich dasjenige sieht, was immerzu die neuen Einschläge in die. Zivilisation bringen muß - nur in einem solchen Verhältnis entwickelt sich das, was der Lehrer als Rückhalt braucht. Und eine solche Anschauung, oder vielleicht besser gesagt eine solche Empfindung, wird in die Lehrerbildung vor allem das hineintragen, was eine umfassende Lebensauffassung ist. Denn der Lehrer braucht eine umfassende Lebensauffassung. Der Lehrer braucht ein lebendiges Vollhineingestelltsein ins Leben. Der Lehrer braucht nicht bloß ein fachmännisch ihm Zugeführtes in Pädagogik und Didaktik, wie man es hat - er braucht nicht bloß ein Zugerichtetsein auf das Unterrichten in diesem oder jenem Lehrfach, sondern er braucht vor allen Dingen etwas, was sich in ihm selbstjederzeit erneuert. Er braucht eine ihn durchseelende Lebensauffassung. Ein tiefes Verständnis des Lebens überhaupt braucht er. Er braucht viel mehr, als er auf die Lippen
nehmen kann, wenn er vor den Kindern steht. Das ist etwas, was eben gerade in die Lehrerbildung hineinfließen muß. Und man sollte eigentlich auch die pädagogische Frage im strengsten Sinne als eine soziale Frage betrachten. Die aber umfaßt sowohl den Unterricht in der Schule wie auch die Entwickelung der Lehrerschaft selber.
Nun sehen Sie, dasjenige, was hier vertreten wird als Pädagogik und Didaktik für den gegenwartigen Zeitpunkt der Menschheitsentwickelung, soll durchaus nicht so gemeint sein, als ob es aufrührerisch, als ob es radikal umstürzlerisch wirken wollte. Es wäre ein tiefes Mißverständnis, wenn man das glauben würde. Es soll sich durchaus handeln um dasjenige, was man, ohne zu irgendwelchen Radikalismen zu kommen, in die Gegenwart einführen kann, wenn man eben nur auf es selber sieht. Nur darum kann es sich handeln. Aber man möchte doch sagen: gerade das soziale Betrachten der pädagogischen Fragen, das ist etwas, was uns auf vieles auch im Leben hinweist. Und so möchte ich etwas jetzt erwähnen, nicht eigentlich, um das dem Inhalte nach jetzt etwa in der Gegenwart vertreten zu wollen, etwa damit agitieren zu wollen, sondern nur um zu illustrieren, gleichsam um auszusprechen: das muß einmal kommen. Die Gegenwart kann das noch nicht machen - also betrachten Sie das bitte nicht als Radikalismen, was ich jetzt aussprechen möchte.
Sehen Sie, in der Gegenwart macht man Leute zu Doktoren, die eigentlich im Grunde genommen in dem, was sie bis zum Doktor-werden durchgemacht haben, gar nicht erprobt sind. Man ist nämlich durchaus nicht erprobt auf chemisches oder geographisches oder geclogisches Können, wenn man in dem Zustande ist, in dem man heute sehr häufig zum Doktor gemacht wird. Sondern man ist in dieser Möglichkeit, so etwas zu haben, erst dann, wenn man die Probe daraufhin abgelegt hat, daß man es in richtiger Weise lehrend und er-ziehend einem anderen übermitteln kann. Und fürjenenLebenspunkt, wo der Mensch auf irgendeiner Stufe die Probe dafür abgelegt hat, daß er dasjenige, was er in sich aufnimmt, auch lehrend und erziehend einem anderen beibringen könnte, sollte es eigentlich aufgehcben werden, die Menschen zu Doktoren zu machen. Sehen Sie, da steckt etwas in den Volksinstinkten drinnen, was außerordentlich
weise ist. Die Volksinstinkte nennen eigentlich nur den einen Doktor, der heilen kann, der Proben darüber liefert, daß er heilen kann; der also im lebendigen Tun drinnen steckt, nicht bloß im Wissen von der Medizin. Nun haben sich zwei Begriffe aus einem gebildet, die Begriffe Erziehen und Heilen. Das Erziehen wurde in älteren Zeiten auch als ein Heilen gedacht. Der Prozeß des Erziehens galt auch als ein Gesundmachen des Menschen. Weil man, wie ich schon angedeutet habe, an dem Menschen fand, daß er zuviel von dem bloß Vererbten an physischen Dingen in sich hat, war das Erziehen ein Heilen. Wenn man sich im alten Sinne terminologisch ausdrückt, kann man sogar sagen: ein Heilen von der Erbsünde. So daß die Heilprozesse, die der Doktor vornimmt, nur eben ein wenig auf einem anderen Niveau stehen, aber im Wesen dasselbe sind, was auch der Lehrer vornimmt. Der Lehrer ist für eine umfassende Weltanschauung ebenso ein Heiler, wie der Arzt ein Heiler ist. Und so könnte schon auch jenes soziale Gewicht damit zusammenfallen, welches ernste Bezeichnungen - die Bezeichnungen haben ja doch eine Bedeutung im sozialen Leben - dann geben können, wenn ins Bewußtsein überginge: aus demjenigen, der erprobt ist, der im Leben das anwenden kann, was er sonst bloß wissend besitzt - aus dem soll erst ein Doktor gemacht werden, das heißt: ihm wird diese Würde zuerkannt. Weil das eigentlich ja sonst eine bloße Etikette ist.
Nun, wie gesagt, das ist nicht etwas, was ich für die Gegenwart agitatorisch fordern will. Ich würde das nie in eine andere Rede als in eine pädagogische hineinverweben. Ich weiß genau zu unterscheiden, welche Forderungen man in der Gegenwart ausführen kann und welche Forderungen sich in der Gegenwart so ausnehmen, wie wenn man zugemachte Türen - nicht offene Türen, sondern zugemachte Türen - einrennen wolle. Derjenige, der wirklich etwas im Leben erreichen will, der stellt nicht abstrakte, ferne Ideale auf, an denen er entweder das Genick bricht oder sich die Stirne zerstößt, sondern der versucht immer im Einklang mit dem Leben zu sein. Dann kann man auch zur Illustration desjenigen, was in der Gegenwart möglich ist, das benützen, was in der Zukunft kommen soll. Denn was ich eben ausgesprochen habe, kann nur die Forderung einer fernen Zukunft
sein. Aber fühlen können wir die Würde, die im sozialen Leben gerade der Lehrerschaft zukommen sollte. Und es kommt mir darauf an, daß wir uns diese Würde illustrieren durch so etwas, wie ich es eben ausgesprochen habe. Und wenn der Lehrer das gleichsam als einen Rückhalt hat, was ich eben angedeutet habe, dann wird sich innerhalb der selbstverständlichen Autorität, die in der Schule walten soll, eben auch die Liebe als richtiges Erwachen von Stufe zu Stufe zeigen. Die Dinge haben ihren Ursprung manchmal in etwas ganz anderem, als man vermeint.
Und so wie die Gottesliebe in der Dankbarkeit ihre Wurzel hat, so hat nun wiederum die richtige moralische Impulsivität in der Liebe ihren Ursprung, welche ich eben angedeutet habe. Denn alles übrige begründet nicht die wahre ethische Tugend. Die wahre ethische Tugend wird nur begründet durch die Menschenliebe. Diese Menschenliebe, die es macht, daß wir nicht so, wie es in der Gegenwart viel-fach der Fall ist, nebeneinander vorbeigehen und uns eigentlich gar nicht kennen, weil wir kein Auge mehr haben für die individuellen Eigenschaften des Nächsten - diese allgemeine Menschenliebe, die auf menschliches Verständnis ausgeht, sie erwacht ebenso zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, wie die Dankbarkeit wächst zwischen der Geburt und dem Zahnwechsel. Alles müssen wir tun in der Schule, um diese allgemeine Menschenliebe zum Erwachen zu bringen.
Was ist es denn, das in der Umgebung für das Kind im ersten Lebens abschnitt bis zum Zahnwechsel geschieht? Die Menschen tun etwas in der Umgebung des Kindes. Aber das, was das Kind aufnimmt von dem Tun der Menschen, das sind nicht die Handlungen der Menschen. Das Kind hat noch gar kein Wahrnehmungsvermögen für die Handlungen der Menschen. Sondern alles, was das Kind in der Umgebung wahrnimmt,das sind für das Kind sinnvolle Gebärden. Im ersten Lebensabschnitt haben wir es in der Tat zu tun mit einem Verständnis für sinnvolle Gebärden. Und sinnvolle Gebärden ahmt das Kind nach. Und aus der Wahrnehmung der sinnvollen Gebärden entwikkelt sich das Dankbarkeitsgefühl und dann aus dem Dankbarkeitsgefühl der Dankbarkeitswille.
Auch das Kind vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, besonders in den ersten Jahren, nimmt noch nicht Handlungen wahr in seiner Umgebung, sondern alles, was es wahrnimmt, selbst das, was die Menschen in der Umgebung durch ihre Bewegungen tun, durch ihr sonstiges Handeln eben tun, das ist für das zweite Lebensalter vom Zahnwech sel bis zur Geschlechtsreife nun nicht mehr bloß eine Summe von sinnvollen Gebärden, sondern eine bedeutungsvolle Sprache. Für das Kind vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife ist auch dasjenige, was in seiner Umgebung getan wird, nicht bloß das, was gesprochen wird, eine bedeutungsvolle Sprache. Es ist nicht so sehr das, was der Erwachsene sagt, das Wichtige für das Kind.
#Bild s. 127
oder philiströs oder gar schlampig, das ist ein ungeheurer Unterschied.
Aber das, was darin wirkt, das ist, was es im Menschenleben bedeutet. So «Blatt» zu schreiben, oder es so zu schreiben (siehe oben), alles ist eine bedeutungsvolle Sprache. Und eine bedeutungsvolle Sprache ist es auch, ob der Lehrer anständig, würdevoll ins Klassenzimmer tritt, oder ob er als Stutzer hereintritt - wie man in einem bestimmten Dialekt sagt. Und eine bedeutungsvolle Sprache ist es, ob der Lehrer während des Unterrichtes immer besonnen ist, so daß dies für das Kind die Bedeutung hat: er greift immer nach dem richtigen Gegenstand, oder ob es ihm passiert, daß, wenn er im Winter weggeht, er sich das Handtuch, mit dem er die Tafel abgewischt hat, statt des Halstuches umbindet. Aber diese Dinge wirken nicht als Handlungen, diese Dinge wirken als Bedeutung. Und sie wirken sowohl in ihrer schlimmen, unschönen, wie auch in ihrer liebenswürdigen Weise durch ihre Bedeutung. Man muß sich nur klar sein, daß da
noch nicht der Handlungswert in alledem drinnen liegt, sondern der Bedeutungswert.
Da können nun auch Handlungen liebenswürdig sein, die vielleicht einem sonst, für sich hingestellt, etwas Lächerliches haben. Ich habe zum Beispiel einen Lehrer gehabt von meinem 13. bis zu meinem 18. Lebensjahr - ich betrachte ihn als meinen allerbesten Lehrer: der fing nie die Stunde an, ohne daß er sich leise schneuzte. Es würde einem riesig gefehlt haben, wenn er das einmal nicht getan hätte. Nun sage ich nicht, daß es nötig gewesen wäre für den Lehrer, das sich auszudenken und es zu machen, sondern da handelt es sich wirklich um Dinge, bei denen man fragen soll, ob es nötig ist, daß der Betreffende sie sich abgewöhnt, wenn sie instinktiv bei ihm festsitzen. Das ist etwas ganz anderes.
Auch das habe ich nur zur Illustration angeführt. Denn das, um was es sich handelt, ist, daß alles, was der Lehrer in diesem Lebensabschnitt vor dem Kinde macht, eine bedeutungsvolle Sprache ist, daß er durch das alles zu dem Kinde spricht. Das, was er in den Worten sagt, ist nur ein Teil dessen, was er zu dem Kinde spricht. Da spielen allerdings ungeheuer viele unbewußte Dinge herein, die ganz in den Tiefen des Empfindungslebens liegen. Da hat das Kind zum Beispiel eine ungemein feine Empfindung dafür - die es sich nicht mit Verstandesbegriffen zum Bewußtsein bringt -, ob der Lehrer während der Stunde etwas kokettiert mit dem oder jenem im Unterricht, oder ob er ein ganz natürlich sich gebender Mensch ist. Das bedeutet für das Kind ein Ungeheures im Unterricht. Und wie ich schon angedeutet habe in der Diskussion: einen ungeheuren Unterschied bedeutet es für das Kind, ob der Lehrer so weit vorbereitet ist, daß er das Buch oder das Heft entbehren kann. Denn das Unbewußte des Kindes sagt sich, wenn der Lehrer mit dem Buch oder mit dem Heft dasteht und unterrichtet: Wozu soll ich denn das eigentlich wissen, da er es selber nicht weiß! Man ist doch auch ein Mensch! Das ist ein vollendeter Mensch, wir sind erst werdende Menschen, und wir sollen uns nun anstrengen, zu wissen, was der selber nicht weiß! -Das ist etwas, was im Unbewußten des Kindes ungeheuer tief sitzt, und was nicht wieder auszubessern ist, wenn es sich in dieses Unbewußte
hineingesetzt hat. Und das begründet eben, daß wirjenes feine, unbefangene Verhalten zu den Kindern in diesem Lebensalter nur gewinnen, wenn wir - es muß schon die Pedanterie gesagt werden -, wenn wir uns ordnungsmäßig vorbereiten, für alles so vorbereiten, daß wir mit dem Inhalte ganz fertig sind, daß der in uns lebt wie geschmiert, wenn ich so sagen darf, aber nicht geschmiert, wie man mit Tinte schmiert, sondern geschmiert, wie man mit dem die Maschine fördernden Öl schmiert. Dann steht man richtig drinnen in der Klasse, dann benimmt man sich namentlich richtig drinnen in der Klasse. Und dadurch ist man auch allein in der Lage, daß in den Kindern gar nicht der Stachel sitzt, mit einem frech zu werden. Denn das ist eigentlich das Schrecklichste, wenn bei den 1u-, 11-, l2jährigen schon die Tendenz heranrückt, mit einem frech zu werden. Es darf daher nicht in dasjenige, was wir selber sagen, auch nicht wenn wir humorvoll werden, etwas hineinkommen, was die Frechheit herausfordert. Sonst kann es natürlich dazu kommen, daß vielleicht, wenn man zu einem Schüler, der sich nicht genug Mühe gibt und an einer Stelle nicht mehr weiter kann, sagt: Da steht nun der Ochs am Berg ... der Junge einem antwortet: Herr Lehrer, ich bin kein Berg. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Sondern es muß durch alle diejenigen Vorbereitungen, von denen ich gesprochen habe, eben das Autoritätsgefühl als etwas ganz Selbstverständliches entstehen. Nur wenn es das ganz Selbstverständliche ist, kommen solche Antworten - die ja auch glimpflicher sein können, ich habe diese ja nur zur Illustration angeführt - nicht zustande. Solche Antworten verderben ja nicht nur das betreffende Frziehungsobjekt, das man unmittelbar vor sich hat, sondern solche Antworten verderben natürlich die ganze Klasse.
Wenn nun der Übergang stattfindet von dem zweiten Lebensabschnitt in den dritten, dann erst beginnt die Möglichkeit für -ja, wie müßte man wohl in der Gegenwart sagen? - für den jungen Herrn und die junge Dame die Möglichkeit, Handlungen zu sehen. Vorher wird gesehen die sinnvolle Gebärde, später wird vernommen die bedeutungsvolle Sprache; jetzt erst tritt die Möglichkeit auf, in dem, was die Umgebung tut, Handlungen zu sehen. Ich sagte: an den sinnvollen
Gebärden entwickelt sich mit der Dankbarkeit die Gottesliebe. Aus dem Wahrnehmen der bedeutungsvollen Sprache entwickelt sich die allgemeine Menschenliebe als Grundlage der Ethik. Kommt man dann in der richtigen Weise dahin, die Handlungen zu sehen, dann entwickelt sich das, was man nennen kann die Werkliebe. Während die Dankbarkeit wachsen muß, die Liebe erwachen, muß dasjenige, was sich jetzt entwickelt, in voller Besonnenheit schon auftreten; wir müssen den jungen Menschen dahin gebracht haben, daß erjetzt über die Geschlechtsreife hinaus in voller Besonnenheit sich entwickelt, so daß er gewissermaßen zu sich selbst gekommen ist: dann entwickelt sich die Werkliebe. Und die muß gewissermaßen als etwas frei aus dem Menschen heraus Entstehendes sich auf der Grund]age von allem übrigen entwickeln: die Werkliebe, die Arbeitsliebe, die Liebe zu dem, was man auch selber tut. In dem Moment, wo das Verständnis für die Handlung des anderen erwacht, in dem Moment muß sich entwickeln als das Gegenbild die bewußte Einstellung zurWerkliebe, zur Arbeitsliebe, zum Tun. Dann ist in der richtigen Weise nach der Zwischenepoche das kindliche Spiel in die menschliche Auffassung der Arbeit umgewandelt. Und das ist dasjenige, was wir änstreben niüssen für das soziale Lehen.
Was ist dazu nun notwendig beim Lehrer? Ja, dazu ist etwas notwendig beim Lehrer, was im Grunde genommen das Schwerste ist, das man entwickeln kann als Lehrender und Erziehender. Denn das Beste, was man dem Kinde geben kann durch das erste und zweite Lebensalter, ist das, was mit der Geschlechtsreife in ihm von selbst erwacht, wovon man selbst als aus der Individualität kommend überrascht ist, was aus dem Menschen selber herauskommt und dem gegenüber man sich sagt: Dazu warst du ja eigentlich nur ein Werkzeug. Ohne die Gesinnung, die aus diesem heraussprudelt, kann man nämlich nicht in der richtigen Weise ein Lehrer sein. Denn man hat ja die verschiedensten Individualitäten vor sich, und man darf nicht so mit seinen beiden Beinen in dem Schulzimmer drinnen stehen, daß man das Gefühl hat: So wie du bist, müssen nun alle werden, die du unterrichtest oder erziehst. Dieses Gefühl darf man gar nie haben. Warum nicht? Nun, es könnten ja, wenn das Glück gerade günstig
ist, unter den Schülern, die man da vor sich hat, neben außerordentlich dummen - über die aber auch noch zu sprechen sein wird - drei oder vier zu Genie veranlagte Kinder sein. Und Sie werden mir doch wirklich zugeben, daß man nicht lauter Genies zu Lehrern machen kann, und daß der Fall sogar nicht selten vorkommen wird, daß der Lehrer nicht die Genialität hat, die einmal diejenigen haben werden, die vielleicht von ihm erzogen und unterrichtet werden mußten. Aber der Lehrer muß nicht nur diejenigen, die so werden können wie er, sondern er muß auch diejenigen richtig erziehen und unterrichten, die weit über ihn hinauswachsen müssen nach ihren Anlagen. Das wird man aber nur können, wenn man sich ganz und gar als Lehrer abgewöhnt, die Schüler zu dem machen zu wollen, was man selber ist. Und wenn man sich entschließen kann, bis zur äußersten Möglichkeit hin selbstlos in der Schule zu stehen, sich möglichst in bezug auf seine menschlichen Sympathien und Antipathien, in bezug auf seine persönlichen Eigenschaften auszuschalten und sich ganz hinzugeben an dasjenige, was einem die Schüler sagen, natürlich unbewußt sagen, dann wird man die Genies in demselben Sinne richtig erziehen, wie man die Dummen richtig erziehen wird. Dadurch entsteht aber eben erst das richtige Bewußtsein im Lehrer. Und das hat er, wenn er sich sagt: Jede Erziehung ist im Grunde genommen Selbsterziehung des Menschen.
Es gibt im Grunde genommen auf keiner Stufe eine andere Erziehung als Selbsterziehung. Aus tieferen Gründen heraus wird ja das insbesondere durch die Anthroposophie eingesehen, die von wiederholten Erdenleben ein wirklich forschungsgemäßes Bewußtsein hat. Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes. Wir müssen die günstigste Umgebung abgeben, damit an uns das Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres Schicksal erziehen muß.
Diese richtige Stellung des Erziehenden und Lehrenden zum Kinde kann man durch nichts anderes sich erringen als immer mehr und mehr durch die Ausbildung dieses Bewußtseins, daß es eben so ist. Für die Menschen im allgemeinen mag es verschiedene Gebete geben;
für den Lehrer gibt es außerdem noch dieses Gebet: «Lieber Gott, mache, daß ich mich in bezug auf meine persönlichen Ambitionen ganz auslöschen kann.» Und «Christus, mache besonders an mir wahr den paulinischen Ausspruch: Nicht ich, sondern der Christus in mir.» -Wie gesagt, für die anderen Menschen mag es mancherlei Gebete geben, für den Lehrer gibt es gerade dieses Gebet zu dem Gott im allgemeinen und zu dem Christus im besonderen, damit in ihm der richtige heilige Geist der wahren Erziehung und des wahren Unterrichts walten kann. Denn dies ist die richtige Dreieinigkeit für den Lehrer.
Wenn es einem gelingt, so in der Umgebung des Kindes zu denken, dann wird dasjenige, was aus der Erziehung hervorgehen soll, zugleich eine soziale Tat sein können. Da kommen allerdings Dinge in Betracht, die ich ja hier nur streifen kann. Aber sehen Sie nur einmal darauf hin: Wovon erwarten denn im gegenwärtigen Leben die Menschen das soziale Besserwerden? Sie erwarten alles von äußeren Einrichtungen. Sehen Sie sich das schreckliche Experiment in Sowjetrußland an. Es geht ja darauf hinaus, alles Glück der Menschheit zu suchen als Ergebnis äußerer Einrichtungen. Was man für Institutionen schaffen soll, darauf käme es in bezug auf die soziale Entwickelung an, meint man. Das ist aber gerade das Unwesentlichste der sczialen Entwickelung. Denn Sie können Institutionen schaffen, welche es auch seien, monarchistische oder republikanische oder demokratische oder sozialistische, was immer, es wird immer davon abhängen, was für Menschen innerhalb dieser Institutionen leben und wirken. Für denjenigen Menschen, der sozial wirkt, kommen zwei Dinge in Betracht: Liebevolle Hingabe an die eigenen Handlungen und verständnisvolles Eingehen auf die Handlungen des anderen.
Denken Sie einmal darüber nach, was gerade aus diesen beiden fließt: Liebevolle Hingabe an die eigenen Handlungen, verständnis-volles Eingehen auf die Handlungen der anderen. Daß die Menschen sozial zusammenarbeiten können, das folgt nur aus diesem. Aber das können Sie äonenlang tradieren: auf keine äußerliche Weise werden Sie das hervorbringen, Sie müssen es aus den Tiefen der Menschen-natur hervorholen. Denn wenn Sie äußerliche Einrichtungen treffen
wollen, auch beim besten Willen können Sie selbst solche treffen und von dem einzelnen Menschen Handlungen verlangen, an die er sich doch nicht hingeben kann; und es kann wiederum der andere Hand-lungen zeigen, für die man kein verständnisvolles Eingehen haben kann. Aber die Institutionen kommen von Menschen - Sie können nämlich überall an den Menschen verfolgen, wie die Institutionen aus den Menschen kommen -, und zwar aus dem kommen sie vom Menschen, was eben in größerem oder geringerem Maße von liebevoller Hingabe an die eigenen Handlungen und dem verständnisvollen Eingehen auf die Handlungen anderer liegt.
Wenn man für dieses soziale Ferment das richtige Verständnis hat, dann wird man einsehen, wie aus Mangel an diesem richtigen Verständnis die sonderbarsten Ansichten gerade in bezug auf das Soziale heraufgezogen sind. Denken Sie doch nur einmal - um ein Beispiel anzuführen, möchte ich dies sagen: Es wird heute Millionen von Menschen, nicht Tausenden, sondern Millionen von Menschen eingetrichtert dasjenige, was aus dem sogenannten Marxismus über das Wesen der Arbeit folgt, über das Verhältnis der Arbeit zu dem sczialen Leben. Und wenn Sie nachsehen, wie der, welcher angeblich das gefunden hat, zu dem gekommen ist, was nun Millionen Menschen eingetrichtert wird, woran Millionen Menschen heute als an einem sozialen Evangelium festhalten, woraus sie agitieren, so beruht es auf einem fundamentalen Fehler der Anschauung des menschlichen sozialen Lebens. Denn Karl Marx will die Arbeit so ins Soziale hineinstellen, daß er sie bewertet an dem, was der Mensch in sich verbraucht durch dasjenige, was er in der Arbeit während der Arbeitszeit auslebt. Aber das führt zu einer vollständigen Absurdität. Denn das, was im Menschen vor sich geht, ist ganz das gleiche, ob ich ein bestimmtes Quantum Holz geh ackt habe durch eine bestimmte Zeit hindurch, oder ob ich, weil ich nicht Holz zu hacken brauche, ein eigens dazu hergerichtetes Rad so benütze, daß ich mir jede andere Arbeit dadurch erspare, daß ich nun wie auf eine Stufe auf diese Speiche mich stelle und sie herunterdrücke, dann auf die nächste Speiche, und so von Speiche zu Speiche hinaufspringe. Da wird dasselbe Ergebnis sich in mir erzeugen, wie wenn ich das entsprechende Quantum
Holz hacke. Die Rechnung von Karl Marx hat den gleichen Ansatz. Das Holzhacken ist aber etwas, was ich hineinstelle in den ganzen Prozeß der Menschheit. Das Speichentreten an dem Rad dagegen
- solch ein Rad wird ja ausdrücklich angefertigt für sich verfettigende Leute-, das hat keinen sozialen Nutzeffekt, sondern das hat nur einen hygienischen Effekt für den, der es anwendet. Aber das, was nach Karl Marx den Wert der Arbeit bemessen soll, das ist das, was menschlicher innerer Verbrauch von Nahrungsmitteln ist. Es ist einfach eine Absurdität, diesen Rechnungsansatz in nationalökonomischer Hinsicht zu machen. Und so wurden alle möglichen Ansätze gemacht, nur das eine wurde nicht in seiner vollen Bedeutung genommen: Liebevolle Hingabe an die eigene Handlung, verständnisvolles Eingehen auf die Handlungen anderer.
Das aber müssen wir erreichen, daß wir in der Umgebung des Kindes uns so benehmen, daß für dieses Kind mit der Geschlechtsreife zum vollen Bewußtsein kommt dasjenige, was in diesen zwei Sozial-sätzen liegt. Dazu müssen wir voll verstehen, was es heißt: neben dem Kinde so zu stehen, daß das Kind die beste Seibsterziehung neben uns treibt.
SIEBENTER VORTRAG Dornach, 21. April 1923
Sie können sich denken, daß es für denjenigen, der nicht auf einem sektiererischen oder auf einem fanatischen Boden steht, schwierig ist, das durchzuführen, was als Pädagogisch-Didaktisches in der Weise aus Menschenerkenntnis folgt, wie ich es in den letzten Tagen angedeutet habe. Denn viele von Ihnen werden sich selber gesagt haben: Was man da als das Richtige ansehen muß, das unterscheidet sich sehr wesentlich von jenen Dingen, die heute durch Schulreglemente, durch Lehrpläne, und wie sonst diese Dinge sind, eben herrschend befunden werden müssen. Da steht man in einer Art von Zwickmühle drinnen. Auf der einen Seite steht diese sachlich-objektiv erkannte pädagogisch-didaktische Grundlage da, die ja - das werden Sie aus dem Vorgebrachten bemerkt haben - für jedes Lebensjahr eine ganz bestimmte Unterrichts- und Erziehungsaufgabe vorschreibt. Man kann es dem Leben des Kindes selber ablesen, was man nicht nur in jedem Jahr, sondern eigentlich in jedem Monat, in jeder Woche, und zuletzt, wenn man ins Individuelle geht, an jedem Tag zu tun hat. Und es darf ja als etwas Schönes ausgedrückt werden, daß die Waldorflehrerschaft eben bis zu einem hohen Grade in die Gesinnung aufgenommen hat diese objektive Forderung einer wirklichen Pädagogik, und es schon einsehen kann, wie mit den Notwendigkeiten der menschlichen Entwickelung eine solche Pädagogik zusammenhängt; wie da nichts Willkürliches ist, sondern alles eben aus der Menschenwesenheit abgelesen ist. Das steht auf der einen Seite. Aufder anderen Seite stehen - gerade für den, der nicht Fanatiker ist, sondern der sich auch mit Idealen, wie man diese Dinge ja auch nennt, voll in die Wirklichkeit hineinstellen muß und will - die Forderungen des Lebens.
Wir dürfen ja gar nicht in fanatischer, sektiererischer Weise Kinder so erziehen, daß sie dann ins Leben nicht hineinpassen. Denn das Leben richtet sich heute ja nicht nach diesen idealen Forderungen, sondern es richtet sich nach dem, was eben heute noch aus dem Leben
heraus geboren ist. Und das sind die Schuireglemente, die Lehrpläne und dergleichen, wie sie eben aus den heutigen Anschauungen heraus gegeben werden. Und man steht daher sehr leicht vor der Gefahr, das Kind in einer Weise zu erziehen, die zwar richtig ist, durch die man es aber vielleicht - man mag das nun als richtig oder als unrichtig ansehen, es ist einmal da - dem Leben entfremdet. Das muß man immer vor sich haben: daß man nicht fanatisch auf ein Ziel los-steuern kann, sondern sich auf der einen Seite bewußt sein muß dessen, was sein sollte, auf der anderen Seite bewußt sein muß, daß man die Kinder nicht dem Leben entfremde.
Gerade was die Gegner so vielfach der Anthroposophie zuschreiben: daß da ein Fanatismus, eine Sektiererei herrsche, das ist, wie Sie finden werden, soweit nicht der Fall; das Gegenteil davon ist der Fall. Es mag bei einzelnen Anthroposophen so etwas zutage treten, aber Anthroposophie selbst ist dasjenige, was überall in lebendige Wirklichkeit sich hineinstellen will. Aber gerade dadurch wird man in bezug auf die Praxis aufmerksam auf die Schwierigkeiten des Lebens. Und so mußte in einem gewissen Sinne, weil eben hier nicht Fanatismus zugrunde liegt, sondern überall objektive Sachlichkeit, gleich von Anfang an etwas - ja, wie soll ich es nennen -, etwas Böses gemacht werden: nämlich eine Art Kompromiß. Es mußte gleich von Anfang an ein Memorandum ausgearbeitet werden, durch das von mir selbst festgelegt worden ist das Folgende: Die Kinder werden in den ersten drei Volksschulklassen nach Möglichkeit so von Stufe zu Stufe geführt nach den Forderungen, die das Menschenwesen selbst ergibt. Dabei richtet man sich aber zu gleicher Zeit innerhalb dieser drei ersten Volksschuljahre so nach den äußeren Forderungen, daß die Kinder nach der s Klasse übertreten können in eine gewöhnliche Volksschule. Das muß nun für den Lehrer - ich muß diese Tautologie bilden: Kompromiß-Rücksicht sein. Das geht nicht anders. Der Wirklichkeitsmensch muß es so machen, denn Besonnenheit muß überall herrschen; der Fanatiker macht es anders. Natürlich ergeben sich einem solchen Wege mancherlei Schwierigkeiten, und mancher Lehrer fände es viel leichter, geradewegs auf das ideale Ziel loszusteuern. Da muß vieles im einzelnen besprochen werden, damit man eben den
Weg durchfindet zwischen den zwei Zielen. Dann ist es im Sinne meines ursprünglichen Memorandums, daß wiederum, wenn die Kinder das 12. Jahr vollendet haben, also wenn sie die 6. Klasse - von unten herauf, von 1 ab gezählt - absolviert haben, sie eintreten können in eine gewöhnliche Schule in die entsprechende Klasse. Daß gerade dieses Jahr von mir gewählt wurde, ist darauf zurückzuführen, daß das Menschenwesen, wie es in den letzten Tagen hier geschildert wurde, da an einem besonderen Abschnitt steht. Wiederum müssen die Kinder übertreten können im 14. Jahr in die Schulen, die sie dann aufsuchen wollen.
Nun, möchte ich sagen, geht es ja noch ziemlich gut mit den ersten drei Volksschulklassen. Da läßt sich halbwegs so etwas erreichen. Es kann auch mit aller Mühe das angestrebt werden für das 12. Lebensjahr. Die Schwierigkeiten beginnen nämlich erst, wenn die späteren Lebensjahre folgen. Denn sehen Sie, wenn es auch nur aus einem ganz dunklen Bewußtsein heraus geschieht, so hat sich ja aus alten Zeiten her noch etwas von altem dämmerhaftem Wissen über den Menschen erhalten. Und das führte dazu, daß man wenigstens ungefähr auch heute noch die Zahnwechselzeit als diejenige ansieht, in der die Kinder überhaupt in die Volksschule geführt werden sollen. Die Leute wissen gar nicht mehr heute, daß das eine mit dem andern zusammenhängt; aber mit altüberliefertem, heute nur instinktiv gefühltem Wissen hängt es doch zusammen. Und auch das ist natürlich schon darinnen, daß die Leute das wiederum nicht wissen oder wußten, und daß sie daher das Lebensalter in einer nicht ganz menschen-gemäßen Weise hinausrücken möchten auf das abstrakt vollendete 6. Lebensjahr, was eigentlich immer etwas zu früh ist für das Schicken des Kindes in die Volksschule. Aber da läßt sich ja nichts erreichen, denn wenn die Eltern ihre Kinder heute nicht mit dem vollendeten 6. Lebensjahr in die Volksschule schicken, kommt der Gendarm oder der Weibel, oder wie man ihn sonst nennt, und holt eben die Kinder in die Schule. Da läßt sich ja nicht viel daran ändern. Aber wie gesagt, es ist verhältnismäßig leicht für die ersten drei Jahre, dieses Kompromißschließen anzustreben. Allerdings, wenn einmal, wie es ja immer vorkommt, der eine oder andere Schüler oder eine Schülerin
übertreten in eine andere Schule, findet sich immer der Einwand:
Ja, so gut lesen und schreiben wie unsere Schüler können diese Kinder nicht; und mit dem, was sie im Zeichnen und in der Eurythmie gelernt haben, wissen wir nichts anzufangen, da mögen sie ja weit sein.
Gerade aus solchen Urteilen kann man auch eine Bejahung der Wald orfschul-Methode ersehen. Denn da möchte ich Sie doch auf etwas hinweisen: Sie können nämlich in Goethes Jugendorthographie, die aus einer viel späteren Zeit stammt als etwa aus dem 7., 8.Jahr, die tollsten Schreibfehler nachweisen. Und Sie können aus der Art und Weise, wie er schreibt, sehr leicht entnehmen, daß man heute von einem achtjährigen Kinde viel mehr verlangt - wenn ich das «mehr» nennen darf -, als dazumal der siebzehnjährige Goethe -nach gewissen Richtungen hin natürlich - erfüllte. Also die Dinge liegen doch etwas anders. Und Goethe verdankt manche Konfiguration in seinem Wesen dem Umstande, daß er im 17. Jahr noch Orthographiefehler gemacht hat, weil sein Inneres dadurch für gewisse Ent-faltungen der Seelenkräfte gerade biegsam geblieben ist, da es sich noch nicht in eine feste Regel hineinbegeben hatte. Wer solche Zusammenhänge kennt, allerdings durch eine feinere Psychologie, als sie heute vielfach gefunden werden kann, der wird natürlich in einem solchen Einwand ebensowenig gegen eine naturgemäße Pädagogik finden, als zum Beispiel in einer historischen Tatsache, die ja recht interessant ist.
Sehen Sie, es tauchte in der Naturwissenschaft so im Beginn des 20. Jahrhunderts, vielleicht schon im letzten Zeitraum des 19. Jahrhunderts plötzlich die Anschauung auf, für das Verstehen der Vererbungserscheinungen sei der Mendelismus die allerbeste Theorie. Dieser Mendelismus heißt so, weil er zurückführte auf einen gewissen Gregor Mendel, der ein Historiker war in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und der gleichzeitig als Gymnasiallehrer in Mähren wirkte. Gregor Mendel hat sorgfältige Versuche ü her die Vererbung bei den Pflanzen gemacht. Dasjenige, was er darüber geschrieben hat, ist dann lange Zeit unberücksichtigt geblieben, und so um die Wende des vorigen und unseres Jahrhunderts tauchte das dann auf als die beste Vererbungstheorie. Nun ist es interessant, einmal biographisch nachzugehen
der Geschichte von Gregor Mendel. Er bereitete sich, wie es dazumal in Österreich ja allgemein üblich war - die österreichischen Freunde werden das wissen, daß die Klostergeistlichen sich vorbereiten für das Gymnasiallehramt und dann die Examina ablegen -, er bereitete sich vor und kam zur Lehramtsprüfung, wie man es damals nannte, und fiel glänzend durch. Er war also unfähig, Gymnasiallehrer zu werden. Nun gibt es die Bestimmung in Österreich, daß man nach einiger Zeit das Examen wiederholen kann. Gregor Mendel wiederholte die Lehramtsprüfüng und fiel wiederum glänzend durch. Solch einen Menschen würde man heute nicht einmal mehr in Österreich als Gymnasiallehrer anstellen, glaube ich. Dazumal war die Sache noch gemütlicher, da hat man auch durchgefallene Lehramtskandidaten angestellt, weil man deren mehr brauchte. So wurde Gregor Mendel dennoch Gymnasiallehrer, trotzdem er zweimal durchgefallen war. Nur wurde er ein zweimal durchgefallener, bloß durch direktoriale Güte fungierender Gymnasiallehrer und saß als minderwertiges Subjekt im Gymnasialkollegium, wo im Mittelschullehrer-Schematismus nicht einmal bei dem Namen dabei geschrieben sein konnte: Dr. phil. Bei denen, die richtig durchs Examen gehen, steht ja gewöhnlich zum Beispiel: Josef Müller, Dr.phil. Bei diesem minderwertigen Subjekt stand das eben nicht; dadurch wurde er überall signiert als eben ein Gymnasiallehrer minderer Sorte. Dann verging eine Anzahl von Jahrzehnten, und der Mann wurde nun nach seinem Tode als einer der größten Naturforscher anerkannt! Die Dinge gehen eben eigentümlich im wirklichen Leben. Und wenn man auch die Dinge nicht unmittelbar nach dem wirklichen Leben einrichten kann - sonst würden ja sehr bald sehr komische Forderungen entstehen für den Unterricht -, aber wenn man sich auch nicht im Leben einrichten kann nach dem, was das Leben dann später zeitigt, so muß man sich doch immer klar sein, daß man auf solche Dinge psychologisch hinhorchen sollte, sich Klarheit verschaffen sollte über diejenigen Dinge, die da geschehen. Sie beziehen sich auf den höheren und niederen Unterricht, auf die höhere und niedere Erziehung des Menschen. Und so muß man sagen, daß es nicht gerade so furchtbar gravierend ist, wenn nun ein Schüler der 3. Klasse abgeht, und eben noch
nicht soviel kann, als man vielleicht durch eine schlechte Methode andern Kindern eingedrillt hat, und was dann später im Leben schadet. Biographien von dieser Art könnten nämlich viele angeführt werden. Da kommen manchmal in den Nekrologen ganz sonderbare Dinge zum Vorschein. Röntgen zum Beispiel ist ja auch aus dem Gymnasium ausgeschlossen worden, und hat nur durch besondere Güte überhaupt zu einem Lehramt kommen können. Wie gesagt, man kann sich nicht darnach richten im Leben, aber die Dinge müssen durchaus beachtet werden, und man muß sie durch eine feinere Psychologie zu begreifen suchen.
Nun wird es aber immer schwieriger, die genannte Kompromiß-stellung einzunehmen in der wirklichen Unterrichts- und Erz iehungspraxis. Es geht noch allenfalls, wenn man sich eben hineinfindet in dem Lebensalter bis gegen das 12. Jahr hin. Dann aber beginnen die Dinge immer schwieriger und schwieriger zu werden, weil nämlich von diesem Lebensalter ab die Lehrpläne und Lehrziele nun gar nichts mehr haben von dem, was dem Menschenwesen entspricht, sondern der reinen Willkür entstammen. Was da in ein Jahr als Lehr-ziele eingefügt wird, das entstammt eben der reinen Willkür, und man kommt nicht mehr zurecht, wenn man das, was der reinen Willkür entstammt, mißt an demjenigen, was aus dem Menschenwesen folgt. Erinnern Sie sich an das, was ich gestern gesagt habe: daß ja, wenn die Geschlechtsreife erlangt ist, das Kind so weit gebracht sein muß, daß es nun wirklich in die Freiheit des Lebens eintreten kann, daß es sich innerlich stark befestigt. Denn sehen Sie, wir haben die zwei Grundtugenden: die Dankbarkeit, zu welcher der Grund gelegt werden muß vor dem Zahnwechsel; die Liebefähigkeit, zu welcher der Grund gelegt werden muß zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife - das haben wir gestern entwickelt; und wir haben mit Bezug auf das Ethische gesehen, wie das Gemüt, das Gefühl des Kindes erfüllt werden muß von Sympathie und Antipathie auch gegenüber dem Guten und Bösen. Wenn man mit dem «Du sollst» kommt in diesem Lebensalter, so verdirbt man das Kind für die spätere Lebenslaufbahn. Dagegen, wenn man ihm kein «Du sollst» entgegenhält, sondern eine gute Autorität ist für das Kind bis zur Geschlechtsreife,
ihm dadurch eben gerade beibringen kann: es gefällt mir das Gute, es mißfällt mir das Böse - dann entwickelt sich in dem Lebensalter, wo die Geschlechtsreife allmählich herauskommt, aus dem Innern des Menschenwesens heraus die dritte Grundtugend: das ist die Pflichtmäßigkeit. Es gibt keine richtige Pflichtmäßigkeit, die eingedrillt worden ist. Es gibt nur eine Pflichtmäßigkeit, welche von selber entstanden ist aus der naturgemäßen Menschenentwickelung auf Grundlage der Dankbarkeit, wie ich es gestern auseinandergesetzt habe, und der Lebefähigkeit. Sind diese, die Dankbarkeit und die Liebefähigkeit, in der richtigen Weise entwickelt worden, dann kommt die Pflichtmäßigkeit mit der vollendeten Geschlechtsreife heraus. Und es ist eine notwendige menschliche Lebenserfahrung, daß dieses selbstverständliche Herauskommen der Pflichtmäßigkeit da ist. Denn das Seelisch-Geistige muß sich seinen eigenen Gesetzen und Bedingungen gemäß entwickeln wie das Leibliche. Wie der Arm oder die Hand wachsen muß aus den inneren Wachstumskräften, und man diese nicht dirigieren kann dadurch, daß man den Arm etwa in ein bestimmtes Eisen einspannt, wie man nicht das Fußwachsen dirigieren sollte, indem man die Füße einspannt - obwohl es eine ähnliche Einspannung, wie man sie bei uns für die Seele vornimmt, ja für die Füße in gewissen Erdgegenden sogar gibt -, so muß eben dasjenige, was in einem bestimmten Lebenspunkte aus der naturgemäß wachsenden Menschennatur heraus sich ergeben soll, wirklich auch sich so ergeben, daß der Mensch das Erlebnis hat: Es kommt aus meinem Innern heraus. Dann stellt sich der Mensch mit der Pflichtmäßigkeit gerade richtig in das soziale Leben hinein. Dann kommt er im edelsten Sinne zu der Erfüllung des Goetheschen Ausspruches: «Pflicht -wo man liebt, was man sich selbst befiehlt.» - Sie sehen hier wiederum, wie die Liebe in alles hineinspielt, und wie die Pflicht auch sich so entwickeln muß, daß man sie zuletzt lieben kann. Dann stellt man sich als Mensch in der richtigen Weise in das soziak Leben hinein. Und dann kommt gerade aus der richtig erlebten Autorität dasjenige heraus, was dann der Mensch ist, der auf sich selbst sich stützen kann.
Und was dann als Religiosität herauskommt, das ist nun auch, ins Geistige umgesetzt, dasjenige, was sich - wie ich es Ihnen gerade
ziemlich ausführlich beschrieben habe - im Kinde vor dem Zahnwechsei entwickelt als die selbstverständliche leibliche Religiosität. Das sind alles Dinge, die eben tief wurzeln müssen in einer wahren Pädagogik und Didaktik.
Aber dann ergibt sich einfach durch eine solche Menschenerkenntnis, wie ich sie geschildert habe, wie notwendig es ist, daß der Unterricht und die Erziehung, angefangen von dem 12. Jahre, hintendierend zur Geschlechtsreife und namentlich nach der Geschlechtsreife, übergehe in einem hohen Grade in das Praktische. Das wird nun bei uns in der Waldorfschule so gehandhabt, daß es vorher vorbereitet wird. In der Waldorfschule sitzen ja Knaben und Mädchen nebeneinander. Und obwohl sich interessante Tatsachen daraus ergeben, von denen ich morgen noch sprechen werde - gerade für die Psychologie ergeben sich außerordentlich interessante Tatsachen, jede Klasse hat ihre besondere Psychologie -, muß man doch sagen: gerade wenn man selbstverständlich nebeneinander auch die praktischen Betätigungen des Lebens von Knaben und Mädchen üben läßt, so ist das eine ganz vorzügliche Vorbereitung für das Leben. Nicht wahr, heute wissen viele Männer wirklich gar nicht, was man für ein gesundes Denken, für eine gesunde Logik hat, wenn man stricken kann. Viele Männer können das gar nicht beurteilen, was man für das Leben hat, wenn man stricken kann. Bei uns in der Waldorfschule stricken die Knaben neben den Mädchen, stopfen auch Strümpfe. Dadurch wird natürlich, wenn später differenziert werden muß, diese Differenzierung als etwas Selbstverständliches sich ergeben, aber es wird dadurch auch eine Erziehung erreicht, welche mit dem Leben, in das sich der Mensch hineinstellen muß, wirklich rechnet.
Die Leute sind immer furchtbar erstaunt darüber, wenn ich eine Behauptung aufstelle, die nicht bei mir nur Überzeugung, sondern psychologische Erkenntnis ist: ich kann einmal nicht den für einen guten Professor ansehen, der nicht, wenn es nötig ist, sich seine eigenen Stiefel flicken kann. Wie soll man denn überhaupt über das Sein und über das Werden etwas Ordentliches wissen, wenn man nicht einmal seine Stiefel flicken kann, wenn es notwendig ist! Es ist das natürlich etwas paradox und extrem gesprochen. Aber heute gibt es
selbst Männer, die sich nicht einmal im nötigen Falle einen Hosenknopf richtig annähen können. Ja, das ist etwas Furchtbares! Man kann wirklich nichts Ordentliches über Philosophie wissen, wenn man nicht in der Hand eine bestimmte Geschicklichkeit für gewisse Dinge hat. Das gehört zum Leben. Und man muß sagen: Nur derjenige kann ein guter Philosoph sein, der, wenn es sein Schicksal gewesen wäre, auch ein guter Schuhflicker geworden wäre. Manchmal werden ja scgar Schuhflicker Philosophen, wie es die Geschichte der Philosophie zeigt.
Nun, die Menschenerkenntnis fordert eben, daß man durch eine richtige Vorbereitung in das praktische Leben hinein die ganze Führung der Erziehung leitet. Und so ergibt es einfach das Lesen in der Menschenwesenheit, daß zum Beispiel in einer bestimmten Schulklasse die Kinder - nein, die jungen Herren und jungen Damen - herangeführt werden an das Weben, daß sie den Webstuhl beherrschen lernen; daß sie herangeführt werden an das Spinnen; daß sie lernen auch einen Begriff sich aneignen, wie Papier gemacht wird zum Beispiel; daß sie lernen, wenigstens die einfachen Verrichtungen der mechanisch-chemischen -nicht nur Mechanik und Chemie -, sondern der mechanisch-chemischen Technologie zu begreifen und auch im Kleinen zu handhaben, so daß sie wissen, wie es im Leben geschieht. Dieser Übergang zu einer wirklich praktischen Unterrichts- und Erziehungsführung, er muß gefunden werden. Und das wird eben gerade angestrebt werden müssen, wenn man in Ernst und Ehrlichkeit auf wirklicher Menschenerkenntnis eine Pädagogik und Didaktik insbesondere für die höheren Klassen aufbauen will.
Ja, da kommt man dann in furchtbare Schwierigkeiten hinein. Man kann annähernd ein neunjähriges Kind so herausstaffieren, neben dem, was man vernünftigerweise machen muß, daß es in die 4. Volksschulklasse übertreten kann; auch bei einem zwölfjährigen Kinde, das in die 7.Volksschulklasse übertreten soll, geht es noch. Furchtbar schwierig wird es schon, zu erreichen, daß die Kinder ins Gymnasium und in die Realschule übertreten können nach absolvierter Volksschule; aber ganz besonders schwierig wird die Sache, wenn es in die höheren Schulklassen hinaufgeht. Denn da fordert Menschenerkenntnis,
daß man ein wenig zu dem Ideal der Griechen zurückkehren kann. Ein weiser Grieche mußte zwar von einem Ägypter hören: Ihr Griechen seid ja alle wie die Kinder; ihr wißt nichts von all den Verwandlungen, die auf der Erde vorgegangen sind. - Das mußte ein weiser Grieche von einem weisen Ägypter hören; aber dennoch waren die Griechen nicht so kindlich geworden, von dem heranwachsenden Menschen, wenn er ein richtiger Gebildeter in einem bestimmten Fache werden sollte, die ägyptische Sprache zu verlangen. Sie begnügten sich mit der griechischen Sprache. Wir machen das, was die Griechen getan haben, ihnen nicht nach, wir lernen Griechisch. Nun will ich nichts dagegen sagen; das Griechischlernen ist etwas Schönes - aber es folgt halt nicht aus dem Menschenwesen in einem bestimmten Lebensalter, wo man nun so und so viele Stunden für Griechisch ansetzen soll und das Griechischlernen in die Zeit hineinfällt, in der eigentlich Weberei, Spinnerei und Kenntnis der Papierfabrikation getrieben werden müßte. Ja, nun soll man den Lehrplan festsetzen. Man soll nun aber auch das erreichen, daß die Schüler - weil man ja ganz gewiß uns eine Hochschulbildung nirgends zugestehen wird - in die Hochschulen, die technischen Lehranstalten und dergleichen übertreten oder, mit anderen Worten, daß sie ein Abiturientenexamen bestehen. Da kommen dann die furchtbaren Schwierigkeiten, die fast unüberwindlichen Schwierigkeiten. Da erlebt man es halt, daß man auf der einen Seite versucht, aus echter Menschenerkenntnis heraus die praktische Betätigung zu pflegen - da kommt dann der Lehrer für Griechisch und sagt: Ich habe zu wenig Stunden; ich kann die Schüler nicht zum Abiturientenexamen führen; ich habe zu wenig Stunden, es geht nicht! - So daß Sie aus dieser ganz sachlichen Erwägung heraus sehen, welche Schwierigkeiten heute noch der Sache gegenüberstehen, und wie irgendein fanatisches Bestehen auf einem Ideal nicht platzgreifen kann. Das, was zu geschehen hat, hängt gar nicht einmal heute allein ab von dem, daß, sagen wir, eine Lehrerschaft einsieht: das ist so gut, das ist so richtig, - sondern es müssen viel weitere Kreise des Lebens die Ideale einer wirklich menschengemäßen Erziehung, eines menschengemäßen Unterrichts einsehen, damit auch das Leben so wir da man nicht die heranwachsenden
Menschen dem Leben entfremdet, wenn man sie naturgemäß erzieht. Denn natürlich macht man heute einen Menschen lebensfremd, wenn er die Gymnasial- oder Realschulbildung bei einem ab-solviert und dann bei einem Abiturientenexamen, das er draußen machen muß, durchfällt. Mit dem Durchfallen, nun - ich spreche ja zu Sachkennern -, mit dem Durchfallen ist es halt doch so, daß es mir möglich wäre, einen Professor ordinarius der Botanik, der sogar ein ganz beschlagener Kopf in der Botanik ist, an einer Hochschule in seinem Fach - wenn ich es gerade darauf anlege - durch ein Examen durchfallen zu lassen. Ich glaube schon, daß dies durchaus gehen würde! Nicht wahr, bei einem Examen kann man natürlich immer durchfallen. Auch da stellen sich ja die merkwürdigsten Dinge im Leben heraus. Sehen Sie, es gibt einen österreichisch-deutschen Dichter, Robert Hamerling. Der hat so ziemlich den besten deutschen Stil, den man sich in Österreich aneignen konnte, später als Dichter gehabt. Es ist interessant, Hamerlings Gymnasiallehramts-Befähigungszeugnis durchzusehen. Griechisch: ausgezeichnet. Lateinisch: ausgezeichnet. Deutsche Sprache und deutscher Aufsatz: kaum fähig, in den unteren Klassen der Mittelschule zu lehren. Das steht in Hamerlings Lehramtszeugnis! Also nicht wahr, mit dem Durchfallen und Durchkommen beim Examen ist das so eine Sache.
Nun, da treten dann also die Schwierigkeiten auf, die einen darauf aufmerksam machen, daß weiteste Kreise erst das Leben selber so gestalten müssen, daß es möglich werde, mehr zu erreichen, als was durch den Kompromiß erreicht werden kann, den ich charakterisiert habe. Also wenn ich Ihnen etwa sagen wollte so ganz in abstracto:
Kann nun die Wald orfschule überall eingeführt werden?, so kann ich natürlich abstrakt wiederum sagen: Ja, überall, wo man sie herein-läßt. Aber auf der anderen Seite ist selbst das abstrakte Hereingelassenwerden noch nicht ganz das Maßgebende. Denn, wie gesagt, das sind ja nur zwei Ausdrücke für ein und dieselbe Sache bei vielen Menschen. Manche, nicht wahr, schlagen sich durch und werden berühmte Dichter, selbst mit einem schlechten Zeugnis aus der Unterrichts-sprache. Aber nicht jeder schlägt sich durch. Für viele bedeutet beim Abiturientenexamen durchfallen: aus dem Leben herausgeworfen
werden! Und so muß man sagen: In je höhere Schulklassen man hineinkommt, desto mehr tritt das auf, daß der Unterricht, den man da geben muß, dem Ideal nicht vollständig entspricht. Gerade das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und das ist etwas, was nun eben zeigt, wie sehr man für diese Dinge mit dem Leben rechnen muß.
Für einen naturgemäßen Unterricht und für eine naturgemäße Erziehung kann natürlich immer nur die Frage sein: Erreicht der Mensch denjenigen sozialen Anschluß im Leben, der durch die Menschennatur selbst gefordert wird? - Denn zuletzt sind das ja auch Menschen, die das Abiturientenexamen fordern, wenn auch das Fordern in dem Stile, wie es heute eintritt, eben ein Irrtum ist. Aber man ist eben dann genotigt, nicht das ganz Richtige zu machen, wenn man im Sinne dieser heutigen sozialen Forderungen nun gerade die Waldorfschul-Pädagogik einführen will. Daher wird natürlich jemand, der die obersten Klassen inspiziert, sich sagen müssen: Ja, da istja garnicht alles so, wie es von der idealen Waldorfschul-Pädagogik gefordert wird! -Aber ich kann Ihnen die Garantie dafür geben: Wenn das, was heute der Menschennatur abgelesen wird - namentlich wenn der Übergang in die praktischen Lebenszweige gefunden werden soll - durchge-führt würde: dann würden beim heutigen Abiturientenexamen alle durchfallen. So schroff stehen sich heute die Dinge gegenüber! Das muß eben durchaus berücksichtigt werden. Es kann ja solchen Dingen in der mann igfaltigsten Weise natürlich Rechnung getragen werden, aber auf der anderen Seite muß daraus das Bewußtsein entspringen, wie sehr nicht nur auf dem Felde der Schule, sondern auch auf dem allgemeinen Lebensfelde gearbeitet werden muß, wenn dasjenige, was gerade in sozialer Beziehung ein menschengemäßer Unterricht und eine menschengemäße Erziehung ist, herbeigeführt werden soll. Dennoch wird bis zu einem gewissen Grade die praktische Betätigung in der angedeuteten Weise gerade in unserem Erziehungs-wesen berücksichtigt. Nur fallen natürlich immer Stunden für das Praktische weg, weil der Griechisch- und Lateinlehrer diese Stunden beansprucht. Aber das geht schon einmal nicht anders.
Aus dem, was ich jetzt gesagt habe, ersehen Sie aber, daß gerade für den Zeitpunkt, der mit der Geschlechtsreife heranrückt im menschlichen
Leben, auch der Übergang in das äußere wirkliche Leben gefunden werden muß; daß da immer mehr und mehr dasjenige in die Schule hineinspielen muß, was den Menschen nach Leib, Seele und Geist in einem höheren Sinne zum lebensbrauchbaren Menschen macht. In dieser Beziehung haben wir ja gar nicht genügend psychologische Einsichten. Denn die feineren Geistzusammenhänge im menschlichen geistig-seelisch-leiblichen Leben, die ahnt man ja zuweilen gar nicht. Die ahnt nur derjenige heute noch, der es sich geradezu zur Aufgabe setzt, das Seelenleben kennenzulernen. Und ich kann Ihnen aus einer gewissen Selbsterkenntnis in bescheidenerWeise durchaus sagen, daß ich gewisse Dinge, die ja heute vielleicht - sogar gewiß - manchem als unnütz erscheinen, auf dem Gebiete der Geisteswissenschaft nicht in der Weise vorbringen könnte, wie ich sie vorbringe, wenn ich zum Beispiel nicht in einem bestimmten Lebensalter - nicht durch Waldorfschul-Pädagogik, aber durch das Schicksal - Buchbinderarbeiten gelernt hätte. Die besondere menschliche Betätigung beim Buchbinden, die ergibt auch für das intimste Geistig-Seelische, besonders wenn es im richtigen Lebensalter auftritt, etwas ganz Besonderes. Und so ist es gerade für die praktischen Be-tätigungen. Und ich würde es als eine Sünde betrachten gegen die Menschenwesenheit, wenn bei uns in der Waldorfschule nicht in einem bestimmten Zeitpunkte, der eben der Menschennatur abgelesen wird, der Randarbeits unterricht auch das Buchbinden und das Schachteinmachen, die Kartonagearbeiten, aufnehmen würde. Die Dinge gehören dazu, wenn man ein ganzer Mensch werden soll. Nicht daß man diese oder jene Schachteln fabriziert hat, oder dieses oder jenes Buch eingebunden hat, ist wesentlich, sondern daß man die Verrichtungen gemacht hat, die dazu gehören, - daß man diese bestimmten Empfindungen und Denkprozesse durchgemacht hat
Die Differenzierung zwischen Knaben und Mädchen tritt dann schon von selber ein. Dafür muß man auch wiederum ein Auge haben, ein Seelenauge nämlich. Zum Beispiel tritt etwas ein, dessen Psychclogie, weil ich ja doch nicht genug Zeit in der Waldorfschule selber zubringen kann, noch nicht erforscht ist, aber noch erforscht werden wird. Es tritt das Eigentümliche ein, daß beim Spinnen es sich herausstellt,
daß die Mädchen sehr gerne spinnen; die Knaben wollen auch ganz gerne dabei sein, aber sie wollen nur den Mädchen die Dinge zutragen, sie wollen Ritterdienste leisten. Sie bringen gerne alles herbei, was dann die Mädchen verspinnen; sie machen lieber die vorbereitenden Arbeiten. Das hat sich herausgestellt, und das muß nun erst psychologisch erforscht werden, daß sich in dieser Weise die Dinge differenzieren. Aber auch aus dieser - wenn ich mich so aus-drücken darf - besonderen Weichenstellung des Handarbeitsunterrichts, auf den sehr viel gehalten wird in unserer Waldorfschul-Päd-agogik, aus dieser Weichenstellung des Handarbeitsunterrichtes nach dem Buchbinden, nach den Kartonagearbeiten hin, zeigt sich eben auch, wie überall, gerade wenn man es auf den Geist absieht, das Praktische des Lebens zu berücksichtigen sich als eine Selbstverständlichkeit ergibt. Es haben ja schreckliche Unpraktiker die Methoden hervorgerufen, die eigentlich die Lebenspraxis glauben mit dein Löffel gegessen zu haben. Es kommt am wenigsten Lebenspra-xis heraus, wenn man von pädagogischen Theorien ausgeht. Die er-geben gar nichts, nur Vorurteile ergeben sie eigentlich. Dagegen ist die wirkliche Pädagogik Menschenerkenntnis Und richtige Menschenerkenntnis ist es schon, wenn sie nach dieser besonderen Richtung hin ausgebildet wird, wie ich es angedeutet habe. Sie ist schon Pädagogik, und sie wird zur Didaktik in der lebendigen Handhabung des Unterrichts und der Erziehung; sie wird eben zur pädagogisch-didaktischen Gesinnung, und auf diese kommt es an. Und dem muß natürlich das ganze Wesen der Schule angepaßt sein.
So liegt gerade bei dem Unterrichtssystem, dem Erziehungssystem, das in der Waldorfschule gepflegt wird, der Schwerpunkt im Lehrerkollegium und in den Beratungen des Lehrerkollegiums, weil die ganze Schule ein in sich belebter und durchgeistigter Organismus sein soll; und weil mit wirklich innerem Anteil der Lehrer der 1. Klasse verfolgen soll dasjenige, was der Physiklehrer der 12. Klasse nicht nur macht in seiner Klasse, sondern an den Schülern erfährt und erlebt. Das strömt alles in der Lehrerkonferenz zusammen. Da strömen aber auch durcheinander alle die Ratschläge, die sich aus der gesamten Handhabung des Unterrichts ergeben. Es wird wirklich
versucht, in der Lehrerkonferenz etwas zu haben wie die Seele des ganzen Schulorganismus. Da weiß der Lehrer der 1. Klasse, daß der Lehrer der 6. Klasse ein Kind hat, das in dieser oder jener Weise zurückgeblieben ist, oder sich gerade in dieser oder jener Weise spezifisch begabt erweist. Und diese Dinge, die der einzelne weiß, die werden auf einem ganz anderen Gebiet bei den anderen fruchtbar. Da kennt, möchte ich sagen, der Lehrkörper, deshalb weil er eine Einheit ist, auch die ganze Schule als eine Einheit. Dann durchzieht die ganze Schule eine gemeinsame Begeisterung, aber auch gemeinsame Sorgen. Dann tragen alle Lehrkräfte miteinander dasjenige, was für die ganze Schule namentlich in moralisch-religiöser Weise, aber auch in erkenntnismäßiger Weise getragen werden muß.
Da erfährt man auch, wie der eine Unterricht, den der eine Lehrer erteilt, auf den anderen Unterricht den der andere Lehrer erteilt, im besonderen wirkt. Gerade so wenig wie es im Menschenorganismus gleichgültig ist, ob der Magen in der richtigen Weise auf den Kopf abgestimmt ist oder nicht, so ist es in einer Schule nicht gleichgültig, ob die Unterrichtsstunde von 9-10 Uhr in der 3. Klasse in der richtigen Weise entspricht der Unterrichtsstunde von 11-12 Uhr in der 8. Klasse. Das sind natürlich alles Dinge, die extrem und radikal gesagt werden, die in dieser Extremheit und Radikalität natürlich nicht erfüllt werden, aber sie werden so gesagt, weil sie wirklichkeitsgemäß sind. Denn gerade wenn man wirklichkeitsgemäß denkt, so kommt man auch der natürlichen, sinnlichen Wirklichkeit gegenüber zu ganz anderen Beurteilungen, als man durch eine abstrakte Lehre kommt. Da kann man es oftmals erfahren, daß Laien, da wo es gestattet ist, in der Medizin irgendwelche Menschen behandeln. Laien haben sich dann ein gewisses Maß von eben laienhaftem Wissen angeeignet. Nun sagt ein solcher Laie von einem Patienten: Ja, dessen Herz ist nicht normal. Das kann sogar richtig sein, aber es folgt daraus noch nicht, daß man dieses Herz normal machen soll. Denn derjenige, der dieses Herz hat, der kann seinen ganzen Organismus gerade auf dieses, einer abstrakten Normalität etwas widersprechende Herz gebaut haben. Versucht man dann, sein Herz normal zu gestalten, so paßt dieses Herz nicht zum Organismus. Man inuß es so lassen, wie es ist,
und muß, wenn die Krankheitszustände zutage treten, trotz der notwendigen Abnormität des Herzens, den ganzen Gang der Therapie eben anders einrichten, als daß man abstrakt auf das Herz losmarschiert mit seinen Arzneien.
Ich habe gestern gesagt: Erziehung hat etwas Ähnliches mit dem Heilen. Und deshalb ist es schon so, daß man ein Ähnliches, dieWirk-lichkeit sozusagen weit umfassendes Vorstellen und Empfinden für eine wirkliche Pädagogik haben muß, wie man es auch schließlich in anderen Wirklichkeitserkenntnisgebieten haben muß.
Wenn man dasjenige nimmt, was aus den heutigen Anatomien, Physiologien - von Psychologien gar nicht zu reden, denn die sind ja überhaupt nur ein Sammelsurium von Abstraktionen - hervorgeht und daraus Menschenerkenntnis fabriziert - Menschenerkenntnis ist bis zu einem bestimmten Grade Selbsterkenntnis, ich meine nicht die in sich hineinbrütende Selbsterkenntnis, sondern die Selbsterkenntnis des Menschenwesens durch den Menschen, also die allgemeine Menschenerkenntnis als Selbsterkenntnis - ja, wenn man das, was man heute hat, zu einer solchen Menschenwesenheitserkenntnis verwendet, so wäre das so, wie wenn man durch Selbstbesinnung von sich die Vorstellung bekäme, man wäre ein Skelett. Wenn man absehen müßte beim Hineinblicken in sich von alledem, was um das Skelett herum ist, man käme sich vor wie ein Skelett. So kommt man sich für die Totalität des Menschen nach Leib, Seele und Geist vor, wenn man zu dieser Menschenerkenntnis nur verwendet, was die heutige Anatomie und Physiologie gibt. Es muß eben für die Psychologie ein wirkliches Durchdringen des Seelischen mit dem Geiste eintreten. Und das Geistige - hat man es einmal, dann kann man es verfolgen auch in die leibliche Realität hinein. Denn in allem Körperlichen wirkt eben der Geist.
Ich habe es ja schon angeführt als das Tragische des Materialismus, daß er von der Materie nichts versteht. Gerade die Geisterkenntnis führt zur richtigen Erkenntnis des Materiellen. Der Materialismus redet zwar von der Materie, aber er dringt nicht ein in die inneren Kräftestrukturen der Materie. Ebensowenig dringt eine bloß auf das Äußerliche sehende Pädagogik ein in dasjenige, was aus der Menschenwesenheit
für das praktische Leben folgt. Und so ergibt sich etwas, was ja für den Geistesforscher naturgemäß ist, was aber für den heutigen Menschen vielfach nicht naturgemäß, sondern etwas Paradoxes ist. So ergibt es sich gerade, daß Sie dazu kommen werden zu sagen: Ja, es ist merkwürdig, diese aus der Anthroposophie herausgeholte Pädagogik kommt gerade zu der Notwendigkeit, die Kinder in einem bestimmten Lebensalter zu ganz bestimmten praktischen Betätigungen anzuleiten, zu materiellen Verrichtungen in der richtigen Weise anzuleiten. Dasjenige, was mit einer auf der Grundlage der anthroposophischen Forschung angestrebten Pädagogik und Didaktik verfolgt wird, das ist nicht ein Lebensfremdmachen und ein Hinaufführen der Kinder in mystische Nebel, sondern das ist gerade ein Durchgeistigen und Durchseelen des Leibes, so daß dieser Leib für das Erdenleben, so lange er in demselben ist, tüchtig ist, und aus der Tüchtigkeit wiederum die innere Sicherheit schöpfen kann. Deshalb wird mit jedem neuen Schuljahr, das wir ans tückeln an die vorhergehenden - wir haben mit einer achtklassigen Volksschule begonnen, haben dann die 9., 10. und ii. daran gefügt und werden jetzt noch die 12. daranfügen -, deshalb wird sich die Notwendigkeit ergeben, sich zu verbreitern gerade nach dem Praktischen hin, und es werden die Schwierigkeiten eben mit jedem Jahr wachsen.
Das hat dazu geführt, daß neulich einmal, als über andere Schwierigkeiten der anthroposophischen Sache verhandelt werden sollte, auch ein Memorandum eingebracht wurde von unseren Schülern der gegenwärtig letzten Waldorfschulklasse. Da haben diejenigen, die nun bald zu erwarten haben, vor dem Abiturientenexamen zu stehen, ein sehr merkwürdiges Memorandum ausgearbeitet, das eben dann begriffen werden wird, wenn man die ganze Sache richtig erwägt. Sie hatten nämlich der Anthroposophischen Gesellschaft ungefähr folgendes Memorandum unterbreitet: Da wir doch im Sinne des Menschen-wesens - das haben sie nämlich schon auf irgendeine Weise vernommen - erzogen und unterrichtet werden, und wenn wir so unterrichtet werden, doch nicht in die gewöhnlichen Hochschulen eintreten können - ich will nun nicht sagen, was diese jungen Herren und jungen Damen über die Hochschulen für ein Urteil abgegeben haben,
aber es unterscheidet sich nicht sehr von manchem Urteil, dem man auch sonst heute begegnen kann -, so möchten wir, wenn wir nicht in solche Hochschulen gehen können, der Anthroposophischen Gesellschaft vorschlagen, eine eigene Hochschule zu begründen, in die wir dann auch übergehen können
Ja, da ergeben sich natürlich heute die größten Schwierigkeiten. Aber das muß auch erwähnt sein, weil Sie eben - nachdem Sie einmal die Absicht verwirklicht haben, die für uns so befriedigend ist, hierherzukommen, um nachzuschauen, was eigentlich diese Waldorfschul-Pädagogik ist -, weil Sie sich ein Gefühl und eine Empfindung aneignen müssen von dem, was eigentlich gewollt ist, müssen Sie schon aufmerksam gemacht werden auf die Schwierigkeiten, die sich da ergeben.
Nämlich, Waldorfschul-Pädagogik ist ja eigentlich heute nur ge-handhabt von Lehrern der Waldorfschule. Nun werden die Schwierigkeiten ja selbstverständlich immer größer, je höher man hinauf-kommt. In einer Hochschule würden sie vermutlich noch größer sein. Aber weil es noch ein sehr abstraktes Ideal ist, kann ich da nur von Vermutungen sprechen, denn ich beschäftige mich immer nur mit dem, was das Leben fordert. Ich kann also jetzt nur sprechen bis zur 12. Klasse hin, weil die gerade vor der Türe steht. Dasjenige, was ins Blaue hinein gedacht werden soll, darf den Wirklichkeitsmenschen nicht allzusehr beschäftigen, sonst wird er von seinen Aufgaben abgeführt. Aber man kann doch sagen: die Schwierigkeiten würden wesentlich wachsen. Zweierlei an Schwierigkeiten wären da, was gleich einzusehen wäre: Erstens, wenn wir heute eine Hochschule errichteten, würden unsere Hochschulexamina gar keine Wirkung haben. Die Leute, die diese Examina durchmachten, würden gar nicht ins Leben eingereiht werden können, würden nicht Ärzte, Juristen werden können, was man doch noch heute anständigerweise in der üblichen Form werden sollte. Es würde also nicht gehen nach der einen Seite. Aber nach der anderen Seite könnte es einem angst und bange werden, wenn einem eine gewisse Realität nicht diese Bangigkeit wiederum ein bißchen abnehmen würde. Auf das hin, daß man gesehen hat, welch löbliches Streben in der jüngsten Jugend ist, hat man nämlich
eine Vereinigung zustande gebracht zur Begründung einer solchen Hochschule, die im Sinne der Waldorfschul-Pädagogik errichtet werden sollte. Angst und bange zu werden braucht einem ja nun deshalb nicht, weil ganz gewiß der Fonds, der durch eine solche Vereinigung zustande kommt, in der nächsten Zeit nicht so groß werden wird, daß man nur daran denken könnte, eine solche Hochschule zu errichten. Also ein löbliches Bestreben ist vorhanden, aber vorläufig noch sehr unpraktisch. Die Angst und Bangigkeit müßte erst dann eintreten, wenn etwa nun ein reicher Amerikaner käme und einem all die Millionen zur Verfügung stellte, welche heute notwendig wären, um eine vollendete Hochschule einzurichten. Ja, was man als das Maximum tun könnte, wäre, daß man sämtliche Waldorfschullehrer zu einer Hochschule hinauf beförderte - dann hätten wir aber wieder keine Waldorfschule. - Das alles sage ich, weil ich glaube, daß es auf Tatsachen viel mehr ankommt als auf alle möglichen abstrakten Auseinandersetzungen. Es kommt eben durchaus darauf an, daß man emp-finden lernt - auf der einen Seite vielleicht, daß da doch ein umfassendes Ideal vorliegt mit der Idee, auf einer wirklichen Menschenerkenntnis Pädagogik und Didaktik zu begründen, daß aber der Kreis derer, die heute wirklich schon real drinnenstehen in diesem Ideal, ein ungemein kleiner ist. Deshalb freut man sich so sehr über jeden Ansatz zur Vergrößerung, die vielleicht aus diesem Kursus durch den so befriedigenden Besuch hervorgehen kann. Auf der anderen Seite ist es notwendig, aus der Sache heraus zu erkennen, was alles geschehen muß, um das Waldorfschul-Ideal auf einen wirklich breiten Boden zu stellen. Das muß schon auch im ganzen Zusammenhang gesagt werden, denn es folgt aus der Konstitution der Waldorfschule selbst heraus.
Über diese Konstitution der Waldorfschule, über die ganze Führung der Waldorfschule, über dasjenige, was zwischen Lehrern und Schülern, zwischen den Schülern untereinander, den Lehrern untereinander herrschen soll, über die ganze Art und Weise, wie man über Prüfüngs- und Zeugniswesen aus der Menschenerkenntnis heraus denken kann, werde ich mir erlauben, morgen in einem abschließenden Vortrage zu sprechen.
ACHTER VORTRAG Dornach, 22. April 1928
Gewissermaßen um das abzurunden, was ja in sehr dürftiger Skizzenhaftigkeit gesagt werden konnte in diesen wenigen Tagen über die aus der anthroposophischen Forschung hervorgehende Pädagogik und Didaktik, möchte ich heute noch etwas hinzufügen über die Art und Weise, wie die Waldorfschule als Beispiel im Sinne dieser Ideen geführt wird, wie sie sich in der Praxis auslebt. Es muß ja vor allen Dingen aus dem ganzen Geiste der hier vertretenen Pädagogik und Didaktik heraus ersehen werden, wie Körperliches, Seelisches und Geistiges in gleichmäßiger Weise berücksichtigt wird, - so daß in der Tat das Unterrichten und Erziehen, wenn es so durchgeführt wird, wie es charakterisiert worden ist, zu gleicher Zeit zu einer Art Hygiene des kindlichen Lebens wird und in den nötigen Fällen sogar zu einer Therapie dieses kindlichen Lebens wird.
Nur muß man, um das einzusehen, in der richtigen Weise hinsehen können auf das kindliche Menschenwesen. Wir müssen uns ja klar sein darüber, daß alles das, was wir beschreiben mußten für die Entwickelung des Kindes bis zum Zahnwechsel hin, sich vor allen Dingen im kindlichen Leben äußert durch das Nerven-Sinnes-System. Nun ist ja jedes Organsystem des Menschen über den ganzen Menschen ausgebreitet, aber es ist zu gleicher Zeit jedes solche System, der Hauptsache nach, nach einer bestimmten Körperseite hin lokalisiert. Und so ist das Nervensystem vorzugsweise nach dem Kopfe hin organisiert. Wenn also hier von den drei hauptsächlichsten Organsystemen des Menschen gesprochen wird, dem Nerven-Sinnes-System, dem rhythmischen System und dem Ernährungs-Bewegungs-System, darf nicht etwa jemaffd sagen, da sei gemeint: Kopfsystem, Brustsystem, Gliedmaßen- oder Verdauungssystem oder dergleichen. Das wäre ganz und gar falsch. In solch räumlicher Weise läßt sich der Mensch nicht gliedern, sondern man kann nur sagen: Diese drei Systeme gehen ineinander und wirken überall ineinander. Aber das Nerven-Sinnes-System
ist hauptsächlich nach dem Kopfe hin lokalisiert; das rhythmische System, das ja alles umfaßt, was im Menschen rhythmisch ist, rhythmisch verläuft, ist hauptsächlich in den Brustorganen des Menschen organisiert, in den Atmungs- und Zirkulationsorganen. Aber sehen Sie, zum rhythmischen System des Menschen gehört ja auch alles dasjenige, was den Rhythmus der Verdauung fördert, endlich auch den Rhythmus von Schlafen und Wachen, insofern als Verdauung und Schlafen und Wachen eben im menschlichen Organismus begründet sind. Und wiederum der eigentliche chemisch-physiologische Vorgang der Verdauung hängt innig zusammen mit alledem, was Bewegungssystem des Menschen ist. Und die Bewegung, sie trägt auf der einen Seite bei zur richtigen Förderung des Ernährungs-und Verdauungssystems und umgekehrt. So daß man sagen muß:
für das kindliche Alter bis zum Zahnwechsel wirken natürlich auch alle drei Systeme ineinander, aber dasjenige, was im Kinde plastisch organisierend ist, was im Kinde wirkt, indem das Kind wächst und sich ernährt, das geht beim Kinde hauptsächlich vom Kopfe aus, von dem Sinnes-Nerven-System. Und wenn das Kind erkrankt, so gehen alle Erkrankungen im wesentlichen von Einflüssen des Nerven-Sinnes-Systems aus. Daher sind ja gerade diese kleinen Kinder bis zum Zahn-wechsel hin diesen von innen her kommenden Erkrankungen ausgesetzt, die man eben die Kinderkrankheiten nennt.
Auf diese Kinderkrankheiten wirkt - mehr als das heute im materialistischen Zeitalter auch der Mediziner versteht - in einer außer-ordentlich starken Weise das Nachahmungswesen aus der Umgebung herein. So daß man für manche Masernerkrankung beim Kinde den jähzornigen Tobsuchtsanfall in seiner Umgebung durchaus verantwortlich machen muß. Ich meine nicht einen Irrsinnsanfall, sondern einen solch sanften Tobsuchtsanfall, wie er ja unter Menschen so sehr häufig vorkommt. Jener Schock, der zu gleicher Zeit moralisch-geistig durchsetzt ist beim Kinde, muß durchaus unter die Krankheitsursachen versetzt werden. Und alles dasjenige, was da für das Kindesalter bis zum Zahnwechsel hin wirkt, das ist in seiner Nachwirkung durchaus noch da fast bis zum 9. Jahre hin. Wenn es also etwa in der Schule vorkommt, daß der Lehrer, der Erziehende sehr zornig
wird, meinetwillen fürchterlich zu poltern anfängt, wenn ein Kind ein klein wenig Tinte ausgießt, er dann vielleicht das Tintenfaß aus der Bank herausnimmt und sagt: Wenn du das noch einmal tust, so gieße ich dir das ganze Tintenfaß über den Kopf, oder schmeiße es dir an den Kopf! - das ist natürlich sehr extrem geschildert, aber Dinge von diesem Typus kommenja immerfort vor-, wenn dies in solcher Weise geschieht, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir zu gleicher Zeit in außerordentlich ungünstiger Weise auch auf die leibliche Gesundheit des Kindes einwirken.
Ebenso wirkt ungeheuer stark für das kindliche Alter noch über den Zahnwechsel hinaus die innere Unwahrhaftigkeit des Lehrenden und Erziehenden. Die innere Unwahrhaftigkeit kann auch darin bestehen, daß man zum Beispiel ein unehrlicher Frömmling ist, oder daß man sittliche Gebote aufstellt für das Kind, bei denen es einem gar nicht einfällt, sich selber hinterher darnach zu benehmen. Da webt und lebt in unseren Worten und in dem, was wir vor dem Kinde entwickeln, eine Unwahrheit. Von dem Erwachsenen können wir sagen: er merkt das nicht. Das Kind aber nimmt das mit den Gesten auf. Und diese innerliche Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit, die wirkt auf dem Umwege über das Nerven-Sinnes-System ungemein stark auf die Organisierung des Verdauungsapparates des Kindes, namentlich auf die Entwickelung der Galle. Und diese Gallenentwickelung ist dann für das ganze Leben von einer ungeheueren Bedeutung.
Dieses Durchschauen des Ineinanderwirkens von Geist, Seele und Leib, das ist es, was fortwährend, ohne daß man es nun immer auf den Lippen führt, in intensiver Anschauung die Handlungen des Lehrenden und Erziehenden durchsetzen muß. Und weil der menschliche Organismus so viel zu tun hat vom Kopfsystem aus, vom Nerven-Sinnes-System aus im kindlichen Lebensalter, und weil da so leicht an die Stelle des sogenannten Normalen das Abnorme eingreifen kann vom Kopfe aus, so ist eben dieses kindliche Lebensalter in einer so außerordentlichen Weise den Kinderkrankheiten ausgesetzt.
Wenn dann das Kind zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife ist, so ist das merkwürdigerweise durch die menschliche
Organisation selbst - allerdings für den, der das Menschenleben durchschaut, in ganz begreiflicher Weise - das gesündeste Lebensalter, weil in diesem Lebensalter alle Organisation ausstrahlt vom rhythmischen System, das niemals ermüdet und niemals zuviel erregt wird durch seine eigene innere Wesenheit. Was an Krankheitserscheinungen in diesem Lebensalter auftritt - natürlich muß das nicht in scharfen Begriffskonturen genommen werden, sondern lebensgemäß, wirklichkeitsgemäß -, das kommt durchaus von außen an den Menschen heran: der Mensch muß irgendwie, wenn er Krankheiten besonders ausgesetzt ist in diesem Lebensalter, wo das rhythmische System hauptsächlich in Betracht kommt, von außen herein nicht richtig behandelt worden sein.
Und dann, wenn die Geschlechtsreife vorüber ist, strahlt ebenso vom Bewegungssystem und Verdauungssystem her das Krankwerden von innen aus. Da werden wir als Menschen den Krankheiten so ausgesetzt, daß von innen her die Krankheitsursachen aufsteigen. Weil in der Handhabung der Erziehung und des Unterrichts so viel von dem liegt, was auch in die körperlichen Dispositionen des Kindes eingreift, müssen wir eigentlich immer auf den Flügeln sozusagen desjenigen, was wir als Unterrichts- und Erziehungsmaximen für dieses zweite Lebensalter des Kindes haben, auch dabei das Körperlich-Hygienische und das Seelisch-Hygienische tragen oder tragen lassen. Es muß immer drinnenstecken in dem, was wir tun.
Sehen Sie, da kann man auch auf Einzelheiten hinweisen. Nehmen Sie zum Beispiel ein melancholisch veranlagtes Kind: Sie werden sehen, wie bei diesem Kinde der Zuckergenuß in einer ganz anderen Art wirkt als bei einem sanguinisch veranlagten Kinde. Wenn Sie einem melancholischen Kinde, natürlich richtig dosiert, Zucker beibringen, so wirkt dieser Zucker unterdrückend auf die Lebertätigkeit; und dasjenige, was dann ausstrahlt von der Lebertätigkeit, was da den ganzen Menschen durchdringt von der nun sich immer mehr und mehr zurückhaltenden Lebertätigkeit, das bekämpft von der Körperseite her das melancholische Temperament. Es ist eine äußere Stütze, aber diese äußere Stütze muß man kennen. Man verleugnet nicht das Geistig-Seelische, wenn man weiß, daß diese äußeren Stützen
da sind. Denn derjenige, der so wie es im Felde der Anthroposophie der Fall ist, weiß, daß in allem Körperlich-Physischen das Geistige wirksam ist, der sieht in der besonderen Tätigkeit, die der Zucker mit Bezug auf die Leber ausführt, eben nicht bloß Physisches, sondern der sieht eine geistig-seelische Wirkung, die dann nur auf physische Weise influenziert wird, wenn wir dem melancholischen Kinde Zucker in richtiger Dosierung beibringen oder beibringen lassen. Beim sanguinischen Kinde kann es wieder gut sein, gerade die Leber anzuregen, und das geschieht, wenn man ihm den Zucker entzieht.
Und so kann man, wenn man dieses ganze Ineinanderwirken von Leib, Seele und Geist kennt, ungeheuer günstig nach den drei Richtungen hin im Menschen wirken. So daß gesagt werden muß: Wenn heute so vielfach die Meinung ist, daß eine Pädagogik, die von geistigen Grundlagen ausgeht, das Körperliche zu wenig berücksichtigt, ist das bei der Pädagogik, die hier gemeint ist, ganz gewiß nicht der Fall. Denn am wenigsten berücksichtigt diejenige Pädagogik das Körperliche, die aus abstrakten Regeln gerade auf das Körperliche losgehen will, weil diese Pädagogik nicht kennt, wie jede Seelen- und Geistesregung eben gerade im kindlichen Lebensalter hineinwirkt in das Körperliche.
Weil dies alles so ist, war es nötig, daß, bevor wir mit der Führung der Waldorfschule begonnen haben, ein seminaristischer Kursus von mir gehalten worden ist für diejenigen, die dazumal Waldorfschullehrer werden wollten oder sollten. Dieser seminaristische Kursus war hauptsächlich daraufhin angelegt, diesen umfassenden Gedanken von dem Ineinanderwirken von Seele, Leib und Geist in die Pädagogik hereinzubringen. Er ist ja allmählich ausgeschieden worden - mehr als man sich dessen bewußt ist - aus der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts.
Dann wurden kleinere Ergänzungskurse während des Funktionierens der Wald orfschule auch in späteren Jahren noch gehalten, die einiges zu dem hinzugefügt haben, was der erste grundlegende Kursus brachte. Und es ist eigentlich das Selbstverständliche für jeden, der den Waldorfschulunterricht irgendwie in die Hand nehmen will, daß
er sich vor allen Dingen ganz hineinlebt, nicht so sehr in die Einzelheiten, die in diesen Kursen vorgebracht worden sind, sondern in den Geist, der da gemeint ist und aus dem heraus die Einzelheiten behandelt werden. Denn wenn man eine Sache lebensvoll behandelt, so kommt es eben viel weniger auf die Einzelheiten an, als auf den Gesamtgeist, der die Einzelheiten innerlich in diesen oder jenen Zusammenhang bringt. Sie werden gesehen haben, namentlich an solchen Vorträgen, wie sie hier von Herrn Dr. von Baravalle und von Fräulein Dr. von Heydebrand gehalten worden sind, wie von den einzelnen Lehrkräften versucht worden ist, in die Handhabung der einzelnen Lehrfächer den Geist dieser Pädagogik hereinzubringen. Die ganze Behandlungsweise der Lehrfächer wird dann wie von einer Art von Lebensblut durchzogen von diesem Geiste der Einheitlichkeit in der Menschenorganisation. Natürlich muß auch in dieser Beziehung sehr vieles skizzenhaft bleiben in demjenigen, was ich heute noch sagen kann.
Nun habe ich schon gestern angedeutet, daß die wesentlichsten Grundbedingungen für die richtige Führung einer solchen Schule darin liegen, daß das Lehrerkollegium wie die Seele und der Geist, aber einheitlich, wirkt auf den ganzen Schulorganismus. Und da ist vor allen Dingen eben auch schon unter die pädagogischen Impulse dasjenige zu rechnen, daß wirklich innerhalb der Lehrerkonferenzen nicht nur ein statistisches Verzeichnis herauskommt dessen, was der einzelne Lehrer bemerkt, sondern daß lebendig sich entwickelt im Lehrerkonferenzwesen jene individualisierende Psychologie, die sich aus der Führung des Unterrichts selbst ergibt. Ich m&hte da nur ein Beispiel erwähnen. Wir haben nebeneinandersitzen in den Klassen Knaben und Mädchen. Anfangs hatte die Waldorfschule einen Schüler-stand, der nicht viel die Hundert überschritt, der sich aber so entwickelt hat, daß wir im letzten Schuljahr 700 Schüler hatten. Aus diesem Anwachsen der Schülerzahl ergab sich die Notwendigkeit, Parallelklassen zu errichten, besonders für alle unteren Klassen. Nun haben wir Klassen, in denen mehr Mädchen als Knaben sind, und auch solche, wo es umgekehrt ist, selten stellt sich auch ein, daß die Zahl ungefähr gleich ist. Es wäre ja pedantisch, die Verfügung zu treffen,
es müßten gleich viel Mädchen und Knaben sein. Erstens geht das nicht an, weil die Schulkinder eben nicht so in die Schule gebracht werden, zweitens würde man aber auch durch solch eine Schematisierung lebensungemäß wirken. Man muß also die Möglichkeit herbeiführen, daß eine Schulführung in der Lage ist, unter allen Verhältnissen dasjenige zur Anwendung zu bringen, was man eben als die richtigen Impulse ansieht. Aber es stellt sich durchaus heraus, daß eine Klasse, wo mehr Mädchen sind, ein ganz anderes psychisches Gebilde ist, als eine Klasse, wo mehr Knaben als Mädchen sind. Dabei kann man ganz absehen von äußeren Verhältnissen, die da auftreten, von demjenigen also, was sich im grob Bemerkbaren abspielt. Sondern, was da eine solche Klasse zu einem besonderen psychischen Gebilde macht, das sind imponderable Impulse, die gar nicht im Äußerlichen grob bemerkbar sind, welche da wirken. Und man hat gerade in Lehrerkonferenzen die Möglichkeit, daß auch in dieser Richtung gearbeitet werde. Und da muß man sich klar sein darüber, wie organisch beseelend das wirkt, wenn man erreichen will, daß die Schule ein organisch Beseeltes ist.
Denken Sie nur einmal, wenn ein Mensch im Leben sagen würde:
Ich will nur dasjenige denken, was mir dann später im Leben wirklich dient, ich will keine Vorstellungen hereinlassen in meine Seele, die mir später im Leben nicht dienen, denn das ist ganz unökonomisch, andere Vorstellungen hereinzulassen als solche, die einem im Leben dienen; also beschränke ich mich auf solche Vorstellungen. Ja, solch ein Mensch würde ein schreckliches Gebilde werden im Leben! Denn erstens hätte er gar nichts zum Träumen, er würde niemals träumen können. Aber, kann man nun auch sagen, wenn man genügend banausisch veranlagt ist: auf das Träumen kommt esja nicht an, die Träume kann man entbehren, die bedeuten ja nichts in der äußeren Wirklichkeit ! Sie bedeuten nichts für den, der diese Wirklichkeit nur in der äußeren Art auffaßt. Ja, wenn die Träume nur wirklich dazu da wären, ein phantastisches Gebilde zu sein. Derjenige hat natürlich nichts von den Träumen, der bei jedem geringfügigen Traume, aus Leber, Galle. und Magen kommend, etwas Tiefgeistiges, etwas Tiefprophetisches sieht, was mehr wert ist als die äußere Wirklichkeit.
Aber der, welcher weiß, daß in den Trauminformationen, den Träumen, nur auf eine undeutliche Weise, die Kräfte zum Ausdruck kommen, die im Atmungs-, Zirkulations- und Nervensystem die gesund- oder krankmachenden Kräfte sind, der weiß, daß sich in diesen Träumen der halbe Mensch gerade in hygienisch-pathologischer Weise spiegelt - und daß, wenn man keine Träume hat, das ungefähr so ist, wie wenn man durch irgendein Gift die Verdauung und die Zirkulation untergraben würde. Man muß sich klar sein darüber:
im Menschen muß eben vieles für alles äußere Leben scheinbar Unnötige sein, wie auch in der Natur selber viel Unnötiges ist. Denn vergleichen Sie einmal die Zahl der Heringseier, die abgelegt werden im Meer - und was da entsteht! Man kann der Natur nun den Vorwurf machen, wie verschwenderisch sie sei, weil so unendlich viel zugrunde geht, daß die Eier eigentlich erspart werden sollten. Das kann man aber nur deshalb behaupten, weil man nicht weiß, wie stark die geistigen Wirkungen sind der zugrunde gegangenen Heringseier auf die sich ausbildenden Heringseier. Es müssen soundso viel Eier zugrunde gehen, damit soundso viel Eier gedeihen können. Die Dinge hängen zusammen.
Nun, angewandt auf die Schule als Organismus, äußert es sich so:
Da wird in den Konferenzen verarbeitet psychologisch-pneumatologisch als Seelen- und Geistlehre dasjenige, was sich aus solchen Dingen, wie zum Beispiel die Zahl der Knaben und Mädchen, und aus vielen, vielen anderen Dingen ergibt. Da arbeitet man fortlaufend an der Entstehung einer Psychologie, auch einer Pathologie der ganzen Schule. Und in die Schule hinein gehört eben, damit das den ganzen Menschen umfaßt, so etwas, wie wir es eben in der Waldorfschule haben: daß unter der Lehre rschaft selbst ein Schularzt ist, der immer auch irgendwo den Unterricht erteilt. So daß eben in die Lehrerschaft hinein - sofern alle in der Konferenz zusammenwirken - eben auch durchaus das pathologisch-therapeutische Element, das ebenso wie das Begabungs-Element und das Genie-Element bei den Kindern in der Schule lebt, nicht nur fortwährend für die einzelnen Fälle besprochen wird in statistischer Weise, sondern verarbeitet wird. So daß an jedem einzelnen Fall ungeheuer viel gelernt werden kann, was vielleicht
dann nicht unmittelbar anwendbar ist, was so ist wie das, was der Mensch aufnimmt und von dem er behauptet, er brauche es nicht im Leben: er braucht es doch. Und das, was man da in sich hineinarbeitet an lebendiger Psychologie, lebendiger Physiologie usw., das wirkt dann auf ganz anderen Gebieten weiter. Sie dürfen ja gar nicht außer acht lassen: Wenn Sie - verzeihen Sie den Ausdruck, er ist ganz berechtigt - an den geistigen Gallenfunktionen des Kindes einmal gelernt haben, in diese Denkweise überhaupt sich hineinzu finden, dann stehen Sie das nächste Mal, wo Sie das, was Sie für die geistigen Gallenfunktionen gelernt haben, nicht anwenden können, weil Sie es nun eben mit der Nase zu tun haben. Sie können ja sagen: wozu brauche ich denn über die Galle zu lernen, wenn ich es jetzt mit der Nase zu tun habe - aber Sie stehen ganz anders dem gegenüber, was an der Nase zutage tritt, wenn Sie einmal überhaupt sich an irgendeiner Ecke in diese Sache hineingefunden haben. So handelt es sich darum, daß im wirklichen Sinn die Lehrerkonferenz zum Geist und zur Seele des ganzen Schulorganismus werde; dann geht jeder Lehrer erst mit der richtigen Gesinnung und der richtigen Seelenverfassung in die Klasse hinein.
Und man muß durchaus berücksichtigen, daß gerade in diesen Dingen das intensivste religiöse Element liegt. Da braucht man eben durchaus nicht immer auf den Lippen zu tragen die Worte: Herr, Herr, oder alles zu durchsetzen mit dem Christusnamen, sondern man kann das Gebot berücksichtigen: Du sollst den Namen des Gottes nicht eitel nennen, - aber man kann alles durchsetzen gerade mit dem religiösen Grund impuls, und in intensivster Weise mit dem christlichen Grundimpuls. Dann wird man auf gewisse alte Erfahrungen kommen, die der moderne Intellektualismus nicht mehr durchschaut, die aber in der Menschheitsentwickelung, der christlichen Entwickelung tief drinnenstecken. So zum Beispiel wird derjenige, der sich in der richtigenWeise anregen lassen will durch alle tiefen Seelenkräfte, um die Pädagogik in diesen pathologisch-physiologischen Gebieten richtig zu gestalten, sehr gut tun - für den modernen Menschen ist das natürlich horribili dictu gesprochen -, sich immer wieder und wiederum anregen zu lassen von dem, was vom Lukas-Evangelium für
eine solche Gesinnung ausströmt. Während jener, der sich anregen lassen will, in den Kindern den nötigen Lebensidealismus hervorzubringen, gut tun wird, sich selber anregen zu lassen von einer immer wiederholten Lektüre des Johannes-Evangeliums. Und wer seine Kinder nicht zu Feiglingen erziehen will, sondern zu solchen Menschen, die das Leben tüchtig anpacken, der lasse sich anregen vom MarkusEvangeli um. Und wer die Kinder zu solchen Leuten erziehen will, die nicht an den Dingen vorübergehen, sondern alles richtig bemerken, der lasse sich anregen vom Matthäus-Evangelium. Solche Dinge hat man den Evangelien gegenüber in alten Zeiten gefühlt. Wenn der heutige Mensch liest, daß man das Lukas-Evangelium als etwas Ärztliches zum Beispiel aufgefaßt hat, dann versteht er nichts mehr davon. Wenn er in die Lebenspraxis hineinkommt von pädagogischer Seite aus, dann fängt er an, von diesen Dingen wiederum etwas zu verstehen.
Nun kann man das so sagen, wie ich es jetzt eben getan habe. Man kann es aber auch anders sagen, und es ist nicht weniger religiös-christlich. Dasselbe, was ich jetzt ausgesprochen habe, kann man auch so sagen, daß man zum Beispiel in dem seminaristischen Kursus die Anschauungen entwickelt über die vier Haupttemperamente des Menschen, über das seelisch-leiblich-geistige Wesen des Cholerikers, des Melancholikers, des Sanguinikers und des Phlegmatikers. Man setzt diese vier Temperamente auseinander und ergeht sich dann in einer Schilderung, wie man die vier verschiedenen Temperamente in der Klasse zu behandeln hat; wie es zum Beispiel gut ist, die Choleriker in einem Winkel der Klasse zusammenzubringen. Dadurch entlastet man von manchem, was man sonst in ermahnender Weise braucht, die ganze Führung der Klasse. Denn die Choleriker puffen sich gegenseitig, und das ist eine außerordentlich gute erzieherische Maß-regel, die sie untereinander ergreifen. Jene nämlich, die gepufft werden von den anderen, die sie puffen, und die eigentlich wollten, daß sie von ihnen gepufft würden, werden dadurch in einer wunderbaren Weise erzogen. Und läßt man die Phlegmatiker sich gegenseitig anphlegmatikern, dann wirkt das in ungeheuer erzieherischer Weise. Aber alles das muß mit dem nötigen Takt gemacht werden. Man muß verstehen, wie man das im einzelnen handhaben muß - Und so
finden Sie in dem ersten Lehrerkurs, den ich für die Stuttgarter Waldorfschule gehalten habe, eine ausführliche Behandlung des Temperamentmäßigen bei den Kindern.
Und so kann man auch sagen: Das, was ich jetzt über die vierEvangelien gesagt habe, ist nämlich, im Grunde genommen, genau dasselbe dem Geiste nach, weil es in dasselbe Lebenselement des Menschen einführt. Heute hat man so das Gefühl, daß man alles nebeneinanderstellen muß, wenn man etwas lernen soll. Ja, dadurch kommt man eben niemals zu einem Grundsatz, wie er im Leben wirklich gehandhabt werden muß. Niemand versteht zum Beispiel im Menschen, sagen wir, das Gallensystem oder Lebersystem, der nicht den Kopf versteht, weil jedes Organ des Verdauungstraktes ein Gegenorgan im Gehirn trakte hat. Man weiß gar nichts über die Leber, wenn man nicht das Korrelat der Leberfunktion im Gehirn kennt. Ebensowenig versteht man innerlich, welche ungeheuren Anregungen auf die Menschenseele von den Evangelien ausgehen können, wenn man auf der anderen Seite das nicht umzusetzen weiß in die Art und Weise, wie der Charakter und das Temperament aufgedrückt sind in den Menschen, wenn sie hier auf der Erde als physische Menschen erscheinen. Lebensvoll die Welt ergreifen ist eben etwas durchaus anderes, als sie in toten Begriffen ergreifen.
Und das ist, was dann auch dazu führt, daß man sieht: Mit diesen Kindern, die man so erzieht, läßt man etwas heranwachsen, was nicht nur für das kindliche Alter da ist, sondern was immer weiter mit-wirkt. Denn sehen Sie, wenn Sie alt werden, was müssen Sie denn tun? Wer das Menschenwesen nicht kennt, der kann gar nicht in der richtigen Weise ermessen, was das eigentlich heißt, daß ich als Kind in dem Zeitalter, wo sie sich einzig und allein dem Menschen einprägen, gewisse Impulse erlangt habe. Damals konnte ich diese Impulse nur in den weichen, fügsamen, schmiegsamen, plastisch-musikalisch zugänglichen kindlichen Organismus tauchen, den hatte ich noch. Im späteren Leben habe ich einen härter gewordenen, nicht körperlich meinetwegen, aber seelisch-leiblich ins Sklerotische hineingehenden Körper. Ja, dasjenige, was an mir erzogen worden ist, das wird ja gar nicht alt ! Es ist nicht wahr, daß das alt wird. Man ist, wenn man noch
so alt geworden ist, innerlich mit genau demselben kindlichen Wesen ausgestattet, mit dem man ausgestattet war, sagen wir, zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr. Das trägt man immer in sich. Aber das muß so biegsam und schmiegsam sein, daß es nun auch dieses alte Gehirn, auf dem schon ein kahler Schädel ist, benützt, wie es dazumal das weiche Gehirn benützt hat. Und wenn nicht so erzogen wird, dann entsteht eben jener ungeheure Gegensatz, der heute zwischen Alter und Jugend zu bemerken ist, und den man als so unüberbrückbar vielfach ansieht. Man sagt da manchmal das Entgegengesetzte für das, was ist. Denn vielfach sagen die Leute: Ja, heute versteht die Jugend das Alter nicht, weil das Alter nicht versteht, jung zu sein mit der Jugend. - Das ist aber nämlich gar nicht wahr. Nichts davon ist wahr. Sondern die Jugend erwartet vom Alter, daß das Alter nun in der richtigen Weise die altgewordene Körperlichkeit benutzt. Da sieht die Jugend im Alter etwas ganz anderes, als was sie selber hat: dann auch stellt sich die selbstverständliche Verehrung des Alters ein. Die Jugend sieht, daß sie vom Alter etwas bekommen kann, was sie von sich nicht bekommen kann, wenn das Alter den Glatzkopf ebenso richtig zu behandeln weiß, wie das Kind mit dem vollbewachsenen Wuschelkopf lebt. Das muß durchaus da sein. Wir müssen so erziehen, daß der Mensch versteht, alt zu werden. Daran krankt die heutige Menschheit, daß diejenigen, die kindlich und jugendlich heranwachsen, in den alten Leuten nicht etwa richtig alt gewordene Menschen erkennen, sondern Kindsköpfe sind heute für die Jugend die alten Leute geblieben, die gerade so sind, wie sie selber ist ! Weil durch die mangelhafte Erziehung die Menschen heute den altgewor-denen Körper nicht benützen können, bleiben sie Kindsköpfe. Der Ausdruck «Kindsköpfe» ist sogar außerordentlich genial gewählt:
man ergreift im Laufe des Lebens nicht seinen ganzen Organismus, sondern man arbeitet nur mit dem Kopfe, mit dem das Kind oder der jugendliche Mensch arbeiten soll. D& sagt die Jugend: Was brauche ich von denen zu lernen ! Die sind nicht weiter wie wir, die sind ebensolche Kind sköpfe. - Darum handelt es sich nicht, daß das Alter heute zu wenig jugendlich ist, sondern das Alter ist viel zu kindlich geblieben: das ist es, was heute die Schwierigkeiten macht. Also man bezeichnet
vielfach mit dem allerbesten Willen das, was ist, durch das Entgegengesetzte.
Diese Dinge müssen eben alle richtig durchschaut werden, dann wird die Pädagogik - verzeihen Sie, wenn ich das so sage -, da sie heute auf dem Kopf steht, wiederum auf die Füße gestellt werden. Denn das hat sie nötig: wieder auf die Füße gestellt zu werden. Sie steht heute im intellektualistischen Zeitalter durchaus auf dem Kopfe.
Das ist es aber, was eben der Waldorfschul-Pädagogik gerade eignet: daß es da wirklich auf die Äußerlichkeiten gar nicht ankommt. Ob nun einer das, was erzeugt werden soll als Gefühls- und Gemüts-inhalt, durch ein Eingehen auf die spezifische Wirkung jedes der vier Evangelien erreicht oder dasselbe an Gemütsingredienzien hervorbringt, indem er in der richtigen Weise die Lehre von den vier Temperamenten behandelt, darauf kommt es nicht an; es kommt darauf an, welcher Geist waltet in demjenigen, was da entwickelt wird. In der äußerlichen Weise, wie das heute aufgefaßt wird, ja, da sind die Sachen fortwährend so, daß - wenn nun einer, sagen wir, den fundamentalen Stuttgarter Lehrerkursus in die Hand bekommt und hört, es stünde da drinnen viel über die Behandlung der Temperamente der Kinder, in einem nächsten Kursus aber ist entwickelt worden die Art und Weise, wie man sich zu den Evangelien stellen soll - ja, da muß er dann eben das Spätere auch noch dazu lernen. Nun ist es gut, wenn man die Dinge von verschiedenen Seiten betrachtet. Aber man muß sich auch dessen bewußt sein, daß die andersartige Darstellung, also die Darstellung, die man früher gibt, und die Darstellung, die man später gibt, übereinstimmen, trotzdem sie andere Worte, andere Wortsätze enthalten. Nur ist diese Übereinstimmung eine unbequeme, weil die Dinge bei einer solchen Auffassung in Wechselwirkung sind, nicht in der bloß einseitigen Kausalwirkung.
Und so können Sie den von Herrn Steffen in so anerkennenswerter Weise, in seiner vorzüglichen künstlerischen Art wiedergegebenen Lehrerkurs nehmen, der im Goetheanum gehalten worden ist, als eine Anzahl englischer Freunde hier war, und können ihn vergleichen mit dem, was nun in diesem Kurs in pädagogisch-didaktischer Weise immer wieder etwas anders gesagt worden ist: es ist dasselbe,
so wie zum Beispiel Kopf und Magen der eine Organismus ist. Aber das Unbequeme ist, daß dadurch alles in Wechselwirkung ist, und daß man daher nicht sagen kann: Ich habe ja den Lehrerkurs, der hier gedruckt worden ist, schon verstanden, da brauche ich, wenn das spätere dasselbe ist, den späteren nun nicht mehr zu lesen. Ja, aber sehen Sie, hat man beides, so versteht man auch das frühere in einer anderen Art durch das, was in Wechselwirkung ist. Und man kann sagen:
Wer seminaristisch einen späteren Kursus in sich aufgenommen hat, der versteht erst den früheren richtig, weil alles in Wechselwirkung steht. In der Mathematik hat man in bezug auf das Auffassen eine rein kaüsale Folge; da kann man das frühere ohne das spätere ganz gut verstehen. In so etwas, wie in der lebendigen Pädagogik, hat man Wechselwirkung; da wird das frühere durch das spätere beleuchtet.
Ich gebe Ihnen diese Schilderung, weil das zugleich der lebendige Geist sein muß, der überhaupt in der ganzen pädagogischen Auffassung der Wald orfschule waltet. Man muß immer die Sache von allen möglichen Seiten kennenlernen wollen und niemals einverstanden damit sein, daß man sie nur von einer Seite kennengelernt hat. Man muß als Waldorfschullehrer immer viel mehr sich dessen bewußt sein: Eigentlich mußt du noch alles selber lernen, - als zu denken:
Eigentlich bist du doch ein furchtbar gescheiter Kerl. - Es kommt einem fast gar nicht das letztere so leicht, wenn man in die Waldorfschul-Pädagogik sich wirklich eingelebt hat. Alles, was einem aus dieser Richtung kommt, muß beim richtigen Waldorfschullehrer aus einer gemüthaften, gefühishaften Ecke kommen - aus dem richtigen Selbstvertrauen, das eins ist mit dem richtigen Gottvertrauen. Wenn der Mensch weiß, daß die göttlichen Kräfte in ihm wirken, so wird er, ganz abgesehen von dem, was er äußerlich mehr oder weniger gelernt hat, einen innerlich lebendigen Quell haben, der weit zurückliegt im Menschen. Man ist erst am Beginn des Weges, wenn man ein äußerlich errungenes Selbstvertrauen hat. Man ist erst, wo man zu sein hat, wenn einen das Selbstvertrauen zum Gottvertrauen geführt hat, einen geführt hat dazu, in der richtigen Weise zu empfinden: Nicht ich, sondern der Christus in mir ist das Wirksame. Da
wird das Selbstvertrauen aber zu gleicher Zeit zur Selbstbescheidenheit, weil man weiß, daß man die göttlich-christlichen Kräfte reflektiert in demjenigen, was man in der Seele trägt. Dieser Geist muß in der Schulführung überall drinnen sein. Wenn dieser Geist nicht drinnen ist, so wäre diese Schule wie ein äußerlicher Organismus, dem man das Blut abzapfen oder die Atmung versperren würde. Auf diesen Geist kommt es eben gerade an. Und wenn dieser Geist lebendig ist, dann wird, ganz unabhängig von den Persönlichkeiten des Leiters oder der Lehrer, aus diesem Geiste selber heraus der Enthusiasmus kommen. Dann wird man auch das Vertrauen haben können, daß in der ganzen Schule etwas vom objektiven Geiste lebt, was nicht dasselbe ist, wie der individuelle Geist eines einzelnen Lehrers. Das kann aber wiederum nur durch sorgfältige Pflege im Konferenzleben des Lehrerkollegiums sich nach und nach herausbilden.
Nun, aus solchen Unterlagen ist auch dasjenige herausgebildet, was an unserer Waldorfschule der Epochenunterricht genannt wird. Dieser Epochenunterrlcht besteht darin, daß man das Kind nicht fortwährend dadurch zerstreut, daß man von 8 bis 8 1/4 Uhr Geographie, von 8 3/4 bis 1/2 10 Uhr etwas ganz Fremdes, vielleicht Latein, und nachher von 1/2 10 bis 1/211 Uhr meinetwillen Mathematik und Rechnen gibt oder dergleichen; sondern daß man täglich den Hauptunterricht so gestaltet, daß man - je nachdem, was eben notwendig ist für die einzelnen Fächer - in der ersten Tageszeit durch 8 bis 4 Wochen hindurch - die Zeit muß natürlich nach den Verhältnissen und dem Unterrichtsinhalt bestimmt werden - immer dasselbe treibt: also sagen wir durch 3 bis 4 Wochen durch eine Epoche hindurch, in einer notwendigen, wenn ich so sagen darf, nichts Zwangsmäßiges enthaltenden, sondern seriös-legeren Weise - Geographieunterricht erteilt; in der nächsten Epoche wird dann ein Unterricht erteilt, der sich aus diesem Geographieunterricht heraus entwickelt usw. Man wird allerdings finden, daß dieser Epochenunterricht - der so eingerichtet ist, daß also durchgegangen wird im Laufe des Jahres epochenweise dasjenige, was Lehrstoff sein soll in einer Klasse -, man empfindet, daß die Handhabung des Unterrichts und der Erziehung unter solchen Voraussetzungen etwas schwieriger ist als sonst; denn man wird
leichter als Lehrer langweilig, wenn man so langehintereinander Geographie zu lehren hat, als wenn man nur 2/4 Stunden hindurch Geographie zu lehren hat. Und man muß auch ganz anders in der Sache drinnenstehen, wenn man in dieser Weise den Unterricht erteilen will.
An diesen Hauptunterricht schließen wir im wesentlichen den Sprachunterricht an nach 10 Uhr, nachdem die Kinder die nötige Pause gehabt haben, und andere Unterrichtszweige, die nicht zum Hauptunterricht gerechnet werden. Mit dem Sprachunterricht halten wir es ja in der Waldorfschule so, daß nun wirklich für die kleinsten Kinder schon zwei nichtdeutsche Sprachen getrieben werden von dem Zeitpunkte an, wo die Kinder eben hereinkommen in die Volksschule. Wir treiben da mit den Kindern eben in derjenigen Methode, die wir für die richtige ansehen müssen, und in der Art, wie man eben die Dinge hat, Französisch und Englisch. Aber es kommt ja hauptsächlich dabei darauf an, daß durch diese Dinge nicht so sehr bloß der äußere Gesichtskreis erweitert werde, sondern daß die Reichhaltigkeit des inneren Lebens, des Seelenlebens besonders, durch diesen Sprachunterricht wesentlich gefördert wird.
Nun werden - wie Sie aus dem gestern Gesagten entnehmen können - in der Führung einer solchen Schule die körperlichen Dinge, besonders wie sie in Eurythmie und Turnen zur Pflege kommen, nicht etwa weniger berücksichtigt, sondern sie werden so berücksichtigt, daß durchaus das in das Gesamtwesen eingreifen kann. Und von An-fang an wird ebenso der Unterricht durchzogen, wie man es eben dem Lebensalter angemessen halten muß, mit dem musikalischen Element.
Es ist ja durchaus in der skizzenhaften Weise, die leider notwendig war, darauf hingedeutet worden, wie die Kinder in das Künstlerische gesanglich, musikalisch, plastisch usw. hineingeführt werden. Diese Dinge müssen durchaus da sein. Es muß durchaus praktisch, das heißt in der Ausführung erkannt werden, was es für den Menschen bedeutet, wenn er in der richtigen Weise durch die - wenn ich so sagen darf - unteren Lebensalter, also zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife - durch das Lebensalter bis zum 9., 12.Jahr usw. -musikalisch geführt wird. In diesem richtigen musikalischen Einführen
liegt die Grundlage für das Hinwegschaffen all der Hindernisse, die wir im späteren Leben für die mutige, sinngemäße Entfaltung unseres Willens haben. Die Art und Weise, wie das Musikalische in den Organismus eingreift, ist so, daß das Musikalische gerade in der richtigen Weise einschleift, möchte man sagen, die Art und Weise, wie die Nervenfluktuation in die Atmungsströmung hineinwirkt, wie diese wieder zurückwirkt auf die Funktion des Nervensystems, wie dann die Atmungsrhythmen hinüberwirken in die Zirkulationsrhythmen, wie der Zirkulationsrhythmus eingreift in den Schlafens- und Wachensrhythmus. Das ist überhaupt etwas, was zu dem Wunderbarsten gehört, daß man gerade durch anthroposophische Forschung durchschauen kann, wie das Musikalische innerlich menschenschöpferisch ist. Man lernt erkennen, wie in der Ausstrahlung der Nerven vom verlängerten Mark, von dem ganzen Rückenmarksystem, wie in diesem Auslaufen der Nerven ein ungeheuer feines musikalisches Instrument gegeben ist. Und man lernt erkennen, daß es vertrocknet und verhärtet und den ganzen Menschen innerlich unfähig macht, das Mutartige richtig zu entfalten, wenn der musikalische Unterricht und die musikalische Erziehung nicht entgegenkommen diesem wunderbar feinen Musikinstrumente. Es ist ja ein feines Musikinstrument, was sich da entfaltet in der Wechselwirkung zwischen den Nerven-Sinnes-Organen mit ihren Funktionen und den Bewegungs-funktionen des Menschen im Zusammenhang mit dem Rhythmus der Verdauung, dem Rhythmus des Schlafens und Wachens. Der obere Mensch will auf dem unteren Menschen spielen. Und man kommt entgegen diesem Sichhineinfügen dessen, was während der Musik-stunden am Klavier ertönt, was die Kinder singen, in das, was gerade im Nerven-Zirkulations-System als göttlicher Schöpfungsplan innerlich zu bemerken ist, durch die Hinorganisation des ganzen menschlichen Organismus auf das Musikalische. Das ist etwas, was zum Wunderbarsten gehört, denn da begegnet sich in jeder Musikstunde ein Göttlich-Geistiges, das wie heraufsteigt in den Leib des Kindes, mit demjenigen, was von der Erde ausgeht. In dem, was wir als ganze Menschheit erarbeitet haben in der musikalischen Kultur, da begegnen sich wirklich Erde und Himmel; dessen muß man sich bewußt
sein. Und daß man sich dessen bewußt ist, daß man weiß, man tut das als Lehrer, nicht indem man darüber viel theoretisiert, sondern indem man da den Genius des Himmels mit dem Genius der Erde in der Menschenbrust sich begegnen läßt: das gibt den Enthusiasmus, den man für die Klasse braucht. Das gibt auch den Enthusiasmus, den man dann wiederum in die Lehrerkonferenzen hineinträgt, wodurch der Lehrer des Musikalischen den Lehrer des Plastischen anregt usw. So muß man eben erkennen, wie in allem der Geist darinnen wirken muß, in der Pädagogik und Didaktik, wie sie hier gemeint ist.
Wir haben zum Beispiel neulich einmal eine Lehrerkonferenz gehabt, in der es wirklich bis zu einem hohen Grade schon gelungen ist, die ganze Art und Weise herauszuarbeiten, wie das Geistig-Seelisch-Leibliche im Menschen wirkt, wenn das Kind in Eurythmieübungen hineingeführt und dann zum Turnen übergeführt wird. Diese Übersicht des Verhältnisses zwischen Turnen und Eurythmie, was von so ungeheurer Bedeutung ist im Handhaben des Unterrichts, arbeitete sich uns neulich bei der Lehrerkonferenz heraus, und das wird sich natürlich fortsetzen. So werden die Lehrerkonferenzen zu dem lebendigen Lebensblut, das den Organismus «Schule» durchziehen muß. Dann kommt alles andere schon von selbst, wenn man sich nur nicht dagegen sträubt. Dann lernt man auch, mit den Kindern in der richtigen Zeit spazieren zu gehen und Ausflüge zu machen. Dann wird das Turnen von selber auch in diejenige Phase des menschlichen Lebens ausströmen, die eben für das betreffende Menschenwesen in irgendeiner Schule schon passend ist. Dann wird nicht die Sorge entstehen: Ja, in der Waldorfschule kann das alles ganz ausgezeichnet sein, aber da wird zu wenig Sport getrieben. Nun, erstens kann heute noch nicht alles getrieben werden, was vielleicht wünschenswert wäre, weil die Waldorfschule sich auch aus kleinen Anfängen entwickelt hat. Daß wir überhaupt zu dem gekommen sind, was wir heute haben, hat die Überwindung ungeheurer äußerer Schwierigkeiten notwendig gemacht. Aber dem Geiste nach laufen diejenigen Dinge, die aus dem Geiste eben hervorgeholt werden, durchaus auch in die richtige Handhabung des Körperlich-Geistigen ein. So muß man sagen:
Wie ich, um den Arm zu heben, nicht zu lernen brauche, wie die einzelnen
größeren und kleineren Muskeln meines Armes nach Gesetzen der Dynamik und Statik, vielleicht des Vitalismus usw. funktionieren, ebensowenig brauche ich im einzelnen alle Finessen zu kennen, wie das oder jenes getrieben wird, wenn ich nur mit dem ganzen Geiste, der dann Lehr- und Erziehungsgesinnung geworden ist, an die Handhabung des Unterrichts heranzutreten vermag - wenn ich gerade in das Zentrale hinein in der richtigen Weise mich begeben kann.
Nun, ich konnte Ihnen ja nur skizzenhaft andeuten, was der Führung einer solchen Schule zugrunde liegt, die gehalten ist in den aus anthroposophischer Forschung fließenden Ideenimpulsen. Und wir sind ja - namentlich durch Ihre Zeitverhältnisse - nun an das Ende dieses Kursus herangelangt. Da lassen Sie mich denn zum Schlusse dasjenige, was ich schon bei einer Diskussion mir erlaubte auszusprechen, noch eininal aussprechen: Wer mit seiner ganzen Seele drinnen lebt in dem Ideal, daß in einer solchen Weise das Erziehungsund Unterrichtsleben wachsen muß zum Heile der Menschheitsentwickelung, der muß in seiner Seele von tiefer Dankbarkeit dafür erfüllt sein, daß die verehrten Lehrer und Lehrerinnen, die hier bei diesem Kursus von auswärts erschienen sind und sich haben informieren wollen von dem, was hier für Pädagogik und Didaktik eben aus anthroposophischer Forschung heraus zu sagen versucht wird. Tiefe Dankbarkeit lassen Sie mich also am Schlusse dieses Kursus Ihnen aussprechen, und Befriedigung, herzliche Befriedigung darüber, daß
- ganz gleichgültig, wie das nun weiter von dem einen oder anderen mehr oder weniger sympathisch oder antipathisch gefunden werden kann -, nun doch wiederum in einer Anzahl von Seelen dasjenige wahrgenommen worden ist, was aus Anthroposophie heraus auf die verschiedensten Zweige des Lebens wirken soll, was aus Anthroposophie heraus das Leben befruchten soll. Und diese zwei Gedanken werden besonders bei denen, die mit der Veranstaltung zu tun hatten, ganz gewiß zurückbleiben: die schöne Erinnerung an die Dankbarkeit und die schöne Erinnerung an die Befriedigung, wie ich sie eben jetzt charakterisiert habe. Und je mehr sich diese Gedanken innerlich intensiver gestalten können - diese Gedanken an eine Arbeit, der solche
Dankbarkeit und solche Befriedigung zugrunde liegen - desto mehr wird auch die Hoffiiung entstehen, daß nach und nach doch gelingen könne, was aus dieser Pädagogik heraus für die gesamte Entwickelung der Menschheit folgen soll. Und es wird um so mehr das liebevolle Wirken in dieser Pädagogik wiederum entstehen können bei denen, die heute schon mit ihrer ganzen Menschlichkeit drinnen wirken mögen. Nicht nur haben Ihnen vielleicht - durch das, was sie aus ihrer Praxis heraus Ihnen haben sagen wollen - die Waldorfschullehrer und Waldorfschulerzieher etwas gegeben, sondern Sie, die Sie dagewesen sind als Besucher, haben ganz gewiß ebenso viel denWaldorflehrern gegeben, indem gerade jene Liebe, die man braucht, jene selbstverständliche Liebe, die eigentlich doch nur allein Enthusiasmus erzeugend ist, angefacht wird, wenn man sieht; daß dasselbe, was in einem lebt, auch in anderen Menschenseelen anfängt zu leben. Und von diesem wechselseitigen Ineinanderwirken von Dankbarkeit und innerer Befriedigung, von Hoffnung und Liebe, die ineinandergeflossen sind während dieses Kursus, dürfen wir hoffen, daß schöne Früchte reifen können, wenn wir an diesen Dingen das nötige Interesse nehmen, wenn wir die nötige innere Aktivität empfinden, um so recht in ihnen zu leben.
Das ist dasjenige, meine sehr verehrten Anwesenden und meine lieben Freunde, was ich nun, nachdem der Kursus beendet ist, in diesen Abschiedsgruß hineingießen möchte. Es soll nicht irgendein abstrakter Gruß sein, sondern ein konkreter Gruß, in dem Dankbarkeit die feste Grundlage ist, in dem Befriedigung dasjenige ist, was als Wärmendes drinnen wirken kann, in dem Hoffmung dasjenige ist, was als mutvoll Stärkendes aus diesem Gruße herausstrahlt. Liebe in der Handhabung dessen, was in dieser Weise Menschheitspädagogik werden soll, Liebe möge das Licht werden, das über diejenigen komme, deren Pflicht es ist, für die Erziehung der Menschheit zu sorgen.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen in diesem Augenblick, nachdem wir mit diesem Kurse haben zu Ende kommen müssen, den schönsten Abschiedsgruß sagen.
DREI FRAGENBEANTWORTUNGEN
I. Dornach, 18. April 1923
Zu einer Frage über den Religionsunterricht.
Es ist ein Mißverständnis dadurch entstanden, daß ja vorläufig geschildert worden ist, wie sich das Kind hinsichtlich seiner religiösen Impulse entwickelt. Es ist noch gar nicht in meinen Vorträgen vom Religionsunterricht gesprochen worden, weil ich ja heute überhaupt erst begonnen habe mit dem Pädagogisch-Didaktischen. Dasjenige, was von mir ausgeführt wurde, das ist, daß eine Art physisch-religiösen, ich sagte leiblich-religiösen Verhältnisses besteht zwischen dem Kinde und seiner Umgebung. So daß also dasjenige, was das Kind bis zum Zahnwechsel hin einfach durch seine Organisation übt, erst nach der Geschlechtsreife, etwa nach dem 14., 15. Jahr, ins Denken übergeht. Ich habe den Vergleich gebraucht, daß dasjenige, was zunächst auf eine leiblich-geistige Weise sich offenbart, gewissermaßen in einer Unterströmung fortfließt, und dann für das Denken, durch welches die Religion beim Erwachsenen auftritt, erst im 15. Jahre ungefähr auftritt. Nun ist die Sache aber so, daß ja gerade bei einer naturgemäßen Pädagogik dasjenige, was in irgendeinem Lebensalter auftritt, sorgfältig vorbereitet werden muß in den früheren Lebensepochen. Und die didaktisch-pädagogische Frage, die nun daraus hervorgeht, ist diese: Wie ist mit Rücksicht auf diese Entwickelungsgesetze des Menschen der Religionsunterricht gerade in der Volksschule einzurichten? Das ist eine Frage, die den nächsten Vorträgen als Aufgabe mit unterliegen wird. Dasjenige, was ich schon voraus sagen möchte, ist nun dieses: Wir müssen uns klar sein, daß wirklich das religiöse Element dem Menschen angeboren ist, zur Menschennatur gehört. Das drückt sich dadurch ganz besonders aus, daß man eben diese religiöse Orientierung des Kindes, wie ich sie beschrieben habe, bis zum Zahnwechsel findet. Dasjenige, was wir nun durch die allgemeine Zivilisation als die Religion der Erwachsenen haben, ist natürlich eine solche, die in Vorstellungen lebt, oder wenigstens ihren Inhalt
durch Vorstellungen bekommt, die allerdings vor allen Dingen im Gemüt sich ausleben. Für diesen Vorstellungsinhalt wird der Mensch erst reif nach dem 14. Lebensjahr. Es bleibt uns gerade das volks schulmäßige Lebensalter für die wichtige Frage: Wie haben wir da nun den Religionsunterricht einzurichten? Da kommt in erster Linie in Frage: Worauf müssen wir in diesem Lebensalter vom 7. bis zum 14. Jahr vorzugsweise wirken? In der ersten Lebensepoche bis zum Zahnwechsel wirken wir als erzieherische Umgebung eigentlich auf das Leibliche. Nach der Geschlechtsreife wirken wir im Grunde genommen auf das Urteil, auf die Vorstellung. In der Zwischenperiode wirken wir nun gerade auf das Gemüt, das Gefühl. Daher ist auch notwendig, diese Periode einzuleiten damit, daß wir bei den Kindern, die in die Volksschule hineinkommen, mit Bildern anfangen. Die wirken nämlich gerade auf die Empfindung, auf das Gemüt. Die Vorstellung reift allmählich erst heran und wird vorbereitet für das richtige Lebensalter. Nun haben wir ebenso, wie ich es morgen für einzelne Lehrfächer ausführen werde, beim Religionsunterricht dafür zu sorgen, daß wir ihn vor allen Dingen ans Gemüt heranbringen. Und darum handelt es sich also: Was wirkt im Gemüt und auf das Gemüt? Ja, da wirkt vor allen Dingen dasjenige, was erlebt wird in Sympathien und Antipathien. Wenn wir nun bei dem Kinde gerade zwischen dem 7. und 14. Jahr solche Sympathien und Antipathien entwickeln, die da vorbereiten ein richtiges religiöses Urteil, dann tun wir das Rechte. Also sagen wir: Wir richten den Unterricht nicht so ein, daß wir überall Gebote obenan stellen «Du sollst dieses tun, Du sollst jenes nicht tun»; das taugt eben wiederum nicht, gerade für dieses kindliche Alter, sondern wir müssen den Unterricht so einrichten, daß das Kind Sympathie bekommt mit dem, was es tun soll. Das behalten wir für uns im Hintergrund, was es tun soll, aber wir stellen in Bildern dasjenige dar, was ihm auch in religiöser Beziehung in höherem und sehr gehobenem Sinne sympathisch einfließen soll. Wir versuchen, ihm Antipathie einzuflößen für dasjenige, was es eben nicht soll. Wir versuchen auf diese Weise auch gerade eben durch das Gemütsurteil immer an Hand des Bildes das Kind allmählich hinzu-führen von dem Göttlich-Geistigen in der Natur durch das Göttlich-Geistige
im Menschen zu dem Aneignen des Göttlich-Geistigen. Aber das Ganze muß durch Gemüt und Gefühl gehen, gerade im volksschulmäßigen Alter. Also nicht dogmatisch und nicht gebots-mäßig, sondern durchaus das Gemüt, das Gefühl vorbereiten für dasjenige, was dann später in selbstgebildetem Urteil auftreten kann. Und wir werden ganz andere Erfolge erzielen gerade für die religiöse Orientierung des Menschen, als wenn wir in dem Lebensalter, in dem das Kind nicht empfänglich dafür ist, mit Geboten oder Glaubensartikeln kommen. Wenn wir ihm die Bilder vorweisen und dadurch vorbereiten dasjenige, worüber sich später der junge Mensch selber ein religiöses Urteil bilden soll, bereiten wir dem Menschen die Möglichkeit, dasjenige wirklich durch seine eigene Geistigkeit zu erfassen, was er als sein innerstes Wesen erfassen soll, nämlich die religiöse Orientierung. Wir lassen gewissermaßen dem Kinde die Freiheit, sich selber religiös zu orientieren, wenn wir ihm das Religiöse ans Gemüt heranbringen, also in Bildern das Religiöse darbieten, nicht in Glaubensartikeln oder in Geboten. Es ist von ungeheurer Bedeutung, wenn der Mensch dann nach der Geschlechtsreife bis in die Zwanzigerjahre hinein die Möglichkeit hat, das, was er erst im Gemüt, im Gefühl, ich möchte sagen mit einer gewissen Weite und Vielseitigkeit aufgenommen hat, aus sich selbst heraus zum Urteil erhebt. Er bringt sich dann selbst auf den Weg zum Göttlichen. Es ist ein großer Unterschied, ob das Kind in der Zeit, in der es auf Autorität eingestellt ist, durch die Autorität eine festbestimmte Richtung bekommt oder ob es so geführt wird, daß es die religiöse Orientierung bei seinem Erzieher oder Lehrer sieht, daran bildhaftig sich hinaufrankt und dann später schöpfen kann daraus das «Du sollst», «Du sollst nicht». Nachdem es zuerst Gefallen oder Mißfallen gefunden hat an dem, was herauskommt als «Du sollst», «Du sollst nicht», nachdem es in bildhafter Naturanschauung erkennen gelernt hat, wie das Gemüt frei wird durch die Vorstellung eines göttlich-geistigen Webens in Natur und Geschichte, kommt es selber darauf, sich die Vorstel-lungen zu bilden. Es bekommt die Möglichkeit, die religiöse Erziehung aüs dem Zentrum des Lebens zu bekommen, zu dem man erst mit der Geschlechtsreife herankommt. Also darum handelt es sich, aus diesen
Untergründen, die aus Menschenerkenntnis gewonnen werden, das Spätere in richtiger Weise vorzubereiten. Ich habe es dargestellt in den Vorträgen, indem ich einen Vergleich gebraucht habe mit einem Fluß, der versinkt und weiter unten wieder hervorkommt. Der Mensch ist in den ersten 7 Jahren religiös eingestellt. Das tritt nun in die Tiefen des Gemütes hinein, wird ganz seelisch, kommt an die Außenfläche erst wiederum als Denken mit der Geschlechtsreife Und nun müssen wir in die Tiefen seiner Seele hineinwirken durch eine uns persönliche Gemütsoffenbarung. Wir bereiten dadurch für das Kind vor, was es zum religiösen Menschen macht, während wir das verhindern, wenn wir ihm nicht die Möglichkeit bieten, aus dem eigenen Zentrum seines Wesens heraus die religiöse Orientierung zu gewinnen. Diese eigene religiöse Orientierung liegt im Menschenwesen. Sie muß nach dem 15. Jahr gewonnen werden. Wir mussen sie vorbereiten in richtiger Weise. Darum muß auch der Religionsunterricht gestaltet werden wie der andere Unterricht in diesem Lebensalter; er muß bildhaft aufs Gemüt wirken, muß dem Kinde Gefühisanregungen geben. Bis in die Mathematik hinein kann man in jedes Unterrichtsfach einen religiösen Zug bringen. Und daß das der Fall ist, das werden diejenigen spüren, die einmal denWaldorfschulunterricht kennen. Da ist wirklich eigentlich in allen einzelnen Fächern Christentum darinnen, bis in die Mathematik hinein ist Christentum darinnen. Es liegt überall der religiöse Zug zugrunde. Nur eben sind wir ja wegen der heutigen Verhältnisse in die Notwendigkeit versetzt, den eigentlichen Religionsunterricht, weil wir keine Weltanschauungsschule sind, sondern eine pädagogische Schule, und weil wir eigentlich nur den Wert darauf legen, daß bei uns nach naturgemäßer Methodik gelehrt wird - wir haben Anthroposophie eben deshalb zugrunde gelegt, weil wir glauben, daß daraus eine wirklich richtige Pädagogik herausquillt, aber wir wollen nicht Anthroposophen dressieren in der Waldorfschule ; deshalb ist es so, daß wir den katholischen Religionsunterricht von katholischen Pfarrern, den evangelischen Religionsunterricht von evangelischen Pfarrern erteilen lassen. Diejenigen, die nun von unseren Lehrern selber unterrichtet werden, das sind eigentlich die Kinder, die zumeist heute Dissidentenkinder
wären, also keinen Religionsunterricht bekommen würden. Es ist eine überraschende Tatsache, daß das die weitaus größte Majorität der Waldorfschulkinder ist. Die kommen nun alle zu dem so-genannten freien Religionsunterricht, der im Grunde genommen nur dasjenige dann zusammenfaßt, was den ganzen Unterricht doch eigentlich beherrscht. Dieser freie Religionsunterricht, der macht uns eigentlich recht viel Sorge. Wir stehen in bezug auf diesen Unterricht in einem ganz besonderen Verhältnis zur Schule. Wir betrachten alle übrigen Fächer als dasjenige, was durch anthroposophische Forschung als notwendige pädagogisch-didaktische Methodik da sein muß. Den freien religiösen Unterricht erteilen wir selbst, indem wir uns ebenso fühlen in der Schule drinnen stehend wie der katholische und evangelische Religionslehrer. Den erteilen wir als Fremde drinnen. Wir wollen nicht eine Weltanschauungs- oder Konfessionsschule haben, auch nicht in anthroposophischem Sinne, aber schließlich wird natürlich gerade die anthroposophische Methodik recht fruchtbar in diesem freien Religionsunterricht, in dem nicht etwa Anthroposophie gelehrt wird, sondern in dem so gearbeitet wird, wie ich es jetzt methodisch charakterisiert habe. Man wendet allerlei ein gegen diesen freien Religionsunterricht, zum Beispiel, daß so furchtbar viele Kinder von dem anderen Religionsunterricht hinüberlaufen zu dem freien. Das macht sehr viele Schwierigkeiten, weil wir einen Religionslehrer nach dem anderen anstellen mußten und nicht mehr genügend Leute haben dafür. Wir können nichts dafür, daß die Kinder hinüberlaufen, von dem anderen Religionsunterricht fortlaufen. Das liegt nur darinnen, daß die anderen eben nicht die Methodik haben, die in unserem Religionsunterricht drinnen ist. Uns kommt es auch beim Religionsunterricht auf die richtige Pädagogik an.
Auf eine weitere Frage.
Das Charakteristische derWaldorfschule soll sein, alle Fragen vom Gesichtspunkte der Pädagogik aus zu betrachten, also auch den Religionsunterricht. Nun wird aber gerade Herr Pfarrer X. zugeben, daß die beiden angeführten Richtungen: die Frage der Ersetzung des Religionsunterrichts durch moralischen Unterricht und die konfessionelle
Schule, daß die von ganz anderen Gesichtspunkten aus aufgeworfen werden. Vor allen Dingen die Ersetzung des Religionsunterrichtes durch den Moralunterricht wird von denjenigen Menschen aufgeworfen, wekhe überhaupt in der Zivilisation die Religion beseitigen wollen, welche die Religion als etwas mehr überflüssig Gewordenes halten. Die wollen natürlich keine Religion, sondern Moralunterricht. Auf der anderen Seite geht natürlich aus dem Hinneigen zu den dogmatischen Konfessionen die Sehnsucht hervor, die Schule konfessionell zu gestalten. Das sind aber keine pädagogischen Gesichtspunkte. Aber damit man auch etwas Präzises verbindet mit dem, was da Pädagogik genannt werden muß, möchte ich sagen: Was ist denn eigentlich der pädagogische Gesichtspunkt? Der pädagogische Gesichtspunkt kann nur der sein, vorauszusetzen, daß der Mensch, wie esja selbstverständlich ist, zunächst in seinem kindlichen oder jugendlichen Lebensalter nicht ein ganzer Mensch ist, sondern erst einer werden muß; daß man erst Mensch wird im Verlauf des Lebens. Man muß also alle menschlichen Anlagen zur Ausbildung bringen. Das ist zuletzt die abstrakteste Form des pädagogischen Gesichtspunktes. Wenn nun jemand vom pädagogischen Standpunkte aus spricht und sagt, aus der Menschenerkenntnis, die zugrunde liegt der Pädagogik, daß das Kind überhaupt schon religiös eingestellt zur Welt kommt, daß es in den ersten 7 Lebensjahren sogar seine Leiblichkeit religiös eingestellt hat, dann muß es einem vorkommen, daß, wenn man den Religionsunterricht ersetzen will durch Moralunterricht, wie wenn man ein physisches Glied des Menschen, ein Bein, nicht ausbilden wollte, weil man zu der Ansicht übergehen würde: der Mensch braucht alles, aber nicht die Beine auszubilden. Das weglassen zu wollen, was zum Menschen gehört, das kann entspringen einem Fanatismus, aber niemals einer Pädagogik. Insofern hier überall pädagogische Grund-sätze verfochten werden, pädagogische Impulse ins Auge gefaßt werden, folgt die Notwendigkeit des Religionsunterrichtes durchaus vom pädagogischen Gesichtspunkte. Daher haben wir, wie ich schon sagte, für diejenigen Kinder, die sonst konfessionslos wären, also keinen Religionsunterricht hätten nach dem Württembergischen Schulgesetz, den freien Religionsunterricht eingerichtet. Dadurch haben wir gar
keine Kinder in der Waldorfschule ohne Religionsunterricht ; denn in den freien Religionsunterricht kommen diese alle. Wir haben dadurch die Möglichkeit, gerade wiederum das religiöse Leben in die Schule zurückzuführen. Das wird vielleicht die beste religiöse Erneuerung sein, wenn man davon spricht, das religiöse Leben in der Schule richtig zu pflegen, wenn man es dahin bringt, dasjenige, was heute als religionslose Aufklärung wirkt, dadurch zu bekämpfen, daß man einfach appelliert an die ursprüngliche religiöse Anlage des Menschen. Ich betrachte das als eine Art von Erfolg in der Waldorfschule, daß wir die Dissidentenkinder auf diese Weise zum Religionsunterricht gebracht haben. Die katholischen und evangelischen Kinder wären ja zu ihrem Religionsunterricht gekommen, aber es war wirklich nicht so leicht, diejenige Form zu finden, die nun allen andern Kindern wiederum Religionsunterricht zuwendet. Das ist vom pädagogischen Standpunkte aus angestrebt worden bei uns.
II. Dornach, 19. April 1923
Über musikalische Ausbildung (in Beantwortung einer Frage über Musik-stunde bei einem 1 7 jährigen Mädchen).
Das Wesentliche ist ja doch das, was Herr Baumann hingestellt hat: daß gerade mit der Geschlechtsreife und dann in den folgenden Jahren sich ergibt, daß ein gewisses musikalisches Urteil an die Stelle eines früheren musikalischen Empfindens und musikalischen Erlebens tritt. Das musikalische Urteil tritt dann auf. Das ist natürlich darin sehr deutlich zu bemerken, daß die Erscheinungen auftreten, die Herr Baumann charakterisiert hat: es tritt eine gewisse Selbstbeobachtung ein bei den Kindern, eine Selbstbeobachtung ihres Singens und dadurch wiederum die Möglichkeit, bewußter die Stimme zu behandeln und dergleichen. Das muß nun auch methodisch kultiviert werden. Dann aber tritt das sehr stark hervor, daß gerade von diesem Jahre ab jenes selbstverständliche musikalische Gedächtnis etwas zurückgeht, so daß die Kinder von diesen Jahren ab sich mehr anstrengen
müssen, um auch gedächtnismäßig das Musikalische zu behalten. Darauf muß man dann im Unterricht ganz besonders sehen. Während die Kinder bis zur Geschlechtsreife ein selbstverständliches Leben haben im Musikalischen, die Dinge sehr leicht behalten, fangen manchmal diejenigen, die früher sehr gut behalten haben, nun an, Schwierigkeiten zu haben im Behalten, also nicht so sehr im Aneignen, sondern im Behalten. Darauf muß man sehen. Man muß versuchen, nicht unmittelbar hintereinander, aber oftmals die Dinge zu wiederholen. Namentlich tritt in diesem Alter stark das hervor - psychologisch liegt da ein sehr feiner, intimer Unterschied zugrunde -, daß, während früher das Instrumental-Musikalische und das Stimmliche, das Vokal-Musikalische in eins zusammenfallen, werden diese zwei Dinge gerade vom 16., 17. Jahr ab sehr deutlich voneinander unterschieden. Es wird viel bewußter hingehört auf das Instrument, es wird viel bewußter von diesem Lebensalter an auch auf das Instrumental-Musikalische hingehört. Man bekommt mehr Verständnis für das InstrumentalMusikalische als vorher. Vorher sang das Instrument sozusagen mit, nachher hört man die Instrumente; hören und singen sind dann zwei, wenn auch parallel miteinandergehende Prozesse. In diesem Verhältnis, das dann eintritt zwischen Singen und Verstehen des Instrumentes, liegt das Charakteristische. Da müssen dann die Unterrichtsmethoden eben darnach eingerichtet werden. Wichtig ist, daß man mit dem Theoretisch-Musikalischen vor diesem Lebensalter überhaupt nicht anfangen sollte, sondern daß man eigentlich das Musikalische praktisch treiben sollte, und, was man theoretisch bemerken will, an-knüpft an das unmittelbar praktische Treiben, und dann allmählich, gerade in diesem Lebensalter, den Übergang erst gewinnt, nun auch etwa verstandesgemäß zu urteilen über das Musikalische. Das, was Herr Baumann zuletzt angedeutet hat, daß man den Kindern manches in ihrer Selbsterkenntnis beibringen kann aus ihrem musikalischen Auftreten heraus, das ist durchaus richtig. Und während zum Beispiel, wenn man, wie wir es ja in der Waldorfschule machen, die älteren Kinder zur plastischen Tätigkeit bringt, wenn man sie allerlei bilden läßt, währenddem man da die Eigentümlichkeiten der Kinder gleich von Anfang an wahrnehmen kann in dem, was sie plastisch
hervorbringen - es ist irgend etwas, wenn es von verschiedenen Kindern plastisch gestaltet wird, ja etwas ganz Verschiedenes -, ist es beim Musikalischen so, daß man auf dasjenige, was den Kindern individuell ist, zunächst gar nicht eingehen kann. Das tritt dann eben hervor, wenn das Kind dieses Lebensalter erreicht hat. Dann kann man, natürlich namentlich aus den ja dann auch schon intensiver hervortretenden Neigungen für diese oder jene musikalische Richtung, zurückwirken auf das Kind, um Einseitigkeiten zu vermeiden. Wenn also das Kind eine bestimmte Musik besonders liebt, sagen wir zum Beispiel, es gibt ja gerade in unserer gegenwärtigen Zivilisation sehr viele Kinder, bei denen stellt sich ganz von selbst ein, daß sie reine Wagnerianer werden. Da muß man entgegenwirken, denn da findet eigentlich das statt, daß ein zu starkes Aufnehmen des Musikalischen mit dem Gefühl eintritt, statt der inneren Gestaltung des Musikalischen selber - ich will damit nichts gegen Wagner sagen -, also es rutscht das Musikalische gewissermaßen zu stark in das Gefühlsleben hinunter. Da muß man es dann heraufheben. Das merkt der Musiker auch an der Gestaltung der Stimme. Die Stimme klingt anders bei einem Kinde, bei dem zu stark das Musikalische ins Gefühl rutscht, als bei einem Kinde, das die Formung der Töne hört, für das Plastische in der Musik ein richtiges Verständnis hat. Da in der richtigen Weise zu wirken für ein richtiges musikalisches Gefühl und Verständnis, dafür ist dieses Lebensalter besonders wichtig. Natürlich kommt dabei in Betracht, daß man ja bis zur Geschlechtsreife unbedingt als Autorität neben den Kindern steht. Da hat man noch nicht Gelegenheit, auf diese Dinge zu sehen beim Kinde. Nachher steht man schon nicht mehr als Autorität neben dem Kinde, sondern durch das Gewicht, das man dem eigenen Urteil für das Kind geben kann. Bis zur Geschlechtsreife ist dasjenige richtig, was der Lehrer für richtig hält, falsch, was der Lehrer für falsch hält, weil es der Lehrer für richtig oder falsch hält. Nach der Geschlechtsreife muß man begründen, auch musikalisch begründen. Deshalb ist es sehr wichtig, daß gerade dann, wenn eben die Veranlassung vorliegt, den musikalischen Unterricht in diese Zeit hinein besonders fortzusetzen, wirklich stramm in das Motivieren der Urteile, die man heranzieht, eingegangen
wird. - Ja, man könnte die ganze Nacht über dieses Thema weiterreden, wenn man wollte.
Frage: Liegt nicht eine Lüge darin, wenn man das Kind nach etwas fragt, was man doch schon weiß?
Es liegt etwas sehr Interessantes zugrunde. Wenn ich jemand frage nach etwas, so ist die Voraussetzung, ich will die Antwort haben, weil ich sie noch nicht weiß. Nun frage ich das Kind um etwas, ich weiß es aber schon, also begehe ich eine Unwahrheit. - Nun handelt es sich im Unterricht eben sehr stark um Imponderabilien. Sehen Sie, es ist manchmal durchaus notwendig, sich dieses klarzumachen. Ich gebrauche oftmals ein Beispiel dafür: Man kann, wenn man religiös bildhaft unterrichtet, bei der Besprechung der Unsterblichkeitsfrage zu einem Bilde greifen in der folgenden Weise. Man sagt sich: du willst dem Kinde, das noch nicht irgendwelche Erörterungen begrifflicher Art verstehen kann, bildlich etwas von der Unsterblichkeit beibringen. Du bist gescheit als Lehrer, das Kind ist dumm ; also präge ich aus meiner Gescheitheit heraus ein Bild. Ich mache das so, daß ich sage: Schau dir die Schmetterlingspuppe an ; die Puppe öffnet sich, wenn sie reif wird, dann fliegt der schöne Schmetterling heraus. So wie der Schmetterling aus der Puppe ausfliegt, so fliegt die unsterbliche Seele aus dem Körper, wenn der Mensch stirbt. Man bringt das dem Kinde bei. Schön, aber man wird bemerken, daß, wenn man aus dieser Orientierung heraus das dem Kinde beibringt, so wird es keinen sehr starken Eindruck auf das Kind machen. Denn der Lehrer in seiner Gescheitheit glaubt natürlich selber nicht an das Bild, sondern er verdeutlicht nur für das dumme Kind die Unsterblichkeitsfrage in diesem Bilde. Aber es gibt noch eine andere Orientierung, das ist die, daß man selber an das Bild glaubt. Und da kann ich sagen: Wenn man nicht furchtbar gescheit ist, sondern wirklichkeitsverwandt ist, glaubt man selber daran. Da nimmt man das Bild so, daß man sich sagt:
nicht ich vergleiche, sondern die Weltordnung selber hat dieses Bild hingestellt ; es liegt wirklich im Auskriechen des Schmetterlings auf einer unteren Stufe dasselbe ausgedrückt, versinnlicht vor, was in der
Unsterblichkeit der Seele vorliegt. Ich kann daran glauben. Merken Sie den Unterschied: wenn ich an meine Bilder selber glaube, mit alldem, was in meinen Worten liegt, wenn ich sie dem Kinde beibringe, da wirkt die Gesinnung des Lehrers mit auf das Kind. Solche Dinge können Sie unendlich viele finden. Und so wirken auch die Imponderabilien mit in der interessanten Frage, die jetzt eben aufgestellt ist. Es handelt sich nicht darum, daß man als Lehrer nun die Ansicht hat:
Ich weiß das, das Kind weiß es nicht, und ich frage das nun, als wenn ich es wissen wollte. Nicht wahr, es ist ein großer Unterschied, ob ich das Kind frage etwa über die Schlacht bei Zabern, und ich weiß es, das Kind aber nicht, oder weiß es auch ; die Unwahrheit liegt darinnen, daß ich frage, während ich die Sache schon weiß. Nun kann ich aber die Gesinnung haben, daß mich trotzdem an der Antwort des Kindes etwas interessiert, und ich stelle vorzugsweise die Fragen in der Absicht, nun richtig zu erfahren, was das Kind über die Sache meint. Dann weiß ich wirklich nicht, was das Kind sagen wird. Das Kind sagt mir die Dinge nuanciert. Und wenn ich mir überhaupt als Ideal stelle, wie ich es oftmals betont habe in meinen Vorträgen:
Kein Weiser ist so gescheit, daß er nicht von einem Säugling etwas lernen könnte - ja man kann noch so weit in der Wissenschaft fortgeschritten sein, der Schrei eines Säuglings kann einen viel lehren -, so kann man tatsächlich als Lehrer aus jeder Antwort des Kindes, wenn man die Frage in dieser Gesinnung stellt, lernen zu lehren. Man kann aus jeder Antwort eines Kindes durchaus nicht das herausholen:
man will hören, was man weiß, sondern man kann dasjenige kennenlernen, was das Kind einem sagt. Dann wird man auch seine Frage richtig stellen. Dann wird man sehr häufig zum Beispiel die Frage so formulieren: Was meinst du darüber? Schon in der Betonung der Frage wird etwas liegen, daß man selber als Lehrer neugierig ist, was das Kind antwortet. Es ist wirklich so, daß auf die Imponderabilien, die sich abspielen zwischen Kind und Lehrer, viel ankommt. Wenn man das unterbewußte Leben kennt, wie es im Kinde ausgebildet ist, kommt man auf vieles andere noch. Auf diesem Gebiete liegt ja auch die Frage des Lügenhaften im Unterricht, wenn man es bestimmt ausdrücken will, wenn der Lehrer vor der Schule steht und
aus dem Buche unterrichtet oder sich so hilft, daß er sich die Sachen irgendwie aufgeschrieben hat. Ja, nicht wahr, das ist unter Umständen sehr bequem für den Lehrer. Für den Unterricht ist es aber eigentlich furchtbar ; schon deshalb furchtbar, weil das Kind in seinem Unterbewußtsein sich fortwährend ein Urteil bildet, wenn der Lehrer mit dem Unterrichtsstoffe so in der Klasse steht. Da spricht das Unterbewußtsein des Kindes: Warum soll ich wissen, was der nicht weiß? Von mir wird verlangt, zu wissen, was der mir aus seinem Buche vorliest. Sehen Sie, das ist noch eine viel größere Unwahrheit, die auf diese Weise in die Klasse kommt, als durch das Fragestellen. Selbst beim Diktieren von Übungssätzen soll man vorsichtig sein und nicht aus dem Buche diktieren. Wenn man beachtet, was im Kinde vorgeht, und das Kind merkt, daß der Lehrer für es Interesse hat und nicht die Frage aus Lügenhaftigkeit stellt, dann ist die Sache eben ganz anders. Auf diese Weise wird man wirklich dazu kommen, keine Lüge mehr zu entwickeln in dem Frage- und Antwortverhältnis zwischen Lehrer und Kind.
III. Dornach, 22. April 1923
Frage: Kann man die Waldorfschul-Praxis auch in anderen Ländern einführen ; zum Beispiel in der Tschechoslowakei ?
Im Prinzip ist es möglich, die Waldorfschul-Pädagogik überall einzuführen, denn sie ist reine Pädagogik, bloße Pädagogik. Das Wesentliche der Waldorfschul-Pädagogik im Unterschied von vielen an-deren pädagogischen Strömungen, die heute bestehen, ist ja das, daß eben die Waldorfschul-Pädagogik rein pädagogisch ist. Nicht wahr, heute gibt es ja Menschen die sagen: Wenn man einen Menschen ordentlich erziehen und unterrichten will, muß man ihn in ein Landerziehungsheim tun ; in der Stadt geht es nicht. Ein anderer fordert diese äußeren Bedingungen, der andere jene. Der eine sagt: das Internat ist das richtige für die Erziehung, der andere sagt: die Familienerziehung ist die richtige. All diese Dinge fallen in der Waldorfschul-Pädagogik
weg. Ich will jetzt gar nicht streiten gegen diese Dinge, sie mögen von dem einen oder anderen Gesichtspunkte aus ihre Berechtigung haben. Aber die Waldorfschul-Pädagogik ist eben reine Pädagogik und kann sich allen äußeren Verhältnissen anpassen, sei es städtische Schule, Landschule oder was auch. Sie ist eben nicht auf besondere Verhältnisse zugeschnitten, sondern sie will nur den heranwachsenden Menschen als solchen ins Auge fassen. Also: die Waldorf-Pädagogik könnte in jede Schule eingeführt werden. Etwas anderes ist es aber, ob man sie hereinläßt, ob die anderen einverstanden sind, die in diesen Schulen die Aufsicht haben oder diese Schulen einrichten oder sie mit Lehrplänen versehen oder dergleichen. Die Waldorfschul-Pädagogik kann morgen in der ganzen Welt in alle Schulen eingeführt werden, aber ob man sie hereinläßt, das ist die Frage. Die ist vom Gesichtspunkte des einzelnen Territoriums aus zu beantworten. - Das ist das einzige, was man darüber sagen kann.
Über Rezitation und Eurythmie.
Es ist ja schade, daß gerade Frau Dr. Steiner, die die Rezitations-kunst hier ausgebildet hat, in diesen Tagen krank ist und nicht die Rezitation selber hat besorgen können. Es handelt sich darum, daß die Eurythmie selber dazu zwingt, wieder zurückzugehen zu derjenigen Rezitations- und Deklamationskunst, die gepflogen worden sind in mehr künstlerisch-fühlenden Zeitaltern, als das unsn.ge ist. Das heutige Zeitalter istjakein sehrkünstlerisch empfindendes undwürde nicht leicht verstehen, warum Goethe selbst seine Jamben-Dramen wie ein Kapellmeister mit dem Taktstock mit seinen Schauspielern einstudiert hat. In unserem Zeitalter wird bei der Rezitation und Deklamation - die beide voneinander unterschieden werden müssen in sehr strenger Weise - viel mehr Rechnung getragen dem Pointieren eben des Prosa-Inhaltes. Wenigstens eine starke Strömung war seit den neunziger Jahren vorhanden, die eigentlich die künstlerische Gestaltung der Sprache selber mehr in den Hintergrund treten ließ und den Prosagehalt des Gedichtes mehr in den Vordergrund treten ließ, während es tatsächlich darauf ankommt, in der imaginativen Gestaltung der Laute, aber auch, sagen wir, des Strophenbaues oder in der
musikalisch-thematischen Behandlung, in Rhythmus, Takt, im melodiösen Thema, das überall doch zugrunde liegen wird, das Wesentliche zu sehen, und durch die Sprachbehandlung auf einer höheren Stufe das zu erreichen, was man in der Prosa durch den bloßen Wort-inhalt erreicht. Es ist ja das Gefühl für das Künstlerische der Sprache überhaupt in der neueren Zeit zurückgegangen, selbst äußere Kultur-erscheinungen machen einem das klar. Ich glaube nicht, daß sehr viele Menschen wissen oder beachtet haben, was der berühmte Curtius an der Berliner Universität für ein Fach hatte. Er trug Kunstgeschichte und dergleichen vor, aber das war nicht das Fach, für das er an der Berliner Universität angestellt war, sondern er hieß «Professor der Eloquenz», er war eigentlich angestellt für die Redekunst, über Redekunst zu sprechen. Aber man hatte dafür kein Verständnis mehr, es war unnötig, daß er über sein eigenes Fach las, so rutschte er in ein anderes Fach hinein. Solche Erscheinungen sind heute vielfach da. Es ist notwendig, wenn wiederum zu einer Rezitationskunst gekommen werden soll, die vorzugsweise ausgebildet werden muß für das mehr Erzählende oder für diejenige Poesie, die etwa die Griechen hatten, für die Rezitationskunst und die Deklamationskunst, das ist diejenige Kunst, die der älteren deutschen Poesie zugrunde liegt, daß da wiederum für die Sprachbehandlung das Nötige getan wird. Das ist es, worauf es ankommt. Ich weiß nicht, was dem Fragesteller gerade aufgefallen ist, aber das ist es, worauf es uns ankommt: durch die Sprachbehandlung das zu erreichen, was für die Prosa durch den Sprachgehalt selber erreicht wird.
Es ist nicht durch die Betonung des Inhalts, nicht durch die Prosa-bedeutung des Inhalts, sondern durch die Art und Weise der Aufeinanderfolge der Laute oder des Gebrauches des Reimes und dergleichen, es ist also gerade durch die Form das zu erreichen, was man heute gerne erreicht durch die prosaische Pointierung. Die Rezitation sucht vorzugsweise an das Plastisch-Maßvolle sich zu halten, sie sucht also vorzugsweise das, wo es darauf ankommt, im Aushalten der Silben und im Kurzmachen der Silben, was ja bei Balladen ganz besonders wichtig werden kann. Die Deklamation sucht durch den Hoch- und Tiefton und was sich daran anschließt das Wesentliche zu
erreichen. (Es war dem Fragenden aufgefallen, daß bei dem Worte «grüßen» die Silbe «grüs» in demselben Tone gesprochen wurde wie die Silbe «sen».> Das ist keine künstlerische Frage, sondern eine bloße Auffassungsfrage. Das hängt ganz davon ab, ob der Sprechende den Hauptwert darauf legt: Sag, ich lass' sie grüßen, oder: Sag, ich lass' sie grüßen.
Frage: Wird dadurch nicht das Gewicht des Reimes verschoben ?
Das könnte nur dann verschoben werden, wenn man die anderen Silben der Sache nicht anpassen würde. Das kommt ja aus der Stimmung, nicht aus der Sprachbehandlung.
Frage: Drückt sich in der Auffassung keine Gesetzmäßigkeit aus ?
Nein, die Auffassung muß frei bleiben. Es ist durchaus möglich, daß Sie ein und dasselbe Gedicht künstlerisch deklamieren oder rezitieren, und Sie können die verschiedensten Auffassungen hereinbringen, gerade wie einer im Spielen eines musikalischen Stückes die verschiedensten Auffassungen hereinbringt. Es gibt keine eindeutige Behandlung des Gedichtes, sondern es kommt auf das Wesentliche an, daß man es also dazu bringt, nicht mehr das Gefühl zu haben:
Man spricht rezitierend oder deklamierend mit dem Kehlkopf, sondern man spricht mit der Luft. Darauf kommt es an, daß man wirklich die Gabe entwickelt, die Luft zu gestalten. Darauf kommt es beim Rezitieren an. Beim Gesang gestaltet man die Luft. Beim Re-zitieren muß auch dieselbe Tendenz walten, nur natürlich bei der Sprache liegt die Melodie schon im Laut. Also es muß tatsächlich in das Behandeln der Sprache das Wesentliche hereingebracht werden und nicht in den Inhalt. Es muß einer solchen Sache Rechnung getragen werden, daß es bei Schiller zum Beispiel so war: bei seinen bedeutendsten Gedichten hatte er eine allgemeine Melodie in der Seele ; dazu konnte er einen Text schreiben, den er wollte. Man muß erreichen, das Wesentliche auszudrücken auf der einen Seite durch das Musikalische, auf der anderen Seite durch das Plastisch-Malerische in der Sprache.
Frage: In der Tanzkunst tanzen die Tänzer verschieden. Das ist bei der Eurythmie nicht der Fall; da ist die Bewegung selbst ja wohl immer die gleiche ?
Das würden Sie nicht sagen, wenn Sie die Eurythmie viel sehen würden. Sagen wir, wenn Sie ein Gedicht rezitieren und ein anderer Mensch dasselbe Gedicht rezitiert, so sind das doch zwei verschie-dene Stimmlagen usw. Sie können nun künstlerisch das Gedicht in der gleichen Weise behandeln. Die künstlerische Behandlung wird gleich sein. Schon dieser Unterschied tritt bei der Eurythmie stark hervor. Sie werden trotzdem die persönlichen Eigentümlichkeiten bei den einzelnen Eurythmikern sehen. Die sind schon individuell. Die Eurythmie ist nur noch nicht weit genug, daß die besondere individuelle Art schon hervortreten würde. Es wird aber das sein, wenn die Eurythmie so weit ist, daß der Eurythmist ganz zusammen sich lebt mit seiner Kunst ; dann wird auch die individuelle Auffassung schon bemerkbar sein. Gewiß, es liegt zugrunde immer eine gesetzmäßige Bewegung. Es ist das so wie beim Sprechen: wenn ich Mund sagen will, darf ich nicht Mond sagen, also nicht ein o statt des u. Der Betreffende muß deshalb eurythmisierend ein u an der betreffenden Stelle haben, aber da kommt dann innerhalb dieser Gesetzmäßigkeit die individuelle Ausgestaltung der Auffassung, die größte Entfaltungsmöglichkeit zu ihrem Recht. Es ist nicht irgend etwas Pedantisches, Stereotypes. Sie werden auch sehen, wenn ein Anfänger etwas eurythmisch darstellt, oder jemand, der es jahrelang getrieben hat, ist es ein großer Unterschied, nicht bloß in der Fertigkeit, sondern auch im Künstlertum. Und ebenso kommt wiederum die ursprüngliche künstlerische Begabung zum Vorschein, ob jemand künstlerische Veranlagung hat oder nicht. Mehr wie bei einer anderen KLlnst kommt das bei der Eurythmie zum Vorschein. Die Eurythmie ist ganz im menschlichen Organismus beschlossen. Der menschliche Organismus umfaßt die Eurythmie so, daß die Eurythmie, ebenso wie die anderen Künste, zum Beispiel die Malerei, nicht verstandesmäßig, aber innerhalb des Bewußtseins, beschlossen werden, während das Tanzen ins Emotionelle hinübergeht. Da können andere Schwierigkeiten
hervortreten. Das Tanzen ist doch nicht etwas rein Künstlerisches. Die Eurythmie ist schon Kunst.
Es war bei den Teilnehmern der Wunsch entstanden, einen Schulverein zu gründen, mit dem Ziel, in der Schweiz eine Waldorfschule aufzubauen. Es stellte sich aber auch die Frage, was wichtiger sei, das Goetheanum wieder aufzubauen oder eine Schule zu errichten. Beides zugleich zu tun, schien nicht möglich. Dr. Steiner wurde gebeten, sich über den Wiederaufbau des Goetheanums zu äußern.
Ja, daß das Goetheanum wieder aufgebaut werde, das ist ja wohl für die weiteren Kreise, nicht bloß für die schweizerischen, sondern für die weiteren Kreise der anthroposophi schen Bekenner in der Welt eine Art Selbstverständlichkeit. Das Goetheanum wurde im Laufe der Jahre, in denen es gestanden hat, nach und nach als etwas angesehen, was schon als ein Mittelpunkt der ganzen anthroposophischen Bewegung da sein sollte. Und es wird kaum ein Zweifel bestehen bei der weitaus größten Anzahl der Anthroposophen in der Welt, daß das Goethe anum wieder aufgebaut. werden muß. Die Hindernisse für den Aufbau des Goetheanums könnte es ja eigentlich nur geben bei den schweizerischen Machthabern. Andere Hindernisse kann es ja nicht geben. Wenn eben die schweizerischen Machthaber der verschiedensten Art es nicht unmöglich machen, daß das Goetheanum aufgebaut werde, so wird es ganz gewiß aufgebaut.
Auf der anderen Seite hat sich ja auch schon, während das Goetheanum bestanden hat, die Notwendigkeit herausgestellt, wenigstens eine kleine Fortbildungsschule hier zu errichten. Denn eigentlich ist es für alle Dinge, welche die Anthroposophie in Angriff nimmt, welche aus den Impulsen der Anthroposophie folgen, immer notwendig, daß sie auch vertreten werden, daß sie dann ins Praktische hinüber-geführt werden. Sie wissen ja, daß sich auch mancherlei andere Bestrebungen aus der anthroposophi schen Arbeit heraus ergeben haben, zum Beispiel die medizinischen. Ich will das nur zur Erläuterung sagen. Da mußte ich auch sagen: Wenn man überhaupt daran denkt, Medizinisches zu treiben auf Grundlage der anthroposophischen Forschungen, so ist es notwendig, daß die Persönlichkeiten, welche sich
dieser Sache widmen, in fortwährendem wirklich praktischem Zusammenhang mit kranken Menschen sind. Deshalb wurden die Kliniken hier in Arlesheim und in Stuttgart eingerichtet. Das will ich nur als ein Beispiel dafür erwähnen, daß es uns wirklich nur so ernst sein kann mit demjenigen, was nach der einen oder anderen Richtung hin an Impulsen aus der anthroposophischen Sache folgt, daß aus dem sich diese Institutionen wie von selbst als eine Notwendigkeit ergeben. Und so haben wir auch eben mit dieser kleinen Fortbildungs-schule, die hier unmittelbar an das Goetheanum sich angeschlossen hat, und ja auch weiter betrieben wird, dasjenige getan, was einzig und allein zu tun möglich war. Begonnen haben wir ja sogar diese Schule damit, daß aus einer gewiß ganz berechtigten Überzeugung heraus eine Anzahl von Eltern uns für diese Schule ja auch kleinere Kinder gerne übergeben hätten, die auch hier dann nach derWaldorfmethode unterrichtet worden wären. Allein diese Kinder hat man uns behördlich genommen. Diese Kinder mußten unter das Zwangsschul-gesetz eben gefügt werden. So daß wir in der Schweiz nicht in der Lage waren, auch nur in kleinem Maßstabe etwas ähnliches einzurichten, wie es in Stuttgart durch ein freieres Schulgesetz ja damals noch möglich war, als die Waldorfschule eingerichtet worden ist. In dieser Beziehung sind ja die Fortschritte der Weltgeschichte sehr merkwürdig. In bezug auf das Unterrichtswesen war man eigentlich frei - glauben Sie nicht, daß ich jetzt konservative oder reaktionäre Tendenzen entfalten will, sondern ich will nur historische Tatsachen feststellen - in jenen alten Zeiten, in denen es noch keinen Liberalismus, geschweige denn eine Demokratie gegeben hat. Die Unfreiheit ist erst gekommen in den Zeiten des Liberalismus und der Demokratie. Ich will nicht einmal behaupten, daß diese Dinge: Unfreiheit und Liberalismus, Unfreiheit und Demokratie unbedingt zusammengehö-ren; aber in der historischen Entwickelung haben sie sich als eng miteinander verbunden gezeigt. Und das allerunfreieste Schulwesen ist ja in demjenigen Teil der heutigen - ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll «zivilisierten Welt», in demjenigen Teil der europäischen Welt, der auch von manchen westeuropäischen, demokratisch gesinnten Leuten wie eine Art Paradies angesehen wird, in Sowjetrußland.
Da wird die Freiheit durch die extremste Demokratie, wie man es nennt, mit Stumpf und Stil ausgerottet, und ein Unterrichtswesen greift da Platz, das überhaupt die Karikatur der menschlichen Freiheit, der menschlichen Betätigung ist.
Nun also, ich möchte das doch eben stark betonen, daß der Wiederaufbau des Goetheanums schon eine Notwendigkeit ist und daß man zu einem Nicht-Aufbauen nur kommen würde, wenn eben der Zwang dazu da wäre. Also das müßte ja auf jeden Fall angestrebt werden, und das wird auch als selbstverständlich von all denjenigen, die es mit der Anthroposophie ernst meinen, auch in ganz ernster Weise energisch als ein Ziel vorausgesetzt. Sobald die behördlichen Angelegenheiten abgeschlossen sind, wird selbstverständlich nach dieser Richtung alles versucht werden. Man kann immer nur eines nach dem anderen tun, wenn man etwas nicht nur bloß theoretisch vertreten will. Nicht wahr, man kann ja alles Mögliche beschließen und Pläne ausdenken, aber wenn man auf dem Boden einer Wirklichkeitserkenntnis steht, tut man das nur, wenn die Basis dazu da ist. Das Idealste wäre natürlich, wenn sich dasjenige, was man an allgemeinem Volksgeistesleben und sonstigem Volksleben durch ein neues Goetheanum begründen könnte, wenn sich das würde ergänzen können durch eine Volksschule auch hier. Aber da kommt es eben darauf an, daß alle diese Interessen, die gerade hierzulande sind, eben in irgendeiner Weise beseitigt werden würden.
Und ich meinerseits bin ja der Überzeugung, wenn sich nur eine genügend große Anzahl von Menschen - womit ich nicht immer Majoritäten meine - findet, welche eine solche Schule als eine Notwendigkeit erkennen, so wird sie auch entstehen. Es werden sich Mittel und Wege ganz unbedingt finden, und sie wird entstehen. Mit dem Goetheanum ist es ja nicht so leicht. Natürlich, es - sagen wir - aus dem Willen der Schweiz heraus zu gestalten, das ist nicht so leicht ; das muß eine internationale Sache sein.
Aber Volksschulen gehen schon aus den Volkskulturen hervor, und da handelt es sich wirklich darum, daß weder die Waldorf-lehrer noch ich oder sonst ein anderer Mensch als unsere verehrten schweizerischen Freunde und Besucher darüber eine Stimme
haben und daß es daher wirklich vor allen Dingen Bedürfnis sein würde, die Empfindungen, die Gesinnung, die Ansicht gerade der schweizerischen Freunde und Besucher über diesen Punkt zu hören.
Nach weiteren Äußerungen von Teilnehmern wird Dr. Steiner gebeten, die Schlußworte zu sprechen.
Der Herr Vorsitzende meint, ich sollte noch einige Worte sagen. Die können ja eigentlich nur darin bestehen, daß ich meine recht große Befriedigung darüber ausdrücke, daß ja bei den sehr verehrten Besuchern, die hier vereint sind, der allerbeste Wille und die allerbesten Absichten zum Ausdruck gekommen sind. Und man muß schon sagen, daß jede solche Vereinigung von Menschen erfreulich ist, welche wiederum einmal darauf kommen, daß dasjenige, was hier in Dornach gepflegt wird, doch nicht das ist, was sehr viele Menschen in unwahrer Art daraus machen. Und wenn sich eine Anzahl von Persönlichkeiten findet, die einfach durch die eigene Anschauung wissen kann, wieviel Unwahres über Dornach verbreitet wird, dann wird auch die Zeit kommen, in welcher alles dasjenige, was heute beabsichtigt wird, in schwacher Weise noch selbstverständlich von hier, daß das in einer viel, viel leichteren Weise zur Verbreitung kommen wird. Es ist ja natürlich nicht jeder in der Lage, die ganz besondere Art und Weise zu sehen, in welcher das entstellt wird, was hier von Dornach aus geschieht. Man ist manchmal ganz verwundert darüber, wie wenig eigentlich heute sittliches Ethos unter den Menschen ist, wieviel Gleichgültigkeit gegenüber Verdrehungen und Entstellun-gen, die doch eigentlich auf das Feld der Unmoralität gehören - wieviel von dem, was an Verdrehungen und Entstellungen geleistet wird, mit einer gewissen Phlegmatik hingenommen wird. Es ist nun schon einmal so, daß man fast auf Unglauben stößt, wenn man die Dinge berührt, die auf dieses Feld gehören. Es ist hier gestern eine Persönlichkeit genannt worden, auf die sehr viele Menschen in der Schweiz hören. Und wenn man nun genotigt ist, zu sagen, daß diese Persönlichkeit zum Beispiel mein Buch «Die Kernpunkte» schon abfällig kritisiert hat, bevor es noch erschienen war, bevor also die betreffende
Persönlichkeit ein Sterbenswörtchen daraus gelesen haben konnte, so wird man bei dem allgemeinen ethischen Phlegma, das eben heute in der Gegenwart herrscht, gegenüber dem, wenn eine vielleicht sogar in einem gewissen Grade berühmte Persönlichkeit eine Unwahrheit sagt, nicht besonders aufsehen. Dadurch summieren sich dann diese Dinge. Sie summieren sich ja ungeheuer. Es ist ja vor zwei Jahren etwa immer wiederum darauf hingewiesen worden, wie eine theologische Persönlichkeit hier in der Schweiz eine Broschüre geschrieben hat, in der die grotesken Worte standen, daß hier im Goetheanum eine Holzplastik aufgestellt werden sollte, welche jetzt schon im Ätelier zu sehen sei, und die oben luziferische Züge und unten ein tierisches Aussehen trüge. Nun trägt diese Figur oben die Züge eines ideal geformten Christus, und unten ist sie noch nicht fertig. Die Persönlichkeit, als sie zur Rede gestellt worden ist, hat einfach erklärt, daß sie diese Worte von einem anderen abgeschrieben hat. Sehen Sie, trotzdem handelt es sich um eine weitberühmte Persönlichkeit der Schweiz. Es ist das oftmals gesagt worden in unserem Kreis, auch mit einer gewissen Dezidiertheit gesagt worden, aber es geht an dem allgemein ethisch-sittlichen Phlegma wiederum vorüber, statt daß es als ein Beispiel in weitesten Kreisen angehört würde dafür, wie stark die Neigung ist, selbst bei ganz berühmten Persönlichkeiten, einfach durch Unwahrheiten die Anthroposophie und alles das, was daran hängt, zu entstellen, durch ganz grobe Unwahrheiten zu entstellen. - Nun, man könnte so fortfahren. Aber ich fürchte, wenn ich Ihnen nur einen kleinen Teil desjenigen, was an Unwahrheiten, an wirklichen Unwahrheiten über Anthroposophie, auch über alles das, was aus der Anthroposophie kommt, verbreitet ist, wenn ich Ihnen das aufzählen wollte, so würden wir erst auseinandergehen können, wenn wieder die Sonne aufgeht. Das wollen wir natürlich nicht. Aber die Sache liegt schon so, daß nun doch wiederum betont werden muß: Alle Dinge werden bei uns so schwer, weil einfach auf allen möglichen unterirdischen Wegen Unwahrheiten über Dornach und alles, was dazu gehört, grassieren, und weil man diesen Dingen gegenüber in einer gewissen Gleichgültigkeit verharrt. Ich will nicht darum betteln, selbstverständlich nicht, daß man
Dornach verteidigt. Aber eines ist doch außerordentlich wichtig, und das ist: Viele Leute sagen: Ja, in bezug auf das Aussprechen von Meinungen muß im weitesten Sinne Freiheit herrschen. - Gewiß, jeder mag seine Meinung haben ; niemand kann mehr auf diesem Standpunkte stehen als ich. Es ist einfach selbstverständlich, daß jeder seine Meinung haben soll und sie auch frei aussprechen soll. Aber niemand sollte, ohne daß er auch in maßgebender Weise das Echo davon hört, eine Unwährheit sagen dürfen in der Welt. Die Welt wird schon durch Unwahrheiten am meisten gestört. Und das ist dasjenige, was uns hier am schwersten wird, zur Geltung zu bringen.Wir haben sehr viele gute Freunde, aber der Enthusiasmus, für die Wahrheit in der Weise einzutreten, daß man wirklich auch die Unwahrheit in der richtigen Weise behandelt, der ist eben für alles das, was von Dornach ausgeht, noch nicht sehr groß geworden. Und mehr als man meint, hängen doch die Schwierigkeiten alle mit diesen Dingen zusammen.
Ich war zum Beispiel vor kurzem einmal in der Lage, daß mir eine sehr große Anzahl von Unwahrheiten entgegengehalten worden sind, also von Urteilen, die Unwahrheiten waren, die mir selbst angehängt werden. Da mir daran lag in diesem Falle, das Urteil, das sich die Leute bildeten, auf Grundlage dieser verbreiteten Unwahrheiten, zu rektifizieren, so sagte ich: Nun, und wenn ich mich verbindlich mache, in ganz kurzer Zeit in sehr übersichtlicher Weise, also so, daß man nicht viel dabei zu lesen hätte, alle diese Unwahrheiten dokumentarisch zu widerlegen, wie würde es dann sein ? Da antwortete man mir: Das würde an der Sache nichts ändern. Nicht wahr, das sind eben doch Hinweise auf Schwierigkeiten, bei denen gesagt werden kann, worin das Wesentliche liegt. Also, Rektifizierung der vielen Unwahrheiten, die über Dornach grassieren, das wäre schon etwas, was außerordentlich wünschenswert wäre. - Die Geldbeschaffung für einen schweizerischen Schulverein würde nicht so schwierig sein, wenn das Mißtrauen nicht vorhanden wäre. Aber dieses Miß-trauen wird eben, glaube ich, auch so lange vorhanden bleiben, so lange man nicht wirksam in der Lage ist, nicht nur die Wahrheit der Unwahrheit gegenüberstellen zu können, sondern auf soundso viele Menschen hinweisen zu können, die da wissen, daß die Unwahrheiten
Unwahrheiten sind, und die auch dafür eintreten wollen, daß diese Unwahrheiten wirklich Unwahrheiten sind.
Denn sehen Sie, es ist in vieler Beziehung jetzt schon so durch diese Sachlage gekommen, daß ich in der letzten Zeit manchen Menschen gegenüber sagen mußte: Ja, uns schadet es ja am allermeisten, wenn wir selbst die Wahrheit unserer Sache beweisen müssen. Denn die Leute hätten uns viel lieber, wenn die Unwahrheiten über uns richtig wären. Dann brauchten sie sich kein Gewissen daraus zu machen, über uns zu schimpfen. So aber wissen gerade die wesentlichsten Verbreiter der Unwahrheiten über Dornach und die Anthroposophie ganz gut, daß die Dinge unwahr sind. Und es ist ihnen dasUnangenehmste, wenn man ihnen die Unwahrheit beweisen könnte. Das ist so in bezug auf persönliche Dinge usw. Ich stelle jetzt diese Dinge wirklich nicht hin, um an dieser Stelle wieder einmal über so etwas zu sprechen, sondern ich möchte nur sagen: ich stelle sie hin als den Schatten gewissermaßen, denjajedes Licht wirft; um dem Lichte die richtige Helligkeit zu geben, muß der Schatten da sein. Hellere Lichter werfen stärkere Schatten. Ich stelle diese Dinge hin wie die andere Seite der Sache. Gerade weil aber diese andere Seite da ist, deshalb dürfen Sie mir glauben, daß es mir eine um so herzlichere Befriedigung gewährt, daß heute abend von so vielen Seiten in einer so eindringlichen Weise dafür gesprochen worden ist, daß etwas getan werden soll für die Sache, für die hier eingetreten werden soll. Und indem ich Ihnen diese herzliche Befriedigung ausspreche, möchte ich eben auch das Licht hinstellen neben den Schatten, den ich, wie gesagt, nur hingestellt habe in dieses Licht, um es mehr in seinem Glanze erscheinen zu lassen ; denn es glänzt mir wirklich recht schön, dieses Licht, das sich dadurch vor uns hingestellt hat, daß so viele verehrte und liebe Besucher, die sich eingefunden haben, in so eindringlicher Weise für die Sache gesprochen haben.
EINLEITENDE WORTE ZUR EURYTHMIE-AUFFÜHRUNG Dornach, 15. April 1923
Die Eurythmie, von der wir Ihnen auch heute wiederum einen Versuch vorführen wollen, wird eine künstlerische Bewegung einleiten, welche aus bisher ungewohnten künstlerischen Quellen schöpft und sich einer auch noch ungewohnten künstlerischen Formensprache bedient. Daher darf es gestattet sein, daß einige Worte vorausgeschickt werden. Nicht um die Vorstellung selber zu erklären, das wäre ja etwas Unkünstlerisches - Kunst muß durch sich selber sprechen -, und besonders eine Kunst, die eigentlich für die Sichtbarkeit geschaffen ist, sollte man nicht in ihren Einzelheiten erklären wollen, sondern nur eben anschauen.
Die Eurythmie tritt ja so vor Sie hin, meine sehr verehrten Anwesenden, daß Sie auf der Bühne sehen werden den bewegten einzelnen Menschen, der gebärdenartige Bewegungen ausführt, namentlich durch Arme und Hände, die ausdrucksvollsten Glieder des menschlichen Organismus, aber auch durch andere Glieder dieses Organismus. Sie werden Menschengruppen sehen in bestimmten Stellungen zueinander, Menschengruppen in Bewegungsformen und so weiter. Das alles woUen nicht Zufallsgebärden sein, sondern das alles will sein eine wirkliche sichtbare Sprache, oder auch ein wirklich sichtbarer Gesang.
Daher wird diese Eurythmie begleitet auf der einen Seite durch das Rezitatorische und Deklamatorische für die Dichtungen, auf der anderen Seite durch Musikalisches. Gerade so, wie der Mensch von seiner kindlichen Stufe der Entwickelung an im weiteren Verlauf seines Lebens mit Bezug auf die Lautsprache von einem gewissen Lallen, das nur Gefühle, Empfindungen ausdrückt in primitiver Weise, aufruckt zu der artikulierten Lautsprache, so kann man nämlich auch von dem, ich möchte sagen Lallenden in Gebärden, die der Mensch
im gewöhnlichen Leben anwendet, um seine Sprache zu begleiten, um das oder jenes in seiner Sprache durch die Gebärde deutlicher oder eindringlicher zu machen - man kann von diesen Gebärden vorrücken zu einer wirklichen sichtbaren Sprache, die als Bewegung des menschlichen Organismus ausgeführt wird.
Dasjenige also, das Sie sehen werden, beruht keineswegs auf willkürlicher Erfindung, sondern es beruht darauf, daß in sorgfältiger Weise studiert worden ist durch sinnlich-übersinnliches Schauen, um mich dieses Goetheschen Ausdruckes zu bedienen, wie die Lautsprache oder der menschliche Gesang zustandekommen. Da hat man es eigentlich auch mit einer Art Gebärde zu tun, aber mit einer Gebärde, die sich nicht in dem gewöhnlich sichtbaren Teil des menschlichen Organismus abspielt, sondern die sich abspielt mit dem aus-strömenden Atmungsstrome, der zum Teil natürlich immer mit Hilfe der körperlichen Organe dirigiert wird vom menschlichen Willen und zum Teil vom menschlichen Denken.
Wir sehen, daß der Mensch, indem er spricht, die Luft in Bewegung setzt. Würden wir diese Bewegungsformen, durch die der Mensch seine Lautsprache an den andern Menschen heranbringt, im einzelnen studieren, so würden wir sehen: Jedem Laute, jedem Wort-gebilde, jedem Satzgebilde entspricht eine ganz bestimmte Formung der ausströmenden Luft.
Dasjenige, was mehr radial vom Menschen weggeht in diesenFormen, das rührt vom menschlichen Willen her, wie gesagt, immer ver-mittelt durch die körperlichen Organe. Dasjenige, was mehr als Querschnitte, wenn ich das so nennen darf, diese Luftgebärde wellig macht, das rührt vom menschlichen Gedanken her. Und wenn wir, wie das eben durch sinnlich-übersinnliches Schauen geschehen kann, wenn wir so, wie wir den bewegten Menschen anschauen können, diese Luftgebärde sehen könnten, so würden wir auch gewissermaßen ein luftartiges Abbild des Menschen vor uns haben, wenigstens eines Teiles des Menschen, und würden darinnen Bewegungen, Bewegungen von Luftströmungen sehen.
Diese Bewegungen von Luftströmungen werden sorgfältig studiert. Und statt daß man den Kehlkopf und die anderen Sprach- und
Gesangsorgane dann gewissermaßen die Luftgebärde als Sprache und Gesang ausführen läßt, überträgt man dasjenige, was sonst Luftgebärde ist, auf die Gebärde des Armes, der Hand, oder auch des ganzen Menschen, oder der Formen, in denen sich Menschengruppen bewegen. Dadurch hat man auf sichtbare Weise genau dasselbe, was man im Sprechen und im Singen hat, nur daß wegbleibt von dieser Bewegung das Gedankenhafte. Das Gedankenhafte ist ja immer ein Unkünstlerisches, ein Prosaisches.
Der Dichter muß, um sich durch die Sprache künstlerisch auszudrücken, geyade das Gedankenhafte bekämpfen. Er ringt dasjenige, was er in der Sprache hat, dem Gedanken ab. Er sucht gewissermaßen den Gedanken herauszulösen und nur das Willensartige in der Sprachbildung zu behalten, die er zum Ausdruck für sein seelisches Erlebnis macht.
Daher drücken wir auch nicht in der Eurythmie das Wellige, das vom Gedanken herrührt in der Luftgebärde, aus, sondern vorzugsweise dasjenige, was bei einem Laute, bei einem Worte, einer Satz-bildung radial nach außen strömt. Dadurch aber hat man ganz besonders Gelegenheit, dasjenige, was der Dichter im ganzen seiner Seele erlebt, gerade durch die das Wort begleitende Eurythmie deutlich und sichtbarlich zum Ausdrucke zu bringen.
Es ist ja so, daß es ein Vorurteil bedeutet, wenn man glaubt, das Menschlich - Seelisch - Geistige stünde mit irgendeinem Teil des menschlichen Körpers in Berührung. Es ist so, daß die Seele den ganzen menschlichen Organismus erfüllt, bis in die äußersten peripherischen Teile, daß sie in allem, was körperliche Ä ußerung und Offenbarung ist, lebt.
Der Dichter erlebt den Inhalt eines Gedichtes mit seiner totalen Menschlichkeit, und er muß eigentlich zurückhalten dasjenige, was bei ihm in die Glieder fließt. Gewiß, solche wahren Dichter, die das wirklich durchmachen, gibt es ja nur wenige; denn man kann schon sagen, daß eigentlich in bezug auf die dichterische Kunst 990/0 von dem, was produziert wird, auch wegbleiben könnte, und es wäre am Künstlerischen nicht sonderlich viel verloren. Aber dasjenige, was wirklich dichterisch erlebt wird, das wird eben vom ganzen Menschen
erlebt, und das Seelisch-Geistige ergießt sich dann in den ganzen Menschen, - dasjenige, was der Dichter erreichen will durch das Imaginative, Malerisch-Plastische der Lautgestaltung, oder auch durch das Rhythmisch-Taktmäßige, Musikalisch-Thematische der Lautgestaltung, das erreicht er dadurch, daß er im Grunde genommen den Prosainhalt des Wortes zurücktreten läßt, und das eigentlich Dichten.sch-Künstlen.sche ausspricht. Wirkliche Rezitationskunst muß daher, wenn sie dem Dichter gerecht werden will, nicht auf das heute in einem unkünstlerischen Zeitalter so beliebte Pointieren des Prosagehaltes den Hauptwert legen, sondern sie muß auf die Gestaltung der Sprache sehen.
Das war ja das Bestreben der hier gepflegten Rezitationskunst, der sich Frau Dr. Steiner jetzt schon seit sehr langer Zeit gewidmet hat. Wenn der Inhalt des Wortes in der Rezitation pointiert wird, dann ist das eben durchaus Prosa. Wenn das auch noch so interessant ist, weil man glaubt, daß die Persönlichkeit des Rezitators dann besonders zum Vorschein kommt, so ist es doch unkünstlerisch. Künstlerisch ist es, wenn man in der Lage ist, durch die malerisch-plastische Ausgestaltung der Lautfolge und der gegenseitigen Nuancierungen der Laute - nicht durch den Inhalt des Wortes - das herauszubringen, was an Leidenschaftsempfindung, an Gefühl und, wenn es sich um Gedanken handelt, auch an Gedanke geoffenbart werden soll. Denn auch wenn dichterisch der Gedanke zur Offenbarung kommen soll, muß die Form des Gedankens unterdrückt werden, und es muß allein in der Gestaltung der Sprache dasjenige gesucht werden, was eigentlich dichterisch ist.
Ebenso, wie es auf das malerisch-plastische Gestalten der Sprache ankommt, so kommt es auf das musikalische, taktmäßige, rhythmische und so weiter an. Man möchte sagen: in der Prosa wird man selbstverständlich den Vers nicht haben; in der Poesie braucht man den Vers, denn in dem Verse wird gestaltet ein Zusammenhang, und auch auf diese Gestaltung des Zusammenhanges, auf dieses gewissermaßen Rhythmisch-Musikalische in der Sprache kommt es an.
So liegt durchaus bei dem wahren Dichter schon eine geheime Eurythmie in der Art und Weise, wie er die Sprache behandelt. Und es
ist daher nichts Künstliches, sondern etwas ganz Selbstverständliches, daß man dasjenige, was der wahre Dichter eigentlich unterdrücken muß, durch die Eurythmie wiederum zur Offenbarung, zum Vorschein bringt. Der Dichter möchte eigentlich mit seinem ganzen Menschen in die Welt hineinstellen dasjenige, was er dichterisch verkörpert. Aber er muß es, ich möchte sagen, künstlich zurückhalten und muß dasjenige, was er in seinem ganzen Menschen ausdrücken wollte, allein in die Behandlung der Sprache hineingehen. In der Eurythmie wird das alles wieder sichtbar. So daß, wenn man auf der einen Seite hat das Rezitatorisch-Deklamatorische, und auf der anderen Seite auf der Bühne dasjenige, das nun von dem Seelisch-Geistigen ganz so, wie sonst in den Sprachstrom, nun in die körperlichen Bewegungen hineinfließt, so hat man unmittelbar ein Bild des dichterischen Erlebnisses. Und das ist eigentlich dasjenige, was Eurythmie möchte: das dichterische Erlebnis sichtbar durch menschliche Bewegungen hinmalen lassen auf die Bühne.
Wenn Sie die Eurythmie in richtiger Weise auf die Seele wirken lassen wollen, dann müssen Sie sie nicht verwechseln mit den Nachbarkünsten, mit den mimischen und mit den Tanzkünsten. Die Eurythmie ist weder das eine noch das andere. Gewiß, diesen Künsten soll alles Gute nachgesagt werden, sie sollen hier durchaus nicht in ihrer Bedeutung angefochten werden; aber Eurythmie will eben etwas ganz anderes sein. Wenn man dasjenige, was Eurythmie zum Ausdrucke bringt, zu stark nach dem Mimischen hin bildet, wenn also Mimisches zum Ausdrucke kommt, kann das nur der Fall sein, wenn zugrunde liegt, sagen wir, irgend etwas in der Dichtung, was Hohn, was ein Sich-Wegsetzen über irgend etwas bedeutet, also etwas bedeutet, wo der Mensch etwa die Mundwinkel verzieht, wenn er spricht, oder wo der Mensch mit den Augen zwinkert, wenn er spricht usw. Alles Mimische ist vom eurythmischen Standpunkte aus so zu betrachten. Will man Mimisches darstellen, so ist das ja ganz berechtigt. Dasjenige, was ich also hier zu sagen habe, bezieht sich nicht auf die mimische Kunst als solche, sondern nur, wenn die Eurythmie unberechtigterweise in das Mimische ausartet. Da wird dann die Eurythmie unkeusch. Ebensowenig bezieht sich das, was ich jetzt
sagen will, auf die Tanzkunst selbst; sondern nur auf das unberechtigte Ausarten der Eurythmie in das Tanzen. Gewiß, die eurythmischen Bewegungen können in Tanzbewegungen übergehen, wenn zum Beispiel in einem Gedichte etwas vorkommt, wo einer den anderen schlägt, dem anderen irgend etwas antut, wo eine mächtige Leidenschaft zum Ausdrucke kommt, dann kann die sonst ganz im Gebiet des Körperlichen gehaltene eurythmische Bewegung übergehen in die Tanzbewegung. Aber wenn die Eurythmie unberechtigt ausartet in Tanzen, wenn das Tanzen um seiner selbst willen im Euryth-mischen erscheint, dann wirkt es brutal. Ich sage nicht, die Tanzkunst ist brutal, sondern: das Ausschlagen der Eurythmie in dieTanzkunst. So daß man dieseswirklich derEurythmie ablauschen kann und sagen kann: Eurythmie ist nicht pantomimisch, ist nichts Mimisches; durch diese künstlerische Form werden andeutende Gebärden gemacht. Eurythmie ist nicht Tanz; durch die Tanzbewegungen werden überschäumende Gebärden gemacht vom Menschen, wo die Leidenschaft ausfließt, so daß der Mensch gewissermaßen seine Bewegungen nicht innerhalb dessen zurückhält, was er mit seinem Bewußtsein umfassen kann. Die Eurythmie steht mitten drinnen: sie hat weder ausschweifende tanzende Gebärden, noch hat sie pantomimische Gebärden, die immer auf Verstand hindeuten. Eurythmie hat ausdrucksvolle Gebärden, die in ihrer Art ästhetisch-künstlerisch wirken sollen, Gebärden, die weder ausgeklügelt sind noch ausschweifend, die weder gedeutet werden sollen noch durch die man gewissermaßen überwältigt wird, sondern die man in der unmittelbaren Form der Linie, in der ganzen Art der Bewegung, dem Auge gegenüber als wohlgefällig, schön empfindet.
Man kann sich eine Empfindung von der Eurythmie verschaffen, wenn man sie sieht als bewegten Gesang. Sie werden auch Musik-stücke hören; dazu wird eurythmisiert. Dieses Eurythmisieren ist nicht ein Tanz. Es unterscheidet sich ganz wesentlich, wenn es richtig gemacht wird, vom Tanz: es ist ein bewegtes Singen, nicht ein Tanzen. Und gerade daran, daß sie bewegtes Singen ist, daran kann man die Eurythmie unterscheiden von ihren Nachbarkünsten. Und man kann sich daran eine Empfindung von dem erwerben, was ich eben ausgesprochen habe.
Die Eurythmie steht erst im Anfange ihrer Entwickelung, und sie wird einer langen Zeit bedürfen, um ihre Vollkommenheit einigermaßen zu erreichen. Daher muß ich bei einer Eurythmie-Vorführung immer um Nachsicht bitten. Wir haben ja in der letzten Zeit namentlich eine Seite des Eurythmischen ausgebildet. Zum Beispiel haben wir hinzugefügt zu dem, was im bewegten Menschen liegt, das Licht-Bild der Bühne. Da soll dasjenige, was in den aufeinanderfolgenden Beleuchtungseffekten auftritt, gewissermaßen wie eine Licht-Eurythmie wirken, und wiederum wie eine Eurythmie den Begleitungen der Eurythmisierenden dienen, so daß das ganze Bühnenbild eigentlich ein Eurythmisches wird. Aber es wird dieses Bühnenbild als Eurythmisches ganz gewiß gegen die Zukunft hin noch viel vervollkommnet werden. Man darf auch an diese Vervollkommnung glauben, denn die Eurythmie bedient sich des vollkommensten Instrumentes, das man haben kann zum künstlerischen Ausdruck: des Menschen selbst, der ein Mikrokosmos, eine kleine Welt ist und alle Geheimnisse und Gesetzmäßigkeiten der großen Welt in sich enthält. Daher hat man im Grunde genommen in der Eurythmie im bewegten Menschen, wenn man alle Möglichkeiten seines Organismus aus ihm herausholt, ein wirkliches künstlerisches Abbild der Weltengeheimnisse und Weltgesetzmäßigkeiten. Die mimische Kunst bedient sich ja nur eines Teiles der menschlichen Wesenheit; ebenso die anderen Künste, die den Menschen selber irgendwie als Instrument betrachten. So daß man sagen kann: Die Eurythmie ist nicht auf ein äußerliches Instrument angewiesen, auch nicht auf einen Teil des Menschen, sondern sie bringt den ganzen Menschen, insbesondere das, was am ausdruck-vollsten an ihm ist, gerade die Arme und die Hände, in eine sichtbare Sprache und in einen sichtbaren Gesang.
Man kann hoffen, daß, wenn wirklich die Entwickelungsmöglichkeiten herausgeholt werden aus der Eurythmie, dann einmal eine Zeit kommen werde, in der tatsächlich diese jüngste Kunst den älteren Künsten als eine vollberechtigte wird an die Seite gestellt werden können.
HINWEISE
Der Kurs «Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschsftlicher Menschenerkenntnis» wurde erstmals veröffentlicht in der Zeitschrift »Die Menschen schule», 1933, 7. Jg., Heft 5-12.
Werke Rudolf Sternes innerhslb der Gesamtausgahe (GA) werden in den Hinweisen mit der Bibliographie-Nummer angegeben. Siehe auch die Übersicht am Schluß des Bandes.
zu Seite
9 in jenem Bau drüben: Siehe Rudolf Steiner »Der Baugedanke des Goetheanum», Stuttgart 1958, GA Bibl.-Nr. 290.
In der Silvesternacht 1922/23 wurde der Bau durch Flammen zerstört. Der Vortrags-zyklus wurde im provisorischen Schreinereissal abgehalten.
11 Rabindranatb Tagore, 1861-1941. Die Zitate sind entnommen aus: »Meine Lebens-erinnerungen», München 1923.
19 Kant-Laplacesche Tbeorie: Hervorgegangen aus Kants »Naturgeschichte und Theorie des Himmels» (1755) bzw. der darin begründeten »Nebularhypothese» und aus »Exposition du systeme du monde» (1796) von Laplace.
22 Carriere, Moritz, 1817-1895. Philosoph und Ästhetiker. »Ästhetik» 1859.
33 Jean Paul (Friedrich Richter), 1763-1825. Siehe seine Erziehungslehre »Levana»,
1807.
48 seitdem ein Konzil den Geist abgeschafft hat: Das achte ökumenische Konzil in Konstantinopel im Jahre 869.
54 Knebel, Karl Ludwig von, 1744-1834. Dichter und Prinzenerzieher am Hofe von Weimar. Nachstehend der Wortlaut der von Rudolf Steiner angeführten Briefstelle:
»Man wird bei genauer Beobachtung finden, daß in dem Leben der meisten Menschen sich ein gewisser Plan findet, der, durch die eigene Natur oder durch die Umstände, die sie führen, ihnen gleichsam vorgezeichnet ist. Die Zustände ihres Lebens mögen noch so abwechselnd und veränderlich sein, es zeigt sich am Ende doch ein Ganzes, das unter sich eine gewisse Übereinstimmung bemerken läßt. Die Hand eines bestimmten Schicksals, so verborgen sie auch wirken mag, zeigt sich auch genau, sie mag nun durch äußere Wirkung Oder innere Regung bewegt sein: ja, widersprechende Gründe bewegen sich oftmals in ihrer Richtung. So verwirrt der Lauf ist, so zeigt sich immer Grund und Richtung durch.» Siehe »Knebels literarischer Nachlaß und Briefwechsel», herausgegeben von Varnhagen von Ense und Mundt o. J. sowie «Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel». herausgegeben von Guhrauer.
60 Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung (1894), GA Bibl.-Nr. 4.
73/74 Kindergarten in der Waldorfichule: Etwas später konnte er, noch unter der Leitung Rudolf Steiners, eingerichtet werden.
87 Die Geistige Führung des Menschen und der Menschheit (1911), GA Bibl.-Nr. 15.
128 wie ich schon angedeutet hahe in der Diskussion: Siehe die Fragenbeantwortung im Anhang dieses Bandes, S.175.
133 Karl Marx, 1818-1883. Siehe »Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie» Bd. 1, Hamburg 1867.
135 Waldorflehrerschaft: Rudolf Steiner hatte im August/September 1919 in drei Kursen die Waldorflehrer für ihre Aufgabe gebildet Siehe die Hinweise zu Seite 158. Die Freie Waldorfschule, gegründet vom Industriellen Emil Molt für die Kinder seiner Fabrikarbeiter, wurde am 7. September 1919 eröffnet.
138 Gregor Mendel, 1822-1884, österreichischer Biologe; seit 1843 Augustinermönch. Er entdeckte die nach ihm benannten Vererbungsregeln. Die erste Publikation 1865 wurde zunächst nicht beachtet. Erst nach seinem Tode wurde auf sie zurückgegriffen.
141 «Pflicht - wo man lieht, was ,,,an sich selhst befiehlt»: Goethe in »Sprüche in Prosa. Einleitung und Anmerkungen von Rudolf Steiner», Stuttgart 1967 (Nr.604).
145 Hamerling, Rohert, 1830-1889, österreichischer Dichter und Philosoph.
158 Seminaristischer Kursus: Siehe Rudolf Steiner »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik», (14 Vorträge, Stuttgart 1919), GA Bibl-Nr. 293; »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches», GA BibL-Nr. 294; »Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge», GA BibL -Nr.295.
kleinere Ergänzungskurse: Diese Kurse für die Lehrer der Freien Waldorfschule sind in zwei Bänden zusammengefaßt: In »Erziehung und Unterricht aus Menschen-erkenntnis», GA Bibl.-Nr. 302a, enthaltend »Meditativ erarbeitete Menschenkunde», 4 Vorträge, Stuttgart 1920. »Erziehungsfragen im Reifealter. Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts», 2 Vorträge, Stuttgart 1922, »Anregungen zur innerlichen Durchdringung des Lehr- und Erzieherberufes», 3 Vorträge, Stuttgart 1923, und in »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung», 8 Vorträge Stuttgart 1921, GA Bibl.-Nr. 302.
159 Dr. Hermann von Baravalle, 1898-1973. Lehrer für Mathematik und Physik an der Freien Waldorfachule in Stuttgart.
Dr. Caroline von Heydehrandt, 1886-1938. Klassenlehrerin an der Stuttgarter Waldorfachule.
164 so finden Sie in dem ersten Lehrerkurs: Über die Behandlung der Temperamente siehe «>Erziehungskunst. Seminarbesprechungen», siehe Hinweis zu Seite 158.
166 Lehrerkurs am Goetheanum: gehalten vom 23. Dezember 1921 bis 7. Januar 1922. Unter den vielen Teilnehmern aus England waren auch an die zwanzig Lehrer aus der Schweiz. Aus deren Initiative ging der hier abgedruckte Osterkurs für Pädagogen
hervor sowie die Gründung des »Schweizerischen Schulvereins für freies Erziehungsund Unterrichtswesen» Januar 1923.
Der sogenannte Weihnachtskurs 1921/22 wurde von Walter Johannes Stein und zur Hauptsache von Albert Steffen referiert und 1922 als Broschüre veröffentlicht. Diese Veröffentlichung (mehrere Auflagen) ist vergriffen.
Der Wortlaut des Kurses wsirde erstmals in der Zeitschrift »Die Menschenschule» veröffentlicht und erschien in Buchform 1949 mit dem Titel »Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des SeelischGeistigen», (16 Vorträge, Dornach 1922/23) GA Bibl.-Nr. 303.
181 Baumann, Paul, 1887-1964. Musiltlehrer an der Freien Waldorfachule in Stuttgart.
187 Frau Dr. Steiner, dic die Rezitationskunst hier ausgebildet hat: Marie Steiner-von
Sivers, 1867-1948. Sie entwickelte mit Rudolf Steiner zusammen die goetheanistische
Bühnenkunst (Sprachgestaltung und Eurythmie). Siehe Marie Steiner: »Rudolf
Steiner und die kedenden Künste», Dornach 1974; sowie Rudolf Steiner / Marie
Steiner-von Sivers »Sprachgestaltung und Dramatische Kunst», GA Bibl.-Nr. 282;
»Methodik und Wesen der Sprachgestaltung», GA Bibl.-Nr. 280; »Marie Steiner -Ihr Weg zur Eeneuerung der Bühnenkunst durch die Anthroposophie«, Dornach 1973.
191/192 kleine Fortbildungsschule: Eröffnet 1921 als Volksschule für die Kinder der Mitarbeiter am Goetheanum. Da im Kanton Solothurn Privatschulen nicht erlaubt waren (das Verbot wurde erst 1976 aufgehoben), mußte sie geschlossen werden. Sie wurde dann als Fortbildungsschule für Schüler vom 14. Lebensjahr an weitergeführt
192 Kliniken in Arlesheim und Stuttgart: »Klinisch-Therapeutisches Institut Arlesheim», begründet 1920 durch Dr. med. Ita Wegman. «Klinisch-Therapeutisches Institut, Stuttgart», begründet 1920 durch die Ärztegruppe: Friedrich H'ssemann, Ludwig Noll, Otto Palmer und Felix Peipers.
194 die Ansicht der schweizerischen Freunde zu hören: Es erfolgte eine Aussprache. Im Januar 1923 war nach den Ratschlägen Rudolf Steiners der »Schweizerische Schulverein für freies Erziehungs- und Unterrichtswesen auf Grund echter Menschen-erkenntnis» gebildet worden mit dem Ziel, in Basel eine Schule zu gründen. Dr. Steiner beteiligte sich sehr an den Vorbereitungen sowohl für diesen Verein, dem er als Vorstandsmitglied angehörte, wie auch für die zu errichtende Schule. Er besuchte mit Albert Steffen den Erziehungadirektor von Basel-Stadt, um die praktischen Fragen abzuklären und fand bei Regierungsrat Hauser offenes Entgegenkommen. Die Schule selbst konnte erst 1926, nach Rudolf Steiners Tod, eröffnet werden.
Der Neubau des zweiten Goetheanum begann 1924 nach dem Modell, das Rudolf Steiner entworfen hatte. Eröffnung 1928.
Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft (1919), GA Bibl.-Nr. 23.
195 Holzplastik im Goetheanum: Die von Rudolf Steiner geschaffene Statue des Menschheitarepräsentanten. Sie stand, noch unfertig, während des Brandes im Atelier und steht heute im Gruppenraum des Goetheanum. 199 sichtbarer Gesang: Siehe »Eurythrnie als sichtbarer Gesang» (8 Vorträge Dornach 1924), GA Bibl-Nr. 278, und »Eurythmie als sichtbare Sprache» (15 Vorträge Doenach 1924), GA Bibl-Nr. 279.
200 sinnlich-übersinnliches Schauen, um mich dieses Goetheschen Ausdrucks zu bedienen: Siehe dazu Goethe in der «Geschichte meines botanischen Studiums«: «Das Wechselhsfte der Pflanzengestalten, dem ich längst auf seinem eigentümlichen Gange gefolgt, erweckte nun bei mir immer mehr die Vorstellung: die uns umgebenden Pflanzen-formen seien nicht ursprünglich determiniert und festgestellt, ihnen sei vielmehr bei einer eigensinnigen, generischen und spezifischen Hartnäckigkeit eine glückliche Mobilität und Biegsamkeit verliehen, um in so viele Bedingungen, die über dem Erdkreis auf sie einwirken, sich zu fügen und darnach bilden und umbilden zu können Die allerentferntesten jedoch haben eine ausgesprochene Verwandtschsft, sie lassen sich ohne Zwang untereinander vergleichen. Wie sie sich nun unter einen Begriff sammeln lassen, so wurde mir nach und nach klar und klärer, daß die Anschauung noch auf eine höhere Weise belebt werden könnte: eine Forderung, die mir damals unter der sinnlichen Form einer übersinnlichen Urpflanze vorschwebte. Ich ging allen Gestalten, wie sie mir vorkamen, in ihren Veränderungen nach, und so leuchtete mir am letzten Ziel meiner Reise, in Sizilien, die ursprüngliche Identität aller Pflanzenteile vollkommen ein, und ich suchte diese nunmehr überall zu verfolgen und wieder gewahr zu werden.« In «Goethes Naturwissenschsftliche Schriften», Band I, herausgegeben und kommentiert von Rudolf Steiner, in Kürschners «Deutsche National-Litteratur« (1883-1897), 5 Bände, Nachdruck Dornach 1975, GA Bibl.Nr.1 a-e.
Literatur
- Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen., GA 306 (1989), ISBN 3-7274-3060-5 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |