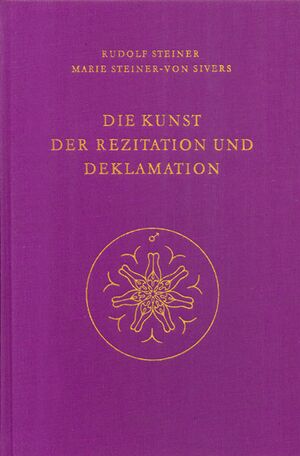Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
GA 281
I DIE KUNST DER REZITATION UND DEKLAMATION Erster Vortrag Dornach, 29. September 1920
#G281-1967-SE009 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
I
DIE KUNST DER REZITATION UND
DEKLAMATION
DIE KUNST DER REZITATION UND
DEKLAMATION
Erster Vortrag
Dornach, 29. September 1920
#TX
In diesen Stunden soll auf einiges, wenn auch skizzenhaft, hingewiesen werden, das sich auf die Rezitations- und Deklamationskunst bezieht. Ausgehen wollen wir dabei von dem Rezitieren und Deklamieren selbst. So daß wir gewissermaßen auf der einen Seite die Praxis stehen haben und auf der anderen Seite die Betrachtung über diese Praxis. Wir wollen heute den Ausgangspunkt nehmen in unserem Rezitieren, das dann den Untergrund bilden soll für die Betrachtung, die angestellt werden soll, von einem Teil des siebenten Bildes meines ersten Mysteriendramas «Die Pforte der Einweihung», von jenem Bilde, das gewissermaßen in der geistigen Welt sich abspielt, sich so abspielt, daß dabei durchaus zugrunde liegt jene Anschauung über den Zusammenhang der geistigen und der seelischen und der physischen Welt, die der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft sich offenbart. Dieses siebente Bild spielt in gewissem Sinn in der geistigen Welt, aber es sind durchaus Personen darinnen dargestellt, die als solche der physischen Welt angehören, die durchaus nicht als Symbole oder als Allegorien gemeint sind, sondern die so gemeint sind, daß sie in lebendiger Wirklichkeit vor uns stehen. Die vier Personen:
Maria, Philia, Astrid, Luna stellen also durchaus Persörlichkeiten der physischen Welt dar. Aber das Bewußtsein der Persönlichkeiten der physischen Welt kann solche Form annehmen - das wird sich in meinen folgenden Vorträgen noch von den verschiedensten Seiten aus zeigen -, daß der Mensch, ebenso wie er durch sein gewöhnliches sinnliches Gegenstandsbewußtsein in der physischen Welt darinnen steht, ebenso mit einem gehobenen, erwachten Bewußtsein in der geistigen Welt darinnen steht.
Das Menschenleben in seinen Tiefen bringt aus sich nicht allein die Kräfte des Instinktiven oder des gewöhnlichen Verständigen hervor, sondern es bringt aus sich auch jene Kräfte hervor, die innerlich impulsiert
#SE281-010
sind aus den seelischen und den geistigen Welten. Und wenn man nicht ein Drarna sich abspielen lassen will, das gewissermaßen nur einseitig den Menschen als Sinneswesen darstellt, sondern das den Menschen in seiner Ganzheit darstellt, wie er sich offenbart so, daß in ihm die seelische und geistige Welt als Impulse leben, dann muß man im Verlaufe der Handlung zu demjenigen, was sich in der physischen Welt abspielt, Dinge hinzufügen, die von der physischen Welt hinweg die ganze Handlung entrücken in eine geistige Sphäre. So wird das Bild, das sich da abspielt als das siebente meines Mysterien-dramas «Die Pforte der Einweihung», durchaus als das Abbild geistiger, aber durch den physischen Menschen hindurch wirkender Impulse anzusehen sein. Wenn man nun nicht aus irgendwelchen Phantasien oder aus einer nebulosen Mystik heraus symbolisch oder allegorisch oder irgendwie anders solche Darstellungen des Übersinnlichen gibt, sondern wenn man sie aus den wirklichen Erfahrungen der übersinnlichen Welt heraus gibt, dann ist man genötigt, zu ganz anderen Vorstellungen zu greifen als diejenigen sind, die man sonst im physischen Leben zu verwenden hat. Im physischen Leben fallen jene Vorstellungen auseinander, die sich auf das moralisch-religiöse Leben beziehen. Sie haben einen mehr ungestalteten Charakter, haben einen Charakter der Abstraktheit, des Unanschaulichen. Dagegen jene anderen Vorstellungen, die sich auf die Natur beziehen, haben einen anschaulichen Charakter, der ihnen schaffe Konturen gibt und so weiter. Wer ein Gefühl dafür hat, wie sich im Anhören das konturierte Wort abhebt von dem gestaltlosen Wort, von dem mehr musikalisch zu empfindenden Wort, der wird überall bemerken die Übergänge von diesem innerlich plastischen zu dem innerlich musikalischen Worte.
Ist man aber genötigt, die Handlung in die geistige Welt hinauf-zuführen, dann muß man gewissermaßen eine Synthese fassen. Man muß die Möglichkeit finden, die Plastik des Wortes soweit aufzulösen, daß sie sich als Plastik nicht verliert, aber man muß sie doch dahin bringen, daß sie unmittelbar zugleich musikalisch wird. Eine plastisch-musikalische Sprechweise muß Platz greifen, denn man hat es nicht mit dem Auseinanderfallen des Sittlich-Religiösen und des Natürlich-Physischen zu tun, sondern mit einer synthetisch zusammenfallenden
#SE281-011
Reihe. Und so werden Sie denn in dieser Szene, die nun zur Rezitation kommt, hören, wie im Grunde genommen aus einem ganz anderen inneren Vorstellungsleben heraus dargestellt wird, als das gewöhnliche des Alltags ist, oder als dasjenige der gewöhnlichen Dramatik ist. Es wird aus einem Vorstellungsleben heraus gesprochen und dargestellt, welches in einem enthält dasjenige, was Natur, elementarische Naturgewalten, elementarische Naturkraftungen sind, und das, was durch diese elementarischen Naturkraftungen zugleich moralisch-ethische Bedeutung hat. Das Physische wird zu gleicher Zeit sittlich, das Sittliche wird in physische Bildlichkeit heruntergeholt. Man kann nicht mehr unterscheiden in dieser Sphäre zwischen dem, was physisch sich abspielt, und dem, was ethisch sich abspielt, denn das Ethische spielt sich in Form des Physischen, das Physische spielt sich im Gebiete des Ethischen ab. Das aber erfordert eine ganz besondere Behandlung der Sprache, und diese Behandlung der Sprache kann gar nicht anders als so erfolgen, daß man überhaupt bei einer solchen Darstellung künstlerisch nicht im allergeringsten mehr von dem Gedanken ausgeht.
Nicht wahr, ich darf von den Erfahrungen reden, die ich an dem Ausgestalten meines Dramas selbst gemacht habe. Ich darf also sagen:
Darinnen lebt kein Gedanke, sondern alles dasjenige, was Sie nun auch rezitiert und deklamiert hören werden, wurde so gehört, allerdings geistig gehört, wie es hier unmittelbar erklingt. - Also es handelt sich nicht etwa um das Fassen eines Gedankens, der dann erst in Worte umgesetzt wird, sondern es handelt sich um das Anschauen desjenigen, was Sie nun dargestellt vernehmen werden, um das anzuschauen gerade in derselben Art und Weise innerlich klingend und innerlich sich gestaltend, wie es zur Darstellung kommt. Man hat nichts zu tun bei einer solchen Darstellung, als lediglich dasjenige, was so innerlich im Schauen auftritt, äußerlich abzuschreiben.
Dadurch aber ergibt sich auch eine ganz bestimmte Art von Charakteristik der Gestaltung, und Sie werden sehen, wie die vier Gestalten, Maria, Philia, Astrid und Luna deutlich voneinander zu unterscheiden sind. Wir werden nicht die Namen von den entsprechenden Aussprüchen besonders sagen, sondern es soll nur der Inhalt der Worte
#SE281-012
rezitiert werden, denn es war einfach da eine absolute Verschiedenheit im Anhören desjenigen, was als Maria sich aussprach, was einfach sich aussprach als dasjenige, was in der höheren Anschauung in einem gehobenen Bewußtsein sich mitten in den zugleich ethisch wirkenden Naturgewalten erfühit und von diesem Erfühlen in den zugleich ethisch wirkenden Naturgewalten sich so inspirieren läßt, daß sie das durch die Sprache zum Ausdrucke bringt. Es ist etwas, was gewissermaßen ein AII-Einfühlen in die Natur, insoferne sie schon ethisch, und in die Ethik, insofern sie schon Natur ist, darstellt.
In Phllia sollte eine Persönlichkeit hingestellt werden, die in einem gewissen Sinne ganz durchstrahlt ist von Liebefähigkeit, aber durchaus als menschliche Gestalt. Sie offenbart sich als menschliche Gestalt einfach, indem man nachvibrieren fühlt, wenn man dafür Empfinglichkeit hat, das, was eine ganz von Liebe durchdrungene Persönlichkeit gegenüber denjenigen Empfindungen und Vorstellungen und Erscheinungen und Schauungen zu sagen hat und zu tun hat, die sich durch Maria abspielen. Astrid hinwiederum stellt eine Persönlichkeit dar, die erfüllt ist ganz von dem, was man nennen könnte die innere menschliche Weisheit, so wie sich diese innere menschliche Weisheit verbindet durch innerlichstes Schauen mit dem Weltenwirken. Und Luna stellt dar dasjenige, was in dem gefestigten Bewußtsein als Willenswirksamkeit sich offenbart.
Nicht sind die drei Persönlichkeiten symbolisch oder allegorisch dargestellt, ebensowenig wie Nero eine symbolische Darstellung der Grausamkeit ist, sondern es sind diese drei Persönlichkeiten Menschen von Fleisch und Blut, aber so, daß sie verschieden sind, wie zum Beispiel im wirklichen Leben die Menschen nach ihren Temperamenten verschieden sind, daß in der einen Persönlichkeit ganz vibriert Liebe, in der anderen ganz vibriert Weisheit, in der anderen ganz Festigkeit. Durch das, was nun plastisch-musikalisch zusammenwirkend sich offenbart, indem eine Art Fühien des Ethisch-Natürlichen und des Natürlich-Ethischen zusammenklingt mit der liebegetragenen, welsheitdurchleuchteten, festigkeiterwärmten menschlichen Persönlichkeit, entsteht dasjenige, was hier als ein Bild der geistigen Welt dargestellt sein soll. Und man darf vielleicht bei der Rezitation gerade davon
#SE281-013
ausgehen, weil - wie sich in der nachherigen Betrachtung des heutigen und der folgenden Tage ergeben wird - daran wird gezeigt werden können, wenn man zum Beispiel schafft aus dem deklamatorischen, rezitatorischen Elemente, nicht aus dem Gedanken-Elemente, wie sich da auch die Deklamationskunst in einer unmittelbaren elementarischen Weise ergibt. Da wird Dichtung zu gleicher Zeit Deklamation und Rezitation. Da entsteht eine Rezitation, eine Deklamation durch inneres Schauen, von der man glauben kann, daß sie zugleich Dichtung ist.
Das ist dasjenige, was dann des weiteren ausgeführt werden soll, wenn wir in die Betrachtung der deklamatorischen, rezitatorischen Kunst eintreten. Es wird nun Frau Dr. Steiner das siebente Bild aus «Die Pforte der Einweihung» rezitieren.
MARIA: Ihr, meine Schwestern, die ihr
So oft mir Helferinnen wart,
Seid mir es auch in dieser Stunde,
Daß ich den Weltenäther
In sich erheben lasse.
Er soll harmonisch klingen
Und klingend eine Seele
Durchdringen mit Erkenntnis.
Ich kann die Zeichen schauen,
Die uns zur Arbeit lenken.
Es soll sich euer Werk
Mit meinem Werke einen.
Johannes, der Strebende,
Er soll durch unser Schaffen
Zum wahren Sein erhoben werden.
Die Brüder in dem Tempel,
Sie hielten Rat,
Wie sie ihn aus den Tiefen
In lichte Höhen ftihren sollen.
Von uns erwarten sie,
Daß wir in seiner Seele heben
Die Kraft zum Höhenfluge.
Du, meine Philia, so sauge
Des Lichtes klares Wesen
Aus Raumesweiten,
#SE281-014
Erfülle dich mit Klangesreiz
Aus schaffender Seelenmacht,
Daß du mir reichen kannst
Die Gaben, die du sammelst
Aus Geistesgründen.
Ich kann sie weben dann
In den erregenden Sphärenreigen
Und du auch, Astrid, meines Geistes
Geliebtes Spiegelbild,
Erzeuge Dunkeikraft
Im ffießenden Licht,
Daß es in Farben scheine,
Und gliedre Klangeswesenheit,
Daß webender Weltenstoff
Ertönend lebe.
So kann ich Geistesfühlen
Vertrauen suchendem Menschensinn.
Und du, 0 starke Luna,
Die du gefestigt im Innern bist,
Dem Lebensmarke gleich,
Das in des Baumes Mitte wächst,
Vereine mit der Schwestern Gaben
Das Abbild deiner Eigenheit,
Daß Wissens Sicherheit
Dem Seelensucher werde.
PHILIA: Ich will erfüllen mich
Mit klarstem Lichtessein
Aus Weltenweiten,
Ich will eratmen mir
Belebenden Klangesstoff
Aus Ätherfernen,
Daß dir, geliebte Schwester,
Das Werk gelingen kann.
ASTRID: Ich will verweben
Erstrahlend Licht
Mit dämpfender Finsternis,
Ich will verdichten
Das Klangesleben.
#SE281-015
Es soll erglitzernd klingen,
Es soll erklingend glitzern,
Daß du, geliebte Schwester,
Die Seelenstrahlen lenken kannst.
LUNA: Ich will erwärmen Seelenstoff
Und will erhärten Lebensäther.
Sie sollen sich verdichten,
Sie sollen sich erfühlen,
Und in sich selber seiend
Sich schaffend halten,
Daß du, geliebte Schwester,
Der suchenden Menschenseele
Des Wissens Sicherheit erzeugen kannst.
MARIA: Aus Philias Bereichen
Soll strömen Freudesinn;
Und Nixen-Wechselkräfte,
Sie mögen öffnen
Der Seele Reizbarkeit,
Daß der Erweckte
Erleben kann
Der Welten Lust,
Der Welten Weh. -
Aus Astrids Weben
Soll werden Liebelust;
Der Sylphen wehend Leben,
Es soll erregen
Der Seele Opfertrieb,
Daß der Geweihte Erquicken kann
Die Leidbeladenen,
Die Glück Erflehenden. -
Aus Lunas Kraft
Soll strömen Festigkeit.
Der Feuerwesen Macht,
Sie kann erschaffen
Der Seele Sicherheit;
Auf daß der Wissende
Sich finden kann
Im Seelenweben,
Im Weltenleben.
#SE281-016
PHILIA: Ich will erbitten von Weltengeistern,
Daß ihres Wesens Licht
Entzücke Seelensinn,
Und ihrer Worte Klang
Beglücke Geistgehör;
Auf daß sich hebe
Der zu Erweckende
Auf Seelenwegen
In Himmelshöhen.
ASTRID: Ich will die Liebesströme
Die Welt erwarmenden,
Zu Herzen leiten
Dem Geweihten;
Auf daß er bringen kann
Des Himmels Güte
Dem Erdenwirken
Und Weihestimmung
Den Menschenkindern.
LUNA: Ich will von Urgewalten
Erflehen Mut und Kraft
Und sie dem Suchenden
In Herzenstiefen legen;
Auf daß Vertrauen
Zum eignen Selbst
Ihn durch das Leben
Geleiten kann.
Er soll sich sicher
In sich dann selber fühlen.
EI soll von Augenblicken
Die reifen Früchte pflücken
Und Saaten ihnen entlocken
Für Ewigkeiten.
MARIA: Mit euch, ihr Schwestern,
Vereint zu edlem Werk,
Wird mir gelingen,
Was ich ersehne.
Es dringt der Ruf
Des schwer Geprüften
In unsre Lichteswelt.
#SE281-017
Als zweite Probe wollen wir den ersten Monolog aus Goethes « Iphigenie»Ihnen vorführen, und zwar in zwei Gestalten. Es gibt ja Goethes «Iphigenie» in zwei Gestalten. Goethe hat bei seinem ersten weimarischen Aufenthalte, man möchte sagen aus der allerersten Begeisterung und aus dem allerersten Verständnis des Iphigenie-Mythos heraus, diesem Iphigenie-Mythos eine dramatische Gestalt gegeben. Es ist die Gestalt, die Goethe dieser seiner «Iphigenie» zunächst gegeben hat, durchaus aus derjenigen künstlerischen Gesinnung und künstlerischen Anschauungsweise herausgeboren, die Goethe in Weimar eigen war, bevor er seine römische Reise angetreten hatte. Man kann daher diese «Iphigenie» die «weimarische Iphigenie» nennen. Er hat dann während seines römischen Aufenthaltes, nachdem er sich mit alledem durchdrungen hatte, was ihm werden konnte aus der Anschauung der griechischen Kunst, insofern er sie durchschaute in den italienischen Kunstwerken und in geringen Überresten, die sich ihm noch dargeboten hatten aus der griechischen Kunst, was von da aus seine ganze künstlerische Anschauungsweise, sein künstlerisches Empfinden und sogar seine künstlerische Gesinnung metamorphosiert hat, in Rom seine «Iphigenie» umgearbeitet. Und so haben wir diese zweite Gestalt der Goetheschen «Iphigenie», die wir die «römische Iphigenie» nennen können. Es ist außerordentlich interessant, die «weimarische Iphigenie» und die «römische Iphlgenie» auf ihre künstlerische, innere künstlerische Gestaltung hin einttal sich anzusehen und zu sehen, wie die eine und die andere dieser beiden Gestalten in das Deklamatorisch-Rezitatorische hineinfließen.
Wenn man die «deutsche Iphigenie», die «weimarische Iphigenie>) ansieht, so ist sie ja, möchte ich sagen, aus derjenigen Zeit des Goetheschen Kunstschöpfens herausgeboren, aus der auch der wunderbare Prosahytunus «An die Natur» herausgeboren ist, jenes gewaltigste Naturgedicht, das da beginnt: «Natur! Wir sind von ihr umgeben», und das dann so gewaltige Sätze enthält wie: «und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arm entfallen» und so weiter. Jenes Naturbild, welches in einer gewissen Art des Rhythmus so gewaltig daherläuft, ist insbesondere charakteristisch für diejenige Zeit, in der Goethe, noch stehend unter jenem machtvollen Eindrucke, den
#SE281-018
künstlerisch so etwas wie der Straßburger Dom auf ihn, die ganze Gotik auf ihn gemacht hatte, auch im Dichterischen schuf. Und so ist die «weimarische », die « deutsche Iphigenie» herausgeboren aus einer Kunstanschauung, die im allereminentesten Sinne eine gotisch-deutsche ist. Goethe handhabt da die Sprache noch so, daß man fühlt, alles tendiert darauf hin, in dieser Sprachgestaltung etwas zu schaffen, was, ich möchte sagen in derselben Weise sich biegt, aber zugleich spitzt wie der Spitzbogen des gotischen Domes. Wir verfolgen mit unserem Gemüte, wie die Rhythmen ineinandergehen. Sie wölben sich, aber sie schließen sich zusammen, wie sich die Spitzbögen des gotischen Domes zusammenschließen. Das alles, was so plastisch - und Goethes Dichtung ist immer plastisch - in Goethes Dichtung eindringt, das ist natürlich durchaus nicht etwa mit Bewußtsein nachgeahmt der Gotik, sondern es ist eine dichterische Auslegung desjenigen, was Goethe empfunden hat, als er etwa stand vor dem gewaltigen Straßburger Dom, vor allem aber auch, was ihm sonst aus dem deutschen Wesen entgegentrat. Um solche freien Rhythmen, die ihm die Ungebundenheit dieses Gotischen möglich machte, zum Ausdrucke zu bringen, verfaßte er seine «weimarische Iphigenie». Da sehen wir überall etwas Knorriges, etwas, was in seinen plastischen Konturen etwa so dasteht wie gewisse Figuren gerade am Straßburger Dom und ähnliches.
Dann kommt Goethe nach Italien. Seine «Iphigenie» steht unter anderem wiederum vor seiner Seele. Aber sie erscheint ihm anders jetzt, wo er erstens unter dem italienischen Himmel lebt, der nicht mit nordischer Kälte, der mit südlicher Lieblichkeit sich über ihm wölbt. Da empfindet Goethe schon aus der äußeren Natur heraus eine Notwendigkeit umzuempfinden, und da empfindet er dasjenige, was er als seine «weimarische Iphigenie» mit nach Rom gebracht hat, wie etwas nordisch Knorriges, etwas Barbarisches geradezu. Und er empfindet namentlich das, wenn er die Linie, die dichterische Linie dieser seiner «weimarisch-deutschen Iphigenie» etwa mißt an dem, was sich ihm an Empfindungslinie ergibt, wenn er so etwas, wie die Werke Raffaels auf sich wirken läßt. Dieser Anblick der Werke Raffaels hat zu gleicher Zeit das Knorrige gerundet, was in Goethes « Iphigenie» aus der Weimarer Zeit noch vorhanden war. Und so empfindet Goethe die
#SE281-019
Notwendigkeit, diese ganze «Iphigenie» umzuschreiben. Aus den freien gotischen Rhythmen wird ein strenges, ruhiges Versmaß, von
dem man sieht: Ein Mensch, der durch und durch Künstler ist wie Goethe, kann nur in diesem sich rundenden, ruhigen Versmaß leben, wenn er den blauen Himmel Italiens über sich und in den Museen, in die er sich hineinbegibt, Raffaels Madonnen und «Die Heilige Cäcilie» vor sich hat. Das innere Miterleben mit derjenigen Kunst, die er als die Kunst der Griechen empfand, die er sich konstruierte aus den italienischen Kunstwerken, dieses Umempfinden, es ist so ungeheuer charakteristisch für Goethe. Aus diesem Umempfinden heraus ergab sich ihm die Notwendigkeit, die ganze «Iphigenie» umzugießen, so daß wir deutlich unterscheiden Goethesche Kunstgesinnung und Kunstempfindung, wie sie sich ausspricht und offenbart in der «weimarischen», wie sie sich offenbart in der «römischen Iphigenie».
Nur naturgemäß ist es, daß etwas von alledem hineinkommen muß in das Rezitatorisch-Deklamatorische. In der «weimarischen Iphigenie» haben wir es zu tun mit einer Kunst, die mehr Deklamation ist, mit einer Kunst, die vor allen Dingen das Tonhafre von innen heraus in die Worte, in die Sätze legen muß. Bei der «römischen Iphigenie» haben wir es zu tun mit einer Kunst, die mehr Rezitation ist, die das Metrum in seinem Eben- und Gleichmaß zum Abfluten bringen muß.
Damit wir zunächst, ich möchte sagen, empirisch sehen, wie sich das Deklamatorische auf der einen Seite und das Rezitatorische auf der anderen Seite offenbart, werden wir zuerst Ihnen vorführen den ersten Monolog aus der « deutschen Iphigenie», woran sich besonders das Deklamatorische zeigen wird, das der Goetheschen Dichtkunst entspricht. Dann werden wir Ihnen vorführen den ersten Monolog der «römischen Iphigenie», in der sich besonders das Rezitatorische zeigen wird der südlichen oder auch der noch an den Orient anklingenden Dichtkunst. Da die beiden im Grunde genommen dasselbe Motiv darstellen, und da die beiden vielleicht sogar für eine grobe Empfindung sich gar nicht unterscheiden, für eine feine Empfindung sich radikal aber unterscheiden, so wird sich gerade an dem Beispiel zeigen lassen, wie Deklamation und Rezitation sich zueinander in der
#SE281-020
Sprachkunst, wie wir sie hier auffassen, als Deklamation im weiteren Sinn ausnimmt.
Es wird nun Frau Dr. Steiner den Monolog aus der «deutschen Iphigenie» und den aus der «röraischen «Iphigenie» zum Vortrag bringen.
IPHIGENIE (WEIMARISCHE FASSUNG)
Heraus in eure Schatten, ewig rege Wipfel des heiligen Hains, wie in das Heiligtum der Göttin, der ich diene, tret' ich mit immer neuem Schauer, und meine Seele gewöhnt sich nicht hierher! So manche Jahre wohn' ich hier unter euch verborgen, und immer bin ich wie im ersten fremd. Denn mein Verlangen steht hinüber nach dem schönen Lande der Griechen, und immer möcht' ich übers Meer hinüber, das Schicksal meiner Vielgeliebten teilen. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt; ihn laßt der Gram des schönsten Glückes nicht genießen; ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken nach seines Vaters Wohnung, an jene Stellen, wo die goldne Sonne zum erstenmal den Himmel vor ihm auf-schloß, wo die Spiele der Mitgebornen die Sanften, liebsten Erdenbande knüpften. - Der Frauen Zustand ist der schlimmste vor allen Menschen. Will dem Mann das Glück, so herrscht er und erficht im Felde Ruhm; und haben ihm die Götter Unglück zubereitet, fällt er, der Erstling von den Seinen, in den schönen Tod. Allein des Weibes Glück ist eng gebunden:
sie dankt ihr Wohl stets andern, öfters Fremden, und wenn Zerstörung ihr Haus ergreift, führt sie aus rauchenden Trümmern, durchs Blut erschlagener Liebsten, ein Überwinder fort. - Auch hier an dieser heiligen Stätte hält Thoas mich in ehrenvoller Sklaverei! Wie schwer wird mir's , dir wider Willen dienen, ewig reine Göttin! Retterin! Dir sollte mein Leben zu ewigem Dienste geweiht sein. Auch hab' ich stets auf dich gehofft und hoffe noch, Diana, die du mich verstoßne Tochter des größten Königs in deinen heiligen, sanften Arm genommen! Ja, Tochter Jovis, hast du den Mann , dessen Tochter du fordertest, hast du den göttergleichen Agamemnon, der dir sein Liebstes zum Altare brachte, hast du vom Felde der umgewandten Troja ihn glücklich und mit Ruhm nach seinem Vaterlande zurückbegleitet, hast du meine Geschwister, Elektren und Oresten, den Knaben, und unsere Mutter, ihm zu Hause, den schönen Schatz, bewahrt, so rette mich, die du vom Tod gerettet, auch von dem Leben hier, dem zweiten Tod!
#SE281-021
IPHIGENIE (ROMISCHE FASSUNG)
Heraus in eure Schatten, rege Wipfel
Des alten, heil'gen, dichtbelaubten Haines,
Wie in der Göttin stilles Heiligtum,
Tret' ich noch jetzt mit schauderndem Gefühl,
Als wenn ich sie zum ersten Mal beträte,
Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher.
So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen
Ein hoher Wille, dem ich mich ergebe;
Doch immer bin ich, wie im ersten, fremd.
Denn ach! mich trennt das Meer von den Geliebten,
Und an dem Ufer steh' ich lange Tage,
Das Land der Griechen mit der Seele suchend;
Und gegen meine Seufzer bringt die Welle
Nur dumpfe Töne brausend mir herüber.
Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern
Ein einsam Leben führt! Ihm zehrt der Gram
Das nächste Glück vor seinen Lippen weg.
Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken
Nach seines Vaters Hallen, wo die Sonne
Zuerst den Himmel vor ihm aufschloß, wo
Sich Mitgeborne spielend fest und fester
Mit sanften Banden an einander knüpften.
Ich rechte mit den Göttern nicht; allein
Der Frauen Zustand ist beklagenswert.
Zu Haus und in dem Kriege herrscht der Mann,
Und in der Fremde weiß er sich zu helfen.
Ihn freuet der Besitz; ihn krönt der Sieg;
Ein ehrenvoller Tod ist flirn bereitet.
Wie enggebunden ist des Weibes Glück!
Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen,
Ist Pflicht und Trost; wie elend, wenn sie gar
Ein feindlich Schicksal in die Ferne treibt!
So hält mich Thoas hier, ein edier Mann,
In ernsten, heil'gen Sklavenbanden fest.
0, wie beschämt gesteh' ich, daß ich dir
Mit stillem Widerwilien diene, Göttin,
Dir meiner Retterin! Mein Leben sollte
Zu freiem Dienste dir gewidmet sein.
Auch hab' ich stets auf dich gehofft und hoffe
Noch jetzt auf dich, Diana, die du mich,
#SE281-022
Des größten Königes verstoßne Tochter,
In deinen heil'gen, sanften Arm genommen.
Ja, Tochter Zeus', wenn du den hohen Mann ,
Den du, die Tochter fordernd, ängstigtest,
Wenn du den göttergleichen Agamemnon,
Der dir sein Liebstes zum Altare brachte,
Von Troja's umgewandten Mauern rühmlich
Nach seinem Vaterland zurückbegleitet,
Die Gattin ihm, Elektren und den Sohn,
Die schönen Schätze, wohi erhalten hast:
So gib auch mich den Meinen endlich wieder ,
Und rette mich, die du vom Tod errettet,
Auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode!
Sie haben die «weimarische», die « römische Iphigenie» gehört und vielleicht daran gesehen, daß hier einmal eine durch und durch künstlerische Persönlichkeit umgearbeitet hat eine Dichtung, nicht aus irgendeinem Ideenbedürfnis heraus, sondern lediglich aus einem künstlerischen Stilbedürfnis heraus, aus einem so stark entwickelten künstlerischen Stilgefühi, daß die ganze Kunstempfindung, die ganze Kunst-gesinnung, die sich in der «römischen Iphigenie» ausdrückt, eine andere ist als diejenige, die sich in der «deutsch-gotischen», in der «weimarischen Iphigenie» ausdrückt. Man kann an diesen beiden Werken, die im Grunde genommen ein und dasselbe sind, gerade sehen, wie nach nur reinen künstlerischen Impulsen Dinge von einander verschieden sind, denn für ein nichtkünstlerisches Empfinden sind eigentlich die Unterschiede der beiden «Iphigenien» gar nicht da. Für ein künstlerisches Empfinden ist die «römische Iphigenie» einfach ein anderes Werk als die «weimarische Iphigenie». Man sieht daraus zu gleicher Zeit, wie wenig es auf das ankommt in der eigentlichen dichterischen Kunst, was in der Dichtkunst Inhalt ist. Der Inhalt ist im Grunde genommen nur die Leiter, auf der die eigentliche dichterische Kunst als das Lebendige hinansteigt. Das aber muß eine Grundlage sein, wenn man Rezitatorik, Deklamatorik als wirkliche Kunst betrachten will. Denn, ich möchte sagen, alles dasjenige, was man da als das eigentliche Element des Rezitatorischen und des Deklamatorischen
#SE281-023
zu beachten hat, beruht auf so feinen Intimitäten wie der Unterschied der «römischen» und der «deutschen Iphigenie». Mit solchen Intimitäten des Künstlerischen werden wir uns zu befassen haben, wenn wir nach weiterer Praxis in die Betrachtung über Deklamation und Rezitation eingehen werden. Davon dann weiter in der nächsten dieser Stunden.
DIE KUNST DER REZITATION UND DEKLAMATION Zweiter Vortrag Dornach, 6. Oktober 1920
#G281-1967-SE024 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
DIE KUNST DER REZITATION UND
DEKLAMATION
Zweiter Vortrag
Dornach, 6. Oktober 1920
#TX
Wie sich die Rezitationskunst hineinstellt zwischen das unkünstlerische Sprechen und Vorlesen und den kunstvoll aufgebauten Gesang, davon ist in unserer eigentlich unkünstierischen Zeit nicht viel Bewußtsein vorhanden. Man hat in vielen Kreisen so das Gefühi, daß rezitieren eigentlich ein jeder könne. Allerdings hängt das etwas zusammen damit, daß sich jeder in diesen Kreisen auch einbildet, dichten zu können. Es würde kaum so leicht das Bewußtsein davon aufkommen, daß man ohne weiteres ein Musiker oder ein Maler sein könne, ohne erst eine gewisse künstlerische Erziehung durchgemacht zu haben. Wenn man dasjenige, was über Rezitationskunst heute an Urteilen üblich ist, nimmt, so muß man sagen: Ebensowenig, wie über das eigentliche Wesen der Dichtung, herrscht eigentlich auch nur einige Klarheit über das Wesen der rezitatorischen Kunst. Nicht einmal, wie diese rezitatorische Kunst sich ihres Werkzeuges, der menschlichen Stimme, im Zusammenhange mit dem menschlichen Organismus bedienen müsse, nicht einmal darüber herrscht einige Klarheit. Das hängt wohl damit zusammen, daß im Grunde genommen in unserer Gegenwart eine ernsthaftige Empfindung von dem , was Dichtung ist, doch nicht vorhanden ist. Dichtung steht ja zweifellos mit dem ganzen Wesen des Menschen in einer anderen Beziehung als die gewöhnliche Prosa, welcher Art diese Prosa auch sein mag. Und auch mit alledem, was der Mensch als jene höhere Welt anerkennen muß, der er mit seinem geistig-seelischen Teile angehört, muß Dichtung in irgendeiner Beziehung stehen. Allein, mit der Unklarheit, die allmählich über das Verhältnis des Menschen zur übersinnlichen Welt überhaupt hereingebrochen ist, ist auch die andere, die Teilunklarheit gekommen über jenes Verhältnis des Menschen zur Welt, das sich in der dichterischen Kunst zum Ausdrucke bringt. Ich möchte auf zwei Tatsachen hinweisen, die herüberklingen aus alten
#SE281-025
Zeiten, allerdings von verschiedenen Völkern mit ihren verschiedenen Entwickelungseigenschaften.
Die eine Tatsache, über die man heute eigentlich so einfach hinweg-geht, ist die, daß Homer, der große griechische Epiker, seine beiden Dichtungen beginnt damit, daß er darauf aufmerksam macht, wie im Grunde dasjenige, was er als seine Dichtung der Welt mitteilen will, nicht von ihm komme:
Singe, o Muse, vom Zorn mir des Peleiden Achilleus...
Nicht Homer singt, die Muse singt. Unsere Zeit kann das nicht mehr ernst nehmen. Ja, im Grunde genommen war das, was hinter diesem Beginn der Homerischen Dichtungen steckt, schon verglommen vor der Verstandesanschauung des 18. Jahrhunderts. Denn als Klopstock seine «Messiade» begann, da blickte er wohl hin auf den Beginn der Homerischen Dichtung, allein er lebte ganz und gar in dieser Beziehung doch in abstrakten, in verstandesmäßigen Vorstellungen, und aus diesen heraus konnte er sich nichts anderes sagen als, der Grieche habe noch an Götter, an Musen geglaubt. Der Moderne kann dafür nur setzen seine eigene unsterbliche Seele. Also beginnt Klopstock:
Singe, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung.
Gerade dieser Anfang der «Messiade» ist, ich möchte sagen, für den, der in die Dinge hineinzuschauen vermag, ein Dokument aller-bedeutendsten Ranges. Und im 19. Jahrhundert ist völlig verlorengegangen die Empfindung dafür, wie Homer andeuten wollte: Wenn ich dichterisch mich offenbare, dann offenbart sich in mir eigentlich ein Höheres, dann tritt mein Ich zurück, dann tritt dieses Ich so zurück, daß andere Mächte sich meines Sprachorganismus bedienen, göttlich-geistige Mächte sich dieses Sprachorganismus bedienen, um sich zu offenbaren. - Also man muß dasjenige, was Homer an die Spitze seiner beiden Dichtungen stellt, doch so betrachten, daß man vielleicht einen größeren Ernst darauf anwendet, als man heute in solchen Dingen gewöhnt ist.
Aber merkwürdigerweise tönt uns etwas Ähnliches und doch wieder durchaus Verschiedenes entgegen aus einem gewissen Zeitalter
#SE281-026
mitteleuropäischer Entwickelung, jenes Zeitalters mitteleuropäischer Entwickelung, auf das uns das später niedergeschriebene Nibelungen-lied hinweist. Auch das beginnt in einer ahnlichen und doch wieder ganz verschiedenen Weise wie Homer:
Uns ist in alten Mären Wunders viel geseit...
In alten Mären - was sind Mären für den, der noch eine lebendige Empfindung, eine Anschauung hat für solche Dinge? Ich kann diese Dinge nicht ausführlich hier darlegen, aber ich habe nur hinzuweisen auf dasjenige, was der Ausdruck «Mar» ist, «Nachtmar», den Sie als Bezeichnung für dasjenige haben, was in gewissen nächtlichen Träumen, die auf einer Art Alpdruck beruhen, sich zum Ausdrucke bringt. Dieser Nachtmar, dieser Alp, sie sind letzte atavistische Spuren desjenigen, auf das wir hingewiesen werden, wenn uns das Nibelungen-lied sagt: Uns ist in alten Mären Wunders viel geseit... - Es ist etwas mitgeteilt, das nicht aus dem gewöhnlichen Ich-Bewußtsein des Tages heraus ist, das aus einer Anschauung heraus ist, die in einer ähnlichen Weise verläuft wie das Bewußtsein, das in den Gestalten lebt eines so lebendigen Traumes, wie es der Nachtmar ist, der Mären. Auch da werden wir also nicht auf das gewöhnliche Bewußtsein hingewiesen , sondern auf etwas, was aus dem Übersinnlichen heraus durch das gewöhnliche Bewußtsein sich offenbart. - Homer sagt: Singe, 0 Muse, vom Zorn mir des Peleiden Achilleus. - Das Nibelungenlied sagt:
Uns ist in alten Mären Wunders viel geseit... - Das eine Mal, worauf wurde da hingewiesen? Auf dasjenige, was die Muse im Grunde genommen hervorbringt, indem sie sich des menschlichen Organismus bedient, indem sie im menschlichen Organismus zu reden, zu vibrieren beginnt. Wir werden hingewiesen auf ein Musikalisches, das den Menschen durchdringt, und das aus etwas Tieferem heraus spricht, als sein gewöhnliches Bewußtsein erreicht. Und wir werden hin-gewiesen, wenn das Nibelungenlied sagt: Uns ist in alten Mären Wunders viel geseit - auf das, was durchzieht das menschliche Bewußtsein als Anschauung, die eine Ähnlichkeit hat mit der Augenanschauung, mit der Sehanschauung. Auf Plastisches weist uns das Nibelungen-lied, auf Bildhaftes, auf Jmaginatives; auf Musikalisches weist uns die
#SE281-027
Homerische Dichtung. Beide von verschiedenen Seiten weisen uns aber auf das hin, was in der Dichtung herausdringt aus der tieferen Menschennatur, was den Menschen ergreift und sich durch ihn ausspricht. Das muß man, ich möchte sagen, in seiner Empfindung haben, wenn man nun auch nachfühlen will, wie wirkliche Deklamation die Dichtung zum Ausdrucke bringt, indem sich diese Wirklichkeit des menschlichen Instrumentes bedienen muß, des menschiichen Sprach-instrumentes, in das aber, wie wir nachher sehen werden, der ganze menschliche Organismus hineinspielt.
Die Art und Weise, wie der Mensch aufgebaut ist, ist ein Ergebnis aus der geistigen Welt heraus. Aber auch die ganze Art und Weise, wie der Mensch wiederum seinen Organismus in Bewegung bringen kann, wenn er Dichterisches nachdeklamiert oder nachrezitiert, auch das muß ein Ergebnis eines Waltens des Geistigen durch den menschlichen Organismus sein. Und man muß nur nachspüren dem, wie da der Geist in dem menschlichen Organismus waltet, wenn durch die Rezitation, die Deklamation die dichterische Kunst zur Offenbarung kommt. Deklamation wird dasjenige, was der menschliche Organismus sein kann , wenn er in der verschiedensten Weise gestimmt ist. Daher, um durchaus in allen Einzelheiten künstlerisch die Verwirklichung zu haben, möchten wir Ihnen erstens das zeigen, was als Deklamation walten muß, wenn mehr das Volkslied und Volksliedweisen in Betracht kommen, möchten dann aufsteigen zu dem, was mehr Kunst-Poesie ist; und wir möchten Ihnen zeigen, wie grundverschieden Deklamatorisches zu wirken hat, je nachdem es aus jenen Tiefen der Menschennatur heraustönt, wo der Ernst, die Tragik heraustönt, oder aus denjenigen, ich möchte sagen Oberflächengebieten der menschiichen Organisation, aus denen die Heiterkeit, die Satire, der Humor herauskommen. Und erst wenn wir uns gewissermaßen empirisch einige Anschauung von diesen Dingen heute verschafft haben werden, werde ich mir erlauben, über den Zusammenhang des Dichterischen und des Deklamatorischen und Rezitatorischen einige Andeutungen zu machen, um darauf hinzuweisen, wie aus diesen Andeutungen heraus wirkliche Methoden für ein Sicherziehen zu künstlerischem Deklamieren und Rezitieren gewonnen werden können.
#SE281-028
Wir werden Frau Dr. Steiner bitten, das ja ganz im Volkstone, in der Volksstinamung gehaltene Gedicht «Heidenröslein» von Goethe zu deklamieren. Damit werden wir beginnen.
Sah ein Knab' ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah's mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach: Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden,
Röslein sprach: Ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Und ich will's nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach
,s Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach ,
Mußt' es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden
Nun wollen wir Frau Dr. Steiner bitten, uns das Gedicht «Erlkönigs Tochter» zu rezitieren, das die Volksweise in besonderer Art wiederzugeben vermag.
Herr Oluf reitet spät und weit,
Zu bieten auf seine Hochzeitleut':
Da tanzten die Effen auf grünem Land,
Erlkönigs Tochter reicht ihm die Hand.
«Willkommen, Herr Oluf, was eilst von hier?
Tritt her in den Reihen und tanz mit mir.» -
« Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag,
Frühmorgen ist mein Hochzeittag.» -
#SE281-029
«Hör' an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir,
Zwei güldne Sporen schenk' ich dir;
Ein Hemd von Seide, so weiß und fein,
Meine Mutter bleicht's im Mondenschein.» -
«Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag,
Frühmorgen ist mein Hochzeittag.» -
«Hör' an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir,
Einen Haufen Goldes schenk' ich dir.» -
«Einen Haufen Goldes nähm' ich wohl;
Doch tanzen ich nicht darf, noch soll.» -
«Und willt, Herr Oluf, nicht tanzen mit mir,
Soll Seuch' und Krankheit folgen dir.» -
Sie tät einen Schiag ihm auf sein Herz,
Noch nimmer fühit er solchen Schmerz.
Sie hob ihn bleichend auf sein Pferd:
«Reit heim zu deinem Bräutlein wert.»
Und als er kam vor Hauses Tür,
Seine Mutter zitternd stand dafür.
«Hör' an, mein Sohn, sag' an mir gleich,
Wie ist dein' Farbe blaß und bleich? » -
«Und sollt' sie nicht sein blaß und bleich?
Ich traf in Erlenkönigs Reich.» -
«Hör' an, mein Sohn, so lieb und traut,
Was soll ich nun sagen deiner Braut?» -
«Sagt ihr, ich sei im Wald zur Stund',
Zu proben da mein Pferd und Hund.» -
Frühmorgen als es Tag kaum war,
Da kam die Braut mit der Hochzeitschar.
Sie schenkten Met, sie schenkten Wein.
«Wo ist Herr Oluf, der Bräut'gam mein?» -
«Herr Oluf, er ritt in Wald zur Stund',
Er probt allda sein Pferd und Hund.» -
Die Braut hub auf den Scharlach rot,
Da lag Herr Oluf, und er war tot.
#SE281-030
Wir werden jetzt zur Darbietung bringen die beiden Gedichte « Olympos» und «Charon» von Goethe. Bei der Rezitation, respektive Deklamation wird eben Gelegenheit dazu sein, das mehr aus dem Bildlichen herausgeholte Gedicht «Olympos » durch die Deklamationskunst zu zeigen, das Gedicht «Charon» mehr in Metrik, weil es mehr aus dem Musikalischen herausgeholt ist.
OLYMPOS
Der Olympos, der Kissavos,
Die zwei Berge haderten;
Da entgegnend sprach Olympos
Also zu dem Kissavos:
«Nicht erhebe dich, Kissave,
Türken - du Getretener.
Bin ich doch der Greis Olympos,
Den die ganze Welt vernahm.
Zwei und sechzig Gipfel zähl ich
Und zweitausend Quellen klar,
Jeder Brunn hat seinen Wimpel,
Seinen Kämpfer jeder Zweig.
Auf den höchsten Gipfel hat sich
Mir ein Adler aufgesetzt,
Faßt in seinen mächt'gen Klauen
Eines Helden blutend Haupt. »
« Sage, Haupt! wie ist's ergangen?
Fielest du verbrecherisch ? » -
Speise, Vogel, meine Jugend,
Meine Mannheit speise nur!
Ellenlänger wächst dein Flügel,
Deine Klauen spannenlang.
Bei Louron, in Xeromeron
Lebt' ich in dem Kriegerstand,
So in Chasia, auf'm Olympos
Kämpft' ich bis ins zwölfte Jahr.
Sechzig Agas, ich erschlug sie,
Ihr Gefild verbrannt' ich dann;
Die ich sonst noch niederstreckte,
Türken, Albaneser auch,
Sind zu viele, gar zu viele,
#SE281-031
Daß ich sie nicht zählen mag;
Nun ist meine Reihe kommen,
Im Gefechte fiel ich brav.
CHARON
Die Bergeshöhn, warum so schwarz?
Woher die Wolkenwoge?
Ist es der Sturm, der droben kämpft,
Der Regen, Gipfel peitschend?
Nicht ist's der Sturm, der droben kämpft,
Nicht Regen, Gipfel peitschend;
Nein, Charon ist's, er saust einher,
Entführet die Verblichnen;
Die Jungen treibt er vor sich hin,
Schleppt hinter sich die Alten;
Die Jüngsten aber, Säuglinge,
In Reih' gehenkt am Sattel.
Da riefen ihm die Greise zu,
Die Jünglinge, sie knieten:
«0 Charon, halt! halt am Geheg,
Halt an beim kühlen Brunnen!
Die Alten da erquicken sich,
Die Jugend schleudert Steine,
Die Knaben zart zerstreuen sich
Und pflücken bunte Blümchen. »
Nicht am Gehege halt' ich still,
Ich halte nicht am Brunnen;
Zu schöpfen kommen Weiber an,
Erkennen ihre Kinder,
Die Männer auch erkennen sie,
Das Trennen wird unmöglich.
Wir werden nun übergehen zu künstlicheren Formen, zum Sonett, und es sollen Sonette von Hebbel und Novalis zur Rezitation kommen.
DIE SPRACHE
Als höchstes Wunder, das der Geist vollbrachte,
Preis' ich die Sprache, die er, sonst verloren
In tiefste Einsamkeit, aus sich geboren,
Weil sie allein die andern möglich machte.
#SE281-032
Ja, wenn ich sie in Grund und Zweck betrachte,
So hat nur sie den schweren Fluch beschworen,
Dem er, zum dumpfen Einzelsein erkoren,
Erlegen wäre, eh' er noch erwachte.
Denn ist das unerforschte Eins und Alles
In nie begriff' nem Selbstzersplitt'rungsdrange
Zu einer Welt von Punkten gleich zerstoben:
So wird durch sie, die jedes Wesenballes
Geheimstes Sein erscheinen läßt im Klange,
Die Trennung völlig wieder aufgehoben!
Friedrich Hebbel
ZUEIGNUNG
Du hast in mir den edeln Trieb erregt,
Tief ins Gemüt der weiten Welt zu schauen;
Mit deiner Hand ergriff mich ein Vertrauen,
Das sicher mich durch alle Stürme trägt.
Mit Ahnungen hast du das Kind gepflegt,
Und zogst mit ihm durch fabelhafte Auen;
Hast als das Urbild zartgesinnter Frauen ,
Des Jünglings Herz zum höchsten Schwung bewegt.
Was fesselt mich an irdische Beschwerden?
Ist nicht mein Herz und Leben ewig dein?
Und schirmt mich deine Liebe nicht auf Erden?
Ich darf für dich der edlen Kunst mich weihn;
Denn du, Geliebte, willst die Muse werden,
Und stiller Schutzgeist meiner Dichtung sein.
II
In ewigen Verwandlungen begrüßt
Uns des Gesangs geheime Macht hienieden,
Dort segnet sie das Land als ew'ger Frieden,
Indes sie hier als Jugend uns umfließt.
Sie ist's, die Licht in unsre Augen gießt,
Die uns den Sinn für jede Kunst beschieden,
Und die das Herz der Frohen und der Müden
In tiunkner Andacht wunderbar genießt.
#SE281-033
An ihrem vollen Busen trank ich Leben:
Ich ward durch sie zu allem, was ich bin,
Und durfte froh mein Angesicht erheben.
Noch schlummerte mein allerhöchster Sinn;
Da sah ich sie als Engel zu mir schweben,
Und flog, erwacht, in ihrem Arm dahin.
Novalis
Und nun, um zu zeigen wie eine andere Stimmung, die entgegengesetzte, hervorgeholt werden muß aus ganz anderen Gebieten der menschlichen Organisation als eines Werkzeuges für Dichtung und Deklamation, wollen wir etwas Humoristisch-Satirisches zum Schlusse bringen, und zwar das Gedicht von Christian Morgenstern:
ST. EXPEDITUS
Einem Kloster, voll von Nonnen,
waren Menschen wohlgesonnen.
Und sie schickten, gute Christen,
ihm nach Rom die schönsten Kisten:
Äpfel, Birnen, Kuchen, Socken,
eine Spieluhr, kleine Glocken,
Gartenwerkzeug, Schuhe, Schürzen...
Außen aber stand: Nicht stürzen!
Oder: Vorsicht! oder welche
wiesen schwarzgemalte Kelche.
Und auf jeder Kiste stand
«Espedito », kurzerhand.
Unsre Nonnen, die nicht wußten,
wem sie dafür danken mußten,
denn das Gut kam anonym,
dankten vorderhand nur IHM,
rieten aber doch ohn' Ende
nach dem Sender solcher Spende.
Plötzlich rief die Schwester Pia
eines Morgens: Santa mia!
Nicht von Juden, nicht von Christen
stammen diese Wunderkisten -
#SE281-034
Expeditus, 0 Geschwister,
heißt er und ein Heiliger ist er!
Und sie fielen auf die Kniee.
Und der Heilige sprach: Siehe!
Endlich habt ihr mich erkannt.
Und nun malt mich an die Wand!
Und sie ließen einen kommen,
einen Maler, einen frommen.
Und es malte der Artiste
Expeditum mit der Kiste. -
Und der Kult gewann an Breite.
Jeder, der beschenkt ward, weihte
Meine Tafeln ihm und Kerzen.
Kurz, er war in aller Herzen.
II
Da auf einmal, neunzehnhundert-
fünf, vernimmt die Welt verwundert,
daß die Kirche diesen Mann
fürder nicht mehr dulden kann.
Grausam schallt von Rom es her:
Expeditus ist nicht mehr!
Und da seine lieben Nonnen
längst dem Erdental entronnen,
steht er da und sieht sich um -
und die ganze Welt bleibt stumm.
Ich allein hier hoch im Norden
fühle mich von seinem Orden,
und mein Ketzergriffel schreibt:
Sanctus Expeditus - bleibt.
Und weil jenes nichts mehr gilt,
male ich hier neu sein Bild: -
Expeditum, den Gesandten,
grüß' ich hier, den Unbekannten.
#SE281-035
Expeditum, ihn, den Heiligen,
mit den Füßen, den viel eiligen,
mit den milden, weißen Haaren
und dem fröhlichen Gebaren,
mit den Augen braun, voll Güte,
und mit einer großen Düte,
die den überraschten Kindern
strebt ihr spärlich Los zu lindern.
Einen güldnen Heiligenschein
geb' ich ihm noch obendrein,
den sein Lächeln um ihn breitet,
wenn er durch die Lande schreitet.
Und um ihn in Engelswonnen
stell' ich seine treuen Nonnen:
Mägdiein aus Italiens Auen,
himmlisch lieblich anzuschauen.
Eine aber macht, fürwahr,
eine lange Nase gar.
Just ins «Bronane Tor» hinein
spannt sie ihr Mein Fingerlein.
Oben aber aus dem Himmel
quillt der Heiligen Gewimmel,
und holdsellg singt Maria:
Santo Espedito - sia i
Die Rezitationskunst muß zweifellos der Dichtung folgen. Sie bringt gegenüber der Dichtung das Menschliche, die menschliche Organisation selbst als das Werkzeug für die künstlerische Darstellung herbei. Wie man sich dieses Werkzeuges bedient im Gesang, in der Rezitationskunst, ist ja etwas, was viel efforscht worden ist, und es ist auch hier gelegentlich schon von dieser Stelle aus auf Fragen hin darauf hingewiesen worden, wie vielerlei Methoden, Methoden über Methoden, durch die man alles gesunde Verhältnis zum Singen und zur Rezitation verlernen kann, es in unserer heutigen Zeit eigentlich gibt. Aber in einer gewissen Weise ist uns verlorengegangen der tiefere
#SE281-036
innere Zusammenhang der dichterischen Äußerung und Offenbarung mit der menschlichen Organisation. Ich werde zunächst heute von etwas scheinbar recht Physiologischem auszugehen haben, um gerade durch den Hindurchgang durch dieses Physiologische Ihnen dann das nächste Mal zeigen zu können, was Dichtung und ihre Darstellerin, Rezitation, Deklamation eigentlich wollen.
Sehen wir dabei zunächst einmal auf dasjenige, von dem schon öfter hier in diesen Vorträgen in diesen Tagen gesprochen worden ist , auf das rhythmische System des Menschen. Dieser Mensch gliedert sich in sein Nerven-Sinnessystem, das eigentliche Werkzeug der Gedankenwelt, der Sinnesvorstellungswelt und so weiter, in das rhythmische System, das eigentliche Werkzeug für die Entwickelung der Gefühiswelt und für alles dasjenige, was aus der Gefühiswelt dann gewissermaßen sich abspiegelnd in die Vorstellungswelt hineinspielt, in das Stoffwechselsystem, durch das der Wille pulst, in dem der Wille sein eigentlich physisches Werkzeug hat.
Sehen wir zunächst auf das rhythmische System. Zwei Rhythmen gehen in diesem rhythmischen System in einer merkwürdigen Art durcheinander. Zunächst haben wir den Atmungsrhythmus, allerdings wie bei allem Lebendigen verschieden, individuell verschieden für die einzelnen Menschen, aber im wesentlichen regelmäßig, so daß wir beim gesunden Menschen bemerken können sechzehn bis neunzehn Atemzüge in der Minute. Als zweites haben wir den Pulsrhythmus, der direkt mit dem Herzen zusammenhängt. Wenn wir wiederum in Rechnung ziehen, daß wir es bei diesen Rhythmen mit Funktionen des Lebendigen zu tun haben, so können wir natürlich nicht an eine pedantische Zahl appellieren wollen, aber wir können im allgemeinen sagen, um die Zahl zweiundsiebzig herum bewegt sich die Zahl der Pulsschläge für den gesunden menschlichen Organismus. So daß wir sagen können, daß die Zahl der Pulsschläge das ungefähr Vierfache ist der Zahl der Atemzüge, daß während eines Atemzuges vier Puls-schläge sind. Wir können also uns vorstellen, daß im menschlichen Organismus das Atmen verläuft, und in das Atmen während eines Atemzuges der Pulsrhythmus viermal hineinschlägt.
Nun blicken Sie einmal im Geiste hin auf dieses Zusammenstimmen
#SE281-037
des pulsrhythmus mit dem Atmungsrhythmus, auf dieses, ich möchte sagen, innerliche, lebendige Klavier, wo auf dem verlaufenden Atmungsrhythmus hin anschlägt in der Empfindung, im Gefühl der Pulsrhythmus. Und jetzt stellen wir uns einmal folgendes vor: Stellen wir uns vor einen Atemzug hin- und zurückgehend, und einen zweiten hin- und zurückgehend und hineinschlagend den Herzrhythmus. Stellen wir das so vor, daß wir da sehen können - das wird Ihnen aus einzelnen Vorträgen schon hervorgegangen sein - den Pulsrhythmus, der im wesentlichen wiederum zusammenhängt mit dem Stoffwechsel-er stößt an den Stoffwechsel an -, stellen wir uns vor, daß im Puls-rhythmus der Wille, ich möchte sagen, nach oben schlägt, so haben wir die Willensschläge hineinschlagend in die Gefühisäußerungen des Atmungsrhythmus. Nehmen wir an, daß wir diese Wiliensschläge artikulieren und sie so artikulieren, daß wir die Willensschläge verfolgen in den Worten, etwa so, daß wir die Worte selber innerlich artikulieren, sagen wir: lang, kurz, kurz; lang, kurz, kurz; lang, kurz, kurz -auf den einen Aterazag, dann machen wir eine Pause, eine Art Zäsur, halten ein, dann den nächsten begleitenden Atemzug, hineinschiagend den Herzrhythmus: lang, kurz, kurz; lang, kurz, kurz; lang, kurz, kurz:
- uu - uu - uu | - uu - uu - uu |
und wir haben, indem wir zwei Atemzüge begleitet sein lassen von den entsprechenden Pulsschlägen, gegenüber denen wir nur eine Pause machen, eine Atempause - wir haben den Hexameter.
Wir können sagen: Dieses uralte griechische Versmaß, wo kam es denn heraus? Es kam heraus aus dem Zusammenklang zwischen Blut-zirkulation und Atmen, und der Grieche wollte seine Sprache so nach innen kehren, nachdem er das Ich unterdrückt hat, indem er die Worte hinorientierte nach den Pulsschlägen und sie spielen ließ auf dem Atem. Er brachte ako seine ganze innere Organisation als rhythmische Organisation in der Sprache selbst zur Offenbarung. Die Sprache erklang so, wie der Zusammenklang von Herzrhythmus und Atmungsrhythmus. Bei ihm war das mehr musikalisch. Bei ihm, bei dem Griechen, war das mehr so, daß es herauf klang vom Willenselemente, heraufklang von den Pulsschlägen zum Atmungsrhythmus hin.
#SE281-038
Sie wissen, dasjenige, was man als den letzten atavistischen Rest alter hellseherischer Anschauung in Bildern hatte, den Alp, den Nachtmar, das drückt sich in Bildern aus und hängt mit dem Atmungsprozeß zusammen, hängt noch in seiner krankhaften, pathologischen Gestalt des Alpdruckes mit der Atmung zusammen.
Nehmen wir nun emmal an - meinetwillen nennen Sie es Hypothese, für mich ist es mehr als Hypothese -, der Mensch ging in jener Urzeit, in der er sich innerlich noch erfühlte, mehr vom Atem aus, ging mehr von oben nach unten, dann stellte er hinein in den einen
Atemzug: Uns ist in alten Maren - wiederuin drei Hochtöne, dreimal gewissermaßen das Wahrnehmen, wie an den Atem heranschlägt der Puls, und wie er sich zum Ausdruck bringt in dem Erlebnis, das mehr ein sichtbares ist, das sich aber dann in der Schattierung der Sprache, in dem Hochton und Tiefton zum Ausdrucke bringt. Wir haben ja im Griechischen mehr das Metrum: lang, kurz, kurz; lang, kurz, kurz; lang, kurz, kurz. Wir haben in den nordischen Versen mehr das deklamatorische Moment, Hochton, Tiefton:
Uns ist in alten Mären Wunders viel geseit
Von Heleden lobebären, von großer Arebeit..
Es ist der ZusammenHang des Atmungsrhythmus mit dem Herz-rhythmus, mit dem Pulsrhythmus. Und ebenso wie der Grieche dar-innen ein musikalisches Element empfand, daher im Metrum das darstellte, so der nordische Mensch ein Bildhaftes, das er in der Schattierung der Worte, im Hochton, Tiefton darstellte. Aber immer war es die Erkenntnis, daß man untertaucht in ein Element des Bewußtseins, in dem das Ich sich überläßt der göttlich-geistigen Wesenheit, die durch den menschlichen Organismus sich offenbart, die diesen menschlichen Organismus sich bildet, um in ihm zu spielen durch den Herz-Puls-Ton, durch den Atmungsprozeß, durch den Zug der Aus- und Einatmung.
u - u - u - u - u - u -
Sie wissen, es sind viele Methoden des Atmens erfunden worden; es ist viel nachgedacht worden über die Methoden, wie man den
#SE281-039
menschlichen Leib behandeln soll, damit er richtig singen oder rezitieren lernt. Es handelt sich aber vielmehr darum, einzudringen in das eigentliche Geheimnis der Dichtung und des Rezitatorischen, des Deklamatorischen. Denn beides fließt aus jener wirklich sinnlichübersirnllchen Anschauung vom Zusammenstimmen des Pulses, der mit dem Herzen zusammenhängt, mit dem Atmungsprozeß. Und jede emzelne Versform - wir werden es das nächste Mal sehen -, jede einzelne Gedichaforin einschließlich des Reimes, der Arnteration, Assonanz lernt man verstehen, wenn man ausgehen kann von der lebendigen Anschauung des menschlichen Organismus, wie er ist, wenn er sich der Sprache als eines künstlerischen Elementes bedient. Deshalb ist es wohl gerechtfertigt, wenn in mehr oder weniger bildhafter Weise verständige Menschen von der Dichtung gesprochen haben als einer Göttersprache. Denn diese Göttersprache spricht in der Tat nicht des vergänglichen menschlichen Ich Geheimnisse aus, sondern sie spricht im menschlichen Bewußtsein Weltengeheirrisse auf musikalische, auf plastische Weise aus. Sie spricht sie aus, indem aus übersinnlichen Welten herein gespielt wird durch das menschliche Herz auf der menschlichen Atmung.
DIE KUNST DER REZITATION UND DEKLAMATION Dritter Vortrag Dornach) 13. Oktober 1920
#G281-1967-SE040 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
DIE KUNST DER REZITATION UND
DEKLAMATION
Dritter Vortrag
Dornach) 13. Oktober 1920
#TX
Es ist natürlich nur möglich, mit einigen Richtlinien in das Wesen der Deklamationskunst hineinzuweisen, denn dieses Wesen ausführlich zu besprechen, würde erfordern das Eingehen in eine ganz große Summe von im Grunde genommen Intimitäten des menschlichen physischen, seelischen und geistigen Lebens. Wir haben das letzte Mal sehen können, wie Blutzirkulation, Pulsschlag und Atmungsrhythmus in einer ganz merkwürdigen Art zusammenspielen im Innern des menschlichen Organismus, wenn dasjenige anklingt, was in der Deklamation, beziehungsweise Rezitation eines Gedichtes erklingen soll, wonach der Dichter gewissermaßen hintendiert schon mit der Schöpfung seines Kunstwerkes. Die Rezitation steht ja in der Mitte drinnen zwischen dem Gesang und zwischen der bloßen Sprache. In det Sprache ist alles dasjenige, was im Gesange noch gewissermaßen an zahlenmäßige Verhältnisse gebunden ist, in ein innerlich Intensives verwandelt. Wenn wir das Wort aussprechen, so ist es gewissermaßen so, wie wenn die Elemente, die im Gesang leben, aus einem Räumllchen zusammengedrückt wären in ein Flächenhaftes, welches Flächenhafte aber durch seine intensive Kraft alles das zum Ausdrucke bringt - aber dann natürlich in anderer Weise zum Ausdrucke bringt-, was in dem Gesanglichen auch enthalten ist. Und zwischen drinnen -zwischen Gesang und dem ausgesprochenen Prosaworte - liegt Rezitation und Deklamation. Man möchte sagen: Rezitation und Deklamation ist ein Gesang, der auf dem Wege zum bloßen Wortwerden aufgehalten ist und in der Mitte auf diesem Wege stehengeblieben ist. Gerade dadurch ist das Wesen der Rezitation so außerordentlich schwierig zu fassen, weil es gewissermaßen eine Mitte darstellt. Insbesondere ist es wiederum eine Aufgabe intimster seelisch-leiblicher Beobachtung, die beiden stark voneinander verschiedenen Elemente dieser Kunst aufzufassen: das eine, die Deklamation, das andere, die
#SE281-041
Rezitation. Und dennoch, in dem Wesen der Dichtung ist das tief begründet, daß das eine Mal mehr rezitiert wird, das andere Mal mehr deklamiert wird.
Es ist dies so im Wesen der Dichtung begründet, daß das, was im Gesanglichen, im Musikalischen, in der Tonhöhe, in Harmonien und so weiter verläuft und darinnen ein gewissermaßen äußeres Dasein führt, sich verinnerlicht so weit, daß vom Äußerlichen nichts mehr erhalten bleibt als die Zeit, die im Metrum zum Ausdrucke kommt in der lang und kurz gesprochenen Silbe. Indem wir vorzugsweise im Rezitieren das Wesen des Metrischen suchen, wo also abgestreift ist Tonhöhe, sogar Klangfarbe und so weiter, abgestreift ist alles dasjenige, was sich in Harmonien oder dergleichen zum Ausdrucke bringt, aber noch gewissermaßen fortschwebend ist die Differenziertheit, sind wir noch nicht zu dem gekommen, was herauskommt, wenn wir fortschreiten bis zu dem Worte, wo auch die Differenziertheit für die eigentliche Substanz des Wortes aufgehoben ist, verschwunden ist. Wir machen leiblich den folgenden Weg durch, wenn wir zum Rezitieren schreiten.
Im wesentlichen beruht das Rezitieren auf jenem Prozesse, der sich abspielt, indem die Atemluft beim Einatmen in unseren Leib dringt, der da durch das Einatmen zunächst dringt in seinem Rhythmus durch die Bewegungen des Gehirnwassers, das aber auch den Rückenmarkskanal ausfüllt, bis in den Nerven-Sinnesapparat des Gehirns. Es stößt sozusagen der Atemrhythmus an die Organe des Vorstellens, und auf diesem Wege wird gewissermaßen Halt gemacht. Dieser Weg, bis zum letzten Schritt gemacht, wird zu dem Einatmungsprozeß, der dann abgelöst wird vom Ausatmungsprozeß, denn zum Rhythmus gehören immer zwei in diesem Falle. Wird dieser Prozeß bis zum letzten Schritt gebracht, so entsteht die Prosa-Vorstellung; wird er jedoch mit dem Bewußtsein aufgehalten vor dem letzten Schritt, wird also nicht das Metrum zerstört, das vom Atmungsrhythmus herrührt, dann entsteht das, was in der Rezitation lebt. So daß wir also sagen: Es ist ein Hin-streben von Weltbeobachtung zur Vorstellung, was in der Rezitation zur Offenbarung kommen soll. Daher ist die Rezitation im wesentlichen die Darstellungskunst für das Epos, für die erzählende Dichtung.
#SE281-042
Wir haben das andere Extrem, die Deklamation. Sie ist gerade an den umgekehrten Prozeß gebunden, an jenen Prozeß, der sich im eigentlichen Seelenieben knüpft nicht an das vorstellungsmäßige Element, sondern an das willensmäßige Element. Aber wenn wir wollen, wenn wir zu einem Willensimpuls übergehen, was ist da alles eigentlich im Grunde überwunden, für viele Menschen allerdings nur unbewußt, für diejenigen, die aber Selbstbeobachtung ausüben können , auch bewußt? Da ist immer überwunden wahrhaftig eine Welt des Harmonisierenden, eine Welt des Konsonierenden, eine Welt des Dissonierenden aus inneren Konsonanzen und Dissonanzen. Aus Harmonien, aus einem innerlichen Erleben, das sehr ähnlich ist dem, was im Musikalischen verschwebt, bildet sich zuletzt der Willensimpuls, wenn wiederum zurückflutet die Atemluft, die zum Gehirn hinauf-geschlagen hat, dann durch den Rückenmarkskanal hinuntergeht und anschlägt nun an den ganzen Stoffwechselprozeß, der in der Blutzirkulation an die Pulsation wiederum seinerseits anschlägt. Bei diesem Gang von oben nach unten, da wird hineingestoßen gewissermaßen in unser Willenselement, das an ein vorwiegendes Ausatmen gebunden ist, dasjenige, was im Menschen lebt an überwundenen, an durch-kämpften Harmonien, innerlichen Dissonanzen oder Konsonanzen und so weiter. So daß gerade das entgegengesetzte Element sich in dem zum Ausdrucke bringt, was im Worte mittönt, wenn das Wort der Träger eines Willensimpulses ist.
Und wenn wir anklingen lassen in einer Dichtung das, was eigentlich in unserem Inneren lebt, wenn wir nicht äußerlich erzählen, sondern wenn wir nach außen schicken, wie wir den Atem nach außen schicken, das, was im Innern lebt, dann kommen wir allerdings in das dramatische Element hinein. Aber das kann ja, soll doch nur als der letzte Schritt bezeichnet werden, denn dieses dramatische Element entwickelt sich dann auch aus dem epischen Elemente heraus, zum Beispiel wenn durch eine Volksanlage das Epische so geartet ist, daß durch diese Volksanlage diejenigen, die es zur Dichtung bringen, den inneren Menschen ergreifen, und indem sie äußerlich darstellen, gerade das Innere des Menschen im Äußeren zur Offenbarung bringen wollen. Dann tönt hinein, wenn der Volkscharakter so ist, in das
#SE281-043
epische Element ein dramatisches. Die Rezitation wird zur Deklamation.
Wie das geschieht, wir wollen es heute veranschaulichen dadurch, daß Sie zunächst rezitiert hören werden ein Stück aus dem Anfang der Goetheschen «Achilleis », wo Goethe sich wirklich ganz hinein-versetzt hat in das epische Gefühlsmaß der Griechen, in den Hexameter, der ganz auf dem Metrum beruht, wo also der innerliche Vorgang der ist, daß vorwiegt im Ergreifen des Bewußtseins der Einatmungsprozeß, der nach der Vorstellung sich hinbewegt. Und wir werden dann als zweites sehen im Gegensatz dazu ein Episches, genommen aus der nordischen Welt, aus der älteren Zeit, ein Stück aus dem ganz großartigen finnischen Volksepos «Kalewala», in dem Sie sehen werden, wie im Epos selber das dramatische Element aufgeht, und daher im Episch-Metrischen ganz von selbst aus der Rezitation die Deklamation wird, und damit - und hier gerade in einer intimen Weise - sich in dem epischen Rezitieren eigentlich das dramatische Deklamieren ergibt.
Das ist das, womit wir zunächst, ich möchte sagen, empirisch beginnen wollen. Frau Dr. Steiner wird aus der «Achilleis» von Goethe vorlesen.
Hoch zu Flammen entbrannte die mächtige Lohe noch einmal
Strebend gegen den Himmel, und Ilios' Mauern erschienen
Rot durch die finstere Nacht; der aufgeschichteten Waldung
Ungeheures Gerüst, zusammenstürzend, erregte
Mächtige Glut zuletzt. Da senkten sich Hektors Gebeine
Nieder, und Asche lag der edelste Troer am Boden.
Nun erhob sich Achilleus vom Sitz vor seinem Gezelte,
Wo er die Stunden durchwachte, die nächtlichen, schaute der Flammen
Fernes, schreckliches Spiel und des wechselnden Feuers Bewegung,
Ohne die Augen zu wenden von Pergamos' rötlicher Feste.
Tief im Herzen empfand er den Haß noch gegen den Toten,
Der ihm den Freund erschlug, und der nun bestattet dahinsank.
Aber als nun die Wut nachließ des fressenden Feuers
Allgemach, und zugleich mit Rosenfingern die Göttin
Schmückete Land und Meer, daß der Flammen Schrecknisse bleichten,
#SE281-044
Wandte sich, tief bewegt und sanft, der große Pelide
Gegen Antilochos hin und sprach die gewichtigen Worte:
«So wird kommen der Tag, da bald von Ilios' Trümmern
Rauch und Qualm sich erhebt, von thrakischen Lüften getrieben,
Idas langes Gebirg und Gargaros' Höhe verdunkelt:
Aber ich werd' ihn nicht sehen. Die Völkerweckerin Eos
Fand nüch, Patroklos' Gebein zusammenlesend; sie findet
Hektors Brüder anjetzt in gleichem frommen Geschäfte:
Und dich mag sie auch bald, mein trauter Antilochos, finden,
Daß du den leichten Rest des Freundes jammernd bestattest.
Soll dies also nun sein, wie mir es die Götter entbieten,
Sei es! Gedenken wir nur des Nötigen, was noch zu tun ist.
Denn mich soll, vereint mit meinem Freunde Patroklos,
Ehren ein herrlicher Hügel, am hohen Gestade des Meeres
Aufgerichtet, den Völkern und künftigen Zeiten ein Denkmal.
Fleißig haben mir schon die rüstigen Myrmidonen
Rings umgraben den Raum, die Erde warfen sie einwärts,
Gleichsam schützenden Wall aufführend gegen des Feindes
Andrang. Also umgrenzten den weiten Raum sie geschäftig.
Aber wachsen soll mir das Werk! Ich eile, die Scharen
Aufzurufen, die mir noch Erde mit Erde zu häufen
Wiffig sind, und so vielleicht befördr' ich die Hälfte.
Euer sei die Vollendung, wenn bald mich die Urne gefaßt hat!»
Also sprach er und ging und schritt durch die Reihe der Zelte,
Winkend jenem und diesem und rufend andre zusammen.
Alle, sogleich nun erregt, ergriffen das starke Geräte,
Schaufel und Hacke, mit Lust, daß der Klang des Erzes ertönte,
Auch den gewaltigen Pfahl, den steinbewegenden Hebel.
Und so zogen sie fort, gedrängt aus dem Lager ergossen,
Aufwärts den sanften Pfad, und schweigend eilte die Menge.
Wie wenn, zum Überfall gerüstet, nächtlich die Auswahl
Stille ziehet des Heers, mit leisen Tritten die Reihe
Wandelt und jeder die Schritte mißt und jeder den Atem
Anhält, in feindliche Stadt, die schlechtbewachte, zu dringen:
Also zogen auch sie, und aller tätige Stille
Ehrte das ernste Geschäft und ihres Königes Schmerzen.
Als sie aber den Rücken des welienbespületen Hügels
Bald erreichten und nun des Meeres Weite sich auftat,
Blickte freundlich Eos sie an aus der heiligen Frühe
#SE281-045
Fernem Nebelgewölk und jedem erquickte das Herz sie.
Alle stürzten sogleich dem Graben zu, gierig der Arbeit,
Rissen in Schollen auf den lange betretenen Boden,
Warfen schaufelnd ihn fort; ihn trugen andre mit Körben
Aufwärts; in Helm und Schild einfüllen sah man die einen,
Und der Zipfel des Kleids war anderen statt des Gefäßes.
Jetzt eröffneten heftig des Himmels Pforte die Horen,
Und das wilde Gespann des Helios, brausend erhub sich's.
Rasch erleuchtet' er gleich die frommen Äthiopen,
Welche die äußersten wohnen von allen Völkern der Erde.
Schüttelnd bald die glühenden Locken, entstieg er des Ida
Wäldern, um klagenden Troern, um rüst'gen Achalern zu leuchten.
Aber die Horen indes, zum Äther strebend erreichten
Zeus Kronions heiliges Haus, das sie ewig begrüßen.
Und sie traten hinein; da begegnete ihnen Hephaistos,
Eilig hinkend, und sprach auffordernde Worte zu ihnen:
«Trügliche, Glücklichen Schnelle, den Harrenden Langsame, hört mich!
Diesen Saal erbaut' ich, dem Willen des Vaters gehorsam,
Nach dem göttlichen Maß des herrlichsten Musengesanges;
Sparte nicht Gold und Silber, noch Erz, und bleiches Metall nicht.
Und so wie ich's vollendet, vollkommen stehet das Werk noch,
Ungekrankt von der Zeit; denn hier ergreift es der Rost nicht,
Noch erreicht es der Staub, des irdischen Wandrers Gefährte.
Alles hab' ich getan, was irgend schaffende Kunst kann.
Unerschütterlich ruht die hohe Decke des Hauses,
Und zum Schritte ladet der glatte Boden den Fuß ein.
Jedem Herrscher folget sein Thron, wohin er gebietet,
Wie dem Jäger der Hund, und goldene wandelnde Knaben
Schuf ich, welche Kronion, den Kommenden, unterstützen,
Wie ich mir eherne Mädchen erschuf. Doch alles ist leblos!
Euch allein ist gegeben, den Charitinnen und euch nur,
Über das tote Gebild des Lebens Reize zu streuen.
Auf denn! sparet mir nichts und gießt aus dem heiligen Salbhorn
Liebreiz herrlich umher, damit ich mich freue des Werkes,
Und die Götter entzückt so fort mich preisen wie anfangs.»
Und sie lächelten sanft, die beweglichen, nickten dem Alten
Freundlich und gossen umher verschwenderisch Leben und Licht aus,
Daß kein Mensch es ertrüg' und daß es die Götter entzückte...
#SE281-046
Nun einige Stellen aus «Kalewala». Es wird versucht werden, trotz-dem eine Übersetzung gelesen werden muß, die Übersetzung doch so zu lesen, daß man dasjenige sieht, was ich erwähnt habe, und was daran gezeigt werden soll.
Schluß der 14. Rune:
Selbst der muntre Lemminkälnen,
Er, der schöne Kaukomiell,
Ging den Schwan nun aufzusuchen,
Ging den Langhals zu entdecken
In dem schwarzen Flusse Tuonis,
In dem untern Raum Manalas.
Machte sich nun rasch von dannen,
Eilte fort mit schnellen Schritten,
Hin zum Fluß des Totenlandes,
Zu des heil'gen Stromes Wirbeln,
Mit dem Bogen auf der Schulter,
Mit dem Köcher auf dem Rücken.
Naßhut, jener Herdenhüter,
Nordlands Greis mit blinden Augen,
Stand dort an dem Flusse Tuonelas,
An des heil'gen Stromes Wirbeln;
Schauet um sich in die Runde,
Ob nicht Lemminkäinen käme.
Dann an einem Tage endlich
Sah den muntern Lemminkainen
Er herbei und näher schreiten
Zu dem Fluß von Tuonela,
An den Rand des Wasserfalles,
Zu des heil'gen Stromes Wirbeln.
Sendet rohrgleich aus dem Meere,
Aus den Wogen eine Schlange,
Stößt sie durch das Herz des Mannes,
Durch die Leber Lemminkäinens,
Durch die linke Achselhöhle
Hin zum rechten Schulterblatte.
#SE281-047
Fühlt der muntre Lemminkälnen
Nun gar heftig sich getroffen,
Redet selber solche Worte:
«Schlimm hab' ich daran gehandelt,
Daß ich nicht erftagen mochte
Von der Mutter, meiner Alten,
Nur zwei kleine Zauberworte,
Wenn es hoch kommt, drei der Worte,
Wie zu sein und wie zu leben
In den Tagen voller Unheil:
Kenne nicht die Pein der Schlange,
Nicht die Qual der Wassernatter.
Mutter, die du mich getragen,
Die mit Mühsal mich erzogen!
Mögst du wissen und erfahren,
Wo dein Sohn, der Arme, weilet,
Kämest dann herbeigeeilet,
Kämst um rascher mir zu helfen,
Um den Armen zu befreien
Von dem Tod an dieser Stelle,
So als Jüngling einzuschlafen,
Lebensfrisch noch fortzugehen. »
Nordlands Greis mit blinden Augen,
Naßhut, dieser Herdenhüter,
Stürzt den muntern Lemminkainen,
Senket ihn, den Sohn Kalewas,
In den schwarzen Fluß Tuonelas,
In den allerschlimmsten Strudel,
Und der muntre Lemminkainen
Fällt mit Lärmen durch die Strömung,
Rauschend mit dem Wasserfalle
In des Totenlandes Räume.
Tuonis blutbefleckter Knabe
Haut den Mann mit seinem Schwerte,
Schlägt drauf los mit scharfer Klinge,
Hauet einmal, daß es funkelt,
Schlägt den Mann in fünf der Stücke,
Schlägt den Leib in acht der Teile,
Wirft sie in den Fluß Tuonelas,
In die untre Flut Manalas:
#SE281-048
«Strecke dich nun ewig dorten,
Mit dem Bogen, mit den Pfeilen,
Schieße Schwäne in dem Flusse,
Wasservögel in den Fluten.»
Also endet Lemminkälnen,
Starb der unverdroßne Freier
In dem schwarzen Strome Tuonis,
In der Niederung Manalas.
Ich denke, Sie werden an diesen beiden Beispielen, der Goetheschen «Achilleis» und der «Kalewala», gesehen haben, wie man auf der einen Seite hatte in der «Achilleis» gewissermaßen dasjenige, was der Mensch an der Anschauung erlebt, ich möchte sagen, wie eingeatmet, dadurch auf dem Wege zur Umwandlung in die ruhige Vorstellung -aber man hat es nicht bis dahin gelangen lassen, sondern aufgehalten, so daß dasjenige, was letzten Endes Vorstellung werden sollte, nicht ganz zur bloß begriffenen Vorstellung wird, sondern auf dem Wege angehalten wird, um gewissermaßen genossene Vorstellung zu werden. Also auf dem Wege von der Anschauung zum Begriff stillgehalten, nicht begriffen, sondern genossen: das drückt sich am besten im Metrum, im ruhigen Metrum aus. Wenn aber herausquillt aus dem Menschen das Willenselement, das auf seinen Wellen die Willens-impulse als Vorstellung trägt, so handelt es sich darum, daß da anhält die Kraft, die den Willen zur Tat, zur Handlung werden läßt gerade an der Stelle, wo der Willensimpuis noch im Menschen lebt und den Menschen selbst stimmlich bewegt, wo also die Stimme so gestaltet wird, daß auf den Wellen der Stimme der Wille lebt, daß gewissermaßen der Übergang gestaltet ist im entgegengesetzten Sinne von früher, wo man es zu tun hatte mit dem Übergang aus der bewegten Anschauung in die Ruhe der Vorstellung. Jetzt haben wir den umgekehrten Vorgang: aus der Ruhe der Vorstellung heraus durch das Willenselement - dieses Willenselement anhalten da, wo es in Bewegung sich umsetzen will als Leben der Außenwelt, wo aber gerade die Bewegung aufgehalten wird: und diese Bewegung, statt daß sie hinausrollt in die Taten, lebt auf dem Strom der Worte.
#SE281-049
Das alles, was ich so andeute, es spielt sich ab auf der einen Seite in der Rezitation, es spielt sich andererseits ab in der Deklamation. Und es kann studiert werden, wenn man beides so verfolgt, wie ich es vorhin angedeutet habe, seelisch4eiblich durch die Anschauung des Menschen selbst dasjenige, was in mehr nalver Weise in einer älteren Zeit tatsächlich ausgeübt wurde. In den älteren Deklamations- und Rezitationskünsten konnte man sehr stark unterscheiden das Epische und das Dramatische, auch im Epischen das Dramatische und dann das Ineinanderklingen von beiden im Lyrischen, wo beides wiederum im Rhythmus durcheinanderklingt. Das, was ja mehr naiv, instinktiv in älteren Zeiten vorhanden war, was eine Zeitlang zurückgegangen ist, indem Rezitationskunst mehr oder weniger Prosa-Darstellung geworden ist, das muß zur Bewußtheit erhoben werden. Es darf natürlich nicht so in dem Rezitatorischen leben, wie ich es dargestellt habe, indem ich mehr beschrieben habe, was im Leibe vorgeht. Aber das muß ein Gefühl werden, eine Empfindung, dieses Zusammenhängen mit dem künstlerisch gestalteten Atem, wie ich es dargestellt habe. Das ist der Weg, um eine Rezitatlonskunst zu finden. Und man muß die Wege studieren können, die das Bewußtsein im Menschen nimmt.
Wenn wir noch einmal anschauen den Weg, wo gewissermaßen der überwiegende Einatmungsprozeß zur Vorstellung hintendiert, so greift unser Bewußtsein ein in das, was da wird auf dem Wege zur Vorstellung hin. Da können wir zwei Wege durchmachen. Entweder wir gehen hinein ins nüchterne Prosa-Vorstellen, dann wird es zum Begreifen; oder aber wir ergreifen dieses nüchterne Prosa-Vorstellen nicht, sondern bewegen uns eigentlich, indem wir gleichsam uns hin-einlegen, bevor die Sache vorstellend wird, in die Einatmungsluft und alles dasjenige, was die tut in unserem Leibe: dann schwingt unser Bewußtsein gewissermaßen auf der Einatmungsluft, und wir kommen, indem das Geistig-Seelische sich loslöst von der Umklammerung des Leibes, in eine Art unbewußten Zustandes hinein. Aber dahin läßt man es nicht kommen, man hält es auf. Das hält man auf dann, wenn man namentlich auf dem Boden des Vokalischen, statt es ins Begreifen hineinkommen zu lassen, oder statt sogar dies mit dem Bewußtsein so weit kommen zu lassen, auf dem Boden des Vokalischen sich hinbewegt,
#SE281-050
in Freude sich hinbewegt. Das tun diejenigen Dichter, welche ihre Freude in der Assonanz haben. Da ist in nicht ganz zum Vor-stellungsmäßigen gewordenen Erleben des Atmungsprozesses dieses Sich-Bewegen des Bewußtseins auf den Wellen der Assonanz, des vokalischen Gleichklanges, was schließlich in abgeschwächter Form auch im Endreim vorhanden ist, da ist dieses vorhanden. Wenn aber auf der anderen Seite der Wille lebt, wo das Innere nach außen will, und wenn wir, statt daß wir an dem Punkt halten, wo das Bewußtsein nicht in die rein begrifflichen Vorstellungen hineinwill, sondern da, wo der Impuls als Wille nach außen strahlt, wir ihn aber aufhalten, wir gewissermaßen ihn fortwährend fangen, da bringen wir in dieses Leben des Willens hinein das, was in die Dichtung hineingekommen ist da, wo insbesondere aus dem Innersten des Menschen heraus das Willenselement gestrahlt hat, jenes Willenselement, das die nordischen Völker ganz besonders erfüllt hat und das sie auch zurn Ausdrucke brachten, wenn sie sich ihrer Dichtkunst hingaben. Wenn sie nicht in äußeren Taten leben konnten, die nordisch-germaaischen Völker, hielten sie den Drang, Trieb, Impuls der äußeren Taten an und bewegten sich dichterisch auf den Wogen der nach auswärts strömenden Willens-impulse. Das lebt in dem sich immerfort wiederholenden Konsonantierenden der Alliteration. Darinnen lebt das Willenselement, dasjenige, was den Atem, den ganzen Leib durchströmt. Und wenn es sich da bewegt in den Alliterationen, lebt dieses Willenselement darinnen, wie in den Assonanzen lebt in dem Gleichklang der Vokale, indem es sich hineinlegt in das Innere der Worte, das nicht zur Vorstellung kommende Einatmen, das gewissermaßen in den Assonanzen wellig sich bewegt.
Wir wollen ein zweites Beispiel vorführen, Assonanzen aus dem «Chor der Urtriebe» von Fercher von Steinwand, und dann das Element der Alliteration, indem wir zum Vortrage bringen ein Stück aus Jordans «Nibelunge». Jordan hat sich besonders bemüht, auch das Wesen des Alliterierenden wiederum hervorzubringen. Es ist natürlich, daß die moderne deutsche Sprache das nicht mehr ganz vertragen hat. Daher liegt ein leiser Hauch von Koketterie über der Jordanschen Dichtung. Das macht aber nichts, es ist besser, wenn man die Er-neuerung der Alliteration zur Veranschaulichung des Alliterationselementes
#SE281-051
bringt, als wenn man in einer viel zu schwierigen Weise alte Alliterationen auferwecken wollte, die doch nicht mehr zu der heutigen Seele ganz sprechen.
Aus «Chor der Urtriebe» von Fercher von Steinwand, zweiter Chor
Ist's ein Schwellen, ist's ein Wogen,
Was aus allen Gürteln bricht?
Wo wir liebend eingezogen,
Dort ist Richtung, dort Gewicht.
Hätt' uns Will' und Wunsch betrogen?
Sind wir Mächte, sind wir's nicht?
Was es sei, wir heischen Licht -
Und es kommt in schönem Bogen!
Jeglichem Streite
Licht zum Geleite!
Schleunigen Schwingungen
Zarter Erregung,
Weiten Verschlingungen
Tiefer Bewegung
Muß es gelingen,
Bald durch die hangenden,
Schmerzlich befangenden
Nächte zu dringen.
Über den Gründen,
Über den milden
Schwebegebilden
Muß sich's verkünden,
Geister entzünden,
Herzen entwilden.
Hat es getroffen,
Find' es euch offen!
Seht ihr die erste
Welle der Helle?
Graßt sie die hehrste,
Heiligste Quelle!
Schnelle, nur schnelle!
Hellen Gesichtes
Huldigt dem Scheine,
Hütet das makellos ewiglich-eine
Wesen des Lichtes!
#SE281-052
Mag es, sein wechselndes Streben zu feiern,
Farben entschleiern!
Wecken wir lieblichen Krieg, daß sich trunken
Lösen die Funken!
Laßt uns die Tiefen, die schaffend erschäumen,
Laßt uns das Edle, was streitend gesunken,
Laßt uns die Kreise, die Fruchtendes träumen,
Strahlend besäumen!
Aus «Die Nibelunge» von Wilhelm Jordan
Sigfrid-Sage, 20. Gesang
Als die sinkende Sonne den Strom der Sage,
Den smaragdenen Rhein, errötend im Scheiden,
Mit Geschmeiden umgoß von geschmolzenem Golde,
Da glitten bei Worms durch die glänzenden Wellen
Hinauf und hinabwärts zahlreiche Nachen
Und führten das Volk vom Festspiel heimwärts.
Dem geregelten Rauschen und Pochen der Ruder
Am Borde der Boote melodisch verbunden,
Erklangen im Takt auch die klaren Töne
Menschlicher Kehlen: in mehreren Kähnen,
Die nah aneinander hlnunter schwammen ,
Sangen die Leute das Lied von der Sehnsucht ,
Die hinunter ins Nachtreich auch Nanna getrieben,
Als die Mistel gemordet ihren Gemahl.
Lauschend im Fenster des Fürstenpalastes
Lag Krimhilde und harrte des Gatten.
In banger Befürchtung bittersten Vorwurfs
Verlangte nun doch nach dem fernen Geliebten
Ihre sorgende Seele voll Sehnsucht und Schmerz.
Sie fühite sich schuldig und ahnte des Schlcksals
Nahenden Schritt. So vernahm sie, erschrocken
Und trüben Sinnes, den Trauergesang.
Während der Wohllaut der uralten Weise
Vom Rhein herauf klang, regten sich leise
Ihre Lippen und ließen die Worte des Liedes,
Welche sie kannte seit frühester Kindheit,
Also hören ihr eigenes Ohr:
#SE281-053
«0 Balder, mein Buhle,
Wo bist du verborgen?
Verninun doch, wie Nanna
Sich namenlos bangt.
Erscheine, du Schöner,
Und neige zu Nanna,
Liebkosend und küssend,
Den minnigen Mund.»
Da klingen von Klage
Die flammenden Fluren,
Von seufzenden Stimmen
Und Sterbegesang:
Die Blume verblühet,
Erblassend, entblättert;
Der Sommer entseelt sie
Mit sengendem Strahl.
Beim Leichenbegängnis
Des göttlichen Lenzes
Zerfällt sie und folgt ihm
In feurigen Tod.
«0 Balder, mein Buhle,
Verlangende Liebe,
Unsägliche Sehnsucht
Verbrennt mir die Brust.»
Da tönt aus der Tiefe
Der Laut des Geliebten:
«Die Lichtwelt verließ ich,
Du suchst mich umsonst.»
«0 Balder, mein Buhle,
Wo bist du verborgen?
Gib Naclrricht, wie Nanna
Dich liebend erlöst?»
«Nicht rufst du zurück mich
Aus Tiefen des Todes.
Was du liebst, mußt du lassen,
Und das Leid nur ist lang.»
#SE281-054
«0 Balder, mein Buhle,
Dich deckt nun das Dunkel;
So nimm denn auch Nanna
Hinab in die Nacht.»
Wir haben gesehen, wie im ersten, assonierenden Gedichte gewissermaßen das Vorstellungselement lebt, aufgehalten auf dem Wege zum Begreifen hin, im Genusse noch festgehalten. Wir haben gesehen, wie in der zweiten, auf die Alliteration, auf den Anfangsreim gebauten Dichtung, das Element des Willens lebt, das wiederum auf seinem Wege hinaus in die Bewegung aufgehalten wird und noch auf den Wellen des Wortes, auf den Wellen der begrifflich gefaßten Willensimpulse innerlich sich fortbewegt.
Sie sehen, wenn man von dem geisteswissenschaftlichen Impuls aus sich nähert einem künstlerischen Elemente, ist man nicht versucht , jenes Abstrakte hineinzubringen, das man so leicht im ästhetischen Kunstbetrachten, das vom Intellektualismus ausgeht, in die Betrachtung hineinbringt. Man kann schon gerade an einer solchen Betrachtung, wie wir sie gepflogen haben, wenn sie auch nur den Richtlinien nach hier ausgeführt werden konnte, sehen, wie herangebracht wird das Verstehen, das anschauende Verstehen als Erkennen der Sache an das Künstlerische, und wie wirklich nach und nach Künstlerisches und Erkennendes ineinanderwachsen müssen in der lebendigen geistigen Anschauung. Die allerdings klingt an den Menschen heran und muß sich gerade bewähren, wenn sie tätig sein soll, da wo der Mensch gewissermaßen selber zum Werkzeug der künstlerischen Darstellung wird. Und solches Erkennen, das, ich möchte sagen, nicht von außen die Kunst betrachtet, sondern sie von innen mitmachend erkennt, wird auch zur Kunstübung die Brücke sein können.
Man wird gerade beim Erlernen der Rezitationskunst auf ein solches Erkennen sich in ganz anderer Weise stützen können als dann, wenn man aus allerlei rein äußerlichen, materialistisch-mechanistischen Beobachtungen des menschlichen Leibes in Deklamationen aller Methoden den Atem ausbildet rein äußerlich-mechanisch, die Stimme rein äußerlich-mechanisch stellt und so weiter. Eine Verinnerlichung
#SE281-055
auch des Lernens an der Kunst ist möglich. Ich will darauf nur zum Schluß mit ein paar Beispielen hinweisen. Es handelt sich nicht darum, daß wir zum Beispiel so etwas wie das Halten der Stimme, das Halten des Tones, das wir auch lernen müssen beim Rezitieren, durch allerlei Anleitungen, den Atem soundso zu behandeln, die Stimme soundso zu stellen, ganz äußerlich, wie es schlechte Gesangslehrerinnen auch tun, an den Menschen heranbringen, sondern darum handelt es sich, daß dasjenige, was in der Unbewußtheit verharren muß, auch beim Lernen einer solchen Sache in der Unbewußtheit verharren soll, daß also nicht durch irgendein täppisches Behandeln des Leibes der Mensch unmittelbar aus aller Unbewußtheit herausgerissen werde. Und dennoch, man kann zum künstlerischen Gestalten, zum künstlerischen Behandeln den ganzen Atemprozeß bringen, wenn man ihn heranbildet so, daß er selber in einer gewissen Sphäre der Unbewußtheit verbleibt, aber hereingerissen wird in das seelische Element, das die Kunst zur Darstellung bringt. So daß wir zum Beispiel das Halten des Tones entwickeln dadurch, daß wir es da üben, wo es besonders präponderiert: beim Rezitieren des Erhabenen. Versuchen wir am Rezitieren des Erhabenen den gefühlsmäßig festzustellenden richtigen Ton in seinem Halten auszubilden, dann richtet sich Stimmstellung, Atemprozeß an dem richtig empfundenen Rezitieren selber.
So können wir das richtige Austonen, das richtige Hinausbringen des Tones an dem Rezitieren von besonderen Musterbeispielen des Lächerlichen entwickeln. Wir können zum Beispiel das, was wir brauchen, das Verstärken des Tones, das wir im auf- und abgehenden Rezitieren oder Deklamieren brauchen, heranbilden, indem wir es am Traurigen üben. Und wir können das Schwächen, das Sanftmachen des Tones gerade dann ausbilden, wenn wir es üben am Freudigen, wenn wir herausfinden, wie wir gewissermaßen seelisch festzuhalten haben dasjenige, was schließlich in der Rezitations- und Deklamationskunst zur Offenbarung kommen muß, und wie wir daran, wenn wir es nur am richtigen Elemente erfassen, nachziehen das, was dann das Leiblich-Physische ist, an das wir direkt nicht mit täppischen Händen zur Verderbnis der Handhabung dieser Dinge kommen sollen, wobei sich nur eine Routine statt einer wirklichen Kunst entwickelt. Dann
#SE281-056
dringen wir in ein wirkliches - das Wort soll nicht nüchtern genommen werden -, in ein wirkliches auch rationelles Kunstüben und Kunsterlernen hinein. Aber wir kommen zu einem solchen nur, wenn wir in unserem Erkennen soviel künstlerisches Empfinden haben, daß wir überhaupt mit dem Erkennen herankommen an die Kunst, und wenn wir auf der andern Seite so viel Anschauung vom Menschlichen haben, daß wir sehen, wie sich zum Beispiel gerade in denjenigen Künsten, die sich des Menschen selber als eines Instrumentes bedienen, dasjenige, was Kunstoffenbarung ist, in der Durchdringung, in der Durchpulsung des Menschen selber offenbart.
So glaube ich, werden Ihnen diese paar Richtlinien, die nur ganz spärlich sein konnten, wenigstens den Weg gezeigt haben, der in einer so subtilen, in einer so intimen Kunst wie die Rezitations-, die Deklamationskunst, befolgt werden muß. Dieser Weg kann aber nur gegangen werden, wenn ernsthaftig der Versuch gemacht wird, die Brücke zu finden zwischen Kunst und Wissenschaft. Dasjenige, was das eine Element ist, auf das ich hingewiesen habe bei der Eröffnungs-handlung zu diesem Kursus, soll hier nicht bloß eine Redensart sein. Gerade auch durch das Muster der Deklamations-, der Rezitations-kunst soll Ihnen gezeigt sein, daß wir uns nicht bloß ein abstraktes Ideal der Vereinigung von Religion, Kunst und Wissenschaft vorsetzen, sondern daß wir, indem wir verfolgen die wahre geistige Anschauung zu einem wirklichen geistigen Erkennen, wir dadurch in der Tat erreichen so etwas wie Herantragen des Erkennens an das künstlerische Schaffen, Durchleuchten des künstlerischen Schaffens mit dem Erkennen, so daß in der Tat das eintreten kann, was den Menschen immer mehr und mehr bewußt in die Kunst hineinträgt, was ihn aber auch immer mehr und mehr bewußt aus der Kunst her-austragen läßt dasjenige, was er im Fortgang seiner Entwickelung zum vollen freien Bewußtsein als Mensch braucht.
NIEDERGANG UND AUFBAU Eine Sprachbetrachtung
#G281-1967-SE057 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
MARIE STEINER
NIEDERGANG UND AUFBAU
Eine Sprachbetrachtung
#TX
Wenn man heute von der Bühne herab eine Madonna, eine Göttin sprechen hört, so traut man seinen Ohren kaum. Es wird nicht der leiseste Versuch gemacht, die Sprache aus der Trivialität des Alltags herauszulö sen; es ist auch nicht der geringste Ansatz da, mit Hilfe der Sprache zu einer höheren Sphäre sich emporzuschwingen. Jeder Weg zum Geiste ist der Bühne heute versperrt, nirgends öffnet sich ein Zugang zu diesen fremden, verschlossenen Welten; auch nicht der bescheidenste. Man strebt ja gar nicht an, in der Sprache etwas von den Hintergründen durchschimmern zu lassen, aus denen überirdlsche Gestalten hervortreten. Reale Geistigkeit ist ein verlorengegangener Begriff. Eine Waschfrau am Troge würde ebenso sprechen können wie diese Madonnen, die man in manchen Mirakelstücken auf den Sockel stellt - bar jedes göttlich-geistigen Inhalts -, so unkultiviert ist die Sprache, so rauh und prosaisch, daß sie schmerzt, daß sie beleidigt. Es soli durchaus nichts Gen.ngschätzendes gegen die Sprechweise der Waschfrau gesagt werden; bei ihr ist das berechtigt. Ihr schwerer Beruf bringt es mit sich, daß die Stimme rauh und hart werden muß, und ihr Kampf mit der Materie muß sie derb machen, wenn sie nicht gerade ein Gegengewicht hat in der Anthroposophie oder in der Religion. Aber die Madonna in den himmlischen Gefilden braucht ja nicht dort grade einer so harten physischen Beschäftigung nachzugehen. Etwas Atmosphäre müßte ihr doch noch anhaften, wenn sie sich auf den Bühnensockel stellt; etwas Glanz, etwas Durchsichtigkeit, etwas Geistigkeit sollte doch in ihre Stimme hineinklingen. Die Sprechenden müßten wissen, wie man es anstellt, eine Stimme aus weiter Ferne erklingen zu lassen, gelöst und schwebend. Die Gestalt, die man uns da vofführt, ist doch Bild für etwas, was bis in den Himmel reicht und von dorther uns seine Gaben hinunterbringt, Lichtfülle und Sphären-ton in uns hineinstrahlend.
#SE281-058
Und dann - die himmlischen Heerscharen! Haben Sie sie je auf der Bühne oder hinter den Kulissen sprechen hören? Goethes Erzengel zum Beispiel und ?.. Jeder Stubenhocker könnte so sprechen und jeder Geschäftsreisende. Trocken, nüchtern, geschäftsmäßig, ganz matter of ....... Aber geistige Hintergründe, Sphärenreigen, Äonenschritt.. die fehlen. « Die Sonne tönt nach alter Weise in Bruder-sphären Wettgesang...» davon ist nicht viel übrig.
Das ist aber, was heute gesucht werden muß, erstrebt, erobert. Schritt für Schritt muß man es sich ertasten, erhören, erfühlen - stetig ringend und nimmer sich zufriedengebend-, bis man intellektualistische Grenzen sprengt, Hindernisse der Materie aus dem Wege räumt, Enge überwindet und sich draußen litidet auf der andern Seite, befreit und erlöst. Wer froh ist «wenn er Regenwürmer lindet», gelangt nicht über sich hinaus, macht nicht die Entdeckung, daß er ja auch ein Luftmensch ist, der den physischen Menschen beherrscht und sich seiner bedienen kann, ohne an ihn gekettet zu sein. Die Heilkraft des Wortes findet er nicht, die Schwungkraft, die Leuchtekraft, die ihn seines Wesens Kern erfassen läßt und ihn hinüberträgt, dahin, von wo er gekomrnen ist. Auf den Flügeln des Wortes kann er wieder die Wege zurücksuchen, die er erahnt, wenn er sich in des Wortes Ursprungskräfte zurückversetzt. Ich - lebendiger Odem -Gottheitsmittel-punkt... dahin kann ihn das Wort zurückführen.
Und schauen wir uns um in den Gefilden dichterer Geistigkeit, die uns die Dichtung erschließen will, in der Welt der Elemente zum Beispiel. Welche Schlüssel werden uns heute in die Hand gegeben durch die Kunst, dieses Götterkind, um uns jene Reiche zu erschließen? Gar keine. Verstand und Temperament sollen allem genügen. Man poltert drauf los, ohne eine Ahnung zu haben von weiser Beherrschung der Kunstmittel durch die Erkenntnis unserer menschlichen Organisation, von Gesetzmäßigkeiten, die Offenbarungen göttlich-schöpferischer Kunstkraft sind, als deren Repräsentanten für uns eben der Mensch und die Erde dastehen. Sollte man nicht endlich den Wegen nachspüren wollen, die Götter angewandt haben, um Kunstwerke nach ihrem Bilde zu schaffen, denen sie dann den lebendigen Odem einflößten? Betreten wir doch mit unserem tastenden Bewußtsein
#SE281-059
diese Wege, leise zunächst und ehrturchtsvoll, und beginnen wir nachzaspüren beim lebendigen Atem, der uns den Daseinsgrund gibt, hier wie dort. Wenn wir in das Wort eindringen - in seine Wesenhaftigkeit uns vertiefen, wir betreten diese Wege. Könnte es eine herrlichere Aufgabe geben?
Nur muß man anfangen beim Buchstabieren, bei den Grundelementen: den Lauten. Nicht bei den drängenden Kräften unserer einseitigen Persönlichkeit. Ich sah auf einer großen Bühne Deutschlands Shakespeares « Sturm». Von der Geistigkeit der Elemente war nichts zu verspüren. Es gab viel Lärm, Temperament und Schreien. Die Kaliban-Szenen wurden in realistischer Weise bis ins Maßlose ausgedehnt und übertrieben, weit über die Grenzen, die Shakespeare ihnen zugewiesen. Und Ariel? Von Luftgewalt, von Lüfteleichtigkeit war nichts da. Eine schwere, starke, knochenfeste Stimme, eine unter-setzte Gestalt, viele Sprünge und viel Geschrei. Die Erdenschwere des gedrungen kleinen Körpers wurde durch jene Sprünge nicht behoben; der struppige, wirre Wuschelkopf war das Gegenteil von Strahlung. Ariel! Ist nicht Leichtigkeit in diesem Wort, Glanz, dahin-fliegende, klingende, verschwebende Lüfteseligkeit? Bald nachner sah ich dieselbe Schauspielerin als Salome in Hebbels «Herodes und Mariarune». Da merkte ich, daß sie Begabung hatte, weil die Physis sie in dieser Rolle unterstützte. Die dunkle, schwere Stimme, der harte lauernde Blick, das gedrungene, zur Erde schwer Hintendierende der Gestalt - sie wurde zur interessantesten Figur in Hebbeis farbenschwerem Stück, diese unheilbrütende Salome-Herodias, während Mariarune gar zu bewußt-kühl, kraftvoll-intelligent und frauenrechtlerisch sich gab. Makkabäerin? Oh nein, ganz norddeutsch im Wesen.
Wann werden die Schauspieler die Wege finden heraus aus ihrem einseitigen Verstand zu den Quellen, die ihnen die Epochen, die Rassen, die Elemente und die Geistwelt erschließen? Sie müssen ja verdorren, wenn sie diese Wege nicht finden. Auf die Spitze getriebene Nerven reißen ab, Lungenschwindsucht ist nicht lange interessant und jedenfalls nicht produktiv; wenn sie Schule macht und zur Manier wird, ist sie abstoßend. Schon mehren sich die Stimmen, die da sagen, daß das Theater vor dem Film wird abdizieren müssen.
#SE281-060
Ich sah einst eine «Iphigenie»-Aufführung. Sie wurde mir zum Ereignis; sie hatte etwas Schicksalwendendes in sich, denn so konnte es nicht weitergehen; dies war auf die Spitze getrieben und mußte brechen. Mußte dort brechen, wo vielleicht die treibenden Kräfte zu diesen Exzessen sind und die Gegenkräfte aufgerufen werden. Ich will nicht so sehr von der Iphigenie selbst sprechen; sie war nur furchtbar langweilig und banal und drückte die Blasiertheit und die öde Leere der ausgehöhlten Salondame aus, die nichts anderes zu tun hat, als in ihrem Park auf- und abzugehen und sich von dem einen langweiligen Verehrer belästigen zu lassen. Ich will mich auch nicht bei der Boxer-gestalt dieses Verehrers aufhalten, obgleich er mit seinen herabhängenden, nackten, muskulösen Armen und seinem entblößten Stier-nacken gleichsam sagen wollte: « Nun nehmt meine Maße, einen patenteren Kerl findet ihr nit...», ich erinnere mich auch nicht, daß etwas anderes aus seinen Worten gesprochen hätte, jedenfalls nichts Königliches. - Aber Orest! Dieser Orest!
Es war klar, daß nur ein Gedanke ihn beseelt hatte: anders zu sein als alle bisher dagewesenen Oreste - und zwar im Überbieten des Trivialen. Denn - nicht wahr, wenn man ein Landstreicher ist, so ist man halt danach - hat eine kupferrote Haut, einen wirren, ungekämmten Haarschopf; der eine undefinierbare Staubfarbe hat, man ist heiser und flach und blechern in der Stimme ... Orest ist ja auch besessen, und man konstruiert sich aus dem Intellekt heraus, wie das ist, wenn man besessen ist: die Gedanken reißen ab - nicht wahr - die Nerven schmerzen, man ist nervös, man will nicht angerührt werden; alles ist einem ekelhaft... Solch ein ausgeklügeltes realistisches Kopfgebilde ist dann von innen heraus so wahr wie eine Billardkugel, die sprechen würde; von außen nimmt sich das aus wie ein verwahrloster Strolch, dem man auf mancher Landstraße Rußlands ja auch begegnen könnte ... Doch halt, solch ein Gedanke könnte ja inspirierend wirken: Tauris -Krim - Rußland - besessene Strolche..., das gibt Analogien. - Von viel weiterher nimmt man ja heute kaum die Gesichtspunkte. Dagegen -Tantalide, griechischer Heros ... das ist veraltet, ist schon zu oft dagewesen. Und gar Jamben, metrisches Maß ... edler Gleichklang der Sprache... längst überholt.
#SE281-061
Uns wurde erzählt, wie Maximilian Hardens journalistische Karriere damit begonnen hatte, daß der Redakteur der Montagsausgabe des «Berliner Tageblatts» eine Anzahl junger Leute als seine Angestellten hatte, denen er sagte: «Ihr sollt die ganze Woche nichts anderes tun, als in den Kaffeehäusern sitzen und alle Zeitungen lesen, deren ihr habhaft werden könnt, und dann müßt ihr mir für den Montag einen Artikel schreiben, der anders ist, als alles was ihr über denselben Gegenstand gelesen habt.» - Am besten soll dies Maximilian Harden getroffen haben.
Wenn etwas Ähnliches das treibende Motiv für jenen Orest-Darsteller gewesen ist, so hätte man eine Erklärung für seinen bizarren und stillosen Einfall, sonst nicht. Obgleich sein Neues nur bestand in einem Auf-die-Spitze-Treiben des im naturalistischen Intellektualismus schon Dagewesenen und in der Anwendung realistisch-nervöser Verkleinerungssucht auf eine Gipfelleistung deutscher Geistigkeit. Das edelste, fehlerloseste, vollkommenste Gebilde deutscher Sprach-kunst: die Goethesche «Iphigenie»in ihrer römischen Fassung, dieses Werk wurde zertreten, ganz rücksichtslos und brutal; und wer solches mitempfindet, fühlte sich mitzertreten. Mit Verantwortung beladen trat man aus einer solchen Vorstellung heraus; denn hier ging es um die Rettung höchster geistiger Werte.
Um diese Zeit verließ uns der Schicksalgestalter, der auch der Kunst die neuen Wege zur Heilung wies. Er spannte den schimmernden Bogen über den Abgrund moderner Geisdosigkeit hinüber zum Jenseits; er baute und formte und zündete und zersprühte, in tausend und aber tausend Edelsteinen sein Werk uns hinterlassend. Im vollen Gefühl unserer Verantwortung fügen wir nun zusammen diese Edelsteine seines Geistesgutes.
Sie werden noch jahrtausendelang die Menschen beseligen und adeln, und heute werden sie uns dienen wie der magische Schlüssel, der geschlossene Tore öffnet, Totes belebt, Krankes gesundet, Böses entsühnt - wenn wir nur guten Willens sind. All diese zerstreuten Edelsteine können zum ZauberscMüssel werden - und liegen sie auch noch so zersplittert da vor unsern Augen wie in diesen höchst ungenügenden Nachschriften dreier herrlicher Vorträge. So lange - sieben Jahre-lagen
#SE281-062
sie da, ungehoben für eine größere Öffentlichkeit, weil die Mängel der Nachschrift zu offensichtlich waren. Und doch, es ist von dem Reichtum noch so viel übrig, daß eine Wiedergeburt des Theaters auf diesem Boden möglich ist.
Jedes Wort des Gesprochenen muß freilich in seiner Vollwertigkeit genommen werden und in seinen Zusammenhängen, und eine Verständnisgrundlage muß geschaffen werden durch den Willen zur Gesamterkenntnis menschlicher und göttlicher Weltwesenheit. Richtlinien nennt Rudolf Steiner, was er uns hier gegeben hat. Er hat uns damit Welten erschlossen.
Diese Vorträge können Wegweiser sein nach jenen subtileren Gebieten der Kunst, zu denen der Zugang heute verlorengegangen ist, vom Materialismus verschüttet. Es sind Intimitäten des Seelenlebens, Geheimnisse der menschlichen Organisation in ihren Zusammenhängen mit den Geheimnissen des Kosmos, die die Grundlage bilden für diese Betrachtungen, welche nichts anderes sein wollen als Ausgangspunkte für ein weiteres Eindringen durch stetes Arbeiten und inneres Erleben. Sie sind wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nur skizzenhaft ausgeführt; aber sie sind Anreger und Wekker und können die Kräfte des Künstlers zu selbständigem Leben aufrufen. Sie wurden gegeben innerhalb eines Gesamtkomplexes von Vorträgen, die sich das eine Ziel gesetzt hatten: aus den Vernichtungs-kräften der Zeit heraus zu neuem Licht und zur Gesundung! Dies war die Tat Rudolf Steiners, und wenn es auch feindlichen Mächten scheinen könnte, daß mit der Lahmlegung seiner öffentlichen Tätigkeit, mit dem Brande des Goetheanum, mit seinem physischen Tode das Werk seines Lebens aufgehalten oder gar vernichtet worden sei -, sie irren sich, denn die zukunftbergenden Keime sind da und wirken überall, auch wenn die äußere Form zerbricht.
Diese Zukunft vorzubereiten und aufzubauen, erforderte unermüdliches Schaffen, die Kraft eines Übermenschen und die Besiegelung durch das Opfer. Inmitten eines rastlosen Arbeitslebens war einer der Höhepunkte im Werke Rudolf Steiners die Eröffnung des Goetheanum als Hochschule für Geisteswissenschaft. Es war die Zeit des Um-sturzes und der sozialen Wirren, des wirtschaftlichen Zusammenbruchs.
#SE281-063
Wenn auch die künstlerischen Arbeiten noch nicht alle vollendet waren, so konnte doch der Bau seiner Bestimmung, die Arbeit ihren Zielen übergeben werden. Drei Jahre lang diente der Bau dieser Arbeit: der Wiedererneuerung der Menschheit im Geiste. Dann brannte er nieder in der Silvesternacht. Die Würde der Feier war dem Vernichtungsakt gegeben; die Größe der Jahreslaufumrahmung dem historischen Geschehen. So in den Kosmos und in den Zeitenlauf hineingesiegelt ward der Bau, als er dem Erdenwirken entrissen wurde.
Diese Vorträge bilden einen Teil der Hochschulkurse, der im Rahmen der ganzen Eröffnungsfeier nicht fehlen durfte, denn er war mehr als integrierender Teil. Das Wort stand für Rudolf Steiner da als Grundlage des Geschehens. Das Wort war Ausgangspunkt und Mittelpunkt und Ziel alles Werdens und aller Entsiegelung. Aber Rudolf Steiner pflegte nicht große Worte nur geheimnisvoll verhüllt hinzu-stellen; er führte zu ihnen hin durch das Erkennen und durch das Ergreifen. Was er erschloß, wurde Wahrnehmung, wurde bewußtseinsmäßiges Erfassen und Wirken. Die ersten Sprossen der Leiter durfte man unter seiner Leitung erklimmen. Dann übergab er uns der Freiheit. Sein Wort in uns sollte Wagemut werden und Tat.
Nie hat die Kunst fehlen dürfen in den Veranstaltungen, die von Rudolf Steiner ausgingen. Erkennend sollten wir ihr nahen, in Ehrfurcht sie auswirken, ihres Ursprungs gedenk. Im kosmischen Kultus war sie wesender Bestandteil; im dreifachen Logos urständete sie; an den Altären der Wahrheit, Schönheit und Stärke diente und opferte sie. Ihre göttliche Bindung hat sie am längsten gewahrt durch die rationalistischen Zeitalter hindurch. In dem Zeitalter der Trivialität versank ihre Gotteskindschaft in die Physis; der Sieg der Mechanik entriß sie ihren geistigen Quellen, fesselte sie an die Maschine.
Sie muß wieder erlöst werden. Das Haus der Sprache - so nannte Rudolf Steiner das Goetheanum - hatte das Ziel, Kunst, Wissenschaft und Religion aus der getrennten Dreiheit, die sie geworden waren, zu ihrer ursprünglichen Einheit wieder zurückzuführen. In der geistigen Vertiefung und gegenseitigen Befruchtung von Kunst, Wissenschaft und Religion sah Rudolf Steiner ein Heilmittel, das in wirksamer
#SE281-064
Weise eingreifen konnte in das soziale Leben der Menschheit, damit Barbarei vermieden werden könne und statt der schon wissenschaftlich bewiesenen Abendröte der europäischen Kultur aus Not, Elend und Irrtum heraus doch eine neue Morgenröte erstehen könne.
Die tief eindringlichen Worte, in denen er diesem seinem Streben Ausdruck verleiht, lassen voll erkennen, welche bedeutsame Rolle er einer durchgeistigten Kunst im Wiederaufbau der höheren Menschheitskultur zuschreibt, und sollen deshalb zusammen mit den Vor-trägen über redende Künste in diesem Buche erscheinen.
Das Haus, das diesen Zielen diente, in freier Offenheit den Willkommensgruß jedem Gaste bietend, steht nicht mehr. An seiner Stelle erhebt sich ein burgähnlicher Bau im spröden Material unserer Zeit, dem Beton. Ihm ist noch Leben eingehaucht worden von seinem dahingegangenen Schöpfer; dies adelt ihn und gibt ihm seine Bedeutung. Dort sollen die Mysterienspiele aufgeführt werden, die dramatischen Schöpfungen Rudolf Steiners, die den Menschen wieder in seine geistig-kosmischen Zusammenhänge hineinstellen, ihn zum Weltenbürger machen, seine gegenwärtige Persönlichkeit aus den früheren Erdenleben heraus erklären. An diesen Dramen wird die Menschheit lernen können sich erkennen, sich erleben und sich wieder erneuern. Dort soll auch vor allem die Eurythmie gepflegt werden, jene Kunst, die Rudolf Steiner als eine neue Kunst in die Reihe der ihr vorangegangenen älteren Künste hineinstellte, die äußere sichtbare bewegliche Form der Sprache, die ganz imperativ und zwingend die Wieder-erneuerung der Sprachkunst, des künstlerisch gesprochenen Wortes fordert. Orchestrales Zusammenwirken zwischen dem gesprochenen Wort und der eurythmischen Gebärde war die Forderung, die Rudolf Steiner stellte, und die in der Praxis erreicht werden mußte. Als das Geleistete seinen Forderungen entsprach, gab er uns das erkennende Bewußtsein dessen, was wir taten, leuchtete in die Geheimnisse der Sprachkunst und der Dichtkunst hinein und erlöste uns so von dem Bann der Unerträglichkeiten.
Wir geben uns keiner Täuschung darüber hin, daß die Welt diesem Streben noch wenig Verständnis entgegenbringen wird. Wir werden es sogar verstehen, wenn mancher ehrlich Suchende dieses Buch zunächst
#SE281-065
voll Ungeduld und Verzweiflung beiseite wirft. Bewußtseinsmetamorphose ist nötig, um diesen Weg zu beschreiten, und man hat ja die Kunst fernhalten wollen von der Bewußtseinsdurchdringung. Schauendes, hörendes, wollendes Bewußtsein führt uns allein heute zu wahrem künstlerischen Erleben und entreißt die dichterische Sprache der abstrakten Intellektualisierung und Mechanisierung, denen sie bereits anheimgefallen ist.
Hat man sich gewöhnt das hinzunehmen, was von der Bühne herab nach dieser Richtung hin heute geboten wird, so ahnt man nicht, was gelitten werden kann, wenn die edelsten Werke der Dichtkunst so verstümmelt, so mißhandelt, so entweiht einem vor die Seele treten, wie es heute nur allzuoft geschieht.
Es ist als ob die Götter sich zürnend abwendeten von dem, was wir mit ihren Gaben gemacht haben. Alles haben sie uns gegeben, nichts vorenthalten; Werke sind entstanden von unglaublicher Höhe und Reinheit und Formvollendung; die deutsche Sprache ist zu einem Werkzeug geworden von subtilster Kraft und Geschmeidigkeit, um die Weiten und Tiefen des Seins zu erfassen und das Innenwesen zu erschließen... Sie ist immer noch wandlung sfähig und biegsam und vermag über sich selbst hinauszuwachsen, so die Menschheit zu ihrem Fortschritt emportragend... Aber wer sie dieser ihrer Bestimmung zuführt, zielbewußt und unbeirrt, der wird gesteinigt.
Wer sie banalisiert und feuilletonisiert gilt dagegen als Meister. Was die deutsche Sprache an Möglichkeiten hat in der Konturierung und Transzendenz ihrer Begriffsformulierungen, das hat sie in anderer Weise in der Plastizität und Durchlässigkeit ihrer Lautelemente. Sie ist nicht im gewöhnlichen Sinne musikalisch, nicht auf der Oberfläche - man muß das innere Ohr für sie haben -, aber sie hat so viele Schattierungen, Lichter, Schleier, Aufhellungen und Blitze, daß man mit ihrer Hilfe immer wieder die Sinnengrenze durchstoßen kann: von der andern Seite, von drüben her tönt es durch ihre Umlaute, ihre Diphthonge hindurch, raunt in den Konsonantenverbindungen, klingt im wehenden Schwingen ihres Satzbaues. Man ahnt nicht, welch ein künstlerisches Erlebnis Sprache sein kann, bevor man gelernt hat von innen hören, bevor das seelisch-geistige Erklingen
#SE281-066
sich umgesetzt hat in die Formung des Tones, in den Flug der Bewegung.
Die heutige Welt ist eine Realisierung des Intellektuellen; sie kommt nicht hinaus über das Mechanisch-Mathematische; sie findet nicht die Wege hinein in das Imaginative, in die Legendenbildung. Man bringt es nicht mehr fertig Bilder zu formen, weil man ein intellektueller Abstraktling geworden ist. Es ist viel leichter, gescheit zu denken, als bildhaft zu gestalten, denn das Intellektuelle entströmt dem Persönlichen, und die künstlerische Gestaltung erfordert viel mehr Selbst-losigkeit. Sie taucht unter in den Gegenstand, statt sich ihn vorzustellen, läßt sich von ihm mitnehmen, statt ihn zu halten. Wir verlieren unsere reale Verbindung mit der Welt, wir entziehen dem Menschen Unsterbliches dadurch, daß wir im Intellektualismus leben. Bildhaftes Gestalten wirkt nicht nur auf das Intellektuelle, sondern es wirkt auf den ganzen Menschen; es geht in viel tiefere Schichten des Seelenlebens hinein als das begriffliche Denken. Dadurch, daß man versucht im Bilde zu sprechen, wird wieder synthetisiert dasjenige, was beim Studium durch das Lehrgut atomisiert wird. Es wird in die Sphäre der Imagination hinaufgerückt, wird dort plastisch gelöst und musikalisch durchseelt. Dadurch nähert es sich dem, was in der Seele ewig ist, was hinter dem Intellektualistischen steht. Durch imaginativ beseeltes Sprechen führen wir den Menschen zum substantiellen Inhalt des Wortes, zum Übersinnlichen, zu dem schöpferischen Wort, das aus dem Übersinnlichen herausströmt. Unsterbliches Seelen-leben wird erweckt, wenn man aus dem Bilde, aus dem Künstlerischen heraus spricht; unsterbliches Seelenleben wird ertötet, wenn man aus dem Intellektualistischen heraus arbeitet.
DIE KUNST DES MÜNDLICHEN VORTRAGES Dornach, 6. April 1921
#G281-1967-SE067 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
DIE KUNST DES MÜNDLICHEN VORTRAGES
Dornach, 6. April 1921
#TX
Die Kunst der Rezitation und Deklamation, über die wir uns heute abend ein wenig unterhalten sollen, wird insbesondere in unserer Gegenwart nicht in dem vollen, wenn ich so sagen darf, künstlerischen Sinne genommen. Man berücksichtigt, wenn man an diese Kunst herantritt, sehr häufig das viel zu wenig, was dabei erstens von seiten des Dichters vorliegt, und auch das nicht in vollem Sinne des Wortes, was nun das Material ist, in dem man als Rezitator oder Deklamator künstlerisch wirksam zu sein hat. Man wird insbesondere dazu veranlaßt, über die wesentlichen Grundlagen der rezitatorischen und deklamatorischen Kunst nachzudenken, wenn - wie das bei uns des öfteren auch vor Ihnen schon geschah - diese Kunst als Begleitkunst der Eurythmie auftritt. Dann wird man so recht gewahr, daß Rezitation und Deklamation hinausgehen müssen über das, was der Prosa-inhalt eines Gedichtes ist, was das eigentlich Gedankliche in einem Gedichte ist. Denn die Hervorhebung dieses Prosainhaltes macht das Rezitieren, Deklamieren eines Gedichtes zu etwas Unkünstlerischem. Und wenn in unserer Gegenwart vielfach gerade darauf Wert gelegt wird, im Rezitieren das hervorzuheben, was im Sinne des Inhaltlichen hervorgehoben wird, wie wenn man eben als Prosalker die Sache vorbringen würde, so zeigt man dadurch nur, daß man von dem eigentlichen Künstlerischen auf diesem Gebiete abgekommen ist. Man sei sich doch klar darüber, daß gewiß der Dichter, wenn er ein wirklicher Dichter ist, in seiner Phantasie im vollen Sinne des Wortes das gehabt hat, was dann zuletzt in Rezitation und Deklamation zum Vorschein kommen muß. Ein Dichter, der nur den Gedankeninhalt oder den wortwörtlichen Empfindungsinhalt und nicht die innerlich gehörte Laut- und Wortbewegung des Gedichtes in der Seele gehabt hätte, wäre eben durchaus kein Dichter. Aber man muß sich auch darüber klar sein, daß in demjenigen, was dem Rezitator vorliegt, zuletzt doch nichts anderes da ist als eine Art Partitur, als eine Art Noten-blatt, und daß die Kunst des Rezitierens und Deklamierens ebenso
#SE281-068
über dieses Notenblatt hinausgehen muß, wie es etwa der Klavier-spieler oder irgendsonst die ausübenden Musiker tun müssen. Es ist ein Neuschaffen in einem Nachschaffen und ein Nachschaffen im Neu-schaffen. Auch der Musiker, der ein Klavierstück komponiert, wird selbstverständlich in seiner Phantasie die ganze Tonbewegung haben; wer aber seine Komposition nachschaffen will, muß vor allen Dingen sich bekanntmachen sowohl mit dem Instrument als auch mit dem, was an Tonbewegung im Toninhalt gerade zum Beispiel durch das Klavier hervorgebracht werden kann. Er muß verstehen die Kunst der Behandlung seines Werkzeuges und Materials. Und so muß der Rezitator verstehen die Kunst in der Behandlung der Sprache. Sein Werkzeug ist ja viel näher an seine eigene Wesenheit gebunden als die äußeren Werkzeuge der Musiker, und in der Behandlung des Werkzeuges wird er auch seine ganz besonderen Eigenheiten entwickeln müssen. Wovon er aber wird ausgehen müssen, das ist die Sprach-behandlung, die Behandlung des Materiales, durch das er das, was ihm vom Dichter doch nur wie eine Partitur gegeben ist, zur Offenbarung zu bringen hat. In bezug auf diese Sprachbehandlung wird ebenso von den Elementen ausgegangen werden müssen wie zum Beispiel in der Kunst des Klavierspieles. Nur wird das Erlernen in vieler Beziehung ein, ich möchte sagen intensiveres sein müssen als das Erlernen des Klavierspieles.
Aber auch dabei darf nicht außer acht gelassen werden, daß wir nun einmal in der Gegenwart in der Zeit leben, in der manches, was bis zu unserem Zeitalter innerhalb der Menschenseele instinktiv gelebt hat, heraufgehoben werden muß in das Bewußtsein. Es besteht heute in weiten Kreisen auch der Künstlerschaft noch eine gewisse Furcht vor diesem Bewußtsein über die besondere Betätigung im künstlerischen Schaffen. Man glaubt, durch eine solche Bewußtheit gewissermaßen der instinktiven Phantasietätigkeit Abbruch zu tun, diese letztere zu lähmen. Viele glauben auch, daß, indem sie das, was in der Seele eigentlich vorgeht, im künstlerischen Schaffen sich zum Bewußtsein bringen, sie dadurch jene Naivität verlieren, welche nötig ist zum künstlerischen Schaffen.
Nun gewiß, an allen diesen Dingen ist etwas durchaus Wahres.
#SE281-069
Aber auf der andern Seite müssen wir uns auch klar darüber sein, daß das, was gerade auf dem Gebiete anthroposophischen Schauens angestrebt wird, für unsere heutige Zeit eine außerordentlich bedeutsame Zivilisationsangelegenheit ist. Das allmähliche Sich-Herauf-ringen zum Erleben dessen, was innerhalb dieser Geistesströmung Imagination genannt wird, webt und lebt durchaus in einem andern Elemente, als es das verstandesmäßige Element ist, und es braucht das künstlerische Erleben gegenüber dem imaginativen Erleben durchaus nicht verlorenzugehen. Ja, es kann, wenn man es mit wirklichen Imaginationen zu tun hat, deshalb nicht verlorengehen, weil das, was auf der einen Seite zum Behuf der Erkenntnis in der Imagination sich erschließt, objektiv - nicht bloß durch das subjektive Erleben, sondern objektiv - verschieden ist von dem, was in der Imagination sich der Seele dann offenbart, wenn diese Seele die Imagination in künstlerischer Gestalt verarbeitet.
Wenn ich da auf etwas Persönliches hinweisen darf, so möchte ich sagen: Mir war es immer etwas außerordentlich Unsympathisches, wenn der eine oder der andere gekommen ist und meine Mysterien-dramen in symbolischer oder sonstiger verstandesmäßiger Weise aus-gedeutet hat und allerlei gerade vom Verstande aus hineingetragen hat. Denn das, was in diesen Mysteriendramen lebt, ist bis auf den einzelnen Laut hin imaginativ erlebt. Das Bild steht als Bild da und stand immer als Bild da. Und niemals wäre es mir selber eingefallen, irgend etwas Verstandesmäßiges zugrunde zu legen, um es dann ins Bild umaugestalten.
Gerade dabei konnte ich erleben, wie, wenn man versucht künstlerisch zu gestalten, dann das Imaginative objektiv etwas ganz anderes wird als das, was man gestalten muß, wenn man zum Behufe der Erkenntnis das Imaginative zu gestalten hat. Also dieses Vorurteil wird überwunden werden müssen, daß die Naivität und die instinktive Phantasie beeinträchtigt werden, wenn man das künstlerische Betätigen in die Bewußtheit heraufhebt. Dieses Vorurteil wird gegenüber den Anforderungen unseres Zeitalters überwunden werden müssen, und dann wird man vielleicht gerade dadurch auf die richtigen Elemente des Deklamatorischen und des Rezitatorischen, so wie diese
#SE281-070
Kunst sich für die Gegenwart und die nächste Zukunft enifalten muß, geführt werden.
Man kann nicht Rezitatorisches und Deklamatorisches zur Ausübung bringen, wenn man nicht eingeht auf die tiefen Unterschiede, die gegeben sind im Dichterischen durch das Lyrische auf der einen Seite, das Epische auf der andern Seite, das Dramatische auf der dritten Seite. Wir werden heute nur in der Lage sein, mehr Lyrisches und dann Dramatisches zur Darstellung zu bringen. Wir werden dann anschließen etwas, was Prosadichtung genannt werden könnte. Für diese Auswahl waren eben Gründe vorhanden; ein anderes Mal soll auch das Epische zur Geltung kommen. Allerdings ist das Epische dasjenige, an dem vielleicht die Kunst der Rezitation, wenn sie über die ersten Elemente hinausgeht, am meisten veranschaulicht werden kann.
Zunächst gilt für das Sich-Hindurchringen zu einer wirklichen deklamatorischen und rezitatorischen Kunst mit Bezug auf die drei Elemente des Dichterischen das Folgende: Es muß derjenige, der zu dieser Art des mündlichen Vortrages kommen will, ein deutliches Gefühl entwickeln von dem Zusammenhange des Lyrischen mit dem sprachlichen Elemente. Diesen Zusammenhang wird er bekommen dadurch, daß er das Erlebnis des Vokalischen hat. Das Erlebnis des Vokalischen, das Erlebnis der Innerlichkeit des Vokalischen ist dasjenige, an dem man sich zur Verkörperung, zur Offenbarung des Lyrischen hinaufringen muß. Denn durch das Vokalische kommt das zum Ausdrucke, was im wesentlichen innerliches Erlebnis des Menschen ist. Und in den einzelnen Vokalen liegen, wenn sie in entsprechender Weise durchdrungen werden mit verständnisvollem Gefühl und verständnisvoller Empfindung, die Variationen menschlichen inneren Erlebens. In diesem Vokalismus lebt alles, was aus dem musikalischen Erleben noch gewissermaßen herüberprojiziert ist in das lyrische Erleben. Das lyrische Erleben geht durchaus auf das musikalische Erleben zurück. Aber im musikalischen Erleben haben wir die Innerlichkeit in die Bewegung der Töne auseinandergefaltet. In der Verwendung des Lautes in der Lyrik haben wir in die Substanz des Vokales selbst die Innerlichkeit hineinvertieft. Derjenige, der von diesem Gesichtspunkte aus zur Rezitation kommen will, darf nur nicht
#SE281-071
in einen gewissen Irrtum verfallen: dieser Irrtum wäre der denkbar größte in bezug auf die rezitatorische Kunst. Man könnte nämlich glauben, man müsse zunächst in dem Erlernen der Materialbehandlung dessen, was die Sprache und ihr Wesen ist, von der Empfindung ausgehen, um aus der Empfindung heraus - was gerade eben ein prosaisches Element wäre - gewissermaßen in den Vokal hineinzutragen das Empfindungsgemäße. Das ist gerade der umgekehrte Weg von dem der Rezitation. Derjenige, der Lyrisches rezitieren will, muß den Vokal selbst empfindend erleben, er muß vom Vokalerlebnis ausgehen. Und geradeso, wie etwa Goethe an den verschiedenen Farben-nuancen deutlich differenziert die Empfindungsnuancen gegeben weiß, so wird derjenige, der in dieser Weise an das Erleben des Vokalischen herangeht, an dem Vokalischen nicht nur Empfindungsnuancen erleben, sondern völlig differenzierte innerliche Seelentatsachen, Seelen-inhalte. Er wird gewissermaßen alle Abstufungen von der Trauer und Bitterkeit bis zum Lustigen und zum Jauchzen in der Empfindung des Vokalischen, gewissermaßen der Vokalskala erleben können.
Gerne wird zugegeben werden, daß vieles von dem, was ich jetzt sage, und was der Rezitator in dieser Weise erlebt, vielfach - indem er einfach gleich darangeht, seine Kunst an einzelnen Gedichten zu erproben - instinktiv von ihm erlebt wird, aber er wird seine Kunst bedeutsam steigern können, wenn er ein solches Erleben zur Bewußtheit heraufbringen kann. Und mit dem, was er am Vokalismus lernt, wird ihm etwas erschlossen, was dann allerdings weiter ausgebildet werden kann, indem man übergeht zu der Empfindung, die entsteht, wenn ein früher ertönender Vokal im nachher ertönenden noch hineinklingt, oder ein nachher ertönender Vokal auf den vorhergehenden zurück seine Wirkung tut und so weiter. All diese Dinge dürfen aber nicht in der mechanistisch-materialistischen Weise getrieben werden, wie das heute vielfach geschieht, wo man auf allerlei Körpereinstellungen und künstliche Atmungsprozesse zunächst abzielt, sondern alles, was in dieser Beziehung der Körper zu lernen hat, muß so gelernt werden, daß man zunächst nur im Material der Sprache selber arbeitet. Geradeso wie als Maler derjenige etwa am meisten lernen kann, der von irgendeinem fertigen künstlerischen Maler direkt
#SE281-072
angewiesen wird, unmittelbar auf der Leinwand zu malen, und ihm nur da und don nachgebessert wird, so wird derjenige am besten rezitieren lernen, der die Behandlung der Sprache unmittelbar an der Sprache, im Sprechen, im Erfassen der Sprachbewegung sich aneignet, und der dann nur bei dem einen oder dem andern aufmerksam gemacht werden wird, was da notwendig ist in bezug auf äußere mechanistische Körperbeherrschung. Es ist ein merkwürdiges Bestreben in unserer materialistischen Zeit, sich zuerst von dem Ge-dichte zu entfernen und gewissermaßen das Instrument einzustellen, und dann zu der künstlerischen Behandlung der Sprache zurückzugehen. Man möchte fast sagen, diese Abirrung sei ein künstlerischer Unfug. Er entspringt jedenfalls nicht einer wirklichen künstlerischen Empfindung.
Dann aber, wenn man sich in dieser Weise am Vokalisieren in das lyrische Erleben findet, wird man auch das epische Erleben verstehen lernen durch das Erleben des Konsonantischen. Das Konsonantische wirklich erlebt, ist eigentlich ein Nacherleben im Innern desjenigen, was außer uns vor sich geht. Und man wird, wenn man an den Elementen des Konsonantischen dieses eigentümliche Nachbilden der Außenwelt in unserem Innern erlebt, dann auch kunstgemäß -ich kann nur heute darauf hinweisen, bei einer anderen Gelegenheit kann ja darauf noch aufmerksam gemacht werden - von diesem Elementaren hingeführt zu dem innerlichen, aber im sprachkünstlerischen Sinne innerlichen Nacherleben desjenigen, was auch in den Bildern eines weitausholenden Epos etwa gegeben ist.
Und so wird bis in die Behandlung der Elemente hinein dasjenige zur wirklichen Kunst ausgebildet werden können, was dem Rezitatorischen und Deklamatorischen zugrunde liegen soll. Man muß sich dabei durchaus klar sein, daß - wenn man also das Wesentliche dieser Kunst in der Sprachbehandlung sieht - Nuancen dieser Kunst in den verschiedenen Sprachen auftreten werden, jede Sprache dann in der ihr eigenen Art ihre besonderen rezitatorischen und deklamatorischen Anforderungen hat. Eine Sprache, die im wesentlichen eine nach-bildende Sprache ist, die im wesentlichen zunächst vom Verständigen ausgeht, vom Klassifizierenden, und im verständigen Element die
#SE281-073
Sprache entwickelt hat, sie schon abgehoben hat von dem, was in der äußeren Welt erlebt wird, eine solche Sprache wird in anderer Art sich ins Rezitatorische und Deklamatorische hineinarbeiten müssen, als eine Sprache, die noch in dem Laute selbst ein unmittelbares Erleben ausdrückt des Verhältnisses dieses Lautes zu dem, was er eigentlich von Innerlichem oder Äußerlichem in sich hat.
Und so sollen Sie nunmehr im ersten Teil desjenigen, was Frau Dr. Steiner deklamieren wird, zunächst Lyrisches hören, und Lyrisches auch so hören, daß Sie dabei entnehmen können, wie sich dieses Lyrische in verschiedenen Nuancen auslebt, wenn es in verschiedenen Sprachen zur Darstellung kommt. Das soll der erste Teil unseres Pro-grammes sein: Darstellung von wesentlich Lyrischem.
Drei Jugendgedichte von Goethe
BEHERZIGUNG
Ach, was soll der Mensch verlangen?
Ist es besser, ruhig bleiben?
Klammernd fest sich anzuhangen?
Ist es besser, sich zu treiben?
Soll er sich ein Häuschen bauen?
Soll er unter Zelten leben?
Soll er auf die Felsen trauen?
Selbst die festen Felsen beben.
Eines schickt sich nicht für alle!
Sehe jeder wie er's treibe,
Sehe jeder wo er bleibe,
Und wer steht, daß er nicht falle!
MEERES STILLE
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Flache rings umher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.
#SE281-074
MIT EINEM GEMALTEN BAND
Kleine Blumen, kleine Blätter
Streuen mir nüt leichter Hand
Gute junge Frühlingsgötter
Tändelnd auf ein luftig Band.
Zephyr, nimm's auf deine Flügel,
Schiing's um meiner Liebsten Kleid!
Und so tritt sie vor den Spiegel
All in ihrer Munterkeit.
Sieht mit Rosen sich umgeben,
Selbst wie eine Rose jung:
Einen Blick, geliebtes Leben!
Und ich bin belohnt genung.
Fühle, was dies Herz empfindet,
Reiche frei mir deine Hand,
Und das Band, das uns verbindet,
Sei kein schwaches Rosenband!
Eine kleine Probe englischer Lyrik
SONG
April, April,
Laugh thy girlish laughter;
Then, the moment after,
Weep thy girlish tears!
April, that mine ears
Like a lover greetest,
If I tell thee, sweetest,
All my hopes and fears,
April, April,
Laugh thy golden laughter,
But, the moment after,
Weep thy golden tears!
William Watson
#SE281-055
National Airs, Nr.1
THE BELL5 OF ST. PETERSBURGH
Those evening heils! those evening bells!
How many a tale their music teils,
Of youth, and home, and tilat sweet time,
When last I heard their soothing chime!
Those joyous hours are past away!
And many a heart, that then was gay,
Within the tomb now darkly dwells,
And hears no more those evening bells!
And so ,twill be when I am gone;
That tuneftil peal will still ring on,
While other bards shall walk these dells,
And sing your praise, sweet evening bells!
Thomas Moore
Eine Probe russischer Lyrik
NILDELTA
Goldenglänzendes, smaragdenes,
Tief schwarzerdenes Gefild,
Deines Kraftens reicher Segen
Aus der Scholle quillt.
Dieser Schoß, der keimetragende,
Tote bergend in den Ton,
Er litt stumm, der allergebene,
Die jahrtausend lange Fron.
Doch nicht alles so Empfangene
Trugst empor du jedes Jahr.
Das vom alten Tod Gezeichnete
Sieht des Lenzes sich noch bar.
Isis nicht, die Kronen tragende,
Wird dir bringen jenen Kranz,
Doch die unberührte, ewige
Magd im Regenbogenglanz.
Wladimir Solovjeff
übersetzt von Marie Steiner
#SE281-076
Wandrers Sturmlied von Goethe
Wen du nicht verlässest, Genius,
Nicht der Regen, nicht der Sturm
Haucht ihm Schauer übers Herz.
Wen du nicht verlässest, Genius,
Wird dem Regengewölk,
Wird dem Schloßensturm
Entgegen singen,
Wie die Lerche,
Du da droben.
Den du nicht verlässest, Genius,
Wirst ihn heben übern Schlammpfad
Mit den Feuerflügeln;
Wandeln wird er
Wie mit Blumenfüßen
Über Deukalions Flutschlamm,
Python tötend, leicht, groß,
Pythius Apollo.
Den du nicht verlässest, Genius,
Wirst die wollnen Flügel unterspreiten,
Wenn er auf dem Felsen schläft,
Wirst mit Hüterfittichen ihn decken
In des Haines Mitternacht.
Wen du nicht verlässest, Genius,
Wirst im Schneegestöber
Wärmumhüllen;
Nach der Wärme ziehn sich Musen,
Nach der Wärme Charitinnen.
Umschwebet mich ihr Musen,
Ihr Charitinnen!
Das ist Wasser, das ist Erde,
Und der Sohn des Wassers und der Erde,
Über den ich wandle
Göttergleich.
Ihr seid rein, wie das Herz der Wasser,
Ihr seid rein, wie das Mark der Erde,
Ihr umschwebt mich und ich schwebe
Über Wasser, über Erde,
Göttergleich.
#SE281-077
Soll der zurückkehren,
Der kleine, schwarze, feurige Bauer?
Soll der zurückkehren, erwartend
Nur deine Gaben, Vater Bromlus,
Und helleuchtend umwärmend Feuer?
Der kehren mutig?
Und ich, den ihr begleitet,
Musen und Charitinnen alle,
Den alles erwartet, was ihr,
Musen und Charitinnen,
Umkränzende Seligkeit
Rings ums Leben verherrlicht habt,
Soll mutlos kehren?
Vater Bromius!
Du bist Genius,
Jahrhunderts Genius,
Bist, was innre Glut
Pindarn war,
Was der Welt
Phöbus Apoll ist.
Weh! Weh! Innre Wärme,
Seelenwärme,
Mittelpunkt!
Glüh' entgegen
Phöb' Apolien;
Kalt wird sonst
Sein Fürstenblick
Über dich vorübergleiten,
Neidgetroffen
Auf der Ceder Kraft verweilen,
Die zu grünen
Sein nicht harrt.
Warum nennt mein Lied dich zuletzt?
Dich, von dem es begann,
Dich, in dem es endet,
Dich, aus dem es quillt,
Jupiter Pluvius!
Dich, dich strömt mein Lied,
Und kastalischer Quell
Rinnt ein Nebenbach,
#SE281-078
Rinnet Mäßigen,
Sterblich Glücklichen
Abseits von dir,
Der du mich fassend deckst,
Jupiter Pluvius!
Nicht am Ulmenbaum
Hast du ihn besucht,
Mit dem Taubenpaar
In dem zärtlichen Arm,
Mit der freundlichen Ros' umkränzt,
Tändelnden ihn, blumenglücklichen
Anakreon,
Sturmatmende Gottheit!
Nicht im Pappelwald
An des Sybaris Strand,
An des Gebirges
Sonnebeglänzter Stirn nicht
Faßtest du ihn,
Den bienensingenden,
Honig-Iallenden,
Freundlich winkenden
Theokrit.
Wenn die Räder rasselten,
Rad an Rad rasch ums Ziel weg,
Hoch flog
Siegdurchglühter
Jünglinge Peitschenknall,
Und sich Staub wälzt',
Wie vom Gebirg herab
Kieseiwetter ins Tal, -
Glühte deine Seel' Gefahren, Pindar
Mut. - Glühte? -Armes Herz!
Dort auf dem Hügel,
Himmlische Macht!
Nur so viel Glut,
Dort meine Hütte,
Dorthin zu waten!
#SE281-079
Es handelt sich bei dem deklamatorisch-künstlerischen Ausbilden des Dichterischen darum, daß erstens nichts verlorengehe von dem, was aus dem Innern des Dichters als Seeleninhalt durch Worte quillt, oder was in dem durch den Dichter Dargestellten enthalten ist. Aber künstlerisch wird die Rezitation, so wie die Dichtung selbst, erst dann, wenn alles das, was an Prosainhalt aus der Seele quillt, auch umgegossen ist in das Fornihafte, in das Gestaltete: im Lyrischen mehr in das Musikalische, im Epischen, insbesondere im Dramatischen mehr in das Bildhafte, in das eigentlich Gestaltete. Dasjenige, was lyrisch ist, sagte ich, neigt zum Vokalischen. Wenn so etwas ausgesprochen wird, darf man immer nicht vergessen, daß jedes Konsonantische zugleich ein vokalisches Element hat. In jedem Konsonantischen liegt der Ansatz zu einem Vokal, in jedem Vokal der Ansatz zu einem Konsonanten. Dies bewirkt - wie auf verschiedenen anderen Gebieten, wo ähnliches getan wird -, daß durch die Kunst der Gegensatz des Subjektiven zum Objektiven völlig überwunden wird und erreicht wird, daß der Mensch mit seinem ganzen Inneren in der Außenwelt lebt, und daß die volle Außenwelt mit ihrer ganzen Intensität durch das menschliche Innere sich zum Ausdrucke bringen kann.
Ich habe, als ich beim vorigen Herbstkurs über rezitatorische Kunst sprach, aufmerksam darauf gemacht, wie zum Beispiel das, was aus dem allgemeinen Weltenrhythtnus heraus im zweiten Gliede der menschlichen Wesenheit sich durch das Rhythmische im Menschen ausdrückt, wiederum sich zum Ausdrucke bringt in der dichterischen Kunst und dann selbstverständlich in der Offenbarung der dichterischen Kunst: in der Rezitation. Wir können sagen, daß ein mehr nach dem Geiste hindrängendes Element - indem der Geist sich selbst in allem Physischen zum Ausdrucke bringt - in dem Tempo des menschlichen Pulsschlages sich auslebt. Wir können aber sagen, daß etwas mehr Seelisches, etwas mehr in der Seele Verlaufendes sich in dem Atmungsrhythmus auslebt. Und es beruht ein großer Teil dessen, was im dichterisch Formellen zum Ausdruck kommt, auf dem Ineinander-spiel des Verhältnisses von Pulsrhythmus und Atmungsrhythmus. Und in dem Hexameter tritt gerade, ich möchte sagen, das ursprünglichste,
#SE281-080
das selbstverständliche Verhältnis des Pulsrhythmus zum Atmungsrhythrnus zutage. Im Grunde genommen sind es zwei Atmun-gen, die im Hexameter auftreten, eingeteilt jeder Atemaug in vier Pulsschläge, was ja das naturgemäße Verhältnis des menschlichen Atems zum Pulsschlag ist.
So spricht sich bis in das Leibliche hinein das aus, was im Dichterischen quillt, und so muß auch wiederum aus dem ganzen Menschen heraus rezitatorisch und deklamatorisch das Dichterische sich zum Ausdrucke bringen. Es ist, wie wenn der Pulsrhythmus spielte auf dem Atmungsrhythmus: Rhythmus auf Rhythmus. Aber gerade was in diesem Rhythmus lebt, ist das, was wiederum in der Musik der Sprache lyrisch in der Dichtung zum Ausdrucke kommt. Und alles das, was Prosainhalt des Gedichtes ist, muß zurückgeführt werden auf diese innere rhythmische oder taktmäßige oder tempomäßige Behandlung. Es muß alles hinüberfließen in die Formen, nichts darf im Gedicht nur bloß so verstanden werden, wie man etwa prosaisch Mit-geteiltes versteht. Es muß alles das, was im Was inhaltlich liegt, in dem Wie der Darstellung wieder liegen. So daß man eigentlich entdeckend dabei das eine in dem anderen vollständig erlebt. Wenn man nötig hat, in einer Dichtung oder beim Rezitieren irgend etwas durch den bloß wortwörtlichen Inhalt aufzufassen, so wird das Künstlerische in diesem Punkte durchbrochen.
Das ist, was einem eigentlich immer vorschweben muß, wenn man auf irgendeinem Kunstgebiet sich hindurchringen will von dem, was der unkünstlerische Inhalt ist, zu dem, was die eigentliche künstlerische Gestaltung oder künstlerisch musikalische Durchdringung ist. Das letztere ist für das Rezitieren und Deltlamieren der Dichtung insbesondere anschaulich in dem, was als Lyrisches zutage tritt.
Man muß sich klar sein darüber, daß nun auch für das Dramatische die besondere Kunstform, die diese Dramatik ausmacht, wenn durch die Sprache dargestellt wird, dann zutage treten muß. Und man muß eigentlich sagen: Rezitation hat als selbständige Kunst zu berücksichtigen, daß sie in einer gewissen Beziehung wiederum etwas anders das Dramatische entwickelt, als es entwickelt wird, wenn die volle dramatische bühnenmäßige Darstellung sich offenbaren kann.
#SE281-081
Dennoch wird das, was das Wesen der bühnenmäßigen Darstellung ausmacht, in bezug auf die Sprachbehandlung auch in der rezitatorischen, deklamatorischen Behandlung des Dramatischen zutage treten müssen.
Was liegt denn eigentlich vor, wenn wir dramatische Dichtung vor uns haben? Die dramatische Dichtung ist ja im wesentlichen das, was erst wird durch die Personen der Bühne oder - wenn wir das Drama nicht mit unseren Augen sehen oder mit unseren Ohren hören - durch das, was wir aus der dichterischen Sprache heraus in der Phantasie uns vollständig vergegenwärtigt vor die Seele stellen können. Alles muß da in bewegter Gestalt ausfließen können. Aber trotzdem das Drama erst fertig ist, wenn es durch die Personen der Bühne dargestellt wird, müssen wir uns doch klar sein, daß alles, was in den äußeren Personen der Bühne vor unser Auge tritt, was durch unser Ohr gehört werden kann, im Grunde Ausdruck für ein Seelisches ist, daß das Seelische, welches in den einzelnen Personen, im Zusammenwirken der Personen dramatisch vor uns steht, eigentlich der wesentliche Inhalt des Dramatischen ist.
Nun wird es aber notwendig sein, daß man aufmerksam ist auf das, was da in der Seele eigentlich vorgeht. Es geht in der Seele gerade beim dramatischen Gestalten etwas vor, was - auch wenn es zunächst dichterisch ist - etwas Imaginatives ist. Auf der Bühne muß bildhaft dargestellt werden, und hier ist das Gesprochene auch bildhafte Darstellung desjenigen, was in des Dichters Seele lebt. Und das, was auf der Bühne dargestellt wird, wirkt nicht durch seine Wirklichkeit, sondern durch das, was aus dem schönen Scheine ist. Es ist trotz seiner Wirklichkeit ein Imaginatives. Und ein Imaginatives ist es auch, allerdings von besonderer Art, wenn wir in der eigenen Phantasie dramatisch Gestaltetes uns vor die Seele hinstellen. Nur ist dieses Imaginative nicht in seinem Sein erlebt, sondern es ist in seiner Projektion in unsere Seele herein als Phantasiegestaltung erlebt. So aber wie sich der Schatten, den ein dreidimensionaler Gegenstand auf eine Wand wirft, zu diesem Gegenstande selbst verhält, in dem im Grunde genommen niemals das lebt, was in dem Gegenstande ist, und so wie ein gutes Abbild einer Sache in zwei Dimensionen alles das enthält,
#SE281-082
was in drei Dimensionen der Gegenstand enthält, so ist in dem, was in der Phantasie sich darstellt - denn die bühnenmäßige Darstellung ist im Grunde genommen nichts anderes als die äußere körperliche Darstellung des Phantasiemäßigen -, ein in die Phantasie herein abgeschattetes Imaginatives enthalten. Daher müssen wir - und jedes gesunde Empfinden wird das auch - einen Widerwillen dagegen haben, wenn im Dramatischen naturalistisch die äußere Wirklichkeit bloß nachgeahmt wird. Das Dramatische verträgt ganz gewiß ebensowenig wie die anderen Künste, die in der Sprache sich offenbaren -aber die kommen weniger in diese Verlegenheit -, das naturalistische Nachahmen. Und wenn in unserer Zeit so vielfach das Bestreben aufgetreten ist, naturalistisch zu sein in der dramatischer Darstellung -wir haben es ja erlebt, daß Schillersche Gestalten auf der Bühne vorgeführt worden sind mit den Händen in der Hosentasche -, wenn dies angestrebt worden ist, naturalistisch nachahmend eine äußere physische Wirklichkeit darzustellen, so bedeutet das nur, daß man von wirklich künstlerischen Empfindungen abgekommen war, daß man nach und nach durch den allgemeinen Gang der Kultur vom Künstlerischen weggekommen ist.
Man kann materialistisch in der Weltanschauung werden, muß es sogar in gewisser Beziehung für die äußere organische Welt, man kann materialistisch in bezug auf das äußere Leben werden, aber man kann nicht materialistisch in der Kunst werden! Denn wenn man es wird, dann ist das, was man hervorbringt, auf keinem Gebiete mehr Kunst. Und das zeigt sich sowohl am Dramatischen als auch in der Sprachbehandlung des das Dramatische Darstellenden.
Da handelt es sich darum, daß nun wirklich in die Sprachbehandlung hineinkommt all dasjenige, dessen die künstlerische Gestaltung der Sprache als solche fähig ist. Die künstlerische Sprachbehandlung hat in sich die verschiedensten Elemente. Ich möchte nur auf einzelnes hindeuten - die Kürze der Zeit gestattet selbstverständlich nicht, auf vieles einzugehen -, ich möchte darauf aufmerksam machen, daß es zum Beispiel mit Bezug auf das, was sich darstellen läßt durch Sprachbehandlung, eine Art Durchschnittstempo geben kann. Man empfindet dieses, und von diesem Durchschnittstempo ausgehend,
#SE281-083
kann es den Übergang geben zu einem schnelleren Tempo, einem Eilen mit den Worten, oder auch zu einem Verlangsamen der Worte. Das erste, das Beschleunigte, wird immer zum Ausdrucke bringen ein gewisses Herausgehen des menschlichen Ich aus sich selber, ein Sich-Entfernen, aber ein Sich-Entfernen in die Breite. Man wird dieses Entfernen in die Breite natürlich in der verschiedensten Art empfinden können; es kann auch zum Beispiel sein ein Entferntsein von etwas, nach dem man sich sehnt und dergleichen.
Ein Verlangsamen des Wortes wird gerade in der dramatischen Behandlung eine Art in sich selber Sein darstellen; daher wird alles, was ausdrücken soll das Zur-Besinnung-Kommen, das still in sich Geschlossene, mit einem Verlangsamen des Tempos zusammenhängen.
Ein anderes formales Prinzip liegt in der Steigerung oder in der Senkung des Tones. Das erstere wird immer zusammenhängen mit einem, ich möchte sagen, Vergeistigen des inneren Erlebens, mit einem über sich Hinaufsteigen des Ich. Ein, ich möchte sagen, in die Weite sich Entfernendes hat es zu tun mit dem Tempo; ein Hinaufsteigen über sich hat es zu tun mit einer Steigerung des Tones. Es wird alles, was nach einer Vergeistigung strebt im Inhalte, wenn es auch nur eine solche Vergeistigung ist, daß der menschliche Intellekt zum Beispiel gefangengenommen wird von dem Willen, von Begeisterung, Enthusiasmus, durch eine Steigerung im Ton sich formal zum Ausdruck bringen. Und es wird dann, wenn der Mensch gewissermaßen unter sich in seinem gewöhnlichen Leben hinuntersinkt, sei es durch Trauer, sei es durch Innigkeit, mit einer Senkung des Tones zusammenhängen müssen. Diese Dinge werden sich ganz besonders im Dramatischen ausdrücken können. Und es wird alles das, was die dramatische Sprachbehandlung fordert, überfließen müssen in ein solches Formales, so daß man nichts durch das bloße verständnismäßige Urteilen im Dramatischen wird erfassen müssen, sondern alles durch diese besondere Art der Sprachbehandlung, natürlich auch durch die gebärdenmäßige Behandlung, wenn es sich um die bühnenmäßige Darstellung handelt und so weiter. Es wird alles überfließen müssen in die besondere Art der Sprache, so daß man alles das, was Inhalt ist,
#SE281-084
in der Sprache fühlt. Es wird in der dramatischen Kunst aus dem Grunde nicht besonders leicht sein, manches zu einer gewissen Vollkommenheit zu bringen, weil das Dramatische, wie schon Aristoteles wußte, es gerade zu tun hat mit den Kausalzusammenhängen des Lebens. Daher liegen auch demjenigen, was in dem früher besprochenen Sinne wie eine Partitur zugrunde liegt und dann künstlerisch zur Offenbarung kommen soll, im hoher Grade auch implizite verstandes-mäßige Elemente urteilsweise zugrunde. Die werden umgeschaffen werden müssen in dasjenige, was durch die Sprachbehandlung, durch Tempo, Takt, Rhythmus, Steigerung oder Fallen des Tones und so weiter erreicht wird. Und das, was als Bild vor der Phantasie entsteht, wird entstehen müssen dadurch, daß diese Sprachbehandlung es ist, aus welcher die Gestaltung der Bilder fließt.
Man muß schon auf diese Intimitäten im menschlichen Leben eingehen, wenn man auf das wahrhaft Künstlerische kommen will. Das Dramatische selbst wird, weil es sich aus dem physischen Erleben heraushebt durch das Imaginative, das ihm, wenn auch im Abglanz, in der Abschattierung eigen ist, durch all das nur wirken können, was als Sprachbehandlung, als Stil zutage tritt.
Daher wird im Dramatischen bis in die Sprachbehandlung hinein dieser dramatische Stil dasjenige sein, wofür man ein besonderes Organ wird haben müssen. Stil muß alles sein, nicht Naturalismus. Daher kann man sagen, daß in einer gewissen Weise das, was sich innerhalb der französischen Bühnenkurst als Bühnenstil ausgebildet hat, was dann auch in anderen Sprachgebieten Nachahmung gefunden hat, was in der klassischen französischen Tragödiendarstellung seinen Höhepunkt gefunden hat, schon in einer gewissen Weise so vor uns stehen soll, daß wir daran die Gestaltung des dramatischen Stiles lernen. Und man wird, wenn wir von da ausgehen, an der Art, wie auf der französischen Bühne noch bis in die jüngste Zeit herein die französischen Klassiker dargestellt worden sind, und von ihnen ausgehend dann dasjenige, was auch nicht klassische Dramatik war, sehr gut dasjenige studieren können, was die dramatische Sprache als etwas Besonderes heraushebt von der naturalistischen Sprache, bei der es auf das Verständliche, nicht so sehr auf die Gestaltung ankommt.
#SE281-085
Durch zwei Proben, eine deutsche und eine französische, soll nun das, was ich mit einigen Linien über den dramatischen Stil und die dramatische Sprachbehandlung andeuten wollte, nunmehr zur Darstellung kommen
Rezitation durch Marie Steiner: aus «Wilhelm Tell» von Friedrich Schiller, 4. Aufzug, 3. Szene:
TELL TRITT AUF MIT DER ARMBRUST
Durch diese hohle Gasse muß er kommen;
Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht - Hier
Vollend' ich's. - Die Gelegenheit ist günstig.
Dort der Holunderstrauch verbirgt mich ihm,
Von dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen;
Des Weges Enge wehret den Verfolgern.
Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt,
Fort mußt du, deine Uhr ist abgelaufen.
Ich lebte still und harmios - Das Geschoß
War auf des Waldes Tiere nur gerichtet,
Meine Gedanken waren rein von Mord -
Du hast aus meinem Frieden mich heraus
Geschreckt, in gärend Drachengift hast du
Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt,
Zum Ungeheuren hast du mich gewöhnt -
Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setzte,
Der kann auch treffen in das Herz des Feinds.
Die armen Kindlein, die unschuldigen,
Das treue Weib muß ich vor deiner Wut
Beschützen, Landvogt! -
Da, als ich den Bogenstrang
Anzog - als mir die Hand erzitterte -
Als du mit grausam teufelischer Lust
Mich zwangst, aufs Haupt des Kindes anzulegen -
Als ich ohnmächtig flehend rang vor dir,
Damals gelobt' ich mir in meinem Innern
Mit furchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört,
Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel
Dein Herz sein sollte. - Was ich mir gelobt
In jenes Augenblickes Höllenqualen,
Ist eine heil'ge Schuld - ich will sie zahlen.
#SE281-086
Du bist mein Herr und meines Kaisers Vogt;
Doch nicht der Kaiser hätte sich erlaubt,
Was du. - Er sandte dich in diese Lande,
Um Recht zu sprechen - strenges, denn er zürnet -
Doch nicht um mit der mörderischen Lust
Dich jedes Greuels straflos zu erfrechen;
Es lebt ein Gott, zu strafen und zu rächen.
Komm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen,
Mein teures Kleinod jetzt, mein höchster Schatz -
Ein Ziel will ich dir geben, das bis jetzt
Der frommen Bitte undurchdringlich war -
Doch dir soll es nicht widerstehn. - Und du,
Vertraute Bogensehne, die so oft
Mir treu gedient hat in der Freude Spielen,
Verlaß mich nicht im fürchterlichen Ernst!
Nur jetzt noch halte fest, du treuer Strang,
Der mir so oft den herben Pfeil beflügelt -
Entränn' er jetzo kraftlos meinen Händen,
Ich habe keinen zweiten zu versenden.
(Wanderer gehen über die Szene.)
Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen,
Dem Wanderer zur kurzen Ruh bereitet -
Denn hier ist keine Heimat. - Jeder treibt
Sich an dem andern rasch und fremd vorüber
Und fraget nicht nach seinem Schmerz. - Hier geht
Der sorgenvolle Kaufmann und der leicht
Geschürzte Pilger - der andächt'ge Mönch,
Der düstre Räuber und der heitre Spielmann,
Der Säumer mit dem schwerbeladnen Roß,
Der ferne herkommt von der Menschen Ländern,
Denn jede Straße führt ans End' der Welt.
Sie alle ziehen ihres Weges fort
An ihr Geschäft - und meines ist der Mord! (Setzt sich.)
- Sonst, wenn der Vater auszog, liebe Kinder,
Da war ein Freuen, wenn er wiederkam;
Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas,
War's eine schöne Alpenblume, war's
Ein seltner Vogel oder Ammonshorn,
Wie es der Wandrer findet auf den Bergen -
#SE281-087
Jetzt geht er einem andern Weidwerk nach,
Am wilden Weg sitzt er mit Mordgedanken;
Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert.
- Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder,
Auch jetzt - euch zu verteid'gen, eure holde Unschuld
Zu schützen vor der Rache des Tyrannen,
Will er zum Morde jetzt den Bogen spannen. (Steht auf.>
Ich laure auf ein edles Wild. - Läßt sich's
Der Jäger nicht verdrießen, tagelang
Umher zu streifen in des Winters Strenge,
Von Fels zu Fels den Wagesprung zu tun,
Hinan zu klimmen an den glatten Wänden,
Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut,
- Um ein armselig Grattier zu erjagen.
Hier gilt es einen köstlicheren Preis,
Das Herz des Todfeinds, der mich will verderben.
(Man hört von Ferne eine heitere Musik, welche sich nähert.)
Mein ganzes Lebelang hab' ich den Bogen
Gehandhabt, mich geübt nach Schützenregel;
Ich habe oft geschossen in das Schwarze
Und manchen schönen Preis mir heimgebracht
Vom Freudenschießen. - Aber heute will ich
Den Meisterschuß tun und das beste mir
Im ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen.
#SE281-088
Aus «Le Cid» von Pierre Corneiile, 3. Akt, 4. Szene:
CHIMÉNE: Ah! Rodrigue, il est vrai, quoique ton ennemie
Je ne puis te blämer d'avoir fuj l'infamie;
Et, de quelque façon qu'éclatent mes douleurs,
Je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs.
Je sals cc que l'honneur, aprés un tel outrage,
Demandait ä l'ardeur d'un généreux courage:
Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien;
Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien.
Ta funeste valeur m'instruit par ta victoire:
EIle a vengé ton pére et soutenu ta gloire:
Méme soin mc regarde, et j ,al, pour m'affliger,
Ma gloire ä soutenir, et mon pére ä venger.
Hélas! ton interet ici mc désespére:
Si quelque autre malheur m'avait ravi mon pére,
Mon äme aurait trouvé dans le bien de te voir
L'unique allégement qu'elle eüt pu recevoir;
Et contre ma douleur j ,aurais senti des charmes
Quand une main si chére eüt essuyé mes larmes.
Mais il mc faut te perdre aprés 1'avoir perdu;
Cet effort sur ma flamme a' mon honneur est dü;
Et cet affreux devoir, dont 1'ordre m'assassine,
Me force ä travailler moi-méme á ta ruine.
Car enfin n'attends pas de mon affection
De läches sentiments pour ta punition.
De quoi qu'en ta faveur notre amour m'entretienne,
Ma générosité doit répondre á la tienne:
Tu t'es, en m'offensant' montré digne de moi;
Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi.
D. RODRIGUE: Ne différe donc plus cc que l'honneur t'ordonne:
Il demande ma tate, et je te l'abandonne;
Fais-en un sacrifice á cc noble intérét;
Le coup m'cn scra doux, aussi bien que l'arrét.
Attendre aprés mon crimc une lente justicc,
C'cst rcculcr ta gloirc autant quc mon supplice.
Je mourrai trop hcurcux, mourant d'un coup si beau.
CHIMÉNE: Va, je suis ta partie, et non pas ton bourreau.
Si tu m'offres ta tétc, est-cc á moi de la prendre.
#SE281-089
Je la dois attaquer, mais tu dois la défendre:
C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtcnir
Et je dois te poursulvre, et non pas te punir.
D. RODRIGUE: De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne.
Ta générosité doit répondre á la mienne;
Et, pour venger un pére, emprunter d'autres bras
Ma Chiméne, crois-moi, c'est n'y répondrc pas.
Ma main seule du mien a su venger l'offense,
Ta main seule du tien doit prendre la vengeance.
CHIMÉNE: Cruel! á quel propos sur cc point t'obstiner?
Tu t'es vengé sans aide, et tu m'en veux donner!
Je suivrai ton exemple, et j ,ai trop de courage
Pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage.
Mon pére et mon honneur ne veulent rien devoir
Aux traits de ton amour ni de ton désespoir.
D. RODRIGUE: Rigoureux point d'honneur! hélas! quoi que je fasse,
Ne pourrai-je á la fin obtenir cette gräce?
Au nom d'un pére mort, ou de notre amitié,
Punis-moi par vengeance, ou du moins par pitié.
Ton malheureux amant aura bien moins de peine
A mourir par ta main qu'á vivre avec ta haine.
CHIMÉNE: Va, je ne te hais point.
D. RODRIGUE: Tu le dois.
CHIMÉNE: Je ne puis.
Und nun noch einiges über - wenn ich mich so ausdrücken darf -die Prosadichtung. Da handelt es Sich darum, daß dasjenige, was wirklich in des Künstlers Seele dichterisch erlebt ist und sich doch nicht in den verschiedensten Kunstformen ausdrücken will, die man so gewöhnt ist auszuführen, nun in der Form der Prosa ausgesprochen wird, und man dennoch durch und durch dichterische Kunst so zum Ausdruck bringen kann. Nur wird das, was sich als Dichtung prosaisch in der Sprachbehandlung zum Ausdruck bringt, wiederum ganz besondere Anforderungen stellen. Man darf das schon sagen: Es wird
#SE281-090
vielleicht gerade das Rezitatorisch-Deklamatorische der Prosadichtung im weitesten Umkreise in unrichtiger Weise als das Leichteste angesehen. In Wirklichkeit ist die rezitatorisch-deklamatorische Darstellungsweise dieser Prosadichtung eigentlich das Schwierigste, denn es stellt eine intimste Kunstform dar. Alles das, was in der Sprach-behandlung zutage treten kann in Lyrik, Epik, Dramatik, was zutage treten kann an Feinerem, an Vertiefung und so weiter, muß, ich möchte sagen wie in einer großen Synthese zutage treten, wenn irgend etwas, was dichterisch ist und in Prosaform auftritt, im mündlichen Vor-trage dargestellt werden soll. Es muß gerade in einer solchen Rezitation in leiser Abtönung eigentlich alles dasjenige erklingen können, was in vcrsmäßig oder sonst geformtem dichterischem Kunstwerke auftritt.
Dadurch, daß immer nur angedeutet wird, was sonst mit starker Betonung, stärkeren Ecken, stärkeren Konturen in der Sprachbehandlung zutage tritt bei Rezitationen und Deklamationen, daß es in leiser Betonung zutage tritt, wird bei einer solchen Rezitation die Darstellung wesentlich durchseelt. Durchseelt!
Noch um einen guten Grad seelischer muß die wirklich künstlerisch rezitatorische Darstellung der Prosadichtung werden. Und dieses Durchsecltwcrdcn muß die Veranlassung sein, daß wir überall über das verstandesmäßige Ergreifen der in den Worten liegenden Vorstellungen hinauszugehen haben zu dem Bildhaften. So daß, sagen wir zum Beispiel, aus der energischen Wucht eine verstandesmäßige Schlußfolgerung übergeht in ein bildhaftcs Erleben, während zu gleicher Zeit leise die Oktave des Musikalischen hindurchklingt. Eine bildhafte Sprachbehandlung ist im Grunde genommen der fortfließende Strom mit seinen gleichmäßigen Wellen in der deklamatorischrezitatorischen Darstellung der Prosadichtung, und wie aus tiefen Untergründen heraus erheben sich andere Wellen, die in den gleichförmigen Fluß eine Abwechslung hineinbringen. Das ist das leise Musikalische, das gerade in dieser Rezitation zutage treten muß. Daher werden Intimitäten einer Sprache in einem höchsten Grade beim mündlichen Vortrage dichterisch durchempfundener prosaischer Stücke zutage treten. Und das Heraufheben eines scheinbar prosaischen
#SE281-091
Vortrages in ein Dichterisches, in ein Künstlerisches, in ein Poetischcs, ist zugleich ein Triumph, möchte ich sagen, den der Mensch seiner Sprache geben kann. Denn dasjenige, was man nennen kann Seele der Sprache, drückt sich im Grunde genommen in so etwas sehr adäquat aus.
Wir wollen nun den Versuch einer solchen Darstellung bringen, aus Novalis' «Die Lehrlinge zu Sais». In diesem ja unvollendet gebliebenen Roman findet sich ein wunderbares kleines Stück Prosa-dichtung, das geradezu überall zeigen kann, wie alles das hervor-gehoben werden kann, was ich versuchte für diese Prosadichtung, wenn sie rezitatorisch, deklamatorisch zur Darstellung kommt, eben anzudeuten. Das Wesentliche wird sein, daß alles, was sonst in der rezitatorischen Darstellung der Dichtung zutage tritt, gerade bei dieser Darstellung der Prosadichtung durch das Intimwerden in Stimmung umgegossen worden ist. Und alles, was zur Differenzierung in der Stimmung angewendet wird, ist nun wiederum durch das Ganze, durch das Totale der Stimmung wie übergossen davon. So etwas kann man schon versuchen bei solchem Meistcrstück einer Prosa-dichtung, wie es das Märchen in den « Lehrlingen zu Sais» des Novalis ist. Dieses wunderbare Märchen drückt wie so vieles, was uns von Novalis überliefert ist, die tiefe Seele des Novalis, ich möchte sagen in ihrer Gänze aus.
Der schöne Knabe Hyazinth liebt das Mädchen Rosenblüte. Es ist eine heimliche, verborgene Liebe. Nur die Blumen und die Tiere des Waldes wissen von dieser Liebe des schönen Knaben Hyazinth zu dem Mädchen Rosenblüte. Da erscheint ein Mann mit einem langen Bart, der einen wunderbaren Eindruck macht und Wundergeschichten erzählt, in denen der schöne Knabe Hyazinth ganz aufgeht. Er wird ergriffen von einer tiefen Sehnsucht nach der verschleierten Jungfrau, nach dem verschieierten Bild der Wahrheit. Und diese Sehnsucht durchbebt seine ganze Seele. Diese Sehnsucht weitet seine Seele, so daß er fremd wird dem, was seine unmittelbare Umgebung ist, daß er hinstrebt zu dem Bilde der verschleierten Jungfrau. Er verläßt Rosenblütchcn, die weinend zurückbleibt. Er kommt durch alle möglichen unbekannten Länder, er lernt vieles kennen auf seinem Wege.
#SE281-092
Er gelangt zuletzt zum Isis-Tempel. - Alle Dinge kommen ihm so bekannt und doch wieder so anders vor, als er sie früher erlebt hat. Sie kommen ihm viel, viel herrlicher vor. Und siehe da, er wagt es, den Schleier zu heben, - und Rosenblütchen stürzt in seine Arme.
Man kann kaum stimmungsvoller zur Darstellung bringen das Hinaustreten der Seele aus ihrer Subjektivität in die Weiten des Welten-alls. Man kann kaum intimer zur Darstellung bringen des Menschen Seelensehnsucht nach der Wahrheit, und man kann kaum enger knüpfen dasjenige, was der Mensch erleben kann bei dem Aufschwung in die höchsten Wahrheitssphären mit dem, was der Mensch wiederum als seine unmittelbarsten intimsten Tageserlebnisse durchmacht, wenn er nur eine genug intime Seele dazu hat. Solches, wie es in diesern Prosa-Märchen zum Ausdrucke kommt, und wie es nur eine Seele wie die des Novalis zutage fördert, jene Seele, die im Grunde genommen das Alltägliche so fühlte, daß es ihr zu gleicher Zeit ein unmittelbarer Ausdruck des unendlich Großen war, jene Seele des Novalis, die es in innerlicher Seelenwahrheit zuwege brachte, als ihr die erste geliebte Persönlichkeit hinweggestorben war, mit ihr so zu leben, daß ihm die Jenseitige wie eine Diesseitige war, daß er sie in unmittelbarer Gegenwart erlebte, - Novalis' Seele vermochte es, das Übersinnliche im Sinnlichen wahrhaftig zu erleben und das Sinnliche hinaufzuheben in dem Erleben zu dem Charakter des Übersinnlichen. Alles floß bei Novalis zusammen: das Wahrheitsstreben, das künstlerische Streben, die religiöse Inbrunst. Nur dann verstehen wir ihn, wenn wir dieses Zusammenfassende verstehen. Daher konnte in dieser Seele auch jene merkwürdige Empfindung entstehen, die uns heraustönt aus den «Lehrlingen zu Sais», und die etwa so sich aus Novalis' Seele heraus-ringt: Die Menschen haben empfunden, daß die Wahrheit in dem Isisbilde verschleiert ist. «Ich bin die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, meinen Schleier hat noch kein Sterblicher gehoben.» Das ist der Wahrspruch dieser verschleierten Isis, und Novalis empfindet ihn. Novalis empfindet gegenüber dem «meinen Schleier hat noch kein Sterblicher gehoben»: Nun, so müssen wir eben Unsterbliche werden! - Nicht verzweifelt Novalis' Gemüt daran, daß die Seele den Schleier der Wahrheit heben kann, aber diese Seele muß sich
#SE281-093
zunächst ihrer Unsterblichkeit in unmittelbarem Erleben bewußt werden. Der Mensch, der das Unsterbliche in sich erlebt, darf nach Novalis' Empfindung den Schleier der Isis heben. Es ist ein gewaltiges Wort: Nun, so müssen wir eben Unsterbliche werden!
Dasjenige, was in umfassender Art in dieser Empfindung lebt, tritt uns intim stimmungsvoll entgegen, wenn der schöne Knabe Hyazinth nach langer Traumwanderung durch unbekannte Gegenden, die ihm doch bekannt, aber nun viel herrlicher als das Bekannte erscheinen, zum Isistempel kommt, den Schleier hebt und dasjenige, was er kennt, was er liebt, ihm entgegentritt: Rosenblüte. Nur ist sie, wie wir uns vorstellen können und es stimmungsvoll in dem Prosamärchen empfinden, jetzt durch das Unendlichkeitserlebnis viel herrlicher geworden, als sie war.
Allerdings, eine Prosadichtung aus einer Stimmung heraus, wo sich das Höchste, zu dem sich der Mensch erheben kann, in das Intimste hinein gestaltet. Eine der schönsten Blüten auf dem Felde der Prosadichtung, ein voller Beweis dafür, daß in scheinbarer Prosa die reinste Dichtung sich aussprechen kann.
Aus «Die Lehrlinge zu Sais» von Novalis
DAS MÄRCHEN VON HYÄZINTH UND ROSENBLÜTE
Vor langen Zeiten lebte weit gegen Abend ein blutj unger Mensch. Er war sehr gut, aber auch über die Maßen wunderlich. Er grämte sich unaufhörlich um nichts und wieder nichts, ging immer still für sich hin, setzte sich einsam, wenn die andern spielten und fröhlich waren, und hing seltsamen Dingen nach. Höhlen und Wälder waren sein liebster Aufenthalt, und dann sprach er immerfort mit Tieren und Vögeln, mit Bäumen und Felsen, natürlich kein vernünftiges Wort, lauter närrisches Zeug zum Totlachen.
Er blieb aber immer mürrisch und ernsthaft, ungeachtet sich das Eichhörnchen, die Meerkatze, der Papagei und der Gimpel alle Mühe gaben, ihn zu zerstreuen und ihn auf den richtigen Weg zu weisen. Die Gans erzählte Märchen, der Bach klimperte eine Ballade dazwischen, ein großer dicker Stein machte lächerliche Bockssprünge, die Rose schlich sich freundlich hinter ihm herum, kroch durch seine Locken, und der Efeu streichelte ihm die sorgenvolle Stirn. - Allein der Mißmut und Ernst waren hartnäckig. Seine Eltern waren sehr
#SE281-094
betrübt, sie wußten nicht, was sie anfangen sollten. Er war gesund und aß, nie hatten sie ihn beleidigt, er war auch bis vor wenig Jahren fröhlich und lustig gewesen, wie keiner; bei allen Spielen voran, von allen Mädchen gern gesehn. Er war recht bildschön, sah aus wie gemalt, tanzte wie ein Schatz.
Unter den Mädchen war eine, ein köstliches, bildschönes Kind, sah aus wie Wachs, Haare wie goldne Seide, kirschrote Lippen, wie ein Püppchen gewachsen, brandrabenschwarze Augen. Wer sie sah, hätte mögen vergehn, so lieblich war sie.
Damals war Rosenblüte, so hieß sie, dem bildschönen Hyazinth, so hieß er, von Herzen gut, und er hatte sie lieb zum Sterben. Die andern Kinder wußten's nicht. Ein Veilchen hatte es ihnen zuerst gesagt, die Hauskätzchen hatten es wohl gemerkt, die Häuser ihrer Eltern lagen nahe beisammen. Wenn nun Hyazinth die Nacht an seinem Fenster stand und Rosenblüte an ihrem, und die Kätzchen auf den Mäusefang da vorbeiliefen, da sahen sie die beiden stehn und lachten und kicherten oft so laut, daß sie es hörten und böse wurden. Das Veilchen hatte es der Erdbeere im Vertrauen gesagt, die sagte es ihrer Freundin, der Stachelbeere, die ließ nun das Sticheln nicht, wenn Hyazinth gegangen kam; so erfuhr's denn bald der ganze Garten und der Wald, und wenn Hyazinth ausging, so rief's von allen Seiten: Rosenblütchen ist mein Schätzchen! Nun ärgerte sich Hyazinth und mußte doch auch wieder aus Herzensgrunde lachen, wenn das Eidechschen geschlüpft kam, sich auf einen warmen Stein setzte, mit dem Schwänzchen wedelte und sang:
Rosenblütchen, das gute Kind,
Ist geworden auf einmal blind,
Denkt, die Mutter sei Hyazinth,
Fällt ihm um den Hals geschwind;
Merkt sie aber das fremde Gesicht,
Denkt nur an, da erschrickt sie nicht,
Fährt, als merkte sie kein Wort,
Immer nur mit Küssen fort.
Ach! wie bald war die Herrlichkeit vorbei. Es kam ein Mann aus fremden Landen gegangen, der war erstaunlich weit gereist, hatte einen langen Bart, tiefe Augen, entsetzliche Augenbrauen, ein wunderliches Kleid mit vielen Falten und seltsame Figuren hineingewebt. Er setzte sich vor das Haus, das Hyazinths Eltern gehörte. Nun war Hyazinth sehr neugierig und setzte sich zu ihm und holte ihm Brot und Wein. Da tat er seinen weißen Bart voneinander und erzählte bis
#SE281-095
tief in die Nacht, und Hyazinth wich und wankte nicht und wurde auch nicht müde, zuzuhören. So viel man nachher vernahm, so hat er viel von fremden Ländern, unbekannten Gegenden, von erstaunlich wunderbaren Sachen erzählt und ist drei Tage dageblieben und mit Hyazinth in tiefe Schachten hinuntergekrochen. Rosenblütchen hat genug den alten Hexenmeister verwünscht, denn Hyazinth ist ganz versessen auf seine Gespräche gewesen und hat sich um nichts bekümmert; kaum daß er ein wenig Speise zu sich genommen. Endlich hat jener sich fortgemacht, doch dem Hyazinth ein Büchelchen dagelassen, das kein Mensch lesen konnte. Dieser hat ihm noch Früchte, Brot und Wein mitgegeben und ihn weit weg begleitet. Und dann. ist er tiefsinnig zurückgekommen und hat einen ganz neuen Lebenswandel begonnen. Rosenblütchen hat recht zum Erbarmen um ihn getan, denn von der Zeit an hat er sich wenig aus ihr gemacht und ist immer für sich geblieben.
Nun begab sich's, daß er einmal nach Hause kam, und war wie neu geboren. Er fiel seinen Eltern um den Hals und weinte. «Ich muß fort in fremde Lande», sagte er; «die alte wunderliche Frau im Walde hat mir erzählt, wie ich gesund werden müßte, das Buch hat sie ins Feuer geworfen, und hat mich getrieben, zu euch zu gehen, und euch um euren Segen zu bitten. Vielleicht komme ich bald, vielleicht nie wieder. Grüßt Rosenblütchen! Ich hätte sie gern gesprochen, ich weiß nicht, wie mir ist, es drängt mich fort; wenn ich an die alten Zeiten zurück denken will, so kommen gleich mächtigere Gedanken dazwischen, die Ruhe ist fort, Herz und Liebe mit, ich muß sie suchen gehn. Ich wollt' euch gern sagen, wohin, ich weiß selbst nicht: dahin, wo die Mutter der Dinge wohnt, die verschleierte Jungfrau. Nach der ist mein Gemüt entzündet. Lebt wohl!»
Er riß sich los und ging fort. Seine Eltern wehklagten und vergossen Tränen; Rosenblütchen blieb in ihrer Kammer und weinte bitterlich. Hyazinth lief nun, was er konnte, durch Täler und Wildnisse, über Berge und Ströme, dem geheimnisvollen Lande zu. Er fragte überall nach der heiligen Göttin, Menschen und Tiere, Felsen und Bäume. Manche lachten, manche schwiegen; nirgends erhielt er Bescheid. Im Anfange kam er durch rauhes, wildes Land; Nebel und Wolken warfen sich ihm in den Weg, es stürmte immerfort; dann fand er unabsehliche Sandwüsten, glühenden Staub, und wie er wandelte, so veränderte sich auch sein Gemüt, die Zeit wurde ihm lang, und die innre Unruhe legte sich, er wurde sanfter, und das gewaltige Treiben in ihm allgemach zu einem leisen, aber starken Zuge, in den sein ganzes Gemüt sich auflöste. Es lag wie viele Jahre
#SE281-096
hinter ihm. Nun wurde die Gegend auch wieder reicher und mannigfaltiger, die Luft lau und blau, der Weg ebener, grüne Büsche lockten ihn mit anmutigem Schatten, aber er verstand ihre Sprache nicht, sie schienen auch nicht zu sprechen, und doch erfüllten sie auch sein Herz mit grünen Farben und kühlem, stillem Wesen. Immer höher wuchs jene süße Sehnsucht in ihm, und immer breiter und saftiger wurden die Blätter, immer lauter und lustiger die Vögel und Tiere, balsamischer die Früchte, dunkler der Himmel, wärmer die Luft, und heißer seine Liebe; die Zeit ging immer schneller, als sähe sie sich nahe am Ziele.
Eines Tages begegnete er einem kristallnen Quell und einer Menge Blumen, die kamen in ein Tal herunter zwischen schwarzen himmel-hohen Säulen. Sie grüßten ihn freundlich mit bekannten Worten. «Liebe Landsleute», sagte er, «wo find' ich wohl den geheiligten Wohnsitz der Isis? Hier herum muß er sein, und ihr seid vielleicht hier bekannter, als ich.» «Wir gehn auch nur hier durch», antworteten die Blumen, «eine Geisterfamilie ist auf der Reise, und wir bereiten ihr Weg und Quartier; indes sind wir vor kurzem durch eine Gegend gekommen, da hörten wir ihren Namen nennen. Gehe nur aufwärts, wo wir herkommen, so wirst du schon mehr erfahren.» Die Blumen und die Quelle lächelten, wie sie das sagten, boten ihm einen frischen Trunk und gingen weiter. Hyazinth folgte ihrem Rat, frug und frug, und kam endlich zu jener längst gesuchten Wohnung, die unter Palmen und andern köstlichen Gewächsen versteckt lag. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht, und die süßeste Bangigkeit durchdrang ihn in dieser Behausung der ewigen Jahreszeiten. Unter himmlischen Wohlgedüften entschlummerte er, weil ihn nur der Traum in das Allerheiligste führen durfte.
Wunderlich führte ihn der Traum durch unendliche Gemächer voll seltsamer Sachen auf lauter reizenden Klängen und in abwechselnden Akkorden. Es dünkte ihm alles so bekannt, und doch in niegesehener Herrlichkeit; da schwand auch der letzte irdische Anflug, wie in Luft verzehrt, und er stand vor der himmlischen Jungfrau. Da hob er den leichten, glänzenden Schleier, und Rosenblütchen sank in seine Arme. Eine ferne Musik umgab die Geheimnisse des liebenden Wiedersehns, die Ergießungen der Sehnsucht, und schloß alles Fremde von diesem entzückenden Orte aus.
Hyazinth lebte nachher noch lange mit Rosenblütchen unter seinen frohen Eltern und Gespielen, und unzählige Enkel dankten der alten wunderlichen Frau für ihren Rat und ihr Feuer; denn damals bekamen die Menschen so viel Kinder, als sie wollten. -
#SE281-097
#TI
MARIE STEINER
AUS DEM SINNLICH-BEDEUTUNGSVOLLEN INS GEISTIG-BEWEGTE
Ein Hinweis
#TX
In den Vorträgen, die diesem Buche als Beigaben noch zuletzt eingefügt werden, findet sich manche wertvolle Ergänzung zu dem, was über die Kunst der Rezitation und Deklamation bereits ausgeführt worden ist. Es rundet das vorhin Gesagte zu einem Ganzen ab. Wenn auch manches wiederholt werden muß, weil über dasselbe Thema an verschiedenen Orten gesprochen wurde und die Grundlagen und die wesentlichen Punkte desselben Gegenstands gegeben wurden, so werden doch jedesmal neue Einblicke eröffnet, die ein tieferes Eindringen ermöglichen und in einem Werke nicht fehlen dürfen, das Grundlegendes zum Aufbau bringen will. Von einer neuen Seite wird immer wieder Licht in jenes Gebiet gegossen, dessen Rückeroberung uns nun möglich gemacht wird. Auch wenn einiges als bloße Wiederholung wirken sollte, würde doch diese Wiederholung vielleicht erst das volle Ergreifen des Gegenstands ermöglichen, da es sich hier um tiefergehende, nicht bloß intellektuelle Erkenntnisse handelt. Heute liest man leicht am Wesentlichen vorbei, weil man die Gewohnheit hat, nur mit dem Intellekt und möglichst schnell die Dinge zu erfassen. Wenn es sich um solche Erkenntnisse handelt, die den ganzen Menschen ergreifen, braucht man mehr Zeit als die heutige Gewohnheit des Hastens sie uns gibt. Durch Wiederholung aber prägt unbemerkt manches sich lebendiger und tiefer ein.
Wir bringen zunächst den Vortrag, den Rudolf Steiner im Juli 1921 in Darmstadt hielt auf Einladung des anthroposophischen Hochschul-Bundes. Dann denjenigen, der während des West-Ost-Kongresses in Wien im Juni 1922 gehalten wurde, trotzdem die Nachschrift jenes Vortrages leider recht viele Lücken aufweist. Einige der Texte, die zur Veranschaulichung des Gesagten schon früher gegeben waren, sind nun, um die Zahl der Beispiele reichlicher zu gestalten, durch
#SE281-098
andere ersetzt worden, die denselben Zweck erfüllen. Zum Schluß bringen wir den Vortrag, den Rudolf Steiner über dasselbe Thema während der künstlerisch-pädagogischen Tagung in Stuttgart zu Ostern 1923 hielt. Ihm war es ja besonders wichtig, die Kunst als grundlegende Kraft in die Erziehung einfließen zu lassen. Sah er doch darin die Rettung vor der allmählichen Ertötung des Seelisch-Geistigen im Menschen. Im Worte empfand er das unmittelbare Weben der göttlichen Schaffenskräfte selber. Für ihn hieß «künstlerisch schaffen:
rhythmisieren, harmonisieren, plastizieren dasjenige, was geistig ist in den seelisch-physischen Funktionen». Aus dem Sinnlich-Bedeutungsvollen ins Geistig-Bewegte - das ist der Weg, den uns Rudolf Steiner für die Kunst der Rezitation und Deklamation gewiesen hat.
FORMENEMPFINDUNG IN DICHTUNG UND REZITATION Eine ästhetische Betrachtung Darmstadt, 30. Juli 1921
#G281-1967-SE099 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
FORMENEMPFINDUNG
IN DICHTUNG UND REZITATION
Eine ästhetische Betrachtung
Darmstadt, 30. Juli 1921
#TX
Wenn wir uns heute gestatten, einiges vorzubringen aus der rezitatorischen Kunst heraus, so geschieht es aus dem Grunde, weil tatsächlich aus lebendigem Ergreifen anthroposophischer Weltanschauung auch für den Volimenschen, für den gesamten Menschen etwas folgt. Man ist ängstlich, wie ich schon an anderer Stelle erwähnt habe, gerade in Künstierkreisen und insbesondere bei Dichtern, Rezitatoren und so weiter, daß alles das, was an Ideen herantritt, was überhaupt die Gestalt des Wissenschaftlichen annimmt, eigentlich dem Künstlerischen fremd und sogar so gegenübergestellt sei, daß es das Elementare, das eigentlich Ursprüngliche, Lebendige, das Intuitiv-Instinktive unterdrücke. Man kann sagen, für jene Intellektualität, die im Lauf der letzten Jahrhunderte in der Menschheitsentwickelung herauf-gezogen ist, ist das durchaus der Fall. Aber diese Intellektualität ist auch verbunden mit einer Hinneigung zu dem, was in der äußeren, physischen Wirklichkeit gegeben ist. Unsere Sprachen selbst haben allmählich eine Gestalt angenommen, die man eine Hinneigung zum Materialismus nennen könnte. In den Worten und ihrer Bedeutung liegt etwas, was unmittelbar hinweist auf die äußere Sinneswelt. Daher wird dieses Intellektuelle, das nur Bild sein muß, das umso echter ist, je weniger es Leben und Wirklichkeit aus dem Innern des Menschen enthält, mit jener elementaren Lebendigkeit, die jedem Künstlerischen zugrunde liegen muß, ja wenig Gemeinsames haben können. Allein, gerade bei jener Erneuerung des geistigen Lebens, die angestrebt wird durch Anthroposophie, handelt es sich darum, das Intellektuelle wiederum hinunterzusenken in die elementarsten Kräfte des menschlichen Seelenlebens. Und da kommt das Künstlerische durchaus nicht in jener Blässe zum Ausdruck, in jener intellektuellen Abgetöntheit, die man so sehr fürchtet. Durch Anthroposophie wird die Phantasie nicht etwa abgeblaßt, nicht etwa hinuntergezogen ins
#SE281-100
Materiell-Logische, sondern gerade befruchtet. Sie wird gewissermaßen dadurch befruchtet, daß sie genährt wird von dem unmittelbaren Zusammenleben mit dem Geistigen. Daher darf erhofft werden, daß das Künstlerische gerade durch die Durchdringung mit dem Anthroposophischen, namentlich mit anthroposophischer Gesinnung, anthroposophischer Lebenshaltung und Seelenverfassung eine Förderung erlebt.
Das, was im allgemeinen für das Künstlerische gelten muß, soll heute gezeigt werden mit Bezug auf das Rezitatorisch-Deklamatorische. Dieses Rezitatorisch-Deklamatorische ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr eingelaufen in eine besondere Vorliebe für die Gestaltung desjenigen, was in den Worten an Bedeutung enthalten ist. Das Pointieren des wortwörtlichen Inhalts ist das, was immer mehr und mehr in den Vordergrund getreten ist. Wenig Verständnis wird unsere Zeit entgegenbringen einer solchen Behandlung, wie sie Goethe eigen war, der wie ein Musikdirigent mit dem Taktstock dagestanden hat und selbst seine Dramen auf die Gestaltung der Sprache hin mit seinen Schauspielern einstudiert hat. Dieses Gestaltende der Sprache, dieses Formhafte, das hinter dem wortwörtlichen Inhalt liegt, ist es, was im Grunde genommen den wirklichen Dichter als Künstler allein begeistern kann. Es muß immer wieder hervorgehoben werden, daß Schiller, wenn er daran ging, irgendeine Dichtung zu schaffen aus innerem Drang, eine unbestimmte Melodie, etwas Melodiöses könnte man sagen, zunächst als Seeleninhalt hatte. Ein musikalisches Element schwebte durch seine Seele, und dann kam der wortwörtliche Inhalt, der gewissermaßen nur bestimmt war, das aufzunehmen, was dem wahren Dichter als Künstler die Hauptsache war: das musikalische Element der Seele. Das ist es ganz besonders: auf der einen Seite dieses musikalische Element, das aber natürlich, wenn es dabei bliebe, bloße Musik wäre, und das, was das Malerische ist auf der andern Seite, zu dem wir zurückkehren müssen in der deklamatorisch-rezitatorischen Kunst. Um etwas zu sagen seinem prosaischen Inhalte nach, dazu ist das eigentlich Dichterische nicht da. Um den prosaischen Inhalt zu gestalten, um ihn umzugießen in Takt, Rhythmus, in melodiöse Thematik, in das, was erst hinter dem prosaischen Inhalte liegt,
#SE281-101
dazu ist eigentlich die Dichtung als Kunst da. Wir würden wohl weniger mit allerlei Dichtungen «gesegnet» sein, wenn wir nicht in dem unkünstierischen Zeitalter der Gegenwart lebten, in dem weder in der Malerei zum Beispiel, noch in der Plastik, noch auch in der Dichtung und ihrer rezitatorisch-deklamatorischen Wiedergabe dieses eigentlich künstlerische Element gesehen würde.
Wenn man auf das eigentliche Ausdrucksmittel der Dichtung sieht, das dann hier ein Ausdrucksmittel des Rezitatorisch-Deklamatorischen ist, ist man natürlich auf die Sprache verwiesen. Die Sprache trägt in sich ein Gedankenelement und ein Willenselement. Das Gedanken-element neigt zu dem Prosaischen hin. Es wird der Ausdruck der Überzeugung. Es wird der Ausdruck desjenigen, was das konventionelle Zusammenleben oder das soziale Zusammenleben mit anderen Menschen fordert. Gerade indem die Kultur fortschreitet, und immer mehr und mehr der Ausdruck der Überzeugung, der Ausdruck des Konventionell-Sozialen in die Sprache eindringen muß im Fortschritt der Kultur, desto unpoetischer, unkünstlerischer wird die Sprache. Und der Dichter muß erst wiederum mit der Sprache kämpfen, um sie in künstlerische Gestaltung umausetzen, in dasjenige, was Sprach-gestaltung selber ist.
Die Sprache - ich habe das im Verlaufe meines anthroposophischen Schrifttums hervorgehoben - hat in sich einen vokalischen Charakter, der im wesentlichen erlebt wird vom Menschen durch sein Inneres. Das, was wir an der Außenwelt erfahren und innerlich erleben, kommt im Vokalischen zum Ausdruck. Das, was wir in gewisser Weise objektiv abbilden von Vorgängen, von Wesensgestaltungen der Außenwelt, kommt in dem Konsonantischen der Sprache zum Ausdruck. Dieses Vokalische und Konsonantische der Sprache ist natürlich in den verschiedenen Sprachen in der verschiedensten Weise vorhanden, und gerade an der Art und Weise, wie Sprachen vokalisieren oder konsonantieren, zeigt sich, inwiefern sie selber als Sprachen mehr oder weniger künstlerisch sich entwickeln. Es gewinnen heute einige Sprachen durch den Verlauf ihrer Entwickelung allmählich einen unkünstlerischen Charakter, verfallen in eine unkünstlerische Dekadenz. Und wenn nun der Dichter daran geht, die Sprache zu gestalten, so handelt
#SE281-102
es sich darum für ihn, daß er auf einer höherer Stufe diesen Sprachentstehungsprozeß selber wiederholt, daß er in der Gestaltung seiner Verse, in der Behandlung des Reimes, in der Behandlung der Alliteration - wir werden von alledem Proben hören und dann darüber zu sprechen haben - etwas trifft, was verwandt ist diesem Sprachentste-hungsprozeß. Der Dichter wird durch sein intuitiv-instinktives Vermögen gedrängt, da wo es sich darum handelt, das Innere zum Ausdruck zu bringen, zum Vokalisieren zu greifen; man wird eine Häufung der Vokale haben. Und wenn der Dichter das Äußere zu gestalten hat, wird er greifen zum Konsonantieren. Man wird eine Häufung des einen oder anderen Elementes haben, je nachdem das Innere oder das Äußere zum Ausdruck gebracht werden soll. Dem muß der Rezitator und Deklamator nachgehen, denn dadurch wird er jenen Rhythmus von Innerlichkeit und Äußerlichkeit wiederum nacherschaffen können. Auf diese Sprachgestaltung, auf das Herausheben dessen, was so in dem künstlerischen Behandeln der Sprache liegt, wird es vorzugsweise ankommen bei der Neugestaltung der rezitatorisch-deklamatorischer Kunst.
Wir wollen nun damit beginnen, daß wir zunächst einige Kleinigkeiten vorführen, an denen sich wird besprechen lassen, wie das Rezitatorisch-Deklamatorische der Sprachbehandlung nachzugehen hat.
Ein Sonett von Goethe
MÄCHTIGES ÜBERRASCHEN
Ein Strom entrauscht umwölktem Felsensaale,
Dem Ozean sich eilig zu verbinden:
Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen,
Er wandelt unaufhaltsam fort zu Tale.
Dämonisch aber stürzt mit einem Male -
Ihr folgten Berg und Wald in Wirbelwinden -
Sich Oreas, Behagen dort zu finden,
Und hemmt den Lauf, begrenzt die weite Schale.
#SE281-103
Die Welle sprüht und staunt zurück und weichet
Und schwillt bergan, sich immer selbst zu trinken:
Gehemmt ist nun zum Vater hin das Streben.
Sie schwankt und ruht, zum See zurückgedeichet;
Gestirne, spiegelnd sich, beschaun das Blinken
Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.
Ein Ritornell von Christian Morgenstern
Das Tier, die Pflanze, diese Wesen hatten
noch die un-menschliche Geduld der Erde;
da war ein Jahr, was heut nur noch Sekunde.
Jetzt geht ihr nichts mehr rasch genug von statten.
Der Mensch begann sein ungeduldig Werde.
Sie spürt: «Jetzt endlich kam die große Stunde:
auf die ich mich gezüchtet Jahrmillionen!
Jetzt brauch ich meinen Leib nicht mehr zu schonen,
jetzt häng ich bald als Geist an Gottes Munde.»
In Form eines Rondo gedichtet von Rudolf Steiner
WELTENSEELENGEISTER
Im Lichte wir schalten,
Im Schauen wir walten,
Im Sinnen wir weben.
Aus Herzen wir heben
Das Geistesringen
Durch Seelenschwingen.
Dem Menschen wir singen
Das Göttererleben
Im Weltengestalten.
#SE281-104
Es wird jetzt eine Szene, das siebente Bild, zum Vortrag kommen, welche entnommen ist dem ersten meiner Mysterien-Dramen, «Die Pforte der Einweihung».
Man hat es da zu tun mit einer Darstellung desjenigen, was der Mensch im Zusammenhang mit der geistigen Welt erlebt. Man wird sehr leicht versucht sein, gerade eine solche Sache so zu betrachten, als wäre sie aus dem Intellekt heraus geschaffen und als wollte man irgendwie eine symbolische Kunst treiben, die eigentlich in Wirklichkeit eben keine Kunst ist. Das, was hier zum Vortrag kommen wird, ist aber durchaus, trotzdem es sich handelt um geistig-seelische Vorgänge, in Gestaltung geschaut. Bis auf den Wortklang herunter stand, wenn ich so sagen darf, alles da, so daß nichts irgendwie kombiniert oder zusammengestellt oder auf symbolische Art ausgestaltet werden mußte: es stand da. Und es ist versucht worden, dasjenige, was der Mensch in mannigfaltiger Weise im Verhältnis zur Geistwelt erlebt, einfach durch das Element des Gestaltens von Seelenkräften, was sich aber ganz elementar ergibt, ohne irgendwie aus einer intellektualistischen Tätigkeit heraus zu gestalten, was durch die verschiedenen Seelenkräfte der Mensch innerlich erleben kann, auch wirklich zur Gestaltung zu bringen. Da man es hier zu tun hat mit einem reinen geistigen Inhalt, so wird es besonders wichtig sein darauf zu achten, wie es nicht um Mitteilung des Prosaischen dieses wortwörtlichen Inhaltes zu tun ist, sondern wie es darum zu tun ist, die geistigen Inhalte selbst zu gestalten. Man wird auf der einen Seite das musikalische Element bemerken, selbst da wo man vermeinen könnte, daß der Inhalt gedanklich wird, und man wird auf der andern Seite bemerken das malerische Element, das namentlich dann herauszutreten hat, wenn man irgend etwas, was Vorgang ist, gestaltet.
Die Szene ist abgedruckt auf S.13 ff.
Wenn es sich um ein Sonett handelt, so ist es durchaus gegeben, daß das Sonett nicht aus dem Vorsatz entsteht, ein Sonett zu dichten, sondern daß sich das Sonett aus den inneren Erlebnissen mit Notwendigkeit herausgestaltet. Das Sonett neigt offenbar zunächst zum Bildnerischen, zum Malerischen, das in der Sprache lebt. Darum handelt
#SE281-105
es sich, daß man irgendein Erlebnis hat, das in irgendeiner Weise zweigliedrig ist. Ein solches Erlebnis stellt sich ein. Man will es so gestalten, wie es in den zwei ersten Strophen zum Vorschein kommt. Dadurch ist man hineingedrängt in eine Diskrepanz des inneren Erlebens. Die zweite Strophe stellt sich sozusagen wie eine Gegenwelle der ersten Welle gegenüber. Man fühlt die Diskrepanzen, die im Weltenall walten, in den zwei Endstrophen. Das menschliche Herz, der menschliche Sinn trachtet nach einem Einklang, einem Harmonie-verhältnis. Er trachtet danach und er will das, was an Disharmonischem zum Ausdruck kommt, in Harmonie ausklingen lassen, will durch das Geistige der Harmonie die materielle Disharmonie besiegen. Das kommt bis in die Reimgestaltungen der zwei ersten und zusammenfassenden Reime der zwei letzten Strophen zum Ausdruck. Soweit nicht vorliegt solch eine Notwendigkeit inneren Erlebens, kann nicht ein Sonett entstehen, das bis in die Reimgestaltung hinein bildhaft sich offenbaren muß. Nun drängt sich hinein in sein Bildhaftes das musikalische Element. Das musikalische Element, das vorzugsweise auf der Vokalisierung und demjenigen beruht, was von dem Konsonanten aus in das Vokalisieren hineingeht. Denn jeder Konsonant hat wiederum sein Vokalelement. Das gibt gewissermaßen den musikalischen Stoff zu dem Bilde her, das zunächst im Sonett vorliegt. Dasjenige also, was im Sonett, das Sonett gestaltend, vorliegt, ist metrisch. Dieses Metrische kommt bei der Sprachkunst vorzugsweise durch das rezitatorische Element zum Ausdruck, das die Griechen wohl bis zu einer höchsten Höhe gebracht haben. Die Griechen lebten im Metrum, das heißt im plastischen Element der Sprache. Wenn wir dagegen heraufkommen sehen das, was mehr aus nordischem oder mitteleuropäischem, germanischem Elemente herausgeboren ist, so sehen wir, wie sich hineingliedert in dieses plastische Element der Sprache ein Musikalisches von innen heraus, ein solches, das mehr aus dem Willen heraus fließt, mehr aus der Persönlichkeit heraus fließt, während bei den Griechen alles aus dem Metrum der Anschaulichkeit heraus fließt. Während beim Griechen vorzugsweise die Rezitationskunst zu einer gewissen Höhe kommen konnte, mußte im germanischen Element die deklamatorische Kunst, das heißt das Herausarbeiten
#SE281-106
aus dem musikalischen Element zur Betätigung kommen, dasjenige, was im musikalischen Thema in Rhythmus, in Takt einfließt. Währenddem man es bei der Rezitation mehr zu tun hat mit dem, was in der Sprache bei dem einen Laut die Breite gibt, den anderen Laut spitz macht, was gestaltet in bildhafter Weise, hat man es bei dem musikalischen Element zu tun mit dem, was der Sprache einen melodiösen Charakter verleiht. Das kann man gerade bei so etwas wie bei dem Sonett sehen, was da in der Behandlung von den verschiedenen Gegenden Europas zutage tritt, wie das deklamatorische Element sich mit dem rezitatorischen Element, wie das Germanische in der späteren Zeit sich mit dem griechischen Maßelement verband. So kommt es darauf an, daß man diese Sprachgestaltung sowohl nach der musikalischen wie nach der plastischen Seite hin wieder trifft, daß man wiederum das, was eigentlich aus dem Sinnlich-Bedeutungsvollen zu dem Geistig-Bewegten führt, in die Deklamation und Rezitation einführen lernt. Dazu ist notwendig, daß man wiederum solche Formen wie Ritornelle oder Rondos und so weiter als solche empfindet. Das macht wahrhaftig die Dichtkunst nicht gedankenarm, denn es drückt nur den Gedanken nicht aus durch ein abstraktes Element, sondern durch sein schaffendes, produktives Element. Auf den Wellen des Sprachlichen selbst, in der reinen Gestaltung des Rezitatorischen, in den hohen und tiefen Tönen des Deklamatorischen, in der melodiösen Gestaltung des Deklamatorischen muß sich die Sprachkunst wiederum beleben, um nachzugehen den Formen, die auf diese Weise geschaffen werden. Ist man dann genötigt, irgend etwas ins Dramatische hinüberzuführen, wie Sie bei der zuletzt vorgetragenen Szene sehen, wo man es zu tun hat mit rein geistigen Erlebnissen, so handelt es sich darum, daß man vollständig überwindet das, was Sprachbedeutung, Wortbedeutung ist, daß man das, was in den Worten liegen soll, wenn man das, was zum Ausdruck kommt, prosaisch ausdrücken sollte, vollständig umwandelt in die Sprachgestaltung selbst. So daß man genau dasselbe Erlebnis hat in der unmittelbaren Darstellung, wie man es hat, wenn man übergeht bei der Prosa von dem Verstehen des Prosaischen zu dem Anschauen dessen, was das Prosaische darstellt. Der Genuß des Prosaischen ist
#SE281-107
etwas Mittelbares. Man muß zunächst verstehen, und durch das Verstehen wird man zum Anschauen geführt. Das führt von vornherein in ein Unkünstlerisches hinein, denn das Künstlerische liegt im Unmittelbaren. Das Künstlerische in der Sprachgestaltung muß unmittelbar zum Ausdruck kommen. Es muß das, was sich darstellt, sich offenbaren, muß selber gestaltet sein, nicht dasjenige, was Abbild ist. Heute sehen wir vielfach, wie das, was Abbild ist, von sogenannten Dichtern zur Gestaltung gebracht werden soll und nicht dasjenige, was sich unmittelbar anschaulich offenbart in der Sprachgestaltung selbst. Wenn Goethe so wunderbar ausdrückt, was sich ihm als Erlebnis gab bei der Ruhe, die der Schiafesruhe für ihn voranging, und dieses dann zum Ausdruck brachte in den Zeilen:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh;
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch -
es ist ein so vollständig harmonischer Zusammenklang das, was da empfunden wird in den Gipfeln, in den Wipfeln und im eigenen Herzen, daß dieser Zusammenklang, namentlich wenn man das Gedicht hört, in den Tönen, der Wortgestaltung selber liegt, daß einem in der Wortgestaltung, in der Sprachgestaltung das wieder ertönt, was man an der Außenwelt erlebt. Alles Erlebnis der Außenwelt ist in die Sprachgestaltung selber eingeflossen. Das wäre das Ideal einer wirklichen Dichtung, daß zur Darstellung gebracht werden kann in der Sprachbehandlung das, was in den äußeren Erlebnissen gegeben ist. Die Wiederholung des äußeren Erlebnisses, einfach der Versuch, in der Sprache zum Ausdruck zu bringen das äußere Erlebnis, ist keine dichterische Kunst. Dichterische Kunst tritt erst ein, wenn aus der lebendigen Menschenseele in der Sprachbehandlung selbst das sich wieder offenbart, was in der Außenwelt erlebt wird.
Bei einem wirklich künstlerischen Dichter, wie bei Goethe, kann
#SE281-108
man das sehen, wenn er genötigt ist, aus anderer Stimmung und Empfindung heraus dasselbe prosaisch wiederzugeben. Goethe hat in den ersten Zeiten seines Weimarer Aufenthaltes aus derjenigen Stimmung heraus, die ihm überkommen war aus dem Einleben, sagen wir in die Gotik, in die Spitzbogenstrebewerk-Stimmung, wie er sie besonders tief empfunden hat im Genuß des Straßburger Domes, er hat daraus sich eine Stimmung gebildet, so daß diese Stimmung, wenn er gestaltete dichterisch, in ihm selber etwas wurde wie innere Deklamation. Es gestaltete sich ihm der Gedanke, die Empfindung so, daß unmittelbar das in der Sprachgestaltung erlebt werden kann, was im Anblick des gotischen Domes erlebt werden kann. Man sieht das nach oben Unvollendete im gotischen Dom, das nach oben Strebende. Das wurde Goethes Stimmung, als er zuerst konzipierte in Weimar seine «Iphigenie». Als er dann, aus einer tiefen Sehnsucht getrieben nach Vollendung seiner künstlerischen Stimmung, seine Reise nach dem Süden antrat und durchinachte, überkam ihn die andere Stimmung, die Stimmung nach dem Metrischen, dem Maße. Er empfand gegenüber dem, was sich ihm als italienische Kunst darbot, einen Nachklang der griechischen Kunst. Er schreibt seinen Weimarer Freunden: Ich habe die Vermutung, daß die Griechen nach derselben Gesetzmäßigkeit verfahren sind bei Schaffting ihrer Kunstwerke, nach denen die Natur selber verfährt. - Im Anblick der «Heiligen Cäcilie», an den Raffaelschen Kunstwerken ging ihm das Metrische auf, das zur inneren Rezitation wurde, und er empfand es nicht mehr als persönliche Wahrheit, wie er seine «Iphigenie» in der ersten Konzeption gestaltet hatte. Er goß sie um, und wir haben nun die nordische und die südliche «Iphigenie». Die «nordische Iphigenie», die nun, wenn sie behandelt werden soll, mit deklamatorischer Kunst behandelt werden muß, in welcher vorzugsweise walten muß das vokalisierende Element, das Element, welches im Tönen gestaltet. Wir haben die «römische Iphigenie», in welcher die rezitatorische Kunst zur vollen Geltung kommen muß, in welcher das plastisch Gestaltende hervortreten muß, das, was ähnliche Erlebnisse in der Sprachbehandlung darbietet, wie Raffaels Kunstwerke darbieten. Wir haben gerade, wenn wir aneinanderhalten diese zwei Iphigenien, - wir werden es
#SE281-109
hier in kleinen Proben nunmehr tun - das vor uns, was im Dichter vorgeht, wenn er nun wirklich in der künstlerischen Form lebt und aus innerer Notwendigkeit heraus seine künstlerischen Formen nachschaffen muß. Und diesem Dichterischen muß das Rezitatorische, das Deklamatorische nachstreben.
Wir werden daher zuerst die «gotisch-germanische Iphigenie», so wie sie sich in Goethe zunächst ausgebildet hat, die «Iphigenie» also in ihrer Weimarer Gestalt zum Vortrag bringen.
Die Szene ist abgedruckt auf S.20.
In diese Verse wollte nun Goethe das bringen, was im Grunde genommen im Norden ein fremder Stoff ist. Durch die Verse selbst ist es unmittelbar herausgewachsen aus der ganzen Stimmung, die in Goethe lebte, und die ich vorhin geschildert habe. Man kann nun durchaus sagen, daß derjenige, der nicht auf das eigentlich Künstlerische eingeht, gar nicht die tiefe Empfindung haben wird für die Nötigung, die Goethe empfand, seinen Lieblingsstoff, die «Iphigenie», in Italien vollständig umzuschmieden, in jenem Lande, wo er nicht nur stand unter dem Eindruck der griechischen Kunstwerke, wie er sie anschaute, sondern wo die Sonne in einer anderen Weise wirkt, in dem Lande, wo sich das Firmament in einer anderen Farbe über uns wölbt, wo die Pflanzen in einer anderen Art aus der Erde heraus-streben. Alles wirkte in Goethe so zusammen, daß wir verfolgen können, wie er bei jeder Zeile immer wieder und wiederum genötigt ist, den Stift anzusetzen, und seiner ganz anderen Stimmung nunmehr diesen Iphigenie-Stoff anzupassen. Es hat eigentlich erst Herman Grimm, der für solche Sachen eine feine Empfindung hatte, in seinen Vorträgen über Goethe diesen radikalen Unterschied zwischen der deutschen und der römischen «Iphigenie» bei Goethe hervorgehoben. Er hat gezeigt, wie tatsächlich umgestaltet ist das, was vorher sozusagen nach der Tiefendimension lebte, indem man versucht ist, die Töne, die Laute vor allen Dingen zu voll oder zu hell oder zu dumpf zu machen, um das zum Ausdruck zu bringen in geistiger Weise, was im Prosaischen, im Wortwörtlichen enthalten ist, hat gezeigt, wie Goethe das umgestaltet zu dem, was, wenn ich so sagen darf, nunmehr
#SE281-110
in der Fläche, im Metrischen lebt, wie er jene Symmetrie, die er in der griechischen Kunst zu erkennen glaubte, hineinzubringen versucht in seine «Iphig enie».
Und so ist es nötig, wenn man versuchen will zu charakterisieren, was Goethe erlebte durch das sprachkünstierische Element, aus dem Deklamatorischen heraus zu arbeiten beim Vortrage der «römischen Iphigenie» in das Rezitatorische hinein, das, wie schon gesagt wurde, die Griechen zur höchsten Blüte gebracht haben.
Die Szene ist abgedruckt auf S.21/22.
Vielleicht findet man das, was bei einem solchen Künstler, wie Goethe es war, gerade in die Form fließt, nur, wenn man in voller Intensität die Tatsache ermessen kann, daß, wenn Goethe selber seine «Iphigenie» zum Vortrag brachte, ihm stets die hellen Tränen von den Augen herunterrollten. Goethe fand sich also hinein aus dem mehr dionysischen Element, um mit einem Nietzsche-Ausdruck zu sprechen, in das apollinische Element, in das metrisch gestaltende Element. Dadurch, daß die Griechen den Willen heraufbrachten im Seelenleben bis zu diesem metrischen Gestalten, brachten sie es dahin, gerade im apollinischen Element das zu erreichen, was dann Nietzsche so fühlte, daß wirklich in diesem Element die Kunst über die äußere sinnliche Wirklichkeit erhoben wurde, und die griechische Kunst das werden konnte, was hinweghebt über den Pessimismus, der gegenüber der Tragik der unmittelbaren physisch-sinnlichen Wirklichkeit vom Menschen erlebt werden muß. Dasjenige, was da, trotzdem es maßvoll wird, trotzdem es apollinisch wird, als ein inneres Menschlichstes waltet, das war es, was Goethe ganz besonders anzog, als er sich einmal in dieses Element versetzt hatte, und was ihn dann dazu brachte, den Versuch zu machen, in dem metrischen Element der Griechen, in diesem innerlich Rezitatorisch-Deklamatorischen, nicht mehr bloß Deklamatorischen, einiges künstlerisch zu schaffen.
Wir wollen nun aus Goethes «Achilleis» eine Probe von demjenigen geben, was Goethe nunmehr als künstlerische Form empfand, nachdem er sich tief hineinversenkt hatte in das Metrische, das innerlich Rezitatorische des griechischen Kunstschaffens.
Der erste Gesang ist abgedruckt auf 5.43 ff.
#SE281-111
Goethe suchte sich zurückzufinden mit solchen Dichtungen zum Griechentum. Da glaubte er, so wie er nun einmal in einem gewissen Zeitabschnitt seines Lebens empfand, näher zu sein dem Urquell des Künstlerisch-Dichterischen, als er es hätte in der modernen Zeit -ohne dieses Zurückgehen zu den Griechen - sein können. Man muß da auf das schauen, was sozusagen in Goethe instinktiv künstlerisch lebte, indem er das griechische Metrum suchte, indem er das suchte, was der Grieche plastisch gestaltete im innerlich Rezitatorischen. So wie im anderen Künstlerischen, so suchte man da, wo die Quelle des Künstlerischen noch reichlicher floß, in der ursprünglichen Menschheit, im Menschen selber, im innersten Erleben des Menschen, das sich im materialistischen Zeitalter mit einer dichten Schichte bedeckt hat, so versuchte man zu erleben das eigentliche auch dichterisch Künstlerische. Wir sehen hinffießen im Griechischen maßvoll den Hexameter, wir sehen, wie sich gestalten aus dem Griechischen diese Daktylen. Was haben wir in einem solchen Metrum eigentlich? Wir müssen uns heute, ich möchte sagen, mehr theoretisch erinnern, wie da im Menschen lebte ein innerlich nach einem gewissen Rhythmus und Zusammenklang von Rhythmen Strebendes.
Nehmen wir auf der einen Seite den Atmungsrhythmus: achtzehn Atemzüge in der Minute ungefähr im normalen mittleren Menschenalter; zweiundsiebzig Pulsschiäge, der Blutrhythmus, in demselben Zeitraum. Wir haben das Zusammenschiagen von vier Pulsschlägen mit dem einen Atemzug. Das ist ein innerliches Harmonisieren der Rhythmen in der menschiichen Natur. Stellen wir uns vor die vier Pulsschläge, die in einem Atemzug verlaufen, nehmen wir ihr Verhältnis, ihren Zusammenklang mit dem Atem selber. Fassen wir zusammen die zwei ersten Pulsschläge in der langen Silbe, die zwei letzten Puls schläge lassen wir in den kurzen Silben: wir haben den dem Hexameter zugrunde liegenden Vers. Und wir haben wiederum den Hexameter selbst gebildet, wenn wir das Zusammenschlagen der Vier mit der Eins ins Auge fassen. Die ersten drei Versfüße mit der Zäsur als den vierten: das Verhältnis zu dem einen Atemzug. Wir haben im Menschen selber dasjenige, was sich da gestaltet. Wir schaffen aus dem Menschen heraus dasjenige, was wir nun der Sprache, die der Ausdruck
#SE281-112
des menschlichen Rhythmus ist, einverleiben. Selbstverständlich kann nun kämpfen der Vierklang des Blutrhythmus mit dem Einklang des Atmungsrhythmus; sie können auseinandergehen und wiederum zusammensein, ihre Harmonisierung erstreben. Sie können nach der einen oder andern Seite auseinandergehen und zuletzt wieder zusammenfließen wollen. Da kommen die verschiedenen Versfußgestaltungen heraus, auch die Verszeilengestaltungen. Aber es ist das alles ein in die Sprache Übergießen desjenigen, was im Menschen selber lebt. Und der Mensch lebt sich dar, indem er das griechische Metrum gestaltet. Es ist das, was aus dem Intimsten der Organisation des Menschen auf die Lippen tritt und sich in der Sprache gestalten will. Das ist das Geheimnis, daß der Grieche strebte nach einem sprachlichen Ausdruck desjenigen, was in den intimsten Organen des Menschen, im rhythmischen Menschen lebt.
Goethe empfand das. Und es ist das gedankliche Element hier, nach dem der Grieche hinstrebte, gerade weil er Grieche war - man soll das nicht verkennen -, das er aber überfirte aus dem bloß abstrakt-gedanklichen Element heraus bis zur unmittelbaren Gestaltung durch das Gedankliche, das Bild, wie es im Menschen wirkt. Denn das, was da im Menschen vorgeht durch das Zusammenschiagen des Blut- und Atmungsrhythmus, das, wenn es sich nach dem Gehirn fortpflanzt, dort anschlägt, setzt sich in das Inhaltliche des Gedankens um, in dem es nur noch verblaßt zu erkennen ist in der Prosa. Es ist das gedankliche Element, aber entkleidet dessen, was der Grieche in das Rezitatorische hineingeheimnißt hat. Und das ist das Folgende:
Wenn der Grieche sprach von dem Ertönen der Leier des Apollo, so sprach er von dem Kunstwerk, das der Mensch selbst ist, das er ist als rhythmischer Mensch im Zusammenklang von Atmungs- und Blutzirkulationsrhythmus. Darin liegen ausgesprochen unendliche Weltgeheimnisse, die mehr besagen, als alle Prosasprache besagen kann. Da hinein tönte das Willenselement.
Das treffen wir als das Deklamatorische, wenn wir uns nun zurück zum Norden wenden. Die nordische Sprache, die nordische Sprach-ges taltung ist so tendiert, daß sie dieses Willenselement in den Vordergrund stellen muß. Im griechischen Rhythmus lebt vorzugsweise das
#SE281-113
Atmungselement, das dem Gedankenelement näher ist als das Blutzirkulationselement. Dasjenige aber, was im Blutzirkulationselement erlebt wird, was mit Recht der alte Geistesforscher als den unmittelbaren Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit, des menschlichen Ich angesehen hat, lebt gerade in der nordischen Sprachbehandlung. Da sehen wir einfallen den Blutrhythmus und sehen zurücktreten den Atmungsrhythmus. Wir sehen aber, wie wiederum der Blutrhythmus mit der Beweglichkeit des ganzen Menschen zusammenhängt. Und wir blicken zurück, wie der nordische Mensch, wenn er sein Nibelungenlied empfand, den Wellenschlag des Blutes empfand, der mit dem kräftigen Willensschlag einsetzt und dann abklingt in dem gedanklichen Element, was dann übergeht in die Alliteration, wo einsetzt der Willensimpuls wie die Welle, die abwellt, um zunächst anzuschiagen die Gestalt, und die dann abfließt, um in das Ruhige, Maßvolle überzugehen. Das aber empfand man als das den ganzen Menschen Konstituierende. Während der Grieche nach innen dringen wollte, nach dem Atmungsrhythmus, ging das, was nordisches Element ist, nach dem tiefsten Persönlichen, nach dem, was im Blutrhythmus lebt. Nordisch-germanische Dichtung ist vergeistigtes Menschenblut. Da lebt der Wille. Und dieser Wille, er gestaltet sich so, wie man sich die Willenswirksamkeit des Wotan vorstellen mußte, wenn er auf den Wellen der Luft hin sich bewegte, wie das Blut, indem es die Persönlichkeit formt, durch den Menschen wellt.
So sehen wir zum Ausdruck kommen in derjenigen Dichtung, die aus dem ursprünglichen Willenselement, aus der ganzen Vollmenschlichkeit im Nordisch-Germanischen zum Ausdruck kommt, wir sehen es wellen und wogen im Nibelungenlied. Und wir sehen selbst noch in der neuesten Zeit, als Wilhelm Jordan nachzuahmen versuchte in der Alliteration das, was in dieser nordischen Deklamation lebte, wie da der Versuch gemacht wird, das, was ich geschildert habe, durch die Dichtung hindurch in der Sprachgestaltung lebendig zu machen. Man darf daher dasjenige, was in Jordans Nibelungenlied lebt, nicht so deklamieren, daß man bloß das Prosaische betont, pointieren möchte; man muß jenen Wellengang, der nun auch entnommen ist dem menschlichen Innern, jene Wotan-Wellen, möchte ich sagen, hörbar
#SE281-114
machen durch die Welt, wenn die Alliterationen Wilhelm Jordans er-klingen. So sind sie bei ihm selbst - er hat sie ja auch rezitiert - erklungen, und diejenigen, die ihn noch gehört haben, wissen, wie er versuchte, die Alliteration wirklich zur Offenbarung zu bringen in der deklamatorischen Versbehandlung.
Wir wollen damit schließen, daß wir zunächst eine kleine Probe vom Anfange des Nibelungenliedes geben, woraus ersehen werden kann dieses andere Element, das dem griechischen Metrumelement gegenübersteht, und im Gegensatz zu dem betrachten, was Goethe, gerade als er älter wurde, aus dem Griechentum bekam, woraus er seine beste Kraft genommen hat, in dem er auch lebte, das er aber zu einer Allseitigkeit verbinden wollte mit dem anderen Element.
Dann wollen wir anschließen eine Probe von dem, wie Wilhelm Jordan versuchte, wiederum die altgermanische Art dichterisch zu gestalten, indem wir ein kleines Stückchen alliterierender Verse aus Wilhelm Jordans «Nibelunge» vortragen.
Aus dem «Nibelungenlied»
I. Äventiure
Uns ist in alten maeren wunders vil geseit
von heleden lobebaeren, von grözer arebeit;
von freude und höchgeziten, von weinen unde klagen,
von küener recken strîten müget ir nu wunder hoeren sagen.
Ëz wuohs in Buregonden ein vil edel magedin,
daz in allen Landen niht schoeners mohte sin,
Kriemhilt geheizen, diu wart ein schoene wlp;
dar umbe muosen dëgene vii verliesen dën lip.
Der minneclîchen meide trüejen wol gezam:
ir moutten küene recken, niemen was ir gram.
âne mâzen schoene sö was ir edel lîp:
dër juncfrouwen tugende zierten anderiu wîp.
Ir pflâgen dri künige edel unde rich,
Gunther unde Gìrnôt die recken lobelich,
unt Giselher dër junge, ein waetlicher dëgen;
dîu frouwe was ir swëster, die helden hetens in ir pflëgen.
#SE281-115
Ein richiu küneginne frou Uote ir muoter hiez;
ir vater dër hiez Dancrât, dër in diu erbe liez
sît nâch sime lëbene, ein ellens richer man,
der ouch in siner jugende grôzer iren vil gewan.
Die hërren wâren milte, von arde höhe erborn,
mit kraft unmâzen küene die recken üzerkorn.
dâ zën Burgonden 5ô was ir lant genannt.
si frümten starkiu wunder sît in Etzelen lant.
Ze Wormze bi dëm Rine si wonten mit ir kraft;
in dienten von ir landen vil stolziu ritterschaft
mit lobelichen iren unz an ir endes zît.
si sturben jaemerlîche sît von zweier frouwen nît.
Die dri künige wâren, als ich gesaget hân,
von vil hôhem eilen; in wâren undertân
ouch die besten recken, von dën man hât gesaget,
starc unt viel küene, in scharpfen strîten unverzaget.
Daz was von Tronege Hagene, unt ouch dër bruoder sin
Dancwart dër snëlle, von Metzen Ortwin,
die zwine marcgrâven, Gire unt Eckewart,
Volkir von Alzeie, mit ganzem eilen wol bewart,
Rümolt dër küchenmeister, ein üzerwelter dëgen,
Sindolt unde Hünolt; dise hërren muosen pflëgen
dës hoves unt dër iren, dër drier künige man.
si heten noch manigen recken, dës ich genennen nienen kan.
Dancwart dër was marschalc; dô was dër nëve sin
truhsetze dës küniges von Metzen Ortwîn
Sindolt dër was schenke, ein waetllcher dëgen;
Hünolt was kameraere: si kunden höher iren pflëgen.
Von dës hoves ire unt von ir witen kraft,
von ir vil höhen wërdekeit unt von ir ritterschaft,
dër die hërren pflâgen mit freuden al ir lëben,
dësn künde iu ze wâre niemen gar ein ende gëben.
In disen höhen iren troumte Kriemhilde,
wie si züge einen valken starc, schoene unt wilde,
dën ir zwìn' arn erkrummen; daz si daz muoste sëhen,
im kunde in dirre wërlde leider nimmer geschëhen.
#SE281-116
Dën troum si dô sagete jr muoter Uoten.
sine kundes niht bescheiden baz dër guoten:
«dër valke, dën du ziuhest, daz ist ein edel man;
in enwëlle got behüeten, du muost in schiere vioren hâ n.»
«Waz saget ir mir von manne, vil liebin muoter mîn?
âne recken minne 5ô wil ich immer sîn;
sus schoene ich wil belîben unz an minen tôt,
daz ich von recken minne sol gewinnen nimmer nöt.»
«Nune versprich ëz niht ze sire», sprach ir muoter dô.
«soltu immer hërzenlîche zër wërlde wërden vrô,
daz kümt von mannes minne; du wirst ein schoene wîp,
ob dir got geflieget eins rëhte guoten ritters lip.»
«Die rede lât belîben, vil liebiu frouwe min;
ëZ ist an manigen wiben vil dicke worden schîn,
wie liebe mit leide ze jungest lönen kan;
ich sol sie mîden beide, sone kan mir nimmer missegân.»
Krieflihilt in ir muote sich minne gar bewac.
sît lëbete diu vil guote vil manigen lieben tac,
daz sine wësse niemen, dën minnen wolde ir lip.
sît wart si mit iren eins vil wërden recken wîp.
Dër was dër sëlbe valke, dën si in ir troume sach,
dën ir beschiet ir muoter. wie sire siu daz rach
an ir naehsten mâgen, die in sluogen, sint!
durch sin eines stërben starp vil maniger muoter kint.
Aus «Die Nibelunge» von Wilhelm Jordan
Hildebrants Heimkehr, 17. Gesang
Schon drängten sich draußen mit dröhnenden Tritten
Zu jedem der Tore der Krieger tausend;
Schon hob sein Hffthorn der Hunnenkönig,
Um Sturm zu blasen. Doch stumm noch blieb es.
Ob sein Herz auch zermalmt war, er mußte horchen,
Und gramvoll beseufzte die große Seele
Verlorenen Grund begrabener Hoffnung
In des stolzen Germanen Sterbegesang:
#SE281-117
«Erwacht! In den Wolken
Ist Waffengerassel.
Erwacht, es gewittert,
Als wieherten Rosse.
Walkürien kommen
Zum Kampf geflogen
In glänzenden Brünnen,
Von Brautlust glühend.
Sie lenken herunter
Die luftigen Renner,
Um Tapfre zu kiesen
Mit tötendem Kuß.
Erwachet! Es warten
Die Wodanswölfe,
Es rufen die Raben,
Ihr MaM zu rüsten.
Um der Seele die Pforte
Zum Sonnenpfade
Weit aufzuschließen,
Ist Eisen geschliffen.
Das Leben ist Schlaf nur,
Erlösung der Schlachttod.
Erwachet zum Sterben,
Und sterbend erwacht.
Erwachet! Es winken
Von Walhalls Schwelle
Die erkorenen Gäste
Des Götterkönigs.
Da lebt ihr in Leibern
Aus Licht gewoben;
Da ist Kampf nur Kurzweil
Und Wunde Wollust.
Da labt das Gedenken
Erduldeter Leiden,
Da schildert ihr scherzend
Der Niblunge Not.»
Rezitation durch Marie Steiner
DICHTUNG UND REZITATION Wien, 7. Juni 1922
#G281-1967-SE118 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
DICHTUNG UND REZITATION
Wien, 7. Juni 1922
#TX
Die Kunst der Dichtung kommt durch Deklamation und Rezitation zu ihrer eigentlichen Geltung. Nicht etwa darum, weil ich aus einem abstrakten Grundsatz heraus behaupten möchte, daß eine Weltanschauung, die einmal aus den Nöten der Zeit heraus auftritt, über alles in einer gewissen Beziehung ihr reformierendes Licht breiten sollte, sondern aus einem ganz anderen Grunde möchte ich mir gestatten, ein paar Worte zu sprechen über das, was gerade zur Kunst der Rezitation und Deklamation vom Gesichtspunkt der hier auf diesem Kongreß vertretenen Welt- und Lebensauffassung zu sagen ist. Wir werden wohl zu einem inneren, wirklichen seelischen Verständnis der dichterischen Kunst erst wiederum gelangen, wenn wir in der Lage sein werden, die eigentliche Heimat der dichterischen Kunst aufzusuchen. Und diese eigentliche Heimat der dichterischen Kunst ist ja doch die geistige Welt, die geistige Welt allerdings in der Weise, daß gerade das Element, welches in der Gegenwart aus dieser geistigen Welt heraus am meisten gepflegt wird - das verstandesmäßige, das begriffliche, das ideenhafte Element -, am allermeisten lähmend wirkt gerade für die dichterische Kunst.
Was damit gemeint ist, wird man vielleicht am besten einsehen, wenn daran erinnert wird, daß eines der allerbedeutendsten dichterischen Kunstwerke sogleich herauftönt aus der Zeitenwende zu uns mit einem Bekenntnisse seines Schöpfers, oder meinetwillen seiner Schöpfer. Die Homerischen Dichtungen beginnen immer mit den Worten: «Singe, o Muse...» Wir sind heute nur allzu geneigt, ein solches Wort mehr oder weniger wie eine Phrase zu nehmen. Als es geprägt worden ist, war es nicht eine Phrase, war es ein inneres Seelenerlebnis. Derjenige, der da dichtete aus dem Geiste heraus, aus dem auch dieses Wort erlebt worden ist, wußte, daß er mit dem, was seine Dichterkraft war, sich versenkte in ein anderes Gebiet des menschiichen Daseins, des menschlichen Erlebens, als das ist, durch das wir weilen in der unmittelbaren sinnlichen Anschauung und etwa
#SE281-119
in der Erfassung dieser sinnlichen Anschauung durch die intellektuelle Kraft des Menschen. Es wußte der Dichter, daß sein Inneres ergriffen wird von einer wahrhaft objektiven geistigen Macht. Daß im Laufe der Menschheitsentwickelung dieses Bewußtsein sich wandein mußte, das ist, möchte ich sagen, ja auch geschichtlich niedergelegt.
Als Klopstock aus deutschem Geistesleben heraus die große MessiasTat in einer ähnlichen Weise besingen wollte wie Homer Griechenlands, Hellas' Vorzeit, da sprach er nicht die Worte: « Singe, 0 Muse...», sondern da sprach er das Wort: «Singe, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung.» Da ist also schon intensiver hingewiesen auf das, was unmittelbar mit dem menschlichen Ich, mit dem menschlichen Selbstgefühi zusammenhängt. Da hat der Mensch, man möchte sagen, sich in seiner persönlichen Individualität gefunden.
Aber wir können doch sagen: Wenn gerade für die Dichtung, für das Künstlerische überhaupt die Form des Bewußtseins, die in der modernen Ideenwelt und in der modernen Beobachtung lebt, allein maßgebend würde, so würden wir Dichtung und Kunst überhaupt verlieren müssen. - Allerdings ist auch hier notwendig, daß das, was einmal der Menschheit angemessen war, andere Formen annimmt. Aber diese anderen Formen können nur dadurch kommen, daß wiederum ein Weg gefunden wird hinein in die geistige Welt, denn nur ein solcher Weg macht es auch dem menschllchen Ich möglich, wiederum ergriffen zu werden von einer geistigen Welt nicht in jene? unbewußt träumerischen Weise wie in der Vorzeit, sondern in der vollbewußten Weise, wie das heute sein muß. Daß dies aber nicht mit einer Herablähmung der Phantasiebetätigung verbunden sein muß, ist zwar heute nicht allgemein begriffen, wird aber verstanden werden, wenn die hier gemeinte Welt- und Lebensauffassung immer mehr und mehr an Ausbreitung gewinnt, denn bei ihr macht die Besonnenheit, macht die Vollbewußtheit, macht das Hintreten vor die geistige Welt mit dem entwickelten Persönlichkeitsgefühl nicht das aus, was, ich möchte sagen, herunterlähmend wirkt auf die unmittelbare Anschauung, auf das Darinnenleben in den Dingen und Wesenhaftigkeiten, was für Dichtung und Kunst überhaupt notwendig ist. Allerdings,
#SE281-120
wenn man sich entfernt mit seiner Ideenauffassung in der bloßen Verstandesauffassung von den Dingen und neben ihnen steht, kann Erkenntnis nicht irgend etwas liefern, was unmittelbar künstlerische Gestaltung gewinnt. Wenn man aber wiederum eintaucht in das, was die Welt als Geistig-Wesenhaftes durchwellt, dann findet man auf diesem geistigen Weg dasselbe, was die Dichtung und alle Kunst im Grunde genommen immer suchten.
Der Dichter wird aus einem solchen Geiste heraus vor sich eigentlich haben, in der Seele vor sich haben dasjenige, was Rezitation und Deklamation für den Hörer erschaffen müssen. Der Dichter muß sich ja hinuntersenken in das Element der Sprache. Innerhalb des griechischen Geisteslebens hat man dieses Hinuntersenken in die Sprache noch als ein Erlebnis gehabt. Man hat es auch gehabt in älteren Formen des mitteleuropäischen, zum Beispiel des germanischen Geisteslebens. In uralten Zeiten der Menschheit, wenn man das, was in der Seele als das Geistig-Göttliche sprechen sollte, wenn man das aufnehmen und zum Ausdruck bringen wollte, versenkte man sich nicht bloß in das sprachliche Element, sondern sogar in das Element, auf dem die Sprache wie auf Meereswogen hinströmte, in das Element des Atems. Es war in früheren Zeiten, die ein altes Geistesleben hatten, das noch erhaben war über Wissenschaft, Kunst und Religion in ihrer Trennung, es war in jenen alten Zeiten, in denen ein solches Geistesleben geboren wurde, auch die Dichtung noch nichts Abgesondertes. Sie wurde etwas Abgesondertes erst, als dasjenige, was im Atem lebendig, offenbar als der Ausdruck des menschlichen Wirkens, des innerlichsten Wollens erlebt worden ist, sich in höhere Regionen des menschlichen organischen Lebens heraufhob: in das Element der Sprache.
Wir sind heute angekommen beim Element des Gedankens. Aus ihm heraus kann nur noch erlebt werden etwas wie ein Heraufstoßen des Atems. Was in uralten Zeiten Mitteleuropas gewaltet hat als unbewußtes Empfinden, wenn der Mensch poetisch wurde, war das Wallen des Blutes, das den Atmungsstrom wiliensmäßig ergreift und ihn von innen heraus tonhaft gestaltet; dagegen in dem Element, das mehr bildhaft gedankenhaft dahinströmte im Rhythmus des Atems und durch Maß, Zahl und Silbe den Laut, den Ton, die Zeile musikalisch
#SE281-121
gestaltete, lebte der Grieche, lebte überhaupt der Angehörige der Griechen- und Römerzeit, wenn er poetisch wurde.
Goethe war herausgeboren in seiner ganzen Seelenwesenheit aus mitteleuropäischem Geiste. Dasjenige, was er in seiner Jugend geschrieben hat, hat er, ich möchte sagen so geschrieben, daß sich ihm imaginativ, bildförmig gestaltet hat, was erlebt wird dann, wenn instinktiv gefühlt wird das Heraufstoßen des menschlichen Atems durch die willensdurchpulsten Blutwogen in die Ton- und Lautgestaltung und damit auch in die Gestaltung des menschlichen seelenhaften Ausdruckes. Dadurch ist er zu dem gekommen, was wir bei ihm so bewundern können in seiner Jugend, auch wenn er scheinbar prosaisch spricht. Wir haben Prosadichtungen aus Goethes Jugend, wie den wunderbaren «Hymnus an die Natur», in welchem jenes Element waltet, in dem man die Sprache überall durchzogen erfühlt von dem auf den Wogen des Blutes pulsierenden Atem. Aus solcher Empfindung heraus hat Goethe zunächst seine «Iphigenie» als junger Mann gedichtet. Sie ist gedichtet so, daß man fühlt, in ihrer Prosa lebt und webt noch etwas von dem Rhythmus des Nibelungenliedes oder des Gudrunliedes, etwas von dem, was in dem Hoch- und Tiefton wirkt und waltet, was berücksichtigt, wie der Wille heraufstößt in dasjenige, was menschliches Kopferlebnis wird. Dieser Rhythmus, heraufgedrängt bis in die Gedankenformen, ist es, was wir bewundern müssen in Goethes Jugenddichtungen, zu denen die erste Fassung seiner «Iphigenie» gehört.
Goethe aber sehnte sich heraus nach Italien. Es kam eine Zeit über ihn, wo er gar nicht mehr bestehen konnte mit sich selbst, ohne daß er diese Reise nach Italien in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts antrat. Wonach sehnte er sich damals im Innersten seines Wesens? Er sehnte sich danach, tiefer in die menschliche Persönlichkeit, in die menschliche Totalität noch hineinzudrängen das, was so im Hoch- und Tiefton lebte, was wirkte in der Sprachgestaltung wie die Formen der gotischen Dome. Er wollte das einsenken in das Ebenmaß desjenigen, was er glaubte nur im Süden, in Italien erleben zu können in den Nachklängen, die er da suchte von jenem Element, das im Griechentum lebte. Und es wurde ihm dieses Erlebnis, das ihm in
#SE281-122
seinem Erfühien aus der Kunst, die er noch sehen konnte, sich ergab, ein Verständnis der griechischen Kunst, von der er annahm, daß die Griechen nach denselben Gesetzen schufen, nach denen die Natur schafft, und denen er glaubte auf der Spur zu sein. Er glaubte ihnen auch auf der Spur zu sein in der Sprachgestaltung. Er versenkte tiefer hinunter in den Atem das, was sprachliches Element war. So dichtete er in Rom seine «Iphigeme» um. Wir haben - obwohi sie nur wenig verschieden sind, diese «Iphigenie», wie er sie ursprünglich gedichtet hatte, und die andere «Iphigenie», wie er sie in Rom umgedichtet hat - deutlich zu unterscheiden zwischen dem, was die «nordische Iphigenie» erst war, und dem, was aus ihr durch die römische Um-dichtung bei Goethe wurde. Da wurde sie ein Gedicht, wo nicht mehr bloß Hoch- und Tiefton leben sollte, sondern in dem etwas anderes leben sollte - ich meine das nicht im kleinlichen Sinne, sondern in der ganzen künstlerischen Sprachgestaltung -, in dem leben sollte das, was nun, ich möchte sagen von dem tieferen Rhythmus der Blutzirkulation seelisch erlebt, hinüberspielt in das Ruhig-Maßvolle im Rhythmus des Atems, im Gedankenelement. Es wurde dasjenige, was ein deklamatorisches Element darstellt in der «nordischen Iphigenie», zu einem rezitatorischen in der «römischen Iphigenie».
Und hier an diesen beiden Iphigenien ist anschaulich zu merken, welcher Unterschied ist zwischen dem, was Deklamieren, und dem, was Rezitieren ist. Das Rezitieren trägt tiefer in die menschliche Wesenheit hinein, schafft auch tiefer aus ihr heraus, ergreift ebenso die ganze Blutzirkulation wie den Atem. Aber dadurch, daß beim Deklamieren in den Atem bis in das höchste menschliche Geistig-Seelische heraufgeholt wird das sonst in den tiefsten Untergründen waltende Willenshafte, dadurch wiederum erscheint uns das, was im Hoch-und Tiefton lebt, als das Kräftigere, als das, was sich aufraffen kann nicht bloß zum Ebenmaß des Reimes und Verses, sondern bis zu dem stark in der Welt hinschreitenden, ja selbst kämpfenden Alliterationselement. Das ist etwas, was seine besondere Schönheit nur im Norden haben kann.
Wir möchten heute nicht theoretische Erörterungen geben, sondern anschaulich machen das, was in der künstlerischen Empfindung
#SE281-123
liegen kann, und deshalb soll jetzt zunächst dasjenige, was, ich möchte sagen das deklamatorische Element in Goethes «nordischer Iphigenie» ist, kontrastiert werden mit demjenigen, was das rezitatorische Element in der römischen Umdichtung ist.
Die Szenen sind abgedruckt auf S.20 ff.
Die dichterische Sphäre, in welche Goethe eingetreten ist, indem er seine «Iphigenie» also umgeschaffen hat, pflegte er weiter in solchen Dichtungen wie zum Beispiel in seiner «Achilleis», von der nun ein Stück zur Rezitation gebracht werden soll. Damit aber finden wir unmittelbar bei Goethe dasjenige, was uns zeigen kann, wie aus dem ganzen Menschen heraus die dichterische Kunst kommt und wie sie sich aus dem ganzen Menschen heraus in dem Rezitatorischen und Deklamatorischen gestalten muß.
Es könnte zunächst aussehen, als ob ich hier eine mechanistische Auffassung des Rezitierens und Deklamierens vertreten wollte, wenn ich hinweise auf das, was man gerade auf einem geisteswissenschaftlichen Wege finden kann als die Entstehung dieses Rezitatorischen und Deklamatorischen aus der menschlichen Wesenheit heraus.
Die Dichtung als Kunst hat die Aufgabe, das, was die Prosa, ich möchte sagen atomisiert hat, ins einzelne gebracht hat bis in das Wort herein, wiederum zu verbreitern, so daß es in dem Harmonischen der Laute, in dem Melodiösen der Laute, in dem bildhaften Gestalten des Sprachlichen wie, ich möchte sagen ein zweites geistiges sprachliches Element über dem gewöhnlichen darüber liegt. Der Prosaiker sagt nur das, was das Wort zu sagen vermag als ein Kleid des Gedankens, und das, was er in diese Rede hineinzulegen versteht von dem Unmittelbaren seines persönlichen Erlebnisses. Der Dichter geht zurück von diesem rhetorischen Element auf ein viel tieferes inneres menschliches Erleben. Er geht bis zu demjenigen zurück, wo noch, wie ich schon angedeutet habe, das rhythmisch Atemhafte und auch das Rhythmische des menschlichen Zirkulationssystems in den Vibrationen wahrzunehmen ist, die durch das sprachlich-poetische Element hindurch sich ziehen. Und wir kommen eigentlich nur auf das Grund-element des Rhythmischen, des Taktmäßigen. des Bildhaften, des
#SE281-124
Melodiösen in der Sprache, wenn wir die menschliche Natur bis in ihre Physis herein geistig auffassen. Da haben wir das Element des Atems, ich möchte sagen, das ist der eine Pol des Rhythmischen im Menschen; da haben wir das Element der Zirkulation, das ist der andere Pol des Rhythmischen im Menschen. Im Zusammenwirken von Atem und Zirkulation drückt sich das aus, was zunächst im einfachsten Verhältnis dann gegeben ist, wenn man in der menschlichen Sprachausdrucksform hinhorchen kann auf das Nachklingen des Atems und der Zirkulation im menschlichen Sprachfluß. Wir atmen ja so, daß wir in einer Minute eine bestimmte Ar:z:ahl von Atemzügen, etwa sechzehn bis achtzehn haben; wir haben in derselben Zeit ungefähr durchschnittlich viermal soviel Pulsschiäge. Zirkulation und Atmung wirken so zusammen, daß die Zirkulation auf dem Atem spielt und der Atem wiederum seinen langsameren Rhythmus der Zirkulation einwebt. Dieses Erlebnis des Ineinander-Harmonisierens von Pulsschlag und Atemschlag, das ist es, was nachvibriert in der Sprache, was in der verschiedensten Weise gestaltet und umgestaltet dann zu dem führt, was in der bildhaften oder musikalischen Sprach-gestaltung, die aus dem Dichter spricht, nachwirkt.
Ich sage - und man hat es auch getan -, man könnte das, was ich so aus dem menschlichen Organismus heraushole als das Grundgesetz des Dichterischen, das Ineinanderwirken von Atem und Zirkulation, mechanistisch, materialistisch finden. Der aber begreift nur das Walten und Wirken des geistigen Lebens in der Welt, der dieses Leben hineinverfolgen kann auch bis in die materiellen Gestaltungen, der hineinverfolgen kann das, was in dem Geist und in der Seele des Menschen lebt, bis dorthin, wo es sich auslebt, offenbart in den körperlichen Funktionen, und wo wiederum die körperlichen Funktionen wie eine feste Wand wirken, als ein Echo zurückwerfen das, was seine Gesetzmäßigkeit aus einer tieferen Geistigkeit heraus ist in der menschlichen unmittelbar erlebten Geistigkeit, die in die Sprache ergossen wird.
Goethe fühlte, wie in älteren menschlichen Zivilisationen gewissermaßen der Mensch noch näherstand seiner eigenen Natur. Daher suchte er dichterische Formen nachfühlen zu lernen auch in älteren
#SE281-125
Epochen der Menschheit und er suchte solche dichterischen Formen wiederum zu beleben. Man kann sagen: Es hatte doch eine tiefe Bedeutung, als in der schönsten Blüte der deutschen dichterischen Entwickelung Goethe aus dem bloß prosaischen Pointieren heraus, das man oft für Deklamieren und Rezitieren hält, hinwies auf die besondere Sprachbehandlung, die erst diesen Namen verdient. Und Goethe stand mit dem Taktstock vor seinen Schauspielern, wenn er ihnen selbst seine Iphigenie-Jamben einstudierte, wissend, daß, was er namentlich als Bildhaftes verkörpern wollte, dasjenige ist, was vor allen Dingen zur Offenbarung kommen muß, daß das Prosaische nur etwas ist wie eine Leiter, auf der sich das höhere, geistig Sinnvollere der Laut-, der Sprachbildhaftigkeit dann entwickeln muß. Man muß erst durch das, was Prosainhalt ist einer Dichtung, hindurchschauen auf das wahrhaft Dichterische. Und es ist nicht ein bloß Persönliches, wenn Schiller gerade bei den schönsten seiner Dichtungen zuerst ein unbestirnteres melodiöses, musikalisches Element, an das er wie aufreihte den prosaischen Inalt, hatte. Bezüglich des Wortinhaltes hätte manches Schillersche Gedicht sogar einen anderen Inhalt haben können, als es heute hat. Es ist überall etwas, was wie im Hintergrunde des Rhetorisch-Sprachlichen beim wahren Dichter steht, was auch empfunden werden muß. Wenn Dichtung gerecht wird der musikalischen Sprachgestaltung, dann bringt sie das Dichterische erst wirklich zur Offenbarung.
Wenn man hinsieht, wie heute oftmals Deklamieren und Rezitieren gelehrt wird, dann kann man insbesondere empfinden, daß uns in dieser Beziehung doch etwas in unserer unkünstlerischen Zeit verlorengegangen ist. Da wird, weil man nicht unmittelbar im rezitatorischen und deklamatorischen Element selbst zu leben vermag, die Stimme als solche gestärkt, wird auf das Mechanistische der Einstellung des Organismus der größte Wert gelegt. Dadurch kommt aber eigentlich ein durch und durch unkünstlerisches Element sowohl in Rezitation wie Deklamation wie auch in den Gesang hinein, denn dadurch verlegt man das, was auf einem ganz anderen Niveau erfahren werden muß, in das Materiell-Körperliche hinein. Das, worauf es ankommt, ist, daß jeglicher Deklamations- und Rezitationsunterricht
#SE281-126
auch nicht anders verlaufen darf, als daß man den Zögling sich ein-leben läßt in die Sprachgestaltung selber, in das, was seelisch nachlebt in dieser Sprachgestaltung, daß man den Zögling dazu bringt, daß er imstande ist, richtig zu hören. Wer imstande ist, wirklich richtig zu hören, was Dichtung zu offenbaren vermag, bei dem wird der richtige Atem, die richtige Einstellung des Körperlichen, das Mechanistische wie in einer Resonanz ganz von selber zum richtigen Hören kommen. Das ist das Wichtige, daß man im Elemente des Deklamatorischen und Rezitatorischen selbst den Zögling leben laßt und alles übrige dem Zögling überläßt. Er muß aufgehen in dem, was gegenständlich tonlich, musikalisch bildhaft ist, in dem, was wirklich dichterisch gestaltet lebt. Nur auf diese Weise, daß man den Zögling dazu bringt, daß er gewissermaßen für das, was, nun sagen wir, ihm vordeklamiert wird, wenn ich mich jetzt paradox ausdrücken darf, ein richtiges Ohr-gefühl entwickelt und durch dieses hindurch eine richtige Empfindung für das, was geistig sich bewegt auf den Wellen dessen, was ihm sein Ohrgefühl gibt; nur dann wird er von diesem Erleben, das er gewissermaßen in seiner Umgebung, nicht in sich selber wahrnimmt - das ist zunächst eine Illusion, aber die muß gepflegt werden -, nur dann wird er das, was er wie ihn umgebend vibrieren fü hit, in sich selbst hineinbeziehen. Man sollte nur durch bestimmte Wortformen, die künstlerisch gestaltet sind, so daß sie gerade auf die menschliche Organisation hintendiert sind, man sollte durch das Rezitieren solcher Wortfolgen den Atem gestalten lernen und ebenso alles übrige, was an Einstellung da ist. Dann wird man gerade dem arn besten genügen, was aus der uns ja so hochstehenden Goetheschen Kunstanschauung und Kunstempfindung hervorgegangen ist.
Um das zu veranschaulichen, nicht um eine Theorie zu veranschaulichen, sondern um das zu veranschaulichen, was gesagt worden ist, soll jetzt ein Stück von Goethes «Achilleis» zur Rezitation kommen.
Text siehe S.43 ff.
Und nun zur Veranschaulichung der Deklamation, etwas zusammengezogen, wie es aus Anlaß einer eurythmischen Darstellung geschah, Goethes «Hymnus an die Natur»:
#SE281-127
Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen - unvermögend, aus ihr herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arm entfallen.
Sie schafft ewig neue Gestalten; alles ist neu und doch immer das Alte. Sie baut immer und zerstört immer.
Sie lebt in lauter Kindern; und die Mutter, wo ist sie? Sie ist die einzige Künstierin; sie spielt ein Schauspiel; es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr. Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillstehen in ihr.
Ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwandelbar.
Gedacht hat sie und sinnt beständig.
Die Menschen sind alle in ihr, und sie in allen. Auch das Unnatürlichste ist Natur, auch die plumpste Philisterei hat etwas von ihrem Genie.
Sie liebt sich selber; sie freut sich an der Illusion. Ihre Kinder sind ohne Zahl.
Sie spritzt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor. Leben ist ihre schönste Erfindung, der Tod - ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben.
Sie hüllt den Menschen in Dumpfheit ein und spornt ihn ewig zum Lichte. Man gehorcht ihren Gesetzen, auch wenn man ihnen widerstrebt; man wirkt mit ihr, auch wenn man gegen sie wirken will.
Sie macht alles, was sie gibt, zur Wohltat.
Sie hat keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Herzen, durch die sie fühlt und spricht.
Ihre Krone ist die Liebe.
Sie macht Klüfte zwischen allen Wesen und alles will sie verschlingen. Sie hat alles isoliert, um alles zusammenzuziehen.
Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und quält sich selbst. Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit.
Sie ist gütig, sie ist weise und still.
Sie ist ganz und doch immer unvollendet.
Jedem erscheint sie in einer eigenen Gestalt. Sie verbirgt sich in tausend Namen und ist immer dieselbe.
Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich vertraue mich ihr. Alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst!
Wir wollen jetzt einige lyrische Proben geben, und zwar von Robert Hamerling und von Anastasius Grün, den beiden österreichischen Dichtern. In der Lyrik ist es noch in anderem Sinn der Fall als in der Epik
#SE281-128
und Dramatik, daß die Sprachgesraltung vor allen Dingen als eine künstlerische unmittelbar erlebt werden muß, denn gewissermaßen strebt alle lyrische Stimmung aus dem unmittelbar Bewußten - wenigstens bis zu einem gewissen Grade - heraus und möchte den Menschen in seiner Wesenheit überleiten in ein allgemeines Welt-Miterleben. Es ist immer etwas in der Lyrik von, man möchte sagen Herabdämpfung des unmittelbar bewußten Erlebens. Und vielleicht gerade bei einem solchen Dichter wie Hamerling, der einmal, ich möchte sagen so weltweiten Eindruck machte und jetzt mehr oder weniger, wenigstens gegenüber seiner früheren Berühmtheit, vergessen ist, ist zu sehen, wie das persönliche Erleben in das lyrische Erleben übergeht. Haben wir es doch bei ihm zu tun mit einer Persönlichkeit, die mit jeder Faser ihrer Seele in der regsten Weise innerlich mit allem Welt-leben mitleben möchte, farbig miterleben möchte alles das, was ihm in der Welt entgegentritt. So spielen denn die unterbewußten Elemente des menschlichen Lebens gerade bei ihm eine große Rolle. Wir sehen bei ihm noch Nachklänge dieses farbigen Erlebens, das er durch das Eintauchen in die antikisierenden Formelemente zur Gestaltung zu bringen versuchte. Gerade bei Hamerling empfinden wir in seiner Lyrik das echt deutsch-österreichische Lyrische. Vielleicht ist er sogar in dieser Beziehung der repräsentativste deutsch-österreichische Dichter. Die deutsche Sprache, die in Österreich gesprochen wird, hat, indem sie sich aus verschiedenen Dialekten heraufhebt zur Umgangssprache, zur sogenannten Schriftsprache, die dann auch die der österreichischen Dichtung wurde, sie hat etwas, was sie von den anderen Formen des deutschen Sprechens unterscheidet, aber diese feinen Nuancen kommen für die dichterische Lautgestaltung ganz besonders in Frage. Man darf sagen: Gegenüber anderen deutschen Sprachformen hat das deutsch-österreichische Element etwas von Abgedämpftem, aber zu gleicher Zeit von solch Abgedämpftem, in das immer ein leises humorvolles Element hineintönt. Diese Sprache wurde dann die Sprache der österreichischen Dichtung. Dieses leise humorvolle Hineinklingen eines innigen Seelischen in das österreichische Sprachelement ist nicht leicht - höchstens in Dialekten -in anderem deutschen Sprechen zu finden. Und das ist etwas, was
#SE281-129
gewissermaßen hier die Sprache wiederum nähert dem antiken Element.
Es ist immerhin auffallend, daß ein solcher nicht hoch genug zu schätzender Dichter wie Joseph Misson, der zum niederösterreichischen Dialekt gegriffen hat, in seinem «Da Naz, a niederösterreichischer Bauerbui, geht in d' Fremd» in der Form zu einer Art Hexameter gekommen ist, und daß dieses Dazukommen wie selbstverständlich künstlerisch für ihn wird. Man darf auch sagen, daß das gedanken-hafte, idealistische Element, das sich als selbstverständlich einstellt, wenn man in der deutsch-österreichischen Sprache lebt, einen idealistischen Zug allem innerlich deutschen Erleben in diesem Stück Mitteleuropa verleiht.
Und das tritt einem in Hamerlings Lyrik bis in die Sprachgestaltung hinein entgegen, die wie auf Vogelschwingen die Gefühle weiter-schickt, aber immerfort diesen Vogel einfängt in streng gestaltete Sprachformen, die eigentlich nur dem sanft humoristischen Element des Deutsch-Österreichischen möglich sind. Daher kann man auch finden, daß, wenn man in der Deklamation das nachformt, was so in Hamerlings lyrischen Dichtungen lebt und das irgendwo anders zum Gehör bringt, es an sich so wirkt, daß der Deutsche aus einer anderen Gegend durchaus etwas Deutsches empfindet, aber zu gleicher Zeit das Deutsche in der Sprache schon idealisiert empfindet. Das ist dasjenige, was das Edle in Hamerlings Lyrik ausmacht und was seinen Schwung, seine Farbigkeit zu einer Selbstverständlichkeit, zu einemn echt Künstlerischen macht.
In einem ganz andern Sinne tritt das dann bei einem anderen Dichter, bei Anastasius Grün hervor. Er hat wirklich so etwas wie eine Empfindung gehabt von dem, was zwischen Ost und West wirken sollte zur Verständigung der Völker über die Erde hin, insbesondere aus dem österreichischen Seelencharakter heraus. Die Stimmung der achtundvierziger Jahre kam am edelsten und schönsten bei Anastasius Grün in seinem «Schutt» und seinen anderen Dichtungen zum Ausdruck. Und eben das Einleitungsgedicht zum «Schutt» soll dann rezitiert werden. Wir haben aber, indem wir Hamerling auf der einen Seite hinstellen, einen Dichter, der eigentlich mehr für die Deklamation
#SE281-130
schuf, der sie durch das Maß formt, und haben bei Anastasius Grün einen Dichter, der unmittelbar etwas wie ein rezitatives Element aus der Sprache herausholt. Das möchten wir nun an dem Gedicht von Anastasius Grün, das dem Sinne nach «West und Ost» heißen könnte, und an zwei Gedichten Robert Hamerlings, «Nächtliche Regung» und «Vor einer Genaiane», zur Anschauung bringen.
WEST UND OST
Prolog zu «Schutt»
Aug' in Auge lächelnd schlangen
Arm in Arm einst West und Ost;
Zwillingspaar, das liebumfangen
Noch in einer Wiege kost'!
Ahriman ersah's, der Schlimme,
Ihn erbaut der Anblick nicht,
Schwingt den Zauberstab im Grimme,
Draus manch roter Blitzstrahl bricht.
Wirft als Riesenschlang' ins Bette,
Ringelnd, bäumend, zwischen sie
Jener Berg' urew'ge Kette,
Die nie bricht und endet nie.
Läßt der Lüfte Vorhang rollend
Undurchdringlich niederziehn,
Spannt des Meers Sahara grollend
Endlos zwischen beiden hin.
Doch Ormuzd, der Milde, Gute,
Lächelnd ob dem schlechten Schwank,
Winkt mit seiner Zauberrute,
Sternefunkelnd, goldesblank.
Sieh, auf Taubenîitt'chen, lächelnd,
Von der fernsten Luft geküßt,
Schlift die Liebe, kundig lächelnd;
Wie sich Ost und Westen grüßt!
#SE281-131
Blütenduft und Tau und Segen
Saugt im Osten Menschengeist,
Steigt als Wolke, die als Regen
Mild auf Westens Flur dann fleußt!
Und die Brücke hat gezogen,
Die vom Ost zum West sich schwingt,
Phantasie als Regenbogen,
Der die Berge überspringt.
Durch die weiten Meereswüsten,
Steuernd, wie ein Silberschwan,
Zwischen Osts und Westens Küsten
Wogt des Lieds melod'scher Kahn.
Anastasius Grün
NÄCHTLICHE REGUNG
Horch, der Tanne Wipfel
Schlummertrunken bebt,
Wie von Geisterschwingen
Rauschend überschwebt.
Göttliches Orakel
In der Krone saust,
Doch die Tanne selber
Weiß nicht, was sie braust.
Mir auch durch die Seele
Leise Melodien,
Unbegriffne Schauer,
Allgewaltig ziehn:
Ist es Freudemahnung
Oder Schmerzgebot?
Sich allein verständlich
Spricht in uns der Gott.
Robert Hamerling
#SE281-132
VOR EINER GENZIANE
Die schönste der Gerzianen fand ich
Einsam erblüht tief unten in kühler Waldschlucht.
0 wie sie durchs Föhrengestrüpp
Heraufschlmmerte mit den blauen, prächtigen Glocken!
Gewohnten Waldespfad
Komm' ich nun Tag um Tag
Gewandelt und steige hinab in die Schlucht
Und blicke der schönen Blume tief ins Aug'...
Schöne Blume, was schwankst du doch
Vor mir in unbewegten Lüften so scheu,
So ängstlich?
Ist denn ein Menschenaug' nicht wert
Zu blicken in ein Blumenantlitz?
Trübt Menschenmundes Hauch
Den heiligen Gottesfrieden dir,
In dem du atmest?
Ach, immer wohl drückt Schuld, drückt nagende Seibstanklage
Die sterbliche Brust, und du, Blume, du wiegst
In himmlischer Lebensunschuid
Die wunderbaren Kronen:
Doch blicke nicht allzu vorwurfsvoll mich an!
Sieh, hab' ich doch Eines voraus vor dir:
Ich habe gelebt:
Ich habe gestrebt, ich habe gerungen,
Ich habe geweint,
Ich habe geliebt, ich habe gehaßt,
Ich habe gehofft, ich habe geschaudert;
Der Stachel der Qual, des Entzückens hat
In meinem Fleische gewühlt;
Alle Schauer des Lebens und des Todes sind
Durch meine Sinne geflutet,
Ich habe mit Engelchören gespielt, ich habe
Gerungen mit Dämonen.
Du ruhst, ein träumendes Kind,
Am Mantelsaum des Höchsten; ich aber,
Ich habe mich emporgekämpft
Zu seinem Herzen,
#SE281-133
Ich habe gezerrt an seinen Schleiern,
Ich habe ihn beim Namen gerufen,
Emporgekiettert
Bin ich auf einer Leiter von Seufzern,
Und hab' ihm ins Ohr gerufen: « Erbarmung!»
O Blume, heilig bist du,
Selig und rein;
Doch heiligt, was er berührt, nicht aucb
Der zündende Schlcksalsblitz?
0, blicke nicht allzu vorwurfsvoll mich an,
Du stille Träumerin;
Ich habe gelebt, ich habe gelitten!
Robcrt Hamerling
Zum Schluß soll noch gebracht werden ein Teil des siebenten Bildes aus meinem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung».
Wenn man den Versuch macht, dasjenige dichterisch zu gestalten, was eigentlich im Übersinnlichen lebt, dann ist man in der besonderen Lage, daß man, ich möchte sagen sich zunächst scheinbar am aller-weitesten von dem entfernt, was ein sicherer Boden der äußeren Wirklichkeit ist. Man ist deshalb auch der Gefahr ausgesetzt, daß derjenige, der sich nicht leicht in eine geistgemäße Auffassung der Dinge hinein-findet, das, was in dieser Weise versucht wird, als Allegorien oder Symbole hinnimmt.
Innerhalb derjenigen Kunstgesinnung, die sich herauserheben kann aus der Anschauung, die hier vertreten wird, kann weder das Symbolum noch die Allegorie irgendeinen Boden haben. Es wird ganz gewiß nicht das Abstrakte des Symbolismus versucht und nicht das Stroherne der Allegorie irgendwie angestrebt. Um was es sich handelt, ist eine lebendige Wiedergabe von Anschauungen, die noch anschaulicher sind als das Sinnliche, weil sie unmittelbar rnit der Seele erlebt werden, nicht erst durch Vermittlung von körperlichen Organen. Nur dem, der diese Anschauungen in sich nicht rege zu machen vermag, sind sie abstrakt oder strohern. Dasjenige, um was es sich eigentlich handelt, möchte ich nur mit ein paar Worten andeuten, da man über das, was man selbst gemacht hat, nicht viel zu sagen weiß. Es handelt sich in diesen Mysteriendichtungen darum, daß in einer geistig-seelischen
#SE281-134
Entwickelung Johannes Thomasius nach und nach zu einem unmittelbaren übersinnlichen Erleben der geistigen Welt gebracht werden soll. Das ist dann bis zu einer gewissen Stufe nach dem Überschreiten mannigfaltiger innerer Heruninisse, auch innerer Förderungen erreicht. Da kommt der Moment, wo er gewissermaßen in dem, was er bisher nur als Außenwelt gekannt hat durch die Sinne und durch den Intellekt, der mit den dünnsten Geistigkeiten am abstraktesten die Sinne durchdringt, finden soll die durchwirkende geistige Wesenheit mit konkreten Geistigkeiten, mit konkreten geistigen Vorgängen. In einer Menschenseele, die an diesem Punkte der Einweihung oder Initiation, wie man es früher genannt hat, ankommt, geht mannigfaltiges vor. Alles das, was man bisher erlebt hat in Licht und Ton, was man erlebt hat in den anderen Elementen der Außenwelt, nimmt für das höhere Erleben andere Formen an. Es ist tatsächlich etwas wie eine Umwandlung der Welt, die erlebt wird wie ein Sichaufraffen und Aufringen der Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens zu einer anderen Daseinsform. Wie diese Seelenkräfte teilnehmen an einer solchen Umwandlung des Menschen, wie dieses Teilnehmen aber in einem innigen Verhältnis steht zum ganzen Weltengeschehen, das soll in diesem Bilde des Mysteriendramas dargestellt werden.
Eine der Personen, Maria, die sich hinaufgelebt hat in die geistige Welt, schildert zunächst, wie jene Kräfte zusammenkommen, die dann die einzelnen Seelenkräfte inspirieren sollen. Phîlia, Astrid, Luna treten auf als die waltenden Seelenkräfte in ihrer Lebendigkeit selber, wie sie teilnehmen am Inspirieren des Menschen Johannes Thomasius. Das, was aus dem Ganzen der Welt, aus der Weltentotalität heraus der Menschenseele werden kann in dem Moment, wo ihr das währe Verständnis des Geisteslebens aufgeht, soll hier dargestellt werden. Mit einer solchen Darstellung entfernt man sich scheinbar am meisten vom Boden der Wirklichkeit, aber deshalb - und derjenige, der diese Dinge geformt hat, muß es wissen - stehen die Gestaltungen, die man da geschaffen hat, nicht weniger konkret vor der Seele wie irgendwelche äußeren Dinge. Manche Menschen können sich allerdings darauf nicht einlassen, nennen überhaupt alles, was über die Sinnesanschauung
#SE281-135
hinausführt, allegorisch. Hamerling hat sich einmal dagegen gewehrt in seiner Dichtung «Ahasver». Er hat gesagt: Kann mich jemand davor beschützen, daß der Nero hier selber dasteht und die Grausamkeit versinnbildlicht? - Nur insofern die Wirklichkeit selbst eine Art Symbolum ist, nimmt man sie herein, aber gerade wenn man geistige Gestaltungen zu bilden hat, dann fühlt man, wie jede Einzelheit bis zu der intimsten Abtönung unmittelbares Erlebnis ist. Und gerade wenn man solches Geistiges schaut, erlebt man nicht in Vorstellungen, sondern in Worten, in den Tönungen der Worte. Und ich glaube, niemand wird bis zu einer gewissen Lebendigkeit Geistgestaltendes schaffen, dem es nicht möglich wird, sich in die Sprache so hineinzuleben, daß er den Geist der Sprache selber dazu verwenden kann in seiner wunderbaren inneren Vernünftigkeit, in seinem wunderbaren Gestalten des Gefühlsmäßigen, der Willensimpulse, die das Individuelle ergreifen. Wer das nicht zu Hiffe nehmen kann, was schon im alltäglichen Leben in einer unbewußten Art des Daseins als geistiges Vibrieren ist, dem wird es nicht gelingen die Sprache zu benützen, um die geistige Welt darzustellen. Aber man braucht nicht weniger dichterisch zu werden, weil man mit seinen Darstellungen in die geistige Welt hineingeht. Geht man doch damit in die Heimat des Dichterischen, des Künstlerischen hinein.
Aus dem Geistigen und Seelischen ist alles Dichterische entsprungen. Dadurch, daß man vor dem Geistig-Wesenhaften steht, kann nicht verlorengehen das, was an lyrischem Aufschwung, an epischer Wucht, an dramatischer Gestaltungskraft im Menschen leben muß. Nicht kann es ersterben, wenn die Dichtung als Kunst zurück-kehrt in ihre eigentliche Heimat, in das Geistgebiet.
Es folgte nun die Rezitation aus dem Mysteriendrama (Text siehe S.13 ff.).
Rezitation durch Marie Steiner.
SILBENLAUTEN UND WORTESPRECHEN Stuttgart, 29. März 1923
#G281-1967-SE136 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
SILBENLAUTEN UND WORTESPRECHEN
Stuttgart, 29. März 1923
Maß, Zahl und Gewicht des Silbenhaften
#TX
Gestatten Sie, daß wir in diese pädagogisch-künstlerische Tagung heute einfügen eine Probe rezitatorischer und deklamatorischer Kunst, zu der ich einiges, ich möchte sagen, episodisch bemerken möchte.
Es ist immer außerordentlich schwierig, gerade über das Künstlerische auch noch zu sprechen. Das Künstlerische gehört der unmittelbaren Empfindung, der unmittelbaren Anschauung. Es muß aufgenommen werden in unmittelbarem Eindruck. Wenn man also über das Künstlerische spricht, so ist man gewissermaßen bei einer solchen Tagung, die künstlerisch das Erkennen, künstlerisch die ganze Handhabung der Erziehungs- und Unterrichtspraxis klarlegen will, in einer besonderen Lage. Gewiß, alle Vorträge, die hier gehalten worden sind, haben immer betont, daß es sich gerade bei der Waldorfschulpädagogik darum handelt, das künstlerische Element in die ganze Erziehungs- und Unterrichtskunst einzufügen. Der Kunst selber gegenüber - das habe ich schon in meinem ersten Vortrag durchblicken lassen - möchte man aber am liebsten, ich möchte sagen keusch zurückhaltend mit dem künstlerischen Elemente sein. Alle Erörterungen, alle Gefühlsoffenbarungen, alle Willensimpulse der Menschen gehen zuletzt in dasjenige über, was die fortlaufende Strömung der menschheitlichen Kultur- und Zivilisationsentwickelung bildet. Und sie sind enthalten in den drei größten Impulsen alles menschlichen Werdens, alles geschichtlichen Geschehens: in dem religiösen, in dem künstlerischen und in dem Erkenntnisideal. Mit Recht wird gerade in unserer Gegenwart versucht, das Künstlerische zum Träger des Erkenntnisideals zu machen, damit wiederum eine Möglichkeit gefunden werde, aus dem Reiche des Stofflichen, aus dem Reiche des Materiellen hinaufzudringen auch mit der Erkenntnis in das Geistige. Ich versuchte zu zeigen, wie die Kunst der Weg ist, um wirkliche Menschenerkenntnis zu gewinnen, weil das künstlerische
#SE281-137
Schaffen, das künstlerische Empfinden gewissermaßen die Organe sind für echte, wahre Menschenerkenntnis, da Natur in dem Augenblicke, wo sie heraufgeht aus der Fülle der Tatsachen und Wesenheiten des Universums, um gewissermaßen den Menschen zustande zu bringen, selbst zur wirklichen Künstlerin wird. Das darf nicht bloß als Metapher ausgesprochen werden, sondern sollte gerade eine tiefere Welt- und Menschenerkenntnis sein. Wiederum der Kunst gegenüber möchte man sagen: Man wird aufdringlich, wenn man künstlerisch über die Kunst sprechen will. Über die Kunst sprechen, heißt zurückführen das Gesprochene auf eine Art religiösen Erkennens, wobei allerdings das Religiöse im weitesten Sinne aufzufassen ist, so daß es nicht nur das umfaßt, was wir heute mit Recht als eigentlich religiös ansehen, das Verehrende im Menschen, sondern wo es auch das umfaßt, was im höchsten Sinne des Wortes der Humor ist. Aber es muß immer eine Art religiösen Empfindens sein, das vorbereitet die Stimmung für die Kunst. Denn man muß, wenn man über die Kunst spricht, aus dem Geiste heraus sprechen. Wie sollte man denn Kunstwerke höchster Art, wie etwa Dantes «Comedia», irgendwie mit dem Worte treffen, wenn man nicht religiöse Momente in dieses Wort aufnehmen würde.
Das hat man schon gefühit, und gerade recht gefühit bei der Entstehung der Kunst. Kunst ist entstanden in der Zeit, als Wissenschaft und Religion mit ihr, mit der Kunst noch ein Gemeinsames, einheitliches Ganzes bildeten. Wir hören am Ausgangspunkte größter Kunstwerke die Worte, die, ich möchte sagen, wie eine welthistorische Bekräftigung des eben Gesagten erscheinen. Wahrhaftig, aus kosmischem Bewußtsein heraus beginnt Homer seine Dichtung etwa mit den Worten:
Singe, o Muse, vom Zorn mir des Peleiden Achilleus.
Homer singt nicht selbst. Homer ist sich bewußt, daß sich seine Seele erheben muß zu Übermenschlich-Übersinnlichem, und daß er seine Worte als Opfergabe in den Dienst höherer Mächte stellen muß, wenn er wirklicher künstlerischer Dichter werden will. Selbstverständlich hat hiermit die Homerfrage als solche nichts zu tun. Und wenn wir einen langen Zeitraum überblicken und gehen bis zu einem
#SE281-138
der modernen Dichter herauf, so hören wir Klopstock seine «Messiade» beginnen mit einem Worte, das allerdings anders, aber äußerlich formell ähnlich klingt:
Singe, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung,
die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet.
Und indem man mit dem einen Gedicht beginnend zu dem anderen vorschreitet, durchschreitet man diejenige Zeit, in der der Mensch den großen, unermeßlichen Weg gemacht hat vom vollen Hingegebensein an göttlich-geistige Mächte, als deren Umhüllung er sich auf der Erde gefüHt hat, bis zu demjenigen Punkte, wo der Mensch sich begann in seiner Freiheit, nur seine eigene Seele umhüllend, zu fühlen. Aber auch da, im Beginne dieser großen Zeit deutscher Dichtung war es so, daß an das Unsichtbare appelliert hat Klopstock, wie Goethe es getan hat jederzeit, wenn er es auch nicht offen ausgesprochen hat. Und so sehen wir, daß bei den künstlerischen Dichtern selber das Bewußtsein vorhanden ist des Sichversetzens in das Übersinnliche.
Das Übersinnliche aber spricht nicht in Worten. Worte sind unter allen Umständen Prosa. Worte sind unter allen Umständen Glieder einer Rede, Glieder eines Seelenvorganges, der sich der Logik fügt. Logik ist aber da, damit wir die äußeren, sinnlichen Wesen und Vorgänge in ihrer sinnlichen, äußeren Wirklichkeit schauen; daher darf Logik sich in nichts real Geistiges mischen. In dem Augenblicke, wo wir auf dem Wege der Logik den Satz in der Prosa zustande bringen, müssen wir ganz auf der Erde stehen. Denn die geistige Welt spricht nicht in menschlichen Worten. Die geistige Welt geht bloß bis zu der Silbe, nicht bis zum Worte, so daß wir sagen können: Der Dichter ist in einer merkwürdigen Lage. Der Dichter muß sich der Worte bedienen, weil Worte einmal die Werkzeuge der menschlichen Sprache sind, aber indem er sich der Worte bedient, muß er notwendig aus seinem eigentlich künstlerischen Element herausgehen. Das kann er nur dadurch, daß er das Wort wiederum zurückführt zu der Gestaltung des Silbenhaften. In Maß, Zahl und Gewicht des Silbenhaften, also in einer Region, wo das Wort noch nicht Wort geworden ist, wo das Wort sich noch dem Musikalisch-Imaginativ-Plastischen des Überwörtlichen,
#SE281-139
des Geistigen fügt, da waltet der Dichter. Und wenn der Dichter sich doch der Worte bedienen muß, so fühlt er in seinem Inneren, daß er die Wortgestaltungen wieder zurückführen muß auf dasjenige Gebiet, aus dem er herausgetreten ist, indem er von der Silbe eben zum Wort übergehen mußte. Er fühlt, daß er im Reim, in der ganzen Strophengestaltung das wiederum gutmachen muß, wiederum künstlerisch runden, gestalten, harmonisieren muß, was dadurch geschieht, daß man mit dem Worte herauskommt aus Silben-maß und Silbengewicht.
Hier schaut man intim hinein in den Seelenzustand des dichterischen Künstlers. Es fühlt aber auch der wirkliche Dichter - und nicht nur von Platen haben wir ein merkwürdiges Wort, das hinweist auf dasjenige, was ich jetzt eben charakterisieren wollte:
... Weitschweifigen Halbtalenten sind
Präzise Formen Aberwitz; Notwendigkeit
Ist dein geheimes Weihge schenk, o Genius!
Platen ruft den Genius an, indem er darauf aufmerksam macht, wie die Notwendigkeit in der Silbengestaltung nach Maß, Zahl und Gewicht der Silben dem Genius eigen ist, während das ins Prosaische Abschweifen lediglich der Aberwitz der Haibtalente ist, die aber allerdings - ich habe schon darauf aufmerksam gemacht - neunundneunzig Prozent derer ausmachen, die dichten. Aber nicht nur Platen, auch Schiller spricht ein Ähnliches aus mit sehr schönen Worten:
Es hat mit der Reinheit des Silbenmaßes die eigene Bewandtnis, daß sie zu einer sinnlichen Darstellung der innern Notwendigkeit des Gedankens dient, da im Gegenteil eine Lizenz gegen das Silbenmaß eine gewisse Willkürlichkeit fühlbar macht. Aus diesem Gesichtspunkt ist sie ein großes Moment und berührt sich mit den innersten Kunstgesetzen.
Die Notwendigkeit des Silbenmaßes, von ihr spricht Schiller in diesem Satze.
Nun, der Deklamator und Rezitator ist der Interpret des wirklich dichterischen Künstlers. Er muß sich bewußt sein insbesondere dessen,
#SE281-140
worauf ich eben aufmerksam machte; er muß sich bewußt sein, daß er das, was ihm in der Dichtung vorliegt, die ja durch Worte sprechen muß, wiederum zurückführen muß auf Maß, Zahl und Gewicht der Silben. Er muß sich bewußt werden, daß er das, was dann in das Wort ausfließt, wiederum runden muß nach Strophengestaltung und nach dem Reime. Daher kommt es auch, daß in unserer etwas unkünstlerisch fühlenden Zeit eine merkwürdige Art von Deklamationsund Rezitationskunst hat heraufkommen können: dieses prosaische Pointieren eben des Prosasinnes, was unkünstlerisch ist. Denn der wirkliche Dichter geht stets zurück von dem Prosaischen der Worte zu dem musikalischen oder plastischen Element. Schiller hatte immer, bevor er die Worte eines Gedichtes hinschrieb, eine wortlose, unbestimmte Melodie, ein melodiöses Erlebnis der Seele. Das hatte noch nicht Worte, das floß melodiös, musikalisch thematisch hin, und daran reihte er dann die Worte. Man könnte sich denken, daß bei Schiller aus demselben melodiösen Thema die verschiedensten Dichtungen dem Wortinhalte nach hervorgegangen wären. Und Goethe stand vor seinen Schauspielern, als er selbst seine Jambendramen mit ihnen einstudierte, mit dem Taktstock wie ein Kapellmeister, nicht so sehr das Wesentliche sehend in dem Prosagehalt der Worte, als in der Gestaltung der Laute, in dem Wägen der Silben, in dem Musikalischen, Rhythmischen, Taktmäßigen und so weiter. Daher ist es notwendig geworden, daß gerade innerhalb unserer Geistesströmung zurückgegangen werden mußte zu einer wirklichen Rezitations- und Deklamationskunst, wo tatsächlich wiederum heraufgehoben wird das, was auf das Niveau der Prosa wegen des Ausdrucksmittels, dessen sich der Dichter bedienen muß, zurückgesunken war, daß das wiederum zurückgeführt wird auf das Niveau des übersinnlichen Gestalten- und Musikerlebnisses.
Diese Arbeit versuchte Frau Dr. Steiner zu tun, indem sie die Rezitations- und Deklamationskunst so auszubilden versuchte in den letzten Jahren, Jahrzehnten, daß wiederum bei ihr über den Prosa-gehalt hinaus das eigentlich innerlich Eurythmische, die imaginative und musikalische Gestaltung des Silbenmaßes, der Laut-Imagination, der Lautplastik, des Musikalischen herauskommt. Das stellt sich dann
#SE281-141
in der verschiedensten Weise dar für Lyrisches, Episches, Dramatisches. Ich werde darauf noch mit ein paar Worten zu sprechen kommen. Zuerst wollen wir Ihnen aber zeigen, wie im allgemeinen herausgeholt werden kann aus dem wirklich Künstlerisch-Dichterischen das, was hier angedeutet worden ist.
Im ersten Teil dieser Rezitationsprobe wird Ihnen vorgeführt werden «Ostern» von Anastastus Grün, insbesondere dazu geeignet, über den Inhalt hinweg zu der künstlerischen Gestaltung zu führen. Diese heute schon etwas altertümliche Dichtung ist - allerdings im engeren Sinne -, gewissermaßen weil sie eine Art Weihegedicht für Ostern ist, zeitgemäß; doch ist sie nicht zeitgemäß, weil sie einem Zeitalter angehört, das weit in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgeht, aber auch einem Zeitalter, in welchem der Dichter sich noch verpflichtet fühlte, zur Notwendigkeit der rhythmisch-plastischen Gestaltung sich zu bekennen. So mag das Gedicht hingenommen werden, das heute, weil es gewissermaßen antiquierte Vorstellungen enthält, von manchen, die nur auf die Prosa hinhören, langweilig empfunden wird, aber mag die Prosa davon langweilig sein, ein echter Dichter hat versucht, der Notwendigkeit des Innerlich-Künstlerischen in der Dichtung sich zu fügen.
Dann werden wir einen modernen Dichter folgen lassen in dem Gedicht «An eine Rose» von Albert Steffen, ein Sonett. Gerade am Sonett kann man, wenn man will, so recht bemerken, wie das ganze, das vorgeführt wird in Worten, durch die streng geschlossene Form die Sünde wider die Worte wiederum gutmacht, das ganze rundet und harmonisiert; gerade bei einem Dichter, der so wie Albert Steffen zugleich tief hineinschürft in verborgenste Tiefen der Weltanschauung, ist es interessant zu sehen, wie er die Notwendigkeit empfindet, das, was er als einen Erkenntnisweg zutage fördert, in die strengste Kunstform zu gießen.
An den Terzinen von Christian Morgenstern werden wir sehen, wie eine besondere dichterische Form, die Terzinenform, in einem Fortführen des Gestaltenempfindens besteht, während das Sonett in einem Runden der Empfindung besteht, wie die Terzine - schon allerdings gegen den Schluß des Gedichtes hin - etwas Offenes hat, wie die
#SE281-142
Terzine aber das, was im Worte ausfließt, zu einem geschlossenen Ganzen macht.
Und dann darf ich vielleicht noch drei meiner Dichtungen «Frühling», «Herbst» und «Weltenseelengeister» bringen, wo versucht ist, gerade innerlichstes menschliches Seelenerleben in strenge Formen zu bringen, Formen, die nicht diejenigen sind der hergebrachten Poetik oder Metrik, die entnommen sind dem Empfinden selber, die aber, ich möchte sagen, innerhalb des seelischen Lebens das unbestimmt Flutende, Glitzernde des Seelenlebens in eine innerlich strenge Form zu bringen versuchen.
Das soll das erste sein, was Frau Dr. Steiner Ihnen vorbringen wird:
diese sechs mehr lyrischen Dichtungen. «Ostern» ist natürlich eine lange Dichtung, und wir werden Ihnen deshalb nur den fünften Teil dieser Dichtung vorführen.
OSTERN
Und Ostern wird es einst, der Herr sieht nieder
Vom Ölberg in das Tal, das klingt und blüht;
Rings Glanz und Füll' und Wonn' und Wonne wieder,
So weit sein Aug' - ein Gottesauge - sieht !
Ein Ostern, wie's der Dichtergeist sieht blühen,
Dem's schon zu schaun, zu pflücken jetzt erlaubt
Die Blütenkränze, die als Kron' einst glühen
Um der noch ungebornen Tage Haupt !
Ein Ostern, wie's das Dichteraug' sieht tagen,
Das überm Nebel, der das Jetzt umzieht,
Die morgenroten Gletscherhäupter ragen
Der werdenden Jahrtausende schon sieht !
Ein Ostern, Auferstehungsfest, das wieder
Des Frühlings Hauch auf Blumengräber sät;
Ein Ostern der Verjüngung, das hernieder
Ins Menschenherz der Gottheit Atem weht !
Sieh, welche Wandlung blüht auf Zions Bahnen !
Längst hält ja Lenz sein Siegeslager hier;
Auf Bergen wehn der Palmen grüne Fahnen,
Im Tale prangt sein Zelt in Blütenzier !
#SE281-143
Längst wogt ja über all' den alten Trümmern
Ein weites Saatenmeer in goldner Flut,
Wie fern im Nord, wo weiße Wellen schimmern,
Versunken tief im Meer Vineta ruht.
Längst über alten Schutt ist unermessen
Geworfen frischer Triften grünes Kleid,
Gleichwie ein stilles, freundliches Vergessen
Sich senkt auf dunkler Tag' uraltes Leid.
Längst stehn die Höhn umfahn von Rebgewinden,
Längst blüht ein Rosenhag auf Golgatha.
Will jetzt ein Mund den Preis der Rose künden,
Nennt er gepaart Schiras und Golgatha.
Längst alles Land weitum ein sonn'ger Garten;
Es ragt kein Halbmond mehr, kein Kreuz mehr da !
Was sollten auch des blut'gen Kampfs Standarten?
Längst ist es Frieden, ew'ger Frieden ja !
Der Kedron blieb. Er quillt vor meinen Blicken
Ins Bett von gelben Ähren eingeengt,
Wohl noch als Träne, doch die dem Entzücken
Sich durch die blonden, goldnen Wimpern drängt !
Das ist ein Blühen rings, ein Duften, Klingen,
Das um die Wette sprießt und rauscht und keimt,
Als gält' es jetzt, geschäftig einzubringen,
Was starr im ScHaf Jahrtausende versäumt,
Das ist ein Glänzen rings, ein Funkeln, Schimmern
Der Städt' im Tal, der Häuser auf den Höhn;
Kein Ahnen, daß ihr Fundament auf Trümmern,
Kein leiser Traum des Grabs, auf dem sie stehn !
Die Flur durchjauchat, des Segens freud'ger Deuter,
Ein Volk, vom Glück geküßt, an Tugend reich,
Gleich den Gestirnen ernst zugleich und heiter,
Wie Rosen schön, wie Cedern stark zugleich.
Begraben längst in des Vergessens Meere,
Seeungetümen gleich in tiefer Flut,
Die alten Greu'l, die blut'ge Schergenehre,
Der Krieg und Knechtsinn und des Luges Brut.
#SE281-144
Auf Golgatha, in eines Gärtchens Mitte,
Da wohnt ein Pärlein, Glück und Lieb' im Blick;
Weit schaut ins Land, gleich ihrem Aug' die Hütte,
Es labt ja Glück sich gern an fremdem Glück !
Einst, da begab sich's, daß im Feld die Kinder
Ausgruben gar ein formlos, eisern Ding;
Als Sichel däucht's zu grad und schwer die Finder,
Als Pflugschar fast zu schlank und zu gering.
Sie schleppen's mühsam heim, gleich seltnem Funde,
Die Eltern sehn es, - doch sie kennen's nicht,
Sie rufen rings die Nachbarn in der Runde,
Die Nachbarn sehn es, - doch sie kennen's nicht.
Da ist ein Greis, der in der Jetztwelt Tage
Mit weißem Bart und fahlem Angesicht
Hereinragt, selbst wie eine alte Sage;
Sie zeigen's ihm, - er aber kennt es nicht.
Wohl ihnen allen, daß sie 5 nimmer kennen !
Der Ahnen Torheit, längst vom Grab verzehrt,
Müßt' ihnen noch im Aug' als Träne brennen.
Denn was sie nimmer kannten, war ein Schwert !
Als Pflugschar soll's fortan durch Schollen ringen,
Dem Saatkorn nur noch weist's den Weg zur Gruft;
Des Schwertes neue Heldentaten singen
Der Lerchen Epopee'n in sonn'ger Luft !
Einst wieder sich's begab, daß, als er pflügte,
Der Ackersmann wie an ein Felsstück stieß,
Und, als sein Spaten rings die Hüll' entfügte,
Ein wundersam Gebild aus Stein sich wies.
Er ruft herbei die Nachbarn in der Runde,
Sie sehn sich's an, - jedoch sie kennen's nicht ! -
Uralter, weiser Greis, du gibst wohl Kunde?
Der Greis besieht's, jedoch er kennt es nicht.
Ob sie's auch kennen nicht, doch steht's voll Segen
Aufrecht in ihrer Brust, in ew'gem Reiz,
Es blüht sein Same rings auf allen Wegen;
Denn was sie nimmer kannten, war ein Kreuz !
#SE281-145
Sie sahn den Kampf nicht und sein blutig Zeichen,
Sie sehn den Sieg allein und seinen Kranz !
Sie sann den Sturm nicht mit den Wetterstreichen,
Sie sehn nur seines Regenbogens Glanz !
Das Kreuz von Stein, sie stellen's auf im Garten,
Ein rätselhaft, ehrwürdig Altertum,
Dran Rosen rings und Blumen aller Arten
Empor sich ranken, kletternd um und um.
So steht das Kreuz inmitten Glanz und Fülle
Auf Golgatha, glorreich, bedeutungsschwer:
Verdeckt ist's ganz von seiner Rosen Hülle,
Längst sieht vor Rosen man das Kreuz nicht mehr.
Ein Sonett von Albert Steffen
AN EINE ROSE
Ich schaue mich in dir und dich in mir:
Wo ich die Schlange bin, bist du die ,
wir aßen beide von der irdischen Krume,
in dir aß Gott, in mir aß noch das Tier.
Die Erde ward für dich zum Heiligtume,
du wurzelst fest, du willst nicht fort von ihr.
Ich aber sehne mich, ich darbe Her,
ich such im All nach meinem Eigentume.
Du überwächst den Tod mit deinen Farben
und saugst dir ewiges Leben aus dem Boden.
Ich kehre immer wieder, um zu sterben.
Denn ach: Nur durch mein Suchen, Sehnen,
Darben, nur durch die Wiederkehr von vielen Toden,
darf ich um dich, 0 rote Rose, werben.
Terzinen von Christian Morgenstern
Was ist das? Gibt es Krieg? Den Abendhimmel
verfinstern Raben gleich geschwungnen Brauen
des Unhelis und mit gierigem Gekrächz.
#SE281-146
Südöstlich rudern sie mit wilder Kraft,
und immer neue Paare, Gruppen, Völker...
Und drüber raucht's im Blassen wie von Blut.
Wie Sankt Franciscus schweb ich in der Luft
mit beiden Füßen, fühle nicht den Grund
der Erde mehr, weiß nicht mehr, was das ist.
Seid still ! Nein, - redet, singt, jedweder Mund !
Sonst wird die Ewigkeit ganz meine Gruft
und nimmt mich auf wie einst den tiefen Christ.
Dies ist das Wunderbarste, dieses feste,
so scheint es, ehern feste Vorwärtsschreiten -
und alles ist zuletzt nur tiefer Traum.
Von tausend Türmen strotzt die Burg der Zeiten
(so scheint's) aus Erz und Marmor, doch am Saum
der Ewigkeit ist all das nur noch Geste.
Dämmrig blaun im Mondenschlmmer
Berge... gleich Erinnerungen
ihrer selbst; selbst Berge nimmer.
Träume bloß noch, hlnterlassen
von vergangnen Felsenmassen:
So wie Glocken, die verklungen,
noch die Luft als Zittern fassen.
Lyrische Dichtungen von Rudolf Steiner
FRÜHLING
Der Sonnenstrahl,
Der lichterfunkelnde,
Er schwebt heran.
Die Blütenbraut,
Die farberregende,
Sie grüßt ihn froh.
#SE281-147
Vertrauensvoll
Der Erdentochter
Erzählt der Strahl,
Wie Sonnenkräfte,
Die geistentsprossenen,
Im Götterheim
Dem Weltentone lauschen;
Die Blütenbraut,
Die farberglitzernde,
Sie höret sinnend
Des Lichtes Feuerton.
HERBST
Der Erdenieib,
Der Geistersehnende,
Er lebt im Welken.
Die Samengeister,
Die Stoffgedrängten,
Erkraften sich.
Und Wärmefrüchte
Aus Raumesweiten
Durchkraften Erdensein.
Und Erdensinne,
Die Tiefenseher,
Sie schauen Künft'ges
Im Formenschaffen.
Die Raumesgeister,
Die ewig-atmenden,
Sie blicken ruhevoll
Ins Erdenweben.
WELTENSEELENGEISTER
Im Lichte wir schalten,
Im Schauen wir walten,
Im Sinnen wir weben.
#SE281-148
Aus Herzen wir heben
Das Geistesringen
Durch Seelenschwingen.
Dem Menschen wir singen
Das Göttererleben
Im Weltengestalten.
Das Zusammenwirken von Atmung und Blutzirkulation
Bevor der zweite Teil dieser Rezitation versucht wird, darf ich mir erlauben, ich möchte sagen, auf das innere Entstehen des Dichterisch-Künstlerischen in der Menschennatur mit einigen Worten hinzuweisen. Dasjenige, was einer wirklichen Menschenerkenntnis zugrunde liegen muß, ist die Anschauung, wie erstens die Welt, das Universum , der Kosmos an dem Menschen künstlerisch schafft, wie aber auf der andern Seite selber der Mensch die vom Kosmos in ihn gelegte künstlerische Gestaltung in der Kunst wiederum hervorholt.
Zwei Elemente sind es, welche im Menschen zusammenwirken müssen durch die Gewalt des Geistes und der Seele, wenn überhaupt Dichterisches sich gestalten, sich formen soll. Es ist nicht der Gedanke, selbst in den Gedankendichtungen ist es noch etwas anderes als der Gedanke selber, der von dem dichterischen Künstler gestaltet wird. Es ist das Zusammenwirken, das wunderbare Zusammenwirken von Atmung und Blutzirkulation. In der Atmung steht der Mensch ganz und gar mit dem Kosmos in Verbindung. Die Luft, die ich jetzt in mich eingeatmet habe, war vorher noch ein Bestandteil des Kosmos und wird danach wiederum ein Bestandteil des Kosmos werden. Ich nehme den Kosmos in seiner Substantialität in mich herein, gebe das, was eine kurze Weile mein war, wiederum dem Kosmos zurück, indem ich atme. Derjenige, der empfindend erkennen kann diese Atmung, für den ist sie eines der wunderbarsten Geheirunisse in der ganzen Gestaltung der Welt. Aber das, was sich da abspielt zwischen Mensch und Welt, findet seine innere Ausgestaltung in der ja eng an den Atmungsrhythmus gebundenen Blutzirkulation, in dem Rhythmus
#SE281-149
der Blutzirkulation. Und es ist beirn erwachsenen Menschen approximativ, durchschnittlich das Verhältnis von eins zu vier, das sich ausdrückt zwischen dem Atemzuge und dem Pulsschlag: achtzehn Atemzüge, ungefähr achtzehn Atemzüge in der Minute, zweiundsiebzig Pulsschläge. Zwischen beiden wird jene innerliche Harmonie herbeigeführt, die das ganze innerlich schaffende, sich musikalisch erschaffende Menschenleben ausmacht.
Man möchte sagen - damit will ich nicht eine besondere Erkenntnis andeuten, sondern ein Bild: Vor einem entsteht der Lichtgeist, der auf den Fluten der Luft in den Menschen hereinspielt durch die Atmung. Die Atmung greift ein in die Blutzirkulation wie in das geheime Funktionieren des menschlichen Organismus selbst. Apollo, der Lichtgott, getragen von den flutenden Luftmassen im Atmungsprozeß; seine Leier, das Funktionieren der Blutzirkulation selber. Alles dasjenige, was sich dichterisch abspielt, dichterisch gestaltet, beruht in Wirklichkeit auf diesem Verhältnis von Atmung, die innerlich erlebt wird, zur Blutzirkulation, die innerlich erlebt wird. Der Atem zählt die Pulsschläge unterbewußt; die Pulsschläge zählen die Atemzüge unterbewußt, teilen und gliedern, gliedern und teilen da-mit das Maß und die Zahl der Silben. Nicht als ob etwa sich anpassen würde das dichterische Offenbaren, das Sprechen den Atemzügen oder der Blutzirkulation, aber dem Verhältnisse zwischen beiden. Sie können ganz herausfallen, die Silbengestaltungen, aber sie stehen in einem innerlichen Verhältnis zueinander in der dichterischen Kunst, wie Atemwesen und Zirkulationswesen.
Und so sehen wir denn da, wo zuerst heraufkommt die Dichtung in der für uns am leichtesten noch verständlichen Gestalt, im Hexameter, wie in den drei ersten Versgliedern des Hexameters und in der Zäsur die vier zu eins sich in ein Verhältnis stellen. Der Hexameter wiederholt zweimal dieses Verhältnis von Blutzirkulation zu Atmung. Der Mensch nimmt das Geistige auf in sein innerliches Funktionieren, in sein innerlich ureigenstes Betätigen, indem er dichterisch gestaltet, was er in jedem Augenblicke seines Lebens hier auf der Erde ist: das Produkt von Atmung und Blutzirkulation. Das gliedert er künstlerisch in Silbe und Maß, in Silbe und Zahl. Und gerade daraus, ob wir
#SE281-150
nun in die Einheit des Atmens weniger oder mehr Silben lassen, die sich dann wie von selbst reduzieren auf das Naturmaß, indem wir mit anderen Worten das Taktmaß so oder so gestalten, bekommen wir heraus in wirklich dichterischer Weise die Steigerung, die Beruhigung, die Spannung, die Lösung.
Indem wir nach dem uns von dem Kosmos selber gegebenen Maß zwischen Atmung und Blutzirkulation den Vers fortrücken lassen , bekommen wir das Epische; und indem wir dazu aufsteigen, das mehr Innerliche geltend zu machen, also die Atmung mehr zurücktreten lassen, nicht gewissermaßen das Atmungswesen zum Aktiven zu machen, zum Zählenden - zum Zählenden auf der Leier der Blutzirkulation -zu machen, sondern indem wir zurückgehen mit der Atmung in unser Selbst, indem wir das Anschlagen des Blutes zu unserem Wesentlichen machen, so daß man gleichsam an den Einkerbungen des Blutstromes abzählt, bekommt man dann die andere Form der metrischen Kunst heraus. Haben wir es mit der Atmung zu tun, die gewissermaßen ab-zählt die Blutzirkulation, dann hat man es zu tun mit dem Rezitieren. Das Rezitieren fließt in der Gemäßheit des Atmungsprozesses dahin. Hat man es zu tun damit, daß das Blutgemäße das Tonangebende ist, daß das Blut seine Stärke, Schwäche, Leidenschaft, Emotion, Spannung und Entspannung eingräbt in den dahinflutenden Atmungsstrom, dann entsteht die Deklamation: die Deklamation, welche mehr schaut auf die Kraft oder die Leichtigkeit, Stärke und Schwäche der Silbenbetonung, Hochton,Tiefton; die Rezitation, die inGemäßheit des ruhig dahinfließenden Atems, der nur die Blutzirkulation zählt, gewissermaßen das Mitteilende der dichterischen Kunst ist, während das Deklamatorische das Schildernde der dichterischen Kunst ist. Und eigentlich muß sich jeder, der die Vortragskunst ausübt, einer Dichtung gegen-über fragen: Habe ich hier zu rezitieren, habe ich hier zu deklamieren? -Es sind im Grunde genommen zwei ganz verschiedene Kunstnuancen. Das tritt einem entgegen, wenn man sieht, wie der dichterische Künstler selber wunderbar unterscheidet zwischen Deklamieren und Rezitieren.
Vergleichen Sie auf das hin einmal die «Iphigenie», die Goethe in Weimar dichtete, bevor er in Italien bekannt wurde mit der griechischen Kunstart, betrachten Sie die «Iphigenie», die er da niedergeschrieben
#SE281-151
hat: ganz deklamatorisch. Er kommt nach Italien, lebt sich ein in seiner Art in dasjenige, was er griechische Kunst nennt -es ist nicht mehr griechische Kunst -, was er noch als Nachklang der griechischen Kunst empfindet: er dichtet seine «Iphigenie» um im Sinne des Rezitativischen. Indem die Deklamation, die aus dem Blut sprießt, übergeht in die Rezitation, die aus der Atmung sprießt, wird dasjenige, was mehr aus dem Innerlich-Nordischen, aus dem deutschen Gemütvollen hervorgeht, mehr äußerlich künstlerisch durch Maß und Zahl sich offenbaren in der - wie Herman Grimm gesagt hat - «römischen Iphigenie». Und für denjenigen, der künstlerisch empfindet, ist der denkbar größte Unterschied zwischen der deutschen und der römischen «Iphigenie» Goethes. Wir wollen gar nicht heute Sympathie oder Antipathie mit dem einen oder anderen haben, sondern hinweisen auf diesen gewaltigen Unterschied, der dann herauskommen soll in dem, was einem als Rezitation, als Deklamation eines Stückes der «Iphigenie» entgegentritt, das sowohl in der einen als auch in der anderen Gestalt vor Sie hintreten wird.
Den Hexameter selber wollen wir sehen in seiner Gestalt in dem Gedichte « Der Tanz » von Schiller. Das richtig Ebemnäßige, das nicht Hexameter zu sein braucht, wollen wir an einigen Dichtungen Mörikes eben sehen, der ja Lyriker ist, aber leicht zum Balladendichter wird.
Wir können es durchaus empfinden, wenn wir die künstlerische Menschheitsentwickelung überschauen, wie im alten Griechenland, wo der Mensch überhaupt mehr in seiner Naturumgebung lebte, alles zum Rezitatorischen wurde. Das Rezitatorische lebt durch den Atmungsprozeß in Maß und Zahl. In der Innerlichkeit des Nordens, in den Gemütstiefen des mitteleuropäischen Geistes- und Seelenlebens entsteht das Deklamatorische, das da rechnet mehr mit Gewicht und Zahl. Und wenn das Göttliche die Welt bei seinem Schaffen durch-wallt nach Maß, Gewicht und Zahl, so sucht zu erlauschen der Dichter in der deklamatorischen, rezitatorischen Kunst das göttliche Walten auf eine intime Weise im Dichterischen, indem in der Rezitation mehr hingeschaut wurde auf Maß und Zahl, indem in der Deklamation mehr hingefühlt wird auf Zahl und Gewicht innerhalb desjenigen, was sich zum Heben des Gewichtes gestaltet.
#SE281-152
Um das geltend zu machen, werden wir nun zur Darstellung bringen den «Tanz» von Schiller, um den Hexameter zu zeigen; « SchönRohtraut» von Mörike, «Die Geister am Mummelsee», die balladen-haft sind, und dann ein kurzes Stück aus der deutschen und römischen «Iphigenle » Goethes.
DER TANZ
Siehe, wie schwebenden Schritts im Wellenschwung sich die Paare
Drehen ! Den Boden berührt kaum der geflügelte Fuß.
Seh ich flüchtige Schatten, befreit von der Schwere des Leibes?
Schlingen im Mondlicht dort Elfen den luftigen Reihn?
Wie, vom Zephyr gewiegt, der leichte Rauch in die Luft fließt,
Wie sich leise der Kahn schaukelt auf silberner Flut,
Hüpft der gelehrige Fuß auf des Takts melodischer Woge,
Säuselndes Saitengetön hebt den ätherischen Leib.
Jetzt als wollt es mit Macht durchreißen die Kette des Tanzes,
Schwingt sich ein mutiges Paar dort in den dichtesten Reihn.
Schnell vor ihm her entsteht ihm die Bahn, die hinter ihm schwindet,
Wie durch magische Hand öffnet und schließt sich der Weg.
Sieh ! jetzt schwand es dem Blick; in wildem Gewirr durcheinander
Stürzt der zierliche Bau dieser beweglichen Welt.
Nein, dort schwebt es frohlockend herauf; der Knoten entwirrt sich;
Nur mit verändertem Reiz stellet die Regel sich her.
Ewig zerstört, es erzeugt sich ewig die drehende Schöpfung,
Und ein stilles Gesetz lenkt der Verwandiungen Spiel.
Sprich, wie geschiehts, daß rastlos erneut die Bildungen schwanken,
Und die Ruhe besteht in der bewegten Gestalt?
Jeder ein Herrscher, frei, nur dem eigenen Herzen gehorchet
Und im eilenden Lauf findet die einzige Bahn?
Willst du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit,
Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung,
Die, der Nemesis gleich, an des Rhythmus goldenem Zügel
Lenkt die brausende Lust und die verwilderte zähmt.
Und dir rauschen umsonst die Harmonien des Weltalls?
Dich ergreift nicht der Strom dieses erhabnen Gesangs?
Nicht der begeisternde Takt, den alle Wesen dir schlagen?
Nicht der wirbelnde Tanz, der durch den ewigen Raum
Leuchtende Sonnen schwingt in kühn gewundenen Bahnen?
Das du im Spiele doch ehrst, fliehst du im Handeln, das Maß.
#SE281-153
Zwei Balladen von Mörike
SCHÖN-ROHTRAUT
Wie heißt König Ringangs Töchterlein?
Rohtraut, Schön-Rohtraut.
Was tut sie denn den ganzen Tag,
Da sie woH nicht spinnen und nähen mag?
Tut fischen und jagen.
0 daß ich doch ihr Jäger wär' !
Fischen und Jagen freute mich sehr. -
- Schweig stille, mein Herze !
Und über eine kleine Weil',
Rohrtaut, Schön-Rohtraut,
So dient der Knab' auf Ringangs Schloß
In Jägertracht und hat ein Roß,
Mit Rohrtaut zu jagen.
0 daß ich doch ein Königssohn wär' !
Rohtraut, Schön-Rohtraut lieb' ich so sehr. -
- Schweig stille, mein Herze !
Einstmals sie ruhten am Eichenbaum
Da lacht Schön-Rohtraut:
«Was siehst mich an so wutniglich?
Wenn du das Herz hast, küsse mich!»
Ach ! erschrak der Knabe !
Doch denket er: mir ist's vergunnt,
Und küsset Schön-Rohtraut auf den Mund.
- Schweig stille, mein Herze !
Darauf sie ritten schweigend heim,
Rohtraut, Schön-Rohtraut;
Es jauchat der Knab' in seinem Sinn:
Und würdst du heute Kaiserin,
Mich sollt's nicht kränken:
Ihr tausend Blätter im Walde wißt,
Ich hab' Schön-Rohtrauts Mund geküßt ! -
- Schweig stille, mein Herze !
#SE281-154
DIE GEISTER AM MUMMELSEE
Vom Berge was kommt dort um Mitternacht spät
Mit Fackeln so prächtig herunter?
Ob das wohl zum Tanze, zum Feste noch geht?
Mir klingen die Lieder so munter.
O nein!
So sage, was mag es wohl sein?
Das, was du da siehest, ist Totengeleit,
Und was du da hörest, sind Klagen.
Dem König, dem Zauberer, gilt es zuleid,
Sie bringen ihn wieder getragen.
O weh!
So sind es die Geister vom See!
Sie schweben herunter ins Mummelseetal,
Sie haben den See schon betreten ,
Sie rühren und netzen den Fuß nicht einmal ,
Sie schwirren in leisen Gebeten -
O schau!
Am Sarge die glänzende Frau !
Jetzt öffnet der See das grünspiegelnde Tor;
Gib acht, nun tauchen sie nieder !
Es schwankt eine lebende Treppe hervor,
Und - drunten schon summen die Lieder.
Hörst du?
Sie singen ihn unten zur Ruh.
Die Wasser, wie lieblich sie brennen und glühn !
Sie spielen in grünendem Feuer;
Es geisten die Nebel am Ufer dahin,
Zum Meere verzieht sich der Weiher. -
Nur still !
Ob dort sich nichts rühren will?
Es zuckt in der Mitten - 0 Himmel ! ach hiff!
Nun kommen sie wieder, sie kommen !
Es orgelt im Rohr und es klirret im Schilf:
Nur hurtig, die Flucht nur genommen !
Davon !
Sie wittern, sie haschen mich schon !
Es folgte noch die Rezitation aus «Iphigenie auf Tauris», (Text siehe S. 20 ff).
#SE281-155
Es hat einmal jemand, nachdem versucht worden ist, so wie es hier geschieht, die dichterische Kunst zurückzuführen auf das gehobene, vom Übersinnlichen durchtränkte innerliche Spielen des Atmungsgeistes auf dem Zirkulationsgeist, rein äußerlich diese Sache an-hörend, gesagt: Ja, da wird die Dichtung, die dichterische Kunst mechanisiert, auf ein mechanisches Verhältnis zurückgeführt. - Das ist so richtig ein materialistisch gesinntes Urteil unserer Zeit. Man kann gar nicht anders als denken: Da steht auf der einen Seite das Seelisch-Geistige möglichst abstrakt in bekannten Begriffsformen, auf der anderen Seite, um mich des Ausdruckes der klassischen deutschen Zeit zu bedienen, das derb-materiell Konkrete, zu dem auch die menschlichen Organe und auch das menschliche innerliche Funktionieren gehören. - Der aber erst versteht in der richtigen Weise die Zusammenwirkung des Übersinnlich-Geistigen mit dem Sinnlich-Physischen, der überall hineinvibrieren schaut das, was im Geiste sich vollzieht, in die Materie. Wer also spricht wie jener Mann gesprochen hat, kritisierend das, was hindeuten sollte auf das wirklich Musikalische und Imaginative der dichterischen Kunst, hat etwa so gesprochen - so paradox das klingt -, wie wenn einer sagen würde: Es gibt Theologen, die behaupten, Gottes Schöpferkraft sei da, um die derb-materielle Welt zu schaffen. Da materialisiert man Gottes Schöpfer-kraft, wenn man sagt, daß Gott sich nicht zurückhält, die derb-materielle Welt zu schaffen. - So gescheit ist es zu sagen, man materialisiere die dichterische Kunst, wenn man zeigt, wie auf der einen Seite das Geistig-Übersinnliche stark genug ist, um bis in das Materielle, aber rhythmisch-künstlerisch sich gestaltende des Atmungsprozesses hin-einzudringen, so wie Apollo selbst auf der Leier spielt, auf der anderen Seite des Blutprozesses. Da wird wiederum eins das LeiblichKörperhafte des Menschen mit dem Seelisch-Geistigen. Da entsteht nicht abstrakte übersinnliche Anschauung in Wolkenkuckucksheimen, da entsteht wahre Anthroposophie und von ihr getragene anthroposophische Kunst , wenn man sieht, wie in dem Körperlichen des Menschen das Geistige waltet und webt, und wie künstlerisch schaffen heißt: rhythmisieren, harmonisieren, plastizieren dasjenige, was geistig ist in den leiblich-physischen Funktionen. Wiederum wird wahr
#SE281-156
das altgefühlte Wort, daß das Herz mehr ist als dieses physiologisch-anatomische Organ, welches in der Brust sitzt für das äußere Auge, daß das Herz etwas zu tun hat mit dem ganzen Seelenleben des Menschen, dieses Herz als der Mittelpunkt der Blutzirkulation. Wiederum wird gefühlt werden, ebenso wie der Zusammenhang des Herzens mit dem Seelischen, so auch der Zusammenhang des Atmungswesens mit dem Geistigen, wie es eine Zeit einmal gefühlt hat, die selbst noch in der den Leib verlassenden Seele im Tode sah den fortziehenden Atmungsprozeß. Ein gescheites, aufklärendes Zeitalter mag über diese Dinge hinwegkommen, meinetwilien, für eine abstrakte, nicht die Wirklichkeit ergreifende, sondern tote Wissenschaft kann das gelten. Für das Erkennen, das im Sinne der Goetheschen Anschauung zugleich die Grundlage aller wirklichen Kunst ist, für dieses Erkennen muß gelten, daß man wiederum die Einheit zwischen Geistig-Seelischem und Körperlich-Physischem im Menschen nicht nur durchschaut, sondern auch künstlerisch lebendig macht. Abstrakte, tote Wissenschaft begründen kann man, wenn man auf die eine Seite die Materie stellt, auf die andere Seite den Geist. Lebenförderndes Künstlerisches schaffen kann man auf diese Weise nicht. Daher ist unsere Wissenschaft, so berechtigt sie ist für alles Technische und für die Grundlegung alles Technischen, so unkünstlerisch. Daher ist sie so menschenfremd, weil die Natur zur Künstlerin wird, indem sie den Menschen gestaltet.
Das aber liegt zugrunde insbesondere der dichterischen Kunst.
Alliteration und Endreim Unschulds-Urzustand und Sündenfall-Zustand
#G281-1967-SE157 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
Alliteration und Endreim
Unschulds-Urzustand und Sündenfall-Zustand
#TX
Ich darf vielleicht jetzt etwas andeuten, was sich selbstverständlich auch, ich möchte sagen, in mehr gelehrten Worten sagen ließe, aber dazu würde ich lange brauchen. Ich möchte etwas andeuten mit Bezug auf die Entwickelung der dichterischen Kunst durch ein Bild. Das Bild soll mehr sein als ein Bild, soll auf die Wirklichkeit hindeuten. Derjenige, der wirkliche Erkenntnis noch bis in die Kunst hinein erfühlen kann, wird mich verstehen.
Wir reden vom menschlichen Sündenfall. Wir reden davon, wie sich der Mensch herausgerissen hat aus jenen Regionen, wo er noch unter dem unmittelbaren Einfluß der Gottheit lebte, wo noch die Gottheit in seinem Willen waltete. Wir reden vom Sündenfall als allerdings dem notwendigen Vorbereitungsstadium der Freiheit, aber wir reden doch so vom Sündenfall, daß dadurch der Mensch, indem er gottverlassen wurde, nicht mehr in seinen Worten diejenige Kraft hatte, die das Göttliche unmittelbar durch das Weben seines Wortes selber webte. Wir reden von dem Sündenfall, weil wir fühlen, daß in unseren Gedanken heute etwas ist, was in Urweltzeiten für die Menschheit nicht war. Da webte noch in wehenden, wallenden menschlichen Gedanken die Kraft des göttlichen Geistigen selber. Da fühlte der Mensch noch, indem er dachte, denke Gott in ihm. Mit der Erringung der menschlichen Selbständigkeit, besonders mit ihrer Vorbereitung, war das gegeben, was wir den Sündenfall nennen. Aber immer hat die Menschheit sich zurückgesehnt nach demjenigen, was der Unschulds-Urzustand war. Und insbesondere dann, wenn sie sich erhob, und namentlich wenn sie sich religiös, aber auch künstlerisch erhob zu dem Übersinnlichen, wurde das empfünden zu gleicher Zeit als ein Zurückgehen zu dem Unschulds-Urzustand. Und wenn Homer sagt: Singe, 0 Muse, vom Zorn mir des Peleiden Achilleus - so ist das das Sich-Zurückversetzen in jene Zeit, in welcher der Mensch auf jenem Weltenniveau gelebt hat, auf dem er unmittelbaren Umgang, weil er selber ein seelisch-geistiges Wesen war, mit den Göttern
#SE281-158
hatte. Das alles entsprach nun doch einer Realität. Und in der Kunst sah der Mensch die lebensvolle Rückerinnerung an jene Unschulds-Urzeit. Das dringt hinein bis in die Einzelheiten des Künstlerischen und insbesondere des Dichterischen, das so verwoben ist mit dem intimsten menschlichen Erleben.
Schauen wir auf eine spätere Zeit. Schauen wir auf die Zeit, in der, sagen wir, unsere Dichter schaffen. Sie tendieren hin nach dem Reim. Warum? Weil, wenn der Mensch weben und leben würde künstlerisch-dichterisch auf dem Niveau des Göttlich-Geistigen im Unschulds-Urzustand, er bei der Silbe, ihrem Maß, Zahl und Gewicht bleiben müßte. Aber er kann es nicht. Der Mensch ist aus dem Unschulds-Urzustand des Silbenlautens übergegangen in den Sündenfall-Zustand des Wortesprechens, das zugeneigt ist der äußeren physisch-sinnlichen Welt. Dichterisch schaffen heißt, sich wiederum zurücksehnen zu dem Unschulds-Urzustand. Muß man aber doch in die Sündenfaliszeit herein singen und sagen, dann muß man, ich möchte sagen, wiederum Buße tun. Man muß ins Wort heraus, ins Prosaische, man muß Buße tun, tut es mit dem Endreim, mit der Strophengestaltung. Aber indem wir in alte Zeiten zurückgehen, wo die Menschheit noch in jenen Zuständen lebte, in denen sie dem Unschulds-Urzustand näher war, war es wenigstens für viele Völker , ganz besonders aber für die germanischen Völker anders. Da ging man nicht erst im Endreim und in der Strophengestaltung mit seinem Singen zurück in den Unschulds-Urzustand, um Buße zu tun für das Prosaische des Wortes. Da blieb man stehen vor dem Worte, wendete das seelische Empfinden, bevor das Wort wurde, nach der Silbe, ging gewissermaßen nicht durch die Buße, durch die Sühne, sondern durch die lebendige Erinnerung zurück zum Unschulds-Urzustand in der alliterierenden Dichtung, in der Alliteration. Es ist die alliterierende Dichtung jene Sehnsucht des Menschen, mit der dichterischen Sprache in der Silbe stehenzubleiben, nicht bis zum Wort zu kommen, die Silbe anzuhalten und im Anschlagen der Silben die innerlichen Harmonien des Dichterischen zu erringen. Man möchte sagen, Alliteration und Endreim verhalten sich im dichterischen Empfinden wie ein Sich-Zurückversetzen in den Unschulds-Urzustand mit der Alliteration
#SE281-159
und einem Sühne-, Bußetun für den Sündenfall im Worte durch den Endreim, durch die Strophengestaltung.
Es ist schon so, daß das Künstlerisch-Dichterische das Allgemein-Menschliche voll umfaßt. Deshalb ist es so schön, zurückgehen zu können zu den Zeiten nordischer Dichtung, wo tatsächlich in dem Leben der Alliteration die dichterischen Kräfte des Volkes selber Zeugnis ablegen wollten dafür, daß der Mensch seinen göttlich-geistigen Ursprung anerkennt, indem er nicht in der Dichtung von der Silbe zum Wort gehen will, sondern in der Silbe sich hält im Alliterieren.
Im 19. Jahrhundert hat, wie Sie wissen, Wilhelm Jordan versucht, nachdem unsere Sprache weit vorgeschritten war über die Möglichkeit, in den früheren Unschulds-Urzustand überzugehen, die Alliteration wiederum zu erneuern. Es ist ein außerordentlich löblicher Versuch von der einen Seite, wenn man sich nur immer bewußt bleibt, daß es eben der Versuch ist, einen Götterschatz in einer Zeit zu heben, für die der Mensch schon sehr fremd den Göttern geworden ist. Dennoch liegt ein guter, ein bester künstlerischer Wille, der wohl hinein-zutragen versteht die Kunst in das Allgemein-Menschliche, in diesem Versuch Wilhelm Jordans. Nun, ich habe noch selbst gehört, wie von Jordan diese Alliterationen gesprochen sein wollten; ich habe insbesondere von seinem Bruder diese Jordanschen Alliterationen sprechen gehört. Ich glaube aber doch, daß es gut ist, wenn man versucht, nur soweit gerade die Alliteration zu sprechen, als sie für unsere schon weitergebildete Sprache noch möglich ist. Das wurde auch auf dem Gebiet der Rezitationskunst, die Frau Dr. Steiner gepflegt hat in den letzten Jahrzehnten, versucht. Daher wird sie Ihnen jetzt noch eine Probe aus den Dichtungen Wilhelm Jordans zu geben versuchen, um auch zu zeigen, wie die Alliteration sich hineinstellt in das ganze Gebiet des dichterischen Schaffens, und wie man versuchen muß, den alliterierenden Dichter zu interpretieren von dem Deklamatorischen beziehungsweise Rezitatorischen aus. Man wird nicht in der Weise, wie sein Bruder es getan hat, das treffen können, was gewollt ist, so naseweis das sich auch ausnimmt, wenn man es ausspricht. Es muß doch mehr gehört werden auf den Sprachgenius als auf das, was aus
#SE281-160
einem allerdings außerordentlich gut gemeinten dichterischen Willen kommt, der aber nicht immer mit dem Sprachgenius - ich meine jetzt nicht die Dichtung, sondern die Rezitation durch den Bruder - einig war. Auf der andern Seite zeigt es, wieviel Kraft, Urkraft in jenem Sinne, wie einstmals Johann Gottlieb Fichte von der deutschen Sprache gesprochen hat, diese deutsche Sprache auch noch heute hat, wenn man sie zu handhaben versteht. Gerade dieses, wieviel Urkräftiges Wilhelm Jordan in der Alliteration dieser Sprache hat abringen kÖnnen, tritt wirklich ganz besonders stark hervor in jener Dichtung und kann uns zu gleicher Zeit in schwerer Zeit ein Trost sein durch die noch unverbrauchte Sprachkraft, die gerade in Mitteleuropa liegt. Ein Trost, weil es in unser Herz die Überzeugung gießen kann: Was auch über Mitteleuropa äußerlich materiell hereinbrechen mag, der deutsche Geist ist nicht verglommen, der deutsche Geist hat ursprüngliche, urkräftige Gewalten in sich. Und er wird sie zur rechten Zeit finden.
Gesucht wurden sie im schönsten Sinne des Wortes doch auch von einem solchen Dichter, der wiederum, ich möchte sagen, die dichterische Unschulds-Vorzeit betreten wollte mit der Erneuerung der Alliteration. Wollen wir nun noch eine Probe alliterierender Dichtung zum Schluß hören.
Tcxt siehe S. 116/17.
II MARIB STEINER SEMINAR Januar / Februar 1928
#G281-1967-SE161 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
II
MARIB STEINER SEMINAR
Januar / Februar 1928
#TX
Es kommt nicht darauf an,
das Vorübergehende zu beobachten,
sondern das Ewige,
das in dem Menschen lebt,
muß immer mehr und mehr
beobachtet werden.
Marie Steiner
#SE281-162
#TI
VORBEMERKUNG
#TX
Das «Seminar» - die Bezeichnung stammt von Frau Dr. Steiner - kam dadurch zustande, daß diese durch einen Armbruch für einige Zeit verhindert war, zu den täglichen Unterrichtsstunden im Saal der Rudolf Steiner-Halde heraufzukommen, und deshalb einen Kreis von etwa zwölf bis vierzehn Persönlichkeiten - zum Teil Mitglieder ihrer Dornacher Schauspielgruppe, zum Teil aber auch solche, die bereits in verschiedenen Städten auf sprachlichem Gebiet tätig waren - nach Haus Hansi [- die erste Stunde fand am 18. Januar um 3% Uhr statt -] berief, um mit ihnen die Textbeispiele für das Buch «Rudolf Steiner: Die Kunst der Rezitation und Deklamation», das sie damals gerade herausgab, durchzuarbeiten, wesentlich im Hinblick auf ein späteres Unterrichten. Dieser Kursus, so sprühend lebendig, trug zugleich - durch die beschränkte Zahl der Teilnehmerinnen - einen ganz intimen, menschlich persönlichen Charakter. Wir waren alle Anfänger, erst kurze Zeit, ca. anderthalb Jahre ihre Schüler.
Die vorliegenden stichwortartigen Aufzeichnungen waren gedacht für befreundete Kollegen, die nicht an den Stunden teilnehmen konnten, um ihnen wenigstens einen kleinen Eindruck von dieser Arbeit zu vermitteln. Es handelt sich bei allem um Korrekturen an dem von uns Versuchten, die im augenblicklichen Tätigsein - richtungweisend - für uns gegeben wurden.
Gertrud Redlich
#SE281-163
Einige Notizen zu den SPRACHÜBUNGEN, im Hinblick auf späteres
Unterrichten:
Artikulationsübungen
Den Atemstrom sollte man erst in einer späteren Stunde erwähnen. Versuchen Sie vorn auf den Lippen zu sprechen, gut zu artikulieren, damit Sie die Sprache nach vorn bringen. Die zwei Hauptfehier, die auftreten, sind Gaumenanklang und Kopfanklang.
Daß er dir log uns darf es nicht loben
Nimm nicht Nonnen in nimmermüde Mühlen
Das I mit den Konsonanten herausführen, N und M führen den I-Laut gut heraus, verspüren Sie die Richtungen. Hüllen Sie das I mit N und M ein. Diese Konsonanten schwingen und nehmen das I mit.
Hören lernen!
Redlich ratsam
Rüstet rühmlich
Riesig rächend
Ruhig rollend
Reulge Rosse
nur artikulieren. Zunächst aufpassen auf die Konsonanten, damit sie die Vokale herausführen. Dann kann man den Schülern sagen, daß sie mehr im Vokal leben, erfühlen, erleben die Laute, im Laute drin sind.
Luftteig kneten
Protzig preist
Bäder brünstig
Polternd putzig
Bieder bastelnd
Puder patzend
Bergig brüstend
#SE281-164
Atemübungen
Erfüllung geht
Durch Hofinung
Geht durch Sehnen
Durch Wollen
Wollen weht
Im Webenden
Weht im Bebenden
Webt bebend
Webend bindend
Im Finden
Findend windend
Kündend
Diese Übung kann Kurzatmigen sehr helfen, sie muß voll klingen. Die Atembehandlung ist das Gegenteil wie beim Sänger, der den Atem dirigiert. Hier muß man ihn auf einmal verausgaben lernen. Dadurch erreicht man Fülle und Rundung.
Die Atemübungen lehren uns musikalisch zu sprechen. Man muß gegenständlich werden bei den Übungen, nichts Balladenhaftes, Pathetisches oder Lyrisches hereinbringen, nüchtern und prosalsch aber gegenständlich lautlich sprechen. Keine Tonhöhen nehmen, die gefühlsmäßig wirken. Bildhaftes ist hier nicht unbedingt nötig.
In den unermeßlich weiten Räumen,
In den endenlosen Zeiten,
In der Menschenseele Tiefen,
In der Weltenoffenbarung:
Suche des großen Rätsels Lösung.
Die vier ersten Zeilen schwingend, besonders N gut benutzen. Horizontale erleben bei «in den Zeiten», Vertikale bei «in den Tiefen», große Woge nach unten, ein großes 0 bei «Weltoffenbarung».
Mitteilung bei der letzten Zeile gegenständlich.
Das Dahinströmen des Atems muß einen mitnehmen, «Menschen-seele Tiefen» etwas tiefer schattieren, Ton und Atem hinunter. Die Sprache braucht Eindringlichkeit, ein Hineinbeziehen des anderen, ein in die Vokale sich liebevolles Hineinlegen.
#SE281-165
Man braucht für diese Übung einen starken Atem, man lernt mit der Einatmung sprechen und das gestalten. « Suche» etwas erhellen. Aufforderung, Ernst ! Erste Zeilen - Hinausgehen in den Kosmos.
Geläufigkeitsübungen
Laile Lieder lieblich
Lipplicher Laffe
Lappiger lumpiger
Laichiger Lurch
Erleben Sie die Wellen, die das L schlägt, es bringt dadurch den Ton heraus. Entwickeln Sie Freude an den Dingen. Die Übung ist sprudelnd und im Affekt, etwas bildhaft zu sagen - affektiv-humoristisch.
Die Geläufigkeitsübungen muß man abschnurren lernen, sie sollen die Sprachwerkzeuge biegsam machen.
Auf den Lippen sprechen, vorn ansetzen, leicht abschnurren !
Die Artikulationsübungen sollen zum Bewußtsein der Sprachwerkzeuge bringen. Die Stimme soll sich allein am Laut stellen.
Pfiffig pfeifen
Pfäffische Pferde
Pflegend Pflüge
Pferchend Pfirsiche
Pfiffig pfeifen aus Näpfen
Pfäffische Pferde schlüpfend
Pflegend Pflüge hüpfend
Pferchend Pfirsiche knüpfend
Kopfpfiffig pfeifen aus Näpfen
Napfpfäffische Pferde schlüpfend
Wipfend pflegend Pflüge hüpfend
Tipfend pferchend Pfirsiche knüpfend
Ketzer petzten jetzt kläglich
Letztlich leicht skeptisch
Ketzerkrächzer petzten jetzt kläglich
Letztlich plötzlich leicht skeptisch
#SE281-166
Auch vorn auf den Lippen und leicht.
Schlinge Schlange geschwinde
Gewundene Fundewecken weg
Gewundene Fundewecken
Geschwinde schlinge Schlange weg
Ganz leicht, vorn.
Zuwider zwingen zwar
Zweizweckige Zwacker zu wenig
Zwanzig Zwerge
Die sehnige Krebse
Sicher suchend schmausen
Daß schmatzende Schmachter
Schmiegsam schnellstens
Schnurrig schnalzen
Zu einer auch russisch sprechenden Teilnehmerin: Das R weniger rollen. Der Deutsche muß das R nach den Nachbarkonsonanten stirnmen können. Nach vorn bringen !
Nur renn nimmer reuig
Gierig grinsend
Knoten knipsend
Pfänder knüpfend
Man soll diese Übungen benutzen, um zu spüren, in welcher Region man spricht.
Noch einmal Atemübungen
Es ist sehr wichtig, daß man auch gute Konsonantenverbindungen schafft, in denen der Laut (Vokal) leben kann. Man lernt allmählich eine Atemerfühlung ohne Gehaltensein durch die Vorstellung. Dafür ist es gut, einige Worte umgekehrt zu üben:
wollen - nellow, eva - ave usw.
Bei «Erfüllung» Atem loslassen lernen, sich fallen lassen mit dem Atem in die Worte.
Wir müssen allmählich erreichen Bewußtseinsdurchdringung.
Atemübungen dienen zum Bewußtmachen des Atemstromes.
Artikulationsübungen zum Bewußtmachen der Sprachwerkzeuge.
#SE281-167
Bei den «Unermeßlichen» kommt noch hinzu ein Dirigieren des Atems. Die Worte werden wie die Kähne über die Wellen gesteuert, allrnähliches Anschwellen bis zur vierten Zeile.
Wenn man den Schülern von der Atembehandlung erzählt, möge man sagen, daß man auf keine Methode eingeschworen ist. Man lernt den Atem an den Lauten selbst üben, er richtet sich von selbst, wenn die Laute gut gesprochen werden.
Den Atem halten lernt man an den fünf Vokalen in einem durch-gehaltenen Atemstrom: A - E - I - 0 - U.
Sende aufwärts
Sehnend Verlangen -
Sende vorwärts
Bedachtes Streben -Sende rückwärts
Gewissenhaft Bedenken.
Lernen Sie mit dem Atem schwimmen und die Laute schwingen hören. Man sollte gleich bei «Sende» hinein ins
Modulieren. Fühlen Sie, was Konsonantenverbindungen an jedem Vokal machen, zum Beispiel: n-d bei sende.
Drei Stimmlagen nehmen !
Nicht die Dinge an einer Schnur halten, die Laute fühlen und mit ihnen schwingen. Der Strom der Bewegung muß einen mitnehmen. In diesen Sachen steckt Wesenhaftigkeit.
Dieses Wesen muß einen mitnehmen, nicht wir dürfen es ans Herz drücken.
Wäge dein Wollen klar,
Richte dein Fühlen wahr,
Stähle dein Denken starr:
Starres Denken trägt,
Rechtes Fühlen wahrt,
Klarem Wollen folgt
Die Tat.
Beim Sprechen der letzten Zeile wegführen vom Musikalischen in die Bewegung.
#SE281-168
Richte dein Fühlen wahr: seelische Linie.
Stähle dein Denken starr: rhythmisch ! Die Laute selbst stellen die Stimme, man muß sich nur hingeben. Die Stimme stellt sich nach den Lauten. Was vorangeht und folgt, färbt immer auf die Dinge ab.
Man sollte allmählich Sinn entwickeln für den Unterschied von künstlerischen Linien und intellektuellem und gefühlsmaßigem Sprechen. Man muß lernen mit dem Ich durch bis zum Schluß zu gehen und nicht immer intellektuell abbrechen.
Bei der Darstellung von Stimmen aus dem Jenseits, zum Beispiel Engel oder Madonnen und so weiter, müßte man lernen halt zu machen, bevor es ganz in die Vorstellung kommt. Sentimentalität stoppt gleich und ist selbstgenießerisch, ist deshalb nicht geistig wahr. Bewegung macht wahr.
Klarem Wollen folgt: künstlerisch anschauen, nicht selber wollen !
Du findest dich selbst:
Suchend in Weltenfernen,
Strebend nach Weltenhöhen,
Kämpfend in Weltentiefen.
Erste Zeile aus dem wollenden Bewußtsein. Der Atemmensch geht durch alle Inkariationen weiter, er ist geistger als der Gefühlsmensch.
Der Base Nase aß Mehl
Rasen Masse kratze kahl
Das A lang und stark hinein. Die Übung ist eigentlich gegen nasales Sprechen, aber auch als A-Ühung gedacht.
Sturm-Wort rumort um Tor und Turm
Molcb-Wurm bohrt durch Tor und Turm
Dumm tobt Wurm-Molch durch Tor und Turm
geht jener Übung voran. Sie ist auch sehr geeignet, um im Atem-strom zu sprechen. Nuancieren ! Erste Zeile nicht dramatisch, sondern im Sprachstrom ganz dunkel, wie der Wind, der umgeht. Molch-Wurm bohrt: nicht seelisch, nicht dramatisch. Laut. Bewegung - Atem.
Dumm tobt: ganz dunkel, dumpf und stoßig.
#SE281-169
Beim 0 muß der harte Gaumen eine Wölbung machen.
Diese drei Zeilen sind alle auf U gestimmt, nur in der Bewegung verschieden; das U muß sich über das 0 legen.
Man muß immer eine Steigerung zum Schluß haben (Molch-Wurm -Wurm-Molch).
Ei ist weißlich, weißlich ist Ei
Blei ist neu im Streu, neu im Streu ist Blei
Die Maid ist bläulich, bläulich maidlich
ist eine gute Übung für gequetschte Laute. Einfach und gegenständlich und hinaus.
Hitzige strahlige stachelige
Sturzstränge stützen
Straff Netze nützlich als
Stramme Tatzen streng
Gefalzt
eine starke Artikulationsübung ! Gut für schlaffe Gaumensegel. Der Wechsel vom Stoß- und Blaselaut mit dazwischen gestreuten L und R strafft das Gaumensegel. Ansatz vorn, übungsmäßig, nicht dichterisch, ganz vorbei am Sinn ! Die Vokale gehen in die Konsonanten hinein und werden von ihnen bezwungen.
Für spitze und scharfe Stimmen:
Walle Welle willig
Leise lispeln lumpige Lurche lustig
Zart mit L fließen, Wellenbewegung spüren, L und W bringen hinaus.
Ist strauchelnder Stern
Meister mystischer Stufen
Stell stets ernsten Strebens
Sternstraße standhaft
Still streng stehend
Vor Stufen steten Strebens
In ständiger Stimmung
Nach vorn den Laut bringen, ganz ohne innere Mitempfindung. In die Konsonantenverbindungen gehen und recht schön biegen. Die Übung ist gut für Stotternde.
#SE281-170
Weiße Helligkeit scheinet in die schwarze Finsternis
Die schwarze Finsternis ergreift die fühlende Seele
Die fühlende Seele ersehnet die weiße Helligkeit
Die weiße Helligkeit ist der wollende Seelentrieb
Der wollende Seelentrieb findet die weiße Helligkeit
In der weißen Helligkeit webet die sehnende Seele
um nuancieren zu lernen ! Man muß immer wieder zum sich wieder-holenden Rhythmus zurückführen, den Atemstrom fließen lassen, der wie ein Wind durchgeht und die Phantasie für Nuancen gebrauchen; auch lernen, hin und wieder Pausen zu machen. Bewegung, Bewegung - nicht in Gesang kommen!
Wie erklären Sie den Hexameter Ihren Schülern? Er ist das Urversmaß. Der menschliche Organismus an sich löst das Rätsel, das im Versmaß gegeben ist. Man kann das Versmaß zurückführen auf den menschlichen Organismus, Atem und Pulsschlag. Auf einen Atemzug kommen vier Pulsschläge.
Geübt die ersten Zeilen der «Achilleis» t'on Goethe.
Hoch zu Flammen entbrannte die mächtige Lohe noch einmal
Strebend gegen den Himmel, und Ilios' Mauern erschienen
Rot durch die finstere Nacht; der aufgeschichteten Waldung
Ungeheures Gerüst, zusammenstürzend, erregte
Mächtige Glut zuletzt. Da senkten sich Hektors Gebeine
Nieder, und Asche lag der edelste Troer am Boden.
In jedem Hexameter sind zwei Atemz:üge und zwei mal vier Puls-schläge (drei Daktylen und eine Zäsur). Beispiel: «Singe, 0 Muse, vom Zorn mir...»
Das Verhältnis i>on Pulsschlag zu Atem ist die Grundlage für das Einwirken höherer Wesenheiten durch Blut und Atmung.
#SE281-171
Wir wollen nun versuchen, die UNTERSCHIEDE VON REZITATION UND
DEKLAMATION verstehen zu lernen am Üben der beiden «Iphigenien».
Aus «Iphigenie»
(Weimarische Fassung):
Heraus in eure Schatten, ewig rege Wipfel des heiligen Hains, wie in das Heiligtum der Göttin, der ich diene, tret' ich mit immer neuem Schauer, und meine Seele gewöhnt sich nicht hierher !
(Römische Fassung):
Heraus in eure Schatten, rege Wipfel
Des alten, heil'gen, dichtbelaubten Haines,
Wie in der Göttin stilles Heiligtum,
Tret' ich noch jetzt mit schauderndem Gefühl,
Als wenn ich sie zum ersten Mal beträte,
Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher.
Die «römische Iphigenie»lebt im Gleichmaß des Metrischen, bei der «deutschen Iphigenie» muß ich wölben, spitzen, steigern aus dem inneren tonhaften Willenselement, das sich wölbt und spitzt zu Ende des Satzes (damare). Hier ist es ein Angehen gegen das Bedrückende.
Versuchen Sie künstlerische Linien zu verstehen und zu entwickeln. Der Inhalt der beiden Iphigenien ist derselbe, die künstlerische Linie eine andere.
Bei der deutschen: Hochton und Tiefton, starkes Leben in der Aus-atmung, Herausstoßen des Atems. Bei der römischen ein musikalisches Dirigieren und Benutzen der Einatmung. Es darf nicht bis zur Vorstellung kommen, das Bild wird abgefangen auf dem Wege zur Vorstellung, man atmet in die von selber einströmende Luft herein aus.
Damit es Deklamation wird, muß man den Willen aufhalten und nicht in die Außenwelt strömen lassen. Damit es Rezitation wird, die Vorstellung aufhalten, im musikalischen Genuß bleiben.
Mit der Einatmung ist alles Geistige zu sprechen, zum Beispiel die Wochensprüche von Rudolf Steiner.
#SE281-172
Der Genuß besteht im musikalisdhen Handhaben, nidht im Genuß der eigenen Persönlichkeit. Dann wird alles realer, edler und wahrer. Wir lernen allmählich mit dem Bewußtsein alle Regionen durchleuchten. Im dahinströmenden Atem löst sich die Plastik musikalisch auf.
Zwei Gedichte werden geübt, eines rezitatorisch, eines deklamatorisch.
Goethe: «Charon» - rezitatorisch (Text siehe S. 31)
«Olympos» - deklamatorisch (Text siehe S. 30)
Davor einige Sprachübungen: Hitzige strahlige I Walle, Welle I Ist strauchelnder I Weiße Helligkeit (Texte siehe S. 169/70)
«Olympos»ist ganz: aus dem Volksmäßigen, Epischen gestaltet, das alles aus dem Willen herausstößt, blutsmäßig, turmhaft steigernd. Pausen ! Großartige Bilder, die wie hingeworfen werden, rauh, eckig, hart wie zackige Gebirge. Wille und Verachtung. Den Raubvogel muß man charakterisieren, er frißt die Kadaver, tonlos, nur im Atem. Setzen Sie beim Gaumensegel an und wölben Sie, machen Sie den harten Gaumen flacher.
« Charon» ist rezitatorisch, metrisch. Hier kommt die Antike herein , es sind gesetzte, verdaute Bilder, das andere Gedicht lebt mitten im modernen Geschehen.
Bei «Charon» ist es mehr das Rhythmische, das die Sache führt , mehr das Musikalische, Stimmung und Malerei, nicht Hoch- und Tief-ton, aber nicht immer dasselbe Tempo, sonst bekommt man keine Nuancen. Nicht seelisch, Abwehrbewegungen im metrischen Gleichmaß und dunkle Schattierung.
«Heidenröslein» (Goethe); «Erlkönigs Tochter» (Herder) (Texte siehe S. 28/29) «Heidenröslein» draußen, in der Luft, im Ton gestalten, aber nicht den Ton halten. Es ist Bewegung und Bild. Sehen Sie stark das Bild. Den kleinen Dialog etwas dramatisch, hier kommt das deklamatorische Willenselement herein. Volksliedartig besonders im Refrain.
« Erlkönigs Tochter»: es ist episch mit stark dramatischem Einschlag. Man muß das dramatische Element und die Stimmung herausarbeiten.
#SE281-173
Die Behandlung ist rezitatorisch mit stark dramatischem Einschlag. Dramatisch wird es, wenn bei irgendeiner Persönlichkeit Eigenleben auftritt. Wenn man sich aber vom persönlichen Temperament fortreißen läßt, ist man aus dem Stil gefallen. Nicht aus dem Rhythmus fallen, der das Ganze veredelt. Rhythmus enthält die verschiedenartigsten Bewegungen. Das Dramatische verführt, man vergißt, stilvoll zu bleiben. Im ganzen Gedicht herrscht eine geheimnisvolle Märchen- und Sagen-stimmung, deshalb muß man die Vokale in die Konsonanten schlüpfen lassen. Das Gedicht enthält viele Möglichkeiten zu differenzieren. Konfigurieren Sie so, daß man Unbedeutendes fallen läßt und das Tempo wechselt. Machen Sie Pausen, damit Stimmung entsteht. Diese Menschen - Mutter, Braut - haben Ahnungen, diese können Sie in den Pausen gestalten.
Ein Rezitator muß alle Fächer beherrschen, er muß differenzieren können. Nicht die Vokale so stark ausarbeiten, dann sind sie durchsichtiger. Lassen Sie sie in die Konsonanten schlüpfen. Der Schmerz der Mutter ist aus der Willensregion zu gestalten, vom Persönlichen abgelöst. Das ist eine Angelegenheit des Atems und der Technik. In den Lauten leben lernen, nicht so mit dem Inhalt verbunden sein. Es handelt sich um ein gespenstisches Geschehen, dies gibt die Farbe. Man muß es interessant machen, Hintergründe aufdecken. Machen Sie bei der Mutter die Diphthonge durchsichtig, dann läßt man Geistiges durchscheinen und das Ganze wird edler.
Beim Durchstoßen der Vokale kommt immer das Geistige herein.
DIE SPRACHE
Als höchstes Wunder, das der Geist vollbrachte,
Preis' ich die Sprache, die er, sonst verloren
In tiefste Einsamkeit, aus sich geboren,
Weil sie allein die andern möglich machte.
Ja, wenn ich sie in Grund und Zweck betrachte,
So hat nur sie den schweren Fluch beschworen,
Dem er, zum dumpfen Einzelsein erkoren,
Erlegen wäre, eh' er noch erwachte.
#SE281-174
Denn ist das unerforschte Eins und Alles
In nie begriff'nem Selbstzetsplitt'rungsdrange
Zu einer Welt von Punkten gleich zerstoben:
So wird durch sie, die jedes Wesenballes
Geheimstes Sein erscheinen läßt im Klange,
Die Trennung völlig wieder aufgehoben !
Friedrich Hebbel
Bei diesem Sonett müssen wir ruhig sein, nicht begrifflich, sondern biegsam und musikalisch plastisch lösen. Mit der Einatmung sprechen, dann entsteht gleich Fülle, und kleine Pausen machen. Die Pausen am richtigen Fleck künstlerisch gestalten, nicht unmotiviert einatmen.
A-Stimmung aus dem wollenden Bewußtsein gesättigte Begeisterung durch die Erfahrung. Das Gedicht ist sehr streng; die Infiektionen nach unten geben die Reife. Hebbel ist herb.
Man muß immer die Grundstimmung des Dichters in den Gedichten haben.
AN DEN ÄTHER
Allewiger und unbegrenzter Äther !
Durch's Engste, wie durch's Weiteste Ergoß'ner !
Von keinem Ring des Daseins Ausgeschloß'ner !
Von jedem Hauch des Lebens still Durchwehter !
Des Unerforschten einziger Vertreter !
Sein erster und sein würdigster Entsproß'ner !
Von ihm allein in tiefster Ruh' Urnfloß'ner !
Dir gegenüber werd' auch ich ein Beter !
Mein schweifend' Auge, das dich gern umspannte,
Schließt sich vor dir in Ehrfurcht, eh' es scheitert,
Denn nichts errnißt der Blick, als seine Schranken.
So auch mein Geist vor Gott, denn er erkannte,
Daß er, umfaßt, sich nie so sehr erweitert,
Den Allumfasser wieder zu umranken.
Friedrich Hebbel
Man muß die Ätherwogen fühlen. Ein Sonett verträgt nkht Deklamation.
#SE281-175
Aus Rudolf Steiners «Mysteriendramen» («Die Pforte der Einweihung», siebentes Bild):
PHILIA: Ich will erfüllen mich
Mit klarstem Lichtessein
Aus Weltenweiten,
Ich will eratmen mir
Belebenden Klangesstoff
Aus Ätherfernen,
Daß dir, geliebte Schwester,
Das Werk gelingen kann.
ASTRID: Ich will verwehen
Erstrahlend Licht
Mit dämpfender Finsternis,
Ich will verdichten
Das Klangesleben.
Es soll erglitzernd klingen,
Es soll erklingend glitzern,
Daß du, geliebte Schwester,
Die Seelenstrahlen lenken kannst.
LUNA: Ich will erwärmen Seelenstoff
Und will erhärten Lebensäther.
Sie sollen sich verdichten,
Sie sollen sich erflihien,
Und in sich selber seiend,
Sich schaffend halten,
Daß du, geliebte Schwester,
Der suchenden Menschenseele
Des Wissens Sicherheit erzeugen kannst.
PHILIA: Ich will erbitten von Wekengeistern,
Daß ihres Wesens Licht
Entzücke Seelensinn,
Und ihrer Worte Klang
Beglücke Geistgehör;
Auf daß sich hebe
Der zu Erweckende
Auf Seelenwegen
In Himmelshöhen.
#SE281-176
ASTRID: Ich will die Liebesströme,
Die Welt erwarmenden,
Zu Herzen leiten
Dem Geweihten;
Auf daß er bringen kann
Des Himmels Güte
Dem Erdenwirken,
Und Weihestimmung
Den Menschenkindern.
LUNA: Ich will von Urgewalten
Erflehen Mut und Kraft,
Und sie dem Suchenden
In Herzenstiefen legen;
Auf daß Vertrauen
Zum eignen Selbst
Ihn durch das Leben
Geleiten kann.
Er soll sich sicher
In sich dann selber fühlen.
Er soll von Augenblicken
Die reifen Früchte pflücken
Und Saaten ihnen entlocken
Für Ewigkeiten.
Zu dieser Szene mit den Seelenkräften:
Hier haben wir ganz musikalisch gelöste Plastik. Die Worte müssen draußen im Kosmos erklingen. Man muß verstehen, die Einatmung abzufangen, sonst kommt nicht das Jenseitige heraus. Ohne diese Atembehandlung kann man nicht musikalisch lösen. Bei vollem Atem , mit zu viel Atemfülle kann man nicht geistig Gelöstes machen. Auf die Dosierung kommt es an, man muß die Dosen einteilen. Auch sollte man über die Hilfszeitwörter hinweggleiten. Dur-Nuancen !
Luna - Premierminister, Maria - oberste Königin.
Wahr sein hängt immer zusammen damit, daß man die ganze Zeit mit dein Ich dabei ist und immer mitgeht in die Dinge hinein. Wahrheit ist immer ein-fach. Das erreicht man, wenn man die Laute verjüngt, nicht dick macht.
Bei der künstlerischen Sprachgestaltung ist das erste: Hören lernen ! Das andere: Stil halten !
#SE281-177
Zwei Sonette von Novalis (Texte siehe S. 32/33)
Diese beiden Sonette sind ganz rezitatorisch und ganz durchsichtig, sehr ruhig und - - sehr schwer !
Wir wollen zunächst auf das Formale hinarbeiten, das andere kommt schon später - das Gefühl zum Beispiel. Auf Stil und Form hinzuarbeiten, ist jetzt unsere Aufgabe.
Novalis ist absolut ein Ich-Mensch. Man muß von Anfang an füh-len, daß ein hohes Ich dahinter ist. Die Ich-Natur kann ewig in alles hinein. Dur ! Im Anfang lieber etwas kraftvoll, die Wortgebärden variieren - und leben in der Imagination. Reife, Beziehung zum Übersinnlichen.
Novalis muß man so sprechen wie einer, der im konkreten Erleben der geistigen Welt steht. Die Wortgebärden müssen einen gleich packen.
Gleichklang. Operieren Sie mit dem, was sowieso an Atem in den Mund kommt.
Wenn man neu einatmen muß, das Wort davor nicht fallen lassen, sondern oben halten. Zündende Ich-Momente in den Einsätzen, Durchsichtig-machen der Vokale, immer poetisch sein.
Novalis ist die Verkörperung der Poesie, seine innere Gebärde ist: den Saum der Gottheit berühren.
Hier nicht Hoch- und Tiefton ! Man sollte bei Novalis die Modulation mit Bewußtsein machen, der Inhalt geht in die Linie über.
Hymnus an die Natur (Goethe) (Text siehe S. 127)
Die Worte müssen hymnisch klingen, deshalb Deklamation, ja nicht didaktisch. Hier ist alles überraschend. Nehmen Sie die Resonanz vom harten Gaumen mit hinaus. Die Natur hat immer das Eherne. Es muß konsonantisch gesprochen werden aus Atem und Lauten, nicht Kopf und Herz, in einer starken willensmäßigen Bewegung. Lassen Sie es nicht Konversation werden. Hoch- und Tiefton, es sind lauter Puls-schläge, die branden in den Atem hinein.
#SE281-178
Zur Gestaltung gehört: Ansatz, Resonanzänie und Resonanzboden. Der Resonanzboden ist immer draußen in der Luft, das ist schön. Verschiedene Tempi. Verschiedene Art der Lautbildung: ob wellig, eckig, scharf und so weiter. In den Lauten liegt mehr, als wir wissen. Da liegen die schöpferischen Kräfte, die spritzen dann mit der ganzen Mannigfaltigkeit der Natur heraus. Unser Seelisches genügt nicht. In den gotischen Spitzbogen hinein mit dem Wurf. Das Willenselement muß durch die Glieder gehen, man fühlt es in den Armen und Beinen.
Bei der Deklamation flutet die Einatmung bis ins Gehirn, dann zurück bis ins Rückenmark. Da müssen wir aufhalten den Atemstrom mit dem Willenselement, es nicht zu Taten kommen lassen. Mit diesem nicht zu Taten gekommenen Willen kann ich operieren im Atem-strom. Die Vorstellung muß man vorher gehabt haben, sie ist mit der Einatmung ins Gehirn gekommen und dort erledigt.
Der Atemstrom kommt zurück bis in die Willenssphäre.
Modeln Sie in die Ausatmung hinein - aber ohne persönliches dramatisches Gefühl -, in den Laut hinein, mit Pausen und nicht mit starkem Schall. Aber immer den Gliedmaßenmenschen mit hineintun.
Aus «Die Nibelunge» von Wilhelm Jordan (Text siehe S. 116/17)
Bewegung ist nicht Hetze ! Bitte einen gehaltenen Schritt hier, ganz in Bewegung und Tiefe hinein. Es braucht nicht zu hallen; episch im Fluß dahinrollen, nicht immer ein gleichmäßiges Tempo wie bei einer Drehorgel. Der Zuhörer muß in die Situation eingeführt werden. Der Laut H meißelt, arbeitet platisch. Das Meißeln muß man vermeiden bei nicht alliterierenden Wörtern, man kann sie deshalb aber doch breit nehmen. Das Lied etwas rezitatorischer mit dramatischem Einschlag, aber nicht so stark, daß das Epische aufgehalten wird. Epik verlangt, daß man sich ganz hineinbegibt und ganz verdaut die Bilder.
Den Schluß dunkel musikalisch, ehern und etwas ausklingend.
Sankt Expeditus (Morgenstern) (Text siehe S. 33 ff.)
« Expeditus» ist humoristische Lyrik, nicht groteske, deshalb ohne starke Übertreibung. Es ist rezitatorisch, also nicht soviel Hoch- und
#SE281-179
Tiefton ! Man könnte es mitteilende Konversation nennen. Man muß unterscheiden lernen, ob die Sprache mehr nach Zahl und Maß dahin-ffießt in den Silben, oder mit Gewicht, schwer und leicht. Innerhalb des Fließens müssen aber die Bilder gut hervortreten. Bitte die Sache sehr aufs Formale ausarbeiten.
Auch die Jugendgedichte von Goethe sind ähnlich zu behandeln, mit Esprit, mit Spiritus ! Etwas pointieren, das heißt ein klein wenig die Silben herausstechen. Der Verstand aus dem Gehirn tut ein bißchen Spaß darüber. Der Humor guckt in alle Töpfe herein und holt sich die Dinge heraus. Deshalb muß man in jede Sache eindringen. Sprechen Sie ganz vorne, recht nahe an den Zähnen, sobald es satirisch wird. Eine leise Legenden- und Märchenstimmung, nicht zu schnell, nicht hallend und gut schattieren und pointieren, die Vokale in die Konsonanten schlüpfen lassen, damit es etwas unreal wird und fließend. Gute Pausen gestalten und im Poetischen bleiben, ja nicht begrifflich, nur ein wenig Kopf. aber mit Anwendung aller Kunst-mittel. Sehr graziös ! Mit Nebensätzen künstlerisch umgeben und sie graziös hereinschieben.
Das Deutsche sitzt nicht von selber vorn auf den Lippen !
Beim Grotesken kann man wulsten zum Ende des Lautes, ihn dick machen; es ist gerade das Umgekehrte wie beim spirituellen Sprechen.
DAS STRÄUSSCHEN
Altböhmisch
Wehet ein Lüftchen
Aus fürstlichen Wäldern;
Da läufet das Mädchen,
Da läuft es zum Bach,
Schöpft in beschlagne
Eimer das Wasser.
Vorsichtig, bedächtig
Versteht sie zu schöpfen.
Am Flusse zum Mädchen
Schwimmet ein Sträußchen,
Ein duftiges Sträußchen
Von Veilchen und Rosen.
#SE281-180
Wenn ich, du holdes
Blümdhen, es wüßte,
Wer dich gepflanzet
In lockeren Boden;
Wahrlich ! dem gäb' ich
Ein goldenes Ringlein.
Wenn ich, du holdes
Sträußchen, es wüßte,
Wer dich mit zartem
Baste gebunden;
Wahrlich ! dem gäb' ich
Die Nadel vom Haare.
Wenn ich, du holdes
Blümchen, es wüßte,
Wer in den kühlen
Bach dich geworfen;
Wahrlich! dem gäb' ich
Mein Kränzlein vom Haupte.
Und so verfolgt sie
Das eilende Sträußchen,
Sie eilet vorauf ihm,
Versucht es zu fangen:
Da fällt, ach ! da fällt sie
Jns kühlige Wasser.
J. W. Goethe
Das Gedicht ist lyrisch und hat ein kleines melodiöses Thema. Es ist objektiv zu behandeln. Das Mädchen ist selbst wie ein Lüftchen. Die Rokokogedichte sind ganz formal, dieses böhmische Volkslied kann etwas inniger sein. Leise Anklänge an Melodien, doch muß die Bewegung dominieren. Windhauchstimmung. Das Musikalische darf nidht das Bild und die Plastik in den Hintergrund treiben.
#SE281-181
Aus «Kleine Mythen» von Albert Steffen
RICHTER UND ERLÖSER
Ein Mann, der Blut vergossen hatte, wurde in der Nacht von einem Wasserfall gepackt, gepeitscht und in den Abgrund hinuntergerissen. Halb erstickt entriß er sich den Wirbeln. Von nun an vernahm er durch alles, was er tat und litt, die Stimme des fürchterlichen Elementes. Es tropfte, rieselte, plätscherte, schüttete, donnerte, es wollte etwas verkünden, und der Gefolterte wußte nicht was.
Nach fünfundzwanzig Jahren wurde das Rauschen stiller.
Eines Nachts erblickte er den Gemordeten an einem Strome, er hielt ein Reis in der Hand und rief: «Ich verwandle Wasser in Blut.»
«Wie?» fragte der Mörder. « Durch das Gesetz», erwiderte der Gemordete. «Richte mich», flehte der Mörder, «damit du mich wiederum lieben kannst , wie ich dich liebe.»
Da erschien an Stelle des Richters der Christus.
Hier haben wir Prosa: legendenhaft, dem Märchen etwas ähnlich, doch ist das Hereinschlüpfen der Vokale hier noch stärker als beim Märchen. Es sollte etwas wie ein Schleier über den Worten liegen. Man spricht nicht gerade auf den Lippen, aber auch nicht im Gaumen. Es muß traumhaft sein, ganz objektiv traumhaft. Im Traume kommt alles unerwartet. Mondscheinstimmung. Die Infiektionen jeder Silbe nach unten. Es ist Imagination, deshalb muß jedes Bild erscheinen trotz des Flusses. Die Worte mit den Konsonanten ergreifen, aber die Dinge schon auflösen, während sie kommen. Alle Bewegungen zu Ende führen. Für die künstlerische Gestaltung muß man sich einmal vom Stoffe ganz packen lassen, ihn ganz durchieben und dann von sich rücken. Man soll alles durchinachen, meinetwegen auch weinen und schluchzen, aber dann sich daneben- und darüberstellen.
Beim Traum spricht man nicht aus dem Herzen heraus, man darf nicht ganz ins Herz hinein, sonst wird es zu real. Man muß einen kleinen Abstand halten und vor allem ins Bild, ganz ins Bild hineingehen. Lernen Sie unterscheiden, was starke Bewegung und was Leidenschaft ist.
#SE281-182
Der Zuhörer erlebt stärker, wenn man ihm die Emotion überläßt, ihn nidht damit überschüttet. Kunst selbst ist in allen Gebieten An-deutung.
Den letzten Satz ganz einfach, eine Lichterscheinung. Strenge ! Dur!: Da erschien an Stelle des Richters der Christus.
III ANSPRACHEN ZU REZITATIONSVERANSTALTUNGEN LUDWIG UHLAND-MATINÉE Berlin, 1. Dezember 1912
#G281-1967-SE185 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
III
ANSPRACHEN ZU REZJTATJONSVERANSTALTUNGEN
LUDWIG UHLAND-MATINÉE
Berlin, 1. Dezember 1912
#TX
Es wäre schön gewesen, wenn wir unser Kunstzimmer hätten früher eröffnen und den heutigen Tag näher zusammenbringen können mit dem Todestag Ludwig Uhlands am 13. November. Da dies nicht hat sein können, so wollen wir wenigstens heute mit einigen Klängen, welche uns gekommen sind von dem großen Dichter Lud-wig Uhland, an sein Leben uns erinnern. Ludwig Uhland könnte man, wenn man bezeichnen wollte dasjenige, was wesentlich ist für sein Dichten, mit einem einzigen Worte so recht kennzeichnen. Man brauchte nur zu sagen: Uhland gehört zu den Dichtern, die nach jeder Richtung hin durch und durch gesund sind. Gesund im Empfinden, im Denken, gesund in Kopf und Herz, das war Ludwig Uhland. Und wenn man ihn kennenlernen will, so sich hinein fühlen will in das, was ihn zum Dichten begeisterte, so kann man sehen, zwei Dinge waren es, die immerzu sein Herz erfüllten, insofern er Dichter war.
Das erste war eine tiefe, gemütvolle Naturliebe. Es mochte noch so erhebend für ihn sein, Kunstwerke als solche zu betrachten, die vielleicht Schönheiten alter Zeiten verkündeten, lieber war es ihm, die große Kunst der Naturmächte zu bewundern. Und so ist es denn aus seinem tiefsten Herzen heraus gesprochen, wenn er wie ein Glaubensbekenntnis in einem Gedichte sagt:
Nicht in kalten Marmorsteinen,
Nicht in Tempeln dumpf und tot,
In den frischen Eichenhainen
Webt und rauscht der deutsche Gott.
Und dies war nicht etwa bloß eine künstlerische Stimmung bei ihm, sondern von seiner Knabenzeit an war dieses sich Hineinfühlen in die Natur etwas, was seinen ganzen Menschen ergriff. Er konnte von sich sagen: Kein' beßre Lust in dieser Zeit,
Ms durch den Wald zu dringen,
Wo Drossel singt und Habicht schreit,
Wo Hirsch' und Rehe springen.
#SE281-186
Da ging ihm das Herz auf in der Natur, und da fühlte er die Wärme in seiner Seele, die in seinen kräftigen, gesunden Dichterklängen zum Ausdruck kommt.
Das andere war die Vorliebe für die Zeiten im europäischen Leben, wo die großen Vorgänge der Menschen in Sagen erzählt, nicht bloß in äußerlicher Weise erlebt wurden. Für diese Zeiten des mittleren Mittelalters kann der heutige Mensch nicht mehr so recht ein Verständnis haben. Man muß schon versuchen, die Seele, die dazumal in den Menschen lebte, vor aller Betrachtung in sich selbst ein bißchen zu beleben, um fühlen zu können, was so um die Mitte des Mittelalters herum ein Mensch in Mitteleuropa fühlte über die großen Taten der Weltgeschlchte, von denen Wohl und Wehe, Erhebung und Glück und Leid der Menschen abhängt. Damals lernte man nicht aus Schulbüchern Geschlchte kennen, sondern ganz anders war es da, als etwa heute, wo wir in die Schule uns hlneinsetzen, und nun beginnt in der entsprechenden Zeit der Schuljunge zu beben, wenn der Lehrer fragt: Wann hat Karl der Große regiert? - und er dann schwitzend sagt: Dann hat er gelebt - und so weiter. So war es damals ganz und gar nicht, sondern vielmehr so, wie man eine Vorstellung eher bekommt, wenn man noch das Glück hat, letzte Reste auf sich wirken zu lassen, wie die Menschen damals zueinander sprachen über solche großen Menschen, die viel beteiligt waren an Wohl und Wehe der Geschlchte, wie, sagen wir, über Karl den Großen. Und da einem Persönliches immer am nächsten in der Erfahrung liegt, so möchte ich ausgehen von einer kleinen Erzählung, die etwas wie einen letzten Rest darstellt von der Art und Weise, wie man in früheren Jahrhunderten von der Geschichte sprach.
Ich kannte einen damals schon älteren Mann in meiner Knabenzeit, der war in einer Buchhandlung angestellt. Er war Salzburger. Dort ist der Untersberg. Und wie man erzählt, daß im Kyffhäuser Barbarossa sitzt, so erzählte man, daß im Untersberg noch immer Karl der Große sitzt. Und jener Mann sagte mir einmal: Ja, das ist ganz wahr, da sitzt der Karl der Große in unserem Untersberg drin. - Ich sagte:
Woher wissen Sie das? - Er sagte: Als ich noch ein Knabe war, ging ich mit einem festen Stock zum Untersberg, und da fand ich ein Loch.
#SE281-187
Und da ich ein schlimmer Lausbub war, habe ich mich gleich eingelassen in dieses Loch. Ich ließ meinen S?ab hlnunter und dann mich hinunterfahren. Richtig, ganz tief hlnunter kam ich. Und da war eine große palastähnliche Höhlung und alles mit Kristall ausgeschlagen. Da ist es, wo Karl der Große und der alte Roland drinnen sitzen, und die Bärte sind ihnen furchtbar lang gewachsen. - Die anwesenden Buben will ich nicht veranlassen, das zu tun; das darf nur ein Salzburger tun. -Nun sagte ich: Haben Sie denn, mein lieber Hanke, wirklich gesehen den Karl den Großen und den Roland? - Er sagte: Nein, aber drin sind sie doch!
Sehen Sie, da lebte noch ein Stück von etwas, was wirklich in mittel- und westeuropäischen Gegenden im Mittelalter im ausgebreitetsten Maße gelebt hat. Und wenn die Leute im Winter um die Ofenbank herumsaßen, und die Eltern erzählten den Kindern von Karl dem Großen und seinen Helden, - wie erzählten die Leute den Jüngeren zum Beispiel von dem großen Karl, der einmal über die Franken regiert hat, und von seinen Helden, zu denen zum Beispiel Roland gehörte, und Olivier und so weiter?
Wenn wir einer solchen Erzählung, wie sie damals gang und gäbe war, zuhören könnten, würden wir das Folgende hören: Ja, Karl der Große, das war ein ganz wunderbarer Mensch, über dem schwebte der Segen Christi. Der war ganz durchdrungen davon, daß er Europa für das Christentum gewinnen muß. Und so wie der Christus selber von zwölf Aposteln umgeben war, so war Karl der Große von zwölf Menschen umgeben. Seinen Roland hatte er wie Christus seinen Petrus. Und namentlich waren da die Heiden in Spanien, gegen die er zog, weil er unter ihnen das Christentum ausbreiten wollte mit seinen zwölf Leuten.
Damals hat man weniger die Bibel gelesen, aber auch freier die Bibel behandelt. Die Leute haben zur Zeit Karls des Großen so erzählt, daß die Art der Erzählung erinnerte an biblische Erzählungen, weil sie das, was sie aus der Bibel wußten, nicht so starr betrachtet haben, sondern zum Muster genommen haben. Und es ist für die mittelalterlichen Menschen so geworden, daß sie ähnlich wie über Christus über Karl den Großen sprachen.
#SE281-188
Der Roland hatte ein mächtiges Schwert, so erzählte man, und ein gewaltiges Horn. Das Schwert Durendart hat er einmal bekommen, als er ganz inbrünstig sich fühlte als ein Gottesstreiter, von Christus selber. Und mit diesem Schwert, das er von Christus erhalten hat, zog er, der der Neffe Karls des Großen war, nach Spanien. Nun wurde weiter erzählt, daß Karl der Große nicht nur alles mögliche getan hat, daß der Roland herangewachsen ist zu einem außerordentlich tüchtigen, bewährten Helden, sondern da wurde von ihm überhaupt erzählt, daß er im tiefsten Maße mit Stärke und Ausdauer ein Gottes-streiter wurde, wie die Leute es richtig ahnten.
Als Karl der Große nach Saragossa zog, wollte man versuchen, die Mauren zum Christentum zu bewegen, und auf den Rat gerade des Roland wurde ein Verbündeter des Roland, Ganelon, ausersehen, mit der heidnischen Bevölkerung von Spanien zu verhandeln. Von dem Ganelon wurde so gesprochen, wie wenn der unter den zwölf Begleitern Karls des Großen der Judas sei. Dieser Ganelon sagte: Wenn der Roland Karl den Großen dazu überredet, ich soll zur heidnischen Bevölkerung gehen, so wollen sie mich bereden zum Tode. - Ganelon verhandelte mit den Feinden. Diese ergaben sich zum Schein, so daß Karl der Große abzog, und zurück ließ er nur seinen treuen Roland. Und als Karl abgezogen war, kamen die Feinde auf Roland zu, und er sah sich umgeben von der ganzen Horde der Feinde, er, der starke Held, der Gottesstreiter.
Nun ist da ein schöner Zug, der immer erzählt wird, der etwas ausdrücken sollte. Man erzählte immer von der innigen Zusammengehörigkeit von Karl dem Großen und Roland. Es war Karl doch nicht so ruhig, daß er Roland zurückgelassen hatte. Aber da hörte er den Ruf des Roland. Daraus hat die Sage gemacht, daß Roland in sein Horn Olifant geblasen hat. Der Name Olifant sagt schon, daß Karl es spürte. Und dann wird in der Sage erzählt, daß Roland sein Schwert am Felsen zerschlagen wollte; das war aber so stark, daß es ganz blieb, nur die Funken sprühten. Da er sich verloren glaubte, ergab er das Schwert dem Christus.
Dieser selbe Roland lebte dann mit Karl dem Großen fort in den Sagen. Und die meisten Sagen sind so, daß man ihnen ansieht, wie
#SE281-189
die Menschen den poetisch schönen Gehalt der Bibel angenommen haben. Man erkennt es in Rolands Kampf mit den Heiden. Aber diese Tat, wie der Roland den Feinden gegenübersteht mit seinem Schwert und Horn und sie ihn von allen Seiten umgeben, wie er das Schwert am Felsen zerschellen will und wie er dann stirbt für eine Sache, die man überall erzählte und wichtig fand, dies ist unendlich bedeutsam, so recht wie vorbestimmt zur Dichtung.
Und die Gedanken, die sich einmal in die Seelen gesenkt haben, die sehen wir wieder, auch da, wo im 12. Jahrhundert durch den Pfaffen Konrad in die deutsche Sprache hineingelegt wurde der Tod des Roland. Und den Zusammenhang der menschlichen Seele mit der ganzen Natur, man konnte das sich damals nicht anders vorstellen als, wenn ein solcher Mensch stirbt, dann geschieht auch alles mögliche draußen in der Natur. Diese Szene ist noch im 12. Jahrhundert wunderbar geschildert worden von dem Pfaffen Konrad.
Er leite sich an sînen zesewin arm,
daz houbet er nider naicte,
di hende er üf spraite,
dem alwaltigen hérren,
dem bevalch er sine sele:
mit sent Michahéle,
sente Gabrîéle, sent Raphahéle
frout er sich imer mére. -
Dö Ruolant von der werld verschlt,
von Himil wart ain michel liecht,
sâ nâch der wile
chom ain nüchel ert pibe,
doner unt himilzaichen
in den zwain richen
ze Karlingen unt ze Yspanîâ.
Di winte huoben sich dâ,
si zevalten di urmâren stalboume;
daz liut ernerte sich chüme,
sie sâhen vil diche
di vorchtiîchen himil bliche;
der liechte sunne, der relasc;
den Haiden gebrast:
#SE281-190
diu scheph in versunchen,
in dem wazer si ertruncken.
Der vil liehte tac
wart vinster sam diu naht.
Die turne zevielen,
diu scöne palas zegiengen.
Di sternen offenten sich;
daz weter wart mislich:
si wolten alle wâne,
daz di wile wâre,
daz diu werld verenden solte,
unt Got sin gerichte haben wolte.
So sprach man über Rolands Tod. Und wir können uns zugleich eine Vorstellung bilden über die Wandlung der Sprache seit 1175. Sie werden daraus sehen, wie sich alles in der Welt wandelt und schnell wandelt. Lautreicher war die Sprache, inniger. Bis in die Zeiten der Kreuzzüge hinein lebte fast in jedem Hause in unseren Gegenden bis nach Sizilien hinunter, bis nach Ungarn hinein so etwas wie die Sage von Karl dem Großen. Es ging den Leuten durchaus in die Seele ein, und man hat heute keine Vorstellung davon, wie diese Dinge damals lagen.
Ludwig Uhland war ein Einzigster auf diesem Felde, der sich so tief, tief in die Dinge vertiefte. Und er hat nicht nur das erklingen lassen, was er fühlte, in manchem schönen Gedichte, sondern es gibt auch Bücher, in denen er die alten Zeiten des deutschen Volkes aufleben läßt. Gerade dadurch, daß Uhland auf der einen Seite die unendliche Liebe zur Natur hatte, auf der anderen Seite das warme Herz für die verklungenen Sagen, die gelebt haben und die man heute nur künstlich hereinrufen muß, ist da etwas, das man eigentlich besser kennen sollte, als man es kennt. Und man darf hoffen, wenn auch manche Mode der Dichtung, die heute manchmal da ist, die Herzen «beungeistern» kann, so mag schon wieder eine Zeit kommen, wo man nach und nach wie Uhland schaffen lernen kann. Er hat die Mitteilung geliebt, unmittelbar von Seele zu Seele am allerrneisten. Und es ist mir eigentlich zum Verständnis gekommen, was Ludwig Uhland jungen Menschen hat sein können, auch wiederum, als ich einen Nach-klang im eigenen Leben hatte verspüren können.
#SE281-191
Ich hatte am meisten gelernt, in der Art Gedanken in die Sprache umsetzen zu können, und Gedanken, die nun in das geistige Leben einführen, mit dem Herzen zu erfassen, dadurch, daß ich teilnehmen durfte bei meinem verstorbenen Lehrer Karl Julius &chröer an dem, was er nannte «Übungen in mündlichem Vortrag und schriftlicher Darstellung». Er hörte uns an und sprach dann einige Worte, in denen er sich ganz auf diejenige Stufe stellte, auf der wir selber waren. Das war eine sehr anregende Sache. Woher hatte Schröer das? Weil er Uhland kannte! Es war ein ganz lebendiges Zusammenarbeiten mit den jungen Leuten. Das hat einmal Uhland getan.
Und so dürfen wir denn sagen: Das 50. Todesjahr des Ludwig Uhland, der am 13. November 1862 gestorben ist, darf in den Herzen der Menschen, welche noch für echte, gesunde Poesie empfänglich sind und Gefühl dafür haben, etwas bedeuten, darf bedeuten, wie man doch immer wieder und wieder zurückkehren muß zu denjenigen, welche uns in Zusammenhang bringen als Menschen, die in der Gegenwart leben, mit alledem, was die Menschheit in früheren und immer mehr früheren Zeiten erlebt hat.
In zweifacher Beziehung knüpft nun Ludwig Uhland an frühere Zeiten an, erstens dadurch, daß er selber noch vieles in seinem Charakter, seiner ganzen Persönlichkeit hatte, was uns an starke, unbeugsame Charaktere erinnert, die in der Gegenwart immer seltener werden. Man darf sich nur erinnern, daß von Uhland im Jahre 1849 das schwere Wort fiel, daß er sich ein deutsches Reich nicht denken könne, ohne daß es mit einem Tropfen demokratischen Öles gesalbt sei. Er steht da wie eine erfrischende und in ihrer Stärke selber bestärkende deutsche Eiche. So weist er auch zurück mit seinem ganzen Streben und Leben, mit seiner Kunst in Zeiten, in denen geblüht und gelebt hat die innige, weittragende Volksphantasie, die in einer herzlichen Weise zusammenbringt Vergangenheit und Gegenwart, die Erbschaft des Seelischen, welche die Menschheit von ihrem Vorangegangenen hat, mit dem, was die Gegenwart bewegt.
Man denkt nicht immer daran, wie im Grunde genommen klein die Zeitspanne ist, die uns von so etwas trennt, was sehr verschieden von uns ist. Denken wir, etwa 800 Jahre sind es, die uns trennen von
#SE281-192
der Zeit, wo man in Deutschland so gesprochen und geschrieben hat, wie ich Ihnen vorgelesen habe. Durch acht Jahrhunderte sind vierundzwanzig Generationen. Wenn Sie sich diese denken, die Hände reichend, so haben Sie die Zeit, wo der Pfaffe Konrad diese ergreifende Szene in die deutschen Herzen versuchte hineinzuschreiben. Und dies wieder zu erneuern, etwas davon nachfühlen zu lassen, das war gerade Uhlands Anliegen.
So sei es denn, daß wir uns - wenn auch etwas verspätet - heute des Todestages Ludwig Uhlands erinnern, erinnern an diesem Tage des Mannes, der so unendlich vieles von den Schönheiten und der Größe der Natur, von den Schönheiten und der Größe mitteleuropäischer Vorzeit in seinen Dichtungen zu erfassen versuchte. Er verdient, daß wir ihn wieder aufleben lassen in den Herzen der Menschen, die von solch gesunder, echter, wahrer Dichtung etwas wissen wollen, und die werden wohl immer da sein, wie auch manche Modekrankheit und Modegesundheit, welche die Seelen von diesem Echten, Wahren der Dichtung abtrennen möchten.
Die zum vortrag gelangte Gedichtreihenfolge ist r'icht bekannt.
VOM WESEN DES VOLKSLIEDES Berlin, 9. Februar 1913
#G281-1967-SE193 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
VOM WESEN DES VOLKSLIEDES
Berlin, 9. Februar 1913
#TX
Der Veranstaltung «Vom Wesen des Volksliedes», die hier durch Rezitation stattfinden soll, möchte ich einige Worte vorausschicken. Ein Bild können wir uns vor die Seele hinstellen, das am 18. Dezember 1818 Goethe am weimarischen Hofe Freunden und Besuchern des weimarischen Hofes vorgeführt hat. Da fand ein großer Maskenzug statt, ein großer Zug von lebenden Bildern. Darunter waren zwei, die wir besonders betrachten wollen. Das eine stellte dar einen jener alten Sänger, wie sie vor alten Zeiten von Land zu Land gezogen sind und dem Volke gesungen haben von den Taten mancher Helden, aber auch von den Emplindungen und Gefühlen im Herzen der einfachen Volksgenossen. Das andere war eine Frau, welche darstellen sollte die Legende, die volkstümliche Erzählung von guten, edlen Taten, von gutem, edlem Geschehen. Und diese zwei Gestalten ließ Goethe ansprechen von der Sprecherin, die alles zu erklären hatte, und diese sagte unter anderem:
Ein edler Mann, begierig zu ergründen,
Wie überall des Menschen Sinn ersprießt,
Horcht in die Welt, so Ton als Wort zu finden,
Das tausendquellig durch die Länder fließt;
Die ältesten, die neusten Regionen
Durchwandelt er und lauscht in allen Zonen.
Und so von Volk zu Volke hört er singen,
Was jeden in der Mutterluft gerührt,
Er hört erzählen, was von guten Dingen
Urvaters Wort dem Vater zugeführt.
Das alles war Ergötzlichkeit und Lehre,
Gefühl und Tat, als wenn es Eines wäre.
Was Leiden bringen mag und was Genüge,
Behend verwirrt und ungehofft vereint,
Das haben tausend Sprach- und Redezüge,
Vom Paradies bis heute gleich gemeint.
So singt der Barde, spricht Legend' und Sage,
Wir fühlen mit, als wären's unsre Tage.
#SE281-194
Wenn schwarz der Fels, umhangen Atmosphäre
Zu Traumgebilden düstrer Klage zwingt,
Dort heiterm Sonnenglanz im offnen Meere
Das hohe Lied entzückter Seele klingt;
Sie meinen's gut und fromm im Grund, sie wollten
Nur Menschliches, was alle wollen sollten.
Wo sich's versteckte, wußt' er's aufzufinden,
Ernsthaft verhüllt, verkleidet leicht als Spiel;
Im höchsten Sinn der Zukunft zu begründen,
Humanität sei unser ewig Ziel.
0, warum schaut er nicht in diesen Tagen
Durch Menschlichkeit geheilt die schwersten Plagen!
Dieser Mann war 1818 schon fünfzehn Jahre tot. 1770 hatte Goethe ihn in Straßburg kennengelernt. Er schildert es selber in seiner «Dichtung und Wahrheit», wie er in Straßburg, in ein Haus eintretend, einem Mann begegnete, der wie er im Begriffe war die Treppe hinaufzugehen und der gleich einen großen Eindruck auf ihn machte. Dieser Mann sah äußerlich schon etwas merkwürdig aus, wie ein Poet, aber zugleich wie ein Geistlicher; er war ja auch einer, denn es war Herder. Er hatte einen langen seidenen Rock, diesen Rock hatte er lang herunterhängend, die Zipfel in die Tasche gesteckt. Herder war ja damals schon krank, aber ein Mensch nzch allem Großen suchend, wo es nur zu finden ist. Goethe wurde mit ihm befreundet und nun sammelten beide im Elsaß Volkslieder, Volksgedichte. Man kann fragen:
Warum taten sie das? Warum gingen sie auf die Landstraße, in die Dörfer, um Volkslieder zu sammeln? Und warum preist Goethe nach fünfzehn Jahren nach dem Tode Herders die Stimmen, die aus den verschiedensten Ländern und Völkern kommen? Weil Goethe und Herder schon damals einen gewissen Drang, Trieb in sich fühlten, die Dichtung, die weit abgekommen war von allem Echten, Wahren, durchdringen zu lassen mit dem, was aus echtem volkstümlichem Herzen klingt. Herder ist darin weitergegangen als Goethe, er ist es ja, der dem deutschen Volk das Volkslied wieder lleb gemacht hat. Er sammelte überall, von den nördlichen Lappen bis zu den südlichen orientalischen Völkern, was er an Volksliedern zusammenbekommen konnte. 1778/79 hat er die «Stimmen der Völker» veröffentlicht. Es
#SE281-195
war allgemein eine große Überraschung, als man sah, was im Volke lebt an Dichtung, in der die menschliche, wahrste Empfindung zum Ausdruck kommt. Heute können wir über rnanches genauer sprechen, als Herder es damals konnte. Wir haben vieles inzwischen über den Ursprung dieser Volkslieder erfahren, aber Herder ahnte schon das alles. Daß die Menschen ursprünglich alles begleiteten, Arbeit und alles, mit dem gesungenen Worte, in dem Rhythmus und Tanz war, das ahnte schon Herder, wie Jauclizen und Traurigsein sich äußert im Volkslied. Er war der erste, der diese Dinge untersuchte, dann ging das fort; Uhland, Achim von Arnim suchten weiter, was in den einfachsten Verhältnissen die Menschen gedichtet. Und man kam dat-auf, daß, was Goethe und Herder in ihrer Jugend gedichtet hatten, eine Unwahrheit in sich hatte; es war nur in der damaligen Zeit so üblich zu dichten. Wenn Herder einmal ein lappländisches Gedicht vergleicht mit dem Gedicht eines selbst ausgezeichneten Dichters, einem Gedicht des Ewaid von Kleist, dann muß er sagen: Was ist das, was der Major von Kleist da dichtete, wenn man das Volkslied dagegen liest? - Man suchte nämlich das, was echte Empfindung, echte Dichtung war, im Volkslied. Uhland, Mörike, Goethe selbst wären nicht so große Dichter geworden, wenn nicht das Echte vorher von ihnen erkannt worden wäre. Heute kann das nicht mehr sein, daß man die Arbeit in dieser Weise mit Liedern begleitet; die Arbeit hat alles Poetische verloren, die Arbeit ist eine schwere Bürde geworden. Das aber muß man klar sehen, daß das Volkslied nicht aus dem Nebel heraus entstanden ist.
Wie ist es denn entstanden? Menschliche Seelenstimmungen sind es, was den Menschen freudig, was ihn traurig macht, worüber er bestürzt ist, was ihn freut und nicht freut; alles ist darin. Und einzelne Menschen sind es immer, die mit dem Volk empfinden können, die dem, was im Volke lebt, dichterischen Ausdruck verleihen; sie sind nie zahlreich, sie wachsen nicht wie Kohlköpfe aus dem Felde. Nicht die Volksphantasie dichtet, wie es die heutige Gelehrsamkeit vom grünen Tisch haben will. Das ist einfach Unsinn. Es sind immer einzelne Menschen, die diese Fähigkeit haben. Auch heute gibt es noch solche Menschen, wenn auch nur ganz selten.
#SE281-196
Je nach der Zeit nahmen die Volkslieder andere Gestalt an, zum Beispiel im 16. Jahrhundert. Wer stimmte da ein Volkslied an? Herumziehende Leute, die mit rechtlosen Anschauungen herumzogen; fahrende Leute von Land zu Land, die nicht viel Geld in der Tasche haben, deshalb häufig Gelüste nach der anderen Tasche, die nicht bei ihnen war: Auch solche Gefühle gibt man wieder, man kann sagen ehrlicher Weise, in so einem Volksgedicht vom «Schwartenhals - Schwartenhals», weil andere den Speck und das Fleisch essen, ihm nur die Schwarte übrigblieb; «Ich kam vor einer Frau Wirtin Haus - sein Tasch' mußt' er mir lassen.»
Daneben gibt es auch Volksgedichte, in denen das Erhabene war. Das wurde alles gesammelt, und die Dichter lernten ungeheuer viel an Wahrheit und Natürlichkeit des Empfindens. Die besten Goetheschen Gedichte, die so Menschenstimmung, Menschenleid und Menschenlust am schönsten zum Ausdruck bringen, sind angeregt durch Volkslieder. Alles, was jemals im Volk gelebt hat, solange das Volk noch nicht müde geworden ist, das drückt sich aus in seiner Dichtung. Dafür soll dann ein Beispiel gegeben werden, wie ein Volk auch noch im 19. Jahrhundert empfand gegenüber denjenigen Menschen, von denen man wußte, daß es seine Helden waren. Und Goethe empfand das, indem er die neugriechisch-epirotischen Heldenlieder übersetzte. Es sind die Lieder des albanischen Volkes; sie sind sehr bedeutsam, und von Goethe schön übersetzt worden. Da wird davon gesungen, wie das albanische Volk fühlt gegenüber dem Feinde, dem Türken, und wie es lechzt nach Freiheit und alle seine Kräfte aufrufen will gegenüber der Türkenherrschaft. Von solchen Gedichten kann man sagen, sie sind zeitgemäß, wenn auch nicht aktuell. Wie die Menschen lechzen, das Schwert zu ergreifen, um sich freizumachen, etwas wie Windesbrausen lebt in diesen Heldenliedern des epirotisch-albanischen Volkes. Und diese Gefühle lebten schon damals, in der Goethezeit. Dahin-stürmende, dahinbrausende Freiheitsgefühle tönen in Rhythmus und Wort. Besonders schön ist das Schlußgedicht: Charon, der Führer der Toten; mehr als Toteuführer, Totenreiter. - Menschen, die Neugriechen kennen, sagen, daß Goethe es darin besonders zu etwas Schönem gebracht hat, nachzuahmen, was in diesen neugriechischen Gedichten lebt
#SE281-197
Dann wird zuletzt ein Gedicht rezitiert werden, das am besten zeigt, wie die Volksdichtung in die Kunstdichtung hineingeflossen ist. Echte Balladentöne sind es, die vor uns hinzaubert der «Erlkönig» von Goethe. Das konnte nur entstehen in einem Menschen wie Goethe, der, von Herder angeleitet, dann selber Balladendichter wurde. Verbunden durch Rhythmus und Ton ist der Goethesche «Erl-könig» mit dem Gedicht im Volkston, wie es vorher durch Herder gesammelt war.
Es wurden folgende Gedichte von Goethe rezitiert: «Heidenröslein» (Text siehe S. 28); ferner «Der König in Thuie» und «Der Fischer».
DER KÖNIG IN THULE
Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.
Es ging ihm nichts darüber,
Er leert' ihn jeden Schmaus;
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.
Und als er kam zu sterben,
Zählt' er seine Städt' und Reich',
Gönnt' alles seinen Erben,
Den Becher nicht zugleich.
Er saß beim Königsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,
Dort auf dem Schloß am Meer.
Dort stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut,
Und warf den heil'gen Becher
Hinunter in die Flut.
#SE281-198
Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer.
Die Augen täten ihm sinken:
Trank nie einen Tropfen mehr.
DER FISCHER
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empor:
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.
Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenlist
Hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund.
Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich dein eigen Angesicht
Nicht her in ew'gen Tau?
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Netzt' ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll,
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und ward nicht mehr gesehn.
#SE281-199
NEUGRIECHISCH-EPIROTI5CHE HELDENLIEDER
I.
Sind Gefilde türkisch worden,
Sonst Besitz der Albanesen;
Stergios ist noch am Leben,
Keines Paschas achtet er.
Und so lang es schneit Her oben,
Beugen wir den Türken nicht.
Setzet eure Vorhut dahin,
Wo die Wölfe nistend hecken!
Sei der Sklave Stadtbewohner,
Stadtbezirk ist unsern Braven
Wüster Felsen Klippenspalte.
Eh als mit den Türken leben,
Lieber mit den wilden Tieren!
II.
Schwarzes Fahrzeug teilt die Welle
Nächst der Küste von Kassandra,
Über ihm die schwarzen Segel,
Über ihnen Himmelsbläue.
Kommt ein Türkenschiff entgegen,
Scharlachwimpel wehen glänzend,
«Streich die Segel unverzüglich,
Nieder laß die Segel du!» -
Nein, ich streiche nicht die Segel,
Nimmer laß ich sie herab,
Droht ihr doch, als wär' ich Bräutchen,
Bräutchen, das zu schrecken ist.
Jannis bin ich, Sohn des Stada,
Eidam des Bukovalas.
Frisch, Gesellen, frisch zur Arbeit!
Auf zum Vorderteil des Schiffes;
Türkenblut ist zu vergießen,
Schont nicht der Ungläubigen. -
Und mit einer klugen Wendung
Beut das Türkenschiff die Spitze;
Jannis aber schwingt Hnauf sich,
Mit dem Säbel in der Faust;
#SE281-200
Das Gebälke trieft vom Blute
Und gerötet sind die Wellen.
Allah! Allah! schrein um Gnade
Die Ungläubigen auf den Knieen.
Traurig Leben! ruft der Sieger,
Bleibe den Besiegten nun!
III.
Beuge, Liakos, dem Pascha,
Beuge dem Wesire dich.
Warst du vordem Armatole,
Landgebieter wirst du nun.
«Bleibt nur Liakos am Leben,
Wird er nie ein Beugender.
Nur sein Schwert ist ihm der Pascha,
Ist Wesir das Schießgewehr.»
Ali Pascha, das vernehmend,
Zürnt dem Unwillkommenen,
Schreibt die Briefe, die Befehle;
So bestimmt er, was zu tun:
Vell Guekas, eile kräftig,
Durch die Städte, durch das Land,
Bring' mir Liakos zur Stelle,
Lebend sei er, oder tot!
Guekas streift nun durch die Gegend,
Auf die Kämpfer macht er Jagd,
Forscht sie aus und überrascht sie,
An der Vorhut ist er schon.
Kontogiakupis, der schreit nun
Von des Bollwerks hohem Stand:
Herzhaft, Kinder mein! zur Arbeit,
Kinder mein,zum Streit hervor!
Liakos erscheint behende,
Hält in Zähnen fest das Schwert.
Tag und Nacht ward nun geschlagen,
Tage drei, der Nächte drei.
Albaneserinnen weinen,
Schwarz in Trauerkleid gehüllt;
Veli Guekas kehrt nur wieder,
Hingewürgt im eignen Blut.
#SE281-201
IV.
Welch Getöse? wo entsteht es?
Welch gewaltiges Erschüttern?
Sind es Stiere vor dem Schlachtbeil,
Wild Getier in grimmem Kampfe?
Nein! Bukovalas, zum Kriege
Fünfzehnhundert Kämpfer führend,
Streitet zwischen Kerasovon
Und dem großen Stadtbezirk.
Flintenschüsse, wie des Regens,
Kugeln, wie der Schlossen Schlag! -
Blondes Mädchen ruft herunter
Von dem Überpforten-Fenster:
Kalte, Janny, das Gefecht an,
Dieses Laden, dieses Schießen!
Laß den Staub herniedersinken,
Laß den Pulverdunst verwehen,
Und so zählet eure Krieger,
Daß ihr wisset, wer verloren!
Dreimal zählte man die Türken,
Und vierhundert Tote lagen,
Und wie man die Kämpfer zählte,
Dreie nur verblichen da.
V.
Ausgeherrschet hat die Sonne,
Zu dem Führer kommt die Menge:
Auf, Gesellen, schöpfet Wasser
Teilt euch in das Abendbrot!
Lamprakos du aber, Neffe,
Setze dich an meine Seite;
Trage künftig diese Waffen,
Du nun bist der Kapitan
Und ihr andern braven Krieger,
Fasset den verwaisten Säbel,
Hauet grüne Fichtenzweige,
Flechtet sie zum Lager mir;
Führt den Beichtiger zur Stelle,
Daß ich ihm bekennen möge,
#SE281-202
Ihm enthülle, welchen Taten
Ich mein Leben zugekehrt.
Dreißig Jahr bin Armatole,
Zwanzig Jahr ein Kämpfer schon;
Nun will mich der Tod erschleichen,
Das ich wohl zufrieden bin.
Frisch nun mir das Grab bereitet,
Daß es hoch sei und geräumig,
Aufrecht, daß ich fechten könne,
Könne laden die Pistolen.
Rechts will ich ein Fenster offen,
Daß die Schwalbe Frühling künde,
Daß die Nachtigall vom Maien
Allerlieblichstes berichte.
Es folgten: Der Olympos, der Kissavos; Charon (Texte siehe S. 30); Herder: Erlkönigs Tochter (Text siehe S. 28/29).
ERLKÖNIG
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
-Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? -
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
«Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.»
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? -
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind.
#SE281-203
«Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.»
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? -
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.
«Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.»
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! -
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.
J. W. Goethe
ZWEI ANSPRACHEN FÜR CHRISTIAN MORGENSTERN I. Stuttgart, 24. November 1913
#G281-1967-SE204 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
ZWEI ANSPRACHEN
FÜR CHRISTIAN MORGENSTERN
I.
Stuttgart, 24. November 1913
#TX
Sie gestatten mir wohl, daß ich der Rezitation von Dichtungen unseres verehrtesten lieben Mitgliedes Christian Morgensteru einige Worte vorangehen lasse. Darf ich doch bei einer solchen Gelegenheit anders sprechen, als ich sonst immer vor Ihnen zu sprechen habe. Sonst fühle ich mich verpflichtet, wenn ich spreche, Persönliches nicht zu berühren und unsere geisteswissenschaftliche Weltanschauung sprechen zu lassen. Dieses Mal aber darf ich so zu Ihnen sprechen, wie ich sprechen muß, wenn ich zu einer solchen Verpflichtung nicht verhalten bin. Ganz persönlich darf ich zu Ihnen sprechen gerade bei einer solchen Gelegenheit.
Gern möchte ich bei einer solchen Gelegenheit die Seelen unserer lieben Freunde sehen in einer Art von Festesschmuck, weil mir vorkommt, daß dies eine Gelegenheit ist, wo wir in einer gewissen Beziehung fühlen können und fühlen dürfen etwas unmittelbar Menschliches von dem Werte und der Wahrheit dieser unserer geisteswissenschaftlichen Bewegung. Etwas von dem Werte und der Wahrheit dieser unserer geistigen Bewegung können wir aber auch sicher wissen dadurch, daß wir anführen die Gründe und die guten Belege zu dieser geisteswissenschaftlichen Weltanschauung. Das aber sind Dinge, die ein jeder selbst besorgen muß, wenn wir uns richtig verstehen, ganz unbekümmert um das, ob er diesem oder jenem Standpunkte unserer Weltanschauung zustimmt oder nicht - aber es gibt andere Beweise. Es gibt solche Beweise, die uns recht sehr zu Herzen sprechen können. Lassen Sie es mich schlicht und einfach aussprechen, daß es diese Beweise unserer Weltanschauung recht gut geben kann. Dieses schlichte Aussprechen ist aber recht sehr herzlich gemeint. Es ist das Wort, das unserer Weltanschauung etwas von seiner inneren Wahrheit gibt dadurch, daß sie sagen darf: Auch Dichter kommen zu uns. -
#SE281-205
Und derjenige wird mich am besten in diesem Augenblick verstehen, der so tief, wie es gerade Christian Morgenstern gegenüber sein kann, das Wort: Auch Dichter kommen zu uns - empfindet, gerade im Hinblick auf den inneren Wahrheitswert und die Verdeutlichung desjenigen, was der Kern unserer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung sein mag.
Es gibt Erlebnisse des menschlichen Herzens, die - soweit man Umschau hält in allen Welten des Natürlichen, Menschlichen und Göttlichen - nur auf dem Wege die rechten sind, den man gehen darf an der Seite' der Seele des Dichters. Und das empfinden, heißt eigentlich erst so recht erleben, was der Dichter dem Erdenleben ist. Und es gibt Momente, wo gerade von seiten des Dichters der menschlichen Seele gegeben werden kann, was unvergänglich ist.
Wie gesagt, ich möchte nur einiges Symptomatische, ganz Persönliche sprechen, nur weil wir uns vielleicht auf diesem Wege zu jenem Festesschmuck der Seele recht rüsten, den ich so gern sehen würde, wenn so etwas wie Christian Morgensterns Dichtungen in den Muße-augenblicken, die man hat, auf die Seele sich senken. Dann fühlt man etwas von dem, was ich eben angedeutet habe.
Für mich selbst gab es in den letzten Tagen noch etwas ganz Besonderes in Verbindung mit diesen Dichtungen. Ich las einige Seiten, die unser liebes Mitglied Christian Morgenstern niedergeschrieben hat, und ich darf gestehen - vielleicht wird mir das von Christian Morgenstern selbst nicht übel genommen, wenn ich ein paar Minuten vor der Rezitation dazu in Anspruch nehme -, daß zu den Momenten seltener Freude, ganz innerer Freude das Lesen so mancher der anspruchslos schlichten Worte gehört, die als «Autobiographische Notiz» in dem Verlags-Almanach Pipet, München, erschienen sind. Ich darf ja persönlich sprechen. Man fühlt sich gerade durch die Berührungen von Christian Morgensterns Liebe erweckender Gemein-schaftsseele mit einer andern zusammen in Regionen getaucht, wo man sich mit dieser Seele zusammen zwar vereinsamt, aber von den Weltenmächten umspült findet, wenn man so etwas liest wie die Anfangsworte zur Autobiographischen Notiz. Man erfühlt sich so wie von etwas eigenartigem Geheimnisvollen angeweht, wenn jemand
#SE281-206
so etwas sagt. Vielleicht wird manchem sonderbar erscheinen, daß ich dieses hier ausspreche, aber es ist so.
«Das Jahr 1901 sah mich über den Paul de Lagardes. Er erschien mir - Wagner war mir damals durch Nietzsche entfremdet - als der zweite maßgebende Deutsche der letzten Jahrzehnte, wozu denn auch stimmen mochte, daß sein gesamtes Volk seinen Weg ohne ihn gegangen war.»
Wenn man vorbereitet ist zum Aufnehmen einer selbständigen Charakteristik des Dichters, so wird einem viel durch die Seele ziehen können bei solch schönen, scheinbar anspruchslosen Worten.
Das möchte ich andeuten, um sagen zu können, daß bei Christian Morgensterns Dichtungen etwas empfunden werden kann von dem, wovon ich meine, daß es eben in Regionen führt, in die man als Menschenseele nur auf zwei Wegen kommen kann: entweder als Schaffender, oder aber an der Seite der Seele eines Schaffenden. Sonst werden einem verschlossen diese Regionen menschlichen Empfindens und Er-lebens, die gefunden werden können, wo entstanden sind Dichtungen wie «Der Stern», oder wie manches wunderbar schöne Landschaftsbild in Christian Morgensterns Werk. Sonst ist einem der Weg zu dieser Region verschlossen.
Und das zweite Wort, das ich aussprechen möchte, wo wir einen tieferen Eindruck vom Leben erhalten, ist jenes Wort, das uns so recht offenbart, was jeder Mensch als einzelne Individualität für sich ist. Es gibt etwas in der Welt für jeden, der als Dichterindividualität vor uns steht, was ein Heiligtum ist, zu dem kein anderer Mensch als nur er selber kommen kann. Denn die Götter haben für jede solche Seele einen einsamen, isolierten Ort im weiten Weltenall geschaffen, wovon die andern ausgeschlossen sind, wenn der Betreffende sich ihnen nicht nähert so, daß er sie zu seinem Heiligtume hinführt, wenn er sie nicht geistig an der Hand nimmt und hinführt. Daß man etwas empfinden kann von der Schöpfung, von der inneren Seelenschöpfung, die der Dichter in die Welt hineinstellen will, das möchte ich Ihnen mit diesen Worten zum Ausdruck gebracht haben.
Über die Dichtungen selbst, die zum Teil aus früheren Zeiten stammen,
#SE281-207
zum Teil in den letzten Zeiten geschaffen sind, obliegt mir nicht zu sprechen, denn es gibt ein Fühlen, das uns sagt: Dichtungen gegenüber ist es in gewisser Beziehung nicht gestattet, mit Worten sich ihnen zu nähern, sondern nur mit jenen Tiefen der Seele muß sich ihnen ein jeder selbst nähern, in denen Worte nicht mehr sprechen. -Das sind solche Tiefen der Seele. Das ist etwas von dem, was ich wünschen möchte, daß es gefühlt werde.
Und da ich schon einmal ganz persönlich zu Ihnen sprechen kann in diesen Minuten, so gestatten Sie mir auch noch diese Bemerkung. Ich habe oftmals die Empfindung haben dürfen, daß innerhalb unserer Bewegung der eine oder andere ist, der aus diesem oder jenem Grunde den Impuls hat, einem eine Freude zu machen. Persönliche Freude wird es mir immer sein, wenn viele Seelen, die innerhalb unserer Bewegung sich gerade vertieft haben durch das, was unsere Bewegung auf diesem Gebiete leisten kann, wenn viele Seelen sich hinzuwenden vermögen zu rechter, zu wahrer, schöner Aufnahme Morgensternscher Dichtungen. Und wenn ich eben von einer Freude, die der eine oder andere mir persönlich machen will, sprechen soll, so kann er sie mir eigentlich am besten dadurch machen, daß er sich bereitfindet zu einem verständnisvollen Eindringen in so etwas, wovon wir Ihnen jetzt einige gute Proben geben möchten. Dies sind die Dinge, durch die man sich auch persönlich mit unserer Bewegung verbunden fühlen darf, und einmal auch gleichsam aus der Rolle fallen darf, und intim persönlich von seiner Freude sprechen darf, auch davon sprechen darf, daß zu dieser Freuden größten die gehört, daß wir Dichter wie Christian Morgenstern unter uns haben, in unserer Mitte. Das Beste, was ich Ihnen geben will, ist nicht eine Einführung in das, was doch wohl durch sich selbst sprechen kann. Aber was ich gerne hätte, ist, daß Freude, viel Freude von meiner Seele in die Ihrige, meine lieben Freunde, hinüber sich ergieße, daß mancher mitfühlt mit mir, was ich selber so gerne fühle und immer fühlen werde. Möge unser lieber Freund Christian Morgenstern viele, viele von seinen dichterischen Schöpfungen, die sich in seiner Seele häufen, uns schenken. Wünschen wollen wir recht innig aus der Seele, daß wir vieles von dem erleben, daß er vieles uns noch schenkt, und daß wir immer die
#SE281-208
Stimmung finden mögen, recht vieles von ihm entgegennehmen zu dürfen.
Damit wollte ich dasjenige, was Ihnen in der Rezitation gegeben werden soll, mit ein paar Worten begrüßen.
Es folgtc dic Rezitation durch Maric Steiner. Dic Reihcnfo'ge ist nicht bekannt.
II.
Leipzig, 31. Dezember 1913
Wir wollen heute, da ein Jahr seinen Kreislauf beschließt und ein neues beginnt, bevor ich zu meinem Vortrag übergehe, etwas vor unsere Seele treten lassen, von dem ich sagen kann, wenn ich den Empfindungen des eigenen Herzens folge, daß es geeignet ist, uns in eine rechte, liebe Festesstimmung zu versetzen.
Eine Anzahl unserer Freunde konnte schon bei dem letzten Vortragszyklus in Stuttgart bekanntgemacht werden mit Dichtungen des zu unserer tiefen Befriedigung heute unter uns weilenden Dichters Christian Morgenstern. Und heute wird Fräulein von Sivers Ihnen zum Vortrag bringen dürfen einige der neuen Dichtungen unseres verehrten Freundes, einige von den Dichtungen, die noch nicht gedruckt sind, deren Erscheinen wir aber im Lauf der nächsten Zeit mit tiefer Befriedigung entgegensehen.
Wenn ich dasjenige, was ich selbst fühle gegenüber diesen Dichtungen, nur mit ein paar Worten zuerst zum Ausdruck bringen darf, so möchte ich Ihnen sagen, daß die Tatsache, daß wir Christian Morgensterns Dichtungen als die eines unserer lieben Mitglieder kennenlernen dürfen, zu den ganz besonderen Freuden, zu den ganz besonderen Befriedigungen gehört, die ich auf dem Felde unseres Wirkens für eine geistige Weltanschauung der Gegenwart finde. Ich möchte sagen, zu den allerhöchsten Beweisen des inneren Wahrheitskernes und Wahrheitswertes dessen, was wir mit unserer Seele suchen, gehört es, daß wir aus dem geistigen Boden, auf den wir uns zu begeben versuchen, heraussprossen sehen Dichtungen von einer solchen Herzenstiefe
#SE281-209
und Geisteshöhe, wie sie gerade diejenigen Christian Morgen-sterns sind.
Ich habe es manchmal hören müssen von dem oder jenem, auch von manchen Nahestehenden, daß das Leben in der Art von Vorstellungen, durch die wir den Zugang suchen zu den geistigen Welten, erkaltend und lähmend wirken könne auf die Enifaltung der dichterischen Kraft und der dichterischen Phantasie. Und etwas wie eine Art von Furcht konnte ich zuweilen bemerken bei denen, die sich nicht schädigen lassen wollen ihre dichterische Kraft von einem Zusammen-hange mit dem geistigen Leben, das wir mit unseren Seelen suchen. Daß schönste, zarteste, edelste, wahrste Dichtung von gleicher Gesinnung und von gleicher Triebkraft mit dem sein kann, was wir selbst suchen, dafür zeugen die Dichtungen Christian Morgensterns. Allerdings, daß in den Sphären geistigen Lebens, in die wir einzudringen versuchen, Dichtung, wahre Dichtung, echter künstlerischer Geist walte, dafür wird notwendig sein, daß Wärme des Herzens, die sich durchdringt mit der Innigkeit des Geisteslebens, wie es unsere Zeit durchpulsen könnte, sich erhebt zu jener schöpferischen Phantasie, die sich von der Kraft des Geisteslebens durchleuchten lassen will. Und dieses ist für mein Empfinden, für mein Fühlen gerade bei den Dichtungen Christian Morgensterns der Fall. Insbesondere wenn ich solche Dichtungen, wie Sie sie nachher hören werden, auf meine Seele wirken lasse, dann kann ich nicht anders als das, was ich dadurch erlebe, in Worte fassen, die ich in anthroposophischer Form aussprechen möchte.
Wenn ich solch ein Gedicht in Ruhe auf meine Seele wirken lasse, so habe ich noch etwas anderes als dieses Gedicht, etwas von dem, was allerdings jede wahre, wirkliche Kunst ebenso hat. Ich möchte das Wort aussprechen: Diese Dichtungen haben Aura! Sie werden durchflossen von einem sie durchdringenden und durchwebenden Geiste, der aus ihnen strahlt, der ihnen innerste Kraft gibt, und der von ihnen in unsere eigene Seele hinein strahlen kann. - Und meine eigene Seelensituation diesen Dichtungen gegenüber auszusprechen mir erlaubend, möchte ich sagen: Oftmals hört man das Wort, das gewiß richtig ist: Wer den Dichter will verstehn, muß in des Dichters
#SE281-210
Lande gehn! Heute möchte ich das Wort gegenüber den Dichtungen unseres Freundes einmal in einer gewissen Weise umkehren: Wer ein Land will recht verstehn, muß ein Ohr für seine Dichter haben! - Bei keinem Lande scheint mir dies so sehr notwendig wie bei dem Geistes-lande. Wenn im Geistesland die Dichter sprechen, dann wollen wir auf sie hinhören. Dann erst, wenn wir nicht bloß dasjenige, was uns an mehr oder weniger wissenschaftlichem Inhalt das Geistesland zu sagen hat, in unser Herz eindringen lassen, sondern wenn wir im Geistesland den Dichter verstehen, dann haben wir unsere Seele bereitet für das Geistesland. Das ist die Stimmung, die ich Ihren Seelen wünschen möchte zum Entgegennehmen dieser Dichtungen, wie diese Stimmung, die ich haben durfte an Christian Morgensterns Dichtungen, für mich etwas Beseligendes war gegenüber der inneren Kraft der Seele, die in die Geistgebiete führt.
Und anschließend daran darf ich vielleicht am heutigen Tage die zwei Wünsche aussprechen: den ersten, daß recht viele von Ihnen angeregt werden mögen, die echte Dichterseele in ihren verschiedenen Werken kennenzulernen, von der wir nachher ein paar Proben hören werden. Es wird mir immer ein befriedigendes Bewußtsein sein zu wissen, daß viele unserer Freunde zu Christian Morgensterns Dichtungen gehen.
Der andere Wunsch ist der, daß es unserem Freunde gegeben sein mag, immer weiter und weiter zu unserer innigen Befriedigung, zu unserer künstlerischen Erhebung so schöpferisch tätig zu sein, wie er es in den Dichtungen war, deren Erscheinen wir zu erwarten haben, und aus denen wir einige Proben jetzt hören werden.
Es folgte die Rezitation durch Marie Steiner. Die Reihenfolge ist nicht bekannt
FRIEDRICH LIENHARD-MATINÉE Stuitgärt, 16. Februar 1915
#G281-1967-SE211 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
FRIEDRICH LIENHARD-MATINÉE
Stuitgärt, 16. Februar 1915
#TX
Wir werden heute die große, die herzliche Freude haben, in diesen Stunden uns erfüllen zu können mit den Eindrücken der dichterischen Schöpfung von Friedrich Lienhard. Bei einer solchen für uns so lieben Gelegenheit soll immer wiederum darauf hingewiesen werden, wie wir fühlen dankbarst, wenn die Möglichkeit gegeben ist, daß zusammenkllngt mit dem Streben, das unsere Herzen durchseelt, dasjenige, was der wahre Dichter heraufholt aus den Heimatgefilden des Geistigen, die auch unsere Heimatgefilde sind. Und betont muß immer werden, wie wir uns glücklich und tief seelisch befriedigt fühlen müssen, wenn der wahre Dichter in unsere Kreise dasjenige trägt, was ihm die geistige Macht, zu der auch wir uns bekennen, als ihrem Liebling in Herz und Seele hinein inspiriert. Und von solchen wahren Inspirationen werden wir uns erfüllt finden, wenn wir hinwenden das geistige Ohr zu Friedrich Lienhards Schöpfungen. Wir dürfen uns innig verwandt fühlen gerade seiner Dichterseele, die aus zwei Quellen her nebeneinander ihre Inspirationen holt, die uns so nahe, so recht naheliegen können. In wievielen doch der Lienhardschen Schöpfungen lebt das, was die verschiedensten, die mannigfaltigsten Geister der elsässischen Naturwelt raunen, rauschen, lispeln, ins Menschenherz hinein vernehmen lassen. Es darf der Glaube ausgesprochen werden, daß im Laufe der geisteswissenschaftlichen Entwickelung gerade innerhalb dieser okkulten Strömung sich immer mehr und mehr diejenigen finden werden, die gerade ein dankbarstes Publikum sind für das, was von solcher Seite herkommt.
Es ist durchaus ein Mißverständnis zu glauben, daß die Inspirationen aus der geistigen Welt, wie man sie nachempfinden kann dem Dichter Lienhard, etwa bloß in den Inhalt des Künstlerischen hinein sich ergießen und ablenken von der eigentlichen künstlerischen Form. Das ist nicht der Fall. In Wahrheit verspürt man vielmehr, wie die Worte getragen werden in die geistigen Höhen und im Tragen selbst Künstlerischstes auch in der Form entfalten, wenn die Träger des
#SE281-212
Wortes, wenn die Träger der anderen Kunstinittel die wahrhaftigen Meister der seelischen Wirklichkeit sind. Dieses Getragenwerden von dem wahrhaftigen Geiste der seelischen Wirklichkeit, das ist es, was in so wunderbarer Weise uns aus Friedrich Lienhards Dichtungen heraus immer begrüßt.
Die zweite Quelle, die uns auch so nahellegt, ist die, daß der Dichter gefunden hat den Weg zu denjenigen Quellen geistiger Inspiration, die aus den alten Überlieferungen germanischer Vorzeit fließen, in denen noch in so großartiger Weise uralte Weisheiten nachklingen und nachraunen. Ist es doch wirklich so, als ob zuweilen gerade in den größeren Dichtungen Lienhards gegenwärtig werden könnte etwas von jener Stimmung, von jener künstlerischen Stimmung uralter Germanenzeit, die eigentlich im Grunde genommen so verweht ist, daß selbst Wilhelm Jordans Dichtungen sie nicht wieder heraufzaubern konnten. Es war mir oftmals, als wenn ich etwas nachklingen hörte gerade aus den Dichtungen Friedrich Lienhards heraus von dem, was so lebhaft vor meiner Seele steht, wie in alten Zeiten die Alliterationen noch lebendig waren, diese Alliterationen, die in jenen Zeiten die Worte so trugen, daß eben Worte da waren, die in jeder Seele lebten. Der Dichter schlug dann irgendeinen Ton an, und die Gemeinde ließ in Alliteration das nachklingen, was der Dichter angeschlagen hatte und was der Sänger zum Ausklang brachte. Wenn der Sänger einen Ton anschlug, dann fielen die Zuhörer ein. Das bildete das Band der Seelen für die Menschen. Und das ist im Grunde genommen nachklingend in all den Gemeindegesängen, welche einen schwachen Nachhall zeigen von dem, was auch in den Mysterien getrieben wurde. Und so müssen wir dankbar sein, wenn ein Dichter wieder in möglichst echtem Sinne an diesen Quell gehen will. Ein Dichter, der gerade in unserer Zeit den Ernst der Kunst in so wunderbarer Weise zu betonen wußte durch seine Verbindung mit den schicksalschweren Tagen, die wir durchleben.
Ich möchte, daß viele von uns Friedrich Lienhards Schriften lesen, seine Gedichte, besonders auch «Deutschlands Europäische Sendung», in der so viel Herzlichkeit lebt in bezug auf die Auffassung dessen, was uns in diesen Tagen so nahetritt, in der so viel lebt von den großen Impulsen, zu denen wir uns hinaufschwingen müssen, wenn wir
#SE281-213
als Bekenner der Geisteswissenschaft im rechten Sinne leben wollen mit dem, was durch unsere Zeit pulst. Und nicht minder wird die Seele Erhebung finden, wenn sie eines echten Dichters Aussprüche vernimmt, der in seinem Herzen zusammengewachsen ist mit Deutschlands Westmark, in seiner Schrift «Das deutsche Elsaß», in der er über den Zusammenhang der deutschen Westmark mit dem gesamten deutschen Wesen so schöne Worte zu finden gewußt hat.
Wir werden zuerst die Freude haben, gerade aus jener noch zu erscheinenden Sammlung heraus, welche gewidmet ist dem Dienste unserer Zeit, durch Friedrich Lienhard selbst einige Gedichte dankbar zu hören. Wir werden sie wirklich dankbar hören können, denn wir werden einen Vorklang von dem vernehmen, was wohl jetzt schon wie ein Zustand der Zukunft, einer Zukunft voller Lebendigkeit, vor unserer Seele stehen darf. Denn es darf vielleicht auch als ein Gruß gelten für dasjenige, was uns Friedrich Lienhard jetzt geben wird, wenn erwähnt wird, wie wir fühlen, daß in unserer Zeit viel, viel dichterische Stoffe vorhanden sind, die hervorkommen, hervor-quellen werden, wenn einmal aus jener tragischen Stimmung, die uns jetzt erfüllen muß angesichts dessen, daß vorläufig hauptsächlich die schweren, oft grausamen Taten sprechen müssen, eine andere Stimmung sich entwickelt haben wird, wo das Fühlen des Schmerzes künstlerisch zum Ausdruck bringen muß vieles, was jetzt noch an den Seelen so vorübergeht, was aber ganz gewiß in ähnlicher Weise, wie den Dichtern der Vergangenheit, unsern Dichtern künstlerisch zu Gestaltendes bieten wird. Ein Bild steht vor mir, von dem ich glaube, daß es manche Inspirationen enthalten muß für die Zukunft, das deutlicher aussprechen wird, was in der Gegenwart lebt, als manches, was jetzt schon deutlich gesehen wird. Viele, viele tiefen Eindrücke konnte man bekommen in unserer Zeit. Für mich überwog ein Eindruck gar viele andere, ein Eindruck, den ich in den ersten Tagen des August hatte. Wenn man den Blick hinrichtete nach dem Deutschen Reichstag und seinen versammelten Parteien mit ihren Parteiführern - es scheint prosaisch zu sein, aber mitten in der Prosa verwandelt sich der Eindruck doch in ein poetisches Bild -, um dann den Blick zurückzuwenden nach Osten, wo eine andere Versammlung stattfand,
#SE281-214
die Versammlung der Duma, und wenn man nicht das allein nimmt, was da vorging, sondern wenn man die Stimmung nimmt, die sich wie eine Aura darüberbreitete, nun, es wird schwierig sogar heute schon, diese Stimmung in Worte zu bringen. Hinwendend den Blick nach dem Deutschen Reichstag: was herrschte wie ein Herold, der vorausgeht kommenden Taten? Schweigen. Schweigen der Parteien. Die Stimmung, die aus diesem Schweigen sich erhebt, wahrhaftig, in Vergleichung mit der anderen, welche aufsteigt, wenn wir im einzelnen betrachten das, was sich abspielte fast in der gleichen Zeit, in der auch die Einberufung der Duma stattfand, es muß uns erscheinen, weil so viel, so unendlich viel von allen Seiten geredet wurde, neben dem schweigenden Herold - ich sage es wahrhaftig nicht mit Hohn, mit Ironie, ich fühlte in meinem Innern Trauer aufsteigen, als ich mir das Bild dessen vergegenwärtigte, was sich abspielte in der Duma im August - das Bild, das einen wie eine mit allem möglichen Flitter-zeug aus Phrasen - die allerdings im Taumel der Begeisterung ausgesprochen wurden - behängte Fastnachtfigur anmutet. Ich weiß mich jeder Objektivität fähig, indem ich diese zwei Bilder hinstellen muß, weil sie sich mir hinstellen vor meine Seele. Und gedeihen wird eine Kunst, die weiß, was sie aus diesen Bildern besprechen muß.
Dankliarlichst werden wir anhören den Anfang der Dichtung, die als Gesang von Friedrich Lienhard gedacht ist, in dem künstlerisch gestaltet ist dasjenige, was durch unsere Zeit webt und karmisch lebt. Und dann, nachdem wir dies empfangen haben werden, werden wir uns weiter vertiefen können in ältere, aber immer jungbleibende Schöpfungen dieses Künstlers, dieses Dichters, der zu uns hat seine Wege lenken wollen.
Dasjenige aber, was wir fühlen, meine lieben Freunde, das möge sein, daß gerade für die Art von Dichtung, wie sie Friedrich Lienhard der Menschheit beschert, ein besonders dankbares Publikum da ist in den Seelen, die Geisteswissenschaft aufgenommen haben.
Von diesen Gedanken aus sei begrüßt Friedrich Lienhard, der Dichter, den wir so gerne, so mit inniger Liebe, so mit menschlicher Verehrung unter uns sehen und immer sehen werden. Friedrich Lienhard trägt seine Dichtungen vor.
LIENHARD-FEIER Dornach, 3. Oktober 1915
#G281-1967-SE215 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
LIENHARD-FEIER
Dornach, 3. Oktober 1915
#TX
Rezitation durch Marie Steiner aus «Gedichte » von Friedrich Lienhard
WOHER?
Weiß nicht und finde nicht Worte,
Wo meine Heimat sei.
Wohl stehen und scheinen wie Kerzen
Die Birken herab in den Mai.
Aber ich seh' wie verirrt hinaus,
Weit wo anders bin ich zu Haus,
Weit!...
Du Heimklang, den ich nicht deuten kann,
Du Fragegewisper im fremden Tann -
Woher?
War ich in alten Zeiten
Ein Ritter am rauhen Meer?
Hört' ich die große Brandung
Anrauschen wehvoll-schwer?
Bin ich gefallen im Kampfe
Um einen granîtnen Besitz?
Zerschlug meine Heldengaleere
Der wilde Blitz?
Ich war vielleicht vor Jahren
Ein Bursche frisch und rund;
Es ging ein Bächlein raunend
Durch einen Mühlengrund.
Ich habe daran gesessen
In manchem jungen Harm,
Derweil eine andre lachend lag
In eines andren Arm.
Weiß nicht und finde nicht Worte,
Wo meine Heimat sei...
#SE281-216
Die Menschen tun mir wehe,
Ich frage den Wind: warum?
Wohin ich horche, wohin ich sehe,
Bleibt ihr Gebaren mir fremd und stumm.
Ihre Stadt voll Unmelodie!
Die Reiche des Weltalls schauen sie nie,
Sehen nicht, daß sie gefangen sind - -
Wollt', ich wär' wieder ein Kind!
So herzig möcht' ich sprechen,
So seltsam, wie es mich drängt!
Fülle von Bildern brechen,
Die leuchtend an meinen Bäumen hängt!
Mit «Du», mit «Bruder» und « Schwester»
Hinwandern durch gütige Welt,
Lieb haben, Liebes sagen
Jedwedem, der mir gefällt.
Leicht wie ein Geist, nur gebunden in Gott -
Frei!...
Weiß nicht und finde nicht Worte,
Wo meine Heimat sei...
MORGENWIND
Du lieblich Morgehläuten, wenn Haim an Häimchen schlägt!
Wenn sich von Schwingeglocken die klingende Au bewegt!
Ich horche in all die Gräser, in all die Glocken hinein -
Komm, wildlebendger Morgenwind, kehr ein, kehr ein, kehr ein!
Es ist ein zartes Zupfen, ist nur ein Rühren von Saiten:
Fingerchen sind ja die Winde, die zitternd darüber gleiten!
Dann kommt ein stärker Sausen aus überbrauster Au:
Es springt und singt in Tropfen der windgeschüttelte Tau!
Und was die zarte Harfe schwingt,
Den Windgesang, den Halmenklang,
Und was in starken Tönen singt
Am ganzen lauten Wiesenhang:
#SE281-217
Ich pflücke, bis ich von Fetzlein und Fetzen
Mir zum Behagen und euch zum Ergötzen
Klänge gefangen in Fiedel und Sang!
So weiß ich auf allen Wiesen der Melodien viel:
Wir warten auf den Morgenwind und werden Glockenspiel!
SOMMERWALD
Wie scheu der Sommerwind im Tannwald geht!
Es ruft vorüber wie von fernem Kinde,
Das in der irren Waldung suchend steht;
Doch summen nur im Sommersäuselwinde
Die Mücken hin... und ihr Gesang verweht...
Lieber Wald!...
Von sieben Zwergen, von Sneewittchen träumt
Der Wandrer, der im Sonnengaukelffimmer
An seiner Tanne viele Stunden säumt:
Ein Hans im Glück, der alles Goldes Glimmer
In einen Quell warf, der im Tale schäumt...
Lieber Wald, o lieber Wald!
Rotkäppchen wandert zierlich durch das Grün,
Am Arm der Kleinen wippt des Körbchens Schwere;
In Blumen greift sie, die am Pfade blühn;
Um jede Dolde, jede fremde Ähre
Muß staunend sie und plaudernd sich bemühn ...
Lieber Wald... 0 lieber Wald! ...
WALDGRUSS
Waldhornschall
Hör' ich dahinten im Wasgenwalde!
o sieh, der Fingerhut
Leuchtet von sonniger Halde!
Eidechsen huschen übern Stein,
Üppig duftet der Thymian-Ram,
Hummeln hangen am heißen Klee - -
0 Wald, mein Wald,
Nach deinen Wonnen ist mir weh!...
#SE281-218
SEELENWANDERUNG
Mich hat der Wald schon immer gehegt
Als Falk oder Bach oder Elfe der Nacht;
Als Efeu hing ich an Trümmerpracht,
Ich hab' mich als Nebel im Grund geregt.
Und wenn des Waldwinds Glockengetön
Herkam durch farbiger Lichtung Glanz:
Ich war's, der alle die Halden und Höhn
Zusammengeläutet zum Sonntagstanz.
Und wenn ein Käfer mit grünlichem Leuchten
Vorherflog spätem Steckenmann:
Ich war's, ich brannte der Nacht, der feuchten,
ln Gras und Tau ein Lichtlein an.
So war ich verzaubert und lebte schon lang!
Nun sing' ich das alles in Menschenklang...
SONNTAGNACHMITTAG
In des Döffleins Sonntagnachmittag
Singt und summt des eignen Herzens Schlag.
In des Dörfleins Sonntagnachmittag
Blüht in feinen Tönen Feld und Hag.
Auch zur Nachbarin im Schatten dort
Spricht aus stiller Bibel Gottes Wort.
Und der Alte, der sein Land beschaut,
Hört melodisch wachsen Klee und Kraut.
Denn auf all des Wachstums Melodien
Beht der Nachhall heil'ger Glocken hin...
GLAUBE
Wie eine Blume in milder Nacht,
Vom Mond gespeist, vom Tau getränkt,
Wachs' ich von deiner Erde auf
Zu dir, der mich hier eingesenkt.
Deine Stürme fahren daher, dahin,
Deine Lenzluft lockt, deine Mondnacht taut -
Tue mit mir nach deinem Sinn:
Du bist mein Gärtner, ich dein Kraut!
#SE281-219
DAS SCHAFFENDE LICHT
1.
Du unergründlich Leuchten!
Du unefforschlich Meer!
0 Lenz, wirf Wogen der Wonne
Über den Wandrer her!
Des Ostens Licht und das Dampfen
Des Weißdorn am tanigen Hag,
Das Brechen und Brausen der Bäche -
Wie sing' ich so sprühenden Tag?!
Horch, in den Himmeln hangen
Lobsingende Lerchen genug!
Schaffend will ich dich trinken,
O Lenztag, Zug um Zug.
2.
All die runden Rosablüten,
Die aus Pfirsichbäumen dringen;
All die unsichtbaren Lerchen,
Die auf weißen Wölkchen singen;
All die Blumen, die wie Flämmchen
Auf der Aue sich enifachen;
Jene Kinder, die am Waldrand
In den Sonntagmorgen lachen -
Ach, und des brausenden Herzens Schlag:
Alles reckt sich empor zum Tag!
Alles, was Odem hat, wird ein Gedicht:
Ein Lobgesang auf das schaffende Licht!
3.
Habt ihr es auch erfahren?
Oft zittert aus Blüten und Kraut
Ein heimwehsüßes Sagen,
Als wär's ein Geisterlaut.
#SE281-220
Und manchmal, nach Gewittern,
Steht groß im Abendbrand
Auf den kristalluen Wolken
Ein unbekanntes Land.
Und ist dein Hügel hoch genug,
So trägt der Winde Säuselzug
Ein geisterfeines Singen her,
Als ob das Spätrot tönend war.
Kennt ihr den Klang so heimwehweich?
Es ist ein Gruß aus sel'gem Reich!
Von dorther hat uns Gott entsandt,
Daß wir dem dunklen Erdenstrand
Lichtworte offenbaren!
Habt ihr es auch erfahren?
Zu den Dichtern, welche in die Welt der äußeren, physischen Wirklichkeit die Töne des geistigen Lebens, die Töne einer noch anderen Welt hereinzubringen wissen, wird man immer in der Zukunft, wenn man einen Überblick halten wird über die Entwickelung des Geisteslebens, Friedrich Lienhard rechnen müssen.
Friedrich Lienhard ist ein Dichter, von dem wir vor allen Dingen in unserer gegenwärtigen Zeit, wo sich in Kunst und Dichtung so vieles von Unwahrem, von Unechtem und Phantastischem mischt, sagen müssen: Er ist als Künstler, als Dichter, als Mensch echt und wahr bis auf den Grund seiner Seele. Und wenn alle die Neigungen verschwunden sein werden, die in der zweiten Hälfte des 19. und im Beginne des 20. Jahrhunderts, man möchte sagen wie die Begleiterscheinungen der materialistischen Neigungen auf künstlerischem und ästhetischem Gebiete hinneigen zu allen möglichen «Ismen», wird man erst fühlen, daß das geistige Leben in Dichtern, wie wir ihn in Friedrich Lienhard haben, die idealen Ziele in der Welt zeigt. Man wird fühlen, wie seine Dichtungen nicht darin Kunst sehen, daß man darin erblicken wird äußere, sinnllch angeschaute, einfach in irgendwelches dichterische Kleid oder in irgendwelche künstlerisch gebildete Worte oder Formen gebrachte Bilder, sondern daß man das
#SE281-221
Künstlerische, das Dichterische darinnen sehen wird, daß die unsichtbare, geheirr:nisvolle Welt, welche in der physischen Welt wirklich allüberall verzaubert liegt, aus ihrer Verzauberung hervorgerufen werde, jene Welt, welche der Mensch für den menschlichen Anblick aus dem Zusammenwirken aller Weltharmonien hauchartig hinwebt und hinwirkt über das Sinnlich-Wirkliche, und daß man versucht, in die Botschaft des dichterischen Schaffens und Dichtens hineinzukommen.
So steht Friedrich Lienhard der Welt, dem Menschen und dem ganzen Universum gegenüber nicht nur als ein Künstler, nicht nur als ein Dichter, sondern, was mehr, viel mehr ist, als ein Suchender, als einer, der in seinem eigenen Gemüte verwoben ist mit den Rätseln des Menschendaseins, des Weltendaseins, und der seine dichterische Kraft zu stimmen vermag aus dem Erfühlen dieser Weltenrätsel, dieser Menschenrätsel heraus.
Wenn wir hinhorchen auf die älteren seiner Dichtungen, so fühlen wir, wie dieses Menschengemüt lebt rnit alledem, was in der Natur selber lebt und webt, wie aus den Vorgängen der Natur die Freuden, die elementarischen Freuden dieses Menschenherzens entbunden werden, so wie wenn die Geister der Natur selber diese menschlichen Freuden in diesem Menschengemüte entzünden wollten, und wir hören forttönen in Friedrich Lienhards dichterischem Schaffen das eigenartige Weben der Elementarwesen der Natur, und das wiederum ist es, was in seinen Dichtungen hinausgeht über das oftmals Dumpfe und Enge, das seine Zeitgenossenschaft hatte und aus dem er herauswachsen mußte.
Das innige, aufrichtige, tiefe Naturempfinden und das Verwoben-sein mit alledem, was im Menschenleben an Verwicklungen besteht und was erzeugt in dem einzelnen Menschengemüte auf der einen Seite sehnendes Verlangen, freudiges Sicherheben, und auf der andern Seite hineinbringt Schmerz und tiefes Leid, alles das bewirkt wiederum Friedrich Lienhards Dichtungen, daß wir sie nicht verstehen können, wenn wir einzelnes als Menschen fassen, sondern fassen als heraus sich entwickelnd aus einem Volke und einem Zeitgeiste unserer neueren Entwickelung.
#SE281-222
Sehr eigentümlich ist es, wenn man ein Organ hat, sich so recht hineinzufühlen in Friedrich Lienhards Dichtungen da, wo die Dichtung erst in ihren tieferen Zügen, in ihrer tieferen Charakteristik beginnt, in welche Tiefen aber oftmals die Menschenseelen gar nicht mitgehen wollen. Wenn man ein Organ hat, da noch mitzugehen und mitzufühlen, findet man, wie die eigentümliche Natur Friedrich Lienhards wirklich dichterisch, weltentrückt ihre eigene Sprache lebt und webt, die ihre eigene Antwort, ich möchte sagen, im großen Welten-dasein fordert, die sie befriedigt, um in ihrem Eigenen fortleben zu lassen das lebendige Weben und Wesen der Allnatur. Dann finden wir, wie in schwingenden Wellen, wie mit Flügeln des Seins und des höheren Lebens fortlebt, was in der Natur schafft und wirkt, und das fühlen macht, wie elementarische Zaubergeister Sein durch das bekommen, was Friedrich Lienhard sagt, durch das, was im Universum lebt und hineinwill in das dichterische Schaffen, weil es sich nicht voll ausleben kann im Naturschaffen. So sehen wir, wie in der Sprache Lienhards etwas ist wie ein höherer Naturton, und wie sich ganz selbstverständlich hineinlebt in Friedrich Lienhards sprachliches Wirken das Weben der Alliteration. Versuchen wir hinzuhorchen und zu ergründen das, was uns so recht zeigen kann, wie das Herz sich aus-tönt in den Tönen der Worte, so werden wir sehen, wie die Natur noch hineinwebt in das glänzende Licht, in die Schall wirkende Luft, wie sich hinwenden über das Naturdasein Kräfte und Wesen, die nicht gesehen werden können als nur vom Künstlerauge, nicht gefühlt werden können als nur vom Künstlerherzen und vom Künstler-gemüte. Seelen wie Friedrich Lienhard erscheinen einem oftmals so, wie wenn die göttliche Alimutter des Daseins das, was an überschüssiger Schöpferkraft in ihr ist und was sie nicht aufbrauchen kann zum Schaffen der Naturreiche, sich aufsparte, um in einzelnen menschlichen Individuen noch auf ganz besondere Weise auszusprechen, was sie aus ihren eigenen Geschöpfen heraus nicht selber sagen kann.
Und dann fühlen wir so recht, was Coethe sagen wollte, wenn er von dem menschlichen Schaffen als von einer Natur über der Natur sprach, als von einer Natur, in der sich zusammenfaßt geistiges Ergeben
#SE281-223
und geistiges Erheben in das, was sonst ausgebreitet ist in den weiten Reichen des Naturdaseins.
Ein Suchender in diesem Sinne, wie ein Suchender getragen ist von den geheimnisvollen Kräften, die ihn schaffend beleben und entwik-kein, wurde Friedrich Lienhard, und so ergab er sich jenen Natur-stimmungen, in denen das fortwirkte, was in der schaffenden Natur wirkt und west, um das zu fühlen, was vom Menschenherzen zum Menschenherzen spielt und was wieder zu dem großen All und zu dem führt, wozu der Dichter berufen ist, es im Bilde darzustellen.
So sehen wir denn, wie Friedrich Lienhard als Suchender ein Wachsender, ein Werdender stets ist, wie er nicht jenem gleicht, der sich einfach hinstellt vor die Welt, um das zu sagen, was gerade sein Herz, seine einzelne menschliche Seele bewegt, sondern wie verwachsen ist mit dem menschlichen Werden und Weben, was nicht bloß als einzelne Egoität sich ausleben will, sondern das sein will wie Exponent, wie Auswirken dessen, was in der Weite der Menschenseele, in der Volksseele, in der Zeitenseele lebt.
Nachdem Friedrich Lienhard eine gewisse Stufe seiner Reife erlangt hatte, vertiefte er sich in das, was die neuere geistige Entwickelung auf so mannigfaltige Weise gebracht hat, und brachte auf seine Weise zum Ausdruck, wie er begonnen hat Goethe, Schiller, Herder, Jean Paul, Novalis zu studieren, um die anderen neueren Geistes-größen näher zu verstehen, tiefer zu verstehen, inniger mit ihnen mitzuleben. Die Wege, die er selber so gemacht hat, stellte er dar in seiner ganz merkwürdigen Einsiedlerzeitschrift, die dennoch wieder als Einsiedlerzeitschrift zu der Außenwelt sprechen konnte über seine «Wege nach Weimar».
Er war gewandert die Wege nach Weimar, jene Wege nach Weimar, welche die jetzigen Wege der neueren Naturwanderschaft der Menschheit, die Wege der heutigen Menschheit sind, die gefunden werden können in unserem Entwickelungszustande, jene Wege, auf denen Goethe den Zusammenhang mit den Himmels-, mit den Seelenwelten gesucht hat, jene Wege, die Herder ergründet hat, um zu finden, wie menschliches Werden mit kosmischer Entwickelung, mit historischer Entwickelung verbunden ist. Jene Wege nach Weimar, durch welche
#SE281-224
die Menschheit mitfühlen kann mit jenen, von denen zurückgetreten ist die Freude, jene Wege nach Weimar, von denen Goethe spricht, daß sie sich erweitern zum kosmischen, zum Weltgefühle, jene Wege, durch welche die Menschenseele in ihrer ganzen Innigkeit sich so verbunden fühlen kann mit der Allnatur, wo die Seele es dahin bringt, daß sie fühlt mit die Freude, fühlt mit das Leid, fühlt mit das Göttliche auf der andern Seite, daß diese Menschennatur es dahin bringt, das Göttliche in den Himmelsharmonien zu fühlen, daß sie es bringt zu einem weinenden Auge auf der einen Seite, zu einem heiteren Auge auf der andern Seite. Jene Wege nach Weimar hat Friedrich Lienhard gesucht, welche Novalis gegangen ist, um zu finden mit zwar tasten-dem Menschensinn den Weg in die übersinnlichen Welten, den Weg, den man gehen muß, wenn man die Menschenseelen noch finden will, welche die irdischen Leiber verlassen haben, jene Wege nach Weimar, auf denen Friedrich Lienhard Goethe, der ihm vorangegangen, nachgegangen ist in treuer Gefolgschaft, auf denen die Menschenseele geheilt wird von allem Geistesegoismus, von allem geistigen Individualismus, weil sie sich aufsaugen lassen kann von dem Allstreben der Menschheit, jene Wege, auf denen sie geheilt wird von dem Egoismus, dem Eigensinn. So fand er den Weg neben denen, die gestrebt haben für Menschenheil und Menschenwerden, sich einzufühlen in Goethe, Schiller, sich einzufühlen in Novalis und die anderen.
Das hat Friedrich Lienhard auf seinen Wegen nach Weimar erstrebt, und dann hat er hinzugegeben das, was er gefunden hat an geistig Gestaltetem und geistig Erfühltem und brachte selber hinein in seiner Kunst das, was er selber als Höchstes erstrebt hat. So ist Friedrich Lienhard nicht nur für sich, sondern mit anderen geworden, und nun haben wir die große Freude, in der Zeit, in der Friedrich Lienhards reiches Streben in sein einundfünfzigstes Lebensjahr einmündet, auch noch denjenigen zu sehen, der in unserer Mitte nach den geistigen Höhen der Menschheit zu streben sich bemüht, und wir dürfen eine große Freude haben, daß er in unserer Mitte ist, eine Freude, die darum groß sein darf, weil wir nicht nur ein egoistisches Geistesleben für eine jede einzelne Seele entwickeln wollen, sondern weil wir, wenn wir ein gesundes Geistesleben entwickeln wollen,
#SE281-225
Fäden ziehen müssen zu alledem, was in der Welt an Geistigem lebt und strebt.
Friedrich Lienhard hat - ich möchte sagen, wie er den Weg gefunden hat zu den elementarischen Geistern, die in den Blättern, mit dem Winde dahinrauschen, die mit dem Wasser dahinrieseln, die im Lichte dahinflimmern, wie er den Weg gefunden hat, mit diesen elementarischen Naturgeistern so zu gehen, daß seine Worte zu Booten werden, welche hintragen diese elementarischen Zaubergeistwesen durch das menschliche Wirken und das menschliche Schaffen - Friedrich Lienhard hat dann auch den Weg gefunden, jene größeren Boote noch zu zimmern, welche fähig sind, aufzunehmen, um sie in die menschliche Pilgerwanderschaft hineinzugeleiten, die weiteren Geister, durch welche gesucht haben diejenigen, die den Weg nach Weimar gegangen sind, den Weg von der Einzelseele zu der Gesamtseele der Menschheit.
Wie Friedrich Lienhard auf diesen beiden Wegen gewandert ist, so wandert er nun auch den weiten Geistesweg, den wir selber mit unseren schwachen Kräften suchen. Mit starken Sehnsuchten versuchte er einzudringen mit seinem Roman «Oberlin» nicht nur in die einzelne Menschenseele dieses merkwürdigen, einsiedlerischen, geist-begabten Pfarrers aus dem Elsaß, sondern er versuchte mit diesem Romane einzudringen in das ganze kulturhistorische Zeitgefüge, innerhalb dessen Oberlin, der Seher, der einsame Seher vom Elsaß darinnensteht.
So kam Friedrich Lienhard auch dazu, ein Dichter zu werden wie diejenigen, die etwa gleichen Hamerlihg und anderen ähnlichen Dichtern, welche versuchen, aus dem historischen Leben und Werden der Menschheit heraus, die Geheimnisse der Menschheit selber darzustellen, die Rätsel des Lebens zu finden. Es ist im höchsten Grade reizvoll zu sehen, wie herauswächst das menschliche Leben und Wesen des ganzen Zeitalters aus der Darstellung Friedrich Lienhards in seinem so schönen Romane «Oberlin». Weiter versuchte Friedrich Lienhard dann zu gehen in späteren historischen Werken, darstellend, wie der Mensch heute verbindet Geist und Natur, wie er mit seiner Seele den Lebenspilgergang zu wandern versuchen kann. So recht hinein-gewachsen in das geisterfüllte Schaffen und Wirken ist Friedrich Lienhard,
#SE281-226
und wie nahe er unserem Streben steht, das wird Ihnen noch ganz zeigen die Rezitation der Gedichte, die, ich möchte sagen, SO recht Seelensubstanz von unserer Seelensubstanz sind und die wir dann noch hören werden.
In Gedichten wie « Christus auf dem Tabor » oder « Tempel der Erfüllung» hat Friedrich Lienhard den innigsten Zusammenhang mit dem Geist-Erfühlen, das wir suchen, gefunden. Wenn man sehen kann, daß immer mehr und mehr die Zeit heranrückt, in welcher ein geistig Schaffender überhaupt zeigen wird, ob er von den Geistesrufen, die in die Zukunft tönen werden, erfaßt ist dadurch, daß er in dem, was er geistig erfassen, erfühlen, erdenken, erdichten, erschaffen kann, sich gewachsen zeigt einem wirklichen Aufblick zu der Welt-einzigen, Menschheit-einzigen Gestalt des Christus, wenn man das sehen darf, dann darf man auch sagen: Friedrich Lienhard hat sich zu solchen Formen seines Dichtens, Denkens und Schaffens gefunden, die verständnisvoll gegenüberstehen können der Menschheit-einzigen, der Welt-einzigen Gestalt des Christus Jesus. Damit gehört er nicht nur der Gegenwart, damit gehört er, als einer der Anfänge, der Zukunft an, die wir ersehnen, die der Mensch ersehnen muß, der gegenwartig seine Zeit versteht.
In dem Gedichte «Tempel der Erfüllung», das wir noch hören werden, zeigt uns Friedrich Lienhard, wie im Symbolum vor ihm steht das, was auch vor unserem geistigen Auge im Symbolum steht, in jenem Symbolum, das uns zum Ausdruck bringen soll, wie Menschheitsherzen, Menschheitsgemüter, Menschheitsgeister hineinwachsen können in jene Zukunft, die den Materialismus überwinden muß aus dem Grunde, weil zum Weltenheil, zur Weltenrettung Ahriman wieder gebunden werden muß. Dessen wollen wir vor allen Dingen gedenken zu der Zeit, da unser lieber Freund Friedrich Lienhard sein fünfzigstes Lebensjahr vollendet, daß er gewußt hat sich zu verbinden jenen, die den Rufen folgen können nach der Zukunft der Menschheit, die erkannt haben, wie man erkennen muß, daß alles abfallen muß von dem Bau der menschlichen Entwickelung und daß nur bleiben kann das, was den Geistesfrüchten, den Geisteskeimen nachstrebt, die heute schon gesät werden für die Zukunft.
#SE281-227
So wollen wir denn zu denjenigen gehören, denen der fünfzigste Geburtstag Friedrich Lienhards ein schönes Fest ist, ein Fest, das sie liebevoll in ihrem Herzen, in ihrem Gemüte begehen wollen, ein Fest, an dem wir uns dem Gedanken hingeben wollen, wie Friedrich Lienhard nicht nur zu unserer Freude zu uns gehört, sondern zu denjenigen gehört, die an dem großen Tempelbau der geistigen Menschheitsentwickelung mitwirken wollen. Wir wollen stärken und kräftigen unsere Liebe zu unserem Freunde, wir wollen stärken und kräftigen unser Verständnis für dessen ganz eigenartiges Weben und Wesen. Viele von Ihnen, meine lieben Freunde, kennen ihn, er war hier und auch in anderen Orten unter uns. Sie kennen ihn, den merkwürdigen Mann, der so durch die Reihen der anderen Menschen geht, als ob seine Augen hineinschauten in eine Welt, aus der entschwindet ein Stück von dem, was sonst die Augen mit Interesse und Aufmerksamkeit betrachten, als ob er manches nicht sieht, dafür aber anderes sieht, was die Umwelt nicht sieht. Und so erscheint er, ich möchte sagen, rein in seinem äußeren Herumgehen wie ein Träumer einer Welt, die andere ringsherum nur dadurch gewahrwerden, daß sie sie in seiner Seele, in seinem Gemüte ahnen, wenn sie seinem sinnenden Haupte gegenüberstehen. So erscheint er als eine Persönlichkeit, die vieles fühlt, was andere nicht fühlen können, die in vieler Beziehung weltfremd ist, weil sie nach Verwandtschaft strebt mit einer Welt, mit der man nur vertraut sein kann, wenn man gegenüber manchem fremd wird, was vielen anderen Menschen so vertraut ist.
In der Tat, wenn man so, ich möchte sagen diskret fühlt das eigentümlich Charakteristische dieser Persönlichkeit, dann mischt sich die innigste Liebe zu seinem ganzen Wesen in die Verehrung seines schönen, seines Hohheit-erfüllten Schaffens hinein, und dann lernen wir wohl auch, zu ihm in der richtigen Weise zu stehen. Heute, da wir entgegensehen seinem fünfzigsten Lebensjahre, wollen wir diese Gedanken in uns hegen und pflegen, daß sie werden können zu schönen Wünschen, zu kräftigen Wünschen dafür, daß Friedrich Lienhard es gegönnt sei, vieles, vieles noch zu schaffen in der aufgehenden weiteren Lebensepoche, in der höheren Reifensepoche aus dem tiefen Born, aus der tiefen Quelle seines geisterfüllten, naturvertrauten,
#SE281-228
menschheitsliebenden, menschheitsfreundllchen Schaffens und Wirkens. Und sagen wir es mit tiefster Befriedigung, ein Wort im Hinblick auf ihn erfüllt uns mit Freude, erfüllt uns mit Genugtuung, erfüllt uns aber auch mit einem gewissen Vertrauen in unsere eigene Sache, ein Wort, mit Bezug auf ihn ausgesprochen: Freuen wir uns, denn er ist unser!
Rezitation durch Marie Steiner aus «Lichtland» von Friedrich Lienhard
TEMPEL DER EREÜLLUNG
Auf rote Wand wölbt sich der Kuppel Blau;
Und in dem Blau sind goldgewirkte Sterne.
Zwölf Meister stehn im runden Säulenbau
Und richten ihrer Blicke Kraft von ferne
Dreizehntem zu, der vor des Altars Grau
Im silbernen Gewand des Führers steht
Und zwölffach Kräfte sammelt im Gebet.
So läuft die Sonne durch die Tierkreiszeichen
Und laßt sich zwölf besondre Kräfte spenden,
Um sie dann weiter in die Welt zu senden;
So tauscht sich Kraft mit Kraft an allen Enden
Des Kosmos und des kleinen Menschenlebens;
Und kein Geringster strahlt und wirkt vergebens -
Das Sonnenziel kann jeder Stern erreichen.
Jeder für alle - und für jeden alle!
Rhythmisch ist diese wunderbare Halle: -
Denn jeder dieser leichtgeschwungnen Bogen
Ist über jeden Meisters Haupt gezogen,
Der marmoredel unter ihm verharrt;
Den Raum erfüllt ein atemfeines Wogen
Geklärter Seelenkräfte stark und zart.
Wer dieses Sonnentempeis Bann betritt,
Dem prägt sich ein die Doppel-Siebenzahl
Der zeichenvollen Säulen, die den Saal
Von rundumher mit Ebenmaß umgeben;
Gleich einer Taube spürt er oben schweben
Des weißen Kuppeffensters runden Schnitt:
Und auf den Altar fällt der heil'ge Strahl.
#SE281-229
Das nur Geahnte darf sich hier gestalten,
Erfüllung wohnt in dieses Baues Rundung;
Der Fernendrang beruhigt sich in Frieden,
Und es vernarbt die irdische Verwundung.
Entronnen niedren, nächtlichen Gewalten,
Sieht der Geweihte sich den Ort beschieden,
Da ihn erwartet himmlische Gesundung.
Und aller Dinge Urform schaut er wahr,
Der Welt verworren Spiel wird Harmonie;
Des Kreuzes Blut stellt sich als Rosen dar,
Auf die vom Oberlicht kristallen-klar
Ein Ton fällt, Klang der Sphärenmelodie,
Der diesen hohen Raum mit Schönheit füllt
Und jede harte Kante weich umhüllt. ..
Zu diesem Tempel zog es dich schon lang,
Du sehnst dich, drin zu schauen und zu beten.
Allein du drehst dich noch an Rosenbeeten
Der äaßren Welt die Taxuswand entlang
Und wirst nicht ftei von dem, was draaßen tönt
Und jenes Tempels Dasein niederdröhnt - -
Wenn du gereift bist, wirst du ihn betreten.
CHRISTUS AUF DEM TABOR
Jenseits der Drangsal,
Funkelnd von Kraft der Gnade,
Stehst du, Sonnengestalt,
Und in Goldlicht verwandelt sich dort
Vergängliches Leid.
So bist du jenseits
Und dennoch erreichbar:
Denn wir,
So oft wir den Wassern der Drangsal
Entsteigen, wie du entstiegest -
Sonnenumfiossen stehn wir bei dir,
Goldgepanzert, verwandelt in Licht.
#SE281-230
Siehe, so standest du einst,
Als du in Hüllen der Erde gingst,
Vorauswerfend Glanz der künftigen Herrlichkeit,
Groß auf dem Tabor.
Zwiesprache hielten mit dir
Erhabene Meister der Urzeit:
Elias und Mose.
Unter dir aber, in Schatten und Schwere,
Schlummerten Gassen und Märkte der Menschen.
Da trat aus dir heraus
Das erdgefangne, das ewige Licht:
Wie zum Bade legtest du ab
Die Hüllen der Erde,
Den Rabbi, den Galiläer -
Und auf dem Tabor stand
Der funkelnde Gottmensch!
Trat aus den Hüllen und stand,
Stand wie eine Opferflammensäule
Groß auf dem nächtlichen Tabor!
Da nahten sich jene, funkelnd wie du,
Die Großen der Vorzeit,
Traten hervor aus verhüliendem Lichtgewölk,
Wurden Gestalt und standen in Glanz
Auf dem Gipfel des Tabor.
Und sie tauschten mit dir die strahlende Rede,
Grüßten dich von den Seligen,
Erfüllten mit Flammenkraft die verzückten Jünger -
Und traten wieder zurück
In die geheinnistiefe Mondnacht.
Du aber, Meister, und deine Jünger -
Schweigend, leuchtend, wissendes Lächeln
Auf hell nachschimmerndem Antlitz,
Wandeltest wieder hinab zu den dunklen Menschen.
LIENHARD-JORDAN-MATINÉE Stuttgart, 26. November 1915
#G281-1967-SE231 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
LIENHARD-JORDAN-MATINÉE
Stuttgart, 26. November 1915
#TX
Wir werden heute in den Kreis der Betrachtungen, die wir während dieser Zeit jetzt pflegen, einfließen ,assen eine Darbietung deutscher Dichtung. Der erste Teil dieser Darbietung wird gewidmet sein demjenigen Dichter, dem gegenüber wir die große, die innige Befriedigung haben, ihn heute in unserer Mitte zu sehen, unseren lieben Profess9r Friedrich Lienhard. Und es entspricht einem tiefen Fühlen gegenüber dem so einzigartig dastehenden Lebenswerke unseres sehr verehrten Freundes, was ich zum Ausdruck bringen will, spät allerdings, anknüpfend an die Gefühle, die aus den weitesten Kreisen des deutschen Volkes Friedrich Lienhard entgegengebracht worden sind zu seinem vor einigen Wochen stattgefundenen Geburtstag. Es entspricht gewiß unserem tiefsten Fühlen, wenn ich am heutigen Tage ihm darbringe den Ausdruck eines völligen Miteinklingens all unserer Herzlichkeit mit den Festesfreuden, die ihn umtönt haben, die ihm gezeigt haben, wie sehr dasjenige, was er aus dem tiefsten Innern seines begnadeten Wesens heraus seinem Volke hat geben dürfen, nachklingt, nachschwingt in den Herzen vieler.
Gewiß, meine lieben Freunde, es war ein weiterer Kreis, an dem für die geschichtliche Entwickelung heute mehr gelegen ist als an unserem engeren Kreise, der in festlicher Stimmung sich Friedrich Lienhard in den letzten Wochen genaht hat. Aber aus vollem Herzen schließen wir uns mit unseren Gefühlen, mit unseren Empfindungen an das an, was vollberechtigt Friedrich Lienhard hören durfte in diesen Wochen: die tiefste Übereinstimmung ihres innersten Fühlens mit seinem Fühlen. Viele haben ihm davon gesprochen. Dasjenige, was die Wissenschaft von sich aus geben kann an Anerkennung menschlichen Geistesstrebens, ist von seiner, ich möchte sagen Mutteruniversität Friedrich Lienhard zu unserer großen Freude, zur Freude gewiß aller derjenigen, welche empfinden können die tiefe Pflicht, die besteht zur Anerkennung der Welt gegenüber menschlichen Geistesleistungen, entgegengebracht worden. Die tiefste Befriedigung
#SE281-232
hat alle diejenigen überkommen, die tiefste Freude, die davon gehört haben, wie Lienhards Mutteruniversität das Ehrendoktorat, die Anerkennung der Wissenschaft für menschliche Geistes-leistungen, ausgesprochen hat. Und im tiefsten Sinne haben wir mit-gefühlt, was alles um ihn herum sich abgespielt hat in den verflossenen Tagen, mitgefühlt aus dem Grunde, weil das, was uns so unendlich heilig ist, woran wir mit aller Liebe, mit allem Streben hängen, auch sein Wirken durchtönend erscheint.
Man kann sagen, daß die neuere Kultur der Menschheit an dichterischer Kunst vieles Bedeutende heraufgebracht hat. An vielen Stellen blüht das, was die gegenwärtige Kultur den Menschen geben kann, in dichterischen Leistungen. Die Zukunft wird darüber entscheiden -und das gegenwärtige Herz kann es schon ahnen, wie sie entscheiden wird -, welche von diesen Blüten so eng verknüpft sind mit dem Zeitlichen der Gegenwartskultur, daß sie auch wiederum versinken werden, wenn das der Gegenwart nur Angehörige dieser Kultur hinuntersinken wird in die Vergangenheit, und dem, was innerhalb unserer Zeitkultur aus solchen Tiefen des Menschenwesens hervorgeholt ist, daß es zu dem Ewigen, was aus unserer Zeitenkultur bleiben wird, hinzublüht, hinzugrünt, hinzuwächst als etwas, was Keime in sich trägt für die Zukunft und tragend sein wird für die fortfließende Geisteskultur der Menschheit. Mit alledem, was also in die Zukunft hlneinragt als das Ewige in der Gegenwart, mit alledem wollen wir im tiefsten Innern verbunden sein. Und solches klingt uns von Friedrich Lienhard entgegen. Wenn wir uns verbinden mit den wunder-vollen Naturstimmungen, die so erhebend, so bezaubernd, so erfreuend, so anmutend aus Friedrich Lienhards Dichtungen tönen, dann fühlen wir, wie hinter seinem Schaffen, in seinem Schaffen die Geister der Natur selber wallen und weben. Wir fühlen uns durch das Wort, durch den Gedanken, durch die Empfindungen hindurch zu der schaffenden Natur hingezogen, mit der wir uns auch erkennend durch Geisteswissenschaft verbinden wollen. Und wir fühlen, daß diese Dichtungen hervorgehen aus dem, was den Menschen aus dem Ewigen ergreift, daß sie ausdrücken dieses Ewige in dem Zeitlichen zur Erhebung, zur Erfreuung, zur Erhöhung des Menschenherzens
#SE281-233
und der Menschenseele. Das macht uns mit aller Dichtung Lienhards intim. Das macht, daß wir uns in sie hineinlesen, in sie hlneinhören; das macht, daß wir uns, ich möchte sagen von jeder ersten Zeile an hineinleben und hineinweben, daß wir mit seinem Lebenselement, mit seinem Schaffen uns verbunden fühlen, daß wir zugleich fühlen, wie Lebenskraft der Seele, Lebenslutt des Geistes in uns überquillt, wenn wir die Eindrücke seiner Dichtungen auf uns wirken lassen dürfen. Dann wiederum, wenn er aus des Daseins geheimnisvollem Nebel hervorzaubert die Gestalten der Vorzeit in lebendiger Betätigung, in lebendiger Wirksamkeit, dann fühlen wir jenes Sehnen der Menschheit lebendig werden, welches sich darin ausspricht, daß immerzu die menschliche Seele hinwegsehen muß über alles das, was geschichtlich äußerlich verläuft, was sich vor den Augen und Ohren und vor den übrigen Sinnen der Menschheit abspielt und hinaufspielt in das Mythische, das als ein Ewiges erfaßt das Geschichtlich-Zeitliche. Und in diesem wahrhaft Mythischen, in diesem mit dem Ewigen die Menschenherzen verbindenden Elemente fühlen wir die Gestalten, die Friedrich Lienhard aus dem Dunkel und dem doch so lichtvoll Wirkenden der Vorzeit herauszaubert.
Indem Lienhards Dichtung so einerseits erhebt aus dem Sinnlichen in das Geistig-Schöpferische der Natur, aus dem Gegenwärtigen in das Vorzeitliche, fühlt man andererseits in seinen Schöpfungen, wie sie hineintragen in das, was uns aus dem Alltag heraus als diesen Alltag vertiefend ergreifen kann, womit wir im unmittelbaren Alltag als dem Geistig-Lebendigen leben, wie diese Dichtungen uns mit allem Menschlich-Nahen und Menschlich-Hohen verbinden, wie sie Herz und Sinn entwickeln für alles das, was in der Welt mit dem Menschen lebt und webt. Wir dürfen, in seine Dichtungen uns vertiefend, durch deren Zauber mit so vielem die Menschenherzen Bezwingenden, die Menschenherzen Erhebenden in Natur und Geist leben. Und so ist uns Leben mit seinen Dichtungen innigstes Glück, jenes Glück, das Führer ist zu des Menschen wahrer Heimat.
So bitte ich Sie denn, mein lieber Professor Lienhard, nehmen Sie entgegen den Gruß, der da stammen will aus dem treuen Suchen nach Verständnis des Eindruckes Ihres Lebenswerkes, Ihres Lebenswerkes,
#SE281-234
das so viel BedeutungsvoWEwiges der Zeitenentwickelung der Menschheit einverleibt hat und uns berechtigt, Sie zu grüßen für all das, was wir nun hoffnungsvoll von Ihnen weiter in dieser Erdeninkarnation erwarten. Nehmen Sie diese Worte wie ein Versprechen, das wir nicht aus vorübergehenden Gefühlen, sondern aus tieferem Verständnis Ihres bisherigen Lebenswerkes Ihnen entgegenbringen möchten. Nehmen Sie sie so, daß wir hängen wollen an alledem, wovon wir hoffen dürfen, daß es ferner uns von Ihnen kommt. Nehmen Sie das, was ich ausspreche, als ein Vorausgesprochenes für jeden Gruß, den wir Ihnen entgegenbringen wollen auf Ihrem ferneren Lebenswege. Ein Band soll das, was wir erstreben, mit dem verbinden, was Sie selber erstreben. Ein Band, das uns heilig sein wird, das wir immer so ansehen wollen, daß wir uns beglückt und befriedigt fühlen, den Dichter Friedrich Lienhard in unserer Mitte zu sehen. Jeder der Augenblicke, wo wir Sie in unserer Mitte sehen werden, wird uns zur innigen Freude, zur innigen Befriedigung sein.
Das wollte ich, bevor wir unsere Seele nun für eine kurze Zeit Ihrem Werke auch äußerlich wieder eröffnen, Ihnen als einen Festesgruß entgegengebracht haben.
Rezitation durch Marie Steiner aus «Gedichte» von Friedrich Lienhard: Glauhe; Morgen-wind; Waldgniß; Das schaffende Licht (Texte siehe S. 216), ferner
EINSAMER FELS
Mich lockt ein Fels im Golde der Luft,
Hoch und allein.
Um seinen Gipfel ist Heideduft
Und Abendschein.
Ein treues Bienchen läutet im Kraut
Blumenglöckchen ruhig-rein.
Wer von dort in die Lande schaut -Die Welt ist sein!
#SE281-235
ELFENTANZ
Raschelgewinder und seidene Schuh',
Krone, Korallen und Bänder dazu -Rundaradei!
Rauschen und schleifen wir, singen dabei,
Rauschen und singen wir,
Raschelrock schwingen wir
Rund um den Eschenbaum, rund in den Mai,
Rundaradei, eia, rundaradei!
Willst du uns greifen?
Mußt du mit schleifen!
Hast du auch Füßchen so seiden wie wir?
Bist du so biegsam,
Bist du so schmiegsam,
Bist so geschwind und so schwingend wie wir?
Die Blättlein am Strauche,
Die drehen im Hauche
Die grasgrünen Röcklein und ffimmern dabei!
Und kam aus dem Blauen
Der Nächte ein Tauen,
So tanzt und so funkelt am Morgen der Mai!
Trinke das Licht und so tanze dich munter!
Trinke das Licht und dann hügelhinan!
Spritzt dir ein Perlchen vom Frühgras herunter,
Denk dir, ein Elfelein springe dich an!
Finken, 0 sieh doch, wie fliegende Lichter,
Wölkchen, 0 sieh doch, wie fliegender Schwan,
Überall, überall Sonnengesichter,
Du nur darin als verdunkelter Mann!
Willst du uns greifen?
Mußt du mit schleifen!
Hast du auch Füßchen so seiden wie wir?
Bist du so biegsam,
Bist du so schmiegsam,
Bist so geschwind und so schwingend wie wir
Poltert der und holpert der,
Mit dem Holzschuh stolpert der -
Zottelbär!
#SE281-236
Flink, umschwirn ihn,
Flirrt, verwirrt ihn!
Sausewind, Kosewind, Neckewind: drein!
Zaus ihn fein,
Zupf ihn fein,
Zaus und zupf und zetrupf ihn fein!
Hei, und so schweben wir luftig und frei!
Drunten du fange nun, fange nuch, fange doch,
Zerre die Schleppe mir, küß mir die Wange doch,
Fange mich - fange doch - fange - -
Vorbei!
SOMMERNACHT
Seltsame Nacht! In Ried und Moor,
Wie rauscht und schlürft das dürre Rohr!
Umarmt sich, als ob es lebendig sei,
Und läßt sich seufzend wieder frei.
Wie das so süßes Raunen gibt!
Ich hab' den Nachtwind immer geliebt:
Dem Schii{ den Birken, dem Mondenschein
Haucht er Stimmen und Seelen ein.
Viel Geister tanzen, die Welt ist laut,
Es wacht und kichen das kleinste Kraut.
Vom alten Ritterturme lacht
Ein Käuzlein in die verzauberte Nacht...
ABENDROT
Mir ist nach einer Heimat weh, die keine Erdengrenzen hat,
Ich sehne mich aus Menschennot nach einer ew'gen Himmelsstadt.
Groß glänzt und klar das Abendrot, sanft rauscht der Quell im Wasgenwald-
Wie bald verging mein Erdentag, und all mein Tagewerk wie bald!
0 komm, du weltallweite Nacht, die keine Erdenmaße kennt,
Aus deren Tiefen Stern an Stern auf unser winzig Sternlein brennt!
Nicht müd' bin ich vom Tagewerk und doch bin ich des Tages satt -
Nach deinen Weiten sehn' ich mich, du unbegrenzte Himmelsstadt!
#SE281-237
HERBST AUF ODILYENBERG
1.
Herbstglocken
Durch roten Wald und Glockensang,
Durch eines Herbsttags sprüh'nden Tau
Such' ich auf bangem Höhengang
Die Hochburg einer heil'gen Frau,
Such' über Wolken Sonnenschein!
0 Nebelgang,
0 schroffer Hang,
Ich will ein stolzes Leben lang
Pilger sein!
2.
Die blaue Blume
Die Erde lächelt als ein Gartenland
Dem Pilger, der die blaue Blume fand.
Blüht eine Lilie aus des Hochwalds Blau:
Das lichte Kloster einer heil'gen Frau.
Und ob ich suche immer-, immerzu -
Die blaue Blume, stiller Berg, bist du!
3.
Herbstgang
Wie bist du schön! Ein Goldnetz spinnt dich ein,
Ich geh' verklärt durch einen Märchenhain.
All meine Seele quillt zu Gott empor,
Ein Rauch, der sich im Höhenblau verlor.
Bin ich es, der im Laubfall träumend geht,
Da voller Farben diese Erde steht,
Da aus der Eiche, die von Golde blinkt,
Ein lichter Kranz auf den Beglückten sinkt?
#SE281-238
Odilienberg ist wie der Himmel schön!
In lauter Licht zerfließen Tal und Höhn,
Und Wonne ward mir, was so leidvoll war -
Hab' Dank für alles, du gesegnet Jahr!
SONNTAGMORGEN AUF ODILIENBERG
Was für ein Lachen und Leuchten heut' in Wald und schimmernder Aue?
Odilia wandelt über den Berg und segnet die sonnigen Gaue!
Frühglocken wecken fern und nah aus Wochentag und Sorgen -
Es liegt ein wundersamer Glanz auf diesem Sonntagmorgen!
Von Otrott und von Heiligenstein, von Klingental und weiter:
Aus Glockentönen steigt empor eine heilige Himmelsleiter!
Und alle die Edlen, die je gelebt im Lande der Alisassen,
Sie sammeln sich in der «Heidenstadt», in unsichtbaren Gassen!
Und all das Kelten- und Kriegervolk, das längst dem Herrn bekehrte,
Es drängt sich wie ein Blütenwald um die Eine, die Hochverehrte.
O Geistermeer, 0 Tönemeer, du Leuchten in Wald und Aue!
Odilia wandelt über den Berg und segnet die sonnigen Gaue!
ST. ODILIA
Schutzpatronin des Elsasses
Ihr Herz war eine Sonne,
Ihre Augen tot und grau!
Und von der klaren Stirne
Der wunderschönen Frau
Flossen die goldnen Haare
In einer reichen Flut -
0 heil'ge Frau von Odilien,
Mach du mich fromm und gut!
In einen Bronnen am Berge
Tat sie die weiße Hand
Und wusch sich die blinden Augen -
#SE281-239
Da sah sie ihr Alsa-Land
In reiner Maienblüte
Vor ihren Augen stebn -
O heil'ge Frau von Odilien,
Lehr du mich also sehn!
Im Kloster läuten die Glocken,
Im Nebel ertrank die Welt -
Doch sieh, hell flammen die Sterne
Vom Sommernachts-Himmelszelt,
Doch sieh, hell leuchtet Straßburg
Herüber zu unsren Höhn -
0 heil'ge Frau von Odilien,
Elsaß ist wunderschön!
Wir wollen dann verbinden mit demjenigen, was wir aus Friedrich Lienhards Dichtungen hören, einiges von einem Dichter, der uns wie Friedrich Lienhard zeigt, daß gerade deutschestes Wesen aus seiner Selbsterfassung heraus den Weg findet zum Ewigen eines idealen Weltbildes, der uns ebenso zeigt, wie das ganze intime Mitfühlen mit den Schwingungen deutschen Wesens den Blick erweitert zur Allweltlichkeit, zum aliweltlichen Anschauen, wie der deutsche Blick nicht einengt, wie er hinausführt auf den großen weiten Plan, wo alles Menschliche Zur Geltung kommt und nichts Menschliches rnißverstanden wird.
Wilhelm Jordan sei der andere Dichter, von dem wir hören wollen das Stück seiner Nibelungendichtung, gerade, wo er einführen will in eine Stimmung des menschlichen Herzens, wo sich das Herz öffnet aus dem Zeitlichen heraus, um für das Zeitliche Rat zu hören aus dem Ewigen. Wie der deutsche Held Ratschlag nicht nur in der äußeren Welt sucht, sondern auch bei den geistigen Wesen, die durch die Natur und durch das äußere Seelenwesen sprechen. Wie er sein Herz öffnet, der deutsche Held, diesem Ratschlag, um abzuschlagen die Bedrohung, die vom hunnischen Osten herüber dem Aufkeimen der deutschen Kultur kommt. Diese Szene, die so ergreifend zusammen-hängt mit innerstem deutschen Fühlen, aber mit Weltkulturfühlen, sei dann in unsere heutige Darbietung eingefügt.
#SE281-240
Aus «Die Nibelunge» von Wilhelm Jordan Sigfrid-Sage, 18. Gesang
Eben damals sprach zu den Dienern
Des Helligtumes im Haine zu Holmgart,
Nun siech schon und uralt die Seherin Oda:
«Ich gedachte zu rasten vom Runenamte
Die wenige Zeit, die meine Wallfahrt
Auf Erden noch dauert; doch hochbedeutsam
Ist diese Botschaft des Vogts von Berne;
Des edlen Ditrich, der längst schon für Ditmar,
Den altersmüden, die Macht verwaltet.
Seinen wackersten Mann und Waffenmeister,
Hildebranten, den Sohn des Herbrant,
Sandt' er, zusammen mit Sigfrids Pfleger,
Zur mächtigen Mutter der Menschen und Götter,
Bericht zu geben, sich Rat zu holen
Und leitendes Licht aus dem Fall der Lose...
Doch klein ist das Maß der menschlichen Klugheit;
So laßt uns nun beten um Offenbarung
Vom allwissenden Geiste der mächtigen Göttin,
Die alles Geschehen in ihrem Schoß trägt,
Und den Schattenwurf sieht des noch Unerschaffnen.
Allmächtige Mutter der Menschen und Götter,
Noch einmal stärke in dieser Stunde
Den Mund der Müden. Zum letzten Male,
Bevor ich sterbe, will ich besteigen
Den goldenen Stuhl auf der hohlen Stufe
Und, die Stirn umwirbelt von Weihrauchwolken,
Vom enttäuschenden Hauch aus der ewigen Tiefe,
Kühn durchschauen das kommende Schicksal. -
So rede nun, Bote, Ditrich des Berners:
Was erfragt von der Göttin der Gotenftarer ?»
Da tat seinen Spruch des Heribrant Sprößling:
«Was hilft uns zum Heil
Vor den hunnischen Horden?
Was ziemt in der Zukunft
Dem Deutschen als Ziel?»
#SE281-241
Da die Frage gestellt war, erstieg sie die Leiter
Matt und mühsam. Mit goldenem Messer
Schnitt sie das Reis, kam langsam herunter,
Ritzte mit Runen die glatte Rinde,
Zerteilte den Stab in kleine Stücke,
Und abgewendet, entwarf sie dieselben
Auf dem weißen Teppich... Drauf band sie das Tuch vor,
Aus ungeborener, schwarzer Böcklein
Wolle gewoben, bückte sich, wählte,
Blindlings greifend, ging in die Grotte
Und hieß die Fürsten und Zeugen ihr folgen.
Da bestieg sie den Stuhl. Sie reihte die Stäbchen
Auf dem heiligen Tisch vom Holz einer Tanne,
Die der Wetterstrahl einst bis zur Wurzel gespalten,
Und las dann die Losung nach ihrer Lage.
Dann saß sie versunken in tiefes Sinnen,
Während der Dampf in dichten Wolken
Das Haupt umhüllte, dem hundert Winter
Die Haare gebleicht zu blendendem Schnee.
Jetzt endlich winkt sie. Der Weihrauch verduftet,
Die Augen rollen in heiligem Rausche
Und funkeln feurig, doch nur in die Ferne
Schaun sie verzückt und gewahren die Zukunft.
Und also begann jetzt die göttlich Begabte:
«In wogendem Wirrwarr
Erscheinen mir Schatten
Von Fürsten und Völkern
Und künftigem Kamp£
Doch es rücken im Raume
Der suchenden Seele
Jahrtausende täuschend
Zusammen in Sicht.
0 Ditrich, bedenke
Den Neid in der Nähe !
Sonst wirft ein Verwandter
Dich treulos vom Thron,
Und Sicherheit suchst du
#SE281-242
Und Hilfe zur Heimkehr
In bittrer Verbannung
Beim gefürchteten Feind.
Welch drohendes Drängen
Von Aufgang und Abend!
Dort hunnische Horden,
Hier Merowigs Macht.
So fristet die Frage
Nach Rechten und Reiche;
Dem Helden gehorchet,
Das hifft auch zum Heil.
Hier bindet gebietend
Der heimische Herrscher
Die neidischen Nachbarn
Zum ruhmvollen Reich;
Dort liegen die Leichen,
Dort steigen die Städte,
Das Lecbfeld beleuchtet
Die Sonne des Siegs.
Seid wehrhaft im Westen,
Erobert im Osten,
Und nehmet im Norden
Die Mark bis ans Meer,
Nur sucht nicht die Buhle
Im Süden der Berge,
Denn Geister und Körper
Vergiftet ihr Kuß.
0 König, verkennst du
Die sinnvolle Sage
Vom Heile der Zukunft
Durch heimische Zucht?
Des Frostiandes Fruchtbaum
Wird krank und verkrüppelt,
Weil, ihn zu veredeln,
Der Palmaweig nicht paßt.
Weh! scharlachrot schäumen
Die Ströme von Strafblut,
#SE281-243
Die schwankende Menge
Wird mutlos und schwört.
Da rastet der Rotbart
Im Berge verborgen,
Bis das Rabenpaar weckend
Nach Walhall ihn ruft.
Da beten die Stolzen
Und beugen die Stirnen
Wie Büßer zum Staube
Vor dem steigenden Stern.
Was krönt in der Krippe
Zum Sieger den Säugling?
Drei Könige kommen
Und heißen ihn Herrn.
O Meister der Milde,
Die wütende, wilde
Und herzlose Hilde
Verbannt dein Gebot;
Ihr Schwert birgt die schwache, -
Nicht wieder erwache -
Zum Rasen der Rache
Der Neid und die Not.
Vergangen, vergessen
Sind Götter und Helden,
Unhörbar verhallen -
Ihr Lob und ihr Lied.
Der furchtlosen Väter
Bewunderte Weisheit
Wird listig verleumdet
Und schamlos beschimpft.
Unfaßliche Fehde
Entleeret die Lande,
Schickt Kinder und Greise
Zum Kampf um ein Grab.
Der Träger der Krone,
Vom Krummstab getroffen,
Dort beugt er sich barfuß
Zum Bußegebet.
#SE281-244
Doch der Zauberer zittert;
Ihr, Stäbchen, zerstört ihm
Das Bollwerk der Burgen,
Sein Brief ist verbrannt.
Als Morgenrot melden
Des Kinderbaums Kerzen:
Die Frist der Entfremdung
Sei bald nun vorbei.
Noch ein Alter voll Unheil,
Voll Zweifel und Zwietracht?
Zu maßloser Mordlust
Sind Brüder entbrannt.
Wie gierige Geier
Entfremden die Franken
Die beste der Burgen
Am rauschenden Rhein.
Doch es lodern nicht lange
Die glänzenden Gluten;
Wir stürzen den Stolzen
Vom trotzigen Thron,
Und es büßt in Verbannung
Auf einsamer Insel
Der Zwingherr verzweifelnd
Die Zerrüttung des Reichs.
Drum, ob auch der Erde
Mehr Krieger als Kräuter
Zum Weltkampf entwüchsen,
Sei furchtlos, mein Volk.
Voll stolzer Gedanken
Durchdauert unsterblich
Der Deutsche die Stürme
Mit starker Geduld.
Einst naht die Genesung,
Wir finden den Führer,
Der Väter entsinnt sich
Zum Siege mein Volk.
Da schlägt es die Schlachten,
Da schmückt sich's mit Kränzen
Und schmiedet die Krone
Der einigen Kraft.»
#SE281-245
Die Seherin sprach es; dann sank sie zusammen
Und rang nach Atem, röchelnd und ächzend,
Mit gebrochenem Blick, den Kopf auf der Brust.
Jetzt erhebt sie das Haupt noch einmal wie horchend,
Mit flammenden Augen und fliegendem Haar.
«0 Sigfrid », ruft sie, « sieh nach der Sonne!
Sie schwindet, sie schwätzt sich: die schwankenden Lichter,
Die den Schatten der Bäume durchschimmern, sie bilden
Nicht Scheibchen wie sonst, nein, scharfe Sicheln.
Es jammern die Unken, es jauchzt der Uhu,
Daß der Mittag zur Nacht wird; der mordende Marder
Beschleicht und fängt sich die schläfrigen Vögel -
So sehr dich dürstet, du darfst nicht trinken:
Denn hinter dir... Hilfe! - warte noch, Hela! -
O weh - getroffen - die Welt geht in Trümmer -
Entsetzlicher Schrei - schreckliche Nacht.» -
Die Sprache verging ihr. Sie sprang in die Höhe,
Wie, den Pfeil im Herzen, der Hirsch in die Luft springt
Stürzte zu Boden und war gestorben.
Als, aufs tiefste bewegt von der Seherin Worten
Und erschüttert, betäubt von den Schauern des Todes,
Odas Reste die andern umringten,
Da verschwand unbemerkt von der Schwelle der Grotte
Und gewann das Weite Sibich, der Welsche.
Nachwort zur zweiten Auflage
#G281-1967-SE246 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
Nachwort zur zweiten Auflage
#TX
In diesem zweiten Band der Vorträge über «Sprachgestaltung und drama. tische Kunst »wurden der Vortragszyklus über «Die Kunst der Rezitation und Deklamation», welcher im Herbst 1920 im Goetheanum stattfand, und die vier weiteren, kursorischen Charakter tragenden Veranstaltungen in Dorn-ach (1921), Darmstadt (1921), Wien (1922) und Stuttgart (1923) in Buchform zusammengefaßt Sie bilden die Fortführung und Erweiterung der 1919 begonnenen Darstellungen in den Kursen über künstierische Sprachbehandlung, welche in dem Band «Methodik und Wesen der Sprachgestaltung» 1954 innerhalb der Rudolf Steiner Gesamtausgabe veröffentlicht wurden.
Als Marie Steiner 1928 die erste Auflage dieser hier vorliegenden Vorträge vorbereitete, hatte die bühnenkünstierische Arbeit im Goetheanum ihre erste Stufe durch die Aufführung der beiden Mysteriendramen von Rudolf Steiner «Die Pforte der Einweihung» und «Die Prüfung der Seele» zur Eröffnung des zweiten Goetheanumbaues erreicht. Im Nachlaß von Marie Steiner fand sich der folgende Text, den sie wohl in den dreißiger Jahren entworfen haben dürfte und welcher diese Arbeit charakterisiert. «Die Sektion für redende und musische Künste am Goetheanum versucht auf der Grundlage einer geistgemißen Menschen- und Welterkennmis, wie sie der anahroposophischen Geisteswissenschaft Dr. Rudolf Steiners eigen ist, dem Rätsel der Sprache näherzukommen und das Wesen der Laut-bildung innerhalb der menschlich-kosmischen Zusammenhänge zu erfassen. Durch den abstrakten Verstand ist uns das Geheimnis des schöpferischen Wortes verlorengegangen; durch die zum Bewußtsein gehobene Aktivität eines nicht bloß gespiegelten, sondern aus tieferen Seelengründen hervorquellenden lebendigen Denkens, kann diese schöpferische Kraft des Wortes wieder erweckt und fühlbar gemacht werden. In der Verbindung mit Musik, Farbe und der neuen Kunst der Eurythmie, die eine durch das Medium der menschlichen Körperlichkeit sichtbar gewordene Sprache ist, kann den Werken unserer großen Dichter auch auf der Bühne neues Leben eingeflößt werden. Das ist eine der Aufgaben, die sich in einer Zeit, wo das Interesse und das Verständnis für das idealistische Streben der Klassiker geschwunden ist, das Goetheanum gestellt hat.»
Damals hatte das Goetheanum vor allem durch die «Faust»-Aufführun-gen Weltruf erlangt. In jahrzehntelanger, strengster Arbeit konnte etwas von dem erreicht werden, was hier in wenigen Worten zusammengefaßt wird. Der Leser aber kann sich auf Grund der vorangegangenen Vorträge nun selbst ein Bild von der Schulung machen, die notwendig war, um dem von Rudolf Steiner hingestellten Ziele näherzukommen. So ist es verständlich,
#SE281-247
daß im Zusammenhang mit der Herausgabe dieser Vorträge Frau Dr. Steiner ein Seminar einrichtete, um mit einigen ihrer Schüler das dem modernen Bewußtsein zunächst schwer Faßbare durch die praktische Arbeit zu erwerben. An diesem Seminar dufften nur Damen, 12-14, teilnehmen, da die Herren in ihrem Vorstellungsleben nicht beweglich genug waren. Eine der Teilnehmerinnen, Frau Gertrud Redlich, hat sich während des Unterrichts vieles notiert, was trotz der Lückenhaftigkeit dem Verständnis der Inhalte gut dienen kann. Daher veröffentlichen wir im zweiten Teil des Buches dieses Seminar und danken herzlich für die Überlassung der Aufzeichnungen, welche eine wesentliche Bereicherung der zweiten Auflage bedeuten, erhält doch durch sie der Leser einen unmittelbaren Einblick in den Unterricht, wie er durch Marie Steiner erfolgte. In den «Vorbemerkungen» wird noch einiges näher ausgeführt.
Die zentrale Bedeutung, welche der rezitatorisch-dramatischen Arbeit durch Marie Steiner im Leben der anthroposophischen Bewegung zukommt, beschreibt Rudolf Steiner im XXXIV. Kapitel seiner Selbst-biographie «Mein Lebensgang» folgendermaßen:
«In der Theosophischen Gesellschaft war kaum irgend etwas von Pflege künstlerischer Interessen vorhanden. Das ist von einem gewissen Gesichtspunkte aus damals durchaus begreiflich gewesen, dutfte aber nicht so bleiben, wenn die rechte geistige Gesinnung gedeihen sollte. Die Mitglieder einer solchen Gesellschaft haben zunächst alles Interesse für die Wirklichkeit des geistigen Lebens. In der sinnlichen Welt zeigt sich für sie der Mensch nur in seinem vergänglichen, vom Geiste losgelösten Dasein. Kunst scheint ihnen ihre Betätigung innerhalb dieses losgelösten Daseins zu haben. Daher scheint sie außerhalb der gesuchten geistigen Wfrklichkeit zu stehen.
Weil dies in der Theosophischen Gesellschaft so war, fühlten sich Künstler nicht zu Hause in ihr.
Marie von Sivers [Marie Steiner] und mir kam es darauf an, auch das Künstlerische in der Gesellschaft lebendig zu machen. Geist-Erkennmis als Erlebnis gewinnt ja im ganzen Menschen Dasein. Alle Seelenkräfte werden angeregt. In die gestaltende Phantasie leuchtet das Licht des Geist-Erlebens herein, wenn dieses Erleben vorhanden ist.
Aber hier tritt etwas ein, das Hemmungen schafft. Der Künstler hat eine gewisse ängstliche Stimmung gegenüber diesem Hereinleuchten der Geist-welt in die Phantasie. Er will Unbewußtheit in bezug auf das Walten der geistigen Welt in der Seele. Er hat völlig recht, wenn es sich um die «Anregung» der Phantasie durch dasjenige bewußt-besonnene Element handelt, das seit dem Beginn des Bewußtseins-Zeitalters im Kulturleben das herrschende geworden ist. Diese «Anregung» durch das Intellektuelle im Menschen wirkt ertötend auf die Kunst.
#SE281-248
Aber es tritt das gerade Gegenteil auf, wenn Geistinhalt, der wirklich erschaut ist, die Phantasie durchleuchtet. Da aufersteht wieder alle Bildkraft, die nur je in der Menschheit zur Kunst geführt hat. Marie von Sivers stand in der Kunst der Wortgestaltung darinnen; zu der dramatischen Darstellung hatte sie das schönste Verhältnis. So war für das anthroposophische Wirken ein Kunstgebiet da, an dem die Fruchtbarkeit der Geistanschauung für die Kunst erprobt werden konnte.
Das «Wort» ist nach zwei Richtungen der Gefahr ausgesetzt, die aus der Entwickelung der Bewußtseinsseele kommen kann. Es dient der Verständigung im sozialen Leben, und es dient der Mitteilung des logisch4ntellektuell Erkannten. Nach beiden Seiten hin verliert das «Wort» seine Eigengeltung. Es muß sich dem «Sinn» anpassen, den es ausdrücken soll. Es muß vergessen lassen, wie im Ton, im Laut, und in der Lautgestältung selbst eine Wirklichkeit liegt. Die Schönheit, das Leuchtende des Vokals, das Charakteristische des Konsonanten verliert sich aus der Sprache. Der Vokal wird seelen-, der Konsonant geistlos. Und so tritt die Sprache aus der Sphäre ganz heraus, aus der sie stammt, aus der Sphäre des Geistigen. Sie wird Dienerin des intellektuell-erkenntnismäßigen, und des geist-fliehenden sozialen Lebens. Sie wird aus dem Gebiet der Kunst ganz herausgerissen.
Wahre Geistanschauung fällt ganz wie instinktiv in das «Erleben des Wortes». Sie lernt auf das seelengetragene Ertönen des Vokals und das geistdurchkraftete Malen des Konsonanten hin-empfinden. Sie bekommt Verständnis für das Geheimnis der Sprach-Entwickelung. Dieses Geheimnis besteht darin, daß einst durch das Wort göttlich-geistige Wesen zu der Menschenseele haben sprechen können, während jetzt dieses Wort nur der Verständigung in der physischen Welt dient.
Man braucht einen an dieser Geisteinsicht entzündeten Enthusiasmus, um das Wort wieder in seine Sphäre zurückzuführen. Marie von Sivers entfaltete diesen Enthusiasmus. Und so brachte ihre Persönlichkeit der anthroposophischen Bewegung die Möglichkeit, Wort und Wortgestaltung künstlerisch zu pflegen. Es wuchs zu der Betätigung für Mitteilung aus der Geist-welt hinzu die Pflege der Rezitations- und Deklamationskunst, die nun immer mehr einen in Betracht kommenden Anteil an den Veranstaltungen bildete, die innerhalb des anthroposophischen Wirkens stattfanden.
Marie von Sivers' Rezitation bei diesen Veranstaltungen war der Ausgangspunkt für den künstlerischen Einschlag in die anthroposophische Bewegung. Denn es führt eine gerade Linie der Entwickelung von diesen «Rezitationsbeigaben» zu den dramatischen Darstellungen, die dann in München sich neben die anthroposophischen Kurse hinstellten.
Wir wuchsen dadurch, daß wir mit der Geist-Erkenntnis Kunst entfalten durften, immer mehr in die Wahrheit des modernen Geist-Erlebens hinein.
#SE281-249
Denn Kunst ist ja aus dem ursprünglichen traum-bildhaften Geist-Erleben herausgewachsen. Sie mußte in der Zeit, als in der Menschheitsentwickelung das Geist-Erleben zurücktrat, ihre Wege sich suchen; sie muß sich mit diesem Erleben wieder zusammenfinden, wenn dieses in neuer Gestalt in die Kulturentfaltung eintritt.»
Die erste gemeinsam durchgeführte Veranstaltung fand in Berlin am 7. Mai 1906, dem Todestag von H.P. Blavatsky, statt. Rudolf Steiner sprach über das Wesen der griechischen Mysterien; Marie von Sivers rezitierte die an Hölderlin gerichtete Dichtung «Eleusis» von Hegel. Als dieses Gedicht viel später in Dornach, am 1. Februar 1925, mit Formen von Rudolf Steiner in eurythmischer Wiedergabe zur Aufführung gelangte, schrieb Rudolf Steiner auf die Programmankündigung: «Im zweiten Teil von Hegel, durch das auf die erste Anregung Rudolf Steiners hin Marie von Sivers ganz im Anfange der anthroposophischen Bewegung unsere Rezitationskunst inauguriert hat.» Und Marie Steiner hebt zehn Jahre nach dem Tode von Rudolf Steiner, 1935, in dem Vorwort zu den «Wahrspruchworten» den Augenblick hervor, in welchem sie an der Weihnachtsfeier in Berlin am 17. Dezember 1906 das erste von Rudolf Steiner geschaffene Wahrspruchwort zu rezitieren hatte. «Es gehört zu den einschlagenden innern Ereignissen unseres Lebens die Stunde, da er zu Weihnachten seinen ersten gedichteten Wahr-spruch gab: und die Kraft gefunden werden mußte, diese Fülle des Erlebens, diese Wucht des wie in Quadern gemeißelten Wortes in den tönenden Laut umzuformen: ein Wendepunkt für das Seelen-Innere.» Begonnen hatte diese Feier mit der Rezitation des Faustmonologes aus der Arielszene des zweiten Teiles: «Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig...» Bald darauf - 1908 - fol gte die Rezitation der «Geistlichen Lieder» und der «Hymnen an die Nacht» von Novalis, und im Herbst 1910 gelangte anläßlich der Generalversammlung der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft Goethes «Pandora» zum Vortrag. Eine Zeittafel dieser Rezitationen soll in einem der Bände von Marie Steiners «Gesammelten Schriften» alles zusammenfassen, was besonders während des ersten Weltkrieges in Dornach von ihr vorgetragen wurde.
Den dritten Teil bilden sodann sieben Ansprachen zu Rezitationsveranstaltungen, von denen Rudolf Steiner in den vorangegangenen Worten gesprochen hat. Die erste - eine Ludwig Uhland-Matinée - ist gleichzeitig die Eröffnung eines Kunstzimmers in Berlin. Wie diese Kunstzimmer entstanden sind, erzählt Marie Steiner in der Neuauflage (1942> eines Fest-vortrages «Das Weihnachtsfest im Wandel der Zeiten», Berlin, 22. Dezember 1910:
«Diese Kunstaimmer, von denen das eine in Berlin-Charlottenburg, das andere in Berlin-Ost eingerichtet wurde, zwei andere gab es in München,
#SE281-250
verdienen es, in der Erinnerung festgehalten zu werden. Denn sie gehen durchaus auf den inspirierenden Einfluß zurück, den das soziale Wirken und die Menschenachtung Dr. Steiners ausübte -, wenn auch die unmittelbare Initiative dieser einzelnen Tat dem warmen Herzen der zwei die anthroposophische Arbeit in München leitenden Künstierinnen, Fräulein Stinde und Gräfin Kalckreuth, entsprang, und dann von Fräulein v. Sivers und Fräulein M. Waller auch in Berlin durchgeführt wurde. Diese Kunstzimmer waren fürs breite Volk gedacht, als gasifreie Stätten, die nicht nur Wärme und Behaglichkeit, sondern auch Schönheit, Ästhetik und geistige Anregung bieten sollten. Die Wände waren mit farbigen Rupfen bespannt, alles bis auf die Bestuhlung dem gewählten Tone angepaßt; Bilder-Ausstellungen wechselten jeden Monat: gute Reproduktionen klassischer Kunstwerke und Gemälde zeitgenössischer Künstler; Abendveranstaltungen gab es mit musikalischen und rezitatorischen Darbietungen, einen Einführungskurs in Geisteswissenschaft, auch in andere Wissensgebiete -, kleine dramatische Darstellungen, wie zum Beispiel die «Geschwister» von Goethe und ähnliches. Hier war es auch, wo in Berlin die «Weihnachtspiele aus altem Volkstum» eingeführt wurden, die dann von Mitspielern nach anderen Stätten gebracht werden konnten. Es darf vielleicht erwähnt werden, daß es nach den Anstrengungen des Tages nicht immer leicht war, bei Nacht und Nebel die weiten Wege in den Osten Berlins mit Untergrundbahn oder Tram zurückzulegen und zuletzt in abgelegenen dunklen Straßen im Schnee zu stapfen. Doch das tägliche Beispiel des unermüdlichen Schaffens Dr. Steiners wirkte anfeuernd. Und man lernte aus eigener Erfahrung die Bedeutung des Kontrastes kennen, wenn man aus der trostlos steinernen Umgebung öder Arbeiterquartiere in die warme Umhüllung eines in gedämpftem Rot erstrahlenden Raumes trat und das Auge auf Kunstwerke fiel, die den Blick fesselten und das Herz erfrischten, so daß es in Sammlung dem Gebotenen in Wort und Ton folgen und sich von der Last des Alltags einigermaßen befreien konnte. In bescheidenem und kleinem Rahmen war es doch Nahrung für die Seelen der Geistsuchenden aus der arbeitenden Bevölkerung. In diesem Sinne war ja so manches in Briefen zum Ausdruck gekommen, die Rudolf Steiner erhalten hatte, als er noch in der Arbeiterbildungsschule Berlins wirkte. Ihm wurde dafür gedankt, daß er den Glauben habe, der Arbeiter brauche auch das geistige Brot, nicht nur das physische.
Der Weltkrieg brachte Veränderungen auch in diesen Betrieb. Das große Kunstzimmer in der Motzstraße mit seinen Nebenräumen wurde in einen Kinderhort umgewandelt, in dem das aus dem bolschewistischen Rußland geflüchtete Fräulein Samweber eine hlngebungsvolle Tätigkeit enifaltete, opferfreudig unterstützt in der auf Spenden beruhenden Verpflegung und
#SE281-251
Hütung der Kinder durch Damen der Anthroposophlschen Gesellschaft. Licht, Luft und Freude hatten sie in den schönen Räumen des Vorderhauses; Dr. Steiner begnügte sich mit den viel bescheideneren Zimmern des Hinterhauses. Das ist nebensächlich, doch für ihn symptomatisch.»
In diese zweite Auflage innerhalb der Gesamtausgabe wurden nicht die 1928 veröffentlichte Ansprache von Rudolf Steiner zur Eröfinung des ersten Hochschulkurses aufgenommen und ebenfalls nicht seine Abschledsworte. Sie erscheinen in Bibliographie-Nummer 253. Ebenfalls mußte auf den Abdruck der einleitenden Worte Rudolf Steiners zur Eurythmie-Aufführung vom 17. Oktober 1920 verzichtet werden; sie erscheinen mit den übrigen Eurythmieansprachen während des Hochschulkurses in Bibliographie-Nummer 277. Doch lassen wir zum Abschluß dieser Bemerkungen aus dieser Ansprache einige Worte noch folgen: «Beim Deklamieren und Rezitieren -das zeigt sich, wenn man zur Eurythmie rezitieren soll - kommt es darauf an, daß schon die innere Eurythmie, Rhythmus, Takt, überhaupt die Formung des wortwörtlichen Inhaltes, wie sie durch den Dichter geschieht, besonders in der Formung des Tones, in der Gestaltung, in dem Tempo, im Takt des Tones, im Rhythmus des Tones zum Ausdrucke kommt. Und nur indem man diese Rezitation, die eben geschildert werden sollte auch im Praktischen durch das, was während des Kurses Frau Dr. Steiner rezitiert hat, ausübt, kann man überhaupt zeigen, wie auf der einen Seite in der sichtbaren Sprache der eurythmischen Bewegung und andererseits durch die eurythmische Formung des Tones in der Rezitation oder Deklamation der Inhalt erst zum vollen Ausdrucke kommt.»
REGISTER
#G281-1967-SE252 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
#TI
REGISTER
#TX
Seite
Comeillc, Pierte (Rouen 1606 -1684 Paris)
Le Cid, 3. Akt, 4. Szene 88
Fercher von Steinwand (Kleinfercher,
Johann), (Steinwand im Mölltal hei
Wildegg, Oherkärnten 1828 -
1902 Wien)
Chor der Urtriehe, 2. Chor 51
Goethe, J. W. (Frankfurt am Main
1749 - 1832 Weimar)
Achilleis 43, 110, 126, 170
Beherzigung 73
Charon 31,172,202
Erlkönig 202
Fischer, Der 198
Heidenröslein 28, 172, 197
Hymaus an die Natur 127,177
Iphigenie (weimarische Fassung)
20,109,123, 154, 171
Iphigenie (römische Fassung)
21,110,123, 154, 171
König in Thule, Der 197
Mächtiges Üherraschen 102
Meeres Stille 73
Mit einem gemalten Band 74
Neugriechisch-epirotische
Heldenlieder 199
Olympos 30, 172,202
Sträußchen, Das 179
Wandrers Sturmlied 76
Grün, Aiuistasius (Anton Alexander,
Graf von Auersperg), (Laibach
1806-1876 Graz)
Fünf Ostern, S. Gesang 142
West und Ost, Prolog zu «Schutt» 130
Hamerllng, Robert (Kirchhach am
Wald, Niederösterreich 1830 -1889 Graz)
Nächtliche Regung 131
Vor einer Genziane 132
Hebbel, Friedrich (Wesselhuren im
Dithniarschen 1813 - 1863 Wien)
An den Äther 174
Sprache, Die 31,173
Seite
Herder, Johann Gottfried
(Moh'ungen, Ostpreußcn 1744 -
1803 Weimar)
Erlkönigs Tochter 28, 172,202
Jordan, Wilhelm (Insterburg 1819 -
1904 Frankfurt am Main)
«Die Nihelunge»,
Sigfrid-Sage, 18. Gesang 240
20. Gesang 52
Hildebrants Heimkehr,
17.Gesang 116,178
Kalewala, inisches Epos
14. Rune (Schluß) 46
Lieni'ard, Friedrich (Rothhaeh im
Elsaß 1865 - 1929 Eisetiach)
Abendrot 236
Christus auf dem Tabor 229
Elfentanz 235
EinsamerFels 234
Glaube 218,234
Herbst auf dem Odilienherg 237
Morgenwind 216,234
schaffende Licht, Das 219,234
Seelenwanderung 218
Sommernacht 236
Sommerwald 217
Sonntagmorgen auf Odilienherg 238
Sonntagnachmittag 218
St. Odilia 238
Tempel der Erfüllung 228
Waldgruß 217,234
Woher 215
Mörike, Eduard (Ludwigsburg 1804 -
1875 Stuttgart)
Geister vom Muniioelaee, Die 154
Schön Rohtraut 153
Morgenstern, Christian (Breslau
1871-1914 Meran)
St. Expeditus 33, 178
Terzinen 145
Tier, die Pilsnze, Das 103
Moore, Thomas M. (Dublin 1799 -1852 Sloperton Cottage, Wiltshire)
National Airs, No. I 75
#SE281-253
Seite
Nihelungenlied, Aus dem
I Aventinre 114
Novalis, Friedrich von Hardenherg
(Wiederstedt im Mansfeldischen
1772 - 1801 Weißenfels)
Das Märchen von Hyazinth und
Rosenblüte aus «Die Lehrlinge
zu Sais» 93
Zueigtinng I und II 32,177
Schiller, Friedrich
(Marhach 1759 - 1805 Jena)
Tanz, Der 152
Wilhelm Teil, 4. Aufzug, 3. Sae"e 85
Solovjeff, Wladimir
(Moskau 1820 - 1879 ebenda)
Nildelta 75
Steiner Rudolf
(Kraljevec 1861 - 1925 Dornach)
Frühling 146
Herbst 147
Pforte der Einweihung, Die,
aus dem siebenten
Bild 13, 104, 135, 175
Weltenseelengeister 103, 147
Wochensprüche
(«Seelenkalender») 171
Spracbäbungen:
Daß er dir log 163
Der Base Nase 168
Du findest dich selbst 168
Seite
Ei ist weißlich 169
Erfüllung geht 164
Hitzige strahlige 169, 172
In den unermeßlich weiten
Räumen 164
Ist straucheinder Stern 169, 172
Ketzer petzten 165
Lalle Lieder lieblieh 165
Leise lispeln 169
Nimm nicht Nonnen 163
Nurrenn 166
Pilffig pfeifen 165
Protzig preist 163
Redlich ratsam 163
Schlinge Schlange 166
Sende aufwärts 167
Sturm-Wort 168
Wäge dein Wollen klar 167
Walle Welle willig 169, 172
Weiße Helligkeit 170, 172
Zuwider zwingen zwar 166
Steffen, Alhert (Murgenthal, Aargau 1884-1963 Dorriach)
An eine Rose 145
Richter und Erlöser
aus «Kleine Mythen» 181
Uhland, Ludwig
(Tübingen 1787 - 1862 ebenda) 185 Watson, William (Wharfedale in Yorkshire 1858 - 1935) Song 74
Literatur
- Rudolf Steiner, Marie Steiner-von Sivers: Die Kunst der Rezitation und Deklamation, GA 281 (1987), ISBN 3-7274-2810-4 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org English: rsarchive.org
 Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com URL: www.steinerverlag.com.
Freie Werkausgaben gibt es auf steiner.wiki, bdn-steiner.ru, archive.org und im Rudolf Steiner Online Archiv. Eine textkritische Ausgabe grundlegender Schriften Rudolf Steiners bietet die Kritische Ausgabe (SKA) (Hrsg. Christian Clement): steinerkritischeausgabe.com Die Rudolf Steiner Ausgaben basieren auf Klartextnachschriften, die dem gesprochenen Wort Rudolf Steiners so nah wie möglich kommen. Hilfreiche Werkzeuge zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk sind Christian Karls kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners und Urs Schwendeners Nachschlagewerk Anthroposophie unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners. |